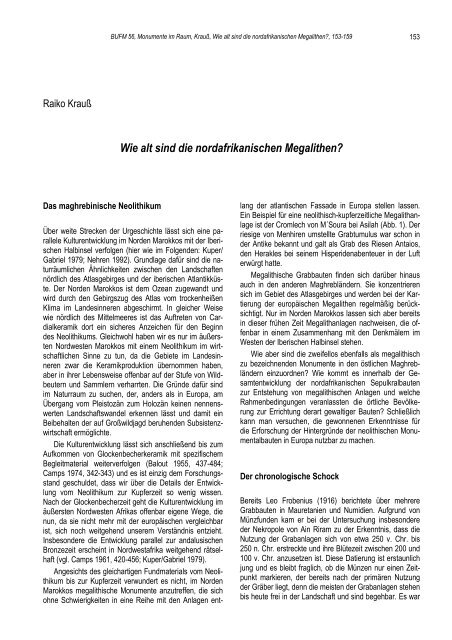Wie alt sind die nordafrikanischen Megalithen? - Universität Tübingen
Wie alt sind die nordafrikanischen Megalithen? - Universität Tübingen
Wie alt sind die nordafrikanischen Megalithen? - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 153<br />
Raiko Krauß<br />
<strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?<br />
Das maghrebinische Neolithikum<br />
Über weite Strecken der Urgeschichte lässt sich eine parallele<br />
Kulturentwicklung im Norden Marokkos mit der Iberischen<br />
Halbinsel verfolgen (hier wie im Folgenden: Kuper/<br />
Gabriel 1979; Nehren 1992). Grundlage dafür <strong>sind</strong> <strong>die</strong> naturräumlichen<br />
Ähnlichkeiten zwischen den Landschaften<br />
nördlich des Atlasgebirges und der iberischen Atlantikküste.<br />
Der Norden Marokkos ist dem Ozean zugewandt und<br />
wird durch den Gebirgszug des Atlas vom trockenheißen<br />
Klima im Landesinneren abgeschirmt. In gleicher Weise<br />
wie nördlich des Mittelmeeres ist das Auftreten von Cardialkeramik<br />
dort ein sicheres Anzeichen für den Beginn<br />
des Neolithikums. Gleichwohl haben wir es nur im äußersten<br />
Nordwesten Marokkos mit einem Neolithikum im wirtschaftlichen<br />
Sinne zu tun, da <strong>die</strong> Gebiete im Landesinneren<br />
zwar <strong>die</strong> Keramikproduktion übernommen haben,<br />
aber in ihrer Lebensweise offenbar auf der Stufe von Wildbeutern<br />
und Sammlern verharrten. Die Gründe dafür <strong>sind</strong><br />
im Naturraum zu suchen, der, anders als in Europa, am<br />
Übergang vom Pleistozän zum Holozän keinen nennenswerten<br />
Landschaftswandel erkennen lässt und damit ein<br />
Beibeh<strong>alt</strong>en der auf Großwildjagd beruhenden Subsistenzwirtschaft<br />
ermöglichte.<br />
Die Kulturentwicklung lässt sich anschließend bis zum<br />
Aufkommen von Glockenbecherkeramik mit spezifischem<br />
Begleitmaterial weiterverfolgen (Balout 1955, 437-484;<br />
Camps 1974, 342-343) und es ist einzig dem Forschungsstand<br />
geschuldet, dass wir über <strong>die</strong> Details der Entwicklung<br />
vom Neolithikum zur Kupferzeit so wenig wissen.<br />
Nach der Glockenbecherzeit geht <strong>die</strong> Kulturentwicklung im<br />
äußersten Nordwesten Afrikas offenbar eigene Wege, <strong>die</strong><br />
nun, da sie nicht mehr mit der europäischen vergleichbar<br />
ist, sich noch weitgehend unserem Verständnis entzieht.<br />
Insbesondere <strong>die</strong> Entwicklung parallel zur andalusischen<br />
Bronzezeit erscheint in Nordwestafrika weitgehend rätselhaft<br />
(vgl. Camps 1961, 420-456; Kuper/Gabriel 1979).<br />
Angesichts des gleichartigen Fundmaterials vom Neolithikum<br />
bis zur Kupferzeit verwundert es nicht, im Norden<br />
Marokkos megalithische Monumente anzutreffen, <strong>die</strong> sich<br />
ohne Schwierigkeiten in eine Reihe mit den Anlagen entlang<br />
der atlantischen Fassade in Europa stellen lassen.<br />
Ein Beispiel für eine neolithisch-kupferzeitliche Megalithanlage<br />
ist der Cromlech von M´Soura bei Asilah (Abb. 1). Der<br />
riesige von Menhiren umstellte Grabtumulus war schon in<br />
der Antike bekannt und g<strong>alt</strong> als Grab des Riesen Antaios,<br />
den Herakles bei seinem Hisperidenabenteuer in der Luft<br />
erwürgt hatte.<br />
Megalithische Grabbauten finden sich darüber hinaus<br />
auch in den anderen Maghrebländern. Sie konzentrieren<br />
sich im Gebiet des Atlasgebirges und werden bei der Kartierung<br />
der europäischen <strong>Megalithen</strong> regelmäßig berücksichtigt.<br />
Nur im Norden Marokkos lassen sich aber bereits<br />
in <strong>die</strong>ser frühen Zeit Megalithanlagen nachweisen, <strong>die</strong> offenbar<br />
in einem Zusammenhang mit den Denkmälern im<br />
Westen der Iberischen Halbinsel stehen.<br />
<strong>Wie</strong> aber <strong>sind</strong> <strong>die</strong> zweifellos ebenfalls als megalithisch<br />
zu bezeichnenden Monumente in den östlichen Maghrebländern<br />
einzuordnen? <strong>Wie</strong> kommt es innerhalb der Gesamtentwicklung<br />
der <strong>nordafrikanischen</strong> Sepulkralbauten<br />
zur Entstehung von megalithischen Anlagen und welche<br />
Rahmenbedingungen veranlassten <strong>die</strong> örtliche Bevölkerung<br />
zur Errichtung derart gew<strong>alt</strong>iger Bauten? Schließlich<br />
kann man versuchen, <strong>die</strong> gewonnenen Erkenntnisse für<br />
<strong>die</strong> Erforschung der Hintergründe der neolithischen Monumentalbauten<br />
in Europa nutzbar zu machen.<br />
Der chronologische Schock<br />
Bereits Leo Frobenius (1916) berichtete über mehrere<br />
Grabbauten in Mauretanien und Numi<strong>die</strong>n. Aufgrund von<br />
Münzfunden kam er bei der Untersuchung insbesondere<br />
der Nekropole von Ain Riram zu der Erkenntnis, dass <strong>die</strong><br />
Nutzung der Grabanlagen sich von etwa 250 v. Chr. bis<br />
250 n. Chr. erstreckte und ihre Blütezeit zwischen 200 und<br />
100 v. Chr. anzusetzen ist. Diese Datierung ist erstaunlich<br />
jung und es bleibt fraglich, ob <strong>die</strong> Münzen nur einen Zeitpunkt<br />
markieren, der bereits nach der primären Nutzung<br />
der Gräber liegt, denn <strong>die</strong> meisten der Grabanlagen stehen<br />
bis heute frei in der Landschaft und <strong>sind</strong> begehbar. Es war
154<br />
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159<br />
Abb. 1: Der Cromlech von M´Soura bei Asilah (Marokko). Luftbildaufnahme von M. Tarradell aus: Camps 1961, Pl. I.2.<br />
dann erst wieder Gabriel Camps, der 1961 mit seinem<br />
Buch über <strong>die</strong> frühgeschichtlichen Grabmonumente der<br />
Berber den Blick auf <strong>die</strong>se faszinierende Denkmälergattung<br />
richtete. Ihm verdanken wir eine großflächige Kartierung<br />
der Monumente (Abb. 2). Seine Klassifikation konnte<br />
vor allem Unterschiede zu den europäischen <strong>Megalithen</strong><br />
aufzeigen. Die Gräber zeigen eine deutliche Konzentration<br />
im Gebiet des östlichen Sahara-Atlas, beiderseits der<br />
Grenze zwischen Algerien und Tunesien. Schon geografisch<br />
bilden <strong>die</strong>se Anlagen eine eigene Gruppe, <strong>die</strong> sich<br />
nicht ohne weiteres mit den neolithischen Anlagen im<br />
Nordwesten Marokkos und in Europa verbinden lassen.<br />
Zur Datierung der Monumente bemerkte Camps „Les<br />
dolmens nord-africains sont postnéolithiques et antépuniques“<br />
(Camps 1961, 146), wobei er <strong>die</strong> gesamte Entwicklung<br />
der monumentalen Grabarchitektur Nordafrikas<br />
von einfachen Grabtumuli bis zu den Megalithgräbern in<br />
den Blick nahm. Üblicherweise werden <strong>die</strong>se Grabbauten<br />
mit den Numidern verbunden, <strong>die</strong> von den antiken Autoren<br />
als autochthone Bevölkerung Nordafrikas angesehen wurden<br />
und als Vorfahren der heutigen Berber gelten (Camps<br />
1980, 53-89.).<br />
Ellès und Makthar<br />
Etwa im Zentrum Nordtunesiens befindet sich am südlichen<br />
Rand der weiten Plain du Sers, bei der Ortschaft<br />
Ellès (Dep. El Kef), eine ausgedehnte Nekropole mit etwa<br />
100 sehr großen Grabbauten. Die Größe der monolithischen<br />
Felsplatten, aus denen <strong>die</strong> Anlagen errichtet worden<br />
<strong>sind</strong>, ist ohne weiteres mit den europäischen <strong>Megalithen</strong><br />
vergleichbar. Betrachtet man ihre Konstruktion jedoch genauer,<br />
offenbart sich eine Komplexität, wie sie bei den<br />
Megalithgräbern der europäischen Urgeschichte nur selten<br />
anzutreffen ist (Abb. 3). Das Grundelement aller Bauten ist<br />
der Dolmen. Diese Konstruktion eines Raumes aus drei<br />
Elementen ist geradezu ein universelles Charakteristikum<br />
der Megalithik. Ausgehend von <strong>die</strong>ser Grundform lassen<br />
sich durch einfache Aneinanderreihung komplexere Räume<br />
erzeugen, <strong>die</strong> immer wieder dem Konzept des Dolmens<br />
folgen. In Ellès <strong>sind</strong> in <strong>die</strong>ser Art regelrechte Totenhäuser<br />
mit einzelnen Grabkammern errichtet worden, <strong>die</strong><br />
durch einen lang gezogenen Korridor erschlossen werden<br />
(Abb. 4). Der Eingang zum Grab liegt jeweils seitlich, an<br />
einer der Schmalseiten. Die Zurichtung der Platten erfolgte<br />
sehr sorgfältig und alle Bauteile <strong>sind</strong> passgenau zugearbeitet<br />
worden. In der Regel <strong>sind</strong> <strong>die</strong> Anlagen an den Hang<br />
gebaut, sodass der rückwärtige Teil ganz im Erdboden<br />
verschwindet. Gegliedert <strong>sind</strong> <strong>die</strong> Fassaden durch vorgeblendete,<br />
vertikale Pfeilerplatten, welche <strong>die</strong> überragenden<br />
Deckplatten der Gräber abstützen. Dadurch ist <strong>die</strong> Front<br />
der Bauten von der eigentlichen Grabkammer abgerückt.<br />
Die durch <strong>die</strong> Pfeilergliederung in der Fassade gebildeten<br />
Joche haben allerdings keine praktische Funktion, da sich<br />
hinter ihnen nur <strong>die</strong> Wand, aber kein Eingang befindet. Es<br />
handelt sich demnach lediglich um Scheinzugänge. Wenn<br />
<strong>die</strong>se aufwändige Gest<strong>alt</strong>ung der Fassade nicht religiös<br />
motiviert ist, wie man <strong>die</strong>s etwa aus der <strong>alt</strong>ägyptischen
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 155<br />
Abb. 2: Verbreitung der Megalithanlagen im östlichen Atlas nach: Camps 1961, 123, Fig. 2.<br />
Abb. 3: Grab 23 der Megalithnekropole von Ellès, Dep. El Kef (Tunesien). Foto R. Krauß 2004.
156<br />
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159<br />
Architektur kennt, könnte es sich auch um ein Relikt handeln,<br />
das auf einen vormals tatsächlich vorhandenen, direkten<br />
Zugang von der Fassade her anspielt. Diese Deutung<br />
drängt sich umso mehr auf, wenn man zwei ebenfalls<br />
megalithische Grabanlagen im ca. 15 km südwestlich von<br />
Ellès gelegenen Makthar (Dep. Siliana), dem römischen<br />
Mactaris, betrachtet, <strong>die</strong> rein äußerlich den Anlagen von<br />
Ellès sehr ähnlich sehen (Abb. 5). Auch <strong>die</strong>se Gräber bestehen<br />
aus aneinander gereihten Grabkammern, allerdings<br />
erfolgt ihre Erschließung ausschließlich über <strong>die</strong> Fassadenseite,<br />
sodass <strong>die</strong> gesamte Raumorganisation in Makthar<br />
eine andere ist als in Ellès. Blickt man frontal auf <strong>die</strong><br />
Grabfassaden von Makthar, gewinnt man zunächst ebenfalls<br />
den Eindruck von Scheinzugängen, aber vier der<br />
sechs Nischen haben tatsächlich unmittelbar vor der rückwärtigen<br />
Wand am Boden eine Öffnung (Abb. 6). Der Zugang<br />
ist hier möglich, weil das gesamte Grab leicht in den<br />
Boden eingetieft ist. Die Idee der Scheintür ist auch in<br />
Makthar insofern gewahrt, als der Blick auf <strong>die</strong> Fassade<br />
den eigentlichen Zugang zum Grab nicht erkennen lässt.<br />
Von der Front gesehen gewinnt man den Eindruck von<br />
sechs Grabkammern. Erst im Grundriss offenbart sich <strong>die</strong><br />
tatsächliche Anzahl von nur vier Kammern, <strong>die</strong> über <strong>die</strong><br />
Eingänge an der Frontseite zu erreichen <strong>sind</strong>. Zwei der Nischen<br />
<strong>sind</strong> leer und bilden somit wieder Scheintüren. Auch<br />
markieren <strong>die</strong>se Nischen keine dahinter liegende Kammer,<br />
wie in Ellès, denn hinter ihnen befindet sich lediglich <strong>die</strong><br />
Trennwand zwischen zwei Kammern.<br />
In Makthar wie in Ellès haben wir damit Fassaden vorliegen,<br />
<strong>die</strong> zwar in irgendeiner Weise auf <strong>die</strong> dahinter liegenden<br />
Kammern Bezug nehmen, aber gleichzeitig <strong>die</strong> tatsächliche<br />
Eingangssituation kaschieren. Während in Makthar<br />
der Zugang zwar über <strong>die</strong> Frontseite erfolgt, indem<br />
man in <strong>die</strong> Fassade hinein tritt und vor der Wand der Grabkammer<br />
in ein Loch hinabsteigen muss, handelt es sich in<br />
Ellès um wirkliche Scheintüren – <strong>die</strong> dahinter liegenden<br />
Kammern <strong>sind</strong> über seitliche Zugänge erreichbar.<br />
Die zeitliche Stellung beider Nekropolen zueinander ist<br />
noch weitgehend unklar (vgl. Pauphilet 1953; Camps 1961,<br />
193-194). Wollte man angesichts der beschriebenen Konstruktionsprinzipien<br />
eine Abhängigkeit voneinander erkennen,<br />
so scheint in Makthar ein früherer Typus vorzuliegen.<br />
Ein Argument dafür wäre der tatsächlich noch über <strong>die</strong><br />
Frontseite gegebene Zugang, der in Ellès auf ein Rudiment<br />
reduziert ist.<br />
Abb. 4: Grundriß und Frontalansicht von Grab 29 der Nekropole<br />
von Ellès. Zeichnung J. Haberkorn 2004.<br />
Abb. 5: Megalithgrab in Makthar, Dep. Siliana (Tunesien).<br />
Foto R. Krauß 2004.<br />
Abb. 6: Grundriß und Querschnitt durch das Megalithgrab<br />
von Makthar aus Camps 1961, 192, Fig. 78.
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 157<br />
Die Bazinas<br />
Das ausgefeilte Konstruktionsprinzip, wie es an Gräbern<br />
beider Nekropolen zu beobachten ist, setzt eine längere<br />
Entwicklungsphase voraus, wenn nicht <strong>die</strong> gesamte Konstruktion<br />
von Gebieten außerhalb Numi<strong>die</strong>ns übernommen<br />
worden ist. Auf der Suche nach Vorläufern der Megalithanlagen<br />
verwies bereits Camps (1961, 158-170.) auf einen<br />
Grabtypus, der im gesamten Maghreb, nördlich des Atlasgebirges<br />
verbreitet ist. Es handelt sich um <strong>die</strong> so genannten<br />
Bazinas, einfache Steinkreise oder von Steinkreisen<br />
umkränzte Grabhügel, <strong>die</strong> im Zentrum eine Grabkonstruktion<br />
aufweisen, <strong>die</strong> als Dolmen ausgeführt sein kann. Mitunter<br />
nehmen <strong>die</strong>se Anlagen megalithische Ausmaße an,<br />
wie etwa in der Nekropole beim Djebel Mazela in Nordostalgerien<br />
(Camps/Camps 1963). Es wurde vermutet,<br />
dass <strong>die</strong> Bazinas in einer Tradition mit den neolithischen<br />
Steinkreisen, wie etwa dem Cromlech de M´Soura stehen<br />
(Camps 1974, 345-346). Eine Fortschreibung der <strong>nordafrikanischen</strong><br />
Megalithtradition vom Neolithikum bis zu den<br />
Bazinas bleibt allerdings problematisch. Es erscheint m. E.<br />
sicher, dass in nachneolithischer Zeit <strong>die</strong> Tradition des<br />
Bauens mit monolithischen Blöcken für längere Zeit zum<br />
Erliegen kam und <strong>die</strong> Bazinas eine eigenständige Entwicklung<br />
der nachneolithischen Zeit darstellen.<br />
Punische Felskammergräber<br />
Auf der Suche nach äußeren Impulsen für <strong>die</strong> Entwicklung<br />
der <strong>Megalithen</strong> lohnt es sich einen weiteren Grabtypus in<br />
den Blick zu nehmen, der außerhalb Afrikas entwickelt<br />
worden ist. Es <strong>sind</strong> <strong>die</strong>s <strong>die</strong> Felskammergräber, deren Verbreitung<br />
sich auf das nördliche Tunesien und den äußersten<br />
Nordosten Algeriens, also <strong>die</strong> unmittelbare Küstenzone<br />
des Sahara-Atlas beschränkt (Parrot u. a. 1977, 276). Verbunden<br />
werden <strong>die</strong> Felskammergräber mit den Puniern,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong>se Bauform aus ihrer phönizischen Heimatregion in<br />
der Levante mitgebracht haben sollen. Der ursprüngliche<br />
Typus des punischen Felskammergrabes tritt vor allem<br />
zwischen dem Cap Blanc und der Cap Bon-Halbinsel auf,<br />
also dem Kernland der punischen Herrschaft. Es handelt<br />
sich um vollständig unterirdisch angelegte Felskammergräber<br />
mit rechteckigen Kammern, <strong>die</strong> über aus dem Fels geschlagene<br />
Treppen zu erreichen <strong>sind</strong>. Einfachere Gräber<br />
verfügen über keinen solchen Zugang, sondern bestehen<br />
lediglich aus einem längsrechteckigen Schacht, der senkrecht<br />
in den Fels abgetieft worden ist. In <strong>die</strong>sen Gräbern<br />
wurden <strong>die</strong> Verstorbenen in Sarkophagen beigesetzt, ein<br />
weiteres phönizisch/punisches Charakteristikum.<br />
Die Haouanet<br />
Im Grenzbereich des punischen Kernlandes konnte<br />
sich ein anderer Typ des Felskammergrabes entwickeln,<br />
der offenbar eine Weiterentwicklung des punischen Typus<br />
darstellt (Abb. 7). Die Datierung <strong>die</strong>ser Anlagen ist allerdings<br />
noch völlig offen. Auch <strong>die</strong>se Gräber <strong>sind</strong> vollständig<br />
aus dem Fels herausgearbeitet, wobei aus dem Gelände<br />
ragende Felsnasen und Vorsprünge derart ausgenutzt<br />
wurden, dass ein horizontaler Zugang zur Grabkammer<br />
möglich war. Dieser eigenständige Typus des Felskammergrabes<br />
wird mit dem arabischen Wort für einen Laden<br />
als Hanout (Plural Haouanet) bezeichnet, und in der Tat<br />
erinnert <strong>die</strong> Form an einen kleinen Kiosk, der aus dem Fels<br />
geschlagen wurde (Camps 1961, 91-110.).<br />
Der numidische Grabbau zwischen Tradition und<br />
punischem Einfluss<br />
Es ist nun gut vorstellbar, dass sich auch <strong>die</strong> traditionellen<br />
Grabbauten unter dem Einfluss der punischen Kammergräber<br />
veränderten. Für <strong>die</strong>se Annahme spricht <strong>die</strong> Verbreitung<br />
der Megalithanlagen in Nachbarschaft des punischen<br />
Herrschaftsgebietes. Ihre Konzentration lässt mit<br />
zunehmender Entfernung vom punischen Kernland nach.<br />
Sie rahmen regelrecht das punische Herrschaftsgebiet ein<br />
(vgl. Camps 1961, Fig. 14). Eine Beeinflussung durch <strong>die</strong><br />
punischen Felskammergräber scheint mir zumindest bei<br />
den <strong>Megalithen</strong> von Makthar klar gegeben, da dort hinter<br />
dem baulich gest<strong>alt</strong>eten Zugang ganz offensichtlich <strong>die</strong><br />
Idee des Felskammergrabes steht, in das man hinabsteigt.<br />
Auch bei den Haouanet findet sich in einigen Fällen ein der<br />
Kammer vorgelagerter Bereich, dem möglicherweise eine<br />
ähnliche Funktion zukam. An den maghrebinischen Megalithanlagen<br />
ist also ein Eklektizismus zu beobachten, der<br />
<strong>die</strong> traditionelle Bauart der Bazina mit dem punischen<br />
Felskammergrab verbindet. Es <strong>sind</strong> gleichsam an <strong>die</strong><br />
Oberfläche verlegte, monumentalisierte Felskammergräber.<br />
Wir erfassen damit ein kulturhistorisches Phänomen,<br />
das in gewisser Weise auch bei der Herausbildung der<br />
europäischen Megalithik zu beobachten ist. Es ist <strong>die</strong> Verbindung<br />
der gegensätzlichen Elemente des „Chthonischen“<br />
und des „Sphärischen“ in der neolithischen Architektur,<br />
<strong>die</strong> der Architekturhistoriker Spiro Kostof als<br />
einander ergänzende Impulse formulierte: „Ehrfurcht vor<br />
der Höhle mit ihren Erinnerungen an <strong>die</strong> Vorfahren einerseits<br />
und <strong>die</strong> neugefundene Ordnung des Himmels andererseits“<br />
(Kostof 1993, 36). Jenseits einer theologischen<br />
Erklärung, <strong>die</strong> sich uns ohnehin aufgrund fehlender Quellen<br />
entzieht, können wir <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong><br />
als pragmatische Versuche begreifen, zwei von unterschiedlichen<br />
Traditionen vorgegebene Maßgaben zu erfüllen:<br />
Die Bestattung der Verstorbenen in einer unterirdischen<br />
Felskammer bei gleichzeitiger Sichtbarkeit der<br />
Grabstätte in der Landschaft. Das Ergebnis führt beinahe<br />
zwangsläufig zur Monumentalität. Es ist <strong>die</strong>se spezifische
158<br />
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159<br />
Abb. 7: Haouanet von Séjenane, Dep. Bizerte (Tunesien). Foto: D. Gobert aus Camps 1961, Pl. III.<br />
Konstellation, <strong>die</strong> auch begründet, warum <strong>die</strong> nordafrikanische<br />
Grabarchitektur nur für einen beschränkten<br />
Zeitraum „megalithisch“ wird. Die Übernahme bestimmter<br />
punischer Bestattungspraktiken durch <strong>die</strong> einheimische<br />
Bevölkerung und der Versuch, ihre indigene Bautradition<br />
zu wahren, konnte sich nur in dem Zeitraum der direkten<br />
Auseinandersetzung beider Volksgruppen miteinander vollziehen,<br />
wo das einheimische Element immerhin noch stark<br />
genug war, sich gegen <strong>die</strong> vollständige Übernahme einer<br />
fremden Kultur zu behaupten. Im Moment der totalen Anpassung<br />
oder im Extremfall der Unterwerfung der Gebiete<br />
durch Karthago wäre <strong>die</strong> Weiterentwicklung der Megalithanlagen<br />
wohl beendet gewesen.<br />
Zu einem grundlegenden Wandel im Grabbau kam es<br />
erst etwas später, als wir auch aus den Schriftquellen<br />
erstmalig von einheimischen Herrschern im Hinterland Karthagos<br />
erfahren. Den Numidern kam im Verlauf der Punischen<br />
Kriege um <strong>die</strong> Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer<br />
große Bedeutung als Verbündete Roms zu (Alföldi<br />
1979). Und so verwundert es nicht, dass spätestens mit<br />
dem berühmtesten numidischen Herrscher, Masinissa,<br />
auch in Nordafrika eine hellenistisch inspirierte Architektur<br />
auftaucht, <strong>die</strong> <strong>die</strong> megalithische Tradition besiegelt (Rakob<br />
1979). Eines der ältesten Beispiele für einen hellenistischen<br />
Grabbau ist der Madracen, am Nordrand des Aurès-Gebirges<br />
im Osten Algeriens, der von Rakob (1979,<br />
132) in das 2. Jahrhundert v. Chr. datiert wird.<br />
Fazit<br />
Ausgehend von den historischen Eckdaten wird sich <strong>die</strong><br />
Entwicklung der monumentalen Megalithgräber etwa zwischen<br />
der Etablierung der punischen Herrschaft im 8. Jh.<br />
v. Chr. bis zur historischen Überlieferung der ersten numidischen<br />
Könige am Ende des 3. Jh.s v. Chr. vollzogen haben.<br />
Umreißen lässt sich zusammenfassend eine dreiphasige<br />
Entwicklung der numidischen Grabbauten:<br />
1. Eine weit in der Urgeschichte verwurzelte Tradition im<br />
Errichten von Grabbauten, <strong>die</strong> meist in Form von künstlichen<br />
Erdhügeln oder Steinkreisen mit kleineren Dolmen<br />
als so genannte Bazinas <strong>die</strong> Landschaft markieren.<br />
2. Die Phase der punischen Präsenz in Nordafrika, <strong>die</strong> mit<br />
dem Aufkommen von Felskammergräbern verbunden<br />
ist. Möglicherweise beeinflusst <strong>die</strong>ser punische Grabtypus<br />
<strong>die</strong> Herausbildung eines eigenständigen, <strong>nordafrikanischen</strong><br />
Typus von Felskammergräbern, den<br />
Haouanet. Im Hinterland der punischen Einfluss-<br />
Sphäre kommt es zu einer Monumentalisierung der
BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 159<br />
Grabanlagen. Für eine beschränkte Zeit entsteht eine<br />
megalithische Architektur im östlichen Atlasgebiet. Mit<br />
einer Nutzung der Anlagen ist allerdings noch lange<br />
nach ihrer Errichtungszeit zu rechnen.<br />
3. Eine Phase des wieder Aufgreifens der traditionellen<br />
Grabarchitektur und deren Anpassung an den hellenistischen<br />
Zeitgeist. Dieses erstmalige Aufscheinen einer<br />
„internationalen“ Formensprache ist Ausdruck eines<br />
neuen numidischen Selbstbewusstseins im Ergebnis<br />
der neuen Machtverhältnisse in Nordafrika. Der punisch-römische<br />
Konflikt erhebt Numi<strong>die</strong>n zum Partner<br />
der römischen Weltmacht. Nach der endgültigen Vernichtung<br />
Karthagos verbleibt Numi<strong>die</strong>n sogar <strong>die</strong> einzige<br />
stabile Herrschaft in der Region. Diese neu errungene<br />
Stellung innerhalb des antiken Machtgefüges<br />
bringt einen großen Bedarf an genealogischer Legitimation<br />
mit sich, in dessen Folge eine numidisch-hellenistische<br />
Architektursprache entwickelt wird.<br />
Die Herausbildung einer megalithischen Architektur ist innerhalb<br />
<strong>die</strong>ser Entwicklung eine Sackgasse, da <strong>die</strong> politischen<br />
Rahmenbedingungen, <strong>die</strong> den Antrieb zu ihrer Errichtung<br />
gaben, nur für kurze Zeit Bestand hatten.<br />
Literatur<br />
Alföldi 1979: M. Alföldi, Die Geschichte des numidischen<br />
Königreiches und seiner Nachfolger. In: H. G. Horn,<br />
Chr. B. Rüger (Hrsg.), Die Numider. Reiter und Könige<br />
nördlich der Sahara (Bonn 1979) 43-74.<br />
Balout 1955 : L. Balout, Préhistoire de l´Afrique du Nord<br />
(Paris 1955).<br />
Camps 1961 : G. Camps, Aux origines de la Berbérie. Monuments<br />
et rites funéraires protohistoriques (Paris<br />
1961).<br />
Camps 1974 : G. Camps, Les civilisations préhistoriques<br />
de l´Afrique du Nord et du Sahara (Paris 1974).<br />
Camps 1980 : G. Camps, Les Berbères. Mémoire et identité<br />
(Paris 1980).<br />
Camps/Camps 1963: G. Camps, H. Camps, La nécropole<br />
mégalithique du Djebel Mazela a Bou Nouara (Paris<br />
1963).<br />
Frobenius 1916: L. Frobenius, Der kleinafrikanische Grabbau.<br />
Einzelbericht aus dem Arbeitskreis der IV. Reiseperiode<br />
der Deutschen Inner-Afrikanischen Forschungs-Expedition.<br />
Prähist. Zeitschr. 8, 1916, 1-84.<br />
Kostof 1993: S. Kostof, Geschichte der Architektur. Bd. 1.<br />
Von den Anfängen bis zum Römischen Reich (Stuttgart<br />
1993).<br />
Kuper/Gabriel 1979: R. Kuper, B. Gabriel, Zur Urgeschichte<br />
des Maghreb. In: H. G. Horn, Chr. B. Rüger (Hrsg.),<br />
Die Numider. Reiter und Könige nördlich der Sahara<br />
(Bonn 1979) 23-42.<br />
Nehren 1992: R. Nehren, Zur Prähistorie der Maghrebländer<br />
(Marokko – Algerien – Tunesien). AVA-Materialien<br />
49 (Mainz 1992).<br />
Parrot u. a. 1977: A. Parrot, M.H. Chéhab, S. Moscati, Die<br />
Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von<br />
den Anfängen bis zum Ende des Dritten Punischen<br />
Krieges (München 1977).<br />
Pauphilet 1953: D. Pauphilet, Monument mégalithique à<br />
Maktar. Karthago IV, 1953, 49-83.<br />
Rakob 1979: F. Rakob, Numidische Königsarchitektur in<br />
Nordafrika. In: H. G. Horn, Chr. B. Rüger (Hrsg.), Die<br />
Numider. Reiter und Könige nördlich der Sahara (Bonn<br />
1979) 119-171.<br />
Anschrift:<br />
Dr. Raiko Krauß<br />
Institut für Ur- und Frühgeschichte<br />
und Archäologie des Mittel<strong>alt</strong>ers<br />
der Eberhard Karls Universität<br />
Schloß Hohentübingen<br />
Burgsteige 11<br />
72070 Tübingen<br />
raiko.krauss@uni-tuebingen.de