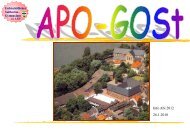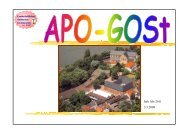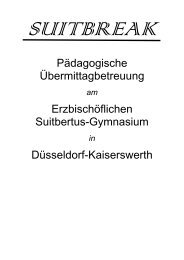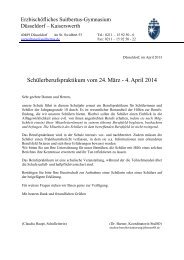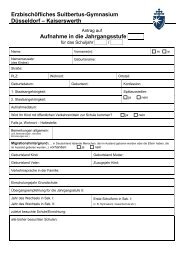Interview mit der Zeitzeugin Ruth Felgentreff - Suitbertus Gymnasium
Interview mit der Zeitzeugin Ruth Felgentreff - Suitbertus Gymnasium
Interview mit der Zeitzeugin Ruth Felgentreff - Suitbertus Gymnasium
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Interview</strong> <strong>mit</strong> <strong>der</strong> <strong>Zeitzeugin</strong> <strong>Ruth</strong><br />
<strong>Felgentreff</strong><br />
Auf <strong>der</strong> Suche nach Informationen über die Geschwister<br />
Aufricht sind wir auf <strong>Ruth</strong> <strong>Felgentreff</strong> gestoßen, die<br />
Schwester und Historikerin in <strong>der</strong> Diakonie Kaiserswerth<br />
ist. Sie hat eine Dokumentation über die Geschwister<br />
geschrieben. Als <strong>Zeitzeugin</strong> <strong>der</strong> NS-Zeit haben wir Frau<br />
<strong>Felgentreff</strong> in unseren Unterricht eingeladen und ein<br />
<strong>Interview</strong> <strong>mit</strong> ihr geführt.<br />
Quelle: eigene Fotos<br />
Die Geschwister Erna und Johanne<br />
Aufricht entstammten einer ungarischjüdischen<br />
Familie und hatten früh ihre<br />
Mutter verloren. Der Vater übertrug<br />
die Erziehungsrechte auf zwei deutsche<br />
evangelische Lehrerinnen, die in<br />
Kaiserswerth lebten.<br />
Johanne Aufricht trat als Schwester in<br />
den Bund <strong>der</strong> Diakonie ein, konnte jedoch<br />
dort aufgrund gesundheitlicher<br />
Probleme nicht lange bleiben. Durch<br />
die Korrespondenz <strong>mit</strong> einem ungarischen<br />
Pfarrer fielen die Geschwister<br />
<strong>der</strong> Gestapo auf, die Auslandskontakte<br />
kontrollierte. Um sie zu<br />
schützen, holte das Mutterhaus sie zurück nach Kaiserswerth.<br />
Erna und Johanne mussten einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie angaben, dass sie jüdischer<br />
Herkunft waren. Daraufhin wurde <strong>der</strong> Vorsteher des Schwesternhauses gezwungen, die<br />
Diakonieschwestern in einer Versammlung zu fragen, ob sie da<strong>mit</strong> einverstanden seien, <strong>mit</strong><br />
jüdischen Schwestern zusammen zu leben, weil es arischen Menschen nicht zumutbar sei, <strong>mit</strong><br />
Juden unter einem Dach zu leben. Für die Diakonieschwestern war es jedoch selbstverständlich, zu<br />
ihren jüdischen Mitschwestern zu halten. Mit <strong>der</strong> Verkündung <strong>der</strong> Nürnberger Rassengesetze 1935<br />
wurde die rassistisch orientierte, nationalsozialistische Gesellschaftsordnung festgeschrieben und<br />
Juden konnten systematisch verfolgt werden. Seit 1941 waren die Geschwister Aufricht wie alle<br />
Juden verpflichtet, den Judenstern zu tragen.<br />
Am 20. Juli 1942 wurden sie deportiert. Trotz des eigenen Elends versuchten die Geschwister,<br />
an<strong>der</strong>en Menschen zu helfen. Erna, die jüngere von beiden, wurde von Theresienstadt nach<br />
Auschwitz deportiert. Man vermutet, dass sie dort ums Leben gekommen ist. Johanne hingegen<br />
kehrte nach Kriegsende nach Kaiserswerth zurück, wo sie die restlichen 18 Jahre ihres Lebens<br />
verbrachte.<br />
<strong>Ruth</strong> <strong>Felgentreff</strong> lernte Johanne persönlich kennen. Da sie durch ihre Erlebnisse eine sehr<br />
introvertierte Frau geworden war, riet man ihr, zur Vergangenheitsbewältigung ihre Gedanken zu<br />
Papier zu bringen. <strong>Ruth</strong> <strong>Felgentreff</strong>s Dokumentation basiert auf dem nachträglich von Johanne<br />
geschriebenen Tagebuch.<br />
Außerdem berichtete <strong>Ruth</strong> <strong>Felgentreff</strong> über die damalige Situation in Kaiserswerth. Man versuchte,<br />
auf dem Theodor-Fliedner <strong>Gymnasium</strong>, auf unserer Schule und in Kin<strong>der</strong>gärten nationalsozialistisch<br />
denkende Frauen, so genannte „braune Schwestern“, einzusetzen, die die Kin<strong>der</strong> in Hitlers Sinne<br />
erziehen sollten. Jedoch gelang dies nur in Kin<strong>der</strong>gärten. Katholische Kin<strong>der</strong> kamen in einen NSV-<br />
Kin<strong>der</strong>garten, einen Kin<strong>der</strong>garten <strong>der</strong> nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Die damalige NSV<br />
hatte die Funktion <strong>der</strong> heutigen Caritas. Bei <strong>der</strong> Recherche für die Dokumentation stieß <strong>Ruth</strong>
<strong>Felgentreff</strong> auf eine Jüdin, Hildegard Müller, die ihr <strong>mit</strong> weiterem Material aus <strong>der</strong> NS-Zeit helfen<br />
konnte.<br />
Durch die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf hat <strong>Ruth</strong> <strong>Felgentreff</strong> noch heute Kontakt zu<br />
Wi<strong>der</strong>standskämpfern und Menschen, die sie in <strong>der</strong> schweren Zeit begleitet haben. Der Grund<br />
dafür, dass sie die Dokumentation erst jetzt verfasst hat, ist, dass sie und die Schwestern, die sie<br />
beim Schreiben unterstützten, erst das Erlebte verarbeiten mussten, was eine lange Zeit in<br />
Anspruch genommen hat. Die Recherche und das Verfassen <strong>der</strong> Dokumentation benötigten<br />
insgesamt 3 Jahre.<br />
Caritas<br />
1897<br />
Quelle: http://www.caritas.de<br />
Am 9. November wird in Köln durch den<br />
Priester Lorenz Werthmann <strong>der</strong> „Caritasverband für das katholische Deutschland" gegründet.<br />
Der Sitz <strong>der</strong> Zentrale ist bis heute in Freiburg.<br />
1916<br />
Die Deutsche Bischofskonferenz erkennt die Caritas als „die legitime Zusammenfassung <strong>der</strong><br />
Diözesanverbände zu einer einheitlichen Organisation" an, <strong>der</strong> „Deutsche Caritasverband“<br />
(DCV), wie er heute genannt wird.<br />
1922<br />
Alle deutschen Diözesen haben einen Diözesan-Caritasverband.<br />
1925<br />
Die katholisch-karitative Fürsorge unterhält in Deutschland bereits 10 000 Einrichtungen<br />
1933 – 1945<br />
Eingeengt, bedroht, unter Opfern auch an Freiheit und Leben von Mitarbeitern, unter Einbußen<br />
an Mitteln und Gebäuden übersteht <strong>der</strong> DCV arbeitsfähig die Jahre <strong>der</strong> nationalsozialistischen<br />
Unrechtsherrschaft.<br />
1945<br />
In jener Notzeit war <strong>der</strong> Caritasverband als einzige überregionale Organisation zur Lin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Not sofort arbeitsfähig und bereit.<br />
Um 1960<br />
Die Caritas leistet erstmals internationale Not- und Katastrophenhilfe.<br />
1990<br />
Mit <strong>der</strong> deutschen Einigung endet auch für die Caritas in Deutschland die über 40 Jahre<br />
andauernde, aufgezwungene Teilung. Die Caritasverbände in <strong>der</strong> damaligen DDR geben<br />
ihre Neu- bzw. Wie<strong>der</strong>gründung als eingetragene Vereine bekannt und bekennen sich in<br />
ihren Satzungen als Teil des Deutschen Caritasverbandes.<br />
1997<br />
Am 9. November begeht <strong>der</strong> DCV in Köln das 100-jährige-Jubiläum seines Bestehens.<br />
2003<br />
Dr. Peter Neher wird neuer Präsident.
Informationen zu Herrn Dr. Ulrich Brzosa (*1962)<br />
Dr. Ulrich Brzosa studierte Theologie und<br />
Geschichte in Bonn und Wien. Er war<br />
schon damals sehr an <strong>der</strong> Geschichte des<br />
3. Reiches interessiert und legte seinen<br />
Studienschwerpunkt auf diesen Bereich.<br />
Seit Studienbeginn beschäftigt sich Herr<br />
Dr. Brzosa beruflich wie auch privat <strong>mit</strong> <strong>der</strong><br />
Rolle <strong>der</strong> katholischen Kirche im<br />
Nationalsozialismus und promovierte auch<br />
in diesem Themenbereich.<br />
Aufgrund des hun<strong>der</strong>tjährigen Bestehens<br />
des Caritas – Verbandes arbeitete er die<br />
Geschichte <strong>der</strong> katholischen Kirche in<br />
Düsseldorf während des NS – Regimes<br />
auf. Bei <strong>der</strong> da<strong>mit</strong> verbundenen<br />
Archivarbeit stieß er auf Elisabeth<br />
Heidkamp.<br />
Durch Herrn Michael Hänsch, den Geschäftsführer des Pfarrverbandes <strong>der</strong> katholischen<br />
Kirche Flingern/ Düsseltal, erhielten wir die Adresse von Herrn Dr. Brzosa.