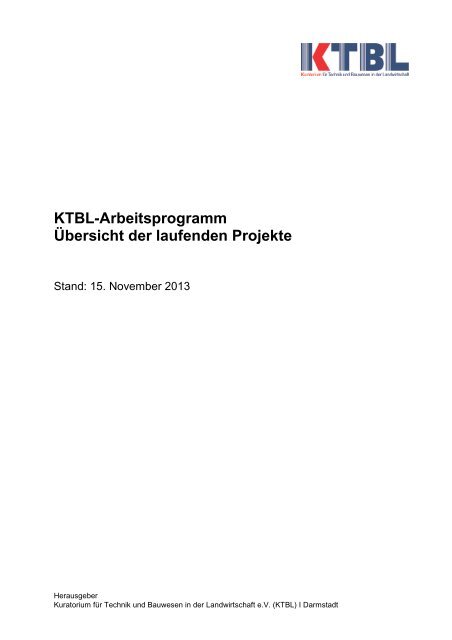KTBL-Arbeitsprogramm Übersicht der laufenden Projekte - ktbl.de
KTBL-Arbeitsprogramm Übersicht der laufenden Projekte - ktbl.de
KTBL-Arbeitsprogramm Übersicht der laufenden Projekte - ktbl.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong><br />
<strong>Übersicht</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>laufen<strong>de</strong>n</strong> <strong>Projekte</strong><br />
Stand: 15. November 2013<br />
Herausgeber<br />
Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft e.V. (<strong>KTBL</strong>) I Darmstadt
© 2013<br />
Herausgeber und Vertrieb<br />
Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft e.V. (<strong>KTBL</strong>)<br />
Bartningstraße 49 | 64289 Darmstadt<br />
Telefon +49 6151 7001-0 | Fax +49 6151 7001-123 | E-Mail: <strong>ktbl</strong>@<strong>ktbl</strong>.<strong>de</strong><br />
vertrieb@<strong>ktbl</strong>.<strong>de</strong> | Telefon Vertrieb +49 6151 7001-189<br />
www.<strong>ktbl</strong>.<strong>de</strong>
Einführung<br />
Einführung<br />
Das <strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> mit Stand 15. November 2013 enthält die zu diesem Zeitpunkt im<br />
<strong>KTBL</strong> <strong>laufen<strong>de</strong>n</strong> und vom Hauptausschuss genehmigten <strong>Projekte</strong>. Es dient <strong>de</strong>m Hauptausschuss<br />
als Informationsquelle. Darüber hinaus bietet es <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektleitung, <strong>de</strong>n Projektpartnern<br />
und <strong>de</strong>n Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgremien einen Überblick über die Arbeitsplanung und die Projektdurchführung.<br />
Das <strong>Arbeitsprogramm</strong> ist nach Arbeitsschwerpunkten geglie<strong><strong>de</strong>r</strong>t. Innerhalb <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsschwerpunkte<br />
sind die jeweilige Arbeitsgemeinschaft, die Arbeitsgruppen und weitere <strong>Projekte</strong> aufgeführt.<br />
Letztere sind häufig Drittmittelprojekte, die in Abstimmung mit <strong>de</strong>n Arbeitsgremien durchgeführt<br />
wer<strong>de</strong>n o<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Vorbereitung <strong><strong>de</strong>r</strong> Gremienarbeit dienen.<br />
Im Sommer letzten Jahres haben die Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgemeinschaft agroXML festgestellt,<br />
dass sie ihre nutzungs- und produktorientierten Aufgaben erfüllt haben. Diesem Standpunkt hat<br />
sich das Präsidium <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong> angeschlossen. Daher wur<strong>de</strong> die Arbeitsgemeinschaft agroXML<br />
Anfang Februar 2013 aufgelöst. Die Gründung einer mehr technologieorientierten und auf EU-<br />
Ebene ausgerichteten Arbeitsgemeinschaft ist geplant. Bis zu <strong><strong>de</strong>r</strong>en Gründung wer<strong>de</strong>n die von<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> alten Arbeitsgemeinschaft betreuten Gruppen weiterhin im <strong>Arbeitsprogramm</strong> geführt.<br />
Die <strong>Projekte</strong> aus <strong>de</strong>m <strong>Arbeitsprogramm</strong> Kalkulationsunterlagen (AP KU) wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Referenten<br />
für Betriebswirtschaft <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s und <strong><strong>de</strong>r</strong> Län<strong><strong>de</strong>r</strong> genehmigt. Sie sind im Arbeitsschwerpunkt<br />
„Arbeits- und Betriebswirtschaft“ zur Kenntnis aufgeführt.<br />
Im Anhang befin<strong>de</strong>n sich nach Arbeitsschwerpunkten geglie<strong><strong>de</strong>r</strong>te Projektübersichten. Die <strong>Übersicht</strong>en<br />
geben einen Überblick über die <strong>Projekte</strong> und Struktur <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsschwerpunkte. Zu je<strong>de</strong>m<br />
Projekt ist die Seite <strong>de</strong>s Proje<strong>ktbl</strong>attes im vorliegen<strong>de</strong>n <strong>Arbeitsprogramm</strong> angegeben. Ansprechpartner<br />
für die <strong>Projekte</strong> sind die unter „Projektbetreuung in <strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle“ genannten<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle.<br />
Die angegebene Projektlaufzeit schließt die Planung mit ein. Sie kann aus diesem Grund von<br />
eigentlichen Projektlaufzeiten abweichen. Dies ist <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-internen Projektverwaltung geschul<strong>de</strong>t.<br />
Bei <strong>de</strong>m im <strong>Arbeitsprogramm</strong> angegebenen Projektbeginn han<strong>de</strong>lt es sich um <strong>de</strong>n<br />
Termin, zu <strong>de</strong>m das Projekt erstmalig in <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektmanagementsoftware erfasst wur<strong>de</strong>.<br />
Das <strong>Arbeitsprogramm</strong> fin<strong>de</strong>n Sie auch als interaktives PDF in <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik „Gremien und <strong>Projekte</strong>“<br />
unter www.<strong>ktbl</strong>.<strong>de</strong>.<br />
3
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Arbeitsgemeinschaft agroXML (agroXML) ................................................................................................. 7<br />
ISOagriNet und agroXML .............................................................................................................................. 8<br />
InfrAgrar - Infrastruktur für betriebs-, betriebszweig-, anwendungs- und standardübergreifen<strong>de</strong><br />
Auswertungen von Daten im Precision Livestock Farming ........................................................................... 9<br />
Pestici<strong>de</strong> Application Manager (PAM) - Entscheidungsunterstützung im Pflanzenschutz auf Basis von<br />
Gelän<strong>de</strong>-, Maschinen-, Hersteller- und Behör<strong>de</strong>ndaten .............................................................................. 10<br />
Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW) ................................................................... 11<br />
Arbeitswirtschaftliche Grundlagen ............................................................................................................... 12<br />
Gesamtbetriebskalkulationen für <strong>KTBL</strong>-Referenzbetriebe .......................................................................... 13<br />
Die Maschinen- und Anlagenkostenkalkulation in <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen Betriebsplanung .................... 15<br />
Standardoutputs (SO) und Standard<strong>de</strong>ckungsbeiträge (SDB) 2012/13 ..................................................... 16<br />
Datensammlung Betriebsplanung Landwirtschaft 2014/15 ......................................................................... 17<br />
Datensammlung „Landschaftspflege mit Schafen“ ...................................................................................... 18<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen“ 2013 .............................................................................. 19<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)........................................................................................................... 29<br />
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) ....................................................................................................... 30<br />
Ringversuch zur Vergleichbarkeit von Biogaserträgen ............................................................................... 31<br />
Vergleichskennzahlen Energieeffizienz ....................................................................................................... 32<br />
Neuauflage <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Publikation „Faustzahlen Biogas“ (3. Ausgabe) ...................................................... 33<br />
<strong>KTBL</strong>/FNR Biogaskongress „Biogas in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft - Stand und Perspektiven“ 2013 .................... 34<br />
MONA – Monitoring <strong>de</strong>s Biomethanprozesses ........................................................................................... 35<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS) .................................................................................................... 36<br />
Emissionsfaktoren Tierhaltung .................................................................................................................... 37<br />
Klimaschutz in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft ............................................................................................................... 38<br />
Erstellung von Emissionsinventaren für Stickstoff und Kohlenstoff aus <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>utschen Landwirtschaft ..... 39<br />
Integrierte Stickstoff-Bilanzierung ................................................................................................................ 40<br />
GÄRWERT – GÄRprodukte ökologisch optimiert und WERTorientiert aufbereiten und vermarkten ......... 41<br />
Aktualisierung <strong>de</strong>s Frameworkco<strong>de</strong>s "Good Agricultural Practice" im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Task Force on Reactive<br />
Nitrogen (TFRN) <strong><strong>de</strong>r</strong> United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ................................... 42<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL) ................................................................................... 43<br />
Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> im ökologischen Landbau zugelassenen Düngemittel ........................................................ 44<br />
Faustzahlen Ökolandbau ............................................................................................................................. 45<br />
Behornte Tiere ............................................................................................................................................. 46<br />
Körnerleguminosen ..................................................................................................................................... 47<br />
Anwendung für mobile Endgeräte zur Stickstoffbilanzierung im Leguminosenanbau ................................ 48<br />
Heubergung ................................................................................................................................................. 49<br />
Investitionsbedarf von Milchviehställen für horntragen<strong>de</strong> Kühe .................................................................. 50<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB) .......................................................................................... 51<br />
Anfallmengen Festmist ................................................................................................................................ 52<br />
Festmistaußenlagerung ............................................................................................................................... 53<br />
Vermeidung von gasförmigen Stickstoffverlusten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Ausbringung von Flüssigmist und Gärresten .... 54<br />
Empfehlungen zur Düngung mit Gärresten ................................................................................................. 55<br />
Indikatoren zur Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Tiergerechtheit in <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen Nutztierhaltung ....................... 56<br />
5
Inhalt<br />
Beste verfügbare Techniken in <strong><strong>de</strong>r</strong> Intensivtierhaltung (BVT) ..................................................................... 57<br />
Faustzahlen Düngemittel ............................................................................................................................. 58<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI) ................................................. 59<br />
Die kommunale Bauleitplanung und ihre Konsequenzen für die landwirtschaftliche Standortentwicklung 60<br />
Ausgleichs-/Kompensationsplanungen im Rahmen landwirtschaftlicher <strong>Projekte</strong> ...................................... 61<br />
Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung 2014 ............................................................. 62<br />
Abluftreinigung für Tierhaltungsanlagen ...................................................................................................... 63<br />
Internet-Abstandsrechner VDI 3894 ............................................................................................................ 64<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN) ............................................ 65<br />
Tagung zu Stand und Perspektiven <strong><strong>de</strong>r</strong> Ebermast ...................................................................................... 66<br />
Online-Anwendung Mastschweine .............................................................................................................. 67<br />
DVG-Tagung "Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung" ................................................................... 69<br />
Flüssigmistlagerung ..................................................................................................................................... 70<br />
Baukost 3.0 - Neuausrichtung <strong><strong>de</strong>r</strong> Baukostenermittlung mit anschließen<strong><strong>de</strong>r</strong> Neuprogrammierung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Online-Anwendung ...................................................................................................................................... 71<br />
Landwirtschaftliche Mehrzweckhallen ......................................................................................................... 72<br />
Bo<strong>de</strong>nhaltung von Legehennen ˗ Maßnahmen zur Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung luftgetragener Belastungen im Stall ......... 73<br />
Bun<strong>de</strong>swettbewerb Landwirtschaftliches Bauen 2013/14 - "Anwendung ganzheitlicher Energiekonzepte in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung" ..................................................................................................................................... 74<br />
Jahrestagung 2013 <strong>de</strong>s „Arbeitskreis Län<strong><strong>de</strong>r</strong> ALB beim <strong>KTBL</strong>" .................................................................. 75<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP) ................................................................. 76<br />
Datensammlung Futterernte und -konservierung ........................................................................................ 77<br />
Precision Farming ........................................................................................................................................ 78<br />
Verfügbare Feldarbeitstage ......................................................................................................................... 79<br />
Praxisreife Verfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Streifenbearbeitung unter mitteleuropäischen Bedingungen ............................. 80<br />
Datensammlung „Freilandbewässerung” .................................................................................................... 81<br />
Referenten „Land- und Energietechnik“ (Ref. LT EN) ................................................................................. 82<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG) ........................................................ 83<br />
Datensammlung Stau<strong>de</strong>n und Topfpflanzen ............................................................................................... 84<br />
Normung von Datenfunk .............................................................................................................................. 85<br />
Metho<strong>de</strong>nentwicklung zur Ermittlung <strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz im Gartenbau................................................... 86<br />
Umweltschonen<strong>de</strong> Bewässerung und Düngung in Gewächshäusern und auf Containerkulturflächen ...... 87<br />
ZINEG - Transfer in die Praxis und Öffentlichkeitsarbeit............................................................................. 88<br />
Berater und Wissenschaftler für Technik und Bauwesen im Gartenbau (AK BWTG) ............................... 90<br />
Arbeitsblätter Gartenbau ............................................................................................................................. 91<br />
BMELV-Innovationspreis Gartenbau ........................................................................................................... 92<br />
Wissenschaftlicher Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses für Technik im Weinbau (TiW/ATW) ................................. 93<br />
Forschungsvorhaben Technik im Weinbau und in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kellerwirtschaft ...................................................... 94<br />
Praxis <strong>de</strong>s ökologischen Weinbaus ............................................................................................................. 96<br />
Datensammlung Weinbau und Kellerwirtschaft ........................................................................................... 97<br />
Arbeitsblätter Weinbau und Kellerwirtschaft ................................................................................................ 98<br />
6
Arbeitsschwerpunkt agroXML<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft agroXML (agroXML)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. agroXML 2.1.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Zur Weiterentwicklung und Etablierung von agroXML als Datenaustauschstandard<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft besteht Abstimmungsbedarf hinsichtlich <strong><strong>de</strong>r</strong> strategischen<br />
Ausrichtung.<br />
Das Ziel ist die ständige Fortschreibung <strong>de</strong>s strategischen Konzeptes für die<br />
Entwicklung und Etablierung von agroXML als Standard, das von allen Beteiligten<br />
mitgetragen und umgesetzt wird.<br />
Aufgelöst, Nachfolgegremium ist geplant.<br />
Dr. M. Kunisch<br />
7
Arbeitsschwerpunkt agroXML<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
ISOagriNet und agroXML<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. agroXML 2.1.2.2<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.07.2008<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Mit agroXML und ISOagriNet wer<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit zwei Standards zum Datenaustausch<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> Tierhaltung entwickelt. Die jeweils verwen<strong>de</strong>ten Metho<strong>de</strong>n und<br />
Technologien sind für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet. Am Beispiel<br />
ausgewählter Anwendungsfälle sind optimale Einsatzbereiche herauszuarbeiten,<br />
abzugrenzen und zu dokumentieren sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Übergang von einem in <strong>de</strong>n an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Standard zu <strong>de</strong>finieren.<br />
Zum En<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Laufzeit liegen Spezifikationen zum Anwendungsfall „Austausch<br />
von Rin<strong><strong>de</strong>r</strong>zuchtwerten“ vor. Hierbei wer<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne Übertragungswege<br />
und Datenformate betrachtet. Darauf basierend sind Empfehlungen sowie Programmco<strong>de</strong>fragmente<br />
zur Konvertierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Standards erstellt. Begrifflichkeiten<br />
bei<strong><strong>de</strong>r</strong> Standards sind soweit harmonisiert, dass eine Konvertierung auf einfache<br />
Art und Weise vonstattengehen kann.<br />
- Dokumentation zum Anwendungsfall „Rin<strong><strong>de</strong>r</strong>zuchtwerte“.<br />
Damalige Arbeitsgemeinschaft agroXML (agroXML)<br />
E. Friedrichs WEDA Damman & Westerkamp GmbH,<br />
Lutten<br />
Dr. R. Köstler<br />
Prof. Dr. J. Spilke<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Lan<strong>de</strong>skontrollverband Sachsen-Anhalt e.V.,<br />
Halle/Saale<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle/Saale<br />
J. Wicklein Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung e.V.,<br />
Ver<strong>de</strong>n/Aller<br />
Gäste F.Gietl Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle/Saale<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
D. Martini<br />
8
Arbeitsschwerpunkt agroXML<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Projekt-Nr. agroXML 2.1.3.8<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkte<br />
Planungsbeginn 01.05.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.04.2014<br />
InfrAgrar - Infrastruktur für betriebs-, betriebszweig-, anwendungs- und standardübergreifen<strong>de</strong><br />
Auswertungen von Daten im Precision Livestock Farming<br />
Drittmittelprojekt<br />
In <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft gewinnen neben <strong>de</strong>n klassischen Produktionsfaktoren - Arbeit,<br />
Bo<strong>de</strong>n, Kapital und Rechten - Informationen als Produktionsfaktor zunehmend<br />
an Be<strong>de</strong>utung. Der Informationsstand bestimmt mehr <strong>de</strong>nn je <strong>de</strong>n unternehmerischen<br />
Erfolg eines Betriebes. Informationen wer<strong>de</strong>n an einer Vielzahl von<br />
Stellen bereitgestellt, z. B. durch Sensoren im Betrieb o<strong><strong>de</strong>r</strong> durch Anbieter im Internet.<br />
Dabei han<strong>de</strong>lt es sich jedoch um Informationsinseln, die aufgrund fehlen<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Standardformate und Schnittstellen bislang nur unzureichend maschinell zur<br />
Ableitung von Handlungsempfehlungen verknüpft wer<strong>de</strong>n können.<br />
Für das Precision Livestock Farming wird eine Infrastruktur entworfen, die die<br />
betriebs-, betriebszweig-, anwendungs- und standardübergreifen<strong>de</strong> Auswertung<br />
von Daten ermöglicht. Ergebnis <strong>de</strong>s <strong>Projekte</strong>s sind generische Datenmo<strong>de</strong>lle, die<br />
Daten unabhängig von <strong><strong>de</strong>r</strong> verwen<strong>de</strong>ten Syntax beschreiben und so die Überführung<br />
zwischen verschie<strong>de</strong>nen Datenformaten erlauben. Außer <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen entstehen<br />
Softwaremodule und Pilotanwendungen zur Demonstration <strong><strong>de</strong>r</strong> technischen<br />
Möglichkeiten. Die Ontologie baut auf <strong>de</strong>n in agroXML vorhan<strong>de</strong>nen Konzepten<br />
und <strong>de</strong>m im Projekt iGreen entwickelten methodischen Rahmen auf und<br />
erweitert diese.<br />
- Die Begriffswelt (Ontologie) für die Wertschöpfungskette <strong><strong>de</strong>r</strong> Schweinefleischerzeugung<br />
wird maschinenlesbar in RDF und menschenlesbar in HTML auf<br />
einem <strong>KTBL</strong>-Webserver zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für verschie<strong>de</strong>ne<br />
Softwaremodule und zugehörige Dokumentationen.<br />
- Abschlussbericht gemäß Vorgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und<br />
Ernährung.<br />
Auftraggeber Damalige Arbeitsgemeinschaft agroXML (agroXML)<br />
Drittmittel 82.511 €, Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 1<br />
Projektpartner Dr. E. Gallmann Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
J. Traunecker Gridsolut GmbH & Co. KG, Wernau<br />
M. Schmitz<br />
1 <strong>KTBL</strong>-Anteil.<br />
9
Arbeitsschwerpunkt agroXML<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Pestici<strong>de</strong> Application Manager (PAM) - Entscheidungsunterstützung im Pflanzenschutz<br />
auf Basis von Gelän<strong>de</strong>-, Maschinen-, Hersteller- und Behör<strong>de</strong>ndaten<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. agroXML 2.1.3.9<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.05.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.10.2016<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Mo<strong><strong>de</strong>r</strong>ner Pflanzenschutz ist ein Kernstück von Precision Farming: die vollautomatische<br />
und minimalinvasive Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit<br />
aber noch eine Vision. Nach wie vor erfolgen viele Entscheidungen und Maßnahmen<br />
ohne Unterstützung von Informationstechnologien. Dies führt u.a. zu<br />
einem hohen Arbeitsaufwand und zu Fehlern, z. B. bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Einschätzung von Abstän<strong>de</strong>n<br />
zu Fließgewässern. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e zum Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong> Umwelt und <strong>de</strong>n damit<br />
verbun<strong>de</strong>nen rechtlichen Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen ist die Weiterentwicklung <strong>de</strong>s technischen<br />
Fortschritts im Pflanzenschutz erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich.<br />
Im Verbundprojekt wird für die Informationstechnologie eine Infrastruktur geschaffen:<br />
Alle Informationen stehen im Sinne von guter fachlicher Praxis und<br />
Cross Compliance für die Durchführung und Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen<br />
in einheitlicher Form bereit. Das <strong>KTBL</strong> ergänzt die Datenaustauschsprachen<br />
agroRDF und agroXML um Datenstrukturen, die im Pflanzenschutz<br />
von Belang sind. Hierzu wer<strong>de</strong>n die hauseigenen Datenmo<strong>de</strong>lle entsprechend<br />
erweitert. Ziel ist die Beschreibung in einer formalen, maschinenlesbaren<br />
Begriffswelt, die anschließend das automatische Sammeln und Verarbeiten von<br />
Daten aus verschie<strong>de</strong>nen Quellen erlaubt. Darüber hinaus schafft das <strong>KTBL</strong> Infrastrukturen<br />
zur zukünftigen Beteiligung am automatischen Informationsaustausch.<br />
- Die <strong>KTBL</strong>-Datenbank wird mit Infrastrukturkomponenten erweitert, die einen<br />
automatischen Datenaustausch ermöglichen.<br />
- Die Ergebnisse wer<strong>de</strong>n in einer API(application programming interface)-<br />
Dokumentation als PDF-Dokument veröffentlicht und Interessenten über die<br />
Internetauftritte <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong> und agroXML kostenfrei zur Verfügung gestellt.<br />
Damalige Arbeitsgemeinschaft agroXML (agroXML)<br />
307.104 €, Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
Projektpartner B. Golla Julius Kühn-Institut, Braunschweig<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. B. Kleinhenz<br />
Dr. G. Kormann<br />
Dr. M. Röhrig<br />
Dr. H.-G. Wegkamp<br />
D. Martini<br />
Zentralstelle <strong><strong>de</strong>r</strong> Län<strong><strong>de</strong>r</strong> für EDV-gestützte Entscheidungshilfen<br />
und Programme im Pflanzenschutz, Bad<br />
Kreuznach<br />
John Deere AMS Europe, Zweibrücken<br />
Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion<br />
e.V., Bad Kreuznach<br />
BASF SE - Agrarzentrum Limburgerhof, Limburgerhof<br />
10
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. ABW 2.2.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Projektlaufzeit Seit 3/2004<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Die Qualität <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Daten ist ein Alleinstellungsmerkmal und macht sie<br />
justitiabel. Eine lückenlose, transparente und abgestimmte Dokumentation<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Metho<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Datenerfassung und Datenaufbereitung liegt im <strong>KTBL</strong><br />
noch nicht vor.<br />
Ziel ist die Entwicklung Abstimmung und Dokumentation von Metho<strong>de</strong>n für<br />
die Datenerfassung sowie die Datenaufbereitung. Weiteres Ziel ist die Erstellung<br />
von Qualitätskriterien für Kalkulationsdaten.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft berät die Geschäftsstelle bei <strong><strong>de</strong>r</strong> inhaltlichen Gestaltung<br />
und Weiterentwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Datenbasis sowie <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong>-<br />
Datenangebots.<br />
Hauptausschuss<br />
Dr. J. Degner<br />
Prof. Dr. R. Doluschitz<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
I. Faulhaber Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
Dr. D. Hesse<br />
Dr. H. Kübler<br />
AGRI-Kontakt, Braunschweig<br />
Hofgut Raitzen, Raitzen<br />
PD Dr. M. Schick<br />
Dr. M. Sievers<br />
P. Spandau<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Prof. Dr. P. Wagner<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Forsten<br />
und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Bernburg<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle/Saale<br />
B. Winkler Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt,<br />
Landwirtschaft und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
BMELV-Vertreter K.-H. Brandt Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. N. Sauer<br />
11
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitswirtschaftliche Grundlagen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. ABW 2.2.2.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Der Bedarf an arbeitswirtschaftlichen Daten auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Ebene <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktionsverfahren<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> auf Betriebsebene nimmt zu. Daher bedarf das <strong>KTBL</strong>-<br />
Datenangebot einer Erweiterung, für die zunächst die methodischen Grundlagen<br />
zu erstellen sind.<br />
Metho<strong>de</strong>npapier „Arbeitswirtschaft“ für <strong>de</strong>n Einsatz in Lehre und bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Datenerfassung.<br />
- In einer <strong>KTBL</strong>-Schrift wer<strong>de</strong>n die Grundlagen zur Arbeitswirtschaft wie<br />
Grundbegriffe, die Beschreibung von Arbeitsumfel<strong><strong>de</strong>r</strong>n und Zeiterfassungsmetho<strong>de</strong>n<br />
dokumentiert.<br />
Projekt ruhte bis 2008 aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Neuausrichtung <strong>de</strong>s Arbeitsschwerpunkts.<br />
Planungsbeginn 01.02.2005<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 14.03.2014<br />
Auftraggeber Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Dr. B. Haidn<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Prof. Dr. E. Quendler<br />
PD Dr. M. Schick<br />
Dr. J. Sonnen<br />
Universität für Bo<strong>de</strong>nkultur Wien, Wien<br />
(Österreich)<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
Grimme Landmaschinenfabrik, Damme<br />
T. Steckel Claas Selbstfahren<strong>de</strong> Erntemaschinen,<br />
Harsewinkel<br />
B. Winkler (Vorsitzen<strong>de</strong>) Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt,<br />
Landwirtschaft und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
Dr. J. Frisch<br />
12
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Gesamtbetriebskalkulationen für <strong>KTBL</strong>-Referenzbetriebe<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. ABW 2.2.2.4<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.06.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Für Politik, Wissenschaft, Beratung und landwirtschaftliche Unternehmer<br />
gleichermaßen ist die Folgenabschätzung neuer Techniken, neuer rechtlicher<br />
Vorgaben o<strong><strong>de</strong>r</strong> allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen für landwirtschaftliche<br />
Betriebe von Be<strong>de</strong>utung. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Rechenmo<strong>de</strong>lle für<br />
betriebs- und arbeitswirtschaftliche Fragestellungen auf Betriebszweig- und<br />
Betriebsebene sind noch nicht durchgängig dokumentiert und abgestimmt.<br />
Auch fehlen abgestimmte und dokumentierte Mo<strong>de</strong>llbetriebe <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong>, die<br />
als Referenzbetriebe für Planungsrechnungen und Bewertungen fachdisziplinübergreifend,<br />
z.B. Arbeits- und Betriebswirtschaft, Klimaschutz, herangezogen<br />
wer<strong>de</strong>n können.<br />
Regionaltypische landwirtschaftliche Betriebe <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktionsrichtungen<br />
Futterbau, Vere<strong>de</strong>lung, Ackerbau und Gemischtbetriebe wer<strong>de</strong>n als <strong>KTBL</strong>-<br />
Referenzbetriebe <strong>de</strong>finiert. Für diese Betriebe wer<strong>de</strong>n auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Basis vorliegen<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
<strong>KTBL</strong>-Planungsdaten arbeits- und betriebswirtschaftliche Kennzahlen<br />
kalkuliert. Rechenmo<strong>de</strong>lle und die sich aus <strong>de</strong>m gesamtbetrieblichen<br />
Ansatz ergeben<strong>de</strong>n Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an die <strong>KTBL</strong>-Datengrundlage wer<strong>de</strong>n<br />
dokumentiert.<br />
- Eine <strong>KTBL</strong>-Schrift enthält Metho<strong>de</strong>nbeschreibungen für betriebs- und arbeitswirtschaftliche<br />
Planungsrechnungen auf <strong>de</strong>n Ebenen Betriebszweig<br />
und Betrieb. Sie beinhaltet zu<strong>de</strong>m die Beschreibung <strong><strong>de</strong>r</strong> in <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgruppe<br />
erarbeiteten 12 <strong>KTBL</strong>-Referenzbetriebe als regionstypische<br />
Ackerbau-, Vere<strong>de</strong>lungs-, Futterbau- und Gemischtbetriebe sowie <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
arbeitswirtschaftliche Kennzahlen und betriebswirtschaftliche Erfolgsgrößen.<br />
- Ein interner Projektbericht dokumentiert die Erfahrungen bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Beschreibung<br />
von Referenzbetrieben und bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kalkulation arbeits- und<br />
betriebswirtschaftlicher Kennzahlen auf Basis <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit verfügbaren<br />
<strong>KTBL</strong>-Produktionsverfahren zeigt die Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an das <strong>KTBL</strong>-<br />
Datenangebot auf. Die zunächst intern nutzbaren Rechenmo<strong>de</strong>lle in<br />
Excel- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Access-dateien können ggf. zu marktfähigen Online-<br />
Anwendungen weiterentwickelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW)<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
13
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
R. Beverborg Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
U. Bönewitz Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
Dr. K.-H. Deerberg<br />
Dr. J. Degner<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,<br />
Rendsburg<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
I. Faulhaber Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
M. Grenzebach Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hessen,<br />
Petersberg<br />
M. Krumm Lan<strong>de</strong>sanstalt für Entwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> ländlichen Räume, Schwäbisch<br />
Gmünd<br />
Dr. H. Kübler<br />
Dr. M. Sievers<br />
Hofgut Raitzen, Raitzen<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Forsten<br />
und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Bernburg<br />
P. Spandau Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
Prof. Dr. P. Wagner<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. J. O. Schroers<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle/Saale<br />
14
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Die Maschinen- und Anlagenkostenkalkulation in <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen<br />
Betriebsplanung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. ABW 2.2.2.5<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 30.09.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.04.2015<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Der Einsatz von Maschinen und technischen Anlagen verursacht Kosten für<br />
Abschreibungen, Reparaturen und Betriebsstoffe. Die Kosten von realen<br />
Maschinen lassen sich daher erst am En<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutzung exakt bestimmen.<br />
Um die Kosten einer Maschine vor ihrem Kauf o<strong><strong>de</strong>r</strong> Einsatz abschätzen zu<br />
können, sind Annahmen hinsichtlich <strong>de</strong>s technischen und wirtschaftlichen<br />
Nutzungspotenzials und <strong><strong>de</strong>r</strong> anfallen<strong>de</strong>n Reparatur- und Wartungskosten zu<br />
treffen. Die bisherige Vorgehensweise ist aufwändig und für zukünftige Fragestellungen,<br />
z. B. im Rahmen von Betriebsbetrachtungen, ungenügend. Die<br />
Metho<strong>de</strong>n und Annahmen zur Kalkulation <strong><strong>de</strong>r</strong> auslastungsabhängigen Abschreibung<br />
sowie die methodischen Grundlagen zur Erstellung eines Mengen-<br />
und Preisgerüsts für die Reparaturkostenkalkulation sind überarbeitungsbedürftig.<br />
Die im <strong>KTBL</strong> angewen<strong>de</strong>ten Metho<strong>de</strong>n zur Kalkulation von Maschinen- und<br />
Anlagenkosten wer<strong>de</strong>n aktualisiert und dokumentiert. Die Dokumentation<br />
dient als geschäftsstelleninterne Vorgabe für die Umsetzung in <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-<br />
Datenbank und <strong>de</strong>n auf ihr aufbauen<strong>de</strong>n Kalkulationsanwendungen. Die Dokumentation<br />
enthält eine Aufstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Attribute wie Beschreibung, Einheit,<br />
Datenquelle, Erhebungsmetho<strong>de</strong> und -intervall, Verantwortlichkeit, und die<br />
formelmäßige Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Algorithmen zur Berechnung <strong><strong>de</strong>r</strong> Kennzahlen.<br />
- Die Dokumentation beschreibt die methodischen Grundlagen und Mo<strong>de</strong>llannahmen<br />
<strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong> bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kostenkalkulation von Maschinen und technischen<br />
Anlagen. Die geschäftsstelleninterne Veröffentlichung erfolgt als<br />
Datei im Satzformat einer <strong>KTBL</strong>-Schrift.<br />
Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW)<br />
G. Aschenbrenner Österreichisches Kuratorium für Landtechnik<br />
und Lan<strong>de</strong>ntwicklung, Wien (Österreich)<br />
Dr. J. Degner<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
A. Fübbeker Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
C. Gazzarin Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
Dr. J. Habermeyer<br />
Dr. H.-H. Kowalewsky<br />
Dr. M. Lips<br />
Dr. N. Uppenkamp<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Prof. Dr. P. Wagner<br />
Dr. N. Sauer<br />
Bun<strong>de</strong>sverband <strong><strong>de</strong>r</strong> Maschinenringe e.V.,<br />
Neuburg a.d. Donau<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle/Saale<br />
15
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel Standardoutputs (SO) und Standard<strong>de</strong>ckungsbeiträge (SDB) 2012/13<br />
Projektart<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. ABW 2.2.4.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.02.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 20.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Sowohl in <strong><strong>de</strong>r</strong> amtlichen Agrarstatistik als auch in <strong><strong>de</strong>r</strong> Buchführungsstatistik<br />
wer<strong>de</strong>n die fünfjährigen gleiten<strong>de</strong>n Durchschnitte <strong>de</strong>s Standardoutputs (SO)<br />
als Kennzahl zur Klassifizierung <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen Betriebe nach Betriebsgröße<br />
und Produktionsrichtung eingesetzt. Sie wer<strong>de</strong>n in <strong><strong>de</strong>r</strong> EU, beim<br />
Bund und in <strong>de</strong>n Län<strong><strong>de</strong>r</strong>n seit <strong>de</strong>m Wirtschaftsjahr 2010/11 an Stelle <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Standard<strong>de</strong>ckungsbeiträge (SDB) verwen<strong>de</strong>t.<br />
Die Standardoutputs (SO) beschreiben die Produktionsleistung eines Produktionsverfahrens<br />
(Merkmals), d.h. <strong>de</strong>n monetären Wert <strong><strong>de</strong>r</strong> erzeugten<br />
Produkte und/o<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>s erzielten Zuwachses. Der Standard<strong>de</strong>ckungsbeitrag<br />
(SDB) beschreibt die Wertschöpfung (Produktionsleistung abzüglich Vorleistungen)<br />
eines Produktionsverfahrens und entspricht inhaltlich <strong><strong>de</strong>r</strong> Direktkostenfreien<br />
Leistung. Der SDB unterschei<strong>de</strong>t sich vom Deckungsbeitrag in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Betriebsplanung, bei <strong>de</strong>m neben <strong>de</strong>n Direktkosten auch die variablen Maschinen-<br />
und Lohnkosten und die Kosten für Dienstleistungen berücksichtigt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Für das Wirtschaftsjahr 2012/13 wer<strong>de</strong>n auf Basis <strong><strong>de</strong>r</strong> aktuellen Preise sowie<br />
erzeugter Mengen und erzielter Zuwächse für alle Produktionsverfahren<br />
(Merkmale) <strong><strong>de</strong>r</strong> Agrar- und Buchführungsstatistik Standardoutputs ermittelt,<br />
zu 5-jährigen gleiten<strong>de</strong>n Durchschnittswerten aufbereitet und <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sund<br />
Län<strong><strong>de</strong>r</strong>ministerien, <strong>de</strong>n statistischen Ämtern und landwirtschaftlichen<br />
Buchstellen zur Verfügung gestellt.<br />
Die Standard<strong>de</strong>ckungsbeiträge wer<strong>de</strong>n ebenfalls aktualisiert, da sie aufgrund<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> längeren Zeitreihe zusätzliche Informationen bieten.<br />
- Die ermittelten 5-jährigen Durchschnittswerte <strong><strong>de</strong>r</strong> SO-Koeffizienten wer<strong>de</strong>n<br />
als Excel-Datei so aufbereitet, dass sie direkt in die Klassifizierungsprogramme<br />
eingelesen wer<strong>de</strong>n können. Sie wer<strong>de</strong>n über das BMELV <strong>de</strong>n<br />
Län<strong><strong>de</strong>r</strong>ministerien, statistischen Ämter und landwirtschaftliche Buchstellen<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
- Die <strong>KTBL</strong>-Online-Anwendung Standard<strong>de</strong>ckungsbeiträge enthält Erfolgsgrößen<br />
für 24 Kulturen und 12 Tierarten und Produktionsrichtungen in 45<br />
Regionen. Nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Aktualisierung stehen die Kennzahlen für die Wirtschaftsjahre<br />
2001/02 bis 2012/13 als Zeitreihe zur Bewertung sowie zum<br />
räumlich und zeitlich differenzierten Vergleich landwirtschaftlicher Produktionsverfahren<br />
zur Verfügung.<br />
Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW)<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Dr. N. Sauer<br />
16
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel Datensammlung Betriebsplanung Landwirtschaft 2014/15<br />
Projektart<br />
weitere<br />
Projekt-Nr. ABW 1.5.4<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.09.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.11.2014<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Produktionsplanung gehört zu <strong>de</strong>n grundlegen<strong>de</strong>n Aufgaben landwirtschaftlicher<br />
Unternehmer und umfasst Entscheidungen über die Kapazitätsausstattung,<br />
über das Produktionsprogramm und über <strong>de</strong>n Produktionsprozess.<br />
Zur Kalkulation wer<strong>de</strong>n Planungsdaten und abgestimmte methodische<br />
Grundlagen benötigt. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e wenn betriebsindividuelle Daten fehlen,<br />
sind verlässliche Planungswerte be<strong>de</strong>utsam. Zum Vergleich und Interpretation<br />
eigener Daten und Planungsergebnisse sind neutrale Kennzahlen hilfreich.<br />
Für Planungsrechnungen und betriebswirtschaftliche Bewertungen im<br />
Ackerbau sowie in <strong><strong>de</strong>r</strong> Grünlandnutzung, Nutztierhaltung und Biogaserzeugung<br />
stehen zuverlässige Informationen zur Verfügung. Sie umfassen ökonomische<br />
Erfolgsgrößen und Stückkosten sowie Planungsdaten zu Leistungen,<br />
Direktkosten und Arbeitswirtschaft. Darüber hinaus sind die methodischen<br />
Grundlagen auf allen Planungsebenen mit anschaulichen Kalkulationsbeispielen<br />
enthalten.<br />
- Die <strong>KTBL</strong>-Datensammlung enthält aktuelle Planungsdaten für Maschinen,<br />
technische und bauliche Anlagen, Stallgebäu<strong>de</strong>, Arbeitsverfahren, Dienstleistungen<br />
und Produktionsverfahren sowie Planungsbeispiele für die be<strong>de</strong>utsamsten<br />
landwirtschaftlichen Kulturen und Nutzierarten sowie Biogas.<br />
- Die Online-Anwendung enthält eine Vielzahl von Produktionsverfahren<br />
aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Tier- und Pflanzenproduktion, die in <strong><strong>de</strong>r</strong> gedruckten Fassung keinen<br />
Platz fin<strong>de</strong>n. Sie wird parallel zur <strong>KTBL</strong>-Datensammlung aktualisiert<br />
und mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Erscheinung <strong><strong>de</strong>r</strong> Print-Ausgabe freigeschaltet. Sie kann auch<br />
unabhängig von <strong><strong>de</strong>r</strong> Printversion genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. N. Sauer<br />
17
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Datensammlung „Landschaftspflege mit Schafen“<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. ABW 2.2.4.7<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 04.10.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.03.2014<br />
Auftraggeber<br />
Projektpartner<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Schafhaltung hat viele Kulturlandschaften Deutschlands geprägt, weshalb<br />
sie zum Erhalt und zur Pflege <strong><strong>de</strong>r</strong> Landschaft und Biotope beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s<br />
geeignet ist. Die Wirtschaftlichkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Schafhaltung ist jedoch immer seltener<br />
gegeben, die Bestandszahlen sind rückläufig. Damit wird <strong><strong>de</strong>r</strong> positive<br />
Nebeneffekt <strong><strong>de</strong>r</strong> Schafhaltung auf Landschaft und Natur gefähr<strong>de</strong>t. Vertragsnaturschutz<br />
bietet eine Perspektive. Naturschutz, Landschaftspflege<br />
und Schafhalter haben <strong>de</strong>shalb ein gemeinsames Interesse am Erhalt <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Schafhaltung und benötigen verfahrenstechnische und ökonomische Planungsdaten<br />
zur biotopspezifischen Landschaftspflege mit Schafen.<br />
Für die Biotoptypen Deiche/Dämme, Magerwiesen, Hei<strong>de</strong>n, Moore und<br />
Streuobstwiesen wer<strong>de</strong>n Standardproduktionsverfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Landschaftspflege<br />
<strong>de</strong>finiert. Die Verfahren wer<strong>de</strong>n nach <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Systematik beschrieben<br />
und durch eine Leistungs-Kostenrechnung belegt. Daraus lassen sich<br />
biotopspezifische Kosten <strong><strong>de</strong>r</strong> Landschaftspflege mit Schafen ableiten.<br />
- Die Datensammlung „Landschaftspflege mit Schafen“ enthält analog zur<br />
Datensammlung "Betriebsplanung Landwirtschaft" Planungsdaten für Maschinen,<br />
Geräte, Anlagen, Arbeitsverfahren und Produktionsverfahren <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Landschaftspflege mit Schafen. Ergänzt wird die Datensammlung durch<br />
methodische Einführungen und Beispiele für Landschaftspflegeverträge.<br />
Arbeitsgemeinschaft Arbeits- und Betriebswirtschaft (ABW)<br />
Vereinigung Deutscher Lan<strong>de</strong>sschafzuchtverbän<strong>de</strong> e.V., Berlin<br />
Dr. J. O. Schroers<br />
18
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel <strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen“ 2013<br />
Projektart<br />
Bund-Län<strong><strong>de</strong>r</strong>-Gruppe, Bund-Län<strong><strong>de</strong>r</strong>-Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. ABW 2.3.13<br />
Problemstellung Auf Grundlage <strong><strong>de</strong>r</strong> Bund-Län<strong><strong>de</strong>r</strong>-Verwaltungsvereinbarung (AZ 311-3054-<br />
0/6) wird <strong>de</strong>m <strong>KTBL</strong> die Aufgabe zur Erstellung einer Grundlage für eine<br />
EDV-gerechte betriebs- und arbeitswirtschaftliche Datensammlung für bun<strong>de</strong>seinheitliche<br />
Kalkulationsunterlagen, <strong><strong>de</strong>r</strong>en Fortschreibung und Aufbereitung<br />
übertragen. Die Programmgestaltungsgruppe (PGG) berät die eingebrachten<br />
Projektvorschläge und erstellt <strong>de</strong>n Vorschlag für das <strong>Arbeitsprogramm</strong><br />
zur Genehmigung durch die Referenten Betriebswirtschaft <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> Län<strong><strong>de</strong>r</strong>. Die PGG kommt jährlich zu einer Sitzung zusammen,<br />
auf <strong><strong>de</strong>r</strong> über <strong>de</strong>n Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>laufen<strong>de</strong>n</strong> und die Ergebnisse <strong><strong>de</strong>r</strong> abgeschlossenen<br />
<strong>Projekte</strong> berichtet und eine Auswahl aus <strong>de</strong>n vorliegen<strong>de</strong>n Projektskizzen<br />
getroffen wird. Die Auswahl wird <strong>de</strong>n Referenten „Betriebswirtschaft“<br />
zur Genehmigung empfohlen.<br />
Projektziel<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Planungsbeginn 14.10.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 28.03.2014<br />
Auftraggeber<br />
Zu <strong>de</strong>n 2012 ausgewählten Themen wer<strong>de</strong>n aktuelle und abgesicherte Daten<br />
erhoben und in <strong>de</strong>n <strong>KTBL</strong>-Datenstamm übernommen. Die <strong>KTBL</strong>-<br />
Geschäftsstelle koordiniert die Projektvergabe, betreut die Projektnehmer,<br />
bereitet die Daten auf und überführt sie in ihren Datenstamm. Die Daten stehen<br />
<strong>de</strong>m Bund, <strong>de</strong>n Län<strong><strong>de</strong>r</strong>n und <strong>de</strong>m <strong>KTBL</strong> für betriebswirtschaftliche Fragestellungen<br />
zur Verfügung.<br />
Genehmigt wer<strong>de</strong>n die KU-Aufträge von <strong>de</strong>n Referenten Betriebswirtschaft<br />
<strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s und <strong><strong>de</strong>r</strong> Län<strong><strong>de</strong>r</strong>. Im <strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> wer<strong>de</strong>n die KU-<br />
<strong>Projekte</strong> für das Jahr 2013 zur Kenntnis aufgeführt (siehe nächste Seite).<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
und die Ministerien für Landwirtschaft <strong><strong>de</strong>r</strong> Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Drittmittel 246.444 €, Bund und Län<strong><strong>de</strong>r</strong> je 50 %<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Programmgestaltungsgruppe<br />
A. Bart Sächsisches Staatsministerium für Umwelt<br />
und Landwirtschaft, Dres<strong>de</strong>n<br />
M. Berlik LMS Agrarberatung GmbH, Rostock<br />
K.-H. Brandt<br />
Dr. K.-H. Deerberg<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
G.-A. Engelien<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,<br />
Rendsburg<br />
Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg<br />
I. Faulhaber Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
K. Gerstenberger Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,<br />
Weinbau und Forsten Rheinland-<br />
Pfalz, Mainz<br />
S. Groß Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,<br />
Forsten, Umwelt und Naturschutz, Erfurt<br />
H. Hanff Lan<strong>de</strong>samt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft<br />
und Flurneuordnung, Teltow<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
A. Hofmann Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie<br />
und Verkehr <strong>de</strong>s Saarlands, Saarbrücken<br />
19
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. H.-H. Kowalewsky<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
W. Richarz Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
Dr. V. Rust<br />
Dr. V. Segger<br />
K.-D. Sens<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Forsten<br />
und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Bernburg<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Entwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> ländl. Räume, Schwäbisch<br />
Gmünd<br />
Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hessen, Alsfeld<br />
P. Spandau Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
Dr. M. Kunisch (Geschäftsführer)<br />
Dr. J.O. Schroers (Projektleiter)<br />
<strong>Übersicht</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> KU-Vorhaben 2013 (Kennziffer, Thema, Projektnehmer)<br />
4b 13 Dichte von Häckselgut Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
4d 12<br />
4g 13<br />
4h 13<br />
Geräte zur Unkrautregulierung im Ökolandbau<br />
Verfügbare Mähdruschstun<strong>de</strong>n - Raps, Körnerleguminosen<br />
und Triticale<br />
Investitionsbedarf für Zuchtsauen- und Ferkelaufzuchtställe<br />
Technische Universität Dres<strong>de</strong>n, Dres<strong>de</strong>n<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik, Potsdam<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
4i 13 Arbeitszeitbedarf in <strong><strong>de</strong>r</strong> Milchviehhaltung Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
4n 13 Arbeitserledigungskosten Beweidung Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Landwirtschaft, Darmstadt<br />
4o 13 Dienstleistungen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Innenwirtschaft Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
4r 13<br />
5a 13<br />
5c 13<br />
5d 13<br />
5g 13<br />
5h 13<br />
6a 13<br />
8a 13<br />
Abluftreinigung für Schweine- und Geflügelställe<br />
Techniken zur Kälte- und Stromerzeugung<br />
mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen<br />
Verfahren zur Aufbereitung von Gärresten<br />
und Separation von Gülle<br />
Verfahren zur Aufbereitung von Biogassubstraten<br />
Energiebedarf in Stallanlagen für die<br />
Schweinehaltung; Techniken zur Steigerung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz<br />
Energiebedarf Melkanlagen und Milchkühlung<br />
Daten zur Arbeitserledigung im Obstbau für<br />
die Pflanzung, Pflege und Rodung<br />
Lohnunternehmerpreise für landwirtschaftliche<br />
Arbeitsverfahren<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Bigatec, Ingenieurbüro für Bioenergie,<br />
Rheinberg<br />
Fraunhofer Institut für Keramische Technologien<br />
und Systeme, Dres<strong>de</strong>n<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum<br />
Rheinpfalz, Neustadt<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,<br />
Rendsburg<br />
20
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Dichte von Häckselgut<br />
Projektart KU-Projekt 4b 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Dichte von Häckselgütern hat einen wesentlichen Einfluss auf das<br />
Transportverfahren und seine Kosten. Für die Häckselgüter Maishäcksel,<br />
gehäckseltes Gras-, Wei<strong>de</strong>lgras- und Kleegras-Anwelkgut sowie gehäckselte<br />
Getrei<strong>de</strong>arten, Getrei<strong>de</strong>-Körnerleguminosen-Gemenge sind die Dichten beim<br />
ein – und mehrphasigen Transport zu bestimmen.<br />
Für Maishäcksel, gehäckseltes Gras-, und Kleegras-Anwelkgut, gehäckselte<br />
Getrei<strong>de</strong>arten und Getrei<strong>de</strong>-Körnerleguminosen-Gemenge sowie weitere<br />
Häckselgüter zur energetischen Nutzung wer<strong>de</strong>n die Masse, das Volumen,<br />
die Häcksellänge und <strong><strong>de</strong>r</strong> TM-Gehalt erhoben. Von <strong>de</strong>n eingesetzten Transportfahrzeugen<br />
wer<strong>de</strong>n Typ und Nennvolumen erfasst, so dass sich ein- und<br />
mehrphasige Transporte beschreiben lassen.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, München<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. J. Grube<br />
Projekttitel<br />
Geräte zur Unkrautregulierung im Ökolandbau<br />
Projektart KU-Projekt 4d 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Daten zu Maschinen, die im ökologischen Landbau zur mechanischen<br />
Unkrautregulierung eingesetzt wer<strong>de</strong>n, sind nicht vollständig und nicht aktuell.<br />
Des Weiteren fehlen Daten zur Kalkulation <strong><strong>de</strong>r</strong> verfahrensspezifischen<br />
Arbeitserledigungskosten.<br />
Es wer<strong>de</strong>n Daten für Maschinen und Verfahren zur Unkrautregulierung im<br />
Ökologischen Landbau erhoben.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Technische Universität Dres<strong>de</strong>n, Dres<strong>de</strong>n<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. F. Kloepfer<br />
21
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Verfügbare Mähdruschstun<strong>de</strong>n - Raps, Körnerleguminosen und Triticale<br />
Projektart KU-Projekt 4g 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Das <strong>KTBL</strong> ist Anbieter von arbeits- und betriebswirtschaftlichen Planungsdaten.<br />
Die Daten zu <strong>de</strong>n verfügbaren Feldarbeitstagen dienen <strong><strong>de</strong>r</strong> Kapazitätsplanung<br />
landwirtschaftlicher Arbeitsverfahren in <strong><strong>de</strong>r</strong> Außenwirtschaft. 2011<br />
wur<strong>de</strong>n die verfügbaren Feldarbeitstage von ausgewählten Kulturen auf Basis<br />
historischer Wetteraufzeichnungen kalkuliert. Zur Kalkulation <strong><strong>de</strong>r</strong> die verfügbaren<br />
Mähdruschstun<strong>de</strong>n für Winterraps, Ackerbohnen, Futtererbsen und<br />
Triticale liegen bis dato keine Abreife- und Abtrocknungsmo<strong>de</strong>lle vor.<br />
Die Abreife- und Abtrocknungsmo<strong>de</strong>lle sind für die vier genannten Kulturen<br />
angepasst und stehen für die Kalkulation <strong><strong>de</strong>r</strong> Kornfeuchte auf Basis historischer<br />
Witterungsdaten zur Verfügung.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik, Potsdam<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. F. Kloepfer<br />
Projekttitel<br />
Investitionsbedarf für Zuchtsauen- und Ferkelaufzuchtställe<br />
Projektart KU-Projekt 4h 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Für die Haltung von Zuchtsauen und Aufzuchtferkeln sind Stallmo<strong>de</strong>lle nach<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Systematik <strong><strong>de</strong>r</strong> Online-Anwendung „Baukost“ zu erstellen. Für das Gebäu<strong>de</strong><br />
und die fest eingebauten technischen Anlagen sind <strong><strong>de</strong>r</strong> Investitionsbedarf<br />
und die jährlichen Kosten zu kalkulieren; dabei wer<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne<br />
Bestandsgrößen und Haltungsformen berücksichtigt.<br />
Aktuelle Kalkulationsdaten (Investitionsbedarf, Baubeschreibungen, Planungskennzahlen,<br />
Bauzeichnungen) wer<strong>de</strong>n für ausgewählte Stallmo<strong>de</strong>lle<br />
erarbeitet. Die Daten gehen in die Baukost-Datenbank ein.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, München<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
E. Witzel<br />
22
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Arbeitszeitbedarf in <strong><strong>de</strong>r</strong> Milchviehhaltung<br />
Projektart KU-Projekt 4i 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Mit steigen<strong>de</strong>n Bestandsgrößen än<strong><strong>de</strong>r</strong>n sich in <strong><strong>de</strong>r</strong> Milchviehhaltung die Arbeitsabläufe<br />
und die Organisationsformen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeit. 2012 wur<strong>de</strong>n mit <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Erhebung <strong>de</strong>s Investitionsbedarfs neue Stallmo<strong>de</strong>lle für die Milchviehhaltung<br />
in das Datenangebot <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong> übernommen. Im zweiten Schritt müssen für<br />
diese Stallmo<strong>de</strong>lle die Arbeitsabläufe beschrieben und fehlen<strong>de</strong> Arbeitselemente<br />
erhoben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Arbeitsabläufe wer<strong>de</strong>n für alle vom <strong>KTBL</strong> angebotenen Produktionsverfahren<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Milchviehhaltung beschrieben und <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitszeitbedarf ermittelt.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Ettenhausen<br />
(Schweiz)<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. W. Hartmann<br />
Projekttitel<br />
Arbeitserledigungskosten Beweidung<br />
Projektart KU-Projekt 4n 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die vorhan<strong>de</strong>nen Planungsdaten zur Beweidung mit Rin<strong><strong>de</strong>r</strong>n und Schafen<br />
bil<strong>de</strong>n nicht die Bandbreite <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis ab. Eine Systematisierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Verfahren<br />
und eine Schließung <strong><strong>de</strong>r</strong> Datenlücken muss durchgeführt wer<strong>de</strong>n.<br />
Ziel <strong>de</strong>s Projekts ist die Systematisierung von Grünlandtypen und <strong><strong>de</strong>r</strong>en Beweidungsformen<br />
nach Tierart, Anzahl Nutzungen, Rasse, Anteil<br />
Stall/Wei<strong>de</strong>haltung, Bestands- und Her<strong>de</strong>ngröße sowie die Erhebung von<br />
Daten zur Kalkulation <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitserledigungskosten.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft, Darmstadt<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. W. Hartmann<br />
23
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Dienstleistungen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Innenwirtschaft<br />
Projektart KU-Projekt 4o 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
In <strong><strong>de</strong>r</strong> Innenwirtschaft wer<strong>de</strong>n für spezialisierte Arbeitsgänge zunehmend<br />
Dienstleistungen externer Unternehmen eingesetzt. Dies betrifft vor allem<br />
große Betriebe mit hohen Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an die Qualität und Schlagkraft <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeit, um Arbeitsspitzen zu verringern, aber auch kleinere Betriebe, die die<br />
erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>liche hochwertige Technik nicht auslasten können. Die Erhebung<br />
erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>t genaue Kenntnisse und Kontakt mit Anbietern und Landwirten.<br />
Dienstleistungen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Innenwirtschaft wie das Reinigen und Desinfizieren<br />
von Ställen und Futteraußensilos, das Besamen und Trächtigkeitsuntersuchungen,<br />
das Ein- und Ausstallen von Mastgeflügel, das Mahlen, Mischen<br />
und Vorlegen von Futter, das Einstreuen von Ställen, die Schafschur, die<br />
Klauenpflege wer<strong>de</strong>n erhoben, Hinweise zur vertraglichen Gestaltung, zu<br />
Abrechnungsmodalitäten und zur Gewährleistung wer<strong>de</strong>n zusammengestellt.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
C. Gaio<br />
Projekttitel<br />
Abluftreinigung für Schweine- und Geflügelställe<br />
Projektart KU-Projekt 4r 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Zahl <strong><strong>de</strong>r</strong> zertifizierten Abluftreinigungsanlagen steigt kontinuierlich. Seit<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> letzten Datenerhebung 2009 sind mehr als zehn neue Verfahren auf <strong>de</strong>n<br />
Markt gekommen. Das Angebot spiegelt die große Nachfrage wie<strong><strong>de</strong>r</strong>: Häufig<br />
ist die Nutzung dieser Technik die einzige Möglichkeit zur Genehmigung eines<br />
Standortes; gleichzeitig können die Kosten <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlage die Haltung unwirtschaftlich<br />
wer<strong>de</strong>n lassen.<br />
Das Projekt beantwortet auf einer standardisierten und nachvollziehbaren<br />
Daten- und Berechnungsgrundlage die Frage, mit welchem Investitionsbedarf<br />
und welchen Betriebs- sowie Gesamtjahreskosten beim Betrieb von zertifizierten<br />
Abluftreinigungsanlagen aktuell zu rechnen ist.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
E. Grimm<br />
24
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Techniken zur Kälte- und Stromerzeugung durch Nutzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Motorabwärme<br />
aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen<br />
Projektart KU-Projekt 5a 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Nutzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Abwärme von Blockheizkraftwerken ist bei Biogasanlagen<br />
vorgeschrieben und für ein positives Betriebsergebnis vieler Anlagen wichtig.<br />
Da die klassischen Metho<strong>de</strong>n wie Beheizung von Wohnhäusern o<strong><strong>de</strong>r</strong> Bereitstellung<br />
von Warmwasser keine übers Jahr gesehen kontinuierlichen Wärmeabnehmer<br />
sind, wer<strong>de</strong>n alternative Technologien interessant. Aus diesem<br />
Grund ist eine Erneuerung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong> Datengrundlage erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich.<br />
Die unterschiedlichen am Markt verfügbaren Verfahren bzw. Techniken für<br />
Biogasanlagen zur Kälte- und Stromerzeugung aus BHKW-Abwärme wer<strong>de</strong>n<br />
systematisiert. Die jeweiligen Verfahren wer<strong>de</strong>n anhand technischer Planungsdaten<br />
beschrieben und die Anschaffungspreise sowie die Nutzungspotenziale,<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Betriebsmittelbedarf, die Reparatur- und Wartungskosten sowie<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Betreuungsaufwand <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlage ermittelt.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, München<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
B. Wirth<br />
Projekttitel<br />
Verfahren zur Aufbereitung von Gärresten und Separation von Gülle<br />
Projektart KU-Projekt 5c 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die am Markt verfügbaren Techniken zur Gärrestaufbereitung und Gülleseparation<br />
haben sich in <strong>de</strong>n letzten Jahren weiterentwickelt sowohl was die<br />
Art <strong><strong>de</strong>r</strong> angebotenen Verfahren anbelangt, als auch was die technischen und<br />
wirtschaftlichen Kennzahlen betrifft.<br />
Die technischen und wirtschaftlichen Kenngrößen <strong><strong>de</strong>r</strong> Verfahren zur Teilund<br />
Vollaufbereitung von Gärresten sowie zur Separation von Gülle wer<strong>de</strong>n<br />
auf <strong>de</strong>n neuesten Stand gebracht. Die am Markt verfügbare Technik wird<br />
systematisiert, die Technik prozesstechnisch beschrieben, die Anschaffungspreise<br />
und die Nutzungsdauer, <strong><strong>de</strong>r</strong> Betriebsstoffbedarf, <strong><strong>de</strong>r</strong> Reparaturund<br />
Wartungsaufwand sowie ggf. <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitszeitbedarf wer<strong>de</strong>n ermittelt.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Bigatec, Ingenieurbüro für Bioenergie, Rheinberg<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
M. Sta<strong>de</strong>lmann<br />
25
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Verfahren zur Aufbereitung von Biogassubstraten<br />
Projektart KU-Projekt 5d 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Es wer<strong>de</strong>n Techniken zur Aufbereitung bzw. Substratkonditionierung durch<br />
Desintegration von Biogassubstraten auf <strong>de</strong>m Markt angeboten. Die technischen<br />
Metho<strong>de</strong>n reichen von mechanischer und thermischer Aufbereitung<br />
bis hin zur elektrokinetischen Behandlung <strong><strong>de</strong>r</strong> Substrate. Die Hersteller versprechen<br />
durch die Aufbereitungsverfahren Ertragssteigerungen durch höhere<br />
Gasausbeute bzw. geringeren Substratverbrauch. Aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Neuerungen<br />
<strong>de</strong>s EEG liegt <strong><strong>de</strong>r</strong> Fokus <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit weniger auf <strong>de</strong>m Neubau von Biogasanlagen,<br />
son<strong><strong>de</strong>r</strong>n eher im Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong> Optimierung bereits bestehen<strong><strong>de</strong>r</strong> Anlagen.<br />
Da die Desintegration zu <strong>de</strong>n beliebten Optimierungsmaßnahmen<br />
zählt, ist es für das <strong>KTBL</strong> wichtig, die Datengrundlage in diesem Bereich<br />
auszubauen.<br />
Die am Markt verfügbaren Verfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Substrataufbereitung für Biogasanlagen<br />
sowie Aufbereitungstechniken für Energierüben wer<strong>de</strong>n systematisiert<br />
und mit Planungsdaten prozesstechnisch beschrieben.<br />
Die Anschaffungspreise, <strong><strong>de</strong>r</strong> Betriebsstoffbedarf, die Reparatur- und Wartungskosten<br />
sowie ggf. <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitszeitbedarf wer<strong>de</strong>n ermittelt; wenn möglich<br />
soll die Korrelation zwischen Leistungssteigerung durch die Substrataufbereitung<br />
in Form höherer Substratausnutzung und <strong><strong>de</strong>r</strong> damit verbun<strong>de</strong>nen<br />
Kosten dargestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, Dres<strong>de</strong>n<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
M. Paterson<br />
Projekttitel<br />
Energiebedarf in Stallanlagen für die Schweinehaltung; Techniken zur Steigerung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz<br />
Projektart KU-Projekt 5g 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Die Planung <strong>de</strong>s Energiebedarfs in <strong><strong>de</strong>r</strong> Schweinehaltung gestaltet sich<br />
schwierig. Für <strong>de</strong>n Bedarf <strong><strong>de</strong>r</strong> Hauptverbraucher Lüftung und Heizung sind<br />
Langzeitmessungen nötig, Stallanlage und Management müssen gutem<br />
fachlichen Standard und guter fachlicher Praxis entsprechen, Fehlmessungen<br />
durch nicht dazugehören<strong>de</strong> Nebenverbraucher müssen ausgeschlossen<br />
wer<strong>de</strong>n. Der Einfluss <strong>de</strong>s Managements ist oft größer als die unterschiedliche<br />
Technik. Einfache Verbrauchsmessungen lassen sich aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> unzureichen<strong>de</strong>n<br />
Dokumentation <strong><strong>de</strong>r</strong> Einsatzbedingungen, Zielgrößen etc. nicht<br />
zur Ableitung von Planungsdaten nutzen.<br />
Das Vorhaben soll <strong><strong>de</strong>r</strong> Absicherung von mo<strong>de</strong>llhaften Ableitungen zum<br />
Energiebedarf von Schweineställen dienen wie sie <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit in <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-<br />
Arbeitsgruppe „Vergleichskennzahlen Energieeffizienz“ erarbeitet wer<strong>de</strong>n<br />
und die Datenbasis für <strong>de</strong>n bisher nur abgeschätzten Energiebedarf verbessern.<br />
Für energieeffiziente Techniken in Schweinställen sollen die Anschaffungspreise<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> spezifische Energieverbrauch erhoben, die fixen und<br />
variablen Kosten abgeleitet und so die Energieeinsparung und Amortisationszeit<br />
gegenüber Standardtechniken ermittelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
26
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, München<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
S. Fritzsche<br />
Projekttitel<br />
Energiebedarf Melkanlagen und Milchkühlung<br />
Projektart KU-Projekt 5h 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Melkanlagen und Anlagen zur Milchkühlung sind die wesentlichen Energieverbraucher<br />
in Milchviehbetrieben. Für <strong>de</strong>n Energiebedarf dieser Anlagen<br />
liegen nur abgeschätzte Werte vor, in Teilbereichen auch mo<strong>de</strong>llhafte Ableitungen.<br />
Das Vorhaben soll <strong><strong>de</strong>r</strong> Absicherung von mo<strong>de</strong>llhaften Ableitungen zum<br />
Energiebedarf von Melksystemen dienen wie sie <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit in <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-<br />
Arbeitsgruppe „Vergleichskennzahlen Energieeffizienz“ erarbeitet wer<strong>de</strong>n<br />
und die Datenbasis für <strong>de</strong>n bisher nur abgeschätzten Energiebedarf von<br />
Milchkühlungsanlagen verbessern.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. W. Hartmann<br />
Projekttitel<br />
Projektart KU-Projekt 6a 13<br />
Daten zur Arbeitserledigung im Obstbau für die Pflanzung, Pflege und Rodung<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Für die Pflanzung, Pflege und Rodung im Obstbau fehlen <strong>de</strong>taillierte Daten<br />
zur Arbeitserledigung.<br />
Erweiterung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Datenbank um Produktionsverfahren im Obstbau und<br />
Veröffentlichung <strong><strong>de</strong>r</strong> Daten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> nächsten Überarbeitung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-<br />
Datensammlung Obstbau<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Neustadt<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
T. Belau<br />
27
Arbeitsschwerpunkt Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
Projekttitel<br />
Lohnunternehmerpreise für landwirtschaftliche Arbeitsverfahren<br />
Projektart KU-Projekt 8a 13<br />
Projekt-Nr. 2.3.13 Durchführung AP "KU" 2013<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Auftragnehmer<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die in <strong><strong>de</strong>r</strong> Datensammlung zur Betriebsplanung Landwirtschaft ausgewiesenen<br />
Preise für Dienstleistungen vom Lohnunternehmer sind nicht aktuell und<br />
weisen eine sehr große Bandbreite auf. Diese resultiert wahrscheinlich aus<br />
unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Die Effekte <strong><strong>de</strong>r</strong> Einsatzbedingungen<br />
auf <strong>de</strong>n Preis <strong><strong>de</strong>r</strong> Dienstleistung müssen quantifiziert und beschrieben wer<strong>de</strong>n.<br />
Eine Aktualisierung ist notwendig.<br />
Preise für Dienstleistungen von Lohnunternehmern, die landwirtschaftliche<br />
Arbeitsverfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Außenwirtschaft durchführen, wer<strong>de</strong>n erhoben. Dabei<br />
müssen jeweils die Abrechnungsmodalitäten beschrieben wer<strong>de</strong>n, so zum<br />
Beispiel Mischkalkulationen aus bearbeiteter Fläche und <strong><strong>de</strong>r</strong> dazu benötigten<br />
Zeit.<br />
- Beitrag zur <strong>KTBL</strong>-Datenbank<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Rendsburg<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> „Kalkulationsunterlagen (KU)“<br />
Dr. J. O. Schroers<br />
28
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. EN 2.6.1.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Projektlaufzeit Seit 2/2010<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Um neu entwickelte Techniken in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis zu etablieren, ist eine zielgruppengerechte<br />
Aufbereitung <strong><strong>de</strong>r</strong> vorhan<strong>de</strong>nen Informationen notwendig. Vor<br />
allem die Bereitstellung von belastbaren arbeits- und betriebswirtschaftlichen<br />
Daten sowie eine Technikbewertung und eine Darstellung <strong>de</strong>s Stan<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Technik sind für die Antizipation erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft Energie <strong>de</strong>finiert und koordiniert die zu bearbeiten<strong>de</strong>n<br />
Themenschwerpunkte. Sie ruft Arbeitsgruppen ins Leben, die die jeweiligen<br />
Themen bearbeiten. Neue Entwicklungen wer<strong>de</strong>n begleitet und die Informationen<br />
für die <strong>KTBL</strong>-Zielgruppen aufbereitet.<br />
Hauptausschuss<br />
W. Eggersglüß Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,<br />
Rendsburg<br />
C. Gers-Grapperhaus Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
G. Hack Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
Dr. G. Höher<br />
Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsisches Ministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft, Verbraucherschutz<br />
und Lan<strong>de</strong>sentwicklung, Hannover<br />
U. Keymer (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
Dr.-Ing. B. Krautkremer<br />
Fraunhofer-Institut für Win<strong>de</strong>nergie und<br />
Systemtechnik, Kassel<br />
K. Mastel Landwirtschaftliches Technologiezentrum<br />
Augustenberg, Rheinstetten<br />
Dr. H. Oechsner<br />
Dr.-Ing. G. Reinhold<br />
Dr. B. Widmann<br />
Universität Hohenheim, Lan<strong>de</strong>sanstalt für<br />
Agrartechnik und Bioenergie, Stuttgart<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
Technologie und För<strong><strong>de</strong>r</strong>zentrum, Straubing<br />
BMELV-Vertreter C. Böttger Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
S. Hartmann<br />
29
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. EN 2.6.2.5<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 19.03.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.11.2013<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Durch das novellierte EEG, dass Anfang <strong>de</strong>s Jahres 2012 in Kraft getreten<br />
ist, bieten sich neue Möglichkeiten und zum Teil auch Pflichten für die bedarfsgerechte<br />
Stromeinspeisung und die Direktvermarktung von Biogasstrom.<br />
Für eine zielgerichtete und effektive Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Regelungen<br />
im Bereich Biogas ist eine fachliche Unterstützung notwendig.<br />
Ziel ist es, Anlagenbetreibern technische, rechtliche und ökonomische Informationen<br />
zur Direktvermarktung von Biogasstrom und zur bedarfsgerechten<br />
Stromerzeugung zur Verfügung zu stellen, um die Entscheidung zur Teilnahme<br />
an <strong><strong>de</strong>r</strong> Stromdirektvermarktung zu erleichtern.<br />
- In einem <strong>KTBL</strong>-Heft wer<strong>de</strong>n für die Anwendung <strong><strong>de</strong>r</strong> im Rahmen <strong>de</strong>s novellierten<br />
EEG geschaffenen Formen <strong><strong>de</strong>r</strong> Direktvermarktung inkl. Marktprämie<br />
und Flexibilitätsprämie alle notwendigen Informationen zusammengestellt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
Dr. M. De<strong><strong>de</strong>r</strong>er<br />
Staatl. Biogasberatung, LSZ, Boxberg<br />
C. Gers-Grapperhaus Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Dr. W. Gruber<br />
Dr. K. Jäkel<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Leipzig<br />
U. Keymer (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
Dr.-Ing. G. Reinhold<br />
S. Hartmann<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
30
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Ringversuch zur Vergleichbarkeit von Biogaserträgen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. EN 2.6.2.7<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 12.03.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.06.2014<br />
Auftraggeber<br />
Projektpartner<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Für die Auslegung und betriebliche Optimierung von Biogasanlagen wer<strong>de</strong>n<br />
im Allgemeinen Daten aus Gärversuchen zusammen mit Informationen und<br />
Erfahrungswissen aus vorhan<strong>de</strong>nen Anlagen herangezogen. Die Ergebnisse<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> bisher im Labor durchgeführten Gärversuche sind zur Ermittlung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Gaserträge nicht ohne weiteres vergleichbar, da oft unterschiedliche Versuchsbedingungen<br />
zugrun<strong>de</strong> gelegt wer<strong>de</strong>n und bestimmte Begriffe bisher<br />
z.T. nicht klar voneinan<strong><strong>de</strong>r</strong> abgegrenzt sind.<br />
In Zusammenarbeit mit <strong><strong>de</strong>r</strong> VDLUFA Qualitätssicherung NIRS GmbH führt<br />
das <strong>KTBL</strong> erneut einen Ringversuch Biogaserträge mit verschie<strong>de</strong>nen im<br />
Biogasbereich etablierten Laboren durch, um die Ergebnisse von Gärversuchen<br />
besser vergleichbar zu machen und um Ursachen für Abweichungen in<br />
<strong>de</strong>n Messergebnissen bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestimmung von Biogaserträgen zu bestimmen.<br />
Mit <strong>de</strong>m Ringversuch wer<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>m qualitativen Vergleich <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Labore auch die praktische Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong> VDLUFA-Metho<strong>de</strong>nvorschrift<br />
„Bestimmung <strong><strong>de</strong>r</strong> Biogas- und Methanausbeute in Gärtests“ geprüft, die zur<br />
einfacheren Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong> VDI-Richtlinie 4630 entwickelt wur<strong>de</strong>. Am En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s <strong>Projekte</strong>s steht eine sachliche Grundlage zur Optimierung und Standardisierung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> verwen<strong>de</strong>ten Analysemetho<strong>de</strong>n zur Verfügung. Des Weiteren<br />
wer<strong>de</strong>n neuere Daten zu Biogaserträgen aus Laborversuchen zusammengetragen<br />
und Richtwerte für Gaserträge verschie<strong>de</strong>ner Substrate aktualisiert.<br />
- Daten- und Metho<strong>de</strong>ngrundlage für zukünftige Neuauflage <strong>de</strong>s Gasertragsheftes<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
VDLUFA Qualitätssicherung NIRS GmbH, Kassel<br />
Dr. M. Bischoff<br />
Dr. J. Clemens<br />
LUFA Nord-West, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Gewitra mbH, Troisdorf<br />
G. Meißauer Schmack Biogas AG, Schwandorf<br />
Dr. H. Oechsner<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
H. Schelle Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim<br />
e.V., Potsdam<br />
Dr. P. Tillmann<br />
Dr. A. Weber<br />
VDLUFA Qualitätssicherung NIRS GmbH, Kassel<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing-Grub<br />
BMELV-Vertreter C. Böttger Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
M. Sta<strong>de</strong>lmann<br />
31
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Vergleichskennzahlen Energieeffizienz<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. EN 2.6.2.10<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Für <strong>de</strong>n Vergleich und die Bewertung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren<br />
in Bezug auf <strong>de</strong>n effizienten Einsatz von Energie stehen bisher lediglich<br />
kumulierte Verbrauchsdaten zur Verfügung, aus <strong><strong>de</strong>r</strong>en Analyse keine Empfehlungen<br />
für eine Effizienzsteigerung abgeleitet wer<strong>de</strong>n können. Dabei ist<br />
die Datenlage für Energieverbrauchsdaten in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft sehr unterschiedlich.<br />
Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e für die Innenwirtschaft liegen <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit nur aggregierte<br />
Daten vor, die keine gezielte Beratung zur Effizienzsteigerung zulassen.<br />
Es fehlt die Datengrundlage, um für die in <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Online-Anwendung<br />
„Baukost“ <strong>de</strong>finierten Stallmo<strong>de</strong>lle abgesicherte Energiebedarfswerte angeben<br />
zu können. Für die Außenwirtschaft ist die Datenlage bereits relativ gut,<br />
sodass sich die Arbeitsgruppe zunächst auf die Innenwirtschaft beschränken<br />
wird.<br />
Ziel ist es, Energieeffizienz-Kennzahlen bereitzustellen, um Beratung und<br />
Praxis zu ermöglichen, <strong>de</strong>n Energieverbrauch in <strong>de</strong>finierten Bereichen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
landwirtschaftlichen Produktionsverfahren zu vergleichen und zu bewerten.<br />
Für die verschie<strong>de</strong>nen Energieverbraucher in <strong><strong>de</strong>r</strong> Innenwirtschaft wer<strong>de</strong>n<br />
Metho<strong>de</strong>n zur Abschätzung <strong>de</strong>s Energiebedarfs entwickelt Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n<br />
damit Grundlagen für die Bewertung von Kosten und Nutzen effizienzsteigern<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Maßnahmen erarbeitet. Die Arbeitsgruppe trägt die verfügbaren<br />
mo<strong>de</strong>llhaften Ansätze zur Ermittlung <strong>de</strong>s Energiebedarfs in <strong><strong>de</strong>r</strong> Innenwirtschaft<br />
zusammen und wird aufzeigen, wo Wissenslücken bestehen und wie<br />
diese geschlossen wer<strong>de</strong>n können.<br />
- Die Kennzahlen zum Energiebedarf wer<strong>de</strong>n in einem <strong>KTBL</strong>-Heft zusammengefasst.<br />
Planungsbeginn 05.07.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.03.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
Dr.-Ing. W. Berg<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e. V., Potsdam<br />
N. Binger Maschinenringe Deutschland GmbH, Neuburg<br />
Dr. T. Böhm<br />
EWE Energie AG, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Prof. Dr. W. Büscher<br />
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität<br />
Bonn, Bonn<br />
B. Feller Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
H. Kämper (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) AEL Arbeitsgemeinschaft für Elektrizitätsanwendung<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft e.V., Berlin<br />
Dr. Ing. B. Krautkremer Fraunhofer-Institut für Win<strong>de</strong>nergie und Systemtechnik,<br />
Kassel<br />
J. Neiber Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
R. Pommer Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Köllitsch<br />
W. Schmid Lan<strong>de</strong>sanstalt für Entwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> ländlichen Räume, Schwäbisch<br />
Gmünd<br />
H. Eckel<br />
32
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Neuauflage <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Publikation „Faustzahlen Biogas“ (3. Ausgabe)<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. EN 2.6.4.22<br />
Problemstellung Die Biogasbranche ist auf zuverlässige Daten angewiesen. Die seit 2007<br />
vom <strong>KTBL</strong> veröffentlichten Faustzahlen Biogas sind eine anerkannte und<br />
etablierte Informationsquelle. Aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> stetigen Weiterentwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Biogastechnologie sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> sich än<strong><strong>de</strong>r</strong>n<strong>de</strong>n rechtlichen wie ökonomischen<br />
Rahmenbedingungen ist die regelmäßige Anpassung an <strong>de</strong>n aktuellen Entwicklungsstand<br />
notwendig.<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 29.09.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 13.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Informationen zur Entwicklung <strong>de</strong>s Biogassektors, die technischbiologischen<br />
Grundlagen, die Aspekte <strong><strong>de</strong>r</strong> Biogaserzeugung und -nutzung,<br />
die Substratbereitstellung, die Gärrestverwertung, die Wirtschaftlichkeit und<br />
die ökologische Betrachtung wer<strong>de</strong>n aktualisiert.<br />
- Spezial-Faustzahlen mit aggregierten, allgemeingültigen Daten zur Biogaserzeugung.<br />
Nachschlagewerk zu Betriebswirtschaft und Produktionstechnik<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
M. Paterson<br />
33
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
<strong>KTBL</strong>/FNR Biogaskongress „Biogas in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft - Stand und<br />
Perspektiven“ 2013<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. EN 2.6.4.24<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 03.02.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 20.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Projektpartner<br />
Die Ziele <strong><strong>de</strong>r</strong> Bun<strong>de</strong>sregierung verfolgen nicht nur <strong>de</strong>n weiteren Ausbau <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
erneuerbaren Energien, auch eine jährliche Steigerung <strong><strong>de</strong>r</strong> Energieproduktivität<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> Effizienz <strong><strong>de</strong>r</strong> Energieerzeugung ist Gegenstand <strong>de</strong>s nationalen<br />
Energie- und Klimaprogramms. Biogas hat sich in <strong><strong>de</strong>r</strong> hiesigen Energieproduktion<br />
etabliert und leistet bereits heute einen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Beitrag zur<br />
nachhaltigen Energiebereitstellung in Deutschland. Der Informationsbedarf<br />
zum Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik und neuen Entwicklungen ist anhaltend hoch. Die<br />
Fachagentur Nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe e. V. und das <strong>KTBL</strong> haben sich mit<br />
ihren gemeinsamen Biogas-Kongressen 2009 und 2011 erfolgreich positioniert.<br />
Im Jahr 2013 ist die dritte Veranstaltung geplant.<br />
Ziel <strong><strong>de</strong>r</strong> Veranstaltung ist, die neuesten Entwicklungen im Bereich Biogasproduktion<br />
und -nutzung aus Wissenschaft und Praxis vorzustellen und zu<br />
diskutieren.<br />
- Der 3. gemeinsame FNR/<strong>KTBL</strong> Fachkongress "Biogas in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
- Stand und Perspektiven" wird die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />
zum Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik und Perspektive <strong><strong>de</strong>r</strong> Biogasnutzung in<br />
Deutschland vorstellen. Der Kongress wird am 10. und 11. September in<br />
Kassel stattfin<strong>de</strong>n.<br />
- Der Tagungsband wird ca. 30 Fachbeiträge <strong>de</strong>s Biogas-Kongresses "Biogas<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft" und bis zu 60 Kurzfassungen <strong><strong>de</strong>r</strong> ausgestellten<br />
Posterbeiträge beinhalten.<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
Fachagentur Nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe e.V.<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>s Programmausschusses<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. W. Gruber<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
U. Keymer Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
München<br />
Dr.-Ing, J. Liebetrau<br />
Prof. Dr.-Ing. B. Linke<br />
Dr. H. Oechsner<br />
Dr.-Ing. G. Reinhold<br />
Deutsches Biomasseforschungszentrum,<br />
Leipzig<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e.V., Potsdam<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
D. Riesel Fachagentur Nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />
e. V., Gülzow<br />
Dr. P. Schüsseler<br />
M. Paterson<br />
Fachagentur Nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />
e. V., Gülzow<br />
34
Arbeitsschwerpunkt Energie<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
MONA – Monitoring <strong>de</strong>s Biomethanprozesses<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. EN 2.6.2.30<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.05.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.10.2014<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Projektpartner<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Derzeit speisen Biogasanlagen ca. 5 % <strong>de</strong>s aus landwirtschaftlichen Substraten<br />
erzeugten Biogases als Biomethan in das Erdgasnetz ein. Die Erzeugung<br />
von Biomethan bietet Potenziale für die Energiewen<strong>de</strong> und landwirtschaftlichen<br />
Betrieben Einkommensalternativen. Im Forschungsvorhaben<br />
MONA wer<strong>de</strong>n zu diesem Zweck die Biogasaufbereitungstechniken zur Einspeisung<br />
von Biogas in das Erdgasnetz o<strong><strong>de</strong>r</strong> zur Nutzung als Treibstoff hinsichtlich<br />
ihrer Umweltwirkungen, Wirtschaftlichkeit und Technik sowie ihres<br />
Betriebs bewertet.<br />
Das <strong>KTBL</strong> gewährleistet im Verbundprojekt <strong>de</strong>n Wissenstransfer. Es erarbeitet<br />
ein wissenschaftlich fundiertes Berechnungsinstrument, welches die Forschungsergebnisse<br />
für die Praxis anwen<strong><strong>de</strong>r</strong>freundlich zur Verfügung stellt.<br />
Der Schritt zur Installation von geeigneten Biogasaufbereitungsanlagen zur<br />
Einspeisung von Biomethan in Erdgasnetze wird für <strong>de</strong>n Bauherrn verkürzt<br />
und erleichtert. Darüber hinaus wer<strong>de</strong>n die bisherigen Erfahrungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlagenbetreiber<br />
zusammengetragen und <strong><strong>de</strong>r</strong> Forschungs- und Handlungsbedarf<br />
festgestellt. Das Tool dient Marktakteuren.<br />
- Der <strong>KTBL</strong>-Wirtschaftlichkeitsrechner Biogas wird um das Modul Gaseinspeisung<br />
erweitert. Das Modul ermöglicht die wirtschaftliche Planung eines<br />
Einspeiseprojektes sowie <strong>de</strong>n Vergleich zur Vor-Ort-Verstromung. Die<br />
Nutzung ist kostenfrei.<br />
- Einrichtung und Betrieb einer Internetpräsenz. Auf <strong><strong>de</strong>r</strong> erstellten Homepage<br />
wird das Projekt vorgestellt, die Kontaktdaten <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektpartner angegeben<br />
und eine Verlinkung auf die Website <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektpartner eingerichtet.<br />
- Ein Fachgespräch dient <strong>de</strong>m Erfahrungsaustausch zwischen <strong>de</strong>n im Projekt<br />
beteiligten Anlagenbetreibern. Die Ergebnisse wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Auftraggeber<br />
und <strong>de</strong>n Teilnehmern in einem Abschlussbericht dokumentiert. 2<br />
halbe Tage, einzügig, ca. 20 Teilnehmer, national<br />
Arbeitsgemeinschaft Energie (EN)<br />
73.674 €, Fachagentur Nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />
B. Wirth<br />
Deutsches Biomasseforschungszentrum<br />
gemeinnützige GmbH, Leipzig<br />
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheitsund<br />
Energietechnik, Oberhausen<br />
Fraunhofer-Institut für Win<strong>de</strong>nergie und Systemtechnik,<br />
Kassel<br />
Universität Stuttgart, Leinfel<strong>de</strong>n-<br />
Echterdingen<br />
Physikalisch-Technische Bun<strong>de</strong>sanstalt,<br />
Braunschweig<br />
35
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Projektlaufzeit Seit 2/2010<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Im Rahmen von internationalen Verpflichtungen zum Atmosphären- und Klimaschutz<br />
wer<strong>de</strong>n zunehmend Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an die Landwirtschaft zur<br />
Quantifizierung und Reduzierung von Ammoniak- und Treibhausgasemissionen<br />
gestellt. Neben <strong><strong>de</strong>r</strong> Berichterstattung über die quantitativen Emissionen<br />
erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>t dies auch die ökologisch/ökonomische Bewertung von Maßnahmen<br />
und Produktionsverfahren, um sowohl für die Politik als auch für<br />
Anwen<strong><strong>de</strong>r</strong> und Industrie Optionen für eine bezahlbare Emissionsreduzierung<br />
aufzuzeigen.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft soll die fachlichen Grundlagen zur Unterstützung<br />
politischer Entscheidungsprozesse legen mit <strong>de</strong>m Ziel einer kosteneffizienten<br />
Reduzierung von Emissionen. Schwerpunkte hierbei sind:<br />
Ermittlung und Abstimmung von Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren als<br />
Eingangsgrößen zur Berechnung von Emissionsinventaren<br />
Unterstützung für die Weiterentwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong> Berechnungsmo<strong>de</strong>lle zum<br />
nationalen Emissionsinventar (insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Emissionsfaktoren)<br />
Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Effizienz und Kosten von Maßnahmen zur Reduzierung<br />
von Emissionen und Stoffausträgen aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft über Betriebsund<br />
Sektormo<strong>de</strong>lle (Lebensweg-Bilanzen)<br />
Fachliche Unterstützung von Entscheidungsprozessen in Politik, Beratung,<br />
Praxis und Industrie<br />
Grundlage <strong><strong>de</strong>r</strong> Einrichtung <strong>de</strong>s Arbeitsschwerpunktes ist ein Vertrag <strong>de</strong>s<br />
<strong>KTBL</strong> mit <strong>de</strong>m Thünen-Institut (TI) im Auftrag <strong>de</strong>s BMELV. Laufzeit zunächst<br />
bis 31.12.2013.<br />
Hauptausschuss<br />
Dr. B. Amon<br />
Prof. Dr. H. Flessa<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. G. Gaillard<br />
Prof. Dr. A. Heißenhuber<br />
Dr. L. Leible<br />
Leibniz Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e. V, Potsdam<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Zürich (Schweiz)<br />
Technische Universität München, Freising<br />
Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe<br />
B. Osterburg Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Prof. Dr. F. Taube<br />
Prof. Dr. Ir. H. Van <strong>de</strong>n<br />
Weghe<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel<br />
Georg-August-Universität Göttingen, Vechta<br />
BMELV-Vertreter Dr. J. Kalisch Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. S. Wulf<br />
36
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Emissionsfaktoren Tierhaltung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.2.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Erstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen Emissionsinventare sind die Eingangsdaten<br />
und die Metho<strong>de</strong>n zur Emissionsermittlung fortlaufend zu verbessern.<br />
Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Emissionsfaktoren für Tierhaltungsverfahren sind eine wesentliche<br />
Grundlage zur Berechnung von Emissionen sowohl im Rahmen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> nationalen Emissionsberichterstattung, als auch für die Beurteilung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Umweltwirkung von Stallbauvorhaben in Genehmigungsverfahren. Hierzu<br />
wer<strong>de</strong>n vergleichbare und repräsentative Emissionsfaktoren benötigt.<br />
Es wer<strong>de</strong>n abgestimmte Emissionsfaktoren für Ammoniak, Lachgas, Methan<br />
und Staub für <strong>de</strong>n Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong> Tierhaltungsverfahren erarbeitet. Darüber<br />
hinaus wer<strong>de</strong>n effektive Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsmöglichkeiten für die genannten Emissionen<br />
aufgezeigt und nach Möglichkeit auch quantifiziert. Die Ergebnisse<br />
dienen <strong><strong>de</strong>r</strong> Qualitätsverbesserung <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen Emissionsinventare<br />
und ermöglichen gezielte Prognosen hinsichtlich <strong><strong>de</strong>r</strong> Emissionsmin<strong><strong>de</strong>r</strong>ung.<br />
Zu<strong>de</strong>m erstellt die Arbeitsgruppe Messprotokolle für zwangsgelüftete und<br />
offene Ställe zur Ermittlung vergleichbarer und repräsentativer Emissionsfaktoren.<br />
- Aktualisierte Emissionsfaktoren für Tierhaltung als Beitrag für die landwirtschaftlichen<br />
Emissionsinventare.<br />
Planungsbeginn 01.01.2008<br />
(begleiten<strong>de</strong> Arbeitsgruppe zum Emissionsinventar, siehe Projekt KS<br />
2.11.4.1)<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.06.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS)<br />
Dr. B. Amon<br />
Dr. W. Berg<br />
Dr. E. Gallmann<br />
Dr. H.-D. Haenel<br />
Prof. Dr. E. Hartung<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e.V., Potsdam<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e.V., Potsdam<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel<br />
T. Hei<strong>de</strong>nreich Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Landwirtschaft,<br />
Umwelt und Geologie, Köllitsch<br />
Dr. M. Keck<br />
Dr. S. Neser<br />
Prof. Dr. J. Seedorf<br />
Prof. Dr. Ir. H. Van <strong>de</strong>n<br />
Weghe (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. B. Eurich-Men<strong>de</strong>n<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
Georg-August-Universität Göttingen, Vechta<br />
37
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Klimaschutz in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.2.2<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
14 % <strong><strong>de</strong>r</strong> Treibhausgasemissionen in Deutschland sind auf die Landwirtschaft<br />
zurückzuführen. Wichtige Stellschrauben zur Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung <strong><strong>de</strong>r</strong> Emissionen<br />
sind das Wirtschaftsdüngermanagement, hier v.a. eine emissionsarme<br />
Wirtschaftsdüngerlagerung, eine optimierte Stickstoffdüngung sowie eine<br />
humuskonservieren<strong>de</strong> Bewirtschaftung. Diese Ansätze wer<strong>de</strong>n in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis<br />
allerdings zum Teil noch nicht ausreichend verfolgt. Neben Tierhaltung und<br />
Pflanzenproduktion bieten auch die Bereitstellung bzw. die Einsparung von<br />
Energie zusätzliche Möglichkeiten zur Treibhausgasmin<strong><strong>de</strong>r</strong>ung.<br />
Die wichtigsten Ansatzpunkte zur Reduzierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Treibhausgasemissionen<br />
aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft wer<strong>de</strong>n für die Tierhaltung, Pflanzenproduktion und<br />
Energiebereitstellung/-einsatz hinsichtlich Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ungspotenzial, Umsetzbarkeit<br />
sowie <strong>de</strong>n damit verbun<strong>de</strong>nen Kosten gegenübergestellt. Die Ergebnisse<br />
wer<strong>de</strong>n für die landwirtschaftliche Praxis aufbereitet und transparent gemacht.<br />
- Heft mit Beschreibung und Bewertung praxistauglicher Maßnahmen zur<br />
Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung von Treibhausgasemissionen in allen Bereichen <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen<br />
Praxis.<br />
Planungsbeginn 01.11.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS)<br />
Dr. U. Bergfeld<br />
Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Köllitsch<br />
H. Böcker Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum<br />
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad Kreuznach<br />
Prof. Dr. W. Büscher<br />
Prof. Dr. H. Flessa<br />
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität,<br />
Bonn<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
A. Lasar Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
H. Schmid Technische Universität München, München<br />
Prof. Dr. K-H. Sü<strong>de</strong>kum<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Prof. Dr. F. Taube<br />
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität,<br />
Bonn<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel<br />
BMELV-Vertreter Dr. A. Täuber Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Berlin<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
U. Roth<br />
38
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Erstellung von Emissionsinventaren für Stickstoff und Kohlenstoff aus <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
<strong>de</strong>utschen Landwirtschaft<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.4.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 23.08.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Unterzeichnung mehrerer internationaler Vereinbarungen hat sich<br />
Deutschland verpflichtet, in regelmäßigem Turnus Bericht über die Emissionen<br />
klimawirksamer Gase und an<strong><strong>de</strong>r</strong>er Umwelt belasten<strong><strong>de</strong>r</strong> Komponenten<br />
aller Verursacherbereiche einschließlich <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft zu erstatten. Die<br />
Berichterstattung unterliegt mittlerweile strengen Qualitätskriterien, <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Nichteinhaltung o<strong><strong>de</strong>r</strong> Nichterfüllung zu drastischen Sanktionen für die Bun<strong>de</strong>srepublik<br />
führt. Die Verantwortlichkeit für die Berichterstattung liegt beim<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Umwelt. Den Verpflichtungen folgend nehmen die<br />
Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelaufgaben und ihre Bearbeitungstiefe zumin<strong>de</strong>st mittelfristig<br />
(5 bis 10 Jahre) ständig zu.<br />
<strong>KTBL</strong> und vTI bereiten gemeinsam Datensätze zu Emissionen aus <strong>de</strong>m<br />
landwirtschaftlichen Sektor für die unterschiedlichen Abkommen so vor, dass<br />
sie in die vorgegebenen Berichtsformate übernommen wer<strong>de</strong>n können.<br />
Daneben dient das Projekt <strong><strong>de</strong>r</strong> I<strong>de</strong>ntifizierung und Quantifizierung von emissionsmin<strong><strong>de</strong>r</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft sowie Quantifizierung<br />
von Kosten. Hierzu wer<strong>de</strong>n Bilanzierungsmo<strong>de</strong>lle in Form von Verfahrens-<br />
und Betriebsmo<strong>de</strong>llen erstellt, die zu ökonomisch-ökologischen Analysen<br />
verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n können.<br />
- Jährlicher <strong>KTBL</strong>-Anteil an <strong><strong>de</strong>r</strong> Emissionsberichterstattung (Thünen Report<br />
„Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>utschen<br />
Landwirtschaft“).<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,<br />
Bonn (vertreten durch Thünen-Institut, Braunschweig)<br />
492.000 €/Jahr, Thünen-Institut<br />
Dr. S. Wulf<br />
39
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Integrierte Stickstoff-Bilanzierung<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.4.13<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 24.08.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 28.02.2014<br />
Auftraggeber<br />
Von <strong><strong>de</strong>r</strong> Bun<strong>de</strong>sregierung wur<strong>de</strong> 2002 die nationale Nachhaltigkeitsstrategie<br />
unter <strong>de</strong>m Titel "Perspektiven für Deutschland" beschlossen. Das Konzept<br />
dient als Handlungsanleitung für eine umfassen<strong>de</strong> zukunftsfähige Politik. Im<br />
Sinne einer Nachhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen Produktionssystemen<br />
müssen die Emissionen von Produktionsweisen und -verfahren<br />
miteinan<strong><strong>de</strong>r</strong> verglichen wer<strong>de</strong>n. Für diesen Vergleich sind Bilanzierungsmo<strong>de</strong>lle<br />
erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich. Die Emissionen müssen bezogen auf unterschiedliche<br />
Größen bilanziert wer<strong>de</strong>n, etwa je Landfläche o<strong><strong>de</strong>r</strong> je Produkteinheit. Weiter<br />
sind für eine Nachhaltigkeitsstrategie naturräumliche und an<strong><strong>de</strong>r</strong>e regionale<br />
Unterschie<strong>de</strong> zu berücksichtigen. Sie sind in <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llen mit abzubil<strong>de</strong>n.<br />
Vorhan<strong>de</strong>ne Datensätze und Mo<strong>de</strong>llansätze zu Produktionsverfahren im<br />
Ackerbau und in <strong><strong>de</strong>r</strong> Milchviehhaltung wer<strong>de</strong>n anhand von Beispielbetrieben<br />
vervollständigt und weiterentwickelt. Die Spreizung <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktionsziele und<br />
Produktionsverfahren wird abgebil<strong>de</strong>t, in<strong>de</strong>m auf Einzelbetrieben und aus<br />
Langzeitversuchen gewonnene Daten aggregiert in die Mo<strong>de</strong>llstrukturen eingebaut<br />
wer<strong>de</strong>n. Eine Typisierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Agrarregionen wird durchgeführt, um für<br />
die Mo<strong>de</strong>llbetriebe abzuleiten, welche Form <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktion für die jeweiligen<br />
Standortbedingungen <strong>de</strong>n ökologischen Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an nachhaltiges Wirtschaften<br />
am ehesten gerecht wird. Die Schwerpunkte <strong><strong>de</strong>r</strong> Berechnungen liegen<br />
auf N-Emissionen in das Grundwasser sowie klimawirksame C- und N-<br />
Emissionen in die Atmosphäre. Die Berechnungen zu Produktionskosten ermöglichen<br />
erste Aussagen für die standortangepassten Emissionsmin<strong><strong>de</strong>r</strong>ungskosten.<br />
- Die <strong>Projekte</strong>rgebnisse wer<strong>de</strong>n im Rahmen eines Workshops mit Vertretern<br />
aus Wissenschaft, landwirtschaftlicher Praxis und Politik diskutiert, um strategische<br />
Ansätze zu Umsetzung zu entwickeln.<br />
- Gemäß Projektantrag wer<strong>de</strong>n in einem Abschlussbericht für <strong>de</strong>n Auftraggeber<br />
Ziel und Methodik beschrieben sowie die Ergebnisse zusammengefasst.<br />
Handlungs- und Forschungsbedarf wer<strong>de</strong>n aufgezeigt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS)<br />
Auftragnehmer B. Osterburg Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Dr. F. Wendland<br />
Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich<br />
Projektpartner Prof. Dr. A. Heißenhuber Technische Universität München, München<br />
Drittmittel<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. G. Wechsung<br />
237.874 €, Umweltbun<strong>de</strong>samt<br />
Dr. R. Vandré<br />
Umweltbun<strong>de</strong>samt, Dessau-Roßlau<br />
40
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
GÄRWERT – GÄRprodukte ökologisch optimiert und WERTorientiert aufbereiten<br />
und vermarkten<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.4.14<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.10.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.09.2016<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Gärprodukte aus Biogasanlagen wer<strong>de</strong>n zunehmend nicht vom Anlagenbetreiber<br />
selbst, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n von Dritten verwertet. Durch die Aufbereitung von<br />
Gärresten können das Transportvolumen reduziert und ergänzen<strong>de</strong> Vermarktungsmöglichkeiten<br />
erschlossen wer<strong>de</strong>n. Eine verbesserte Nährstoffnutzung<br />
ist möglich. Allerdings sind Aufbereitungsverfahren häufig energieaufwändig.<br />
Die durch <strong>de</strong>n Energiebedarf bedingten Emissionen, sowie direkte<br />
Emissionen, die durch die Lagerung und Handhabung <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufbereitungsprodukte<br />
entstehen, sind <strong>de</strong>n positiven Effekten <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutzung von Aufbereitungsprodukten<br />
gegenüberzustellen.<br />
In <strong>de</strong>m Verbundprojekt wer<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne Verfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Gärrestaufbereitung<br />
hinsichtlich technischer, ökonomischer und ökologischer Aspekte bewertet<br />
und geeignete Nutzungspfa<strong>de</strong> für unterschiedliche Ausgangsmaterialien<br />
und Rahmenbedingungen beschrieben. Das <strong>KTBL</strong> übernimmt die Aufgabe,<br />
die Stoffflüsse und Emissionen zu bilanzieren und die Verfahren bezüglich<br />
ihrer Treibhausgasemissionen zu bewerten. Das zu erstellen<strong>de</strong> Berechnungsmo<strong>de</strong>ll<br />
soll geeignet sein, Randbedingungen und Parameter zu<br />
variieren und somit Sensitivitätsanalysen durchzuführen, z. B. hinsichtlich<br />
Gärrestmengen, Transportentfernungen und Nährstoff- bzw. Trockenmassegehalte<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Gärreste. Für die Bilanzierung wird auf Mess- und Erhebungsgrößen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Projektpartner sowie auf <strong>KTBL</strong>-Grunddaten zurückgegriffen.<br />
- Die Ergebnisse wer<strong>de</strong>n in einem Abschlussbericht für <strong>de</strong>n Auftraggeber<br />
zusammengestellt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS)<br />
58.234 €, Fachagentur Nachwachsen<strong>de</strong> Rohstoffe<br />
Projektpartner 2 Prof. Dr. C. Herbes Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen,<br />
Nürtingen<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Prof. Dr.-Ing. M. Kraume<br />
Prof. Dr. T. Müller<br />
Prof. Dr. C. Pekrun<br />
Dr. S. Wulf<br />
Technische Universität Berlin, Berlin<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen,<br />
Nürtingen<br />
2 Arbeitsgruppe hat sich noch nicht konstituiert, Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong> ist noch nicht gewählt.<br />
41
Arbeitsschwerpunkt Klimaschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Aktualisierung <strong>de</strong>s Frameworkco<strong>de</strong>s "Good Agricultural Practice" im Rahmen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Task Force on Reactive Nitrogen (TFRN) <strong><strong>de</strong>r</strong> United Nations Economic<br />
Commission for Europe (UNECE)<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. KS 2.11.4.15<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 11.03.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Das im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Genfer Luftreinhaltekonvention (CLRTAP) 1999 beschlossene<br />
und 2012 revidierte Göteburg-Protokoll reguliert unter an<strong><strong>de</strong>r</strong>em<br />
Ammoniak-Emissionen aus landwirtschaftlichen Quellen. Mit <strong>de</strong>m Göteburg-<br />
Protokoll verpflichten sich die Unterzeichner auf Basis eines Referenzdokuments,<br />
<strong>de</strong>m Framework Co<strong>de</strong> "Good Agricultural Practice" (FC GAP), Leitlinien<br />
für die gute fachliche Praxis zu verabschie<strong>de</strong>n. Die Leitlinien richten<br />
sich an Behör<strong>de</strong>n, Berater und die Landwirte.<br />
Die UNECE Expertengruppe TFRN hat die Revision <strong>de</strong>s seit 2001 gültigen<br />
FC GAP beschlossen. Auf Bitten <strong><strong>de</strong>r</strong> TFRN soll das <strong>de</strong>utsche Umweltbun<strong>de</strong>samt<br />
(UBA) kurzfristig <strong>de</strong>n vorhan<strong>de</strong>nen Entwurf <strong>de</strong>s FC GAP überarbeiten.<br />
Das UBA hat <strong>de</strong>m <strong>KTBL</strong> diese Aufgabe als Projekt übertragen.<br />
Der Entwurf <strong>de</strong>s FC GAP wird zur En<strong>de</strong> April 2013 stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Sitzung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> TFRN überarbeitet, mit <strong>de</strong>n Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong>n abgestimmt und in eine beschlussfähige<br />
Fassung überführt. Exemplarisch wird das Teilkapitel „Emissionsmin<strong><strong>de</strong>r</strong>ung<br />
bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern“, illustriert<br />
mit Fotos bzw. Grafiken, erarbeitet.<br />
Für die Politikberatung wer<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>s Diskussionstan<strong>de</strong>s<br />
in internationalen Gremien wie <strong><strong>de</strong>r</strong> Convention on Long-range Transboundary<br />
Air Pollution (CLRTAP) sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Industrial Emissions Directive (IED) und<br />
<strong>de</strong>s aktuellen Stan<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong> Wissenschaft <strong><strong>de</strong>r</strong> Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbedarf für das<br />
Guidance Document zum Annex IX <strong>de</strong>s Göteburg Protokolls beschrieben<br />
sowie Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsvorschläge für <strong>de</strong>n Annex IX formuliert.<br />
- Bericht an das Umweltbun<strong>de</strong>samt (UBA) mit Framework Co<strong>de</strong> und Handlungsempfehlungen<br />
zur Revision <strong>de</strong>s Annex IX.<br />
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz (KS)<br />
23.920 €, Umweltbun<strong>de</strong>samt<br />
Dr. S.Wulf<br />
42
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Zur Weiterentwicklung <strong>de</strong>s ökologischen Landbaus besteht Entwicklungsund<br />
För<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbedarf. Dazu müssen neue Entwicklungen aufgegriffen, ihre<br />
Wirkungen frühzeitig eingeschätzt und Handlungsbedarf <strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Weiterentwicklung umfasst neben <strong>de</strong>n Aspekten <strong><strong>de</strong>r</strong> pflanzlichen Produktion<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung auch soziale und ökonomische Arbeitsfel<strong><strong>de</strong>r</strong>,<br />
Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeits- und Prozessqualität sowie Produktsicherheit.<br />
Bereitstellen von Informationen für die Planung und Bewertung kompletter<br />
Produktionssysteme im Rahmen interdisziplinärer Systemvergleiche.<br />
Definition <strong>de</strong>s Stan<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft hat Arbeitsgruppen und weitere <strong>Projekte</strong> eingerichtet<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong>en Ergebnisse bewertet.<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. U. Klöble<br />
Projektlaufzeit Seit 4/2004<br />
Auftraggeber Hauptausschuss<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> J. Braun Freising<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Prof. Dr. K.-J. Hülsbergen Technische Universität München, Freising<br />
Prof. Dr. B. Hörning<br />
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung<br />
Eberswal<strong>de</strong>, Eberswal<strong>de</strong><br />
Dr. K. Kempkens<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
A. Meyercordt Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Hannover<br />
U. Prolingheuer Kompetenzzentrum Ökolandbau Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen<br />
GmbH, Visselhöve<strong>de</strong><br />
Prof. Dr. G. Rahmann Thünen-Institut, Westerau<br />
Dr. U. Schumacher<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft<br />
e.V., Berlin<br />
Dr. M. Stolze<br />
Forschungsinstitut für biologischen Landbau,<br />
Frick (Schweiz)<br />
Dr. K. Wiesinger<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Dr. K.-P. Wilbois<br />
Forschungsinstitut für biologischen Landbau,<br />
Frankfurt/M.<br />
Dr. U. Zerger<br />
Stiftung Ökologie & Landbau, Bad Dürkheim<br />
Gast D. Hahn Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und<br />
Ernährung, Bonn<br />
BMELV-Vertreter E. Bün<strong><strong>de</strong>r</strong> Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
43
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> im ökologischen Landbau zugelassenen Düngemittel<br />
Arbeitsgruppe, Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.2.4<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Im ökologischen Landbau wer<strong>de</strong>n neben Wirtschaftsdüngern betriebsfrem<strong>de</strong><br />
Düngemittel sowie Natur- und Hilfsstoffe eingesetzt. Die Zulassung dieser<br />
Stoffe ist in <strong><strong>de</strong>r</strong> EG-Öko-Basisverordnung (EG) Nr. 834/2007 bzw. Durchführungsverordnung<br />
(EG) Nr. 889/08 geregelt.<br />
Für Praxis und Beratung im Ökolandbau fehlen für viele dieser Stoffe umfassen<strong>de</strong><br />
Informationen zur Herkunft und stofflichen Zusammensetzung. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e<br />
für Ökobetriebe, die auf eine Zufuhr von externen Nährstoffen angewiesen<br />
sind, wer<strong>de</strong>n Entscheidungshilfen für <strong>de</strong>n Einsatz verschie<strong>de</strong>ner<br />
Dünger benötigt.<br />
Für eine Auswahl <strong><strong>de</strong>r</strong> nach o.g. EG-Öko-Verordnungen zugelassenen Rohstoffe<br />
und Düngemittel (ca. 25) ist eine Charakterisierung hinsichtlich <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Inhaltsstoffe sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Umweltverträglichkeit vorgenommen und darauf aufbauend<br />
sind Anwendungsempfehlungen für die Praxis zusammengestellt.<br />
- Erweiterung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Datenbank um organische NPK-Düngemittel mit<br />
Inhaltsstoffen und Anwendungsempfehlungen.<br />
- In einer <strong>KTBL</strong>-Schrift wer<strong>de</strong>n die wichtigsten organischen Han<strong>de</strong>lsdünger<br />
beschrieben sowie Anwendungsempfehlungen veröffentlicht.<br />
Planungsbeginn 02.12.2008<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Drittmittel<br />
161.821 €, Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Dr. Martin Bach<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Prof. Dr. K.-J. Hülsbergen Technische Universität München, Freising<br />
Dr. H. Kolbe<br />
Sächs. Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Leipzig<br />
E. Reiners Bioland e.V., Mainz<br />
H.-W. Schneichel<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord,<br />
Koblenz<br />
Dr. K. Severin<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Hannover<br />
Dr. K.-P. Wilbois<br />
Forschungsinstitut für biologischen Landbau,<br />
Frankfurt/M.<br />
Gäste Dr. H.-J. Reents Technische Universität München, Freising<br />
G. Semmler Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hesen, Kassel<br />
BMELV-Vertreter G. Embert Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. K. Möller<br />
44
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Faustzahlen Ökolandbau<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.2.5<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 22.02.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 03.04.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Der ökologische Landbau ist auf verlässliche Daten angewiesen. Bisher<br />
wur<strong>de</strong>n häufig aus Mangel an Alternativen Daten aus <strong>de</strong>m konventionellen<br />
Landbau als Basis herangezogen. Um das weitere Entwicklungspotenzial<br />
<strong>de</strong>s Ökolandbaus voll auszuschöpfen und seinen Ansprüchen gerecht zu<br />
wer<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n letzten Jahren viele Fragestellungen bearbeitet und<br />
Daten erarbeitet. Heute liegen diese in <strong><strong>de</strong>r</strong> Quantität vor, dass <strong><strong>de</strong>r</strong> rasche<br />
Überblick schwierig ist.<br />
Die Daten zum ökologischen Landbau sind gesichtet. Die wichtigsten Daten<br />
sind ausgewählt, aufbereitet und <strong>de</strong>n Entscheidungsträgern in einer leicht<br />
zugänglichen Form als aggregierte und allgemeingültige Faustzahlen zur<br />
Verfügung gestellt. Interessenten mit praxisnahen Fragen können auf ein<br />
handliches Nachschlagewerk zu Betriebswirtschaft und Produktionstechnik<br />
im ökologischen Landbau analog <strong><strong>de</strong>r</strong> vom <strong>KTBL</strong> in 14. Auflage herausgegebenen<br />
„Faustzahlen für die Landwirtschaft“ zurückgreifen.<br />
- Aggregierte, allgemeingültige Daten zum Ökolandbau in einem Nachschlagewerk<br />
zu Betriebswirtschaft und Produktionstechnik als Faustzahlenbuch.<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
U. Becherer Bioland Beratung Ost, Muschau<br />
Prof. Dr. A. M. Häring<br />
(Vorsitzen<strong>de</strong>)<br />
Hochschule für Nachhaltige Ent-wicklung,<br />
Eberswal<strong>de</strong><br />
M. Haugstätter Beratungsdienst Ökologischer Landbau e.<br />
V, Schwäbisch Hall<br />
J. Herrle Naturland Fachberatung, Seehausen<br />
Prof. Dr. G. Rahmann<br />
Dr. M. Stolze<br />
Thünen-Institut, Trenthorst<br />
Forschungsinstitut für biologischen Landbau,<br />
Frick (Schweiz)<br />
D. Werner Arc-Beratung-GbR, Schwanenfeld<br />
Dr. U. Williges<br />
Dr. U. Klöble<br />
Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hessen, Marburg<br />
45
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Behornte Tiere<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.2.6<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 18.02.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe 3<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die EG-Öko-Verordnungen verlangen seit 2008, dass behornte Tiere nicht<br />
routinemäßig, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n nur noch fallweise unter bestimmten Bedingungen<br />
enthornt wer<strong>de</strong>n dürfen. In <strong><strong>de</strong>r</strong> biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise<br />
wird ausdrücklich die Haltung behornter Rin<strong><strong>de</strong>r</strong> gefor<strong><strong>de</strong>r</strong>t. In <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis aller<br />
an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Ökobetriebe wird häufig enthornt. Zurzeit sind ca. 50 % aller<br />
Ökomilchviehbestän<strong>de</strong> enthornt. Vor allem sind Bestän<strong>de</strong> in Laufställen betroffen,<br />
da diese Ställe und das Management auf enthornte Tiere ausgerichtet<br />
sind. Wenn Tiere mit Hörnern in eine enthornte Her<strong>de</strong> integriert wer<strong>de</strong>n<br />
sollen, ist mit mehr Unruhe, Kämpfen und Verletzungen zu rechnen. Die<br />
Tierhalter befürchten Unfälle für die Tierbetreuer.<br />
Um die Vorschriften <strong><strong>de</strong>r</strong> EG-Öko-Verordnung umsetzen zu können, sollen<br />
Milchkuhhalter Anleitungen erhalten, wie sie ihren Bestand auf behornte Tiere<br />
umstellen können.<br />
- Ein Heft bietet eine Anleitung für die Haltung von behornten Milchviehbestän<strong>de</strong>n.<br />
Dabei wer<strong>de</strong>n bauliche Voraussetzungen und Managementfragen<br />
berücksichtigt.<br />
Arbeiten beginnen nach Abschluss <strong>de</strong>s <strong>Projekte</strong>s 2.8.4.13: Investitionsbedarf<br />
von Milchviehställen für horntragen<strong>de</strong> Kühe<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Dr. U. Klöble<br />
3 Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgruppe wer<strong>de</strong>n noch benannt.<br />
46
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Körnerleguminosen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.2.7<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 18.04.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Körnerleguminosen können Fruchtfolgen bereichern und einen Beitrag zur<br />
Deckung <strong>de</strong>s wachsen<strong>de</strong>n Bedarfs an Eiweißträgern leisten. Trotz dieser<br />
Vor-teile wer<strong>de</strong>n sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Landbau<br />
immer weniger Körnerleguminosen angebaut, da sie als unwirtschaftlich<br />
an-gesehen wer<strong>de</strong>n. Ein Grund liegt in <strong>de</strong>n häufig unterschätzen Futter- und<br />
Vor-fruchtwerten. Daneben sind ihre speziellen Ansprüche an <strong>de</strong>n Anbau<br />
teilweise nicht o<strong><strong>de</strong>r</strong> nicht mehr bekannt. Mittlerweile sind neue Anbauempfehlungen<br />
erarbeitet wor<strong>de</strong>n, die aber in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis noch nicht verbreitet<br />
sind.<br />
Der aktuelle Stand <strong>de</strong>s Wissens wird zusammengetragen und dokumentiert.<br />
Empfehlenswerte Anbauverfahren für Körnerleguminosen, u.a. Ackerbohnen,<br />
Blaue Lupine, Winter- und Sommererbsen sowie Sojabohnen, wer<strong>de</strong>n<br />
beschrieben und damit potenziellen Neueinsteigern in <strong>de</strong>n Anbau von Körnerleguminosen<br />
eine Entscheidungs- und Planungshilfe angeboten.<br />
- In einem Heft wer<strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utsame Körnerleguminosen anhand von Kulturdatenblättern<br />
mit allen wichtigen Informationen zum Anbauverfahren<br />
beschrieben.<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Dr. H. Böhm (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Thünen-Institut, Trenthorst<br />
U. Ebert Kompetenzzentrum Ökolandbau Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen<br />
GmbH, Visselhöve<strong>de</strong><br />
J. Recknagel Landwirtschaftliches Technologiezentrum<br />
Augustenberg, Mühlheim<br />
Prof. Dr. K. Schmidtke<br />
Hochschule für Technik und Wirtschaft<br />
Dres<strong>de</strong>n, Dres<strong>de</strong>n<br />
W. Vogt-Kaute Naturland Fachberatung, Wartmannsroth<br />
G. Völkel Kassel<br />
Dr. K.-P. Wilbois<br />
Dr. U. Klöble<br />
Forschungsinstitut für biologischen Landbau,<br />
Frankfurt am Main<br />
47
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Anwendung für mobile Endgeräte zur Stickstoffbilanzierung im Leguminosenanbau<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. DBWeb 2.4.4.25<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Leguminosen bin<strong>de</strong>n luftgetragenen Stickstoff im Bo<strong>de</strong>n. Die Menge <strong>de</strong>s im<br />
Bo<strong>de</strong>n fixierten Stickstoffs lässt sich in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis nur schwer bestimmen, da<br />
sie unter an<strong><strong>de</strong>r</strong>em von <strong><strong>de</strong>r</strong> Kulturart, <strong>de</strong>m Kornertrag, <strong>de</strong>n Ernteverlusten,<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Ackerzahl und <strong>de</strong>m Grad <strong><strong>de</strong>r</strong> Verunkrautung zum Erntezeitpunkt abhängt.<br />
Die zum Erntezeitpunkt im Bo<strong>de</strong>n, in Pflanzenresten und in Ernteprodukten<br />
enthalten<strong>de</strong>n Stickstoffmengen lassen sich rechnerisch ermitteln und stehen<br />
für Betriebsleiterentscheidungen zur Verfügung.<br />
- Eine App erlaubt die mobile Anwendung eines Stickstoffbilanzierungsrechners<br />
für Leguminosen. Die Eingaben <strong>de</strong>s Nutzers wer<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>n<br />
ISIP-Server gesandt, dort verrechnet und die Ergebnisse wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m<br />
Nutzer mobil zur Verfügung gestellt.<br />
Planungsbeginn 01.04.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber Hauptgeschäftsführung<br />
Projektpartner Dr. M. Röhrig Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion<br />
e.V., Bad Kreuznach<br />
Prof. Dr. K. Schmidtke Hochschule für Technik und Wirtschaft<br />
Dres<strong>de</strong>n, Dres<strong>de</strong>n<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. J Frisch<br />
48
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Heubergung<br />
Arbeitsgruppe, Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.2.9<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Gras- und Maissilage sind die wichtigsten Futterkonserven <strong>de</strong>utscher Wie<strong><strong>de</strong>r</strong>käuerbetriebe.<br />
Das Witterungsrisiko ist im Vergleich zur Heugewinnung<br />
gering, zugleich ist Silageerzeugung ertragssicher und qualitätsstabil. Die<br />
Silagetechnik ist ausgereifter und preisgünstiger als die Technik zur Heubergung.<br />
Heu bleibt jedoch eine interessante Alternative zur Silage: Ernährungsphysiologisch<br />
bietet es gegenüber Silage Vorteile, und Milch aus Betrieben<br />
mit Heufütterung bietet interessante Vermarktungsmöglichkeiten;<br />
schon heute ist die Heufütterung Voraussetzung für die Teilnahme an beson<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Vermarktungsprogrammen. Da immer weniger Heu in <strong><strong>de</strong>r</strong> Fütterung<br />
eingesetzt wird, wur<strong>de</strong> in <strong><strong>de</strong>r</strong> Vergangenheit die Heubergetechnik kaum<br />
noch technisch weiterentwickelt. Dabei bestehen konkrete Verbesserungsansätze<br />
um z. B. die Bröckelverluste bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bergung zu min<strong><strong>de</strong>r</strong>n und damit<br />
die Erträge und die Qualität <strong>de</strong>s Heus zu verbessern.<br />
Das Verbundvorhaben <strong><strong>de</strong>r</strong> Universität Kassel und <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong>s zeigt die verfahrenstechnischen<br />
und wirtschaftlichen Vorteile und Grenzen <strong><strong>de</strong>r</strong> Heubergung<br />
gegenüber <strong><strong>de</strong>r</strong> Silageerzeugung auf. An <strong>de</strong>n entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Punkten<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Heubergung sind technische Optimierungen geplant, die von Universität<br />
Kassel, Fachgebiet Agrartechnik, gemeinsam mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Landtechnikindustrie<br />
getestet wer<strong>de</strong>n. In diesem Forschungs- und Entwicklungsprozess wer<strong>de</strong>n<br />
Lösungen entwickelt, die Eingang in die Entwicklung neuer landtechnischer<br />
Verfahren fin<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Dies sind vor allem die Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung <strong><strong>de</strong>r</strong> Bröckelverluste<br />
beim Aufbereiten, Zetten, Schwa<strong>de</strong>n und Bergen sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Lagerverluste<br />
beim Pressen, Lüften und Trocknen. Das <strong>KTBL</strong> ermittelt ergänzend<br />
Daten zum Arbeitszeitbedarf und <strong>de</strong>n Maschinenkosten von praxisüblichen<br />
Verfahren, um sie hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit vergleichen zu können.<br />
Die Ergebnisse <strong>de</strong>s <strong>Projekte</strong>s wer<strong>de</strong>n in die Praxis transferiert, so dass neue<br />
Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stehen.<br />
- In einem Heft wer<strong>de</strong>n Empfehlungen für eine optimierte Heutechnik vorgestellt.<br />
- Das <strong>KTBL</strong>-Datenangebot zur Heubergung wird aktualisiert und steht Nutzern<br />
über die <strong>KTBL</strong>-Produkte zur Verfügung.<br />
Planungsbeginn 22.02.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.05.2016<br />
Auftraggeber Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Drittmittel<br />
64.240 €, Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
Projektpartner Prof. Dr. O. Hensel Universität Kassel, Kassel<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> J. Braun Freising<br />
Arbeitsgruppe 4 Prof. Dr. O. Hensel<br />
Universität Kassel, Kassel<br />
M. Hermle Bioland Beratung, Visselhöve<strong>de</strong><br />
Dr. M. Holp<br />
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
Dr. A. Pöllinger<br />
Höhere Bun<strong>de</strong>slehr- und Versuchsanstalt für<br />
Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein,<br />
Irdning<br />
Dr. H. Spiekers<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing-Grub<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. U. Klöble<br />
4 Weitere Arbeitsgruppenmitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> wer<strong>de</strong>n noch benannt.<br />
49
Arbeitsschwerpunkt Ökologischer Landbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Investitionsbedarf von Milchviehställen für horntragen<strong>de</strong> Kühe<br />
Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. ÖL 2.8.4.13<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Das Entfernen von Hörnern ist ein Eingriff am Tier, <strong><strong>de</strong>r</strong> aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
Tierschutzes vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n sollte. Nach <strong>de</strong>n EU-Rechtsvorschriften<br />
zum ökologischen Landbau darf seit 2009 nicht mehr routinemäßig enthornt<br />
wer<strong>de</strong>n. Um <strong>de</strong>m Arbeitsschutz zu genügen, sind die meisten Milchkühe jedoch<br />
auch im ökologischen Landbau bisher hornlos und die Ställe auf hornlose<br />
Tiere abgestimmt. Für die artgerechte Milchviehhaltung besteht Bedarf<br />
an Stallkonzepten, die für horntragen<strong>de</strong> Kühe geeignet sind. Für diese Ställe<br />
ist mit einem höheren Investitionsbedarf zu rechnen als für die bisher üblichen<br />
Ställe, da sie höhere Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an die Abmessungen und Gebäu<strong>de</strong>einrichtungen<br />
erfüllen müssen.<br />
Es wer<strong>de</strong>n Stallmo<strong>de</strong>lle <strong>de</strong>finiert, die <strong>de</strong>n Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong><strong>de</strong>r</strong> horntragen<strong>de</strong>n<br />
Milchkühe entsprechen. Für diese Mo<strong>de</strong>lle wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Investitionsbedarf ermittelt<br />
und mit <strong>de</strong>m Bedarf für die herkömmlichen Öko-Milchviehställe verglichen.<br />
Dadurch sollen die Mehrkosten für die Anpassung an aktuelle Rahmenbedingungen<br />
ermittelt und Eingangsgrößen für weitere Berechnungen<br />
wie Leistungs-Kostenrechnungen bereitgestellt wer<strong>de</strong>n. Es wer<strong>de</strong>n Kostenmo<strong>de</strong>lle<br />
für je einen Liegeboxenlaufstall und Tretmiststall in jeweils drei Bestandsgrößen<br />
erstellt und für die Onlinenutzung aufbereitet.<br />
- Im Kalkulationsprogramm "Baukost - Investitionsbedarf und Jahreskosten<br />
landwirtschaftlicher Betriebsgebäu<strong>de</strong>" stehen 6 Mo<strong>de</strong>lle für Milchviehställe<br />
zur Verfügung, die für die Haltung behornter Kühe geeignet sind.<br />
Planungsbeginn 19.04.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 13.12.2013<br />
Auftraggeber Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Drittmittel<br />
9.900 €, Bun<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
Auftragnehmer J. Simon Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
B. Meyer<br />
50
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Projektlaufzeit Seit 3/2007<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Die Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an die Bewertung von landwirtschaftlichen Produktionssystemen<br />
steigen. Neben <strong><strong>de</strong>r</strong> Evaluierung ökonomischer Aspekte sowie <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Umweltwirkungen landwirtschaftlicher Produktionsverfahren gewinnt die Beurteilung<br />
sozioökonomischer Fragen an Be<strong>de</strong>utung.<br />
Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgemeinschaft ist ein Lenkungsgremium für die vielfältigen <strong>Projekte</strong><br />
mit systemübergreifen<strong>de</strong>n Bewertungsansätzen etabliert.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft richtet Arbeitsgruppen ein, initiiert <strong>Projekte</strong> und bewertet<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong>en Ergebnisse. Sie stellt Verbindungen zu an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Organisationen<br />
und Gremien her und wirkt bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Vorplanung von Veranstaltungen und<br />
Veröffentlichungen aus ihrem Fachgebiet mit.<br />
Hauptausschuss<br />
Dr. M. Bach<br />
Prof. Dr. B. Gerowitt<br />
(Vorsitzen<strong>de</strong>)<br />
Prof. Dr. K.-J. Hülsbergen<br />
Dr. L. Leible<br />
Prof. Dr. H. Nieberg<br />
Prof. Dr. Ir. H. Van <strong>de</strong>n<br />
Weghe<br />
Gast Prof. Dr. G. Breitschuh Jena<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen<br />
Universität Rostock, Rostock<br />
Technische Universität München, Freising<br />
Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Georg-August-Universität Göttingen, Vechta<br />
BMELV-Vertreter Dr. B. Polten Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. U. Schultheiß<br />
51
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Anfallmengen Festmist<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.2.5<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 18.04.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.06.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Festmist und Jauche sind wertvolle Wirtschaftsdünger. Zur Berechnung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
notwendigen Lagerraumkapazität, zur Düngeplanung und zur Berechnung<br />
von Nährstoffflüssen sind Daten zu Anfallmengen und <strong>de</strong>n enthaltenen<br />
Nährstoff- und Trockenmassegehalten notwendig. Allerdings variieren die<br />
Daten in Abhängigkeit von Tierart, Produktionsrichtung, Leistung, Fütterung,<br />
Haltungsverfahren sowie Lagerungsmanagement erheblich.<br />
Das <strong>KTBL</strong> bietet aktuelle Faustzahlen zu <strong>de</strong>n Anfallmengen und Nährstoffgehalten<br />
für Festmist und Jauche. Diese Faustzahlen dienen Landwirten als<br />
Richtwerte sowie zum Abgleich mit eigenen Erfahrungs- und Analysenwerten.<br />
Darüber hinaus können sich z. B. Planer und Berater auf diese aktualisierten<br />
Daten stützen. Nicht zuletzt wer<strong>de</strong>n die Daten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Erstellung von<br />
nationalen Emissionsinventaren im Rahmen internationaler Klimaschutzabkommen<br />
eingesetzt.<br />
- In einer <strong>KTBL</strong>-Schrift wer<strong>de</strong>n Planungsdaten zu Anfallmengen und Nährstoffkonzentrationen<br />
von Festmist und Jauche für verschie<strong>de</strong>ne Tierkategorien<br />
angeboten.<br />
- Die in <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Online-Anwendung „Wirtschaftsdüngerrechner“ enthaltenen<br />
Daten zu Festmist und Jauche wer<strong>de</strong>n aktualisiert.<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Dr. H. Cielejewski<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
T. Hei<strong>de</strong>nreich (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Köllitsch<br />
Dr. S. Neser<br />
Dr. W. Pflanz<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg,<br />
Boxberg-Windischbuch<br />
Gäste Dr. A. Pöllinger Höhere Bun<strong>de</strong>slehr- und Versuchsanstalt für<br />
Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein,<br />
Irdning, Österreich<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. A. Priepke<br />
Dr. K. Rutzmoser<br />
Dr. D. Horlacher<br />
Lan<strong>de</strong>sforschungsanstalt für Landwirtschaft<br />
und Fischerei Mecklenburg Vorpommern,<br />
Dummerstorf<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing<br />
52
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Festmistaußenlagerung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.2.6<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.01.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong><br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe 5<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Eine Zwischenlagerung von Festmist auf unbefestigtem Untergrund – die<br />
Festmistaußenlagerung – ist rechtlich erlaubt. Sie ist sinnvoll und vertretbar,<br />
um u.a. eine bedarfsgerechte Düngung sicherzustellen o<strong><strong>de</strong>r</strong> bei begrenzter<br />
Lagerkapazität. Allerdings wird in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis unterschiedlich beurteilt, wie<br />
diese zeitlich begrenzte Lagerung vor allem unter <strong>de</strong>m Gesichtspunkt <strong>de</strong>s<br />
Bo<strong>de</strong>n- und Gewässerschutzes erfolgen sollte. Einige Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong> und<br />
Genehmigungsbehör<strong>de</strong>n haben Merkblätter herausgegeben, die Eckdaten<br />
zur Lagerung von Festmist im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung<br />
aufzeigen. Die Merkblätter enthalten allerdings keine einheitlichen<br />
Empfehlungen, was zeigt, dass das mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Festmistaußenlagerung verbun<strong>de</strong>ne<br />
Gefahrenpotenzial von <strong>de</strong>n zuständigen Fachbehör<strong>de</strong>n unterschiedlich<br />
eingeschätzt wird.<br />
Der verfügbare Wissensstand zur Festmistaußenlagerung wird ausgewertet.<br />
Auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Basis <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit gelten<strong>de</strong>n Rechts wer<strong>de</strong>n praktikable Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen<br />
an eine ordnungsgemäße Festmistaußenlagerung formuliert. Landwirte<br />
und Genehmigungsbehör<strong>de</strong>n greifen auf konsensfähige Empfehlungen zurück.<br />
- In einem <strong>KTBL</strong>-Heft wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Wissensstand zur Festmistaußenlagerung<br />
dargestellt. Auf Basis <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit gelten<strong>de</strong>n Rechts wer<strong>de</strong>n praktikable<br />
Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen an eine ordnungsgemäße Festmistaußenlagerung formuliert.<br />
Projekt unterbrochen<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Wer<strong>de</strong>n noch benannt<br />
Dr. U. Schultheiß<br />
5 Die Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> wer<strong>de</strong>n noch benannt.<br />
53
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Vermeidung von gasförmigen Stickstoffverlusten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Ausbringung von<br />
Flüssigmist und Gärresten<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.2.7<br />
Problemstellung Ökologisch und ökonomisch ist eine effiziente Verwertung <strong><strong>de</strong>r</strong> in Flüssigmist<br />
und Gärresten enthaltenen Nährstoffe notwendig. Stickstoffemissionen sind<br />
<strong>de</strong>shalb sowohl im Interesse von landwirtschaftlichen Betrieben als auch <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Gesellschaft zu vermei<strong>de</strong>n. Unter <strong>de</strong>m Aspekt einer effizienten pflanzenbaulichen<br />
Verwertung <strong>de</strong>s leicht verfügbaren Stickstoffanteils im Flüssigmist ist<br />
eine Anwendung zur gezielten Bestan<strong>de</strong>sdüngung bei Flächen- und Reihenkulturen<br />
bei geringen NH 3 -Verlusten sinnvoll und notwendig. Geeignete<br />
technische Lösungen liegen vor, u.a. berücksichtigt in <strong><strong>de</strong>r</strong> Düngeverordnung,<br />
sind in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis aber immer noch relativ wenig verbreitet. Die Grün<strong>de</strong> dafür<br />
sind vielfältig: u.a. hohe Investitionen, erwartete Leistungseinbußen. Weiterhin<br />
sind auch die Wechselwirkungen <strong><strong>de</strong>r</strong> verwen<strong>de</strong>ten Techniken im Hinblick<br />
auf an<strong><strong>de</strong>r</strong>e klimarelevante Gase und pflanzenbauliche Aspekte zu berücksichtigen.<br />
Bei einzelnen Verfahren entweicht zwar weniger NH3, dafür entstehen<br />
aber mehr Lachgas, Methan o<strong><strong>de</strong>r</strong> Kohlendioxid, was die Umwelt<br />
ebenfalls belastet.<br />
Projektziel<br />
Technische Lösungen zur emissionsarmen Ausbringung von Flüssigmist und<br />
Gärresten wer<strong>de</strong>n beschrieben sowie ökologisch und ökonomisch bewertet.<br />
Für Reihen- und Flächenkulturen wer<strong>de</strong>n in Abhängigkeit vom Düngungszeitpunkt<br />
und Standort empfehlenswerte Ausbringungsverfahren und die<br />
spezifischen Hemmnisse vorgestellt, Innovationen wer<strong>de</strong>n aufgezeigt. Darüber<br />
hinaus wer<strong>de</strong>n für die unterschiedlichen Verfahren Emissionsfaktoren<br />
bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Ausbringung abgeleitet.<br />
Produkt(e)<br />
- In einem Heft wer<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik beschrieben, Innovationen<br />
aufgezeigt sowie eine ökologische und ökonomische Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Verfahren<br />
vorgenommen.<br />
Planungsbeginn 01.10.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber Arbeitsgemeinschaften Systembewertung (SB) und Klimaschutz (KS)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Prof. Dr. J. Augustin Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung<br />
e.V., Müncheberg<br />
N. Bleisteiner<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf,<br />
Wei<strong>de</strong>nbach<br />
Prof. Dr. M. Elsäßer Landwirtschaftliches Zentrum für Rin<strong><strong>de</strong>r</strong>haltung,<br />
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und<br />
Fischerei Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Aulendorf<br />
Dr. H.-H. Kowalewsky Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
A. Neftel Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
B. Osterburg Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Prof. Dr. A. Pacholski Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg<br />
Dr. W. Zorn<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
BMELV-Vertreter K.H. Brandt Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
H. Honecker Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. U. Schultheiß<br />
Dr. S. Wulf<br />
54
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Empfehlungen zur Düngung mit Gärresten<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.2.8<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.04.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe 6<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Vergärung von Biomasse in Biogasanlagen fallen je nach Art <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Substrate und <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufbereitung Gärreste mit höchst unterschiedlichen Eigenschaften<br />
an. So schwanken die N-Gehalte zwischen 2 und 26 %, die<br />
Ammonium-N-Gehalte zwischen 45 und 80 % und die TM-Gehalte flüssiger<br />
Gärreste zwischen 2 und 12 %. Zu<strong>de</strong>m haben in <strong>de</strong>n vergangenen Jahren<br />
aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> zunehmen<strong>de</strong>n Anzahl von Biogasanlagen (Stand 2013: bun<strong>de</strong>sweit<br />
ca. 7700 Anlagen) die Mengen an Gärresten zugenommen.<br />
Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e in Regionen, in <strong>de</strong>nen aufgrund hoher Tierzahlen ohnehin bereits<br />
große Mengen an Wirtschaftsdüngern anfallen, stellt eine umweltverträgliche<br />
Verwertung <strong><strong>de</strong>r</strong> vorhan<strong>de</strong>nen Wirtschaftsdünger einschließlich <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Gärprodukte eine große Herausfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ung dar. Durch eine kompakte und<br />
übersichtliche Aufbereitung <strong><strong>de</strong>r</strong> wesentlichen Aspekte <strong><strong>de</strong>r</strong> Gärrestverwertung<br />
können Praktiker die Rückführung von Nährstoffen über die Gärreste optimieren<br />
und mögliche Umweltrisiken minimieren.<br />
Die gute fachliche Praxis <strong><strong>de</strong>r</strong> Verwertung von Gärprodukten in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
wird dargestellt mit <strong>de</strong>m Ziel, mögliche Umweltrisiken zu minimieren.<br />
Die Eigenschaften von Gärresten wer<strong>de</strong>n beschrieben, Düngungs- und Humuswirkungen<br />
aufgezeigt, rechtliche Regelungen dokumentiert und Kosten<br />
für die Ausbringung und Emissionsvermeidung mitgeteilt.<br />
- Eigenschaften von Gärresten und ihre Verwendung wer<strong>de</strong>n in einem Heft<br />
beschrieben.<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Dr. U. Schultheiß<br />
6 Die Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> wer<strong>de</strong>n noch benannt.<br />
55
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Indikatoren zur Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Tiergerechtheit in <strong><strong>de</strong>r</strong> landwirtschaftlichen<br />
Nutztierhaltung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.2.9<br />
Problemstellung<br />
International und national gibt es <strong><strong>de</strong>r</strong>zeit vielfältige Aktivitäten, um die Tiergerechtheit<br />
landwirtschaftlicher Nutztierhaltung durch geeignete Indikatoren<br />
zu untersuchen bzw. zu bewerten. Bedarf für Indikatoren zur Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Tiergerechtheit besteht vor allem in <strong><strong>de</strong>r</strong> Beratung, För<strong><strong>de</strong>r</strong>ung und Kontrolle<br />
landwirtschaftlicher Aktivitäten (Betriebskontrolle sowie Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen aus<br />
<strong>de</strong>m neuen Tierschutzgesetz) sowie im Rahmen von „Labeln“ in Verbindung<br />
mit höheren Tierschutzstandards und betrieblichen Managementsystemen.<br />
Je nach Fragestellung unterschei<strong>de</strong>n sich die Methodik sowie Art, Anzahl<br />
und Zusammenstellung geeigneter Indikatoren.<br />
Projektziel<br />
Maßgebliche Indikatoren und Indikatorensysteme, die sich für die betriebliche<br />
Eigenkontrolle gemäß <strong>de</strong>n Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong>de</strong>s Tierschutzgesetzes<br />
(2013) eignen, wer<strong>de</strong>n für die wichtigsten Tierarten zusammengetragen.<br />
Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit diese Indikatoren auch zur Implementierung<br />
in Betriebsbewertungssysteme und für ein nationales Monitoring herangezogen<br />
wer<strong>de</strong>n können. Die Indikatoren sollen wissenschaftlich abgesichert,<br />
praktikabel und verständlich sein. Der breit abgestimmte Kriterienkatalog<br />
dient allen Entwicklern, Betreibern und Nutzern von Indikatorensystemen<br />
als Grundlage.<br />
Produkt(e) - In einem Fachgespräch wer<strong>de</strong>n die <strong><strong>de</strong>r</strong>zeitigen Aktivitäten zur Bewertung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Tiergerechtheit für die betriebliche Eigenkontrolle diskutiert, ein<br />
Kriterienkatalog mit Indikatoren erstellt und <strong><strong>de</strong>r</strong> Handlungsbedarf für das<br />
<strong>KTBL</strong> bestimmt.<br />
Planungsbeginn 01.08.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
- Die Ergebnisse <strong>de</strong>s Fachgesprächs wer<strong>de</strong>n in einem Bericht zusammengefasst.<br />
Das Format ist noch nicht festgelegt und richtet sich nach<br />
<strong>de</strong>m Verlauf und <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>s Fachgesprächs.<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
Prof. Dr. T. Amon<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim<br />
e. V., Potsdam<br />
A. Bergschmidt Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Prof. Dr. E. F. Hessel<br />
Prof. N. Kemper<br />
Prof. Dr. U. Knierim<br />
Dr. L. Schra<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. U. Schumacher<br />
Prof. Dr. E. von Borell<br />
Gast Prof. Dr. G. Breitschuh Jena<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. U. Schultheiß<br />
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen<br />
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Hannover<br />
Universität Kassel, Kassel<br />
Friedrich-Loeffler-Institut, Celle<br />
Bioland Verband für organisch-biologischen<br />
Landbau e.V., Mainz<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle<br />
56
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Beste verfügbare Techniken in <strong><strong>de</strong>r</strong> Intensivtierhaltung (BVT)<br />
Arbeitsgruppe, Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. SB 2.9.4.14<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Planungsbeginn 01.10.2008<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.03.2014<br />
Auftraggeber<br />
Projektmittel<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
nationalen<br />
technischen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Auf europäischer Ebene wer<strong>de</strong>n die BVT-Referenzdokumente (BREF) von<br />
2003 zur Intensivtierhaltung im Rahmen <strong>de</strong>s sog. Sevilla-Prozesses überarbeitet.<br />
Deutschland ist verpflichtet, an <strong><strong>de</strong>r</strong> Überarbeitung mitzuwirken und<br />
Informationen zum Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Intensivtierhaltung zu liefern.<br />
Erarbeitung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Beitrags für <strong>de</strong>n Informationsaustausch zu <strong>de</strong>n<br />
BVT auf europäischer Ebene, <strong><strong>de</strong>r</strong> mit <strong><strong>de</strong>r</strong> nationalen technischen Arbeitsgruppe<br />
(nTAG) abgestimmt ist und die Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>m UBA geschlossenen<br />
FuE-Vertrages erfüllt.<br />
- Abschlussbericht (<strong>de</strong>utscher Beitrag zum Sevilla-Prozess)<br />
Abstimmung <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeiten mit <strong><strong>de</strong>r</strong> nationalen technischen Arbeitsgruppe<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
69.900 €, Umweltbun<strong>de</strong>samt<br />
Dr.-Ing. W. Berg<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e. V., Potsdam<br />
Dr. K. Damme<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Kitzingen<br />
Dr.-Ing. W. Eckhof<br />
Ingenieurbüro Eckhof, Ahrensfel<strong>de</strong><br />
Dr. E. Gallmann<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
F. Geburek Lan<strong>de</strong>samt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz<br />
Nordrheim-Westfalen, Recklinghausen<br />
Prof. Dr. E. Hartung<br />
Christian-Albrechts-Universität, Kiel<br />
T. Hei<strong>de</strong>nreich Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Köllitsch<br />
Dr. D. Höppner<br />
Zentralverband <strong><strong>de</strong>r</strong> Deutschen Geflügelwirtschaft<br />
e.V., Berlin<br />
Dr. H.-H. Kowalewsky Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
B. Kuhn Neuland GmbH, Bad Bevensen<br />
U. Meierfrankenfeld Erzeugerring Westfalen e.G., Sen<strong>de</strong>n<br />
C. Meyer Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp,<br />
Blekendorf<br />
Dr. L. Schra<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Friedrich-Loeffler-Institut, Celle<br />
G. Wechsung Umweltbun<strong>de</strong>samt, Dessau<br />
Prof. Dr. Ir. H. Van <strong>de</strong>n Georg-August-Universität Göttingen, Vechta<br />
Weghe (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
BMELV-Vertreter Dr. J. Kalisch Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
E. Grimm<br />
57
Arbeitsschwerpunkt Systembewertung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Faustzahlen Düngemittel<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. SB 2.9.4.19<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 13.01.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Es liegt eine Vielzahl von Publikationen zu Düngemitteln und ihrer Anwendung<br />
vor, allerdings fehlen Faustzahlen – kurze und übersichtliche Planungsdaten<br />
– zu Betriebswirtschaft, Umwelt und Recht. Letzteres ist von<br />
aktueller Be<strong>de</strong>utung, da in jüngster Vergangenheit zahlreiche neue Vorgaben<br />
im Agrar bzw. Düngerecht auf nationaler und EU-Ebene zu beachten<br />
sind.<br />
Mit einer speziellen Ausgabe sollen Grundlagen zur Verwendung von Düngemitteln<br />
sowie Faustzahlen zur Kalkulation von Stoffflüssen und <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Wirtschaftlichkeit bereitgestellt wer<strong>de</strong>n. Die Ausgabe beschreibt neben Produktions-<br />
und Anfallsmengen mineralischer und verschie<strong>de</strong>ner organischer<br />
Dünger, <strong><strong>de</strong>r</strong>en Inhaltsstoffe und Wirkung sowie die aktuelle Rechtslage.<br />
Damit soll <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirt die notwendigen Daten erhalten, um wirtschaftlicher,<br />
umweltverträglicher und rechtskonform zu düngen.<br />
- Faustzahlenbuch mit aggregierten, allgemeingültigen Daten zu Düngemitteln,<br />
zur Düngung sowie zu Umweltwirkungen<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Dr. D. Horlacher<br />
58
Arbeitsschwerpunkt Standortentwicklung und Immissionsschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. TBS 2.5.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Projektlaufzeit Seit 4/2000<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Die Arbeitsgemeinschaft befasst sich mit raumplanerischen Fragen zur Bauleitplanung<br />
und Raumordnung sowie mit Instrumenten <strong><strong>de</strong>r</strong> Lan<strong>de</strong>ntwicklung<br />
und methodischen Fragen <strong>de</strong>s Immissionsschutzes. Vermeidung von Nutzungskonflikten,<br />
Integration landwirtschaftlicher Belange im ländlichen Raum<br />
und im Umfeld von Ballungsräumen, Umweltschutz, Sicherung <strong>de</strong>s Standortes<br />
und nachhaltige Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe sind zentrale<br />
Aufgabengebiete. Es müssen rechtzeitig einsetzen<strong>de</strong> Maßnahmen sowie<br />
Daten und Metho<strong>de</strong>n als Beitrag zur Vermeidung und Lösung dieser Probleme<br />
entwickelt wer<strong>de</strong>n.<br />
Bereitstellen von Informationen zum Themenspektrum <strong><strong>de</strong>r</strong> Standortentwicklung<br />
landwirtschaftlicher Betriebe und <strong>de</strong>s Immissionsschutzes sowie Definition<br />
<strong>de</strong>s Stan<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik.<br />
Hauptausschuss<br />
Dr.-Ing. W. Eckhof<br />
Ingenieurbüro Eckhof, Ahrensfel<strong>de</strong><br />
G. Franke Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hessen, Kassel<br />
Prof. Dr. U. Grabski-Kieron<br />
Westfälische Wilhelms-Universität Münster,<br />
Münster<br />
M. Kamp Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
H.-J. Lamott<br />
Dr. M. Mußlick<br />
Dr. S. Neser<br />
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt<br />
Sachsen-Anhalt, Mag<strong>de</strong>burg<br />
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,<br />
Forsten, Umwelt und Naturschutz, Erfurt<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
V. Nies (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
Dr. G. Nolte<br />
Dr. T. Pitschmann<br />
ÖKON Angewandte Ökologie und Landschaftsplanung<br />
GmbH, Münster<br />
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern<br />
mbH, Leezen<br />
W. Schepers Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Gäste Dr.-Ing. G. Aulig Freising<br />
BMELV-Vertreter Dr. B. Polten Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
K. Kühlbach<br />
59
Arbeitsschwerpunkt Standortentwicklung und Immissionsschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Die kommunale Bauleitplanung und ihre Konsequenzen für die landwirtschaftliche<br />
Standortentwicklung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBS 2.5.2.15<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 04.01.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.04.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Novellierung <strong>de</strong>s Baugesetzbuches (BauGB) 2013 mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ung <strong>de</strong>s<br />
Privilegierungstatbestan<strong>de</strong>s für gewerbliche Tierhaltungsprojekte hat die Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Bauleitplanung für einen Teil landwirtschaftlicher <strong>Projekte</strong> erheblich<br />
gesteigert. Die Konsequenzen dieser Rechtsetzung und die allgemeine<br />
Entwicklung, dass <strong><strong>de</strong>r</strong> bisher meist unbeplante Außenbereich zunehmend<br />
durch die Kommunen beplant wird können zu einer starken Einschränkung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Standortauswahl und <strong><strong>de</strong>r</strong> Erweiterungsmöglichkeiten von landwirtschaftlichen<br />
Stallbauprojekten führen. Auch die Aus<strong>de</strong>hnung <strong><strong>de</strong>r</strong> Randzonen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Siedlungsentwicklung und <strong><strong>de</strong>r</strong> naturschutzrechtlichen Ausgleichsplanungen<br />
haben direkte Konsequenzen für landwirtschaftliche Betriebe.<br />
Gleichzeitig weisen zahlreiche Anfragen von Landwirten und Beratern auf ein<br />
Informations<strong>de</strong>fizit bezüglich <strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung <strong><strong>de</strong>r</strong> kommunalen Bauleitplanung<br />
für die Betriebsentwicklung hin.<br />
Die kommunalen Planungsinstrumente (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan,<br />
Satzung, Verän<strong><strong>de</strong>r</strong>ungssperre u.a.) sind systematisch erläutert. Planungs-rechtliche<br />
Zusammenhänge und Auswirkungen auf landwirtschaftliche<br />
Projektplanungen auch durch die BauGB-Novelle sind leicht verständlich und<br />
kompakt dargestellt.<br />
- In einem <strong>KTBL</strong>-Heft sind die Inhalte, <strong><strong>de</strong>r</strong> Ablauf (insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Beteiligungsmöglichkeiten)<br />
und die Konsequenzen <strong><strong>de</strong>r</strong> kommunalen Bauleitplanung<br />
für die landwirtschaftliche Standortentwicklung nachvollziehbar dargestellt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI)<br />
R. Fietz Bayerischer Bauernverband, München<br />
Dr. M. Francois<br />
A. Herrmann Landkreis Fulda<br />
Dr. Francois, Neuhaus und Kollegen,<br />
Rechtsanwälte, Bitburg<br />
J. Kothe Hessische Landgesellschaft mbH, Kassel<br />
V. Nies (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
K. Kühlbach<br />
60
Arbeitsschwerpunkt Standortentwicklung und Immissionsschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Ausgleichs-/Kompensationsplanungen im Rahmen landwirtschaftlicher<br />
<strong>Projekte</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBS 2.5.2.16<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 17.01.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 28.05.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben sind die im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Eingriffsregelung<br />
erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lichen Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen nicht<br />
selten eine in <strong>de</strong>n vorbereiten<strong>de</strong>n Projektplanungen vernachlässigte Größe.<br />
Umso größer ist anschließend die Überraschung über <strong>de</strong>n Umfang<br />
und die Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong><strong>de</strong>r</strong> zuständigen Behör<strong>de</strong>.<br />
Es liegt ein <strong>KTBL</strong>-Heft vor, das landwirtschaftlichen Betriebsleitern und<br />
Beratern aber auch <strong>de</strong>n mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektrealisierung beauftragten Planungsbüros<br />
praxisbezogene Hinweise für eine rechtzeitige Einbeziehung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> notwendigen Maßnahmen im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung<br />
bietet. Die Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Planungs- und Realisierungskonzepte<br />
erfolgt anhand von Beispielen. Berücksicht wer<strong>de</strong>n auch aktuelle<br />
Entwicklungen <strong>de</strong>s rechtlichen Rahmens wie z.B. Län<strong><strong>de</strong>r</strong>verordnungen<br />
bzw. <strong><strong>de</strong>r</strong> Entwurf einer Bun<strong>de</strong>skompensationsverordnung.<br />
- In einem <strong>KTBL</strong>-Heft wer<strong>de</strong>n praxisbezogene Hinweise für eine rechtzeitige<br />
Einbeziehung <strong><strong>de</strong>r</strong> notwendigen Maßnahmen im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> naturschutzrechtlichen<br />
Eingriffsregelung angeboten. Die Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Planungs-<br />
und Realisierungskonzepte erfolgt anhand von Beispielen.<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI)<br />
Dr.-Ing. G. Aulig<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Freising<br />
A. Herrmann Landkreis Fulda, Fulda<br />
A. Lin<strong>de</strong>nberg Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsische Landgesellschaft mbH,<br />
Hannover<br />
Dr. G. Nolte<br />
K. Kühlbach<br />
ÖKON Angewandte Ökologie und Landschaftsplanung<br />
GmbH, Münster<br />
61
Arbeitsschwerpunkt Standortentwicklung und Immissionsschutz<br />
Projekttitel Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für die Tierhaltung 2014<br />
Projektart<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBS 2.5.2.18<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Bei Genehmigung, Bau und Betrieb von Tierhaltungsanlagen ist eine Vielzahl<br />
von rechtlichen Bestimmungen zu beachten, die kontinuierlich weiterentwickelt<br />
wer<strong>de</strong>n. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e für Mitarbeiter in Genehmigungsbehör<strong>de</strong>n<br />
besteht ein ständiger Informationsbedarf über neue Rechtssetzungen und<br />
aktuelle Rechtsprechung. Auch aktuelle Entwicklungen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Emissionsund<br />
Immissionsschutztechnologie haben einen Einfluss auf die Entscheidungen<br />
in Genehmigungsbehör<strong>de</strong>n und sind somit wichtige Informationen<br />
für diese Zielgruppe.<br />
Aktuelle Fragestellung zu <strong>de</strong>n rechtlichen Rahmenbedingungen sowie <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Auswirkungen für Planung, Genehmigung und Betrieb von Tierhaltungsanlagen<br />
sind in 7 Fachvorträgen anschaulich dargestellt. Alle Vorträge fin<strong>de</strong>n<br />
sich in schriftlicher Kurzfassung im Tagungsband wie<strong><strong>de</strong>r</strong>.<br />
Produkt(e) - Die Vortragsveranstaltung im Juni 2014 in Hannover beschreibt <strong>de</strong>n aktuellen<br />
Stand <strong>de</strong>s Wissens und bietet die Möglichkeit als Gesprächsplattform<br />
zu fungieren. 7 Vorträge, einzügig, 120 Teilnehmer, national.<br />
Planungsbeginn 01.10.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.10.2014<br />
Auftraggeber<br />
- Die Vortragsveranstaltung im Juni 2014 in Ulm beschreibt <strong>de</strong>n aktuellen<br />
Stand <strong>de</strong>s Wissens und bietet die Möglichkeit als Gesprächsplattform zu<br />
fungieren. 7 Vorträge, einzügig, 60 Teilnehmer, national.<br />
- In einer <strong>KTBL</strong>-Son<strong><strong>de</strong>r</strong>veröffentlichung sind die Kurzfassungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Beiträge<br />
zusammengestellt.<br />
- Den Teilnehmern wer<strong>de</strong>n die PowerPoint-Präsentationen als geschützte<br />
pdf-Datei (lesbar, druckbar) auf <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Homepage zur Verfügung gestellt<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Dr.-Ing. W. Eckhof Ingenieurbüro Eckhof, Ahrensfel<strong>de</strong><br />
Arbeitsgruppe 7 M. Kamp Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Münster<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
H.-J. Lamott<br />
Dr. S. Neser<br />
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt,<br />
Mag<strong>de</strong>burg<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
V. Nies Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Münster<br />
Dr. G. Nolte<br />
A. Hackeschmidt<br />
ÖKON Angewandte Ökologie und Landschaftsplanung<br />
GmbH, Münster<br />
7 Arbeitsgruppe hat sich noch nicht konstituiert, Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong> ist noch nicht gewählt.<br />
62
Arbeitsschwerpunkt Standortentwicklung und Immissionsschutz<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Abluftreinigung für Tierhaltungsanlagen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBS 2.5.2.19<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 21.12.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 27.02.2015<br />
Auftraggeber<br />
Die Abluftreinigung wird zur Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung <strong><strong>de</strong>r</strong> Emissionen aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Tierhaltung<br />
und zur Steigerung <strong><strong>de</strong>r</strong> Akzeptanz <strong><strong>de</strong>r</strong> Betriebe in <strong><strong>de</strong>r</strong> Bevölkerung immer<br />
wichtiger. Die Politik hat darauf reagiert: Bereits in zwei Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong>n wur<strong>de</strong><br />
die Abluftreinigung per Erlass zum Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik bei immissionsschutzrechtlich<br />
genehmigungsbedürftigen Anlagen erklärt. Neben <strong><strong>de</strong>r</strong> Verfahrenstechnik<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> Leistungsfähigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlagen zur Emissionsmin<strong><strong>de</strong>r</strong>ung<br />
wer<strong>de</strong>n insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Investitions- und Betriebskosten <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlagen<br />
noch kritisch diskutiert.<br />
Aufgrund dieser Situation ergibt sich ein Bedarf für die Praxis, die verfügbaren<br />
Abluftreinigungsverfahren hinsichtlich Verfahrenstechnik und Leistungen<br />
zu beschreiben sowie die Gesamtkosten praxisgerecht und nachvollziehbar<br />
zu kalkulieren.<br />
Die Neufassung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Schrift 451 „Abluftreinigung für Tierhaltungsanlagen“<br />
bietet einen Überblick zum aktuellen Entwicklungsstand <strong><strong>de</strong>r</strong> Verfahren.<br />
Sie beschreibt die Reinigungsprinzipien, die Auslegung <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlagen, die<br />
Reinigungsleistungen, die Anlagenüberwachung und die Kosten.<br />
Um die Kosten für Investition und Betrieb <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlagen praxisgerecht und<br />
nachvollziehbar zu kalkulieren und <strong>de</strong>n Ergebnissen eine hohe Akzeptanz<br />
bei allen Beteiligten zu verschaffen, wer<strong>de</strong>n die im Rahmen <strong>de</strong>s KU-<br />
Vorhabens „Abluftreinigung für Schweine- und Geflügelställe“ (4r_13) erhobenen<br />
Daten, die Berechnungsgrundlagen und die Berechnungsmethodik<br />
auf breiter Basis im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgruppe abgestimmt.<br />
- Überarbeitung und Aktualisierung <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Schrift 451 (2006) „Abluftreinigung<br />
für Tierhaltungsanlagen“.<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> G. Franke Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hessen, Kassel<br />
Arbeitsgruppe 8 F. Geburek Lan<strong>de</strong>samt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz<br />
Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Prof. Dr. E. Hartung<br />
E. Grimm<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel<br />
8 Arbeitsgruppe hat sich noch nicht konstituiert, Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong> ist noch nicht gewählt, weitere Arbeitsgruppenmitglie<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
wer<strong>de</strong>n noch benannt.<br />
63
Arbeitsschwerpunkt Standortentwicklung und Immissionsschutz<br />
Projekttitel Internet-Abstandsrechner VDI 3894<br />
Projektart<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. TBS 2.5.4.7<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 28.03.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 02.09.2014<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Die Abstandsregelung <strong><strong>de</strong>r</strong> neuen VDI-Richtlinie „Emissionen und Immissionen<br />
aus Tierhaltungsanlagen (3894)“ bietet <strong>de</strong>m Anwen<strong><strong>de</strong>r</strong> verschie<strong>de</strong>ne<br />
Berechnungsmöglichkeiten, um eine Tierhaltung hinsichtlich <strong>de</strong>s Immissionsschutzes<br />
zu beurteilen. Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Richtlinie lassen sich <strong><strong>de</strong>r</strong> notwendige Abstand<br />
zum Schutz von Wohnbebauung vor Geruchsbelästigung, die mögliche<br />
Quellstärke bzw. Anlagenkapazität eines Betriebes bei gegebenem Abstand<br />
zu einer Wohnbebauung und die Geruchsstun<strong>de</strong>nhäufigkeit an einem<br />
Immissionsort ermitteln. Die Richtlinienanwendung erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>t jedoch umfangreiches<br />
Fachwissen.<br />
Mit einer <strong>KTBL</strong>-Online-Anwendung können geübte und auch ungeübte Anwen<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
die oben genannten Berechnungen gemäß VDI-Richtlinie 3894 richtig<br />
und anwen<strong><strong>de</strong>r</strong>freundlich durchführen.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Online-Anwendung mit <strong><strong>de</strong>r</strong> gemäß VDI-Richtlinie 3894 zum Schutz<br />
vor erheblichen Geruchsbelästigungen zwischen einer Tierhaltung und<br />
Wohnbebauung notwendige Abstän<strong>de</strong>, vorhan<strong>de</strong>ne Quellstärken und zu<br />
erwarten<strong>de</strong> Geruchshäufigkeiten ermittelt wer<strong>de</strong>n können.<br />
Arbeitsgemeinschaft Standortentwicklung und Immissionsschutz (STI)<br />
E. Grimm<br />
64
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
(TBN)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. TBS 2.4.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Projektlaufzeit Seit 4/1999<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Zur Weiterentwicklung nachhaltiger Nutztierhaltungssysteme besteht Entwicklungs-<br />
und För<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbedarf. Dazu müssen neue Entwicklungen aufgegriffen,<br />
ihre Wirkungen frühzeitig eingeschätzt und Handlungsbedarf vorgegeben<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Weiterentwicklung umfasst neben <strong>de</strong>n Aspekten <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
umweltverträglichen, tiergerechten und wirtschaftlichen Nutztierhaltung auch<br />
soziale und ökonomische Arbeitsfel<strong><strong>de</strong>r</strong> sowie Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeits- und Prozessqualität<br />
und Produktsicherheit.<br />
Es wer<strong>de</strong>n Informationen für die Planung und Bewertung kompletter Produktionssysteme<br />
im Rahmen interdisziplinärer Systemvergleiche bereitgestellt.<br />
Der BMELV-Bun<strong>de</strong>swettbewerb „Landwirtschaftliches Bauen“ und die<br />
gleichnamigen BMELV-Mo<strong>de</strong>llvorhaben wer<strong>de</strong>n fachlich begleitet. Die Arbeitsgemeinschaft<br />
richtet Arbeitsgruppen und weitere <strong>Projekte</strong> ein und bewertet<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong>en Ergebnisse.<br />
Hauptausschuss<br />
Prof. Dr. R. Brunsch<br />
Prof. Dr. W. Büscher<br />
Prof. Dr. E. Hartung<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Prof. Dr. E. Hessel<br />
Prof. Dr. T. Jungbluth<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e. V., Potsdam<br />
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität<br />
Bonn, Bonn<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel<br />
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
R. Kaufmann Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
A. Lin<strong>de</strong>nberg Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsische Landgesellschaft mbH,<br />
Hannover<br />
Dr. L. Schra<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Prof. Dr. E. von Borell<br />
Dr. G. Wendl<br />
Prof. Dr. M. Ziron<br />
Friedrich-Loeffler-Institut, Celle<br />
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle/Saale<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Fachhochschule Südwestfalen, Soest<br />
Gäste S. Häuser DLG Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft<br />
e.V., Frankfurt/Main<br />
Prof. Dr. N. Kemper<br />
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Hannover<br />
BMELV-Vertreter Dr. B. Polten Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
W. Achilles<br />
65
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Tagung zu Stand und Perspektiven <strong><strong>de</strong>r</strong> Ebermast<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBN 2.4.2.19<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Um Ebergeruch im Fleisch auszuschließen, wer<strong>de</strong>n die männlichen Ferkel<br />
bisher in Deutschland chirurgisch kastriert. Gemäß <strong>de</strong>m neuen Tierschutzgesetz<br />
soll in Deutschland bis spätestens En<strong>de</strong> 2018 auf die betäubungslose<br />
Ferkelkastration verzichtet wer<strong>de</strong>n. Die Ebermast kann auf einen Eingriff am<br />
Tier völlig verzichten. Den For<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen <strong>de</strong>s Tierschutzes und <strong><strong>de</strong>r</strong> Verbraucher<br />
wird so am weitesten entsprochen. Auch die Politik befürwortet die<br />
Ebermast. In umfangreichen Forschungsvorhaben konnten viele Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Ebermast bereits geklärt wer<strong>de</strong>n. Die Ebermast wird in <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis bereits<br />
durchgeführt und die Schlachtunternehmen haben Verfahren zur Geruchserkennung<br />
und Wege <strong><strong>de</strong>r</strong> Vermarktung entwickelt. Für <strong>de</strong>n breiten Einsatz in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis sind <strong><strong>de</strong>r</strong> Stand <strong>de</strong>s Wissens darzustellen und noch offene Fragen<br />
zur Haltung, Fütterung und Vermarktung herauszuarbeiten.<br />
Auf einer überregionalen Tagung wer<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Stand <strong>de</strong>s Wissens, die Erfahrungen<br />
aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis und die Perspektiven <strong><strong>de</strong>r</strong> Ebermast unter Berücksichtigung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> jüngsten wissenschaftlichen Ergebnisse aufgezeigt. Den Teilnehmern<br />
bietet sich eine Austauschplattform, die zur inhaltlichen Koordinierung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>laufen<strong>de</strong>n</strong> und geplanten Vorhaben aus Wissenschaft, Landwirtschaft<br />
und Vermarktung dient.<br />
Produkt(e) - Die Wissenschaftstagung beschreibt <strong>de</strong>n Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Forschung und Perspektiven<br />
(2 halbe Tage, einzügig, 60-120 Teilnehmer, national)<br />
Planungsbeginn 15.04.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.10.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgruppe<br />
- Im Tagungsband sind alle Vorträge und Poster <strong><strong>de</strong>r</strong> gleichnamigen Tagung<br />
zusammengestellt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
G. Freisfeld Erzeugerring Westfalen e. G., Sen<strong>de</strong>n<br />
H. Schra<strong>de</strong> Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg, Boxberg-Windischbuch<br />
Dr. K.-H. Tölle<br />
Prof. Dr. E. von Borell<br />
Dr. M. Weber<br />
Prof. Dr. M. Ziron<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
ISN - Interessengemeinschaft <strong><strong>de</strong>r</strong> Schweinehalter<br />
Deutschlands e.V., Damme<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Forsten und<br />
Gartenbau Sachsen-Anhalt, Bernburg<br />
Fachhochschule Südwestfalen, Soest<br />
BMELV-Vertreter M. Chapman-Rose Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
S. Fritzsche<br />
66
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Online-Anwendung Mastschweine<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBN 2.4.2.20<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 21.02.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Eine zukunftsfähige Tierhaltung zeichnet sich durch hohe Tierschutz- und<br />
Umweltstandards bei gegebener Wirtschaftlichkeit aus; schon bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Wahl<br />
<strong>de</strong>s Haltungsverfahrens wer<strong>de</strong>n die Weichen für die Zukunft gestellt. Stehen<br />
die Tiere im Stall, lässt sich die Tiergerechtheit am Tier direkt feststellen, die<br />
Messung aller Umweltwirkungen ist hingegen auch dann nicht möglich. Sowohl<br />
bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Planung als auch während <strong><strong>de</strong>r</strong> Stallbewirtschaftung ist <strong>de</strong>shalb<br />
eine Metho<strong>de</strong> erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich, mit <strong><strong>de</strong>r</strong> die Wirkungen <strong>de</strong>s Haltungsverfahrens<br />
zuverlässig abgeschätzt wer<strong>de</strong>n können. Mit <strong>de</strong>m Nationalen Bewertungsrahmen<br />
Tierhaltungsverfahren wur<strong>de</strong> 2006 solch eine Metho<strong>de</strong> vorgestellt.<br />
Seit<strong>de</strong>m haben sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Wissensstand und <strong><strong>de</strong>r</strong> Informationsbedarf vergrößert.<br />
Interessenten können sich im Internet einen Überblick über die Vor- und<br />
Nachteile von Haltungsverfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Schweinemast verschaffen. Planungsrelevante<br />
Daten zu ausgewählten Haltungsverfahren sind zentral zusammengefasst;<br />
Produktionsverfahren können kalkuliert wer<strong>de</strong>n.<br />
- Im Pilotprojekt "Mastschweine" wird eine neue Online-Anwendung erstellt,<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>m Nutzer Informationen zur Bewertung von Haltungsverfahren<br />
von Mastschweinen angeboten wer<strong>de</strong>n. Zu vor<strong>de</strong>finierten und frei wählbaren<br />
Haltungsverfahren wer<strong>de</strong>n die Kosten sowie die Wirkungen auf Umwelt<br />
und Tiergerechtheit beschrieben und bewertet.<br />
- Die vorhan<strong>de</strong>ne Online-Anwendung "Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren"<br />
aus <strong>de</strong>m Jahre 2006 bleibt zunächst erhalten. Um zukünftig<br />
die Anwendung auch ohne die <strong>KTBL</strong> Schrift 446 nutzen zu können,<br />
wer<strong>de</strong>n die Bewertungstabellen für Tierverhalten, Tiergesundheit und<br />
Umwelt ebenfalls online gestellt. Die Nutzerführung <strong><strong>de</strong>r</strong> Anwendung und<br />
die Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Informationen wer<strong>de</strong>n verbessert.<br />
- Die Ergebnisse <strong>de</strong>s <strong>Projekte</strong>s wer<strong>de</strong>n im Rahmen einer eintägigen und<br />
einzügigen Veranstaltung vorgestellt. Einsatzmöglichkeiten und <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutzen<br />
wer<strong>de</strong>n vermittelt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
Arbeitsgemeinschaft Systembewertung (SB)<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Prof. Dr. E. Hartung<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Prof. Dr. N. Kemper<br />
Dr. K. Kempkens<br />
Christian-Albrecht Universität zu Kiel, Kiel<br />
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Hannover<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Bonn<br />
A. Lin<strong>de</strong>nberg Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsische Landgesellschaft mbH,<br />
Hannover<br />
Dr. S. Neser<br />
Dr. W. Pflanz<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising<br />
Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg,<br />
Boxberg-Windischbuch<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
67
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. L. Schra<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Friedrich-Löffler-Institut, Celle<br />
P. Spandau Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Münster<br />
Prof. Dr. Ir. H. Van <strong>de</strong>n<br />
Weghe<br />
Prof. Dr. E. von Borell<br />
R. Wiedmann Tübingen<br />
Dr. B. Eurich-Men<strong>de</strong>n<br />
Georg-August-Universität Göttingen, Vechta<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Halle<br />
68
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
DVG-Tagung "Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung"<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. TBN 2.4.4.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Die "angewandte Ethologie" trägt dazu bei, Erkenntnisse über das Tier in<br />
seiner Haltungsumgebung zu gewinnen, zu bewerten und daraus neue, angepasste<br />
Techniken und Verfahren für die landwirtschaftliche Tierhaltung zu<br />
entwickeln. Die Fachgruppe "Ethologie und Tierhaltung" <strong><strong>de</strong>r</strong> Deutschen Veterinärmedizinischen<br />
Gesellschaft (DVG)" unterstützt dies u. a. mit ihrer<br />
Freiburger Tagung.<br />
Die auf <strong><strong>de</strong>r</strong> jährlich im Herbst stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n internationalen Arbeitstagung<br />
"Angewandte Ethologie bei Nutztieren" vorgetragenen Ergebnisse aus <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Forschung erscheinen seit <strong>de</strong>n Siebzigerjahren traditionsgemäß als <strong>KTBL</strong>-<br />
Schrift "Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung".<br />
Produkt(e) - Der Tagungsband zur Internationalen Arbeitstagung <strong><strong>de</strong>r</strong> DVG beinhaltet<br />
alle Referate und Posterbeiträge <strong><strong>de</strong>r</strong> Veranstaltung.<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.01.2014<br />
Auftraggeber<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
Projektpartner Dr. U. Pollmann Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft<br />
e. V., Gießen<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. K. Huesmann<br />
69
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Flüssigmistlagerung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. TBS 2.4.4.6<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 25.08.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.05.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgruppe<br />
Bei Bau und Betrieb von Anlagen zur Lagerung von Flüssigmist sind verschie<strong>de</strong>ne<br />
Vorschriften und technische Bestimmungen zu beachten. Bereits<br />
bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Planung und <strong><strong>de</strong>r</strong> Standortsuche sind Art und Größe <strong><strong>de</strong>r</strong> Behälter<br />
ebenso von Be<strong>de</strong>utung wie notwendige Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> die Baukosten.<br />
Projektziel ist die Erstellung einer zusammenfassen<strong>de</strong>n Darstellung für die<br />
Flüssigmistlagerung in Behältern und Erdbecken, welche die rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen, die unterschiedlichen Bauweisen sowie <strong><strong>de</strong>r</strong>en Kosten,<br />
die Planung, die erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>liche Lagerkapazität und die Anfallmengen berücksichtigt.<br />
- Ein <strong>KTBL</strong>-Heft beschreibt die rechtlichen Grundlagen, die Planung, die<br />
Bauarten und Bauausführungen, <strong>de</strong>n Lagerraumbedarf und Kostenschätzungen<br />
für die Flüssigmistlagerung.<br />
- Online-Anwendung, Erweiterung <strong><strong>de</strong>r</strong> Baukost-Anwendung für die Lagerung<br />
von Flüssigmist.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
S. Hamann-Lahr Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz<br />
J. Koopmann Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Dr. H.-H. Kowalewsky<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
A. Lin<strong>de</strong>nberg Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsische Landgesellschaft, Hannover<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
H.-N. Meiforth<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Nienburg<br />
J. Nienhaus Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Bonn<br />
A. Hackeschmidt<br />
70
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Baukost 3.0 - Neuausrichtung <strong><strong>de</strong>r</strong> Baukostenermittlung mit anschließen<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Neuprogrammierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Online-Anwendung<br />
Weiteres Projekt<br />
Projekt-Nr. TBS 2.4.4.19<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.07.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.09.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Projektgruppe Kun<strong>de</strong>nbefragung<br />
Baukost ist ein etabliertes <strong>KTBL</strong>-Produkt. Die Online-Anwendung basiert auf<br />
einer eigenständigen <strong>KTBL</strong>-Datenbank. Infolge verschie<strong>de</strong>ner Ergänzungen<br />
ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Programmco<strong>de</strong> unübersichtlich gewor<strong>de</strong>n und weitere Ergänzungen<br />
wer<strong>de</strong>n zunehmend schwierig. Zu<strong>de</strong>m sind neue Nutzerfunktionen und eine<br />
einheitliche Preisbasis wünschenswert. Deshalb ist eine Neuprogrammierung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Datenbank in Oracle und <strong><strong>de</strong>r</strong> Online-Anwendung erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich,<br />
wodurch auch eine Anpassung an das allgemeine <strong>KTBL</strong>-Layout und eine<br />
verbesserte Bedienerführung möglich ist.<br />
Die Daten zum Investitionsbedarf wer<strong>de</strong>n mit einer neuen Metho<strong>de</strong> ermittelt.<br />
Dabei wer<strong>de</strong>n die Preise <strong><strong>de</strong>r</strong> Bauleistungen getrennt von <strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>lldaten<br />
(Mengen, Zeichnungen, Planungskennzahlen) erhoben und verwaltet. Mo<strong>de</strong>lle<br />
haben eine einheitliche Preisbasis.<br />
Es wird eine Gebäu<strong>de</strong>datenbank in Oracle sowie eine Baukost entsprechen<strong>de</strong><br />
Onlineanwendung mit zusätzlichen Funktionen, z. B. Kombination von<br />
Mo<strong>de</strong>llen, entwickelt.<br />
- <strong>KTBL</strong>-interne Oracle-gestützte Gebäu<strong>de</strong>datenbank.<br />
- Online-Anwendung Baukost (Version 3.0) im <strong>KTBL</strong>-Layout mit zusätzlichen<br />
Funktionen gegenüber Version 2 und vereinheitlichten Preisdaten<br />
bei Neumo<strong>de</strong>llen.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
W. Bockhorst Lan<strong>de</strong>ssparkasse zu Ol<strong>de</strong>nburg, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
G.-J. Bötel<br />
J. Gartung Schwülper<br />
Ingenieurbüro Bö<strong>de</strong>cker GmbH, Lehrte<br />
Prof. Dr. U. Hellmuth<br />
Fachhochschule Kiel, Osterrönfeld<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
J. Koopmann Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
U. Weddige Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp,<br />
Blekendorf<br />
E. Witzel<br />
71
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Landwirtschaftliche Mehrzweckhallen<br />
Weitere <strong>Projekte</strong><br />
Projekt-Nr. TBS 2.4.4.25<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 23.03.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.03.2014<br />
Auftraggeber<br />
Landwirtschaftliche Hallen zum Abstellen von Maschinen und Geräten bis<br />
hin zur Lagerung pflanzlicher Erzeugnisse dienen oftmals unterschiedlichen<br />
Zwecken und benötigen daher multifunktionale Nutzungskonzepte.<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Planung ist abzuwägen, wie groß die Flexibilität in Bezug auf die angestrebten<br />
Nutzungen sein soll und welche Parameter festgelegt wer<strong>de</strong>n<br />
müssen, damit zukünftige Entwicklungen offen bleiben o<strong><strong>de</strong>r</strong> sogar hinsichtlich<br />
eines Folgenutzungskonzeptes berücksichtigt wer<strong>de</strong>n können.<br />
Potenziellen Bauherren von landwirtschaftlichen Mehrzweckhallen steht eine<br />
Entscheidungshilfe zur Verfügung. Sie behan<strong>de</strong>lt alle Themengebiete, die für<br />
die Planung einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle relevant sind. Die<br />
übersichtliche Darstellung von Konstruktionsprinzipien und -<strong>de</strong>tails, nutzungsflexiblen<br />
Planungsansätzen und baurechtlichen Belangen wird durch<br />
Planungsbeispiele mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ergänzt. Aktuelle<br />
Ergebnisse zu Schleppkurven landwirtschaftlicher Fahrzeuge mit ihren Konsequenzen<br />
für die Dimensionierung von Mehrzweckhallen sind eingearbeitet.<br />
- In einem <strong>KTBL</strong>-Heft wer<strong>de</strong>n planerische, baukonstruktive und rechtliche<br />
Aspekte bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Errichtung landwirtschaftlicher Mehrzweckhallen aufgezeigt,<br />
Planungsbeispiele bieten ergänzend Daten zum Investitionsbedarf.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
Projektpartner T. Gensler Gensler Architekten, Ebersburg<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
R. Kaufmann Forschungsanstalt Agroscope, Reckenholz-<br />
Tänikon ART, Ettenhausen (Schweiz)<br />
A. Lin<strong>de</strong>nberg Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsische Landgesellschaft mbH,<br />
Hannover<br />
B. Meyer<br />
72
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Bo<strong>de</strong>nhaltung von Legehennen ˗ Maßnahmen zur Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung luftgetragener<br />
Belastungen im Stall<br />
Arbeitsgruppe, Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. TBS 2.4.5.7<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Die Stallluft in Bo<strong>de</strong>nhaltungen von Legehennen ist durch hohe Konzentrationen<br />
von Stäuben, Keimen und Ammoniak gekennzeichnet. Untermauert<br />
wird dies durch das im April 2010 abgeschlossene Forschungsprojekt "Beurteilung<br />
verschie<strong>de</strong>ner Haltungssysteme für Legehennen aus Sicht <strong>de</strong>s Arbeits-<br />
und Umweltschutzes; Belastungen durch luftgetragene Stäube und<br />
Mikroorganismen". Das Projekt zeigt, dass Verbesserungen zum Schutz von<br />
Tieren und Tierbetreuern notwendig und möglich sind.<br />
Mit <strong>de</strong>m Mo<strong>de</strong>llvorhaben soll die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verbesserung<br />
<strong>de</strong>s Stallklimas in Bo<strong>de</strong>nhaltungssystemen von Legehennen im praktischen<br />
Betrieb aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, um die Haltung von Legehennen in<br />
Deutschland tiergerechter zu gestalten und die Bedingungen am Arbeitsplatz<br />
zu verbessern. Dazu wer<strong>de</strong>n in 2 Praxisbetrieben Lösungen für eine stallklimaoptimierte<br />
Bo<strong>de</strong>nhaltung von Legehennen mit wissenschaftlicher Begleitung<br />
untersucht und ggf. optimiert. Das Mo<strong>de</strong>llvorhaben wird klären, welche<br />
Wirkung die untersuchten technischen und managementbedingten<br />
Maßnahmen zur Verbesserung <strong><strong>de</strong>r</strong> Luftqualität in Ställen haben. Die Ergebnisse<br />
wer<strong>de</strong>n veröffentlicht, um so Neuerungen zum schnelleren Einzug in<br />
die Praxis zu verhelfen. Die Ermittlung luftgetragener Belastungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Stallluft<br />
wie Ammoniak-, Staub- und Bioaerosolkonzentrationen, sowie <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ung, bil<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Schwerpunkt <strong><strong>de</strong>r</strong> Untersuchungen. Darüber hinaus<br />
wer<strong>de</strong>n auch Fragen zur Tierleistung, zur Wirtschaftlichkeit und zur Umsetzbarkeit<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Min<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsmaßnahmen diskutiert.<br />
Produkt(e)<br />
- Zwei wissenschaftliche Abschlussberichte für <strong>de</strong>n Auftraggeber.<br />
Planungsbeginn 21.09.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
182.500 €, Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Prof. Dr. R. An<strong><strong>de</strong>r</strong>sson<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. P. Hiller<br />
Hochschule Osnabrück<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Dr. J. Lippmann<br />
Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
Dr. B. Spindler<br />
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover,<br />
Hannover<br />
BMELV-Vertreter C. Lipinski Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Auftragnehmer<br />
LUFA Nord-West, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
A. Hackeschmidt<br />
73
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Bun<strong>de</strong>swettbewerb Landwirtschaftliches Bauen 2013/14 - "Anwendung<br />
ganzheitlicher Energiekonzepte in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung"<br />
Arbeitsgruppe, Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. TBN 2.4.5.8<br />
Problemstellung<br />
Energie ist ein wichtiger Produktionsfaktor in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung. Daher<br />
spielt die kostengünstige Versorgung mit Energie und die effiziente Nutzung<br />
von Stroms und Wärme eine wichtige Rolle für <strong>de</strong>n wirtschaftlichen Erfolg<br />
von Betrieben.<br />
Die Produktionsprozesse in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung bieten an vielen Stellen Potenziale<br />
zur Steigerung <strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz und zur Energieeinsparung. Um<br />
diese Möglichkeiten auszuschöpfen, sind ganzheitliche Konzepte notwendig,<br />
die die baulichen und technischen Einzelmaßnahmen zu einem abgestimmtem<br />
Gesamtkonzept für <strong>de</strong>n Stall und <strong>de</strong>n Betrieb verbin<strong>de</strong>n.<br />
Projektziel<br />
Die Bun<strong>de</strong>sministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
zeichnet bis zu fünf Tierhaltungsbetriebe für ihr vorbildliches Energiemanagement<br />
aus. Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Auszeichnung von Energiekonzepten, die über Einzelmaßnahmen<br />
hinausgehen, soll das Bewusstsein für die Be<strong>de</strong>utung ganzheitlicher<br />
Energiekonzepte gestärkt wer<strong>de</strong>n. Dabei wer<strong>de</strong>n sowohl Tierhalter<br />
als auch die Fachberatung und die interessierte Öffentlichkeit angesprochen.<br />
Die so gewährte Transparenz för<strong><strong>de</strong>r</strong>t <strong>de</strong>n Dialog zwischen Tierhaltern und<br />
ihren Besuchern sowie das gegenseitige Verständnis. Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Auszeichnung<br />
beispielhafter Lösungen sollen Landwirte zur Nachahmung angeregt wer<strong>de</strong>n.<br />
Produkt(e)<br />
- In einem Heft wer<strong>de</strong>n die Erfahrungen aus <strong>de</strong>m Bun<strong>de</strong>swettbewerb sowie<br />
die Preisträger mit ihren Maßnahmen vorgestellt.<br />
- Preisverleihung anlässlich <strong><strong>de</strong>r</strong> EuroTier 2014 auf <strong>de</strong>m TopTierTreff durch<br />
das Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
sowie <strong>de</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong>: Überreichung von Stallplaketten,<br />
Urkun<strong>de</strong>n, Prämien sowie Vi<strong>de</strong>opräsentation <strong><strong>de</strong>r</strong> Preisträger und sich<br />
anschließen<strong><strong>de</strong>r</strong> Stehempfang.<br />
Planungsbeginn 15.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 27.02.2015<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Bun<strong>de</strong>sprüfungskommission<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
80.000 €, Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
Prof. Dr. R. Brunsch Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim<br />
e. V., Potsdam<br />
Prof. Dr. W. Büscher Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,<br />
Bonn<br />
S. Kraatz Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim<br />
e. V., Potsdam<br />
A. Lin<strong>de</strong>nberg Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sächsische Landgesellschaft mbH,<br />
Hannover<br />
Dr. B. Polten<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
C. Schied Lan<strong>de</strong>sanstalt für Entwicklung <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> ländlichen Räume, Schwäbisch Gmünd<br />
J. Simon Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing-Grub<br />
A. Zibell LMS Agrarberatung GmbH, Pasewalk<br />
Prof. Dr. M. Ziron<br />
Dr. K. Huesmann<br />
Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn<br />
74
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Jahrestagung 2013 <strong>de</strong>s „Arbeitskreis Län<strong><strong>de</strong>r</strong> ALB beim <strong>KTBL</strong>"<br />
Arbeitskreis<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
In <strong>de</strong>n selbstständigen Arbeitsgemeinschaften für Landtechnik und Bauwesen<br />
(ALB) <strong><strong>de</strong>r</strong> einzelnen Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong> sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Schweiz besteht <strong><strong>de</strong>r</strong> Bedarf<br />
an überregionalem Informationsaustausch.<br />
Der Arbeitskreis Län<strong><strong>de</strong>r</strong> ALB beim <strong>KTBL</strong> ist ein freiwilliger Zusammenschluss<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> selbstständigen Arbeitsgemeinschaften für Landtechnik und<br />
Bauwesen und fungiert als <strong><strong>de</strong>r</strong>en Koordinierungs- und Gesprächsplattform.<br />
Das <strong>KTBL</strong> stellt satzungsgemäß die Geschäftsführung.<br />
- Jahrestagung 2012, 1 ½ Tage, nur für Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong>.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutztierhaltung (TBN)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>s<br />
Arbeitskreises<br />
C. Baumgartner ALB-Schweiz<br />
K. Bünz ALB-Schleswig-Holstein<br />
R. Densborn ALB-Rheinland-Pfalz/Saarland<br />
S. Dworzak ÖKL, Österreich<br />
G. Franke ALB-Hessen<br />
C. Guler ALB-Schweiz<br />
Dr. D. Hesse<br />
Prof. Dr. T. Jungbluth<br />
(Sprecher)<br />
ALB-Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen<br />
ALB-Ba<strong>de</strong>n-Württemberg<br />
K. Klindtworth ALB-Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen<br />
H. Lappé ALB-Nordrhein-Westfalen<br />
L. Lohmann ALB-Nordrhein-Westfalen<br />
A. Lorenz ALB-Rheinland-Pfalz/Saarland<br />
E. Munduch-Ba<strong><strong>de</strong>r</strong> ÖKL, Österreich<br />
Dr. H. Oechsner<br />
ALB-Ba<strong>de</strong>n-Württemberg<br />
A. Sandhäger ALB-Hessen<br />
P. Seidl ALB-Bayern<br />
Dr. A. Spreu<br />
ALB-Schleswig-Holstein<br />
Dr. M. Müller<br />
ALB-Bayern<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
E. Witzel<br />
75
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pfanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Projektlaufzeit Seit 07/1984<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Zur Weiterentwicklung nachhaltiger Verfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion besteht<br />
Entwicklungs- und För<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbedarf. Dazu müssen neue Entwicklungen<br />
aufgegriffen, ihre Wirkungen frühzeitig eingeschätzt und Handlungsbedarf<br />
vorgegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Weiterentwicklung umfasst außer <strong>de</strong>n Aspekten <strong><strong>de</strong>r</strong> umweltverträglichen<br />
und an die Landschaft angepassten Pflanzenproduktion auch soziale und<br />
ökonomische Arbeitsfel<strong><strong>de</strong>r</strong> sowie Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeits- und Prozessqualität<br />
und Produktsicherheit.<br />
Es wer<strong>de</strong>n laufend Informationen für die Planung und Bewertung kompletter<br />
Produktionssysteme im Rahmen interdisziplinärer Systemvergleiche bereitgestellt<br />
und <strong><strong>de</strong>r</strong> Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Technik <strong>de</strong>finiert.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft richtet nach Bedarf Arbeitsgruppen und <strong>Projekte</strong><br />
ein und bewertet <strong><strong>de</strong>r</strong>en Ergebnisse.<br />
Sie stellt Verbindungen zu an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Organisationen und Gremien her und<br />
wirkt bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Planung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen aus ihrem<br />
Fachgebiet mit.<br />
Hauptausschuss<br />
PD Dr. J. Brunotte<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
J. Buhl Untermarchtal<br />
Dr. J. Degner<br />
Dr. M. Demmel<br />
Dr.-Ing. D. Ehlert<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising-Weihenstephan<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e.V., Potsdam<br />
A. Fübbeker Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Prof. Dr.-Ing. H. Knechtges Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen,<br />
Nürtingen<br />
Prof. Dr. Y. Reckleben<br />
Dr. H. Sparing<br />
Dr. N. Uppenkamp<br />
C.-W. Way<strong>de</strong>lin<br />
Fachhochschule Kiel, Rendsburg<br />
Freist<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Münster<br />
WöDA - Wöpkendorfer Dienstleistungs- und<br />
Agrargesellschaft mbH, Dettmannsdorf<br />
Gast R. Hörner Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V.,<br />
Frankfurt am Main<br />
BMELV-Vertreter K.-H. Brandt Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr.-Ing. N. Fröba<br />
76
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Datensammlung Futterernte und -konservierung<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.2.6<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.02.2004<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.04.2014<br />
Die Produktionsplanung gehört zu <strong>de</strong>n grundlegen<strong>de</strong>n Aufgaben landwirtschaftlicher<br />
Unternehmer und umfasst Entscheidungen über die Kapazitätsausstattung,<br />
über das Produktionsprogramm und über <strong>de</strong>n Produktionsprozess.<br />
Zur Kalkulation wer<strong>de</strong>n Planungsdaten und abgestimmte methodische<br />
Grundlagen benötigt. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e wenn betriebsindividuelle Daten fehlen,<br />
sind verlässliche Planungswerte be<strong>de</strong>utsam. Zum Vergleich und Interpretation<br />
eigener Daten und Planungsergebnisse sind neutrale Kennzahlen hilfreich.<br />
Für Planungsrechnungen und betriebswirtschaftliche Bewertungen in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Futterproduktion stehen zuverlässige Informationen zur Verfügung. Sie umfassen<br />
ökonomische Erfolgsgrößen und Stückkosten sowie Planungsdaten<br />
zu Leistungen, Direktkosten und Arbeitswirtschaft. Darüber hinaus sind die<br />
methodischen Grundlagen auf allen Planungsebenen mit anschaulichen<br />
Kalkulationsbeispielen enthalten.<br />
- Die <strong>KTBL</strong>-Spezialdatensammlung enthält aktuelle Planungsdaten für Maschinen,<br />
technische und bauliche Anlagen, Arbeitsverfahren, Dienstleistungen<br />
und Produktionsverfahren sowie Planungsbeispiele für die be<strong>de</strong>utsamsten<br />
landwirtschaftlichen Futterpflanzen (Grobfutter).<br />
- Eine die Datensammlung ergänzen<strong>de</strong> Online-Anwendung enthält eine<br />
Vielzahl von Produktionsverfahren, die in <strong><strong>de</strong>r</strong> gedruckten Fassung keinen<br />
Platz fin<strong>de</strong>n.<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
Dr.-Ing. W. Berg<br />
Dr. H. Böhm<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e.V., Potsdam<br />
Thünen-Institut,<br />
Westerau<br />
A. Fübbeker Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
H.-G. Gerighausen<br />
Dr. H. Spiekers<br />
Dr. J. Thaysen<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. R. Tölle<br />
Dr. J. Grube<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, Viersen<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Poing<br />
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,<br />
Rendsburg<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
77
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pfanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Precision Farming<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.2.10<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.03.2008<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.03.2014<br />
Techniken und Verfahren <strong>de</strong>s Precision Farming wer<strong>de</strong>n zunehmend auf<br />
<strong>de</strong>m Markt angeboten. In <strong><strong>de</strong>r</strong> Praxis herrscht Skepsis aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Erfahrungen<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> Vergangenheit. Die Umsetzung von Precision Farming stockt.<br />
Übergeordnetes Ziel ist die Erhöhung <strong>de</strong>s Anteils von Komponenten für das<br />
Precision Farming. Die Arbeitsgruppe soll eine Gesprächs- und Informationsplattform<br />
mit <strong>de</strong>m Ziel <strong><strong>de</strong>r</strong> praktischen Einführung und breiten Anwendung<br />
von Precision Farming, vorrangig im Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong> teilflächenspezifischen<br />
Bewirtschaftungsmaßnahmen, bil<strong>de</strong>n und die verschie<strong>de</strong>nen Aktivitäten<br />
in diesem Bereich vernetzen. Kernaufgabe <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsgruppe ist die<br />
Darstellung und Bewertung konkreter Precision-Farming-Verfahren für die<br />
Praxis auf Basis <strong>de</strong>s Expertenwissens und ökonomischer Berechnungen <strong>de</strong>s<br />
<strong>KTBL</strong>.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Heft „Teilflächenspezifische Bo<strong>de</strong>nuntersuchung“ mit anwendungsorientierten,<br />
abgesicherten Kurzinformationen zu Technik, Verfahren und<br />
Management <strong><strong>de</strong>r</strong> Erfassung von Bo<strong>de</strong>nkennwerten.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Heft „Teilflächenspezifische Kalkung“ mit anwendungsorientierten,<br />
abgesicherten Kurzinformationen zu Technik, Verfahren, Management<br />
gegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Heft „Parallelfahrsysteme“ mit anwendungsorientierten, abgesicherten<br />
Kurzinformationen zu Technik, Verfahren und Ökonomie von Parallelfahrsystemen.<br />
- Tagung zur teilflächenspezifischen Bo<strong>de</strong>nuntersuchung.<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
Dr.-Ing. D. Ehlert<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e.V., Potsdam<br />
J. Goldmann DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel<br />
e.V., Groß-Umstadt<br />
V. Jäger Bomitz-Bommelsen<br />
Prof. Dr. W. Kath-Petersen<br />
Fachhochschule Köln, Köln<br />
H. Lisso Neu-Seeland Agrar GmbH, Falkenstein<br />
H. Müller Müller-Elektronik GmbH & Co.KG , Salzkotten<br />
B. Preuß-Driessen Herzogliche Gutsverwaltung Gut Grünholz,<br />
Thumby<br />
Prof. Dr. A. Ruckelshausen<br />
C.-W. Way<strong>de</strong>lin<br />
Dr. F. Kloepfer<br />
Fachhochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
WöDA - Wöpkendorfer Dienstleistungs- und<br />
Agrargesellschaft mbH, Dettmannsdorf<br />
78
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Verfügbare Feldarbeitstage<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.2.12<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsen<strong>de</strong> 01.03.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.06.2015<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Daten für die verfügbaren Feldarbeitstage für verschie<strong>de</strong>ne Anspruchsstufen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Bo<strong>de</strong>nbearbeitung, für die Raufutterernte und die verfügbaren Mähdruschstun<strong>de</strong>n<br />
wur<strong>de</strong>n zuletzt in <strong>de</strong>n frühen Neunzigerjahren mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Erweiterung<br />
um die neuen Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong> aktualisiert. Die verfügbaren Daten haben<br />
sich seit<strong>de</strong>m geän<strong><strong>de</strong>r</strong>t und aktuelle und zukünftige Entwicklungen <strong>de</strong>s<br />
Klimawan<strong>de</strong>ls sollen mit berücksichtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Regionalisierte Daten für das Gebiet <strong><strong>de</strong>r</strong> Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland<br />
- verfügbare Feldarbeitstage für die Bo<strong>de</strong>nbearbeitung (Parameter: Anspruchstufen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsverfahren, Befahrbarkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Bö<strong>de</strong>n)<br />
- verfügbare Mähdruschstun<strong>de</strong>n Juni bis Oktober (Parameter: Kornfeuchte)<br />
- verfügbare Raufuttererntetage (Parameter: Abtrocknung <strong>de</strong>s Ernteguts)<br />
Die Daten zu <strong>de</strong>n verfügbaren Feldarbeitstagen dienen <strong><strong>de</strong>r</strong> Kapazitätsplanung<br />
(Abgleich Zeitangebot und Zeitbedarf) landwirtschaftlicher Arbeitsverfahren<br />
in <strong><strong>de</strong>r</strong> Außenwirtschaft.<br />
- Aktualisiertes Kapitel „Klimagebiete und verfügbare Feldarbeitstage“ für<br />
<strong>KTBL</strong>-Datensammlung.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
Dr. G. Augter<br />
Sven Boese<br />
Dreieich<br />
Saaten-Union, Isernhagen<br />
PD Dr. J. Brunotte<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. J. Degner<br />
Dr. H. Kübler<br />
Dr. M. Lorenz<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Thüringer Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Jena<br />
Hofgut Raitzen<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
P. Parker Universität Gießen, Gießen<br />
Dr. H. Risius<br />
Dr. W. Schäfer<br />
Prof. Dr. T. Toews<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e. V., Potsdam<br />
Lan<strong>de</strong>samt für Bergbau, Energie und Geologie,<br />
Hannover<br />
Fachhochschule Bingen, Bingen<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Dr. F. Kloepfer<br />
79
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pfanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Praxisreife Verfahren <strong><strong>de</strong>r</strong> Streifenbearbeitung unter mitteleuropäischen<br />
Bedingungen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.2.14<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 15.01.2011<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Forschungseinrichtungen und Landtechnikhersteller in Deutschland und Europa<br />
untersuchen die Einsatzmöglichkeiten, <strong><strong>de</strong>r</strong> seit einigen Jahren in <strong>de</strong>n<br />
USA schon etablierten Streifenbearbeitung (strip tillage), in Mitteleuropa. Die<br />
Ergebnisse dieser Untersuchungen wur<strong>de</strong>n bisher noch nicht gemeinsam<br />
analysiert, strukturiert und systematisiert veröffentlicht.<br />
Der Status Quo <strong><strong>de</strong>r</strong> Untersuchungen zum Thema Streifenbearbeitung ist<br />
beschrieben und die praxisreifen Techniken sind aufgezeigt.<br />
- Auf einer Arbeitsgruppensitzung mit Gästen am 15. und 16. Mai 2013 wird<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> aktuelle Wissensstand zum Thema Streifenbearbeitung vorgestellt<br />
und die Aussagen <strong>de</strong>s geplanten Heftes wer<strong>de</strong>n abgestimmt.<br />
- Ein Heft gibt <strong>de</strong>n Stand <strong><strong>de</strong>r</strong> Forschung wie<strong><strong>de</strong>r</strong> und stellt das Anbausystem<br />
Streifenbearbeitung mit seinen Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten vor. Ein Überblick über die<br />
verfügbare praxisreife Technik wird ebenso enthalten sein.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
Dr. M. Demmel<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. J. Bischoff<br />
PD Dr. J. Brunotte<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft,<br />
Freising-Weihenstephan<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Forsten und<br />
Gartenbau, Bernburg<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
D. Dölger Hanse Agro Beratung und Entwicklung GmbH,<br />
Gettorf<br />
Dr. W. Hermann<br />
Universität Hohenheim, Stuttgart<br />
A. Hirl Innovative Agrartechnik GmbH, Bresegard<br />
E. Müller Sächsische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Nossen<br />
D. Rieve Muuks<br />
Dr. W. Schmidt (bis<br />
16.05.2013)<br />
J. Schulze-Wext Bergzow<br />
Dr. H. Sparing<br />
Dr. N. Uppenkamp<br />
PD Dr. H.-H. Voßhenrich<br />
Dr. J. Grube<br />
Sächsische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Nossen<br />
Freist<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Münster<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
80
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Datensammlung „Freilandbewässerung”<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.2.15<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Die Bewässerung von landwirtschaftlichen Feldkulturen kann ertragssteigernd<br />
wirken ist aber in je<strong>de</strong>m Fall arbeits- und kostenintensiv. Die <strong>KTBL</strong>-<br />
Datensammlung Feldbewässerung aus <strong>de</strong>m Jahr 2009 bietet Planungsdaten,<br />
mit <strong>de</strong>nen sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsaufwand und die Kosten kalkulieren lassen.<br />
2011 wur<strong>de</strong>n im Auftrag <strong>de</strong>s <strong>KTBL</strong> Kennzahlen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitswirtschaft erhoben,<br />
die eine noch <strong>de</strong>tailliertere Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitswirtschaft ermöglichen.<br />
Für Planungsrechnungen und betriebswirtschaftliche Bewertungen von Freilandbewässerungen<br />
stehen <strong>de</strong>n Nutzern neue Daten zur Arbeitswirtschaft<br />
sowie aktuelle Preise von Stoffen und Technik zur Verfügung.<br />
- Die Datensammlung liefert grundlegen<strong>de</strong> Informationen für Planungsrechnungen<br />
und betriebswirtschaftliche Bewertungen. Sie umfasst die<br />
Wasserbereitstellung sowie fünf Bewässerungssysteme.<br />
Planungsbeginn 05.11.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.06.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
J. Anter Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Dr. A. Butz<br />
Landwirtschaftliches Technologiezentrum<br />
Augustenberg, Rheinstetten<br />
E. Fricke Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Ol<strong>de</strong>nburg<br />
F. Hagene<strong><strong>de</strong>r</strong> Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Landshut, Landshut<br />
J. Kleber Forschungsanstalt Geisenheim, Geisenheim<br />
Dr. M. Müller<br />
Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und<br />
Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern<br />
e.V., Freising<br />
R. Scheyer Lan<strong>de</strong>sbetrieb Landwirtschaft Hessen,<br />
Griesheim<br />
Dr. A. Teichert<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
H.-H. Thörmann<br />
Dr. S. Weinheimer<br />
T. Belau<br />
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften,<br />
Su<strong><strong>de</strong>r</strong>burg<br />
Thünen-Institut, Braunschweig<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum<br />
Rheinpfalz, Neustadt<br />
81
Arbeitsschwerpunkt Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pfanzenproduktion<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Referenten „Land- und Energietechnik“ (Ref. LT EN)<br />
Arbeitskreis<br />
Projekt-Nr. PGW 2.1.4.5<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
- CD mit Vorträgen.<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s unterschiedlichen Aufbaus <strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung in <strong><strong>de</strong>r</strong> BRD<br />
wur<strong>de</strong> im Jahre 1974 <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitskreis Referenten Landtechnik gegrün<strong>de</strong>t, um<br />
<strong>de</strong>n Erfahrungsaustausch und die Diskussion über neue Erkenntnisse im Bereich<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Landtechnik und <strong><strong>de</strong>r</strong> Energie zu ermöglichen sowie Konsequenzen<br />
für die Beratertätigkeit abzuschätzen.<br />
Angebot einer Plattform zur neutralen Diskussion über aktuelle und zukünftige<br />
Themen <strong><strong>de</strong>r</strong> Land- und Energietechnik. Weiterhin ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Austausch zwischen<br />
<strong>de</strong>n Referenten <strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung notwendig, da es keine flächen<strong>de</strong>cken<strong>de</strong><br />
Beratung für je<strong>de</strong>s Fachgebiet gibt. Neuigkeiten aus <strong>de</strong>m Bereich<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung sowie aus <strong>de</strong>m <strong>KTBL</strong> wer<strong>de</strong>n vorgestellt und diskutiert.<br />
- Arbeitstagung im geschlossenen Kreis mit 40 bis 50 Teilnehmer.<br />
Projektpartner<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>s<br />
Arbeitskreises<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Offizialberatung, Referenten für Landtechnik und Energie<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion (TP)<br />
Referenten für Landtechnik und für Energie aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Län<strong><strong>de</strong>r</strong>. Ansprechpartner: Dr. H.-H. Kowalewsky, Landwirtschaftskammer<br />
Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
Dr. J. Grube<br />
82
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Projektlaufzeit Seit 3/2003<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Zur Weiterentwicklung nachhaltiger Verfahren im Gartenbau besteht Entwicklungs-<br />
und För<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbedarf. Dazu müssen neue Entwicklungen aufgegriffen,<br />
ihre Wirkungen frühzeitig eingeschätzt und Handlungsbedarf vorgegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Weiterentwicklung umfasst neben <strong>de</strong>n Aspekten <strong><strong>de</strong>r</strong> umweltverträglichen und<br />
an die Landschaft angepassten Pflanzenproduktion im Freiland und im geschützten<br />
Anbau auch soziale und ökonomische Arbeitsfel<strong><strong>de</strong>r</strong> sowie Fragen <strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeitsund<br />
Prozessqualität und Produktsicherheit.<br />
Entwicklungsten<strong>de</strong>nzen und aktueller Handlungsbedarf im Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktions-<br />
und Verfahrenstechnik im Gartenbau wer<strong>de</strong>n aufgezeigt.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft richtet Arbeitsgruppen ein und bewertet <strong><strong>de</strong>r</strong>en Ergebnisse.<br />
Darüber hinaus stellt sie Verbindungen zu an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Organisationen und Gremien<br />
her und wirkt bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Planung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen<br />
aus ihrem Fachgebiet mit.<br />
Vorschläge für KU-Vorhaben wer<strong>de</strong>n erarbeitet, die KU-<strong>Projekte</strong> sind begleitet<br />
und die Ergebnisse bewertet.<br />
Hauptausschuss<br />
Dr. F. Eckhard<br />
Sächsisches Lan<strong>de</strong>samt für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Geologie, Dres<strong>de</strong>n<br />
K. Gerstenberger Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft<br />
und Weinbau Rheinland-Pfalz, Mainz<br />
Dr. M. Geyer<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim<br />
e.V., Potsdam<br />
G. Hack Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Bonn<br />
Dr. B. Har<strong>de</strong>weg<br />
Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau<br />
e.V., Hannover<br />
E. Herrmann Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum<br />
Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Stuttgart<br />
Dr. K. Klopp<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen, Jork<br />
T. Koch Orchi<strong>de</strong>en Koch, Lennestadt<br />
Prof. Dr. J. Meyer<br />
Prof. Dr. T. Rath<br />
Technische Universität München, Freising<br />
Leibniz Universität Hannover, Hannover<br />
BMELV-Vertreter Dr. I. Braune Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, Bonn<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
T. Belau<br />
83
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Datensammlung Stau<strong>de</strong>n und Topfpflanzen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.2.6<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.10.2008<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 28.02.2014<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Es liegen keine aktuellen Beschreibungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktionsverfahren sowie Daten<br />
für die Verfahren vor.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>Projekte</strong>s liegt eine Datensammlung „Stau<strong>de</strong>n und Topfpflanzen“<br />
vor und die <strong>KTBL</strong>-Datenbank ist um <strong>de</strong>n Bereich Stau<strong>de</strong>n und Topfpflanzen erweitert.<br />
- In einer Spezialdatensammlung wer<strong>de</strong>n analog zur Spezialdatensammlung<br />
„Containerschule“ Planungsdaten und Leistungs-Kostenrechnungen für die<br />
Stau<strong>de</strong>n- und Topfpflanzenerzeugung angeboten.<br />
- Eine die Datensammlung ergänzen<strong>de</strong> Kalkulationsanwendung in Excel erlaubt<br />
betriebsindividuelle Kalkulationen.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
Prof. Dr. R. Burmann<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Prof. Dr. A. Bettin<br />
Osnabrück<br />
Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
M. Fischer Pöppelmann GmbH & Co., Lohne<br />
N. Gröger Ingenieurbüro Gröger, Kleve<br />
C. Nobis Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Münster<br />
P. Rehrmann Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
U. Ruttensperger Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau,<br />
Hei<strong>de</strong>lberg<br />
T. Wolf Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Straelen<br />
Dr. R. Uhte<br />
C. Reinhold<br />
Ralf Uthe Software-Entwicklung & Betriebswirtschaft,<br />
Hannover<br />
84
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Normung von Datenfunk<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.2.9<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 13.10.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Neue Technologien <strong><strong>de</strong>r</strong> drahtlosen Kommunikation ermöglichen die Vernetzung<br />
entfernter Systeme von Sensoren und Aktoren. Anwendungsgebiete sind z. B.<br />
die Bewässerungssteuerung im Gartenbau, zukünftig aber auch die Kommunikation<br />
zwischen Maschinen und Anbaugeräten. Protokolle und Inhalte <strong><strong>de</strong>r</strong> drahtlosen<br />
Kommunikation in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft sind noch nicht spezifiziert und wer<strong>de</strong>n<br />
bei Bedarf von <strong>de</strong>n Herstellern <strong>de</strong>finiert. Für die Kommunikation zwischen verschie<strong>de</strong>nen<br />
Herstellern wer<strong>de</strong>n jedoch einheitliche Standards benötigt. Mit <strong>de</strong>m<br />
ISOBUS liegt für die drahtgebun<strong>de</strong>ne Kommunikation ein Standard vor, <strong><strong>de</strong>r</strong> für<br />
drahtlose Netzwerke spezifiziert und erweitert wer<strong>de</strong>n kann. Ziel ist die Standardisierung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> drahtlosen Kommunikation zwischen Sensoren und Aktoren in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Landwirtschaft.<br />
Es wird geklärt, ob und inwiefern für das <strong>KTBL</strong> Handlungsbedarf besteht. Aus<br />
einem Handlungsbedarf wird ein konkreter Arbeitsauftrag formuliert, z. B. Gründung<br />
einer <strong>KTBL</strong>-Arbeitsgruppe o<strong><strong>de</strong>r</strong> Initiierung eines Normungsvorhabens.<br />
- In einem <strong>KTBL</strong>-Fachgespräch wird die Standardisierung <strong><strong>de</strong>r</strong> drahtlosen Kommunikation<br />
diskutiert und <strong><strong>de</strong>r</strong> Handlungsbedarf bestimmt (2 halbe Tage, einzügig,<br />
20 Teilnehmer, national).<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Dr. M. Beck Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,<br />
Arbeitsgruppe 9 Freising<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Prof. Dr. H. Bernhardt<br />
Dr. J.-H. Harms<br />
Technische Universität München, Freising<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Landwirtschaft, Poing-<br />
Grub<br />
F. Kirchberger Agrarsystem GmbH, Ebensfeld<br />
U. Knoblich Amber Wireless GmbH, Trier<br />
C. Mühlmann Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising<br />
Prof. Dr. S. Peisl<br />
Dr. M. Rothmund<br />
Dr. F. Kloepfer<br />
Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt für Weinbau und Gartenbau,<br />
Veitshöchheim<br />
Horsch Holding GmbH, Schwandorf<br />
9 Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong> ist noch nicht gewählt.<br />
85
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Metho<strong>de</strong>nentwicklung zur Ermittlung <strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz im Gartenbau<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.2.10<br />
Problemstellung Es liegen verschie<strong>de</strong>ne Berechnungsmetho<strong>de</strong>n für die Erstellung eines CO 2 -<br />
Footprint im Gartenbau (ISO14000-Serie, PAS2050-Standard, GHG-Protocol)<br />
und eines Energieausweises für Wohngebäu<strong>de</strong> nach EnEV 2009 vor. Diese sind<br />
für Gewächshäuser nicht 1:1 anwendbar. Für einen Energieausweis „Gewächshäuser“<br />
muss eine solche Berechnungsmetho<strong>de</strong> geschaffen wer<strong>de</strong>n. Dabei sollen<br />
weitestgehend die vorhan<strong>de</strong>nen Berechnungsmetho<strong>de</strong>n verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.05.2012<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 28.02.2015<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Es wird eine abgestimmte praktikable Metho<strong>de</strong> zur Ermittlung <strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz<br />
im Unterglasgartenbau erarbeitet und beispielhaft für die Erstellung eines<br />
Energieausweis angewen<strong>de</strong>t.<br />
- In einem Fachgespräch wer<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> Entwurf einer Berechnungsmetho<strong>de</strong> für<br />
die Erstellung <strong>de</strong>s Energieausweises für Gewächshäuser vorgestellt sowie<br />
notwendige Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen und Ergänzungen formuliert.<br />
- In einer Schrift wird eine abgestimmte Metho<strong>de</strong> zur Erstellung eines Energieausweises<br />
für Gewächshäuser beschrieben. Dies beinhaltet die Bestimmung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Energieeffizienz im geschützten Anbau.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
Prof. Dr. H. Bre<strong>de</strong>nbeck<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
Dr. B. Har<strong>de</strong>weg<br />
Dr. D. Ludolph<br />
Prof. Dr. J. Meyer<br />
Prof. Dr. K. Schockert<br />
Dr.-Ing. B. von Elsner<br />
Fachhochschule Erfurt, Erfurt<br />
Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V.,<br />
Hannover<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen, Hannover<br />
Technische Universität München, Freising<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz,<br />
Neustadt<br />
Leibniz Universität Hannover, Hannover<br />
B. Wenzel Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Straelen<br />
C. Reinhold<br />
86
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Umweltschonen<strong>de</strong> Bewässerung und Düngung in Gewächshäusern und auf Containerkulturflächen<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.2.11<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 15.08.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 27.02.2016<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Bewässerungs- und Düngungssysteme sind im gesamten Gartenbau ein fester<br />
Bestsandteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion. Sie wer<strong>de</strong>n in <strong><strong>de</strong>r</strong> Freiland- und Unterglasproduktion<br />
eingesetzt. Mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Einführung <strong><strong>de</strong>r</strong> Verordnung über Anlagen zum<br />
Umgang mit wassergefähr<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Stoffen wer<strong>de</strong>n auch an Gartenbaubetriebe mit<br />
Gewächshäusern und Cotainerkulturflächen spezielle Anfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen gestellt.<br />
Eine aktuelle Veröffentlichung mit Hinweisen für eine umwelt- und grundwasserschonen<strong>de</strong><br />
Bewirtschaftung von Gewächshäusern und Cotainerkulturflächen ist<br />
aber nicht verfügbar.<br />
Unteren Wasserbehör<strong>de</strong>n und Betreibern von Gartenbaubetrieben wer<strong>de</strong>n Beurteilungsgrundlagen<br />
und Hinweise zum umweltgerechten Einsatz von Flüssigdünger<br />
in Gewächshäusern und auf Cotainerkulturflächen geliefert. Die technische<br />
Ausrüstung <strong><strong>de</strong>r</strong> Verteilsysteme und Lagerung steht dabei im Mittelpunkt.<br />
- In einer Schrift wer<strong>de</strong>n die an die Anlagen zur Verteilung und Lagerung von<br />
Flüssigdünger in Gewächshäusern und auf Cotainerkulturflächen gestellten<br />
Umweltanfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen und <strong><strong>de</strong>r</strong>en Umsetzung in die Praxis beschrieben.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
G. Hack Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Münster<br />
T. Koch Orchi<strong>de</strong>en Koch, Lennestadt<br />
R. Lüttmann Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen, Ol<strong>de</strong>nburg<br />
T. Belau<br />
87
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
ZINEG - Transfer in die Praxis und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Arbeitsgruppe, Drittmittelprojekt<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.4.13<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 15.08.2008<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.03.2015<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Im Verbundvorhaben „Zukunftsinitiative Niedrigenergiegewächshaus (ZINEG)"<br />
erarbeiten die beteiligten Institutionen Lösungen für die gärtnerische Praxis, um<br />
<strong>de</strong>n Verbrauch fossiler Energie und damit die CO 2 -Emmissionen im Unterglasbereich<br />
zu reduzieren. Diese Lösungen wer<strong>de</strong>n im Projekt pflanzenbaulich,<br />
ökonomisch und ökologisch bewertet.<br />
Das <strong>KTBL</strong> hat als Unterauftragnehmer in <strong>de</strong>m Projekt ZINEG die Aufgabe <strong>de</strong>s<br />
Wissenstransfers in die Praxis übernommen. Eine projektbegleiten<strong>de</strong> Arbeitsgruppe<br />
berät die Wissenschaftler bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Versuchsplanung und -durchführung,<br />
evaluiert die Ergebnisse und bereitet sie zielgruppengerecht auf.<br />
Nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Hälfte <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektlaufzeit wer<strong>de</strong>n die Zwischenergebnisse zielgruppengerecht<br />
aufgearbeitet über das Informationsportal hortigate veröffentlicht.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Projekts wer<strong>de</strong>n alle Ergebnisse in Form von Heften und Foliensammlungen<br />
für die gärtnerische Praxis, Beratung und Lehre veröffentlicht.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Heft mit Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Lösungen für CO 2 -neutrale Energieversorgung<br />
und Wärmebedarfsminimierung bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzenproduktion im Unterglasbereich.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Heft mit Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Lösungen für eine optimal wärmegedämmte<br />
Gewächshaushülle.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Heft mit Darstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Lösungen für eine geschlossene Betriebsweise<br />
von Gewächshäusern.<br />
- Internetpräsenz www.zineg.<strong>de</strong>; Inhalt: Projektziele, Projektbeteiligte, Versuchsstandorte,<br />
Informationen zu relevanten Veranstaltungen, Kurzinformationen<br />
zu <strong>de</strong>n Versuchsergebnissen.<br />
- <strong>KTBL</strong>-Fachgespräch mit 50 Teilnehmern, ergänzend evtl. ein zweiter Termin<br />
(eintägig; Durchführung an einem <strong><strong>de</strong>r</strong> drei ZINEG-Standorte).<br />
- ZINEG-Infodienst stellt monatlich <strong><strong>de</strong>r</strong> gärtnerischen Fachpresse Informationen<br />
zu Neuigkeiten aus <strong>de</strong>m Projekt zur Verfügung.<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik im Gartenbau (TBG)<br />
142.490 €, Leibniz Universität Hannover<br />
Projektpartner G. Akyazi Leibniz Universität Hannover, Hannover<br />
C. Becker Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt<br />
e.V., Großbeeren<br />
Prof. Dr. B. Beßler<br />
Prof. Dr. A. Bettin<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Hannover<br />
Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
Prof. Dr. W. Bokelmann<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
D. Dannehl Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
J. Flenker Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
Dr. M. Geyer<br />
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-<br />
Bornim e. V., Potsdam<br />
Fortsetzung nächste Seite<br />
88
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Dr. B. Har<strong>de</strong>weg<br />
Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau<br />
e.V., Hannover<br />
M. Horscht Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Hannover<br />
Dr. H.-P. Kläring<br />
Dr. Y. Klopotek<br />
Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt<br />
e.V., Großbeeren<br />
Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt<br />
e.V., Großbeeren<br />
K. Knösel Leibniz Universität Hannover, Hannover<br />
A. Kreuzpaintner Technische Universität München, Freising<br />
Dr. A. Krumbein<br />
Dr. N. Laun<br />
Dr. D. Ludolph<br />
Prof. Dr. J. Meyer<br />
Dr. H.-P. Römer<br />
Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt<br />
e.V., Großbeeren<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz,<br />
Neustadt<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>sachsen,<br />
Hannover<br />
Technische Universität München, Freising<br />
Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
P. Rehrmann Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
Dr. T. Roksch<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
I. Schluch Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
M. Schlüpen Technische Universität München, Freising<br />
Prof. Dr. U. Schmidt<br />
Prof. Dr. K. Schockert<br />
Prof. Dr. H.-J. Tantau<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin<br />
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz,<br />
Neustadt<br />
Leibniz Universität Hannover, Hannover<br />
P. Wilms Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Prof. Dr. H. Bre<strong>de</strong>nbeck Fachhochschule Erfurt, Erfurt<br />
(Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>)<br />
G. Hack Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Bonn<br />
P. Heise Landratsamt Ludwigsburg, Ludwigsburg<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Prof. Dr. A. Ulbrich<br />
C. Reinhold, Dr. W. Graf<br />
Hochschule Osnabrück, Osnabrück<br />
89
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Berater und Wissenschaftler für Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
(AK BWTG)<br />
Arbeitskreis<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.4.2<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s unterschiedlichen Aufbaus <strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung und <strong><strong>de</strong>r</strong> Wissenschaftsszene<br />
in Deutschland ist eine Plattform nötig, um <strong>de</strong>n Erfahrungsaustausch<br />
und die Diskussion über neue Erkenntnisse im Bereich Technik und Bauwesen<br />
im Gartenbau zu ermöglichen sowie Konsequenzen für die Beratertätigkeit<br />
und die Forschung abzuleiten.<br />
Fortbildung und neutrale Diskussion über aktuelle und zukünftige Themen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Technik und <strong>de</strong>s Bauwesens im Gartenbau. Weiterhin ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Austausch innerhalb<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung und mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Wissenschaft notwendig, da es keine flächen<strong>de</strong>cken<strong>de</strong><br />
Beratung für je<strong>de</strong>s Fachgebiet gibt. Neuigkeiten aus <strong>de</strong>m Bereich<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Offizialberatung, <strong><strong>de</strong>r</strong> Wissenschaft sowie aus <strong>de</strong>m <strong>KTBL</strong> wer<strong>de</strong>n vorgestellt<br />
und diskutiert.<br />
- Fortbildungsseminar mit Exkurison im geschlossenen Kreis.<br />
- CD mit <strong>de</strong>n Beiträgen zum Seminar<br />
Projektpartner<br />
Auftraggeber<br />
Offizialberatung und Wissenschaftler für Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>s<br />
Beirates vom<br />
Arbeitskreis<br />
Prof. Dr. H. Bre<strong>de</strong>nbeck Fachhochschule Erfurt, Erfurt<br />
G. Hack Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,<br />
Bonn<br />
R.Lu<strong>de</strong>wig<br />
Landratsamt Tübingen, Tübingen<br />
Prof. Dr. H.-J. Tantau<br />
Leibniz Universität Hannover, Hannover<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
T. Belau<br />
90
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsblätter Gartenbau<br />
<strong>KTBL</strong>-Arbeitsblätter<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Für die Praxis und Fachberatung wer<strong>de</strong>n Informationen über technische Entwicklungen<br />
und ihre verfahrenstechnische Einordnung in <strong>de</strong>n Gartenbau benötigt.<br />
Dieser Aufgabe widmet sich das <strong>KTBL</strong> mit <strong>de</strong>n Arbeitsblättern Gartenbau.<br />
3 Arbeitsblätter pro Jahr<br />
- Auszüge in <strong><strong>de</strong>r</strong> Zeitschrift TASPO (Auflage 16.000 Stück) und als <strong>KTBL</strong>-<br />
Arbeitsblatt Gartenbau.<br />
- In <strong>de</strong>n <strong>KTBL</strong>-Arbeitsblättern wer<strong>de</strong>n technische und bauliche Grundlagen beschrieben<br />
und mit Hilfe von Grafiken erläutert. Die Arbeitsblätter wen<strong>de</strong>n sich<br />
an Gärtner, Berater, Ausbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> und Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, Gutachter und Sachverständige.<br />
Projektpartner I. Anger Haymarket Media GmbH & Co KG, Braunschweig<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
K. Weiss Haymarket Media GmbH & Co KG, Braunschweig<br />
Arbeitsgemeinschaft Technik und Bauwesen im Gartenbau (TBG)<br />
T. Belau<br />
91
Arbeitsschwerpunkt Technik und Bauwesen im Gartenbau<br />
Projekttitel<br />
BMELV-Innovationspreis Gartenbau<br />
Projektart<br />
Projekt-Nr. PGW 2.2.4.4<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.09.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Bun<strong>de</strong>swettbewerb <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>sministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz<br />
Das Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
(BMELV) vergibt für hervorragen<strong>de</strong>, beispielgeben<strong>de</strong> Innovationen im Gartenbau<br />
<strong>de</strong>n BMELV-Innovationspreis im Gartenbau.<br />
Die Preisträger wer<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sminister für Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz o<strong><strong>de</strong>r</strong> seinen Vertreter im Amt ausgezeichnet.<br />
Ausschreibung und Vergabe von Preisen für Innovationen pflanzenbaulicher,<br />
technischer, kulturtechnischer o<strong><strong>de</strong>r</strong> betriebswirtschaftlicher Art mit insgesamt<br />
15.000 € Preisgeld – nach Möglichkeit je einer in <strong>de</strong>n Kategorien Pflanze, Technik,<br />
Kooperation/Betriebsorganisation. Die Beurteilung wird von <strong><strong>de</strong>r</strong> Vergabekommission<br />
vorgenommen.<br />
- Veröffentlichung <strong><strong>de</strong>r</strong> Ausschreibung in Printmedien und Internet.<br />
- Interner Bewertungsbericht „Technik“.<br />
- Zusammenstellung <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewerbungen.<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn<br />
C. Reinhold<br />
92
Arbeitsschwerpunkt Technik im Weinbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Projekt-Nr. PGW 2.3.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziele<br />
Wissenschaftlicher Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses für Technik im Weinbau<br />
(TiW/ATW)<br />
Arbeitsgruppe, gleichzeitig wissenschaftlicher Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses für<br />
Technik im Weinbau (ATW)<br />
Zur Weiterentwicklung weinbaulicher Bewirtschaftungssysteme sowie im Kellertechnik-<br />
und Managementbereich von Weinbaubetrieben besteht Entwicklungsund<br />
För<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbedarf. Dazu müssen neue Entwicklungen aufgegriffen, ihre<br />
Wirkungen frühzeitig eingeschätzt und <strong><strong>de</strong>r</strong> Handlungsbedarf vorgegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Weiterentwicklung umfasst neben <strong>de</strong>n Aspekten <strong><strong>de</strong>r</strong> nachhaltigen Produktionstechniken<br />
auch soziale und ökonomische Arbeitsfel<strong><strong>de</strong>r</strong> bis hin zu Fragen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Arbeits- und Prozessqualität und Produktsicherheit.<br />
Entwicklungsten<strong>de</strong>nzen und aktueller Handlungsbedarf im Bereich <strong><strong>de</strong>r</strong> Produktions-<br />
und Verfahrenstechnik im Weinbau wer<strong>de</strong>n aufgezeigt.<br />
Die Arbeitsgruppe/Arbeitsgemeinschaft fungiert als Lenkungsgremium, richtet<br />
Arbeitsgruppen ein und bewertet <strong><strong>de</strong>r</strong>en Ergebnisse. Darüber hinaus stellt sie<br />
Verbindungen zu an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Organisationen und Gremien her und wirkt bei <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Planung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen aus ihrem Fachgebiet<br />
mit.<br />
Vorschläge für KU-Vorhaben wer<strong>de</strong>n erarbeitet, die KU-<strong>Projekte</strong> sind begleitet<br />
und die Ergebnisse bewertet.<br />
Projektlaufzeit Seit 07/1952<br />
Projektpartner 10 Deutscher Weinbauverband e.V., Bonn<br />
Auftraggeber<br />
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V., Frankfurt/M<br />
Ausschuss für Technik im Weinbau (ATW) mit <strong>KTBL</strong> als Trägerorganisation<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>s<br />
Beirates<br />
Gäste<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
H. Fischer (Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,<br />
Weinbau und Forsten, Mainz<br />
Dr. R. Jung<br />
Dr. M. Stoll<br />
Hochschule Geisenheim University, Geisenheim<br />
Hochschule Geisenheim University, Geisenheim<br />
M. Stumpf Weingut Bickel-Stumpf, Frickenhausen<br />
O. Walg Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum<br />
Rheinhessen, Bad Kreuznach<br />
Dr. J. Dietrich<br />
(ATW-Vorstand)<br />
Staatsweingut Meersburg, Meersburg<br />
P. Jost (ATW-Vorsitzen<strong><strong>de</strong>r</strong>) Weingut Hahnenhof, Bacharach<br />
Prof. Dr. H.-P. Schwarz<br />
(ATW-GF-Vorstand)<br />
C. Reinhold<br />
Hochschule Geisenheim University, Geisenheim<br />
10 Gemeinsam mit <strong>de</strong>m <strong>KTBL</strong> Träger <strong>de</strong>s Ausschusses für Technik im Weinbau.<br />
93
Arbeitsschwerpunkt Technik im Weinbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Beson<strong><strong>de</strong>r</strong>heiten<br />
Produkt(e)<br />
Forschungsvorhaben Technik im Weinbau und in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kellerwirtschaft<br />
Drittmittelprojekt<br />
Zunehmen<strong>de</strong> Umweltauflagen und zurückgehen<strong>de</strong> Wirtschaftlichkeit zwingen zu<br />
umweltschonen<strong>de</strong>n und rationellen Arbeitsmetho<strong>de</strong>n im Winzerbetrieb. In <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Kellerwirtschaft sind Qualität erhalten<strong>de</strong> Maßnahmen, die sich aus anbautechnischen<br />
Entwicklungen ergeben, von aktueller Be<strong>de</strong>utung. Zur Einführung neuer<br />
Metho<strong>de</strong>n und Techniken im Weinbau wie in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kellerwirtschaft sind begleiten<strong>de</strong><br />
Untersuchungen durchgeführt, um Fehlentwicklungen vermei<strong>de</strong>n zu helfen.<br />
Die Län<strong><strong>de</strong>r</strong> Bayern, Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz finanzieren<br />
die Forschungsvorhaben Technik im Weinbau und in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kellerwirtschaft.<br />
Dem <strong>KTBL</strong> obliegen die Mittelverwaltung und die Veröffentlichung <strong><strong>de</strong>r</strong> Versuchsergebnisse.<br />
Die Ergebnisse <strong><strong>de</strong>r</strong> Untersuchungen wer<strong>de</strong>n Beratern, Firmen und Praktikern<br />
zur Verfügung gestellt und ggf. Entscheidungsträgern in <strong>de</strong>n Verwaltungen als<br />
Datenmaterial an die Hand gegeben.<br />
Im <strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> wer<strong>de</strong>n die Vorhaben für das Jahr 2013 zur Kenntnis<br />
aufgeführt (siehe nächste Seite).<br />
- Berichterstattung im Fachorgan DEUTSCHER WEINBAU <strong>de</strong>s Deutschen<br />
Weinbauverban<strong>de</strong>s.<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
- <strong>KTBL</strong>-Schriften und Manuskriptveröffentlichungen.<br />
Projektpartner<br />
Auftraggeber<br />
Drittmittel<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Forschungsring <strong>de</strong>s Deutschen Weinbaues (FDW bei <strong><strong>de</strong>r</strong> DLG)<br />
Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong> Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz<br />
48.000 € (Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong> Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-<br />
Pfalz)<br />
C. Reinhold<br />
94
Arbeitsschwerpunkt Technik im Weinbau<br />
Vorhaben 2012 (Kennziffer, Thema, Projektnehmer)<br />
ATW 178<br />
Untersuchung unterschiedlicher Desinfektionsmittel<br />
bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Flaschensterilisation<br />
mittels Rinser<br />
J. Seckler u. Dr. M. Freund, Hochschule Geisenheim<br />
University, Geisenheim<br />
ATW 179<br />
Arbeitswirtschaftlicher Vergleich <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Nutzung pilzwi<strong><strong>de</strong>r</strong>standsfähiger und<br />
-anfälliger Rebsorten<br />
ATW 180 Alternative Sektflaschenverschlüsse –<br />
vergleichen<strong>de</strong> Untersuchungen<br />
ATW 181<br />
ATW 182<br />
ATW 183<br />
ATW 184<br />
ATW 185<br />
Rotweinausbau in Barriquefässer<br />
<strong>de</strong>utscher Herkünfte<br />
Spektrale Messmetho<strong>de</strong>n zur Insitu-<br />
Bestimmung qualitativer Parameter im<br />
Weinberg<br />
Mechanische Ausdünnung in extensiven<br />
Erziehungsformen<br />
Aktuelle Verfahren zur mechanischen<br />
Bo<strong>de</strong>nbearbeitung im Unterstockbereich<br />
Untersuchungen neuer technischer Möglichkeiten<br />
zur Mechanisierung <strong>de</strong>s Aushebens<br />
beim Rebschnitt<br />
E. Weinmann u. Dr. V. Jörger, Staatliches<br />
Weinbauinstitut, Freiburg<br />
Prof. Dr. R. Jung, Hochschule Geisenheim<br />
University, Geisenheim<br />
Dr. G. Bin<strong><strong>de</strong>r</strong>, DLR Rheinpfalz, Neustadt<br />
Dr. M. Stoll, Hochschule Geisenheim University,<br />
Geisenheim<br />
E. Sauer u. C. Deppisch, Bayerische Lan<strong>de</strong>sanstalt<br />
für Wein- und Gartenbau, Veitshöchheim<br />
E. Weinmann u. Dr. V. Jörger, Staatliches<br />
Weinbauinstitut, Freiburg<br />
O. Walg, Dienstleistungszentrum Ländlicher<br />
Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad<br />
Kreuznach<br />
ATW 186 Gasmanagement in Winzerbetrieben N. Breier, Dienstleistungszentrum Ländlicher<br />
Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück,<br />
Oppenheim<br />
ATW 187<br />
Technische Entfernung von tierischen<br />
Scha<strong><strong>de</strong>r</strong>regern aus <strong>de</strong>m Lesegut<br />
Dr. M. Rentzsch u. J. Burkert, Bayerische<br />
Lan<strong>de</strong>sanstalt für Wein- und Gartenbau,<br />
Veitshöchheim<br />
95
Arbeitsschwerpunkt Technik im Weinbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Praxis <strong>de</strong>s ökologischen Weinbaus<br />
Weiteres Projekt<br />
Projekt-Nr. PGW 2.3.4.5<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 20.05.2010<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Auftraggeber<br />
Die Vorgaben für die Umstellung von konventionellen auf ökologischen Weinbau<br />
wur<strong>de</strong>n seit Erscheinen <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Schrift 459 geän<strong><strong>de</strong>r</strong>t. Aus diesem Grund ist<br />
eine Aktualisierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Schrift erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>lich.<br />
Die Schrift „Praxis <strong>de</strong>s ökologischen Weinbaus" liegt als Neuauflage vor. In dieser<br />
Schrift erhalten Fachleute einen Einblick in die Grundlagen <strong>de</strong>s ökologischen<br />
Weinbaus und die Vorgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> EG-Öko-Verordnung. Schwerpunkte <strong><strong>de</strong>r</strong> Schrift<br />
wer<strong>de</strong>n die Anbautechnik und <strong><strong>de</strong>r</strong> Rebschutz sein. Der ökologische Weinbau<br />
nach <strong><strong>de</strong>r</strong> biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise wird ebenfalls vorgestellt. Die<br />
beson<strong><strong>de</strong>r</strong>en Belange <strong><strong>de</strong>r</strong> Umstellung, <strong><strong>de</strong>r</strong> Kontrolle und <strong><strong>de</strong>r</strong> Vermarktung sollen<br />
erläutert wer<strong>de</strong>n.<br />
- In <strong><strong>de</strong>r</strong> überarbeiteten Schrift 459 erhalten Fachleute einen Einblick in die<br />
Grundlagen <strong>de</strong>s ökologischen Weinbaus und die Vorgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> EG-Öko-<br />
Verordnung mit <strong>de</strong>n Schwerpunkten Anbautechnik, Rebschutz und biologischdynamische<br />
Wirtschaftsweise.<br />
Wissenschaftlicher Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses für Technik im Weinbau (TiW/ATW),<br />
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
Auftragnehmer Prof. Dr. R. Kauer Hochschule Rhein-Main, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
B. Fa<strong><strong>de</strong>r</strong> Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen,<br />
Oppenheim<br />
C. Reinhold<br />
96
Arbeitsschwerpunkt Technik im Weinbau<br />
Projekttitel<br />
Projektart<br />
Datensammlung Weinbau und Kellerwirtschaft<br />
Arbeitsgruppe<br />
Projekt-Nr. PGW 2.3.4.9<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Die Produktionsplanung gehört zu <strong>de</strong>n grundlegen<strong>de</strong>n Aufgaben weinbaulicher<br />
Unternehmen und umfasst Entscheidungen über die Kapazitätsausstattung,<br />
über das Produktionsprogramm und über <strong>de</strong>n Produktionsprozess. Zur Kalkulation<br />
wer<strong>de</strong>n Planungsdaten und abgestimmte methodische Grundlagen benötigt.<br />
Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e wenn betriebsindividuelle Daten fehlen, sind verlässliche<br />
Planungswerte be<strong>de</strong>utsam. Zum Vergleich und Interpretation eigener Daten<br />
und Planungsergebnisse sind neutrale Kennzahlen hilfreich.<br />
Für Planungsrechnungen und betriebswirtschaftliche Bewertungen in Weinbau<br />
und Kellerwirtschaft stehen zuverlässige Informationen zur Verfügung. Neue<br />
Angaben zu Betriebsmittelpreisen, Maschinenkosten, etc. wer<strong>de</strong>n erhoben und<br />
zusammengestellt. Die erweiterte Kostenkalkulation <strong><strong>de</strong>r</strong> Maschinen und Anlagen<br />
bil<strong>de</strong>t die Grundlage für die Bewertung von Neu-, Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen.<br />
Die Daten wer<strong>de</strong>n in <strong><strong>de</strong>r</strong> Datenbank eingepflegt und online<br />
verfügbar sein.<br />
Produkt(e) - Die Datensammlung bietet analog zur Datensammlung "Betriebsplanung<br />
Landwirtschaft" Planungsdaten und Leistungs-Kostenrechnungen für <strong>de</strong>n<br />
Weinbau und die Kellerwirtschaft.<br />
Planungsbeginn 18.03.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 30.06.2016<br />
Auftraggeber<br />
Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Arbeitsgruppe<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Wissenschaftlicher Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses für Technik im Weinbau (TiW/ATW)<br />
Dr. J. Dietrich<br />
Prof. Dr. R. Jung<br />
Prof. Dr. H.-P. Schwarz<br />
Staatsweingut Meersburg, Meersburg<br />
Hochschule Geisenheim University, Geisenheim<br />
Hochschule Geisenheim University, Geisenheim<br />
O. Walg Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück,<br />
Bad Kreuznach<br />
C. Reinhold<br />
97
Arbeitsschwerpunkt Technik im Weinbau<br />
rojekttitel<br />
Projektart<br />
Arbeitsblätter Weinbau und Kellerwirtschaft<br />
<strong>KTBL</strong>-Arbeitsblätter<br />
Projektnr. PGW 2.3.4.1<br />
Problemstellung<br />
Projektziel<br />
Produkt(e)<br />
Planungsbeginn 01.01.2013<br />
<strong>Projekte</strong>n<strong>de</strong> 31.12.2013<br />
Projektpartner<br />
Auftraggeber<br />
Projektbetreuung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Geschäftsstelle<br />
Für die Praxis und Fachberatung wer<strong>de</strong>n Informationen über technischen Entwicklungen<br />
und ihre verfahrenstechnische Einordnung in <strong>de</strong>n Weinbau und die<br />
Kellerwirtschaft benötigt. Dieser Aufgabe widmet sich das Kuratorium für Technik<br />
und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft (<strong>KTBL</strong>) mit <strong>de</strong>n Arbeitsblättern Weinbau<br />
und Kellerwirtschaft..<br />
3 Arbeitsblätter pro Jahr<br />
- In <strong>de</strong>n <strong>KTBL</strong>-Arbeitsblättern wer<strong>de</strong>n technische und bauliche Grundlagen be<br />
schrieben und mit Hilfe von Grafiken erläutert. Die Arbeitsblätter wer<strong>de</strong>n einzeln<br />
und als Beilage <strong><strong>de</strong>r</strong> Zeitschrift „Das Deutsche Weinmagazin“ veröffentlicht.<br />
Fachverlag Dr. Fraund GmbH, Mainz<br />
Wissenschaftlicher Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses für Technik im Weinbau (TiW/ATW)<br />
C. Reinhold<br />
98
Anhang – Mitglie<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>KTBL</strong>-Präsidium und Hauptausschuss<br />
PRÄSIDIUM<br />
Prof. Dr. Thomas Jungbluth, Präsi<strong>de</strong>nt<br />
Wolfram Schöhl, Stellvertreten<strong><strong>de</strong>r</strong> Präsi<strong>de</strong>nt<br />
Dr. Thomas Pitschmann, Stellvertreten<strong><strong>de</strong>r</strong> Präsi<strong>de</strong>nt<br />
Dr. Michael Quinckhardt<br />
Prof. Dr. Eberhard Hartung<br />
Peter Spandau<br />
Clemens Neumann<br />
HAUPTAUSSCHUSS<br />
Prof. Dr. Barbara Benz<br />
Prof. Dr. Heinz Bernhardt<br />
PD Dr. Joachim Brunotte<br />
Prof. Dr. Reiner Brunsch<br />
Klaus Bünz<br />
Prof. Dr. Wolfgang Büscher<br />
Dr.-Ing. Wilfried Eckhof<br />
Prof. Dr. Heinz Flessa<br />
Gerd Franke<br />
PD Dr. Eva Gallmann<br />
Prof. Dr. Steffi Gei<strong>de</strong>l<br />
Prof. Dr. Bärbel Gerowitt<br />
Dr. Martin Geyer<br />
Prof. Dr. Eberhard Hartung<br />
Dr. Dirk Hesse<br />
Prof. Dr. Engel Hessel<br />
Michael Horper<br />
Dr. Jörg Hüther<br />
Ulrich Keymer<br />
Dr. Hans-Heinrich Kowalewsky<br />
Dr. Hartwig Kübler<br />
Hubertus Lappé<br />
Andreas Lin<strong>de</strong>nberg<br />
Prof. Dr. Kerstin Müller<br />
Dr. Martin Müller<br />
Dr.-Ing. Michael Mußlick<br />
Volkmar Nies<br />
Hans Preiß<br />
Prof. Dr. Gerold Rahmann<br />
PD Dr. Matthias Schick<br />
Dr. Ulrich Schumacher<br />
Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz<br />
Peter Spandau<br />
Prof. Dr. Ir. Herman Van <strong>de</strong>n Weghe<br />
Dr. Georg Wendl<br />
Dr. Jürgen Wilhelm<br />
Dr. Ute Williges<br />
Prof. Dr. Martin Ziron<br />
Dr. Werner Kloos<br />
99
Anhang – <strong>KTBL</strong>-Organisationsstruktur sowie <strong>KTBL</strong>-Vereinsstruktur und Arbeitsweise<br />
Abb. 1: <strong>KTBL</strong>-Organisationsstruktur<br />
Abb. 2: <strong>KTBL</strong>-Vereinsstruktur und Arbeitsweise<br />
100
Gremien- und Projektübersicht I, Stand: 15.11.2013<br />
Arge<br />
agroXML, aufgelöst<br />
S.7<br />
Arbeits- und Betriebswirtschaft<br />
S.11<br />
<strong>KTBL</strong>-<strong>Arbeitsprogramm</strong> Kalkulationsunterlagen (KU)<br />
S.19<br />
ISOagriNET und<br />
agroXML<br />
S.8<br />
Arbeitswirtschaftliche<br />
Grundlagen<br />
S.12<br />
Dichte von Häckselgut<br />
S.21<br />
Nutzung Motorwärme aus<br />
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen<br />
S.25<br />
Agru<br />
Gesamtbetriebskalkulationen für<br />
<strong>KTBL</strong>-Referenzbetriebe S.13<br />
Geräte zur Unkrautregulierung im<br />
Ökolandbau S.21<br />
Aufbereitung von Gärresten und<br />
Separation von Gülle<br />
S.25<br />
Maschinen- und<br />
Anlagenkostenkalkulationen S.15<br />
Verfügbare Mähdruschstun<strong>de</strong>n<br />
S.22<br />
Aufbereitung von<br />
Biogassubstraten<br />
S.26<br />
Investitionsbedarf Zuchtsauenund<br />
Ferkelställe<br />
S.22<br />
Energiebedarf in Schweineställe,<br />
Steigerung Energieeffizienz S.26<br />
Arbeitszeitbedarf in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Milchviehhaltung<br />
S.23<br />
Energiebedarf Melkanlagen<br />
und Milchkühlung<br />
S.27<br />
weitere Gremien und <strong>Projekte</strong><br />
InfrAgrar<br />
Pestici<strong>de</strong> Application Manager<br />
S.9<br />
S.10<br />
Standardoutputs und<br />
Standard<strong>de</strong>ckungsbeiträge<br />
S.16<br />
Datensammlung Betriebsplanung<br />
Landwirtschaft 2014/15<br />
S.17<br />
Datensammlung Landschaftspflege<br />
mit Schafen<br />
S.18<br />
Arbeitserledigungskosten<br />
Beweidung<br />
Dienstleistungen in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Innenwirtschaft<br />
Abluftreinigung für<br />
Schweine- u. Geflügelställe<br />
S.23<br />
S.24<br />
S.24<br />
Daten zur Arbeitserledigung<br />
im Obstbau<br />
S.27<br />
Lohnunternehmerpreise für<br />
landwirtsch. Arbeitsverfahren S.28<br />
Arge = Arbeitsgemeinschaft; Agru = Arbeitsgruppe Seite 101
Gremien- und Projektübersicht II, Stand: 15.11.2013<br />
Arge<br />
Energie (EN)<br />
S.29<br />
Klimaschutz (KS)<br />
S.36<br />
Ökologischer Landbau (ÖL)<br />
S.43<br />
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)<br />
S.30<br />
Emissionsfaktoren<br />
Tierhaltung<br />
S.37<br />
Bewertung Düngemittel<br />
im ÖL<br />
S.44<br />
Ringversuch Biogaserträge<br />
S.31<br />
Klimaschutz in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Landwirtschaft S.38<br />
Faustzahlen Ökolandbau<br />
S.45<br />
Agru<br />
Vergleichskennzahlen<br />
Energieeffizienz<br />
S.32<br />
Behornte Tiere<br />
S.46<br />
Körnerleguminosen<br />
S.47<br />
Heubergung<br />
S.49<br />
weitere Gremien und <strong>Projekte</strong><br />
Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe<br />
S.33<br />
Biogaskongress 2013<br />
MONA – Monitoring <strong>de</strong>s<br />
Biomethanprozesses<br />
S.34<br />
S.35<br />
Landwirtschaftliche<br />
Emissionsinventare<br />
S.39<br />
Integrierte Stickstoffbilanzierung<br />
S.40<br />
GÄRWERT<br />
Frameworkco<strong>de</strong><br />
„Good Agricultural Practice“<br />
S.41<br />
S.42<br />
Stickstoffbilanzierung im<br />
Leguminosenanbau S.48<br />
Investitionsbedarf von Milchviehställen<br />
für horntragen<strong>de</strong> Kühe S.50<br />
Arge = Arbeitsgemeinschaft; Agru = Arbeitsgruppe Seite 102
Gremien- und Projektübersicht III, Stand: 15.11.2013<br />
Arge<br />
Systembewertung (SB)<br />
S.51<br />
Standortentwicklung und<br />
Immissionsschutz (STI)<br />
S.59<br />
Technik und Bauwesen in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Nutztierhaltung (TBN)<br />
S.65<br />
Anfallmengen Festmist<br />
S.52<br />
Kommunale<br />
Bauleitplanung<br />
S.60<br />
Tagung<br />
Perspektiven Ebermast<br />
S.66<br />
Festmistaußenlagerung<br />
S.53<br />
Ausgleichs-/<br />
Kompensationsplanungen<br />
S.61<br />
Nationaler Bewertungsrahmen<br />
Mastschweinehaltung<br />
S.67<br />
Agru<br />
Vermeidung Stickstoffverluste<br />
bei Flüssigmistausbringung S.54<br />
Düngung mit<br />
Gärresten S.55<br />
BMELV-Mo<strong>de</strong>llvorhaben<br />
Luftqualität Legehennen<br />
S.73<br />
Buwe 2013/14<br />
Energiekonzepte Tierhaltung S.74<br />
Indikatoren zur Bewertung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Tiergerechtheit S.56<br />
BVT in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Intensivtierhaltung<br />
S.57<br />
weitere Gremien und <strong>Projekte</strong><br />
Faustzahlen<br />
Düngemittel<br />
S.58<br />
Rechtl. Rahmenbedingungen<br />
für die Tierhaltung 2013<br />
Abluftreinigung für<br />
Tierhaltungsanlagen<br />
S.62<br />
S.631<br />
Internet-Abstandsrechner VDI 3894<br />
S.64<br />
DVG-Tagung 2013<br />
Flüssigmistlagerung<br />
Baukost 3.0<br />
Landwirtschaftliche<br />
Mehrzweckhallen<br />
Arbeitskreis<br />
Län<strong><strong>de</strong>r</strong>-ALB<br />
S.69<br />
S.70<br />
S.71<br />
S.72<br />
S.75<br />
Arge = Arbeitsgemeinschaft; Agru = Arbeitsgruppe Seite 103
Gremien- und Projektübersicht IV, Stand: 15.11.2013<br />
Arge<br />
Technik in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Pflanzenproduktion (TP)<br />
S.76<br />
Technik und Bauwesen im<br />
Gartenbau (TBG)<br />
S.83<br />
Daten Futterernte und<br />
-konservierung<br />
S.77<br />
Datensammlung Stau<strong>de</strong>n<br />
und Topfpflanzen<br />
S.84<br />
Wiss. Beirat <strong>de</strong>s Ausschusses<br />
Technik im Weinbau<br />
S.93<br />
Precision Farming<br />
S.78<br />
Normung Datenfunk<br />
S.85<br />
Agru<br />
Verfügbare Feldarbeitstage<br />
Streifenbearbeitung<br />
S.79<br />
S.80<br />
Metho<strong>de</strong>nentwicklung<br />
Energieeffizienz S.86<br />
Bewässerung und<br />
Düngung S.87<br />
Datensammlung<br />
Freilandbewässerung S.81<br />
ZINEG<br />
S.88<br />
weitere Gremien und <strong>Projekte</strong><br />
Arbeitskreis Referenten Land- und<br />
Energietechnik S.82<br />
Arbeitskreis Technik und Bauwesen<br />
im Gartenbau S.90<br />
Arbeitsblätter<br />
Gartenbau<br />
BMELV-Innovationspreis<br />
Gartenbau<br />
S.91<br />
S.92<br />
ATW-Forschungsvorhaben<br />
Ökologischer<br />
Weinbau<br />
Datensammlung<br />
Weinbau u. Kellerwirtschaft<br />
Arbeitsblätter<br />
Weinbau<br />
S.94<br />
S.96<br />
S.97<br />
S.98<br />
Arge = Arbeitsgemeinschaft; Agru = Arbeitsgruppe Seite 104