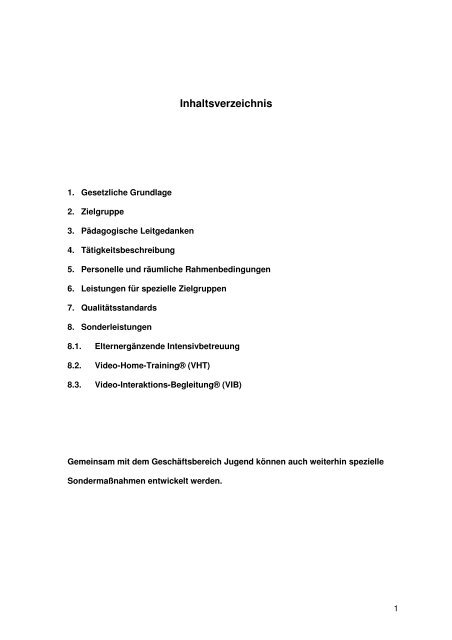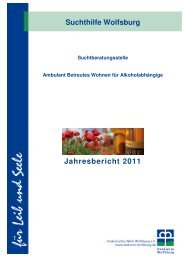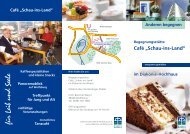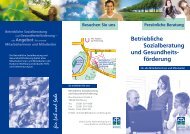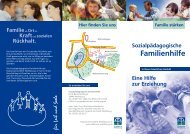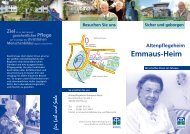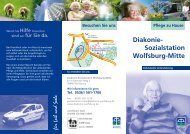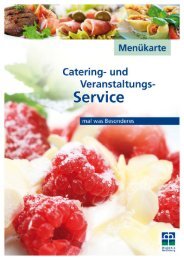Leistungsbeschreibung - Diakonie Wolfsburg
Leistungsbeschreibung - Diakonie Wolfsburg
Leistungsbeschreibung - Diakonie Wolfsburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1. Gesetzliche Grundlage<br />
2. Zielgruppe<br />
3. Pädagogische Leitgedanken<br />
4. Tätigkeitsbeschreibung<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
5. Personelle und räumliche Rahmenbedingungen<br />
6. Leistungen für spezielle Zielgruppen<br />
7. Qualitätsstandards<br />
8. Sonderleistungen<br />
8.1. Elternergänzende Intensivbetreuung<br />
8.2. Video-Home-Training® (VHT)<br />
8.3. Video-Interaktions-Begleitung® (VIB)<br />
Gemeinsam mit dem Geschäftsbereich Jugend können auch weiterhin spezielle<br />
Sondermaßnahmen entwickelt werden.<br />
1
1. Gesetzliche Grundlage<br />
Wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung<br />
nicht gewährleistet ist, besteht für Personensorgeberechtigte ein Anspruch auf Hilfe<br />
zur Erziehung (§ 27 Abs. 1 SGB VIII).<br />
SPFH ist als Arbeitsfeld mit eigenständigen Arbeitsansätzen und Methoden ein<br />
ambulantes Angebot der Hilfe zur Erziehung.<br />
Sozialpädagogische Familienhilfe soll nach § 31 KJHG „… durch intensive Betreuung<br />
und Begleitung, Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von<br />
Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen, im Kontakt mit Ämtern und<br />
Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf<br />
längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.“<br />
2. Zielgruppe<br />
SPFH als intensivste ambulante Jugendhilfeform arbeitet mit Familien in ihrem<br />
systemischen Kontext.<br />
Konkret handelt es sich dabei überwiegend um Familien, die aufgrund verschiedener<br />
Belastungssituationen eine dem Wohle der Kinder angemessene Versorgung und<br />
Erziehung nicht oder nicht genügend gewährleisten können.<br />
Gesellschaftliche Faktoren, wie z.B. Arbeitslosigkeit, schlechte Wohnverhältnisse,<br />
soziale Isolation und Armut bedingen oder verschärfen häufig die familiären<br />
Schwierigkeiten.<br />
In jedem konkreten Einzelfall ist zu prüfen, ob SPFH als Maßnahme das geeignete<br />
und angemessene Jugendhilfeangebot ist. Dabei ist die Motivation der Familie zur<br />
Mitarbeit und Veränderung im Rahmen dieses Jugendhilfeangebotes von<br />
entscheidender Bedeutung.<br />
2
3. Pädagogische Leitgedanken<br />
Grundhaltung<br />
Unser Menschenbild ist von der Grundannahme geprägt, dass Menschen ihr Leben<br />
aktiv gestalten können und wollen, d.h. sie sind bestrebt, ihr Potential zu entfalten, zu<br />
lernen und sich weiterzuentwickeln.<br />
Unser Arbeitsansatz ”Hilfe zur Selbsthilfe” stellt selbsthilfefördernde Lernprozesse in<br />
den Mittelpunkt der praktischen Arbeit. Daneben stehen unter der Berücksichtigung<br />
der Bedürfnisse der Kinder auch modellhaftes Handeln und gegebenenfalls<br />
stellvertretendes Agieren.<br />
Methodische Grundlagen<br />
Der Arbeitsansatz der SPFH orientiert sich an folgenden Grundgedanken:<br />
• Systemische Sichtweise<br />
Die systemische Sichtweise betrachtet weniger die Ursachen symptomhaften<br />
Verhaltens, sondern versucht zu erkennen, welche Funktion das gezeigte<br />
Verhalten für das Familiensystem hat.<br />
• Lebensweltorientierung<br />
Die Lebensweltorientierung macht sich zur Aufgabe, den Sinn der<br />
Alltagshandlungen der Menschen zu entdecken und ernst zu nehmen, d.h.<br />
auch kulturelle und traditionelle Hintergründe zu berücksichtigen und zu<br />
respektieren.<br />
• Ressourcenorientierung<br />
Die Ressourcenorientierung arbeitet mit einer positiv orientierten<br />
Betrachtungsweise, die die vorhandenen Stärken und Interessen entdecken,<br />
fördern und ausbauen will (Nutzung des Selbsthilfepotentials).<br />
• Ziel- und Lösungsorientierung<br />
Die zielorientierte Arbeit entwickelt konkrete Schritte zur Bearbeitung der<br />
Fragestellung der Familie. Die Lösungswege orientieren sich an den<br />
Zukunftsideen der Klienten. Inhalt, Methoden und Umfang der Hilfeform<br />
richten sich nach dem jeweiligen Bedarf im Einzelfall.<br />
3
4. Tätigkeitsbeschreibung<br />
SPFH wird geleistet in Form von Beratung und psychosozialer Begleitung,<br />
pädagogischer Intervention, Anleitung zur lebenspraktischen Kompetenz, Prävention<br />
und Sozialplanung.<br />
In Bezug auf die Zielgruppe entwickeln MitarbeiterInnen der SPFH flexible,<br />
individuelle, situations- und/oder lösungsorientierte Handlungskonzepte.<br />
Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit ist der Aushandlungsprozess<br />
zwischen Familie, SPFH und Geschäftsbereich Jugend in Form eines Hilfeplanes (§<br />
36 KJHG)<br />
Die erste Arbeitsphase beläuft sich auf 6 Monate. In diesem Zeitraum werden mit der<br />
Familie folgende Punkte bearbeitet.<br />
• Klärung von existenziellen Fragestellungen bzw. Aufträgen (z.B. Wohnraum,<br />
Finanzen). Solche Fragen sind stets vorrangig zu bearbeiten, da nur so eine<br />
Arbeitsfähigkeit erreicht werden kann. Dies gilt für den Verlauf der gesamten<br />
Maßnahme.<br />
• Aufbau eines Arbeitsbündnisses<br />
Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu den einzelnen<br />
Familienmitgliedern ist eine wichtige Basis für die gesamte Arbeit.<br />
• Erarbeitung eines Selbsthilfeplanes für die einzelnen Familienmitglieder<br />
Am Ende der Arbeitsphase findet zwischen Familie, SPFH und GB Jugend<br />
eine Bilanz über den Erfolg der gemeinsamen Arbeit statt.<br />
Den Abschluss dieser Arbeitsphase bildet eine Hilfeplanung/-fortschreibung<br />
mit der Familie, dem GB Jugend und der SPFH. In diesem Gespräch werden<br />
die Arbeitsergebnisse ausgewertet. Auf dieser Grundlage werden mittel- und<br />
langfristige Ziele sowie konkrete Handlungsschritte für den weiteren Verlauf<br />
festgehalten. Je nach Grad der Verselbständigung der Familie gibt es<br />
folgende Möglichkeiten:<br />
1. Beendigung<br />
2. Fortführung der begleitenden Arbeit der SPFH mit Festlegung von Inhalten<br />
und Stundenumfang<br />
3. Intervall<br />
4
Das Intervall ist eine Phase der Selbsterprobung der Familie. Sie kann eingeleitet<br />
werden, wenn in der ersten Arbeitsphase genügend Aufträge bearbeitet werden<br />
konnten.<br />
Auf der Grundlage der Zielvereinbarung werden zwischen Familie, GB Jugend und<br />
SPFH der zeitliche Rahmen der Erprobungsphase festgelegt, wobei dieser die Länge<br />
der ersten Arbeitsphase nicht überschreiten soll. Ferner treffen alle Beteiligten<br />
individuelle Regelungen für die Familie. Es werden:<br />
- Absprachen getroffen, wie und in welchem Umfang SPFH den Prozess während<br />
der Intervallphase begleiten kann<br />
- Erstansprechpartner festgelegt<br />
- Verabredungen als mögliche Kriseninterventionen durch die SPFH als<br />
Sicherungssystem für die Familie getroffen.<br />
Ein Informationsaustausch zwischen der SPFH und dem GB Jugend wird im<br />
Einverständnis mit der Familie vereinbart.<br />
Die Intervallphase endet mit dem Auswertungsgespräch. Das Auswertungsgespräch<br />
dient zur Klärung, ob weitere Hilfen zur Erziehung notwendig sind, ggf. Festlegung ob<br />
analog zur 1. Arbeitphase eine weitere Arbeitsphase erforderlich ist.<br />
Die Arbeit wird beendet, wenn die Aufträge für alle Beteiligten zufrieden stellend<br />
bearbeitet worden sind.<br />
Nachbetreuungsangebot<br />
Die Familie hat die Möglichkeit im Rahmen der Nachbetreuung bei Bedarf Kontakt zur<br />
früheren FamilienhelferIn bzw. Dienststelle herzustellen. Seitens der SPFH wird<br />
binnen 3 bis 6 Monate ein Kontakt zur Familie aufgenommen, um die aktuelle<br />
Situation zu besprechen. Darüber hinaus besteht das Angebot für interessierte<br />
Familien an themen- und freizeitorientierten Gruppenangeboten teilzunehmen.<br />
5
5. Personelle und räumliche Rahmenbedingungen<br />
Die Sozialpädagogische Familienhilfe verfügt über eigene Räumlichkeiten. Diese<br />
Räume können für direkte Familienkontakte und familienübergreifende Tätigkeiten<br />
genutzt werden. Der Hauptarbeitsplatz der MitarbeiterInnen der SPFH ist aber die<br />
Lebenswelt der Familie. Die meisten Termine finden in der Wohnung der Familie<br />
statt.<br />
Qualifikation der MitarbeiterInnen<br />
Neben einer pädagogischen Grundausbildung (ErzieherIn, SozialarbeiterIn,<br />
SozialpädagogIn) sind Berufserfahrung und lebenspraktische Kenntnisse und<br />
Fertigkeiten erforderlich. Insbesondere sind persönliche Reife und Ausdauer sowie<br />
Flexibilität, Empathie und ein hohes Maß an Selbstorganisation<br />
Grundvoraussetzungen für diesen Arbeitsbereich.<br />
In der SPFH des DWW arbeiten Sozialpädagogische Fachkräfte mit Aus-, Fort- und<br />
Weiterbildungen in Heilpädagogik, Gestaltberatung, Suchtkrankenhilfe, NLP,<br />
Systemischer Beratung und Familientherapie, Video-Home-Trainer ® .<br />
6
6. Qualitätsstandards<br />
Im Sinne von Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit findet in der Arbeit eine<br />
ständige Überprüfung der Struktur- , Prozess- und Ergebnisqualität statt durch:<br />
• Eingangsqualität<br />
Erstgespräch bei Anfrage vor Beginn der Hilfe > Ziel: Klärung der Aufträge<br />
und bedarfsgerechte Ermittlung der Kapazität bzw. des Hilfebedarfs<br />
• Dienstbesprechung<br />
• regelmäßige externe Fall-/Teamsupervision<br />
• wöchentliche kollegiale Supervision in Kleingruppen<br />
• nach Bedarf Einzelfallgespräche mit Leitung<br />
• Leitungssupervision<br />
• kontinuierlich arbeitsfeldbezogene Fortbildung für einzelne<br />
MitarbeiterInnen / für das gesamte Team<br />
• Weiterbildung/Qualifizierung<br />
• Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen der Jugendhilfe<br />
• im Rahmen der Hilfeplanung halbjährliche Auswertungen (Hilfeplanprotokolle )<br />
gemeinsam mit Familie und ASD<br />
• Co-Arbeit<br />
• jährliche Mitarbeitergespräche<br />
• Ergebnisqualität<br />
Die Qualität der Ergebnisse unserer Arbeit wird in den halbjährlichen Hilfeplanungen<br />
besprochen. Die Auswirkungen der Wirksamkeit unserer Arbeit findet sowohl im<br />
direkten Gespräche mit der Familie als auch im Auswertungsgespräch mit dem<br />
Geschäftsbereich Jugend statt. Erstellung einer jährlichen Statistik, Dauer und<br />
Ergebnisse von Hilfeabläufen<br />
• Qualitätsentwicklung<br />
Entwicklung von Schlüsselprozessen für eigene Arbeitsabläufe<br />
Entwicklung von Schlüsselprozessen mit Kooperationspartnern<br />
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzeption<br />
7
7. Leistungen für spezielle Zielgruppen<br />
Das Angebot richtet sich an Familien und alleinerziehende Mütter und Väter mit<br />
schwerwiegender Problematik, wie Kindeswohlgefährdung, Suchtprobleme und<br />
Migrationshintergrund<br />
Zielgruppe<br />
Kindeswohlgefährdung nach § 8a<br />
SGB VIII<br />
Besonderheiten<br />
• Der Auftrag an die SPFH wird vom GB Jugend<br />
konkret benannt und mit den Eltern in der HPK<br />
besprochen<br />
• Auflagen können von Gericht oder GB Jugend<br />
vorgegeben werden<br />
• Der Bewilligungsbescheid beinhaltet den<br />
§ 8 a Auftrag<br />
• Die speziellen Verantwortlichkeiten werden im<br />
Hilfeplan festgehalten<br />
• Schweigepflichtsentbindung mit verstärktem<br />
Austausch zwischen GB Jugend und SPFH<br />
• Kontrollinstanz verbleibt beim ASD/GB<br />
• Ggf. Co-Arbeit<br />
• Intensive Zusammenarbeit mit Netzwerk<br />
Familien mit Suchthintergrund • Hinführung zur Therapie<br />
• Stützung der Kinder im Umgang mit ihren Eltern<br />
und deren Krankheit<br />
• Aufhebung der Schweigepflicht<br />
• Kontrollinstanz verbleibt beim ASD/GB<br />
• Ggf. Co-Arbeit<br />
Ausländische, binationale Familien • Vermittlerfunktion zwischen binationalen<br />
Ehepartnern<br />
• Zusammenarbeit mit ausländischen Fachkräften<br />
8
8. Sonderleistungen<br />
8.1. Elternergänzende Intensivbetreuung - (Projekt auch in Kooperation)<br />
Gesetzliche Grundlage §§ 27, 31 KJHG, § 8a SGB VIII<br />
Zielgruppe<br />
Das Angebot richtet sich an Familien, alleinerziehende Mütter und Väter, bei denen eine<br />
Fremdunterbringung der Kinder aktuell droht.<br />
Voraussetzung ist das Einverständnis der/des Erziehungsberechtigten und der Wunsch,<br />
die Familie zu erhalten.<br />
Ziele<br />
• Familienkonsolidierung<br />
Die Besonderheit dieser Arbeit liegt zunächst in der Sicherstellung eines Mindestmaßes<br />
an Versorgung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen im Rahmen von intensiver<br />
elternergänzender Hilfen.<br />
Parallel dazu wird mit den Eltern und Kindern/Jugendlichen daran gearbeitet, die<br />
Familiensituation zu stabilisieren, d.h. unter anderem Konflikte und Probleme zu<br />
entschärfen und lebenspraktische Kompetenzen zu entwickeln.<br />
Methoden<br />
• Wahrnehmung von Versorgungs- und Erziehungsaufgaben in Teilbereichen<br />
• Ermutigung der Veränderungsbereitschaft der Familie<br />
• Einsatz von Methoden aus der Familienaktivierung<br />
Rahmenbedingungen<br />
• Einsatz von mindestens zwei Fachkräften/evtl. Einsatz von Zusatzkräften nach<br />
speziellem Bedarf<br />
• angemessener Stundenumfang<br />
• Abklärungsphase von 3 Monaten mit anschließender HPK (Fachkonferenz)<br />
• monatliche Netzwerkkonferenzen<br />
9
8.2. Video-Home-Training ® (VHT)<br />
Video-Home-Training ® ist eine ressourcenorientierte Methode in der Arbeit mit Eltern und<br />
ihren Kindern<br />
Ziele<br />
- Basiskommunikation aufbauen<br />
- Familienorientiertes Denken und Handeln weiterentwickeln<br />
- Bessere Alltagsbewältigung durch vermehrte positive Kontakte der<br />
Familien, d.h.<br />
• Eltern werden in ihrer Eigenverantwortung belassen<br />
• Aktivierung der vorhandenen Kräfte bei den Eltern<br />
• Orientierung an den Ressourcen der Familie<br />
Zielgruppe<br />
Familien, die Hilfe benötigen bei der Erziehung, insbesondere bei<br />
- verhaltensauffälligen,<br />
- entwicklungsverzögerten,<br />
- lernbehinderten,<br />
- gewaltbereiten,<br />
- hyperaktiven,<br />
- schulverweigernden,<br />
- essgestörten Kindern und Jugendlichen.<br />
Methoden<br />
Arbeitsweise<br />
Der Video-Home-Trainer®<br />
- geht einmal wöchentlich in die Familie<br />
- macht eine kurze Videoaufnahme des täglichen Familienlebens<br />
- untersucht diese auf gelungene Kommunikationsmuster und<br />
- präsentiert sie eine Woche später in Ausschnitten auf ermutigende und aktivierende<br />
Weise.<br />
Eltern lernen am eigenen Modell:<br />
- sichtbar machen der gelungenen Momente<br />
- Verstärkung<br />
- Erfolg wird sichtbar in Folgeaufnahmen<br />
10
Methodisches Material<br />
Videokamera und Bildmaterial aus der Familie<br />
Zeitumfang<br />
Ein VHT®-Prozess umfasst vier Wochenstunden und läuft in der Regel über die Dauer von<br />
16 Wochen. Folgende Leistungen sind im Gesamtpaket enthalten:<br />
- Erstkontakt<br />
- Videoaufnahmen<br />
- Analyse der Aufnahmen<br />
- Rückschaukontakte<br />
- Nachbereitung und Auswertung der Rückschauen<br />
- Reflexionsgespräche<br />
- Abschuss- bzw. Auswertungsgespräch<br />
- Dokumentation<br />
- bei Bedarf Teilnahme an Hilfeplangesprächen<br />
- Fahrtkosten (im Raum <strong>Wolfsburg</strong>)<br />
- Materialkosten<br />
Kosten<br />
Bei einem VHT®-Prozess von 16 Wochen a 4 Wochenstunden ergibt sich eine<br />
Gesamtstundenzahl von 64 Stunden. Die Abrechnung erfolgt nach dem aktuellen<br />
Fachleistungsstundensatz.<br />
Video-Home-Training® kann im Rahmen des Einsatzes von Sozialpädagogischer<br />
Familienhilfe auch als eine spezielle Methode ohne Zusatzkosten in den Familien angeboten<br />
werden.<br />
11
8.3. Video-Interaktions-Begleitung® (VIB)®<br />
Video-Interaktions-Begleitung® ist die Anwendung der erfolgreichen Grundprizipien des<br />
Video-Home-Trainings® für die Begleitung und Reflexion von Fachkräften im pädagogischen<br />
Bereich.<br />
Zielgruppe<br />
Pädagogische Fachkräfte sowie Teams aus dem pädagogischen Bereich.<br />
Ausgangspunkte der VIB® mit pädagogischen Fachkräften können Fragestellungen sein<br />
wie:<br />
- Wie kann ich das Verhalten eines Kindes oder eines/einer Jugendlichen besser<br />
verstehen?<br />
- Wie kann ich einen guten Kontakte zu ihm/ihr aufbauen und dadurch positiv lenken sowie<br />
seine/ihre Entwicklung fördern?<br />
- Wie kann ich die Gruppe der Kinder/Jugendlichen besser erreichen und lenken, so dass<br />
sie sich in ihrer Entwicklung gegenseitig positiv beeinflussen können?<br />
- Wie kann ich eine positive Lernatmosphäre schaffen?<br />
- Wie kann ich die Kinder/Jugendlichen besser motivieren?<br />
- Wie kann ich angemessen auf die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes/Jugendlichen<br />
eingehen?<br />
- Wie kann ich die Konfliktlösungsfähigkeit der Kinder/Jugendlichen verbessern bzw.<br />
aufbauen?<br />
- Wie kann ich meine Arbeit effektiv gestalten?<br />
Bei der VIB® im Team können folgende Fragestellungen bearbeitet werden:<br />
- Wie ist meine eigene Basiskommunikation, wo liegen meine Stärken, woran möchte ich<br />
noch arbeiten, um mit den KollegInnen und den Kindern/Jugendlichen gut<br />
zurechtzukommen?<br />
- Wie sieht unsere Basiskommunikation untereinander aus?<br />
- Wie können wir optimal gemeinsam beraten und Beschlüsse fassen, an die sich auch<br />
alle halten?<br />
- Wie bekommen wir Konflikte in den Griff?<br />
- Wie verhandeln wir mit der Leitung?<br />
- Was ist meine Rolle im Team?<br />
12
Methode<br />
Die Arbeitsweise der Video-Interaktions-Begleitung® entspricht weitgehend der des Video-<br />
Home-Trainings®<br />
- Klärung der Fragestellung des Pädagogen/Teams<br />
- Videoaufnahmen aus dem alltäglichen Arbeitsbereich<br />
- Analyse der Aufnahmen<br />
- Rückschaukontakte mit dem Pädagogen/Team<br />
Die Analyse und die positive Verstärkung durch die Bilder und den Video-Interaktions-<br />
Begleiter festigen den eigenen Entwicklungsprozess.<br />
Kosten<br />
Eine Video-Interaktions-Begleitung® wird nach Einheiten berechnet. Eine Einheit beinhaltet<br />
- Erstkontakt/Auftragsklärung<br />
- Aufnahme<br />
- Analyse<br />
- Rückschau<br />
- Nachbereitung und Auswertung der Rückschauen<br />
- Abschluss- und Auswertungsgespräch<br />
- Dokumentation<br />
- Fahrtkosten (im Raum <strong>Wolfsburg</strong>)<br />
- Materialkosten<br />
Ein Prozess umfasst ca. 5 Einheiten. Die Kosten dafür müssen individuell vereinbart werden.<br />
Die Abrechnung erfolgt nach dem aktuellen Fachleistungsstundensatz.<br />
29.10.2010<br />
13