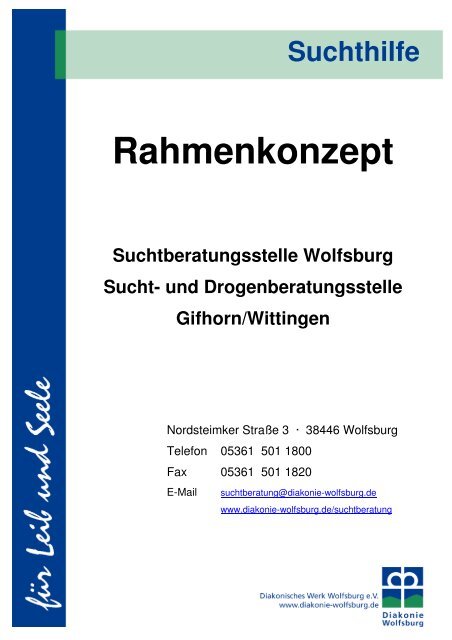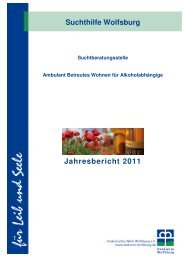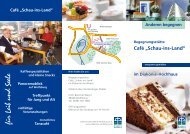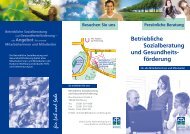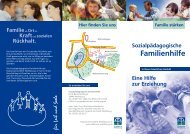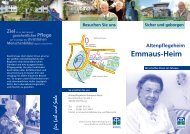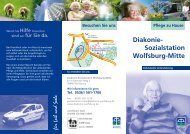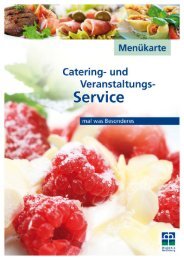Suchthilfe Rahmenkonzept ... - Diakonie Wolfsburg
Suchthilfe Rahmenkonzept ... - Diakonie Wolfsburg
Suchthilfe Rahmenkonzept ... - Diakonie Wolfsburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Suchthilfe</strong><br />
<strong>Rahmenkonzept</strong><br />
Suchtberatungsstelle <strong>Wolfsburg</strong><br />
Sucht- und Drogenberatungsstelle<br />
Gifhorn/Wittingen<br />
Nordsteimker Straße 3 · 38446 <strong>Wolfsburg</strong><br />
Telefon 05361 501 1800<br />
Fax 05361 501 1820<br />
E-Mail suchtberatung@diakonie-wolfsburg.de<br />
www.diakonie-wolfsburg.de/suchtberatung
Inhalt<br />
1. Trägerschaft / Einzugsgebiet ............................................................................ 3<br />
2. Zielgruppe .......................................................................................................... 3<br />
2.1. Abhängigkeitskranke Frauen und Männer........................................................... 3<br />
2.2. Menschen mit pathologischem Glücksspielverhalten .......................................... 4<br />
2.3. Menschen mit Essstörungen............................................................................... 5<br />
2.4. Menschen mit problematischer Nutzung des Internets........................................ 5<br />
2.5. Angehörige und weitere Bezugspersonen, die sich beteiligt und beeinträchtigt<br />
fühlen.................................................................................................................. 5<br />
3. Grundlagen ....................................................................................................... 5<br />
3.1. Behandlungsansatz ............................................................................................ 5<br />
3.2. Persönlichkeitsmodell ......................................................................................... 7<br />
4. Grundlagen von Beratung und Therapie.........................................................10<br />
4.1. Verständnis von Beratung und Therapie.............................................................11<br />
4.2. Verständnis von Abhängigkeit und teilhabe bezogener Therapie (ICF) ..............11<br />
5. Diagnostische Phase........................................................................................13<br />
6. Ambulante Entwöhnungsbehandlung.............................................................14<br />
6.1. Indikation ............................................................................................................15<br />
6.2. Kontraindikation..................................................................................................15<br />
6.3. Phasenverlauf der ambulanten Rehabilitation ....................................................16<br />
6.4. Kombinationsbehandlung ...................................................................................16<br />
6.5. Nachsorge / Ambulante Weiterbehandlung.........................................................16<br />
7. Behandlungsziele .............................................................................................17<br />
8. Therapeutisches Setting und Angebote..........................................................17<br />
8.1. Einzeltherapie.....................................................................................................18<br />
8.2. Gruppentherapie.................................................................................................18<br />
8.3. Paar- und Familientherapie.................................................................................19<br />
8.4. Einzel- und Gruppentherapie für Familienangehörige und weitere<br />
Bezugspersonen.................................................................................................19<br />
8.5. Medizinische Information und Therapie ..............................................................19<br />
8.6. Psychosoziale Hilfen ..........................................................................................19<br />
8.7. Meditative und entspannende Verfahren.............................................................20<br />
8.8. Selbstsicherheitstraining .....................................................................................20<br />
8.9. Themenzentrierte Intensivphase.........................................................................20<br />
8.10. Rückfallpräventionsprogramm S.T.A.R. .............................................................20<br />
1
9. Weitere Angebote der <strong>Suchthilfe</strong> .....................................................................21<br />
9.1. Einzelberatung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Familien<br />
suchtkranker Eltern .............................................................................................21<br />
9.2. Einzelberatung für Menschen mit Alkoholauffälligkeiten im Straßenverkehr........21<br />
9.3. Angebote für riskante Konsumenten und Missbraucher.......................................21<br />
9.4. Betreuung, Beratung und ambulante Behandlung pathologischer Glücksspieler .22<br />
9.5. Einzelberatung/-therapie bei Essstörungen.........................................................22<br />
9.6. Psychosoziale Betreuung Substituierter..............................................................22<br />
9.7. Tabakentwöhnung ..............................................................................................22<br />
9.8. Suchtberatung nach SGB II / Vermittlungshemmnis Sucht ................................23<br />
9.9. Mediensuchtberatung .........................................................................................23<br />
9.10. Ambulant Betreutes Wohnen für Alkohol- und Drogenabhängige ......................23<br />
9.11. Selbsthilfegruppen ..............................................................................................24<br />
9.12. Suchtprävention .................................................................................................24<br />
9.13. Öffentlichkeitsarbeit ...........................................................................................24<br />
10. Supervision und Fortbildung............................................................................25<br />
11. Qualitätsmanagement und Statistik ................................................................25<br />
12. Zusammenarbeit und Kooperationen mit Facheinrichtungen der<br />
Suchtkrankenhilfe .............................................................................................25<br />
13. Literaturverzeichnis<br />
2
1. Trägerschaft / Einzugsgebiet<br />
Träger der Einrichtungen der Diakonischen <strong>Suchthilfe</strong> ist das Diakonisches Werk<br />
<strong>Wolfsburg</strong> e.V. Die Suchtberatungsstelle in <strong>Wolfsburg</strong> besteht seit 1979. Zum<br />
Einzugsgebiet der Fachstelle gehören Bewohnerinnen und Bewohner der kreisfreien<br />
Stadt <strong>Wolfsburg</strong>. Die Sucht- und Drogenberatungsstelle Gifhorn mit der Außenstelle<br />
in Wittingen wurde zum 01.01.2007 in die Trägerschaft des Diakonisches Werk<br />
<strong>Wolfsburg</strong> e.V. übernommen. Zum Einzugsgebiet gehören die Bewohnerinnen und<br />
Bewohner des Landkreises Gifhorn.<br />
Zur <strong>Suchthilfe</strong> gehören daneben ein Ambulant Betreutes Wohnen für<br />
Alkoholabhängige in <strong>Wolfsburg</strong> und ein Ambulant Betreutes Wohnen für<br />
Drogenabhängige in Gifhorn/Wittingen. Zudem haben sich verschiedene<br />
Selbsthilfegruppen der Diakonischen <strong>Suchthilfe</strong> angeschlossen und treffen sich in<br />
deren Räumlichkeiten.<br />
2. Zielgruppen<br />
Abhängigkeitskranke Frauen und Männer mit dem Suchtmittel Alkohol, Medikamente,<br />
illegale Drogen und Tabak<br />
Menschen mit einem pathologischen Glücksspielverhalten<br />
Menschen mit Essstörungen<br />
Menschen mit anderen, nicht stoffgebundenen Süchten, wie einer problematischen<br />
Nutzung des Internets („Medien-/Onlinesucht“)<br />
Menschen mit einem selbstschädigenden und risikoreichen Substanzkonsum<br />
Angehörige und weitere Bezugspersonen, die sich in irgendeiner Form beteiligt bzw.<br />
beeinträchtigt fühlen<br />
2.1. Abhängigkeitskranke Frauen und Männer<br />
Abhängigkeitskranke Frauen und Männer werden in der beratenden und<br />
therapeutischen Arbeit in ihrer gesamten Person auf der Basis des bio-psycho-<br />
sozialen Persönlichkeitsansatzes gesehen und angenommen. Die Lebens- und<br />
Genussfähigkeit ist durch einen süchtigen Prozess eingeschränkt. Unter diesem<br />
Ganzheitsprinzip rücken die Beeinträchtigungen auf der geistig-seelischen,<br />
körperlichen und sozialen Ebene in den Mittelpunkt des beratenden und<br />
therapeutischen Handelns.<br />
3
Das Ganzheitsprinzip berücksichtigt dabei den einzelnen Menschen in seinen<br />
Dimensionen von Leiblichkeit, sozialem Netz, materieller und ökonomischer<br />
Sicherheit in einem wertorientierten und kulturellen Kontext. Unsere systemische<br />
Sichtweise bringt somit die Abhängigkeitserkrankung eines Einzelnen in einen<br />
interaktionellen Zusammenhang mit seiner Umwelt.<br />
Ein abhängigkeitskranker Mensch ist eine Persönlichkeit, die weitgehend unabhängig<br />
und selbstständig ihr Leben in Eigenverantwortung und in Verantwortung vor Gott<br />
führen soll und kann. Grundlage für unsere Arbeit ist das christliche Menschenbild mit<br />
einer ganzheitlichen Zuwendung und einem diakonischen, wertorientierten Handeln.<br />
Wir sehen uns als Dienstleister für abhängigkeitskranke Menschen und sind dem<br />
Diakonischen Auftrag verpflichtet und setzen ihn in unserem Tun um.<br />
Abhängigkeitskranke Frauen und Männer werden als Partner gesehen, die aktiv und<br />
selbstverantwortlich an der Genesung mitarbeiten. Die Basis der Beratung und<br />
Therapie stellt eine vertrauensvolle, tragfähige Beziehung zwischen Betroffenen und<br />
Helfern dar.<br />
2.2. Menschen mit pathologischem Glücksspielverhalten<br />
Pathologisches Glücksspielverhalten als eine Form des krank- und zwanghaften<br />
Glücksspielens zeigt sich als eine sichtbare Einschränkung der Persönlichkeit mit<br />
negativen Auswirkungen auf die eigene Person, in den zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen, im sozialen und wirtschaftlichen Bereich mit einem symptomatischen<br />
und selbstzerstörerischen Verlauf. Der Wiederholungszwang bringt den Glücksspieler<br />
unter zunehmender Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit in einen Kreislauf<br />
ohne Ende.<br />
Therapieziele sind insbesondere das Bewusstwerden des pathologischen Prozesses<br />
und der Aufbau von geeigneten Bewältigungsstrategien, besonders zur<br />
Wiedererlangung der eigenen Entscheidungsfähigkeit. Grundbedingung ist hier<br />
ebenfalls eine Spielabstinenz.<br />
4
2.3. Menschen mit Essstörungen<br />
Hierzu gehören hauptsächlich Menschen mit Störungen des Essverhaltens (Bulimie,<br />
Anorexia nervosa, binge eating disorder), die diese Störung für sich als einen<br />
süchtigen Prozess erleben und Beratung oder ambulante Behandlung suchen.<br />
Das systemische Erklärungsmodell gestörten Essverhaltens stellt die Grundlage in der<br />
Behandlung dar.<br />
2.4. Menschen mit problematischer Nutzung des Internets<br />
Erscheinungsformen sind insbesondere exzessives Surfen im Netz, Chatten, Mailen,<br />
Konsolenspiele, Online-Rollenspiele (World of Warcraft, Ego-Shooter) und<br />
Internetpornografie.<br />
2.5. Angehörige und weitere Bezugspersonen, die sich beteiligt und beeinträchtigt<br />
fühlen<br />
In der Beratungs- und Therapiearbeit mit Familienangehörigen, Lebenspartnern und<br />
weiteren Bezugspersonen, wie z.B. Arbeitskollegen oder Freunden, steht das<br />
Bewusstmachen der eigenen co-abhängigen, selbstschädigenden Entwicklung im<br />
Zusammentreffen mit dem suchtkranken Menschen im Vordergrund. Es werden<br />
gemeinsam alternative Bewältigungsstrategien erarbeitet, was verändernde<br />
Auswirkungen auf das Familien- und Umweltsystem und den betroffenen Suchtkranken<br />
haben kann.<br />
3. Grundlagen<br />
3.1. Behandlungsansatz<br />
Die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen der Beratungs- und<br />
psychotherapeutische Behandlungsansatz fußt, orientieren sich an den<br />
tiefenpsychologischen, lerntheoretischen und humanistischen Theorien und Therapien.<br />
Ein integrativer und systemorientierter Behandlungsansatz, der die Ergebnisse und<br />
Erfahrungen von wissenschaftlicher Forschung in tiefenpsychologischer,<br />
lerntheoretischer und humanistischer Theorie und Therapie verbindet, hat sich in der<br />
Suchtbehandlung inzwischen unter Berücksichtigung der multifaktoriellen Genese<br />
bestätigt. Wir sehen eine Abhängigkeitserkrankung damit auch als Familienerkrankung<br />
an.<br />
5
Hinter der Persönlichkeit des abhängigkeitskranken Menschen verbergen sich in der<br />
Regel tiefe strukturelle Mängel und erhebliche Defizite in den Ich-Funktionen sowie<br />
häufig eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung. Nicht ausreichend<br />
entwickelte Ich-Funktionen, wie u.a. Selbstbewusstsein, Realitätsbezogenheit,<br />
Frustrationstoleranz, Konfliktfähigkeit und fehlende Affektdifferenzierung versucht der<br />
abhängigkeitskranke Mensch mit Hilfe des Suchtmittels auszugleichen.<br />
Bedrohliche Affektzustände wie Wut, Angst oder Hilflosigkeit können unter dem<br />
Einfluss des Suchtmittels ausagiert oder gemildert werden. Das Suchtmittel übernimmt<br />
eine Regulationsfunktion und hilft dem abhängigkeitskranken Menschen, sich selbst<br />
und seine Beziehungen zu organisieren.<br />
Als Ursache der Ich-Störungen werden massive Probleme in der frühkindlichen<br />
Entwicklung angenommen. Das Selbst wird als schwach und minderwertig erlebt, der<br />
abhängigkeitskranke Mensch hat in der Kindheit oft keine hinreichende Unterstützung<br />
erfahren, die zu starker Frustration oder Verwöhnung geführt haben. In unserer<br />
Therapie sind besonders die Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene und<br />
der Widerstand für therapeutische Interventionen zu nutzen.<br />
Die Selbstwahrnehmung der Affekte und die realitätsgerechte Prüfung der<br />
Beziehungen in der Gruppentherapie stehen dabei im Vordergrund. Das Ziel ist u.a. die<br />
als bedrohlich erlebten, abgespaltenen Affekte in die Gesamtpersönlichkeit zu<br />
integrieren und damit eine psychische Stabilität mit reifen Ich-Funktionen unter<br />
ständigem Realitätsbezug zu erreichen.<br />
In der Erklärung der Persönlichkeit eines abhängigkeitskranken Menschen, der<br />
Entstehung und Aufrechterhaltung von Abhängigkeit, sind die Ergebnisse der<br />
Lerntheorien ein für unsere Therapie ebenso bedeutsamer psychologischer Ansatz. Im<br />
Mittelpunkt steht hier das beobachtbare offene Verhalten des Suchtkranken.<br />
In den lerntheoretischen Grundannahmen funktioniert Alkoholtrinken auf der Grundlage<br />
von Lernprinzipien, die Gebrauch als auch Missbrauch bewirken und aufrechterhalten.<br />
Vom Problemtrinken wird dann gesprochen, wenn die betreffende Person selbst<br />
negative Auswirkungen im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich spürt.<br />
Häufigkeit und Intensität sind somit ein Gradmesser für die Schwere der Problematik.<br />
6
Das Suchtmittel hat einen positiven und negativen Verstärkungswert. Reduktion von<br />
Angst und Stress, Abbau von Aggressionen und Wut sowie Hemmungen und<br />
Langeweile sind häufig Motive für das Trinken.<br />
Sich immer mehr positive oder negative Verstärkung in Form des Suchtmittels zu<br />
holen, bewirkt einen zunehmend alkoholbezogenen Lebensstil. Der Suchtkranke lernt,<br />
dass das Suchtmittel ein wirksames Mittel zur Bewältigung belastender Situationen<br />
darstellt. Spannungsreduzierende Effekte des Alkohols sind inzwischen empirisch<br />
nachgewiesen.<br />
Die sozial-kognitive Lerntheorie von BANDURA dient in unserer Therapie als<br />
wesentliche Basis für Interventionen. BANDURA nahm eine Erweiterung auf die<br />
subjektive, phänomenologische Ebene vor, so dass die kognitiven, affektiven und<br />
verhaltensbedingten Effekte in den Mittelpunkt treten. Kognitive, soziale und andere<br />
Persönlichkeitsfaktoren können einen Suchtverlauf und z. B. ein Rückfallgeschehen<br />
derart beeinflussen, dass in der Therapie die Bearbeitung von Einstellungen,<br />
Bewertungen und Verhaltensmustern im Vordergrund stehen müssen. Das Entwickeln<br />
und Verbessern von subjektiver und sozialer Kompetenz in den verschiedenen Ebenen<br />
ist das Ziel der therapeutischen Interventionen.<br />
Diese Sichtweise bedeutet für uns keinen Gegensatz zur tiefenpsychologischen<br />
Theorie, sondern integriert beide Persönlichkeitsmodelle auf der Affekt-,<br />
Wahrnehmungs- und Wirkungsebene. Die Integration der verschiedenen Modelle wird<br />
aus unserer Sicht sowohl personenzentriert als auch umweltbezogen der Komplexität<br />
des Suchtgeschehens gerecht.<br />
Die humanistischen Theorien, welche die wesentlichen Prinzipien für Gesprächs- und<br />
Kommunikationstherapie darstellen, bringen besonders die Aspekte für ein<br />
angemessenes Therapeutenverhalten mit Empathie und Kongruenz sowie die<br />
Bearbeitung der verschiedenen Kommunikationsebenen (Inhalts- und<br />
Beziehungsaspekt) sowie die digitale und analoge Kommunikation und die<br />
Metakommunikation hervor.<br />
3.2. Persönlichkeitsmodell<br />
Verhaltenstheoretische Alkoholismusmodelle mit grundsätzlichen Annahmen und<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Suchtpersönlichkeit mit der Entstehung,<br />
Ausprägung und Behandlung der Abhängigkeit sind wesentliche Grundlagen unseres<br />
Behandlungsansatzes.<br />
7
Wir sehen dabei besonders den paradigmatischen Wechsel in der Entwicklung der<br />
Verhaltenstheorie und Therapie des Alkoholismus weg von den klassischen lern-<br />
theoretischen Modellvorstellungen hin zu einer kognitiv orientierten Verhaltenstherapie<br />
als bedeutsam an.<br />
Aus den früheren klassischen lerntheoretischen Modellen sollen die Aversionstherapie<br />
mit ihren elektrischen und chemischen Behandlungsansätzen sowie die Spannungs-<br />
Reduktions-Theorie der Alkoholabhängigkeit kurz genannt werden. Die Erkenntnisse<br />
aus der Spannungs-Reduktions-Theorie haben heute innerhalb der kognitiv orientierten<br />
Verhaltenstheorie durchaus noch einen gewissen Stellenwert, da beim Abhängigen die<br />
durch soziale Einstellungen geprägten Erwartungen zu den entspannenden Effekten<br />
des Alkohols verhaltenswirksam sein können.<br />
Die soziale Lerntheorie, wie sie bereits Ende der 60-er Jahre von BANDURA<br />
beschrieben wurde, stellt den Übergang zu den neuen verhaltenstheoretischen Modell-<br />
vorstellungen der Alkoholabhängigkeit dar, wobei BANDURA anfangs auch noch von<br />
der klassischen Spannungs-Reduktions-Hypothese beim Alkoholismus ausging. Bei<br />
der sozialen Lerntheorie sollen insbesondere drei Grundannahmen für die<br />
Persönlichkeit des Alkoholikers näher beschrieben werden.<br />
1. Die umfangreiche Variabilität von normalem und krankhaftem Trinkverhalten muss<br />
in Abhängigkeit von kulturellen und sozialen Einflüssen gesehen werden. Die<br />
sozial geprägten Einstellungen zum Alkohol mit den bestehenden akzeptierten<br />
Regeln über den Umgang mit Alkohol und die daraus resultierenden<br />
Verhaltensänderungen sind dabei die verbindenden Elemente.<br />
2. Art und Umfang von normalem und krankhaftem Trinkverhalten stellen Ergebnisse<br />
aus dem Sozialisationsprozess des Individuums dar, wobei z.B. durch den Einfluss<br />
der Eltern oder peer-group-Trinknormen und Erwartungshaltungen aus der<br />
jeweiligen Umwelt in die eigene Persönlichkeit integriert werden. BANDURA sieht<br />
dabei Modelllernprozesse als zentrale Lernmechanismen im Erwerb des<br />
Trinkverhaltens an.<br />
3. Es wird davon ausgegangen, dass das aktuelle Trinkverhalten unter der Kontrolle<br />
von sozialen Interaktionsprozessen steht, wie beispielsweise der Grad der<br />
sozialen Interaktion oder Isolation, die Art der Situation oder Aktivität, soziale<br />
Gruppennormen, aber auch die Ausgangsstimmung des Individuums selbst.<br />
8
Die sozial-kognitive Lerntheorie des Alkoholismus führte zu einer theoretischen<br />
Erweiterung der sozialen Lerntheorie von BANDURA. Die Verhaltens-<br />
wahrscheinlichkeit in Bezug auf Konsum von Alkohol ist dabei von mehreren<br />
Variablen abhängig:<br />
- der kognitiven Erwartung des Einzelnen, dass ein Resultat als Ergebnis des<br />
Verhaltens auftritt ( Wirkungstrinken),<br />
- die subjektiv empfundene Bedeutung des Ergebnisses und<br />
- die Art der psychologischen Situation, in der sich das Individuum befindet.<br />
BANDURA beschreibt zu den Handlungs-Ergebnis-Erwartungen als zusätzliche<br />
Unterscheidung die sogenannten Selbstwirksamkeitserwartungen des<br />
Individuums, von denen es abhängt, inwieweit eine Person<br />
Bewältigungsfertigkeiten in Problemsituationen einsetzt und aufrechterhält. An<br />
dieser Stelle ist besonders MARLATT (1983) zu erwähnen, der aus den<br />
verschiedenen Theorien ein sozial-kognitives Modell des Trinkverhaltens und der<br />
Alkoholabhängigkeit entwickelte. Vier wesentliche Aspekte sind hier enthalten:<br />
1. eine Risikosituation, bei der sich die Person hilflos oder unter Kontrolle von<br />
anderen Personengruppen oder der Umwelt fühlt,<br />
2. die Selbstwirksamkeitserwartung als die wahrgenommene Verfügbarkeit von<br />
Bewältigungsfertigkeiten als Alternative zum Alkoholkonsum,<br />
3. die Erwartung über den Effekt, des Alkohols als Bewältigungsstrategie, welche<br />
bestimmtes Verhalten durch den Alkoholkonsum möglich macht und<br />
4. die Verfügbarkeit von Alkohol und die in einer bestimmten Situation<br />
bestehenden Trinkzwänge.<br />
Damit gewinnt dieses Modell von MARLATT besonders auch Bedeutung in der<br />
Erklärung der Beziehung von Alkoholkonsum und sozialem Stress. In der Rückfall-<br />
prophylaxe setzen wir das alternative Erklärungsmodell mit der kognitiv-verhaltens-<br />
bedingten Rückfallanalyse ein, um das eindimensionale Krankheitskonzept des<br />
Alkoholismus mit dem Kontrollverlust zu erweitern.<br />
9
Zusammengefasst siedeln wir das Persönlichkeitsmodell des Alkoholabhängigen in<br />
der sozial-kognitiven Lerntheorie an (im Wesentlichen fußend auf den Arbeiten und<br />
Ergebnissen von BANDURA und MARLATT), die den Einsatz vielfältiger verhaltens-<br />
therapeutischer Verfahren ermöglichen. Trinkverhalten und Persönlichkeit sind dabei<br />
abhängig von sozialem und kulturellem Kontext, erworben und aufrechterhalten in<br />
sozialen Interaktionsprozessen. Kognitive Erwartungsmuster steuern das<br />
Trinkverhalten dabei genauso und sind verantwortlich für die Entstehung und<br />
Aufrechterhaltung abhängigen Verhaltens wie auch weitere kognitive Faktoren, wie<br />
z.B. Einstellung, Bewertung, Abwehrprozesse und Mechanismen der<br />
Reizverarbeitung.<br />
Alkohol- und Drogenkonsum können als eine fehlgeleitete Bewältigungsstrategie des<br />
Individuums gesehen werden. Suchtmittelabhängigkeit generell stellt ein gelerntes<br />
Verhalten dar, dessen schädigende Verhaltensweisen wieder verlernbar sind.<br />
Die Erkenntnisse aus der neurobiologischen Forschung, besonders aus den letzten<br />
Jahren, fließen in unseren konzeptionellen Beratungs- und Therapieansatz mit ein.<br />
Dabei ist grundlegend festzustellen, dass die Einnahme von abhängigkeits-<br />
erzeugenden Substanzen nicht nur aktuelle physische Reaktionen, sondern auch<br />
dauerhafte Veränderungen bewirken. Die Umbauten im zentralen Nervensystem<br />
können sowohl das Auftreten von Entzugserscheinungen, als auch das Verlangen<br />
(Craving) nach Suchtmitteln auslösen.<br />
4. Grundlagen von Beratung und Therapie<br />
Das Beratungs- und Therapiekonzept orientiert sich an wissenschaftlichen Theorien<br />
und Verfahren von<br />
- Tiefenpsychologie/Psychoanalyse<br />
- Verhaltenstheorie und -therapie<br />
- Humanistischer Psychologie mit Gesprächspsychotherapie und<br />
Kommunikationstherapie<br />
- Systemischer Therapie<br />
- und anderer begleitender Verfahren.<br />
Die auf dieser Grundlage beruhenden Beratungskonzepte von Sozialarbeit/<br />
Sozialpädagogik sind in das Beratungs- und Therapiekonzept integriert (Einzelhilfe,<br />
Casemanagement, Gruppenarbeit, Familienberatung und Gemeinwesenarbeit).<br />
10
4.1. Verständnis von Beratung und Therapie<br />
Beratung zielt in erster Linie auf eine bewusste Wissens- und Einsichtsvermittlung in<br />
kognitive und auch emotionale Prozesse in einem kommunikativen Kontext hin.<br />
Therapie ist ein weitergehender Lern- und Wachstumsprozess mit dem Ziel einer<br />
Verhaltens- und/oder Persönlichkeitsveränderung.<br />
Therapie ist besonders auch ein Prozess des Wachsens in einer therapeutischen<br />
Beziehung mit einer positiven und kreativen Nutzung eigener Energien und<br />
Ressourcen zur Stärkung und Entfaltung der Selbstheilungskräfte.<br />
4.2. Verständnis von Abhängigkeit und teilhabe bezogener Therapie (ICF)<br />
Abhängigkeit wird in Beratung und Therapie als eine komplexe Störung des Erlebens,<br />
des Verhaltens, der sozialen Beziehungen und der körperlichen Funktionen mit<br />
Krankheitswert gesehen. Sie stört die Selbstregulationsfähigkeit der Person.<br />
Wesentliche Elemente dieser Fähigkeit sind die Wert- und Zielorientierung, die<br />
differenzierte emotionale Reaktionsfähigkeit, die Nähe-Distanz-Regulation in<br />
zwischenmenschlichen Beziehungen, die Konfliktfähigkeit, das Selbstvertrauen, die<br />
Frustrationstoleranz, die Selbstbeobachtung und die Selbstbewertung sowie die<br />
Erwartungshaltung insgesamt zu Lebensperspektiven.<br />
Unter Berücksichtigung des bio-psycho-sozialen Persönlichkeitsmodells wird die<br />
Abhängigkeitsentwicklung eines Menschen im Wesentlichen als ein Zusammentreffen<br />
und interaktionelles Geschehen verschiedener psychischer, sozialer und<br />
substanzbezogener Bedingungen verstanden. Besonders Lebensereignisse,<br />
Prägungsprozesse, Lernerfahrungen, Verfügbarkeit eines Suchtmittels, Einflüsse und<br />
Haltungen von Gesellschaft und Kultur und direktem Lebensumfeld bestimmen das<br />
therapeutische Handeln.<br />
Primäres Ziel der Therapie ist es, suchtkranke Menschen in ihren Möglichkeiten und<br />
Fähigkeiten zu fördern, sich aktiv mit körperlichen, seelischen und sozialen Problemen<br />
und Beschwerden auseinanderzusetzen, denen sie zuvor meinten hilflos ausgeliefert<br />
zu sein oder ausweichen zu müssen.<br />
11
Dieses bedeutet sowohl Veränderungen im affektiven Erleben, in der kognitiven<br />
Verarbeitung als auch im Verhalten. Alle positiven Einstellungs- und<br />
Verhaltensänderungen können jedoch nichts daran ändern, dass abhängigen<br />
Menschen eine dauerhafte Rückkehr zum gemäßigten Umgang mit Suchtmitteln nicht<br />
mehr möglich ist. Nur eine völlig abstinente Lebensweise wird eine stärkere positive<br />
Selbstbewertung, eine bewusste persönliche Wertorientierung, aktives Problemlösen<br />
und Entscheiden, die Übernahme von Verantwortung, Selbstständigkeit,<br />
Selbstsicherheit und einen besseren Umgang mit belastenden Gefühlen und<br />
Situationen ermöglichen.<br />
Durch den interdiziplinären Ansatz in der engen Zusammenarbeit zwischen<br />
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, Psychologe und Arzt ist gewährleistet, dass die<br />
Wechselwirkung von organischen, psychischen und sozialen Faktoren bei der<br />
Abhängigkeitserkrankung in unserem Krankheits- und Behandlungsmodell<br />
berücksichtigt sind.<br />
Die Kenntnis um die Wechselwirkungen von organischen, psychischen und sozialen<br />
Faktoren bei einer Abhängigkeitserkrankung ist erweitert und ergänzt um den Ansatz<br />
der funktionalen Gesundheit auf der Basis der ICF (Internationale Klassifikation der<br />
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO). Das bio-psycho-soziale Modell ist Grundlage für die Annahmen der ICF.<br />
Funktionale Gesundheit ist demnach vorhanden, wenn unter Berücksichtigung des<br />
gesamten Lebenshintergrundes eines Menschen<br />
- die körperlichen Funktionen und Körperstrukturen, die den geistigen und<br />
seelischen Bereich mit einschließen, anerkannten statistischen Normen<br />
entsprechen,<br />
- bei den Aktivitäten der Mensch das tun kann, was von einem Menschen ohne<br />
Gesundheitsprobleme erwartet wird<br />
- und der Mensch sich in allen Lebensbereichen, die ihm wichtig sind, in der Weise<br />
entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung erwartet<br />
werden und er/sie damit an allen Lebensbereichen teilnehmen kann.<br />
12
Die Komponenten (Körperfunktionen und Strukturen, Aktivitäten und Teilhabe) sind<br />
abhängig von den Gesundheitsproblemen und den Personen- und Umweltfaktoren und<br />
werden dadurch beeinflusst und variiert.<br />
(Beispiel: Langzeitarbeitslosigkeit ruft psychische Erkrankung oder Abhängigkeit hervor<br />
bzw. verstärkt diese).<br />
Im Verständnis von Abhängigkeit und Therapie werden darum besonders die<br />
Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf die<br />
- Körperfunktionen und -strukturen (Schädigungen oder Folgeerkrankungen des<br />
Alkoholismus) diagnostiziert und wenn möglich therapiert<br />
- Aktivitäten (was ist noch möglich), ressourcenorientiert bei beruflichen Tätigkeiten,<br />
in der Selbstversorgung und Kommunikation, in den sozialen Beziehungen oder<br />
Mobilität berücksichtigt<br />
- Teilnahme gesehen, die die Daseinsentfaltung und das selbstbestimmte Leben in<br />
verschiedenen Lebensbereichen meint. In der Diagnostik werden darum besonders<br />
die Barrieren, die dies verhindern, aber auch die Förderfaktoren, die es trotz eines<br />
gesundheitlichen Problems erleichtern oder ermöglichen, festgestellt.<br />
Die Feststellungen werden im Behandlungsplan mit aufgenommen und können<br />
dadurch in der ambulanten Rehabilitation berücksichtigt und bearbeitet werden. Ziel ist<br />
dabei immer, in der Rehabilitationsmaßnahme einen Abbau bzw. eine Verringerung<br />
oder die Aufhebung der Beeinträchtigungen funktionaler Gesundheit zu erreichen.<br />
5. Diagnostische Phase<br />
Die diagnostische Phase umfasst mindestens 12 Wochen. Am Anfang steht eine<br />
ausführliche Eingangsdiagnostik, besonders bezogen auf<br />
- die Motivation und Behandlungseinsicht,<br />
- die Abklärung der zugrundeliegenden Persönlichkeitsdefizite,<br />
- eine systemische Betrachtung der gesamten Person im Familien- und<br />
Umweltsystem, mit einer ausführlichen Verhaltensanalyse, die kognitive,<br />
emotionale und somatische Elemente berücksichtigt,<br />
- die Berücksichtigung der ICD-10 Kriterien (Internationale Klassifikation psychischer<br />
- Störungen der WHO) des Abhängigkeitssyndroms und schädlichen Gebrauchs,<br />
13
- die Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit nach dem bio-psycho-sozialen<br />
Modell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung<br />
und Gesundheit der WHO).<br />
In diesen Zeitraum fallen<br />
- eine ärztliche Untersuchung (Arzt),<br />
- eine psychologische Untersuchung (Diplom-Psychologe),<br />
- eine Aufnahme der Sozial- und Suchtanamnese und die Erfassung des<br />
psychosozialen Bedingungsgefüges (Diplom-Sozialarbeiter),<br />
- das Erarbeiten der Handlungsmöglichkeiten und Defizite des Klienten,<br />
- falls erforderlich die Einleitung der Durchführung einer stationären<br />
Entgiftungsbehandlung,<br />
- Vermittlung von Informationen zur Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit und<br />
Co-Abhängigkeit,<br />
- Kontaktaufnahme zu Angehörigen und Bezugspersonen,<br />
- Klärung der Rahmenbedingungen der ambulanten Rehabilitationsmaßnahme.<br />
Gegen Ende der diagnostischen Phase wird ein Behandlungsplan mit formulierten<br />
Grob- und Feinzielen und die Behandlungsvereinbarung getroffen. Der Arzt der<br />
Einrichtung ist in den Fallbesprechungen und durch die medizinische Visite an der<br />
Diagnostik, Indikationsstellung und Aufstellung des Rehabilitationsplanes beteiligt.<br />
6. Ambulante Entwöhnungsbehandlung<br />
Für eine ambulante Entwöhnungsbehandlung/Therapie kommen abhängigkeitskranke<br />
Frauen und Männer in Frage, die<br />
- erstmalig eine ambulante Therapie durchführen wollen und sollen,<br />
- im Anschluss an eine stationäre Kurzzeitbehandlung der ambulanten<br />
Weiterbebehandlung aufgrund noch nicht ausreichend erfolgter psychischer<br />
Festigung bedürfen,<br />
- nach abgeschlossenem stationären Modul im Rahmen der<br />
Kombinationsbehandlung Nord, die Suchttherapie ambulant fortsetzen,<br />
- aufgrund von Krisensituationen akut rückfallgefährdet sind und auch bei Rückfällen<br />
nach stationärer Therapie.<br />
14
Die Motivation bei Abhängigkeitskranken muss dabei ausreichend sein. Die<br />
Auswirkungen des Abhängigkeitsprozesses im physischen und psychischen sowie im<br />
sozialen Bereich dürfen noch nicht so schwerwiegend sein, dass die Behandlung im<br />
ambulanten Setting von vornherein erschwert oder ausgeschlossen wäre. Das betrifft<br />
besonders die Bereiche der Selbstkontrolle und Selbststeuerung.<br />
Bei der ambulanten Rehabilitation, die auf der Grundlage der Vereinbarung<br />
„Abhängigkeitserkrankungen“ durchgeführt wird, gelten während der Behandlung die<br />
Richtlinien der zuständigen Leistungs- und Kostenträger. Die inhaltliche und formale<br />
Verantwortung für die Durchführung der ambulanten medizinischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme trägt der Beratungsstellenarzt.<br />
6.1. Indikation<br />
- Bereitschaft und Fähigkeit zu dauernder Abstinenz<br />
- Einsicht in den Abhängigkeitsprozess und eine erforderliche Behandlung<br />
- Überwiegend selbstmotivierter Leidensdruck<br />
- Bereitschaft und Fähigkeit, Absprachen und die Behandlungsvereinbarung<br />
einzuhalten<br />
- Kein Vorliegen einer akuten Selbst- (Suizidgefahr) oder Fremdgefährdung<br />
- Freiwilligkeit<br />
- Soziale Integration mit einem noch weitgehend intakten Umfeld in den Bereiche<br />
Familie, Arbeit, Einkommen und Wohnsitz<br />
6.2. Kontraindikation<br />
- Akute Suizidalität und Psychose<br />
- Schwere psychische und physische Störungen und Folgeschäden aus dem<br />
Suchtverlauf<br />
- Anstehende Haftstrafen sowie ausstehende Strafverfahren, die eine regelmäßige<br />
Teilnahme nicht möglich machen<br />
- Unfähigkeit zur Abstinenz im ambulanten Setting<br />
- Soziale Desintegration und Obdachlosigkeit<br />
- Chronifizierte Abhängigkeit bei langer Suchtkarriere<br />
15
6.3. Phasenverlauf der ambulanten Rehabilitation<br />
Die ambulante Entwöhnungsbehandlung /Rehabilitation verläuft in mehreren Phasen.<br />
Die erste Therapiephase ist zuerst auf sechs Monate begrenzt und der Beginn der<br />
ambulanten Rehabilitation. Gemeinsam mit den Klienten wird vor Ablauf der ersten<br />
Therapiephase durch den Beratungsstellenarzt und das therapeutische Team über die<br />
Verlängerung entschieden und diese bei den Leistungsträgern beantragt. Nach der<br />
Bewilligung wird der Therapieprozess fortgesetzt. Eine ambulante Rehabilitation dauert<br />
6 bis18 Monate, wobei das erste Jahr in der Regel den wesentlichen therapeutischen<br />
Prozess beinhaltet.<br />
Die Nachsorge schließt sich der Therapie an und ist dabei auf die Aktivierung des<br />
Selbsthilfepotentials, die Integration in das soziale Umfeld und den Wiederanschluss<br />
bzw. Anschluss an eine Selbsthilfegruppe ausgelegt.<br />
6.4. Kombinationsbehandlung<br />
Die Fachstelle prüft anhand festgelegter Kriterien eingangs, ob neben der originären<br />
ambulanten Rehabilitation auch eine durch ambulante, ganztags ambulante und<br />
stationäre Module vernetzte Behandlungsmaßnahme in Frage kommt. Die<br />
Gesamtzeitdauer der Kombinationsbehandlung beträgt 12 Monate. Für die<br />
PatientInnen bietet eine Kombinationsbehandlung die Möglichkeit, auf den<br />
Krankheitsprozess bezogen so effektiv und individuell wie möglich eine optimale<br />
Behandlung zu erhalten (näheres regeln Konzept und Kooperationsvereinbarungen).<br />
6.5. Nachsorge / Ambulante Weiterbehandlung<br />
Schwerpunkt der ambulanten Nachsorge / Weiterbehandlung ist die Aktivierung des<br />
Selbsthilfepotentials und die Begleitung bei der Reintegration in das berufliche und<br />
soziale Umfeld. Die bereits in einer stationären Maßnahme erreichten<br />
Behandlungsziele und Veränderungen fließen in die ambulante Weiterbehandlung mit<br />
ein. Die Freizeitaktivitäten, die Entwicklung und Förderung von neuen oder<br />
vorhandenen Interessen mit der erforderlichen Stabilisierung der Persönlichkeit stehen<br />
ebenfalls im Vordergrund. Die Anbindung an die zur Verfügung stehenden<br />
Selbsthilfegruppen wird angestrebt. Die regelmäßige Teilnahme an einer<br />
Selbsthilfegruppe ist prognostisch unverzichtbar.<br />
16
7. Behandlungsziele<br />
Das Therapieziel für den Abhängigkeitsprozess ist die Abstinenz, um positive<br />
Veränderungen in der Persönlichkeit mit den sich daraus ergebenden<br />
Lebensumfeldveränderungen erreichen zu können. Ein abstinentes, drogenfreies<br />
Leben wird als Grundbedingung gesehen, um aus dem Krankheitsprozess<br />
herauszufinden. Als wesentliche Behandlungsziele der ambulanten Rehabilitation sind<br />
anzusetzen,<br />
- dauerhafte, zufriedene Abstinenz,<br />
- Verbesserung und Änderung von problematischen psychosozialen<br />
Verhaltensweisen, Einstellungen und Persönlichkeitsdefiziten,<br />
- Erhöhung der sozialen Kompetenz, besonders der zwischenmenschlichen<br />
Interaktion und Beziehungsfähigkeit,<br />
- angemessenes Konfliktverhalten,<br />
- berufliche Integration bzw. Re-Integration und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit,<br />
- Akzeptanz der eigenen Person, der Abhängigkeit und Steigerung von<br />
Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit,<br />
- Entwicklung von realitätsorientierten Lebens- und Handlungsperspektiven ,<br />
- Bewusstwerden und Ablösen von süchtigen Beziehungsmustern im systemischen<br />
Kontext und Aufbau einer autonomen Identität,<br />
- Erhöhung der Selbst- und Fremdwahrnehmung,<br />
- Verbesserung und Differenzierung von emotionaler, d.h. affektiver Dynamik,<br />
- Bewusstwerden von Abwehrmechanismen und Übertragungsphänomen.<br />
In der ambulanten Rehabilitation nehmen die Betroffenen mit ihren realen<br />
Alltagsbedingungen, den Belastungen und Konflikten am therapeutischen Prozess teil.<br />
Neben der aktuellen Bearbeitung solcher konkreten Belastungen nimmt eine<br />
kontinuierliche Rückfallprophylaxe einen bedeutenden Raum in der Therapie ein.<br />
8. Therapeutisches Setting und Angebote<br />
Die ambulante Rehabilitation für Suchtkranke wird sowohl als Einzel- wie auch<br />
Gruppentherapie durchgeführt. Dem Patienten werden dabei regelmäßig ein bis zwei<br />
Therapieeinheiten pro Woche angeboten. Dazu gehören nach Indikation ebenfalls<br />
Paar- und Familiengespräche/-therapie. Für Angehörige und Bezugspersonen werden<br />
therapeutisch orientierte Einzel- und Gruppengespräche angeboten. Meditative und<br />
entspannende Verfahren kommen zur Anwendung.<br />
17
Der Ablauf der ambulanten Therapie ist vertraglich geregelt und erwartet sowohl vom<br />
Klienten als auch vom Therapeuten hohe Verbindlichkeit. Grundsätzlich wird zuerst<br />
von einer sechsmonatigen Behandlungsdauer ausgegangen, die je nach Indikation bis<br />
längstens 18 Monate verlängert werden kann.<br />
8.1. Einzeltherapie<br />
Eine Einzeltherapie ist besonders indiziert, wenn<br />
- die Problematik einer Gruppentherapie entgegensteht,<br />
- Klienten aus beruflichen oder persönlichen Gründen nicht in der Lage sind, an der<br />
Gruppentherapie teilzunehmen,<br />
- eine besondere Problematik eine tiefergehende persönliche Bearbeitung<br />
erforderlich macht,<br />
- die Gruppenfähigkeit eingeschränkt oder noch nicht erreicht ist.<br />
Ausschließlich psychotherapeutisch orientierte Einzeltherapie im Rahmen der<br />
ambulanten Rehabilitation ist nicht vorgesehen.<br />
Die Einzeltherapie beginnt nach Abschluss der diagnostischen Phase und kann auch<br />
parallel zur Gruppentherapie durchgeführt werden. Die Einzeltherapie findet in der<br />
Regel einmal wöchentlich mindestens 50 Minuten statt.<br />
8.2. Gruppentherapie<br />
Die Gruppentherapie stellt das Kernstück der ambulanten Rehabilitation dar. Die<br />
Gruppentherapie wird als halboffene Gruppe über einen Zeitraum von sechs bis<br />
18 Monaten durchgeführt. Die Therapiegruppe trifft sich einmal wöchentlich für<br />
mindestens 100 Minuten. Sie wird in der Regel im Co-Therapeuten-System geleitet.<br />
Die Urlaubs- und Krankheitsvertretung ist gewährleistet. Die Regelgruppengröße<br />
beträgt bis zu zwölf PatientInnen.<br />
KlientInnen aus der stationären Therapie, bei denen ambulante therapeutische<br />
Weiterbehandlung durchgeführt wird, sind in die Gruppentherapie integriert.<br />
18
Einzel- und Gruppentherapie findet nach Absprache mit den Patienten statt. Besonders<br />
wird eine schichtbedingte Arbeitszeit berücksichtigt, so dass die Sitzungen vormittags,<br />
nachmittags und in den Abendstunden erfolgen können.<br />
8.3. Paar- und Familientherapie<br />
Paar- und Familientherapie kann zusätzlich in der ambulanten Rehabilitation<br />
durchgeführt werden, wenn besonders interaktionelle Konflikte in den familiären<br />
Beziehungen vorhanden sind.<br />
8.4. Einzel- und Gruppentherapie für Familienangehörige und weitere<br />
Bezugspersonen<br />
Nach Möglichkeit werden Bezugspersonen von Beginn an in die Beratung/Therapie mit<br />
einbezogen. Je nach Indikation werden Einzel- und Gruppengespräche sowie<br />
Krisenintervention angeboten.<br />
Für Bezugspersonen, deren abhängigkeitskranke PartnerInnen ambulante Therapie im<br />
Sinne der Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ durchführen, werden<br />
regelmäßige Gespräche angeboten.<br />
8.5. Medizinische Information und Therapie<br />
Durch den Beratungsstellenarzt erhalten die TeilnehmerInnen der ambulanten<br />
Therapie begleitend medizinische Information und Beratung und falls erforderlich in<br />
Absprache mit dem Hausarzt und dem niedergelassenen Facharzt für Psychiatrie und<br />
Neurologie medizinische Behandlung.<br />
8.6. Psychosoziale Hilfen<br />
Begleitende Maßnahmen sind darüber hinaus gezielte Hilfen zur alltäglichen<br />
Lebensbewältigung, z.B. Hilfen in finanziellen Schwierigkeiten, bei der Arbeits- und<br />
Wohnungssuche u.ä.<br />
19
8.7. Meditative und entspannende Verfahren<br />
Als zusätzliches Gruppenangebot werden solche Verfahren, wie z.B. progressive<br />
Muskelentspannung und Meditationen angeboten. Sie werden von entsprechend<br />
ausgebildeten Fachkräften durchgeführt.<br />
8.8. Selbstsicherheitstraining<br />
Als zusätzliches Angebot im Sinne einer Indikationsgruppe wird in Abständen ein<br />
Selbstsicherheitstraining (Assertiveness-Training) angeboten.<br />
8.9. Themenzentrierte Intensivphase<br />
Zur Vertiefung von Aspekten im Therapiekonzept wird eine themenzentrierte<br />
Intensivphase durchgeführt. Die Themen sind sowohl sucht- als auch<br />
persönlichkeitsbezogen. Sie dauert bis zu fünf Wochen und umfasst vier Einheiten pro<br />
Patient und Woche und ein Angehörigenseminar. Näheres regelt ein spezielles<br />
Konzept.<br />
8.10. Rückfallpräventionsprogramm S.T.A.R.<br />
Die Fachstelle bietet in der ambulanten Entwöhnungsbehandlung/Rehabilitation die<br />
Teilnahme am strukturierten Trainingsprogramm "Rückfallprävention mit<br />
Alkoholabhängigen" (S.T.A.R.) nach KÖRKEL/SCHINDLER an. Das<br />
Präventionsprogramm besteht aus insgesamt 15 Modulen und wird von geschulten<br />
MitarbeiterInnen moderiert. Zentrale aufeinander abgestimmte Themen und<br />
Fragestellungen zur Vorbeugung und zum Umgang mit Rückfällen werden aufgegriffen<br />
und bearbeitet.<br />
Es werden z.B. Kenntnisse vermittelt über<br />
- Grundinformationen zum Alkoholverlangen und Rückfälligkeit<br />
- Risikosituationen und Umgang mit unangenehmen Gefühlen<br />
- Ablehnen von Trinkaufforderungen<br />
- Bedeutung des Lebensstils und Einfluss des sozialen Umfeldes auf Abstinenz<br />
und/oder Rückfall<br />
20
9. Weitere Angebote der Suchtberatungsstelle<br />
9.1. Einzelberatung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus<br />
Familien suchtkranker Eltern<br />
Unter systemischer und präventiver Sichtweise werden Angebote für Kinder und<br />
Jugendliche aus Familien suchtkranker Eltern durchgeführt. Die Beratung und Therapie<br />
erfolgt ausschließlich im Einzelsetting.<br />
9.2. Einzelberatung für Menschen mit Alkoholauffälligkeiten im<br />
Straßenverkehr<br />
Für diese Personengruppe, die hauptsächlich mit Auflagen der Medizinisch-<br />
Psychologischen-Untersuchungsstelle des Technischen Überwachungsvereins (TÜV)<br />
in unsere Suchtberatungsstelle kommt, wird Einzelberatung und medizinische<br />
Information angeboten.<br />
Ziel ist im Wesentlichen die Beteiligten zu einer selbstkritischen Auseinandersetzung<br />
mit der eigenen Alkoholgefährdung zu befähigen. Dabei werden die alkoholbedingten<br />
Einflüsse mit Straßenverkehr berücksichtigt. Bei vorliegender Abhängigkeit kann sich<br />
über die Einzelberatung und Motivation eine ambulante oder stationäre<br />
Entwöhnungsbehandlung anschließen.<br />
9.3. Angebote für riskante Konsumenten und Missbraucher<br />
Die Hilfeangebote für Klienten mit riskantem Konsum und Missbraucher werden von<br />
der Fachstelle kontinuierlich aufgebaut und erweitert. Mit dem Drink-Less-Programm<br />
sollen die Menschen angesprochen werden, die eine deutliche Verringerung ihres<br />
Alkoholkonsums wollen. Eine diagnostische Einschätzung über den Grad der<br />
Suchtgefährdung, die Abklärung der Ziele und die Prüfung der Ausschlusskriterien<br />
gehen dem ambulanten Programm voraus. Das Programm mit jeweils 10 Sitzungen<br />
wird im Einzelsetting durchgeführt.<br />
Alkoholabhängige Frauen und Männer und solche, die bereits eine Abstinenz erreicht<br />
haben, werden nicht in das Programm aufgenommen.<br />
21
9.4. Betreuung, Beratung und ambulante Behandlung pathologischer Glücksspieler<br />
Die Betreuung pathologischer Glücksspieler umfasst Einzelberatung, Begleitbetreuung<br />
und Weitervermittlung in stationäre Einrichtungen sowie Durchführung der ambulanten<br />
Nachsorge nach abgeschlossener stationärer Behandlung und ambulante Therapie in<br />
Einzelfällen. Daneben erfolgt die Vermittlung in die der Beratungsstelle<br />
angeschlossenen Selbsthilfegruppe für Spieler.<br />
9.5. Einzelberatung/-therapie bei Essstörungen<br />
Einzelberatung/-therapie wird überwiegend bei KlientInnen mit Bulimie und binge<br />
eating dissorder durchgeführt. Ggf. erfolgt die Vermittlung in eine stationäre<br />
Therapiemaßnahme. Die Durchführung von ambulanter Nachsorge/ Weiterbehandlung<br />
nach abgeschlossener stationärer Therapie wird ebenfalls durchgeführt.<br />
9.6. Psychosoziale Betreuung Substituierter<br />
In der Sucht- und Drogenberatungsstelle Gifhorn/Wittingen wird die psychosoziale<br />
Betreuung Substituierter angeboten. Die psychosoziale Betreuung soll den<br />
drogenabhängigen Menschen durch geeignete Unterstützungsmaßnahmen in<br />
psychischen, sozialen und lebenspraktischen Bereichen helfen, die seelischen und<br />
sozialen Folgen der Abhängigkeit von illegalen Drogen zu erkennen und zu<br />
überwinden.<br />
Der Umfang der Betreuung richtet sich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung<br />
nach den individuellen Umständen und dem Krankheitsverlauf des drogenabhängigen<br />
Menschen. Regelmäßige Einzelgespräche stellen die Grundlage für die psychosoziale<br />
Betreuung dar. Darüber hinaus können Gruppenaktivitäten und Gruppenberatung<br />
stattfinden.<br />
9.7. Tabakentwöhnung<br />
Beim Vorliegen einer süchtigen Tabakproblematik führt die Suchtberatungsstelle<br />
kursmäßig Raucherentwöhnungen durch. Grundlage dafür ist das anerkannte<br />
Programm "Rauchfrei in 6 Schritten". Die durchführenden MitarbeiterInnen sind<br />
entsprechend qualifiziert und anerkannt. Mit den gesetzlichen Krankenkassen sind<br />
dazu Vereinbarungen getroffen. Im Bedarfsfall wird Einzelberatung durchgeführt.<br />
22
9.8. Suchtberatung nach SGB II / Vermittlungshemmnis Sucht<br />
Auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt <strong>Wolfsburg</strong>/<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>Wolfsburg</strong> SGB II und der Suchtgefährdetenhilfe der <strong>Diakonie</strong><br />
<strong>Wolfsburg</strong> führt die Fachstelle die Suchtberatung für EmpfängerInnen von<br />
Arbeitslosengeld II durch. In Gifhorn ist ein sozialpädagogischer Mitarbeiter des<br />
Landkreises in der Sucht- und Drogenberatungsstelle zur Beratung der<br />
ALG II-Empfänger eingesetzt.<br />
Wenn sich bei dem Hilfesuchenden ein Suchtproblem herausstellt, welches die<br />
Vermittlung in Arbeit einschränkt oder behindert, verweisen die MitarbeiterInnen der<br />
Arbeitsagentur an uns. In vertraulichen Einzelgesprächen wird zur Klärung der<br />
persönlichen Situation beigetragen und eine Diagnosestellung vorgenommen. Neben<br />
Information und Beratung werden gemeinsame Lösungen mit dem Hilfesuchenden<br />
erarbeitet und umgesetzt (näheres dazu siehe Rahmenleistungsvereinbarung).<br />
9.9. Mediensuchtberatung<br />
Die <strong>Suchthilfe</strong> verzeichnet eine stetige Zunahme an Beratungsanfragen von<br />
Betroffenen und Angehörigen zur problematischen Internetnutzung, die auch als<br />
Medien-/Onlinesucht, Internet- und Computerabhängigkeit oder pathologischer<br />
PC-Gebrauch in Fachgremien intensiv diskutiert wird. Erscheinungsformen der<br />
problematischen Internetnutzung sind insbesondere exzessives Surfen, Chatten,<br />
Mailen, Konsolenspiele, Online-Rollenspiele, wie z.B. World of Warcraft, Ego-Shooter<br />
und Internetpornografie.<br />
Unsere Einzelberatung richtet sich an Personen, die in diesen Problembereichen als<br />
Betroffene oder Angehörige Unterstützung und Hilfe suchen. Bei Bedarf erfolgt eine<br />
Vermittlung in eine ganztags ambulante oder stationäre Therapie.<br />
9.10. Ambulant Betreutes Wohnen für Alkohol und –Drogenabhängige<br />
Das Ambulant Betreute Wohnen für alkohol- und medikamentenabhängige Frauen und<br />
Männer in <strong>Wolfsburg</strong> umfasst eine Wohngruppe mit vier Einzelzimmern, die gemischt-<br />
geschlechtlich belegt werden können und das Ambulant Betreute Einzelwohnen als<br />
aufsuchendes Hilfeangebot. Die Betreuten des Ambulant Betreuten Wohnens können<br />
an der ambulanten Rehabilitation Abhängigkeitskranker teilnehmen.<br />
23
Die Betreuung wird von ausgebildeten pädagogischen Fachkräften geleistet. Näheres<br />
dazu siehe Konzept des Ambulant Betreuten Wohnens.<br />
Das Ambulant Betreute Wohnen für Drogenabhängige in Gifhorn wird in Form der<br />
aufsuchenden Hilfe des Betreuten Einzelwohnens geleistet. Näheres dazu siehe<br />
Konzept des Ambulant Betreuten Wohnens für Drogenabhängige.<br />
9.11. Selbsthilfegruppen<br />
Der <strong>Suchthilfe</strong> sind in <strong>Wolfsburg</strong> und im Landkreis Gifhorn mehrere Selbsthilfegruppen<br />
angeschlossen. Darüber hinaus gibt es innerhalb der Vernetzung in der<br />
Suchtkrankenhilfe <strong>Wolfsburg</strong> eine Zusammenarbeit mit weiteren Selbsthilfegruppen<br />
und den Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften Sucht.<br />
9.12. Suchtprävention<br />
Die Fachstellen führen eine Reihe von suchtpräventiven Maßnahmen und Projekten<br />
durch. Suchtpräventive Angebote sind ein bedeutender Bestandteil im<br />
Leistungskatalog der Fachstellen. Sie beteiligen sich an landes- und bundesweiten<br />
Suchtkampagnen und führen Schulungen und Fortbildungen für verschiedene<br />
Interessengruppen zu aktuellen Themen der <strong>Suchthilfe</strong> vor Ort durch. In der<br />
Betrieblichen Suchtberatung fördern die Fachstellen besonders die Multiplikatoren<br />
in Firmen und Unternehmen. Sie arbeiteten in Kirchengemeinden und<br />
Konfirmandengruppen/-freizeiten mit und tragen zur Gestaltung von suchtbezogenen<br />
Unterrichtseinheiten in Schulen bei.<br />
9.13. Öffentlichkeitsarbeit<br />
Öffentlichkeitswirksame Informationstage werden angeboten, wie auch die<br />
Beteiligung der Medien/Presse entsprechend berücksichtigt.<br />
Die Fachstellen sind vertreten im Arbeitskreis Sucht <strong>Wolfsburg</strong> und der<br />
Arbeitsgemeinschaft Sucht im Landkreis Gifhorn. Außerdem sind sie Mitglied in<br />
den Sozialpsychiatrischen Verbünden. Sie nehmen an Regionalkonferenzen und<br />
überregionalen Zusammenkünften der <strong>Suchthilfe</strong> mit ihren Verbänden teil.<br />
24
10. Supervision und Fortbildung<br />
Supervision wird für die MitarbeiterInnen in regelmäßigen Abständen durchgeführt.<br />
Fallbesprechungen finden in den Teamgesprächen wöchentlich mit dem<br />
Beratungsstellenarzt statt.<br />
Die MitarbeiterInnen sind gehalten, zur Qualifizierung, fachlichen Vertiefung und<br />
Weiterentwicklung Fortbildungen zu absolvieren. Die nichtärztlichen MitarbeiterInnen in<br />
der ambulanten Rehabilitation verfügen über die Anerkennung als Psychologischer<br />
Psychotherapeut und/oder Heilpraktiker für Psychotherapie zu ihren anerkannten<br />
therapeutischen Weiterbildungen.<br />
11. Qualitätsmanagement und Statistik<br />
Die <strong>Suchthilfe</strong> ist beteiligt an der Ebis-Statistik (Programmsystem für Einrichtungen der<br />
ambulanten Suchtkrankenhilfe im einrichtungsbezogenen Informationssystem, GSDA<br />
GmbH). Eigene katamnestische Erhebungen, wie auch Erhebungen zur<br />
Kundenzufriedenheit werden ebenfalls durchgeführt. Die Suchtberatungsstelle ist<br />
eingebunden ist das Qualitätsmanagement der Niedersächsischen Landesstelle für<br />
Suchtfragen (NLS) und hat mit der Entwicklung eines Qualitätshandbuches begonnen.<br />
Im Rahmen der Kombinationsbehandlung nimmt die <strong>Suchthilfe</strong> regelmäßig am<br />
Qualitätszirkel teil. Darüber hinaus werden die Ergebnisse des<br />
Qualitätssicherungsprogrammes der Sozialleistungsträger in das interne<br />
Qualitätsmanagement der <strong>Suchthilfe</strong> einfließen.<br />
12. Zusammenarbeit und Kooperationen mit Facheinrichtungen der<br />
Suchtkrankenhilfe<br />
Die <strong>Suchthilfe</strong> ist eingebunden in das ambulante und stationäre Betreuungs- und<br />
Behandlungsnetz für abhängigkeitskranke Menschen und deren Bezugspersonen.<br />
Interdiziplinäre Zusammenarbeit im eigenen Team und im Bezugs- und Umweltsystem<br />
sind Handlungsgrundlage. Die <strong>Suchthilfe</strong> verfügt über mehrere vertragliche<br />
Kooperationsvereinbarungen mit Rentenversicherungsträgern und<br />
<strong>Suchthilfe</strong>einrichtungen und Organisationen zur qualitativen Absicherung von<br />
Behandlungsmaßnahmen.<br />
Kornelia Andreß<br />
Leiterin der <strong>Suchthilfe</strong><br />
25
Literaturverzeichnis<br />
1. ALTMANNSBERGER, Walter<br />
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit<br />
Hogrefe Verlag, 2004<br />
2. BUCHKREMER, Gerhard, BATRA, Ariel<br />
Tabakentwöhnung<br />
Kohlhammer Verlag, 2004<br />
3. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Hrsg.<br />
Arbeitshilfe für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit<br />
Abhängigkeitserkrankungen<br />
Druckhaus Strobach GmbH, Heft 12, 2006<br />
4. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Hrsg.<br />
ICF-Praxisleitfaden, Januar 2006<br />
5. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation DIMDI, Hrsg.<br />
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit<br />
(ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO)<br />
6. DILLING, Horst, Hrsg.<br />
Lexikon zur ICD-10 Klassifikation psychischer Störungen<br />
Huber Verlag, 2008<br />
7. GRAWE, Klaus<br />
Neuropsychotherapie<br />
Hogrefe Verlag, 2004<br />
8. HAUSTEIN, Knut-Olaf<br />
Tabakabhängigkeit<br />
Deutscher Ärzte Verlag, Köln, 2001<br />
9. Dr. HAUTZINGER, Martin<br />
Kognitive Verhaltenstherapie bei psychischen Störungen<br />
Beltz Verlag, PVU, 3. Auflage, 2000<br />
10. KÖRKEL, J., SCHINDLER, C.<br />
Rückfallprävention mit Alkoholabhängigen<br />
Springer Verlag, 2003<br />
11. KRUSE, Gunther<br />
Alkoholabhängigkeit erkennen und behandeln<br />
Psychiatrie Verlag, 2000<br />
26
12. LINDENMEYER, Johannes<br />
Alkoholabhängigkeit<br />
Hogrefe Verlag, 1999<br />
13. LINDENMEYER, Johannes<br />
Der springende Punkt<br />
Pabst Science Publishers, 2001<br />
14. LINDENMEYER, Johannes, Hrsg.<br />
Kognitive Therapie der Sucht<br />
Beltz Verlag, PVU, 1997<br />
15. LUDEWIG, Kurt<br />
Systemische Therapie<br />
Klett-Cotta-Verlag, 1993<br />
16. MANN, K., BUCHKREMER, G. , Hrsg.<br />
Sucht<br />
Grundlagen, Diagnostik, Therapie<br />
Fischer Verlag, 1996<br />
17. MILLER, W., ROLLNICK, S.<br />
Motivierende Gesprächsführung<br />
Lambertus Verlag, 2004<br />
18. MÖLLER, LAUX, DEISTER, Hrsg.<br />
Psychiatrie und Psychotherapie<br />
Thieme Verlag, 2001, 2. Auflage<br />
19. PETRY, Jörg<br />
Psychotherapie der Glücksspielsucht<br />
Beltz Verlag, Psychologie Verlags Union, 1996<br />
20. SCHWENTERMANN, Michael<br />
Grundsatzpapier der Rentenversicherung zur Internationalen Klassifikation der<br />
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO)<br />
Deutsche Rentenversicherung, Heft 1 - 2/2003, Seiten 52 ff.<br />
21. GRÜSSER, Sabine M., THALEMANN, Carolin N.<br />
Verhaltenssucht<br />
Diagnostik, Therapie, Forschung<br />
Verlag Hans Huber, Bern, 2006<br />
22. VON SALISCH, Maria, KRISTEN, Astrid, OPPL, Caroline<br />
Computerspiele mit und ohne Gewalt<br />
Auswahl und Wirkung bei Kindern<br />
Kohlhammer Verlag, 2007<br />
Stand. April 2010<br />
27