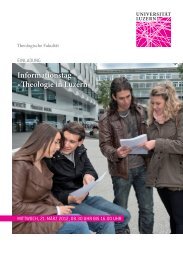1 Laudatio zum 1000. Geburtstag von Papst Leo IX, gehalten auf ...
1 Laudatio zum 1000. Geburtstag von Papst Leo IX, gehalten auf ...
1 Laudatio zum 1000. Geburtstag von Papst Leo IX, gehalten auf ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
<strong>Laudatio</strong> <strong>zum</strong> <strong>1000.</strong> <strong>Geburtstag</strong> <strong>von</strong> <strong>Papst</strong> <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>, <strong>gehalten</strong> <strong>auf</strong> „Wirthen“<br />
<strong>von</strong> Peter Grandy, anlässlich der GV der Romanerbruderschaft Solothurn<br />
vom 20. Januar 2003<br />
<strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>.<br />
<strong>Papst</strong> (12.II.1049-19.IV.1054)<br />
--------- Bischof <strong>von</strong> Toul (1026-1051)<br />
21.VI.1002-19.IV.1054<br />
Egisheim Rom<br />
Anlässlich des <strong>1000.</strong> <strong>Geburtstag</strong>s <strong>von</strong> <strong>Papst</strong> <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>. am 21. Juni 2002 ist die<br />
heutige <strong>Laudatio</strong> diesem bis heute einzigen <strong>Papst</strong> aus dem Bistum Basel<br />
gewidmet. Im Jahre<br />
1048 starb nach nur<br />
ganz kurzer<br />
Regierungszeit <strong>Papst</strong><br />
Damasus II. Auf<br />
Wunsch <strong>von</strong> Kaiser<br />
Heinrich III., der<br />
Fürsten und der<br />
Bischöfe sowie nach<br />
erfolgter Zu-stimmung<br />
durch das Volk <strong>von</strong><br />
Rom bestieg am 12.<br />
Februar 1049 der junge<br />
Touler Bischof Bruno<br />
<strong>von</strong> Egisheim als <strong>Papst</strong><br />
<strong>Leo</strong> <strong>IX</strong> den Stuhl des<br />
Apostelfürsten.<br />
Sein Name <strong>Leo</strong> stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: der Löwe . Er<br />
starb in Rom am 19. April 1054 mit 52 Jahren relativ jung nach nur 5 jährigem<br />
Pontifikat. Wie wir noch sehen werden, endete jedoch seine kurze<br />
Regierungszeit für die Kirchen <strong>von</strong> Ost und West mit Folgen, die bis heute ihre<br />
Wirkung zeigen. Sein Gedenktag im Regionalkalender der Kirche <strong>von</strong><br />
Basel, Freiburg im Breisgau und Trier ist der 19. April. Von <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>, dem<br />
die Kirche auch die Aufnahme des Allerseelenfestes in den Festkalender<br />
verdankt, befinden sich Reliquien in Rom (St. Peter), Egisheim, Buchsweiler<br />
und Dagsburg.<br />
Ich werde zu Beginn kurz über dessen Herkunft und Werdegang berichten. In<br />
einem weiteren Abschnitt soll dessen politische und kirchliche Tätigkeit<br />
beleuchtet werden. Ich spreche ferner über die im 11. Jahrhundert<br />
durchgeführte Um- und Neugestaltung der römischen Kurie zur Kurie der<br />
Weltkirche. Im weitern versuche ich in groben Zügen, die zahlreichen<br />
epochemachenden Synoden <strong>Papst</strong> <strong>Leo</strong>s darzustellen sowie <strong>auf</strong> den Konflikt<br />
zwischen Kirche und Staat, zwischen römischer und orthodoxer Kirche<br />
hinzuweisen. Letzterer führte schliesslich zur bis heute nachwirkenden Trennung<br />
Roms <strong>von</strong> Byzanz.
2<br />
Zur Herkunft: <strong>Papst</strong> <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong> mit dem T<strong>auf</strong>namen Bruno stammte aus dem<br />
elsässischen Hochadel und war der Sohn des Grafen Hugo IV. <strong>von</strong><br />
Egisheim eines Vetters der Mutter Kaiser KONRADS II.und der Heilwig <strong>von</strong><br />
Dagsburg-Egisheim, Tochter <strong>von</strong> Graf Ludwig .<br />
Bruno war ebenfalls mit Kaiser HEINRICH III. verwandt. Sein Großvater<br />
väterlicherseits, Hugo III., Graf <strong>von</strong> Nordgau-Egisheim, und die Großmutter<br />
des Kaisers, Adelheid, die Frau Heinrichs <strong>von</strong> Franken, waren Geschwister.<br />
Die Eltern schickten Bruno bereits als 5-jähriges Kind in die Domschule des<br />
Bischofs Bertold <strong>von</strong> Toul, der ihn, ganz seiner mönchsfreundlichen<br />
Überzeugung folgend, zu einem großen Freund des klösterlichen Lebens<br />
erzog und später <strong>zum</strong> Domherrn ernannte. Bertold war es stets ein Anliegen,<br />
den klösterlichen Status, das Leben der Brüder, ihr Ansehen und ihre Arbeit<br />
zu fördern. In diesem Sinne bezog der junge Bruno auch überzeugt Partei für<br />
die Anliegen seines Erziehers. Nach dem Tode Bertolds wurde Bruno an die<br />
Hof-Kanzlei Kaiser Konrads II (1024-1039) berufen.<br />
Im Jahre 1026 leitete er das Aufgebot Touls <strong>auf</strong> dem Feldzug in der<br />
Lombardei. Als Bischof Hermann <strong>von</strong> Toul starb, wurde Bruno, kaum 24<br />
jährig, <strong>auf</strong> Wunsch des Klerus zu seinem Nachfolger bestimmt. Am 9.<br />
September 1027 wurde er <strong>von</strong> Erzbischof Poppo <strong>von</strong> Trier geweiht. Von den<br />
damals üblichen Geldzahlungen aus Anlass der Verleihung der weltlichen<br />
Bischofsrechte hatte ihn der König befreit. Als nicht <strong>von</strong> der Simonie<br />
betroffener Bischof konnte er deshalb später als <strong>Papst</strong> überzeugend den<br />
Kampf gegen den Ämterk<strong>auf</strong> in Angriff nehmen. Als Bischof verteidigte Bruno<br />
seine Selbstständigkeit gegenüber dem Metropoliten oder Erzbischof; er<br />
stärkte sein Bistum nach innen und aussen. Häufige Synoden und Visitationen<br />
halfen mit, das religiöse Niveau zu heben. In diesem Sinne sorgte er<br />
besonders für die Klöster St-Evré, Remiremont , St-Mansuy und<br />
Moyenmoutier, in denen er die cluniazensische Reformrichtung des Abtes<br />
Wilhelm <strong>von</strong> Volpiano durch dessen Schüler Widrich ausbreiten ließ. Cluny,die<br />
ehemalige Benedikt-inerabtei in Burgund war Ausgangspunkt der<br />
cluniazensischen Reform, durch die im 10./11. Jh. das benediktinische<br />
Mönchtum erneuert und die päpstl. Machtentfaltung überhaupt erst ermöglicht<br />
wurde .WILHELM <strong>von</strong> Volpiano ,* 962 - † 1. Januar 1031 war im übrigen der<br />
Sohn <strong>von</strong> Graf Robert <strong>von</strong> Volpiano, der mit der Kaiserin Adelheid verwandt<br />
war. Brunos Sorge galt aber in erster Linie seinem Bistum und nur selten<br />
suchte er den Hof <strong>auf</strong>.<br />
Politisch unterstützte Bischof Bruno <strong>von</strong> Toul die salischen Kaiser. So<br />
vermittelte er (1032/1033) im Streit um Burgund diplomatisch geschickt<br />
zwischen Konrad und König Heinrich I. <strong>von</strong> Frankreich, wobei er immer die<br />
Interessen Konrads vertrat. Der König leistete im Gegenzug militärische Hilfe,<br />
indem er (1037) an der Südwest-grenze mit Waffengewalt gegen Graf Odo<br />
<strong>von</strong> Champagne ein-schritt , der mehrfach das Bistum verwüstete. Als<br />
Konrads Sohn, Heinrich III., 1039 den Thron bestieg, wusste er Bruno<br />
ebenfalls <strong>auf</strong> seiner Seite. Erneut vermittelte der Touler Bischof (1048) beim<br />
lothringischen Aufstand Herzog Gottfrieds III. des Bärtigen, dabei konnte er<br />
ein französisches Eingreifen im Reich verhindern. Nach dem frühen Tod der<br />
beiden deutschen Päpste Clemens II.(1046-/1047) und Damasus II. (1048)<br />
bestimmte ihn Kaiser HEINRICH III. im Dezember 1048 <strong>auf</strong> dem Reichstag zu
3<br />
Worms <strong>zum</strong> Nachfolger <strong>auf</strong> dem Stuhl Petri. Der Vorschlag einer römischen<br />
Gesandt-schaft, den frühern Abt <strong>von</strong> St. Bénigne, Erzbischof Halinard <strong>von</strong><br />
Lyon, zu wählen, scheiterte an der Ablehnung sowohl durch den Kandidaten<br />
selbst als auch des Königs, dem Halinard nicht genehm war. Bruno nahm die<br />
Wahl erst an, als er sicher war, dass auch die letzte Einzelheit kanonischer<br />
Rechtmäßigkeit gewahrt und die Einstimmigkeit bewiesen war.<br />
Bruno, Bischof <strong>von</strong> Toul, wählte sehr bewußt den <strong>Papst</strong>namen <strong>Leo</strong>. Bischof<br />
Bruno wurde am 12.2. 1049 im Lateran als <strong>Papst</strong> <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong> gekrönt. Bei der<br />
Krönung bestand er jedoch <strong>auf</strong> der Zustimmung per Akklamationem durch<br />
Klerus und Volk <strong>von</strong> Rom. Damit wollte der neue <strong>Papst</strong> die Kanonische Wahl<br />
durch Klerus und Volk in der Kirche allgemein beachtet wissen. Den<br />
Gewählten empfahlen 3 entscheidende Tatsachen: er war leidenschaftlicher<br />
Vorkämpfer der Reform, ein zuverlässiger Verwandter und ein reichstreuer<br />
Hierarch, eine der farbigsten Persönlichkeiten des <strong>Papst</strong>tums. Seine<br />
Namenwahl war bereits Programm: <strong>Leo</strong> strebte die Rück-kehr zur reinen<br />
Urkirche der Apostel an! Er hatte, als er Rom noch als Bischof <strong>zum</strong> ersten Mal<br />
betrat, nicht nur eine <strong>auf</strong>fallend starke Leibgarde bei sich gehabt, sondern es<br />
auch vermieden, sich bei dem gerade amtierenden <strong>Papst</strong> vorzustellen - für<br />
einen Bischof immerhin ungewöhnlich.<br />
Neugestaltung der römischen Kurie:<br />
Ein weiteres Mittel zur Reorganisation der curialen Verhältnisse Roms war die<br />
Bildung eines Kreises <strong>von</strong> bewährten Mitarbeitern. Aus diesem Grund<br />
organisierte er die päpstliche Verwaltung neu. <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong> zog Humbert <strong>von</strong> Silva<br />
Candida, Hugo <strong>von</strong> Remiremont, Friedrich <strong>von</strong> Lothringen (= Stephan <strong>IX</strong>),<br />
Hildebrand (=Gregor VII), Petrus Damiani , Halinard <strong>von</strong> Lyon und Udo <strong>von</strong><br />
Toul, seinen späteren Nachfolger (1051) im Bischofsamt an die Kurie. Dieser<br />
Kreis bildete den Grundstock des späteren Kardinalskollegiums. Mit der<br />
Berufung <strong>von</strong> zahlreichen Reformern nach Rom minderte der <strong>Papst</strong> im weitern<br />
den Einfluss des römischen Klerus. So wandelte sich schliesslich unter <strong>Papst</strong><br />
<strong>Leo</strong> <strong>IX</strong> die stadtrömische Bistumsverwaltung in die Kurie der Weltkirche. Dazu<br />
gehörte nun aber eine aktive Kirchen- und Aussenpolitik.<br />
Kein <strong>Papst</strong> ist soviel gereist, um <strong>auf</strong> Synoden in Italien, Deutschland und<br />
Frankreich der Reform <strong>von</strong> Cluny Geltung zu verschaffen, zu predigen, den<br />
Primat wieder zu festigen, das <strong>Papst</strong>tum als Idee zu verlebendigen und der<br />
Kirche ihre Universalität wiederzugeben. Dazu suchte er sich seine Mitarbeiter<br />
im Strahlungsbereich <strong>von</strong> Cluny. <strong>Leo</strong> bildete das Kardinals-kollegium <strong>zum</strong><br />
eigentlichen Senat der Kirche um und wurde so <strong>zum</strong> Begründer des<br />
Kardinalskollegiums in seiner bis heute praktizierten Form. Während seines<br />
nur 5 Jahre dauernden Pontifikates hielt sich <strong>Leo</strong> nur wenige Monate in Rom<br />
<strong>auf</strong>. Er hielt eine Vielzahl <strong>von</strong> Versammlungen und Synoden ab und leitete die<br />
gregorianische Reform der Kirche ein.<br />
Auf seinen langen Visitationsreisen durch ganz Europa gründete und<br />
restaurierte er viele Klöster, wie <strong>zum</strong> Beispiel am 22. November 1049 das<br />
Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen oder weihte unzählige Kirchen wie <strong>zum</strong><br />
Beispiel die Kapelle der Vorbourg bei Delsberg , aber auch in Augsburg und
4<br />
Regensburg, und stärkte so den unmittelbaren Einfluss des <strong>Papst</strong>tums <strong>auf</strong> <strong>von</strong><br />
Rom ferne Gemeinden.<br />
<strong>Leo</strong>s Verbundenheit mit der lothringisch/burgundischen Mönchsreform kommt<br />
in den <strong>auf</strong> seinen Reisen erteilten Klosterprivilegien <strong>zum</strong> Ausdruck. So<br />
erhielten mehr als 160 Klöster besondere Privilegien. Hier handelte es sich oft<br />
um eine erneute Verbriefung alter Privilegien oder um Anerkennung eines bestehenden<br />
Zustandes unter päpstlichen Vorzeichen, wobei sich auch<br />
päpstlicher neben königlichen Schutz stellte. <strong>Leo</strong> erkannte die Rechte der<br />
Eigenkirchenherren durch Zusicherung erblicher Vogteirechte an, schützte<br />
dabei aber durch Appelationsrechte an den <strong>Papst</strong> die Klöster vor Missbrauch.<br />
Die Tendenz, Klöster mehr als bisher mit Rom in Verbindung zu bringen, sollte<br />
dem Schutz der Klöster dienen und richtete sich nicht gegen Laien, betonte<br />
und konkretisierte aber päpstliche Rechtsansprüche, die im Sinne des<br />
Eigenkirchenrechtes verstanden wurden.<br />
Epochemachende Synoden:<br />
Nach seinem Amtsantritt als <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>. Ende Februar 1049 führte er die offizielle<br />
Kirchenpolitik weiter, indem er gegen die Priesterehe und für das Zölibat<br />
eintrat sowie die Laieninvestitur und die Simonie bekämpfte.<br />
Die erste grosse Synode <strong>Leo</strong>s <strong>IX</strong>. in Rom im April 1049 war programmatisch.<br />
Die Kanones der ersten vier ökumenischen Konzilien Nicäa (325),<br />
Konstantinopel (381), Ephesus und Chalkedon wurden verlesen und die<br />
Verbindlichkeit päpstlicher Dekrete bestätigt, bevor man energischer als bisher<br />
gegen Priesterheirat und -konkubinat vorging, ebenso wie gegen Simonie. Es<br />
war <strong>Papst</strong> <strong>Leo</strong> der die Absetzung aller simonistisch gewählten und geweihten<br />
Geistlichen, sowie aller im Konkubinat lebenden Priester forderte. Es zeigte<br />
sich aber, dass in Rom kein Gottes-dienst mehr hätte stattfinden können,<br />
wären alle Maßnahmen durchgeführt worden. Doch im gleichen Maße bestand<br />
das Prob-lem der rechtmäßig verheirateten Priester. Nachdem bereits<br />
Benedikt VIII. Priesterkinder, also die wehrlosesten Opfer der Zwangslage der<br />
Zölibatsgesetze, zu Gesetzlosen und "Sklaven der Kirche" erklärt hatte,<br />
erweiterte <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>., persönlich eine gütige, liebenswürdige Gestalt, diesen<br />
Barbarismus dahingehend, dass er auch Ehefrauen <strong>von</strong> Priestern ebenso wie<br />
Konkubinen zu Sklavinnen der Kirche erklärte, was der Kirche Roms billige<br />
Arbeitskräfte sicherte. Der Kirchenlehrer Petrus Damiani, mit Hildebrand<br />
wichtigster Berater des <strong>Papst</strong>es, überreichte <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>. sein Liber Gomorrhianus,<br />
sein Gomorrhabuch, über die all-gemeinen Zustände in den Lebensbereichen<br />
der Priester.<br />
Auf dem Reimser Konzil vom Oktober 1049 verkündete <strong>Leo</strong> ferner als erster<br />
<strong>Papst</strong> einen Gottesfrieden (lat. Pax Dei oder Treuga Dei), eine durch<br />
kirchliches Gebot allgemein verbindliche und ins Kirchenrecht <strong>auf</strong>genommene<br />
Einschränkung des mittelalterlichen Fehdewesens an kirchlichen Festtagen<br />
und an bestimmten Wochentagen; Dieser Ende des 10. Jh. <strong>von</strong> Südfrankreich<br />
ausgehenden Gottesfrieden-Bewegung blieb zwar der durch-greifende Erfolg<br />
versagt, dennoch fand sie ihre Ergänzung in der durch Vertrag und<br />
Beschwörung zustandegekommenen weltlichen Landfriedens-Bewegung.
5<br />
Auf der Synode <strong>von</strong> Vercelli (1050) schliesslich erfolgte die Verdammung der<br />
Eucharistielehre Berengars <strong>von</strong> Tours, Mönch, frz. Scholastiker, * um 1000<br />
Tours, † 1088 Saint-Côsme (bei Tours); Berengar war Befürworter einer<br />
streng logischen Arg-umentationsweise, der sogar die Glaubenswahrheiten<br />
sich unter-werfen müßten. Seine Lehre <strong>von</strong> der bloß sinnbildlichen Gegenwart<br />
Gottes in der Eucharistie wurde <strong>von</strong> der Kirche verurteilt.<br />
Kirchenreformen: Konflikt Kirche und Staat:<br />
Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts gab es in Teilen Frankreichs und Englands<br />
sowie im Heiligen Römischen Reich eine starke Bewegung zur Reformierung<br />
der Kirche. Die Reformer kritisierten, dass die Laieninvestitur nicht den alten<br />
Kirchengesetzen ent-sprach, und führten <strong>auf</strong> sie den moralischen Verfall des<br />
damaligen Klerus zurück, insbesondere dessen Nachsicht gegenüber der<br />
Nichteinhaltung des Zölibats sowie der weit verbreiteten Simonie, dem K<strong>auf</strong><br />
und Verk<strong>auf</strong> <strong>von</strong> Kirchenämtern.<br />
Im 11. und 12. Jahrhundert eskalierte ferner der Konflikt zwischen Kirche und<br />
Staat um die Rolle der weltlichen Herrscher bei der Amtseinsetzung <strong>von</strong><br />
Bischöfen und Äbten. Dabei war vor allem strittig, dass der Landesherr dem<br />
geistlichen Würdenträger Ring und Stab überreichte, die Symbole seiner<br />
geistlichen Autorität.<br />
Auch die "Laieninvestitur", die Einsetzung <strong>von</strong> Nicht-Geistlichen ins<br />
Bischofsamt, die im frühen Mittelalter <strong>auf</strong>gekommen war, wurde angefochten.<br />
Die Laieninvestitur entstand im Umfeld des Feudal-systems, in dem geistliche<br />
Würdenträger oft zugleich weltliche Herrscher und damit Vasallen des Königs<br />
waren. Kaiser und Könige versuchten, die reichen und mächtigen geistlichen<br />
Würden-träger an sich zu binden, indem sie ihnen im Gegenzug Schutz<br />
anboten. Den weltlichen Landesherren war die Loyalität der Bi-schöfe und<br />
Äbte meist wichtiger als deren moralische Integrität.<br />
Herausforderung im Kampf mit den Normannen: Bruno war 24 Jahre, als<br />
er das Bistum Toul <strong>von</strong> KONRAD II. erhielt. Er befehligte die bischöflichen<br />
Truppen <strong>auf</strong> dem italienischen Feldzug, dabei bewies er eigene Fähigkeiten<br />
für die Kriegsführung, <strong>von</strong> der er auch als <strong>Papst</strong> nie ganz ablassen konnte. So<br />
wagte er als <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>. 1053 die offene Herausforderung im Kampf mit den<br />
Normannen, obwohl Kaiser HEINRICH III. seine deutschen Truppen zurückbeorderte.<br />
Mit Hilfe der süditalienischen Griechen und seinem Aufgebot<br />
eröffnete er den Feldzug, mit dem er, gleich den späteren<br />
Kreuzzugsunternehmen, der römischen Kirche und ihrer Christen-heit große<br />
Gebiete zurückerobern wollte. So marschierte er mit den Truppen über Monte<br />
Cassino, S. Germano und Benevent nach Civitate. Hier im Schloß verschanzte<br />
er sich, während die Normannen vorpreschten. Dann trieben die<br />
<strong>auf</strong>gebrachten Stadtbürger <strong>Leo</strong> und seine Kardinäle aus der Stadt. Hier,<br />
westlich des Monte Gargano, erlitt der <strong>Papst</strong> am 18. Juni 1053 eine<br />
vernichtende Niederlage und gelangte als Geisel selbst in feindliche<br />
beneventanische Gefangenschaft. 1054 wurde er nach 8-monatiger<br />
Gefangenschaft schwer krank freigelassen. <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong> starb sechs Wochen<br />
später, erschöpft und ausgelaugt, nachdem er sich ans Grab des Petrus hatte<br />
tragen lassen, um dort seine letzten Stunden zu verbringen.
6<br />
Stimmen des Verrats wurden laut, aber ausschlaggebend war gewesen, dass<br />
die Ritter, die <strong>Leo</strong> in Deutschland anwerben konnte, schlecht gerüstet und<br />
wenig kriegstüchtig waren, dass <strong>Leo</strong> mit den Seinen schon rein zahlenmäßig<br />
und mangels Erfahrung einem viel stärkeren Gegner gegenüberstand. Der<br />
Sieg der Normannen gilt als Beginn ihrer Staatsgründung. Sie anerkannten<br />
den <strong>Papst</strong> sogar als ihren Lehensherrn. Geschichtlich ist dieser mißlungene<br />
Feldzug insofern <strong>von</strong> verhängnisvollster Bedeutung geworden, als der <strong>Papst</strong><br />
ihn <strong>zum</strong> "heiligen Krieg" erklärte und damit das Unheil der<br />
Kreuzzugsjahrhunderte einleitete. Seine Krieger wurden zu Märtyrern und<br />
Heiligen stilisiert. Ein Beispiel war gegeben, das schon bald <strong>zum</strong><br />
konsequenten Mißbrauch des Begriffes "heilig" im Zusammenhang mit dem<br />
Krieg berechtigen sollte. Petrus Damiani hat den <strong>Papst</strong> dafür <strong>auf</strong> das schärfste<br />
getadelt und sich dagegen gewandt, dass "<strong>zum</strong> Schimpf der Kirche durch<br />
Kriegsgewalt entschieden werden" soll. 40 Jahre nach dem Tode des <strong>Papst</strong>es<br />
waren die Kreuzzüge geboren, um mit wechselnden Namen und Zielen die<br />
folgenden 850 Jahre zu überdauern.<br />
Zur rechtlichen Definition des Patrimonium Petri und des Primates berief der<br />
<strong>Papst</strong> sich ausgiebig <strong>auf</strong> die pseudoisidorischen Dekretale und die<br />
Behauptungen der Donatio Constantini.:<br />
Bei den pseudoisidorischen Dekretalen handelt es sich um eine angeblich<br />
<strong>von</strong> einem Isidor Mercator verfaßte Kirchenrechtssammlung, die neben<br />
echtem Material zahlreiche Fälschungen <strong>von</strong> alten Dekretalen,<br />
Synodalbeschlüssen und fränkischen Reichsgesetzen enthält; diese sind<br />
wahrscheinlich in Reims zwischen 847 und 852 entstanden. Absicht war, die<br />
Stellung der Bischöfe zu stärken und die päpstliche Gewalt zu erhöhen, um<br />
die alte fränkische Provinzialkirchenverfassung zu zerschlagen. Bedeutung<br />
erlangten die pseudoisidorischen Dekretale aber erst ab Mitte des 11. Jh., als<br />
sie dem Reformpapsttum zur Stützung seiner Forderungen dienten. Bei den<br />
Behauptungen der Donatio Constantini (bekannt auch unter dem Begriff der<br />
Konstantinischen Schenkung) wiederum handelte es sich um ein im 8.<br />
Jahrhundert <strong>auf</strong>getauchtes angebliches Schreiben Kaiser Konstantins d. Gr.<br />
an <strong>Papst</strong> Silvester I., in welchem dem <strong>Papst</strong> der Lateranpalast sowie der<br />
Vorrang über Kirche und Kaisertum zuerkannt wurden; diese haben sich im<br />
15. Jh. als Fälschung erwiesen.<br />
In die Zeit des Pontifikates <strong>Leo</strong>s <strong>IX</strong> fiel ebenfalls die endgültige, auch formelle<br />
Trennung <strong>von</strong> der Kirche <strong>von</strong> Byzanz. Als Folgenreich erwies sich besonders<br />
das wachsende römische Selbst-bewußtsein in der Beziehung zu Byzanz, mit<br />
dem <strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>. eigentlich ein Bündnis gegen das Vordringen der Normannen in<br />
Süd-Italien suchte. 1054 fand der lange Dogmenstreit zwischen West- und<br />
Ostkirche durch die Exkommunikation des Patriarchen <strong>von</strong> Konstantinopel<br />
Michael Kerullarios und aller seiner Kirchenmitglieder durch Kardinal Humbert<br />
seinen Höhepunkt: Dieser Schritt vollendete die Spaltung zwischen Rom und<br />
der orthodoxen Kirche.<br />
Damit endeten alle in 575 Jahren wechselnd stark sich manifestierenden<br />
Gegensätze im völligen Bruch. Die beiden letzten Gegner und Protagonisten<br />
der Tragödie symbolisierten zwei Welten: Kardinal Humbert <strong>von</strong> Silva-<br />
Candida, Mönch <strong>von</strong> Cluny, Geschichtsphilosoph, Rechtstheoretiker der<br />
Reform und größter Wortführer eines <strong>von</strong> aller Simonie gereinigten Primates,
7<br />
doch auch der rücksichtsloseste und diplomatischste Verhandlungs-partner,<br />
war der Wortführer Roms;<br />
<strong>auf</strong> der andern Seite vertrat Patriarch Michael Kerularios, der bedeutendste<br />
Patriarch <strong>von</strong> Konstantinopel nach Photios den Ost-Primat mit gleicher<br />
Schroffheit wie Kardinal Humbert den Westprimat.<br />
Als offizielles Datum der Trennung gilt der Tag, an welchem der Kardinal die<br />
Bannbulle des <strong>Papst</strong>es gegen den Patriarchen <strong>auf</strong> dem Altar der Hagia<br />
Sophia niederlegte. An diesem Tag war der <strong>Papst</strong> bereits gestorben<br />
Erst die Begegnung Pauls VI. mit dem Patriarchen Athenagoras I. und die<br />
formelle Aufhebung des Bannfluches am Ende des 2. vatikanischen Konzils ist<br />
<strong>zum</strong> Beginn einer neuen Begegnung <strong>von</strong> Ost und West geworden.<br />
<strong>Leo</strong> <strong>IX</strong>., der nach seinem Tode 1054 sogleich als Heiliger verehrt und <strong>von</strong><br />
einem Touler Kleriker (nicht Humbert) durch eine noch zu seinen Lebzeiten<br />
begonnene Vita gewürdigt wurde, war der historisch bedeutendste der<br />
deutschen Päpste und hat weniger in seinen Zielen als in der Art ihrer<br />
Durchsetzung den Aufstieg des hochmittelalterlichen <strong>Papst</strong>tums eingeleitet.