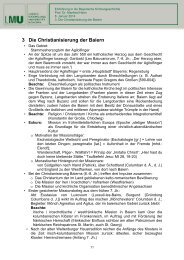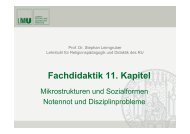(10) Philosophische Begründungstypen der Umweltethik 1 ...
(10) Philosophische Begründungstypen der Umweltethik 1 ...
(10) Philosophische Begründungstypen der Umweltethik 1 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vogt – Nachhaltigkeit [Zsfg. <strong>10</strong>] 70<br />
(<strong>10</strong>) <strong>Philosophische</strong> Begründungstypen <strong>der</strong> <strong>Umweltethik</strong><br />
1. Fragebogen: „Entdecken Sie Ihre umweltethische Position!<br />
(siehe Anlage)<br />
2. Typen umweltethischer Begründung<br />
Ein Ausgangspunkt für die Suche nach fundamental neu ansetzenden Begründungsmodellen<br />
in <strong>der</strong> ökologischen Ethik war eine radikale Kritik am christlichen Naturverhältnis:<br />
Die im biblischen Schöpfungsbericht grundgelegte „anthropozentrische“ Vorstellung,<br />
dass <strong>der</strong> Mensch mit einem Herrschaftsauftrag über die Natur ausgestattet sei<br />
(Gen 1, 26-28), wird von Lynn White, Carl Amery u.a. als zentrale geistesgeschichtliche<br />
Ursache des neuzeitlich-instrumentellen Naturverhältnisses und damit <strong>der</strong><br />
abendländischen Umweltkrise gedeutet (Amery 1972). Als alternative Ausgangspunkte<br />
gewinnen die Vorstellungen „Vermeidung von Leid“, „Gleichberechtigung aller Leben“<br />
und „Rechtsgemeinschaft <strong>der</strong> Natur“ eine ethische Schlüsselbedeutung. In diesen Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
lassen sich folgende Begründungsmodelle unterscheiden:<br />
Anthropozentrischer Ansatz: Als zentraler ethischer Maßstab gilt hier die Würde des<br />
Menschen (griechisch: anthropos = Mensch). Ökologische For<strong>der</strong>ungen werden in Bezug<br />
die Bedürfnisse und Lebensbedingungen des Menschen begründet, wobei in neuerer<br />
Zeit insbeson<strong>der</strong>e globale Zusammenhänge sowie die künftigen Generationen ins Blickfeld<br />
gekommen sind. In seiner klassischen Ausformung bei Kant erkennt die anthropozentrische<br />
Ethik allein den Angehörigen <strong>der</strong> menschlichen Gattung den Anspruch zu,<br />
nie nur als Mittel, son<strong>der</strong>n stets auch als Zweck an sich selbst behandelt zu werden<br />
(Kant BA 66f). Darauf aufbauend geht die methodische Anthropozentrik davon aus,<br />
dass jede Begründung ethischer Sollensansprüche auf den Menschen Bezug nehmen<br />
muß, weil nur er sittliches Subjekt und damit möglicher Adressat moralischer Appelle<br />
ist (Irrgang 1992, 9-1<strong>10</strong>; Lochbühler 1996, 201-320). Die inhaltlich-materiale<br />
Anthropozentrik sieht darüber hinaus den Menschen als „Spitzengeschöpf“ an, in dem<br />
die Evolution ihren höchsten Sinn findet und <strong>der</strong> mit einem Gestaltungs- und<br />
Herrschaftsauftrag über die Natur ausgestattet ist.<br />
Pathozentrischer Ansatz: Als ethischer Maßstab gilt die Empfindungsfähigkeit (griechisch:<br />
pathein = leiden, empfinden). Ziel ist es, Leid zu vermeiden, wobei alle Lebewesen,<br />
die Freude und Schmerz empfinden können, als Träger eigener moralischer<br />
Rechte berücksichtigt werden. Der pathozentrische Ansatz entfaltet sein Anliegen vor<br />
allem im Bereich <strong>der</strong> Tierethik, in <strong>der</strong> bezogen auf die jeweilige Empfindungsfähigkeit<br />
Kriterien für artgerechte Tierhaltung definiert werden. Angesichts <strong>der</strong> Erfor<strong>der</strong>nisse des<br />
Pflanzenschutzes sowie <strong>der</strong> Berücksichtigung ökologischer Gesamtzusammenhänge<br />
hilft das Kriterium <strong>der</strong> Leidensfähigkeit jedoch kaum weiter.<br />
Biozentrischer Ansatz: Als ethischer Maßstab gilt <strong>der</strong> Wille zu leben (griechisch: bios =<br />
Leben). Jedes Lebewesen hat danach ein prinzipiell gleichrangiges Recht auf die Achtung<br />
seiner zum Überleben und zur Entfaltung notwendigen Grundbedürfnisse. Der biozentrische<br />
Ansatz geht wesentlich auf Albert Schweitzer zurück, <strong>der</strong> als allgemeines<br />
ethisches Leitprinzip formuliert: "Die Ehrfurcht vor dem Leben gibt mir das Grundprinzip<br />
des Sittlichen ein, dass das Gute in dem Erhalten, För<strong>der</strong>n und Steigern von Leben<br />
besteht und das Vernichten, Schädigen und Hemmen von Leben böse ist" (Schweitzer<br />
1990, 17). Der Gedanke, dass alle Lebewesen in einer einzigen Lebensgemeinschaft<br />
miteinan<strong>der</strong> verbunden sind, wird zunehmend auch von <strong>der</strong> Whiteheadschen Prozeßphilosophie<br />
her begründet. Der biozentrische Ansatz erkennt keinen grundsätzlichen<br />
Vorrang <strong>der</strong> menschlichen Interessen an. Um im Konfliktfall zwischen verschiedenen<br />
70
Vogt – Nachhaltigkeit [Zsfg. <strong>10</strong>] 71<br />
Lebewesen entscheiden zu können, werden teilweise Differenzierungen eingeführt, z.B.<br />
<strong>der</strong> Grad an Fähigkeit, nach selbstgesetzten Zielen zu streben, was ein wichtiges<br />
Merkmal von Leben ist (Ricken 1987).<br />
Physiozentrischer Ansatz (auch ökozentrisch o<strong>der</strong> holistisch genannt): Ethischer Maßstab<br />
ist hier die Zugehörigkeit zur Natur in ihrer Gesamtheit (griechisch: physis = Natur).<br />
Das physiozentrische Modell knüpft in seinem Naturverständnis an religiös-mythische<br />
und romantische Traditionen an und sucht auf dieser Basis nach einem „Frieden<br />
mit <strong>der</strong> Natur“ (Meyer-Abich 1986). Im Rahmen einer umfassenden „Rechtsgemeinschaft<br />
<strong>der</strong> Natur“ soll nicht nur den Menschen, son<strong>der</strong>n allen Lebewesen sowie Flüssen,<br />
Wäl<strong>der</strong>n und an<strong>der</strong>en Ökosystemen <strong>der</strong> Status von Rechtssubjekten mit eigenen, von<br />
Vertretern einklagbaren Rechten zugestanden werden. Das hat zur Konsequenz, dass<br />
eine radikale Reform des gesamten Rechtssystems gefor<strong>der</strong>t wird.<br />
3. Ökologische Aufklärung <strong>der</strong> Anthropozentrik<br />
Ohne die vielschichtigen Auseinan<strong>der</strong>setzungen um diese unterschiedlichen ethischen<br />
Ansätze hier im einzelnen zu entfalten, sollen im folgenden als eine Art Resümee für<br />
die Begründung des Nachhaltigkeitsprinzips einige wichtige Gesichtspunkte festgehalten<br />
werden:<br />
1. Die Natur hat einen Eigenwert. Sie hat den Menschen hervorgebracht und wird ihn<br />
überdauern; die Frage nach ihrem Nutzen betrifft von daher nur einen relativ eng<br />
umgrenzten Teilaspekt des menschlichen Naturverhältnisses. Die Wahrnehmung ihrer<br />
Schönheit, die Erhaltung ihrer Vielfältigkeit und die Achtung ihrer Entfaltungsbedingungen<br />
sind für den Menschen zugleich eine Frage <strong>der</strong> Übereinstimmung mit<br />
sich selbst, also seiner Identität und Selbstachtung.<br />
2. Die ästhetische, mystische o<strong>der</strong> ontologische Qualität, die für die Natur als solche<br />
reklamiert wird, ist nie aus ihrer Bezogenheit auf die kulturell vermittelten Wahrnehmungsformen<br />
des menschlichen Subjekts zu lösen (Höhn 1997, 271-274). Insofern<br />
ist die Feststellung des Eigenwertes <strong>der</strong> Natur strikt an ihren (erkenntnistheoretischen<br />
und ethischen) Bezug zum Menschen gebunden. Sie ist ein kulturspezifisches<br />
Phänomen.<br />
3. Nur <strong>der</strong> Mensch kann Subjekt sittlicher Verantwortung und damit Adressat moralischer<br />
Appelle sein. Ihm kommt eine unbedingte Würde zu, und zwar nicht aufgrund<br />
bestimmter natural faßbarer und auch an<strong>der</strong>en Lebewesen o<strong>der</strong> Naturdingen zuschreibbarer<br />
Eigenschaften, son<strong>der</strong>n als Person und damit als einem zu Freiheit und<br />
Verantwortung berufenem sittlichen Subjekt (Vogt 1997, 333-368). In dieser personal-transzendentalphilosophischen<br />
und methodischen Hinsicht ist die Anthropozentrik<br />
unhintergehbar: Jede Begründung ethischer Imperative muß zentral auf den<br />
Menschen als Person Bezug nehmen.<br />
4. Christliche Ethik kann <strong>der</strong> umweltethischen Kritik entgegenhalten, dass nicht die<br />
Anthropozentrik als solche, son<strong>der</strong>n vielmehr <strong>der</strong> Verlust ihrer theologischen Rückbindung<br />
im säkularen Anthropozentrismus <strong>der</strong> Neuzeit zu einem einseitig instrumentellen<br />
Naturverhältnis geführt hat (Irrgang 1992, 17). Dies wird durch eine differenzierte<br />
Kulturgeschichte bestätigt (Rappel 1996).<br />
5. Die Kantsche Auffassung, dass Tierquälerei nur deshalb ethisch verwerflich sei,<br />
weil <strong>der</strong> Mensch dadurch in seinem Einfühlungsvermögen auch gegenüber<br />
Menschen verrohe (Kant A <strong>10</strong>8f), ist unzureichend. Nicht als Bedürfniswesen,<br />
son<strong>der</strong>n als Verantwortungssubjekt steht <strong>der</strong> Mensch im Zentrum ethischer<br />
Argumentation. Dabei bleibt er strikt an eine Grundorientierung gebunden, die den<br />
71
Vogt – Nachhaltigkeit [Zsfg. <strong>10</strong>] 72<br />
Eigenwert seiner Mitgeschöpfe achtet und riskante Eingriffe in ökologische Systeme<br />
meidet. Personale Anthropozentrik ist also nicht zu verwechseln mit einer<br />
Begründung des Ethischen allein vom menschlichen Nutzen her.<br />
6. In Bezug auf inhaltliche Kriterien des Naturumgangs bedarf die Anthropozentrik<br />
einer „ökologischen Aufklärung“ (Höhn 1994, 16; Hasted 1991, 9-24.151-203.283-<br />
292): Für den Tierschutz gewinnt dabei das Kriterium <strong>der</strong> Empfindungsfähigkeit<br />
eine grundlegende Bedeutung; für den Umweltschutz das <strong>der</strong> Grundfunktionen<br />
übergreifen<strong>der</strong> ökologischer Zusammenhänge. Wenn man dies auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong><br />
Kriterien und nicht auf <strong>der</strong> Ebenen <strong>der</strong> alternativen Letztbegründung einordnet,<br />
kann die <strong>Umweltethik</strong> in vieler Hinsicht konstruktiv an die Ethik Aufklärung anknüpfen.<br />
Die Intention einer (zweiten) Aufklärung entspricht <strong>der</strong> Grundausrichtung<br />
des Nachhaltigkeitsprinzips, das in seinen Ursprüngen von aufklärerischen Impulsen<br />
getragen war (Schanz 1996, 18-36).<br />
7. Das stärkste Argument für politische Initiativen zum Umweltschutz ist nicht <strong>der</strong><br />
Hinweis auf Eigenrechte <strong>der</strong> Natur, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Nachweis, dass Naturschutz heute<br />
Voraussetzung für existentielle Lebenschancen künftiger Generationen ist. So begründet<br />
<strong>der</strong> 1994 eingefügt Artikel 20a des deutschen Grundgesetzes die Verankerung<br />
des Umweltschutzes als Staatsziel mit dem zunächst auf den Menschen bezogenen<br />
Grundsatz intergenerationeller Gerechtigkeit. Auch die Dokumente von Rio<br />
führen das Nachhaltigkeitsprinzip von einem anthropozentrischen Bezug her ein:<br />
„Human beings are at the center of sustainable development“ lautet <strong>der</strong> Beginn des<br />
ersten Grundsatzes <strong>der</strong> Rio-Deklaration (BMU 1992, 45). Das Nachhaltigkeitskonzept<br />
ist seinem Ursprung nach ein Naturnutzungskonzept und schon von daher auf<br />
den Menschen bezogen.<br />
8. Die ökologischen Erfor<strong>der</strong>nisse werden im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzeptes<br />
vor allem durch einen langfristigen und globalen Bewertungshorizont eingebracht,<br />
wobei es gerade systematisch auf die Zusammenhänge zwischen menschlichen und<br />
naturalen Interessen ankommt. Dieser integrative Ansatz wird von einer Ethik, die<br />
von <strong>der</strong> Kritik anthropozentrischer Letztbegründung ausgeht, verstellt.<br />
9. Das Nachhaltigkeitsprinzip relativiert nicht die ethische Unterscheidung zwischen<br />
personalem und naturalem Bereich. Seine For<strong>der</strong>ung nach einer umfassenden Berücksichtigung<br />
ökologischer Faktoren zielt vielmehr auf eine natur- und gesellschaftstheoretisch<br />
fundierte Analyse <strong>der</strong> kritischen Gefährdungsfaktoren zivilisatorischer<br />
Entwicklung. Durch diese Ausrichtung bleibt das Nachhaltigkeitsprinzip sowohl<br />
mit den normativen Grundlagen <strong>der</strong> Demokratie (die unbedingte Würde <strong>der</strong><br />
menschlichen Person als Angelpunkt des gesamten Rechtssystems) als auch mit den<br />
naturwissenschaftlich-nüchternen Zugangsweisen des technischen Umweltschutzes<br />
vermittelbar.<br />
4. Vernetzung als Schlüsselprinzip <strong>der</strong> <strong>Umweltethik</strong><br />
In <strong>der</strong> Ökologie geht es nicht nun um die Schonung einzelner knapp gewordener<br />
Naturressourcen, son<strong>der</strong>n grundlegen<strong>der</strong> um eine neue Denkweise: Gefor<strong>der</strong>t ist vernetztes<br />
Denken, und damit eine systematische Beachtung <strong>der</strong> vielschichtigen Beziehungszusammenhänge<br />
zwischen Mensch und Umwelt. Dies entspricht dem methodischsystemtheoretischen<br />
Verständnis von Ökologie als Beziehungswissenschaft, nämlich als<br />
Wissenschaft <strong>der</strong> Beziehungsgefüge zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt.<br />
Eine solche ökologische Betrachtungsweise for<strong>der</strong>t Denk- und Handlungsansätze, <strong>der</strong>en<br />
Grundmaxime sich als "Vernetzung" umschreiben lässt: Die Einbindung <strong>der</strong> Zivilisati-<br />
72
Vogt – Nachhaltigkeit [Zsfg. <strong>10</strong>] 73<br />
onssysteme in das sie tragende Netzwerk <strong>der</strong> Natur muss zur Leitmaxime des individuellen<br />
und gesellschaftlichen Handelns werden.<br />
Wegweisend, um das Ziel einer solchen Rückbindung zu erreichen, ist die kommunikative<br />
Vernetzung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen. Dabei<br />
muss die Ausdifferenzierung mo<strong>der</strong>ner Gesellschaft in relativ autonome Subsysteme<br />
beachtet werden (vgl. Luhmann 1990, 202-217; Luhmann 1994).<br />
Ökologische Imperative sind in die jeweilige Handlungslogik <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Teilsysteme zu „übersetzen“. D.h. beispielsweise für das ökonomische System: Es kann<br />
ökologische Knappheiten nur dann „wahrnehmen“, wenn sie in Kosten beziffert und<br />
durch entsprechende wirtschaftliche Rahmenbedingungen geschützt werden (Schramm<br />
1994, 132-147).<br />
Solche Übersetzungsleistungen zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen<br />
Subsystemen geschehen bisher nur unzureichend: Wir leben in einer „segmentierten“<br />
Gesellschaft, in <strong>der</strong> Teilbereiche optimiert werden, in <strong>der</strong> das Gesamtwohl aber zunehmend<br />
aus dem Blick geraten zu sein scheint (An<strong>der</strong>s 1987). Die Sicherung des<br />
Gesamtwohls kann jedoch in einer offenen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft<br />
nicht durch eine zentrale Steuerungsinstanz geleistet werden, son<strong>der</strong>n nur<br />
durch eine dynamische und vielschichtige Vernetzung (Vogt 1996a, 174-179).<br />
Gemäß dem Leitgedanken <strong>der</strong> Vernetzung sind ökologische Themen deutlicher als<br />
Querschnittsthemen auszugestalten und in die Handlungslogik <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
gesellschaftlichen Teilsysteme hineinzuvermitteln. „Vernetzung“ kann dabei sehr<br />
vielfältiges bedeuten. Zum Beispiel: Verknüpfung von ökonomischer Rationalität und<br />
ökologischem Wissen, von technischem Können und kulturellen Wertorientierungen,<br />
von religiösem Ethos und politischer Bildungsarbeit. Nur durch eine intensive<br />
Bündelung solcher unterschiedlicher Handlungsfel<strong>der</strong> und Kompetenzen können die<br />
Ziele nachhaltiger Entwicklung erreicht werden.<br />
Die Strategie dauerhaft-umweltgerechter Entwicklung durch eine Vernetzung unterschiedlicher<br />
Handlungsfel<strong>der</strong> zielt darauf, die Grenzen <strong>der</strong> Natur in Chancen zu wandeln,<br />
nämlich in Chancen für einen strukturellen Wandel, <strong>der</strong> sich auf Dauer auch in sozialer<br />
und ökonomischer Hinsicht als sinnvoll erweist. So eröffnen sich bisweilen durch<br />
Einschränkung im einen Bereich zugleich neue Entfaltungsmöglichkeiten in einem an<strong>der</strong>en<br />
(vgl. BUND/Misereor 1996, 153).<br />
Für das ethische Postulat einer „Gesamtvernetzung“ und Rückbindung <strong>der</strong> Zivilisationsentwicklung<br />
an die Entfaltungsbedingungen <strong>der</strong> Natur hat Wilhelm Korff – auf das<br />
lateinische rete, das Netz, zurückgreifend - den Begriff Retinität geprägt (Korff 1993,<br />
25). Der Sachverständigenrat für Umweltfragen bezeichnet ihn als Schlüsselprinzip <strong>der</strong><br />
<strong>Umweltethik</strong> (SRU 1994, 54; vgl. dazu Ausführungen oben zu den Strategiekernen von<br />
Nachhaltigkeit).<br />
Gemäß dem Retinitätsprinzip ist <strong>Umweltethik</strong> nicht als Bereichsethik zu konzipieren,<br />
son<strong>der</strong>n als ein umfassendes Integrationskonzept für die komplexen Entwicklungsprobleme<br />
neuzeitlicher Gesellschaft. Orientierungsmaßstab ist dabei nicht das Paradigma<br />
<strong>der</strong> Natur als absolut vorgegebener Wachstumsgrenze, son<strong>der</strong>n das Leitbild einer dynamischen<br />
Stabilisierung <strong>der</strong> komplexen Mensch-Umwelt-Zusammenhänge.<br />
Das erfor<strong>der</strong>t eine verstärkte Berücksichtigung systemtheoretischer Analysen über die<br />
Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> Steuerung vernetzter, also komplexer dynamischer Systeme<br />
für Politik und Ethik in mo<strong>der</strong>ner Gesellschaft. Es geht um einen grundlegenden<br />
Paradigmenwechsel, <strong>der</strong> sowohl die Natur- als auch die Sozialwissenschaften umfasst<br />
und <strong>der</strong> für die Sozialethik von hoher Relevanz ist.<br />
73
Vogt – Nachhaltigkeit [Zsfg. <strong>10</strong>] 74<br />
Warum genügt nicht <strong>der</strong> deutsche Begriff „Vernetzung“?<br />
Der lateinische Begriff „Retinität“ ist zunächst fremd und ungewohnt. Insbeson<strong>der</strong>e im<br />
Hinblick auf die pädagogische Vermittlung ist dies ein großer Nachteil. Warum soll<br />
man nicht besser auf den deutschen Begriff „Vernetzung“, <strong>der</strong> sich hoher Beliebtheit<br />
erfreut, zurückgreifen? Gerade diese Beliebtheit ist jedoch für die Ethik ein Problem:<br />
Sie beruht auf einer schillernden Vieldeutigkeit, die den damit verbundenen Gehalt des<br />
ethisch Verbindlichen nicht hinreichend zu fassen vermag.<br />
Normative Aussagekraft gewinnt <strong>der</strong> Ansatz erst dann, wenn man ihn in ein ethisches<br />
Bezugssystem einordnet, von dem her man zwischen einer zielführenden Vernetzung<br />
und einer, die eher zu erhöhter Unübersichtlichkeit führt, unterscheiden kann.<br />
„Retinität“ unterscheidet sich von dem allgemeinen Begriff „Vernetzung“ durch die<br />
Einordnung in einen ethischen Begründungszusammenhang. Sie ist ein spezifisch<br />
ethischer Begriff und bezieht sich auf die Handlungsimperative einer Rückbindung <strong>der</strong><br />
Zivilisationsentwicklung an die langfristigen Erhaltungs- und Funktionsbedingungen<br />
<strong>der</strong> sie tragenden ökologischen Systeme.<br />
Die notwendige Vernetzung umfasst also weit mehr als durch systemtheoretische Optimierungen<br />
erreicht werden kann. Denn die wesentlichen „Knotenpunkte“ des Netzes<br />
sind Menschen, die humane Ziele und Werte in die unterschiedlichen Handlungssysteme<br />
einbringen. Demgemäß sind ökologische Themen mit grundlegenden ethischen<br />
Fragen <strong>der</strong> individuellen und gesellschaftlichen Lebensführung zu verknüpfen. Nur auf<br />
<strong>der</strong> Grundlage einer Verbindung von systemtheoretischen und ethisch-personalen<br />
Reflexionen können Grundprinzipien und Entscheidungskriterien verantwortlichen<br />
Handelns angesichts komplexer Mensch-Umweltzusammenhänge gefunden werden.<br />
Genau auf eine solche Verknüpfung ist das Retinitätsprinzip angelegt.<br />
Retinität ist kein ethisches Letztprinzip. Sie ist begründungsbedürftig durch die Angabe<br />
des eigenen Standpunkts und <strong>der</strong> eigenen Perspektive. Diese sind beim Menschen<br />
gewöhnlich durch die eigenen Bedürfnisse und die jeweiligen kulturellen Deutungsmuster<br />
von Mensch, Natur und Gesellschaft geprägt. Dabei stellt sich für die <strong>Umweltethik</strong><br />
die grundlegende Frage, welcher Stellenwert <strong>der</strong> Natur im Verhältnis zu den menschlichen<br />
Zwecken zukommt. Darauf gibt es sehr unterschiedliche Antworten, die zu entsprechend<br />
unterschiedlichen Begründungsansätzen in <strong>der</strong> <strong>Umweltethik</strong> führen (dazu<br />
oben, letzte Vorlesung).<br />
Retinität als Leitprinzip für eine „ökologische Aufklärung“ <strong>der</strong> Anthropozentrik<br />
Der Sinn des Retinitätsprinzips ist es, die hier gefor<strong>der</strong>te ökologische Aufklärung <strong>der</strong><br />
Anthropozentrik genauer zu entfalten. In seiner Begründungslogik hält es am klassischen<br />
Ausgangspunkt <strong>der</strong> Kantischen Ethik fest und versteht die unverletzliche Würde<br />
des Menschen als Vorraussetzung und Ziel verantwortlichen Handelns. Es entfaltet die<br />
ökologischen Imperative nachhaltiger Entwicklung wesentlich von diesem Bezugspunkt<br />
her. Als Kriterien für den Naturumgang beachtet es jedoch auch Leidensfähigkeit,<br />
Lebenswillen und ökologische Systembedeutung.<br />
Die Zuordnung des Retinitätsprinzips zu einer ökologisch aufgeklärten Anthropozentrik<br />
ergibt sich schon aus seinem forstwirtschaftlichen Ursprung als Naturnutzungskonzept:<br />
Der Begriff des Nutzens ist hier auf die menschlichen Interessen bezogen und bringt die<br />
ökologischen Interessen durch die schlichte For<strong>der</strong>ung nach einem langfristigen<br />
Zeithorizont ein.<br />
Das Retinitätsprinzip relativiert nicht die strikte ethische Unterscheidung zwischen<br />
personalem und naturalem Bereich. Aufgrund <strong>der</strong> anthropozentrischen Rückbindung<br />
kann sich Retinität in seiner operationalen Entfaltung auf eher nüchterne Weise funktio-<br />
74
Vogt – Nachhaltigkeit [Zsfg. <strong>10</strong>] 75<br />
naler und systemtheoretischer Analysen über die komplexen Mensch-Umwelt-Zusammenhänge<br />
bedienen. Seine For<strong>der</strong>ung nach einer umfassenden Berücksichtigung<br />
ökologischer Faktoren zielt nicht auf ein mystisches Sich-Einfühlen in die Natur,<br />
son<strong>der</strong>n auf eine natur- und gesellschaftstheoretisch fundierte Analyse <strong>der</strong> kritischen<br />
Gefährdungsfaktoren. Ökologische Aufklärung ist das Ziel, nicht <strong>der</strong> Rückzug auf einen<br />
vormo<strong>der</strong>nen mystisch-religiösen Naturbegriff.<br />
Viele berechtigte Anliegen des Tierschutzes sind mit dem Retinitätsprinzip nicht<br />
hinreichend zu begründen. Sein Schwerpunkt liegt in einem an<strong>der</strong>en Bereich: Es<br />
formuliert die Anliegen des Umweltschutzes in einer konzeptionell erweiterten und<br />
zukunftsorientierten Perspektive. Dabei bleibt es bewusst sowohl mit den normativen<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Demokratie (die unbedingte Würde <strong>der</strong> menschlichen Person als<br />
Angelpunkt des gesamten Rechtssystems) als auch mit den praktischen Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
des technischen Umweltschutzes vermittelbar.<br />
Trotz <strong>der</strong> prinzipiellen Zuordnung zum anthropozentrischen Ansatz überschreitet das<br />
Retinitätsprinzip jedoch dessen traditionelle Ausformulierung: Es konzentriert sich auf<br />
die systemischen Wechselwirkungen zwischen Zivilisation und Natur und leitet<br />
Handlungskonsequenzen aus den hier auftretenden Gefährdungen ab. Retinität zielt auf<br />
ein Denken in Zusammenhängen, das sich <strong>der</strong> natur- und sozialwissenschaftlichen<br />
Analysen über komplexe Systeme für eine Abschätzung <strong>der</strong> Handlungsfolgen und damit<br />
auch für eine ethische Entscheidungstheorie bedient und möglichst ausgewogene<br />
Zuordnungen von ökologischen, sozialen und individuellen Erfor<strong>der</strong>nissen anstrebt.<br />
Im gemeinsamen Wort <strong>der</strong> Kirchen zur sozialen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland<br />
„Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (1997) wird eine Erweiterung<br />
<strong>der</strong> sozialethischen Begrifflichkeit angemahnt. Das gemeinsame Wort umschreibt die<br />
notwendige Erweiterung mit den Begriffen „Nachhaltigkeit“ und „Vernetzung“ (vgl.<br />
Textziffern 122-125). In <strong>der</strong> Erklärung „Handeln für die Zukunft <strong>der</strong> Schöpfung“ <strong>der</strong><br />
Arbeitsgruppe für ökologische Fragen <strong>der</strong> Bischofskonferenz wird dies aufgegriffen und<br />
im Sinne des Retinitätsprinzips präzisiert.<br />
Zusammenfassend kann man den Begriff Retinität als Grundfor<strong>der</strong>ung ökologischer<br />
Ethik unter folgenden Aspekten charakterisieren:<br />
- Rückbindung <strong>der</strong> menschlichen Zivilisationsentwicklung in das sie tragende<br />
Netzwerk <strong>der</strong> ökologischen Regelkreise<br />
- Vernetzung <strong>der</strong> Bemühungen um ökologisches Bewahren und technische Innovationen<br />
- Vernetzung von ökonomischen und ökologischen Stoffkreisläufe<br />
- Vernetzung sozialer und ökologischer Rhythmen (z.B. jahreszeitgemäße<br />
Nahrungsmittel)<br />
- Vernetzung ökonomischer, ökologischer und sozialer Indikatoren im Verständnis<br />
von Wohlstand<br />
- Demokratische Erneuerung <strong>der</strong> Zivilgesellschaft durch vielfältige Netzwerke<br />
gesellschaftlicher Initiativen<br />
- Vernetzung <strong>der</strong> zunehmend von Spezialistentum geprägten Einzelbereiche in<br />
Wissenschaft und Gesellschaft<br />
75




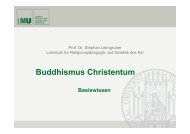

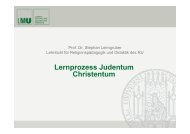




![Gliederung[1]](https://img.yumpu.com/23779936/1/184x260/gliederung1.jpg?quality=85)