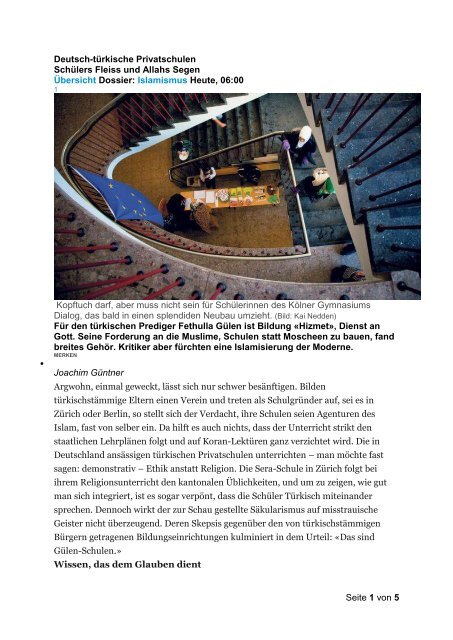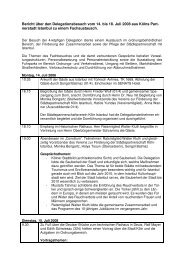Seite 1 von 5 Deutsch-türkische Privatschulen ... - Köln-Istanbul
Seite 1 von 5 Deutsch-türkische Privatschulen ... - Köln-Istanbul
Seite 1 von 5 Deutsch-türkische Privatschulen ... - Köln-Istanbul
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Deutsch</strong>-<strong>türkische</strong> <strong>Privatschulen</strong><br />
Schülers Fleiss und Allahs Segen<br />
Übersicht Dossier: Islamismus Heute, 06:00<br />
1<br />
<br />
Kopftuch darf, aber muss nicht sein für Schülerinnen des <strong>Köln</strong>er Gymnasiums<br />
Dialog, das bald in einen splendiden Neubau umzieht. (Bild: Kai Nedden)<br />
Für den <strong>türkische</strong>n Prediger Fethulla Gülen ist Bildung «Hizmet», Dienst an<br />
Gott. Seine Forderung an die Muslime, Schulen statt Moscheen zu bauen, fand<br />
breites Gehör. Kritiker aber fürchten eine Islamisierung der Moderne.<br />
MERKEN<br />
Joachim Güntner<br />
Argwohn, einmal geweckt, lässt sich nur schwer besänftigen. Bilden<br />
türkischstämmige Eltern einen Verein und treten als Schulgründer auf, sei es in<br />
Zürich oder Berlin, so stellt sich der Verdacht, ihre Schulen seien Agenturen des<br />
Islam, fast <strong>von</strong> selber ein. Da hilft es auch nichts, dass der Unterricht strikt den<br />
staatlichen Lehrplänen folgt und auf Koran-Lektüren ganz verzichtet wird. Die in<br />
<strong>Deutsch</strong>land ansässigen <strong>türkische</strong>n <strong>Privatschulen</strong> unterrichten – man möchte fast<br />
sagen: demonstrativ – Ethik anstatt Religion. Die Sera-Schule in Zürich folgt bei<br />
ihrem Religionsunterricht den kantonalen Üblichkeiten, und um zu zeigen, wie gut<br />
man sich integriert, ist es sogar verpönt, dass die Schüler Türkisch miteinander<br />
sprechen. Dennoch wirkt der zur Schau gestellte Säkularismus auf misstrauische<br />
Geister nicht überzeugend. Deren Skepsis gegenüber den <strong>von</strong> türkischstämmigen<br />
Bürgern getragenen Bildungseinrichtungen kulminiert in dem Urteil: «Das sind<br />
Gülen-Schulen.»<br />
Wissen, das dem Glauben dient<br />
<strong>Seite</strong> 1 <strong>von</strong> 5
Der islamische Prediger Fethullah Gülen vereint auf irritierende Weise<br />
Konservatismus und Modernismus. In Glaubensfragen strikt traditionalistisch,<br />
fordert er seine Anhänger doch zugleich auf, sich wissenschaftliche Fortschritte<br />
anzueignen und als Unternehmer Erfolg zu suchen. Als Geissel der Muslime erachtet<br />
er nicht das Christentum oder die «US-Imperialisten», sondern Unwissenheit und<br />
Armut. 1938 in einem Dorf bei Erzurum im Osten Anatoliens geboren, 1959 als Imam<br />
staatlich lizenziert, bereiste er in den siebziger und achtziger Jahren die Türkei und<br />
gewann schon damals eine weite Anhängerschaft – als Prediger, der sich und sein<br />
Publikum zu Tränen zu rühren verstand.<br />
Nachdem ihn die Kemalisten angeklagt hatten, eine Gefahr für die <strong>türkische</strong> Republik<br />
zu sein, emigrierte er 1999 in die USA, offiziell aus gesundheitlichen Gründen.<br />
Theologische Anleihen machte Gülen bei Said Nursi, einem 1960 verstorbenen<br />
Sufisten und Aktivisten. Gemäss Nursi ist der säkulare Staat zu mächtig, als dass die<br />
Religion die Konfrontation mit ihm suchen sollte. Auch dürfe der Gläubige vor<br />
Technologie und moderner Naturwissenschaft nicht fliehen, sondern müsse sie als<br />
Formen sehen, in denen sich Gottes Schöpfung rational offenbare. Mit anderen<br />
Worten: Wissenschaft dementiert nicht Religion, sondern bringt sie zum Leuchten.<br />
Von hier aus wird verständlich, wie Fethullah Gülen, der Prediger und Hermeneut<br />
des Theologen Said Nursi, zum Vater einer islamischen Bildungsbewegung werden<br />
konnte. Seit Mitte der achtziger Jahre lautet seine Losung: «Baut keine Moscheen<br />
mehr, baut Schulen!» Der Ruf fand breites Gehör. Gülens Anhänger, die<br />
«Fethullahcis», haben in den zurückliegenden Jahrzehnten mehr als tausend Schulen<br />
errichtet. Sie begannen damit in der Türkei, regten sich nach dem Fall des Eisernen<br />
Vorhangs auch auf dem Balkan, in den ehemaligen Staaten des Sowjetreichs und sind<br />
heute in Westeuropa, Afrika und Asien ebenfalls vertreten – in rund 140 Ländern<br />
weltweit. Lag anfangs das Schwergewicht auf der Errichtung <strong>von</strong> Gymnasien und<br />
Zentren, die auf den Aufnahmetest für die Universitäten vorbereiten, so kümmert<br />
sich die Gülen-Bewegung heute nicht bloss um die höhere Schulbildung, sondern hat<br />
auch Kindertagesstätten und Realschulen in ihrem Portfolio.<br />
Distanzierungen<br />
Aber lässt sich überhaupt <strong>von</strong> «Gülen-Schulen» sprechen? Weder die Sera-Schule in<br />
Zürich noch die BiL-Schule in Stuttgart, noch das Gymnasium Dialog in <strong>Köln</strong>, die<br />
Sema-Schulen in Mannheim oder die Einrichtungen des türkisch-deutschen<br />
Bildungsinstituts in Berlin (Tüdesb) nehmen Bezug auf Fethullah Gülen. Man kann<br />
dort problemlos Lehrer werden, ohne Fethullaci zu sein. Manche Schulleiter<br />
reagieren verärgert, konfrontiert man sie mit Gülen. Sie möchten ihre Schule, die als<br />
private zuallererst ein Werk bürgerschaftlichen Engagements ist, nicht als Anhängsel<br />
des Netzwerks eines Predigers sehen. Erst recht soll jeder Eindruck vermieden<br />
<strong>Seite</strong> 2 <strong>von</strong> 5
werden, die Schule leiste Missionsarbeit. Einen solchen Eindruck aber erzeugt die<br />
Rede <strong>von</strong> «Gülen-Schulen» unweigerlich.<br />
Doch das wäre irrig. Die Sema-Schulen etwa berufen sich auf die Pädagogik <strong>von</strong><br />
Maria Montessori, Célestin Freinet und Peter Petersen. Für die anderen gilt, dass sich<br />
zwar im Trägerverein oder unter den Lehrern einige finden, die sagen, sie seien <strong>von</strong><br />
den Ideen Fethullah Gülens inspiriert. Auch für die Schüler ist der Hocaefendi, der<br />
«verehrte Lehrer», kein Unbekannter. In einer kritischen Fernsehreportage des<br />
WDR, die unter dem Titel «Der lange Arm des Imam» auf Youtube archiviert ist,<br />
bekennen sich Mädchen und Buben aus einer Klasse des <strong>Köln</strong>er Gymnasiums Dialog<br />
geradezu enthusiastisch zu Gülen. Klar wird allerdings auch, dass sich diese<br />
Zuneigung dem Elternhaus verdankt, nicht dem Curriculum. Der Unterricht an den<br />
sogenannten Gülen-Schulen folgt, wie schon erwähnt, den staatlichen Lehrplänen.<br />
Von den Schulbehörden oder <strong>von</strong> Bildungspolitikern, die in ihren Kommunen mit<br />
deutsch-<strong>türkische</strong>n Schulgründungen betraut sind, gibt es nur Lobendes zu hören.<br />
Journalisten, die beim Verfassungsschutz nachfragten, ob die Gülen-Bewegung unter<br />
Beobachtung stehe, erhielten einen abschlägigen Bescheid. Dazu bestehe kein Anlass.<br />
Von Schülern viel Lob<br />
Rund 5200 <strong>Privatschulen</strong> gibt es in <strong>Deutsch</strong>land, gerade einmal zwei Dutzend da<strong>von</strong><br />
haben einen <strong>türkische</strong>n Hintergrund. Grundsätzlich gilt für alle privaten<br />
Lehranstalten, dass sie ihr Dasein dem Unbehagen an den staatlichen Regelschulen<br />
verdanken. In erster Linie sind sie Reaktionen auf etwas Negatives, verbunden mit<br />
dem Impetus, es besser zu machen. Sie versprechen eine «kindgerechte» Pädagogik,<br />
individuelle Förderung und oft auch kleinere Klassen. Bei den Schulen der Gülen-<br />
Bewegungen kommt noch etwas Besonderes hinzu: der Migrationshintergrund. Seit<br />
der ersten Pisa-Studie ist bekannt, dass Schulerfolg und soziale Lage in <strong>Deutsch</strong>land<br />
allzu eng verklammert sind. Ein Schüler mit <strong>türkische</strong>n Wurzeln hat es bei gleicher<br />
Leistung schwerer als ein deutscher, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Viele<br />
Migrantenkinder, die nun die BiL-Schule, das Gymnasium Dialog oder die<br />
Einrichtungen <strong>von</strong> Tüdesb besuchen, blicken auf Diskriminierungen zurück. Bald<br />
reichte ein Kopftuch, damit ein Mädchen als rückständig abgestempelt wurde, bald<br />
genügte dem Lehrer das Wissen, einen <strong>türkische</strong>n Schüler vor sich zu haben, um sich<br />
herablassend zu verhalten.<br />
Geht es dem <strong>türkische</strong>n Nachwuchs an den <strong>Privatschulen</strong> besser? Ganz ohne Zweifel,<br />
lässt man die Antworten <strong>von</strong> Schülerinnen und Schülern des Tüdesb-Gymnasiums in<br />
Berlin für einmal als allgemeines Exempel gelten. Die Lehrer werden gelobt, weil sie<br />
stets ansprechbar seien und dafür Sorge trügen, dass niemand auf der Strecke bleibe.<br />
«Sie kümmern sich», heisst es dann etwa. Der Umgang miteinander ist freundlich,<br />
und ohne dass dem Besucher völlig einsichtig wird, welche Schule des Respekts die<br />
Kinder hier durchlaufen, so sticht doch das gesittete Benehmen ins Auge. Im<br />
<strong>Seite</strong> 3 <strong>von</strong> 5
Schulhaus fehlen die andernorts üblichen Graffiti, der Betrieb in den Pausen ist<br />
lebhaft, aber ohne jede Aggression. Allein daran, dass die Schüler uniform gekleidet<br />
sind, kann es schwerlich liegen – auch wenn gern betont wird, dass Schuluniformen<br />
das Gemeinschaftsgefühl stärken und der Benachteiligung jener vorbeugen, die sich<br />
keine Markenkleidung leisten können.<br />
Die deutsch-<strong>türkische</strong>n Schulen haben alle einmal klein angefangen: als<br />
Vereinigungen <strong>von</strong> Eltern und Studenten, die Zentren für Nachhilfe errichteten. Seit<br />
zehn Jahren gibt man sich mit dieser Art <strong>von</strong> Reparaturbetrieb nicht länger zufrieden<br />
und setzt den staatlichen Schulen das eigene, private Modell entgegen. Die Nachfrage<br />
ist gross, die Schulen expandieren. In Stuttgart und <strong>Köln</strong> entstehen gerade splendide<br />
Neubauten, und in Berlin hegt man Pläne für einen riesigen Campus: Dort hat<br />
Tüdesb ein ehemaliges Kasernengelände der britischen Alliierten erworben, mehr als<br />
zwanzig Gebäude verteilen sich auf 84 000 Quadratmetern. Bereits jetzt betreibt der<br />
Verein sechs Bildungszentren, ein Gymnasium, eine Real- und eine Grundschule<br />
sowie drei Kindergärten in freier Trägerschaft. Ist der Campus bezogen, wird dort ein<br />
Bildungsgang vom Kindergarten bis zur Hochschulreife möglich sein – alles an einem<br />
Standort. Und wer weiss, vielleicht stehen irgendwann auch Universitätsgründungen<br />
an. In der Türkei hat die Gülen-Bewegung solches schon vollbracht.<br />
Finanziert werden die <strong>Privatschulen</strong> hauptsächlich aus Spenden. Früher hätten die<br />
<strong>türkische</strong>n Fremdarbeiter einen Teil ihrer deutschen Löhne in die Heimat geschickt,<br />
heisst es, heute hingegen steckten deutsch-<strong>türkische</strong> Eltern das Geld lieber in die<br />
Bildung ihrer Kinder. Gut so! Man begreift freilich auch, warum Fethullah Gülen<br />
seine Jünger anspornt, wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Je reicher der<br />
Unternehmer, desto grösser sein Potenzial als Spender für die Bewegung.<br />
Wohlmeinende und argwöhnische Beobachter der Fethullahcis sind sich uneins, wie<br />
deren Vereinigung <strong>von</strong> Leistungswille und frommer Lebensführung zu werten sei:<br />
Haben wir es mit muslimischen Calvinisten zu tun oder eher mit einem islamischen<br />
Opus Dei? Strebt Gülen eine Modernisierung des Islam an oder im Gegenteil eine<br />
Islamisierung der Moderne? Die Front der vehementen Kritiker reicht <strong>von</strong> der<br />
Soziologin Necla Kelek und dem Islamwissenschafter Ralph Ghadban bis zu<br />
Friedmann Eissler <strong>von</strong> der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen<br />
(EZW) in Berlin.<br />
Eissler räumt ein, dass Religion an den Gülen-Schulen keine Rolle spielt, und setzt<br />
hinzu: «In den engeren Kreisen der Bewegung wird jedoch ein konservatives<br />
islamisches Ideal gepflegt, das in Sachen Bildungsbegriff, Demokratieverständnis,<br />
Frauenbild und Gesellschaftsmodell und anderen Fragen eine teilweise ernüchternde<br />
Diskrepanz zu der nach aussen hin gezeigten Dialogoffenheit aufweist.» Das mag<br />
stimmen, erinnert aber vergleichsweise an Versuche, die Waldorfschulen zu<br />
erledigen, indem man sie nur mit dogmatischen Anhängern des hie und da abseitigen<br />
<strong>Seite</strong> 4 <strong>von</strong> 5
Rudolf Steiner identifiziert. Wobei zu sagen wäre: Weltanschauliche Positionen zu<br />
markieren, ist <strong>Privatschulen</strong> nach deutschem Gesetz erlaubt, wie es ja auch den<br />
Kirchen erlaubt ist, konfessionsgebundene Schulen zu unterhalten. Die Schulen der<br />
Gülen-Bewegung verzichten auf ein solches spirituelles Profil, obgleich sie das Recht<br />
dazu hätten. Dass sie sich auf die profane Bildung verlegen und Religion nicht zum<br />
Thema machen, mag aus Sorge vor islamophoben Beobachtern geschehen.<br />
Nach Ralph Ghadban lenkt die säkulare Ausrichtung dieser Schulen bloss da<strong>von</strong> ab,<br />
dass die Gülen-Bewegung im schulischen Umfeld sehr wohl Gefolgsleute sammelt. In<br />
den Nachhilfe-Zentren würden Schüler zu einem «Sobeth», einem Gesprächskreis,<br />
eingeladen, wo man bete und die Schriften Gülens behandle. Der eigentliche Ort der<br />
religiösen Bildung seien die «Lichthäuser», häusliche Kreise und fromme<br />
Wohngemeinschaften <strong>von</strong> Studenten, nach Geschlechtern getrennt. Über diese<br />
Lichthäuser und deren angebliche Indoktrination ist bisweilen Abenteuerliches zu<br />
hören, auch gibt es Aussteigerberichte <strong>von</strong> Frauen, die angeben, sie hätten sich dort<br />
völlig unterwerfen müssen. Unstrittig scheint zu sein, dass man in den Lichthäusern<br />
einer gottesfürchtigen Gemeinschaft begegnen kann, denen ein Abi («grosser<br />
Bruder») oder eine Abla («grosse Schwester») vorsteht, wo man den Koran, Gülen<br />
und Nursi studiert, mehrmals täglich betet und enthaltsam lebt. Fraglich aber ist, ob<br />
wir uns die Gülen-Bewegung als weltumspannende Organisation vorstellen müssen:<br />
mit dem Meister im amerikanischen Exil an der Spitze, darunter ein Rat mit Imamen,<br />
die jeweils für einen Kontinent zuständig sind, und darunter wieder andere Kader bis<br />
hinab zu den Abis und Ablas im Halbschatten der Lichthäuser. Gerüchte dieser Art<br />
kursieren, belegt sind sie nicht.<br />
Kein Ort für schwere Fälle<br />
Lässt man die Schulen Schulen sein, sondiert ihr Klima und ihre Leistungen und<br />
schert sich nicht darum, welches Mitglied des Trägervereins oder welcher Lehrer mit<br />
Gülen sympathisiert, so fällt die Bilanz erfreulich aus. Die Bildungserfolge der<br />
Absolventen könnten über kurz oder lang das alte Klischee vom «<strong>türkische</strong>n<br />
Problemschüler» widerlegen. Andererseits gilt: Die wirklich schweren Fälle landen<br />
ohnehin nicht an den Gülen-Schulen. Die Kinder dort kommen aus<br />
bildungsbeflissenen Milieus, die willens und in der Lage sind, jeden Monat einige<br />
hundert Euro Schulgeld zu zahlen. Um die Schulversager, die renitent und lustlos<br />
sind, muss sich das öffentliche System kümmern. Noch stecken die deutsch<strong>türkische</strong>n<br />
Schulen, obgleich sie für alle offen sind, in einer ethnischen Nische. Über<br />
neunzig Prozent ihrer Schüler haben einen Migrationshintergrund. Doch das soll sich<br />
ändern.<br />
<strong>Seite</strong> 5 <strong>von</strong> 5