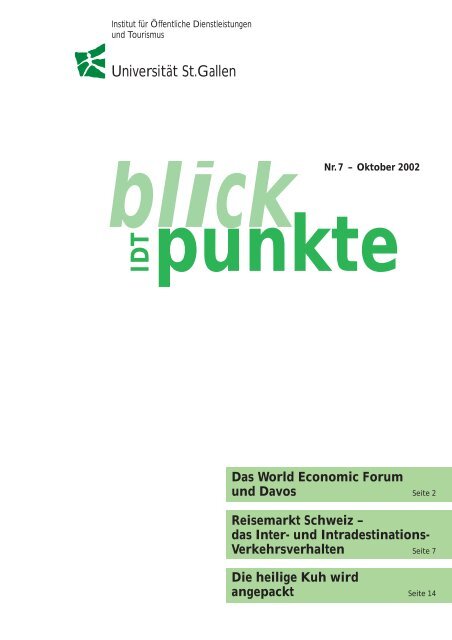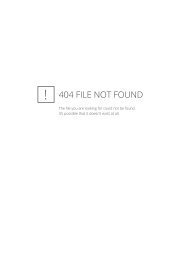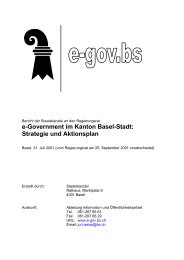Ausgabe Nr. 7: Oktober 2002 - am Institut für Systemisches ...
Ausgabe Nr. 7: Oktober 2002 - am Institut für Systemisches ...
Ausgabe Nr. 7: Oktober 2002 - am Institut für Systemisches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Institut</strong> für Öffentliche Dienstleistungen<br />
und Tourismus<br />
Universität St.Gallen<br />
blick<br />
<strong>Nr</strong>.7<br />
IDT<br />
– <strong>Oktober</strong> <strong>2002</strong><br />
punkte<br />
Das World Economic Forum<br />
und Davos Seite 2<br />
Reisemarkt Schweiz –<br />
das Inter- und Intradestinations-<br />
Verkehrsverhalten Seite 7<br />
Die heilige Kuh wird<br />
angepackt Seite 14
IDT-Blickpunkte Inhaltsverzeichnis<br />
Editorial 1<br />
Das World Economic Forum und Davos – Ein Verlustgeschäft oder ein wichtiger<br />
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region? 2<br />
Vizekanzlerin an der HSG 4<br />
Angebot & Nachfrage nach Golfplätzen im Schweizer Alpenraum 5<br />
«Liegen wir noch auf Kurs, oder driften wir ab?» –<br />
Monitoring und Management nachhaltiger Tourismusentwicklung 6<br />
Reisemarkt Schweiz – das Inter- und Intradestinations-Verkehrsverhalten 7<br />
Bewegung im öffentlichen Rechnungswesen der Schweiz! 9<br />
Welche Erwartungen haben Mitarbeitende an die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung? 10<br />
Fallstudie Weisse Arena – ein Tourismus-Case für 1000 Studierende 11<br />
Das IDT im Pott 12<br />
Die heilige Kuh wird angepackt – Auslagerung auch in der hoheitlichen Verwaltung? 14<br />
Worte statt Konzepte – Nichts geht mehr ohne Regional Governance 16<br />
Eigentümerstrategien für Staatsbetriebe 17<br />
Moral Hazard bei Leistungsvereinbarungen im Verkehrsbereich –<br />
Explodieren die Transaktionskosten? 18<br />
Steigende Bekanntheit des CE eGov 19<br />
Jahrbücher der Schweizerischen Tourismus- und Verkehrswirtschaft 2001/<strong>2002</strong> 20<br />
Kurzmitteilungen 21<br />
Herausgeber<br />
<strong>Institut</strong> für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus (IDT-HSG)<br />
Varnbüelstrasse 19, CH-9000 St.Gallen<br />
Fon +41 71-224 25 25, Fax +41 71-224 25 36, http://www.idt.unisg.ch<br />
Redaktion<br />
Simone Vonaesch simone.vonaesch@unisg.ch
Editorial IDT Blickpunkte<br />
«Mer wönd’s wüssä!» Die Nachfrage nach Informationen<br />
gleicht bisweilen dem Appetit nach Süssem: Erst kann<br />
man nicht genug kriegen, dann stellt man fest, dass man<br />
nicht so viel verdauen kann. Dennoch, allein der Appetit<br />
ist ein gutes Zeichen, und in Massen ist Transparenz über<br />
Ergebnisse der eigenen Arbeit ein Segen für das Management<br />
und auch für die Politik. Die vorliegende <strong>Ausgabe</strong><br />
der IDT Blickpunkte dreht sich um eben diese Transparenz,<br />
die viele unserer Studien und Forschungsprojekte<br />
anstreben.<br />
«Mer wönd’s wüssä!» Das World Economic Forum in Davos<br />
wurde von uns daraufhin untersucht, ob es einen Beitrag<br />
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leistet (siehe<br />
Seite 2). Grundsätzlicher stellen wir die Frage, wie ein Monitoring<br />
und Management nachhaltiger Tourismusentwicklung<br />
aussehen müsste (S. 6). Schliesslich untersuchen<br />
wir mit Fallstudien (siehe die Weisse Arena, S. 11),<br />
einer Längsschnittstudie zum Reisemarkt Schweiz (S. 7)<br />
oder Strukturvergleichen die Entwicklungen in der Praxis<br />
des Tourismus.<br />
«Mer wönd’s wüssä!», sagen aber auch die Politikerinnen<br />
und Politiker, die für die Steuerung unseres Landes, der<br />
Kantone und Gemeinden verantwortlich sind. Grundlage<br />
vieler Steuerungsentscheide ist die finanzielle Situation,<br />
abgebildet im öffentlichen Rechnungswesen. Und eben<br />
hier bewegt sich die Schweiz momentan rasant, wie der<br />
Beitrag auf Seite 9 deutlich macht. Wissen sollten die Verwaltungsmanager/innen<br />
aber auch, welche Erwartungen<br />
ihre Mitarbeitenden an die Reform haben. Das haben wir<br />
untersucht und legen eine kurze Synthese vor (S. 10).<br />
Gewusst haben wir es schon lange, nun liegt ein Konzept<br />
vor: Auslagerungen sind auch im hoheitlichen Bereich der<br />
staatlichen Tätigkeit möglich. Nur, unter welchen Voraussetzungen?<br />
Diese heilige Kuh packt eine Dissertation aus<br />
unserem Haus an, und sie zeigt ein differenziertes Bild<br />
(S. 14). Und auch dies haben wir gewusst: Susanne Riess-<br />
Passer ist nicht gleich Jörg Haider, nun hat sie dies deutlich<br />
gemacht. Ein Bericht zu ihrem Auftritt an der Uni<br />
St.Gallen auf Seite 4.<br />
Viel Spass beim Lesen der neuen <strong>Ausgabe</strong> der IDT Blickpunkte!<br />
Ihr<br />
Kuno Schedler<br />
Für die Direktion des<br />
IDT-HSG<br />
Prof. Dr. Kuno Schedler<br />
Simone Vonaesch<br />
1
Das World Economic Forum und Davos – Ein Verlustgeschäft oder ein<br />
wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region?<br />
Thomas Bieger, Roland Scherer, Lukas Bischof<br />
Im Auftrag von Davos Tourismus hat das <strong>Institut</strong> für Öffentliche Dienstleistungen<br />
und Tourismus der Universität St.Gallen eine Studie zu den wirtschaftlichen Effekten<br />
des World Economic Forum in Davos erstellt. Auch der Kanton Graubünden, die<br />
Landschaft Davos, das seco und das World Economic Forum selbst waren finanziell<br />
beteiligt.<br />
In der Studie werden die direkten und indirekten wirtschaftlichen<br />
Effekte des World Economic Forum auf die<br />
Gemeinde Davos, den Kanton Graubünden und die ges<strong>am</strong>te<br />
Schweiz erfasst und, soweit wie möglich, auch<br />
quantifiziert. Dabei wurden sowohl die direkten <strong>Ausgabe</strong>n<br />
berücksichtigt, die durch das World Economic Forum<br />
entstehen (z.B. durch die Teilnehmer, Organisatoren,<br />
Sicherheitsleute und die Firmenpartner), als auch<br />
sogenannte intangible Effekte wie z.B. die Werbewerte<br />
der Presseberichte über das Annual Meeting. Neben der<br />
Frage, ob das World Economic Forum insges<strong>am</strong>t eher ein<br />
Gewinn oder ein Verlustgeschäft für den Wirtschaftsraum<br />
Davos und die Schweiz ist, wurde auch untersucht, welche<br />
Gruppen von dem Event profitieren und wer durch<br />
das World Economic Forum beeinträchtigt wird. Im Mittelpunkt<br />
der ursprünglichen Analyse standen die Effekte,<br />
die aus dem Annual Meeting 2001 resultierten. Durch die<br />
Durchführung des Annual Meeting <strong>2002</strong> in New York bot<br />
sich die Möglichkeit, genauere Aussagen über die verschiedenen<br />
wirtschaftlichen Effekte des Events zu formulieren,<br />
da erstmals auch die «Mindereinnahmen», die<br />
durch die Verlegung entstanden sind, beobachtet werden<br />
konnten.<br />
Rest des Kantons Graubünden und den Rest der Schweiz.<br />
Die Resultate lassen für die untersuchten Perimeter folgende<br />
Schlussfolgerungen zu:<br />
Davos Graubünden Schweiz<br />
Primäre Zahlungsinzidenz 7.2 Mio. CHF 7.9 Mio. CHF 12.9 Mio. CHF<br />
Sekundäre Zahlungsinzidenz 8.5 Mio. CHF 8.8 Mio. CHF 13.4 Mio. CHF<br />
Total direkte Umsätze 15.7 Mio. CHF 16.7 Mio. CHF 26.3 Mio. CHF<br />
Indirekte Umsätze 7.0 Mio. CHF 7.5 Mio. CHF 15.5 Mio. CHF<br />
Ges<strong>am</strong>tumsätze 22.7 Mio. CHF 24.2 Mio. CHF 41.8 Mio. CHF<br />
Auf der Basis einer Inzidenzanalyse und unter Einbeziehung<br />
von Multiplikatoreffekten hat das Annual Meeting<br />
2001 des World Economic Forum in Davos die in der<br />
obenstehenden Abbildung dargestellten wirtschaftlichen<br />
Umsätze generiert. Diese Umsätze wurden aufgrund einer<br />
nachfrageseitigen Analyse ermittelt (d.h. über die Ermittlung<br />
der Nachfrage des World Economic Forums<br />
selbst sowie eine Modellrechnung der <strong>Ausgabe</strong>n der verschiedenen<br />
Teilnehmergruppen) und durch eine angebotsseitige<br />
Analyse (d.h. über eine empirische Erfassung<br />
der Einnahmen der Unternehmen) überprüft.<br />
Die wirtschaftlichen Effekte, die aus dem Annual Meeting<br />
resultieren, bewirken in den untersuchten Räumen unterschiedliche<br />
Effekte. Differenziert wurde hier zwischen<br />
den Effekten, die direkt auf Davos wirken, sowie auf den<br />
Davos hatte im Jahr 2001 positive wirtschaftliche Effekte<br />
im Umfang von ca. 16 Millionen CHF zusätzlichem Umsatz,<br />
die direkt aus dem Annual Meeting resultieren.<br />
Werden die Multiplikatoreffekte eingerechnet, liegen die<br />
ges<strong>am</strong>ten induzierten Zusatzumsätze in einer Grössenordnung<br />
zwischen 22 und 23 Millionen CHF. Am stärksten<br />
profitieren in Davos die Hotellerie und Gastronomie<br />
von dem Anlass. Hier wurden im Jahr 2001 durch das<br />
Annual Meeting zusätzliche Umsätze in einer Grössenordnung<br />
von 10 bis 11 Millionen CHF getätigt. Die starke<br />
Bedeutung des Annual Meetings für den Hotelsektor<br />
hat sich gerade auch im Winter <strong>2002</strong> gezeigt, in dem das<br />
Annual Meeting nicht in Davos stattfand. Es konnte zwar<br />
ein Teil der fehlenden Hotellogiernächte substituiert werden,<br />
doch bleibt – trotz der massiven einmaligen finanziellen<br />
Marketingunterstützung durch die Landschaft Davos<br />
und den Kanton Graubünden – in den Monaten<br />
Januar und Februar <strong>2002</strong> ein Rückgang der Logiernächte<br />
um 9% im Vergleich zum Vorjahr. Allein für den Hotelund<br />
Gastronomiesektor ergaben sich Umsatzeinbussen<br />
von mindestens 7 Millionen CHF. Dies hängt insbesondere<br />
mit dem Wegfall der für die Hotels lukrativen «Outside<br />
Events» des Annual Meeting zus<strong>am</strong>men. So mussten<br />
allein im Bereich Food & Beverage Umsatzeinbussen von<br />
mindestens 3 Millionen CHF verzeichnet werden.<br />
Betrachtet man die Verteilung der in der Vergangenheit<br />
durch das Annual Meeting entstandenen Umsätze auf die<br />
verschiedenen Betriebe, so zeigt sich eine eindeutige<br />
Konzentration der Umsätze auf einige Betriebe. Etwa 15<br />
bis 20 Davoser Betriebe, überwiegend aus dem gehobenen<br />
Hotelbereich, sowie einzelne Bau- und Transportbetriebe<br />
profitieren in erheblichem Umfang vom World<br />
Economic Forum. Teilweise können diese Unternehmen<br />
im Zus<strong>am</strong>menhang mit dem Annual Meeting zwischen 15<br />
2
und 20% ihres Jahresumsatzes generieren. Es ist davon<br />
auszugehen, dass diese Unternehmen ohne das Annual<br />
Meeting in erhebliche bis existenzbedrohende wirtschaftliche<br />
Schwierigkeiten geraten würden. Dies könnte den<br />
Cluster Tourismus Davos empfindlich treffen, da es sich<br />
bei der betroffenen Klasse von qualitativ hochstehenden<br />
Hotels um sehr dyn<strong>am</strong>ische Unternehmen handelt, die immer<br />
wieder neue Gäste nach Davos bringen und für den<br />
Kongressstandort Davos unerlässlich sind. Die durch das<br />
Annual Meeting induzierten Umsätze erlangen d<strong>am</strong>it strategische<br />
Bedeutung, da sie dazu beitragen, dyn<strong>am</strong>ische<br />
Unternehmen <strong>am</strong> Ort langfristig zu erhalten.<br />
Für den Kanton Graubünden stellt sich die regionalwirtschaftliche<br />
Bilanz des World Economic Forum etwas anders<br />
dar. Zusätzlich zu den in Davos induzierten Umsätzen<br />
fallen in den restlichen Gebieten des Kantons nur geringfügig<br />
weitere Umsätze in einer Grössenordnung von 1 bis<br />
2 Millionen CHF an. Insges<strong>am</strong>t kann für ganz Graubünden<br />
mit zusätzlichen Umsätzen in Höhe von rund 24 bis<br />
25 Millionen CHF (Effekte für Davos inklusive) gerechnet<br />
werden, die direkt und indirekt durch das World Economic<br />
Forum entstehen. Aufgrund der wichtigen Rolle, die Davos<br />
für den ges<strong>am</strong>ten Tourismussektor in Graubünden spielt,<br />
sind diese direkten wirtschaftlichen Effekte des Annual<br />
Meeting auch für den ges<strong>am</strong>ten Kanton Graubünden von<br />
grosser Bedeutung. Gleichzeitig zeigte sich, dass durch<br />
den Event keine wesentlichen Verdrängungseffekte in<br />
Kauf genommen werden müssen, etwa in Form von Minderumsätzen<br />
in anderen Destinationen aufgrund der massiven<br />
Sicherheitsmassnahmen. Für die ges<strong>am</strong>te Schweiz<br />
liegen die Umsätze, die durch das Annual Meeting direkt<br />
und indirekt generiert werden, in einer Grössenordnung<br />
von rund 42 Millionen CHF. Ausserhalb von Davos betreffen<br />
diese Umsätze vor allem die Verkehrs-, speziell die<br />
Luftverkehrsbranche. Grössere Umsätze gibt es auch im<br />
Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen sowie<br />
bei den Vorleistungskäufen der Hotellerie und Gastronomie.<br />
Ebenfalls grössere Umsätze werden bei privaten<br />
Haushalten getätigt, wobei es sich hier vor allem um Personalkosten<br />
für temporär während des Annual Meeting in<br />
Davos beschäftigte Personen handelt. Räumlich gesehen<br />
fallen die Umsätze ausserhalb von Davos vor allem im<br />
Kanton Zürich (insbesondere für Luftverkehr) sowie im<br />
Kanton Genf (Sitz des World Economic Forum) an.<br />
Den zusätzlichen Umsätzen, die insges<strong>am</strong>t durch das Annual<br />
Meeting des World Economic Forums in Davos,<br />
Graubünden und in der Schweiz getätigt werden, standen<br />
im Jahr 2001 Kosten von rund 11 Millionen CHF gegenüber,<br />
die vor allem von der öffentlichen Hand getragen<br />
wurden. Hierzu gehören die Kosten für die Sicherheitsmassnahmen,<br />
die im Jahr 2001 vor allem in Zürich entstandenen<br />
Schäden durch gewalttätige Demonstrationen<br />
sowie die aufgrund der Sicherheitsmassnahmen entstandenen<br />
Umsatzeinbussen bei einzelnen Betrieben in Davos<br />
und in anderen Bündner Gemeinden. Konkret bedeutet<br />
dies, dass hier erhebliche positive finanzielle Effekte bei<br />
einzelnen Privatunternehmen entstehen, die Kosten für<br />
diesen Anlass grösstenteils aber von der öffentlichen Hand<br />
getragen werden.<br />
Neben den tangiblen Effekten sind die intagiblen Effekte<br />
des Annual Meeting für Davos von erheblicher Bedeutung.<br />
Dies gilt insbesondere für die Struktureffekte des World<br />
Economic Forum für Davos: Ohne dessen Präsenz wären<br />
die erheblichen Investitionen in die Kongress- und Hotelinfrastruktur<br />
kaum getätigt worden. Weitere umfangreiche<br />
Investitionen sind in den kommenden Jahren geplant. Das<br />
World Economic Forum wirkt d<strong>am</strong>it als entscheidender<br />
Motor für ein qualitativ höchststehendes Hotelangebot in<br />
Davos und leistet indirekt einen erheblichen Beitrag auch<br />
für andere Branchen (insbesondere für das Baugewerbe<br />
aufgrund der umfangreichen Investitionen) sowie für den<br />
Arbeitsmarkt. Auch die Imageeffekte, die aus dem Anlass<br />
resultieren, sind erheblich und wirken, wie eine Telefonumfrage<br />
in den wichtigsten touristischen Märkten von Davos<br />
gezeigt hat, überwiegend positiv. Eine wichtige Rolle<br />
für die Imageeffekte spielen dabei die Medienberichte: Allein<br />
die Presseberichte im deutschsprachigen Raum entsprechen<br />
einem Werbeäquivalent von mind. 1. Millionen<br />
CHF. Insges<strong>am</strong>t kann davon ausgegangen werden, dass<br />
das World Economic Forum vor allem in der relevanten<br />
Zielgruppe der Kongressreisenden und der St<strong>am</strong>mgäste<br />
eine wesentliche Komponente des Images von Davos ist.<br />
Vor allem für den Kongresstourismus, der für die Auslastung<br />
der Nebensaison und im Hinblick auf die Wertschöpfung<br />
wesentlich ist, hat das World Economic Forum<br />
eine grosse Bedeutung. Von diesen positiven Imageeffekten<br />
profitiert nicht nur Davos allein, sondern aufgrund der<br />
wichtigen Funktion von Davos auch der ges<strong>am</strong>te Bündner<br />
Tourismus. Um die positiven Imageeffekte, die unzweifelhaft<br />
aus dem Anlass resultieren, entsprechend auch für die<br />
konkrete Positionierung von Davos in den entsprechenden<br />
Märkten zu nutzen, ist jedoch eine stärkere Integration des<br />
Anlasses in die Marketingstrategie von Davos Tourismus<br />
notwendig. Hier bestehen noch deutliche Defizite in der<br />
Ausnutzung der unzweifelhaft vorhandenen Potenziale.<br />
Zus<strong>am</strong>menfassend kann festgehalten werden, dass das Annual<br />
Meeting des World Economic Forum für Davos und<br />
auch für Graubünden und die ges<strong>am</strong>te Schweiz starke positive<br />
wirtschaftliche Effekte besitzt. Diese beziehen sich<br />
nicht allein auf die direkten monetären Wirkungen des Anlasses,<br />
sondern haben eine grosse strategische Bedeutung.<br />
Gleichwohl darf nicht verschwiegen werden, dass die<br />
Durchführung dieses Anlasses mit erheblichen finanziellen<br />
Aufwendungen der öffentlichen Hand verbunden ist. Aufgabe<br />
der Politik ist es hier, die notwendigen «Belastungsgrenzen»<br />
für derartige Veranstaltungen festzulegen.<br />
Thomas Bieger, Prof. Dr. Pol.<br />
Geschäftsführender Direktor<br />
thomas.bieger@unisg.ch<br />
Roland Scherer, Dipl.-Verw.-Wiss.<br />
Leiter des Kompetenzzentrums Regionalwirtschaft<br />
roland.scherer@unisg.ch<br />
Lukas Bischof, lic. oec. HSG<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
lukas.bischof@unisg.ch<br />
3
Vizekanzlerin an der HSG<br />
John Philipp Siegel, Mathias E. Brun<br />
Vortrag zu Verwaltungsreformen auf Einladung des IDT<br />
Am 20. Juni <strong>2002</strong> freuten sich die Direktoren und Mitarbeitenden<br />
des IDT, die Vizekanzlerin und Bundesministerin<br />
für Öffentliche Leistung und Sport der Republik<br />
Österreich, Frau Dr. Susanne Riess-Passer, an der Universität<br />
St.Gallen begrüssen zu dürfen. Nach einem kleinen<br />
Empfang des IDT im Kirchhoferhaus, an dem auch der<br />
österreichische Botschafter sowie der IDT-Gastprofessor<br />
Dr. Viktor Mayer-Schönberger von der Harvard-Universität<br />
teilnahmen, stand der Vortrag vor den Studierenden<br />
der HSG im Vordergrund des Besuches.<br />
Frau Dr. Riess-Passer machte in überraschend lockerer<br />
und zweifellos fachkundiger Tiefe die Reformen von<br />
Staat und Verwaltung in Österreich zum Gegenstand ihrer<br />
Rede. Dabei ging sie nicht nur auf Reformerfordernisse,<br />
Massnahmen und Erfahrungen ein, sondern berichtete<br />
auch über die Widerstände gegen Reformen und<br />
Absurditäten des Verwaltungsalltags in der Nachbarrepublik.<br />
Sie verdeutlichte die Grundzüge, Erfolge und Misserfolge<br />
der schwarz-blauen Verwaltungspolitikerin der<br />
ablaufenden Legislaturperiode.<br />
Im Mittelpunkt der anschliessenden Diskussion mit den<br />
Studierenden der HSG standen dann auch innenpoliti-<br />
sche Fragen, zu denen Riess-Passer, d<strong>am</strong>als noch Vorsitzende<br />
der Freiheitlichen Partei, Stellung nahm.<br />
Im Anschluss an den mehr als zweistündigen Vortrag und<br />
die Diskussion traf sich der Gast mit den österreichischen<br />
Studierenden der HSG, um mit ihnen in vertrauter Atmosphäre<br />
aus dem politischen «Nähkästchen» zu plaudern.<br />
Der Besuch verlief durchwegs in einer freundlichen Atmosphäre<br />
und wurde allgemein positiv bewertet. Das<br />
IDT verfolgt mit Einladungen an reformfreudige Politiker<br />
und Politikerinnen das Ziel, den Studierenden der<br />
HSG Informationen und Erfahrungen «aus erster Hand»<br />
zu ermöglichen, auch wenn und gerade weil diese zahlreichen<br />
Konflikten ausgesetzt sind.<br />
John Ph. Siegel, Dipl.-Verw.-Wiss.<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
john-philipp.siegel@unisg.ch<br />
Mathias E. Brun, lic.rer.publ.HSG<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
mathias.brun@unisg.ch<br />
Foto: (von l.n.r.) P. Schönenberger, Land<strong>am</strong>mann SG; F. Lüdi, Grossratspräsident SG; S. Riess-Passer, Vizekanzlerin<br />
AT; K. Schedler, Direktor IDT; T. Bieger, Direktor IDT; Quelle: IDT<br />
4
Angebot & Nachfrage nach Golfplätzen im Schweizer Alpenraum<br />
Stefan Leuenberger<br />
Mit Wandernden alleine ist kaum Geld zu verdienen. Um die touristische Infrastruktur<br />
im Alpenraum zumindest teilweise auch im Sommer auszulasten und d<strong>am</strong>it auch<br />
zusätzliche Ganzjahresarbeitsplätze zu schaffen, setzen alpine Destinationen vermehrt<br />
auf wertschöpfungsstarke Nischen wie Extremsportangebote oder Golfplätze.<br />
Golf liegt im Trend und entwickelt sich, trotz weiterhin relativ hohem Preis, zunehmend<br />
zu einem Volkssport. Im Zus<strong>am</strong>menhang mit einer Beurteilung der Wirtschaftlichkeit<br />
von projektierten Golfplätzen wurde von Studierenden im 8. Semester<br />
im Rahmen einer Semesterarbeit eine vertiefte Analyse des Angebots und der Nachfrage<br />
nach Golfplätzen im Schweizer Alpenraum durchgeführt. 1<br />
Will man die Entwicklung des Golfsports in der Schweiz<br />
und d<strong>am</strong>it der entsprechenden Nachfrage antizipieren,<br />
bietet sich z.B. eine Analogie zur Entwicklungskurve des<br />
Trendsports der 70er- und 80er- Jahre – Tennis – an. Hier<br />
zeigte sich bei den in einem Club eingeschriebenen Mitgliedern<br />
in den Siebzigerjahren zuerst ein steiler Anstieg<br />
ausgehend von ca. 50'000 Mitgliedern, der dann Mitte der<br />
Achtzigerjahre bei etwas mehr als 200’000 Mitgliedern<br />
den Sättigungsbereich erreichte. Seit etwa 1994 nimmt<br />
die Zahl der eingeschriebenen Tennisspieler kontinuierlich<br />
ab. 2<br />
Ein wichtiger Faktor bei einer Prognose der Nachfrageentwicklung<br />
im Golfsport stellt die demographische Entwicklung<br />
der Schweizer Bevölkerung dar. Bis ins Jahr<br />
2020 wird der Anteil der über 50-Jährigen an der Ges<strong>am</strong>tbevölkerung<br />
um einen Drittel auf 40 % steigen. 3<br />
Dies fällt besonders ins Gewicht, da trotz wachsender<br />
Zahl junger Golfspieler und deren intensiver Förderung<br />
durch die meisten Clubs die über 50-Jährigen das Hauptsegment<br />
der aktiven Golfspieler darstellen. Diese Tatsache<br />
mag einerseits d<strong>am</strong>it zus<strong>am</strong>menhängen, dass der<br />
Einkaufspreis in einen Golfclub im Durchschnitt immer<br />
noch 10‘000 CHF und mehr beträgt und auch die Jahresmitgliedschaft<br />
in den seltensten Fällen unter 1000 CHF zu<br />
liegen kommt. 4<br />
Andererseits ist Golf eine der wenigen<br />
Sportarten, die bis ins hohe Alter betrieben werden können.<br />
Zu beachten ist dabei auch, dass das relativ hohe<br />
Durchschnittsalter und die hohen getätigten Kosten bei<br />
einem Clubeintritt (zu einem guten Teil «sunk costs», z.B.<br />
in Form von Baukostenanteilen, die beim Austritt verloren<br />
wären) zu einer stabilen Mitgliederschaft führen.<br />
Hierzulande beträgt der Anteil eingeschriebener Golfclub-Mitglieder<br />
gerade mal 0.55 % der Ges<strong>am</strong>tbevölkerung.<br />
Ein Anteil der in vergleichbaren europäischen Ländern<br />
nur noch von Deutschland und Spanien mit ca.<br />
0.49 % unterschritten wird und z.B. in Österreich als<br />
nächstfolgendem Land in der Rangliste bereits 0.89 % beträgt.<br />
5<br />
Zur Betrachtung des Angebots und der jeweiligen Mitgliederkapazität<br />
von Golfplätzen in alpinen Tourismusdestinationen<br />
der Schweiz sei auf nachfolgende Grafik 6<br />
verwiesen (die drei farblich hervorgehobenen Projekte<br />
befinden sich noch in der Planungsphase):<br />
Anzahl Mitglieder<br />
1'800<br />
1'600<br />
1'400<br />
1'200<br />
1'000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Crans sur Sierre<br />
S<strong>am</strong>edan<br />
Domat/Ems<br />
Brigels<br />
Verbier<br />
Lenzerheide<br />
Interlaken<br />
Riederalp<br />
Davos<br />
Ybrig<br />
Gstaad<br />
Schluein<br />
Alvaneu Bad<br />
Engelberg<br />
Obersaxen<br />
Arosa<br />
Gotthard/Realp<br />
Vulpera<br />
Sedrun<br />
Flühli-Sörenberg<br />
Source du Rhône<br />
Stefan Leuenberger<br />
Studentischer Mitarbeiter<br />
stef.leuenberger@student.unisg.ch<br />
1<br />
Aenishänslin E., Federizzi S., Gruber M., Hager K., Hürlimann F., Leuenberger S., Meier M., Rhyner M.,<br />
Spring K. (<strong>2002</strong>): Wirtschaftlichkeitsstudie neu projektierter Golfplätze in der Surselva. Seminararbeit,<br />
IDT-HSG: St.Gallen.<br />
2<br />
Swisstennis: www.swisstennis.com/swisstennis [30.;05.<strong>2002</strong>]; Association Suisse de Golf: www.asg.ch/target<br />
[25.05.<strong>2002</strong>]<br />
3<br />
Bundes<strong>am</strong>t für Statistik: www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber01/dwandel.pdf [08.06.<strong>2002</strong>]<br />
4<br />
o.V. (<strong>2002</strong>): Golfplatzführer Schweiz <strong>2002</strong>. Medien Verlag Ursula Meier (Hrsg.): Volketswil.<br />
5<br />
Golf Suisse [<strong>2002</strong>]<br />
6<br />
Schäfer P. (<strong>2002</strong>): Golfguide <strong>2002</strong>. Bilanz, Wirtschafts-Medien AG (Hrsg.): Zürich.<br />
5
«Liegen wir noch auf Kurs, oder driften wir ab?» –<br />
Monitoring und Management nachhaltiger Tourismusentwicklung<br />
Klaus-Dieter Schnell<br />
Nachhaltige Tourismusentwicklung ist ein Managementprozess, keine neue Art von<br />
Tourismus. Für die Alpenregionen bedeutet das, dass sie Wirtschaft, Umwelt und Soziales<br />
so in Einklang bringen müssen, dass Landschaft und Umwelt nicht zerstört<br />
werden und keine Entwicklung auf Kosten kommender Generationen stattfindet.<br />
Das IDT-HSG entwickelt im Rahmen des NFP48 Instrumente, mit denen Regionen<br />
ihre Entwicklung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit laufend verfolgen<br />
und aktiv gestalten können.<br />
Das Nationale Forschungsprogr<strong>am</strong>m NFP48 bündelt seit<br />
diesem Frühjahr aktuelle Forschungen zum Thema<br />
«Landschaften und Lebensräume der Alpen». Zum Forschungsschwerpunkt<br />
«Raumnutzung und Wertschöpfung»<br />
steuert das IDT-HSG gemeins<strong>am</strong> mit Partnern das zentrale<br />
Tourismusprojekt bei. Das Projekt «Monitoring und<br />
Management nachhaltiger Tourismusentwicklung in den<br />
Regionen der Alpen» ist gleichzeitig eines der grössten<br />
Projekte im NFP48.<br />
Das Projekt verzahnt das «Management» eng mit dem<br />
«Monitoring» nachhaltiger Tourismusentwicklung. Wissenschaftlicher<br />
Partner – und verantwortlich für den Teil<br />
Monitoring – ist das Forschungs- und Beratungsunternehmen<br />
Rütter+Partner aus Rüschlikon. Die Praxispartner<br />
sind die Regionen Einsiedeln, Vi<strong>am</strong>ala und Trachselwald<br />
sowie die Tourismusorganisationen von Engelberg<br />
und Zermatt.<br />
Unsere Ausgangsfrage ist, was die Regionen im Alpenraum<br />
aktiv dafür tun können, ihren Status als selbstständig<br />
handlungsfähige Natur-, Lebens- und Wirtschaftsräume<br />
zu erhalten. Diese Eigenschaft wird als notwendige<br />
Voraussetzung dafür betrachtet, dass Landschaft und Kultur<br />
bewahrt und selbstständig weiterentwickelt werden<br />
können. Besonderes Augenmerk liegt daher auf der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung der Regionen und der Rolle,<br />
die der Tourismus darin spielt.<br />
Das Ges<strong>am</strong>tprojekt besteht aus vier Arbeitsmodulen: In<br />
Modul 1 werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet.<br />
In Modul 2 werden Entwicklungen sowie Massnahmen<br />
und deren Folgen auf der Basis der theoretischen<br />
Grundlagen in fünf regionalen Fallstudien analysiert. Die<br />
empirischen Ergebnisse werden in Modul 3 vergleichend<br />
analysiert und entsprechend angepasste regionale Indikatorensätze<br />
sowie ein Rahmen für Monitoring- und Managementkonzepte<br />
entwickelt. Darauf aufbauend wird in<br />
Modul 4 ein praxisorientiertes Handlungsmodell für das<br />
Monitoring und das Management einer nachhaltigen<br />
Tourismusentwicklung erstellt.<br />
Die Ergebnisse werden mit steter Regelmässigkeit auf unserer<br />
Homepage www.idt.unisg.ch abrufbar sein. Darunter<br />
werden auch Arbeitspapiere sein, etwa zum Vergleich<br />
verschiedener aktueller Indikatorensysteme für nachhaltige<br />
Entwicklung (Okt. 02) oder zur Längsschnittanalyse<br />
der touristischen Entwicklung in den letzten 30 Jahren<br />
(Jan. 03).<br />
Klaus-Dieter Schnell, M.A./Raumplaner NDS/ETH<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
klaus-dieter.schnell@unisg.ch<br />
Aktuelle Website des Nationalen Forschungsprogr<strong>am</strong>ms<br />
NFP48 Landschaften und Lebensräume der Alpen:<br />
www.nfp48.ch<br />
Informationen zum Progr<strong>am</strong>m, zu den Projekten und weitere Links zur Alpenforschung.<br />
6
Reisemarkt Schweiz – das Inter- und Intradestinations-<br />
Verkehrsverhalten<br />
Thomas Bieger, Christian Laesser und Vera Haag<br />
Der Freizeitverkehr generiert in der Schweiz mehr als 50 % aller Verkehrsbewegungen<br />
und ist somit ein wichtiger Treiber zur Erklärung des Verkehrs insges<strong>am</strong>t.<br />
Verkehrsflüsse und die d<strong>am</strong>it zus<strong>am</strong>menhängende Infrastruktur beeinflussen<br />
anderseits die Lebensbedingungen und haben dadurch wiederum einen Effekt auf<br />
das Freizeitverhalten. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf entsteht.<br />
Beim Freizeitverkehr können die folgenden Formen der<br />
Mobilität unterschieden werden:<br />
•Freizeitmobilität zu Hause (induziert etwa durch<br />
Sportaktivitäten)<br />
• Mobilität nach und zwischen Destinationen (Privatreisen,<br />
induziert durch Tourismus)<br />
• Mobilität innerhalb einer Destination (während des<br />
Ferienaufenthalts)<br />
Der vorliegende Artikel befasst sich mit der zweiten und<br />
dritten Form von Mobilität, der Interdestinationsmobilität<br />
<strong>am</strong> Beispiel Tourismus sowie der Intradestinationsmobilität<br />
<strong>am</strong> Beispiel von Schweizer Mobilitätsmustern.<br />
Die Interdestinationsmobilität:<br />
Das Beispiel Tourismus<br />
Basierend auf Daten des Reisemarkts Schweiz, die alle<br />
zwei bis drei Jahre bei 2'000 Haushalten erhoben und an<br />
unserem <strong>Institut</strong> ausgewertet werden, kann eine Anzahl<br />
Erkenntnisse bezüglich des Freizeitverkehrs gezogen<br />
werden.<br />
Wie Abbildung 1 zeigt, hat das Flugzeug über die letzten<br />
Jahrzehnte stetig Marktanteile aufgebaut. Die Zahl der<br />
Privatreisen mit dem Auto ist absolut immer noch im Steigen<br />
begriffen, obwohl diese relativ an Gewicht verloren<br />
hat. Der Bahnverkehr hat bis 1998 absolut und relativ<br />
eingebüsst. Dies ist erstaunlich, gehören doch die<br />
Schweizer zu den häufigsten Bahnfahrern im Vergleich<br />
mit anderen Ländern. Dafür gibt es einen Grund: Über<br />
die letzten Jahre hat sich der Anteil an langen Reisen verdreifacht.<br />
Während 1980 nur etwa 3% aller Privatreisen<br />
von Schweizerinnen und Schweizern zu Destinationen<br />
ausserhalb Europas geführt haben, betrug der Anteil an<br />
Reisen ausserhalb Europas 1998 bereits 12% (etwa 1,5<br />
Millionen Wege). Die Wahl der Destination ist das alles<br />
übersteuernde Kriterium zur Verkehrsmittelwahl.<br />
Unabhängig von der Wahl der Destination gibt es noch<br />
weitere erklärende Faktoren:<br />
•Die Art der Reise kann zum Teil die Verkehrsmittelwahl<br />
erklären: So ist beispielsweise der Anteil des Autos<br />
an Reisearten wie «Winterferien im Schnee» (84 %)<br />
oder «Ferien in der Bergen» (81 %) besonders hoch.<br />
Flugzeuge hingegen sind ein wichtiges Transportmittel<br />
für Reisearten wie etwa «Strandferien» (44 %), «Städtetrips»<br />
(36 %) oder «Sightseeing Trips» (35 %).<br />
• Einen Einfluss auf die Transportmittelwahl hat auch<br />
die Gruppengrösse: So gewinnt das Auto an Bedeutung<br />
bei grösseren Gruppen. Die durchschnittliche<br />
Grösse einer Reisegruppe ist beim Auto 2.7 und beim<br />
Flugzeug und der Bahn 2.0. Finanzielle Überlegungen<br />
mögen hier auch einen Einfluss haben.<br />
Transportmittelwahl zur Feriendestination<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Bus<br />
Boot/Schiff<br />
Flugzeug<br />
Bahn<br />
Auto<br />
1972<br />
1976/77<br />
1980/81<br />
1984<br />
1988/89<br />
1992/93<br />
1995/96<br />
1998<br />
Abbildung 1:<br />
Transportmittelwahl zur Feriendestination<br />
Quelle: Reisemarkt Schweiz<br />
7
• Das Alter der Reisenden ist ein weiterer erklärender<br />
Faktor. Der grösste Anteil des Autos liegt bei der Altersgruppe<br />
Bewegung im öffentlichen Rechnungswesen der Schweiz!<br />
Bernhard Knechtenhofer<br />
Nach einigen Jahren mit lediglich kleinen Anpassungen wird zur Zeit in der Schweiz<br />
an mehreren Projekten zur grundlegenden Weiterentwicklung des öffentlichen<br />
Rechnungswesens gearbeitet. Unter der Leitung der Eidgenössischen Finanzverwaltung<br />
wird einerseits das Projekt zur umfassenden Anpassung des Bundesrechnungsmodells<br />
vorangetrieben, andererseits gibt es auch auf der Stufe der Kantone und<br />
Gemeinden mehrere vielversprechende Projekte.<br />
In den letzten Jahren fanden weder beim Bund noch bei<br />
den Kantonen und Gemeinden grosse Weiterentwicklungen<br />
im öffentlichen Rechnungswesen statt. Nach dem<br />
wegweisenden Wurf zur Konzeption des Harmonisierten<br />
Rechnungsmodells der Kantone und Gemeinden (oft<br />
kurz HRM oder NRM genannt) vor gut 30 Jahren gab es<br />
im Grossen und Ganzen kaum Anpassungen oder Weiterentwicklungen<br />
im öffentlichen Rechnungswesen in<br />
der Schweiz. Voraussichtlich ändert dies in den nächsten<br />
Jahren! Nachfolgend eine erste Übersicht über ausgewählte<br />
Projekte in Arbeit:<br />
Neues Bundesrechnungsmodell<br />
Seit über einem Jahr arbeitet eine Projektgruppe an der<br />
Neukonzeption des Bundesrechnungsmodells. Noch in<br />
diesem Jahr findet die Vernehmlassung bei den Kantonen<br />
zum Grundmodell des neuen Bundesrechnungsmodells<br />
statt. Zentrale Merkmale dieses neuen Bundesrechnungsmodells<br />
sind:<br />
– Umstellung auf Accrual Accounting (kaufmännische<br />
Buchführung) in allen Dienststellen. D<strong>am</strong>it verbunden<br />
ist die Einführung der Steuerung nach der Erfolgsrechnung<br />
auf der Stufe des Amtes. Zur Ges<strong>am</strong>tsteuerung<br />
des Bundes wird die Mittelflussrechnung eine zentrale<br />
Rolle behalten;<br />
– Entwicklung eines Rasters für Kosten-Leistungsrechnungen.<br />
Dies schafft die Grundlage zur Ausweitung<br />
der internen Verrechnungen zwecks «Kostentransparenz»<br />
und Steigerung des Kostenbewusstseins;<br />
– Einführung von einheitlichen Rechnungslegungsnormen.<br />
Die Ausgliederungen, Auslagerungen etc. wie<br />
beispielsweise ETH, SBB, Post, Swisscom, Swissmedic,<br />
IGE und diverser Fonds sollen im Ausweis des Bundes<br />
erfasst werden;<br />
– Bedarfsgerechtere Finanzberichterstattung.<br />
Insges<strong>am</strong>t soll mit dem neuen Bundesrechnungsmodell<br />
die Management-Rationalität entschieden gestärkt werden,<br />
bei gleichzeitiger Berücksichtigung der politischen<br />
und volkswirtschaftlichen Anforderungen.<br />
Weiterentwicklungen im Rechnungswesen der<br />
Kantone und Gemeinden<br />
Auf der Stufe der Kantone und Gemeinden sind gleichzeitig<br />
mehrere Projekte in Bearbeitung:<br />
– Das Projekt KOLIBRI zur Entwicklung eines harmonisierten<br />
Grundrasters für Kosten-Leistungsrechnungen<br />
in den Kantonen und Gemeinden ist abgeschlossen.<br />
Die Resultate werden demnächst in Buchform publiziert;<br />
– In mehreren Kantonen u.a. in Zürich und Solothurn<br />
sind derzeit Überarbeitungen der Finanzhaushaltsgesetze<br />
in Bearbeitung. Dabei sollen stets die neusten<br />
Entwicklungen beispielsweise in der Rechnungslegung<br />
mitberücksichtigt werden;<br />
– Vertreter der Fachhochschule Winterthur sind zus<strong>am</strong>men<br />
mit der Stadt Kloten und anderen Partnern daran,<br />
die Jahresrechnung der Stadt Kloten nach den internationalen<br />
Rechnungslegungsstandards für öffentliche<br />
Gemeinwesen (IPSAS) beispielhaft darzustellen;<br />
– Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons<br />
Bern (AGR) erarbeitet zus<strong>am</strong>men mit einem<br />
Vertreter des IDT-HSG Empfehlungen zur Ergänzung<br />
der heutigen kommunalen Rechnungslegung. Mit den<br />
Ergänzungen sollen in Zukunft die finanziellen Verflechtungen<br />
zwischen den Gemeinden und anderen<br />
Einheiten, die kommunale Aufgaben erfüllen, transparenter<br />
dargestellt werden können.<br />
– Nicht zuletzt hat die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren<br />
(FDK) eine Kommission eingesetzt,<br />
die sich mit der Weiterentwicklung des HRM beschäftigen<br />
soll.<br />
Öffentlicher Sektor insges<strong>am</strong>t<br />
Die volkswirtschaftliche Darstellung der Abschlüsse der<br />
öffentlichen Gemeinwesen nach der funktionalen Gliederung<br />
wurde international überarbeitet. Die Schweiz<br />
wird in Zukunft die entsprechenden Daten voraussichtlich<br />
nach den Vorgaben der Standards of National<br />
Accounts (SNA) bzw. nach der Classification of Functions<br />
of Government (COFOG) ausweisen. Noch dieses Jahr<br />
soll zur Bewältigung der d<strong>am</strong>it verbundenen umfangreichen<br />
Arbeiten eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von<br />
Bund und Kantonen gebildet werden.<br />
Fazit<br />
Offensichtlich herrscht im öffentlichen Rechnungswesen<br />
der Schweiz zur Zeit so etwas wie eine Aufbruchstimmung.<br />
Die Resultate aus den zahlreichen Projekten können<br />
mit Spannung erwartet werden. Sie eröffnen den jeweiligen<br />
Gemeinwesen Chancen, die es zu nutzen gilt,<br />
d<strong>am</strong>it die Schweiz international (auch weiterhin) zu den<br />
guten Beispielen im öffentlichen Rechnungswesen gezählt<br />
werden kann.<br />
Bernhard Knechtenhofer, lic. oec. HSG<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
bernhard.knechtenhofer@unisg.ch<br />
9
Welche Erwartungen haben Mitarbeitende an die<br />
Wirkungsorientierte Verwaltungsführung?<br />
Martin Koci<br />
Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung in einem kantonalen Amt 1 wurden u.a. die<br />
Erwartungen erhoben, welche die Mitarbeitenden an die kurz vor der Einführung<br />
stehende Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) haben. Aus den Ergebnissen<br />
geht hervor, dass die grössten Erwartungen der Mitarbeitenden v.a. in die<br />
Beseitigung der heute bekannten Mängel des Bürokratiesystems sowie in die Ausformung<br />
zeitgemässer Arbeitsplätze gesetzt werden.<br />
Evaluationen im Zus<strong>am</strong>menhang mit Reorganisationen<br />
im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich zeigen<br />
oftmals auf, dass die erfolgreiche Einführung moderner<br />
Managementkonzepte, wie die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung<br />
(WoV), auf dem Enthusiasmus und der<br />
Partizipation aller (betroffenen) Mitarbeiter beruht. Dies<br />
entspricht wahrlich nicht einer neu entdeckten Weisheit,<br />
aber selbst eine derart rationale Organisation, wie sie die<br />
klassische Verwaltung darstellt, besteht in ihrem Wesen<br />
aus den Menschen, die dort arbeiten und so der «Maschinerie<br />
Leben einhauchen». Dennoch erhält das Personal<br />
nach wie vor zu wenig Berücksichtigung bei organisationalen<br />
Neuerungen.<br />
In der Regel erfolgt die Einführung neuer Konzepte von<br />
«oben» herab, d.h. die betroffenen Mitarbeiter werden<br />
von den Verantwortlichen zu gegebenem Zeitpunkt darüber<br />
in Kenntnis gesetzt. Kaum eine Projektorganisation<br />
ist bemüht, die Mitarbeitenden rechtzeitig um ihre Meinungen<br />
und Erwartungen im Zus<strong>am</strong>menhang mit den<br />
geplanten Neuerungen zu befragen, geschweige denn<br />
sie aktiv zu beteiligen.<br />
Im Rahmen eines Forschungsprojektes konnte das IDT-<br />
HSG der Universität St.Gallen neben vielen relevanten<br />
Themen auch die Erwartungen der Mitarbeitenden an geplante<br />
WoV-Massnahmen mittels eines Fragebogens erheben<br />
und analysieren. Eine Liste von insges<strong>am</strong>t 28 relevanten<br />
Items zum Thema WoV wurden von den<br />
Befragten kritisch bewertet.<br />
Aus der Ergebnissen kann entnommen werden, dass die<br />
höchsten Erwartungen in die Beseitigung von bestehenden<br />
Mängeln im bürokratischen System gesetzt werden.<br />
Dies drückt sich insbesondere darin aus, dass ein «Abbau<br />
von Traditionen und Regelwerken» von den meisten Mitarbeitenden<br />
bei einer allfälligen Veränderung gewünscht<br />
wird. Ein ähnlich hohes Resultat erzielt auch der Aspekt<br />
«Verminderung von Leerläufen», welcher von den Mitarbeitenden<br />
als ein (negatives) Phänomen ihrer Tätigkeit<br />
angesehen wird. Die weiteren Erwartungen werden in<br />
eine «Stärkung der Eigenverantwortung» gesetzt sowie in<br />
die «Verbesserung der Arbeitsabläufe» (im Sinne einer Effizienz-<br />
und Effektivitätssteigerung).<br />
«Abbau von (internen) Machtstrukturen», «Verringerung<br />
von Detailkontrollen», «Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch»,<br />
«Sicherheit des Arbeitsplatzes» sowie «Verbesserung<br />
Aufstiegschancen» stehen <strong>am</strong> unteren Ende der<br />
Liste, d.h. dazu werden die kleinsten Erwartungen geäussert.<br />
Diesen Aspekten ist gemeins<strong>am</strong>, dass sie ebenfalls<br />
(ein systemimmanenter) Ausdruck der heutigen Arbeitsform<br />
eines vornehmlich bürokratischen Systems<br />
darstellen und dass sie anscheinend als wenig veränderbar<br />
empfunden werden (kleinste Erwartungswerte).<br />
Fasst man die dargestellten Resultate zus<strong>am</strong>men, so kann<br />
daraus entnommen werden, dass die Erwartungen der<br />
Mitarbeitenden in Richtung einer «Ausmerzung» von bestimmten<br />
Schwächen des bisherigen Systems zielen und<br />
gleichzeitig aber bestimmte Struktur- und Prozessdefizite<br />
bürokratischer Organisationsformen als unveränderbar<br />
(oder zumindest nur schwer veränderbar) angesehen<br />
werden.<br />
Dieses kurze Beispiel zeigt, dass mit den hier beschriebenen<br />
Resultaten Wünsche und Erwartungen der Mitarbeitenden<br />
aufgezeigt werden können. Diese zu berücksichtigen<br />
und zus<strong>am</strong>men mit den Mitarbeitenden<br />
eingehend zu analysieren erhöht die Aussicht, Reorganisationen<br />
erfolgreich(er) durchzuführen und gleichzeitig<br />
Zeit, Geld und Arbeitseinsatz einzusparen. Mitarbeitende<br />
werden zusätzlich motiviert, sich bei den Neuerungen<br />
aktiv und (mit-)gestaltend zu beteiligen. Darüber hinaus<br />
dient diese zugleich auch als Prioritätenliste für die Implementierung<br />
relevanter Anreize für die zukünftige und<br />
zeitgemässe Ausgestaltung neuer Arbeitsplätze (nicht<br />
nur) im öffentlichen Bereich.<br />
Abschliessend kann festgehalten werden, dass diese Resultate<br />
als erste Ansätze für gezielte gegensteuernde<br />
Massnahmen angesehen werden können. Sie dienen bei<br />
Reorganisationsprojekten als gute Informationsbörse und<br />
ein Schritt in Richtung einer umfassenden Evaluation der<br />
Ansprüche aller betroffenen Parteien.<br />
Martin Koci, lic. phil.<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
martin.koci@unisg.ch<br />
1<br />
Anm.: Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine näheren Angaben zur untersuchten Stichprobe<br />
gemacht.<br />
10
Fallstudie Weisse Arena – ein Tourismus-Case für 1000 Studierende<br />
Andreas Liebrich<br />
Wieder werden im Herbst rund 1000 junge, motivierte Studierende an unsere Universität<br />
eintreten. Sie werden teilweise alle in ein und derselben Veranstaltung<br />
sitzen um dieselbe betriebswirtschaftliche Sprache zu erlernen. Dies bedeutet auch<br />
eine grosse Herausforderung für die Lehrenden. Die anspruchsvollen Lerninhalte<br />
müssen zu sinnvollen, wohlschmeckenden Häppchen verarbeitet werden um die<br />
volle Aufmerks<strong>am</strong>keit der Fresh(wo)men zu erlangen.<br />
Rund 1000 Studierende haben die neue Assessment-Stufe<br />
im Jahre 1 der Neukonzeption der Lehre in Angriff<br />
genommen. Ungefähr die gleiche Anzahl wird es auch in<br />
diesem Jahr wieder sein. Neben dem Handling der hohen<br />
Anzahl von Studierenden, was für das IDT neu war,<br />
boten vor allem auch die Neuerungen der Lehre Herausforderungen.<br />
Neben den herkömmlichen Übungen und<br />
den Vorlesungen, sie bilden das Kontaktstudium, erhalten<br />
die Studierenden Aufträge, welche während des<br />
Selbststudiums zu bearbeiten sind. Im Kontaktstudium<br />
müssen die Studierenden heute im Fach Betriebswirtschaftslehre<br />
wöchentlich eine zweistündige Vorlesung<br />
besuchen, die von nicht weniger als fünf Professoren im<br />
650 Leute fassenden Audimax gehalten wird und in zwei<br />
kleinere Auditorien übertragen wird.<br />
Vor allem zur Unterstützung des Selbststudiums wurde<br />
eigens für die Studierenden der neu konzeptionierten<br />
Lehre eine webbasierte Lernplattform geschaffen. Um<br />
sinnvoll mit diesem neuen Medium arbeiten zu können,<br />
ist eine gute Koordination zwischen den verschiedenen<br />
Lerngefässen notwendig. Dies und die hohe Anzahl Studierender<br />
fordert einen umso klareren didaktischen Aufbau<br />
der ges<strong>am</strong>ten Veranstaltung, eine Minimierung der<br />
Schnittstellen, klare Aufträge für die Fallstudie und, nach<br />
den Erfahrungen des letzten Jahres, nicht zuletzt eine Reduktion<br />
des Aufwandes für Studierende und Übungsleiter.<br />
Wir behelfen uns des Kaskadenprinzips, um die<br />
Komplexität darzustellen:<br />
Jeder Block einer Vorlesung wird eingeleitet durch die<br />
Vorlesung (vgl. Abbildung). Die Lerninhalte müssen im<br />
Selbststudium nachbearbeitet werden. Die Repetitionsfragen<br />
auf der Lehrplattform dienen der Lernkontrolle.<br />
Fragen und Antworten bieten zwar noch immer beschränkte<br />
Möglichkeiten komplexe Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
zu testen. Da die Erstsemestrigen aber vor allem auch<br />
Erläuterung der wichtigen Lerninhalte (Vorlesung)<br />
Di<br />
die neuen Fachbegriffe und die «betriebswirtschaftliche<br />
Sprache» lernen sollen, bietet sich diese Form der Lernkontrolle<br />
geradezu an, zumal die komplexeren betriebswirtschaftlichen<br />
Fragen zum Marketing in den 25 Übungsgruppen<br />
behandelt werden. Sofern durch die elektronische<br />
Lernkontrolle Fragen entstehen, welche die Studierenden<br />
nicht mit Hilfe des Buches lösen können, steht in der<br />
letzten der vier Übungen Zeit für die Beseitigung von Unklarheiten<br />
zur Verfügung.<br />
Die Abteilung T & V gestaltet zwei Vorlesungen und vier<br />
Übungen zum Themenkreis Marketing. Da sicherlich alle<br />
Studierenden des ersten Semesters bereits eigene Erfahrungen<br />
im Bereich Tourismus haben, eignet sich ein<br />
Skigebiet besonders gut, Geschäftsprozesse anschaulich<br />
darzustellen und Übungen anhand einer Fallstudie zu<br />
machen. Dank den vielen Innovationen in Flims/Laax/<br />
Falera wurde die Weisse Arena als Fallstudie gewählt.<br />
Der Fallstudientext bietet auch Nichtschneesportlern einen<br />
guten Einblick in das Freiluftunternehmen «Weisse<br />
Arena». Zur Unterstützung des Verständnisses stehen in<br />
der Lernplattform Videos zur Verfügung, welche die Positionierung<br />
der Weissen Arena mit Hilfe von Video-Clips<br />
verbildlichen. Zu den fünf Demovideos gesellt sich ein<br />
Interview mit dem CEO der Weissen Arena AG, Reto<br />
Gurtner. Er gibt in einem Interview mit Prof. Thomas<br />
Bieger Auskunft über die Zielgruppen und Kernprobleme<br />
seines Unternehmens.<br />
Im ersten Jahr der Durchführung der Fallstudie «Weisse<br />
Arena» konnten gute Erfahrungen ges<strong>am</strong>melt werden.<br />
Aber auch trotz des hohen Aufwandes für die Vorbereitung<br />
für abwechslungsreichen, multimedial unterstützten<br />
Unterricht ist die Motivation der Lernenden keine Selbstverständlichkeit:<br />
Das Credit-Punkt-System lässt die Studierenden<br />
zu ökonomischem Verhalten übergehen, was<br />
nichts anderes heisst, als dass sie nur Arbeiten machen,<br />
die auch Credits abwerfen und dagegen hilft nur die<br />
Motivation durch spannende Lerninhalte. Wir glauben<br />
mit der Fallstudie eben diese Lerninhalte interessant verpackt<br />
zu haben.<br />
Vertiefung der Lerninhalte (Lehrmaterial) zum Fall (Lernplattform)<br />
Di<br />
Drei Mal<br />
«hochpumpen»<br />
(<br />
Beantworten der Repetitionsfragen (Lernplattform) Mi - Do<br />
Anwendung (Übungen)<br />
Fr<br />
Unklarheiten mit Lehrbuch und Repetitionsfragen bearbeiten<br />
Fragestunde (in 5. Übung)<br />
Andreas Liebrich, lic. oec. HSG<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
andreas.liebrich@unisg.ch<br />
11
Das IDT im Pott<br />
Klaus-Dieter Schnell, Simone Strauf, Manfred Walser<br />
Dortmund rief – und die Elite der europäischen Regionalforscher k<strong>am</strong> ins Ruhrgebiet.<br />
Dort fand der 42. Jahreskongress der Europäischen Regionalwissenschaftlichen<br />
Vereinigung statt. Auch Mitarbeiter der Regio-Abteilung des IDT präsentierten<br />
hier neue Projektergebnisse. Einige Impressionen:<br />
Fachkonferenzen sind Teil unserer Arbeit. Die Darstellung<br />
und Diskussion von Forschungsergebnissen in der<br />
internationalen «scientific comunity» hilft dabei, den Stellenwert<br />
der eigenen besser einzuschätzen. Auf Konferenzen<br />
werden Methoden verglichen, nützliche Kontakt<br />
geknüpft und neue Projektideen geboren.<br />
und die aktuelle Diskussion um «Regional governance»<br />
geführt. Mit den empirischen Daten aus der fachlichen<br />
Begleitung der Bodensee Agenda 21 konnten wir einige<br />
Thesen aus dieser Diskussion untermauern und mit Ergebnissen<br />
aus anderen Regionen vergleichen.<br />
…und Fachgespräche in der Pause<br />
In den Workshops über «Rural and peripheral areas» präsentierten<br />
wir unseren Forschungsansatz im neuen NFP-<br />
48-Projekt «Sustainable tourism management and monitoring».<br />
Das Thema der Indikatorenentwicklung lockte<br />
Für die Abteilung Regionalwirtschaft ist der jährliche<br />
Kongress der Europäischen Regionalforscher (European<br />
Regional Science Association ERSA) eine wichtige Veranstaltung.<br />
Er fand in diesem Jahr an der Universität Dortmund<br />
statt.<br />
Die Schweiz stellte eine starke Delegation: Mit den Autoren<br />
vom IDT, dem Te<strong>am</strong> um den ehemaligen Direktor<br />
unseres <strong>Institut</strong>s Alain Thierstein und seinen drei Assistenten<br />
vom ORL-ETH, mit Denis Maillat und seinen Mitarbeitern<br />
von der Universität Neuchâtel, mit Angelo Rossi<br />
(SUPSI, Manno), Rico Maggi (USI, Lugano) und<br />
Antoine Bailly (Universität Genf) sowie weiteren Kollegen<br />
waren alle Landesteile prominent vertreten.<br />
Letzte Vorbereitungen im Zug…<br />
Vier Tage lang wurden in zwölf Sessions von je<br />
anderthalb Stunden Dauer Ergebnisse und Forschungsdesigns<br />
aus ganz Europa und Übersee präsentiert. Von<br />
den über 500 eingereichten Papers wurden etwa 370 vorgestellt.<br />
Dabei fanden in jeder Session 12 thematische<br />
Workshops parallel statt.<br />
Mit 20 bis 30 Teilnehmern<br />
waren trotz der<br />
Kürze der Zeit intensive<br />
Diskussionen möglich. In<br />
zwei Workshops waren<br />
Mitarbeiter des IDT-HSG<br />
aktiv:<br />
Unter dem Titel «Urban<br />
and regional planning»<br />
wurden Themen rund<br />
um das Management von<br />
Regionen aufgegriffen<br />
v.l.n.r. Alain Thierstein und Manfred Walser<br />
auch Experten aus anderen Workshops an, es war einer<br />
der immer wiederkehrenden Schwerpunkte der diesjährigen<br />
Konferenz.<br />
Die Konferenz endete wie jedes Jahr mit einer fachlichen<br />
Exkursion. Mit der internationalen Bauausstellung Emscher<br />
Park hat das Ruhrgebiet einiges für die Regionalwissenschaft<br />
zu bieten.<br />
Technical Excursion in der IBA Emscher Park: Visionäre<br />
Architektur (Akademie Mont Cenis),<br />
alte Industrie (Landschaftspark Duisburg Nord)<br />
12
Dies zog sich auch wie ein roter Faden durch die diesjährige<br />
Konferenz. Mit der Bauausstellung gelang der Region<br />
ein Imagewandel, der in dieser Deutlichkeit von<br />
kaum einer anderen altindustrialisierten Region in Europa<br />
nachvollzogen werden konnte: weg von der dreckigen<br />
Eisen-und-Kohle-Region, die von einem innovationsfeindlichen<br />
Dreieck aus Politik, Industrie und<br />
Gewerkschaften beherrscht wird, hin zu einer dyn<strong>am</strong>ischen<br />
und hoch innovativen Region mit visionären Ideen<br />
und zukunftsweisenden Projekten.<br />
Plenum<br />
Klaus-Dieter Schnell, M.A./Raumplaner NDS/ETH<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
klaus-dieter.schnell@unisg.ch<br />
Präsentation<br />
D<strong>am</strong>it spiegelt der Tagungsort etwas wider, was auch für<br />
unsere Arbeit <strong>am</strong> <strong>Institut</strong> als Leitidee bezeichnet werden<br />
kann: Regionale Entwicklung gelingt nur dann, wenn der<br />
Wandel zuerst in den Köpfen derer stattfindet, die in der<br />
Region aktiv sind.<br />
Simone Strauf, Geographin, Volkswirtin M.A.<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
simone.strauf@unisg.ch<br />
Manfred Walser, Dipl.-Verw.-Wiss.<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
manfred.walser@unisg.ch<br />
Aktuelles Seminarprogr<strong>am</strong>m der Bodensee Agenda 21:<br />
«Lebensräume – Lebensträume, Raum sinnvoll nutzen»<br />
Zielpublikum der Seminarreihe der BA 21 sind alle Interessierten an der nachhaltigen Entwicklung sowie Vertreter<br />
von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung aus dem Bodenseeraum. Detailinformationen zu den<br />
einzelnen Veranstaltungen unter www.regio-bodensee.net/agenda oder bei Manfred Walser, Wiss. Mitarbeiter<br />
<strong>am</strong> IDT, manfred.walser@unisg.ch, und als Fachbegleiter der BA 21 mit für das Seminarprogr<strong>am</strong>m verantwortlich.<br />
Die nächsten Termine sind:<br />
19. November <strong>2002</strong> Von Kirchturm zu Kirchturm: Städtekooperation <strong>am</strong> Bodensee<br />
Friedrichshafen Vortrag von Prof. Dr. Karl Ganser, ehem. Direktor der IBA Emscher Park. Fallbeispiele aus D, A, CH.<br />
In Zus<strong>am</strong>menarbeit mit dem «Kooperationsraum Bodensee-Oberschwaben».<br />
28. November <strong>2002</strong> Offene Agenda-Prozesse: Wege zu einer neuen Planungskultur<br />
Stein <strong>am</strong> Rhein Fallbeispiele aus Konstanz, Zürich und Schaffhausen, Diskussion und Workshop.<br />
5. Dezember <strong>2002</strong> Vier Länder, vier Indikatorensysteme?<br />
Lindau<br />
Expertenworkshop zur Synthese der nationalen Diskussionen um Nachhaltigkeitsindikatoren.<br />
18. Dezember <strong>2002</strong> Raumwahrnehmung – Wie sehen wir die Bodenseeregion?<br />
Bregenz<br />
Workshop mit Prof. Dr. Gerhard Strohmeier, <strong>Institut</strong> für Interdisz. Forschung und Fortbildung, Wien<br />
Bedeutung der Vielfalt der Sichtweisen für die Ziele einer nachhaltigen Regio Bodensee.<br />
16. Januar 2003 Regionale Kooperation und Agenda 21<br />
Konstanz<br />
Vortrag von Prof. Dr. Dietrich Fürst, Universität Hannover. In Zus<strong>am</strong>menarbeit mit dem<br />
Agendabüro der Stadt Konstanz.<br />
23. Januar 2003 Urbane Dichte und Einf<strong>am</strong>ilienhaus – Auf der Suche nach adäquaten<br />
Konstanz<br />
Siedlungstypologien in der Regio Bodensee<br />
Diskussion mit Thomas Sieverts (Darmstadt), Bart Lootsma (Wien) und Winy Maas (Rotterd<strong>am</strong>).<br />
In Zus<strong>am</strong>menarbeit mit der FH Konstanz und dem Projekt Vision Bodenseestadt.<br />
13
Die heilige Kuh wird angepackt – Auslagerung auch in der<br />
hoheitlichen Verwaltung?<br />
Isabella Proeller<br />
Auslagerungen haben sich in den letzten Jahren international zu einem verbreiteten<br />
Instrument der Verwaltungsreform etabliert. In vielen Diskussionen und theoretischen<br />
Abhandlungen zum Thema Auslagerung wird der Bereich der hoheitlichen<br />
Verwaltung meist a priori und recht kategorisch ausgeschlossen. Da aber auch hoheitliche<br />
Verwaltungseinheiten vermehrt Finanz- und Effizienzdruck ausgesetzt<br />
sind, stehen Auslagerungen auch in diesem Verwaltungsbereich zunehmend zur Diskussion.<br />
Nicht zuletzt finden sich auch jetzt schon Anwendungsbeispiele für Auslagerungen<br />
in der hoheitlichen Verwaltung.<br />
Zunächst scheint es vielleicht plausibel, dass der Staat<br />
sich diesen wichtigen und besonderen Aufgabenbereich<br />
zur eigenen Durchführung vorbehält. Auch sagt einem<br />
das Gefühl, dass Auslagerungen in hoheitlichen Verwaltungsbereichen<br />
wohl nicht dasselbe Ausmass und dieselbe<br />
Bedeutung einnehmen werden wie in anderen Verwaltungsbereichen.<br />
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich<br />
allerdings, dass überzeugende Argumente gegen ein kategorisches<br />
Verbot von Auslagerungen im hoheitlichen<br />
Bereich fehlen. Auslagerungen in der hoheitlichen Verwaltung<br />
sind in besonderem Masse dem Spannungsfeld<br />
von betriebswirtschaftlich motivierten Effizienzüberlegungen,<br />
Anliegen der recht- und ordnungsmässigen Leistungserbringung<br />
und politischen Ansprüchen ausgesetzt.<br />
Mit der Beurteilung von Auslagerungen in diesem spezifischen<br />
Umfeld befasst sich eine Dissertation der Universität<br />
St.Gallen.<br />
Unter Auslagerung wird die Einbindung von Privaten in<br />
den öffentlichen Leistungserstellungsprozess zur selbstständigen<br />
Erbringung von (Teil-)Leistungen verstanden.<br />
Der Private wird vertraglich veranlasst einen Beitrag zu<br />
leisten und die erbrachte (Teil-)Leistung muss einen<br />
funktionalen Bezug zu einer Staatsaufgabe aufweisen,<br />
d.h. sie ist Teil des Kernprozesses der Leistungserstellung.<br />
Neben dem Begriff Auslagerung werden zahlreiche<br />
weitere Begriffe zum Teil synonym verwendet, wie z.B.<br />
Outsourcing, Contracting Out oder funktionelle Privatisierung.<br />
Die hoheitliche Verwaltung wurde im Sinne der<br />
Eingriffsverwaltung abgegrenzt als der Teil der öffentlichen<br />
Verwaltung, welchem zur Aufgabenerfüllung die<br />
Möglichkeit zusteht, in die Rechte der Bürger und Kunden<br />
einzugreifen.<br />
Auslagerungen in der hoheitlichen Verwaltung werden<br />
oft auf Ebene ganzer Aufgaben oder Produkte diskutiert.<br />
So wird z.B. von der Auslagerung des Steuerbezugs oder<br />
der Auslagerung des Strafvollzugs gesprochen. Für die<br />
Beurteilung von Auslagerungen in der hoheitlichen Verwaltung<br />
empfiehlt sich aber eine konsequente Analyse<br />
auf Ebene der Prozesse. Für die Auslagerungsdiskussion<br />
müssen die Prozesse ferner hinsichtlich ihrer Bedeutung<br />
im Rahmen der hoheitlichen Leistungserbringung sowohl<br />
aus betrieblicher als auch aus juristischer Sicht charakterisiert<br />
werden. Denn ein Prozess der einen «prägenden<br />
Grundfaktoren<br />
Legitimationsrelevanz<br />
Servicefaktoren<br />
Kritische<br />
Prozesse<br />
Unkritische<br />
Prozesse<br />
Nicht-Eingriff<br />
Hoheitliche<br />
(=kritische<br />
Eingriffs-)<br />
Prozesse<br />
Unkritische<br />
Eingriffs-<br />
Prozesse<br />
Eingriff<br />
Wahrnehmung<br />
beim Adressaten<br />
Abbildung 1: Portfolio zur Kategorisierung von Prozessen<br />
der hoheitlichen Verwaltung<br />
Verfahrensschritt» (im rechtlichen Sinne) abbildet, verlangt<br />
nach anderen Kriterien zur Beurteilung als eine reine<br />
administrative Tätigkeit. Zur Strukturierung der Prozesse<br />
nach ihrer Bedeutung kann das in Abb. 1<br />
dargestellte Portfolio herangezogen werden. Danach<br />
werden die Prozesse der hoheitlichen Verwaltung nach<br />
den Kriterien «Legitimationsrelevanz» und «Wahrnehmung<br />
beim Adressaten» kategorisiert.<br />
Die Legitimationsrelevanz ordnet die Prozesse hinsichtlich<br />
ihrer «strategischen» Bedeutung für die Leistungserbringung.<br />
Legitimation wird in der betrieblichen Rationalität<br />
im Sinne von Akzeptanz verwendet, im Gegensatz<br />
zum juristischen Sprachgebrauch, wonach unter Legitimation<br />
das Vorliegen einer rechtlichen Grundlage verstanden<br />
wird. Das Schaffen von Legitimation (Akzeptanz)<br />
kann als Metaziel der öffentlichen Verwaltung<br />
angesehen werden. Mit dem Kriterium Wahrnehmung<br />
beim Adressaten wird die Bedeutung des Prozesses aus<br />
Sicht des Betroffenen festgehalten. Die Eingriffshandlung<br />
der hoheitlichen Verwaltung wird für ihn relevant, wenn<br />
er sie als Veränderung seiner Rechtsposition wahrnimmt.<br />
Mit Hilfe des Portfolios können unkritische, kritische und<br />
hoheitliche Prozesse sowie unkritische Eingriffsprozesse<br />
unterschieden werden, wobei letztere eine rein theoretische<br />
Kategorie darstellen, der in der Praxis keine Prozesse<br />
zugeordnet werden können. Für die weitere Diskussion<br />
werden daher nur die ersten drei Kategorien<br />
weiter in die Diskussion miteinbezogen.<br />
14
Maxime<br />
Prozesse<br />
Schutz effizienter<br />
Leistungserstellung<br />
Schutz rechtmässiger<br />
Aufgabenerfüllung<br />
Schutz des<br />
Individuums<br />
unkritische kritische hoheitliche<br />
Fokus<br />
Beurteilungskriterien<br />
Effizienz<br />
Kosten-Leistungsverhältnis<br />
Risiko<br />
Verhältnis<br />
Staat-Contractor<br />
Rechte<br />
Verhältnis<br />
Staat-Bürger<br />
Entschei-<br />
Politik/<br />
Verwaltung<br />
dungsträger<br />
Verwaltung<br />
Gesetzgeber<br />
Dominante<br />
Rationalität<br />
Politische<br />
Betriebliche<br />
Politische<br />
Betriebl./Jur.<br />
Politische<br />
Betriebl./Jur.<br />
Kontroll- u.<br />
(Gradueller) Gradueller Markt (Graduelle)<br />
Steuerungsmech.<br />
Markt<br />
bis Hierarchie Hierarchie<br />
Abbildung 2: Heuristischer Entscheidungsrahmen zur<br />
Beurteilung von Auslagerungen in der hoheitlichen<br />
Verwaltung<br />
Zur Bestimmung der inhaltlichen Fragestellungen und<br />
Aspekte, die zu einer Beurteilung von Auslagerungen<br />
herangezogen werden müssen, wurden verschiedene<br />
bestehende Ansätze aus unterschiedlichen wissenschaftlichen<br />
Disziplinen analysiert. Es wurden sechs Themenkomplexe<br />
identifiziert und zu sogenannten «Dimensionen»<br />
zus<strong>am</strong>mengeführt, welche für eine umfassende<br />
Beurteilung einer Auslagerung in Betracht gezogen werden<br />
müssen. Die Dimensionen (Maxime, Fokus, Beurteilungskriterien,<br />
Entscheidungsträger, dominante Rationalität,<br />
Kontroll- und Steuerungsmechanismus) stehen in<br />
unterschiedlicher qualitativer Bedeutung zueinander.<br />
Aus der Zus<strong>am</strong>menführung der Dimensionen mit den<br />
Prozesskategorien, die aus dem Portfolio in Abb. 1 abgeleitet<br />
wurden, ergibt sich der heuristische Entscheidungsrahmen<br />
in Abb. 2. Im heuristischen Entscheidungsrahmen<br />
werden die Ausprägungen der Dimensionen je<br />
Prozesskategorie konkretisiert. Die im heuristischen Entscheidungsrahmen<br />
aufgeführten Werte und Aspekte je<br />
Prozesskategorie sind stark aggregiert und stehen für<br />
weitergehende, ausführlichere Überlegungen. Beispielsweise<br />
stehen in der Dimension Beurteilungskriterien hinter<br />
den Schlagworten Kosten-Leistungsverhältnis, Verhältnis<br />
Staat-Contractor und Verhältnis Staat-Bürger<br />
ausführlichere Kriterienkataloge, wie in Abb. 3 dargestellt.<br />
Der heuristische Entscheidungsrahmen verdeutlicht, dass<br />
die zur Beurteilung von Auslagerungen relevanten<br />
Aspekte und Umfeldfaktoren zwischen den Prozesskategorien<br />
stark variieren. Als Instrumentarium trägt er<br />
dazu bei, bei der Beurteilung konsequent auf die Prozessebene<br />
abzustellen. Im Unterschied zu bestehenden<br />
Auslagerungsmodellen wird mit dem vorliegenden heuristischen<br />
Entscheidungsrahmen spezifisch auf den Anwendungsbereich<br />
der hoheitlichen Verwaltung eingegangen.<br />
Isabella Proeller, Dr. oec. et lic. iur.<br />
Projektleiterin Abteilung Public Management<br />
isabella.proeller@unisg.ch<br />
Beurteilungskriterien<br />
für<br />
Unkritische Prozesse<br />
• Spezifizierbarkeit der Leistung<br />
• Nachträgliche Überprüfbarkeit<br />
•Marktcharakteristika<br />
•Wirtschaftlichkeit<br />
• Monitoringfähigkeit beim Staat<br />
• Strategische Bedeutung<br />
der Leistung<br />
Kosten-Leistungsverhältnis<br />
Kritische Prozesse<br />
Insbesondere:<br />
•Vorliegen von Ermessensspielräumen<br />
•Situationsbezogenheit<br />
•Verlust materieller Entscheidungsgewalt<br />
• Bedeutung eines Fehlers<br />
Daneben:<br />
• Kosten-Leistungsverhältnis<br />
(siehe unkritische Prozesse)<br />
• z.T. Vss. an die Beleihung<br />
Verhältnis Staat-Contractor<br />
Hoheitliche Prozesse<br />
Insbesondere:<br />
• Vss. an die Beleihung<br />
• Gleiches Mass an Rechtsschutz<br />
und Verfahrensgarantien<br />
•Wettbewerbsneutralität<br />
• Bedeutung eines Fehlers<br />
Daneben:<br />
• Kosten-Leistungsverhältnis<br />
•Verhältnis Staat-Contractor<br />
•Haftungsfragen<br />
Verhältnis Bürger-Staat<br />
Abbildung 3: Kriterienkataloge zur Beurteilung von Auslagerungen für unkritische, kritische und hoheitliche<br />
Prozesse<br />
Die Buchausgabe der Dissertation «Auslagerung in der hoheitlichen Verwaltung – Interdisziplinäre Entwicklung<br />
einer Entscheidungsheuristik» wird <strong>am</strong> 13. November im Paul Haupt Verlag erscheinen. Bestellungen werden unter<br />
der obenstehenden Email-Adresse gerne entgegengenommen.<br />
15
Worte statt Konzepte – Nichts geht mehr ohne<br />
Regional Governance<br />
Manfred Walser, Roland Scherer<br />
Auch die Wissenschaft ist nicht frei von Eitelkeiten und Revierverhalten. Dazu gehört,<br />
den richtigen Begriff für ein mehr oder weniger neues Konzept zu finden, eifrig zu verteidigen<br />
und möglichst oft zu publizieren. Irgendwann gilt man dann vielleicht als<br />
Schöpfer eines wissenschaftlichen Konzepts, was den akademischen Ruf deutlich steigern<br />
kann. Doch öfters tauchen in der Fachdiskussion auch Begriffe auf, die sehr<br />
schnell Karriere machen, ohne dass ihnen ein ausgereiftes theoretisches Konzept zugrunde<br />
liegt. «Governance» oder auch «Regional Governance» ist ein solcher Begriff.<br />
Der Begriff «Governance» wird heute in den verschiedenen<br />
Disziplinen sehr unterschiedlich verwendet. Das gilt auch<br />
für die hier <strong>am</strong> IDT-HSG vertretenen Forschungsschwerpunkte:<br />
In der Betriebswirtschaft umfasst «Corporate Governance»<br />
die Regeln guter und wertorientierter Unternehmensführung<br />
und insbesondere die Grundsätze und<br />
Regeln über Organisation, Verhalten und Transparenz für<br />
Führung von grossen Unternehmen. Im Public Management<br />
wird «Good Governance» oftmals mit einem neuen<br />
Management-Ansatz für die öffentliche Verwaltung gleichgesetzt,<br />
bei dem es einerseits um eine effiziente und effektive<br />
Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Zus<strong>am</strong>menspiel mit<br />
privaten Akteuren und andererseits auch um Fragen der Legitimation<br />
und Transparenz des öffentlichen Handelns<br />
geht. In der Regionalwissenschaft wird «Regional Governance»<br />
heute oftmals als Synonym für schwach institutionalisierte<br />
Steuerungsformen wie Netzwerke, runde Tische,<br />
Regionalkonferenzen etc. verwendet.<br />
Grundsätzlich umschreibt der Begriff «Governance» die an<br />
sich banale Tatsache, dass die Entwicklung eines Unternehmens<br />
oder eines Raumes nicht ausschliesslich hierarchisch<br />
von einer abgeschlossenen Akteursgruppe gesteuert<br />
wird, sondern immer im Zus<strong>am</strong>menspiel vieler Akteure mit<br />
unterschiedlichen Interessen und «Entscheidungslogiken»<br />
geschieht. Netzwerke und weiche Kooperationsformen auf<br />
der Basis von persönlicher Wertschätzung geraten deshalb<br />
immer mehr in das Blickfeld der Forschenden. «Governance»<br />
wird häufig auch mit dem Management von öffentlichen<br />
und privaten Netzwerken gleichgesetzt. Nach Rhodes<br />
sind d<strong>am</strong>it die folgenden Merkmale für Governance kennzeichnend,<br />
unabhängig welche Wissenschaftsdisziplin sich<br />
mit dem Thema beschäftigt:<br />
Soweit besteht Einigkeit in der wissenschaftlichen Welt.<br />
Schwieriger – und noch lange nicht ausreichend erforscht<br />
– sind die methodischen und analytischen Fragen, die<br />
sich um diese Beobachtung gruppieren. Erklärungsansätze<br />
liefern beispielsweise die Politikwissenschaften, die<br />
unterschiedliche Formen der Steuerung identifizieren:<br />
• Politik und Verwaltung arbeiten mit Mitteln der «hierarchischen<br />
Steuerung», d.h. mit Gesetzen und Verordnungen,<br />
Subventionen und Gebühren.<br />
• Daneben gibt es die Steuerung über die Marktmechanismen<br />
von Angebot und Nachfrage. Sie bestimmen<br />
nicht nur das private Konsumverhalten, sondern genauso<br />
die Prioritäten der weiteren Entwicklung von<br />
Dienstleistungen, Infrastrukturen etc.<br />
• Als dritte Form der Steuerung tritt die sog. «sozio-emotionale«<br />
Steuerung hinzu. Hinter diesem nicht besonders<br />
wohltönenden Begriff verbirgt sich eine Form der<br />
Steuerung auf der Grundlage von Vertrauen und<br />
Gegenseitigkeit. Sie bestimmt überall dort die Entwicklung,<br />
wo Akteure auf freiwilliger Basis zus<strong>am</strong>menarbeiten:<br />
in Verbänden und Vereinen, Entwicklungsagenturen,<br />
an runden Tischen usw.<br />
Auf der regionalen Ebene besteht gerade hinsichtlich dieser<br />
Fragestellungen noch ein deutlicher Forschungsbedarf:<br />
Neben einer intensiven steuerungstheoretischen<br />
Fachdiskussion fehlen empirische Studien, die sich mit<br />
dem Komplex des Regional Governance beschäftigen.<br />
D<strong>am</strong>it wird sich das Kompetenzzentrum Regionalwirtschaft<br />
in der kommenden Zeit verstärkt beschäftigen.<br />
• Ein Netzwerk auf der Basis von Selbstorganisation<br />
• Unabhängigkeit zwischen beteiligten Organisationen<br />
• Regelmässige Interaktion zwischen den Mitgliedern des<br />
Netzwerks<br />
• Interaktion auf der Basis von Vertrauen und gesteuert<br />
durch Regeln, die sich die Akteure im Netzwerk selbst<br />
geben<br />
• Ein signifikanter Grad von Unabhängigkeit gegenüber<br />
staatlichen Organen<br />
Roland Scherer, Dipl.-Verw.-Wiss.<br />
Leiter des Kompetenzzentrums Regionalwirtschaft<br />
roland.scherer@unisg.ch<br />
Manfred Walser, Dipl.-Verw.-Wiss.<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
manfred.walser@unisg.ch<br />
16
Eigentümerstrategien für Staatsbetriebe<br />
John Philipp Siegel<br />
Strategisches Management wird zunehmend auch im öffentlichen Sektor bedeuts<strong>am</strong>.<br />
Durch Dezentralisierung entstehen Entscheidungs- und Handlungsspielräume, die<br />
den Einbezug langfristiger Entwicklungsziele in die Managementsysteme ermöglichen.<br />
Die durch NPM gegebenen Möglichkeiten erfordern aber auch eine Kombination<br />
von strategischer Steuerung und Corporate Governance.<br />
Der Staat muss als Eigentümer von Unternehmungen Strategien<br />
entwickeln und umsetzen, die ihm eine bewusste,<br />
an strategischen Zielen orientierte und wirkungsvolle<br />
Steuerung der Staatsbetriebe ermöglichen.<br />
• Zweckorientierte Ziele bestimmen Leistungen oder Wirkungen,<br />
welche zur Erreichung politischer Ziele bzw.<br />
zur Versorgung der Allgemeinheit notwendig sind und<br />
die durch das Unternehmen hergestellt werden sollen.<br />
• Finanzielle Ziele orientieren sich an der Notwendigkeit,<br />
Risiken für die Staatsrechnung zu begrenzen, auszuschliessen<br />
oder eine Rendite zu erwirtschaften.<br />
• Kundenorientierte Ziele bestimmen Ziele, welche die<br />
Zufriedenheit der Abnehmer mit den Leistungen betreffen.<br />
• Mitarbeiterorientierte Ziele sollen die langfristige Entwicklung<br />
der Schlüsselressource Personal sicherstellen<br />
und die Interessen der Mitarbeitenden berücksichtigen.<br />
Die Eigentümerstrategie macht diese Ziele bewusst und für<br />
die Unternehmung verbindlich.<br />
Darüber hinaus beinhaltet sie Regelungen zur Durchsetzung<br />
bzw. Kontrolle dieser Ziele, indem Steuerungsstrukturen<br />
und -prozesse bestimmt werden. Allerdings ist es<br />
notwendig, dem Staatsbetrieb Spielräume zur Entwicklung<br />
der Unternehmensstrategie zu lassen. Eigentümer- und Unternehmensstrategie<br />
sind nicht identisch. Vielmehr bestimmt<br />
die Eigentümerstrategie die staatlichen Vorgaben,<br />
an denen sich die Unternehmensstrategie ausrichten muss.<br />
Dazu ist Klarheit notwendig, d.h. auch Politik und Verwaltung<br />
müssen in ihrer Rolle als Eigentümer nachvollziehbar<br />
festlegen, was sie mit dem Staatsbetrieb erreichen wollen.<br />
Wie diese Ziele erreicht werden, bleibt dann weitgehend<br />
in der Verantwortung der Unternehmung und deren Management<br />
als wichtigste Aufgabe.<br />
Die Ziele des Staates als Eigentümer und als Leistungseinkäufer<br />
können sich dabei durchaus widersprechen:<br />
Eigentlich müsste der Staat «seine» Unternehmung bei der<br />
Vergabe von Aufträgen bevorzugen, um ihre Erlöse zu steigern.<br />
Andererseits sollte er vor allem Qualität, Preis und<br />
Sicherheit der Leistungserbringung zu zentralen Entscheidungskriterien<br />
machen. Der Staat ist mit der Eigentümerstrategie<br />
gefordert, diesbezüglich einen Grundsatzentscheid<br />
zu treffen, nämlich ob er die Unternehmung<br />
tatsächlich (schrittweise) dem «rauhen Wind des Wettbewerbs»<br />
aussetzen oder sie in einer Schutzzone bewahren<br />
will – mit Einbussen bei der Effizienz. Auch ordnungspolitische<br />
Argumente sind in der Eigentümerstrategie zu<br />
berücksichtigen.<br />
Im Unterschied zu nichtstaatlichen Investoren müssen stets<br />
auch politische Aspekte in die Strategieentwicklung einbezogen<br />
werden. Dazu gehört etwa die Rolle als Arbeitgeber<br />
oder auch eine Corporate Governance, welche eine verantwortungsvolle<br />
Verwendung öffentlicher Mittel und die<br />
Versorgung der Gesellschaft mit öffentlichen Gütern garantiert.<br />
Das Management der Eigentümerstrategie ist insofern<br />
immer auch ökonomisches und politisches Risikomanagement.<br />
Die Komplexität der Strategieentwicklung und<br />
–implementation ist dabei ebenso wenig zu unterschätzen<br />
wie die Folgen einer unzureichenden Auseinandersetzung<br />
mit einzelnen Komponenten der Eigentümerstrategie. Die<br />
Zieldefinition der Eigentümer muss stets in ein System strategischen<br />
Controllings integriert werden, wenn eine wirkungsvolle<br />
Steuerung tatsächlich erreicht werden soll.<br />
John Philipp Siegel, Dipl.-Verw.-Wiss.<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
john-philipp.siegel@unisg.ch<br />
Evaluation<br />
Formulierung<br />
Implementation<br />
Eigentümerstrategie<br />
• folgt der politischen Rationalität<br />
• zielt auf Zweckbestimmung, Zieldefinition und<br />
Legitimität<br />
Evaluation<br />
Formulierung<br />
Unternehmensstrategie<br />
• folgt der Management-Rationalität<br />
• zielt auf Zweckbestimmung, Zielerreichung und<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Implementation<br />
17
Moral Hazard bei Leistungsvereinbarungen im Verkehrsbereich –<br />
Explodieren die Transaktionskosten?<br />
Renato Fasciati<br />
Asymmetrische Information als Grundvoraussetzung von Principal Agent-Problemen<br />
und daraus entstehende Transaktionskosten bestehen grundsätzlich in allen<br />
Auftragsverhältnissen. Es stellt sich nun aber die Frage, ob durch den Systemwechsel<br />
hin zu Ausschreibungen und Wettbewerb im schweizerischen Regionalverkehr<br />
die Transaktionskosten stark angestiegen sind. Der vorliegende Artikel untersucht<br />
das Ausmass der Transaktionskosten- und Principal-Agent-Probleme im Verkehrsbereich<br />
und entwickelt mögliche Lösungsansätze.<br />
Die <strong>am</strong> 1. Januar 1999 in Kraft getretene 1. Etappe der<br />
Bahnreform brachte in der Schweiz zwei gewichtige Änderungen<br />
im Regionalverkehr. Zum einen wechselte die<br />
Verantwortung der Bestellung von Transportleistungen<br />
vom Bund zu den Kantonen und zum anderen wurde mit<br />
dem System von Ausschreibungen Wettbewerb im Regionalverkehr<br />
eingeführt.<br />
Mit dem neuen System änderte auch das Finanzierungsverfahren.<br />
Anstelle der nachträglichen Defizitdeckung<br />
werden nun das Angebot sowie die Abgeltung von öffentlichen<br />
Transportleistungen im voraus mittels Leistungsaufträgen<br />
und -vereinbarungen zwischen Kantonen<br />
und Transportunternehmen festgelegt. Dabei kann zeitlich<br />
zwischen dem Bestellverfahren und der Vertragsumsetzung<br />
unterschieden werden.<br />
Principal-Agent-Probleme<br />
Das Auftragsverhältnis schafft ein typisches Principal-<br />
Agent- und im speziellen ein Moral-Hazard-Problem (moralisches<br />
Wagnis). Unterschiedliche Interessen zwischen<br />
Auftraggeber und Auftragnehmer führen bei ungleicher<br />
Informationsverteilung zu einem suboptimalen Ergebnis.<br />
Mit anderen Worten besteht die Gefahr, dass sich die<br />
Transportunternehmung nicht im Sinne des Kantons bzw.<br />
Leistungsbestellers verhält, da dieser nicht alle Handlungen<br />
des Agenten beobachten kann.<br />
Eine beim Bund, den Kantonen und verschiedenen<br />
Transportunternehmen durchgeführte Expertenumfrage<br />
zeigte bezüglich der Principal-Agent- bzw. Moral-Hazard-<br />
Problematik in der Vertragsumsetzung den grössten<br />
Handlungsbedarf auf. Die Vernachlässigung von Qualität<br />
und Sicherheit, fehlende erlössteigernde Massnahmen sowie<br />
mangelnde Innovationen des Betreibers stellen dabei<br />
die grössten Herausforderungen dar.<br />
Transaktionskosten<br />
Transaktionskosten bezeichnen spezifische Kosten bei der<br />
Etablierung, Durchführung und Kontrolle von Tauschvereinbarungen<br />
bzw. Verträgen. Je nach Organisationsform<br />
der wirtschaftlichen Tätigkeit fallen unterschiedliche<br />
Transaktionskosten an. Deshalb spielen in der Transaktionskostenanalyse<br />
weniger die absoluten als vielmehr die<br />
relativen Kosten und d<strong>am</strong>it der Vergleich unterschiedlicher<br />
Verfahren oder Vertragsarten (wie z.B. Leistungsaufträge)<br />
eine Rolle. Vorzuziehen ist dabei die Organisationsform,<br />
die <strong>am</strong> wenigsten Transaktionskosten verursacht.<br />
Im Bereich von Leistungsaufträgen im öffentlichen Verkehr<br />
fallen an unterschiedlichen Stellen Transaktionskosten<br />
an. Auf der einen Seite entstehen Kosten aus dem<br />
Verfahren an sich – z.B. dem Bestellverfahren –, und auf<br />
der anderen Seite verursacht die Reduzierung von Principal-Agent-Problemen<br />
zusätzliche Kosten.<br />
Die grössten Transaktionskosten im Bestellverfahren konnten<br />
gemäss Expertenumfrage in den Bereichen Bestellerkoordination,<br />
Fahrplanverfahren, Leistungsdefinition sowie in<br />
der Ausschreibung, der Kalkulation und Offertenerstellung<br />
identifiziert werden. Bei der Vertragsumsetzung – wo die<br />
Moral-Hazard-Probleme wie oben beschrieben <strong>am</strong> grössten<br />
sind – hat die Untersuchung jedoch keine grossen Kosten<br />
bzw. Kostenveränderungen ergeben. Die Hypothese explodierender<br />
Transaktionskosten aufgrund Moral-Hazard-<br />
Problemen kann deshalb nicht erhärtet werden.<br />
Ein gewichtiger Treiber von Transaktionskosten im Bestellverfahren<br />
stellt die Häufigkeit von Ausschreibungen<br />
dar. Während allein die Möglichkeit von Ausschreibungen<br />
von öffentlichen Transportleistungen gemäss allen<br />
Befragten positive Einflüsse auf die Qualität, Innovation<br />
und das Kostenbewusstsein der Betreiber hat, bewirken<br />
zu häufige Ausschreibungen enorme Unsicherheiten und<br />
Transaktionskosten bei allen Beteiligten. Es gilt somit die<br />
optimale Vertragsdauer bis zur nächsten Ausschreibung<br />
zu bestimmen, die von den Experten mit ca. sechs Jahren<br />
angegeben wurde.<br />
Lösungsansätze<br />
Wie können nun im Verkehrsbereich Principal-Agent-Probleme<br />
bekämpft sowie Transaktionskosten reduziert werden?<br />
In der zugrunde liegenden Diplomarbeit wurden<br />
verschiedene Lösungsansätze entwickelt und von den Experten<br />
in Bezug auf Wirks<strong>am</strong>keit und Umsetzbarkeit hin<br />
geprüft.<br />
Die erfolgsversprechendsten Instrumente zur Bekämpfung<br />
der Principal-Agent- bzw. Moral-Hazard-Probleme<br />
sind dabei die Positionierung des Erlösrisikos beim<br />
Transportunternehmer, ein Benchmarking, ein Bonus-Malus-System<br />
zur Qualitätskontrolle sowie unabhängige Zufriedenheitsmessungen.<br />
Renato Fasciati, lic. oec. HSG<br />
Renato_Fasciati@mckinsey.com<br />
18
Steigende Bekanntheit des CE eGov<br />
Lukas Summermatter<br />
Der Webauftritt des Center of Excellence for Electronic Government wird laufend<br />
verbessert und ausgebaut. Die Bemühungen haben dazu geführt, dass sich die Website<br />
www.electronic-government.org zu einer international anerkannten Quelle für<br />
Informationen rund ums Thema E-Government entwickelt hat.<br />
Das Center of Excellence for Electronic Government (CE<br />
eGov) 1<br />
ist bestrebt, umfassend und aktuell über Forschung<br />
und Praxis im Bereich E-Government zu informieren.<br />
Neben eigenen Publikationen werden auch Studien<br />
und Berichte von anderen Forschungseinrichtungen<br />
ges<strong>am</strong>melt und thematisch geordnet abgelegt. Neu aufgebaut<br />
wird derzeit eine Projekt- und Pressedatenbank<br />
für die Schweiz. Die Projektdatenbank soll einen Überblick<br />
über die in der Schweiz laufenden E-Government-<br />
Projekte sowohl auf kommunaler und kantonaler als auch<br />
auf nationaler Ebene bieten.<br />
Starting Point für E-Government<br />
Die grossen Bemühungen um eine aktuelle und informative<br />
Website für Wissenschaftler, Praktiker und Studenten<br />
tragen erste Früchte. Steven Clift, ein international bekannter<br />
Online-Stratege, der mit seinem Democracies Online<br />
Newswire 2 laufend über aktuelle Geschehnisse rund<br />
um E-Democracy berichtet, hat die Website des CE eGov<br />
auf der Liste der E-Democracy Resources 3 als einer von 14<br />
E-Democracy Starting Points aufgeführt.<br />
pieren aus der Schweiz und dem Ausland wird darin untersucht,<br />
welches die Auslöser und Treiber des E-Government<br />
sind.<br />
Im Spätherbst wird das Buch «Electronic Government einführen<br />
und entwickeln: Von der Idee zur Praxis» 6<br />
im<br />
Haupt-Verlag erscheinen. Auf Basis eines umfassenden<br />
Konzepts bietet es Orientierungswissen und Werkzeuge<br />
für ein erfolgreiches Management von E-Government Aktivitäten.<br />
Dabei stehen Themen der Verwaltungsführung<br />
wie Strategie, Strukturen und Kultur im Vordergrund. Speziell<br />
wird auf Fragen der Einführung von E-Government<br />
und den Zus<strong>am</strong>menhang zu anderen Reformvorhaben<br />
eingegangen. Mit einer Selbstevaluation können bestehende<br />
Defizite identifiziert und Anregungen für eine Weiterentwicklung<br />
abgeleitet werden.<br />
Lukas Summermatter, lic. oec. HSG<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
lukas.summermatter@unisg.ch<br />
Aufnahme in den SOSIG<br />
Weiter wurde die Website des CE eGov in den Social<br />
Science Information Gateway (SOSIG) 4<br />
aufgenommen.<br />
Der SOSIG ist ein frei zugänglicher Internet-Service, welcher<br />
als zuverlässige Quelle von qualitativ hochwertigen<br />
Internet-Informationen für Studenten, Wissenschaftler<br />
und Praktiker in den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften<br />
dient. Jede Quelle im SOSIG wird von international<br />
anerkannten Wissenschaftlern und Bibliothekaren<br />
ausgesucht und beschrieben. Betrieben wird der<br />
SOSIG von der University of Bristol mit Unterstützung<br />
n<strong>am</strong>hafter <strong>Institut</strong>ionen wie der British Library of Political<br />
and Economic Science (Bibliothek der London School of<br />
Economics).<br />
Neue Publikationen<br />
Zwei neue Publikationen zum Thema E-Government erscheinen<br />
demnächst: Im Buch zum 2. Schweizer E-Government<br />
Symposium erscheint ein Beitrag mit dem Titel<br />
«Was treibt das E-Government?» 5 . Anhand von Strategiepa-<br />
1<br />
http://www.electronic-government.org<br />
2<br />
http://www. http://www.e-democracy.org/do/<br />
3<br />
http://www.publicus.net/articles/edemresources.html<br />
4<br />
http://www.sosig.ac.uk ist Bestandteil des Resource Discovery Network (http://www.rdn.ac.uk)<br />
5<br />
SCHEDLER, K. und SUMMERMATTER, L. (<strong>2002</strong>) Was treibt das E-Government? in Dieter Spahni (Hrsg.)<br />
eGovernment 2: Perspektiven und Prognosen. Bern: Haupt. Erscheint Ende September <strong>2002</strong><br />
6<br />
SCHEDLER, K., SUMMERMATTER, L. und SCHMIDT, B. (forthcoming) Electronic Government einführen<br />
entwickeln: Von der Idee zur Praxis. Bern: Haupt. Erscheint im Spätherbst <strong>2002</strong><br />
19
Jahrbücher 2001/<strong>2002</strong> – Bestellen Sie schnell und einfach per Fax<br />
Jahrbuch der schweizerischen Tourismuswirtschaft<br />
Beiträge<br />
Christian Baumgartner: Bewertungsschema für Nachhaltigkeit<br />
in touristischen Destinationen<br />
Pietro Beritelli/Ulrike Kuhnhenn: Erwartungen und Herausforderungen<br />
bei der Entwicklung von 3D-Destinationen<br />
Thomas Bieger/Christian Laesser/Patrick Caspar: Branchenmobilität<br />
von Kadermitarbeitern. Das Fallbeispiel Tourismus<br />
Thomas Bieger/Thomas von Rohr: Das Konzept Geschäftsmodell<br />
als neue strategische Planungseinheit im Tourismus<br />
Thomas Bieger/Roland Scherer/Simone Strauf: Die wirtschaftlichen<br />
Effekte von Kulturevents: Das Beispiel Lucerne<br />
Festival<br />
Anne Chesaux: Unternehmensbewertung in der Hotellerie<br />
Axel Dreyer: Vermarktung von Destinationen mit Events<br />
Martin Eltschinger: Finanzielles Rechnungswesen in der<br />
Hotellerie<br />
Matthias Fuchs: Destinationsbenchmarking – Theoretische<br />
und methodologische Fragestellungen<br />
Klaus Grabler: Das Benchmarking – System der österreichischen<br />
Seilbahnwirtschaft<br />
Christian Hanser/Peder Plaz: Service Providing – Strategie<br />
zur Stärkung der Innovations- und Investitionskraft von Bergbahnen<br />
Peter Keller: Touristische Wachstumsstrategien –<br />
Kann der Tourismus in entwickelten Volkswirtschaften ein<br />
strategischer Wirtschaftssektor sein?<br />
Peter Keller: Innovation und Tourismus<br />
Karl Koch: Marktstruktur, Finanzierungsprobleme und staatliche<br />
Förderung in der Hotellerie<br />
Gottfried F. Künzi: Neues Ferienwohnungs-Klassifikations-<br />
System der Schweiz<br />
Hansruedi Müller: Grundlagen zu einem touristischen Berufsbildungskonzept<br />
Hansruedi Müller/Fabian Schmid: Auf dem Weg zu einem<br />
Tourismusbarometer<br />
Harald Pechlaner: Aufgaben einer Tourismusorganisation <strong>am</strong><br />
Beispiel Tirol Werbung<br />
Mike Peters/Klaus Weiermair: Innovation und Innovationsverhalten<br />
im Tourismus<br />
Karl Wöber: Informationsbedürfnisse und Informationsversorgung<br />
im Tourismusmanagement<br />
TOURISMUSCHRONIK, VERÖFFENTLICHUNGEN<br />
❑ Bestellung gegen Rechnung<br />
zum Preis von Fr. 52.– (Förderer: Fr. 40.–)<br />
+ Verpackung und Porto<br />
❑ Ich möchte in Zukunft dieses Jahrbuch unaufgefordert<br />
(bis auf Widerruf) erhalten.<br />
N<strong>am</strong>e:<br />
Jahrbuch der schweizerischen Verkehrswirtschaft<br />
Beiträge<br />
Thomas Bieger/Kuno Schedler: Falken und Spatzen im<br />
Markt der (halb)öffentlichen Leistungen – Der «Service Public»<br />
als international hart umkämpftes Geschäft<br />
Max Friedli/Oliver Washington: Finanzierung des öffentlichen<br />
Verkehrs<br />
Florian Gubler/Felix Walter: Nachhaltigkeitsbeurteilung von<br />
Strasseninfrastrukturprojekten<br />
Franz Hermann/Christian Laesser/Markus Schwaninger:<br />
Mediationsverfahren bei Verkehrs-Grossprojekten – Beobachtungen<br />
und Erfahrungen <strong>am</strong> Fallbeispiel «Gasteinertal»<br />
Carl F. Hidber: Mailand und Zürich, die ersten Metropolen<br />
südlich und nördlich der Alpen (ein Vergleich der Verkehrssysteme)<br />
Claude Kaspar: Schweizerische Gesellschaft – Forum des<br />
Schweizer Verkehrs – Aus der Tätigkeit im Jahr 2001<br />
Hans Koller: Das Verbandsbeschwerderecht – ein künftiges<br />
Instrument im Dienst der nachhaltigen Entwicklung<br />
Sepp Moser: Nach dem Swissair-Debakel: Mutige Lösungen<br />
oder Realitätsverweigerung?<br />
Armin Schmutzler: Zur Akzeptanz der Umwelt- und Verkehrspolitik<br />
Bemerkungen aus ökonomischer Sicht<br />
Hans Kaspar Schiesser/Peter Vollmer: Der öffentliche Verkehr<br />
im Jahre 2020 – Prognose und Vision<br />
Ulrich Seewer: Immer mehr, immer weiter, immer länger –<br />
Ergebnisse des Mikrozensus Verkehrsverhalten 2000<br />
Hans Werder: Herausforderungen der schweizerischen Verkehrspolitik<br />
Rudolf Zumbühl: Die möglichen Auswirkungen eines Ausbaus<br />
der Strasseninfrastruktur auf die Verkehrsnachfrage<br />
VERKEHRSCHRONIK<br />
❑ Bestellung gegen Rechnung<br />
zum Preis von Fr. 52.– (Förderer: Fr. 40.–)<br />
+ Verpackung und Porto<br />
❑ Ich möchte in Zukunft dieses Jahrbuch unaufgefordert<br />
(bis auf Widerruf) erhalten.<br />
Vorn<strong>am</strong>e:<br />
evtl. <strong>Institut</strong>ion/Unternehmung:<br />
Anschrift:<br />
Datum:<br />
PLZ/Ort:<br />
Unterschrift:<br />
Fax an: 0041-71-224 25 36 oder per Post an: IDT-HSG, Varnbüelstrasse 19, 9000 St.Gallen<br />
20
Kurzmitteilungen aus dem <strong>Institut</strong><br />
Seminar für Verwaltungsmanagement 2003<br />
Das Executive Seminar für Verwaltungsmanagement –<br />
ein Lehrgang mit Zertifikat für alle Führungskräfte im öffentlichen<br />
Bereich<br />
Bereits zum 5. Mal wird das Seminar für Verwaltungsmanagement<br />
durchgeführt. Wie führe ich meine Verwaltungseinheit<br />
erfolgreich im Wandel? Welches Potenzial<br />
besitzen meine Mitarbeitenden? Wie nutze ich Controlling<br />
und Management-Information effizient? Wie stelle<br />
ich die Qualität sicher? Auf diese und weitere Fragen aus<br />
der Verwaltungspraxis gibt Ihnen das mehrfach bewährte<br />
Executive Seminar für Verwaltungsmanagement praktische<br />
Antworten. Zahlreiche ausgewiesene Experten aus<br />
Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft vermitteln<br />
Ihnen auf anschauliche Art und Weise, wie Sie sich<br />
und Ihrem Te<strong>am</strong> den Erfolg in der Verwaltungspraxis ermöglichen.<br />
Daten: 13.3.-15.3.03/10.4.-12.4.03/8.5.-10.5.03/<br />
26.6.-28.6.03/13.11.-15.11.03<br />
Weitere Auskünfte gibt Ihnen: martin.koci@unisg.ch,<br />
Tel. 071 224 25 39<br />
Seminar für Kosten-Leistungsrechnung in öffentlichen<br />
<strong>Institut</strong>ionen 2003<br />
Bereits zum 3. Mal wird das Seminar für Verwaltungsmanagement<br />
durchgeführt. Bei der Konzeption von Systemen<br />
zur Kosten-Leistungsrechnung stellen sich in der<br />
Praxis schnell Fragen wie: Soll ein Teilkosten- oder ein<br />
Vollkostensystem gewählt werden? Auf welche Stolpersteine<br />
muss bei der Einführung besonders geachtet werden?<br />
etc.<br />
Das praxisorientierte Seminar ist spezifisch ausgerichtet<br />
für Führungskräfte und deren Finanzfachleute von öffentlichen<br />
<strong>Institut</strong>ionen. Die Teilnehmenden erstellen im<br />
zweiteiligen Seminar unter Anleitung der Referenten ihr<br />
individuelles Konzept zur Kosten-Leistungsrechnung.<br />
Daten: 22.4-25.4.03/11.6.-12.6.03<br />
Weitere Auskünfte gibt Ihnen:<br />
bernhard.knechtenhofer@unisg.ch, Tel. 071 224 25 18<br />
Public Management Newsletter<br />
Sind Sie über die aktuellen Entwicklungen über<br />
Reformen und Initiativen im Verwaltungsmanagement informiert?<br />
Dann profitieren Sie von unserem neuen,<br />
kostenlosen Service unseres Public Management Centers<br />
of Excellence. Wir lesen für Sie die Zeitungen und<br />
informieren Sie einmal im Monat per E-Mail über die<br />
neuesten Entwicklungen in der Schweiz. Abonnieren<br />
Sie unseren gratis Newsletter auf der Homepage:<br />
http://coc.idt.unisg.ch<br />
Public Management Center of Excellence<br />
Diese Homepage bietet eine umfassende Literatur- und<br />
Linkliste zu aktuellen NPM-Themen wie zum Beispiel<br />
laufende WoV-Projekte in der Schweiz, usw.<br />
http://coc.idt.unisg.ch<br />
Electronic Government Center of Excellence<br />
Der Begriff «Electronic Government» verbreitet sich auch<br />
in der Schweiz immer schneller. Eines der Hauptziele des<br />
Electronic Government Centers of Excellence ist es daher,<br />
möglichst umfassende Informationen zum Thema<br />
eGovernment anzubieten. Das Zentrum ist als virtuelles<br />
Netzwerk konzipiert, das objektive, anwendungsorientierte<br />
Forschung im Bereich eGovernment durchführt,<br />
und dessen Ergebnisse an Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft<br />
und Forschung gerichtet sind.<br />
http://www.electronic-government.org<br />
Seminar für Dienstleistungsmanagement von Februar<br />
bis November 2003<br />
Bereits zum fünften Mal wird der Kurs «Dienstleistungsmanagement»<br />
durchgeführt, welcher von unserem<br />
<strong>Institut</strong> zus<strong>am</strong>men mit dem IGW-HSG und dem I.VW-<br />
HSG angeboten wird.<br />
Weitere Auskünfte gibt Ihnen:<br />
andreas.liebrich@unisg.ch, Tel. 071 224 25 27<br />
Daten: 1. Modul 28.2./1.3.03, 2. Modul 9./10.5.03,<br />
3. Modul 13./14.6.03, 4. Modul 26./27.9.03,<br />
5. Modul 14./15.11.03<br />
Neues Buch zum Thema Clustering als Strategie der<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Clustering ist ohne Zweifel eines der aktuellen «Zauberwörter»<br />
der Wirtschaftsförderung. Nach dem heutigen<br />
Verständnis hängt die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes<br />
zu grossen Teilen davon ab, wie er Wissen generieren,<br />
verbreiten und nutzen kann. Die Cluster sind dabei<br />
die Basis dieses Wissensaustausches. Die Autoren des<br />
Bandes waren grossteils zu Gast auf der letztjährigen<br />
IDT-Tagung zum Clustering. Die Beiträge sowohl aus der<br />
Praxis des Clusterings als auch aus wissenschaftlicher<br />
Sicht wurden mit einigen interessanten Artikeln über<br />
Wirtschaftscluster in der Schweiz ergänzt. Die Autoren<br />
schildern anschaulich, wie sich die Netzwerke aus Unternehmen,<br />
ihren Lieferanten und Kunden sowie Wissensorganisationen<br />
und öffentlichen <strong>Institut</strong>ionen innerhalb<br />
eines bestimmten Raumes bilden – und mit welchen<br />
Strategien und Mitteln man diese Vernetzung fördern<br />
kann. Das Buch wirft Licht auf die Frage, ob und wie die<br />
erhofften Effekte des Clusterings wirklich auftreten und<br />
wie erfolgreich sich Clusterstrategien in der Praxis erweisen.<br />
Scherer, R. & Bieger, T. (<strong>2002</strong>): Clustering – Zauberwort<br />
der Wirtschaftsförderung. Beiträge zur Regionalwirtschaft<br />
Bd. 5, Schriftenreihe des IDT-HSG, Haupt-Verlag, Bern<br />
(im Erscheinen).<br />
21
Gesellschaft zur Förderung des <strong>Institut</strong>s für Öffentliche<br />
Dienstleistungen und Tourismus<br />
Unter der Bezeichnung «Gesellschaft zur Förderung des <strong>Institut</strong>s für Öffentliche Dienstleistungen und<br />
Tourismus, Universität St.Gallen» (nachfolgend Gesellschaft genannt) besteht mit<br />
Sitz in St.Gallen ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.<br />
Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die Tätigkeiten des <strong>Institut</strong>s für Öffentliche Dienstleistungen und<br />
Tourismus; IDT-HSG, Universität St.Gallen (nachfolgend <strong>Institut</strong> genannt) in den<br />
Kompetenzfeldern Tourismus, Verkehr, Regionalwirtschaft, Öffentliches Management, zu<br />
fördern und finanziell zu unterstützen.<br />
Durch Ihren Beitritt<br />
– gehören Sie zu einem Netzwerk der an unseren Spezialgebieten interessierten Personen<br />
und <strong>Institut</strong>ionen<br />
– sind Sie immer <strong>am</strong> Puls der neuesten Entwicklungen<br />
– stellen Sie qualitativ hochstehende Forschung in diesen Bereichen sicher<br />
Verwendung Ihrer Mitgliederbeiträge<br />
– Grundlagenforschung im Interesse der beteiligten Branchen<br />
– Gewährleistung der Finanzierung von Aktivitäten, die nicht durch staatliche Mittel<br />
abgedeckt sind (z.B. Bibliothek/Dokumentation, Informationstätigkeit)<br />
Ihre Vorteile<br />
– Regelmässige Information über die <strong>Institut</strong>saktivitäten, u.a. durch unser zweimal jährlich erscheinendes<br />
«IDT Blickpunkte», Tagungen und Weiterbildungen<br />
– Publikationen zu Vorzugspreisen<br />
– Teilnahme an jährlich mindestens zwei Tagungen des <strong>Institut</strong>s zu ermässigten Preisen<br />
– Besuch von Weiterbildungsseminaren zu Vorzugspreisen und/oder bevorzugte Anmeldung<br />
– Die Möglichkeit, «Discussion Papers» des <strong>Institut</strong>s zu Vorzugspreisen zu bestellen<br />
(CHF 10.– pro Exemplar)<br />
– Beratung bei der Benützung unserer Bibliothek<br />
– Jahresvers<strong>am</strong>mlung als gesellschaftliches Get Together des Tourismus, der Verkehrswirtschaft,<br />
der Regionalwirtschaft und des Öffentlichen Managements.<br />
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Simone Vonaesch, IDT-HSG<br />
E-Mail: simone.vonaesch@unisg.ch