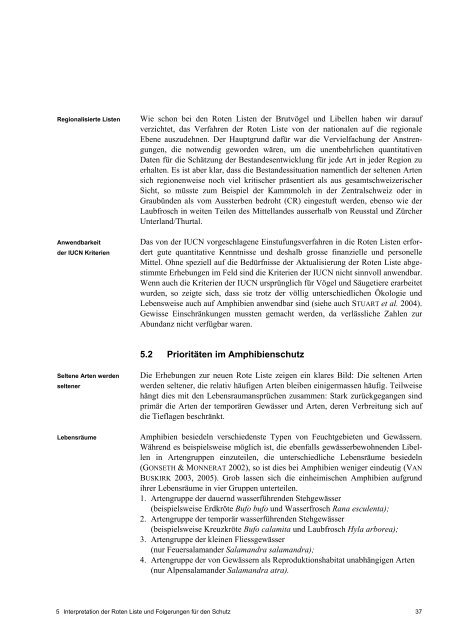Rote Liste der gefährdeten Amphibien der Schweiz 2005 - Karch
Rote Liste der gefährdeten Amphibien der Schweiz 2005 - Karch
Rote Liste der gefährdeten Amphibien der Schweiz 2005 - Karch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Regionalisierte <strong>Liste</strong>n<br />
Anwendbarkeit<br />
<strong>der</strong> IUCN Kriterien<br />
Wie schon bei den <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong>n <strong>der</strong> Brutvögel und Libellen haben wir darauf<br />
verzichtet, das Verfahren <strong>der</strong> <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong> von <strong>der</strong> nationalen auf die regionale<br />
Ebene auszudehnen. Der Hauptgrund dafür war die Vervielfachung <strong>der</strong> Anstrengungen,<br />
die notwendig geworden wären, um die unentbehrlichen quantitativen<br />
Daten für die Schätzung <strong>der</strong> Bestandesentwicklung für jede Art in je<strong>der</strong> Region zu<br />
erhalten. Es ist aber klar, dass die Bestandessituation namentlich <strong>der</strong> seltenen Arten<br />
sich regionenweise noch viel kritischer präsentiert als aus gesamtschweizerischer<br />
Sicht, so müsste zum Beispiel <strong>der</strong> Kammmolch in <strong>der</strong> Zentralschweiz o<strong>der</strong> in<br />
Graubünden als vom Aussterben bedroht (CR) eingestuft werden, ebenso wie <strong>der</strong><br />
Laubfrosch in weiten Teilen des Mittellandes ausserhalb von Reusstal und Zürcher<br />
Unterland/Thurtal.<br />
Das von <strong>der</strong> IUCN vorgeschlagene Einstufungsverfahren in die <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong>n erfor<strong>der</strong>t<br />
gute quantitative Kenntnisse und deshalb grosse finanzielle und personelle<br />
Mittel. Ohne speziell auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Aktualisierung <strong>der</strong> <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong> abgestimmte<br />
Erhebungen im Feld sind die Kriterien <strong>der</strong> IUCN nicht sinnvoll anwendbar.<br />
Wenn auch die Kriterien <strong>der</strong> IUCN ursprünglich für Vögel und Säugetiere erarbeitet<br />
wurden, so zeigte sich, dass sie trotz <strong>der</strong> völlig unterschiedlichen Ökologie und<br />
Lebensweise auch auf <strong>Amphibien</strong> anwendbar sind (siehe auch STUART et al. 2004).<br />
Gewisse Einschränkungen mussten gemacht werden, da verlässliche Zahlen zur<br />
Abundanz nicht verfügbar waren.<br />
5.2 Prioritäten im <strong>Amphibien</strong>schutz<br />
Seltene Arten werden<br />
seltener<br />
Lebensräume<br />
Die Erhebungen zur neuen <strong>Rote</strong> <strong>Liste</strong> zeigen ein klares Bild: Die seltenen Arten<br />
werden seltener, die relativ häufigen Arten bleiben einigermassen häufig. Teilweise<br />
hängt dies mit den Lebensraumansprüchen zusammen: Stark zurückgegangen sind<br />
primär die Arten <strong>der</strong> temporären Gewässer und Arten, <strong>der</strong>en Verbreitung sich auf<br />
die Tieflagen beschränkt.<br />
<strong>Amphibien</strong> besiedeln verschiedenste Typen von Feuchtgebieten und Gewässern.<br />
Während es beispielsweise möglich ist, die ebenfalls gewässerbewohnenden Libellen<br />
in Artengruppen einzuteilen, die unterschiedliche Lebensräume besiedeln<br />
(GONSETH & MONNERAT 2002), so ist dies bei <strong>Amphibien</strong> weniger eindeutig (VAN<br />
BUSKIRK 2003, <strong>2005</strong>). Grob lassen sich die einheimischen <strong>Amphibien</strong> aufgrund<br />
ihrer Lebensräume in vier Gruppen unterteilen.<br />
1. Artengruppe <strong>der</strong> dauernd wasserführenden Stehgewässer<br />
(beispielsweise Erdkröte Bufo bufo und Wasserfrosch Rana esculenta);<br />
2. Artengruppe <strong>der</strong> temporär wasserführenden Stehgewässer<br />
(beispielsweise Kreuzkröte Bufo calamita und Laubfrosch Hyla arborea);<br />
3. Artengruppe <strong>der</strong> kleinen Fliessgewässer<br />
(nur Feuersalaman<strong>der</strong> Salamandra salamandra);<br />
4. Artengruppe <strong>der</strong> von Gewässern als Reproduktionshabitat unabhängigen Arten<br />
(nur Alpensalaman<strong>der</strong> Salamandra atra).<br />
5 Interpretation <strong>der</strong> <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong> und Folgerungen für den Schutz 37