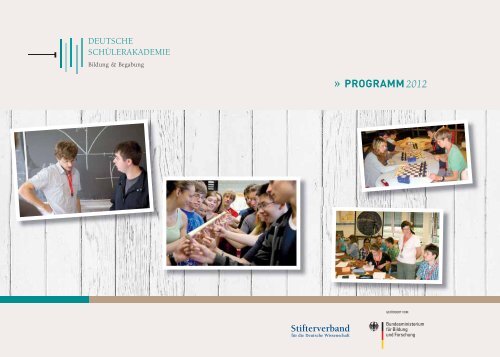DSA Programm 2012 - Deutsche SchülerAkademie
DSA Programm 2012 - Deutsche SchülerAkademie
DSA Programm 2012 - Deutsche SchülerAkademie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
» PROGRAMM <strong>2012</strong>
IMPRESSUM<br />
Redaktion: Volker Brandt, Jürgen Klein, Christiane Kunze<br />
Bei den Abbildungen handelt es sich, sofern nicht anders angegeben, um<br />
Abbildungen, die während der Akademien des letzten Jahres an den verschiedenen<br />
Standorten von Kursleitenden und Teilnehmenden erstellt wurden.<br />
© <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong><br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong><br />
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH<br />
Kortrijker Str. 1, 53177 Bonn<br />
Tel.: 0228 - 95915-40<br />
Fax: 0228 - 95915-49<br />
Web: www.deutsche-schuelerakademie.de<br />
E-Mail: info@deutsche-schuelerakademie.de<br />
Papenburg (5. bis 14. August <strong>2012</strong>)<br />
Papenburg (17. bis 26. August <strong>2012</strong>)<br />
Hilden (26. Juli bis 11. August <strong>2012</strong>)<br />
Rostock (28. Juni bis 14. Juli <strong>2012</strong>)<br />
Braunschweig I (26. Juli bis 11. August <strong>2012</strong>)<br />
Braunschweig II (16. August bis 1. September <strong>2012</strong>)<br />
Grovesmühle (2. bis 18. August <strong>2012</strong>)<br />
Urspring (2. bis 18. August <strong>2012</strong>)<br />
Torgelow (12. bis 28. Juli <strong>2012</strong>)<br />
Torgelow (2. bis 18. August <strong>2012</strong>)<br />
Waldenburg (9. bis 25. August <strong>2012</strong>)
2–3 GRUSSWORT<br />
4–15 DIE DEUTSCHE SCHÜLERAKADEMIE (<strong>DSA</strong>)<br />
16 AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I<br />
26. Juli–11. August<br />
18 – 1.1 Chaostheorie und Mandelbrotmenge<br />
19 – 1.2 Warum Blut nicht immer rot sein muss<br />
20 – 1.3 Die Ökonomik von Altruismus, Liebe und<br />
Milchkartons<br />
21 – 1.4 Tödliche Entscheidungen<br />
22 – 1.5 Zwischen Ostalgie, Verdrängung und Vergessen<br />
23 – 1.6 Die Weisheit der Pointe<br />
24 AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II<br />
16. August–1. September<br />
26 – 2.1 Simulierte Natur<br />
27 – 2.2 Kosmos und Chaos …<br />
28 – 2.3 Design Thinking<br />
29 – 2.4 Wissenschaftskommunikation<br />
30 – 2.5 Zitiert? Plagiert? Bearbeitet?<br />
31 – 2.6 Texte auf Wanderschaft<br />
32 AKADEMIE GROVESMÜHLE<br />
2.–18. August<br />
34 – 3.1 Wahrscheinlichkeiten als Sprache<br />
35 – 3.2 Warum Toast immer auf die Butterseite fällt …<br />
36 – 3.3 Die Pflanze im Klimasystem<br />
37 – 3.4 Embodiment/Verkörperlichung der<br />
Kommunikation<br />
38 – 3.5 Warum Krieg?<br />
39 – 3.6 Worauf man achten muss, wenn man tot ist<br />
40<br />
AKADEMIE URSPRING<br />
2.–18. August<br />
42 – 4.1 Abstraktion in der Mathematik<br />
43 – 4.2 Teilchenphysik mit dem ATLAS-Detektor<br />
44 – 4.3 Chemie zum Anschauen<br />
45 – 4.4 Der »Unsichtbaren Hand« auf die Finger<br />
klopfen?<br />
46 – 4.5 Einheit und Freiheit<br />
47 – 4.6 Ist Gott tot?!<br />
48 AKADEMIE HILDEN<br />
26. Juli–11. August<br />
50 – 5.1 Immer mehr und trotzdem wenig?<br />
51 – 5.2 Der metallene Mensch<br />
52 – 5.3 Auf den Spuren von Tim Berners Lee<br />
53 – 5.4 Mensch – Bürger – Staatsbürger<br />
54 – 5.5 Theorien der Gewalt<br />
55 – 5.6 Klassisch, romantisch, modern –<br />
Alles im großen Stil<br />
56 AKADEMIE ROSTOCK<br />
28. Juni–14. Juli<br />
58 – 6.1 Mathematische Anatomie des Universums<br />
59 – 6.2 Wenn das Ganze mehr ist als die Summe der<br />
einzelnen Teile<br />
60 – 6.3 Nächster Halt: Mars<br />
61 – 6.4 Das sprechende Gehirn<br />
62 – 6.5 Moral und Gerechtigkeit in modernen<br />
Gesellschaften<br />
63 – 6.6 Fremdes und Eigenes im Dokumentarfilm<br />
64 AKADEMIE TORGELOW<br />
12.–28. Juli<br />
66 – 7.1 Komplexe Analysis<br />
67 – 7.2 Sand + Sonne = Strom<br />
68 – 7.3 Perspektivenwechsel<br />
69 – 7.4 Sind Geisteskrankheiten Gehirnkrankheiten?<br />
70 – 7.5 »Auf klassischem Boden begeistert«<br />
71 – 7.6 »Weißt du, wie das wird?«<br />
72 MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW<br />
2.–18. August<br />
74 – T.1 Kombinatorische Optimierung<br />
75 – T.2 Zeitvertreib oder Vermittler?<br />
76 – T.3 Glocalize It!<br />
77 – T.4 »Urbanus vulgaris«<br />
78 MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG<br />
9.–25. August<br />
80 – W.1 Wie kommt die Sonne ins Auto?<br />
81 – W.2 Märkte spielend verstehen<br />
82 – W.3 International vergleichende Sozialpolitik<br />
83 – W.4 Macht der Medien<br />
84 DIE JGW-SCHÜLERAKADEMIEN<br />
86 JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I<br />
5.–14. August<br />
88 – JGW 1.1 Bewölkt bis bedeckt<br />
89 – JGW 1.2 Das Higgs, der LHC und Quarks<br />
90 – JGW 1.3 Schöne neue Neurowelt?<br />
91 – JGW 1.4 Eigentum in der Krise?<br />
92 – JGW 1.5 Tumulte, Tod und Trauer?<br />
93 – JGW 1.6 »Als ein Mensch dem Tod in der Geburt<br />
erkoren!«<br />
94 JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II<br />
17.–26. August<br />
96 – JGW 2.1 Von der Gaswolke bis zum Schwarzen Loch<br />
97 – JGW 2.2 Alles unter Kontrolle<br />
98 – JGW 2.3 Amnesie, Agnosie und andere Ausfälle<br />
99 – JGW 2.4 Menschenrechte in Theorie und Praxis<br />
100 – JGW 2.5 9/11: Ereignis – Wahrnehmung –<br />
Verarbeitung<br />
101 – JGW 2.6 Wie utopisch ist »Utopia«?<br />
102<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
108 CLUB DER EHEMALIGEN (CDE)<br />
109 BILDUNG & BEGABUNG GEMEINNÜTZIGE<br />
GMBH<br />
110 FÖRDERER<br />
-- 1
2 ––<br />
»Die Gesellschaft lebt davon, dass Menschen bereit sind, ihre<br />
eigenen Grenzen immer neu auszuloten und sie zu verschieben.«<br />
PROF. DR. ANNETTE SCHAVAN, MDB<br />
BUNDESMINISTERIN FÜR BILDUNG<br />
UND FORSCHUNG<br />
Die Zukunft unserer Gesellschaft liegt in unseren Händen.<br />
Gemeinsam gestalten wir das Morgen. Antworten auf die Frage, wie<br />
wir zusammenleben wollen, geben uns Philosophie und Technik,<br />
Ökologie und Religion, Sozialwissenschaften und Wirtschaft,<br />
persönliche Lebenserfahrung, theoretische Reflexion und künstlerische<br />
Vertiefung. Eine Gesellschaft, die über den Tag hinaus denkt, braucht<br />
Vordenkerinnen und Vordenker. Sie ist darauf angewiesen, dass<br />
Menschen neue Ideen entwickeln und alte Antworten in Frage stellen.<br />
Sie lebt davon, dass Menschen bereit sind, ihre eigenen Grenzen immer<br />
neu auszuloten und sie zu verschieben.<br />
Die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> bietet seit mehr als 20 Jahren begabten<br />
Jugendlichen in ganz unterschiedlichen Disziplinen ein hochkarätiges<br />
Bildungsprogramm. Genauso wichtig wie die fachlichen Inhalte, die<br />
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermittelt werden,<br />
sind die interdisziplinäre Atmosphäre und der musisch-kulturelle<br />
Rahmen der <strong>SchülerAkademie</strong>n. Die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> schafft
so einen Raum, der es begabten Jugendlichen ermöglicht, ihre Talente und ihre Persönlichkeit zu<br />
entfalten und ihren eigenen Weg zu finden.<br />
Die Förderung begabter Schülerinnen und Schüler ist der Bundesregierung ein besonderes<br />
Anliegen. Es geht um junge Menschen, die Spitzenleistungen erbringen und zugleich bereit<br />
sind, über die Grenzen von Fächern und Disziplinen hinauszuschauen und gesellschaftliche<br />
Verantwortung zu übernehmen.<br />
Mein besonderer Dank gilt den Ehrenamtlichen, Alumni und Förderern, die mit ihrem<br />
Engagement das Angebot der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> tragen. Den Schülerinnen und Schülern<br />
sowie den Kursleiterinnen und Kursleitern der Akademien <strong>2012</strong> wünsche ich eine gute Zeit und<br />
viel Erfolg!<br />
PROF. DR. ANNETTE SCHAVAN, MDB<br />
BUNDESMINISTERIN FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG<br />
–– 3
Die <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>SchülerAkademie</strong><br />
»Aber was genau ist denn eine <strong>SchülerAkademie</strong>? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt,<br />
als im Februar letzten Jahres [mein Lehrer] auf mich zukam und fragte, ob ich damit<br />
einverstanden wäre, wenn er mich für diese <strong>SchülerAkademie</strong> vorschlagen würde. Bis zu diesem<br />
Zeitpunkt hatte ich noch nie etwas davon gehört und, ohne wirklich zu wissen, um was<br />
es geht, hab ich einfach mal zugesagt und mich daraufhin für den Kurs »Vanilleschote oder<br />
lndustrieabfall?« auf der Akademie in Rostock beworben. Als ich dann einige Wochen später<br />
die Zusage erhalten habe, wusste ich allerdings nicht recht ob ich mich freuen soll oder nicht,<br />
da ich mich bei einer »Begabtenförderung« völlig fehl am Platz fühlte und Angst hatte, 16<br />
Tage mit lauter seltsamen Jugendlichen verbringen zu müssen.<br />
Diese Zweifel hielten an, bis ich mich am 7. Juli, dem ersten Akademietag, mit einer anderen<br />
Teilnehmerin am Bahnhof … getroffen habe, um mit ihr zusammen nach Rostock zu fahren.<br />
Und falls doch noch eine leichte Skepsis übrig geblieben ist, dann ist diese spätestens am<br />
Hauptbahnhof in Rostock verflogen, wo wir mitten in eine riesige Gruppe »ganz normaler«<br />
und total netter Jugendlicher geraten sind, die ebenfalls auf dem Weg zur Akademie waren.<br />
Die Atmosphäre, die sich seit unserer Ankunft in Rostock entwickelt hat, ist einfach unbeschreiblich.<br />
Sechzehn Tage lang, hatten wir dann in einer riesigen Gemeinschaft von über<br />
hundert Teilnehmern wirklich sehr viel Spaß und haben uns nebenher in den jeweiligen<br />
Kursen mit teilweise sehr komplexen wissenschaftlichen Fragen und Problemen beschäftigt<br />
und sehr viel erarbeitet, die weit über den Schulstoff hinausgehen, ja sogar bis in die ersten<br />
Semester der jeweiligen Studiengänge hineinreichen … Die nicht zu knappe Freizeit haben<br />
wir damit verbracht, Volleyball oder Fußball zu spielen, im Chor zu singen, Rostock zu<br />
erkunden … oder einfach nur zusammenzusitzen und bis spät in die Nacht zu reden. Ein<br />
Highlight der Akademie war zweifellos das Volleyballturnier, das wir Teilnehmer eigenständig<br />
organisiert haben, mit der anschließenden Akademieparty, die alle Erwartungen überstiegen<br />
hat und an die sich wohl alle Teilnehmer noch lange und gerne zurückerinnern werden, ebenso<br />
wie an das Abschlusskonzert des Chors, an den Bunten Abend und die Abschlussparty am<br />
letzten Abend.<br />
4 ––<br />
Chancen und Ziele<br />
» Zwischen Schule und Universität eine Brücke bauen<br />
» Das schulische Bildungsangebot ergänzen<br />
» Auf die Anforderungen des Studiums vorbereiten<br />
» An die Formierung wissenschaftlicher Texte heranführen<br />
» Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens kennenlernen<br />
» Die eigene Leistungsfähigkeit erkunden<br />
» Erfahrungen in Teamarbeit machen<br />
» Konzentriertes Arbeiten auch als Vergnügen kennen lernen und empfinden<br />
Wir Teilnehmer sind während dieser sechzehn Tage so stark zusammengewachsen, dass nach<br />
dieser tollen Akademie der Abschied umso schwerer fiel. Auch wenn alle Teilnehmer in ganz<br />
Deutschland bzw. sogar international verteilt sind, habe ich immer noch mit vielen von ihnen<br />
Kontakt und kann diese Erfahrung, an der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> teilzunehmen, allen,<br />
die diese Chance bekommen, nur empfehlen.«<br />
»Rückblickend kann ich nur jedem zu einem Besuch einer solchen Akademie raten! Denn es<br />
öffnet einem nicht nur das Tor zu neuen Eindrücken, schlägt einen Bogen zum Studium oder<br />
fördert engagierte, »hochbegabte« Schüler und führt sie an ihre Leistungsfähigkeit heran, wie<br />
es ihr Ziel ist. Sie ermöglicht vielmehr die Teilnahme an einer unvergleichlichen Gemeinschaft,<br />
die Hoffnung für eine Zukunft gibt, wo jeder Verantwortung übernimmt und wo Toleranz<br />
nicht nur GROSS geschrieben, sondern auch gelebt wird.«<br />
Diese Gedanken gingen Teilnehmenden des letzten Jahres durch den Kopf, nachdem<br />
der Alltag sie nach der Akademie wieder eingefangen hatte: Eine Mischung aus Befangenheit,<br />
Unsicherheit und gespannter Erwartung begleitet die meisten Akademieteilnehmerinnen<br />
und -teilnehmer in der Zeit vor der Akademie. Groß ist dann die<br />
Erleichterung, aufgeschlossenen, interessierten und begeisterungsfähigen Menschen<br />
zu begegnen, zu denen rasch der Kontakt hergestellt ist, da sie »auf gleicher Wellenlänge«<br />
liegen.<br />
Neben der intensiven und anstrengenden Kursarbeit gibt es zahlreiche Freizeit-, Spiel-<br />
und Sportangebote und natürlich entstehen viele positive Erfahrungen durch die persönlichen<br />
Gespräche, die schnell eine Gemeinschaft entstehen lassen, mit Bindungen,<br />
die weit über die Akademie hinaus dauern.
Das Angebot <strong>2012</strong><br />
Im Sommer <strong>2012</strong> führt die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> für insgesamt rund 650 Schülerinnen<br />
und Schüler sieben Akademien in Braunschweig (Niedersachsen), Hilden<br />
(Nordrhein-Westfalen), Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), Schelklingen (Baden-<br />
Württemberg), Torgelow bei Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) und<br />
in Veckenstedt (Sachsen-Anhalt) durch.<br />
Zusätzlich werden für jeweils 64 Schülerinnen und Schüler in Waldenburg (Sachsen)<br />
und in Torgelow zwei Multinationale Akademien veranstaltet. Neben jungen <strong>Deutsche</strong>n<br />
werden hier Schülerinnen und Schüler aus den östlichen Nachbarländern vom<br />
Baltikum bis Rumänien teilnehmen.<br />
Die Multinationalen Akademien in Waldenburg (Rumänien, Slowakei, Tschechien<br />
und Ungarn) und Torgelow (Estland, Lettland, Litauen und Polen) werden durch die<br />
Haniel Stiftung, Duisburg, gefördert. Die übrigen Akademien werden etwa zur Hälfte<br />
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Weitere Gelder<br />
kommen vom Stifterverband für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft, von Stiftungen und von<br />
privaten Spendern. So kann der Teilnahmebeitrag (siehe Seite 12 f.) für diese Akademien<br />
weit unterhalb der tatsächlich entstehenden Kosten liegen und deckt nur rund<br />
ein Drittel davon. Auf Antrag kann eine Ermäßigung oder eine Befreiung von der Eigenbeteiligung<br />
gewährt werden.<br />
Zwei weitere Akademien werden in Papenburg (Niedersachsen) vom Verein Jugendbildung<br />
in Gesellschaft und Wissenschaft e.V. (JGW), einem Zusammenschluss ehemaliger<br />
<strong>SchülerAkademie</strong>-Teilnehmender, ausgerichtet. Auch die se Akademien werden<br />
durch Sponsoren und private Spenden unterstützt. Näheres dazu steht auf den Seiten<br />
84 ff. Schließlich gibt es noch Teilnahmemöglichkeiten an ähnlichen Akademieprogrammen<br />
in Litauen, Österreich und Polen (siehe Seiten 102 ff.).<br />
Warum Akademien?<br />
Viele besonders begabte, interessierte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler<br />
machen die Erfahrung, dass sie eher selten auf Gleichaltrige treffen, die ihre Interessen<br />
teilen und deren Fähigkeitsschwerpunkte ähnlich sind. Auch erleben sie, dass Inhalte<br />
und Gestaltung des Schulunterrichts den eigenen Interessen, Neigungen und Fähigkeiten<br />
nicht hinreichend gerecht werden.<br />
–– 5
Anders als für Leistungssportler oder für musikalische Talente gibt es für intellektuell<br />
besonders begabte und interessierte Jugendliche im außerschulischen Bereich wenige<br />
Angebote. Für diese Schülerinnen und Schüler hat die Bildung & Begabung gemeinnützige<br />
GmbH (siehe auch Seite 109) seit 1988 Ferienprogramme entwickelt und<br />
erprobt. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Bundesministerium für Bildung und<br />
Wissenschaft ist daraus die »<strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong>« geworden.<br />
1993 wurden durch Beschluss des <strong>Deutsche</strong>n Bundestags wichtige Finanzmittel für<br />
das Projekt im Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung abgesichert.<br />
1994 stimmte auch die Kultusministerkonferenz diesem Konzept zur Begabtenförderung<br />
einstimmig zu. Im Sommer 2001 übernahm der damalige Bundespräsident Johannes<br />
Rau nach dem Besuch einer Akademie die Schirmherrschaft über die <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>SchülerAkademie</strong>. Sein Nachfolger, Horst Köhler, setzte diese Schirmherrschaft fort;<br />
auch er besuchte eine Akademie. 2009 übernahm Horst Köhler die Schirmherrschaft<br />
über die Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH mit allen ihren Projekten. Die-<br />
6 ––<br />
se Tradition wird vom Bundespräsidenten Christian Wulff fortgeführt. Die <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>SchülerAkademie</strong> wird bei ihrer Aufgabe durch einen Beirat unterstützt.<br />
Für die Organisation und Durchführung ist die Bildung & Begabung gemeinnützige<br />
GmbH verantwortlich.<br />
Ziele, Konzeption und Inhalt<br />
Ziel der Akademien ist, Schülerinnen und Schülern eine intellektuelle und soziale<br />
Herausforderung zu bieten, sie in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie miteinander in<br />
Kontakt zu bringen und unter Anleitung von qualifizierten Lehrkräften an anspruchsvollen<br />
Aufgaben ihres Interessenbereiches arbeiten zu lassen. Das Niveau entspricht<br />
dabei häufig dem von Hochschulstudiengängen in den ers ten Semestern.<br />
Eine Akademie besteht aus sechs Kursen (die Multinationalen Akademien Waldenburg<br />
und Torgelow aus vier Kursen) mit jeweils bis zu 16 Teilnehmenden. Jeder Kurs<br />
wird von zwei Leitungspersonen betreut. Während der Akademie arbeiten die Teilnehmenden<br />
in einem Kurs eigener Wahl für eine Dauer von insgesamt ca. 50 Stunden.<br />
Für die Akademien des JGW e.V. (siehe Seite 86–101) gelten zum Teil andere Regeln.<br />
Die Konzeption der Akademien basiert auf folgenden Prinzipien:<br />
– Teilnehmen können besonders befähigte und motivierte Jugendliche der gymnasialen<br />
Oberstufe. Sie leben und arbeiten 16 Tage (JGW-Akademien: 10 Tage) an<br />
einem Ort zusammen.<br />
– Die Teilnehmenden werden durch Wissenschaftler, Lehrer oder andere Experten<br />
in ein Thema eingeführt und unterrichtet. Sie werden zum selbständigen Wissenserwerb<br />
und zu eigenständigem Tun angeleitet. Dabei lernen sie wissenschaftliche<br />
Standards und Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens kennen.<br />
– Die Kursthemen werden aus verschiedenen Disziplinen der Natur-, Geistes- und<br />
Gesellschaftswissenschaften und des kulturellen Bereichs zusammengestellt. In<br />
jeder Akademie ist eine Mischung der Disziplinen gegeben. Der Informations- und<br />
Erfahrungsaustausch soll weitgehend interdisziplinär sein, was durch entsprechende<br />
<strong>Programm</strong> elemente unterstützt wird.<br />
– Die Kurse vermitteln grundlegendes Faktenwissen und trainieren systematisches<br />
und strukturelles Denken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Vermittlung von<br />
fachspezifischen Methoden wissenschaftlichen Arbeitens.<br />
– Die Kursarbeit wird durch sportliche, soziale und kulturelle, insbesondere musikalische<br />
Aktivitäten ergänzt.<br />
– Als ganz wesentlicher Bestandteil wird in den Kursen eine Dokumentation (siehe<br />
Seite 10) erarbeitet. Hier werden das Kursthema, der Lernprozess und die Ergeb-
nisse der Kursarbeit dokumentiert und abschließend in einer Broschüre zusammengefasst.<br />
– Ein ebenfalls zentraler Bestandteil ist die Rotation (siehe Seite 10), in der die Teilnehmenden<br />
in die Rolle der Lehrenden schlüpfen und den Teilnehmenden anderer<br />
Kurse über ihre Arbeit berichten.<br />
– In den Akademien wird den Teilnehmenden kein fertiges <strong>Programm</strong> geboten, sondern<br />
nur ein Rahmen, den die Teilnehmenden mit den Kursleitenden gemeinsam<br />
mit Leben füllen. Lernen ist hier nicht passiv sondern aktiv.<br />
Neben dem Kursprogramm gibt es zahlreiche offene Angebote: Theater, Musik, Exkursionen,<br />
Chor, Sport, Gastvorträge u.v.a.m. Diesen kursübergreifenden Aktivitäten<br />
(»KüA«) wird wegen ihrer sozialen und interdisziplinären Bedeutung ein etwa gleicher<br />
zeitlicher Umfang im Tagesablauf eingeräumt wie dem Kursprogramm.<br />
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben während der Akademie in einer Gemeinschaft<br />
von ähnlich interessierten und motivierten Jugendlichen und Kursleitenden.<br />
Diese anregende, offene und tolerante Gemeinschaft ist für viele Teilnehmende rückblickend<br />
oft die wichtigste und wertvollste Erfahrung. Schnell entwickeln sich auch<br />
über die Akademie hinaus haltende Kontakte und Freundschaften, die u.a. über den<br />
»Club der Ehemaligen e.V.« (siehe Seite 108) vielfach bis in das Studium hinein aufrecht<br />
erhalten werden. Zahlreiche »Ehemalige« sind inzwischen als Kursleitende tätig.<br />
Was erwartet mich und was wird von mir erwartet?<br />
Wer an einer Akademie teilnehmen will, muss sich darauf einstellen, 16 Tage voll<br />
eingespannt zu sein und mit ganzer Kraft zu arbeiten. Natürlich gibt es viele Gelegenheiten<br />
zu Gesprächen, zu gemeinsamen Spaziergängen etc., doch die Tage sind relativ<br />
stark strukturiert.<br />
Bei einigen Kursbeschreibungen (ab Seite 18) sind noch spezielle Teilnahmevoraussetzungen<br />
erwähnt, die gewährleisten, dass die spezifischen Vorkenntnisse, die für eine<br />
erfolgreiche Bewältigung des Kurses notwendig sind, vorhanden sind. Unabhängig<br />
davon gelten für jeden Kurs folgende Voraussetzungen, welche nicht bei jeder Kursbeschreibung<br />
erwähnt werden:<br />
– Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie für das jeweilige Fachgebiet des gewählten<br />
Kurses, ihrer Methodik und damit für den Kurs selbst ein hohes Interesse<br />
aufbringen. Dies gilt sowohl für den Hauptwunsch als auch für alle alternativ angegebenen<br />
Kurswünsche (siehe Seite 11).<br />
– In den meisten Kursen wird zur Vorbereitung und Einarbeitung bereits einige Wochen<br />
vorab eine (z.T. umfangreiche) Textsammlung zugeschickt. Die Fachtexte sind<br />
vielfach englischsprachig. Erwartet wird die Bereitschaft, sich intensiv mit Fachliteratur<br />
(auch fremdsprachiger) auseinander zu setzen und sich in neue Gebiete selbst<br />
einzuarbeiten.<br />
– In der Regel wird die Vorbereitung eines Referats von ca. 20 Minuten Länge erwartet.<br />
Von jeder/jedem Teilnehmenden wird erwartet, dass er/sie im Laufe der Akademie<br />
einmal als Referent vor den anderen spricht.<br />
Und weiterhin: Auch während der Kurse sind möglicherweise noch fehlende Grundlagen<br />
zu erarbeiten; die Bereitschaft zur Text- und (Klein-)Gruppenarbeit sowie Diskussionsfreude<br />
sind generell unverzichtbar.<br />
Organisation der Akademie<br />
Beirat:<br />
» Ines Albrecht, Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, Wismar<br />
» Rainer Arnold, Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn<br />
» Dr. Judith Günther, Bayer Schering Pharma, Berlin<br />
» Bettina Jorzik, Stifterverband für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft, Essen<br />
» Hanno Kamp, Club der Ehemaligen der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>n e.V., Bonn<br />
» Dr. Tobias Kläden, Katholische Arbeitsstelle für missionarische Pastoral (KAMP)<br />
e.V., Erfurt<br />
» Prof. Dr. Franzis Preckel, Universität Trier (Vorsitzende)<br />
» Dr. Jenny Thauer, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin<br />
» Barbara Reinhard, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-<br />
Württemberg, Stuttgart (als Repräsentantin der Kultusministerkonferenz)<br />
» PD Dr. Elke Völmicke, Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, Bonn<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle der <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>SchülerAkademie</strong>: Volker Brandt (Leiter der Geschäftsstelle), Christiane Kunze<br />
(Stellvertreterin), Jürgen Klein, Dr. Dorothea Patzke, Iris Prochazka, Martin<br />
Rosenkranz, Grazyna Rynca, Miriam Staiger, Martina Stiehl<br />
–– 7
Zeitliche Struktur des Akademieverlaufes<br />
Ein typischer Akademietag hat folgenden Verlauf:<br />
8 ––<br />
7:30 – 8:30 Frühstück<br />
8:30<br />
anschließend<br />
bis 12:00<br />
12:15 – 13:30 Mittagessen<br />
Plenum: Hier treffen sich alle Teilnehmenden und Kursleitenden<br />
zum gemeinsamen Tagesbeginn mit einem Informationsaustausch.<br />
Dann wird etwa drei Stunden bis zum Mittag<br />
in den Kursen gearbeitet mit Pausen je nach Bedarf.<br />
14:00 – 16:00 Nach dem Essen finden bis 16.00 Uhr verschiedene kursübergreifende<br />
Angebote statt, die allen Teilnehmenden offen stehen und<br />
auch von allen (mit)gestaltet werden können. Wählen kann man<br />
zwischen Chor, Kammermusik, Theater, Sport, Kunst oder speziellen<br />
Arbeitsgemeinschaften (z.B. Sprachen) etc.<br />
16:00 Getränke- und Kuchenpause<br />
16:30 – 18:30 Fortsetzung der Kursarbeit<br />
18:45 – 19:30 Abendessen<br />
ab 20:00 Nach dem Abendessen gibt es wieder für alle offene Angebote.<br />
Je nach Interesse und Engagement gestalten Teilnehmende und<br />
Kursleitende gemeinsam Kammermusik, Theater, Sport, Vorträge,<br />
Arbeitsgemeinschaften, Nachrichten, einen Vorleseabend und vieles<br />
mehr.<br />
Der Tag ist mit vielen attraktiven, z.T. parallel laufenden Angeboten ausgefüllt. Es gilt,<br />
eine sinnvolle Auswahl zu treffen und nicht die gesamte Zeit zu verplanen, damit auch<br />
Raum für Entspannung und Erholung bleibt. Tradition ist es, dass sich zu Beginn der<br />
Akademie ein Chor und musikalische Ensembles bilden, die gegen Ende der Akademie<br />
ein öffentliches Konzert geben. Weiterhin gehören Exkursionen zu reizvollen Zielen der<br />
Region zum Akademieprogramm.
Anreise bis<br />
17:00 Uhr<br />
Donnerstag<br />
Eröffnung<br />
Treffen in<br />
den Kursen<br />
Kurs und KüAs<br />
Kurs und KüAs<br />
Sonntag<br />
Kurs und KüAs<br />
Kurs und KüAs<br />
Dienstag<br />
Exkursion und KüAs<br />
Kurs und KüAs<br />
Ablauf der Akademie<br />
Kurs und KüAs<br />
Kurs und KüAs<br />
Samstag<br />
Rotation<br />
Auswertung,<br />
Kurs<br />
Volleyballturnier<br />
Sonntag<br />
Kurs und KüAs<br />
Kurs und KüAs<br />
Kurs und KüAs<br />
Vor- und Nachbereitungen<br />
Kurs und KüAs<br />
Mittwoch<br />
Kurs und KüAs,<br />
Generalprobe<br />
Konzert<br />
Donnerstag<br />
Freitag<br />
Kurs, Aufräumen<br />
Abschlussabend<br />
Samstag<br />
Abschlussplenum,<br />
Abreise<br />
–– 9
10 ––<br />
Rotation<br />
Damit die Teilnehmenden einen Einblick in die Inhalte anderer Kurse erhalten,<br />
unterrichten sich die Kurse gegenseitig. Auf Postern oder in der Akademiezeitung<br />
werden Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse präsentiert.<br />
Eine spezielle Form der gegenseitigen Information ist die Rotation. Während der<br />
Rotation schlüpfen die Teilnehmenden für einen Vormittag in die Rolle der Kursleitenden<br />
und berichten anderen Kursen über ihre Arbeit. Dafür müssen sie die<br />
gewonnenen Erkenntnisse gedanklich neu strukturieren und Formen der sach-<br />
und zielgerechten Vermittlung von Methoden und Inhalten entwickeln.<br />
Dokumentation<br />
Ein wichtiges Prinzip der <strong>SchülerAkademie</strong> ist das Verschriftlichen von Methoden,<br />
Prozessen und Inhalten der Kursarbeit. Während der Akademie entstehen so<br />
Berichte zu den Ergebnissen der Kursarbeit, Zusammenfassungen von Referaten,<br />
Exzerpte zu wissenschaftlichen Artikeln, Texte zu kursübergreifenden Aktivitäten<br />
etc. Es werden die Wiedergabe und Erläuterung von Untersuchungen und deren<br />
Ergebnissen, von logischen Gedankengängen u.a. geübt.<br />
Für alle ist es eine Herausforderung – viele Texte müssen mehrfach und wiederholt<br />
bearbeitet und redigiert werden, bis sie eine bestimmte Form und korrekten<br />
Inhalt haben. Durch mehrfaches Korrigieren der Texte lernen die Teilnehmenden<br />
zusammenhängend und prägnant zu formulieren und wissenschaftliche Standards<br />
anzuwenden. Diese Texte werden in Auszügen zu einer Dokumentation zusammengefasst<br />
und später allen Teilnehmenden übersandt.<br />
Die Produktion der Dokumentation ist arbeitsaufwendig, kostet viel Zeit, ist aber<br />
als Lernerfahrung unersetzlich.<br />
Musik! Musik! Musik!<br />
Neben der Arbeit in den Kursen wird in allen Akademien viel Musik gemacht. Sowohl<br />
räumlich auf dem Gelände als auch zeitlich im Tagesablauf gibt es zahlreiche Möglichkeiten.<br />
Jede(r) kann sich nach ihren/seinen Neigungen und Fähigkeiten einbringen.<br />
Traditionell wird in jeder Akademie ein Chor gebildet. Bei der Wanderung durch die<br />
Epochen und Stile von Barock bis Gospel, von Romantik bis Jazz werden alle ihren<br />
Spaß haben, ob mit oder ohne Vorerfahrung. Darüber hinaus kann bei Interesse auch<br />
ein kleiner Kammerchor gebildet oder auch einzeln die eigene Stimme entdeckt werden.<br />
Auch alle Arten von Instrumenten sind herzlich willkommen. Es werden daraus Ensembles<br />
und evtl. ein Orchester zusammengestellt und die Musikliteratur nach den<br />
Bedürfnissen arrangiert. Kammermusikalisch kann alles entstehen, wozu man Lust<br />
hat. Eigene Noten oder Vorschläge können gern mitgebracht werden.<br />
Die Ergebnisse werden am Ende in einem Konzert der Öffentlichkeit präsentiert.<br />
Rechtzeitig vor Akademiebeginn werden die Teilnehmen den einen Fragebogen erhalten,<br />
mit dem Stimmlage, Instrumente und musikalische Interessen erfragt werden, um<br />
so die kursübergreifende Musik gut vorplanen zu können.
Teilnahmevoraussetzungen<br />
1 Wohnsitzkriterium<br />
Zugang zu den Akademien haben grundsätzlich Schülerinnen und Schüler, die ihren<br />
Wohnsitz in Deutschland haben oder eine Schule im Ausland, die zur Allgemeinen<br />
Hochschulreife führt, besuchen.<br />
2 Jahrgangskriterium<br />
Die Jugendlichen müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung<br />
– die 11. oder 12. Jahrgangsstufe von Schulen, die mit der 13. enden, bzw.<br />
– die 10. oder 11. Jahrgangsstufe von Schulen, die mit der 12. enden,<br />
besuchen. Zum Zeitpunkt der Akademieteilnahme dürfen sie ihre Abschlussprüfung<br />
(Abitur) noch nicht abgelegt haben.<br />
3 Leistungskriterium<br />
Die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> richtet sich an Jugendliche mit herausragenden Leistungen,<br />
die über eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft sowie über eine breite<br />
Interessenausrichtung verfügen.<br />
Als Nachweis der besonderen Leistungsfähigkeit können gelten:<br />
– die erfolgreiche Teilnahme an einem bundes- oder landesweiten Schülerwettbewerb;<br />
die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit den Wettbewerbsleitungen;<br />
– eine mit einem schriftlichen Gutachten versehene Empfehlung einer Schulleitung<br />
bzw. der verantwortlichen Lehrerin bzw. des verantwortlichen Lehrers. Die <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>SchülerAkademie</strong> bittet dazu im Januar jeden Jahres alle in Frage kommenden<br />
Schulen im gesamten Bundesgebiet und im Ausland um entsprechende Empfehlungen;<br />
– das letzte Schulzeugnis, ggf. mit weiteren Nachweisen, zusammen mit der Begründung<br />
des Teilnahmewunsches/einem Motivationsschreiben und einer Empfehlung<br />
(für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht von der Schulleitung empfehlen lassen<br />
wollen).<br />
Neben den formalen Voraussetzunggen müssen die Teilnehmenden die Bereitschaft<br />
mitbringen, sich die komplette Akademie über mit allen Kräften einzubringen und<br />
aktiv und gemeinschaftlich das Akademie- und Kursgeschehen sowie den kursübergreifenden<br />
Bereich mitzugestalten.<br />
Bewerbung und Kurswahl<br />
Die zur Teilnahme qualifizierten Schülerinnen und Schüler werden Ende Februar von<br />
der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> zur Bewerbung um einen Platz in einer Akademie<br />
aufgefordert. Dazu ist ein Kurs auszuwählen. Sofern hohes Interesse auch für andere<br />
Kursthemen besteht, können zusätzlich bis zu vier Alternativkurse angegeben werden;<br />
dadurch erhöht sich die Teilnahmechance. Die Bewerbung muss bis spätestens<br />
15. März <strong>2012</strong> erfolgen. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wird zugesichert.<br />
Die Multinationalen Akademien wurden für Schülerinnen und Schüler aus Deutschland,<br />
Estland, Lettland, Litauen und Polen (Akademie Torgelow) bzw. aus Deutschland,<br />
Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn (Akademie Waldenburg) eingerichtet<br />
(siehe Seite 72).<br />
Schülerinnen und Schüler aus dem sonstigen Ausland können sich nur für Kurse der<br />
sieben regulären Akademien sowie der Akademien des Vereins Jugendbildung in Gesellschaft<br />
und Wissenschaft e.V. (JGW e.V.) bewerben.<br />
BEWERBUNG<br />
BITTE BIS<br />
15. MÄRZ <strong>2012</strong><br />
–– 11
Vergabe der Plätze<br />
Auf Grundlage der Kurswünsche und der Bewerbungsunterlagen entscheidet die<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> über die Vergabe der Plätze. Dabei wird ein ausgewogenes<br />
Verhältnis von Schülerinnen und Schülern angestrebt. Ferner wird auf eine angemessene<br />
zahlenmäßige Berücksichtigung aller Bundesländer geachtet. Ein Rechtsanspruch<br />
auf Teilnahme besteht nicht. Bei erheblichen Bewerberüberhängen für einzelne Kurse<br />
entscheidet das Los. Wer die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und eine Absage erhält,<br />
für den bedeutet dies keineswegs ein Zweifel an der Qualifikation. Im Jahre 2011<br />
lag die Aufnahmequote bei 58 Prozent.<br />
Weitere Fragen zum Zulassungsverfahren und zum Ablauf der Akademien werden<br />
gern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle der <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>SchülerAkademie</strong> beantwortet. Durch sie werden ggf. auch Kontakte zu ehemaligen<br />
Teilnehmenden oder Kursleitenden vermittelt, die über die Akademien Auskunft<br />
geben können. Darüber hinaus bieten die Internetseiten der <strong>Deutsche</strong>n Schüler-<br />
Akademie (www.deutsche-schuelerakademie.de) sowie des Clubs der Ehemaligen e.V.<br />
(www.cde-ev.de) bzw. des Vereins Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V.<br />
(www.jgw-ev.de) einen guten Einblick.<br />
12 ––<br />
Kosten / Eigenleistung / Rücktritt<br />
Die Kosten für die Organisation und Durchführung der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong><br />
werden hauptsächlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband<br />
für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft und weiteren Förderern aufgebracht.<br />
Von den Teilnehmenden der regulären <strong>SchülerAkademie</strong>n wird eine Eigenbeteiligung<br />
von 550 Euro erwartet, was etwa den Kosten für Unterkunft und Verpflegung im gastgebenden<br />
Internat entspricht.<br />
Die Kosten für die Multinationalen Akademien werden von der Haniel Stiftung, Duisburg,<br />
getragen. Die Höhe der Eigenbeteiligung für die Teilnahme an einer Multinationalen<br />
Akademie beträgt für Schülerinnen und Schüler aus Deutschland ebenfalls<br />
550 Euro, für Schülerinnen und Schüler aus den mittelosteuropäischen Ländern aufgrund<br />
der Förderung durch die Haniel Stiftung nur 100 Euro.<br />
Die Organisation der JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>n erfolgt ehrenamtlich. Die Kosten für die<br />
Durchführung werden über die Eigenbeteiligung gedeckt. Diese beträgt für die Akademien<br />
des JGW e.V. aufgrund der kürzeren Dauer 395 Euro.<br />
Bei allen Akademien kann die Eigenbeteiligung auf Antrag ermäßigt oder erlassen<br />
werden.
Studienstiftung des deutschen Volkes<br />
Die Studienstiftung des deutschen Volkes wurde 1925 in Dresden gegründet und ist<br />
damit das älteste deutsche Begabtenförderungswerk. Sie ist politisch, konfessionell<br />
und weltanschaulich unabhängig. Zurzeit werden rund 10.500 Studierende und<br />
Doktoranden gefördert.<br />
Jeder Stipendiat erhält ein monatliches Büchergeld sowie ein Lebenshaltungsstipendium,<br />
dessen Höhe vom Elterneinkommen abhängig ist. Des Weiteren gibt es ein<br />
umfangreiches Förderprogramm, das u.a. Auslandsstipendien, wissenschaftliche<br />
Kollegs, Sprachkurse und Sommerakademien beinhaltet.<br />
Die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> hat jedes Jahr die Möglichkeit, herausragende Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer für das Auswahlverfahren vorzuschlagen; das Team<br />
der Akademie- und Kursleitenden einer Akademie kann solche Vorschläge unterbreiten.<br />
Die Studienstiftung ist darüber hinaus Partner bei der Gewinnung von Kursleitenden<br />
für die <strong>Deutsche</strong> Schüler Akademie aus dem Kreis ihrer ehemaligen Stipendiaten.<br />
Für die seit Beginn der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> gewährte Förderung sagen wir<br />
herzlichen Dank.<br />
Damit sind auch alle Kosten für Kursprogramm, Betreuung und die vom Veranstalter<br />
geplanten kursübergreifenden Aktivitäten und Exkursionen abgedeckt. Die Fahrtkosten<br />
zwischen Wohnort und Akademie sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen<br />
ebenso wie Ausgaben für persönliche Arbeitsmaterialien, Telefon, Porto, private Ausflüge,<br />
Fahrradmiete, zusätzliche Getränke o.Ä.<br />
Ein Rücktritt von der Teilnahme ist bis zum 15. Mai <strong>2012</strong> (Eingang bei der Geschäftsstelle<br />
der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>) bzw. bis sieben Tage nach Versand der<br />
Entscheidung über einen Ermäßigungsantrag kostenlos möglich. Danach wird bei<br />
Rücktritt ohne wichtigen Grund (z.B. Krankheit) eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro<br />
erhoben.<br />
Ermäßigung oder Erlass der Eigenbeteiligung<br />
Die Eigenbeteiligung kann ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Einkommensverhältnisse<br />
der Familie die Zahlung der Eigenbeteiligung nur zum Teil oder gar nicht<br />
zulassen. Kein Schüler/keine Schülerin sollte daher allein aus finanziellen Gründen<br />
von einer Bewerbung Abstand nehmen. Die Platzvergabe erfolgt ohne Berücksichtigung<br />
der Einkommensverhältnisse. Ein Antrag auf Ermäßigung oder Erlass ist erst<br />
nach Erhalt der Teilnahmezusage zu stellen. Die Beurteilung der Bedürftigkeit folgt im<br />
Wesentlichen den Regeln des BAföG.<br />
Zeitplan<br />
Das Bewerbungs- und Verteilungsverfahren <strong>2012</strong> läuft mit folgenden Terminen:<br />
– Bis zum 15. März muss die Bewerbung an die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> abgesandt<br />
sein.<br />
– Die Zusagen und Absagen werden bis zum 30. April an die Bewerber versandt.<br />
Bitte nicht vorher nachfragen!<br />
– Bei einer Zusage muss die Eigenbeteiligung bis zum 15. Mai auf dem Konto des<br />
Vereins Bildung und Begabung e.V. eingegangen sein. Spätestens zu diesem Termin<br />
muss alternativ der Antrag auf Ermäßigung oder Erlass der Eigenbeteiligung bei<br />
der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> vorliegen. Er wird innerhalb weniger Tage bearbeitet.<br />
–– 13
14 ––<br />
Anreise<br />
Rechtzeitig vor Beginn der Akademie werden die Adressen der Teilnehmenden<br />
versandt, damit sie sich für die Fahrt absprechen und Fahrgemeinschaften bilden<br />
können. Mit der Anmeldung erklärt sich die Bewerberin bzw. der Bewerber einverstanden,<br />
dass die Adresse zu diesem Zwecke weitergegeben werden darf.<br />
Ferientermine<br />
Die Sommerferien liegen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich, sodass<br />
die Akademie vielleicht nur teilweise in die Ferienzeit fällt. In diesem Fall ist es<br />
erforderlich, bei der Schule und/oder Schulaufsichtsbehörde einen Antrag auf<br />
Freistellung vom Unterricht zu stellen. Einige Bundesländer haben bereits von<br />
sich aus die Schulen ihres Landes gebeten, Schülerinnen und Schüler ggf. vom<br />
Unterricht freizustellen. Die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> wird nötigenfalls solche<br />
Anträge unterstützen.<br />
Multinationale Akademien<br />
Diese Akademien sollen Forum für eine intensive Begegnung von Jugendlichen aus jeweils<br />
fünf europäischen Ländern sein, zur grenz überschreitenden Begabtenförderung<br />
beitragen und das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit fördern. In Waldenburg<br />
werden Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Rumänien, der Slowakei<br />
und Tschechien sowie aus Ungarn zusammentreffen, während in Torgelow bei Waren<br />
die Länder Deutschland, Estland, Lettland, Litauen und Polen vertreten sein werden.<br />
Die Akademien werden im Wesentlichen nach den Strukturen der <strong>Deutsche</strong>n Schüler-<br />
Akademie organisiert, sind aber auf vier Kurse mit je 16 Teilnehmenden begrenzt. Die<br />
Kurse werden paritätisch aus den beteiligten Ländern besetzt.<br />
Die multinationale Zusammensetzung der Kurse macht es möglich, viele Aspekte der<br />
nationalen Kulturen in das Akademieleben, in kursübergreifende Angebote und Veranstaltungen<br />
einzubringen, so z.B. auch Einführungen in die Sprachen der beteiligten<br />
Länder. Gemeinsame Arbeitssprache während der gesamten Akademien ist Deutsch.<br />
Die Eigenbeteiligung für diese Akademien beträgt für Teilnehmende aus Deutschland<br />
550 Euro, für Teilnehmende aus den anderen Ländern 100 Euro. Auch hier ist eine<br />
Reduktion oder ein Erlass in begründeten Fällen möglich.
Ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ...<br />
Unabhängig von der Durchführung der Multinationalen Akademien werden wie in<br />
jedem Jahr auch zahlreiche Jugendliche aus dem Ausland an den regulären Schüler-<br />
Akademien teilnehmen.<br />
… und ihre Gastfamilien<br />
Um diesen ausländischen Teilnehmenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist,<br />
die Eingewöhnung in Deutschland zu erleichtern, werden sie eingeladen, bereits eine<br />
Woche vor Beginn der Akademie bei einem Teilnehmer bzw. einer Teilnehmerin zu<br />
wohnen. Hierfür werden Familien gesucht, die bereit sind, diesen einwöchigen Familienaufenthalt<br />
zu ermöglichen. Wer bereit ist, eine(n) ausländische(n) Teilnehmer(in)<br />
in der Woche vor dem jeweiligen Akademiebeginn bei sich aufzunehmen, wird gebeten,<br />
dies bei der Bewerbung anzugeben.<br />
Nach der Akademie<br />
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält eine Bescheinigung über die Kursteilnahme<br />
und ein Exemplar der Dokumentation der besuchten Akademie. Weiterhin<br />
können die Teilnehmenden und Kursleitenden nach der Akademie dem Club der<br />
Ehemaligen e.V. (siehe auch Seite 108) beitreten. Darüber hinaus hat die <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>SchülerAkademie</strong> jedes Jahr die Möglichkeit, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
für das Auswahlverfahren der Studienstiftung des deutschen Volkes vorzuschlagen<br />
(sie he Seite 13). Die Entscheidung hierüber treffen die Akademie- und Kursleitenden.<br />
–– 15
16 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Akademie<br />
Braunschweig I<br />
CJD Jugenddorf-Christophorusschule<br />
Braunschweig<br />
Das CJD Braunschweig liegt am Rande der Stadt Braunschweig. Die rund 250.000 Einwohner<br />
zählende Stadt bietet zahlreiche Angebote einer Universitätsstadt mit Forschungsanstalten,<br />
Museen usw. Zum Jugenddorf gehören das Gymnasium, die Internationale Schule Braunschweig-Wolfsburg,<br />
die Hans-Georg-Karg-Grundschule und die Musische Akademie.<br />
Das Jugenddorf bietet ein umfangreiches Freizeit- und Bildungsangebot. Zum Gymnasium von<br />
Klasse 5 bis 12 für ca. 900 Schülerinnen und Schüler gehört ein Internat für Jungen und Mädchen<br />
mit 130 Plätzen. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Zweibettzimmern. Neben der<br />
Normalverpflegung gibt es auch vegetarische Kost oder Diätkost. Die Gebäude des Gymnasiums<br />
und des Internats liegen auf einem Gelände mit alten Bäumen in der Nähe eines Naturschutzreservats<br />
mit günstiger Straßenbahn- und Busverbindung zur Innenstadt.<br />
Fortsetzung siehe Seite 24 …
JUGENDDORF-CHRISTOPHORUSSCHULE BRAUNSCHWEIG<br />
GEORG WESTERMANN-ALLEE 76<br />
38104 BRAUNSCHWEIG<br />
www.cjd-braunschweig.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
1.1 Chaostheorie und Mandelbrotmenge<br />
1.2 Warum Blut nicht immer rot sein muss<br />
1.3 Die Ökonomik von Altruismus, Liebe und Milchkartons<br />
1.4 Tödliche Entscheidungen<br />
1.5 Zwischen Ostalgie, Verdrängung und Vergessen<br />
1.6 Die Weisheit der Pointe<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Thomas Schlerka (Jg. 1975) ist mit Leib und Seele und von ganzem Herzen<br />
Musiker. Er begann bereits mit 12 Jahren als Jungstudent, war mehrfach Preisträger<br />
bei »Jugend musiziert« in Klavier und Gesang, dirigierte bereits mit 15<br />
Jahren sein erstes Sinfoniekonzert und wurde seither von namhaften Dirigenten<br />
gefördert und unterrichtet (Harnoncourt, Celibidache, Rilling u.a.). Tom studierte<br />
katholische Kirchenmusik, Komposition und künstlerisches Dirigieren.<br />
Besonders liegt ihm die Arbeit mit musikbegeisterten Jugendlichen am Herzen.<br />
Bei der <strong>DSA</strong> ist er seit dem Jahr 2000 tätig, zuerst als kursübergreifender Musiker,<br />
dann als Kursleiter (Musik/Theologie). Tom hat eine Professur für künstlerisches Dirigieren<br />
inne. In seiner knapp bemessenen Freizeit liest er sehr gerne, spielt gerne Badminton und Tennis.<br />
Seine größte Leidenschaft aber ist und bleibt das Telefonieren.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I<br />
Akademieleitung<br />
Judith Günther (Jg. 1973) studierte Chemie an der Technischen Universität<br />
Darmstadt, wo sie während der Diplomarbeit ihr Interesse für Computermethoden<br />
entdeckte und fortan den Laborkittel an den Nagel hängte (jetzt ist er nur<br />
noch bei <strong>SchülerAkademie</strong>n wieder im Einsatz). Seit ihrer Promotion beschäftigt<br />
sie sich mit Arzneistoffentwicklung und mit rechnergestützten Verfahren,<br />
um in dreidimensionale Proteinstrukturen neue Wirkstoffkandidaten hineinzubasteln.<br />
Die Forschung, aber auch die Begeisterung am kunterbunten kulturellen<br />
Leben und Treiben der Stadt führten Judith vor zehn Jahren nach Berlin. Da<br />
sie Fremdsprachen am liebsten vor Ort lernt, reist Judith gerne und kommt dann häufig zurück<br />
mit einem Koffer voller Bücher, die sie gar nicht alle lesen kann, und Kisten voller Weinflaschen,<br />
die sie gar nicht alle allein trinken kann.<br />
Ute Schütte (Jg. 1983) verbrachte 2001 auf der <strong>SchülerAkademie</strong> in der<br />
Grovesmühle zwei unvergesslich tolle Wochen. Im Sommer 2010 erlebte sie die<br />
<strong>SchülerAkademie</strong> ein zweites Mal – aus Kursleiterperspektive. Nun freut sie sich<br />
darauf, die <strong>SchülerAkademie</strong> in Braunschweig noch einmal neu kennenzulernen.<br />
Ute studierte Pharmazie in Münster und darf sich nach Ausflügen nach<br />
Lille und Boston seit 2009 Apothekerin nennen. Im Moment arbeitet sie am<br />
Universitätsklinikum Bonn an ihrer Doktorarbeit in der Krebsforschung. Wenn<br />
sie nicht gerade im Labor pipettiert oder in der Apotheke Kunden berät, singt<br />
sie in ihrer Freizeit mit Begeisterung in verschiedenen Chören.<br />
Maximilian Frank (Jg. 1994) erwirbt momentan seine allgemeine Hochschulreife<br />
an der Hohen Landesschule Hanau. Den Prüfungen in seinen Leistungskursen<br />
Physik und Geschichte sieht er erwartungsvoll entgegen. Nach der Reifeprüfung<br />
möchte er Psychologie studieren, da der Mensch für ihn den zweifelsfrei<br />
spannendsten Forschungsgegenstand darstellt. Im Jahr 2011 war er selbst<br />
Teilnehmer der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> in Braunschweig und freut sich<br />
riesig darauf, ein Jahr später dorthin zurückzukehren und zusammen mit Judith<br />
und Ute <strong>DSA</strong> einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben und zu<br />
gestalten. Wenn es die doch zeitintensive Abiturvorbereitung zulässt, liegt ihm die Lektüre philosophischer<br />
Texte, historischer Romane sowie der Flug seines Modellhubschraubers am Herzen.<br />
Den nötigen Ausgleich findet er im Basketballspiel, des Weiteren ist er passionierter Bogenschütze<br />
und einer heißen Tasse Tee nie abgeneigt.<br />
–– 17
18 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 1.1<br />
Chaostheorie und Mandelbrotmenge<br />
Im Kurs geht es um die Chaostheorie. Hier ist die Iteration,<br />
die mehrfache Hintereinanderausführung von Funktionen,<br />
von Bedeutung. Bei der Iteration einer Funktion f ergibt<br />
sich für eine Zahl x0 ein Orbit<br />
,<br />
wobei f n [ ] [ 2]<br />
[ 3]<br />
Of ( x0) = ( x0, f( x0), f ( x0), f ( x0),<br />
…)<br />
die n -fache Iteration von f bezeichnet:<br />
f( x0)<br />
[ 2]<br />
f ( x0) = f ( f( x0)<br />
)<br />
[ 3]<br />
[ 2]<br />
f ( x ) = f ( f ( x ) )= f f ( f( x ) )<br />
f<br />
⋮<br />
0<br />
[ n] [ n−1]<br />
0<br />
( ( ) )<br />
0 0<br />
( )<br />
( x ) = f ( f ( x0) )= f …f( f( x0))<br />
… .<br />
��������� n−mal<br />
Es werden Orbits reeller und komplexer quadratischer<br />
Funktionen untersucht. Begonnen wird mit der Untersuchung<br />
von Orbits von reellen Funktionen; bei diesen ist<br />
Kursleitung<br />
Birgit Griese (Jahrgang 1969) studierte nach einem mehrmonatigen Aufenthalt<br />
in London an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Mathematik<br />
und Englisch für die Sekundarstufen I und II. Nach dem Zweiten<br />
Staatsexamen veröffentlichte sie zusammen mit Hannes Stoppel 1997 das<br />
»Übungsbuch zur Linearen Algebra«, das inzwischen in der 7. Auflage bei<br />
Vieweg+Teubner erschien. Seit 1997 ist Birgit Griese an der Willy-Brandt-<br />
Gesamtschule in Bottrop tätig, wo sie seit 2008 Vorsitzende der Fachschaft<br />
Mathematik ist. Seit 2010 arbeitet sie am Projekt MP2 der Ruhr-Universität<br />
Bochum mit, das Ingenieurstudierende in der Studieneingangsphase insbesondere im Fach<br />
Mathematik unterstützt. Die hierdurch intensivierten Einblicke in die Didaktik der Mathematik<br />
haben sich als äußerst spannendes Tätigkeitsfeld herausgestellt.<br />
ein Orbit recht gut an einem Funktionsgraphen zu untersuchen.<br />
Anschließend werden Orbits komplexer Funktionen untersucht.<br />
Hierbei werden grundlegende mathematische Hintergründe<br />
zu komplexen Zahlen � und zur komplexen<br />
Analysis erarbeitet.<br />
Eines der Ziele liegt bei der Untersuchung der Orbits<br />
2<br />
komplexer Funktionen Qc :��� mit Qc ( z)= z + c und<br />
c �� darin, Zusammenhänge zwischen der Struktur der<br />
Mandelbrotmenge und den 0-Orbits der Funktionen Qc zu untersuchen.<br />
Für alle c �� gibt es eine Gefangenenmenge. Sie besteht<br />
aus den komplexen Zahlen, deren 0-Orbits der Funktion<br />
Q c nicht gegen das Unendliche verlaufen. Die Gefangenenmengen<br />
unterscheiden sich für verschiedene c sehr<br />
stark voneinander, auch wenn sich das c nur gering verändert.<br />
Die Strukturen der Gefangenenmengen in Abhängigkeit<br />
von c �� sollen untersucht werden. Hierbei ergeben<br />
sich Zusammenhänge<br />
zwischen 0-Orbits und<br />
der Struktur der Gefangenenmengen.<br />
Der Rand des den Ursprung des Koordinatensystems enthaltenden,<br />
nierenförmigen Teils der Mandelbrotmenge lässt<br />
sich durch eine Parametrisierung<br />
φ � π φ π φ<br />
1<br />
1<br />
·exp ( 2·<br />
·· i )− ·exp ( 4·<br />
·· i )<br />
2<br />
4<br />
mit der komplexen Exponentialfunktion exp und der<br />
imaginären Einheit i = −1 beschreiben. Es sollen Beziehungen<br />
zwischen einer bestimmten Parametrisierung und<br />
dem Verhalten (beispielsweise der Periode) der 0-Orbits auf<br />
dem Graphen der Parametrisierung untersucht werden.<br />
Mit Hilfe eines Computers können umfangreiche Berechnungen<br />
und graphische Darstellungen durchgeführt und<br />
sichtbar gemacht werden.<br />
Hannes Stoppel (Jg. 1966) studierte von 1988 bis 1993 Mathematik und Physik in Düsseldorf.<br />
Nach seinem anschließenden Referendariat und Tätigkeiten von 1993 bis 1999 im<br />
Bereich Mathematik an der Uni Düsseldorf arbeitete er von 2000 bis 2001 als Mathematiker<br />
in der Wirtschaft. Seit dem Jahr 2001 ist er Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik<br />
am Max-Planck-Gymnasium in Gelsenkirchen. Neben seinem Unterricht leitet Hannes seit<br />
dem Jahr 2001 jährlich Schülerteams bei Jugend forscht oder Intel Leibniz Challenge und<br />
Arbeitsgruppen der Schülerakademie der Bezirksregierung Münster für die Jahrgangsstufen<br />
6 und 13. Ferner gibt er häufig Workshops in Mathematik für Lehrerinnen und Lehrer. Hannes<br />
schrieb im Jahr 1997 zusammen mit Birgit Griese das »Übungsbuch zur Linearen Algebra«. Im Jahr 2000<br />
verfasste er das Buch »Mathematik anschaulich«, und im Jahr 2010 entstand das Arbeitsheft »Stochastik und<br />
Statistik«.In der Freizeit spielt Hannes in zwei Trios Jazz und Rockmusik am Schlagzeug.
Kurs 1.2<br />
Warum Blut nicht immer rot sein muss<br />
Komplexchemie<br />
Verbindungen, die heute der Stoffklasse der Komplexverbindungen<br />
zugeordnet werden, sind schon seit einigen<br />
Jahrhunderten bekannt. So berichtete im Jahre 1798 Tassaert<br />
über die Synthese eines orangegelben Feststoffs der<br />
Zusammensetzung CoCl 3 ∙ 6NH 3 . Bis zu Beginn des 20. Jh.<br />
wurden zahlreiche weitere so genannte »Verbindungen höherer<br />
Ordnung« entdeckt. Jedoch blieb lange Zeit die Frage<br />
nach ihrem Aufbau und chemischen Verhalten umstritten.<br />
Erst 100 Jahre nach Tassaerts Beobachtung stellte Alfred<br />
Werner 1898 mit seiner »Koordinationslehre« eine Theorie<br />
auf, die alle bis dahin aufgekommenen Widersprüche erklärte.<br />
Hierfür wurde er 1913 mit dem Nobelpreis für Chemie<br />
ausgezeichnet. Demzufolge besteht ein Komplex aus<br />
einem zentralen Metallion und einer bestimmten Anzahl<br />
daran gebundener Moleküle oder Ionen, die als Liganden<br />
die Koordinationssphäre bilden, indem sie über freie Elektronenpaare<br />
koordinieren.<br />
Das auffälligste Merkmal vieler Komplexverbindungen ist<br />
ihre Farbe, neben welcher aber noch weitere physikalische<br />
Eigenschaften wie der Magnetismus von Bedeutung sind.<br />
Kursleitung<br />
Kathrin Daub (Jg. 1982) studierte an der Universität zu Köln Chemie und<br />
Biologie auf Lehramt für die Sekundarstufen II/I. Anschließend arbeitete sie in<br />
Köln und Arizona, USA, an ihrer Doktorarbeit in Anorganischer Chemie, die<br />
sie 2009 abschloss. Seit kurzem ist sie mit dem Referendariat fertig und arbeitet<br />
nun am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hürth. In ihrer Freizeit ist sie eine<br />
unermüdliche Läuferin, mag Ballsportarten, liest viel und geht ins Kino, Theater<br />
oder zum FC. Und im Sommer reist sie immer gerne zur <strong>DSA</strong> nach Braunschweig,<br />
wo sie sich inzwischen schon sehr heimisch fühlt.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I<br />
Doch wie werden jene Größen beeinflusst? Zur Klärung der<br />
Frage werden anhand von Kurzreferaten und Experimenten<br />
die Eigenschaften verschiedener Zentralmetalle, die Fülle<br />
unterschiedlicher Liganden und deren Auswirkung auf die<br />
Zusammensetzung eines Komplexes untersucht.<br />
Um Voraussagen und Deutungen zum Aufbau und zur<br />
Geometrie von Komplexen sowie der damit verbundenen<br />
physikalischen Eigenschaften treffen zu können, ist eine<br />
Betrachtung der Bindungssituation notwendig. Als theoretische<br />
Grundlage wird im Kurs die Ligandenfeldtheorie<br />
behandelt, wobei ein vertiefter Einblick unter Aspekten<br />
der Molekülorbitaltheorie möglich ist. Im Rahmen dieser<br />
Thematik werden zudem anhand von Röntgenbeugung,<br />
Schwingungs- und UV/VIS-Spektroskopie einige Methoden<br />
zur Strukturaufklärung von Komplexen theoretisch und<br />
z.T. auch praktisch herangezogen.<br />
Die Anwendungsgebiete der Komplexverbindungen sind<br />
sehr weitreichend; z.B. spielen sie als Katalysatoren in industriellen<br />
Prozessen eine große Rolle, aber auch in jedem<br />
Organismus sind sie zur Aufrechterhaltung von Lebensprozessen<br />
essentiell: Wie erfolgt die Sauerstoffbindung<br />
im Hämoglobin? Was hat es mit blauem Blut auf sich?<br />
Und welche Bedeutung haben Komplexe in der Krebstherapie?<br />
Solche Fragen werden aus Sicht der Komplexchemie<br />
betrachtet. Als biologischer Ligand nimmt dabei der<br />
Tetrapyrrol-Ring eine fundamentale Rolle ein, aber auch<br />
Aminosäureseitenketten in Proteinen sowie Nukleobasen<br />
sind potenzielle Liganden. Deren Komplexbildungsfähigkeit<br />
ermöglicht zwar die Nutzung von Metallionen im Organismus,<br />
kann aber gleichzeitig zum Funktionsverlust von<br />
Proteinen oder zu DNA-Schäden führen, wenn Metallionen<br />
unkontrolliert in Zellen gelangen – wie es bei Schwermetallvergiftungen<br />
der Fall ist.<br />
Neben Erkenntnissen zur Komplexchemie werden auch naturwissenschaftliche<br />
Denk- und Arbeitsweisen akzentuiert.<br />
Hierzu zählen vor allem ein selbständiges Planen und Auswerten<br />
von Experimenten, aber auch eine anschließende<br />
Reflexion über eigenes Vorgehen und den Wert experimentellen<br />
Arbeitens.<br />
Zum Verständnis der elektronischen Verhältnisse in Komplexen<br />
ist die Kenntnis des Orbitalmodells erforderlich,<br />
worüber jeder im Vorfeld des Kurses ein Skript erhalten<br />
wird.<br />
Marike Wolberg (Jg. 1982) studierte Chemie, Niederländisch und Biologie auf Lehramt<br />
für die Sekundarstufen II/I an der Uni Köln, wo sie sich nun als Promotionsstudentin<br />
der Anorganischen Chemie widmet. In ihrer Freizeit scheut sie sich nicht trotz anwesender<br />
bissiger Hunde am Rhein entlang zu laufen, besucht gerne die eine oder andere<br />
Kletterhalle oder liest ein Geschichtsmagazin. Sofern sie Zeit erübrigen kann, verbringt<br />
sie diese gerne mit einem Ausflug in die Niederlande, wo sie 2008/2009 für das Goethe-<br />
Institut an einer Gesamtschule Deutsch unterrichtete und Kulturwissenschaften studierte.<br />
Sie freut sich auf ihre erste Akademie.<br />
–– 19
20 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 1.3<br />
Die Ökonomik von Altruismus,<br />
Liebe und Milchkartons<br />
Wirtschaftswissenschaftliche Theorien angewendet auf das normale Leben<br />
Warum machen sich Leute Geschenke? Wer bekommt<br />
gute Noten in der Schule? Nach welchen Kriterien wählen<br />
Männer ihre Partner aus – und nach welchen Frauen? (Und<br />
warum lassen sie sich scheiden?) Warum kann man Medikamente<br />
nicht im Supermarkt kaufen? Warum sind Dosen<br />
rund und Milchkartons eckig? Ökonomen haben auf diese<br />
Fragen Antworten entwickelt, Alltagsökonomik sozusagen.<br />
Der Kurs will diese Antworten verstehen, überprüfen und<br />
diskutieren, wie sinnvoll sie sind.<br />
Die Mikroökonomik erklärt das Handeln von Menschen<br />
mit rationalen Motiven: Jeder versucht seinen eigenen<br />
»Nutzen« zu maximieren, jeder ist ein Egoist. Damit lassen<br />
sich nicht nur Finanzkrisen und Unternehmensfusionen<br />
erklären, sondern manchmal auch Phänomene des Alltags,<br />
soziale Interaktion und zwischenmenschliche Verhaltensweisen.<br />
Weihnachtsgeschenke und Freiwilligenarbeit<br />
Kursleitung<br />
Lion Hirth (Jg. 1985) kennt Marie aus Tübingen. Er liebt Bergsteigen und<br />
Fotografieren. Leider sind die Alpen von Berlin-Kreuzberg nicht ganz einfach<br />
zu erreichen, aber dafür kann man dort gut Rennrad fahren und Tanzen<br />
gehen. Er freut sich auf viele rationale Diskussionen und ein paar irrationale<br />
Gespräche auf der Akademie. Lion studierte in Tübingen, den USA<br />
und Chile Volkswirtschaftslehre und arbeitet bei einem Stromkonzern.<br />
erklären Ökonomen beispielsweise nicht mit Altruismus,<br />
sondern mit dem Versuch, sich altruistisch erscheinen zu<br />
lassen, um sozialen Status und Anerkennung zu gewinnen.<br />
Ob ein Paar sich für Kinder entscheidet, hängt ökonomisch<br />
gesprochen von den Präferenzen der beiden Partner<br />
ab – und, wenn diese unterschiedlich sind, auch von ihrer<br />
jeweiligen Verhandlungsmacht, zum Beispiel von ihrem<br />
Einkommen. Empirische Untersuchungen zeigen: Je mehr<br />
eine Frau im Vergleich zu ihrem Mann verdient, desto eher<br />
kann sie ihren Kinderwunsch durchsetzen.<br />
Ziel des Kurses ist zu verstehen, wie die Wirtschaftswissenschaften<br />
zu ihren Erklärungen kommt, welche Annahmen<br />
sie trifft, wie man ihre Theorien überprüfen kann – und wo<br />
sie falsch liegt. Als Handwerkszeug dafür dienen die neoklassische<br />
Mikroökonomik und statistische Verfahren, wie<br />
Regressionsanalysen. Die Teilnehmenden werden sich in<br />
Konzepte wie Nutzenmaximierung, Lagrange-Optimierung<br />
und Spieltheorie einarbeiten und sie verwenden. Dort, wo<br />
rationale Erklärungen an ihre Grenzen stoßen, diskutieren<br />
sie Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomik und Soziologie<br />
oder erarbeiten sich diese Erkenntnisse selbst, indem<br />
sie Verhaltensexperimente durchführen.<br />
Am Ende des Kurses hat jeder hoffentlich ein Gefühl dafür<br />
bekommen, wie sozialwissenschaftliche Theorien entstehen<br />
und wie viel theoriegeleitete Erkenntnisse über die wirkliche<br />
Welt aussagen können. Damit wäre ein Stück Wissenschaftstheorie<br />
am eigenen Leib erfahrbar geworden.<br />
Für diesen Kurs ist kein über den Schulstoff hinausgehendes<br />
Vorwissen notwendig. Wichtige Voraussetzung ist<br />
Interesse an menschlichem Verhalten, Offenheit für unkonventionelle<br />
Theorien und ein bisschen Spaß an Mathematik.<br />
Marie-Theres von Schickfus (Jg. 1985) ist gerade völlig irrational dabei, ihrem Diplom<br />
in Volkswirtschaftslehre aus Tübingen und Warschau noch einen Magister in Geschichte<br />
hinzuzufügen. Dazu lebt sie in Berlin, wo sie ihre Freizeit mit Opernbesuchen und Ultimate<br />
Frisbee verbringt. Auf der Akademie will sie sich natürlich auch ins Musizieren stürzen und<br />
Ultimate spielen, aber vor allem Ideen mit interessierten und interessanten Menschen austauschen.
Kurs 1.4<br />
Tödliche Entscheidungen<br />
Medizinische und ethische Aspekte von Entscheidungen<br />
über Leben und Tod<br />
»Du sollst nicht töten.« – Das fünfte Gebot ist einfach formuliert,<br />
doch seine Umsetzung im medizinischen Alltag<br />
stellt uns vor erhebliche Probleme. Wann fängt menschliches<br />
Leben an? Was tun, wenn nicht genug medizinische<br />
Hilfe für alle Kranken da ist? Darf das Leben eines Einzelnen<br />
für das Wohl vieler geopfert werden? Was ist mit<br />
dem Selbstbestimmungsrecht von unheilbar Kranken und<br />
Selbstmördern? Was ist der Tod?<br />
Die Disziplin der Medizinethik bemüht sich um einen<br />
systematischen Zugang zu solchen Fragen. Dabei geht es –<br />
anders als in Talkshows und im Zeitungsfeuilleton – nicht<br />
um den Streit über Meinungen, sondern um die Analyse<br />
der zentralen Begriffe und die Überprüfung möglicher Argumente<br />
auf ihre Geltung.<br />
Der Kurs beinhaltet drei Schwerpunkte: allgemeine ethische<br />
Theorie, medizinisch-biologische Grundlagen und die<br />
Diskussion von Problemen der angewandten Ethik.<br />
Kursleitung<br />
Josefine Okoniewski (Jg. 1987) studierte in Leipzig Medizin und hat gerade ihr<br />
Praktisches Jahr u.a. in der Schweiz absolviert. Derzeitig promoviert sie über Globalischämie<br />
und bereitet sich auf ihre Abschlussprüfung vor. In ihrer Freizeit bastelt<br />
und werkelt sie gern, besucht Opernhausveranstaltungen (egal ob Oper, Musical,<br />
Ballett oder Konzert), greift zu einem Buch oder schaut einen guten Film.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I<br />
In der allgemeinen ethischen Theorie werden moralische<br />
Urteile untersucht: Wie funktioniert ein solches Urteil?<br />
Nach welchen Kriterien werden Handlungen als moralisch<br />
gut oder schlecht bewertet? Die Teilnehmenden lesen im<br />
Kurs klassische Autoren, wie Immanuel Kant und John<br />
Stuart Mill, und werden so an den Umgang mit anspruchsvollen<br />
philosophischen Texten herangeführt. Durch die Beschäftigung<br />
mit der ethischen Theorie wird das Fundament<br />
für die anschließende sachliche Diskussion der medizinethischen<br />
Fragen gelegt.<br />
Anhand medizinischer Fachliteratur werden im Kurs die<br />
für die Organspende relevanten Krankheitsbilder mit Ursachen,<br />
Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt,<br />
wie zum Beispiel Nierenversagen, Leberversagen und<br />
Leukämie. Ebenso setzen sich die Teilnehmenden mit dem<br />
Ablauf einer Organspende und den rechtlichen Regelungen<br />
auseinander. Ein weiteres Thema werden die verschiedenen<br />
Stammzelltypen und die Entwicklung von Embryonen<br />
sein, um so die Möglichkeiten, Risiken und Probleme von<br />
Stammzellforschung, Präimplantationsdiagnostik und<br />
Pränataldiagnostik zu verstehen. Ein zusätzlicher Komplex<br />
beschäftigt sich mit Themen zum Ende des Lebens, wie<br />
Sterbehilfe, Suizid und Patientenverfügung.<br />
Den dritten Schwerpunkt des Kurses bilden moderne Aufsätze<br />
aus der angewandten Ethik, welche sich der philosophischen<br />
Untersuchung konkreter moralischer Probleme<br />
widmen. Dazu zählt die gerechte Verteilung von Spenderorganen,<br />
die moralische Zulässigkeit von Sterbehilfe und<br />
die Frage, welchen Schutz und welche Rechte menschliche<br />
Embryonen genießen sollten.<br />
Ein wichtiges Ziel des Kurses ist es, dass die Teilnehmenden<br />
die gängigen Typen von Argumentationen in der<br />
medizinethischen Debatte kennen und einschätzen lernen,<br />
um sich darauf aufbauend eigene Standpunkte zu erarbeiten<br />
und diese begründen zu können.<br />
Martin Palauneck (Jg. 1982) studierte an den Universitäten Leipzig und Basel Philosophie,<br />
Mathematik und Theoretische Physik. Inzwischen promoviert er in Leipzig<br />
über die Rolle von Traditionen in der Moral. Er ist ein Fan von Aristoteles und Kant,<br />
außerdem liebt er alle Arten von Swing, Soul und Funk, spielt Posaune im Studentenorchester<br />
und geht gerne tanzen, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet.<br />
–– 21
22 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 1.5<br />
Zwischen Ostalgie, Verdrängung und Vergessen<br />
Die Geschichte der DDR<br />
Die Geschichte der DDR ist präsent und unsichtbar zugleich:<br />
Einerseits erregen Jahrestage und bestimmte Aspekte<br />
der DDR (z.B. Stasi, Mauer) regelmäßig mediale und<br />
politische Aufmerksamkeit, und die Quantität wissenschaftlicher<br />
Publikationen ist unüberschaubar. Andererseits<br />
jedoch herrscht in breiten Teilen der Bevölkerung wenig<br />
Kenntnis über die Geschichte der DDR. So stellte beispielsweise<br />
eine Berliner Studie von 2007 fest, dass bei 21,8<br />
Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler die DDR<br />
überhaupt nicht Teil des Lehrstoffes war und dass 46,6<br />
Prozent denken, die DDR werde zu wenig thematisiert.<br />
Aus zwei Gründen befindet sich der Umgang mit der DDR-<br />
Geschichte momentan zwischen Ostalgie, Verdrängung<br />
und Vergessen: Erstens steht bis heute der fortdauernde Einigungsprozess<br />
im Vordergrund. Zweitens finden Themen<br />
wie der Alltag oder die Vergnügungskultur in der DDR<br />
kaum den Weg in die Öffentlichkeit. Das Ziel des Kurses ist<br />
es, einen differenzierten Blick auf die Geschichte der DDR,<br />
Ansätze der Geschichtsschreibung, politische Diskussionen<br />
sowie die Erinnerungskultur zu entwickeln.<br />
Kursleitung<br />
Linda Braun (Jg. 1984) studierte in Bielefeld, Basel und Tübingen Geschichte<br />
und Linguistik. Seit 2009 ist sie Doktorandin an der Johns Hopkins<br />
University (Baltimore) und promoviert über die Rezeption und Aufführungspraktiken<br />
von Ragtime und Jazz in Deutschland. In ihrer Freizeit<br />
lässt sie sich von Gesprächen, Büchern, Debatten und Musik (Klassik, Jazz)<br />
faszinieren, spielt gerne Gesellschaftsspiele und lernt Sprachen. Momentan<br />
liest und diskutiert sie besonders gerne jiddische Literatur.<br />
Im ersten Teil des Kurses werden staatliche, wirtschaftliche<br />
und gesellschaftliche Strukturen der DDR im chronologischen<br />
Überblick betrachtet, um ein grundlegendes<br />
Verständnis für die folgenden Inhalte zu schaffen. Zentrale<br />
Themen sind beispielsweise Elemente der Herrschaftspraxis<br />
der SED, Theorie und Lebenswirklichkeit des »real<br />
existierenden Sozialismus« oder auch Konzepte wie »Antifaschismus«<br />
und »Friedensstaat«. Des Weiteren werden<br />
Forschungsansätze und Konzeptionen der DDR als »totalitärer«<br />
Staat, »Unrechtsstaat«, »Fürsorgediktatur«, »Doppelstaat«<br />
oder auch »partizipatorische Diktatur« untersucht<br />
und diskutiert.<br />
Zweitens stehen ausgewählte Themen der DDR-Geschichte<br />
im Mittelpunkt. Zum Beispiel wird der Alltag eine bedeutende<br />
Rolle spielen, insbesondere das Arrangieren mit dem<br />
oder gar das Profitieren von dem Herrschaftssystem im<br />
Gegensatz zur Verfolgung durch den staatlichen Repressionsapparat.<br />
Gerade in Bezug auf die Überwachung ist es<br />
interessant, wie sehr diese auch den Alltag betreffen konnte.<br />
So ist bis heute ungeklärt, warum die hier abgedruckte<br />
Photographie der Sitzecke für die Stasi eine solche Brisanz<br />
hatte, dass sie zerrissen wurde.<br />
Zentral für den dritten<br />
Teil des Kurses ist der<br />
»Kampf um die Erinnerung«<br />
in der DDR<br />
sowie nach 1989 in der<br />
BRD. Wie wurde in dem<br />
selbsternannten »Arbeiter-<br />
und Bauernstaat«<br />
eine Erinnerungskultur in<br />
Anknüpfung an die deut-<br />
http://simonmenner.com/Seiten/Stasi/Stasi%20<br />
-%20Destroyed%20Images.html<br />
(MfS-HA-VII-Fo-0807-0003)<br />
sche Geschichte geschaffen? Wie ist die Erinnerungskultur<br />
in der BRD beschaffen? Welche Aspekte werden betont,<br />
welche ausgeklammert? Welche Rolle nehmen Befürworter<br />
der DDR und Opfer der Repressionen ein?<br />
Für den Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich,<br />
jedoch die Bereitschaft, sich auf neue Inhalte<br />
und Sichtweisen einzulassen und Texte gründlich zu lesen<br />
und zu analysieren. Zur Vorbereitung des Kurses wird<br />
ein Reader zur Verfügung gestellt, der die Grundlage für<br />
den ersten Teil des Kurses schaffen wird. Danach werden<br />
Inhalte und diverse Quellen (z.B. Archivalien, Filme, Tondokumente)<br />
in Gruppen- und Projektarbeit sowie mit dem<br />
ganzen Kurs zusammen erarbeitet.<br />
Andreas Gnahm (Jg. 1982) studierte von 2003 bis 2008 Geschichte, Politikwissenschaft<br />
und Latein an der Universität Tübingen, absolvierte anschließend ein Referendariat und das<br />
Zweite Staatsexamen in Reutlingen und wohnt seit 2010 in Ulm, wo er momentan am Schubart-Gymnasium<br />
als Lehrer tätig ist. In seiner Freizeit beschäftigt er sich nicht nur mit dem<br />
Blick in die Vergangenheit, sondern auch mit dem Blick in die Weite, bevorzugt von den<br />
Bergen aus. In flacheren Regionen lässt er sich auch gerne von Literatur, Musik und Gesellschaftsspielen<br />
mit guten Freunden begeistern.
Kurs 1.6<br />
Die Weisheit der Pointe<br />
Amerikanische Sitcoms<br />
Wenn in einer Serie Lachkonserven die Zuschauer darauf<br />
aufmerksam machen, wo die Pointe war, dann handelt es<br />
sich um eine Sitcom. Diese kurze Spezialform der Serie ist<br />
seit den 1980er Jahren in vielfachen Variationen fester Bestandteil<br />
amerikanischer Serienkultur. Auch im deutschen<br />
Fernsehen sind viele Sitcoms synchronisiert zu TV-Hits geworden:<br />
Von Alf, Eine schrecklich nette Familie über Friends<br />
und Die Nanny bis zu How I Met Your Mother sind Sitcoms<br />
oft über Jahre ein Teil unseres kulturellen Alltags. Als<br />
Zuschauer verfolgen wir die Beziehungen, Konflikte und<br />
Entwicklungen der jeweiligen Figuren, wir lachen über die<br />
Pointen, über die Missgeschicke, über die Situationskomik<br />
– und vor allem über das, was wir wiedererkennen als unser<br />
Eigenes.<br />
Das Fernsehen und Serien insbesondere können als »kulturelles<br />
Forum« gelten, auf dem unterschiedliche Ansichten,<br />
Lebensstile und gesellschaftliche Normen vorgestellt und<br />
Kursleitung<br />
Barbara Hornberger (Jg. 1970) studierte Kulturwissenschaften mit den<br />
Fächern Musik und Literatur/Theater/Medien sowie den Schwerpunkten<br />
Gesang und Populäre Kultur. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
an der Universität Hildesheim darf sie sich beruflich mit den Dingen<br />
beschäftigen, die ihr am meisten Spaß machen: Musik, Theater, Film,<br />
Kabarett, Fernsehen, Literatur … und zwar praktisch und theoretisch.<br />
Nach einigen Jahren der Akademieleitung freut sie sich jetzt wieder auf<br />
einen spannenden Kurs und eine weitere <strong>SchülerAkademie</strong>.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG I<br />
verhandelt werden. Serien bieten spielerisch Verhaltens-<br />
und Weltmodelle an, Sitcoms tun dies mit Mitteln der<br />
Komik. Dabei werden stellvertretend Konflikte durchgespielt<br />
und Lösungen ausprobiert. Diese Angebote müssen<br />
von den Zuschauern nicht übernommen werden, aber sie<br />
bieten einen Orientierungsrahmen und Möglichkeiten zur<br />
Auseinandersetzung. Darum sind Serien auch gesellschaftliche<br />
Integrationsorte: Mitten in der Unterhaltung werden<br />
Probleme, Tabus, gesellschaftliche Fragen platziert und die<br />
verschiedenen Perspektiven darauf durchgespielt. Gesellschaftliche<br />
und kulturelle Veränderungen finden so ihren<br />
Widerhall in fiktionalen Erzählungen.<br />
Im Kurs werden verschiedene Sitcoms – Klassiker ebenso<br />
wie aktuelle Erfolgsserien – auf ihre Weltentwürfe, Erzählweisen,<br />
Figuren-Konstellationen, Dramaturgie-Konzepte<br />
und Schauspielstile hin analysiert und verglichen. Theore-<br />
tischer Hintergrund der Analysen sind verschiedene kulturwissenschaftliche<br />
Konzepte und Methoden, u.a. aus den<br />
Cultural Studies und der Hermeneutik.<br />
Ziel ist es, den Teilnehmenden eine grundlegende Einführung<br />
in die Analyse von Sitcoms und Serien zu geben.<br />
Dabei erhalten sie zugleich eine allgemeine Einführung ins<br />
kulturwissenschaftliche und medienwissenschaftliche Arbeiten<br />
sowie in die Theorien zur Populären Kultur.<br />
In einem zweiten Schritt werden die gewonnenen Erkenntnisse<br />
in eine eigene Schreib- und Spielpraxis überführt und<br />
darin überprüft und ausprobiert: Die Teilnehmenden werden<br />
selbst zu Drehbuchautoren avancieren und innerhalb<br />
der analysierten Sitcomstoffe eigene Erzählvariationen entwickeln.<br />
Die Ergebnisse können dann in Auszügen gefilmt<br />
oder auf der Bühne ausprobiert werden.<br />
Eric Rentmeister (Jg. 1979) arbeitet als freischaffender Schauspieler, Sänger, Regisseur und Choreograph.<br />
Direkt nach dem Diplom 2004 an der Folkwang Hochschule Essen wurde er von Vincent<br />
Paterson (bekannt als Choreograf von Madonna, Michael Jackson) als Conférencier für das<br />
Musical »Cabaret« in Berlin engagiert. In den letzten Monaten spielte er in der «West Side Story»<br />
und in «La Cage aux Folles». Im Schauspiel war er u.a. in »Woyzeck« und »Die Heilige Johanna<br />
der Schlachthöfe« zu sehen, aktuell im mehrfach nominierten und ausgezeichneten »Adler an Falke«.<br />
2009 übernahm er die Choreographie bei »Evita« am Theater Dortmund. Seine jüngste Regiearbeit<br />
war »Hänsel und Gretel« (2008) am Westdeutschen Tourneetheater Remscheid.<br />
–– 23
24 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II (16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>)<br />
Akademie<br />
Braunschweig II<br />
CJD Jugenddorf-Christophorusschule<br />
Braunschweig<br />
Fortsetzung von Seite 16:<br />
In der Schule ist die gute Ausstattung des naturwissenschaftlichen Bereichs hervorzuheben.<br />
Sowohl in der Bibliothek als auch im PC-Zentrum bietet die Schule vernetzte Rechner-Pools mit<br />
Internet-Zugang.<br />
Vielfältig sind die Möglichkeiten zur sportlichen und musisch-künstlerischen Betätigung auf<br />
dem Jugenddorfgelände: Für Fußball kann ein Kleinspielfeld genutzt werden, ferner gibt es ein<br />
Volleyball- und ein Beachvolleyballfeld sowie einen Basketballkorb. Außerdem steht eine große,<br />
teilbare Sporthalle mit einem separaten Gymnastikraum zur Verfügung. Zwei Tischtennisplatten<br />
und zwei Tischkicker, die sich auf dem Außengelände des Jugenddorfes befinden, runden das<br />
Angebot ab.<br />
Zum Musizieren laden Klaviere, drei Flügel, ein Cembalo und verschiedene andere Instrumente<br />
ein. Ferner gibt es einen Bandkeller und ein Kammertheater mit ca. 100 Plätzen. Zum Kunstbereich<br />
gehören Zeichensaal und Werkraum.
JUGENDDORF-CHRISTOPHORUSSCHULE BRAUNSCHWEIG<br />
GEORG WESTERMANN-ALLEE 76<br />
38104 BRAUNSCHWEIG<br />
www.cjd-braunschweig.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
2.1 Simulierte Natur<br />
2.2 Kosmos und Chaos …<br />
2.3 Design Thinking<br />
2.4 Wissenschaftskommunikation<br />
2.5 Zitiert? Plagiiert? Bearbeitet?<br />
2.6 Texte auf Wanderschaft<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Mario Pfister (Jg. 1988) studiert derzeit an der Uni Regensburg Lehramt Musik<br />
und an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg<br />
(HfMK) Chorleitung bei Prof. Kunibert Schäfer, unter dessen Leitung<br />
er u.a. im Neuen Kammerchor der HfKM singt. Neben dem Studium gilt sein<br />
musikalisches Engagement v.a. dem Vokalensembles »assonanz« aus Bamberg<br />
als aktiver Sänger und musikalischer Leiter. Als Ausgleich neben der Musik hat<br />
seit vielen Jahren das Basketballspielen einen wichtigen Platz in der Freizeitgestaltung,<br />
auch mit Freunden verbringt er sehr gerne Zeit. Für ihn ist es die erste<br />
Teilnahme an der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>.<br />
(16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II<br />
Akademieleitung<br />
Hartmut Rosa (Jg. 1965) wurde auf einen Lehrstuhl für Allgemeine und Theoretische<br />
Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen – nachdem<br />
er zuvor in Augsburg und Essen Politische Theorie lehrte und in Freiburg,<br />
London, Berlin und Harvard Politikwissenschaft, Germanistik und Philosophie<br />
studierte. In seinem Buch »Beschleunigung« geht er der Frage nach, warum wir<br />
nie Zeit haben, obwohl wir dauernd welche sparen. Ab und zu lehrt er auch<br />
an der New School for Social Research in New York – der schnellsten Stadt der<br />
Welt. Zum Ausgleich blickt er als Hobby-Astronom in die Sterne, spielt und hört<br />
alle Arten von Musik von Mozart bis Rock Hard oder er orgelt in kleinen Kirchen, wenn er nicht<br />
hinter Bällen unterschiedlicher Größe herrennt: Kickern, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Fußball<br />
...<br />
Svenja Esins (Jg. 1989), 2008 selbst Teilnehmerin der <strong>DSA</strong> in Rostock, leitet<br />
seitdem fast jährlich Akademien zusammen mit Hartmut Rosa. Sie studiert Medizin<br />
in der Fahrradstadt Münster. Nebenbei spielt sie Wasserball und hat nun<br />
auch den Tauchsport für sich entdeckt. Musik (Querflöte) sowie das Reisen gehören<br />
zu ihren größten Leidenschaften. Das Schuljahr 2006/2007 hat sie in<br />
Texas verbracht und betreut nun ehemalige und zukünftige Austauschschüler.<br />
Sie freut sich jetzt schon auf die Teilnehmenden der Akademie Braunschweig,<br />
auf gemeinsames Musizieren und viele spannende Mitternachtsfußballspiele.<br />
–– 25
26 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II (16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 2.1<br />
Simulierte Natur<br />
Die Physik hat große Fortschritte gemacht hin zu einem<br />
sehr detaillierten Verständnis der grundlegenden Gesetzmäßigkeiten<br />
der Natur. Folgt daraus<br />
aber auch ein ebenso detailliertes<br />
Verständnis aller beobachtbaren Naturvorgänge?<br />
Nicht automatisch, da<br />
die Komplexität realer Vorgänge in<br />
den meisten Fällen dazu führt, dass<br />
eine geschlossene Lösung entweder<br />
gar nicht oder nur sehr schwierig zu<br />
finden ist. Daher lassen sich in nur<br />
wenigen idealisierten Fällen aus den<br />
Gesetzen der Physik direkte Vorhersagen<br />
ableiten.<br />
Um dennoch Aussagen über das<br />
Verhalten von Systemen machen zu<br />
können, kann man in Fällen, in denen<br />
experimentelle Studien am tatsächlichen Objekt nicht<br />
möglich oder zu aufwendig sind, auf Simulationen zurückgreifen.<br />
Mit der wachsenden Verfügbarkeit immer größerer<br />
Kursleitung<br />
Computerressourcen sind numerische Simulationen von<br />
der Wettervorhersage bis zum Entwurf eines Gebäudes allgegenwärtig<br />
geworden. Eine numerische<br />
Simulation kann einmal als<br />
Vorhersagewerkzeug hilfreich sein,<br />
z.B. wenn die physikalische Theorie<br />
gut etabliert ist, aber der Systemaufbau<br />
sehr komplex. Zum anderen ist<br />
es aber auch möglich zu überprüfen,<br />
inwieweit die Theorie, die hinter<br />
der Simulation steht, Vorhersagen<br />
produziert, die mit experimentellen<br />
Gegebenheiten im Einklang stehen.<br />
Ziel der Simulation ist es dabei,<br />
alle wesentlichen Eigenschaften des<br />
Systems abzubilden, und ihr Verhalten<br />
zu modellieren. Wie stellt man<br />
jedoch fest, ob alle wesentlichen Eigenschaften berücksichtigt<br />
sind? Welche Information bezieht man in den Entwurf<br />
der Simulation ein? Welche vereinfachenden Annahmen<br />
sind berechtigt? Kann man dem Ausgang der Simulation<br />
trauen? Wie genau entspricht der Simulationsausgang dem<br />
David Grellscheid (Jg. 1975) ist Elementarteilchenphysiker und lebt seit einigen Jahren<br />
in Durham in Nordengland, wo er an einem Softwarepaket zur Simulation von<br />
Teilchenkollisionen mitarbeitet, das von den Experimenten am Europäischen Kernforschungszentrum<br />
(CERN) verwendet wird. Er studierte Physik in Stuttgart und Cambridge,<br />
Großbritannien. Dort promovierte er zu einem Thema aus der Stringtheorie, bevorzugt<br />
jetzt aber physikalische Theorien, die sich auch überprüfen lassen. Neben der<br />
Wissenschaftsgeschichte interessieren ihn technische und juristische Risiken der Computernutzung<br />
und Fragen zum gesellschaftlichen Stellenwert der Naturwissenschaften.<br />
Die Teilnehmenden sollten ein Interesse an der mathematischen<br />
Modellierung von Naturvorgängen und am <strong>Programm</strong>ieren<br />
mitbringen, besondere Vorkenntnisse oder <strong>Programm</strong>iererfahrung<br />
sind jedoch nicht notwendig. Sowohl die nötige Mathematik<br />
als auch die verwendete <strong>Programm</strong>iersprache Python wird<br />
im Vorfeld des Kurses eingeführt.<br />
tatsächlichen Experiment, das man eventuell nie direkt<br />
durchführen kann?<br />
Anhand von <strong>Programm</strong>ierprojekten zu Themen wie Schaukeln,<br />
Satellitenbahnen, Ameisenstraßen, Gravitationswellen<br />
und Elementarteilchen, wird der Kurs einen Überblick<br />
über die Modellierung physikalischer Vorgänge auf dem<br />
Computer geben und einige dieser Fragen beantworten.<br />
Dabei steht zunächst eine Einarbeitung in die jeweilige<br />
physikalische Theorie am Anfang. Im praktischen Teil werden<br />
zu Beginn einige kleinere Simulationsprojekte stehen,<br />
die vom Aufbau her nicht sehr komplex sind, an denen<br />
sich aber die Arbeitsschritte und Probleme gut verdeutlichen<br />
lassen. Hier lassen sich einige der grundlegenden<br />
Techniken wie z.B. Differenzialgleichungen, Integralberechnung,<br />
Zufallsbewegung oder Optimierung einzeln betrachten.<br />
Referate der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bilden<br />
jeweils den Einstieg in ein Thema.<br />
Im Verlauf des Kurses werden dann in Gruppen einige der<br />
Projekte umgesetzt.<br />
Carsten Schneemann (Jg. 1977) hat es während seines Studiums der Mathematik<br />
und Physik aus der schwäbischen Heimat, nach Zwischenstopps in Stuttgart<br />
und Göttingen, ins preussische Potsdam verschlagen, wo er sich am Albert-Einstein-Institut<br />
mit der Simulation von Gravitationswellen beschäftigte. Mittlerweile<br />
entwickelt er bei einer kanadischen Firma bildgebende Systeme für die Kardiologie,<br />
was ihm auch erlaubt, intensiv seiner Reisefreude nachzugehen. Darüber hinaus<br />
interessiert er sich für Wissenschaftsphilosophie und gesellschaftsrelevante<br />
Aspekte naturwissenschaftlicher Forschung.
(16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II<br />
Kurs 2.2<br />
Kosmos und Chaos – Paradigmen<br />
des Studiums chaotischer Systeme<br />
Ein interdisziplinärer Streifzug zwischen Philosophie, Mathematik und Physik<br />
»VORHERSAGEN SIND SCHWIERIG,<br />
BESONDERS WENN SIE DIE ZUKUNFT BETREFFEN.«<br />
NIELS BOHR<br />
Mit der Entwicklung der modernen, quantitativen Naturwissenschaften<br />
durch Galilei, Kepler, Newton u.a. kündigt<br />
sich ein Umbruch nicht nur in diesen Wissenschaften<br />
selbst, sondern in den fundamentalen Kategorien des<br />
Nachdenkens über die Welt an. Die herausragenden Erfolge<br />
der neuen mechanischen Theorie, ihre großartige<br />
Kraft in der Synthese und Erklärung der scheinbar heterogensten<br />
Phänomene regten die Zeitgenossen an, sich den<br />
Fragen nach den großen Zusammenhängen des Weltgeschehens<br />
neu zu stellen und neue Deutungen zu entwerfen.<br />
Unter diesen der französische Mathematiker Laplace, der<br />
– um 1800 – annahm, dass die Kenntnis der Welt zu einem<br />
einzigen Augenblick ausreichen müsse, um ihre ganze Vergangenheit<br />
und Zukunft vollständig zu durchschauen – so-<br />
Kursleitung<br />
Fabian Bernstein (Jg. 1982) studierte Physik, Musik, Kultur- und Musikwissenschaft<br />
in Berlin und Paris. Daher zählte die Herstellung photonischer Raumgitter<br />
in Photopolymeren ebenso zu seinem Studiencurriculum wie quellenkritische<br />
Untersuchungen von Manuskripten Felix Mendelssohn Bartholdys. Im<br />
Jahr 2000 nahm er zusammen mit Peter Parczewski an einer <strong>SchülerAkademie</strong><br />
in Gaesdonck zur »Entfaltung von Paradoxien« teil. Seine Freizeit verbringt er<br />
vornehmlich am Klavier, lesend oder in Gesellschaft seiner Freunde.<br />
fern nur die Naturgesetze, die sie beherrschen, vollständig<br />
bekannt seien. Laplace war sich der praktischen Uneinholbarkeit<br />
der Voraussetzung natürlich bewusst, doch war<br />
sein Argument, vom Standpunkt des damaligen Wissens,<br />
nichtsdestotrotz korrekt.<br />
Als Mathematiker dachte Laplace an die Kombination von<br />
Differenzialgleichungen und Anfangsbedingungen, die in<br />
der Tat die Dynamik eines Systems vollständig festlegen.<br />
Anschaulich wird jeder Zustand als Ursache des folgenden<br />
gedacht, der aus ihm mittels der Naturgesetzlichkeit hervorgeht.<br />
Wenn dies so ist, dann genügt die Kenntnis eines<br />
einzigen Augenblicks, um daraus die Zustände zu allen<br />
anderen Zeitpunkten abzuleiten. Immanuel Kant hat diesen<br />
Gedanken, geschult an Newton, in der »Kritik der reinen<br />
Vernunft« so ausgesprochen: »Wenn wir also erfahren, daß<br />
etwas geschieht, so setzen wir dabei jederzeit voraus, daß<br />
irgend etwas vorausgehe, worauf es nach einer Regel folgt.«<br />
Erst im 20. Jh. konnte Henri Poincaré zeigen, dass mit dem<br />
Räsonnement Laplaces etwas grundsätzlich nicht stimmt.<br />
Aber was? Oder anders gefragt: Wo irrte Laplace?<br />
Diese Frage führt unmittelbar in die aufregende Welt der<br />
Chaosforschung, die den Kurs sowohl in ihren mathematischen<br />
und physikalischen als auch philosophischen<br />
Aspekten beschäftigen wird. In diesem Erkundungsgang<br />
werden anschauliche Phänomene, wie der sprichwörtlich<br />
gewordene Schmetterlingseffekt (und die Frage, was es<br />
damit eigentlich auf sich hat) oder Musterbildungsprozesse<br />
in der (Entwicklungs-)Biologie ebenso wenig fehlen, wie<br />
die Besichtigung der notwendigen mathematischen Begriffe<br />
und Modelle. Was ist ein Phasenraum, ein Attraktor, eine<br />
Bifurkation? Einen Schlüssel zum Verständnis dieser Konzepte<br />
bildet die logistische Abbildung, die daher mit der<br />
gebotenen Sorgfalt untersucht werden wird. Es wird sich<br />
zeigen, dass sich die zuweilen äußerst komplexe Dynamik<br />
chaotischer Systeme in einem einfachen mathematischen<br />
Formalismus kodieren lässt, dem der symbolischen Dynamik.<br />
Dieses mathematische Handwerkszeug wird es<br />
erlauben, die verborgenen Mechanismen des Chaos besser<br />
zu verstehen und ihm auf allerlei Wegen zu folgen, es im<br />
Computer zu simulieren und in unserer Umwelt um uns<br />
herum, ja in der Tat: auf Schritt und Tritt, zu entdecken.<br />
Peter Parczewski (Jg. 1981) studierte in Stuttgart und Heidelberg Mathematik. Die Promotion<br />
über ein Thema der stochastischen Integrationstheorie bezüglich der fraktionalen<br />
Brownschen Bewegung führte ihn dann über Braunschweig nach Saarbrücken. In seiner<br />
Freizeit rennt er schon mal einen Berg hinauf, beispielsweise auch in den Alpen bei der<br />
Europameisterschaft im Extremberglauf. Neben Leichtathletik und dem Sportteil der Süddeutschen<br />
Zeitung widmet er sich aber vor allem dem Schreiben, welches mittlerweile<br />
gerinnt, sodass er sich 2011 im Finale des »Literaturwettbewerbs open mike« wiederfand.<br />
–– 27
28 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II (16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 2.3<br />
Design Thinking<br />
Eine praktische Annäherung an einen Diskurs im Kontext von Internet und Gesellschaft<br />
»ICH BIN NIE GESCHEITERT, ICH HATTE<br />
NUR ZEHNTAUSENDE IDEEN, DIE NICHT<br />
FUNKTIONIERTEN.«<br />
BENJAMIN FRANKLIN<br />
Lange war der Design Prozess vom Engineering-Gedanken<br />
geprägt: Man ging davon aus, dass man das Problem kennt<br />
und dass die Aufgabe darin besteht, die richtige Lösung zu<br />
finden. Immer wieder musste man jedoch feststellen, dass<br />
sowohl das Problem als auch die dafür entwickelten Lösungen<br />
nicht den Bedürfnissen der Benutzer entsprachen.<br />
In jüngerer Zeit bahnte sich daher ein Wandel des Innovationsverständnisses<br />
an. Dabei werden Problemstellungen<br />
und Lösungen in einem zyklischen und iterativen Prozess<br />
entwickelt, wobei sukzessive Bedürfnisse aufgedeckt, Ideen<br />
generiert, Konzepte entwickelt und vorläufige Prototypen<br />
an den Bedürfnissen der Nutzer gemessen werden.<br />
Design Thinking wird also in erster Linie als ein Lernprozess<br />
verstanden. In einem Zusammenspiel eines<br />
Kursleitung<br />
Jeremias Schmitt (Jg. 1985) studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation<br />
an der Universität der Künste Berlin. Er schreibt momentan an seiner<br />
Masterarbeit am Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation. Seit Oktober<br />
2011 ist er Student an der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-<br />
Institut in Potsdam. Derzeitig arbeitet er am Alexander von Humboldt Institut<br />
für Internet und Gesellschaft in Berlin.<br />
UNDERSTAND OBSERVE<br />
POINT<br />
OF<br />
VIEW<br />
IDEATE PROTOTYPE TEST<br />
Eigene Darstellung in Anlehung an Plattner et al. 2009, 114<br />
heterogenen Teams, bestehend aus Nutzern, Forschern<br />
und Entwicklern, soll so neues Wissen generiert werden.<br />
Dementsprechend gilt es, eine »gemeinsame« Sprache zu<br />
erlernen. Die Methode des Design Thinkings kann dieses<br />
ermöglichen. Der Prozess gestaltet sich in sechs Schritten,<br />
die in wiederholten Schleifen Rückkopplungen zulassen<br />
und sich so immer wieder gegenüber neuem Wissen öffnen<br />
(vgl. Abb.). Die Schritte werden in analytische Phasen, in<br />
denen Informationen gesammelt, geordnet und ausgewertet<br />
bzw. in synthetische Phasen klassifiziert, in denen<br />
Lösungen generiert, erprobt und verbessert werden vgl.<br />
Plattner et al. 2009, 61)<br />
Ziel des Kurses ist die Einführung in die Methodik des<br />
Design Thinkings, um ein ganzheitliches Verständnis des<br />
Prozesses zu erhalten. Der Fokus liegt auf der Integration<br />
von Forschung, Entwicklung und Anwenderperspektive.<br />
Dafür werden unterschiedliche Verfahren der qualitativen<br />
Sozialforschung vorgestellt. Kreativtechniken wie Brainstorming,<br />
assoziatives, abduktives oder visuelles Denken sowie<br />
Spieltheorien und Prototyping sollen ebenfalls vermittelt<br />
werden. Gleichzeitig sollen die einzelnen Techniken von<br />
den Teilnehmenden in einem kritischen Diskurs reflektiert<br />
werden, so dass ihre gezielte Anwendung erlernt und beurteilt<br />
werden kann.<br />
Zu einem der wichtigsten Grundprinzipien des Design<br />
Thinkings zählt Multidisziplinarität, die unterschiedliche<br />
fachliche Herkunft der einzelnen Mitglieder. Heterogenität<br />
ist der Ausgangspunkt für Diffusion und Differenzierung.<br />
Spezifische Vorkenntnisse sind jedoch nicht erforderlich.<br />
Der Kurs richtet sich daher an alle diejenigen, die sich<br />
gerne mit praktischen und gesellschaftlichen Problemstellungen<br />
befassen, Freude am Experimentieren haben und<br />
den Kollegen der Stanford University zustimmen, die an<br />
dieser Stelle sagen würden: »fail often and early«.<br />
Quelle: Plattner, Hasso; Meinel, Christoph; Weinberg, Ulrich<br />
(2009): Design Thinking: Innovation lernen – Ideenwelten<br />
öffnen. München: FinanzBuch Verlag GmbH.<br />
Paula Zscheischler (Jg. 1984) studierte nach dem Abitur und einem anschließenden<br />
12-monatigen Aufenthalt in Krakau Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an<br />
der Universität der Künste Berlin und Design an der Hochschule der Künste in Zürich.<br />
Ihre Diplomarbeit schrieb sie am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation<br />
und dem Institut für Technologiemanagement der Universität Stuttgart. In ihrer<br />
Freizeit liest sie, macht Musik, liebt Museen und geht gerne tauchen.
Kurs 2.4<br />
(16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II<br />
Wissenschaftskommunikation<br />
Der lebendige Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft<br />
Wissenschaftliche Themen sind stark präsent in Öffentlichkeit<br />
und Medien. In den Schlagzeilen liest man von<br />
schwarzen Löchern, Supercomputern und überlichtschnellen<br />
Neutrinos – aber was bedeutet das für das tägliche<br />
Leben? Welche Fragen der Menschheit werden damit<br />
beantwortet, und wie kommt die Forschung zu diesen Ergebnissen?<br />
Vor allen Dingen: Wie kommen diese Themen<br />
in die Öffentlichkeit?<br />
Hinter den Schlagzeilen steckt die Arbeit von Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftlern in Universitäten, Laboren<br />
und Forschungsinstituten. Hier wird Grundlagenforschung<br />
betrieben, und die fachliche Kommunikation findet auf<br />
Expertenniveau statt. Damit andere etwas davon mitbekommen,<br />
hat sich eine zweite Kommunikationsebene<br />
entwickelt: Der Dialog mit den Menschen außerhalb der<br />
Forschung. Hier setzt Wissenschaftskommunikation an.<br />
Begründet im gesellschaftlichen Interesse und in der Ver-<br />
Kursleitung<br />
antwortung der Wissenschaft für öffentliche Fördermittel<br />
wird sie immer wichtiger. Wissenschaftskommunikation<br />
hat die Aufgabe, der Öffentlichkeit in verständlicher Form<br />
wissenschaftliche Arbeit und Ergebnisse zu erklären. Die<br />
Möglichkeiten reichen von populärwissenschaftlichen<br />
Fernsehbeiträgen und Zeitschriften bis zu Wissenschaftsnächten<br />
oder Ausstellungen. Neben Transparenz und<br />
Anschaulichkeit ist auch die Motivation von wissenschaft-<br />
lichem Nachwuchs ein<br />
Ziel der Wissenschaftskommunikation.<br />
Kathrin Goldammer (Jg. 1980) studierte in Berlin Elektrotechnik und promovierte<br />
am Elekronensynchrotron BESSY in Berlin in Beschleunigerphysik. Danach<br />
zog es sie in die Energiewirtschaft, wo sie zunächst bei einem Schweizer Energieversorger<br />
als Asset Optimizer zuständig war für die Bewirtschaftung der deutschen<br />
Kraftwerke. Seit 2010 leitet sie bei einer mittelständischen Unternehmensberatung<br />
in Berlin den Funktionsbereich Realoptionen und beschäftigt sich mit den Kraftwerken<br />
und Gasspeichern von Stadtwerke-Kunden und Industrieunternehmen.<br />
Ihre Freizeit wird bestimmt von einem großen Freundeskreis, täglichem Fahrradfahren<br />
und ihrer Freude an Konzerten, Kino, Theater und der japanischen Sprache. Sie freut sich auf<br />
ihre zweite <strong>DSA</strong> als Kursleiterin.<br />
Am Anfang des Kurses<br />
steht eine Bestandsaufnahme:<br />
Die Teilnehmenden<br />
analysieren die verschiedenen<br />
Formen der Wissenschaftskommunikation von der<br />
Pressemitteilung bis zum Science Slam. Welche Methoden<br />
werden verwendet, und wie wirken die Formate auf die Öffentlichkeit?<br />
Der Kurs untersucht, mit welchen Stilmitteln<br />
Forschungsinstitute, Universitäten und Kommunikationsa-<br />
genturen wissenschaftliche Ergebnisse aufbereiten und präsentieren.<br />
Dabei liegt der fachliche Schwerpunkt auf den<br />
Natur- und Technikwissenschaften, Stichwort MINT.<br />
Das Ziel ist die Entwicklung eines eigenen Formats zur<br />
Wissenschaftskommunikation. Dabei beschäftigen sich die<br />
Teilnehmenden gleichsam mit Inhalten, Methoden und<br />
Menschen aus der Wissenschaft. Inhalte sind Beispiele des<br />
physikalischen Grundlagenwissens, die der Kurs in selbst-<br />
gebauten Experimenten<br />
untersucht, genauso wie<br />
aktuelle Ergebnisse aus<br />
der Forschung. Wissenschaftliche<br />
Methodik bedeutet:<br />
Welche Methoden<br />
wendet die Wissenschaft<br />
an, um Erkenntnisse zu<br />
gewinnen, und wie helfen diese Methoden im Alltag? Zuletzt<br />
beschäftigt sich der Kurs mit den Menschen in der<br />
Wissenschaft: Was treibt sie an und was kann man von<br />
ihnen lernen? In Form einer Art »BRAVO Science« werden<br />
im Kurs die Ergebnisse umgesetzt.<br />
Der Kurs lebt vom Interesse an naturwissenschaftlichen Themen und<br />
ihrer Popularisierung; besondere Vorkenntnisse in diesen Bereichen sind<br />
allerdings nicht erforderlich. Das Kursziel wird durch einen interdisziplinären<br />
Ansatz und mit einem (für die Teilnehmenden individuell wählbaren)<br />
Mix aus journalistischer Recherche, wissenschaftlichem Experimentieren,<br />
didaktischer Kommunikation und kreativer Arbeit erreicht.<br />
Thorsten Kamps (Jg. 1970) studierte Physik an der Technischen Universität Dortmund<br />
mit den Schwerpunkten Elementarteilchen- und Beschleunigerphysik. Seine Doktorarbeit<br />
fertigte er am <strong>Deutsche</strong>n Elektronen-Synchrotron (DESY) und an der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin an. Danach arbeitete er an der Royal Holloway University<br />
in London für das internationale Forschungsprojekt International Linear Collider mit<br />
Aufenthalten am Forschungszentrum der Europäischen Organisation für die Kernforschung<br />
(CERN), in Genf, in den USA und in Japan. Wieder zurück in Berlin ist er als<br />
Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie beschäftigt.<br />
Sein Forschungsschwerpunkt ist die Erzeugung und Diagnose von hochbrillianten Elektronenstrahlen<br />
für Teilchenbeschleuniger. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Fahrrädern, Musik und Popkultur.<br />
–– 29
30 ––<br />
AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II (16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 2.5<br />
Zitiert? Plagiiert? Bearbeitet?<br />
Urheberrechtliche und musiktheoretische Fragen musikalischer Bearbeitung<br />
»Original« und »Bearbeitung« – zwei<br />
Begriffe, die für sich betrachtet eindeutig<br />
zu sein scheinen, die quasi<br />
eine Trennlinie zwischen sich ziehen.<br />
Demnach müssten auch im künstlerischen<br />
Schaffensprozess klare Verhältnisse<br />
herrschen: das musikalische<br />
»Werk«, also die Neuschöpfung,<br />
einerseits und die »Bearbeitung«, d.h.<br />
die Umgestaltung, andererseits. Aber<br />
allein die Gattungsvielfalt (Transkrip- Gabriel Fauré<br />
tion, Reminiszenz, Variation, Paraphrase, um nur einige zu<br />
nennen) offenbart bereits, dass die Einflüsse anderer Werke<br />
beim Komponieren nicht nur unterbewusst, sondern auch<br />
bewusst wirksam sind. Damit drängt sich eine weitere<br />
Frage auf, und zwar keine musikalische, sondern eine<br />
rechtliche: die nach dem Schutz des geistigen Eigentums<br />
des Schöpfers eines Werks. Verfolgt man die Geschichte<br />
des (Musik-) Urheberrechts, so fällt auf, dass die Begriffe<br />
»Original« und »Bearbeitung«, »Schutz der Melodie« und<br />
»Zitat« erst im 18./19. Jahrhundert zunehmend eine Rol-<br />
Kursleitung<br />
Maren Wilhelm (Jg. 1977) studierte Schulmusik, Germanistik,<br />
Musiktheorie und Komposition in Hannover. Seit 2009 ist sie stellvertretende<br />
Professorin für Musiktheorie an der Musikhochschule<br />
Hannover. Wenn sie nicht in irgendeiner Form mit Musik beschäftigt<br />
ist, bekocht sie gerne Freunde oder ihren Mann. Dies ist ihre zweite<br />
Akademie.<br />
le spielen, nämlich einerseits mit dem Aufkommen des<br />
künstlerischen Anspruchs nach »Originalität« eines Werks<br />
(damit verbunden: auf Anerkennung der Urheberschaft)<br />
sowie andererseits der lauter werdenden, für den Künstler<br />
oft elementaren, Forderung nach einem wirksamen Schutz<br />
seiner wirtschaftlichen Urheberinteressen.<br />
Im Kurs werden beide Seiten, die juristische<br />
des Urheberrechts und die<br />
musiktheoretische, gleichermaßen anhand<br />
der konkreten Erscheinung, des<br />
musikalischen Werks beleuchtet. Inhaltlicher<br />
musikalischer Schwerpunkt<br />
ist das 19. Jahrhundert mit zwei Zeitgenossen:<br />
zum einen eine der schillerndsten<br />
Virtuosengestalten, nämlich Franz<br />
Liszt (insb. Klaviertranskriptionen),<br />
zum anderen Gabriel Fauré (Pelléas et<br />
Mélisande), Komponist und Direktor<br />
des Conservatoire de Paris.<br />
Für diesen interdisziplinär angelegten<br />
Jura- und Musik-Kurs sind weder<br />
juristische noch musikwissenschaft-<br />
liche Vorkenntnisse<br />
erforderlich, doch<br />
sollte die Bereitschaft<br />
und Fähigkeit zu<br />
analytischem und<br />
logischem Denken,<br />
Ausschnitt aus dem Originalmanuskript der<br />
Liszt-Transkription von Schuberts »Die Nebensonnen«<br />
(aus: »Die Winterreise«)<br />
Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1870 Nr.<br />
19 »Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken,<br />
Abbildungen, musikalischen Kompositionen<br />
und dramatischen Werken« vom<br />
11. Juni 1870<br />
aber auch kreativem Arbeiten sowie<br />
die Freude an klassischer Musik<br />
ausgeprägt sein. Musikalische Grundkenntnisse<br />
(einschließlich Noten lesen<br />
können) werden vorausgesetzt.<br />
Jens Ph. Wilhelm (Jg. 1963) studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Wien, unterrichtete<br />
Strafrecht an den Universitäten Heidelberg und Mannheim und ist mittlerweile hauptamtlicher<br />
Dozent an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), wo er vor allem Straf- und Strafverfahrensrecht<br />
sowie Staatsrecht lehrt. Für ihn ist es seine elfte Akademie und der zweite Kurs zum Thema<br />
»Musik und Recht«, was es ihm ermöglicht, seine musikalischen (Chorgesang, Klavier) und juristischen<br />
Interessen zusammenzuführen.
Kurs 2.6<br />
Texte auf Wanderschaft<br />
Identitäten in Bewegung<br />
IN MEINEM BUCH GIBT ES DA EINEN SATZ DAZU,<br />
DER DAS GUT UMREISST: »ICH BIN NICHT DAHEIM,<br />
ICH BIN ANGEKOMMEN.« DAHEIM IST SO EINE<br />
SACHE. DAHEIM WÜRDE ICH MICH IN RUSSLAND<br />
SCHON GAR NICHT FÜHLEN. ABER ES IST SCHON<br />
SO, DASS ICH MICH AUCH IN ÖSTERREICH NICHT<br />
100 PROZENT DAHEIM FÜHLE. [...] ICH DENKE<br />
NUR, DASS DIESE ENTWURZELUNG, MIR DIE<br />
MÖGLICHKEIT GENOMMEN HAT, MICH INNERLICH<br />
NOCH EINMAL FIX WO NIEDERZULASSEN. IN DER<br />
SPRACHE ALLERDINGS FÜHLE ICH MICH SOWOHL<br />
ANGEKOMMEN ALS AUCH »DAHEIM«.<br />
JULYA RABINOWICH,<br />
DERSTANDARD.AT, 19.11.2008<br />
In diesem Kurs wird es um literarische Texte und Biografien<br />
gehen, die durch Migration, Asyl oder Exil gekennzeichnet<br />
sind – Texte, die nicht in einer Kultur verwurzelt<br />
Kursleitung<br />
(16. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER <strong>2012</strong>) AKADEMIE BRAUNSCHWEIG II<br />
sind, sondern sich »auf Wanderschaft« befinden und von<br />
unterschiedlichen kulturellen Räumen geprägt werden.<br />
Diese Literaturen definieren sich durch Heimatlosigkeit,<br />
Heterogenität und Fragmentierung. Besonders Autorinnen<br />
und Autoren, die oft nicht (nur) Deutsch als ihre Erstsprache<br />
ausweisen und deren Schreiben von mehr als einem<br />
Kulturraum beeinflusst wird, entziehen sich national<br />
geprägten Zuschreibungen und Einordnungen. Im oben<br />
angeführten Zitat meint die Autorin Julya Rabinowich,<br />
sie fühle sich weder in Österreich noch in ihrem Geburtsland<br />
Russland »daheim«. In der (Zweit-) Sprache und im<br />
Schreiben habe sie jedoch ihre »Heimat« gefunden. Dem<br />
Begriff Heimat können hier unterschiedliche Bedeutungen<br />
zukommen.<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kurses werden vor<br />
dem Hintergrund philosophisch-theoretischer Konzepte,<br />
v.a. postkolonialer Theorien (wie H. Bhabha, W. Welsch, G.<br />
Deleuze/F. Guattari, E. Glissant), literarische Texte kritisch<br />
diskutieren und analysieren. Neben dem deutschsprachigen<br />
Raum wird es auch um literarische Entwicklungen<br />
außerhalb Europas gehen. Die Theorie wird gemeinsam im<br />
Sabrina Nepozitek (Jg. 1984) wurde in einem kleinen Dorf in der Weststeiermark (Österreich)<br />
geboren und studierte an der Universität Klagenfurt Romanistik (Schwerpunkt<br />
Frankoromanistik) und Kulturwissenschaften. Während des Studiums absolvierte sie bereits<br />
zahlreiche Auslandsaufenthalte, u.a. in Frankreich, Spanien und Senegal. Seit 2009<br />
unterrichtet sie als Lektorin des österreichischen Austauschdienstes an der Université de<br />
Bretagne Occidentale in Brest (Westfrankreich) am Institut für Germanistik und promoviert<br />
im Fach Romanistik zur französischsprachigen Literatur des Maghreb. In ihrer Freizeit<br />
ist sie Mitglied einer französischen Theatergruppe.<br />
Kurs erarbeitet und zur Textanalyse herangezogen. Es werden<br />
Texte von Autoren und Autorinnen wie beispielsweise<br />
Feridun Zaimoglu, Julya Rabinowich, Tahar Ben Jelloun<br />
oder Leïla Marouane thematisiert.<br />
Geleitet wird die Lektüre und die Analyse von der Frage:<br />
Welche Motive und Merkmale sind in den Texten von<br />
Autorinnen und Autoren zu finden, die »zwischen« den<br />
Kulturen schreiben? Zudem werden Kategorisierungen<br />
und Begriffe kritisch reflektiert und das Verhältnis vom<br />
Schreiben in der Erst- und Zweitsprache untersucht. Ziel<br />
des Kurses ist es, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in<br />
einem ersten Schritt Theorien und Methodik literarischer<br />
Textanalyse zu vermitteln. Im Anschluss sind sie selbst<br />
gefordert, diese auf die Analyse transkultureller Literaturen<br />
anzuwenden.<br />
Die Kursarbeit besteht neben der Textlektüre und dem Input<br />
vor allem aus Diskussionen und Referaten. Zusätzlich<br />
ist aber auch die Möglichkeit zu eigenen kreativen Arbeiten<br />
(literarische Schreibversuche, künstlerische Darstellungen<br />
etc.) gegeben.<br />
Silke Schwaiger (Jg. 1983) wurde in einem kleinen Dorf in Südkärnten (Österreich)<br />
geboren und studierte an der Universität Klagenfurt Germanistik<br />
(Literatur- und Kulturwissenschaft). Während ihres Studiums absolvierte sie<br />
ein Auslandsstudium in Wrocław (Polen); lebte und arbeitete einige Monate in<br />
Brüssel und Berlin. Seit 2010 ist sie an der University of Southampton (Großbritannien).<br />
Dort unterrichtet sie als Teaching Assistant und promoviert in German<br />
Studies im Bereich transkulturelle Literaturen. Sie liebt es zu reisen – neue<br />
Städte und Landschaften; Menschen und Geschichten kennenzulernen.<br />
–– 31
32 ––<br />
AKADEMIE GROVESMÜHLE (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Akademie<br />
Grovesmühle<br />
Landschulheim Grovesmühle<br />
Das Landschulheim Grovesmühle liegt in ländlicher Umgebung und in unmittelbarer Nachbarschaft<br />
der Harzstädte Ilsenburg und Wernigerode sowie des Brockens mit entsprechenden<br />
Möglichkeiten zu Exkursionen.<br />
Die zum Teil schon im 18. Jh. entstandenen und inzwischen vollkommen restaurierten Fachwerkgebäude<br />
stammen aus der Zeit, als die Grovesmühle eine Papiermühle war. 1914 gründete<br />
der Reformpädagoge Hermann Lietz hier ein Landwaisenheim, später beherbergte die<br />
Grovesmühle die Unterstufenschüler der Hermann-Lietz-Schulen. Nach zwischenzeitlicher<br />
Nutzung als staatliche Schule wurde die Grovesmühle 1995 als Internat und Schule in freier<br />
Trägerschaft neu eröffnet.<br />
Die Schul- und Internatsgebäude liegen auf einem naturnahen, mit Wasserläufen und Teichen<br />
versehenen zehn Hektar großen Gelände. Die Unterbringung erfolgt in Zwei- bis Vierbettzimmern.<br />
Neben dem regulären Essen wird auch vegetarische Kost gereicht.<br />
Das Landschulheim Grovesmühle bietet einen z.T. vernetzten PC-Raum mit Internetanschluss.<br />
Es stehen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung zur Verfügung. Die modern eingerichteten<br />
Kurs- und Fachräume (z.B. Naturwissenschaften, Musiksaal mit Bühne) ermöglichen eine intensive<br />
Kursarbeit und eine ganze Reihe von kursübergreifenden Aktivitäten.
LANDSCHULHEIM GROVESMÜHLE<br />
GROVESMÜHLE 1<br />
38871 VECKENSTEDT<br />
www.grovesmuehle.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
3.1 Wahrscheinlichkeiten als Sprache<br />
3.2 Warum Toast immer auf die Butterseite fällt ...<br />
3.3 Die Pflanze im Klimasystem<br />
3.4 Embodiment/Verkörperlichung der Kommunikation<br />
3.5 Warum Krieg?<br />
3.6 Worauf man achten muss, wenn man tot ist<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Veit Meier (Jg. 1981) studierte an der Hochschule für Musik »Franz Liszt«,<br />
Weimar, Schulmusik mit den Schwerpunkten Violine, Jazzgesang und Chorleitung<br />
sowie ergänzend Violinpädagogik und Stimmbildung. Seitdem unterrichtete<br />
er an mehreren Gymnasien in Bayern das Fach Musik und leitete Schulchöre,<br />
Kammerchor, Schulbands und seit September am Clavius-Gymnasium Bamberg<br />
die beiden Big Bands. Neben jahrelanger Chorleitertätigkeit ist der Musikpädagoge<br />
aus Leidenschaft Konzertmeister in mehreren Orchestern und arbeitet nebenher<br />
als Musikkabarettist, Komponist, Arrangeur und Gesangslehrer. Seit einem<br />
halben Jahr tritt er regelmäßig mit einer a cappella-»Boy Band« auf. Neben der Begeisterung<br />
für alle Bereiche der Musik ist er passionierter Alpinsportler, Hobbykicker und bereist die Welt.<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE GROVESMÜHLE<br />
Akademieleitung<br />
Florian Frenzel (Jg. 1972) ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für<br />
Medien und Theater an der Universität Hildesheim, wo er zum Thema Theaterübungen<br />
promoviert. Hier studierte er einst selbst Kulturpädagogik, angewandte<br />
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Zwischenzeitlich arbeitete er<br />
sechs Jahre lang als Theaterpädagoge am Nationaltheater Mannheim, organisierte<br />
Festivals und entwickelte Inszenierungen mit Schauspielern und Jugendlichen.<br />
Er soll angeblich recht gut kochen können, wandert gerne durch schöne<br />
Gegenden und Star Trek TNG ist immer noch seine Lieblingsserie (trotz LOST<br />
und Mad Man).<br />
Claudia Böhm (Jg. 1993) war 2011 Teilnehmerin des Politikkurses der <strong>DSA</strong> in<br />
Rostock. Dort begegnete sie u.a. Florian und Hannah. Sie macht gerade ihr Abitur<br />
in Hannover und möchte nach einem Jahr unterschiedlichster Aktivitäten<br />
und Projekte Medizin oder Biologie studieren. In ihrer Freizeit geht sie gerne<br />
bouldern, wandern oder paddeln, fotografiert oder wirft das Diabolo in die Luft.<br />
Sie freut sich riesig auf das begeisternde <strong>DSA</strong>-Feeling und hofft auf einen bunten<br />
Mix aus interessanten Themen, lustige Aktionen und kontroversen Diskussionen<br />
– eben genau das, was eine <strong>DSA</strong> auszeichnet!<br />
Hannah Kikwitzki (Jg. 1992) war 2009 Teilnehmerin des Musikkurses der<br />
<strong>DSA</strong> in Hilden. Nachdem sie 2010 ihr Abitur bestand, entschloss sie sich, vor<br />
der langen Zeit des Jurastudiums noch einmal durchzuatmen, und ging in die<br />
Ukraine, wo sie neun Monate als Freiwillige in Schulen, Kindergärten und Jugendgruppen<br />
arbeitete. Neben dem Reisen interessiert sie sich sehr für Musik,<br />
Bücher, gute Filme und Schokolade. Seit Beginn des Studiums genießt sie die<br />
kleine Studentenstadt Münster, ist aber auch immer wieder froh, in die schönste<br />
Stadt der Welt nach Hamburg zurückzukehren. Sie ist sehr glücklich, dieses<br />
Jahr zum zweiten Mal als Co-AL bei einer Akademie mitmachen zu können und freut sich schon<br />
auf interessante Gespräche und viel Kreativität!<br />
–– 33
34 ––<br />
AKADEMIE GROVESMÜHLE (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 3.1<br />
Wahrscheinlichkeiten als Sprache<br />
Probleme übersetzen und lösen<br />
In diesem Kurs erlernen die Teilnehmenden die mathematische<br />
Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie. Diese<br />
ist nicht nur elegant (wie fast alles in der Mathematik),<br />
sondern auch überaus praktisch. Erstens, weil sich die<br />
»Grammatik« aus wenigen Axiomen zusammensetzt und<br />
somit schnell zu erlernen ist. Und zweitens, da alle Zufallsprobleme<br />
(z.B. Regenwahrscheinlichkeit, optimale Mischverfahren<br />
etc.) in diese Sprache übersetzt werden können<br />
und anschließend verblüffend einfach zu lösen sind.<br />
Eine Reißzwecke landet mit Wahrscheinlichkeit 2/3 auf<br />
der Seite und mit Wahrscheinlichkeit 1/3 auf dem Kopf.<br />
Wie kann man solche »zufälligen Gesetzmäßigkeiten«<br />
mathematisch formulieren, zumal in der Mathematik doch<br />
nichts vom Zufall abhängen sollte? Ausgehend von Kolmogorovs<br />
axiomatischem Aufbau werden u.a. die Konzepte<br />
von Zufallsvariablen, deren Verteilungen und Momente,<br />
stochastische Unabhängigkeit, Konvergenzen von Zufallsvariablen,<br />
Entropie und der Satz von Bayes gemeinsam erarbeitet.<br />
Ausgestattet mit dem neuen Wortschatz kann man<br />
tiefgreifende Resultate beweisen, die für die Anwendungen<br />
Kursleitung<br />
Kai-Friederike Oelbermann (Jg. 1982) ist in Bremen geboren. Sie studierte<br />
in Leipzig und Bologna Mathematik, Psychologie (und natürlich<br />
Italienisch, Wasserball etc.) und arbeitet seit 2009 an der Universität<br />
Augsburg. Dort lehrt sie Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik und<br />
schreibt ihre Doktorarbeit zur mathematischen Analyse von Wahlsystemen.<br />
Auf der Akademie will sie junge Leute für die Mathematik begeistern,<br />
aber natürlich auch Fußball, Ultimate Frisbee und Tischtennis<br />
spielen.<br />
von erheblicher Bedeutung sind. Die mathematische Beweisführung<br />
ist zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig,<br />
macht aber schnell Spaß und schult eine klare Argumentationsweise.<br />
Anhand mehrerer Beispiele wird deutlich, wie lohnend<br />
die Kenntnisse in der Sprache der<br />
Wahrscheinlichkeiten sind:<br />
– In der Datenanalyse beantworten<br />
die Teilnehmenden u.a. die Frage,<br />
ob es stimmt, dass der Gefoulte<br />
beim Fußball besser nicht den Elfmeter<br />
schießen sollte.<br />
– Mit Hilfe von Statistiken kann<br />
man prüfen, ob Wahlergebnisse<br />
gefälscht worden sind.<br />
– Einige Aussagen glaubt und versteht<br />
man erst, wenn man sie in<br />
der Welt der Wahrscheinlichkeiten<br />
formuliert hat. Z.B. ist die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass zwei Teilnehmer der Akademie am<br />
gleichen Tag Geburtstag haben, höher als 99.9999 %.<br />
– Mit Hilfe der totalen Variationsnorm kann man die Frage<br />
übersetzen, wie oft ein Kartenstapel gemischt werden<br />
muss, damit er »richtig durcheinander« ist. Es gibt Kartentricks,<br />
die darauf basieren, dass dies nach 3 oder 4<br />
maligem Mischen noch nicht der Fall ist.<br />
– Fragen der Kausalität werden formalisiert (Warum haben<br />
Landstriche mit vielen Störchen eine hohe Geburtenrate?)<br />
und Möglichkeiten diskutiert, diese zu beantworten.<br />
– Die statistische Lerntheorie beschreibt, worauf man achten<br />
muss, wenn einer Maschine das Unterscheiden zwischen<br />
Äpfeln und Birnen beigebracht werden<br />
soll.<br />
Der Kurs zeigt, wie viel in der Welt der Wahrscheinlichkeiten<br />
möglich ist. Zum Schluss wird<br />
über ihre Grenzen diskutiert.<br />
Ein paar der kennengelernten Rätsel und<br />
Tricks werden die Teilnehmenden auf dem<br />
Computer implementieren. Dies geschieht in<br />
der <strong>Programm</strong>iersprache R, die viele Wahrscheinlichkeitstheoretiker<br />
und Statistiker in ihrem<br />
Alltag benutzen. Mit Hilfe des <strong>Programm</strong>s<br />
Mondrian können komplizierte Datensätze<br />
visualisiert und analysiert werden. Vorkenntnisse im <strong>Programm</strong>ieren<br />
sind nicht erforderlich. Spaß an Knobeleien<br />
sowie Freude am logischen Denken sind hingegen gute<br />
Voraussetzungen.<br />
Jonas Peters (Jg. 1984) freut sich auf das gemeinsame Arbeiten und Spaß Haben auf der Akademie.<br />
Er möchte dort einigen seiner Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: Fußball, Ultimate Frisbee,<br />
Doppelkopf und Kammer- oder Orchestermusik (mit seinem Cello) spielen. Außerhalb der<br />
Akademie begeistert er sich für die Nordsee, Bücher, Wandern und Radfahren und beschäftigt<br />
sich mit der Frage einer alternativen Stromversorgung. Nach dem Mathematikstudium in Heidelberg<br />
und Cambridge promoviert Jonas über Kausalität und deren Inferenz am Max-Planck-Institut<br />
für Intelligente Systeme in Tübingen und an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH)<br />
Zürich.
Kurs 3.2<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE GROVESMÜHLE<br />
Warum Toast immer auf die Butterseite fällt …<br />
Klassische Mechanik<br />
Seit jeher versuchen die Menschen zu verstehen, wie die<br />
Welt um sie herum funktioniert. Anfangs rein empirisch<br />
stellte spätestens Newton die Suche auf mathematische<br />
Grundlagen. Seine Gleichungen erlaubten zu berechnen,<br />
wie sich Kräfte auf die Bewegung eines Körpers auswirken.<br />
Seither haben sich mathematische Theorien als außerordentlich<br />
erfolgreich erwiesen, physikalische Phänomene in<br />
der Natur zu beschreiben. In einer eleganten Formulierung<br />
der newtonschen Theorie zeigen sich die Prinzipien, die<br />
allen modernen physikalischen Theorien zu Grunde liegen.<br />
Der Kurs gibt eine Einführung in diese Theorie der klassischen<br />
Mechanik.<br />
Nach einer Einweisung in das mathematische Handwerkszeug<br />
erarbeiten sich die Teilnehmenden das Prinzip der<br />
Variationsrechnung. Dazu dienen einfache Beispiele von<br />
der kürzesten Verbindung zweier Punkte bis zu der Frage,<br />
wie ein Flugzeug am schnellsten über eine Rettungsrutsche<br />
verlassen werden kann. Dies bildet das Fundament<br />
Kursleitung<br />
Tobias Hofbaur (Jg. 1984) studierte Physik in Augsburg, Maynooth (Irland) und<br />
München. 2008 schloss er sein Studium mit einer Diplomarbeit in theoretischer<br />
Kosmologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München ab. Zur Zeit promoviert<br />
er dort über die Möglichkeit eines ewigen Universums und alternative<br />
Gravitationstheorien im frühen Universum. In seiner Freizeit ist er als Trainer und<br />
Kämpfer im Fechtsport aktiv. Außerdem tanzt er leidenschaftlich gerne Standard<br />
und Latein. Seit seiner ersten <strong>SchülerAkademie</strong> ist er außerdem dem Tango Argentino<br />
verfallen.<br />
für die Einführung des<br />
Lagrange-Formalismus,<br />
der alle mechanischen<br />
Problemstellungen<br />
auf ein gemeinsames<br />
Grundkonzept zurückführt.<br />
Dadurch lassen<br />
sich mit einem einfachen<br />
Schema für jedes<br />
System die Differenzialgleichungen, die die Bewegung der<br />
Teilchen beschreiben, herleiten. Dies wird im Kurs durch<br />
Arbeit in Kleingruppen auf einige klassische Probleme angewendet.<br />
Besonders zeigt sich die Vereinfachung<br />
durch den Lagrange-Formalismus bei<br />
Systemen aus mehreren Teilchen, die<br />
durch Federn verbunden sind. Dies sind<br />
Modellsysteme für eine Vielzahl an Molekülen<br />
und Festkörpern. Im Kurs sollen die berechneten<br />
Lösungen der schwingenden Teilchen in kleinen Experimenten<br />
überprüft werden. Doch nicht nur die Bewegungen<br />
idealisierter Punktteilchen können beschrieben<br />
werden sondern auch ausgedehnte, starre Körper<br />
wie z.B. Toastscheiben und Kreisel.<br />
Ebenf Ebenfalls sehr elegant ergeben sich aus diesem Mechanis-<br />
mus KKonstanten<br />
der Bewegung. Hierbei offenbart sich ein<br />
funda fundamentaler Zusammenhang zwischen diesen Erhal-<br />
tungsg<br />
tungsgrößen und Symmetrien des Systems. So stellt die<br />
Impulserhaltung eine direkte Folge der Unabhängigkeit<br />
von der Position im Raum dar. Die geschickte Ausnutzung<br />
der Symmetrien eines Problems erlaubt es oft, die mathematische<br />
Formulierung erheblich zu vereinfachen. Dies<br />
wird im Kurs zum Beispiel bei<br />
der Behandlung der Bewegung<br />
Grundkenntnisse der Differenzial- und In- der Planeten im Sonnensystem<br />
tegralrechnung (insbesondere Ableiten) sind<br />
ausgenutzt. In Streuversuchen<br />
unabdingbar. Bereitschaft zum Durcharbeiten<br />
aus der Teilchenphysik zeigt<br />
eines Vorbereitungsskripts wird erwartet.<br />
sich, dass nicht nur die Gravitation<br />
auf diese Weise als Zentralkraft<br />
modelliert werden kann, sondern auch viele andere<br />
Probleme mit den gleichen Methoden behandelt werden<br />
können.<br />
Philipp H. v. Loewenfeld (Jg. 1978) studierte an der Technischen Universität München<br />
(TUM) Allgemeine Physik. Nach einer Diplomarbeit am Albert-Einstein-Institut<br />
in Potsdam im Bereich der Allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigte er sich im Rahmen<br />
seiner Promotion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) mit<br />
Stringtheorie-inspirierter Kosmologie. Seit April 2009 ist er als Referent des Studiendekans<br />
wieder an der TUM und bemüht sich dort, die Studienbedingungen für Physikstudierende<br />
zu verbessern. In seiner Freizeit fährt er gern Fahrrad oder betätigt sich als<br />
Zuckerbäcker.<br />
–– 35
36 ––<br />
AKADEMIE GROVESMÜHLE (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 3.3<br />
Die Pflanze im Klimasystem<br />
Ein klimatologischer Streifzug vom Experiment zum Modell<br />
Pflanzen spielen mit ihrer Photosynthese eine zentrale Rolle<br />
im Kohlenstoffkreislauf. Das dabei umgesetzte CO 2 leistet<br />
einen wichtigen Beitrag zum natürlichen Treibhauseffekt<br />
und steht so im Fokus der aktuellen Klimaforschung und<br />
der gesellschaftlichen Debatte um den Klimawandel. Die<br />
Klimaforschung nähert sich dieser Frage von zwei Seiten.<br />
Zum einen werden mit Experimenten die verschiedenen<br />
Prozesse in der Pflanze und im Ökosystem untersucht.<br />
Auf der anderen Seite werden anhand dieser Erkenntnisse<br />
Computermodelle entwickelt, die Aussagen über globale<br />
Prozesse und zukünftige Entwicklungen ermöglichen sollen.<br />
Für den Großteil der Klimaforscher sind diese Modelle<br />
ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung verschiedener<br />
Fragestellungen. Für viele Kritiker sind sie allerdings moderne<br />
Orakel.<br />
Der Kurs folgt diesem breiten Querschnitt durch die Klimaforschung.<br />
Zuerst werden mithilfe moderner Messgeräte<br />
im Feld die Phostosynthese und ihre klimatologischen<br />
Kursleitung<br />
Einflussfaktoren wie Licht und Luftfeuchte untersucht und<br />
an verschiedenen Pflanzen gemessen. Die gewonnenen<br />
Daten werden anschließend naturwissenschaftlich ausgewertet,<br />
um Schlüsse auf die verschiedenen Prozesse ziehen<br />
zu können. Dazu werden die notwendigen statistischen<br />
Methoden und der Umgang mit der Open-Source Software<br />
R vermittelt.<br />
In einem zweiten Schritt werden die gewonnenen Daten<br />
genutzt, um mit R ein einfaches aktuelles Computermodell<br />
zu testen und anzuwenden. Am Beispiel dieses Modells<br />
wird die Wirkungsweise und Struktur vieler aktueller Klimamodelle<br />
verdeutlicht. Zusätzlich bekommen die Teilnehmenden<br />
ein Gespür für die Möglichkeiten derartiger Modelle,<br />
aber auch für ihre Unsicherheiten und Fehlerquellen.<br />
Mit Hilfe des Modells und zusätzlichen Informationen über<br />
Ökosysteme kann schließlich die Pflanze als zentraler Aspekt<br />
im Klimasystem eingeordnet werden. Weiterhin wird<br />
Jannis von Buttlar (Jg. 1981) studierte in Karlsruhe und Bayreuth Geoökologie. Während<br />
des Studiums arbeitete er einige Monate im Kaukasus in der Umweltbildung und entwickelte<br />
am Stockholm Environment Institute at York (SEI) Photosynthesemodelle. Seit seiner<br />
Diplomarbeit arbeitet und promoviert er am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena<br />
an der spannenden Schnittstelle zwischen Klimadaten und den entsprechenden Modellen.<br />
Dazwischen versucht er möglichst viel Zeit auf und in abgelegenen Bergen und Wäldern zu<br />
verbringen, spielt Didgeridoo oder entspannt sich beim Slacklinen. Sein ökologisches Wissen<br />
gibt er in der Erlebnispädagogik bei von ihm geleiteten Wildnistouren und in Zukunft<br />
bei der <strong>DSA</strong> weiter.<br />
untersucht, wie sich Ökosysteme durch die sich als Folge<br />
des Klimawandels ändernden äußeren Faktoren verändern.<br />
Darauf aufbauend werden auch Wechselwirkungen von der<br />
Biosphäre zurück zum Klimasystem (Feedbacks) diskutiert,<br />
ein Aspekt, der die Klimaforschung so herausfordernd und<br />
spannend macht.<br />
Der Kurs richtet sich an Jugendliche mit naturwissenschaftlichem<br />
Schwerpunkt und dem Interesse, ihre Kenntnisse<br />
in einem aktuellen Thema mit großer gesellschaftlicher<br />
Relevanz anzuwenden. Auf der anderen Seite richtet er sich<br />
aber auch an Teilnehmende mit starken Mathematik- und/<br />
oder Informatikinteressen, die diese gerne im ökologischen<br />
Kontext anwenden möchten. Der Kurs setzt keine über das<br />
Schulwissen hinausgehenden biologischen Kenntnisse bzw.<br />
spezielle <strong>Programm</strong>ierkenntnisse voraus. Voraussetzung<br />
sind lediglich ökologische Experimentierfreude und ein<br />
gewisses Interesse bzw. Spaß an der Arbeit mit dem Computer.<br />
Jakob Zscheischler (Jg. 1985) studierte Mathematik in Dresden, Berlin und<br />
Tübingen. Um seine Freude an der Mathematik und sein schon länger vorhandenes<br />
Interesse an der Klimaforschung zu verbinden, promoviert er seit 2010<br />
an den Max-Planck-Instituten für Intelligente Systeme und Biogeochemie in<br />
Tübingen und Jena. Nachdem ihm letztes Jahr seine erste Akademie als Kursleiter<br />
viel Freude bereitet hat, beschloss er, der <strong>DSA</strong> mit einem weiteren Kurs<br />
treu zu bleiben. Wenn er neben der Promotion nicht gerade im selbst gegründeten<br />
Bolongaro-Sextett singt, macht er Kammermusik, spielt Fußball oder<br />
wandert, liest oder diskutiert.
Kurs 3.4<br />
Embodiment/Verkörperlichung<br />
der Kommunikation<br />
Wie Imitation uns hilft, einander zu verstehen<br />
Woher wissen wir, wie sich ein anderer<br />
Mensch fühlt, was seine Ziele, Gedanken<br />
und Wünsche sind? Zum einen teilen wir<br />
unsere Gedanken und Emotionen durch<br />
Sprache mit. Zum anderen interpretieren<br />
wir Mimik und Körpersprache unserer Mitmenschen<br />
und teilen ihre Gefühle. Beides,<br />
Sprache und Empathie, fußt auf komplexen<br />
mentalen Leistungen, die jeder im Alltag<br />
als selbstverständlich erachtet.<br />
Jeder? Fast jeder! Kleinkinder müssen Sprache<br />
und komplexere Formen des Mitfühlens erst erlernen.<br />
Menschen im Autismusspektrum haben zum Teil große<br />
Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was ein anderer Mensch<br />
denkt und wie er sich fühlt. Wie können Kleinkinder in so<br />
kurzer Zeit ein so komplexes Verständnis der Welt aufbauen,<br />
und wodurch kann die Empathiefähigkeit von Menschen<br />
im Autismusspektrum verstärkt werden? Im Kurs<br />
Kursleitung<br />
Bereits Saeuglinge koennen einfache Gesichtsausdrücke<br />
imitieren. Aus: A. N. Meltzoff & M. K. Moore,<br />
Science, 1977, 198, 75-78.<br />
Svenja Köhne (Jg. 1983) studierte an der Universität Hamburg und der Humboldt-<br />
Universität zu Berlin Psychologie mit Schwerpunkt auf Kognitions- und Neurowissenschaften.<br />
In ihrer Promotion am Exzellenz Cluster Languages of Emotion in<br />
Berlin untersucht sie, ob Tanz und Bewegung die Empathiefähigkeit bei Autismus<br />
steigern kann. Svenja tanzt selber gerne (Modern, Ballett, Tango), liebt Sport (Surfen,<br />
Segeln, Triathlon, Yoga) und Musik (Electro, Folk).<br />
wird die »Embodiment«-Perspektive<br />
der kognitiven Wissenschaften, die<br />
davon ausgeht, dass Bewegung (Sensomotorik)<br />
zentral für solch komplexe<br />
sozialkognitiven Prozesse ist,<br />
als eine potenzielle Antwort auf diese<br />
Fragen vorgestellt. Konkret wird die<br />
Frage beleuchtet, inwiefern die Verknüpfung<br />
von Wahrnehmung der<br />
Bewegung anderer und der Produktion<br />
eigener Bewegungen, eine Grundlage<br />
für Sprache und Empathie ist.<br />
Ein wichtiger Lernmechanismus im Spracherwerb von<br />
Kleinkindern beginnt bei der Imitation von Lauten, welche<br />
die erwachsenen »expert Speakers« im Umfeld hervorbringen.<br />
Dabei scheint nicht nur die Wahrnehmung der<br />
Laute und Bewegungen anderer Menschen, sondern auch<br />
die Evaluation der eigenen Vokalisationen und Muskelbewegungen<br />
wichtig für den erfolgreichen Spracherwerb zu<br />
sein. Es ist auch nicht gleichgültig, mit wem Kleinkinder<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE GROVESMÜHLE<br />
interagieren: Sie können die Laute einer Sprache besser erlernen,<br />
wenn ihr Gegenüber eine echte Person ist, als wenn<br />
sie zum Beispiel Videoaufnahmen derselben Person sehen.<br />
Auch beim Erkennen und Teilen von Gefühlen anderer<br />
Menschen spielt die Wahrnehmung und Produktion von<br />
Bewegungen eine wichtige Rolle. Wenn uns das Lachen<br />
eines Freundes ansteckt oder wir das Gesicht verziehen,<br />
wenn wir sehen, wie er sich in den Finger schneidet, dann<br />
spüren wir seinen physischen Zustand mit unserem eigenen<br />
Körper nach. Menschen im Autismusspektrum haben<br />
häufig Schwierigkeiten damit, Bewegungen eines anderen<br />
Menschen zu imitieren. Es wird vermutet, dass hier ein<br />
Zusammenhang besteht zu den Einschränkungen in der<br />
Empathiefähigkeit und dass dies auf Veränderungen im so<br />
genannten »Spiegelneuronensystem« des Gehirns zurückzuführen<br />
ist.<br />
Parallel zur inhaltlichen Erarbeitung dieses Themas wird<br />
der Kurs eine Einführung in die Methoden der Experimentalpsychologie<br />
legen: Was ist eine sinnvolle Fragestellung,<br />
und durch welche Art von Experiment kann sie am besten<br />
beantwortet werden? Anhand der im Kurs behandelten<br />
Beispiele wird erarbeitet, wie ein psychologisches, neurowissenschaftliches<br />
bzw. psycholinguistisches Experiment<br />
aufgebaut sein muss, um die Rolle von sensomotorischen<br />
Prozessen für Spracherwerb und Empathiefunktionen zu<br />
untersuchen. Dabei wird auch erlernt, wissenschaftliche<br />
Veröffentlichungen von experimenteller Forschung kritisch<br />
zu lesen und selbst ein Experiment zu konzipieren.<br />
Sho Tsuji (Jg. 1984) studierte an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität<br />
Tokio Psychologie und Psycholinguistik. In ihrer Promotion am Max-Planck-Institut<br />
für Psycholinguistik in Nijmegen vergleicht sie die Sprachentwicklung niederländischer<br />
und japanischer Kleinkinder mit behavioralen und bildgebenden Methoden. Sie hat<br />
Svenja bei der <strong>DSA</strong> im Jahr 2002 in der Grovesmühle kennengelernt und freut sich deshalb<br />
ganz besonders darauf, noch einmal gemeinsam eine <strong>SchülerAkademie</strong> zu erleben<br />
und viele interessante Menschen kennenzulernen<br />
–– 37
38 ––<br />
AKADEMIE GROVESMÜHLE (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 3.5<br />
Warum Krieg ?<br />
Fragen und Antworten aus Ökonomie, Philosophie und den Sozialwissenschaften<br />
Warum gibt es Krieg? Diese Frage haben sich alle uns bekannten<br />
Hochkulturen gestellt. Seit es Kriege gibt, werden<br />
sie aufgezeichnet, dargestellt, bewertet und hinterfragt.<br />
Doch was ist Krieg eigentlich? Und ist er gut oder schlecht?<br />
Ist er »der Vater aller Dinge«, wie es der griechische Philosoph<br />
Heraklit vor 2500 Jahren formulierte? Befeuert er<br />
gar den Fortschritt, den Handel und die Entdeckung neuer<br />
Gebiete und Technologien, wie es Immanuel Kant in seiner<br />
bedeutenden Schrift »Zum Ewigen Frieden« dem Krieg<br />
zugutehielt? Medial ist das Thema heute zwar omnipräsent,<br />
doch Kriegsbilder haben ihren Schrecken angesichts<br />
nahezu täglicher Berieselung verloren. Gilt es daher, den<br />
Krieg immer wieder neu zu verurteilen, seine Gründe und<br />
Wirkungen unermüdlich gesellschaftlich zu reflektieren<br />
und den ewigen Frieden nicht als Ziel sondern als demokratische<br />
Aufgabe zu begreifen? Oder gehören Demokratie<br />
und Krieg mehr zusammen, als allgemein angenommen?<br />
Kursleitung<br />
Anja Breljak (Jg. 1988) lebte einen kleinen, sehr jungen Teil ihres Lebens auf<br />
dem kriegsgeschüttelten Balkan, einen großen Teil im großen Berlin. Dort und<br />
in Sarajevo studierte sie Philosophie, Volkswirtschaftslehre und Soziologie. Die<br />
Fragen nach dem Krieg haben sie jedoch nicht losgelassen, und so beschäftigte<br />
sie sich in ihrem Studium vor allem mit Kriegsökonomien, den völkerrechtlichen<br />
Fragen dahinter und den theoretischen Kriegskonzepten dazwischen<br />
(insbesondere Kant und Hegel). Sie wird neben dem Studium zur Journalistin<br />
ausgebildet, schreibt in ihrer Freizeit gerne Lyrisch-Prosaisches und liebt das<br />
Theater(-spielen).<br />
Dass der Friede auch im modernen Europa bislang nicht<br />
ewig ist, haben vor nicht langer Zeit mehrere Konflikte gezeigt:<br />
Der Zerfall Jugoslawiens und die nachfolgenden Balkankriege,<br />
Sezessionskonflikte in Spanien, der dauerhafte<br />
Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei, die Kriege<br />
im Kaukasus.<br />
Voraussetzung für diesen Kurs ist die Bereitschaft sich<br />
auf verschiedene Methoden und kontroverse Diskussionen<br />
einzulassen. Von den Teilnehmenden wird erwartet,<br />
vorab einen hohen Anteil an philosophischer Lektüre<br />
zu erarbeiten und einführende Referate vorzubereiten.<br />
Die fortschreitende Technologisierung<br />
hat die<br />
Folgen des Krieges nicht<br />
humaner gemacht, und<br />
große Pazifismusdebatten<br />
scheinen die Gesellschaft<br />
dem ewigen Frieden nicht nähergebracht zu haben. Ist der<br />
Krieg also in der Natur des Menschen angelegt, oder sind<br />
es doch vornehmlich ökonomische Zwänge, die zum Krieg<br />
führen?<br />
Diesen Fragen wird der Kurs durch interdisziplinäres<br />
Arbeiten nachgehen. Dabei wird die ideengeschichtliche<br />
Herangehensweise eine philosophische Grundlage für ein<br />
tiefergehendes Verständnis des Krieges legen. Die Theorien<br />
verschiedener Denker, die von ihnen analysierten Ursachen<br />
und die moralische Einordnung werden anhand ihrer<br />
Texte nachvollzogen und diskutiert. Eine zweite Grundlage<br />
der Arbeit bildet die Suche nach den konkreten Ursachen<br />
aktueller Kriege. Die Teilnehmenden<br />
werden sich dazu ins Völkerrecht einarbeiten,<br />
politische Karten und Länderstudien<br />
erstellen, spieltheoretische<br />
Modelle kennenlernen und anhand<br />
eines aktuellen Konfliktes Eskalationsmechanismen<br />
selbst durchspielen.<br />
Ziel des Kurses ist es, auf verschiedenen Wegen Antworten<br />
auf die Frage »Warum Krieg?« zu finden, die jede Disziplin<br />
anders für sich stellt und beantwortet. Insbesondere die<br />
Reflexion von Annahmen über den Krieg und die Folgen<br />
kriegerischer Konfliktlösung, wie Migration oder kulturelle<br />
und wirtschaftliche Rückschläge, sowie die Bedeutung von<br />
Geschlechtern, Widerstand oder auch Medien wird exerziert.<br />
Titus Laser (Jg. 1985) wollte erst Straßenbahnfahrer, später Schauspieler werden und<br />
bewarb sich um ein Studium. Nach der Ablehnung wollte er ein Freiwilliges Soziales Jahr<br />
in Moskau machen, stattdessen landete er für 10 Monate in der Küche einer Amsterdamer<br />
Schule. Sein in Köln begonnenes Studium der Informationsorientierten Betriebswirtschaftslehre<br />
(IBWL) brach er ab und studierte stattdessen Kulturwissenschaften in<br />
Frankfurt (Oder). Zur Zeit studiert er Sozialwissenschaften in Berlin. Seinen Nebenjob<br />
im Bundestag hat er aufgegeben und arbeitet nun für den Berliner Verlag. Er mag das<br />
Internet, geht oft ins Theater, beschäftigt sich mit internationalen Beziehungen und liebt<br />
es fast so gern zu reisen wie heimzukehren.
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE GROVESMÜHLE<br />
Kurs 3.6<br />
Worauf man achten muss, wenn man tot ist<br />
Jenseitsvorstellungen in der Antike<br />
Wenn man tot ist, muss man sich rechts halten: Denn dort,<br />
bei der weißen Zypresse, gibt es Wasser. Aber Vorsicht:<br />
Nicht gleich aus der ersten Quelle trinken, sondern den<br />
Durst zurückhalten bis zum Teich der Mnemosyne! Dort<br />
stehen allerdings Wächter und stellen Fragen, bevor sie<br />
dem Neuling Zugang zum Wasser gewähren. Deshalb ist es<br />
gut, schon während des irdischen Daseins ein Eingeweihter<br />
gewesen zu sein, denn dann kennt man die richtigen Passwörter.<br />
Solche Beschreibungen der Topographie des Jenseits findet<br />
man auf Goldblättchen, die die Orphiker in Griechenland<br />
den Verstorbenen mit ins Grab legten. Die dahinterstehenden<br />
Vorstellungen sind freilich deutlich älter und führen<br />
ins Alte Ägypten. Diese Hochkultur war, wie keine andere,<br />
auf das postmortale Dasein fokussiert: Unzählige Papyri beschreiben<br />
genauestens den Ablauf eines Totengerichts und<br />
geben dem Verstorbenen ein Repertoire an Sprüchen für<br />
alle erdenklichen Situationen im Jenseits mit auf den Weg.<br />
Im griechisch-römischen Kulturraum hingegen ist die<br />
Kursleitung<br />
Christian Gers-Uphaus (Jg. 1984), begeisterter Teilnehmer der <strong>DSA</strong> im Jahr 2002,<br />
studierte zunächst Physik, Mathematik und Chemie in Münster. Dabei entdeckte er<br />
ziemlich schnell seine Vorliebe für philosophische und theologische Fragestellungen<br />
und wechselte daraufhin zu den Fächern Theologie, Philosophie und Judaistik, die er<br />
ebenfalls in Münster sowie in Rom und Paris studierte. Den Diplomabschluss erwirbt<br />
er im Frühjahr <strong>2012</strong>. Seine Interessenschwerpunkte liegen in den Bereichen Exegese<br />
sowie Patristik. In seiner Freizeit widmet er sich Fremdsprachen und spielt gerne<br />
Tennis.<br />
traditionelle Vorstellung vom Leben nach dem Tod eine andere:<br />
Homer beschreibt die Unterwelt als einen eher trostlosen<br />
Ort, an dem die Verstorbenen als Schatten leben. Dies<br />
erweckte allerdings den Widerspruch<br />
der Philosophen: Pythagoras ging als<br />
wohl erster im Abendland von einer<br />
Reinkarnation aus; Platon begründet<br />
ausführlich die Unsterblichkeit der<br />
Seele. Wesentlich nüchterner äußerte<br />
sich Epikur: »Wenn ich bin, ist der<br />
Tod nicht; wenn er ist, bin ich nicht.«<br />
Auch vor Spott war die mythische<br />
Jenseitsvorstellung nicht gefeit: Aristophanes<br />
verwendet die Unterwelt<br />
als parodistische Kulisse für seine<br />
Komödie »Die Frösche«. Im Panorama<br />
antiker Jenseitsvorstellungen darf<br />
schließlich auch das Judentum und<br />
das Christentum nicht fehlen, wo das<br />
Thema um die neue Gattung der Apokalyptik bereichert<br />
wurde: Im Zentrum steht nun nicht mehr nur der individuelle<br />
Tod, sondern die Erwartung eines nahen Weltendes<br />
mit dem Beginn eines neuen Lebens. In der Offenbarung<br />
des Johannes verbindet sich dies mit einer bizarren Bilderwelt,<br />
die erst entschlüsselt werden will.<br />
Ein Toter wird vor den Thron des Osiris geführt<br />
(Szene aus dem Totenbuch, ca. 1300 v. Ch.).<br />
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BD Hunefer<br />
cropped 2.jpg<br />
Im Kurs werden Quellentexte aus den genannten drei Kulturkreisen<br />
gelesen: Altes Ägypten, griechische Mythologie<br />
und Philosophie, biblische und frühchristliche Literatur.<br />
Ergänzt wird dies um archäologische<br />
Aspekte, da sich auch aus der Gestaltung<br />
von Pyramiden, Grabanlagen<br />
und Totentempeln einiges über die<br />
mit dem Totsein verbundenen Vorstellungen<br />
entnehmen lässt. Bei den<br />
Analysen wird gemeinsam überlegt,<br />
was die Menschen in der Antike dazu<br />
motivierte, sich ein Totengericht,<br />
einen Hades, eine Wiedergeburt oder<br />
Himmel und Hölle vorzustellen. Es<br />
wird sich herausstellen, dass dabei<br />
religiöse Traditionen und philosophische<br />
Überlegungen eng ineinandergreifen.<br />
Daraus ergibt sich dann<br />
die Frage: Welche Relevanz hat die<br />
jeweilige Vorstellung vom Leben nach dem Tod für das Leben<br />
vor dem Tod?<br />
Der Kurs setzt außer der Bereitschaft, sich bereits im Vorfeld<br />
in die Quellentexte einzulesen und ein Referat vorzubereiten,<br />
keine speziellen Vorkenntnisse voraus.<br />
Daniel Lanzinger (Jg. 1982) wurde in Augsburg geboren. Um seiner Leidenschaft<br />
für die Antike nachzugehen, studierte er Theologie, Griechisch und Philosophie, und<br />
zwar in München, Jerusalem und Münster. Die Zeit in Jerusalem war so spannend,<br />
dass er dort nach dem Diplomabschluss noch ein weiteres Jahr als Studienleiter verbrachte.<br />
Inzwischen promoviert Daniel an der Uni Bonn im Fach Neues Testament.<br />
Wenn er nicht am Schreibtisch sitzt, reist er gerne Richtung Süden, um archäologische<br />
Stätten zu erkunden und durch mediterrane Landschaften zu wandern, geht ins<br />
Theater oder liest ein gutes Buch.<br />
–– 39
40 ––<br />
AKADEMIE URSPRING (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Akademie Urspring<br />
Urspringschule<br />
Die Urspringschule liegt am Südrand der Schwäbischen Alb, 20 km westlich von Ulm<br />
– idealer Ausgangsort für Exkursionen zum Bodensee, in den Schwarzwald oder nach<br />
Stuttgart.<br />
Im Areal des über 880 Jahre alten Klosterbezirks Urspring leben und arbeiten rund<br />
260 Kinder und Jugendliche und 90 Erwachsene zusammen. Das historische Ensemble<br />
wurde in den letzten Jahren aufwendig restauriert und um neue Gebäude behutsam<br />
ergänzt. Schon bei der ersten Ankunft in Urspring stellt sich das einzigartige Campus-<br />
Gefühl ein.<br />
Urspring, eine reformpädagogisch und evangelisch geprägte Einrichtung, setzt 80<br />
Jahre nach der Gründung im Gymnasium und in der Montessori-Grundschule heute<br />
folgende inhaltliche Schwerpunkte:<br />
Abitur und Lehre: Alle Mädchen und Jungen können zusätzlich zum Abitur in vier<br />
Meisterwerkstätten eine Lehre mit Gesellenprüfung kurz nach dem Abitur machen.<br />
Basketball-Leistungszentrum: Urspring ist ein vom <strong>Deutsche</strong>n Basketball Bund anerkanntes<br />
Basketball-Internat. In den Teams der Urspringschule haben talentierte<br />
Jugendliche, Jungen und Mädchen, die Chance, sich mit professionellem Coaching<br />
hochzuarbeiten. Die Meistertitel und Finalteilnahmen auf Bundes- und<br />
Landesebene der letzten Jahre sprechen für sich.<br />
Urspring ist bunt: Typisch für das Leben in Urspring ist die bunte Variationsbreite der<br />
Herkunft der Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten und Gesellschaftszusammenhänge.<br />
Tägliche Begegnungen in Schule, Arbeitsgemeinschaften,<br />
Werkstätten, Wohngruppen fordern und fördern den ganzen Menschen.<br />
Diese Schwerpunktsetzung prägt die Angebotspalette in Urspring: Zweibettzimmer<br />
im historischen Baubestand, fachmännisch ausgestattete Schülerwerkstätten, EDV-<br />
Schulungsraum, Cafeterien, Foren für Theater, Kunstausstellungen und Musik, Mehrzweckhalle,<br />
Sporthalle und Sportplatz – und mittendrin die eigene Kirche für Gottesdienste<br />
und Konzerte.
URSPRINGSCHULE<br />
AN DER SCHWÄBISCHEN ALB<br />
89601 SCHELKLINGEN<br />
www.urspringschule.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE URSPRING<br />
4.1 Abstraktion in der Mathematik<br />
4.2 Teilchenphysik mit dem ATLAS-Detektor<br />
4.3 Chemie zum Anschauen<br />
4.4 Der »Unsichtbaren Hand« auf die Finger klopfen?<br />
4.5 Einheit und Freiheit<br />
4.6 Ist Gott tot?! Akademieleitung<br />
Joachim (Jo) Schwerdtfeger (Jg. 1962) wird im Sommer bereits zum siebten<br />
Male Aktivurlaub in Urspring verleben. Seitdem die <strong>DSA</strong> im Jahre 2008 ins<br />
Schwäbische zurückgekehrt ist, kann er dem Ort, den Menschen und dem Akademieerlebnis<br />
nicht widerstehen. In den vielen Jahren seiner <strong>DSA</strong>-Tätigkeit leitete<br />
er allerdings nicht nur Akademien, sondern ab und an auch Kurse zu Themen<br />
aus den Bereichen Mathematik und Biologie – die Fächer, die mittlerweile<br />
auch seinen (Schul-)Alltag bestimmen. In seiner Freizeit widmet er sich gern<br />
dem Schachspiel, genießt auf dem Rad die Natur des Niederrheins oder er lässt<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Lena-Maria Kramer (Jg. 1979) studierte Gesang und Gesangspädagogik und<br />
freut sich jeden Tag, dass sie von dieser »brotlosen Kunst« leben kann. Als Sängerin<br />
ist sie vor allem im Bereich Oratorium, Alte Musik und Neue Musik tätig.<br />
Sie unterrichtet außerdem freischaffend und als Angestellte der Städtischen Musikschule<br />
Düsseldorf, sowie als Lehrbeauftragte an der Folkwang Universität<br />
der Künste (UdK) Essen. Während ihrer täglichen Zugfahrten hört sie gerne<br />
Hörspiele von der Hexe Schrumpeldei über John Sinclair bis hin zu den 3 ???.<br />
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihren Freunden und Gesellschaftsspielen.<br />
sich ganz einfach von seiner Neugier treiben.<br />
Ronja Flemming (Jg. 1991) hat schon einige Akademien miterleben dürfen.<br />
Nachdem sie im Jahr 2009 Teilnehmerin war, arbeitete sie mit Begeisterung<br />
2010 und 2011 zusammen mit Jo in der Akademieleitung. Sie schaut schon jetzt<br />
voller Vorfreude dem Aufenthalt in Urspring entgegen. Im »richtigen« Leben ist<br />
Ronja Wirtschaftsingenieurwesen-Studentin in ihrer Wunschstadt Berlin. Dort<br />
lebt sie seit 2010 und ist noch immer dabei, die Hauptstadt fleißig gemeinsam<br />
mit Freunden zu erkunden. Die restliche Zeit des Tages verbringt Ronja in der<br />
Sporthalle beim Handball, wo sie entweder selber spielt oder eine Kindermannschaft<br />
trainiert.<br />
–– 41
42 ––<br />
AKADEMIE URSPRING (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 4.1<br />
Abstraktion in der Mathematik<br />
Einführung in die abstrakte Algebra und andere Beispiele aus der Mathematik<br />
Abstraktion ist ein Begriff, der oft abschreckend wirkt. Und<br />
doch ist unser begriffliches Denken von unserem Abstraktionsvermögen<br />
bestimmt:<br />
Kinder lernen nach und<br />
nach, dass zum Beispiel<br />
der Begriff »Kuh« nicht<br />
nur ein bestimmtes Lebewesen<br />
auf ihrem lokalen<br />
Bauernhof meint, sondern<br />
eine Vielzahl verschiedener<br />
Instanzen zusammenfasst.<br />
Ähnlich fassen wir Kühe,<br />
Pferde, Rosen, Würmer<br />
und Menschen (und vieles<br />
mehr) unter dem Begriff »Lebewesen« zusammen. Wenn<br />
wir also wissen, dass sich jedes Lebewesen irgendwie fortpflanzen<br />
können muss, können wir dieses Wissen auf jedes<br />
neue Beispiel von Lebewesen anwenden und müssen es<br />
uns nicht für jede Art neu überlegen. Somit stellt Abstraktion<br />
eine wichtige Grundlage für unser Denken und unsere<br />
Sprache dar.<br />
Kursleitung<br />
Mathematik besteht zum größten Teil aus solcher Abstraktion.<br />
Erfolgreiche Abstraktion kann neues Licht auf ein<br />
Problem werfen und völlig unterschiedliche Gebiete innerhalb<br />
und außerhalb der Mathematik verbinden. Dieser<br />
Kurs wird zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Bereichen<br />
der Mathematik (wie etwa Algebra, Geometrie und Zahlen-<br />
system) erkunden:<br />
– Wie addiert man Uhrzeiten?<br />
Und wie »addiert«<br />
man Symmetrien?<br />
Die Suche nach einem<br />
adäquaten Additionsbegriff<br />
führt zum Konzept der Gruppe. Diese finden nicht<br />
nur in der Mathematik, sondern auch in »alltäglichen«<br />
Situationen Anwendung, zum Beispiel durch die Kryptographie.<br />
– Nimmt man noch die Multiplikation zur Addition hinzu,<br />
gelangt man zur Definition eines Körpers. Hier sind<br />
rationale und reelle Zahlen die bekanntesten Beispiele,<br />
doch es gibt auch andere: Restklassen (wie zum Beispiel<br />
Uhrzeiten) lassen sich auch multiplizieren und bilden<br />
unter bestimmten Umständen ebenfalls einen Körper.<br />
– Was bedeutet eigentlich »Gleichheit«? Wie können wir<br />
z.B. formal beschreiben, dass 2/4 und 1/2 die gleiche<br />
rationale Zahl darstellen? Gibt es andere Relationen, die<br />
Julia Goedecke (Jg. 1982) nahm während der Schulzeit an einem Mathematikkurs<br />
der <strong>DSA</strong> über konforme Abbildungen und nicht-euklidische Geometrie in Schelklingen<br />
teil. Ihr Mathematikstudium sowie ihre Promotion im Bereich Kategorientheorie<br />
absolvierte sie in Cambridge. Nach einem Forschungsjahr in Belgien unterrichtet und<br />
forscht sie momentan wieder in Cambridge als Fellow des Queens' College. Außerhalb<br />
der Mathematik ist Julia eine enthusiastische Sängerin. Mit den New Cambridge Singers<br />
tritt sie regelmäßig in Konzerten auf, in denen sie gelegentlich auch Solopartien<br />
übernimmt.<br />
Wichtigste Anforderung an die Teilnehmer ist<br />
die Bereitschaft, sich auf abstraktes Denken<br />
einzulassen und erleben zu wollen, dass Mathematik<br />
über Rechnen weit hinausgeht.<br />
etwas Ähnliches wie »Gleichheit« beschreiben, und wie<br />
kann man damit Objekte in »Gleiche« und »Ungleiche«<br />
einteilen?<br />
– Vektoren, sei es in der Ebene oder im Raum, sind einigen<br />
schon bekannt. Man kann die Addition solcher<br />
Vektoren und die skalare Multiplikation formalisieren<br />
und so den Begriff des Vektorraums definieren.<br />
Im daraus entstehenden Gebiet der linearen<br />
Algebra kann man im gleichen Atemzug über<br />
Vektorräume und über Abbildungen zwischen<br />
ihnen sprechen, da letztere ebenfalls Vektorräume<br />
bilden.<br />
– Zum Abschluss unternimmt der Kurs einen kleinen Abstecher<br />
in das abstrakteste Gebiet moderner Mathematik:<br />
in die Kategorientheorie. Hier werden zum Beispiel<br />
alle Gruppen und ihre Abbildungen oder alle Vektorräume<br />
und ihre Abbildungen zu einem einzigen Objekt<br />
zusammengefasst, welches dann selbst zum Gegenstand<br />
von Untersuchungen wird.<br />
Die Inhalte des Kurses werden zunächst durch Referate der<br />
Teilnehmer und anschließend durch Gruppenarbeit und<br />
gemeinsame Diskussion erschlossen. Ziel ist es, Arbeitsmethoden<br />
und Ideen aus der weiten Welt der reinen Mathematik<br />
kennen und die Abstraktion lieben zu lernen.<br />
Julian Vogel (Jg. 1982) interessierte sich bereits in der Schule für die Naturwissenschaften<br />
und nahm mehrfach am Wettbewerb »Jugend forscht« teil. Anschließend<br />
studierte er Physik und Mathematik in Karlsruhe mit einem Abstecher nach<br />
Cambridge. Nach seiner Diplomarbeit aus dem Bereich der Relativitätstheorie ist<br />
er seit 2007 Diplom-Physiker. Seit 2009 lernt Julian eine ganz andere Seite der<br />
Physik kennen und gestaltet im Bundesumweltministerium den Strahlenschutz<br />
für Bevölkerung, Arbeitskräfte und Patienten. Nach der Arbeit entspannt er am<br />
liebsten beim Laufen und Fahrradfahren.
Kurs 4.2<br />
Teilchenphysik mit dem ATLAS-Detektor<br />
ATLAS ist einer der vier großen Teilchen-Detektoren des<br />
LHC-Beschleunigerrings (Large Hadron Collider) am Forschungszentrum<br />
der Europäischen Organisation für Kernforschung<br />
(CERN) in Genf. Der Detektor ist ein Werkzeug<br />
zur Untersuchung spannender physikalischer Fragen: Was<br />
sind die fundamentalen Bausteine der Materie und welche<br />
Kräfte wirken zwischen ihnen? Unter ATLAS im weiteren<br />
Sinne versteht man auch die Gemeinschaft einiger Tausend<br />
Physiker, Ingenieure und Techniker, die den Detektor gebaut<br />
haben und mit ihm arbeiten.<br />
Im Kurs werden die folgenden Punkte näher betrachtet:<br />
Wie ist der Detektor aufgebaut? Wie arbeiten experimentelle<br />
Teilchenphysikerinnen und Teilchenphysiker? Was sind<br />
die wesentlichen physikalischen Zusammenhänge, die wir<br />
mit dem ATLAS-Detektor erforschen?<br />
Um die Bedeutung des ATLAS-Experiments besser einordnen<br />
zu können, wird zu Anfang des Kurses das so genannte<br />
Standard-Modell der Teilchenphysik besprochen. Es wurde<br />
in den 1970er Jahren entwickelt und beschreibt bis heute<br />
alle uns bekannten Teilchen und ihre Wechselwirkungen<br />
mit hoher Genauigkeit.<br />
Kursleitung<br />
Nach dem einleitenden Theorieteil geht es um konkrete<br />
Fragestellungen, die für das Verständnis des Experiments<br />
wichtig sind: Was passiert, wenn zwei Protonen kollidieren?<br />
Welche Teilchen können entstehen? Wie »sieht«<br />
der Detektor diese Teilchen? Wie »sehen« Physiker die<br />
Teilchen in ihren Messdaten? Bei der Beantwortung dieser<br />
Fragen lernt man den Detektor näher kennen und auch<br />
die Software, die benötigt wird, um die riesigen Mengen<br />
aufgezeichneter Daten zu<br />
untersuchen (ATLAS liefert<br />
rund 30 GB pro Sekunde an<br />
Rohdaten, das wären rund<br />
eine halbe Millionen DVDs<br />
am Tag).<br />
Physiker bauen ihre Experimente gerne selber – einen Teilchenbeschleuniger<br />
kann man nicht aus dem Katalog bestellen<br />
(und bei Problemen kann man sich nicht an den Kundendienst<br />
wenden). Ein wichtiger Teil der Arbeit besteht<br />
darin, sich mit einem Teil des Detektors näher auseinander<br />
zu setzen: Manchmal gibt es technische Schwierigkeiten<br />
zu beseitigen, in anderen Fällen will man die Effizienz<br />
Sarah Heim (Jg. 1985) studierte Physik in Heidelberg und Lansing, Michigan (USA). Zurzeit<br />
lebt sie in der Nähe von Genf (Schweiz) und ist Teil der ATLAS Kollaboration am Forschungszentrum<br />
CERN. Der Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit ist die Suche nach neuen Wechselwirkungsteilchen,<br />
die in den Proton-Proton Kollisionen des LHC produziert werden könnten<br />
und in zwei hochenergetische Elektronen zerfallen würden. Wenn sie nicht gerade nach neuen<br />
Teilchen sucht, wandert sie im nahen Jura, kajakt auf der Rhone und genießt die französische<br />
Küche.<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE URSPRING<br />
Das Kursangebot richtet sich an alle, die sich für<br />
Teilchenphysik interessieren! Mathe- oder Physik-<br />
LK sind zur Teilnahme nicht erforderlich. Ein großer<br />
Teil der Arbeit findet am Computer statt, es<br />
wird aber alles dazu Notwendige im Kurs erklärt.<br />
verbessern. Dies soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht<br />
werden.<br />
Nach etwa der Hälfte des Kurses sind dann alle »Zutaten«<br />
vorhanden, um eigene Experimente durchzuführen! Die<br />
Teilnehmenden werden in kleinen Gruppen echte experimentelle<br />
Daten auswerten und dabei wichtige Teile des<br />
Standard-Modells »wiederentdecken«. Wie es sich für eine<br />
wissenschaftliche Arbeit gehört, werden<br />
die Ergebnisse schriftlich festgehalten<br />
und mit den anderen Teilnehmenden<br />
diskutiert.<br />
Der Kurs wird abgerundet durch<br />
einem Überblick über offene Fragen im<br />
Standard-Modell und jenseits davon: Es gibt zahlreiche<br />
theoretisch denkbare Erweiterungen, und zwischen diesen<br />
Theorien zu unterscheiden ist eine wichtige Aufgabe von<br />
ATLAS und den anderen LHC-Experimenten. Über das<br />
Higgs-Boson wird dabei sicherlich auch gesprochen – mehr<br />
kann jetzt noch nicht verraten werden.<br />
Kilian Rosbach (Jg. 1981) studierte Physik in Bonn und Berlin. Im Anschluss<br />
machte er einen Ausflug in die Neurowissenschaften mit einem<br />
Projekt zu synaptischen Proteinen an der Universität von Amsterdam, Niederlande.<br />
Seit Anfang 2010 arbeitet er wieder als Physiker, diesmal als Doktorand<br />
der Universität Genf, Schweiz, und untersucht mit dem ATLAS-Detektor<br />
Proton-Proton Kollisionen – vor allem solche, bei denen Top-Quarks<br />
entstehen. Zur Erholung geht er Joggen oder versucht, Klavier zu spielen.<br />
–– 43
44 ––<br />
AKADEMIE URSPRING (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 4.3<br />
Chemie zum Anschauen<br />
Farbstoffe und Analysemethoden<br />
Es ist bunt, es leuchtet und es sieht schön aus – ich will es<br />
haben! Farben werden in der Industrie- und Werbebranche<br />
zielgerichtet eingesetzt, um Kunden zu begeistern oder ein<br />
Produkt ins rechte Licht zu setzen. Aber warum ist unsere<br />
Jeans eigentlich blau, was ist wirklich im roten Gummibärchen<br />
und wie entsteht z.B. an Silvester das Licht von<br />
Feuerwerk?<br />
Der Kurs geht diesen Fragestellungen aus Sicht der Chemie<br />
nach. Dabei stehen allgemein-chemische Prinzipien<br />
von Farbigkeit, die Synthese und Einteilung organischer<br />
Farbstoffe, der Aufbau farbiger Komplexe sowie entsprechende<br />
Analysemethoden im Vordergrund. Die gemeinsam<br />
erarbeitete Theorie wird durch Experimente vertieft, die in<br />
Kleingruppen eigenständig geplant, durchgeführt und ausgewertet<br />
werden.<br />
Dabei wird geklärt, was Farben eigentlich sind und warum<br />
wir sie sehen können – dazu sind auch Einblicke in den<br />
Atombau und Exkurse in die Physik und Biologie vorge-<br />
Kursleitung<br />
sehen: Wie funktioniert unser Auge, was ist Licht und wie<br />
kommt ein Farbeindruck zustande?<br />
Neben den theoretischen Grundlagen wirft der Kurs ebenfalls<br />
einen Blick auf die großtechnische Umsetzung: Wie<br />
funktioniert das Färben? Welche Eigenschaften müssen<br />
Farbstoffe haben, damit unsere Kleidung in der Waschmaschine<br />
ihre Farbe behält?<br />
Eva Koch (Jg. 1986) studierte Chemie in Leipzig, Melbourne (Australien) und Athens<br />
(USA). Sie nahm 2009 als Young Researcher an der Nobelpreisträgertagung Chemie in<br />
Lindau teil und war 2010 als deutsche Jugenddelegierte auf dem G8/G20-Gipfel in Kanada.<br />
Derzeit arbeitet sie an ihrer Promotion in der organischen Chemie an der Westfälischen<br />
Wilhelms-Universität Münster. In ihrer Freizeit betreut sie Projekte beim<br />
Förderverein Chemie-Olympiade, engagiert sich bei der evangelischen Studentengemeinde<br />
und spielt leidenschaftlich gern (Brett-)Spiele. Bereits seit ihrer Teilnahme an<br />
der <strong>SchülerAkademie</strong> 2005 wartet sie darauf, selbst einen Kurs leiten zu dürfen.<br />
Weitere Themenschwerpunkte bilden Pigmente und deren<br />
Anwendung bei Wandfarben und Autolacken, Farben in<br />
Lebensmitteln und Kosmetika, aber auch das Leuchten von<br />
Neonröhren, Silvesterraketen und Knicklichtern (Fluoreszenz/Phosphoreszenz).<br />
Um farbige Stoffe zu analysieren und Farben objektiv messen<br />
zu können, werden in der Praxis UV/Vis-Spektroskopie<br />
und Dünnschichtchromatographie genutzt. Die Techniken<br />
sollen gemeinsam erarbeitet und in Experimenten selbst erprobt<br />
werden. Der große Bereich der chemischen Analytik<br />
wird im Laufe der Zeit regelmäßig wieder aufgegriffen und<br />
vertieft werden. Es ist zudem ein Exkurs in die Kernspinresonanz-Spektroskopie<br />
(NMR) vorgesehen.<br />
Nicht zuletzt spielt das wissenschaftlich-korrekte Arbeiten<br />
in der Chemie im Rahmen dieses Kurses eine große Rolle.<br />
Dabei werden die Teilnehmenden an Originalliteratur herangeführt<br />
und auch selbst wissenschaftlich-angemessene<br />
Texte verfassen. Des Weiteren wird vorgestellt, wie ein<br />
Laborbuch angefertigt wird, wie man in chemischen Datenbanken<br />
recherchiert und was »gute wissenschaftliche<br />
Praxis« bedeutet.<br />
Diese und andere Themen werden gemeinsam oder in<br />
kleinen Gruppen erarbeitet. Vorgesehen sind auch die<br />
Übernahme von Diskussionsleitungen durch die Teilnehmenden,<br />
die mündliche Präsentation von Fachthemen und<br />
Planspiele.<br />
Um direkt mit der Chemie der Farbstoffe im Kurs beginnen<br />
zu können, müssten vor Beginn des Kurses einige Grundlagen<br />
der Organik selbstständig erarbeitet werden. Alle Teilnehmenden<br />
bereiten außerdem im Vorfeld der Akademie je<br />
ein Kurzreferat aus einem Themenpool vor.<br />
Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Chemie reichen aus.<br />
Kai Koch (Jg. 1986) studierte Schulmusik an der Hochschule für Musik Detmold<br />
und Chemie an der Universität Paderborn. Seit 2011 absolviert er ein Masterstudium<br />
mit dem Hauptfach Orgel an der Musikhochschule Münster. Er ist unter anderem<br />
mehrfacher Preisträger beim Bundeswettbewerb Komposition und bei »Jugend<br />
Komponiert«. 2007 wurde er mit dem Förderpreis »Junge Kunst im Hochstift« ausgezeichnet.<br />
Neben Chorleitung und populärem Klavierspiel gehören Gesellschaftsspiele<br />
und Kochen zu seinen größten Leidenschaften. Er ist sehr auf seine allererste<br />
<strong>SchülerAkademie</strong> gespannt.
Kurs 4.4<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE URSPRING<br />
Der Unsichtbaren Hand auf die Finger klopfen?<br />
Zum Verhältnis von Markt und Staat<br />
Die Metapher von der »Unsichtbaren Hand« geht auf eine<br />
eher beiläufige Formulierung des berühmten Ökonomen<br />
Adam Smith zurück, der im 18. Jahrhundert bezeichnenderweise<br />
vor allem als Moralphilosoph bekannt war. Aber<br />
sie hat seither eine imposante Karriere erlebt und ist zum<br />
Inbegriff dessen geworden, was wir als modernen Kapitalismus<br />
kennen: eine spezifische Form des wirtschaftlichen<br />
Denkens und Handelns, die der zentralen Planung und<br />
Steuerung nicht bedarf. Sie vertraut in besonderem Maße<br />
auf die Eigendynamik des Marktes, aus der am ehesten das<br />
Gemeinwohl erwachse – so zumindest lautet die Annahme.<br />
Daraus folgt wiederum die Forderung, daß Staat und Gesellschaft<br />
in diesen Markt so wenig wie möglich eingreifen<br />
sollten. Freilich ist die Erwartung, der Markt könne sich<br />
selbst regulieren, gerade in der jüngsten Vergangenheit<br />
immer wieder enttäuscht worden. Die Krisen des Finanzsystems<br />
und der Staatsverschuldung führen nicht nur<br />
zum Konjunkturabschwung, sondern eben auch zum<br />
Kursleitung<br />
Georg Eckert (Jg. 1983) schloss sein Studium der Geschichte und Philosophie<br />
in Tübingen und Brighton mit einer Dissertation über die Zeit der<br />
Aufklärung ab. Seither lehrt der gebürtige Württemberger als Historiker<br />
an der Universität Wuppertal und erforscht vor allem, wie und warum<br />
bestimmte Ideen politisch wirksam werden. Das setzt etwas Lektüre voraus<br />
– und vor allem den Dialog mit anregenden Menschen, zum Beispiel<br />
bei <strong>SchülerAkademie</strong>n. Je nach Jahreszeit fährt Georg zudem gerne Fahrrad<br />
oder Ski und singt in mehreren Chören.<br />
Aufschwung von Forderungen, die Politik müsse jener<br />
»Unsichtbaren Hand« durch direkte Eingriffe in das Marktgeschehen<br />
auf die Finger klopfen.<br />
Doch diese Streitfragen sind viel älter als der Kapitalismus.<br />
Ob und wie wirtschaftliches Handeln reguliert und gelenkt<br />
werden müsse, ist seit jeher umstritten. Der Kurs wendet<br />
sich zahlreichen Versuchen zu, das Verhältnis von Markt<br />
und Staat zu bestimmen – aus Geschichte und Gegenwart,<br />
vom antiken Griechenland bis zur Moderne. Vor allem seit<br />
dem 18. Jahrhundert, in dem sich erst ein hinreichend<br />
starker Staat ausgebildet hat, tobt eine umfassende Diskussion,<br />
deren Protagonisten wie etwa Adam Smith, Karl<br />
Marx, John Maynard Keynes und Milton Friedman, im<br />
Kurs anhand von ausgewählten, teilweise längst klassisch<br />
gewordenen Texten behandelt werden.<br />
Die eingehende gemeinsame Lektüre soll vor allem auf<br />
die ökonomischen, sozialen, politischen und moralischen<br />
bzw. philosophischen Eigenheiten der jeweils geschilderten<br />
Auffassungen von Wirtschaft aufmerksam machen. Insbesondere<br />
gilt es darauf zu achten, welche theoretischen Prämissen<br />
ihnen zugrunde liegen und welche praktischen Implikationen<br />
aus ihnen folgen. Schließlich sind es einerseits<br />
die jeweiligen Menschenbilder, die den Rahmen für die<br />
jeweiligen Gesellschaftsordnungen vorgeben. Andererseits<br />
bestimmt das jeweils gewählte Verhältnis von Markt und<br />
Staat, ob solche Ordnungen stabilisiert oder verändert werden:<br />
Jede Steuer ist zum Beispiel ein Eingriff in den Markt.<br />
Weil die Märkte sich nun nicht mehr allein von den Nationalstaaten<br />
steuern lassen, wird sich der Kurs auch übernationalen<br />
Ordnungsmodellen wie gerade der EU, widmen.<br />
Jens Müller (Jg. 1984) verließ nach dem Abitur den heimischen Niederrhein und absolvierte im<br />
Anschluss an einen Freiwilligendienst in Frankreich den Bachelorstudiengang »Deutsch-Französische<br />
Studien« in Regensburg und Clermont-Ferrand. Dabei entdeckte er seine Leidenschaft<br />
für wirtschaftsphilosophische und -politische Themen, weshalb er sich anschließend für einen<br />
Masterstudiengang in »Europäischer Volkswirtschaftslehre« in Brüssel entschied. Seit dem Ende<br />
des Studiums arbeitet er als parlamentarischer Referent eines Europaabgeordneten. Er freut sich<br />
darauf, nach 2009 zum zweiten Mal einen Kurs gemeinsam mit Georg Eckert zu leiten – und mit<br />
ihm hoffentlich auch wieder beim Badminton erfolgreich zu sein.<br />
–– 45
46 ––<br />
AKADEMIE URSPRING (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 4.5<br />
Einheit und Freiheit<br />
Deutschland und die <strong>Deutsche</strong> Frage im Spiegel politischer Reden<br />
Die <strong>Deutsche</strong>n sind eine »verspätete Nation« (Helmuth<br />
Plessner). Die Frage nach Einheit und Freiheit, nach deren<br />
Verhältnis zueinander, hat die deutsche Geschichte wie keine<br />
andere begleitet – und beeinflusst. Sie war oft genug eine<br />
Frage nach Einheit oder Freiheit, denn eine gleichzeitige<br />
Verwirklichung beider Stränge scheiterte immer wieder an<br />
inneren und äußeren Widerständen. Deutschlands Mittellage<br />
in Europa, seine föderale und vielstimmige Geschichte<br />
sowie sein historisches Sendungsbewusstsein trugen dazu<br />
bei, dass die Frage nach der territorialen Ausdehnung und<br />
der inneren Verfasstheit Deutschland und Europa schon<br />
seit dem Mittelalter beschäftigte.<br />
Vor diesem Hintergrund wurde die »<strong>Deutsche</strong> Frage«<br />
im Völkerfrühling des 19. Jahrhunderts erneut virulent,<br />
bestand nun doch die Hoffnung, die verzögerte Nationalstaatsbildung<br />
Deutschlands nach dem Ende des Heiligen<br />
Römischen Reichs und den Befreiungskriegen ein für alle<br />
Mal abzuschließen. Der Weg zum modernen Nationalstaat<br />
war jedoch steinig: Er führte durch die zerplatzten Träume<br />
Kursleitung<br />
Angela Abmeier (Jg. 1984) studierte in Berlin und Cambridge (UK) Geschichte,<br />
Neuere deutsche Literatur und Rechtswissenschaften. Der Geschichtswissenschaft<br />
treu geblieben, arbeitet sie derzeit in Archiven und Bibliotheken an ihrer Doktorarbeit<br />
zur deutsch-deutschen Außenpolitik. Sie reist aber nicht nur gern in die Vergangenheit,<br />
sondern auch in fremde Länder. Daheim in Berlin singt sie in einem<br />
Chor und erfreut sich am reichhaltigen kulturellen Angebot der Hauptstadt: an<br />
Theater, Konzert, Kino oder aber an einem gemütlichen Kaffee mit Freunden in<br />
einem der zahlreichen Cafés.<br />
von 1848 und das Blut und Eisen dreier Einigungskriege<br />
erst in die wilhelminische (Selbst-)Herrlichkeit, dann<br />
geradewegs in die »Urkatastrophe« von 1914 (George F.<br />
Kennan). Das mörderische 20. Jahrhundert sah Einheit und<br />
Freiheit erst in zwei Weltkriegen zerbersten, bevor sie – die<br />
Teilung im Systemwettbewerb zunächst zementiert – am<br />
Ende 1990 doch noch gemeinsam gelangen, dieses Mal<br />
nicht gegen, sondern mit seinen Nachbarn im europäischen<br />
Mächtekonzert. Es war ein »langer Weg nach Westen«<br />
(Heinrich August Winkler).<br />
Diese Nationalgeschichte wird anhand wichtiger politischer<br />
Reden zu den Leitmotiven »Einheit« und »Freiheit« erschlossen<br />
und die <strong>Deutsche</strong> Frage in den sechs Zeiträumen<br />
»1848«, »Kaiserreich«, »Weimar«, »Nationalsozialismus«,<br />
»Bundesrepublik« und »DDR« seit dem 19. Jahrhundert<br />
nachgezeichnet. Da weltpolitische Daten und Zäsuren<br />
deutscher Geschichte nicht notwendigerweise mit der<br />
Fragestellung nach Einheit und Freiheit zusammenfallen,<br />
muss dieser Gang durch die neueste deutsche Geschichte<br />
notwendigerweise selektiv und also kursorisch bleiben.<br />
Der Kurs wird stattdessen die Quellen in der Tiefe befragen<br />
(Quellenkritik) und sie in ihren jeweiligen biographischen,<br />
politik- und geistesgeschichtlichen Umfeldern verorten<br />
(Kontextualisierung): Welche Personen und Gruppen standen<br />
aus welchen Gründen wann und wie zum Fragenkomplex<br />
von Einheit und Freiheit und was bedeutet dies?<br />
Der Kurs wird quellenbasiert arbeiten, um sich so der Arbeit<br />
eines Historikers anzunähern: Was können Quellen zu<br />
einer bestimmten Fragestellung aussagen – und was nicht?<br />
Dazu werden auch geschichtswissenschaftliche Methoden<br />
erlernt. Der Kurs stellt damit eine vertiefte Einführung in<br />
die historische Quellenforschung anhand politischer Reden<br />
zur deutschen Nationalgeschichte dar.<br />
Für eine erfolgreiche Teilnahme ist gutes Schulwissen zur<br />
deutschen Geschichte unerlässlich. Dies wird im Kurs als<br />
gegeben vorausgesetzt, denn die Reden werden anhand von<br />
Teilnehmerreferaten, weiteren Bild- und Textquellen sowie<br />
Fachliteratur von den Teilnehmenden in großen Teilen<br />
selbstständig erschlossen.<br />
Christian E. Rieck (Jg. 1978) studierte in Bayreuth, im spanischen Sevilla, in Berlin<br />
und Oxford (UK) zunächst die Rechte, dann Regionalwissenschaften. Nach einer<br />
Projektassistenz bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin war er wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien GIGA in Hamburg.<br />
An der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Leipzig lehrt er an der<br />
Schnittstelle zwischen Zeitgeschichte und Politikwissenschaft. Er brennt für die Geschichte<br />
des 19. und 20. Jahrhunderts – wie auch für die neuzeitliche Kinematographie.
Kurs 4.6<br />
Ist Gott tot?!<br />
Philosophische und theologische Antwortsuche<br />
Die Frage nach der Existenz Gottes wird besonders in<br />
der Gegenwart häufig gestellt und negativ beantwortet.<br />
Gott wird neurophysiologisch als Destillat unserer Hirnfunktionen<br />
gesehen, die Religion evolutionsbiologisch als<br />
Wettbewerbsvorteil im Kampf ums Überleben beschrieben.<br />
Andere Vertreter des Neuen Atheismus (wie z.B. Richard<br />
Dawkins, der mit seinem Buch »Der Gotteswahn« auf den<br />
Bestsellerlisten steht) deklarieren den Glauben an Gott als<br />
irrational und sehen schwerwiegende negative Auswirkungen.<br />
Allerdings sind sich Kritiker einig, dass diese Art von<br />
Atheismus nicht durchweg überzeugen kann. Stattdessen<br />
scheinen sie auf die großen atheistischen Positionen des<br />
neunzehnten Jahrhunderts lediglich zurückzugreifen.<br />
Für Feuerbach war die Religion lediglich eine Projektion<br />
menschlicher Wünsche und Ideale und Gott dementsprechend<br />
ein fiktives Wesen für diese menschlichen Bedürfnisse,<br />
Marx sah Religion als »Opium des Volkes«, ein<br />
Kursleitung<br />
Katharina Hölzner (Jg. 1984) studierte an der Technischen Universität Dortmund<br />
katholische Theologie und Philosophie und absolvierte anschließend in Essen ihr<br />
Referendariat. Seit Februar <strong>2012</strong> arbeitet sie als Lehrerin an einem Wittener Gymnasium.<br />
Nebenbei liest sie alles, was sie in die Finger bekommt, kocht gerne und treibt<br />
regelmäßig Sport<br />
Beruhigungs- und Betäubungsmittel, das illusorisches statt<br />
wirkliches Glück verschafft; für Friedrich Nietzsche war<br />
Gott schlicht tot.<br />
Aber wie sieht es eigentlich mit der Kehrseite der Medaille<br />
aus? Was sagen Theologen zu den alten und neuen Vorwürfen?<br />
Schließlich ist es auch für die Verfechter Gottes<br />
nicht unbedingt leicht, die Argumente der Atheisten zu<br />
widerlegen. Denn Beweise für die Existenz Gottes gibt es<br />
nicht, zumindest nicht mehr, seit Kant den traditionellen<br />
Gottesbeweis entlarvt hat.<br />
Im Zusammenhang mit der Projektionsthese argumentieren<br />
Theologen historisch. Die Schaffung Gottes als Spiegelbild<br />
der menschlichen Wünsche und Ideale ist ein aufklärerisches<br />
Argument; die Gotteserfahrung jedoch ist ein<br />
ursprüngliches Phänomen, Religion gehört im Gegensatz<br />
zur Aufklärung von Anfang an zum Menschen. Zudem<br />
argumentiert die Kirche und die Theologie, dass die An-<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE URSPRING<br />
erkennung Gottes keineswegs der Würde des Menschen<br />
widerspricht, da diese Würde in Gott selbst gründet und<br />
vollendet wird. Welche weiteren Argumente führen Theologen<br />
an, um die Existenz Gottes annehmen zu können<br />
und gelten zu lassen? Was für ein Gottesverständnis steckt<br />
eigentlich dahinter? Können diese Argumente denn überhaupt<br />
überzeugen? Und wie sieht es eigentlich mit den<br />
Konsequenzen der jeweiligen Auffassungen für das Weltbild<br />
aus? Welche der Positionen kann eine bessere Antwort<br />
auf die Fragen des Lebens geben: derjenige, der an Gott<br />
glaubt, oder derjenige, der sich jedem Glauben an Gott<br />
verweigert? Was für ein Bild des Menschen wird erschaffen?<br />
Wären wir ohne Religion und Gott wirklich besser dran?<br />
Nach einem Überblick über den Religionsbegriff wird in<br />
unterschiedlichen Arbeitsformen diesen und anderen Fragen<br />
mit Hilfe von unterschiedlichen Ansätzen der Theologie<br />
und der Philosophie auf der Suche nach einer Antwort<br />
auf die Gottesfrage nachgegangen.<br />
Matthias Hölzner (Jg. 1977) ist Lehrer an einem Essener Gymnasium für die Fächer<br />
Mathematik, Deutsch und katholische Religion. Außerdem hat er als promovierter<br />
Sprachwissenschaftler einen Lehrauftrag an der Universität Duisburg-Essen für Linguistik<br />
und Sprachdidaktik. In seiner Freizeit treibt er regelmäßig Sport.<br />
–– 47
48 ––<br />
AKADEMIE HILDEN (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Akademie Hilden<br />
Evangelisches<br />
Schulzentrum Hilden<br />
Unmittelbar neben dem beschaulichen Stadtzentrum von Hilden, einer typischen bergischen<br />
Mittelstadt, lernen täglich ca. 1.850 junge Menschen in zwei Schulen auf einem weiträumigen<br />
Campus: Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (1.100 Schülerinnen und Schüler), die Wilhelmine-<br />
Fliedner-Realschule (750 Schülerinnen und Schüler) und das Internat sowie das Tagesinternat bilden<br />
das Evangelische Schulzentrum Hilden.<br />
Gut ausgestattete Fach- und Sammlungsräume (Naturwissenschaften, Musik, Kunst, Theater) und<br />
eine große Sportanlage (zwei Sporthallen, eine Judohalle, Außenplatz mit Tartanbahn, Kugelstoß-<br />
und Weitsprunganlage), Bibliothek, Interneträume und -Café machen Lust zum Lernen.<br />
Im Internat leben ungefähr 60 Schülerinnen und Schüler in Einzel- und Doppelzimmern, z.T.<br />
mit eigener Dusche und WC. Die große Mensa wird vom eigenen Küchenteam betreut und bietet<br />
täglich neben Frühstück und Abendbrot zwei frisch gekochte Mittagsmahlzeiten an, auch vegetarische.<br />
Kulturelle Angebote im Großraum von Düsseldorf und Köln, im Ruhrgebiet und im Bergischen<br />
Land sind vom Schulzentrum aus gut zu erreichen.
EVANGELISCHES SCHULZENTRUM HILDEN<br />
GERRESHEIMER STR. 74<br />
40721 HILDEN<br />
www.eszhilden.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
5.1 Immer mehr und trotzdem wenig?<br />
5.2 Der metallene Mensch<br />
5.3 Auf den Spuren von Tim Berners-Lee<br />
5.4 Mensch – Bürger – Staatsbürger<br />
5.5 Theorien der Gewalt<br />
5.6 Klassisch, romantisch, modern – Alles im großen Stil<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Motje Wolf (Jg. 1982) ist Director of Music der St. Margaret’s Church und unterrichtet<br />
an der De Montfort University ein Modul über Community Music. Außerdem<br />
arbeitet sie im Choir Outreach Project Leicester Cathedral in England,<br />
wo sie seit 2008 Choral Scholar ist. Motje interessiert sich für Neue und für<br />
Alte Musik, spielt Barockgeige und singt. Außerdem leitet sie Musikworkshops<br />
in Schulen und Universitäten in England und Deutschland. Momentan ist sie<br />
dabei, ihre Dissertation über elektroakustische Musik fertig zu stellen, um dann<br />
hoffentlich bald viel mehr Zeit für weitere Musikprojekte zu haben. Die kursübergreifende<br />
Musik leitete sie schon bei vielen Junior- und <strong>SchülerAkademie</strong>n war 2000 selbst<br />
Teilnehmerin einer <strong>DSA</strong> und freut sich auf die kommende Akademie.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE HILDEN<br />
Akademieleitung<br />
Christoph Kolodziejski (Jg. 1981) forscht in der Universitätsstadt Göttingen<br />
und versucht dabei mit den Erfahrungen, die er während seiner Göttinger Promotionszeit<br />
und seinem halbjährigen Aufenthalt am University College London<br />
gemacht hat, mehr über die Dynamik von synaptischen Verbindungen im Gehirn<br />
zu erfahren. Zwischenzeitlich wagte er es für ein Semester, sein im Würzburger<br />
Physikstudium erworbenes Wissen an ruandische Studenten am Kigali<br />
Institute for Science and Technology weiterzugeben. Ansonsten fotografiert<br />
Christoph gerne Land und Leute, tanzt Tango Argentino und freut sich auf seine<br />
zweite Akademieleitung.<br />
Julia Reinert (Jg. 1990) entschloss sich nach ihrem Abitur 2009, ihre Heimat<br />
Weilheim/Teck zu verlassen und Natural Science an der University of Cambridge<br />
zu studieren. Mit dem Schwerpunkt Biochemie ist sie nun in ihrem letzten<br />
Bachelorjahr. Während der letzten beiden Sommer forschte sie an Adenoviren<br />
in Zürich und an Proteinen mit dem Massenspektrometer in München.<br />
In ihrer freien Zeit macht sie Musik auf ihrer Gitarre oder Querflöte und tanzt<br />
gerne. Nun freut sie sich auf ihre zweite AL-Assistenz und die Zusammenarbeit<br />
mit Christoph und Markus.<br />
Markus Parlasca (Jg. 1992) absolvierte im März 2011 sein Abitur im beschaulichen<br />
Trier. Zur Zeit studiert er Volkswirtschaftslehre an der University of Cambridge,<br />
Großbritannien. 2010 war er bereits als Teilnehmer in Hilden dabei, als<br />
er den Mikroökonomiekurs »Markt und Wettbewerb« belegte. Jetzt freut er sich<br />
schon auf seine zweite Akademie im wunderschönen Hilden. Wenn Markus<br />
nicht gerade hinter Büchern verschwindet oder durch Deutschland reist, treibt<br />
er Sport. Er fechtet und spielt je nach Saison Badminton oder Cricket.<br />
–– 49
50 ––<br />
AKADEMIE HILDEN (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 5.1<br />
Immer mehr und trotzdem wenig?<br />
Das Bezwingen unendlicher Summen<br />
Um 500–400 v. Chr. überlegte sich der griechische Philosoph<br />
Zenon von Elea, dass jede Bewegung unendlich<br />
lange dauern müsste: Um eine beliebige Strecke zu gehen,<br />
muss man zunächst die erste Hälfte der Strecke zurücklegen,<br />
anschließend von der Reststrecke die Hälfte, dann die<br />
Hälfte der jetzt noch verbleibenden Strecke und so weiter.<br />
Insgesamt ist die Gesamtstrecke also eine unendlich lange<br />
Summe von Einzeletappen, und daher müsste das Gehen<br />
unendlich viel Zeit in Anspruch nehmen.<br />
Natürlich wussten schon die alten Griechen, dass da etwas<br />
falsch sein muss, doch sie konnten das Paradoxon nicht<br />
auflösen – sie wussten noch nicht, wie man mit unendlichen<br />
Summen umgeht. Genau das soll in diesem Kurs<br />
erarbeitet und geklärt werden.<br />
Wie zwei Zahlen addiert werden, lernt jeder in der Grundschule.<br />
Was passiert jedoch, wenn man nicht nur eine<br />
Kursleitung<br />
Jan Nagel (Jg. 1983) freut sich auf das Mitwirken an seiner ersten Schüler-<br />
Akademie. In Bochum und Bergen studierte er Mathematik mit Nebenfach<br />
Biologie. Nach seiner Promotion an der Ruhr-Universität Bochum ging er<br />
an die Technische Universität München, wo er den Studenten die Wahrscheinlichkeitstheorie<br />
näherbringt und untersucht, welche Gesetzmäßigkeiten<br />
zufällige Bewegungen von Teilchen aufweisen. Wenn er von der Arbeit<br />
loskommt, geht er gerne laufen, spielt Badminton oder Gitarre.<br />
begrenzte Zahl von Summanden zusammenzählt, sondern<br />
immer neue Zahlen addiert und so eine unendliche Summe,<br />
eine Reihe, bildet? Ist das Ergebnis automatisch unendlich<br />
groß? Und wenn nicht: Was kommt dann dabei heraus?<br />
Im Rahmen des Kurses werden diese Probleme gelöst,<br />
indem gezeigt wird, dass manchen Reihen ein sinnvoller,<br />
endlicher Wert zugeordnet werden kann.<br />
Der erste Teil des Kurses klärt die grundsätzlichen Fragen,<br />
etwa wie eine unendliche Summe und ihre Konvergenz,<br />
ihr Grenzwertverhalten, definiert sind. Die Teilnehmenden<br />
werden Rechenregeln für Reihen aufstellen und handliche<br />
Kriterien erarbeiten, anhand derer beurteilt werden kann,<br />
ob eine Konvergenz eintritt oder nicht. Dabei werden<br />
schnell neue Fragen auftauchen, etwa ob – anders als bei<br />
endlichen Summen – die Reihenfolge der Addition eine<br />
Rolle spielt.<br />
Der anschließende Teil der Kursarbeit beschäftigt sich mit<br />
der Anwendung von Reihen. Denn unendliche Summen<br />
und wie sie mit Zahlen und Funktionen zusammenhängen,<br />
ist erstens aus mathematischer Sicht spannend, zweitens<br />
sind Reihen auch für Anwender interessant. Beispielsweise<br />
können wichtige, aber nicht ganz einfache Funktionen wie<br />
der Sinus oder der Logarithmus durch unendliche Summen<br />
dargestellt und berechnet werden. Und indem man<br />
die unendliche Summe an einem bestimmten Punkt abschneidet,<br />
erhält man eine handliche Näherung: eine endliche<br />
Summe einfach zu berechnender Funktionen statt der<br />
komplizierten Ausgangsfunktion selbst – eine Technik, die<br />
in etwa in den Ingenieurswissenschaften und der Physik<br />
benutzt wird. Größen wie die Kreiszahl � besitzen elegante<br />
Darstellungen mittels verschiedener Reihen, die von historischer<br />
Bedeutung waren, als die Größen immer genauer<br />
bestimmt wurden. Eine weitere zentrale Rolle kommt den<br />
Reihen bei der Messung komplizierter Längen oder Flächen<br />
zu. Dafür muss sich der Kurs zunächst überlegen, wie auf<br />
sinnvolle Art etwa die Länge einer gekrümmten Kurve bestimmt<br />
werden kann.<br />
Aeneas Rooch (Jg. 1983) begeistert sich für Naturwissenschaft, Technik und Musik. Nachdem<br />
er vor zwölf Jahren selbst an der <strong>SchülerAkademie</strong> teilgenommen hatte, studierte er Mathematik<br />
und Physik in Bochum und Rouen. An der Ruhr-Universität Bochum erforscht er<br />
statistische Verfahren, um stark abhängige Daten zu analysieren, und zeigt Ingenieursstudenten,<br />
wo sich Mathematik in technischen Anwendungen versteckt. Für den Hörfunk untersucht<br />
er, warum nasse Kleidung dunkler ist oder ob man mit Tintenfischtinte wirklich<br />
schreiben kann, und in seiner Freizeit spielt er gerne Badminton und Klavier.
Kurs 5.2<br />
Der metallene Mensch<br />
Seit Beginn des Computerzeitalters hat sich die Entwicklung<br />
von Maschinen rasant beschleunigt. Die moderne Gesellschaft<br />
wäre ohne die Hilfe von Automaten kaum noch<br />
vorstellbar und deren Komplexität nimmt immer mehr zu.<br />
Der Schritt hin zu autonomen Robotern, die mit Hilfe einer<br />
künstlichen Intelligenz Aufgaben erledigen, lässt allerdings<br />
weiterhin auf sich warten. Ein großes Problem stellt in diesem<br />
Zusammenhang die Erzeugung komplexer Verhaltensmuster<br />
durch eine Vielzahl sensorischer Daten dar. Die Maschine<br />
muss anhand der Umweltinformationen entscheiden<br />
können, welches Verhalten angemessen ist.<br />
Man könnte dieses Problem natürlich rein kombinatorisch<br />
angehen und bei einer bestimmten Konstellation der Umwelteinflüsse<br />
ein bestimmtes Verhalten programmieren. Bei<br />
komplexen Organismen wie dem Menschen würde dieses<br />
Verfahren bei Millionen zu verarbeitender Sinnesimpulse<br />
pro Sekunde jedoch schnell an seine Grenzen stoßen. Forschern<br />
am Bernstein Center in Göttingen ist es kürzlich<br />
gelungen einen effektiveren Weg zu finden, Verhalten zu<br />
erzeugen. Die Forscher verwendeten dazu ein nichtlineares<br />
neuronales Netzwerk mit mehreren stimulierenden und<br />
hemmenden Synapsen um einen sechsbeinigen Laufroboter<br />
Kursleitung<br />
Andrea Vüllings (Jg. 1980) studierte als gelernte Laborassistentin für Biologie<br />
und Chemie mit mehrjähriger Berufserfahrung an der Humboldt-Universität<br />
in Berlin Physik. Derzeit fertigt sie ihre Masterarbeit an der Technischen<br />
Universität Berlin im Bereich der nichtlinearen Dynamik an. Ihr besonderes<br />
Augenmerk gilt dabei der stochastischen Dynamik von Netzwerken. Neben<br />
dem eigenen Studium leitet sie außerdem Tutorien in der theoretischen Physik<br />
zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie freut sich schon<br />
sehr auf die vielfältigen Erfahrungen mit den Teilnehmenden und Kollegen<br />
der <strong>SchülerAkademie</strong>.<br />
in die Lage zu versetzen, selbstständig Hindernissen auszuweichen<br />
und sich aus Fallen zu befreien. Ziel des Kurses<br />
wird es sein, genau zu verstehen wie es mit der Methode<br />
der Göttinger Forscher möglich wird, komplexes Verhalten<br />
effektiv zu erzeugen.<br />
Im Kurs wird zunächst eine grundlegende Einführung<br />
in die Dynamik nichtlinearer Systeme auf universitärem<br />
Niveau erarbeitet. Dazu gehört unter anderem die Beschreibung<br />
deterministischer physikalischer Systeme im Phasenraum,<br />
die Analyse nichtlinearer Differenzialgleichungen,<br />
die Bifurkationstheorie und das deterministische Chaos.<br />
Die Vielfalt der Lösungen nichtlinearer Differenzialgleichungen<br />
wird dann später als Register für die verschiedenen<br />
Verhaltensweisen, die ein Roboter ausführen kann,<br />
dienen.<br />
Im zweiten Teil des Kurses wird es vor allem um die Kontrolle<br />
chaotischer Systeme gehen. Dazu werden systematisch<br />
verschiedene Methoden entwickelt, nichtlineare Systeme<br />
zu stabilisieren und zu kontrollieren. Die zeitverzögerte<br />
Rückkopplung wird sich als besonders wichtiger Mechanismus<br />
herauskristallisieren. Am Ende der ersten Woche<br />
wird deutlich, wie sich z.B. Laser durch geschickte Rückkopplung<br />
stabilisieren lassen. Im neuronalen Netzwerk<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE HILDEN<br />
werden die stimulierenden und hemmenden Synapsen die<br />
Kontrollsignale darstellen und dafür verantwortlich sein,<br />
dass bei einem bestimmten Sensorinput ein ausgewähltes<br />
Verhaltensmuster ausgelöst wird.<br />
Im dritten Teil des Kurses werden die erarbeiteten Grundlagen<br />
auf gekoppelte Netzwerke ausgedehnt, um schließlich<br />
ein vollständiges neuronales Netz zu simulieren. Dieses<br />
neuronale Netz kann dann einem Roboter als Generator für<br />
komplexes Verhalten dienen. Es wird sogar möglich sein,<br />
durch eine geschickte Erweiterung des Netzwerkes ein<br />
Lernverhalten zu etablieren.<br />
Die Kursinhalte werden immer wieder durch praktische,<br />
im Kurs entwickelte Simulationen untermauert.<br />
Am Ende der zwei Wochen wird jeder ein umfassendes<br />
Bild der Dynamik nichtlinearer gekoppelter Netzwerke<br />
und deren Anwendung im Bereich der künstlichen Intelligenz<br />
erlangt haben. Dabei wird der Kurs punktuell in<br />
die aktuelle Forschung auf diesem Gebiet vorstoßen und<br />
dementsprechend auch mit englischer Fachliteratur und<br />
wissenschaftlichen Veröffentlichungen arbeiten. Eine solide<br />
mathematische Vorbildung vor allem im Bereich der Differenzialrechnung<br />
ist wünschenswert.<br />
Christof Witte (Jg. 1986) promoviert derzeit am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik<br />
in Potsdam im Bereich der klassischen und Quantengravitation. Nach einem Bachelorstudium<br />
an der Humboldt-Universität in Berlin zog es ihn als Stipendiat der Studienstiftung<br />
und des <strong>Deutsche</strong>n Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ins Ausland an<br />
die Universität Cambridge, wo er einen Master in angewandter Mathematik und theoretischer<br />
Physik erlangte. Als ehemaliger Teilnehmer der ersten JGW-<strong>SchülerAkademie</strong> im<br />
Jahr 2004 und Kursleiter im Jahr 2011 freut er sich schon jetzt besonders auf die intensive<br />
Zusammenarbeit im Kurs, die für Teilnehmende und Kursleitende erfahrungsgemäß eine<br />
bleibende Erinnerung sein wird.<br />
–– 51
52 ––<br />
AKADEMIE HILDEN (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 5.3<br />
Auf den Spuren von Tim Berners-Lee<br />
Wie funktioniert eigentlich das Internet?<br />
Kaum eine andere Erfindung hat die Menschheit in den<br />
letzten Jahrzehnten so stark beeinflusst wie die des World<br />
Wide Web. Grade mal 20 Jahre jung ist »das Internet« aus<br />
dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei<br />
ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen, sie<br />
schreitet viel eher im Eiltempo<br />
voran und wirkt wie ein<br />
ewiger Prozess. Täglich entstehen<br />
neue Geschäftsideen<br />
und Angebote im Internet,<br />
die oftmals das Leben von<br />
Millionen von Menschen beeinflussen.<br />
Ganze Industrien,<br />
wie z.B. Musik- und Printmedien,<br />
mussten sich radikal<br />
umstellen. Brockhaus und andere Lexika werden nicht<br />
mehr neu aufgelegt, da sie von Wikipedia in den Schatten<br />
gestellt wurden und an Bedeutung verloren haben. Informationen<br />
sind nahezu unbeschränkt jederzeit für jeden<br />
verfügbar und die globale Vernetzung – nicht nur von Wissen<br />
– ist im vollen Gange.<br />
Kursleitung<br />
<strong>Programm</strong>ierkenntnisse sind hilfreich und wünschenswert.<br />
Es wird die Bereitschaft erwartet, sich im Vorfeld des<br />
Kurses autodidaktisch mit einer <strong>Programm</strong>iersprache auseinanderzusetzen,<br />
die in dieser Form im Schulstoff nicht<br />
vorkommt. Für Schüler mit Lust am abstrakten Denken<br />
und an praktischen Anwendungen werden die Herausforderungen<br />
aber gut zu bewältigen sein. Die Kursleiter werden<br />
dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen.<br />
Olaf Görlitz (Jg. 1978) studierte Informatik an der TU Berlin, verbrachte ein<br />
Studienjahr in den USA und schreibt zur Zeit in Koblenz an seiner Doktorarbeit<br />
über die effiziente Verarbeitung von Suchanfragen auf verteilten semantischen<br />
Datenquellen. In seiner Freizeit ist er gern zu Fuß oder mit dem Rad<br />
in der Natur unterwegs. Oft hat er dabei einen GPS-Empfänger in der Tasche<br />
und sammelt nebenbei Daten für das OpenStreetMap-Projekt. Außerdem interessiert<br />
er sich für Kampfsport, geht gern auf rockige Musik-Festivals und<br />
taucht im Urlaub immer mal wieder in die Unterwasserwelt ab.<br />
Die Idee zur Erschaffung des World Wide Web hatte Tim<br />
Berners-Lee 1984, als er nach einer Möglichkeit suchte, die<br />
wissenschaftlichen Erkenntnisse am CERN (der Europäischen<br />
Organisation für Kernforschung) besser austauschen<br />
und teilen zu können. Die Prototypen seines ersten Web-<br />
servers und Webbrowsers wurden<br />
versehentlich gelöscht. Nachdem<br />
sein Projektantrag für ein Informationsmanagementsystem<br />
mit<br />
den Worten »vague but exciting«<br />
(siehe Graphik) akzeptiert wurde,<br />
arbeitete er weiter an der Idee<br />
und veröffentlichte 1990 die erste<br />
Website der Welt unter http://info.<br />
cern.ch.<br />
Doch obwohl weltweit schon Milliarden von Menschen Zugang<br />
zum Internet haben und es täglich nutzen, verstehen<br />
nur wenige die grundlegenden Technologien, die es erst<br />
ermöglichen, dass z.B. jeder mit dem Smartphone Videos<br />
bei YouTube anschauen kann. Im Kurs wird zunächst die<br />
(technologische) Situation in den späten 80er Jahren betrachtet,<br />
um zu verstehen, welche Rahmenbedingungen<br />
zur Erfindung des World Wide Web führten. Hierzu wird<br />
insbesondere die Autobiographie Tim Berners-Lee als<br />
roter Faden benutzt. Anschließend werden die wichtigsten<br />
Technologien des World Wide Web genauer unter die Lupe<br />
genommen. Dazu wird das HTTP-Protokoll analysiert und<br />
ein eigener Webserver und Webbrowser programmiert,<br />
mit dem man in der Lage ist, HTML-Dokumente zwischen<br />
Computern und auch mit dem Internet auszutauschen.<br />
Damit der Kurs sich nicht nur mit technologischen Aspekten<br />
befasst und man auch etwas über die aktuellen Diskussionen<br />
zur Nutzung des Internets erfährt, werden auch<br />
die Themen Offenheit/Open Source und Netzfreiheit eine<br />
zentrale Rolle spielen. Bereits Tim Berners-Lee hat diese<br />
Problematiken vorhergesehen und viele Texte und Reden<br />
zum Thema Ethik und Moral im Internet veröffentlicht.<br />
Diese Themen sind zu Zeiten von Anonymus, Wikileaks<br />
und Co. aktueller denn je, weshalb sich der Kurs auch mit<br />
ihnen kritisch auseinander setzen wird.<br />
René Pickhardt (Jg. 1985) studierte Mathematik, Physik und Informatik an der Johannes<br />
Gutenberg Universität in Mainz und die chinesische Sprache an der Beijing Foreign Studies<br />
University in China. Mittlerweile promoviert er über soziale Netzwerke und Graph Datenbanken<br />
mit Olaf gemeinsam in Koblenz. In seiner Freizeit blogt René über technische<br />
Themen und Online Musik Marketing. Letzteres Thema hängt mit seinen Erfahrungen des<br />
von ihm programmierten sozialen Netzwerks »metalcon« und seiner Band »In Legend« zusammen.<br />
Neben Heavy Metal zählen zu seinen Hobbys Fitness-Training und Kurse an der<br />
<strong>DSA</strong> leiten – dies ist sein dritter Kurs.
Kurs 5.4<br />
Mensch – Bürger – Staatsbürger<br />
Perspektiven aus Philosophie und Politik zum Staat und seiner Bürger<br />
Wie in vielen westlichen Demokratien wird auch in<br />
Deutschland ein stetes Sinken der Wahlbeteiligung beobachtet.<br />
Noch in den 1970er Jahren gaben über 90 Prozent<br />
der wahlberechtigten <strong>Deutsche</strong>n ihre Stimme zur Bundestagswahl<br />
ab. Im Jahr 2009 machten nur noch knapp 71<br />
Prozent der Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Kann<br />
von einer sinkenden Wahlbeteiligung eine Krise der Demokratie<br />
abgeleitet werden? Der Kurs wendet sich dieser<br />
Frage aus philosophischen und politikwissenschaftlichen<br />
Perspektiven zu.<br />
In der allgemeinen Wahrnehmung der westlichen Welt<br />
gilt die Demokratie bislang als die beste Staatsform. Aber<br />
entgegen des heutigen Selbstverständnisses zeichnen Philosophen<br />
wie Platon, Aristoteles oder Thomas Hobbes ein<br />
ganz anderes Bild eines guten Staates. Eine philosophiegeschichtliche<br />
Untersuchung des Staatsbegriffs soll einen<br />
systematischen Überblick über die verschiedenen Staatsformen<br />
geben. Zudem wird der Demokratiebegriff etwas<br />
genauer betrachtet. Was versteht man unter Demokratie?<br />
Gibt es nur eine Form von Demokratie? Einige Autorinnen<br />
Kursleitung<br />
Marén Heinzelmann (Jg. 1983) studierte in Leipzig und Houston, Texas, Biologie<br />
und Philosophie. Gerade schreibt sie ihre Diplomarbeit am Institut für Pflanzenphysiologie<br />
der Universität Leipzig und erforscht, wie man die Photosynthese einzelliger<br />
Algen zur Energiegewinnung nutzen kann. Philosophisch haben es ihr besonders<br />
Aristoteles und seine modernen Interpreten angetan. Seit ihrer Jugend spielt sie<br />
leidenschaftlich gern Theater. Sie lacht, liest und tanzt gern, am liebsten zu guten<br />
Salsarhythmen.<br />
und Autoren behaupten, die westliche Gesellschaft befände<br />
sich bereits in einer Postdemokratie. Die Lektüre verschiedener<br />
Texte wird einen Überblick über zeitgenössische Demokratie-<br />
sowie Postdemokratietheorien geben.<br />
Die Betrachtung des Staates kommt nicht ohne die Betrachtung<br />
seiner Bürger aus. Daher wird der Kurs auch<br />
den Begriff des Bürgers diskutieren. Wer gehört zum Staat?<br />
Wer legitimiert den Staat? Wie wird über die staatliche<br />
Zugehörigkeit entschieden? Welche Rolle spielen ethnische<br />
Minderheiten im Staat? Die Zugehörigkeit zu einem Staat<br />
bestimmt nicht zuletzt das eigene Selbstverständnis und<br />
die Identität jedes Einzelnen. Zudem liegt jedem Staatsbegriff<br />
immer schon ein bestimmtes Menschenbild zugrunde.<br />
Daher drängt sich die Frage auf, was den Menschen vom<br />
Bürger unterscheidet. Hierfür werden den Teilnehmenden<br />
sowohl klassische philosophische Positionen als auch moderne<br />
Identitätstheorien Rede und Antwort stehen.<br />
Der Kurs hat das Ziel, auf die obigen Fragen mögliche<br />
Antworten zu finden, zum einen durch die Lektüre theoretischer<br />
Texte, zum anderen durch praktische Übungen (z.B.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE HILDEN<br />
Quelle: http://upload.wikimedia.org/<br />
wikipedia/commons/d/db/Leviathan_gr.jpg<br />
Diskursanalyse). Die Teilnehmenden werden klassische Argumentationsarten<br />
aus Philosophie und Politikwissenschaft<br />
kennen und bewerten lernen und so einen Einblick in<br />
interdisziplinäre Fragestellungen erhalten, der zum Weiterdenken<br />
und -fragen anregt.<br />
Sophia Koleczko (Jg. 1986) studierte in Leipzig und Grenoble, Frankreich. Politikwissenschaft<br />
mit den Nebenfächern Jura und Wirtschaft. Ihr Schwerpunkt und<br />
besonderes Interesse liegt im Bereich der politischen Theorie und Sozialphilosophie.<br />
Momentan absolviert sie ein Praktikum am Zentrum Gender Studies der Universität<br />
Basel, Schweiz. In ihrer Freizeit tanzt sie gern, fährt in die verschneiten Berge zum<br />
Skifahren und geht mit Freunden die Partyszene erkunden.<br />
–– 53
54 ––<br />
AKADEMIE HILDEN (26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 5.5<br />
Theorien der Gewalt<br />
Was Gewalt ist und wie sie sich verstehen lässt<br />
Seit jeher scheint Gewalt zum Repertoire menschlichen<br />
Handelns zu gehören – unabhängig davon, ob es sich um<br />
moderne oder um nur wenig entwickelte vormoderne<br />
Gesellschaften handelt. Stets lassen sich Akte der Gewalt<br />
ausmachen. Nie ist sie gänzlich verschwunden. Gleichwohl<br />
findet sie in unterschiedlichem Maße statt. Zwischen einer<br />
Rauferei auf dem Schulhof oder einem Massaker während<br />
eines Krieges bestehen immense Unterschiede. Intensität<br />
und Formen der Gewalt können demnach variieren. Dies<br />
hängt mit den verschiedensten Faktoren, wie der Kultur,<br />
der Ökonomie, der Kontrolle durch einen starken Staat,<br />
den technischen Möglichkeiten oder gruppendynamischen<br />
Aspekten, zusammen.<br />
Will man sich mit Gewalt befassen, so ist zunächst zu fragen,<br />
was sich darunter verstehen lässt. Der Kurs wendet<br />
sich daher in einem ersten Schritt der Erarbeitung und<br />
Diskussion unterschiedlicher Begriffsdefinitionen von Gewalt<br />
aus den Bereichen der Psychologie und Soziologie zu<br />
Kursleitung<br />
Anna Dannert (Jg. 1985) stammt aus der Metropole Ruhr(gebiet). Sie arbeitet als<br />
persönliche Referentin im Landtag Nordrhein-Westfalen und als Trainerin in der<br />
politischen Jugendbildung. Mit der Gewalt befasste sie sich vor allem im Rahmen<br />
ihres Studiums der Politik- und Erziehungswissenschaften an der Ruhruniversität<br />
in Bochum. Sie reiste ausgiebig in ferne Länder, wie Indien, den Libanon oder die<br />
USA, liest sehr gerne und ist eine begeisterte Basketballspielerin.<br />
(Canetti, Popitz, Nunner-Winkler). Im Anschluss daran<br />
geht der Kurs auf unterschiedliche Ansätze ein, Gewalt zu<br />
verstehen und verständlich zu machen. Zum einen werden<br />
in diesem Zusammenhang makroskopische Modelle untersucht,<br />
die die Entwicklung der Gewalt in Zusammenhang<br />
mit der Moderne stellen (Elias, Galtung, Baumann). Zum<br />
anderen werden unterschiedliche Formen und Situationen<br />
der Gewalt näher betrachtet. Dabei wird beispielsweise die<br />
Differenzierung in »alte« und »neue« Kriege hinterfragt<br />
(Münkler) und auf Dynamiken gewaltbereiter oder von<br />
Bürgerkriegen gezeichneter Gesellschaften eingegangen<br />
(Elwert, Waldmann). Neben diesen gesellschaftlichen Kontexten<br />
der Gewalt werden jedoch auch biologische und<br />
evolutionspsychologische Erkenntnisse angerissen (Euler).<br />
Die Beschäftigung mit dem Sujet der Gewalt erfolgt interdisziplinär.<br />
Insofern geht mit der Diskussion über die<br />
Formen der Gewalt auch die Frage nach dem Beitrag unterschiedlichster<br />
Disziplinen, wie zum Beispiel der Psychologie,<br />
Soziologie und Biologie oder der Literatur- und der<br />
Geschichtswissenschaften und der Pädagogik, zur Erschlie-<br />
ßung dieses Themenfeldes einher. Im Fokus stehen dabei<br />
stets die Fragen nach dem spezifischen Blickwinkel der<br />
Fachrichtungen einerseits und dem übergeordneten Ertrag<br />
für die Gewaltforschung andererseits.<br />
Der Kurs gibt somit einen Einblick in die Grundlagen<br />
der Gewaltforschung, führt in Theorien zur Entwicklung<br />
der Gewalt ein und thematisiert unterschiedliche Ansätze<br />
zur Erforschung und Gliederung dieses Phänomens. Da<br />
dies aus interdisziplinärer Perspektive geschieht, ist damit<br />
zugleich eine Einführung in Herangehensweisen und<br />
Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Disziplinen verbunden.<br />
Auf diese Weise wird ein Überblick über die Ansätze<br />
unterschiedlicher Disziplinen verschafft, Wissenschaft zu<br />
betreiben.<br />
Die Kursarbeit gestaltet sich überwiegend seminaristischtheoretisch.<br />
Die einzelnen Themenbereiche werden durch<br />
Referate eingeleitet, die im Vorhinein vorbereitet werden.<br />
Die entsprechende Literatur wird dafür zur Verfügung gestellt.<br />
Janis Nalbadidacis (Jg. 1984) zog es nach der Schule aus dem trauten Ruhrgebiet<br />
ins schillernde Berlin. Dort ging er dem irritierenden Phänomen der Gewalt vor allem<br />
während seines geschichtswissenschaftlichen Studiums nach. Zurzeit bereitet er seine<br />
Promotion vor, die er zu Repressionen der griechischen Diktatur verfasst. In seiner<br />
Freizeit widmet sich der Liebhaber griechischer Musik mit Hingabe seiner Gitarre<br />
sowie dem Hechten nach Volleybällen.
Kurs 5.6<br />
Klassisch, romantisch, modern –<br />
Alles im großen Stil<br />
Die Geschichte der Symphonik<br />
Ob in Europa, Amerika oder Asien, ob im Krieg oder Frieden<br />
– Symphonische Musik ist aus der weltweiten Kulturlandschaft<br />
unmöglich wegzudenken. Nicht nur die europäische<br />
Aufklärung, die Vermischung verschiedenster Künste<br />
im 20. Jahrhundert und das Einsetzen neuer Instrumente<br />
haben in der Musik und der Arbeit heutiger Orchester Spuren<br />
hinterlassen.<br />
Im Kurs wird es daher um die Entwicklung der Musik<br />
und die Konstellation eines Orchesters gehen. Angefangen<br />
bei Mozart wird der Kurs sich über die Romantik und<br />
die Moderne bis zu zeitgenössischen Orchesterwerken<br />
vorarbeiten. Neben analytischen Gesichtspunkten wie der<br />
Untersuchung der Harmonik, Rhythmik und Melodik wird<br />
gleichzeitig auf die Besetzungen und Instrumentierungen<br />
eingegangen. Die Betrachtung sozial- und kulturhisto-<br />
Kursleitung<br />
rischer Ereignisse wird dabei helfen, die Einflüsse und Veränderungen<br />
ganzheitlich zu verstehen. Texte von und über<br />
Komponisten werden dafür genauso wichtig sein, wie das<br />
Lesen der Partituren selbst.<br />
Während auf diesem Weg ein Überblick und ein allgemeines<br />
Verständnis für die Symphonik entstehen, werden<br />
immer wieder spezielle Möglichkeiten der Aufführungspraxis<br />
und der Interpretation im Mittelpunkt stehen. Von<br />
dem Überdenken der bloßen technischen Umsetzung eines<br />
Notensatzes über das Ausdrücken der inneren Befindlichkeit<br />
eines romantischen Komponisten, wird auch die Frage<br />
beantwortet, inwieweit sich bei einer heutigen Aufführung<br />
symphonischer Musik Dirigent und Musiker einbringen<br />
können und dürfen. Was ist der Unterschied zwischen<br />
dem Original eines Schumann und der Reproduktion<br />
heute? Wie setzt man sich konkret mit einem modernen<br />
Werk oder gar einer Uraufführung auseinander? Es werden<br />
neben Parallelen und Gegensätzen hilfreiche Lösungsan-<br />
Charlotte Schäfer (Jg. 1984) studierte Schulmusik und Gesangspädagogik an der<br />
Folkwang Universität der Künste sowie Französisch in Essen und Vichy (Frankreich).<br />
Ihre besondere Liebe gilt der musikalischen Avantgarde, so dass sie neben ihrer<br />
hauptberuflichen Tätigkeit als Gesangslehrerin und Fachbereichsleiterin an zwei Musikschulen<br />
in NRW jede Gelegenheit nutzt, sich dieser Epoche zu widmen – als Gesangssolistin<br />
gleichermaßen wie z.B. als Projektleiterin und Skriptorin in der Kölner<br />
»musik Fabrik« oder im Vorstand der Orchesterakademie NRW. Wenn sie drei Wünsche<br />
freihätte, würde sie die ganze Welt bereisen, ein Quietsche-Entchen-Parlament<br />
ins Leben rufen und Mozart fragen, wie er zu der Antwort »42« steht.<br />
(26. JULI BIS 11. AUGUST <strong>2012</strong>) AKADEMIE HILDEN<br />
sätze und mögliche Kompromisse erarbeitet. Dafür werden<br />
Meinungen alter und neuer, bekannter und unbekannter<br />
Interpreten diskutiert und an Aufnahmen verschiedener<br />
Dirigenten und Orchester geprüft.<br />
Die Frage der Interpretation bedarf einer weiteren Klärung:<br />
Inwieweit ist theoretisches Wissen mit einer individuellen<br />
musikalischen Intention zu vereinbaren? Was gibt der Notentext<br />
vor und was nicht? In dem Zusammenhang werden<br />
die Chancen und die Grenzen der Musikwissenschaft untersucht<br />
und die Frage, was eigentlich Kunst in der Musik<br />
ist, offengelegt.<br />
Ziel des Kurses ist es, einen breiten und fundierten Zugang<br />
zur symphonischen Musik zu ermöglichen. Das Verstehen<br />
klassischer Formen spielt dabei eine genauso wichtige<br />
Rolle, wie das Entdecken von Ausdrucksstärke und der<br />
Stilbreite neuer Musik. Die Teilnehmenden werden die<br />
Kompetenz erlangen, über das Schöne und Bekannte in der<br />
Musik hinaus ihre Ohren für viele inhaltliche Details und<br />
epochale Prozesse zu öffnen.<br />
Tim Wendhack (Jg. 1986) studiert Geschichts- und Musikwissenschaften an der<br />
Heinrich-Heine-Universität sowie der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.<br />
Neben seinem Studium erhält er Unterricht in Dirigieren und ist selbst an<br />
der Geige in verschiedenen Orchestern zu finden. Ganzjährig trifft man ihn an<br />
den verschiedensten kulturellen Orten am Rhein und in Westfalen. Meistens als<br />
Gast, manchmal als Mitwirkenden, gelegentlich als Kritiker. Als geborene Ruhrgebietsseele<br />
gehört bei ihm eine gute Currywurst genauso zum Genussmittel wie ein<br />
ausgedehnter Spaziergang und lange Kochabende. Er freut sich auf alle Diskussionen<br />
und Entdeckungen während der Akademie.<br />
–– 55
56 ––<br />
AKADEMIE ROSTOCK (28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Akademie Rostock<br />
CJD Jugenddorf-Christophorusschule<br />
Rostock<br />
Die alte, an der Mündung der Warnow gelegene Hansestadt Rostock mit ihrem historischen Altstadtkern, der<br />
Universität und dem Stadthafen bietet ihren Besuchern eine maritime Atmosphäre in direkter Nähe des traditionsreichen<br />
Ostseebades Warnemünde mit seinem breitesten und feinsten Sandstrand der norddeutschen Ostseeküste.<br />
Gut erreichbar durch öffentliche Verkehrsmittel befindet sich die Jugenddorf-Christophorusschule in ruhiger Lage,<br />
zehn Busminuten vom Zentrum der Stadt entfernt, und bietet ca. 1.000 Schülerinnen und Schülern ab Klasse<br />
5 eine Gymnasialausbildung. Außerdem lernen 200 Schülerinnen und Schüler in der Grundschule. Moderne<br />
Schul(neu)bauten ermöglichen hervorragende Bedingungen, besonders in allen Naturwissenschaften, im Bereich<br />
Kunst, Musik und Sport. Wer Lust auf Bücher verspürt, kann in den Räumen der neuen Bibliothek herumstöbern.<br />
Für Großmedienprojektionen bietet die Aula der Schule Raum, die mit ihrer Bühne auch zum Theaterspiel<br />
einlädt, eine zweite Bühne erweitert diese Möglichkeiten. Weiterhin stehen zwei Computer-Kabinette mit jeweils<br />
20 modernen Rechnern und Internetzugang zur Verfügung.<br />
Das Internat, in dem bis zu 90 Schüler Platz finden, bietet im alten Charme des Plattenbaus moderne Doppelzimmer<br />
mit WC und Duschbereich. Neben der Normalverpflegung wird auch vegetarisches Essen angeboten.<br />
Für den sportlichen Ausgleich können die Großraum-Turnhalle mit mehreren Volleyball-Spielfeldern, das Beach-<br />
Volleyballfeld, die Streetball-Anlage und zwei Außen-Tischtennisplatten genutzt werden.
JUGENDDORF-CHRISTOPHORUSSCHULE ROSTOCK<br />
GROSS SCHWASSER WEG 11<br />
18057 ROSTOCK<br />
www.cjd-rostock.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
6.1 Mathematische Anatomie des Universums<br />
6.2 Wenn das Ganze mehr ist als die Summe der einzelnen Teile<br />
6.3 Nächster Halt: Mars<br />
6.4 Das sprechende Gehirn<br />
6.5 Moral und Gerechtigkeit in modernen Gesellschaften<br />
6.6 Fremdes und Eigenes im Dokumentarfilm<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Daniel Klein (Jg. 1986), in Essen geboren, war Jungstudent für Klavier an der<br />
Hochschule für Musik Köln und studierte nach dem bilingual deutsch-französischen<br />
Abitur (AbiBac) Klavier an der Folkwang-Hochschule und ab 2007 Dirigieren/Orchesterleitung<br />
an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Im<br />
Februar <strong>2012</strong> schloss er sein Studium mit Bestnote ab. Seit fünf Jahren arbeitet<br />
er in der Essener Opernklasse als Korrepetitor und studiert eine Vielzahl von<br />
Orchester- und Opernaufführungen ein und leitete sie. In seiner Freizeit besucht<br />
er gern Jazzkonzerte oder radelt durch das Ruhrgebiet, dem er sich sehr<br />
verbunden fühlt. Auf die Begegnungen während der Akademie freut er sich bereits sehr!<br />
(28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE ROSTOCK<br />
Akademieleitung<br />
Hermine Wenzlaff (Jg. 1979) studierte in Berlin, Tübingen und Brisbane/Australien<br />
Biologie. Begeistert von den Neurowissenschaften erforschte sie in ihrer<br />
Doktorarbeit in Berlin, wie Entscheidungsfindungs-Prozesse im menschlichen<br />
Gehirn ablaufen. Nach einigen Jahren in der Grundlagenforschung wandte sie<br />
sich der angewandten, klinischen Forschung zu und setzt sich für die Entwicklung<br />
von Medikamenten, z.B. gegen Alzheimer, ein. In jeder freien Minute klettert<br />
sie enthusiastisch oder spielt Violine.<br />
Benedikt Beer (Jg. 1993) schnupperte letztes Jahr das erste Mal fasziniert Akademieluft<br />
in einem neurowissenschaftlichen Kurs, als Katharina seine Kurs-<br />
und Hermine seine Akademieleiterin war. Im Frühjahr legt er sein Abitur im<br />
beschaulichen Warburg (Ostwestfalen) ab und fiebert schon jetzt der Akademie<br />
entgegen. Für Oktober plant er den Anfang seines Medizinstudiums. Seine<br />
Freizeit verbringt er im <strong>Deutsche</strong>n Roten Kreuz, der Schülervertretung, beschäftigt<br />
sich mit Politik, Wirtschaft und (natürlich!) Medizin. Außerdem liest er leidenschaftlich<br />
gerne und ist guter Literatur nie abgeneigt.<br />
Katharina Schaefer (Jg. 1981) hat ein Herz für kleine Städte. Geboren in Marburg<br />
studierte sie Biologie in Tübingen (mit Ausflug nach Toronto), machte ein<br />
Praktikum bei der EU in Brüssel und schließt gerade ihre Promotion in Kopenhagen<br />
ab. War ihre anfängliche Leidenschaft noch Genetik, entdeckte sie während<br />
des Studiums die Neurophysiologie, leitete Zellen ab und schaut sich nun<br />
das somatosensorische System im Gehirn des Menschen genauer an. Außerdem<br />
liebt sie Wasser in jeglicher Form und ist so oft es geht an Bord kleiner Jollen zu<br />
finden. Ansonsten liest und fotografiert sie.<br />
–– 57
58 ––<br />
AKADEMIE ROSTOCK (28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 6.1<br />
Mathematische Anatomie des Universums<br />
Ziel der theoretischen Physik ist es – unter Benutzung von<br />
bestehender oder neu zu schaffender Mathematik – immer<br />
weiter verfeinerte Theorien über die Natur aufzustellen.<br />
Die gegenwärtig akzeptierte Formulierung aller fundamentalen<br />
Theorien der Physik baut auf dem mathematisch sehr<br />
vielschichtigen Konzept der Raumzeit auf. Zu diesen Theorien,<br />
aus denen prinzipiell alle bekannten physikalischen<br />
Phänomene ableitbar sein sollten, gehören die Gravitation<br />
in Form der Allgemeinen Relativitätstheorie auf der einen<br />
Seite und die elektroschwache und starke Wechselwirkung<br />
in Form von sogenannten Quantenfeldtheorien auf der anderen<br />
Seite. Alle diese Theorien benötigen zu ihrer Formulierung<br />
eine zugrundeliegende Raumzeit. Die Allgemeine<br />
Relativitatstheorie ist die Theorie, die die Raumzeit selbst<br />
als dynamisches Objekt beschreibt, also die Theorie der<br />
Raumzeitstruktur selbst. Insbesondere erlaubt die Kombination<br />
obiger Theorien nichts weniger als die Diskussion<br />
des gesamten Universums!<br />
In diesem Kurs wird die state-of-the-art-Betrachtung der<br />
mathematischen Struktur der Raumzeit erarbeitet. Bis in<br />
Kursleitung<br />
Herbert Sauber (Jg. 1953) studierte Mathematik, Physik und Informatik<br />
in Göttingen, Canterbury und Hagen. Er ist seit 1979 im Berliner Schuldienst,<br />
unterrichtete neun Jahre an der Europäischen Schule Brüssel I, war<br />
Schulleiter an der Europäischen Schule Taipeh und leitet seit 2007 ein bilinguales<br />
Gymnasium in Berlin. Die Arbeit in der Schule empfindet er als<br />
eine dankbare, fordernde und in vielerlei Hinsicht bereichernde Tätigkeit,<br />
die ihm allerdings nur wenig Zeit lässt, seinen ursprünglichen Interessen,<br />
der Naturwissenschaft und der Mathematik, nachzugehen. Umso mehr<br />
freut er sich auf die Tage der <strong>DSA</strong>, an der er zum ersten Mal teilnimmt, um in Gebiete jenseits<br />
der Schulmathematik einzutauchen. In seiner knappen Freizeit beschäftigt er sich mit<br />
Mathematik, Astronomie, Schach und seiner Familie.<br />
die letzten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts fielen tatsächlich<br />
alle Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie<br />
und Quantenfeldtheorien mit den experimentellen Beobachtungen<br />
zusammen. Diese Tatsache ließ vermuten, dass<br />
eine scheinbar harmlose,<br />
von obigen Theorien abgeleitete<br />
qualitative Aussage<br />
Gültigkeit hat, nämlich dass<br />
die bekannte Expansion des<br />
Universums sich immer weiter verlangsamen muss. Mehrere<br />
spektakuläre und voneinander unabhängige astrophysikalische<br />
Beobachtungen der letzten Jahre zeigten einerseits,<br />
dass die Expansion des Universums immer schneller vonstatten<br />
geht, andererseits gibt es seit November 2011 ernstzunehmende<br />
Berichte über Neutrinos, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit<br />
ausbreiten. Diese Beobachtungen sind<br />
weitreichend, da sie bei näherer Analyse beeindruckend<br />
zeigen, dass wir fundamentale Aspekte der Raumzeitstruktur,<br />
der Materie, oder beider Bereiche, im Rahmen der<br />
Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie nicht verstehen.<br />
Das elaborierte, weil so vielschichtige, mathematische<br />
Bild der Raumzeit könnte also in Zukunft im Zuge dieses<br />
Vorausgesetzt werden Mathematik-Leistungskurs<br />
sowie sehr gutes Leseverständnis in Englisch<br />
Befundes abgeändert werden müssen. Unter Einbeziehung<br />
neuester Forschungsergebnisse zeigt dieser Kurs schließlich<br />
auf, wie ein solcher schönheits-chirurgischer Eingriff mathematisch<br />
zu bewerkstelligen ist.<br />
Der Kurs hat das zugegebenermaßen sehr<br />
ambitionierte Vorhaben, die mathematische<br />
Struktur der Raumzeit, und damit<br />
die allgemeine Relativitätstheorie, von<br />
fundamentalen Prinzipien ausgehend Schritt für Schritt zu<br />
entwickeln. Das bedeutet zwar, dass alle benötigten mathematischen<br />
Vorkenntnisse im Kurs systematisch entwickelt<br />
werden (ausgehend von formaler Logik), aber auch, dass<br />
das Abstraktionsniveau und die zu erarbeitende Stoffmenge<br />
entsprechend hoch sind. Dafür erhalten die Teilnehmenden<br />
einen echten Einblick in Universitätsmathematik und theoretische<br />
Physik, der teilweise in Bereiche weit jenseits des<br />
Bachelorstudiums in Mathematik und Physik reicht. Gegen<br />
Ende des Kurses werden die Teilnehmenden dann in der<br />
Tat so sorgfältig mit mathematischer Technologie ausgestattet<br />
sein, dass in einzelnen Punkten bis an die aktuelle<br />
Forschungsgrenze vorgestoßen werden kann.<br />
Frederic P. Schuller (Jg. 1975) arbeitet nach einer Forschungsprofessur an der Universidad<br />
Nacional Autonoma de Mexico und längeren Forschungsaufenthalten am Perimeter Institute<br />
for Theoretical Physics in Kanada und der Universität Oxford als Forscher am Albert-Einstein-<br />
Institut, Golm. Studium und Promotion schloss er an der Universität Cambridge ab, in der<br />
Gravitationstheoriegruppe um Stephen Hawking. Für seine Forschungsarbeiten im Gebiet der<br />
Allgemeinen Relativitätstheorie erhielt er unter anderem den Erice Original Work Award von<br />
Gerard’t Hooft, Physik Nobelpreisträger des Jahres 1999, und den Smith-Knight Preis der<br />
Mathematischen Fakultät in Cambridge. Abwechselnd als Dozent auf Sommerakademien der<br />
Studienstiftung und der <strong>SchülerAkademie</strong> tätig, ist er immer wieder begeistert und beeindruckt von den Teilnehmenden<br />
und Kollegen, und freut sich schon jetzt auf die zweieinhalb Wochen, die erfahrungsgemäß keiner<br />
je vergessen wird.
Kurs 6.2<br />
Wenn das Ganze mehr ist als<br />
die Summe der einzelnen Teile<br />
Zelluläre Automaten<br />
Was passiert, wenn sich Töne in der Luft ausbreiten? Wie<br />
durchmengen sich Gase? Kann man beobachten, wie Meinungen<br />
um sich greifen?<br />
Um in einer komplexen Umwelt neue Erkenntnisse zu<br />
gewinnen, wird stark vereinfacht: Es werden Modelle gebildet,<br />
die eine Reduktion auf wesentliche Aspekte darstellen.<br />
So wenig wie möglich, so viel wie nötig, so kann man die<br />
Bildung eines Modelles grob zusammenfassen.<br />
Im Kurs werden Zelluläre Automaten vorgestellt. Zelluläre<br />
Automaten sind ein Werkzeug zur Untersuchung, zum<br />
Erkenntnisgewinn. Dabei wird der Gegenstand der Betrachtung<br />
als räumlich diskreter, dynamischer Prozess aufgefasst.<br />
Mit anderen Worten: Die Welt wird gestückelt – in<br />
Zellen aufgeteilt. Diese Zellen verändern mit der Zeit ihren<br />
Zustand anhand eines Regelsatzes, der beschreibt, wie sich<br />
eine einzelne Zelle aufgrund ihres eigenen Zustandes und<br />
Kursleitung<br />
des ihrer Nachbarzellen entwickeln wird. Dabei wird festzustellen<br />
sein, dass bereits einfache Regeln zu komplexem<br />
Verhalten weit über die Nachbarschaft<br />
einzelner Zellen<br />
hinaus führen können.<br />
Helfen wird dabei der Computer,<br />
der es erlaubt auch komplexe<br />
Regelsätze in großen<br />
Welten zu betrachten. Eine<br />
Einführung in die <strong>Programm</strong>ierung<br />
mit Python ist daher<br />
Teil des Kurses. Vorkenntnisse<br />
in der <strong>Programm</strong>ierung sind<br />
nicht erforderlich.<br />
Mit diesem Handwerkszeug<br />
gerüstet kann einer Vielzahl<br />
von Problemen und Fragestellungen<br />
zu Leibe gerückt werden. Z.B. anhand des<br />
berühmten »Game of Life« werden Phänomene wie Selbst-<br />
Jan-Matthias Braun (Jg. 1979) beschloss sein Studium der Physik in Dresden mit einer<br />
Diplomarbeit aus dem Themengebiet des Quantenchaos. Für die nächsten zwei Jahre<br />
wechselte er das Thema und beschäftigte sich mit Rasterkraftmikroskopen und Einzelmolekülspektroskopie,<br />
bevor es ihn im Herbst 2009 zurück nach Göttingen trieb, wo<br />
er seitdem über neuronale Netzwerke, Maschinenlernen und die menschliche Fortbewegung<br />
promoviert und für die <strong>SchülerAkademie</strong> begeistert wurde. Seine verbleibende<br />
Freizeit verbringt er gerne mit Rollenspiel, Bumerangs, Bogenschießen, Schwertkampf,<br />
Schwimmen oder an der Gitarre.<br />
(28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE ROSTOCK<br />
Ein Beispiel für einen einfachen Zellulären Automaten.<br />
Die gekachelte Ebene ist die Welt des Automaten,<br />
die unterschiedlichen Farben entsprechen<br />
unterschiedlichen Zuständen der einzelnen Kacheln.<br />
Die Regeln des Automaten machen aus der<br />
Startbedingung (oben rechts) mit der Zeit eine sich<br />
drehende Spirale (Hintergrund). Was hier wie eine<br />
Spielerei aussieht wird im Kurs auch auf ernsthafte<br />
Problemstellungen angewandt.<br />
organisation und Selbstreplikation betrachtet. Physikalische<br />
Probleme, wie die Ausbreitung von Schallwellen, erlauben<br />
die Verbindung der Simulation am Computer mit experimentellen<br />
Messgrößen, wie Druck und Dichte, und somit<br />
auch den Rückschluss vom Modell auf die Realität. Sogar<br />
soziale Interaktion kann auf diese Weise als Informationsaustausch<br />
bzw. Zustandswechsel in einem Zellulären Automaten<br />
dargestellt werden.<br />
Dabei stehen immer die Fragen im Hintergrund, wie<br />
einfachste Regeln zu komplexem Verhalten führen<br />
können, was so einfache Regeln mit unserer komplexen<br />
Umwelt zu tun haben und ob die Regeln<br />
nicht doch zu einfach waren, wo die Grenzen dessen<br />
sind, was mit Zellulären Automaten dargestellt<br />
werden kann, und natürlich auch, wie ein eigenes<br />
Modell aufgestellt werden kann.<br />
So vorbereitet wird die Erarbeitung eigener und ausgewählter<br />
Modelle in Kleingruppen den Abschluss<br />
des Kurses bilden.<br />
Im Rahmen des Kurses wird ein einfaches Hilfsmittel<br />
zur Modellierung nahezu beliebiger Probleme<br />
vorgestellt. Die Umsetzung als Simulation am<br />
Computer ermöglicht es, dem Modell Vorhersagen<br />
abzuringen und diese wiederum zu interpretieren<br />
und zu deuten, d.h. mit dem Untersuchungsgegenstand in<br />
Beziehung zu setzen.<br />
Michael Fauth (Jg. 1985) beendete 2011 sein Studium als Lehrer für Mathematik,<br />
Physik und Astronomie. Während seiner gesamten Studienzeit arbeitete<br />
er im Institut für Strahlenphysik am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf<br />
an Datenerfassungssystemen für Halbleiterdetektoren. Seit Herbst 2011 beschäftigt<br />
er sich am physikalischen Institut in Göttingen mit der Modellierung<br />
von Lernprozessen. Der erfahrene Ferienlagerbetreuer war leicht für die <strong>SchülerAkademie</strong><br />
zu begeistern. Aber auch diverse Bandprojekte, Festivals oder das<br />
Bauen von Baumhäusern zählen zu seinen Interessen.<br />
–– 59
60 ––<br />
AKADEMIE ROSTOCK (28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 6.3<br />
Nächster Halt: Mars<br />
Auf der Suche nach Leben im Universum<br />
Zu den größten Fragen an die Naturwissenschaft gehört die<br />
nach der Entstehung des Lebens. Im Zusammenhang mit<br />
den Erkenntnissen von Astronomen, Chemikern, Biologen<br />
und anderen Forschern entstand die Idee,<br />
dass Leben auch an anderen Orten als auf<br />
der Erde möglich sein oder gewesen sein<br />
sollte. Der nächste Ort wäre der Mars.<br />
Kein anderer Planet im Sonnensystem<br />
ähnelte der Erde mehr. Verschiedene<br />
Oberflächenmerkmale deuten darauf hin, dass der Mars<br />
einen noch andauernden Klimawandel erlebt und in ferner<br />
Vergangenheit ein blauer Planet mit Ozeanen und Flüssen<br />
gewesen ist.<br />
War diese feuchte Periode lang genug für die Entwicklung<br />
von Leben? Wenn ja, welche Lebensformen konnten sich<br />
entwickeln? Warum fehlt das Wasser heute auf dem Mars?<br />
Kursleitung<br />
Um diese und viele weitere Fragen zu beantworten, müssen<br />
wir den Mars vor Ort untersuchen, was eine Reihe von<br />
neuen Problemen aufwirft.<br />
Im Kurs werden Kenntnisse<br />
aus vielen Disziplinen<br />
benötigt, die die<br />
Natur hinterfragen oder<br />
Hilfsmittel zu deren Erforschung<br />
bereitstellen.<br />
Nur interdisziplinär kann der Mars erkundet werden, um<br />
schließlich herausfinden, ob und wie sich Leben auf ihm<br />
entwickeln konnte, aber<br />
»Marsgesichter« im Zeitraum von etwa 4 Mrd. Jahren<br />
(Quelle: Daein Ballard).<br />
auch, wie man auf dem<br />
Mars als Mensch überleben<br />
könnte. Entsprechend<br />
wird es im Kurs mehrere<br />
Gruppen von Spezialisten<br />
geben, die ihr Wissen und Können untereinander austauschen<br />
werden. Wichtig ist dabei, das eigene Thema durch<br />
kleine Aktivitäten nahbarer zu machen. Außerdem wer-<br />
Kathrin Blumenstein (Jg. 1965) studierte von 1984 bis 1989 Physik und Astronomie<br />
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ab 1989 arbeitete sie als Lehrerin in Berlin.<br />
Die ersten drei Jahre waren geprägt von einem berufsbegleitenden Studium der Mathematik,<br />
um die Lehrbefähigung in diesem Fach zu erwerben. Danach unterrichtete sie<br />
an einem Gymnasium Mathematik und Physik und versuchte, auch die Astronomie<br />
nicht zu kurz kommen zu lassen und immer wieder Schüler dafür zu interessieren.<br />
Im Sommer 2011 begann ein neuer Lebensabschnitt, sie lebt nun für ein paar Jahre<br />
in Nairobi, Kenia, um dort an der <strong>Deutsche</strong>n Schule zu unterrichten. In ihrer Freizeit<br />
liest sie gerne ein gutes Buch, interessiert sich für Kunst und Kultur und erkundet nach und nach ihr<br />
neues Zuhause.<br />
den jeweils fünf oder sechs<br />
Teilnehmende im Rahmen<br />
dreier Projekte gemeinsam<br />
praktische Aufgaben bearbeiten.<br />
Zur Teilnahme am Kurs werden erwartet: mathematisch-naturwissenschaftliches<br />
Interesse, Lust an Beobachtung<br />
und Experiment, Tag- und Nachtaktivität<br />
Bärtierchen, Quelle: Ralph O. Schill,<br />
BMBF-Projekt FUNCRYPTA.<br />
Zu den Spezialisten gehören Astronomen, Planetologen,<br />
Geologen, Astrobiologen, Raumfahrtingenieure, Raumfahrtarchitekten<br />
und Ernährungswissenschaftler. Die<br />
Astronomen sagen uns, woher die chemischen Elemente<br />
kommen, wie sie sich im Weltall verteilen, und letztlich,<br />
wie Planeten entstehen, die Leben tragen können. Die<br />
Planetologen und die Geologen können u.a. in der Planetenoberfläche<br />
»lesen«, um etwas über die Entwicklung<br />
des Mars herauszufinden. Die Astrobiologen suchen nach<br />
Spuren von außerirdischem Leben. Irdische Lebewesen, die<br />
extremen Bedingungen trotzen können,<br />
wie z.B. die Bärtierchen, geben ihnen<br />
dazu Hoffnung.<br />
Für eine bemannte Raumfahrt zum<br />
Mars gilt es viele Probleme zu lösen, wie<br />
den Transport und die Lebenserhaltung. Hier gibt es viel zu<br />
tun für Ingenieure, aber auch für Architekten oder Humanwissenschaftler.<br />
Olaf Fischer (Jg. 1958) studierte von 1982 bis 1987 Physik und Astronomie an<br />
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach kurzer Lehrertätigkeit an einer Leipziger<br />
Schule für mathematisch-naturwissenschaftlich interessierte Schüler bot sich<br />
ihm die Möglichkeit zur Promotion in der Astrophysik an der Jenaer Universitäts-<br />
Sternwarte und später zur Habilitation im Bereich Physik- und Astronomiedidaktik.<br />
Seit 2005 ist er im Rahmen des Projektes »Wissenschaft in die Schulen!« in<br />
Heidelberg tätig und setzt dieses Engagement seit 2010 im Haus der Astronomie,<br />
einer deutschlandweit einmaligen Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft zur<br />
Popularisierung und Vermittlung astronomischer Forschung in Heidelberg, fort. In seiner Freizeit<br />
versucht er sich mit Freude im Inline-Skaten
Kurs 6.4<br />
Das sprechende Gehirn<br />
Ein Einblick in die Neuropsychologie der Sprache<br />
Der Philosoph und Historiker Herodot erzählt, dass der<br />
Pharao Psammetichos einen Versuch unternahm, die Ursprache<br />
zu bestimmen. Dazu ließ er zwei Kinder von einem<br />
Hirten aufziehen, ohne dass dieser je auch nur ein Wort<br />
zu ihnen sprach. Später wiederholte der Schottische König<br />
Jacob IV. dieses Experiment, doch die Kinder starben aus<br />
Mangel an Zuwendung. Noch heute gehen Wissenschaftler<br />
der Frage nach, was Menschen die Fähigkeit zur Sprache<br />
gibt, durch welche Mechanismen es bereits Säuglingen<br />
möglich ist, ihre Muttersprache von anderen zu unterscheiden,<br />
und wie Wahrnehmung und Denken durch sprachliche<br />
Strukturen geprägt sind.<br />
Freilich bedienen sich die modernen Wissenschaften feinerer<br />
Methoden als der ägyptische Pharao. Auch wissen wir<br />
heute, dass, obwohl die Fähigkeit, Sprache zu erlernen, angeboren<br />
ist, der Erwerb nicht automatisch erfolgt sondern<br />
einen Lernprozess voraussetzt.<br />
Kursleitung<br />
Yulia Oganian (Jg. 1985) absolvierte in Bonn das Abitur und studierte anschließend<br />
in Freiburg Mathematik und Psychologie. Fernweh und Abenteuerlust führte<br />
sie nach dem Bachelor an die hebräische Universität in Jerusalem, wo sie Kognitionswissenschaften<br />
und theoretische Neurobiologie studierte. Seit Anfang 2011 untersucht<br />
Yulia in ihrer Promotion an der FU Berlin die Besonderheiten bilingualer<br />
Sprachwahrnehmung und ist darauf gespannt, wo sie sich als nächstes wiederfinden<br />
wird. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Yulia mit Tango und Yoga, Büchern, Film und<br />
Theater, wobei gute Gesellschaft nie fehlen darf.<br />
Der Kurs wird am Beispiel der menschlichen Fähigkeit<br />
zur verbalen Kommunikation verschiedene Ansätze und<br />
Methoden der Neurowissenschaften kennenlernen. Im<br />
ersten Teil des Kurses werden Aufbau des Gehirns und die<br />
neurophysiologischen Grundlagen der Kommunikation<br />
zwischen den Neuronen behandelt. Klinische Fallbeispiele<br />
zeigen eindrucksvoll, welche Folgen der Ausfall bestimmter<br />
Gehirnregionen nach sich ziehen kann: Was geschieht,<br />
wenn das Gehirn keine Erinnerungen mehr bilden kann<br />
oder die linke Hand nicht weiß, was die rechte vorhat? Was<br />
sagt es über die Bestandteile menschlicher Psyche aus? Zudem<br />
werden unterschiedliche Arbeitsmethoden der medizinischen<br />
und kognitiven Neurowissenschaften vorgestellt.<br />
Im zweiten Teil werden die gelernten Prinzipien auf Prozesse<br />
der Sprachwahrnehmung und -produktion angewendet.<br />
Was sind die einzelnen Stufen zwischen der Wahrnehmung<br />
eines akustischen Signals und dem Verständnis des<br />
Inhalts? Welcher Paradigmen bedient sich die klassische<br />
Psychologie zur Isolierung einzelner Stufen in diesem Pro-<br />
(28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE ROSTOCK<br />
zess und was können moderne bildgebende Methoden zu<br />
diesem Erkenntnisprozess beisteuern? Welche biologischen<br />
Grundlagen ermöglichen den Erwerb von Sprache? Wie<br />
verhält es sich mit Mehrsprachigkeit?<br />
Unser Gehirn ist vielschichtig – so auch die Ansätze für<br />
dessen Verständnis. Der Kurs richtet sich daher an Teilnehmende,<br />
die sowohl an den biologischen Grundlagen, als<br />
auch an den höheren kognitiven Ebenen des menschlichen<br />
Denkens interessiert sind; neben psychologischen werden<br />
am Rande auch mathematische Modelle behandelt.<br />
In Einzel- und Gruppenreferaten wird die Thematik<br />
erarbeitet und wissenschaftliche Arbeitsweisen werden<br />
kennengelernt. Zum Abschluss des Kurses werden die Teilnehmenden<br />
in Kleingruppen selbständig ein Experiment<br />
planen und durchführen, und so die verschiedenen Stadien<br />
wissenschaftlicher Arbeit von der Fragestellung bis zur Datenauswertung<br />
durchlaufen.<br />
Niki Vavatzanidis (Jg. 1982) wuchs zweisprachig in Thessaloniki auf. Zwischen<br />
Geistes- und Naturwissenschaften hin- und hergerissen studierte sie Cognitive Science<br />
und Medical Neuroscience. Während es in ihren Forschungsarbeiten an unterschiedlichen<br />
Max-Planck-Instituten in Leipzig und Berlin um Fehlerverarbeitung<br />
ging, schreibt sie nun ihre Doktorarbeit über die Sprachentwicklung von hörgeschädigten<br />
Kindern. Ihre eigenen grauen Sprachzellen trainiert sie mit ihrer Familie und<br />
ihrer Leidenschaft zu mehrsprachiger Literatur und Querfeldeinreisen. Ansonsten<br />
genießt sie es, in der Natur zu sein, lernt Yoga und argentinischen Tango.<br />
–– 61
62 ––<br />
AKADEMIE ROSTOCK (28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 6.5<br />
Moral und Gerechtigkeit in<br />
modernen Gesellschaften<br />
Anerkennungs- und Aushandlungsprozesse in Theorie und Praxis<br />
Unser persönliches und politisches Leben ist durchsetzt<br />
von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Üblicherweise<br />
wird versucht, diese Konflikte zu lösen, indem die<br />
verschiedenen Seiten Argumente hervorbringen, die ihre<br />
jeweiligen Ansichten stützen. Allerdings lassen sich diese<br />
Debatten in der Regel nicht auf argumentativer Ebene allein<br />
lösen. Die meisten Argumente wirken nur innerhalb eines<br />
bestimmten weltanschaulichen respektive kulturellen Rahmens.<br />
Zentrale Begriffe wie »Gerechtigkeit« werden je nach<br />
Kontext unterschiedlich semantisiert, und ihre Verwendung<br />
ist immer auch kulturell, sozial und politisch geprägt. Um<br />
aber zu einem Konsens – oder zumindest einem Kompromiss<br />
– zu kommen, müssen wir unsere durch kulturelle,<br />
soziale und politische Kontexte mitbestimmte Perspektive<br />
zum Teil verlassen oder zumindest zwischen verschiedenen<br />
Sichtweisen vermitteln. Um dies erfolgreich tun zu können,<br />
müssen wir indes allererst auf eine Ebene kommen, auf der<br />
über derartige Prozesse reflektiert werden kann.<br />
Kursleitung<br />
Dominik Klein (Jg. 1983) studierte in Bonn Mathematik, Philosophie<br />
und Skandinavistik. Momentan promoviert er in Tilburg/Niederlande in<br />
Logik und Philosophie. Dort interessiert ihn, was für Rollen Gruppen in<br />
Erkenntnis- und Entscheidungsprozessen spielen. Außerdem betreibt er<br />
diverse Rückschlagspiele und bereist gerne mit dem Rucksack die Welt.<br />
Nach der Akademie möchte er noch Teile Zentralasiens erkunden.<br />
Die Gedanken und Gefühle, die entstehen, wenn wir in<br />
eine neue Lebenswelt – etwa durch einen Ortswechsel bei<br />
Antritt des Studiums – eintreten, sind mannigfaltig und<br />
verwirrend. Während wir noch mit der Eigensicherung<br />
beschäftigt sind, treffen häufig andere in scheinbar demokratischen<br />
Prozessen Entscheidungen über uns. Doch<br />
wie müssten diese demokratischen Prozesse gestaltet sein,<br />
damit sie zu einem effektiven Werkzeug werden, über<br />
endliche Ressourcen, wie Lebenszeit oder monetäre Mittel,<br />
zu entscheiden, und gleichzeitig in einem fairen Aushandlungs-<br />
und Anerkennungsprozess vollzogen werden können?<br />
Um eine Antwort auf diese Frage geben zu können, setzt<br />
sich der erste Teil des Kurses mit verschiedenen Gerechtigkeitsbegriffen<br />
und ihren vielfältigen Konnotationen sowie<br />
mit Argumentationsstrukturen und -logiken auseinander.<br />
Im Rückgriff auf verschiedene Positionen der politischen<br />
Philosophie wird untersucht, welche Interpretation(en) verschiedene<br />
politische Strömungen (wie etwa Kommunitarismus,<br />
Liberalismus) dem Gerechtigkeitsbegriff zuschreiben<br />
und welche Antworten die einzelnen Systeme in verschiedenen<br />
politischen oder alltäglichen Entscheidungssituationen<br />
geben.<br />
Der zweite Teil des Kurses wendet sich dem Konzept der<br />
Aushandlung selbst zu und untersucht, wie derartige Prozesse<br />
– auch und vor allem jenseits der »großen Politik« im<br />
alltäglichen Leben – ablaufen und welche Mechanismen in<br />
ihnen wirken. Der Kurs führt zu diesem Zweck durch die<br />
Lebenswelt einer Wohngemeinschaft, die nicht nur mit täglichen<br />
Problemen des Miteinanders konfrontiert wird, sondern<br />
auch mit politischen Verortungen und der Frage nach<br />
sozialverträglichen Anerkennungs- und Aushandlungsprozessen.<br />
Es wird dabei darum gehen, die eigene Gemeinschaft<br />
unter anderem im Rollenspiel mit Regeln und Grenzen<br />
aufzubauen und diese, auch unter Berücksichtigung<br />
der zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen, kritisch<br />
zu beleuchten, um die eigene Position im wertschätzenden<br />
Disput mit Anderen auszubalancieren. Es wird aufgezeigt,<br />
wie jeder seine Interessen in sozialer Interaktion artikulieren<br />
kann und wie man lernt, mit der erlernten Transparenz<br />
der eigenen Wirkungsweise und Fremdwahrnehmung umzugehen.<br />
Abschließend werden die Probleme der Wohngemeinschaft<br />
auf eine Makroebene gehoben, um die höhere<br />
Form der Anerkennungs- und Aushandlungsprozesse<br />
sichtbar zu machen, welche auf politischer Ebene wirken.<br />
Dieser Kurs gibt dementsprechend nicht nur eine theoretische<br />
Einsicht in Aushandlungsprozesse, er zeigt den Teilnehmenden<br />
auch gleichzeitig auf, wo sie selbst in derartigen<br />
Prozessen stehen und wie die eigenen Verhaltensweisen<br />
auf andere wirken.<br />
Sascha Wesner (Jg. 1974), geboren in Wilhelmshaven, lebt seit einigen Jahren in Bonn und<br />
studierte in Oldenburg Wirtschaft/Politik auf Lehramt. Aktuell unterrichtet er als Studienrat<br />
in Montabaur. Er absolvierte von 2010 bis <strong>2012</strong> eine psychoanalytisch-systemische Ausbildung<br />
in Köln und promoviert (extern) an der Goethe Universität in Frankfurt im Bereich der Berufs-<br />
und Wirtschaftspädagogik mit dem Schwerpunkt Moralentwicklung und Demokratiepädagogik.<br />
In seiner Freizeit treibt er (mit Blick auf die Ressource Zeit) Sport (Pilates, Yoga, Joggen),<br />
spielt Rollenspiele und zieht sich gerne mit Büchern und Tee zurück.
(28. JUNI BIS 14. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE ROSTOCK<br />
Kurs 6.6<br />
Fremdes und Eigenes im Dokumentarfilm<br />
Fremdheit ist ansteckend. Auf den ersten Blick betrachtet,<br />
bedarf es, um vom Eigenen und vom Fremden zu<br />
sprechen, mindestens zweier Parteien, die sich gegenüber<br />
stehen und denen diese Namen zugeordnet werden. Zweier<br />
Parteien, jedoch nur eines Standpunktes – üblicherweise<br />
des eigenen. Denn sobald der Fremde zurückblickt, mutiert<br />
man gleichsam selbst zum Fremden. In seinen Augen<br />
erscheint man unbekannt, unvertraut – fremd eben. »People<br />
are strange when you’re a stranger«, sangen The Doors<br />
nicht umsonst. Selbst im Wort »eigen« schwingt Fremdheit<br />
mit, denn ist uns jemand nicht fremd, den wir als »eigen«<br />
bezeichnen? Führt man sich die Instabilität und Überlappung<br />
der Begriffe »fremd« und »eigen« vor Augen, liegt<br />
die Frage nahe, warum sie in unserer Alltagssprache so fest<br />
verankert sind. Was genau meinen wir mit diesen Begriffen<br />
und wozu gebrauchen wir sie? Beschreiben sie eine Realität<br />
oder erschaffen sie diese? Und wo verläuft nun die Grenze<br />
zwischen dem Eigenen, Vertrauten, und dem Fremden?<br />
Mit diesen Fragen beschäftigen sich zahlreiche geisteswissenschaftliche<br />
Fächer. So untersuchen die Soziologie und<br />
die Kulturwissenschaft die Trennung zwischen »Eigenem«<br />
und »Fremden« als sprachlich konstruiertes Machtinstrument,<br />
das sowohl in der Migrations- und Integrationspo-<br />
Kursleitung<br />
David Gross (Jg. 1978), in Salzburg geboren, studierte Publizistik und<br />
Theaterwissenschaften in Wien und Journalismus in Krems. Seit 2003<br />
ist er als freiberuflicher Journalist und Filmemacher in den Bereichen<br />
Radio, Print, Fernsehen und Kino tätig. Zuletzt produzierte er eine<br />
Menschen-Porträt-Reihe fürs Fernsehen und einen abendfüllenden Dokumentarfilm<br />
über »Heilige Quellen«.<br />
litik als auch in der Außenpolitik zum Tragen kommt. Die<br />
Ethnologie versteht sich als Wissenschaft vom kulturell<br />
Fremden und arbeitet sich zugleich an dieser problematischen<br />
Definition ab. Wer ist im ethnologischen Untersuchungsfeld<br />
fremd – die beobachtete Kultur oder der Beobachter,<br />
der an diese als Fremder herantritt? Die Philosophie<br />
schließlich erwägt die Möglichkeit, dass unser Selbst<br />
uns immer zunächst fremd ist, und sich erst durch die Begegnung<br />
mit Anderen, Fremden, erkennen kann, oder, wie<br />
Martin Buber es formuliert, »am Du zum Ich wird«. Aus<br />
den verschiedenen Blickwinkeln dieser Disziplinen werden<br />
sich die Teilnehmenden mit den Konzepten des »Eigenen«<br />
und des »Fremden« auseinandersetzen.<br />
Im Kurs wird der Dokumentarfilm als Schnittstelle genutzt.<br />
Hier trifft das »Eigene« auf das »Fremde«, es begegnen<br />
sich zwei Welten, eine Spannung baut sich auf, beide Seiten<br />
werden auf die Probe gestellt. Am Anfang der Filmgeschichte<br />
war der Dokumentarfilm. Die ersten »bewegten<br />
Bilder«, die heute als Filme gelten, sind per Definition<br />
dokumentarisch. Ein Zug, der in einen Pariser Bahnhof<br />
einfährt, gedreht 1895 von den Brüdern Lumière. Aber was<br />
ist ein Dokumentarfilm eigentlich? Er soll »authentisch«<br />
sein, soweit ist man sich einig, aber wirft diese Antwort<br />
nicht noch mehr Fragen auf? Kann ein Dokumentarfilm die<br />
Wirklichkeit abbilden, oder hat man bereits durch die Entscheidung,<br />
in einem bestimmten Moment auf den Auslöser<br />
der Kamera zu drücken, manipuliert? Wie sehr spürt man<br />
im Film die Filmemacher? Darf man filmische Gestaltungsmittel<br />
für dokumentarische Aufnahmen nutzen? Es sind<br />
diese grundlegenden Fragen, die im Kurs gestellt werden,<br />
um Darstellungen des »Eigenen« und »Fremden« im Dokumentarfilm<br />
ein Stück weit auf den Grund zu gehen.<br />
Dokumentarfilm ist nicht gleich Dokumentarfilm. Häufig<br />
werden damit Naturdokumentationen oder Tierfilme assoziiert,<br />
produziert für ein großes Fernsehpublikum. Der Dokumentarfilm<br />
kennt aber weit mehr Spielformen, die von<br />
politisch und sozialkritisch, bis poetisch und essayistisch,<br />
von beobachtend bis partizipierend reichen. Ausgehend<br />
von theoretischen Überlegungen zum Medium werden die<br />
Teilnehmenden die Kamera selbst in die Hand nehmen.<br />
Kaum ein anderes Medium bietet in vergleichbarer Intensität<br />
die Möglichkeit, die eigene sowie die fremde Position<br />
immer aufs Neue zu befragen. Die Macht der Bilder wird<br />
allerorts gleichermaßen beschworen wie gegeißelt, und was<br />
wäre lohnender als der Versuch, sich im wahrsten Sinn des<br />
Wortes »ein eigenes Bild« von der Welt zu machen. Denn<br />
wie der Dokumentarfilmer Thomas Schadt so treffend formuliert:<br />
»Nichts ist spannender als die Wirklichkeit!«<br />
Natascha Zemliak (Jg. 1983) wurde in der ukrainischen Stadt Dnepropetrowsk geboren und<br />
kam im Alter von neun Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. In München absolvierte sie<br />
die Schule und studierte Anglistik und Germanistik mit Schwerpunkt auf Literatur-, Film- und<br />
Kulturwissenschaft. Seit 2009 arbeitet sie an einer literaturwissenschaftlichen Dissertation zum<br />
Thema »An den Grenzen von Sprache: Trauma und Übersetzung«. Ihre Freizeit verbringt sie auf<br />
Reisen, Konzerten, im Kino, Theater und in der Natur, mit Buch in der Hand und manchmal mit<br />
einer Gitarre.<br />
–– 63
64 ––<br />
AKADEMIE TORGELOW (12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Akademie Torgelow<br />
Internatsgymnasium Torgelow<br />
Am Wiesenufer des Torgelower Sees in einem der schönsten Naturschutzgebiete Deutschlands<br />
wurde im Jahr 1994 das Private Internatsgymnasium Schloss Torgelow eröffnet. In der Mitte zwischen<br />
Hamburg und Berlin nahe der Urlaubsmetropole Waren an der Müritz am Rande der Mecklenburger<br />
Seenplatte lernen und leben heute 220 begabte und hoch begabte Internatsschüler aus<br />
ganz Deutschland.<br />
Über 30 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in kleinen Klassen mit maximal 12 Schülern die<br />
Klassen 5 bis 12. In den Klassenräumen der Oberstufe kommen seit einiger Zeit statt Kreidetafeln<br />
so genannte »Interactive Smartboards« zur Verwendung. Die Unterrichtsaufzeichnungen können<br />
über das schuleigene Wireless LAN im Schülernetzwerk zur Verfügung gestellt werden. Internetzugang<br />
in den Klassenräumen ermöglicht zusätzlich unterrichtsbegleitende Recherchen im Internet.<br />
Fortsetzung siehe Seite 72 …
Schloss Torgelow<br />
Schlossstr. 1<br />
17192 Torgelow am See (Waren)<br />
www.schlosstorgelow.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
7.1 Komplexe Analysis<br />
7.2 Sand + Sonne = Strom<br />
7.3 Perspektivenwechsel<br />
7.4 Sind Geisteskrankheiten Gehirnkrankheiten?<br />
7.5 »Auf klassischem Boden begeistert«<br />
7.6 »Weißt du, wie das wird?«<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Iskra Ognyanova (Jg.l980) kommt aus Bulgarien und begann ihre erste<br />
Hoch schulausbildung an der Nationalmusikakademie in Sofia mit Tonregie<br />
und Chorleitung. Ab 2005 studierte sie an der Robert-Schumann-Hochschule,<br />
Düsseldorf mit den Hauptfächern Chorleitung, Klavier und Musikpädagogik.<br />
Zahlreiche Meisterkurse rundeten ihre Studien ab. Sie konzertiert als Pianistin<br />
und Chorleiterin in Bulgarien, Deutschland, Italien, Südkorea und Tschechien.<br />
Seit 2008 ist sie Chorleitungsassistentin und Repetitorin beim Düsseldorfer<br />
Mädchen- und Jungenchor. In Neuss lehrt sie an Grundschulen im Projekt<br />
»Jedem Kind seine Stimme« (JeKi-Sti) und leitet den JeKi-Sti Kinderchor der Musikschule.<br />
Sie erhielt mehrere Stipendien und Preise, u.a. den ersten Preis für Klavier beim Landeswettbewerb<br />
»Junge Künstler« in St. Zagora, den Förderpreis beim »N. Stefanov-Wettbewerb« in<br />
Sofia, den dritten Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb »Klassik und Gegenwart«,<br />
Bulgarien, DAAD-Stipendium (2006), E.ON-Stipendium (2007, 2008), Stipendium der Ewald<br />
Horbach Stiftung (2010).<br />
(12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE TORGELOW<br />
Akademieleitung<br />
Tabea Kretschmann studierte in Erlangen und Cambridge/UK Deutsch, Geschichte<br />
und Italienisch. In ihrer Dissertation, die sie an der Universität Salzburg<br />
schrieb, beschäftigte sie sich mit der Frage, warum und wie die Divina<br />
Commedia Dantes – eine fiktive mittelalterliche Jenseitsreise – gegenwärtig für<br />
Theater, Film, Musical u.a. immer wieder neu bearbeitet wird. Beruflich ist sie<br />
inzwischen mit dem Schwerpunkt »Talentmanagement« bei einer Frankfurter<br />
Unternehmensberatung tätig. In ihrer Freizeit freut sie sich über literarische<br />
und filmische Entdeckungen aller Art und entspannt beim Radeln, Joggen oder<br />
Almwandern ebenso wie beim Zeitunglesen im Café.<br />
Valentin Heimerl (Jg. 1994) möchte nach seinem Abitur im März voraussichtlich<br />
Jura in seiner Heimat Süddeutschland studieren. Im Winter fährt er in den<br />
Bergen Ski, im Sommer joggt er und fährt Fahrrad. Seinem Geschichtsinteresse<br />
geht er beim Reisen und beim Lesen nach, er kocht außerdem gerne und bastelt<br />
an seiner Modelleisenbahn. Valentin war im letzten Jahr begeisterter Teilnehmer<br />
der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> in der Grovesmühle und freut sich sehr darauf,<br />
mit seiner ehemaligen Akademieleiterin Tabea nun die einzigartige Atmosphäre<br />
einer Akademie mitzugestalten.<br />
Tobias Staudner (1995) ist Schüler am Josef-von-Fraunhofer-Gymnasium<br />
Cham mitten im idyllischen Bayern. Er war selbst im Jahr 2011 Teilnehmer der<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>. Seine freie Zeit verbringt Tobias mit Lesen, Gitarrespielen,<br />
Sport aller Art und der Mitorganisation der Schülermitverwaltung<br />
(SMV) an seiner Schule. Und er könnte sich gut vorstellen, sein Interesse für<br />
Rätsel und Kriminalgeschichten später auch einmal als Anwalt beruflich auszuleben.<br />
–– 65
66 ––<br />
AKADEMIE TORGELOW (12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 7.1<br />
Komplexe Analysis<br />
Vieles aus der reellen Analysis wird erst durch das Studium<br />
der komplexen Analysis verständlich. In der Tat sorgt ein<br />
»Heraustreten« aus der reellen Zahlengerade in die komplexe<br />
Ebene für Erkenntnisse, die ein tieferes Verstehen des Reellen<br />
ermöglichen. Lassen sich reelle Funktionen zu komplexen<br />
Funktionen fortsetzen, so eröffnet die komplexe Analysis völlig<br />
neue Sichtweisen und erlaubt häufig erst die Klärung von<br />
Fragen, die in der reellen Analysis offen bleiben. Beispielsweise<br />
erweist sich die komplexe Exponentialfunktion als periodische<br />
Funktion, die mit den trigonometrischen Funktionen eng verwandt<br />
ist.<br />
Die komplexe Analysis bietet aber auch viele weitere interessante<br />
Aspekte: So führen z.B. Konvergenzuntersuchungen<br />
an komplexen Folgen zu Gebilden der fraktalen Geometrie;<br />
konforme Abbildungen gestatten Transformationen, durch die<br />
bestimmte Eigenschaften erhalten bleiben, was etwa bei Kartenprojektionen<br />
nützlich ist. Anwendungen finden sich in der<br />
Physik und Technik; komplexe Transformationen werden etwa<br />
in der Strömungsmechanik mit Gewinn eingesetzt. Unterstützt<br />
durch die Möglichkeit, mit Computern immer umfangreichere<br />
Kursleitung<br />
Dirk Büchner (Jg. 1980) studierte Mathematik und<br />
Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu<br />
Kiel. Seit August 2011 arbeitet er als Studienreferendar<br />
an der Max-Planck-Schule in Kiel. Er hat große<br />
Freude daran, in jungen Menschen das Interesse für<br />
die Mathematik zu wecken und zu fördern. In seiner<br />
Freizeit liest er gerne und beschäftigt sich mit der<br />
Entwicklung von Brett- und Kartenspielen.<br />
mathematische Modelle berechnen und studieren zu können,<br />
erzielen Methoden der komplexen Analysis eine steigende Relevanz<br />
für die moderne Forschung.<br />
Ein erster Kursteil führt in die Grundlagen der komplexen<br />
Analysis ein. In einem zweiten Kursteil werden von Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern kleine Projekte bearbeitet, um so<br />
in kleinen Teams die verschiedenen mathematischen Methoden<br />
an speziellen Fragestellungen eigenständig zu erforschen.<br />
Im Kurs muss aus der umfangreichen Stoffmenge natürlich<br />
ausgewählt werden. In einem dritten Kursteil werden die Ergebnisse<br />
der Projektarbeit in Form von Vorträgen dem Kurs<br />
präsentiert und in schriftlicher Form dokumentiert.<br />
Dieser inhaltlich nicht einfache Kurs wendet sich an Teilnehmende,<br />
die sich sehr für Themen aus der Mathematik und<br />
ihre Anwendungen interessieren. Erwartet wird: Freude an der<br />
gedanklichen Durchdringung komplexer mathematischer Fragestellungen<br />
aus unterschiedlichen Bereichen, die Bereitschaft,<br />
sich in neue und schwierige Themen einzuarbeiten, kreativ<br />
nach Lösungen zu suchen und über die erzielten Ergebnisse<br />
Referate zu halten. Vorausgesetzt wird weiterhin die Fähigkeit,<br />
gelegentlichen Frust ertragen zu können und sich durch zeitweilige<br />
Rückschläge nicht entmutigen zu lassen.<br />
Kenntnisse in der reellen Analysis, speziell der Differenzial-<br />
und Integralrechnung sind für einige Teile des Kurses nötig.<br />
Einige notwendige Grundlagen werden im Rahmen des Kurses<br />
gesondert behandelt oder müssen in den Projekten selbst<br />
erarbeitet werden. Speziellere Vorkenntnisse aus der Mathematik<br />
sind aber nicht erforderlich. Erwartet wird allerdings die<br />
Bereitschaft, sich intensiv mit mathematischer Literatur (auch<br />
fremdsprachlicher) auseinander zu setzen und sich in neue<br />
Gebiete einzuarbeiten. Obwohl auch der Computer eingesetzt<br />
wird, werden <strong>Programm</strong>ierkenntnisse nicht vorausgesetzt,<br />
können aber für einige mathematische Fragestellungen nützlich<br />
sein.<br />
Joachim Gomoletz (Jg. 1955) ist in der Schulleitung der Max-Planck-Schule in Kiel tätig, unterrichtet an diesem<br />
Gymnasium die Fächer Mathematik, Physik und Informatik und leitet das Projekt »Kompetenzzentrum Begabtenförderung«.<br />
Er koordinierte die Projekte MATHEMA und PHYSIK PLUS zur Förderung besonders interessierter<br />
Schülerinnen und Schüler im Land Schleswig-Holstein und hatte an der Fachhochschule und an der Universität<br />
Kiel Lehraufträge für Mathematik inne. Er bildet Lehrerinnen und Lehrer zu Informatiklehrkräften aus und ist als<br />
Schulbuchautor tätig. Mehrfach leitete er bereits Kurse bei der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>. Im Jahre 1998 erhielt<br />
er den Karl-Heinz-Beckurts-Lehrerpreis für seine Verdienste um die Begabtenförderung. Zu seinen Hobbys zählen<br />
u.a. die Beteiligung an wissenschaftlichen Forschungen, die Fotografie und ausgedehnte Radtouren.
Kurs 7.2<br />
Sand + Sonne = Strom<br />
Grundlagen der Photovoltaik<br />
»SOL OMNIBUS LUCET«<br />
TITUS PETRONIUS ARBITER, SATYRICON<br />
»Die Sonne scheint allen« – auch zur Energieerzeugung. Es<br />
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in großen Worten von<br />
den Herausforderungen der Energiewende gesprochen wird<br />
und weitere Investitionen in erneuerbare Energien gefordert<br />
werden. Wie aber nutzt man die allen scheinende Sonne sinnvoll<br />
zur Energieerzeugung? Wie funktioniert Photovoltaik und<br />
was hat es mit der Gleichung Sonne + Sand = Strom auf sich?<br />
Aus Silizium, dem Element, auf dem Sand beruht, werden in<br />
hochreiner Umgebung blau schimmernde Scheiben. Diese<br />
sind nicht nur die Grundlagen unserer digitalen Welt, sondern<br />
auch der Baustoff für Solarzellen. Doch noch viel interessanter<br />
als das ist das »Innenleben« der Scheiben: Winzige, in das Material<br />
eingebrachte Verunreinigungen ermöglichen die Stromerzeugung<br />
mit Hilfe von Sonnenlicht. Elektronen werden über<br />
Leitungen eingesammelt und die angeschlossene elektrische<br />
Kursleitung<br />
Schaltung führt sie als elektrische Energie dem Stromnetz zu.<br />
Entscheidend ist hier der sogenannte pn-Übergang, dessen<br />
Verständnis in diesem Kurs vermittelt wird. Dazu werden sich<br />
die Teilnehmenden mit den Grundlagen der Halbleiterphysik<br />
auseinandersetzen<br />
und so einiges über<br />
Halbleiter (wie<br />
Silizium), Dotieratome<br />
(die »Verunreinigungen«)<br />
und Ladungsträger<br />
(wie Elektronen)<br />
erfahren. Außerdem<br />
wird erarbeitet, was der pn-Übergang bewirkt und wie mit<br />
Hilfe von Photonen (der Sonneneinstrahlung) darin Strom<br />
erzeugt wird. Darüber hinaus geht es um das Sonnenspektrum<br />
und warum eine Solarzelle mit 21% Wirkungsgrad schon<br />
ziemlich gut ist.<br />
Doch nicht nur die physikalische Theorie wird den Kurs begleiten,<br />
sondern auch die ingenieurwissenschaftliche Praxis:<br />
Rainer Jacob (Jg. 1982) ist ein sächsisches Original. Das hört man nicht nur an seinem<br />
Dialekt, sondern er blieb bis zum Ende der Promotion dem Fachbereich Physik seiner<br />
Heimatuniversität, der Technischen Universität Dresden, verbunden. Dort promovierte<br />
er 2011 im Bereich Halbleiterspektroskopie, wobei sich sein Labor am Teilchenbeschleuniger<br />
ELBE am Helmholtz-Zentrum Dresden befand. Im Moment ist Rainer jedoch auf<br />
einem Ausflug in die Industrie und »jobbt« als Projektleiter in einer Firma für Nanopositioniersysteme<br />
in Karlsruhe. Seine größte Leidenschaft ist, neben dem Allerkleinsten, der<br />
Sport und das Lesen. Er betreibt Kampfsport verschiedener Stile, ist viel mit dem Rad unterwegs<br />
und klettert gern in der Sächsischen Schweiz. Er begann außerdem gerade alle nordischen Staaten<br />
zu bereisen und hat immer ein gutes Buch in seinem Gepäck. Jetzt freut er sich darauf, das Motto seines<br />
eigenen <strong>DSA</strong> Kurses im Jahr 2000 endlich mal selbst als Kursleiter sagen zu können.<br />
Der Kurs ist vielseitig und interdisziplinär ausgerichtet.<br />
Nichtsdestotrotz werden vor allem naturwissenschaftliche<br />
und technische Aspekte der Photovoltaik im<br />
Mittelpunkt stehen. Von den Teilnehmenden wird die<br />
Bereitschaft erwartet, sich im Vorfeld des Kurses einige<br />
notwendige Grundlagen autodidaktisch zu erarbeiten.<br />
(12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE TORGELOW<br />
Wie werden Solarzellen hergestellt, in Module verpackt und<br />
auf Dächer montiert? Wie stellt man den optimalen Arbeitsbereich<br />
einer Solaranlage ein und warum muss sie mit Hilfe von<br />
Wechselrichtern an das Stromnetz angeschlossen werden? Die<br />
Klärung dieser Fragen soll aber nicht nur graue Theorie bleiben,<br />
weshalb einige praktische Versuche an einer Mini-Anlage<br />
durchgeführt werden.<br />
Neben technischen Fragen ist es auch interessant zu betrachten,<br />
welche politischen und gesellschaftlichen Hoffnungen<br />
mit Solarenergie verknüpft werden. Ein Überblick über die<br />
aktuelle Energiepolitik wird daher ebenfalls Teil<br />
des Kurses sein.<br />
Der Kurs gibt den Teilnehmenden einen Einblick<br />
in verschiedene physikalische und technische<br />
Disziplinen und versetzt sie in die Lage, diese<br />
Erkenntnisse am Beispiel der Photovoltaik zu<br />
verknüpfen. Der Schwerpunkt wird dabei auf<br />
Halbleiterphysik, Schaltungstechnik und Energieelektronik<br />
liegen. Mit viel Fokus auf Interaktion werden die<br />
Teilnehmenden in Kurzreferaten, Diskussionen und Gruppenprojekten<br />
die Inhalte erarbeiten und vertiefen. Sind die ersten<br />
theoretischen Grundlagen gelegt, kann das frische Wissen<br />
in kleinen Projekten praktisch erprobt und neu kombiniert<br />
werden. Dabei werden die Freiheit und der Spaß daran, eigene<br />
Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen, nicht zu kurz<br />
kommen.<br />
Jutta Müntjes (Jg. 1982) wurde im fränkischen Nürnberg geboren, was sich<br />
sprachlich aber nur wenig niedergeschlagen hat. Sie studierte Elektrotechnik<br />
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Königlich<br />
Technischen Hochschule Stockholm, Schweden, und promoviert seit 2008 an<br />
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) im<br />
Bereich Mikrosysteme in der Medizintechnik. Wenn Jutta nicht gerade mikrosystemtechnisch<br />
das Aderinnere untersucht oder Erstsemester in die Grundlagen<br />
der Elektrotechnik einweist, geht sie in der Eifel wandern oder in den Alpen<br />
klettersteigen, spielt Klavier oder verschlingt Bücher (gerne auch auf Schwedisch). Seitdem<br />
sie vor zwei Jahren schon einen <strong>DSA</strong>-Kurs zum Thema GPS leiten durfte, freut sie sich darauf,<br />
gemeinsam mit den Teilnehmenden wieder viele erhellende Momente zu erleben.<br />
–– 67
68 ––<br />
AKADEMIE TORGELOW (12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>)<br />
Kurs 7.3<br />
Perspektivenwechsel<br />
Internationaler Handel und Finanzmärkte betrachtet durch die<br />
doppelte Linse der Politik- und Wirtschaftswissenschaften<br />
Wirtschaftspolitik ist so allgegenwärtig wie mannigfaltig – von<br />
der Eurokrise bis zu Mindestlöhnen. Wirtschaftspolitik ist<br />
auch ein prominenter Gegenstand der Politik- und der Wirtschaftswissenschaften.<br />
Jedoch unterscheiden sich die Perspektiven<br />
der beiden Sozialwissenschaften auf sie erheblich. Beide<br />
erklären wichtige Aspekte, doch beide haben auch ihre toten<br />
Winkel.<br />
Der Kurs versucht Wirtschaftspolitik doppelt zu untersuchen<br />
und dabei von den Erklärungen beider Disziplinen zu profitieren.<br />
Auf diese Weise erläutert der Kurs wirtschaftspolitische<br />
Themen und gewährt einen Einblick in die Methodik der Politikwissenschaft<br />
und der Volkswirtschaftslehre.<br />
Der Kurs ist in drei Themenblöcke gegliedert. Der erste Themenblock<br />
beschäftigt sich mit Handelspolitik. Sowohl nach<br />
der Grossen Depression Anfang der 1930er als auch im Zuge<br />
Kursleitung<br />
der jüngsten Wirtschaftskrise wurde der Ruf nach Handelsbeschränkungen<br />
lauter, um, so das Argument, die heimische<br />
Wirtschaft vor unlauterem Wettbewerb aus dem Ausland zu<br />
schützen. Gleichzeitig sind wir aber auch Zeugen eines nun<br />
schon mehrere Jahrzehnte andauernden Trends der Handelsliberalisierung.<br />
Wie können diese Globalisierungswellen<br />
erklärt werden? Die Wirtschaftswissenschaft findet seit langem<br />
überzeugende Gründe für Freihandel, deutet aber gleichzeitig<br />
darauf hin, dass es Gewinner und Verlierer dabei gibt. Für<br />
die Politikwissenschaft stellt sich die Frage, wie institutionelle<br />
Rahmenbedingungen bestimmen, welche Interessen schlussendlich<br />
Gehör finden und in Politik umgesetzt werden.<br />
Der zweite Block wendet sich internationalen Finanzmärkten<br />
zu. Seit den 1970ern wurden Finanzmärkte vielerorts liberalisiert:<br />
Die Regulierung von Banken wurde gelockert und<br />
Grenzbarrieren für Kapital aufgehoben. Während diese Maß-<br />
Christian Pröbsting (Jg. 1984) erhielt 2010 seinen Abschluss als Diplom-Volkswirt<br />
(mit Nebenfächern Politikwissenschaften, Französisch und Spanisch) an der Eberhard-<br />
Karls Universität Tübingen und promoviert seitdem in Volkswirtschaftslehre an der<br />
University of Michigan, Ann Arbor. Seine Schwerpunkte sind Internationale Handelsbeziehungen<br />
und Entwicklungsökonomie. Er sammelte Auslandserfahrungen im Rahmen<br />
eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in Frankreich, eines Auslandsstudienjahres<br />
an der Université de Genève, und eines Praktikums bei der Gesellschaft für Internationale<br />
Zusammenarbeit (GIZ) in den Philippinen im Bereich Mikroversicherungen.<br />
nahmen Raum schafften für Innovationen im Finanzsektor,<br />
engten sie den Handlungsspielraum für Staaten ein. Diese<br />
Folgen ergeben sich aus ökonomischen Zusammenhängen,<br />
welche im Kurs untersucht werden. Außerdem wird darauf<br />
eingegangen, warum es zu dieser Liberalisierung kam.<br />
Die aktuelle Eurokrise ist das Thema des dritten Blockes.<br />
Erklärungen und Lösungen zur Eurokrise werden in Wissenschaft<br />
und Politik hitzig debattiert. Debattiert werden soll auch<br />
im Kurs. Es stellt sich die Aufgabe, kreativ zu werden und<br />
Lösungsansätze zu entwickeln. Wohin geht es mit dem Euro?<br />
Was muss getan werden, um eine solche Krise in Zukunft zu<br />
vermeiden?<br />
Raphael Reinke (Jg. 1984) studierte Internationale Volkswirtschaftslehre in Tübingen<br />
und promoviert derzeit in Florenz über Bankenrettungsmaßnahmen während<br />
der Finanzkrise. Gerne lernt er neue Städte kennen. In diesem Sinne nutzte<br />
er Zivildienst und Studium dazu, längere Zeit in Antananarivo, Denver und Washington<br />
zu verbringen. In der Freizeit engagiert er sich in der kirchlichen Jugendarbeit<br />
und bei Organisationen für interkulturellen Austausch. Ansonsten geht er<br />
gerne Schwimmen, Laufen und Rad fahren. Neben Politik und Wirtschaft kann er<br />
sich für andere Länder begeistern.
Kurs 7.4<br />
(12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE TORGELOW<br />
Sind Geisteskrankheiten Gehirnkrankheiten?<br />
Grundlagen der Psychopathologie<br />
Körperliche Erkrankungen sind in den meisten Fällen leicht<br />
auf eine Ursache zurückführbar: Wer unter Bauchschmerzen<br />
leidet, hat sich vermutlich den Magen verstimmt, und wer<br />
hinkt, ist offenbar am Fuß verletzt. Doch<br />
wie steht es mit der »Verortung« von psychischen<br />
Krankheiten? Schon im Volksmund<br />
ist die Überzeugung, es handle sich<br />
hierbei um »Krankheiten des Kopfes« bzw.<br />
des Gehirns (beide Begriffe wurden im<br />
<strong>Deutsche</strong>n jahrhundertelang synonym gebraucht)<br />
tief verwurzelt: Jemand, der sich<br />
auffällig, unpassend oder irrational verhält,<br />
hat »nicht alle Tassen im Schrank«, einen<br />
»Dachschaden« oder einen »Sprung in der<br />
Schüssel«. Und auch aus psychiatrischer<br />
Sicht spricht, betrachtet man die aktuelle<br />
Theorienlandschaft, wenig gegen eine solche Lokalisierung:<br />
So werden Psychiater, nicht zuletzt auch motiviert durch die<br />
unleugbaren Erfolge der Psychopharmakalogie, zu Clinical<br />
Neuroscientists »aufgewertet« – was letzten Endes auch die<br />
Unterscheidung zwischen körperlichen und psychischen<br />
Kursleitung<br />
Krankheiten selbst in Frage stellt, die, so scheint es, gänzlich<br />
auf neuronale und hormonelle Störungen reduziert werden<br />
können.<br />
Michael Siegel (Jg. 1987) studierte Philosophie, Logik, Kunstgeschichte und Neuere<br />
<strong>Deutsche</strong> Literatur in Marburg und Leipzig. Im Moment schreibt er seine Promotionsarbeit<br />
zur Wissenschaftstheorie der Psychopathologie. Nebenbei arbeitet er am<br />
Senckenberg-Museum für Naturforschung in Frankfurt a.M. und als Kursleiter für<br />
Bildbearbeitung und Layout an der Philipps-Universität, Marburg. In seiner Freizeit<br />
knipst er gerne Fotos, liest Bücher, treibt Sport und bummelt über Flohmärkte.<br />
Doch bei genauerer Betrachtung erweist sich<br />
die Sachlage als weitaus komplizierter: Schon<br />
der Leidensdruck ist im Falle psychischer<br />
Krankheiten kein somatischer. Kein Betroffener<br />
klagt wie im gleichnamigen Monty-<br />
Python-Sketch: »My brain hurts!« Auch gibt<br />
es theoretische Vorbehalte gegen ein solch<br />
reduktionistisches Krankheitskonzept: Schon<br />
vor fast 100 Jahren warnte der Begründer<br />
der modernen Psychopathologie Karl Jaspers<br />
vor irreführenden »Hirnmythologien«, und<br />
manche Psychiatrie-Kritiker behaupteten<br />
gar, psychische Krankheiten seien ganz im Gegenteil gänzlich<br />
kulturelle und gesellschaftliche Konstrukte. Obwohl es in den<br />
Vereinigten Staaten inzwischen mehr Psychotherapeuten als<br />
Postboten gibt, ist der Begriff der psychischen Krankheit, wie<br />
z.B. auch die stetigen Überarbeitungen der gängigen psychiatrischen<br />
Klassifikationssysteme (DSM und ICD) zeigen, auch<br />
unter Experten alles andere als unkontrovers.<br />
Ziel dieses Kurses ist es, mit Hilfe entsprechender Fachliteratur<br />
moderne wie auch klassische Grundlagen der psychiatrischen<br />
Krankheitslehre zu erarbeiten und ihren wissenschafts- und<br />
erkenntnistheoretischen Status zu klären. In die (Un-)Tiefen<br />
der Neurobiologie sowie der klinischen Psychiatrie und<br />
Pharmakalogie wird man dabei weder sehr weit vorstoßen<br />
können – noch müssen: Der Schwerpunkt wird vor allem auf<br />
dem (sprach-)theoretischen Grundgerüst, auf den zentralen<br />
Begriffen und Unterscheidungen der Psychopathologie, aber<br />
(exkursorisch) auch der Medizin im allgemeinen liegen (Was<br />
ist »gesund«, was ist »krank«?), also nur bedingt auf deren<br />
naturwissenschaftlichem Beiwerk sowie seiner praktischen Anwendung.<br />
Die metatheoretischen Fragestellungen des Kurses<br />
werden daher lediglich exemplarisch an einschlägigen Krankheitsbildern<br />
und Therapieformen entwickelt.<br />
Voraussetzung für die Kursteilnahme sind dabei ausdrücklich<br />
nicht spezielle Kenntnisse in den Bereichen der Natur- oder<br />
Sozialwissenschaften. Willkommen ist, wer sich über die Heil-<br />
und Pflegepraxis hinaus dafür interessiert, was Medizin und<br />
Psychologie als Wissenschaft ausmacht – und was nicht.<br />
Stefan Siegel (Jg. 1978) studierte Humanmedizin und Philosophie an der Universität<br />
Erlangen-Nürnberg. Er promovierte an der Ruhr-Universität Bochum mit einer<br />
Arbeit zu ethischen Aspekten der Reproduktionsmedizin. Nach seiner Approbation<br />
als Arzt begann er seine Weiterbildung auf dem Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie.<br />
Er arbeitet derzeit am Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin.<br />
Seine privaten Interessengebiete sind Kino, Theater und Ballett, Science Fiction- und<br />
Fantasy-Romane sowie das Wandern in freier Natur.<br />
–– 69
70 ––<br />
AKADEMIE TORGELOW (12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>)<br />
»Auf klassischem Boden begeistert« *<br />
Kurs 7.5<br />
Antike-Rezeption in der deutschen Literatur<br />
Der Hausmeister von Hogwarts heißt Argus Filch.<br />
2002 kommt der VW Phaeton auf den Markt.<br />
Max Frischs »Homo Faber« geht eine Liaison mit<br />
seiner eigenen Tochter ein.<br />
Diesen drei Beispielen ist gemeinsam, dass sie antike Mythen<br />
aufgreifen, deren Ursprung tausende Jahre zurückliegt und die<br />
heute weder aus der Fantasy-Literatur noch aus der Werbung<br />
wegzudenken sind. Doch was ist eigentlich ein »Mythos«?<br />
Und was ist die »Antike«? Was bedeutet es, wenn sie in neuen<br />
Kontexten auftauchen?<br />
In der Literaturwissenschaft sind Fragen wie diese wichtig,<br />
denn antike Themen spielen in vielen bedeutenden deutschen<br />
Texten eine Rolle – so liest Werther »seinen Homer«, Eichendorffs<br />
Florio wird vom »Marmorbild« der Venus verfolgt und<br />
Rilke schreibt »Sonette an Orpheus«. Solche Reminiszenzen<br />
sind jedoch nicht zufällig und vereinzelt, im Gegenteil: Die<br />
Auseinandersetzung mit der Antike beeinflusste die deutsche<br />
Kursleitung<br />
Karoline Pietsch (Jg. 1986) wurde bei ihrer eigenen Teilnahme 2004 nachhaltig<br />
vom Akademiekonzept und der Atmosphäre vor Ort beeindruckt, sodass<br />
sie sich parallel zu ihrem Studium bei der Organisation und Durchführung<br />
der JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>n engagierte. Sie studiert in Freiburg Latein<br />
und Germanistik mit dem festen Ziel, in Kürze als Lehrerin an die Schule<br />
zurückzukehren. Wenn sie nicht am Schreibtisch sitzt, balanciert sie Tabletts,<br />
joggt um den See oder unternimmt schöne Dinge mit ihren Freunden.<br />
Literatur schon in ihren Anfängen und ist seitdem nie ganz<br />
verschwunden. Noch im 18. Jahrhundert wird darüber diskutiert,<br />
ob die antike Literatur unerreichbares Vorbild oder<br />
anspornendes Beispiel sei; ob ein Autor<br />
die tradierten Regeln bestmöglich erfüllen<br />
oder unter den veränderten gegenwärtigen<br />
Verhältnissen aus sich selbst<br />
heraus schöpferisch tätig sein solle. Die<br />
hauptsächlich formale Vorbildhaftigkeit<br />
der antiken Literatur weicht im Laufe<br />
der Zeit einer Orientierung am – so dachte man – ursprünglichen<br />
Lebensgefühl der Griechen und ihrer Humanität: Schiller<br />
preist daher das Altertum in »Die Götter Griechenlands«<br />
als »holdes Blütenalter der Natur«. Diese Idealisierung der<br />
Antike schlägt später in einen Antiklassizismus um, der die<br />
barbarischen Züge der Mythen und die soziale Realität der<br />
Menschen im Altertum in den Fokus rücken lässt. Vor dem<br />
Hintergrund der ideologischen Grabenkämpfe der letzten hundert<br />
Jahre schließlich werden die antiken Mythen vor allem<br />
als Materialfundus verstanden und für verschiedenste, v.a.<br />
politische, Aussagen nutzbar gemacht. So soll Brechts »Antigone<br />
des Sophokles« die Rolle der Gewalt beim Zerfall einer<br />
Staatsspitze aufzeigen.<br />
Der Kurs wird in einem Gang durch die Literaturgeschichte<br />
– vom Mittelalter bis zur Gegenwart – Texte analysieren, die<br />
einen formalen oder inhaltlichen Bezug zur Antike aufweisen.<br />
Dabei wird zunächst nach der Art der Rezeption gefragt, etwa<br />
ob es sich um eine Übernahme antiker Gattungsmerkmale, um<br />
die literarische Umsetzung<br />
antiker Mythen oder um ein<br />
Spiel mit Motiven in neuem<br />
Kontext handelt. Anschließend<br />
kann die zentrale Frage<br />
untersucht werden: Warum<br />
wird hier die Antike aufgegriffen?<br />
Dies beinhaltet mehrere Dinge: Welche Wirkung hat<br />
der Rückgriff auf die Antike? Welchen (literarischen) Konventionen<br />
folgt ein Text? Welches Bild von der Antike liegt ihm zu<br />
Grunde? Welche Funktion soll der Text haben? Poetologische<br />
und andere theoretische Texte aus den jeweiligen Epochen<br />
helfen bei der Beantwortung solcher Fragen. Um zu verstehen,<br />
auf welchen Wissenshorizont Anspielungen auf antike Ereignisse,<br />
Lebenswelten und Gestalten verweisen, sollen auch die<br />
lateinischen und griechischen Werke herangezogen werden, in<br />
denen sie vermittelt werden.<br />
Da es während der Akademie keine Zeit geben wird,<br />
die Texte zu lesen, wird die Bereitschaft zur vorherigen<br />
Lektüre vorausgesetzt. Latein- oder Griechischkenntnisse<br />
sind für die Teilnahme nicht notwendig.<br />
* Johann Wolfgang Goethe: Elegien V, V.1, in: Johann Wolfgang Goethe:<br />
Gedichte 1800–1832, hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt a.M.<br />
1988, S. 157<br />
Janja Soldo (Jg. 1986) wuchs in Baden-Baden auf, wo sie sich schon als Schülerin für die<br />
Antike begeistern ließ. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein Studium der Klassischen<br />
Philologie und Germanistik in Freiburg, welches von der Studienstiftung des <strong>Deutsche</strong>n Volkes<br />
gefördert wird. Neben dem Studium arbeitet sie als Hilfskraft am Lehrstuhl für Neuere<br />
<strong>Deutsche</strong> Literatur und übernimmt kleinere Lektoratsarbeiten für einen Freiburger Verlag. In<br />
ihrer freien Zeit ist sie meist hinter einem Buch oder bei Diskussionen über Gott und die Welt<br />
zu finden.
»Weißt du, wie das wird« *<br />
Kurs 7.6<br />
Ein Musiktheater (be)schreibt Weltgeschichte – und wir schreiben mit …<br />
Der Ring des Nibelungen ist das Magnum Opus der Operngeschichte.<br />
Ein 16 stündiges Riesenwerk, das seinen Schöpfer<br />
Richard Wagner über mehr als 20 Jahre begleitet hat. Wagner<br />
reflektiert im Ring Welt- und Zeitgeschichte, Mythos und<br />
politische Realität – und schafft so ein »Bühnenfestspiel«,<br />
das bis heute, mehr als 100 Jahre nach seinem Entstehen, die<br />
Gemüter erregt, Künstler inspiriert und Jahr für Jahr tausende<br />
Begeisterte in die Theater treibt.<br />
An der Schwelle zum Richard-Wagner-Jahr 2013 werden<br />
Wagner und sein Werk zum Zentrum eines analytischen und<br />
kreativen Schaffens-Prozesses. Dabei steht der 4. Teil des<br />
Rings – die Götterdämmerung – im Fokus der Arbeit. Hier<br />
fasst Wagner die Vielzahl von Handlungssträngen, von Verstrickungen<br />
und Intrigen seiner Tetralogie zu einer letzten großen<br />
Anstrengung zusammen – um sie dann in einem gewaltigen<br />
Weltuntergangs-Szenario in Flammen aufgehen zu lassen.<br />
Auf welche Quellen hat Wagner bei seiner Arbeit zugegriffen,<br />
wie hat er sie verwendet. Wie reagiert er in seinem Schreiben<br />
auf die philosophischen und politischen Strömungen seiner<br />
Kursleitung<br />
Julia Bührle-Nowikowa (Jg. 1975), geboren in St. Petersburg, ist freiberuflich<br />
als bildende Künstlerin, Illustratorin (Cornelsen Verlag, Frankfurter Verlagsanstalt)<br />
sowie als Bühnen-und Kostümbildnerin für Oper, Musical, Schauspiel und<br />
Tanztheater tätig. Eigene Arbeiten als Bühnen- und Kostümbildnerin: am Staatstheater<br />
Saarbrücken (<strong>2012</strong>), Royal District Theatre in Tbilisi, <strong>Deutsche</strong>nTheater<br />
in Göttingen, an den Kammerspielen Paderborn, der Schwankhalle Bremen, der<br />
Hochschule für Musik und Theater Hamburg, am <strong>Deutsche</strong>n Nationaltheater<br />
Weimar u.a. Bei der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> macht sie zum ersten Mal mit.<br />
Zeit, wie treibt er sie aber auch voran und schafft neue Denk-<br />
Traditionen?<br />
Wie gelingt es im Ring, szenische Aktion mit musikalischer<br />
Textur zu verbinden, Drama und Oper, Wort und Musik zu<br />
mehrdimensionaler Projektionsfläche für handelnde Figuren<br />
und Publikum werden zu lassen? Lässt es sich aus dieser<br />
Mehrdimensionalität heraus erklären, wie in dunkelsten und<br />
hoffnungsvollsten Abschnitten unserer Geschichte das Musiktheater<br />
Wagners immer wieder zum Denk- und Glaubenszentrum<br />
von Kultur wird?<br />
Die Rezeptionsgeschichte des Rings, die Geschichte der<br />
Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele und auch die wechselvolle<br />
Geschichte der Familie Wagner sind seit 1876, dem<br />
Gründungsjahr der Festspiele, ein immerwährendes Thema<br />
für Boulevardpresse wie Hochkultur. Bayreuth wird in jedem<br />
Sommer immer wieder neu zum Zentrum globalen Theaterlebens,<br />
hier als Künstler oder Zuschauer anwesend zu sein,<br />
kommt einem kulturellen Adelsschlag gleich.<br />
Wer behält das letzte Wort im Ring, die Zerstörung in Krieg<br />
und Feuer? Oder der Versuch, so etwas wie den »Weg« , eine<br />
»bessere Welt« zu formulieren?<br />
(12. BIS 28. JULI <strong>2012</strong>) AKADEMIE TORGELOW<br />
»Werktreue heißt für<br />
mich, die Reaktion,<br />
die Wirkung, die<br />
ein Komponist mit<br />
seinem Werk bei<br />
seinem Publikum auslösen wollte, heute bei meinem/unserem<br />
Publikum zu erzielen.«, sagt Peter Konwitschny, einer der<br />
wichtigen Wagner-Regisseure des 20. und 21. Jahrhunderts.<br />
Der Kurs geht in seiner Arbeit genau so vor, wie es ein Regie-<br />
Team tun würde, das eine Inszenierung der Götterdämmerung<br />
konzipieren würde. Über Recherche und Analyse des musikalischen<br />
und dramaturgischen Materials geht es zu einer<br />
kreativen Befragung der Götterdämmerung. In Wort- und Bild,<br />
in szenisch-musikalischen Skizzen und Ausstattungsentwürfen<br />
entsteht die Vision eines »Rings für das 21. Jahrhundert«. Zentraler<br />
Teil der Arbeit ist dabei das Kreieren eines Ausstattungskonzepts,<br />
eines Bühnenbild-Modells und eines Storyboards.<br />
Der Kurs vereint Aspekte aus den Fachbereichen Musik, Theater,<br />
Literatur, Geschichte und Politik.<br />
* Richard Wagner, Götterdämmerung, zitiert nach: http://www.faz.net/<br />
aktuell/feuilleton/bayreuth-2013-wie-das-wird-11105938.html<br />
Dirk Schattner (Jg. 1976) ist Regisseur, Autor und Songtexter in den Bereichen Musiktheater/Musical,<br />
Video und Sprechtheater. Seine letzten Arbeiten waren »Das<br />
Mädchen mit den Schwefelhölzern« nach H.C. Andersen (Wien), das Musical »Wenn<br />
Rosenblätter fallen« (Hamburg, Mannheim, Wien, Amsterdam) und ein Multi-Media<br />
Abend über Gustav Mahler (Bayreuth). 2010 hat Dirk für das Kulturhauptstadtjahr ca.<br />
80 Kurz-Video-Clips produziert. Bei der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> macht er zum<br />
dritten Mal mit. Mit der Bühnenbildnerin Julia Bührle-Nowikowa arbeitet er seit Jahren<br />
intensiv zusammen.<br />
–– 71
72 ––<br />
MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Multinationale<br />
Akademie Torgelow<br />
Internatsgymnasium Schloss Torgelow<br />
Fortsetzung von Seite 64:<br />
Im Oktober 2006 wurde ein weiterer Neubau eröffnet, der u.a. mit einer neuen Bibliothek, einem<br />
großen naturwissenschaftlichen Labor, neuen Projekträumen sowie einem komfortabel eingerichteten<br />
Vortragssaal die schulische Qualität noch weiter verbessert hat. Im Nachmittagsbereich finden wöchentlich<br />
über 70 Projekte statt. Angebote, wie die Sporthalle und ein Sportplatz, der Tennisplatz,<br />
ein umfangreich ausgestattetes Fitnessstudio und vieles mehr, nehmen die Schülerinnen und Schüler<br />
regelmäßig in Anspruch.<br />
Auf dem Internatsgelände wohnen die Schüler sowohl im Schloss als auch in anderen modern eingerichteten<br />
Gebäuden. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Zweibettzimmern. Die Vollverpflegung<br />
erfolgt in der internatseigenen Mensa, in der die Speisen durch ein eigenes Küchenteam frisch<br />
zubereitet werden.
SCHLOSS TORGELOW, SCHLOSSSTR. 1,<br />
17192 TORGELOW AM SEE (WAREN),<br />
www.schlosstorgelow.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
T.1 Kombinatorische Optimierung<br />
T.2 Zeitvertreib oder Vermittler? – Phänomen Spiel<br />
T.3 Glocalize It!<br />
T.4 »Urbanus vulgaris«<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Katrin Schmidmayr (Jg. 1989) studiert Schulmusik, Englische Philologie und<br />
Erziehungswissenschaften an der Universität Regensburg und der Royal Holloway<br />
University of London. Sie verfügt über eine breite musikalische Ausbildung<br />
in Sologesang und in den Instrumenten Klavier, Klarinette und Saxophon sowie<br />
Chor- und Orchesterleitung. In ihrer Freizeit wirkt sie in Opernproduktionen,<br />
Orchestern und Kammermusikgruppen, wie dem Klaviertrio vatriopinto, mit.<br />
Ihr besonderes Interesse gilt dem Bereich Konzertpädagogik, in dem sie schon<br />
beim London Chamber Orchestra im Rahmen eines Praktikums tätig war.<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW<br />
Akademieleitung<br />
Tobias Kläden (Jg. 1969) freut sich in diesem Jahr auf ein kleines Jubiläum:<br />
die zehnte Akademie, an der er teilnehmen darf. Der gebürtige (und heute noch<br />
überzeugte) Kölner studierte katholische Theologie und Psychologie in Bonn,<br />
Jerusalem und Münster. Nach einigen Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
an der Universität Münster brachten ihn die Wechselfälle des Lebens ins schöne<br />
Erfurt, wo er als sozialwissenschaftlicher Referent bei einer Arbeitsstelle der<br />
<strong>Deutsche</strong>n Bischofskonferenz arbeitet. Er würde gerne mehr Sport treiben.<br />
Mónika Bánszki (Jg. 1993) stammt aus Ungarn, hat gerade das Gymnasium<br />
beendet und möchte an einer deutschen Universität Geographie studieren. Sie<br />
nahm in 2011 selber an der <strong>SchülerAkademie</strong> in der Landesschule Pforta teil<br />
und freut sich in diesem Jahr, als Assistentin mitzumachen, Leute aus anderen<br />
Nationen kennenzulernen und eine tolle Zeit zu erleben. In ihrer Freizeit<br />
nimmt sie gern an Urlauben teil, organisiert Veranstaltungen, kocht und bäckt<br />
viel oder reitet, wenn das Wetter schön ist.<br />
��������� ������������� (Jg. 1991) kommt aus Kaunas (Litauen) und<br />
studiert in ihrer Heimatstadt Medizin. Dieses Jahr ist ihr zweites Studienjahr.<br />
Wenn aber der Kopf zu vollgestopft mit medizinischen Begriffen wird, tanzt<br />
sie Ballet oder modernen Tanz. Eine andere Tätigkeit, die sich abzulenken hilft,<br />
ist das Klavierspielen, das sie seit dem 7. Lebensjahr begleitet (jetzt aber leider<br />
immer weniger). Sie ist ein häufiger Gast in Deutschland, die Anlässe für die<br />
Besuche variieren von Austauschprogrammen bis zu multinationalen Schüler-<br />
Akademien. Die erste Akademie in Torgelow hat sie als Teilnehmerin im Jahr<br />
2009 erlebt, an ihrer zweiten Akademie nahm sie als Assistentin der Akademieleitung zwei Jahre<br />
später in der Landesschule Pforta teil. Dieses Jahr wartet sie neugierig auf die Rückkehr nach<br />
Torgelow, wo bestimmt wieder eine wunderbare Zeit mit allen Teilnehmenden wartet.<br />
–– 73
74 ––<br />
MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs T.1<br />
Kombinatorische Optimierung<br />
»Die Geschäfte führen die Handlungsreisenden bald hier,<br />
bald dort hin, und es lassen sich nicht füglich Reisetouren<br />
angeben, die für alle vorkommenden Fälle passend sind;<br />
aber es kann durch eine zweckmäßige Wahl und Eintheilung<br />
der Tour, manchmal so viel Zeit gewonnen werden<br />
[…] Die Hauptsache besteht immer darin: so viele Orte wie<br />
möglich mitzunehmen, ohne den nämlichen Ort zweimal<br />
berühren zu müssen.«<br />
(aus: »Der Handlungsreisende – wie er sein soll und was er zu<br />
thun hat, um Aufträge zu erhalten und eines glücklichen Erfolgs<br />
in seinen Geschäften gewiß zu sein – von einem alten Commis-<br />
Voyageur«, B. F. Voigt)<br />
Das oben stehende Zitat ist die erste bekannte Formulierung<br />
des Problems des Handlungsreisenden, eine der<br />
bekanntesten Forschungsfragen der kombinatorischen<br />
Optimierung. Schon 1832 galt es das Problem zu lösen,<br />
Kursleitung<br />
eine Reihenfolge festgelegter Orte zu finden, sodass bei der<br />
Rundreise durch alle diese Orte eine möglichst kurze Strecke<br />
zurückgelegt wird. Ob beim Design von Mikrochips,<br />
bei der Tourenplanung eines Pannendienstes oder bei der<br />
Genomsequenzierung – in vielen praktischen Anwendungen<br />
gilt es heute, das Problem des Handlungsreisenden<br />
in Größenordnungen von mehreren tausend Orten zu lösen.<br />
Kombinatorische Optimierung ist ein Teilbereich der diskreten<br />
Mathematik, der sich mit solchen und ähnlichen<br />
Aufgabenstellungen beschäftigt. Formal gesprochen geht<br />
es darum, das nach bestimmten Kriterien optimale Element<br />
aus einer endlichen Menge von erlaubten Lösungen<br />
zu finden. Dafür gilt es, schnelle Algorithmen, also von<br />
einem Computer ausführbare Handlungsvorschriften, zu<br />
entwickeln. Diese nutzen entweder die kombinatorischen<br />
Strukturen des Problems oder arbeiten auf einem Modell,<br />
welches das Problem als System von linearen Gleichungen<br />
Achim Hildenbrandt (Jg. 1986) wuchs in einem kleinen Dorf in Thüringen auf. Nach<br />
seinem Abitur studierte er Mathematik und Informatik in der oberfränkischen Metropole<br />
Bayreuth. Mittlerweile arbeitet er am Institut für wissenschaftliches Rechnen der Uni<br />
Heidelberg. Nach Dienstschluss ist er viel mit Freunden unterwegs, sowohl in der Natur<br />
auf ausgedehnten Wanderungen als auch im urbanen Umfeld in Oper, Theater oder auf<br />
Heavy-Metal-Konzerten. Von seiner eigenen Akademieteilnahme im Jahre 2003 kennt er<br />
das Akademieleben bereits gut und freut sich nun, es einmal aus einer anderen Perspektive<br />
zu erleben.<br />
und Ungleichungen beschreibt. Der letztere Ansatz wird<br />
als ganzzahlige lineare <strong>Programm</strong>ierung bezeichnet. Der<br />
Kurs wird sich ausgiebig mit beiden Lösungsmöglichkeiten<br />
beschäftigen.<br />
Oft sind diese Probleme jedoch beweisbar schwer zu lösen<br />
(was „schwer“ hierbei genau bedeutet, wird ebenfalls<br />
ein wichtiges Thema des Kurses sein). Es ist deshalb auch<br />
nicht immer möglich, große Probleme, wie sie in der Praxis<br />
auftauchen, exakt zu lösen. Hier liefern dann empirische<br />
Näherungsverfahren, so genannte Heuristiken, akzeptable<br />
Lösungen.<br />
Der Kurs stellt sowohl eine theoretische als auch eine praktische<br />
Auseinandersetzung mit kombinatorischen Optimierungsproblemen<br />
dar. Die Teilnehmenden sollten Spaß an<br />
der Beschäftigung mit theoretischen und algorithmischen<br />
Aspekten der Mathematik mitbringen. Besondere Vorkenntnisse<br />
sind nicht erforderlich.<br />
Olga Heismann (Jg. 1988) verbrachte ihre Schulzeit in Hamburg. Bis 2010 studierte<br />
sie Mathematik an der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich<br />
jetzt als Doktorandin an einem Forschungsinstitut für anwendungsorientierte<br />
Mathematik und Informatik mit kombinatorischen Optimierungsproblemen<br />
im Schienenverkehr. 2004 war sie als Teilnehmerin auf der <strong>SchülerAkademie</strong><br />
Grovesmühle und leitete 2007 einen Kurs auf der JuniorAkademie Hessen. In<br />
ihrer Freizeit tanzt sie gerne Standard- und Lateinamerikanische Tänze oder geht<br />
klettern.
Kurs T.2<br />
Zeitvertreib oder Vermittler?<br />
Phänomen Spiel<br />
Literatur und Musik als Kulturgüter haben eine lange<br />
Tradition der wissenschaftlichen Betrachtung. Die Untersuchung<br />
von Spielen als kulturelles Phänomen hingegen<br />
ist eine noch sehr junge Disziplin, obwohl Spiele auf eine<br />
nicht minder lange Geschichte zurückblicken können.<br />
Spiele vereinen narrative Elemente mit abstrakten Regelsätzen<br />
und erfordern Interaktionen der Spieler. Hierdurch<br />
ergibt sich, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung<br />
mit Spielen, die Ludologie, sich aus einer Vielzahl von<br />
Disziplinen zusammensetzt: Vereint werden Elemente aus<br />
Psychologie, Pädagogik, Erzähltheorie und mathematischer<br />
Spieltheorie.<br />
Die zentrale Fragestellung des Kurses wird sein, ob Spiele<br />
einen rein vergnüglichen Zeitvertreib darstellen oder ob<br />
und wie Spiele als Medium der Wissensvermittlung genutzt<br />
werden können. Dazu erarbeiten die Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer die geschichtliche Entstehung des Spiels und<br />
die heutige Definition von Spielen. Dies geschieht anhand<br />
wissenschaftlicher Quellen in vornehmlich englischer Sprache.<br />
Kursleitung<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW<br />
Nachdem diese Grundlagen gelegt sind, wird sich<br />
der Kurs mit dem Phänomen Spiel aus verschiedenen<br />
Blickwinkeln auseinandersetzen. Unter anderem mit<br />
der Benutzung von Spielmechaniken in spielfremden<br />
Kontexten (Gamification) als auch dem Einsatz von<br />
Spielen und Simulationen zu Trainingszwecken (Serious<br />
Games). Hier werden die Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer Schwerpunkte in ihrem eigenen Interessengebiet<br />
legen können.<br />
Weitere Aspekte werden die Analyse und die Entwurfsprinzipien<br />
von Spielmechaniken sein. Wie kann Fairness oder<br />
Spielspaß gemessen werden? Wie kann ein Spiel entworfen<br />
werden, um den Mitspielern einen bestimmten Sachverhalt<br />
zu verdeutlichen? Dazu werden mathematische Konzepte<br />
aus der Spieltheorie und Methoden aus der künstlichen<br />
Intelligenz erarbeitet.<br />
Malte Harder (Jg. 1986) studierte Mathematik in seiner Heimatstadt Bremen und in<br />
Warwick, Großbritannien. Zur Zeit promoviert er in Informationstheorie und Artificial<br />
Life in Hatfield bei London, Großbritannien, und untersucht die Informationverarbeitung<br />
in Kollektiven. In seiner Freizeit klettert er gerne, fotografiert und übt sich als<br />
Hobby-Typograph. Eine weitere Leidenschaft sind Brett- und Kartenspiele, die nicht<br />
ganz unschuldig bei der Wahl des Kursthemas war. Als Teilnehmer war Malte schon<br />
2004 bei der <strong>SchülerAkademie</strong> dabei, als Kursleiter ist dies die erste Akademie für ihn.<br />
Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit Spielen<br />
wird im Kurs auch praktisch gearbeitet. Als Beispiel wird<br />
unter anderem ein Spiel zur Vermittlung des Paradox der<br />
Selbstbeschränkung gespielt und analysiert. Im weiteren<br />
Verlauf werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in<br />
Kleingruppen nach den im Kurs gewonnenen Erkenntnissen<br />
eigene Spiele entwickeln. Dabei wird das Ziel sein, dass<br />
diese Spiele den Spielern bestimmte Prinzipien vermitteln<br />
sollen.<br />
Christoph Salge (Jg. 1982) studierte an der TU Braunschweig Informatik mit<br />
dem Nebenfach Psychologie. Inzwischen lebt er seit 4 Jahren in England, wo er<br />
an der University of Hertfordshire erst promovierte und jetzt als Research Fellow<br />
im Bereich »Kognitive Robotik« forscht. Seine Forschungsinteressen liegen unter<br />
anderem auch in der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Entwicklung<br />
von Computerspielen. In seiner Freizeit ist er begeisterter Rollen-, Computer- und<br />
Brettspieler, was sich auch in der Themenwahl widerspiegelt.<br />
–– 75
76 ––<br />
MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW (2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs T.3<br />
Glocalize It?<br />
Globale Wirtschafts- und Handelszusammenhänge und Alternativen<br />
Warum reist eine äthiopische Kaffeebohne zur Röstung<br />
nach Indien, wird in Shanghai verschifft und landet über<br />
Bremen in Oer-Erkenschwick, um an der örtlichen Tchibo-<br />
Theke verkauft zu werden? Warum wird eine ghanaische<br />
Kakaobohne aus Sohom im Amsterdamer Hafen gemahlen,<br />
auf einem Tanker unter georgischer Flagge nach New York<br />
verschifft und in Hackettstown zu einem Schokoriegel<br />
konfektioniert? Warum wird kenianischer Tee aus Kericho<br />
nach Singapur transportiert, in Malaysia fermentiert<br />
und in Saalbach-Hinterglemm auf der Skihütte als Eistee<br />
getrunken? Warum muss Baumwolle aus Burkina Faso<br />
nach Bangladesch zum Einfärben, in einen turkmenischen<br />
Sweat-Shop zum Vernähen bevor sie als H&M-T-Shirt in<br />
Karlsruhe über den Ladentisch geht?<br />
Und warum kann ich keine dieser Fragen beantworten?<br />
Als Adam Smith 1776 in »Der Wohlstand der Nationen«<br />
von der unsichtbaren Hand und dezentralen Märkten<br />
schrieb, ahnte er nicht wie folgenschwer seine Ideen<br />
Kursleitung<br />
wirtschaftliches Handeln und Denken noch bis ins 21.<br />
Jahrhundert beeinflussen würden. Oft verkennen wir die<br />
allgegenwärtigen Auswirkungen klassischer Wirtschaftstheorien<br />
auf unseren Alltag. So lebensfremd sie uns scheinen,<br />
so lebensbestimmende, -beeinflussende und -verändernde<br />
Mechanismen verbergen sich hinter ihnen.<br />
Markteffizienz, neoliberale Wirtschaftspolitik und Welthandel<br />
haben einerseits für Wohlstand und Sicherheit in<br />
einigen Teilen der Welt gesorgt, andererseits sieht sich ein<br />
Großteil der Weltbevölkerung mit gegenteiligen Lebensumständen<br />
konfrontiert. Diese ungleiche wirtschaftliche<br />
Entwicklung geht Hand in Hand mit globalen Umweltproblemen.<br />
Viele Menschen haben sich kluge Gedanken gemacht, um<br />
sich diesen Herausforderungen zu stellen. Daraus sind<br />
Ideen von alternativen Wirtschafts- und Lebensmodellen<br />
entstanden, die fortlaufend diskutiert und weiterentwickelt<br />
werden und sich in sozialen Bewegungen manifestieren.<br />
Tanja Peuker (Jg. 1983) studierte in Maastricht European Studies und Media Culture bevor sie nach<br />
Danzig ging, um für das Maximilian Kolbe Haus Projekte, wie das Jugend- und Populärkulturfestival<br />
»Akcja Siec« oder das Umweltprojekt »Wedrowka po Bieszczadach«, zu organisieren. 2008 kehrte sie<br />
nach Berlin zurück, um Interkulturelles Konfliktmanagement an der Alice Salomon Hochschule zu<br />
studieren. Nebenbei war sie an der Initiierung von Carrotmob Berlin sowie an der Institutionalisierung<br />
von »Citizens for Europe e.V.« beteiligt und arbeitete für das Goethe Institut Berlin. Dank eines DAADpostgraduierten-Stipendiums<br />
verschlug es Tanja nach dem Master nach Neuseeland, wo sie an der<br />
Unitec Auckland Journalismus und Publikationsdesign studierte. In ihrer Freizeit widmet sie sich gerne<br />
der graphischen Gestaltung von T-Shirts und produziert für den Alex die Radiosendung Kiezgeflüster.<br />
Hinter Fair Trade, BuenVivir (Sumak Kawsay), De-growth,<br />
Corporate Social Responsibility, Social Business, Recycling<br />
und Cradle to Cradle verbergen sich gelebte Alternativen.<br />
Unsere Welt ist aber weder schwarz-weiß noch statisch. Sie<br />
verändert sich ständig. Die aufgeführten Konzepte sind keine<br />
alleingültigen Allheilbringer, und wirtschaftliches Handeln<br />
im herkömmlichen Sinne ist nicht per se schlecht.<br />
Der Kurs lädt zu einer Reise ein, um globale Zusammenhänge<br />
und lokale Handlungspielräume zu erkunden. Der<br />
Ausgangspunkt ist das Geröllfeld der klassischen Wirtschaftstheorien.<br />
Exkurse werden in praktische Fallbeispiele<br />
von Ghana bis Singapur und Genf führen. Entdeckt und<br />
erforscht werden die vielfältigen Inseln der Handlungsalternativen<br />
und, für den Heimweg ist man gerüstet mit alltagstauglichen<br />
Handlungsstrategien.<br />
Der kreative Kopf ist die treibende Kraft auf dieser Reise.<br />
Nora Hofstetter (Jg. 1987) studiert nachhaltige Entiwcklung<br />
im Masterstudiengang an der Universität Basel. Nach ihrem Bachelorstudium<br />
in Sozialwissenschaften an der Jacobs University<br />
Bremen arbeitete sie in verschiedenen Eigenschaften im Bereich<br />
Corporate Social and Ecological Responsibility, zuletzt bei einer<br />
ghanaischen NGO im Rahmen des ASA-<strong>Programm</strong>s. Wie viel<br />
Spaß Kursleitung macht, hat sie vor zwei Jahren als Kursleiterin<br />
bei der JuniorAkademie Meisenheim entdeckt. Nora is(s)t gerne<br />
unter Leuten, in ihrer Freizeit reist sie und fährt Ski.
Kurs T.4<br />
»Urbanus vulgaris«<br />
Die Stadt am Beginn einer neuen Ära?<br />
Das 21.Jh gilt offiziell als das Jahrhundert der städtischen,<br />
urbanen Entwicklung; nicht wenige kennzeichnen städtisches<br />
Leben heute mit Begriffen wie gigantisch oder unkontrollierbar.<br />
Die Stadt als Inbegriff menschlicher Kommunikation –<br />
dieser lebendige Raum und gleichzeitig Körper ist sowohl<br />
in eine neue Quantität wie Qualität eingestiegen – sie zu<br />
erkennen, an den Ereignissen zu partizipieren, den Raum<br />
mit zu gestalten und für sich und die eigene Umwelt zu<br />
definieren ist eine komplexe Erfahrung, in der alle Akteure<br />
urbanen Raumes gezwungen sind kommunikative Bewegung<br />
zu demonstrieren: Einwohnerschaft, Zivilgesellschaft,<br />
selbstverwaltende Organe, Politik, Wirtschaft, aber auch<br />
überregional steuernde Institutionen.<br />
Partizipative Stadtentwicklung hat in den letzten Monaten<br />
eine vollkommen neue Richtung eingeschlagen. Als Beispiel<br />
können die Demonstrationen in der Stadt Stuttgart<br />
dienen, wo die Menschen gegen den Bau eines unterirdischen<br />
Bahnhofs auf die Straße gehen. Hinzu kommen<br />
Kursleitung<br />
Jennifer Neufend (Jg. 1978) studierte in Osnabrück und Hamburg<br />
Sozialwissenschaften und Germanistik. Sie war als freie Journalistin<br />
tätig und arbeitete, unterstützt durch die Europäische Union<br />
und die Bosch-Stiftung, an Schulen in Estland und Tschechien.<br />
Bis Januar <strong>2012</strong> war sie an einer Hamburger Schule tätig. Zurzeit<br />
absolviert sie das Lehramts-Referendariat in Stadthagen. Ihr Herz<br />
schlägt für die Demokratiepädagogik. Dies ist bereits der zweite<br />
Kurs, den sie mit Jonas Büchel zur Stadtentwicklung an einer Multinationalen<br />
Akademie durchführt. Sie reist gerne, z.B. durch das Baltikum.<br />
(2. BIS 18. AUGUST <strong>2012</strong>) MULTINATIONALE AKADEMIE TORGELOW<br />
weltweite alternative urbane Bewegungen wie in New York,<br />
London, Madrid oder Athen.<br />
Metropolen – Quo Vadis?<br />
Die geschichtliche Entwicklung der Metropolen ist eine<br />
Schatzkammer der europäischen Siedlungsgeschichte; sie<br />
stehen heute wie vor mehr als einem halben Jahrtausend<br />
für die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung und sind<br />
Spiegelbild des ungeheuren globalen Austauschs. In ihrem<br />
Mikro(Makro-)kosmos kondensiert sich der Nährboden für<br />
die Zukunft.<br />
Im Kurs sind Diversität ebenso wie Übereinstimmung von<br />
Interesse: Wie und wo ähneln sich die Metropolen, wie<br />
gleichen sich ihre Kulturen, wo unterscheiden sie sich<br />
und wo haben sie gemeinsame Wurzeln? Neben den schillernden<br />
modernen Metropolen werden aber auch die traditionsreichen<br />
Städte betrachtet. Was lässt einige Standorte<br />
kontinuierlich an Bedeutung gewinnen, andere jedoch in<br />
der Vergessenheit versinken?<br />
Der Kurs wird eine Kompetenz vermitteln, die die historische<br />
Siedlungsentwicklung und die modernen Tendenzen<br />
der urbanen und Metropolenentwicklung verknüpft.<br />
Kenntnisse zur Stadt- und Raumentwicklung werden erarbeitet<br />
sowie historische und aktuelle Gründe für soziale<br />
Bewegung und Migration analysiert. Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer werden gemeinsam mit der Kursleitung<br />
diese Grundlagen erarbeiten und zusammenstellen und<br />
auf dem Weg dorthin lernen, Stadt in ihrer Komplexität zu<br />
begreifen. Die Methodenauswahl wird eine ausgewogene<br />
Mischung aus Theorie sein – gleichzeitig werden Inhalte,<br />
individuell wie in der Gruppe, erarbeitet und parallel wird<br />
das erlernte Wissen unter Anleitung selbst definierter Beispiele<br />
nicht nur erprobt, sondern so praxisnah wie möglich<br />
eingesetzt: Selber Stadt bauen ...!<br />
Jonas Büchel (Jg. 1965) ist glücklich verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Lettland.<br />
Er studierte an der Fachhochschule Dortmund audiovisuelle Gestaltung und an der Evangelischen<br />
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe sowie der Alice-Salomon Hochschule Berlin Soziale<br />
Arbeit. Außerdem wurde er während einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum Kultur- und Eventmanager.<br />
Mit Integrierter Mediation befasste er sich im Rahmen einer Ausbildung und Zusatzqualifikation<br />
des juristischen und psychologischen deutsch-lettischen INTERREG-<strong>Programm</strong>es in Riga.<br />
Jahrelange arbeitete er als Sozialarbeiter in der Berufsbildung im Kontext der Jugendarbeit, v.a. mit<br />
sozial benachteiligten und auffälligen Zielgruppen mit Migrationshintergrund im Ruhrgebiet, Berlin<br />
und den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Jetzt leitet er in Riga ein Büro für Stadtentwicklung und Sozialplanung.<br />
–– 77
78 ––<br />
MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG (9. BIS 25. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Multinationale Akademie<br />
Waldenburg<br />
Europäisches Gymnasium Waldenburg<br />
Das Europäische Gymnasium Waldenburg liegt zentral im Wirtschaftsdreieck Leipzig-<br />
Chemnitz-Zwickau im neuen Landkreis Zwickau, teilweise an der Grenze zu Thüringen<br />
und prägt maßgelblich das gesellschaftliche Leben der Städte Waldenburg, Lichtenstein,<br />
Meerane und Glauchau.<br />
Die Töpferstadt Waldenburg liegt im Tal der Zwickauer Mulde und ihre Umgebung<br />
wird geprägt durch Waldgebiete, Flussauen und die Hügellandschaft des Erzgebirgsvorlandes.<br />
Der Grünfelder Park, das Schloss der Herren von Schönburg und das<br />
Naturalienkabinett sind beliebte Ausflugsziele und prägen das historische Bild der<br />
Stadt. Der englische Landschaftspark »Grünfeld« zählt zu den bedeutendsten Werken<br />
sächsischer Gartenkunst. Auch Fahrrad- und Wanderfreunde kommen in Waldenburg<br />
auf ihre Kosten. Viele beschilderte Wege führen Natur- und Kunstinteressierte durch<br />
das Muldental. Zahlreiche Burgen, Schlösser, und Museen der Umgebung laden zu<br />
Kulturgenuss und Entspannung ein.<br />
Unweit der Kirche steht das ehemalige Fürstlich Schönburgische Lehrerseminar, gestiftet<br />
1844 von Fürst Otto Viktor I. von Schönburg-Waldenburg. Heute sind dort das<br />
1994 in freier Trägerschaft gegründete Europäische Gymnasium und die Freie Jugendkunstschule<br />
ansässig. Der große 3-flüglige Bau zählt nach seiner Rekonstruktion zu<br />
einem der schönsten historischen Gebäude der Stadt.<br />
Das Gymnasium ist Träger der Titel «Schule mit internationalem Charakter» (verliehen<br />
vom Staatsministerium für Kultus und Sport, SMK), »Schule ohne Rassismus<br />
– Schule mit Courage« (verliehen von der Stiftung Courage), Schule der offenen Tür<br />
(verliehen von der Zeitschrift Focus-Schule) und zählt lt. Schulranking der Zeitschrift<br />
»Capital« 13/05 zu den 100 besten Gymnasien Deutschlands.<br />
Im vergangenen Jahr waren das Gymnasium und die in enger Kooperation verbundene<br />
Jugendkunstschule Siegerschule des vom WDR und dem Verband der Schulmusiker<br />
ausgeschriebenen Wettbewerbs »Musik gewinnt«. Außerdem wurde das Jugendblasorchester<br />
vom entsprechenden Landesverband mit dem Prädikat »Sehr gut«<br />
eingestuft. Eine hohe Würdigung erfuhr die Arbeit des Kollegiums auch durch den<br />
Besuch des Bundespräsidenten am 17.04.2007. An der Schule werden auf der Grundlage<br />
einer Vereinbarung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus und den<br />
Regierungen Chinas und Vietnams Jugendliche dieser Länder zum deutschen Abitur<br />
geführt.
EUROPÄISCHES GYMNASIUM WALDENBURG<br />
ALTENBURGER STR. 44<br />
08936 WALDENBURG, SACHSEN<br />
www.eurogymnasium-waldenburg.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
W.1 Wie kommt die Sonne ins Auto?<br />
W.2 Märkte spielend verstehen<br />
W.3 International vergleichende Sozialpolitik<br />
W.4 Macht der Medien<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Arpad Toth (Jg. 1982) wurde in Budapest, Ungarn, geboren. Er studierte Harfe,<br />
Musiktheorie, Solfége und Chorleitung an der Budapester Liszt Akademie. An<br />
derselben Universität promovierte er. Er lehrt in Budapest, leitet mehrere Chöre<br />
in Ungarn, in der Slowakei und in Rumänien (Siebenbürgen). Sein spezielles<br />
Interesse gilt der Improvisation und zeitgenössischer Musik. Seit 2006 leitet Árpád<br />
immer wieder die kursübergreifende Musik während Multinationaler Akademien<br />
der <strong>DSA</strong>.<br />
(9. BIS 25. AUGUST <strong>2012</strong>) MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG<br />
Akademieleitung<br />
Ingrid Gündisch (Jg. 1977) wurde in Bukarest geboren. 1984 kam sie mit ihrer<br />
Familie nach Deutschland. Sie studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst<br />
»Ernst Busch« in Berlin. Heute arbeitet sie als freischaffende Regisseurin<br />
und lebt mit ihrem Mann in Hamburg. Inszenierungen von ihr waren an<br />
den Theatern in Berlin, Köln, Hermannstadt, Dresden, Nürnberg, Esslingen,<br />
Aachen, Stuttgart, Fürth und Bern zu sehen. Bei der <strong>SchülerAkademie</strong> ist Ingrid<br />
zum siebten Mal dabei: 1995 war sie Teilnehmerin, viermal hat sie Kurse geleitet,<br />
jetzt freut sie sich, zum zweiten Mal die Akademieleitung zu übernehmen.<br />
Alexander Rühle (Jg. 1993) schließt im März dieses Jahres sein Schülerleben<br />
mit dem Abitur ab und bereitet sich derzeit mit einem Krankenhauspraktikum<br />
auf das Medizinstudium vor. Wesentlich beigetragen zu diesem Wunsch, Medizin<br />
zu studieren, hat dabei die Teilnahme am Kurs »Das menschliche Immunsystem«<br />
während der <strong>SchülerAkademie</strong> 2010 in Metten. Er spielt leidenschaftlich<br />
gerne Klavier, vor allem Werke von Beethoven und Schubert. Neben der<br />
Musik ist es vor allem das Fußballspielen, das ihn begeistert. An die besonders<br />
schöne Zeit der letzten Akademie denkt er sehr gerne zurück – vor allem an die<br />
geschlossenen Freundschaften – und möchte dies zusammen mit Felix in Waldenburg wieder<br />
aufleben lassen.<br />
Felix Strieth-Kalthoff (Jg. 1993) macht in diesem Jahr sein Abitur (Leistungskurse<br />
Chemie und Mathematik), um ab dem Winter die ländliche Heimat<br />
Lippstadt zu verlassen und dann in Münster oder München das Studium der<br />
Chemie aufzunehmen. Nach Teilnahmen an einer JuniorAkademie (2007) und<br />
einer Multinationalen <strong>SchülerAkademie</strong> (2010) freut er sich nun auf eine neue,<br />
spannende Herausforderung, bei der er die Akademie aus der anderen Perspektive<br />
kennenlernt. In seiner Freizeit befasst er sich aktiv mit diversen Facetten<br />
der Musik (v.a. Gitarre und Bass) oder tanzt im Standardbereich.<br />
–– 79
80 ––<br />
MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG (9. BIS 25. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs W.1<br />
Wie kommt die Sonne ins Auto?<br />
Herausforderungen ans Automobil im 21. Jahrhundert<br />
»ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CARS WILL SOON<br />
CEASE TO BE AN OPTION … THEY WILL BECOME A<br />
NECESSITY.«<br />
FUJIO CHO – VORSTANDSVORSITZENDER VON TOYOTA<br />
»THERE IS NO SUCH THING AS A GREEN CAR.«<br />
NORWEGISCHES MINISTERIUM FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ<br />
Schon Anfang der 1970er Jahre wurde mit Fahrverboten<br />
auf die damalige Ölkrise reagiert und versucht, den Verbrauch<br />
von Erdöl im Transport auf den Straßen zu verringern.<br />
Seit dieser Zeit gibt es immer wieder Meldungen,<br />
dass der Vorrat an Erdöl in absehbarer Zeit zu Ende gehen<br />
wird. In den letzten Jahren ist ein neuer Punkt in der Diskussion<br />
hinzugekommen: die Klimaerwärmung durch die<br />
hohe Emission von Kohlenstoffdioxid. Außerdem wird in<br />
vielen Ballungszentren über eine erhöhte Feinstaubbelastung<br />
geklagt, die zu einem großen Teil auf den Individualverkehr<br />
zurückzuführen ist.<br />
Kursleitung<br />
Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist auch in der Politik die<br />
Notwendigkeit erkannt worden, dass neue Lösungen im<br />
Individualverkehr gefunden und forciert werden müssen.<br />
Eine Möglichkeit, die derzeit stark verfolgt wird, ist die<br />
Umstellung auf Elektroan-<br />
triebe.<br />
Aber wie genau soll das<br />
funktionieren? Was hat<br />
die Umstellung für Konsequenzen<br />
für die Konstruktion<br />
von PKWs? Welche<br />
Materialien werden dort verwendet?<br />
Wie wird die Infrastruktur<br />
von »Tankstellen« künftig aussehen? Was heißt das<br />
für die Produktion und Verteilung von elektrischer Energie?<br />
Wird es auf Grund dieser Umstellung andere Umweltprobleme<br />
geben?<br />
Im Kurs werden zunächst die verschiedenen Randbedingungen<br />
ausgelotet, die für eine erfolgreiche Umstellung<br />
auf alternative Antriebe wichtig sind, auch in politischer<br />
und gesellschaftlicher Hinsicht. Ein Hauptschwerpunkt<br />
Myriam Koch (Jg. 1984) studierte in Aachen Elektrotechnik und Informationstechnik.<br />
Derzeit arbeitet sie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich am Institut<br />
für Hochspannungstechnik. Bei ihrer Arbeit geht es u.a. um die Herausforderungen,<br />
die die Umstellung auf einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz mit<br />
sich bringen. Daneben macht sie gerne Musik, treibt Sport und versucht neue Sprachen<br />
zu lernen. Nach ihrer eigenen Teilnahme an einer <strong>SchülerAkademie</strong> 2001 freut sie sich,<br />
dieses Jahr als Kursleiterin wieder bei einer <strong>DSA</strong> dabei sein zu dürfen.<br />
Für den Kurs werden keine speziellen Kenntnisse benötigt,<br />
allerdings werden die Oberstufenmathematik und -physik,<br />
vor allem die Infinitesimalrechnung, als Grundlage verwendet.<br />
Das Herausarbeiten von Zusammenhängen sollte Spaß<br />
machen. Es wird die Bereitschaft erwartet sich selbständig<br />
mit einem kleinen Themenbereich auseinander zu setzten,<br />
eventuell Texte in englischer Sprache zu lesen, sowie im Vorfeld<br />
der Akademie ein Referat vorzubereiten.<br />
der Kursarbeit wird das systematische Konstruieren von<br />
Elektroautos sein: Wie kann das Auto besonders leicht<br />
konstruiert werden und damit möglichst wenig Treibstoff<br />
verbrauchen? Welche Materialien und Fertigungstechniken<br />
bringen hohe Gewichts-<br />
vorteile? Besonders interessant<br />
bei Elektroautos sind die neuen<br />
Möglichkeiten, die sich in der<br />
Konstruktion und Auslegung der<br />
Autos ergeben. Andererseits wird<br />
aus der Sicht der Elektrotechnik<br />
angeschaut, welche Anforderungen<br />
einerseits an den Antrieb und<br />
die Hilfseinrichtungen im Auto<br />
gestellt werden und andererseits, was es unter anderem für<br />
die Stromnetze der Zukunft heißen wird, wenn der Anteil<br />
der Elektroautos steigt.<br />
Die theoretischen Betrachtungen werden Hand in Hand<br />
mit experimentellen Untersuchungen gehen. Mit diesen<br />
Erfahrungen werden die Einsatzmöglichkeiten der Komponenten<br />
und die eventuell notwendigen Zusatzvorkehrungen<br />
diskutiert.<br />
Julian von Lautz (Jg. 1986) hat Maschinenbau mit Vertiefung Materialwissenschaften<br />
in Braunschweig studiert. Jetzt promoviert er am Fraunhofer Institut<br />
für Werkstoffmechanik in Freiburg über dünne Kohlenstoffschichten. In seiner<br />
Freizeit kocht er gerne, streitet im Debattierclub und engagiert sich in der<br />
politischen Jugendbildung. 2004 nahm er in Roßleben an einer <strong>DSA</strong> teil, und<br />
ist seitdem begeistert im Ehemaligenverein aktiv, wo er auch Myriam kennenlernte.
Kurs W.2<br />
Märkte spielend verstehen<br />
Spieltheorie in den Wirtschaftswissenschaften<br />
Weltklimagipfel Durban, es geht heiß her: Die Vertreter von<br />
192 Staaten ringen um ein Klimaschutzabkommen, das<br />
dem »Kyoto-Protokoll« folgen soll. Das Ergebnis ist völlig<br />
offen: von dem ersehnten Nachfolgeprotokoll bis hin zu<br />
einer ewigen Vertagung der Verhandlungen. Jeder Gesandte<br />
versucht, die Interessen seines Landes optimal durchzusetzen,<br />
jedoch erfordert eine erfolgreiche gemeinsame Lösung<br />
von jedem einzelnen auch Kompromisse und Kooperationsbereitschaft.<br />
Ein Gesandter fragt sich nun, welche Strategie<br />
aus seiner Sicht die beste ist – abhängig davon, wie<br />
sich die übrigen Vertreter entscheiden.<br />
Wie lassen sich solche Entscheidungssituationen beschreiben<br />
und ihre potenziellen Ergebnisse analysieren? Ist es<br />
möglich, das tatsächliche Ergebnis zu prognostizieren?<br />
Welche wirtschaftlichen Interessen beeinflussen es? Und<br />
warum ist es überhaupt nötig, dass möglichst viele Staaten<br />
an so einem Klimaschutzabkommen teilnehmen?<br />
Die Antworten lauten: Die Spieltheorie liefert das nötige<br />
mathematische Handwerkszeug. Ein zentrales Konzept ist<br />
Kursleitung<br />
Christina Cappenberg (Jg. 1987) studierte Volkswirtschaftslehre in Münster<br />
und Paris. Zurzeit schreibt sie an der Universität Münster ihre Doktorarbeit über<br />
die staatliche Förderung regionaler Unternehmensnetzwerke. In ihrer Freizeit<br />
erkundet sie mit Vorliebe zu Pferd die Münsterländer Parklandschaft, musiziert<br />
in der Kirchengemeinde oder veranstaltet Kochabende mit Freunden. Im Jahr<br />
2004 nahm sie selbst an der Multinationalen Akademie teil, damals in Metten,<br />
und freut sich nun auf ihre erste <strong>SchülerAkademie</strong> aus der Kursleiterperspektive.<br />
(9. BIS 25. AUGUST <strong>2012</strong>) MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG<br />
das »Nash-Gleichgewicht« – genau das Ergebnis, bei dem<br />
keiner der Beteiligten seine Strategiewahl nachher bereut.<br />
Die ökonomischen Rahmenbedingungen beeinflussen die<br />
Einzelinteressen. Und möglichst viele Staaten sollten ein<br />
Klimaschutzabkommen unterzeichnen, da eine saubere<br />
Umwelt ein sogenanntes Kollektivgut ist. Einerseits profitieren<br />
hiervon alle, andererseits sind aber auch bei einer<br />
Schädigung durch einen einzelnen alle betroffen. Allein<br />
über die Mechanismen des »freien Marktes« lassen sich<br />
diese und ähnliche Probleme nicht lösen. Daher greift die<br />
Wirtschaftspolitik ein, wie hier durch ein Klimaschutzabkommen.<br />
Ziel dieses Kurses ist es, mithilfe der Spieltheorie verschiedene<br />
solcher Beispiele zu untersuchen, in denen ein Markt<br />
nicht optimal funktioniert. Ein Markt ist hierbei derjenige<br />
Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Spieler bzw. Marktteilnehmer<br />
aufeinandertreffen und ihre Situation durch<br />
Tausch bzw. durch kooperative Arbeitsteilung verbessern<br />
können.<br />
Mit der Definition von Markt und Marktversagen sowie<br />
der Analyse von Nash-Gleichgewichten in verschiedenen<br />
Entscheidungssituationen werden im ersten von drei Kursblöcken<br />
die Grundlagen erarbeitet. Im zweiten Kursblock<br />
sollen selbständig vertiefende Aspekte ausgesucht, anhand<br />
von wissenschaftlicher Literatur untersucht und im Kurs<br />
präsentiert werden. Im Mittelpunkt des dritten Kursblocks<br />
stehen die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung<br />
von Strategieentscheidungen. Hierzu werden in einem<br />
Planspiel wirtschaftspolitische Verhandlungen simuliert.<br />
Die Grundlagen werden mit einer Mischung aus Vorlesungsstil<br />
und Gruppenarbeit sowie Diskussionsrunden und<br />
Übungsaufgaben erarbeitet. Bei der anschließenden Projektarbeit<br />
wird neben der inhaltlichen Ebene ein starker Fokus<br />
auf Präsentationstechniken liegen. Anhand des Planspiels<br />
lernen die Teilnehmenden die Grenzen der spieltheoretischen<br />
Konzepte in der Realität kennen.<br />
Für die Teilnahme am Kurs ist es hilfreich, die Grundlagen<br />
der Differenzial- und Wahrscheinlichkeitsrechnung zu<br />
beherrschen. Es ist jedoch auch möglich, sich diese mit im<br />
Vorfeld bereitgestellter Literatur zu erarbeiten. In jedem Fall<br />
ist ein Interesse an ökonomischen Fragestellungen erforderlich.<br />
Thomas Wotschke (Jg. 1984) studierte Physik in Bonn und Amsterdam. Im Moment<br />
schreibt er als Stipendiat der <strong>Deutsche</strong>n Telekom Stiftung seine Doktorarbeit über<br />
Stringtheorie am Bethe Center for Theoretical Physics der Universität Bonn. In seiner<br />
Freizeit schlägt er den kleinen weißen Ball beim Tischtennis übers Netz und fiebert<br />
wahlweise bei Borussia Dortmund und den Iserlohn Roosters mit bzw. ärgert sich über<br />
selbige. Weiterhin beschäftigt er sich mit Satire, geht ins Kino und versucht bereits zum<br />
dritten Mal bis zur Akademie einige Akkorde auf der Gitarre zu lernen.<br />
–– 81
82 ––<br />
MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG (9. BIS 25. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs W.3<br />
International vergleichende Sozialpolitik<br />
Egal ob Arbeitslosengeld, Krankenversicherung oder Rente,<br />
im Laufe des letzten Jahrhunderts einigten sich alle europäischen<br />
Gesellschaften in ihren Staaten auf irgendeine<br />
Art der sozialen Absicherung. Das heißt, in jedem europäischen<br />
Staat gibt es heute eine Form von Schutz gegen<br />
individuelle Lebensrisiken, wie Krankheit, Arbeitslosigkeit,<br />
Alter etc. Wie dieser Schutz genau geregelt ist und wie<br />
hoch er ausfällt, ist ganz unterschiedlich, aber in allen diesen<br />
Staaten unterstützt die Gesellschaft diejenigen, die in<br />
schwierige Lebenssituationen geraten sind.<br />
Damit unterscheiden sich die europäischen Staaten beispielsweise<br />
von den USA, in denen besonderer Wert<br />
darauf gelegt wird, sich selbst zu helfen und nicht durch<br />
die Gesellschaft unterstützt zu werden. Die Europäische<br />
Union lobt die Unterstützung, die die europäischen Bevölkerungen<br />
ihren Gesellschaftsmitgliedern zukommen lassen,<br />
als das »Europäische Sozialmodell«, als eine besondere Art<br />
der Solidarität, die typisch für Europa sei.<br />
Kursleitung<br />
Aber wie kam es dazu, dass diese Unterstützungssysteme<br />
im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts geschaffen wurden?<br />
Folgen die Unterstützungssysteme in den verschiedenen<br />
europäischen Staaten wirklich der gleichen Logik oder gibt<br />
es grundlegende Unterschiede?<br />
Einerseits haben unterschiedliche geschichtliche Einflüsse<br />
die Sicherungssysteme in den Ländern unterschiedlich<br />
geprägt, andersherum haben aber auch unterschiedliche<br />
Sicherungssysteme die entsprechenden Gesellschaften geprägt<br />
und verändert.<br />
Ebenso ist interessant zu fragen: Wie haben sich die sozialen<br />
Sicherungssysteme in Westeuropa entwickelt – wie in<br />
Ost europa? Was ist in ehemals sozialistischen Staaten seit<br />
dem Ende des Kalten Krieges geschehen? Wie haben sie<br />
ihre sozialen Sicherungssysteme auf- und umgebaut – und<br />
warum?<br />
Nachdem die historischen Ursprünge von sozialen Sicherungssystemen<br />
(Sozialstaaten) erörtert wurden und die<br />
Teilnehmenden gelernt haben, Unterschiede zu erkennen<br />
sowie darauf aufbauend unterschiedliche Sozialstaatska-<br />
Alexandra Braun (Jg. 1984) studierte in Berlin und Canterbury, England, Politikwissenschaft und<br />
Methoden der Sozialforschung. Ihre Leidenschaft gilt aber dem Sozialstaatsvergleich, weil sie findet,<br />
dass die Sozialpolitik eines Landes viel über dieses Land und seine Menschen sagt. Seit 2010 ist sie<br />
Fellow für Teach First Deutschland und setzt sich so an einer Mannheimer Hauptschule für mehr<br />
Bildungsgerechtigkeit in Deutschland ein. Sie liebt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und hat<br />
sich deshalb schon in vielen verschiedenen Bereichen engagiert. Außerdem reist sie sehr gern – egal<br />
wohin. Sie hat gerne Menschen um sich, trifft sich darum viel mit Freunden und mag gutes Essen.<br />
tegorien zu bilden, werden in Kleingruppen Staaten ausgewählt<br />
und untersucht. Die Gruppen werden erforschen,<br />
welche historischen Einflüsse für die Entwicklung der sozialen<br />
Sicherungssysteme in den post-sozialistischen Staaten<br />
seit den 1990er Jahren ausschlaggebend waren bzw. sind<br />
und wie die Gesellschaften durch die unterschiedlichen<br />
Sozialpolitiken die Lebensbedingungen der Menschen in<br />
ihren Staaten verändern.<br />
Der Kurs wird dazu beitragen, die Komplexität hinter gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen zu erkennen und persönliche<br />
Wertvorstellungen nicht als gegeben hinzunehmen,<br />
sondern am Beispiel der Sozialpolitik zu verstehen, dass<br />
auch sie von der Gesellschaft beeinflusst sind, in der wir<br />
leben. Außerdem werden die Teilnehmenden in die Lage<br />
versetzt, Gesellschaft ganzheitlich zu betrachten sowie<br />
sozialpolitische Entwicklungen in einen größeren Kontext<br />
einzuordnen.<br />
Durch die Herkunft der Teilnehmenden aus verschiedenen<br />
europäischen Staaten, wird der Kurs zu einem wirklich<br />
europäischen Forschungsseminar, das seine eigenen Gesellschaften<br />
untersucht!<br />
Hristina Markova (Jg. 1983) studierte Soziologie an der Universität<br />
Heidelberg. Als Promotionsstipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
beschäftigt sie sich in ihrer Doktorarbeit intensiv mit hochschulpolitischen<br />
Themen. Neben der Promotion arbeitet sie als Trainer Assistant<br />
bei der Heidelberger Unternehmensberatung bpc Consulting.<br />
Ihre Freizeit verbringt sie gern mit Freunden, liebt Städtetouren und<br />
Joggen am Fluss oder Strand.
Kurs W.4<br />
Macht der Medien<br />
Nachrichten, Dokumentationen, Kommentare, Internet ...<br />
Es gibt permanent aktuelle Neuigkeiten aus aller Welt, sie<br />
sind schnell bei uns und wirken fundiert und glaubwürdig.<br />
Leider ist die Realität nicht immer so. Hinter dem Vorhang<br />
der bunten Medienwelt geht es oft um Einfluss, Profit und<br />
Quoten. Kann man Manipulationen und falsche Nachrichten<br />
in den Medien erkennen, um auf dem globalisierten<br />
Informationsmarkt nicht die Orientierung zu verlieren?<br />
Im Kurs »Macht der Medien« wird die Tätigkeit und Wirkung<br />
von Fernsehen, Film, Presse, Radio sowie Internet<br />
unter die Lupe genommen. Es wird bei den Journalisten<br />
und Filmemachern hinter die Kulissen geschaut, ihre Arbeit<br />
hinterfragt und manchmal auch enttarnt. Außerdem<br />
gibt es ein konkretes Beispiel aus der deutschen Literaturgeschichte,<br />
das die Thematik der Manipulation durch<br />
Medien aufgreift.<br />
Der Kurs besteht aus zwei Teilen – aus einer theoretischen<br />
Analyse der Medien an konkreten Beispielen, sollen die<br />
Teilnehmenden nicht nur die Grundlagen der Medien kennen<br />
lernen, außerdem sollen sie selber praktisch als Journalisten<br />
arbeiten.<br />
Kursleitung<br />
Sandra Kube (Jg. 1975) studierte an der Universität in Hamburg Germanistik<br />
mit Schwerpunkt auf neuer Literatur und Film, außerdem alte Literatur,<br />
Psychologie und Ethnologie. Sie arbeitete vor, während und nach<br />
dem Studium bei verschiedenen Filmprojekten und Filmproduktionsfirmen<br />
in Hamburg und Berlin sowie in der Werbung. Seit ihrem Magisterabschluss<br />
Anfang 2006 ist sie als freie Autorin in Hamburg tätig. In ihrer<br />
Freizeit liest sie gerne und liebt Filme.<br />
(9. BIS 25. AUGUST <strong>2012</strong>) MULTINATIONALE AKADEMIE WALDENBURG<br />
Im theoretischen Teil wird anhand verschiedener Beispiele<br />
aus den Bereichen Journalismus (Presse, Radio, Internet),<br />
Film und Literatur gearbeitet.<br />
Die Arbeit in kleinen Workshops wird die eigene alltägliche<br />
Mediennutzung reflektieren. Die Unterschiede<br />
zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien wird<br />
als Gruppenarbeit anhand von verschiedenen Nachrichtensendungen<br />
analysiert. Dabei sollen die Gefahren der Manipulation<br />
und dem Infotainment gezeigt werden. Im Detail<br />
werden in Vorträgen auch die Gefahren gezeigt, wie durch<br />
Medien Stereotype zwischen Nationen verbreitet werden.<br />
Eine weitere Workshop-Einheit wird der Rolle der sozialen<br />
Medien in der Gesellschaft gewidmet. An einem Literatur-<br />
und verschiedenen Filmbeispielen wird die Arbeitsweise<br />
der unterhaltenden Medienmacher gezeigt.<br />
Im zweiten Teilen sollen die Teilnehmenden ihre eigene<br />
Zeitung erstellen. Hierfür werden sie alle Posten für die<br />
Produktion einer Zeitung besetzen, um praktisch zu erleben,<br />
wie so ein Produkt entsteht.<br />
Die Teilnehmenden werden in Form eines Kurzreferates<br />
das Mediensystem ihres eigenen Herkunftslandes vorstellen<br />
und sich parallel auf die Entstehungsgeschichte von ausgewählten<br />
Medien konzentrieren. Zur Medienanalyse werden<br />
konkrete Beispiele aus den entsprechenden Ländern benötigt.<br />
Die Teilnehmenden werden schon im Vorfeld nach<br />
einem mitgeteilten Schlüssel und Fragenkatalog Medien<br />
analysieren und für die Vorstellung im Kurs zusammen<br />
stellen.<br />
Jedem Teilnehmenden wird ebenfalls zur Vorbereitung des<br />
Kurses das Buch »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«<br />
von Heinrich Böll geschickt. Die Teilnehmer sollen die<br />
Erzählung lesen und vorbereiten, sie wird dann im Kurs<br />
besprochen und hinsichtlich des Themas Medienmanipulation<br />
analysiert.<br />
Die Informationen über die Arbeitsweise der Massenmedien<br />
sollen die Teilnehmenden für den Umgang mit den<br />
Medien sensibilisieren. Die eigene Mediennutzung soll<br />
kritischer werden und sie sollen das Handwerkszeug zur<br />
sinnvollen Hinterfragung erlernen.<br />
Die Teilnehmenden lernen darüber hinaus die Grundlagen<br />
der praktischen journalistischen Arbeit und die Methoden<br />
der Filmemacher kennen.<br />
Bára Procházková (Jg. 1979) studierte Politikwissenschaft und Osteuropastudien an der<br />
Universität Hamburg. Während des Studiums war sie als interkulturelle Trainerin in<br />
Deutschland, Tschechien, Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Polen tätig. Seit<br />
2004 arbeitete sie als Redakteurin im Tschechischen Hörfunk, später als Chefreporterin der<br />
Tageszeitung Deník und seit 2008 als Redakteurin der tschechischen Wochenzeitung Respekt.<br />
Sie engagiert sich in Initiativen für die Verbesserung der deutsch-tschechischen Beziehungen<br />
und leitet Seminare für deutsche politische Stiftungen.<br />
–– 83
JGW-SCHÜLERAKADEMIEN<br />
Die JGW-<br />
<strong>SchülerAkademie</strong>n<br />
Wenn man selbst das große Glück hatte, an einer <strong>SchülerAkademie</strong> teilzunehmen,<br />
dann weiß man, wie besonders, wie bedeutend und in gewisser Weise auch prägend<br />
dieses Erlebnis ist. Rückblickend möchte man es unter keinen Umständen missen und<br />
ist dankbar für diese erhaltene Chance.<br />
Der Verein Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V. (JGW) wurde von<br />
ehemaligen Teilnehmenden der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> gegründet und besteht<br />
seit 1999. Ein ehrenamtlich arbeitendes Organisationsteam richtet seit 2004 JGW-<br />
<strong>SchülerAkademie</strong>n unter dem Dach der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> aus. Ziel seiner<br />
Arbeit ist es, noch mehr Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer Schüler-<br />
Akademie zu ermöglichen. Darüber hinaus entsendet JGW jährlich eine Delegation zu<br />
den zwei weltweit größten UN-Simulationen – zum National Model United Nations<br />
(NMUN) und zur World-MUN. Informationen zu weiteren Projekten auf www.jgw-ev.de.<br />
84 ––
Wie bei den von der Bildung & Begabung gemeinnützigen GmbH ausgerichteten<br />
<strong>SchülerAkademie</strong>n sind die JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>n von intensiver Kursarbeit auf<br />
hohem Niveau und den verschiedensten Aktivitäten in der kursfreien Zeit geprägt.<br />
Musik und Sport gehören ebenso dazu wie lange Diskussionen bis tief in die Nacht,<br />
spontane Spiele-Abende und ein Exkursionstag. Die Teilnahmebedingungen sowie das<br />
Bewerbungsverfahren sind mit denen der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> identisch.<br />
Kosten / Ermäßigung oder Erlass<br />
Aufgrund der mit zehn Tagen kürzeren Dauer wird von den Teilnehmenden der<br />
JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>n eine Eigenbeteiligung von 395 Euro erwartet. Hinsichtlich<br />
einer Ermäßigung oder eines Erlasses der Eigenbeteiligung gelten die gleichen<br />
Bedingungen wie bei der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> (siehe Seite 13), d.h. die<br />
Eigenbeteiligung kann ermäßigt oder ganz erlassen werden, wenn die Einkommensverhältnisse<br />
der Familie die Zahlung der Eigenbeteiligung nur zum Teil oder gar<br />
nicht zulassen. Auch hier erfolgt die Platzvergabe ohne Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse.<br />
Ein Antrag auf Ermäßigung oder Erlass ist erst nach Erhalt<br />
der Teilnahmezusage zu stellen.<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIEN<br />
–– 85
86 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I (5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
JGW-<strong>SchülerAkademie</strong><br />
Papenburg I<br />
Historisch-Ökologische Bildungsstätte<br />
Emsland in Papenburg e.V.<br />
Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg liegt inmitten eines<br />
vor mehreren hundert Jahren trockengelegten Moorgebietes im nordwestlichen Niedersachsen.<br />
Sie wurde im Rahmen einer Beschäftigungsinitiative für ältere Langzeitarbeitslose<br />
konzipiert und erbaut.<br />
Besonderer Wert wurde dabei auf eine Energie und Ressourcen schonende Gestaltung<br />
gelegt, was sich auch in der ungewöhnlichen und originellen Innengestaltung<br />
zeigt. Als anerkannte Heimvolkshochschule legt sie in ihrem eigenen <strong>Programm</strong> den<br />
Schwerpunkt auf politische und Umwelt-Bildung.<br />
Das Areal ist harmonisch in die Landschaft eingebettet. Von der Straße ist es durch einen<br />
sanften Hügelwall getrennt, auf dessen Innenseite sich Haupthaus und zahlreiche<br />
kleinere Gebäude befinden. Fast alle Häuser haben eigene Wintergärten, in denen es<br />
neben den landesüblichen Pflanzen auch zahlreiche exotische Gewächse wie Aloe vera,<br />
Kumquats und Palmen gibt. Die Flure im Haupthaus öffnen sich allesamt auf den<br />
großen Wintergarten, der wiederum auf den vorgelagerten See blickt. Dieser wird aus<br />
einem über das Gelände der Bildungsstätte verlaufenden Bach gespeist und lädt zu<br />
Fahrten mit dem Boot ein. Das komplette Haus steht für die Akademie zur Verfügung.<br />
Fortsetzung siehe Seite 94 …
HISTORISCH-ÖKOLOGISCHE BILDUNGSSTÄTTE EMSLAND<br />
SPILLMANNSWEG 30<br />
26871 PAPENBURG<br />
www.hoeb.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
JGW 1.1 Bewölkt bis bedeckt<br />
JGW 1.2 Das Higgs, der LHC und Quarks<br />
JGW 1.3 Schöne neue Neurowelt<br />
JGW 1.4 Eigentum in der Krise<br />
JGW 1.5 Tumulte, Tod und Trauer?<br />
JGW 1.6 »Als ein Mensch dem Tod in der Geburt erkoren!«<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Kerry Jago (Jg. 1979) wuchs in Neuseeland auf und studierte dort zunächst<br />
Komposition und Geschichte. 2001 kam er nach Deutschland, um sein Studium<br />
in Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik und Theater Hannover<br />
aufzunehmen, das er im Sommer 2006 beendete. Seitdem leitet er diverse Orchester<br />
in Deutschland und den Niederlanden und studierte bis 2011 zusätzlich<br />
Gesang am Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Kerry interessiert sich<br />
sehr für Musiktheorie, aber auch für Geschichte, die deutsche Sprache, Bergwandern,<br />
guten Käse und Cricket.<br />
(5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I<br />
Akademieleitung<br />
Jan Brockhaus (Jg. 1986) war 2004 Teilnehmer der ersten JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>.<br />
Nach dem Abitur absolvierte er seinen Zivildienst im Bereich der Kinder-<br />
und Jugendarbeit sowie einen »Work and Travel«-Aufenthalt in Australien.<br />
Sein anschließendes Physikstudium in Münster und Paris schloss er im Frühjahr<br />
<strong>2012</strong> ab und ist derzeit viel mit der Planung seines weiteren Lebensweges<br />
beschäftigt. In seiner Freizeit tanzt er gerne, liest oder spielt Klavier. Außerdem<br />
hilft er seit 2004 bei der Organisation der JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>n mit.<br />
Maren Ochs (Jg. 1992) legte im Jahr 2011 ihr Abitur ab und zog daraufhin aus<br />
der baden-württembergischen Heimat ins schöne München. Sie absolviert dort<br />
ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Internat für Schülerinnen und Schüler<br />
mit Hörschädigung. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Maren mit fremden Sprachen<br />
und philosophischen Themen, genießt Besuche in Kinos und Kunstmuseen<br />
oder vertieft sich in Gedichte. Seit sie 2009 selbst glückliche Teilnehmerin<br />
einer JGW-<strong>SchülerAkademie</strong> war, engagiert sie sich bei der Organisation weiterer<br />
Akademien.<br />
–– 87
88 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I (5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs JGW 1.1<br />
Bewölkt bis bedeckt<br />
Wolken in Wetter und Klima<br />
Das Wetter beeinflusst unseren Alltag. Von der Frage, was<br />
wir morgens anziehen, bis zum Ernteerfolg des Landwirts<br />
hängt alles davon ab, was das Wetter mit sich bringt. Aber<br />
wie funktioniert Wetter eigentlich? Wie entstehen Wind<br />
und Wolken, und wie kann man sie vorhersagen? Und welchen<br />
Einfluss haben Wolken auf unser Klima?<br />
Über die Jahrtausende haben sich<br />
Menschen mit der Beobachtung des<br />
Wetters beschäftigt, aber erst eine<br />
schnelle Nachrichtenübertragung wie<br />
die Telegrafie, ermöglichte es, Wetterdaten<br />
von vielen Orten zusammenzutragen<br />
und zu einem großen Bild<br />
zusammenzufügen. Heute stützt sich<br />
die Meteorologie stark auf moderne Kommunikations- und<br />
Messmethoden sowie aufwendige Modelle und Simulationen,<br />
aber der Mensch ist trotzdem unersetzbar.<br />
Kursleitung<br />
Der Kurs beginnt mit einer Einführung in die Meteorologie.<br />
Zunächst wird es dabei um die grundlegenden physikalischen<br />
Zusammenhänge in der Atmosphäre gehen. Daran<br />
anschließend werden globale Strömungen und große Wettersysteme,<br />
aber auch lokale Phänomene und insbesondere<br />
die Entstehung der Wolken betrachtet und untersucht. Das<br />
erarbeitete Wissen<br />
Der Kurs setzt kein spezielles physikalisches, mathematisches<br />
oder computertechnisches Wissen voraus; alles Nötige wird im<br />
Kurs vermittelt. Das Interesse, physikalische Prozesse zu verstehen<br />
und sich mit Gleichungen auseinanderzusetzen, ist jedoch<br />
von Vorteil.<br />
Hendrik Hoeth (Jg. 1977) nahm 1996 selbst an einer <strong>SchülerAkademie</strong> teil. Er<br />
studierte in Clausthal, Haifa (Israel) und Wuppertal Physik mit Schwerpunkt<br />
auf experimenteller Teilchenphysik. Nach seiner Promotion rutschte er in Richtung<br />
Theorie und beschäftigt sich nun an der Durham University in England<br />
mit Phänomenologie. Mit der Meteorologie kam er durch die Fliegerei in Kontakt:<br />
Am Wochenende findet man ihn meistens auf dem Segelflugplatz oder in<br />
der Werkstatt, wo er sein eigenes Flugzeug baut.<br />
wird darüber hinaus<br />
anhand von aktuellen<br />
Wetterkarten<br />
vertieft und diskutiert.<br />
Anschließend<br />
verschiebt sich der Fokus zu kleineren Systemen. In der<br />
Mikrophysik stehen die einzelnen Tropfen und ihre Entstehung<br />
im Vordergrund. Welche kleinen Prozesse spielen bei<br />
der Bildung von Wolkentropfen eine Rolle? Und wie entstehen<br />
größere Regentropfen und Hagel?<br />
Ein Meer von Wolken<br />
Nach diesem Ausflug zu den winzigen Prozessen und<br />
kurzen Zeitskalen richtet sich der Blick des Kurses auf die<br />
langfristigen Entwicklungen im globalen Sinne. Nicht nur<br />
für das Wetter, sondern auch für das Klima haben Wolken<br />
eine besondere Bedeutung. Diese wird im Kurs näher<br />
betrachtet und die verschiedenen möglichen Wechselwirkungen<br />
werden untersucht.<br />
Darüber hinaus wird auch ein Einblick in die verschiedenen<br />
mathematischen Modelle gegeben. Auf einer winzigen<br />
Skala entstehen die Wolken, bildet sich Regen, doch<br />
ihr Einfluss ist auch auf sehr großen Gebieten und Zeitskalen<br />
zu spüren. Um die Entstehung, Wirkung und Veränderung<br />
von Wolken besser zu verstehen und zu untersuchen,<br />
gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen mathematischen<br />
Modellen. Sie behandeln verschiedene zeitliche und örtliche<br />
Größenordnungen und verfolgen unterschiedliche<br />
Ziele in der Simulation. Außerdem werden anhand des erarbeiteten<br />
Wissens eigene einfache Modelle formuliert und<br />
auf dem Computer ausprobiert.<br />
Vera Schemann (Jg. 1983) verbrachte ihre Schulzeit im schönen Münsterland und war<br />
2002 selbst Teilnehmerin einer <strong>SchülerAkademie</strong>. Anschließend zog es sie zum Studium<br />
der Technomathematik in den Norden nach Bremen. Seit dem Frühjahr 2010 lernt<br />
sie in Hamburg als Doktorandin am Max-Planck-Institut für Meteorologie, die Wolken<br />
mit anderen Augen zu sehen. Wenn sie nicht die Wolken betrachtet, versinkt sie gerne<br />
in skandinavischen Krimis und liebt sowohl das Radfahren als auch Diskussionen über<br />
die schönste Nebensache der Welt – den Fußball.
Kurs JGW 1.2<br />
Das Higgs, der LHC und Quarks<br />
Einführung in die experimentelle Teilchenphysik<br />
Seit vielen Jahrhunderten beschäftigen sich Menschen mit<br />
der Frage, woher die uns umgebende Welt stammt und wie<br />
sie aufgebaut ist. Es wurden immer wieder neue Methoden<br />
entwickelt, um Materie noch detaillierter untersuchen zu<br />
können. Inzwischen sind Physiker in der Lage, Strukturen<br />
im Bereich eines Billiardstels eines Millimeters aufzulösen.<br />
Wie dies geschieht und wie sich Forscher die subatomare<br />
Welt vorstellen, wird in diesem Kurs gezeigt.<br />
Zurzeit ist die vorherrschende Ansicht in der Physik, dass<br />
die Welt mit zwölf Elementarteilchen und vier Kräften,<br />
die zwischen diesen Teilchen wirken, beschrieben werden<br />
kann – mithilfe des so genannten Standardmodells. Teilchenphysiker<br />
auf der ganzen Welt untersuchen diese Teilchen<br />
und Kräfte mit verschiedenartigen Experimenten, die<br />
sie nicht nur auf sämtliche Erdteile verschlägt, z.B. in die<br />
Antarktis, sondern auch tief unter die Erde, unter Wasser<br />
oder in den Weltraum.<br />
Kursleitung<br />
Der Kurs beginnt damit, das Standardmodell<br />
der Teilchenphysik genauer<br />
unter die Lupe zu nehmen,<br />
insbesondere welche Beobachtungen<br />
zur Entwicklung dieses<br />
Modells geführt haben. Auch die<br />
Grenzen des Modells und offene<br />
Fragen, wie die Suche nach dem<br />
Higgs-Teilchen, sollen dabei diskutiert<br />
werden.<br />
(5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I<br />
Danach wendet sich der Kurs<br />
aktuellen Experimenten zu, die<br />
genau diese offenen Fragen lösen<br />
wollen. Dabei wird es auch darum<br />
gehen, wie Versuche in der Teilchenphysik<br />
überhaupt funktionieren. Wie werden Daten<br />
genommen und ausgewertet? Warum erfordert der Nachweis<br />
kleinster Teilchen so große Versuchsaufbauten? Und<br />
warum sind häufig so viele Experimentatoren – teilweise<br />
über 2000 Leute – an einem Versuch beteiligt?<br />
Benedikt Hegner (Jg. 1978) studierte Physik, Geschichte und Philosophie an der<br />
RWTH Aachen. 2008 promovierte er in experimenteller Teilchenphysik am <strong>Deutsche</strong>n<br />
Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg. Seitdem ist er wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter an der Forschungseinrichtung der European Organization for Nuclear<br />
Research (CERN) und sucht als Mitglied des Compact Muon Solenoid Experimentes<br />
(CMS-Experiment) nach neuer, unbekannter Physik. Neben der Forschung genießt<br />
er die wunderschöne Umgebung Genfs und geht gerne im Gebirge wandern. Seinen<br />
ersten Kontakt mit der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong> hatte er im Jahr 2005 als Kursleiter<br />
auf der Akademie Grovesmühle.<br />
Die Spuren der entstandenen Teilchen nach einer Proton-Proton-<br />
Kollision im CMS Detektor am LHC am CERN. Das Ereignis könnte<br />
womöglich durch ein Higgsteilchen zustande gekommen sein.<br />
Abbildung © 2011 CERN<br />
Ein besonderer Blick wird auf die vier Experimente geworfen,<br />
die seit zwei Jahren im Large Hadron Collider (LHC)<br />
am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf<br />
laufen. In einem 27 km langen Kreisbeschleuniger werden<br />
dort Protonen aufeinander<br />
geschossen, um die Endprodukte<br />
dieser Zusammenstöße zu untersuchen.<br />
Dort wird unter anderem<br />
nach dem vermutlich für die Masse<br />
verantwortlichen Higgs-Teilchen<br />
gesucht, an dessen Existenz Physiker<br />
seit Jahren glauben, welches<br />
jedoch bis heute nicht (sicher)<br />
nachgewiesen werden konnte.<br />
Am Beispiel des Compact Muon<br />
Solenoid-Experimentes (CMS-Experimentes)<br />
wird ein Großdetektor<br />
untersucht, aus welchen Teilen ein<br />
Detektor besteht und wie sich aus<br />
den Beobachtungen der physikalische Prozess rekonstruieren<br />
lässt. Als Highlight werden ein paar echte Daten des<br />
CMS-Experimentes ausgewertet.<br />
Und keine Panik – es wird nicht viel gerechnet!<br />
Dörthe Kennedy (Jg. 1982) war 2002 selbst Teilnehmerin der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong><br />
und besuchte damals einen Kurs über Teilchenphysik, der ihre Studienwahl<br />
maßgeblich beeinflusste. Sie studierte nach dem Abitur an der Universität<br />
Hamburg Physik und promoviert seit 2008 am <strong>Deutsche</strong>n Elektronen-Synchrotron<br />
(DESY) in Hamburg im Bereich der experimentellen Teilchenphysik, wobei sie sich<br />
mit der Suche nach Supersymmetrie mit dem ATLAS-Detektor an der Forschungseinrichtung<br />
der European Organization for Nuclear Research (CERN) beschäftigt.<br />
Nebenbei lernt sie ein bisschen Polnisch und am Wochenende werden regelmäßig<br />
die Joggingschuhe ausgepackt.<br />
–– 89
90 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I (5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs JGW 1.3<br />
Schöne neue Neurowelt?<br />
Schein & Sein in den Neurowissenschaften<br />
Die Neurowissenschaften stehen wie kaum ein anderer Forschungszweig<br />
im Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit.<br />
Nicht umsonst wurde das 21. Jahrhundert zum<br />
Jahrhundert der Hirnforschung ausgerufen: Fast täglich<br />
vermelden Hirnforscher bahnbrechende Forschungsergebnisse.<br />
Dies ist den konzeptuellen und technischen Entwicklungen<br />
der letzten Jahrzehnte zu verdanken, welche einen<br />
unglaublichen Boom der Neurowissenschaften ausgelöst<br />
haben.<br />
Bei näherem Hinsehen muss man sich allerdings fragen, ob<br />
dieser öffentliche Hype gerechtfertigt ist. Wie viel verstehen<br />
wir tatsächlich vom Gehirn? Und was steckt wirklich<br />
dahinter, wenn der Spiegel mal wieder berichtet, Neurowissenschaftler<br />
könnten unsere Gedanken lesen, potenzielle<br />
Straftäter anhand ihrer Gehirne erkennen oder durch neue<br />
Medikamente unsere Konzentration und Gedächtnisfähigkeiten<br />
steigern?<br />
Kursleitung<br />
Der Kurs verfolgt zwei wesentliche Ziele:<br />
– Vermittlung eines einführenden Überblicks über den<br />
aktuellen Stand der Neurowissenschaften. Was wissen<br />
wir wirklich?<br />
– Beschäftigung mit Prozessen der Wissenschaftskommunikation<br />
am Beispiel neurowissenschaftlicher Arbeiten:<br />
Was passiert mit Forschungsergebnissen auf dem Weg<br />
von wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Fernsehbeiträge<br />
oder Zeitschriftenartikel hin zur öffentlichen<br />
Wahrnehmung?<br />
Im ersten Teil des Kurses wird zunächst das Bild der<br />
Öffentlichkeit von den aktuellen Möglichkeiten und Beschränkungen<br />
der Neurowissenschaften erarbeitet. Hier<br />
sind die Teilnehmenden selbst zunächst Stichprobe der<br />
interessierten Öffentlichkeit und danach »Betrachter<br />
von außen«. In kurzen Referaten werden anschließend<br />
einzelne Bereiche des tatsächlichen Forschungsstandes<br />
beleuchtet: von Gehirn-Computer-Schnittstellen zur Com-<br />
Torsten Betz (Jg. 1984) kommt aus der Nähe von Frankfurt am Main. Nach seinem<br />
Zivildienst als Hausmeistergehilfe verschlug es ihn zum Studium der Cognitive Science<br />
nach Osnabrück. Bis auf einen Abstecher für ein Auslandssemester in Hawaii blieb er<br />
dort entspannte sieben Jahre und promoviert nun seit 2011 am Bernstein Center for<br />
Computational Neurosciene in Berlin über Helligkeitswahrnehmung, was spannender ist<br />
als es klingt. In seiner Freizeit würde er gerne surfen, muss sich aber aufgrund geographischer<br />
Limitierungen meist mit Radfahren begnügen.<br />
putersteuerung mittels Gedanken über wissenschaftliches<br />
»Gedankenlesen« und »Cognitive Enhancer« (Mittel zur<br />
Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit) bis hin zu<br />
Lügendetektion oder »Hirnschrittmachern«, welche heute<br />
beispielsweise zur Behandlung von Parkinson eingesetzt<br />
werden.<br />
Im zweiten Teil des Kurses werden dann die tatsächlichen<br />
Forschungsergebnisse mit dem zuvor betrachteten öffentlichen<br />
Bild verglichen. Angeregt durch hierbei zu Tage<br />
tretende Differenzen sollen kritisch Prozesse der Wissenschaftskommunikation<br />
untersucht und eigene Positionen<br />
hierzu erarbeitet werden. Ausgehend von Textvergleichen<br />
zwischen populär- und fachwissenschaftlichen Artikeln,<br />
Zitaten von Wissenschaftlern, Journalisten, Politikern und<br />
anderen Rezipienten wird über die Verantwortung der einzelnen<br />
Beitragenden zu diesem Prozess diskutiert. Welchen<br />
Einflüssen unterliegen die einzelnen Akteure, und welche<br />
Konsequenzen hat ihr Verhalten für die breite Öffentlichkeit?<br />
Kai Görgen (Jg. 1983) fand nach dem Abitur, einem halben Jahr als Surflehrer,<br />
dem Zivildienst und einem einjährigem Abstecher in die Elektrotechnik<br />
schließlich 2004 zum Studiengang Cognitive Science in Osnabrück. Hochinterdisziplinär<br />
dreht sich dort alles rund ums Denken, ob in künstlichen Systemen<br />
oder dem menschlichen Hirn. Nach seinem Bachelor 2007 ging Kai nach Berlin,<br />
wo er heute in Computational Neuroscience promoviert. In seiner Freizeit geht<br />
er Klettern, Snowboarden und Kitesurfen.
Kurs JGW 1.4<br />
Eigentum in der Krise?<br />
Es gibt kaum ein zweites Prinzip unserer Staats- und<br />
Wirtschaftsordnung, das gleichzeitig so fundamental und<br />
scheinbar so selbstverständlich ist, wie die Garantie von Eigentumsrechten.<br />
Ihre Bedeutung zeigt sich erst, wenn das<br />
Selbstverständliche an Selbstverständnis verliert, nämlich<br />
zum Beispiel dann,<br />
wenn Krisen das<br />
Gefüge erschüttern.<br />
Es ist daher Ziel<br />
dieses Kurses, die<br />
herausragende Bedeutung<br />
des Konzepts<br />
des Privateigentums<br />
als grundlegendes<br />
Prinzip<br />
einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung wie auch moderner<br />
Sozialstaaten westlicher Prägung herauszuarbeiten und<br />
aus diesem Blickwinkel aktuelle Krisen (insbesondere die<br />
Staatsschulden- und Nachhaltigkeitskrise) zu betrachten.<br />
Kursleitung<br />
Der Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer, die zur Auseinandersetzung mit interdisziplinären<br />
Fragestellungen und zur Lektüre<br />
komplexer Texte (teilweise in englischer Originalsprache)<br />
bereit sind. Zudem wird ein grundlegender<br />
Überblick über das aktuelle Nachrichtengeschehen<br />
erwartet.<br />
Verena Risse (Jg. 1983) studierte Jura und Philosophie in Köln, Paris und London.<br />
Inzwischen promoviert sie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main über<br />
Fragen außerstaatlicher Gerechtigkeit, was ihr auf schöne Weise erlaubt, ihre beiden<br />
Studienfächer zusammenzubringen. Weil das Promotionsthema oft aber die ganz<br />
großen Fragen aufwirft, bereiten ihr im Alltag die profanen Dinge häufig die größte<br />
Freude: Sie liest gerne und viel, geht wandern oder fährt Ski und besucht Ausstellungen<br />
moderner Kunst.<br />
(5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I<br />
Im ersten Teil des Kurses wird anhand grundlegender<br />
Texte der Staatstheorie und Ökonomie erarbeitet, wodurch<br />
sich Eigentumsrechte auszeichnen. Zunächst wird hier die<br />
philosophische Diskussion um die Definition<br />
von Eigentum und verschiedener Begründungen<br />
für dessen rechtmäßigen Erwerb im Mittelpunkt<br />
stehen. Dabei wird auch darauf eingegangen,<br />
welche fundamentale Rolle die Behauptung von<br />
Eigentum für ein funktionierendes Gemeinwesen<br />
spielt und wie die Anreizwirkung von Privateigentum<br />
letztlich zur Steigerung des Wohlstands<br />
in kapitalistischen Wirtschaftssystemen führt.<br />
Diese Überlegungen legen eine Schutzwürdigkeit des Eigentums<br />
durch den Staat nahe, die im Mittelpunkt des<br />
zweiten Teils des Kurses steht. Dabei birgt diese staatliche<br />
Eigentumsgarantie einen Konflikt: Einerseits kann der<br />
Eigentumsschutz nur mittels eines stabilen Staatswesens<br />
erreicht werden; andererseits wirkt das Eigentumsrecht<br />
auch gegen den Staat und begrenzt dessen Möglichkeit, auf<br />
Plakat mit dem Slogan der Occupy-Bewegung »Wir<br />
sind die 99%« vor dem Hochhaus der Commerzbank<br />
in Frankfurt am Main, eigenes Foto<br />
die Ressourcen seiner<br />
Bevölkerung zurückzugreifen.<br />
Durch<br />
den Staat garantierte<br />
Eigentumsrechte<br />
sind somit das Scharnier, über das staatlicher Einfluss und<br />
wirtschaftliche Freiheit verbunden sind. Wie aber wirkt<br />
es sich aus, wenn diese Verbindung instabil wird? Diese<br />
Frage nach der Krisenfestigkeit des Privateigentums wird<br />
im letzten Teil des Kurses behandelt und damit ein kleiner,<br />
aber zentraler Aspekt der gegenwärtigen Wirtschafts- und<br />
Finanzkrise in den Blick genommen: Wie sicher sind<br />
Eigentumsrechte in staatlichen Krisen? Und gibt es möglicherweise<br />
Umstände, in denen ein demokratischer Staat zu<br />
Eingriffen in das Eigentum seiner Bürger befugt ist?<br />
Lukas Buchheim (Jg. 1982) studierte Volkswirtschaftslehre und Soziologie an der<br />
Münchener Ludwig-Maximilians-Universität und verbrachte Auslandsjahre an der<br />
University of Wisconsin in Madison sowie am University College London. Seit 2008<br />
ist er wieder zurück in München, wo er in seiner Doktorarbeit unter anderem der<br />
Frage nachgeht, wie Menschen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Im Sommer<br />
besteigt er Gipfel der nahegelegenen Alpen und kommt auch im Winter regelmäßig<br />
zum Skifahren wieder.<br />
–– 91
92 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I (5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs JGW 1.5<br />
Tumulte, Tod und Trauer?<br />
Die Tragödie als Text- und Kunstform<br />
»DIE TRAGÖDIE IST NACHAHMUNG EINER GUTEN<br />
UND IN SICH GESCHLOSSENEN HANDLUNG VON<br />
BESTIMMTER GRÖSSE, IN ANZIEHEND GEFORMTER<br />
SPRACHE, [...] DIE JAMMER UND SCHAUDERN<br />
HERVORRUFT UND HIERDURCH EINE REINIGUNG<br />
VON DERARTIGEN GEMÜTSZUSTÄNDEN BEWIRKT.«<br />
(ARISTOTELES, POETIK VI. ÜBERSETZUNG: M. FUHRMANN)<br />
So definiert Aristoteles um 330 v. Chr. die Tragödie als eine<br />
Untergattung des Dramas. Wie und woraus die Tragödie<br />
im antiken Griechenland entstanden ist, liegt im Dunkeln.<br />
Doch bereits zu Aristoteles‘ Zeit waren die drei antiken<br />
Dramatiker Aischylos, Sophokles und Euripides bekannt<br />
und gerühmt für ihre tragischen Stücke, von denen uns<br />
einige erhalten geblieben sind. Seit dieser Zeit kann die<br />
Tragödie eine beachtliche Erfolgsgeschichte verzeichnen:<br />
Zuschauer in englischen Theatern der frühen Neuzeit wurden<br />
Zeugen des Niedergangs von William Shakespeares<br />
tragischen Helden wie Hamlet oder Macbeth. Unter dem<br />
französischen König Ludwig XIV. bestimmten Dramatiker<br />
wie Jean Racine oder Pierre Corneille mit ihren Tragödien<br />
die literarische Szene des Landes, während sich ca. ein<br />
Kursleitung<br />
Jahrhundert später in Deutschland<br />
so genannte bürgerliche Trauerspiele<br />
z.B. von Gotthold Ephraim Lessing<br />
und Friedrich Schiller großer Beliebtheit<br />
erfreuten. Vormals auf die Welt<br />
des Adels reduziert, hatte die Tragödie<br />
so ihren Weg ins Bürgertum gefunden.<br />
Durch die Moderne bis hin<br />
zu heutigen Aufführungen machen<br />
immer noch Meister der tragischen<br />
Bühnenform von sich reden.<br />
Eva-Maria Martus (Jg. 1983) hat schon früh die Liebe zu Literatur und Film entdeckt.<br />
Daher war der erste Schritt nach dem Abitur eine Ausbildung zur Buchhändlerin.<br />
Nach dem Bachelorstudium der Anglistik und Germanistik in Bayreuth und<br />
Sheffield sowie Tätigkeiten in der Verlags- und Kinobranche macht sie gerade ihren<br />
Master in English Studies im schönen Heidelberg. Wenn sie nicht auf Reisen, im Kino<br />
oder im Theater ist, macht es sich Eva auch gerne mit Literatur aus allen Genres, Zeiten<br />
und Ländern auf dem Sofa gemütlich.<br />
Auf den zweiten Blick muss diese Erfolgsgeschichte der<br />
Tragödie aber verwundern, da die meisten tragischen<br />
Stücke von wenig Vergnüglichem handeln: Kindermord,<br />
Vergiftung, Verfolgung und Verblendung, Liebesverrat,<br />
Wahnsinn, Gewalt und Tod – Wie ist es möglich, dass wir<br />
so etwas gerne lesen oder aufgeführt sehen? Woher kommt<br />
unsere Faszination für das Schreckliche? Diese spannende,<br />
philosophische Frage bildet den Hintergrund des Kurses.<br />
Zur Annäherung wird der Kurs sich in einem Dreischritt<br />
mit der Tragödie als Text- und Kunstform beschäftigen.<br />
Herbert Draper, ”The Lament for Icarus”, 1898. – Ist<br />
Ikarus ein typisch tragischer Held?<br />
Am Anfang steht die gemeinsame Suche<br />
nach einer Definition für Tragödie:<br />
Gibt es bestimmte Merkmale, die alle<br />
tragischen Stücke vereinen? In einem<br />
zweiten Schritt soll problematisiert werden,<br />
ob »Tragödie« als Kategorie nur auf<br />
das Drama oder auch auf andere Textgattungen<br />
zutrifft. Schließlich fragt der Kurs<br />
danach, wie sich die Tragödie im Kontext<br />
der europäischen Geistesgeschichte verändert hat.<br />
Im Zentrum der Kursarbeit steht das gemeinsame intensive<br />
Lesen und Diskutieren tragischer literarischer Texte, wobei<br />
auch andere Kunstformen wie die Malerei, Photographie<br />
oder der Film in den Blick genommen werden. Ergänzend<br />
dazu werden ausgewählte Fachtexte analysiert, die einen<br />
spannenden Einblick in die wissenschaftlichen Disziplinen<br />
der Literaturkritik und -geschichte bieten und helfen, der<br />
Faszination des Tragischen näher zu kommen.<br />
Ricarda Wagner (Jg. 1987) hat 2005 selbst an einer JGW-<strong>SchülerAkademie</strong> teilgenommen.<br />
Nach drei Jahren Studium der Alten Geschichte, Anglistik und Germanistik<br />
in Heidelberg verschlug es sie für ein Jahr an die Universität Cambridge,<br />
und von dort aus wieder zurück an den Neckar. Ricarda unterhält leidenschaftliche<br />
Beziehungen zu einigen Sprachen Europas und macht gerade nähere Bekanntschaft<br />
mit Russisch. In freien Stunden findet man sie lesend, am Klavier oder auf der<br />
Fechtbahn.
(5. BIS 14. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG I<br />
Kurs JGW 1.6<br />
»Als ein Mensch dem Tod in der Geburt erkoren!«<br />
Die Existenzphilosophie des Barock<br />
Die Literatur des Barock ist erschütternd. Allenthalben ist<br />
von der Vergänglichkeit aller Dinge, der Verdorbenheit<br />
unserer eigenen Natur, dem immerfort drohenden Tod<br />
zu hören. Die Welt, so schreibt Gryphius einmal, sei eine<br />
»Folter-Kammer« und in dieser Welt lange zu leben, sei<br />
doch nichts anderes »als lange geqvälet werden«. Wie aber<br />
ist es zu dieser ganz Europa ergreifenden existentiellen Verzweiflung<br />
gekommen? Und wie konnte der Mensch diese<br />
Verzweiflung eigentlich ertragen, wie konnte er sie überwinden?<br />
Das sind die zentralen Fragen dieses Kurses.<br />
Eine Antwort auf die erste Frage wird im ersten Teil des<br />
Kurses versucht werden. Es wird dazu die historische<br />
Situation des 17. Jahrhunderts umfänglich aufzuarbeiten<br />
sein. Dies wird von zwei Seiten aus geschehen: Einerseits<br />
gilt es, sich eindringlich mit der absolutistischen Politik<br />
Kursleitung<br />
Björn Freter (Jg. 1977) studierte Philosophie und Literaturwissenschaft. Derzeit<br />
promoviert er sich mit einer Arbeit zu Liebe und Naturrecht. In der Zeit,<br />
die neben dieser Arbeit verbleibt, widmet er sich vor allem ökologischen und<br />
zoologischen Problemen, den Vorlieben für Ägyptologie, Altorientalistik und alte<br />
Sprachen sowie der Arbeit an psychiatrischen und psychotherapeutischen Fragestellungen.<br />
Daneben ist er passionierter Handwerker, schwimmt oft und gern in<br />
den Berliner Seen und ist leidenschaftlicher Musikhörer.<br />
und ihren höchsten Vertretern zu beschäftigen, und anderseits,<br />
die Lebenswirklichkeit des Gemeinen Mannes zu<br />
untersuchen. Dabei werden<br />
exemplarisch einige der<br />
unzähligen kriegerischen<br />
Auseinandersetzungen (etwa<br />
der Dreißigjährige Krieg, die<br />
französischen Hegemonialkriege,<br />
der englische Bürgerkrieg oder die Türkenkriege)<br />
aufgearbeitet, aber auch nach den Ursachen der Krisenhaftigkeit<br />
des Jahrhunderts überhaupt gefragt.<br />
Der Kurs setzt bis auf die Bereitschaft, ein Referat<br />
und ein nicht unerhebliches Lektürevolumen auf<br />
sich zu nehmen, nichts voraus.<br />
Die zweite Frage steht im Mittelpunkt der anderen Kurshälfte.<br />
In diesem Teil werden literarische Texte analysiert.<br />
Der Schwerpunkt wird dabei auf den barocken Trauerspielen<br />
von Andreas Gryphius, Daniel Caspar von Lohenstein<br />
und Jakob Bidermann liegen. In stetem Rückbezug auf die<br />
im historischen Teil gewonnenen Erkenntnisse werden vor<br />
allem die theologischen und philosophischen Hintergründe<br />
der Literatur des Barock aufgearbeitet. Es gilt, sich an das<br />
Selbstverständnis des Menschen im 17.<br />
Jahrhundert anzunähern, um nachvollziehen<br />
zu können, warum die existenzielle<br />
Krise im Barock so drastische Ausmaße<br />
angenommen hat.<br />
In einem letzten, zusammenführenden Schritt wird geklärt,<br />
welche Lösungsstrategien die Zeitgenossen entwickelten,<br />
um diese Krise überwinden und in ein neues Zeitalter eintreten<br />
zu können. Die Lichtmetaphorik der Aufklärung gewinnt<br />
erst vor dem Hintergrund des Barock ihre historische<br />
Schärfe.<br />
Des Weiteren sind zwei Exkurse zur barocken Architektur<br />
und zur Musik des Barock eingeplant.<br />
Sebastian E. Richter (Jg. 1981) studierte Journalistik sowie Geschichte und Germanistik<br />
in Leipzig. Gegenwärtig arbeitet er an einer Studie zur Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte<br />
der Montanregion Erzgebirge in der Frühen Neuzeit. Die Schwerpunkte<br />
seiner wissenschaftlichen Interessen liegen in der Sächsischen Landesgeschichte<br />
und der Ostmitteleuropäischen Geschichte der Frühen Neuzeit und des 19./20. Jahrhunderts<br />
sowie in der Literaturgeschichte dieser Region. Bereits im Jahr 2006 leitete er<br />
einen JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>-Kurs zu Luther und der Reformation.<br />
–– 93
94 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II (17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
JGW-<strong>SchülerAkademie</strong><br />
Papenburg I I<br />
Historisch-Ökologische Bildungsstätte<br />
Emsland in Papenburg e.V.<br />
Fortsetzung von Seite 86:<br />
Die Unterbringung der Teilnehmenden und Kursleitenden erfolgt in sämtlichen<br />
Gebäuden der Anlage. Manche Zimmer sind eigene kleine Häuschen, die in einem<br />
größeren Wintergarten stehen. Für die Kursarbeit stehen verschiedene Seminarräume<br />
sowie das ebenfalls auf dem Gelände befindliche Regionale Umweltbildungszentrum<br />
und mehrere PCs zur Verfügung.<br />
Für das kulinarische Wohlbefinden sorgt eine vollwertige und abwechslungsreiche<br />
Küche, basierend auf Lebensmitteln, die umweltfreundlich, artgerecht und in der Region<br />
erzeugt wurden. Auch für Freizeit und kursübergreifende Aktivitäten bietet die<br />
Anlage ausreichend Raum: Wintergärten, Kaminzimmer, Partyraum, Turnhalle und<br />
die ländliche Umgebung laden zu vielgestaltiger Beschäftigung ein und werden mit<br />
dazu beitragen, dass die Zeit in Papenburg reich an unterschiedlichen intellektuellen<br />
und sinnlichen Erfahrungen wird.
HISTORISCH-ÖKOLOGISCHE BILDUNGSSTÄTTE EMSLAND<br />
SPILLMANNSWEG 30<br />
26871 PAPENBURG<br />
www.hoeb.de<br />
<strong>Programm</strong><br />
JGW 2.1 Von der Gaswolke bis zum Schwarzen Loch<br />
JGW 2.2 Alles unter Kontrolle<br />
JGW 2.3 Amnesie, Agnosie und andere Ausfälle<br />
JGW 2.4 Menschenrechte in Theorie und Praxis<br />
JGW 2.5 9/11: Ereignis – Wahrnehmung – Verarbeitung<br />
JGW 2.6 Wie utopisch ist »Utopia«?<br />
Leitung kursübergreifende Musik<br />
Feodora-Johanna Gabler (Jg. 1985) studierte von 2005 bis 2008 Harfe an der<br />
Musikhochschule München. Im Jahr 2011 beendete sie erfolgreich die angeschlossene<br />
Meisterklasse. Parallel dazu nahm sie ein Studium der Schulmusik<br />
an der Musikhochschule Würzburg auf. Sie wurde unter anderem durch die<br />
Studienstiftung des deutschen Volkes und die <strong>Deutsche</strong> Stiftung Musikleben<br />
gefördert. Nach einem Engagement in der Staatskapelle Dresden (2008–2010)<br />
arbeitet sie nun als freischaffende Musikerin und Lehrerin. Sie liebt Bücher,<br />
Konzertbesuche und Tanzen.<br />
(17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II<br />
Akademieleitung<br />
Caroline Wacker (Jg. 1993) wurde im wunderschönen Erlangen geboren und<br />
studiert dort Humanmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität. 2010 war<br />
sie begeisterte Teilnehmerin im Kurs »Von kleinen Welten zu großen Netzwerken«<br />
in Papenburg und engagiert sich seitdem mit viel Freude für die JGW-<br />
<strong>SchülerAkademie</strong>n. Wenn sie ein bisschen Zeit übrig hat, liebt Caroline es, Saxofon<br />
und Klavier zu spielen, in Konzerte zu gehen oder auch einfach ein gutes<br />
Gespräch zu führen.<br />
Johannes Waldschütz (Jg. 1982) studierte Geschichte mit dem Schwerpunkt<br />
Mittelalter sowie Politikwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg<br />
und an der University of Iowa. Bei den JGW-<strong>SchülerAkademie</strong>n hat er bereits<br />
drei Kurse geleitet und freut sich nun auf seine Aufgabe als Akademieleiter.<br />
Johannes geht im Sommer gerne Wandern und begeistert sich im Winter für<br />
(fast) alle Varianten des Skisports. Ansonsten ist er das, was man eine Leseratte<br />
nennt, und testet seine Fähigkeit, sich die absurdesten Dinge zu merken, gerne<br />
beim Pubquiz.<br />
–– 95
96 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II (17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs JGW 2.1<br />
Von der Gaswolke bis zum Schwarzen Loch<br />
Vom Leben und Sterben der Sterne<br />
Wie ist die Sonne entstanden? Warum leuchtet sie? Was<br />
wird mit ihr in der Zukunft passieren? Woher kommt die<br />
Erde? Erst die moderne Astrophysik ermöglicht es, Antworten<br />
auf diese jahrhundertealten Fragen zu geben. Sie<br />
stellt aber auch neue Fragen: Was passiert<br />
mit Sternen, die eine viel größere<br />
oder viel kleinere Masse als unsere<br />
Sonne haben? Warum explodieren<br />
manche Sterne am Ende ihres Lebens<br />
als Supernova? Was sind planetarische<br />
Nebel? Und wie können so extreme<br />
Objekte wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher entstehen?<br />
Manche dieser Fragen können von der Wissenschaft<br />
mittlerweile recht genau beantwortet werden, viele andere,<br />
wie zum Beispiel die nach der Entstehung der Planeten,<br />
sind Gegenstand hitziger Diskussionen in der Forschungsgemeinschaft.<br />
Dieser Kurs wird eine grundlegende Einführung in den<br />
Lebenszyklus der Sterne geben, von der Geburt aus einer<br />
Kursleitung<br />
Victoria Grinberg (Jg. 1984) studierte Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität<br />
(LMU) München. Während ihres Studiums sammelte sie in San Diego und<br />
Amsterdam sowie am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik erste Forschungserfahrungen<br />
in der Astrophysik. Heute promoviert sie über schwarze Löcher<br />
in Doppelsternsystemen an der Dr.-Remeis-Sternwarte, Bamberg. Ihre andere große<br />
Leidenschaft sind Literatur und Sprachwissenschaft und sie verbringt ihre Freizeit am<br />
liebsten mit einem guten Buch. Außerdem kocht sie gerne, besonders mit Freunden.<br />
Gaswolke über die lange und meist stabile Phase auf der<br />
Hauptreihe hin zu dem leisen, kalten Tod als Weißer Zwerg<br />
oder aber der gewaltigen Explosion als Supernova und<br />
der Entstehung von Neutronensternen und Schwarzen<br />
Löchern. Neben<br />
dem allgemeinen<br />
Überblick werden<br />
Einzelthemen in<br />
Referaten und in<br />
Gruppenarbeit<br />
vertieft. Bei der<br />
Diskussion von Themen wie Wasserstofffusion oder Entartungsdruck<br />
von Elektronen wird deutlich, warum ein gutes<br />
Verständnis aller Bereiche der Physik, von der klassischen<br />
Mechanik und der Quantenphysik bis hin zur allgemeinen<br />
Relativitätstheorie, für einen Astronomen heute unabdingbar<br />
ist.<br />
Da alle wichtigen astrophysikalischen Veröffentlichungen<br />
heute in englischer Sprache erfolgen, ist die Beherrschung des<br />
Englischen (gutes Schulniveau) für diesen Kurs unbedingt notwendig.<br />
Gute (Schul-)Physikkenntnisse werden außerdem die<br />
Bearbeitung mancher Themen erleichtern.<br />
Während des Kurses werden grundlegende Herangehensweisen<br />
des wissenschaftlichen Arbeitens in der Astrophysik<br />
kennengelernt: Der Umgang mit wissenschaftlichen Fachzeitschriften<br />
wird anhand von wegbereitenden Artikeln,<br />
die das Feld geprägt haben, und aktuellen Forschungsergebnissen<br />
geübt. Der Kurs wird außerdem Daten von Weltklasse-Instrumenten<br />
wie dem Hubble-Weltraumteleskop<br />
analysieren und sich so die Methoden der experimentellen<br />
Astrophysik erarbeiten. Mit Hilfe astrophysikalischer Simulationen<br />
soll das Leben eines Sterns nachgezeichnet und<br />
so ein Eindruck gegeben werden, wie ein theoretischer Astrophysiker<br />
Schlüsse über die physikalischen Vorgänge im<br />
Weltraum zieht.<br />
Am Ende der Akademie wird der Kurs einige der eingangs<br />
gestellten Fragen beantworten können oder aber zumindest<br />
wissen, warum einige der Fragen<br />
(noch) offen sind und wie<br />
Astronomen und Astrophysiker<br />
versuchen, den unendlichen<br />
Weiten des Weltraums ihre Geheimnisse<br />
zu entlocken.<br />
Bildquelle: NASA and The Hubble Heritage<br />
Team (AURA/STScI); Das Lichtecho des<br />
roten Überriesen V838 Monocerotis erleuchtet<br />
den interstellaren Staub um diesen<br />
veränderlichen Stern.<br />
Daniela Huppenkothen (Jg. 1986) studierte zunächst Geowissenschaften und<br />
Astrophysik an der Jacobs University Bremen, danach Astronomie und Astrophysik<br />
an der Universiteit van Amsterdam. Erste astrophysikalische Gehversuche unternahm<br />
sie in Santa Cruz, Kalifornien, wo sie an Supernovaüberresten geforscht<br />
hat. Im Augenblick promoviert sie in Amsterdam über hoch magnetisierte Neutronensterne<br />
und Sternbeben. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Harfe<br />
oder aber, bei entsprechender Gelegenheit, unter Wasser beim Tauchen.
Kurs JGW 2.2<br />
Alles unter Kontrolle<br />
Einführung in die Regelungstechnik mechatronischer Systeme<br />
Wie funktioniert eigentlich ein Tempomat? Wie hält man<br />
einen Hubschrauber auf konstanter Höhe? Wie kann ein<br />
Roboter tonnenschwere Lasten millimetergenau positionieren?<br />
Diese und ähnliche Fragen beantwortet die Regelungstechnik<br />
(engl.: Automatic Control), die sich inzwischen<br />
– sichtbar und unsichtbar – durch viele Bereiche unseres<br />
täglichen Lebens zieht. Ihre Grundlage bildet die so genannte<br />
Rückführung tatsächlichen, gemessenen Zeitverhaltens<br />
und dessen Vergleich mit dem gewünschten Verlauf<br />
der Regelgröße. Anhand der festgestellten Abweichung<br />
zwischen Soll- und Ist-Zustand wird dann regelmäßig<br />
durch korrigierende Aktionen eingegriffen, um das System<br />
in gewünschter Weise zu beeinflussen – der Regelkreis ist<br />
geschlossen.<br />
Kursleitung<br />
(17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II<br />
Standardregelkreis<br />
Diese Technik setzt allerdings zweierlei voraus: Erstens<br />
muss der Ist-Zustand mithilfe von Messungen festgestellt<br />
werden können; zweitens benötigt man, um sinnvoll eingreifen<br />
zu können, Kenntnis vom dynamischen Verhalten<br />
des zu regelnden Systems. Dann ist es möglich, das Steuersignal<br />
automatisch so zu korrigieren, dass z.B. Robustheit<br />
gegenüber Störungen, schnelles und exaktes Erreichen des<br />
Wunschzustandes oder energieeffizientes Systemverhalten<br />
gewährleistet sind.<br />
Während die simplen Regler der ersten Generation noch<br />
mechanisch umgesetzt wurden (wie z.B. der berühmte<br />
Heiko Panzer (Jg. 1984) stammt aus Kempten im Allgäu. Nach seinem Abitur<br />
studierte er Mechatronik und Maschinenbau an der Technischen Universität (TU)<br />
München, und forscht seit 2009 ebendort am Lehrstuhl für Regelungstechnik. Sein<br />
Arbeitsgebiet ist die Modellreduktion dynamischer Systeme, ein mathematiklastiger<br />
Grenzbereich der Ingenieurwissenschaften. Seine Hobbys sind dagegen eher praktischer<br />
Natur; zu ihnen zählen Elektronik und <strong>Programm</strong>ierung. Heiko leitete bereits<br />
2011 einen Kurs auf einer JGW-<strong>SchülerAkademie</strong> und freut sich nun auf sein zweites<br />
Akademieerlebnis.<br />
Fliehkraftregler von James Watt), kommen zur Berechnung<br />
der Stellgröße heutzutage Mikrochips zum Einsatz, die ihre<br />
Messungen aus vielfältigen Sensoren beziehen und komplexe,<br />
optimierte Regelalgorithmen realisieren. Deren Entwicklung<br />
ist seit mehreren Jahrzehnten auch Gegenstand<br />
intensiver Forschung.<br />
Mechanischer Fliehkraftregler nach James Watt (http://<br />
commons.wikimedia.org/wiki/File:Centrifugal_governor.svg<br />
(Public Domain))<br />
Matthias Bittner (Jg. 1984) studierte in München Maschinenwesen mit der Spezialisierung<br />
auf Elektronik/Informatik und Regelungstechnik. Schon während<br />
des Studiums arbeitete er als Tutor in der Lehre mit. Im Februar 2011 begann er<br />
seine Promotion am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik der Technischen Universität<br />
München und beschäftigt sich dort nun mit der Flugbahnoptimierung. Seit<br />
Oktober ist er zudem für die Betreuung der Vorlesung Flugsystemdynamik und<br />
deren Übung zuständig. Privat reist er gerne und beschäftigt sich mit Fotografie<br />
und Bildbearbeitung.<br />
–– 97
98 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II (17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs JGW 2.3<br />
Amnesie, Agnosie und andere Ausfälle<br />
Neurologische Schäden und ihre Folgen<br />
Viele haben Verwandte oder Bekannte, die durch einen<br />
Schlaganfall oder einen Verkehrsunfall Hirnschädigungen<br />
davon getragen haben. Beobachtet man diese Personen,<br />
so fallen häufig Veränderungen in deren Verhalten auf. In<br />
vielen Fällen kommt es zu Gedächtnisverlusten, die sich<br />
entweder auf Erinnerungen vor, während oder nach dem<br />
tragischen Ereignis beziehen. Andere Patienten wiederum<br />
können einen Arm nicht mehr bewegen oder verlieren die<br />
Fähigkeit, sich sprachlich auszudrücken. Sehr spezifisch<br />
sind häufig auch Ausfälle im Sehsystem wie etwa der Verlust<br />
des Farbensehens. Auch gegenteilige Effekte sind möglich:<br />
So glauben Menschen, die den Verlust eines Beines<br />
erfahren, weiterhin Schmerzen in diesem Bein wahrzunehmen,<br />
so genannte Phantomschmerzen.<br />
Wie kommt es aber überhaupt dazu? Meistens liegen die<br />
Ursachen in konkreten Schäden des Gehirns. Dabei können<br />
einzelne oder verschiedene Hirnbereiche betroffen<br />
sein. Im Falle von Gedächtnisverlust (Amnesie) können der<br />
Hippocampus oder das Großhirn beeinträchtigt sein.<br />
Kursleitung<br />
Bei der Agnosie, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Objekte,<br />
Formen oder Personen nicht mehr richtig erkannt<br />
werden können, liegen in der Regel Schädigungen des<br />
Temporallappens vor.<br />
Im Kurs werden die Teilnehmenden sich eingehend mit<br />
diesen Ausfällen auseinandersetzen. Dazu werden die verschiedenen<br />
Verhaltensänderungen näher betrachtet und<br />
charakterisiert und es wird den anatomischen und physiologischen<br />
Ursachen auf den Grund gegangen. Dabei werden<br />
moderne diagnostische Methoden der medizinischen Hirnforschung<br />
wie die funktionale Magnetresonanztomographie<br />
(fMRI) vorgestellt, aber auch klassische verhaltensbasierte<br />
Diagnoseverfahren.<br />
Neben den häufigeren Erkrankungen werden auch exotischere<br />
Fälle beleuchtet, beispielsweise werden die Teilnehmenden<br />
einen Mann kennenlernen, der seine Frau<br />
mit einem Hut verwechselt hat, und eine blinde Frau, die<br />
sehen konnte. Die Realität ist hierbei verrückter als die<br />
Fiktion.<br />
Juliane Jäpel (Jg. 1988) studierte von Oktober 2006 bis Mai 2011 Biomedizin an der<br />
Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Seit letztem Herbst ist sie Doktorandin am<br />
Max-Planck-Institut für Neurobiologie und beschäftigt sich dabei mit strukturellen Mechanismen<br />
der Plastizität. Als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes war<br />
sie selbst auf zwei Sommerakademien und im letzten Jahr hat sie in Papenburg einen<br />
Kurs über Lernen und Gedächtnis gegeben. In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht<br />
häufig ins Kino.<br />
Quelle: http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/<br />
hand-repraesentation-auf-armstumpf/;<br />
www.dasGehirn.info – ein Projekt der Gemeinnützigen<br />
Hertie-Stiftung, der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft e.V.<br />
in Zusammenarbeit mit dem ZKM | Zentrum für Kunst und<br />
Medientechnologie Karlsruhe<br />
Diese Reise durch die faszinierende Welt der Neurologie<br />
wird die Komplexität des menschlichen Gehirns näher<br />
bringen und die Teilnehmenden über eindrucksvolle Patientenschicksale<br />
staunen lassen. Dabei wird deutlich, dass<br />
die Wahrnehmung der Umgebung relativ ist und maßgeblich<br />
von Verarbeitungsprozessen im Gehirn bestimmt wird<br />
– die menschliche Psyche ist ein erstaunliches Ding.<br />
Daniel Meyer (Jg. 1982) studierte Chemie und Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München. Seine Abschlussarbeit führte er an der Stanford<br />
University zum Thema Proteinfaltung durch. Als Doktorand am Max-Planck-<br />
Institut für Neurobiologie gilt sein neues Interesse der Schnittfläche zwischen<br />
Neurobiologie und Psychologie, wobei er an grundlegenden Mechanismen von<br />
Lernen und Gedächtnis forscht. In seiner Freizeit beschäftigt sich Daniel mit<br />
Bildungspolitik und unternimmt gerne sportliche Aktivitäten im Freien.
(17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II<br />
Kurs JGW 2.4<br />
Menschenrechte in Theorie und Praxis<br />
Vom Recht auf Leben zur humanitären Intervention<br />
»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten<br />
geboren.« So heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung<br />
der Menschenrechte, die 1948 von der Generalversammlung<br />
der Vereinten Nationen verabschiedet worden<br />
ist. Seitdem wurde der Menschenrechtskatalog schrittweise<br />
erweitert und es wurden spezifische Standards für Frauen,<br />
Kinder, Behinderte, Minderheiten, Wanderarbeiter und<br />
andere Gruppen eingeführt. Doch wenn am 8. Dezember<br />
jeden Jahres überall auf der Welt der Tag der Menschenrechte<br />
gefeiert wird, fragt sich so mancher, was die Menschenrechte<br />
eigentlich sind.<br />
Der Kurs versucht, den Teilnehmenden ein grundlegendes<br />
Verständnis der Menschenrechte zu vermitteln und sie zur<br />
kritischen Reflexion anzuregen. Dabei werden folgende<br />
Fragen gestellt: Was sind Menschenrechte, wie können sie<br />
philosophisch begründet werden und was bedeutet »universell«?<br />
Wie viele Menschenrechte gibt es und wer legt<br />
fest, was als Menschenrecht gilt und was nicht?<br />
Kursleitung<br />
Josephine Diallo (Jg. 1988) absolvierte einen deutsch-französischen Bachelorstudiengang<br />
in Angewandter Politikwissenschaft. Nach einem längeren journalistischen<br />
Praktikum im Senegal zog es sie im Sommer 2010 nach Dakar zurück, um ein Jahr<br />
für eine Nicht-Regierungsorganisation im Bereich der Menschenrechte und die Internationale<br />
Organisation für Migration zu arbeiten. Seit September 2011 studiert sie<br />
an der Sciences Po Paris den Master-Studiengang Human Rights and Humanitarian<br />
Action. Sie liebt es, zu schwimmen oder für Freunde bzw. mit ihnen zu kochen<br />
In einem ersten Teil wird der Kurs in grundlegende philosophische<br />
Konzepte zur Idee der Menschenrechte einführen<br />
und diese historisch verorten. Danach werden die<br />
Grundlagen des internationalen Menschenrechtsregimes<br />
erarbeitet, wobei die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,<br />
die Internationale Konvention über zivile und<br />
politische Rechte und die Internationale Konvention über<br />
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte im Vordergrund<br />
stehen. Auf Basis der verschiedenen internationalen<br />
Konventionen sollen die Teilnehmenden ihre eigene Menschenrechtserklärung<br />
verfassen.<br />
Nach diesem eher theoretischen ersten Teil widmet sich der<br />
Kurs in einem zweiten Schritt der »Menschenrechtspraxis«.<br />
Jeden Tag werden überall auf der Welt Menschenrechte<br />
verletzt. Warum ist das so? Geschieht das auch in Deutschland?<br />
Und können humanitäre Interventionen, so wie im<br />
Kosovo und in Libyen, in gravierenden Fällen eine Lösung<br />
sein?<br />
Verschiedene gesellschaftswissenschaftliche Methoden werden<br />
im Kurs vorgestellt, mit Hilfe derer die Inhalte erarbei-<br />
Das UN-Hauptquartier in New York,<br />
Foto: Dominik Schneider<br />
tet werden können. Es werden sowohl juristische als auch<br />
nicht-juristische Quellen verwendet, wobei der Kurs auf<br />
verschiedenartige Materialien zurückzugreift (Zeitschriften,<br />
Internet, Comics etc.). Im zweiten Teil des Kurses werden<br />
die Teilnehmenden eine UN-Sicherheitsratssitzung und die<br />
Abstimmung über eine humanitäre Intervention simulieren,<br />
um so die Entscheidungsmechanismen innerhalb der<br />
Vereinten Nationen besser verstehen zu können.<br />
Dominik Schneider (Jg. 1986) verbrachte seinen Auslandszivildienst in einem Kinderhort<br />
in Ostpolen. Seitdem ist er begeistert von fremden Ländern, Kulturen, Sprachen<br />
und dem Reisen. Deshalb studierte er Politik und Psychologie nicht nur an der<br />
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, sondern auch an der Norwegian University of<br />
Science and Technology (NTNU) Trondheim (Norwegen) und schloss 2011 seinen<br />
Master in International Relations an der Syracuse University (USA) ab. In seiner Freizeit<br />
sind Musik (Singen, Klavier), Kreatives Schreiben und Sport angesagt.<br />
–– 99
100 ––<br />
JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II (17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>)<br />
Kurs JGW 2.5<br />
9/11: Ereignis – Wahrnehmung – Verarbeitung<br />
»DIE ANSCHLÄGE VOM 11. SEPTEMBER 2001<br />
LIEGEN ZEHN JAHRE ZURÜCK. DIE FOLGEN SIND<br />
NOCH IMMER STARK SPÜRBAR: KRIEGE, STRENGERE<br />
EINWANDERUNGSGESETZE IN DEN USA UND<br />
ANTI-TERROR-MASSNAHMEN IN ÜBERSEE UND<br />
HIERZULANDE HABEN UNSERE WELT, WIE WIR<br />
UNS IN IHR BEWEGEN UND WIE WIR SIE SEHEN,<br />
VERÄNDERT.«<br />
Diese Feststellung leitet das <strong>Programm</strong>heft zu »remembering<br />
9/11«, einer Veranstaltungsreihe des Carl-Schurz-<br />
Hauses (Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg), ein.<br />
Bereits am Tag nach den Anschlägen war sich die internationale<br />
Presse einig: Nichts wird mehr so sein, wie es war.<br />
Diese ersten journalistischen Aussagen als Verarbeitungen<br />
der Ereignisse bzw. als Verarbeitungen individueller und<br />
kollektiver Wahrnehmungen der Ereignisse sind nur der<br />
Anfang – weltweit fanden die Anschläge des 11. Septembers<br />
Verarbeitung in unterschiedlichster Form. Neben Politikwissenschaftlern,<br />
Journalisten und Zeithistorikern begannen<br />
auch früh Künstler mit der Be- und Verarbeitung:<br />
Kursleitung<br />
Gedichte, Lieder, Plastiken, Denkmäler, Theaterstücke,<br />
Comics, Filme … thematisieren 9/11 auf ganz unterschiedliche<br />
und doch häufig ähnliche Weise.<br />
Der Dreigliederung des Titels folgend geht der Kurs auf die<br />
Ereignisse des 11. Septembers 2001, die Wahrnehmung<br />
derselben und vielfältige daraus resultierende Verarbeitungen<br />
ein.<br />
Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht wird die Frage nach<br />
dem einschneidenden Charakter dieses Tages gestellt –<br />
handelt es sich bei 9/11 wirklich um eine epochale Zäsur,<br />
die die Geschichte in ein Davor und Danach teilt, wie es<br />
bereits die ersten Pressemeldungen nahelegten?<br />
Isabelle Luhmann (Jg. 1987), ursprünglich aus Hildesheim bei Hannover, verschlug<br />
es im Jahr 2000 in den Schwarzwald, wobei sie einige Kulturschocks erlebte. Nachdem<br />
sie 2007 ihr Abitur absolvierte, ging sie zunächst für ein halbes Jahr als Au Pair<br />
nach England. Seit 2008 studiert sie die Fächer Geschichte, Biologie und Deutsch in<br />
Freiburg. Neben dem Studium ist Isabelle für alle möglichen Sportarten zu haben,<br />
eine besondere Schwäche hat sie jedoch für Basketball. Außerdem ist sie begeisterte<br />
Museumsgängerin.<br />
Mit Ansätzen der Oral History wird den Phänomenen der<br />
Wahrnehmung und Erinnerung nachgegangen. Welche<br />
Aussagekraft haben Zeitzeugeninterviews für historische<br />
Fragestellungen und wie geht der Historiker mit ihnen um?<br />
Wo liegen Chancen und Grenzen individueller und kollektiver<br />
Erinnerung für eine wissenschaftliche Erforschung der<br />
Vergangenheit?<br />
Den Kern des Kurses (und zugleich die Anwendung der<br />
Erkenntnisse aus den ersten beiden Arbeitsgebieten) stellt<br />
die Auseinandersetzung mit vielfältigen Formen der Verarbeitung<br />
von 9/11 aus der unmittelbaren Folgezeit bis in<br />
die Gegenwart dar. Historische Arbeitsweisen finden hier<br />
neben literaturwissenschaftlichen Methoden und Ansätzen<br />
der Cultural Studies Anwendung. Liegen der Wahrnehmung<br />
und späteren Verarbeitung von Geschehnissen wie<br />
9/11 gewisse medien- und genreübergreifende Narrative<br />
zugrunde? Welche kulturellen und individuellen Unterschiede<br />
treten uns in der Verarbeitung des 11. Septembers<br />
entgegen? Und welche Rolle spielen Medien und Kunst<br />
überhaupt in dieser Kette von Wahrnehmung und Verarbeitung<br />
von Ereignissen?<br />
Neben Kurzreferaten wird vor allem die intensive Diskussion<br />
in Kleingruppen und im Plenum die Arbeitsweise des<br />
Kurses bestimmen. Sowohl Textarbeit als auch die Analyse<br />
von Bildern, Musikstücken und Filmen werden hierfür die<br />
Grundlage bilden.<br />
Christian Wiedermann (Jg. 1982) absolvierte nach der Mittleren Reife eine Berufsausbildung<br />
zum Zimmerer und war ein weiteres Jahr im Beruf tätig. Nach<br />
dem Zivildienst holte er sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg am Seminar St.<br />
Pirmin (Sasbach) nach. Seit 2008 studiert er Geschichte und Germanistik an der<br />
Universität Freiburg. Als passionierter Lagerfeuergitarrist ist er seit Jahren in der<br />
Jugendarbeit aktiv, vielfältig musikalisch unterwegs und Trainer für Geräteturnen.<br />
Außerdem ist Christian bekennender Tatort-Fan.
Kurs JGW 2.6<br />
Wie utopisch ist »Utopia«?<br />
Staatsutopien der frühen Neuzeit in komparatistischer Perspektive<br />
Wenn man von etwas sagt, es sei »utopisch«, so meint<br />
man damit zumeist, es sei unrealistisch, wirklichkeitsfern<br />
und kaum zu verwirklichen. »Utopie«<br />
hingegen nennt man die Vorstellung von<br />
einer idealen Lebensform oder die Vision<br />
einer glücklichen Zukunft. Wie passt das<br />
zusammen?<br />
Mit »Utopia« (1516) hat Thomas Morus<br />
der literarischen Gattung der (Staats-)<br />
Utopie ihren Namen gegeben. Im Kurs<br />
wird dieses Gründungswerk der utopischen Literatur, das<br />
bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt hat, eingehend<br />
betrachtet. Utopia lässt sich unter einer Vielzahl<br />
von Gesichtspunkten lesen: als literarische Erzählung, als<br />
Reisebericht, als philosophische Abhandlung oder als politisches<br />
Traktat. Diese Vielzahl möglicher Perspektiven führt<br />
zu einem ebenso breiten Spektrum an unterschiedlichen<br />
Interpretationen, die eine Auseinandersetzung mit dem<br />
Kursleitung<br />
(17. BIS 26. AUGUST <strong>2012</strong>) JGW-SCHÜLERAKADEMIE PAPENBURG II<br />
Werk sehr spannend machen. Durch die Betrachtung von<br />
»Utopia« aus verschiedenen Blickwinkeln, wird der Kurs<br />
einigen der Fragen nach-<br />
gehen, die Leserinnen und<br />
Leser des Buches seit langem<br />
beschäftigen, etwa:<br />
Ist Utopia als ernsthafter<br />
Vorschlag für politische<br />
Reformen gemeint? Ist<br />
die im Werk dargestellte<br />
Gesellschaft überhaupt<br />
ein Idealstaat? Und was hat Utopia uns heute noch zu sagen?<br />
Dabei werden in die Arbeit am Text Sichtweisen und<br />
Fragestellungen unterschiedlicher Disziplinen wie Politik,<br />
Geschichte, Literaturwissenschaft und Philosophie einfließen.<br />
Anhand des Textes lassen sich zudem Einblicke in die<br />
Kultur des Humanismus und die humanistischen Vorstellungen<br />
von Bildung, Erziehung, dem guten Leben und der<br />
richtigen Staatsverfassung gewinnen, die ihrerseits auf die<br />
historische und politische Situation im England des 16.<br />
Jahrhunderts antworten.<br />
»Utopia« und »Nova Atlantis« sind zunächst auf<br />
Latein verfasst worden. Im Kurs wird mit deutschen<br />
Übersetzungen gearbeitet, ggf. ist jedoch auch ein<br />
Blick in das Original vorgesehen. Lateinkenntnisse<br />
sind daher hilfreich, aber keine Voraussetzung für die<br />
Teilnahme.<br />
Bernhard Stricker (Jg. 1988) absolvierte nach dem Abitur am Gymnasium Paulinum<br />
in Münster seinen Zivildienst im Kulturzentrum GREND e.V. in Essen. Seit 2008<br />
studiert er Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie in<br />
Bochum. Nebenbei machte er eine Grundausbildung Theaterpädagogik am Theaterpädagogischen<br />
Zentrum Ruhr. Bernhard sammelte Erfahrungen als Sprachlehrer und<br />
Gruppenleiter sowie im Bereich Schauspiel und Theater. Zudem konnte er ein bisschen<br />
internationale Luft bei Auslandsaufenthalten in Frankreich und Italien schnuppern.<br />
Utopia / Thomas More;<br />
Quelle: Bildarchiv des UNESCO Kompetenzzentrums,<br />
Unesco Kompetenzzentrum an der<br />
Universität Paderborn, Paderborn<br />
Neben Morus’ klassischem Werk ist es lohnenswert, zwei<br />
weitere berühmte Utopien der frühen Neuzeit in Augenschein<br />
zu nehmen: Tommaso Campanellas »Sonnenstadt«<br />
(1602) und Francis Bacons »Nova Atlantis« (1627). Sie<br />
führen das von Morus begründete Genre der Staatsutopie<br />
fort, rücken jedoch ganz andere Vorstellungen von einem<br />
guten Leben in den Mittelpunkt. Aus einem Vergleich der<br />
drei Werke wird sich schließlich vielleicht eine Antwort<br />
auf die Frage ergeben, was eigentlich das »Utopische« an<br />
Utopien ist – und vielleicht, wer weiß, eine Antwort darauf,<br />
warum »a map of the world that does not include Utopia is<br />
not even worth glancing at« (Oscar Wilde).<br />
Sonja Völker (Jg. 1987) absolvierte 2006 ihr Abitur am Erasmus-Gymnasium in<br />
Grevenbroich. Seither studiert sie Latein, Geschichte und Griechisch in Tübingen<br />
und London (Ontario). Im Sommer 2009 unterrichtete sie für drei Monate<br />
in Ghana im Rahmen eines Freiwilligendienstes. An der Universität arbeitet sie<br />
als Tutorin für Sprachkurse sowie als Mentorin für wissenschaftliches Arbeiten.<br />
Sonja engagiert sich ehrenamtlich in Gremien der universitären Selbstverwaltung<br />
und im Vorstand des Forum Offene Religionspolitik e.V.<br />
–– 101
102 ––<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
<strong>Programm</strong>e<br />
im Ausland <strong>2012</strong><br />
Akademien in Litauen,<br />
Polen und Österreich<br />
Seit einigen Jahren unterhält die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> Austauschabkommen mit ausländischen Partnern, die vergleichbare<br />
Maßnahmen wie die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> anbieten. Auch im Jahr <strong>2012</strong> werden diese Austauschprogramme<br />
fortgesetzt.<br />
Summer Academy in Nida,<br />
16. bis 26. August <strong>2012</strong> in Litauen<br />
In diesem Jahr organisiert die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong><br />
zum fünften Mal ein Austauschabkommen mit der National<br />
Student Academy of Lithuania, die jedes Jahr eine Akademie<br />
für hochbegabte Schülerinnen und Schüler in Litauen<br />
ausrichtet.<br />
Die Teilnahmegebühr für die Akademie in diesem Jahr (16.<br />
bis 26. August <strong>2012</strong>) beträgt 780 Euro (390 Euro Teilnahmegebühr<br />
plus 390 Euro für Unterbringung und Vollverpflegung)<br />
zuzüglich Reisekosten.<br />
»You are invited to join the Economics section and together with a<br />
dozen 16–18-year-old peers from Lithuania deepen your know-<br />
ledge of Marketing and PR, Finance, Sales, Personnel Management,<br />
International Investment, Entrepreneurship, Leadership<br />
and other topics guided by top managers and professionals from<br />
leading Lithuanian and international companies. Seminars are<br />
structured in an entertaining way – there are plenty of discussions,<br />
case studies, and interactive games.<br />
Your action-packed day at the Academy will start at 8.00 a.m.<br />
with breakfast followed by two 1.5-hour subject interactive<br />
classes. Topics covered during previous Summer Academies<br />
included Entrepreneurship, Business Plan Preparation, Implementing<br />
Business Ideas, Methods for Financing Business, Business<br />
Models and Strategies, etc.<br />
After lunch you will be welcome to join a 1.5 hour self-development<br />
lecture. In the afternoon you will have some spare time for<br />
sightseeing, going to the beach and sporting activities. Each day<br />
you will have a chance to mingle with all Summer Academy’s<br />
students at a daily evening event – a concert, cinema or guest<br />
evening, a mind storm or a theatre project.<br />
The Summer Academy is organised by the National Student<br />
Academy of Lithuania. Every year the best Academy’s students<br />
as well as the most talented young musicians are invited to participate<br />
and create a versatile and dynamic community of young<br />
intellectuals studying Economics, Philology, Maths, Physics and<br />
Astronomy, Chemistry, History, Biochemistry, Computer Science<br />
and Music.<br />
Lithuania is a small Baltic country with a population of 3.5<br />
million people. Nida is a neat and cosy village in westernmost<br />
Lithuania, in the Curonian Spit that is inscribed on UNESCO’s<br />
List of World Heritage.«<br />
Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstelle der<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>.
Multidisciplinary Scientific Camp, Polen<br />
Der Polish Children´s Fund, eine polnische Organisation<br />
zur Förderung von hochbegabten Schülerinnen und<br />
Schülern, organisiert seit dem Jahr 1986 multidisziplinäre<br />
wissenschaftliche Camps (Schülerakademien) für hoch begabte<br />
polnische Schüler. Jedes Jahr treffen sich etwa 80–90<br />
Schüler der Mittelschulen in der Umgebung von Warschau.<br />
Das Camp findet in einem gut ausgestatteten Konferenzzentrum<br />
(Zweibettzimmer mit Bad) mit Computerräumen,<br />
Schwimmbad und Sportanlagen am Waldesrand in der Nähe<br />
von Warschau statt.<br />
Auf dem <strong>Programm</strong> des Camps stehen jeden Tag zur Wahl:<br />
drei Vorlesungen der besten polnischen Wissenschaftler,<br />
acht bis zehn Workshops, zwei allgemeine Diskussionstreffen<br />
mit hervorragenden Persönlichkeiten der Wissenschaft,<br />
Literatur und Kultur, Vorträge der Teilnehmenden, Sport<br />
und psychologische Workshops. Jede(r) Teilnehmende soll<br />
in alle Aktivitäten einmal täglich hineinschnuppern. Es gibt<br />
auch ein Konzert der klassischen Musik und Filmabende.<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> wird die Akademie vom 27. April bis 5. Mai<br />
stattfinden.<br />
Teilnahmevoraussetzungen sind die gleichen wie bei der<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>, außerdem wird eine sehr<br />
gute polnische Sprachkompetenz erwartet. Die Eigenbeteiligung<br />
beträgt 180 Euro.<br />
Interessenten melden sich bitte so bald wie möglich bei der<br />
Geschäftsstelle der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>, damit sie<br />
nähere Informationen zum polnischen <strong>Programm</strong> erhalten<br />
können.<br />
Internationale Sommerakademie Obertrum,<br />
Österreich<br />
Ein Austauschabkommen für einige Schülerinnen und<br />
Schüler unterhält die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> mit der<br />
Pädagogischen Hochschule Salzburg, Österreich, die vom<br />
1. bis 4. Juli <strong>2012</strong> die Sommerakademie Obertrum, 20 km<br />
nördlich von Salzburg am gleichnamigen See ausrichtet.<br />
Die Unterbringung erfolgt in der Landesberufsschule Obertrum,<br />
einer Tourismusschule mit exzellenter Infrastruktur,<br />
die jede Art von Freizeitaktivitäten erlaubt.<br />
Angeboten werden insgesamt vier Workshops zu naturwissenschaftlichen,<br />
wirtschaftlichen und kreativen Themen.<br />
Die Teilnehmenden melden sich im Vorfeld für einen der<br />
angebotenen Workshops und arbeiten insgesamt fünf Halbtage<br />
in Gruppen zu etwa fünfzehn Personen.<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
Die an der Sommerakademie Obertrum interessierten<br />
Schülerinnen und Schüler können ab dem 26. März <strong>2012</strong><br />
genauere <strong>Programm</strong>informationen abrufen unter: www.phsalzburg.at/ahs/begabtenfoerderung.<br />
Die Eigenbeteiligung beträgt 75 Euro.<br />
Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstelle der<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>.<br />
Internationale Sommerakademie Semmering,<br />
Österreich<br />
Bereits zum 14. Mal wird dieses Jahr die Internationale<br />
Sommerakademie Semmering in Niederösterreich für leistungsbereite<br />
Schülerinnen und Schüler abgehalten. Diese<br />
Akademie wird vom Verein zur Förderung begabter und<br />
hochbegabter Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich,<br />
vom Landesschulrat für Niederösterreich, Referat für<br />
Begabtenförderung, und von der Begabtenakademie Niederösterreich<br />
ausgerichtet. Sie findet vom 20. bis 28. Juni<br />
<strong>2012</strong> statt.<br />
Die Teilnehmenden können einen von zwölf Kursen wählen.<br />
Das Kursangebot umfasst auch dieses Jahr wieder eine<br />
Palette an interessanten Inhalten und spannt den Bogen<br />
von den Geisteswissenschaften (Sprachen, Kunst, Kultur)<br />
hin zu den naturwissenschaftlichen Fachbereichen (Mathematik,<br />
Biologie, Chemie, Physik). So können sich die<br />
Jugendlichen unter der Anleitung von äußerst motivierten<br />
und engagierten Kursleiterinnen und Kursleitern mit neuartigen<br />
Kursthemen auseinandersetzen – beispielsweise<br />
anspruchsvolle mathematische Aufgabenstellungen lösen,<br />
naturwissenschaftliche Phänomene erforschen oder kreative<br />
Erfahrungen machen – und in neue Wissensgebiete<br />
eintauchen.<br />
Alle Kurse garantieren neben intellektuellen Herausforderungen<br />
im Unterricht auch ein Rahmenprogramm während<br />
der Pausen bzw. in der kursfreien Zeit. Kooperatives<br />
–– 103
104 ––<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
Arbeiten und Kopfzerbrechen haben genauso Platz wie<br />
gemeinsames Erleben und eine ordentliche Portion Spaß<br />
beim sportlichen Ausgleich. Neben der Förderung der Begabungen<br />
geht es auch um den Austausch untereinander<br />
oder mit den Referentinnen und Referenten.<br />
Die Teilnahmevoraussetzungen entsprechen denen der<br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>. Die Eigenbeteiligung beträgt<br />
330 Euro. Informationen zur Akademie sind auch auf der<br />
Internetseite des Landesschulrates http://bbf.lsr-noe.gv.at/<br />
erhältlich.<br />
Kursbeschreibungen Sommerakademie Semmering<br />
Kurs 1: »Ost-West-Dialog: Slawische und romanische<br />
Sprachen synchron«<br />
(Gemeinsam Sprachen lernen)<br />
In der ersten Hälfte des Kurses werden aktive Grundkenntnisse<br />
aus Russisch (Lese- und Schreibkompetenz, Minimalkonversation)<br />
und anhand von CD-ROMs und zahlreichen<br />
Aufschriften bescheidene passive Kenntnisse (Lese- und<br />
Verstehenskompetenz) in sechs anderen slawischen Sprachen<br />
(Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Kroatisch, Slowenisch,<br />
Bulgarisch) erworben. In der zweiten Hälfte des<br />
Kurses werden – zum Teil über die Arbeitssprache Englisch<br />
– unter Beisein eines spanischen Native Speaker aktive<br />
Grundkenntnisse aus Spanisch (Lese- und Schreibkompetenz,<br />
Minimalkonversation) und anhand von CD-ROMs<br />
und einigen Aufschriften passive Kenntnisse (bescheidene<br />
Rezeptivkompetenz) in drei anderen romanischen Sprachen<br />
(Französisch, Portugiesisch, Rumänisch) erworben.<br />
Somit ergibt sich eine optimale Möglichkeit der Interkomprehension<br />
und ein synergistischer Effekt der Verstehenskompetenz<br />
und Sprachanwendung für alle Kursteilnehmenden<br />
– unabhängig davon, ob Anfänger oder Fortgeschrittene.<br />
Es ist auch geplant, eine Vorlesung zur Didaktik der<br />
»Mehrsprachigkeit« am Slawistischen Institut der Universität<br />
Wien am 22.6. zu besuchen.<br />
Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die<br />
eine slawische und/oder romanische Sprache bereits in<br />
der Schule lernen bzw. im Kurs neu lernen wollen, und<br />
»Muttersprachler« diverser slawischer bzw. romanischer<br />
Sprachen, die über ihre Brückensprache andere verwandte<br />
Sprachen auf innovative Weise kennenlernen wollen.<br />
Kurs 2: »Aufschrei aus Unrecht – Die<br />
Auseinandersetzung mit Verstößen gegen<br />
Recht und Würde des Menschen in der<br />
Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts«<br />
(Deutsch/Literatur)<br />
Autoren aller Epochen schufen Erbauliches, Unterhaltsames<br />
oder Belehrendes, manche von ihnen sahen sich<br />
zudem als Mahner. Sie versuchten in ihren Werken meist<br />
eine fiktive Welt zu erschaffen, in der Unrecht aufgezeigt<br />
wird. Ein Unrecht, das auch im realen Umfeld herrscht,<br />
unbarmherziger als so manches Dichterhirn sich dies ausmalen<br />
kann. Dies betrifft nicht nur Kriege und bewaffnete<br />
Konflikte und beschränkt sich nicht auf die Bewältigung<br />
von Nationalsozialismus und Stalinismus. Auf allen Kontinenten<br />
der Erde werden Menschen nach wie vor gepeinigt<br />
und verfolgt, weil sie die Konformität mit den Machthabern<br />
und Herrschaftssystemen verweigern.<br />
Anhand ausgewählter Werke der Literatur, vor allem des<br />
20. und 21. Jahrhunderts, wird versucht, den Aufschrei der<br />
Unterdrückung herauszuhören beziehungsweise herauszulesen.<br />
In der Folge soll der Kontext zu den Hintergründen<br />
erforscht und mit diesen verglichen werden. Die Frage, inwieweit<br />
hinter Fiktion und Fantasie tatsächliche Nöte und<br />
Verstöße gegen Rechte und Würde der Menschen stehen,<br />
ist ein zentrales Anliegen des Kurses.<br />
Bitte nach Möglichkeit ein Notebook für die Kursarbeit<br />
mitnehmen.<br />
Kurs 3: »Die EU und Du: Recherchieren,<br />
Diskutieren, Präsentieren«<br />
(Rhetorik/Geschichte)<br />
In diesem Kurs sollen die Teilnehmenden ihre persönliche<br />
Wirkung und ihre Überzeugungskraft in Diskussionen,<br />
Vorträgen und Präsentationen steigern und mehr über die<br />
unbewusste Macht von Stimme, Sprache und Körpersprache<br />
erfahren.<br />
Sie erhalten konkretes Feedback und Anregungen zu ihrem<br />
Auftreten und der Art und Weise, wie sie Inhalte präsentieren.<br />
Praxisnah wird erarbeitet, wie Stimme, Sprechweise,<br />
Sprachgestaltung und persönliche Wirkung eingesetzt<br />
werden können, um Auftritte noch wirkungsvoller und<br />
ergebnissicherer zu gestalten und die Lust am Sprechen zu<br />
wecken.<br />
Inhaltlich werden wir uns dabei an einer Thematik orientieren,<br />
mit der sich in letzter Zeit die Politik und folglich<br />
auch die Medien tagtäglich auseinandergesetzt haben: »Die<br />
EU und Du.«
Seminarinhalt:<br />
� Die Wirkung von Stimme, Sprechweise und Körpersprache<br />
erfahren<br />
� Sicher, verständlich und klangvoll sprechen<br />
� Erfolgreiche Rhetorik: Ziel ist es, seine Wirkung und<br />
Überzeugungskraft zu steigern, Diskussions-, Gesprächsstrategien<br />
und Redekonzepte zu entwickeln,<br />
klar und verständlich wie auch kompetent zu sprechen.<br />
Es wird wahrnehmungsorientiert gearbeitet, Videoanalysen,<br />
Gruppen- und Trainerfeedback sichern eine hohe Anwendbarkeit<br />
der Lernergebnisse.<br />
Es ist daran gedacht, im Rahmen einer<br />
Exkursion nach Brüssel mit Mitgliedern<br />
der ständigen Vertretung Öster reichs und<br />
EU-Parlamentariern über das Thema dieses<br />
Kurses zu diskutieren.<br />
Dieser Kurs richtet sich an jene Interessierten,<br />
die an einer gezielten Weiterentwicklung<br />
ihres persönlichen und rhetorischen Auftretens<br />
sowie dem vertiefenden Kennenlernen<br />
von Strukturen und Mechanismen in der EU<br />
interessiert sind.<br />
Kurs 4: »Discuss with us – The Stage is Yours«<br />
(Englisch/Deutsch-Debattierklub)<br />
Man hat viel zu sagen! Es sprudelt nur so aus einem heraus!<br />
Jetzt sucht man eine Plattform, die einem Gehör<br />
verschafft. Man sucht Gleichgesinnte, mit denen man sich<br />
austauschen und messen kann. Super: Wir bieten all das!<br />
In diesem interdisziplinären Kurs kann man Methoden<br />
aus den Bereichen der Dramapädagogik und der Sprechtheorie<br />
kennenlernen, um seine Meinung effektiv an den<br />
Mann/an die Frau zu bringen. Ob zum Tagesgeschehen, zu<br />
Gesellschaftspolitik, Wissenschaft oder Ethik – die eigene<br />
Meinung ist wichtig!<br />
Man lernt, sich Gehör zu verschaffen, seine Position auf<br />
den Punkt zu bringen, seine Argumentation zu strukturieren<br />
und alle mit seinem souveränen Auftreten zu überzeugen.<br />
Kurs 5: »Gut oder böse? – Ethische Fallanalysen«<br />
(Philosophie)<br />
Die technisch-wissenschaftliche Rationalität unserer Zeit<br />
führt dazu, dass die Möglichkeiten des menschlichen<br />
Handelns immer mehr erweitert werden, ohne dass der<br />
größere Spielraum auch<br />
moralisch bedacht wird.<br />
Das, was man tun kann, ist<br />
aber nicht schon das, was<br />
man auch tun sollte. Daher<br />
wird die ethische Reflexion<br />
heute immer dringlicher,<br />
wenn neue moralische<br />
Problemfelder entstehen,<br />
z.B. in der Medizin (Klonen,<br />
Organtransplantation,<br />
Sterbehilfe usw.) und in<br />
anderen Bereichen der angewandten<br />
Ethik, wie in der Technikethik, Tierethik oder<br />
Umweltethik. Oft geht es um nichts weniger als den Verlust<br />
der Menschenwürde oder die Zerstörung des Ökosystems<br />
auf diesem Planeten.<br />
Im Philosophie-Kurs werden arbeitsteilig zu selbst gewählten<br />
Themen moralische Argumentationen anhand aktueller<br />
Fallbeispiele analysiert. Um die Frage zu beantworten, ob<br />
das Machbare auch gemacht werden soll, werden die ethischen<br />
Grundbegriffe auf der Grundlage einer allgemeinen<br />
Einführung in die Philosophie geklärt und die logischen<br />
Werkzeuge und gängigen ethischen Argumentationsmodelle<br />
eingesetzt. Eine solche ethische Reflexion ist heute notwendiger<br />
denn je, nicht zuletzt, um die Motive und Risiken<br />
der wissenschaftlich-technischen oder politisch-ökonomischen<br />
Möglichkeiten zu bewerten und so vielleicht deren<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
voreilige und oft irreversible Umsetzung zu verhindern.<br />
Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit, brisante ethische<br />
Probleme unserer Zeit kritisch zu diskutieren, ihre<br />
Argumentationsstruktur genau zu untersuchen, die Ergebnisse<br />
zu präsentieren und eigenständig (z.B. essayistisch)<br />
darüber zu »philosophieren«. Falls sich die Möglichkeit dazu<br />
ergibt, soll auch der interdisziplinäre Diskurs (z.B. mit<br />
dem Biologie-Kurs) gepflegt bzw. durch eine Exkursion zu<br />
einer Forschungseinrichtung vertieft und veranschaulicht<br />
werden.<br />
Der Kurs richtet sich an diskussionsfreudige Schülerinnen<br />
und Schüler, die sich über die Fachgrenzen hinaus mit aktuellen<br />
ethischen Problemen analytisch auseinandersetzen<br />
wollen.<br />
Kurs 6: » ... und Action! – Die Antike im Film«<br />
(Interdisziplinäres Latein-Lektüre-<br />
Filmprojekt)<br />
Anhand ausgewählter, im Regelunterricht üblicherweise<br />
nicht gelesener Texte werden verschiedene, die Antike<br />
betreffende Themenkreise aus historischer und kulturgeschichtlicher<br />
Sicht erarbeitet. Am Ende jedes Tages wird<br />
ein dazu passender Film vorgeführt, der – aus der Sicht<br />
Hollywoods – dasselbe Thema zeigt.<br />
Die Teilnehmenden werden darin geschult, den (absichtlichen<br />
oder unabsichtlichen) Ungenauigkeiten, Verzerrungen<br />
und falschen Darstellungen durch Regisseure und<br />
Filmstudios auf die Spur zu kommen und so legendäre<br />
Hollywood-Blockbuster neu zu erleben und dabei gleichzeitig<br />
viele unbekannte Details über die Antike zu erfahren.<br />
Geplante Filme:<br />
Quo Vadis (USA 1951), Ben Hur (USA 1959), Cleopatra<br />
(USA 1963), Gladiator (UK/USA 2000), Troja (USA/<br />
Malta/England 2004), 300 (USA 2007).<br />
–– 105
106 ––<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
Kurs 7: »Digitale Bildbearbeitung, 3D-Grafik und<br />
Animation – reale und virtuelle Welten«<br />
(Bildnerische Erziehung/Mediendesign)<br />
Der Kurs beschäftigt sich zunächst mit der Digitalfotografie,<br />
wobei die Aufnahmetechnik im selbst gebauten Studio<br />
im Mittelpunkt steht. Der zweite Schwerpunkt ist die<br />
Schaffung von virtuellen Welten mit Hilfe der 3D-Compu-<br />
tergrafik. Beim abschließenden Compositing werden die<br />
realen Personen oder Gegenstände mit Hilfe professioneller<br />
Bildbearbeitung mit den Computergrafiken zusammengeführt.<br />
Ein dritter Schwerpunkt des Kurses befasst sich mit<br />
Animationstechniken (Stop-Motion- und Computeranimation).<br />
Beispiele aus Kunst, Geschichte und Werbung sollen zu<br />
der Frage überleiten: Kann man Bildern trauen? Wo endet<br />
Dokumentation bzw. wo beginnt Manipulation? Wann<br />
sind Bilder Kunst? Eine Videodokumentation soll den Kurs<br />
begleiten. Eigene Digitalfotoapparate (und Notebooks) der<br />
Teilnehmenden sind willkommen, aber nicht unbedingt<br />
erforderlich. Computergrundkenntnisse werden vorausgesetzt.<br />
Ein Kursskriptum wird an die Teilnehmenden ausgegeben.<br />
Fachliteratur und Trainings-DVDs stellt der Kursleiter für<br />
die Dauer des Kurses zur Verfügung.<br />
Willkommen sind alle am Thema Interessierten, die sich<br />
dann auch auf einen abwechslungsreichen und intensiven<br />
Kurs freuen können.<br />
Kurs 8: Physik<br />
Das Austrian Young Physicists’ Tournament (AYPT) ist ein<br />
nationaler, teamorientierter, wissenschaftlicher Wettbewerb<br />
zwischen Schüler/innen-Teams. Die besten Schüler/innen<br />
vertreten als Nationalteam Österreich beim IYPT (International<br />
Young Physicists’ Tournament). Im Rahmen dieses<br />
Wettbewerbs präsentieren und diskutieren Schüler/innen-<br />
Teams ihre Ergebnisse zu wissenschaftlichen Aufgabenstellungen,<br />
an denen sie zuvor etwa ein halbes Jahr gearbeitet<br />
haben. Die Präsentation, wie auch die Verteidigung der<br />
Lösung in der Diskussion wird von einer Jury, bestehend<br />
aus internationalen Experten, bewertet.<br />
Der Kurs dient als Vorbereitung für die Teilnahme am AYPT<br />
2013. Die besten Teilnehmenden dürfen Österreich beim<br />
internationalen Wettbewerb (IYPT) 2014 vertreten.<br />
Während der Sommerakademie <strong>2012</strong> wird im Team an<br />
AYPT Aufgaben gearbeitet, sich Wissen angeeignet und<br />
dieses Wissen bei wissenschaftlichen Problemstellungen<br />
sowie in der Diskussion von Aufgaben anderer Teams angewendet.<br />
Über eine elektronische Plattform wird dann im<br />
folgenden Schuljahr die Zusammenarbeit im Team unter<br />
der Betreuung der Kursleiterin fortgesetzt. Zeitnah zum<br />
Wettbewerb ist auch ein zwei- bis dreitätiges Präsenztreffen<br />
der Wettbewerbsteilnehmenden geplant.<br />
Die offene Art der »AYPT Problems« bietet einen Einstieg in<br />
die wissenschaftlichen Arbeitsweisen der Forschung. Man<br />
lernt, einen Zugang zu bisher unbekannten Problemstellungen<br />
zu finden. Ein weiterer wichtiger Aspekt des AYPT<br />
ist auch die Rhetorik. Es ist wichtig die vorbereiteten Lösungen<br />
und Ergebnisse in überzeugender und eindrucksvoller<br />
Art und Weise zu präsentieren. Darüber hinaus ist<br />
eine gewisse Spontanität erforderlich, um in der Lage zu<br />
sein, binnen sehr kurzer Vorbereitungszeit eine Kritik-Rede<br />
und anschließende Diskussion mit dem Gegner vorzubereiten.<br />
Das AYPT bietet die Gelegenheit zu üben, wie man sich<br />
und seine Sache am besten »verkauft«.<br />
Da das AYPT vollständig in Englisch abgewickelt wird und<br />
daher im Kurs auch Englisch als Arbeitssprache verwendet<br />
wird, werden damit auch die Fremdsprachenfähigkeiten<br />
gefördert und trainiert. Insbesondere eignet man sich<br />
fremdsprachliches Fach-Vokabular an, was im gewöhnlichen<br />
Englischunterricht nur sehr selten der Fall ist.<br />
Kurs 9: »Vom Gen zur Gentechnologie« (Biologie)<br />
Immer wieder hört und liest man von den möglichen Risiken<br />
der Gentechnologie. Die Meinungen der Befürworter<br />
und der Gegner prallen hier häufig aufeinander. Wenn man<br />
fragt, was Gentechnologie eigentlich ist, muss man immer<br />
wieder feststellen, dass das Wissen darüber bei großen Teilen<br />
der Bevölkerung äußerst dürftig ist. Wir wollen uns daher<br />
mit einer Reihe von Fragen zur Gentechnologie intensiv<br />
beschäftigen:<br />
� Was ist die DNA und wie ist sie chemisch aufgebaut?<br />
� Was ist ein Gen? Wozu brauchen wir es?
� Was sind Erbkrankheiten? Wie wirken sich Veränderungen<br />
der Gene auf den Menschen aus?<br />
Nach den Grundlagen geht es in die Tiefe. Wir werden<br />
uns mit den Methoden und Verfahren der Gentechnologie<br />
beschäftigen:<br />
� Was sind Plasmide und wozu setzt man sie ein?<br />
� Was sind Restriktionsenzyme und wie kann man damit<br />
die DNA schneiden?<br />
� Was ist Klonieren? Wie unterscheidet es sich vom<br />
Klonen?<br />
� Wie kann man mit der PCR die DNA vervielfältigen<br />
und anschließend sichtbar machen?<br />
Im Kurs soll es aber nicht nur um die Verfahren gehen,<br />
sondern auch um die Anwendungen. Was ist heute technisch<br />
möglich? Was von den Möglichkeiten darf oder soll<br />
man auch wirklich anwenden? Sind gentechnisch veränderte<br />
Lebensmittel wirklich gefährlich?<br />
Geplant ist auch das praktische Arbeiten im Labor der<br />
Universität Graz. Dort werden die Kursteilnehmenden die<br />
Möglichkeit haben, die wichtigsten Verfahren der Gentechnologie<br />
selbst durchzuführen.<br />
Der Kurs richtet sich an Teilnehmende, die ihre Meinung<br />
zur Gentechnologie nicht nur aus den Tageszeitungen<br />
holen wollen, sondern die mehr darüber wissen wollen<br />
und die auch keine Scheu haben, im Labor praktisch zu<br />
arbeiten.<br />
Kurs 10: » Von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden – oder warum<br />
Technik nicht langweilig sein muss«<br />
(Fahrzeugtechnik)<br />
Das Studium der Fahrzeugtechnik bietet nicht nur eine<br />
fundierte praxisnahe Ausbildung, sondern lässt auch Emotionen<br />
und Spaß nicht zu kurz kommen.<br />
Man wird sich im Rahmen des Kurses vom Mittwoch bis<br />
zum Sonntag am Semmering mit einigen Punkten der<br />
Theorie zum KFZ wie zum Beispiel Mechanik, Festigkeit,<br />
Elektrizitätslehre, Thermodynamik aber auch mit dem Motor<br />
und der Fahrdynamik beschäftigen. Um jedoch ein ausgewogenes<br />
Verhältnis von Praxis und Theorie zu erreichen,<br />
sollen grundlegende physikalische Inhalte mit einer Reihe<br />
von Experimenten überprüft werden.<br />
Kernpunkt des Kurses ist jedoch die dreitägige Exkursion<br />
zum Joanneum nach Graz, wo die technischen Einrichtungen<br />
und Laboratorien besucht werden. Außerdem ist<br />
ein Treffen mit Studenten geplant, die an der »Formula<br />
Student« – einem internationalen Wettbewerb für Nachwuchsingenieure<br />
– mitmachen und uns natürlich auch ihr<br />
Rennauto zeigen werden.<br />
Mittlerweile konstruiert und baut das joanneum racing<br />
team sein neuntes Auto, um sich damit unter anderem in<br />
Silverstone und am Hockenheimring mit der Konkurrenz<br />
zu messen. Dabei geht es nicht nur um Beschleunigung<br />
und Geschwindigkeit, sondern auch um Fahrsicherheit<br />
und Verbrauch und nicht zuletzt um den heiß begehrten<br />
Sieg im Konstruktionswettbewerb.<br />
Kurs 11: »Ressourcenknappheit und Finanzkrise.<br />
Können Wirtschaft und Technik die<br />
aktuellen Herausforderungen bewältigen?«<br />
(Wirtschaft/Technik)<br />
Energiekrise, Finanzkrise, Eurokrise – unsere Welt scheint<br />
in der Krise zu sein. Doch ist sie das wirklich? Die Erde<br />
bietet genug Nahrung für über 10 Milliarden Menschen,<br />
gleichzeitig genießen die Menschen die höchste Lebenserwartung<br />
aller Zeiten. Es scheint uns doch gut zu gehen,<br />
oder?<br />
Die Menschheit verbraucht immer schneller immer mehr<br />
Ressourcen, als die Erde dauerhaft zur Verfügung stellen<br />
kann. Fortschrittliche Technik und die damit verbundene<br />
erhöhte Effizienz werden gerne als Allheilmittel für dieses<br />
Dilemma gesehen. Doch oft führen moderne Technologien<br />
zur Entwicklung neuer Produkte, welche zusätzliche<br />
PROGRAMME IM AUSLAND <strong>2012</strong><br />
Bedürfnisse im Konsumenten wecken. Die Finanzinstitutionen<br />
erleichtern deren Erfüllung durch immer kreativere<br />
Finanzprodukte.<br />
�� Haben viele Volkswirtschaften jahrelang über ihre<br />
Verhältnisse gelebt und dadurch die derzeitigen Krisen<br />
verursacht?<br />
�� Kann die Versorgung von über 10 Milliarden Menschen<br />
mit Energie, Nahrung und Wasser auf nachhaltige<br />
Weise erfolgen?<br />
�� Woher kommt das Geld und warum hat es einen<br />
Wert?<br />
�� Wie kam es zur Finanzkrise und warum sprach man<br />
zuerst nur von einer Immobilienkrise?<br />
�� Ist mehr Technik immer besser und wie viel Technik<br />
braucht der Mensch wirklich?<br />
�� Warum musste der durchschnittliche <strong>Deutsche</strong> 1970<br />
noch 96 Minuten für 1 kg Schweinekotelett arbeiten<br />
und heute nur mehr 23 Minuten?<br />
Man maßt sich nicht an, Antworten auf all diese Fragen<br />
zu haben. Das Ziel des Kurses besteht darin, aktuelle Entwicklungen<br />
kritisch zu hinterfragen, deren Ursachen zu erforschen<br />
und Lösungsansätze zu entwickeln. So sollen die<br />
Teilnehmenden persönliche Antworten auf diese wichtigen<br />
und dringenden Fragen finden. Diskussionsrunden mit<br />
Gastreferenten zu ausgewählten Themen sowie zwei Exkursionstage<br />
ergänzen das Kursangebot.<br />
–– 107
NACH DEN AKADEMIEN GEHT ES WEITER! CLUB DER EHEMALIGEN E.V.<br />
Club der Ehemaligen<br />
der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>n e.V. (CdE e.V.)<br />
Auch in diesem Jahr haben alle Teilnehmenden einer <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>SchülerAkademie</strong> (<strong>DSA</strong>) Gelegenheit, zweieinhalb<br />
Wochen Akademie mitzuerleben und mitzugestalten. Sie<br />
werden dabei Projekte bearbeiten, interessante Menschen<br />
kennen lernen und über die Kursarbeit hinaus sich gemeinsam<br />
Theater, Sport, Chor, Orchester und vielen anderen<br />
kursübergreifenden Aktivitäten widmen. Dieser inhaltliche<br />
und persönliche Austausch muss nicht auf die Zeit<br />
der Akademie beschränkt bleiben. Um den Teilnehmenden<br />
die Möglichkeit zu geben, auch über das Erlebte hinaus in<br />
regen Kontakt mit interessierten Schülerinnen, Schülern,<br />
Studierenden und Berufstätigen aus ganz Deutschland und<br />
vielen anderen Ländern zu treten, wurde der Club der Ehemaligen<br />
der <strong>Deutsche</strong>n <strong>SchülerAkademie</strong>n (CdE e. V.) ins<br />
Leben gerufen.<br />
Der Verein ist ein lebendiges Forum für Aktivitäten, Diskussionen,<br />
Bekanntschaften – in Deutschland und der<br />
Welt! Der CdE bietet seinen Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten,<br />
eigene Ideen einzubringen und zusammen mit<br />
anderen jungen Menschen umzusetzen.<br />
Zu seinen Angeboten zählen:<br />
Hauptsächlich veranstaltet der CdE Akademien: Jedes Jahr<br />
gibt es eine PfingstAkademie mit einer Vielzahl interessanter<br />
Kurse und viel Raum für inhaltlichen Austausch,<br />
Clubinterna und persönliche Kontakte. Knapp 400 Teilnehmende<br />
werden im Mai <strong>2012</strong> in Kirchheim (bei Bad<br />
Hersfeld) von anderen Ehemaligen angebotene Kurse besuchen<br />
und Akademie-Atmosphäre aufleben lassen.<br />
Ferner werden auch SommerAkademien veranstaltet. Über<br />
100 Teilnehmer werden sich eine Woche lang wie auf<br />
108 ––<br />
einer <strong>SchülerAkademie</strong> fühlen können: Es gibt intensive<br />
Kursarbeit mit kursübergreifenden Aktivitäten und viel<br />
Zeit für nette Leute. Auch über Neujahr gibt es seit sechs<br />
Jahren eine – ebenfalls einwöchige – WinterAkademie. Und<br />
seit 2009 gibt es sogar eine Multinationale Akademie, wo<br />
sich die Ehemaligen der Multinationalen <strong>DSA</strong>s für einige<br />
Tage in einem osteuropäischen Land treffen. Über den<br />
CdE laufen zudem noch viele weitere Veranstaltungen, wie<br />
zum Beispiel: wissenschaftliche Seminare, Musik-, und Skifreizeiten.<br />
Zweimal im Jahr erscheint der exPuls, das offizielle Mitteilungsorgan<br />
des CdE mit vereinsinternen Informationen<br />
und Ankündigungen, Berichten, Diskussionen und Fotos,<br />
sowie Artikeln von CdElern: Jeder ist herzlich eingeladen,<br />
dazu beizutragen. Im CdElokal treffen sich in zahlreichen<br />
Städten regelmäßig CdEler zu verschiedenen Aktivitäten in<br />
ungezwungener Atmosphäre. Gerade für Studienanfänger<br />
sind diese Lokalgruppen interessant: So lassen sich leicht<br />
Kontakte am neuen Hochschulort knüpfen!<br />
Unter der Adresse<br />
http://www.cde-ev.de/<br />
gibt es ein umfangreiches Internet-Angebot – unter anderem<br />
mit aktuellen Informationen zum CdE, seinen Angeboten<br />
und vor allem einer Adressdatenbank.<br />
Die <strong>DSA</strong>-Mailingliste bietet ihren Abonnenten ein offenes<br />
Forum für den Austausch von Informationen und Meinungen.<br />
Wer hier eingetragen ist, kann mit einer Mail Hunderte<br />
von CdElern auf einmal erreichen. Spannende Diskussionen<br />
garantiert!<br />
Diese Angebote stehen allen offen, die an einer <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>SchülerAkademie</strong> teilgenommen haben oder vorgeschlagen<br />
wurden. Bis zum Ende ihres Teilnahmejahres sind ehemalige<br />
Akademieteilnehmer automatisch Mitglieder im CdE<br />
und erhalten ein Exemplar des exPuls zugeschickt. Von<br />
allen, die länger im CdE bleiben wollen, erbitten wir (namentlich<br />
zur Finanzierung des exPuls) einen Mitgliedsbeitrag<br />
von 2,50 Euro je Halbjahr. Nähere Informationen gibt<br />
es hierzu im exPuls sowie unter http://www.cde-ev.de.<br />
Die Akademie ist der Anfang, im CdE geht es weiter!<br />
Ansprechpartner des CdE<br />
Vorstand des CdE<br />
vorstand@cde-ev.de<br />
Olga Heismann, Hanno Kamp (Außenvorstand)<br />
Viktoria Ronge, Christine Toman (Innenvorstand)<br />
David Lorch (Kassenwart)<br />
CdE-lokal<br />
cdelokal@schuelerakademie.de<br />
Daniel Hümmer, Jost Migenda, Maike Paetzel,<br />
Anna Wieshammer<br />
Mitgliederverwaltung<br />
verwaltung@cde-ev.de<br />
Christina Cappenberg, Juwita Hübner,<br />
Silke Pohl, Sina Weber
Ziele<br />
Bildung & Begabung, das Zentrum für Begabungsförderung<br />
in Deutschland, bündelt mit seinen Akademien und Wettbewerben<br />
ein vielfältiges Förderangebot für junge Talente, bietet<br />
umfassende Informationsangebote und setzt sich in der Begabungsförderung<br />
für Vernetzung und Transparenz ein. Mit seinen<br />
Projekten erreicht Bildung & Begabung jedes Jahr mehr<br />
als 240.000 talentierte und motivierte junge Menschen.<br />
Bildung & Begabung ist eine zentrale Anlaufstelle für Eltern,<br />
Lehrer und Förderer begabter junger Menschen. Sie können<br />
sich zum Beispiel online über Förderangebote, Beratungsstellen<br />
oder schulische Praxisbeispiele informieren. Der Begabungslotse<br />
von Bildung & Begabung (www.begabungslotse.de)<br />
ist für diese Themen ein Wegweiser für ganz Deutschland.<br />
Bildung & Begabung möchte dafür sorgen, dass Talente zukünftig<br />
in allen sozialen Herkunftsgruppen erkannt und gefördert<br />
werden. Deshalb hat Bildung & Begabung Projekte<br />
gestartet, die sich insbesondere auch an junge Menschen mit<br />
Zuwanderungsgeschichte richten.<br />
Schülerwettbewerbe<br />
Um Talente im Schulalter zu wecken und herauszufordern,<br />
bietet Bildung & Begabung Schülerwettbewerbe an, die zu den<br />
traditionsreichsten in Deutschland gehören. Die besten und<br />
engagiertesten Teilnehmer werden über den Wettbewerb hinaus<br />
gefördert und können sich auf attraktive Preise freuen.<br />
Dazu zählen Stipendien, Sprachreisen oder Praktika.<br />
Zum Angebot von Bildung & Begabung gehören der Bundeswettbewerb<br />
Mathematik und der Bundeswettbewerb Fremdsprachen.<br />
Darüber hinaus organisiert Bildung & Begabung den<br />
Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade<br />
(IMO) und führt in Zusammenarbeit mit den Mathematik-<br />
Bildung & Begabung: Talente für Deutschland<br />
Olympiaden e.V. die Geschäftsstelle der <strong>Deutsche</strong>n Mathematik-<br />
Olympiade. Mit »Jugend trainiert Mathematik« bereitet Bildung<br />
& Begabung besonders gute Nachwuchs-Mathematiker auf internationale<br />
Wettbewerbe wie die IMO vor.<br />
Zahlreiche Sieger der Wettbewerbe von Bildung & Begabung<br />
werden mit einem Bundessieg in die Studienstiftung<br />
des deutschen Volkes aufgenommen. Darüber hinaus führen<br />
Austauschprogramme die Wettbewerbssieger zu Zielen in<br />
der ganzen Welt, wo sie an akademischen <strong>Programm</strong>en oder<br />
Sprachkursen teilnehmen können.<br />
Fördermaßnahmen<br />
Die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong> (<strong>DSA</strong>) bringt in jedem Sommer<br />
motivierte und engagierte Schüler mit den unterschiedlichsten<br />
Talenten zusammen, die 16 Tage lang gemeinsam spannende<br />
Themen bearbeiten. Junge Menschen, die sich erfolgreich an<br />
Wettbewerben beteiligt haben, die von ihrer Schule empfohlen<br />
worden sind oder die ihr besonderes Leistungsvermögen<br />
auf andere Weise unter Beweis gestellt haben, erfahren dort<br />
im Kreise von ähnlich Befähigten und Interessierten und unter<br />
der Anleitung von Experten aus Schule, Hochschule und Wirtschaft<br />
eine intensive fachliche und persönliche Förderung. Seit<br />
2003 werden auch Akademien für Schülerinnen und Schüler<br />
der Sekundarstufe I (<strong>Deutsche</strong> JuniorAkademien) sowie Akademien<br />
mit Teilnehmenden aus verschiedenen mittel- und osteuropäischen<br />
Ländern (Multinationale Akademien, gefördert von<br />
der Haniel Stiftung) durchgeführt.<br />
Mit der VorbilderAkademie richtet sich Bildung & Begabung<br />
seit 2011 speziell an talentierte und begeisterungsfähige junge<br />
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Die Akademie soll<br />
den Teilnehmern dabei helfen, eigene Talente und Chancen zu<br />
erkennen und Ressourcen zu aktivieren. Sie will Wissen über<br />
das Bildungssystem vermitteln und die Jugendlichen dabei unterstützen,<br />
mögliche Bildungswege für sich zu identifizieren.<br />
Informationsangebote und Veranstaltungen<br />
Mit dem Begabungslotsen (www.begabungslotse.de) bietet<br />
Bildung & Begabung das größte Informationsportal rund um<br />
alle Fragen der Talentförderung in Deutschland an. Der Begabungslotse<br />
deckt das vielfältige Spektrum der Begabungsförderung<br />
und Talententwicklung ab. Dazu gehört die Beratungsstelle<br />
in München ebenso wie das Frühstudium in Frankfurt<br />
oder der Schülerwettbewerb in Berlin. Den Kern des Begabungslotsen<br />
bildet eine bundesweite Datenbank, die sich sowohl<br />
thematisch als auch geografisch durchsuchen lässt.<br />
Mit Fachtagungen und Seminaren vernetzt Bildung & Begabung<br />
Lehrer, Eltern sowie Wissenschaftler und Praktiker in<br />
der Begabungsförderung. Die Veranstaltungen sollen der Begabungsförderung<br />
in Deutschland neue Impulse geben.<br />
Träger und Förderer<br />
Bildung & Begabung wurde 1985 auf Initiative des Stifterverbandes<br />
für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft gegründet und wird<br />
bis heute maßgeblich vom Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung (BMBF) und vom Stifterverband finanziert. Weitere<br />
Partner von Bildung & Begabung sind die Bundesländer, Stiftungen,<br />
Unternehmen und private Geldgeber. Schirmherr von<br />
Bildung & Begabung ist der Bundespräsident.<br />
Ein Kuratorium berät Bildung & Begabung in allen Fragen seines<br />
Tätigkeitsbereichs und beschließt die einzelnen Maßnahmen.<br />
Im Kuratorium sind vertreten: das Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung, die Kultusministerkonferenz, der Stifterverband<br />
für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft sowie die Wirtschaft, das<br />
Stiftungswesen und die Wissenschaft.<br />
Bildung & Begabung online: www.bildung-und-begabung.de<br />
Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH<br />
Kortrijker Straße 1, 53177 Bonn<br />
Tel. 02 28 / 9 59 15 10 – Fax 02 28 / 9 59 15 19<br />
info@bildung-und-begabung.de<br />
–– 109
Zum Schluss ein herzliches<br />
Dankeschön …<br />
… den folgenden Institutionen und Personen für ihre<br />
Hilfe und Unterstützung, ohne die die Durchführung<br />
der Akademien nicht möglich wäre:<br />
– Bundesministerium für Bildung und Forschung,<br />
Berlin<br />
– Stifterverband für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft,<br />
Essen<br />
– Haniel Stiftung, Duisburg<br />
– Claussen-Simon-Stiftung, Hamburg<br />
– BASF AG, Ludwigshafen<br />
– Reuter'sche Stiftung, Essen<br />
– Johs. Kölln-Stiftung, Essen<br />
– Fonds der Chemischen Industrie, Frankfurt a.M.<br />
– Marianne und Emil Lux Stiftung, Remscheid<br />
– Rotary Club Remscheid<br />
– Edith und Carl Otto Weise-Stiftung, Frankfurt a.M.<br />
– Christine Diek-Stiftung, Frankfurt a.M.<br />
– Sondervermögen Bein, Essen<br />
– Merck KGaA, Darmstadt<br />
– preVent GmbH, Limeshain<br />
– Maplesoft Europe GmbH, Aachen<br />
– Schach Niggemann, Heiden<br />
– Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,<br />
Frankfurt a.M.<br />
– Süddeutsche Zeitung GmbH, München<br />
– Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH Co. KG, Hamburg<br />
– Carl-Zeiss-Jena GmbH, Jena<br />
– Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen<br />
– LD Systeme AG & Co. KG, Hürth<br />
– Sartorius AG, Göttingen<br />
– Gilson, Bad Camberg<br />
– Carl Roth GmbH+Co. KG, Karlsruhe<br />
– Verlag C. H. Beck oHG, München<br />
– Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH,<br />
Heidelberg<br />
110 ––<br />
– CJD Christophorusschule Braunschweig,<br />
Braunschweig<br />
– Gymnasium und Internat des Landschulheims<br />
Grovesmühle, Veckenstedt<br />
– Urspringschule, Schelklingen<br />
– Evangelisches Schulzentrum Hilden, Hilden<br />
– CJD Christophorusschule Rostock, Rostock<br />
– Privates Internatsgymnasium Schloss Torgelow,<br />
Torgelow<br />
– Europäisches Gymnasium Waldenburg, Waldenburg<br />
– Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland,<br />
Papenburg<br />
Darüber hinaus wurde die <strong>Deutsche</strong> <strong>SchülerAkademie</strong><br />
mit Spenden von Eltern u.a. unterstützt:<br />
Jörg-Martin und Lieselotte Abels, Bad Berleburg; Michael<br />
Adams, Offenbach/Main; Monika Adler, Wallerfangen; Dr.<br />
Wera Ahn-Roth, Bonn; Wilhelm und Anja Alfke, Bassum; Josef<br />
Altmeppen, Haselünne; Eugen-Rudolf Ancke, Weinbach; Thomas<br />
Armbruster, Kornwestheim; Christoph Bach, Würselen;<br />
Hans-Jürgen Bach, Neumünster; Klaus Badenhoop, Mannheim;<br />
Ali Bajawi, Heidelberg; Richard und Gabriele Bamler,<br />
Gilching; Gerlinde Barna, Bietigheim-Bissingen; Cornelia Barrelet,<br />
Pinneberg; Michael Becker, Bilkheim; Dr. Uwe und Heidrun<br />
Becker, Bad Malente-Gremsmühlen; Ilse Beckmann,<br />
Horst; Dr. Frank und Ines Benkert, Leipzig; Andreas und Petra<br />
Berge, Weissach; Thomas und Sabine Berwanger, Nonnweiler;<br />
Bernhard Berwian, Lebach; Dr. Gerhard und Eva Bittner, Erlangen;<br />
Dr. Wilfried Blotenberg, Dinslaken; Wolfgang Blümel,<br />
Ebersdorf; Manfred Bockius, Ingelheim; Dr. Adalbert Boczek<br />
und Elke Siegmann, Rinteln; Elke Bodenstedt, Filderstadt; Roswitha<br />
Bodenstein-Lukate, Mannheim; Dr. Ellen Böhm, Hannover;<br />
Martina Böhme-Götz, Ilsfeld; Martina Böhme-Götz, Ilsfeld;<br />
Andrea Böhringer, Berlin; Dr. Peter Braun, Germering;<br />
Klaus-Dieter Breuer, Bochum; Christoph und Elke Briegleb,<br />
Würzburg; Dr. Eberhard Brosi und Esther Muffler-Brosi, Überlingen;<br />
Gerhard Bruns, Oberndorf a.N.; Klaus Büchler, München;<br />
John Buckley, Reading; Monika Büter, Herford; Birgit<br />
Buttler, Marl; Klaus Byrohl, Hameln; Jürgen Chlumsky, Niedernhausen;<br />
Klaus-Martin Christ, Erfurt; Josefine Clahsen,<br />
Baesweiler; Sybille Claus, Wernigerode; Karin Dänecke-Barkhofen,<br />
Krefeld; Joachim und Sigrid Daubner, Backnang; Stefan<br />
Dick, Baienfurt; Herbert Diemer, Weichtungen; Dr. Gerhard<br />
Dietel, Regensburg; Christian und Barbara Düsel, Vilsbiburg;<br />
Renate Dylla, Herbrechtingen; Iris Ebel-Philippi, Köln; Harmen<br />
und Irene Eckert, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Wilfried<br />
Eckert, Mainz; Bertolt und Sabine Eicke, Berlin; Dr. Olaf Enge-<br />
Rosenblatt, Hainichen; Dr. Leo Englert, Kehl; Rita Erhardt-<br />
Mandry, Lauchheim; Andreas Ernst, Weinheim; Werner Ettel,<br />
Schwäbisch Gmünd; Marcus Fähnle, Mannheim; Reinhard<br />
Faßhauer, Langenhagen; Matthias und Ulrike Feindler, Wuppertal;<br />
Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt; Christian Fendt, Bamberg;<br />
Dirk Feuerherdt, Norderstedt; Dr. Heinrich A. Fichter,<br />
Frankfurt a.M.; Thomas und Gabriele Fiebiger, Ingolstadt;<br />
Marcus und Christina Fiekas, Osterode; Jens-Peter und Birgit<br />
Finke, Aschersleben; Detmer Fischbeck, Aurich; Heiderose Fischer,<br />
Bruchsal; Thomas Flad, Albstadt; Thomas Fleckenstein,<br />
Frankenthal; Nikolai Forstbauer, Stuttgart; Ingo und Andrea<br />
Frenzel, Luckau, OT Schlabendorf; Ludmilla Fuhrmann, Stuttgart;<br />
Jürgen und Astrid Funkhänel, Donaueschingen; Elisabeth<br />
Gabele, Regensburg; Wolfgang und Helga Gebert, Hamburg;<br />
Hubert und Erika Gerke, Beverungen; Dr. Jürgen Gernert,<br />
Großrinderfeld; Sophia Gernert, Großrinderfeld; Thomas und<br />
Ilse Geulig, Bietigheim; Dr. Bernd und Angela Gewiese, Straubenhardt;<br />
Hans-Michael und Almut Giesen, Berlin; Jürgen Gilcher,<br />
Buborn; Patricio Gómez de Larrain, Hamburg; Klaus und<br />
Martina Goyke, Hagen; Katja Graf, Frankenthal; Dr. Clemens<br />
Graf von Looz-Corswarem, Köln; Markus und Ludgera Graw,<br />
Schönau; Dr. Axel Größer und Dr. Gisela Wagner-Größer, Altötting;<br />
Manfred Grundei, Rohrdorf; Dr. Dietrich Gundert und<br />
Dr. Ursula Gundert-Remy, Berlin; Yike Guo, Darmstadt; Barbara<br />
Gutsch, Lauta; Karl Gutzweiler, Rastatt; Karol und Antonina<br />
Guzek, Bamberg; Dr. Stefan Haberland, Dorfen; Heike Habermann-Langer,<br />
Berlin; Robert Hahn, Warendorf; Thorsten Hahn<br />
und Susan Tiedt, Neustadt; Willi Hahn, Schwetzingen; Klaus<br />
Haller und Erika Luck-Haller, Bonn; Johanna Hallermeier, Auerbach;<br />
Cornelia Händchen, Aerzen; Andreas und Simone<br />
Hanke, Meuselwitz; Peter und Annette Hanke, Karlsruhe; Gisela<br />
Hanl, Wernigerode; Wolfgang Hatzel, Paderborn; Dr. Wer-
ner Hauck, Landstuhl; Ulrich Haumering, Kempen; Prof. Dr.<br />
Bernhard und Margarete Hauser, München; Herr Häusler und<br />
Frau Schmeing-Häusler, Ottobrunn; Nils Heblich-Menke, Bad<br />
Kreuznach; Peter und Sabine Hefter, Forchheim; Karlheinz<br />
Heitmüller-Faltinat, Frankfurt; Dr. Thomas und Gertraude<br />
Helmer, Gomadingen; Dr. Harald Hemm, Landstuhl; Ortwin<br />
Herbst, Grünstadt; Peter und Elisabeth Herdegen, Bischberg;<br />
Sylvia und Ralf Hereth, Coburg; Michael Herrmann, Bielefeld;<br />
Marlu Herrmann-Horter, Mainz-Laubenheim; Dr. Gregor und<br />
Dr. Eva Christine Hess, Worms; Manfred Hofmann, Odernheim;<br />
Dr. Dieter Hohberger, Frankfurt; Dr. Paul Hölsch, Waldkirch;<br />
Dieter Hoss, Essen; Dr. Rüdiger Hossiep, Bochum;<br />
Hans-Dieter und Gisela Howahl, Issum; Monika Huber, St.-Johann;<br />
Iris Hugendieck, Rheine; Martina Huß, Heiligenberg;<br />
Stephanie Isensee, Pforzheim; Karsten und Kirsten Jablonka,<br />
Bremen; Karl-Heinz und Bettina Jäckel, Jena; Birgit Jäger, Baden-Baden;<br />
Birgit Jäger, Baden-Baden; Martin Jakisch, Hamburg;<br />
Dr. Werner Jann, Potsdam; Egon Kaletsch, Wettenberg;<br />
Klaus und Ulrike Kaltenbach, Kißlegg; Bettina Kalthoff, Lippstadt;<br />
Dr. Manfred und Gisela Kalz, Neuruppin; Volker Kandziora,<br />
Weil am Rhein; Wolfgang Kasprzik, Tübingen; Sandra<br />
Kerber, Weinheim; Sigrid Kern, Möckmühl; Karola Kess-Knell,<br />
Berlin; Helmut und Renate Keus, Essen; Manfred Kickert,<br />
Konz; Christoph und Silke Kiefer, Korbach; Thomas und Petra<br />
Kilian, Otterstadt; Susanne Kiparski, Hamm; Klaus und Gudrun<br />
Klas, Wöllstadt; Lambert Kleesattel, Wesseling; Karin<br />
Klein, Konradsreuth; Herr Klene und Frau Heiler-Klene, Wilhelmshaven;<br />
Andreas Klose, Hattingen; Heinrich Knee, Stuttgart;<br />
Dr. Franz und Gabriele Knott, München; Dr. Helge Kober,<br />
Altrip; Dr. Karin Koch, Dudenhofen; Eberhard Kölble,<br />
Ispringen; Ewald Kolkhorst, Rahden; Lotte Kolliver, Herzogenrath;<br />
Winfried Königsdorf, Gründau; Wolfgang Koppenhöfer,<br />
Pfinztal; Klaus Krah, Bremen; Helmut Krall, Bürstadt; Stefan<br />
Krasulsky, Cottbus; Herr und Frau Dr. Kreissl, Gifhorn; Dieter<br />
Kress, Oberasbach; Peter Kreutz, Stolberg; Heinz-Georg Kriener,<br />
Schutterwald; Manuela Krischker, Petershagen; Armin<br />
und Beate Krug, Scheinfeld; Ulrich und Nelly Kübler, Ilsfeld;<br />
Matthias Küchle, Ettenheim; Walter und Lubow Kuhlmann,<br />
Neubulach; Gabriele Kuklinski, Köln; Elmar Kulke, Lehrte;<br />
Ulrike Kursch, Coburg-Ketschendorf; Christoph Lammersdorf,<br />
Mainz; Josef Landstorfer, Amberg; Ulrich Lange, Bad Salzuflen;<br />
Hans-Jürgen Lankeit, Bad Arolsen; Jürgen und Sabine Lanzendorfer,<br />
Pfinztal; Frau C. Lassalle-Bornickel, Hildesheim; Kerstin<br />
Lau, Neu-Anspach; Eva Leidescher-Blaschke, Esslingen; Alfred<br />
und Petra Leisen, Sehlem; Bernd Leist, Illingen; Helmut<br />
Lermer, Ludwigshafen-Gartenstadt; Leutron Vision-Systemhaus<br />
für Bildverarbeitung GmbH, Konstanz; Giuseppe und<br />
Marisa Lico, Viernheim; Gerhard Liebrich, Frankenthal; Tanja<br />
Liedtke, Korbach; Werner Lieret, Schwabmünchen; Bruno und<br />
Gabriele Linn, Geisenfeld; Waldemar und Marianne Loeding,<br />
Groß Grönau; Stefan Lohnert, Edingen-Neckarhausen; Prof.<br />
Dr. Michael Loick, Euskirchen; Ingrid Lorenz, Hatten; Andreas<br />
Lünemann, Oldenburg; Burkard Lutz, Kassel; Dr. Angelika<br />
Mader, Landau; Christine und Matthias Mahl, Hütschenhausen;<br />
Franz Maier und Elisabeth Gistl-Maier, Deggendorf; Rolf<br />
Maier, Waiblingen; Jens Malzacher, Mutterstadt; Günter Mänz,<br />
Baesweiler; Sigrid Mänz, Schmelz; Dr. Wolfgang und Bärbel<br />
Markhof, Grevenbroich; Prof. Dr. Dr. Michael Martinek, Püttlingen;<br />
Christoph Massau, Hatten; Ivo und Marta Matic, München;<br />
Dr. Joachim und Angelika Mayer, Bietigheim-Bissingen;<br />
Dr. Joachim und Angelika Mayer, Bietigheim-Bissingen; Dr.<br />
Gerhard Mehltretter, Marzling; Fritz Mehner, Iserlohn; Gisela<br />
Mentner, Hamburg; Bernhard Mescheder, Schloß Holte-Stukenbrock;<br />
Werner Messner, Trossingen; Dr. Dr. Ralf Meyer, Aachen;<br />
Martina Meyer-Schwickerath, Münster; Angela Meyerhof,<br />
Karlsruhe; Microvision Engineering GmbH, Reutlingen;<br />
Günter und Cornelia Miksch, Erdmannhausen; Andreas und<br />
Ulrike Mock, Bergheim; Dr. Dieter Moehrs, Norderstedt; Dr.<br />
Klaus-Hinrich Mohaupt, Scheeßel; Jens und Eva Möller, Remscheid;<br />
Monika und Albert Monath, Grünstadt; Michael und<br />
Katrin Moratz, Nienhagen; Dr. Klaus Mörike, Pliezhausen; Ulrich<br />
Morsdorf, Recklinghausen; Norbert Mühlberger und<br />
Klaudia Kasper, Detmold; Prof. Dr. Christian und Dr. Christine<br />
Müller, Berlin; Dr. Friedrich Müller, Meckenheim; Lothar Müller,<br />
Kleinmachnow; Herr Münch und Frau Reinert-Münch,<br />
Kulmbach; Josef Nachtrab, Windsbach; Dr. Erich und Dr. Petra<br />
Neisius, Heiligenhaus; Britta und Dr. Wolfgang Nettekoven,<br />
Pulheim; Josef Nickel, Weil im Schönbuch; Marianne Niebel,<br />
Villingen-Schwenningen; Margareta und Horst Nieberlein, Büchenbach;<br />
Andreas Niemeyer, Emsdetten; Horst Nitzsche,<br />
Freiburg; Frau Nohr-Görgen und Herr Görgen, Lahnstein; Robert<br />
und Helgard Nowak, Berlin; Volker Nüstedt, Oldenburg;<br />
Thomas Oberender, Schkopau; Helga Oberg, Stuttgart; Dr. Doris<br />
Oberkobusch, Düsseldorf; Alois Obermeier, Obertraubling;<br />
Herr Dr. Oberst und Frau Gantert-Oberst, Ottensoos; Werner<br />
und Hildegard Olbermann, Frankenthal; Dr. Katrin Olbrich,<br />
Leipzig; Karl-Heinz und Uta Opdensteinen, Nettetal; Hiltrud<br />
Oser, Bühl; Martina Paret, Herrenberg; Wolfgang und Angelika<br />
Parzinger, Emmerting; Sven Paulsen, Sylt OT Keitum; Heinrich<br />
und Ulrike Peitz, Ulm; Ferdinand und Sabine Peter, Kochel;<br />
Roland Petermann, Schotten; Hans-Hermann und Rosemarie<br />
Peters, Föhren; Dr. Ursula und Dr. Jochen-Ulrich Peters, Köln;<br />
Agnes und Walter Petschan, Heidelberg; Klaus Pflüger, Essen;<br />
Dr. Fritz Pinkenburg, Rendsburg; Dr. Dieter und Dr. Ute Polte,<br />
Schermbeck; Klaus und Jutta Popp, Ludwigshafen; Margarete<br />
Porn, Swisttal-Ludendorf; Dr. Johannes Pornschlegel, Friedberg;<br />
Gerd Quecke, Düren; Michael Quernheim, Soest; Dr.<br />
Franz Quint, Rastatt; Bolko und Sieglinde Raffel, Dormagen;<br />
Dr. Klaus Rave, Kronshagen; Gisela Reichert, Sulzbach; Dietmar<br />
und Birgit Reinert, Sankt Augustin; Dr. Dieter Remus,<br />
Hamburg; Gabriele Repczuk, Hanerau-Hademarschen; Rainer<br />
Rettig und Ursula Eichenauer-Rettig, Weitenhagen; Renate<br />
Rettkowski, Stendal; Dirk Richau, Braunschweig; Carsten und<br />
Anka Riediger, Tangstedt; Stefan Ringler, Kandel; Rita Risse,<br />
Recke; Albert Rist, Straubing; Brigitte Sibylle Ritz, Waldshut-<br />
Tiengen; Christine Rohrschneider, Leipzig; Dr. Dietmar Romann,<br />
St. Wendel; Ute Römer-Pommeranz, Gelsenkirchen; Dr.<br />
Gotthard Roosen-Runge, Krummesse; Dr. Hans Rose, Erbendorf;<br />
Dr. Jochen Rose, Viersen; Dr. Peter Roth und Anne Heusgen-Roth,<br />
Deggendorf; Ulrike Rudolph, Lilienthal; Silvia Ruf-<br />
Provenzano und Francesco Provenzano, Görwihl; Joachim<br />
Rupp, Stutensee; Heinrich Ruppel, Frankfurt M.; Dr. Ferdinand<br />
Rüschenbaum, Mülheim/Ruhr; Wolfgang Sahlmüller, Ibbenbühren;<br />
Dirk Sandig, Mönchengladbach; Stephan Saß, Berlin;<br />
Dr. Peter Sauer, Castrop-Rauxel; Irina Scegoleva-Minkovskij,<br />
Köln; Esther Schäch, Böhl-Iggelheim; Gerhard Schackert,<br />
Schifferstadt; Joachim Schäfer, Plankstadt; Roswitha Schallnus,<br />
Bad Soden-Salmünster; Christine und Günther Schätzl, Passau;<br />
Bettina Schaumberg, Hamburg; Annelie Scheffler, Hagen;<br />
Dr. Burkhard und Maria Scherf, Uedem; Klaus-Peter und Renate<br />
Schick, Lohne; Gerd Schieweck, Berlin; Michael Schikowsky,<br />
Hamburg; Bettina Schillings, Voerde; Holger Schimmelmann,<br />
Nuthetal / OT Tremsdorf; Dr. med. Astrid und Dr.<br />
–– 111
med. Erich Schirner, Erlangen; Dr. Barbara Schlichte-Hiersemenzel,<br />
Hannover; Wolfgang Schlömer, Aachen; Johann und<br />
Jutta Schmid, Stockdorf; Josef und Gertrud Schmiddunser,<br />
Haag; Karl-Josef Schmidgen, Wassenach; Dr. Michael und Birgit<br />
Schmidt, Hannover; Reiner Schmidt, Kornwestheim; Ute<br />
Schmidt, Coburg; Burkhard Schnack, Kiel; Ulrich Schnaut,<br />
Wilnsdorf; Volker Schneider, Flörsheim-Weilbach; Dr. Uwe<br />
Schneidewind, Oldenburg; Hartmut und Frauke Schnepel, Lohe-Rickelshof;<br />
Prof. Dr. H.-G. Schnürch, Kaarst; Luise Scholtissek,<br />
Osterholz-Scharmbeck; Reinhard Schomäcker, Berlin;<br />
Karin Schön, Heidenheim; Rainer Schönberg, Augsburg; Dr.<br />
Helmut Schönecker, Eberhardzell; Josef Schönherr, Westhausen;<br />
Kirsten Schönherr, Dresden; Toralf Schrader, Wernigerode;<br />
Fritz und Catalina Schreiber, Kolbermoor; Herr und Frau<br />
Dr. Schriml, Lüdenscheid; Edelgard-Maria Schulz, Hochheim;<br />
Dr. Wolfgang und Dr. Petra Schulz, Tettnang; Matthias Schumacher,<br />
Lüneburg; Herr Schütte und Frau Dannenberg-Schütte,<br />
Berlin; Alice und Albrecht Schwab, Münster; Klaus Schwabenland,<br />
Oberhausen; Klaus-Dieter Schwartz, Hannover;<br />
Christian Schwarzkopf, Mainz; Dr. Rainer Schweizer und Karin<br />
Henssler-Schweizer, Kirchheim u. Teck; Hans-Peter<br />
Schwendemann, Zell am Hamersbach; Gudrun Seidel, Gelsenkirchen;<br />
Dr. Frank und Antje Seiffarth, Kreuztal; Rudolf Seitz,<br />
Inning; Maren Siewert, Gothendorf/Süsel; Marisa Maria Luise<br />
Skorianz, Olching; Karin und Reinhard Skrodzki, Gelsenkirchen;<br />
Ursula Sossna, Wahrenholz; Günther Späth, Rodach;<br />
Stefan Spengler, Budenheim; Norbert und Ursula Stahr,<br />
Vechta; Dr. Herbert Stark, Kelkheim; Hans-Michael Steenbock,<br />
Heppenheim; Dr. Helmut Steger, Dingolfing; Johannes und<br />
Elisabeth Stegmaier, Ravensburg; Eduard und Angelika Stelzer,<br />
Gengenbach; Hermann Steuwer, Hunteburg; Wolfgang und Rita<br />
Straub, Freising; Alfred und Irmgard Straubinger, Pullach;<br />
Eva Maria Striewe, Essen; Jürgen Süykers, Oldenburg; Frau<br />
Dr. Swiridoff-Heller, Heidelberg; Detlef Szymanski, Rümmelsheim;<br />
Jürgen Tecklenburg, Hamburg; Jürgen und Jutta Thalmann,<br />
Annweiler; Wolff-Dieter und Ute Theissen, Lüdenscheid;<br />
Christiane Thomas, Wörrstadt; Bernhard-Theodor und<br />
Elisabeth Tilling, Velbert; Dr. Peter Titulaer, Rheurdt; Thomas<br />
Tönshoff, Duisburg; Helmut und Elke Trappen, Bitburg; Gabriele<br />
Triebel, Kiel; Christa Udvardi-Lakos, Freudenstadt; Gerhard<br />
Uhl, Frankenthal; Uta Ungermann, Osnabrück; Kai Un-<br />
112 ––<br />
kelbach, Osthofen; Martin Unterweger, Albstadt; Ewald und<br />
Marina Ure, Krefeld; Ulrike van Geuns-Rosch, Wolfsburg;<br />
Theodor van Kempen, Bonstetten; Ilse Viefhues-Aders, Schüttorf;<br />
Ilka Viereck-Boenke, Baunatal; Jürgen und Martina Vinçon,<br />
Schramberg-Tennenbronn; Franz Vocks-Turowski und<br />
Luise Turowski, Bielefeld; Dr. Ehrenfried und Julia Vogt, Künzell;<br />
Waltraud Volk-Weinreuter, Leingarten; Udo Völzing, Mücke;<br />
Christa Wahl, Oberhosenbach; Volker Wallrath, Stutensee;<br />
Artur und Manuela Walter, Ingolstadt; Eva Maria Walter,<br />
Durbach; Klaus und Silvia Walter, Stegaurach; Krisztina Walther,<br />
Münchberg; Dr. Egon Walzer, Maintal; Dr. Jürgen Wegner,<br />
Düsseldorf; Dr. Hubert Wehweck, München; Moritz Weig,<br />
Mayen; Armin und Andrea Weißing, Bad Salzuflen; Dieter<br />
Wenzlitschke, Obertshausen; Bernd Werner, Waldsee; Bernd<br />
Westphal, Günzburg; Roswitha Wetzel, Boppard; Brigitte Weyers,<br />
Bocholt; Thomas Widmann, Ettlingen; Markus Wiebel,<br />
Lübeck; Herr Wiedemann und Frau Wiedemann-Elsen, Hannover;<br />
Dr. Frank und Sibylle Wiegand, Weißenfels; Prof. Dr.<br />
Hetmar Wilbert, Erwitte; Jochen und Astrid Wilde, Bad Kissingen;<br />
Wolfgang und Beate Winkler, Sulzbach; Dr. Fritz und<br />
Rita Winter, Leutkirch; Franz Wintergerst, Bad Hindelang; Dr.<br />
Joachim und Beate Wittbrodt, Bammental; Albert Wulff, Alfter;<br />
Dr. Günther Zahn, Burghausen; Karl Zeller, Leiblfing; Werner<br />
Zentner, Mörlenbach; Regina Zepf, Mosbach; Herr Zickgraf<br />
und Frau Krause-Zickgraf, Neuhofen; Gabriele Ziehensack,<br />
Frankfurt am Main; Markus Zielonka, Kirchheimbolanden;<br />
Holger Ziemer, Pritzerbe; Norbert Ziesche, Bockenau; Herr<br />
und Frau Dr. Zimmermann, Landshut; Angelika Zins, Frankfurt<br />
a.M.<br />
Dezember 2011
Reuter’sche Stiftung<br />
im Stifterverband<br />
für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft<br />
Johs. Kölln Stiftung<br />
im Stifterverband<br />
für die <strong>Deutsche</strong> Wissenschaft<br />
Rotary Club<br />
Remscheid