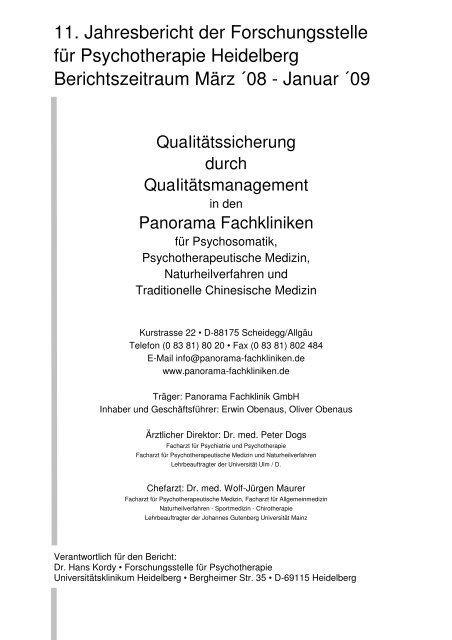JB_Scheidegg_08 09 final - Panorama-Fachklinik Scheidegg
JB_Scheidegg_08 09 final - Panorama-Fachklinik Scheidegg
JB_Scheidegg_08 09 final - Panorama-Fachklinik Scheidegg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11. Jahresbericht der Forschungsstelle<br />
für Psychotherapie Heidelberg<br />
Berichtszeitraum März ´<strong>08</strong> - Januar ´<strong>09</strong><br />
QuaIitätssicherung<br />
durch<br />
QuaIitätsmanagement<br />
in den<br />
<strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en<br />
für Psychosomatik,<br />
Psychotherapeutische Medizin,<br />
Naturheilverfahren und<br />
Traditionelle Chinesische Medizin<br />
Kurstrasse 22 • D-88175 <strong>Scheidegg</strong>/Allgäu<br />
Telefon (0 83 81) 80 20 • Fax (0 83 81) 802 484<br />
E-Mail info@panorama-fachkliniken.de<br />
www.panorama-fachkliniken.de<br />
Träger: <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong> GmbH<br />
Inhaber und Geschäftsführer: Erwin Obenaus, Oliver Obenaus<br />
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Peter Dogs<br />
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin und Naturheilverfahren<br />
Lehrbeauftragter der Universität Ulm / D.<br />
Chefarzt: Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer<br />
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Naturheilverfahren - Sportmedizin - Chirotherapie<br />
Lehrbeauftragter der Johannes Gutenberg Universität Mainz<br />
Verantwortlich für den Bericht:<br />
Dr. Hans Kordy • Forschungsstelle für Psychotherapie<br />
Universitätsklinikum Heidelberg • Bergheimer Str. 35 • D-69115 Heidelberg
2<br />
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S<br />
0 Übersicht ................................................................................................................. 3<br />
1 Wer kommt zur Behandlung? .................................................................................. 6<br />
1.1 Beschreibung der Patienten: Soziodemografische Angaben ............................ 6<br />
1.1.1 Altersverteilung........................................................................................... 6<br />
1.1.2 Geschlechterverteilung............................................................................... 6<br />
1.1.3 Familienstand ............................................................................................. 7<br />
1.1.5 Höchster beruflicher Abschluss .................................................................. 8<br />
1.2 Überweisungsweg und Sozialversicherungsstatus ........................................... 8<br />
1.1.2 Wohnort...................................................................................................... 8<br />
1.2.2 Kostenträger............................................................................................... 9<br />
1.2.3 Überweisungsweg ...................................................................................... 9<br />
1.2.4 Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme.................................................................. 10<br />
1.2.5 Behandlungsdiagnosen............................................................................ 10<br />
1.2.6 Krankheitsdauer ....................................................................................... 13<br />
1.3 Motivation und Therapieerwartung.................................................................. 14<br />
1.3.1 Motivation ................................................................................................. 14<br />
1.3.2 Problembereiche ...................................................................................... 14<br />
1.3.3 Therapeutische Arbeitsbeziehung ............................................................ 15<br />
2 Mit welchen therapeutischen Mitteln?.................................................................... 16<br />
2.1 Verweildauer................................................................................................... 16<br />
2.2 Welche therapeutischen Maßnahmen sind hilfreich? - Einschätzung der<br />
Patienten............................................................................................................... 16<br />
3 Mit welchem Ergebnis ........................................................................................... 18<br />
3.1 Gesamteinschätzung ...................................................................................... 18<br />
3.1.1 Einschätzung der Veränderungen ............................................................ 18<br />
3.1.2 Auffälligkeitsraten ..................................................................................... 19<br />
3.2 Therapieergebnis im Therapeutenurteil .......................................................... 20<br />
3.2.1 Beeinträchtigungsschwere ....................................................................... 20<br />
3.2.2 Globale Erfassung des Funktionsniveaus ................................................ 20<br />
3.3 Therapieergebnis im Patientenurteil................................................................ 21<br />
3.3.1 Klinisch-Psychologisches Diagnosesystem-38......................................... 21<br />
3.4 Patientenzufriedenheit .................................................................................... 22<br />
4 Zusammenfassung und Ausblick........................................................................... 23
3<br />
0 Übersicht<br />
Seit April 1995 führen die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en für Psychosomatik, Psychotherapeutische<br />
Medizin, Naturheilverfahren und Traditionelle Chinesische Medizin <strong>Scheidegg</strong>/Allgäu ein<br />
Programm zum Qualitätsmanagement (QM) durch, welches von der Forschungsstelle für<br />
Psychotherapie wissenschaftlich begleitet wird. Nach einer Unterbrechung zwischen 2006<br />
und 2007 wegen der Teilnahme an dem Projekt QS-Reha (durchgeführt durch das Institut<br />
und Poliklinik für Medizinische Psychologie der Universität Hamburg im Auftrag der<br />
gesetzlichen Krankenkassen) wurde das bewährte QM im Frühjahr 20<strong>08</strong> wieder<br />
aufgenommen.<br />
Das QM beinhaltet eine standardisierte psychologische Eingangs- und<br />
Entlassungsdiagnostik sowie die detaillierte Dokumentation der angewandten<br />
therapeutischen Maßnahmen. Diese Daten bilden die Grundlage für einen im Jahresabstand<br />
zu erstellenden Bericht, in dem die Kernfragen eines QMs beantwortet werden:<br />
1. Wer kommt zur Behandlung?<br />
2. Welche therapeutischen Mittel werden eingesetzt?<br />
3. Welche Ergebnisse werden erreicht?<br />
Das QM-Modell orientiert sich am "Heidelberger Modell" 1 , stellt die Ergebnisqualität ins<br />
Zentrum und berücksichtigt relevante Daten zur Struktur- und Prozessqualität. Alle<br />
Beurteilungen erfolgen sowohl aus der subjektiven Sicht des Patienten 2 als auch aus der<br />
professionellen Perspektive des Therapeuten. Die Zufriedenheit der Patienten mit ihrer<br />
Behandlung erhält dabei besondere Aufmerksamkeit.<br />
Seit 2003 wird Web-AKQUASI 3 als Werkzeug für die Qualitätssicherung in den <strong>Panorama</strong><br />
<strong>Fachklinik</strong>en verwendet. Dabei handelt es sich um eine internet-basierte Weiterentwicklung<br />
der vorher benutzten Version AKQUASI. Dieses neue Werkzeug erlaubt insbesondere eine<br />
kontinuierliche Beobachtung des Gesundungsverlaufs und stellt dem klinischen Team diese<br />
Verlaufsinformation zur Unterstützung klinischer Entscheidungen ohne Zeitverzug zur<br />
Verfügung.<br />
Nicht zuletzt die Absicht, den Gesundungsverlauf kontinuierlich zu beobachten, verlangte<br />
nach einem neuen psychometrischen Messinstrument, das die benötigten Informationen vom<br />
Patienten in einer vertretbaren Zeit erheben lässt. Daher wurde das bisherige Inventar, das<br />
die Symptom-Check-List (SCL-90-R), das Inventar Interpersonaler Probleme (IIP) und den<br />
Giessener Beschwerdebogen (GBB) umfasste, durch das Klinisch Psychologische<br />
Diagnosesystem (KPD-38) ersetzt. Dieses Verfahren, das mit 38 Fragen auskommt, wurde<br />
von der Forschungsstelle für Psychotherapie standardisiert und validiert. Es erfasst neben<br />
dem körperlichen und seelischen Befinden sowie der sozialen Beeinträchtigung auch die<br />
psychosozialen Ressourcen des Patienten .<br />
In den Jahren 2006 und 2007 wurden wegen der oben angesprochenen Teilnahme an der<br />
QS-Reha keine Qualitätsberichte von der Forschungsstelle für Psychotherapie erstellt. Der<br />
1 Kordy H & Lutz W (1995) Das Heidelberger Modell: Von der Qualitätskontrolle zum Qualitätsmanagement<br />
stationärer Psychotherapie durch EDV-Unterstützung. Psychotherapie Forum 3, 197-206.<br />
Kordy H & Hannöver W (1998) Beobachten, Dokumentieren, Bewerten, Steuern: Qualitätsmanagement in der<br />
stationären Psychotherapie. In Laireiter AR & Vogel H: Qualitätssicherung in der Psychotherapie und<br />
psychosozialen Versorgung: Ein Werkstattbuch. DGVT-Verlag, Tübingen.<br />
2<br />
Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir die maskuline Schreibweise. Zu den Patienten zählen<br />
selbstverständlich Frauen und Männer, das gleiche gilt für die Therapeuten.<br />
3 Percevic, R., Gallas, C., Arikan, L., Mößner, M. & Kordy H. (2006). Internet-gestützte Qualitätssicherung und<br />
Ergebnismonitoring in Psychotherapie, Psychiatrie und psychosomatischer Medizin. Psychotherapeut,51, 395-<br />
397.
4<br />
hier vorliegende Report ist der elfte Jahresbericht und fasst die qualitätsrelevanten<br />
Informationen aus dem Berichtszeitraum März 20<strong>08</strong> bis Januar 20<strong>09</strong> zusammen.<br />
Vereinbarungsgemäß wird im Rahmen der Qualitätssicherung eine Zufallsstichprobe von<br />
Behandlungen untersucht 4 . Im Berichtszeitraum wurden so 375 Patienten erfasst. Von 219<br />
(58,4 %) dieser Patienten liegen Daten vor, die für die Berechnung des zentralen<br />
Qualitätsindikators, des sog. Auffälligkeitssignals, ausreichen. Im hier vorliegenden<br />
Jahresbericht wird im Folgenden, ähnlich wie in den früheren Berichten, von dieser<br />
Stichprobe (N = 219) ausgegangen.<br />
Der Blick auf den zentralen Qualitätsindikator, das sog. Auffälligkeitssignal, zeigt, dass die<br />
<strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en nahtlos an das positive Bild zur Ergebnisqualität vor der<br />
Unterbrechung des QM anschließen. Dem Auffälligkeitssignal kommt eine besondere<br />
Bedeutung zu, da sich im Rahmen des QM-Programms die Aufmerksamkeit stark auf jene<br />
Behandlungen richtet, deren Ergebnisse Anlass zu einer kritischen klinischen Diskussion<br />
geben. Der prozentuale Anteil solchermaßen auffälliger Behandlungsverläufe wird mit der<br />
Auffälligkeitsrate ausgedrückt.<br />
Mit der Umstellung des Qualitätssicherungssystems und der darin enthaltenen Instrumente<br />
wurde das Auffälligkeitssignal für den Bericht 2005 neu definiert. Auch wenn die<br />
Neudefinition wie die bisher verwendete den Prinzipien des Stuttgart-Heidelberger Modells<br />
folgt, ist eine exakter Vergleich der Zahlen für die Jahre 2003 und früher nicht möglich.<br />
1995/96 (n=2<strong>08</strong>)<br />
1996/97 (n=2<strong>08</strong>)<br />
1997/98 (n=178)<br />
1998/99 (n=274)<br />
1999/00 (n=227)<br />
2000/01 (n=2<strong>09</strong>)<br />
2001/02 (n=287)<br />
2002/03 (n=385)<br />
12,2<br />
18,5<br />
19,7<br />
16,3<br />
17,7<br />
14,8<br />
22<br />
25<br />
2003/04 (n=267)<br />
2004/05 (n=304)<br />
13,8<br />
15<br />
20<strong>08</strong>/<strong>09</strong> (n=219)<br />
8,2<br />
0 10 20 30<br />
Abb. 1: Auffällige Behandlungsverläufe (Angaben in %)<br />
Dieser zentrale Qualitätsindikator, der sich über die ersten sieben Jahre hinweg von 25 % im<br />
Jahre 1995/96 fast kontinuierlich verbesserte, erreicht im aktuellen Berichtszeitraum (unter<br />
der neuen Definition) mit 8,2 % einen noch einmal erheblich besseren Wert als im<br />
Vergleichsjahr 2004/5 (13,8 %).<br />
Patientenzufriedenheit<br />
Das Behandlungsprogramm der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en wird von nahezu allen Patienten<br />
positiv angenommen. Dies hatten bereits die Daten aus den vergangenen Jahren belegt und<br />
bestätigt sich im aktuellen Berichtszeitraum wieder. Die Zufriedenheit für sieben der acht<br />
4 Pro Monat werden per Zufall zwei Wochen ausgewählt. Alle Patienten, die in diesen beiden Wochen zur<br />
Behandlung aufgenommen werden, nehmen am Qualitätssicherungsprogramm teil.
5<br />
betrachteten Aspekte liegt über 90 % und lediglich bei einem der Aspekte („habe die gewollte<br />
Behandlung erhalten“) mit 89 % knapp darunter.<br />
Behandlungsergebnisse<br />
Bei vergleichsweise kurzer Verweildauer von im Mittel 37,3 Tagen (s = 7,5) 5 werden im<br />
aktuellen Berichtszeitraum sehr gute Ergebnisse erzielt. Aus Sicht der überwiegenden<br />
Mehrzahl der Patienten verbessern sich sowohl der körperliche (81 %) als auch der<br />
seelische Zustand (89 %), das Selbstwerterleben (85 %) und das Allgemeinbefinden (86 %).<br />
Verschlechterungen werden sowohl aus der Patienten- als auch der Therapeutenperspektive<br />
äußerst selten berichtet. Dieses ausgesprochen positive Bild der Therapieergebnisse aus<br />
der Sicht der Beteiligten wird bestätigt durch die standardisierten Bewertungen unter<br />
Verwendung von psychometrischer Skalen, die für die Bewertung psychotherapeutischer<br />
Behandlungsergebnisse als relevant angesehen werden 6 . In dem zusammenfassenden<br />
Urteil über alle diese Einzelkriterien hinweg werden 73 % der Behandlungen mindestens als<br />
guter Erfolg eingeschätzt. Auf allen der zahlreichen Einzeldimensionen hinweg überwiegt die<br />
Anzahl der positiven Veränderungen die der negativen sehr deutlich.<br />
5 s steht für "Standardabweichung".<br />
6 Klinisch Psychologisches Diagnosesystem (KPD-38; Gesamtskala: 66 % verbessert oder sehr verbessert).
6<br />
1 Wer kommt zur Behandlung?<br />
1.1 Beschreibung der Patienten: Soziodemografische Angaben<br />
1.1.1 Altersverteilung 7 Abb. 2: Altersverteilung (Angaben in %)<br />
über 68 Jahre<br />
1,8<br />
59-68 Jahre<br />
15,5<br />
49-58 Jahre<br />
39-48 Jahre<br />
29,7<br />
31,5<br />
29-38 Jahre<br />
10,5<br />
19-28 Jahre<br />
7,3<br />
bis 18 Jahre<br />
0,5<br />
0 10 20 30 40<br />
Die Patienten der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en zeigen bezüglich des Alters eine für (nichtuniversitäre)<br />
psychosomatisch-psychotherapeutische <strong>Fachklinik</strong>en charakteristische<br />
Verteilung. Die im aktuellen Berichtszeitraum erfassten Patienten sind im Mittel 47,7 (s =<br />
11,7) Jahre alt (2004/05: 44,6 Jahre). Gegenüber den Vorjahren zeigt sich eine leichte<br />
Verschiebung zugunsten der Gruppen höheren Alters. Im Berichtszeitraum stellen die 39 -<br />
58jährigen zusammen knapp zwei Drittel (61 %) der Patienten.<br />
1.1.2 Geschlechterverteilung 8<br />
Frauen<br />
66,2<br />
Männer<br />
33,8<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Abb. 3: Geschlechterverteilung (Angaben in %)<br />
Wie in anderen psychosomatischen Einrichtungen übersteigt auch in den <strong>Panorama</strong><br />
<strong>Fachklinik</strong>en der Anteil der Frauen sehr deutlich den der Männer. Die Frauen stellen zwei<br />
Drittel der gesamten Patienten (63 % in 2004/05), die Männer ein Drittel (37 % in 2004/05).<br />
7 n = 212 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 7 (3,2 %).<br />
8 n = 219 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 0 (0 %).
7<br />
1.1.3 Familienstand 9 Abb. 4: Familienstand (Angaben in %)<br />
verheiratet<br />
41,6<br />
ledig<br />
29,2<br />
getrennt lebend<br />
5<br />
geschieden<br />
20,1<br />
verwitwet<br />
3,7<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
Hinsichtlich des Familienstandes zeigt sich im aktuellen Berichtszeitraum mit 42 % eine<br />
weitere Abnahme des Anteils verheirateter Patienten gegenüber früheren Jahren (45 % in<br />
2004/05 bzw. 52 % in 2002/03). Dementsprechend haben sich die Anteile der Patienten, die<br />
getrennt leben, geschieden, verwitwet oder wieder verheiratet sind, mit 29 % (23 % in<br />
2004/05; 25 % in 2002/03) und der Anteil der Ledigen mit 29 % (27 % in 2004/05 und 22 %<br />
in 2002/03) leicht erhöht.<br />
1.1.4 Schulbildung 10 Abb. 5: Schulbildung (Angaben in %)<br />
Gymnasium<br />
49,3<br />
Realschule<br />
31,5<br />
Hauptschule<br />
16,9<br />
Sonstige<br />
2,3<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Beim Bildungsniveau zeigt sich eine ähnliche Verteilung wie in den Vorjahren. Den mit 49 %<br />
größten Anteil stellen die Patienten mit gymnasialem Abschluss (2004/05: 43 %). Auch der<br />
Anteil der Patienten mit Realschulabschluss ist im Vergleich zu früheren Jahren leicht<br />
gewachsen (32 % gegenüber 27 % in 2004/05), während der Anteil der Patienten mit<br />
Hauptschulabschluss nahezu konstant geblieben ist (17 % gegenüber 15 % in 2004/05).<br />
Demnach weist das Klientel der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en ein höheres Bildungsniveau auf als<br />
Bevölkerungsgruppen mit ähnlicher Altersstruktur.<br />
9 n = 218 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 1 (0,5 %).<br />
10 n = 219 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 0 (0 %).
8<br />
1.1.5 Höchster beruflicher Abschluss 11<br />
FH/Uni<br />
41,6<br />
Meister<br />
5,5<br />
Lehre<br />
34,2<br />
noch in Ausbildung<br />
0,5<br />
ohne Abschluss<br />
6,4<br />
sonstiger Abschluss<br />
11<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />
Abb. 6: Berufsabschlüsse (Angaben in %)<br />
Ähnlich wie bei der Schulbildung repräsentieren die Patienten der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en<br />
auch im Hinblick auf die berufliche Ausbildung eher die Mittel- bzw. obere Mittelschicht. Mehr<br />
als ein Drittel der Patienten verfügt über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss (42<br />
%). Berücksichtigt man die große Zahl älterer Patienten und die Überrepräsentierung von<br />
Frauen, liegt dieser Wert deutlich höher als in einer vergleichbaren Bevölkerungsgruppe.<br />
Erst in den 70er Jahren erlangten mehr als 10 % eines Jahrgangs die Hochschulreife. Der<br />
Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen blieb für Frauen auch in dieser Zeit noch<br />
schwierig.<br />
1.2 Überweisungsweg und Sozialversicherungsstatus<br />
1.1.2 Wohnort 12 Abb. 7: Einzugsgebiete (Angaben in %)<br />
Bodensee / Albkreis<br />
6,8<br />
Bayern<br />
34,2<br />
übrige BRD<br />
56,6<br />
außerhalb Deutschlands<br />
0,9<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Der Versorgungsbereich der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en ist unverändert das gesamte<br />
Bundesgebiet. Ähnlich wie in früheren Jahren kommen nur wenige der Patienten aus der<br />
näheren Umgebung, dem Bodensee/Albkreis (7 % gegenüber 9 % in 2004/05). Dagegen hat<br />
der Anteil derer, die aus der weiteren Umgebung (restliches Bayern) kommen, auf 34 % (24<br />
% in 2004/05) zugenommen. Etwas weniger, aber nach wie vor deutlich mehr als die Hälfte<br />
der Patienten kommt aus dem übrigen Bundesgebiet (57 % gegenüber 61 % in 2004/05).<br />
11 n = 217 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 2 (0,9 %).<br />
12 n = 216 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 3 (1,4 %).
9<br />
1.2.2 Kostenträger 13 Abb. 8: Kostenträger (Angaben in %)<br />
Ersatzkassen<br />
45,7<br />
Pflichtkassen<br />
19,2<br />
Privatkassen<br />
34,2<br />
Andere<br />
0,9<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Die Mehrzahl der Patienten der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en ist Mitglied einer Ersatzkasse. Der<br />
Anteil liegt mit 46 % deutlich unter dem früherer Jahre (55 % in 2004/05 bzw. 65 % in<br />
2002/03). Dagegen ist der Anteil der privat Versicherten von 19 % (2004/05) auf 34 %<br />
deutlich gestiegen, während der Anteil der Pflichtversicherten mit 19 % (gegenüber 17 % in<br />
2004/05) nahezu konstant geblieben ist.<br />
1.2.3 Überweisungsweg 14<br />
FA f. Psychiatrie/Neurologie<br />
FA f. Allgemeinmedizin<br />
33,3<br />
32,9<br />
Ärztl. Psychotherapeut<br />
5,9<br />
FA f. Innere Medizin<br />
5<br />
anderer Facharzt<br />
Kostenträger<br />
andere Klinik<br />
unbekannt<br />
Nichtärztl. Psychotherapeut<br />
2,7<br />
1,4<br />
0,9<br />
0,9<br />
0,5<br />
0 10 20 30 40<br />
Abb. 9: Überweisungsweg (Angaben in %)<br />
Der übliche Weg in die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en führt über die Überweisung durch einen<br />
Allgemeinmediziner (33 %) oder einen nicht-psychotherapeutischen Facharzt (33 %). Der<br />
Anteil der Patienten, die zunächst einen Spezialisten für Psychotherapie aufsuchen, liegt nur<br />
bei 6 % und ist damit etwas niedriger als in früheren Jahren (12 % in 2004/05 und 16 % in<br />
2002/03). Nur 1 % der Patienten kommen auf dem Weg über eine andere Klinik.<br />
13 n = 217 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 2 (0,9 %).<br />
14 n = 212 aus dem Therapeutenbericht, keine Angaben: n = 7 (3,2 %).
10<br />
1.2.4 Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme 15<br />
Gut ein Drittel (34 %) der Patienten der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en sind Rentner,<br />
Hausfrauen, Schüler oder Studenten, für die eine formelle Krankschreibung im<br />
Allgemeinen eine geringe Bedeutung hat. Insofern unterscheidet sich das Klientel der<br />
<strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en von dem psychosomatischer <strong>Fachklinik</strong>en oder Abteilungen,<br />
die eng mit Rentenversicherungsträgern zusammenarbeiten.<br />
arbeitsunfähig<br />
29,7<br />
nicht arbeitsunfähig<br />
36,1<br />
nicht berufstätig<br />
34,2<br />
0 10 20 30 40<br />
Abb. 10: Arbeitsunfähigkeit bei Aufnahme (Angaben in %)<br />
Der Anteil der Patienten, die arbeitsunfähig (d.h., mit einer formellen Bescheinigung) in die<br />
Klinik kommen, ist mit 30 % gegenüber den Vorjahren nahezu gleich geblieben (31 % in<br />
2004/05). Diese erstreckt sich für ein Drittel (33 %) auf mehr als 12 Wochen. Dies entspricht<br />
etwa dem Wert von 2004/05, als ebenfalls knapp ein Drittel (30 %) so lange arbeitsunfähig<br />
waren. Für 36 % der Patienten liegt keine formell bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vor.<br />
bis 4 Wochen<br />
9,3<br />
5-12 Wochen<br />
21,4<br />
13-24 Wochen<br />
12,9<br />
über 24 Wochen<br />
20<br />
0 10 20 30<br />
Abb. 11: Arbeitsunfähigkeit bei Aufnahme (Angaben in %)<br />
1.2.5 Behandlungsdiagnosen 16<br />
Die Diagnosen werden nach dem ICD-10 dokumentiert. Die Zusammenfassung ist in zwei<br />
Darstellungen aufgeteilt: die erste gibt eine Übersicht über die Hauptkategorien 17 des ICD-<br />
10, die zweite ordnet die spezifischen Diagnosen 18 nach der Häufigkeit, zeichnet also das<br />
Versorgungsprofil der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en. Beide Darstellungen beziehen sich, ähnlich<br />
15 Abb. 10: n = 219 aus dem Therapeutenbericht, keine Angaben: n = 0 (0 %).<br />
16 n = 219 aus dem Therapeutenbericht, keine Angaben: n = 0 (0 %).<br />
17 F0: Organische, einschl. symptom. psychische Störungen; F1: psychische und Verhaltensstörungen durch<br />
psychotrope Substanzen; F2: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen; F3: Affektive Störungen, F4:<br />
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen; F5: Verhaltensauffälligkeiten mit körperl. Störungen und<br />
Faktoren, F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen; F7: Intelligenzminderung; F8: Entwicklungsstörungen;<br />
F9: Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn i. d. Kindheit und Jugend.<br />
18<br />
F32: depressive Episode; F33: rezidivierende depressive Störungen; F34: anhaltende affektive Störungen,<br />
F40: Phobische Störungen; F41: sonstige Angststörungen; F43: Reaktionen auf schwere Belastungen und<br />
Anpassungsstörungen; F45: somatoforme Störungen; F50: Essstörungen; F60: spezifische<br />
Persönlichkeitsstörungen; kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen H93: Sonstige Krankheiten des<br />
Ohres, andernorts nicht klassifiziert.
11<br />
wie in den früheren Jahresberichten, auf die Erstdiagnosen. Zusätzlich wurden für den<br />
aktuellen Berichtszeitraum auch die Diagnosen ausgewertet, die an zweiter, dritter und<br />
vierter Stelle gestellt wurden.<br />
F0<br />
F1<br />
F2<br />
F3<br />
F4<br />
F5<br />
F6<br />
F7<br />
F8<br />
F9<br />
andere<br />
0,5<br />
0,5<br />
2,7<br />
4,1<br />
0,5<br />
9,6<br />
77,2<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
Abb. 12: Erstdiagnosen (Angaben in %)<br />
Vier Hauptkategorien bestimmen das Profil hinsichtlich der Erstdiagnosen: klar dominierend<br />
sind die affektiven Störungen (F3: 77 %), gefolgt von den neurotischen bzw. somatoformen<br />
Störungen oder Belastungsstörungen (F4: 10 %) sowie den Persönlichkeits- und<br />
Verhaltensstörungen (F6: 4 %) und Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F5:<br />
3 %). Die affektiven Störungen nehmen im aktuellen Berichtszeitraum an Gewicht deutlich zu<br />
(64 % in 2004/05) während die neurotischen bzw. somatoformen Störungen (14 % in<br />
2004/05) und die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen im Vergleich zu früheren Jahren<br />
(8 % in 2004/05) seltener diagnostiziert werden.<br />
F32<br />
46,1<br />
F33<br />
31,1<br />
andere<br />
F43<br />
F60<br />
F41<br />
F50<br />
F40<br />
F45<br />
3,5<br />
3,2<br />
3,2<br />
2,3<br />
2,3<br />
1,8<br />
1,8<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Abb. 13: Spezifische Erstdiagnosen (Angaben in %)<br />
Im spezifischen Diagnoseprofil der Kliniken zeigt sich wieder die zahlenmäßige Dominanz<br />
der Diagnose einer depressiven Episode (46 %, 2004/05: 45 %). An zweiter Stelle folgt mit<br />
einem gegenüber den Vorjahren höherem Anteil die rezidivierende depressive Störung F33,<br />
die bei 31 % der Patienten diagnostiziert wurde (16 % in 2004/05). Die spezifische
12<br />
Persönlichkeitsstörung F60 wurde im aktuellen Jahr nur in 3 % der Fälle als Erstdiagnose<br />
gestellt (6% in 2004/05), ähnlich häufig wie eine Essstörung (F50 – 2 %; 6% in 2004/05) oder<br />
eine Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörung (F43 – 3 %).<br />
F1<br />
1,9<br />
F3<br />
14,6<br />
F4<br />
46,2<br />
F5<br />
10,8<br />
F6<br />
18,4<br />
F9<br />
0,6<br />
H9<br />
andere<br />
3,8<br />
3,2<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Abb. 14: Weitere Diagnosen (Angaben in %)<br />
Bei ungefähr der Hälfte der Patienten (52 %) wird neben der Hauptdiagnose mindestens eine<br />
weitere Störung diagnostiziert (70 % in 2004/05). Betrachtet man die Diagnosen, die an<br />
zweiter, dritter oder vierter Stelle gestellt werden, so zeigt sich, dass diese vorwiegend aus<br />
der Kategorie der neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen (F4: 46 %)<br />
stammen. Der Anteil hat im Vergleich zu früheren Jahren (19 % in 2004/05) zugenommen.<br />
Eine Persönlichkeits- und Verhaltensstörung wurde bei 18 % und damit deutlicher seltener<br />
als früher (2004/05: 36 %), eine affektive Störung bei 15 % (2004/05: 13 %) und eine<br />
Diagnose der Kategorie F5 (Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und<br />
Faktoren) bei 11 % (2004/05: 4 %) als weitere Diagnose gestellt.<br />
F45<br />
19,6<br />
F60<br />
15,8<br />
F41<br />
F50<br />
10,1<br />
10,8<br />
F32<br />
andere<br />
7,6<br />
7,2<br />
F43<br />
F40<br />
F33<br />
6,3<br />
6,3<br />
6,3<br />
H93<br />
3,8<br />
F42<br />
2,5<br />
F17<br />
F61<br />
1,3<br />
1,3<br />
0 5 10 15 20 25<br />
Abb. 15: Weitere spezifische Diagnosen (Angaben in %)
13<br />
Hinsichtlich der spezifischen Diagnosen zeigt sich, dass wie in den Vorjahren neben der<br />
Hauptdiagnose vor allem somatoforme Störungen (F45: 20 %) und spezifische<br />
Persönlichkeitsstörungen (F60: 16 %) diagnostiziert werden. Angststörungen (F41) und<br />
Essstörungen (F50) werden mit 11% bzw. 10 % etwas häufiger als depressive Episoden<br />
(F32) mit 8 % diagnostiziert.<br />
F32<br />
67,7<br />
F33<br />
46,6<br />
F45<br />
F60<br />
21<br />
19,1<br />
andere<br />
F41<br />
F50<br />
F43<br />
F40<br />
14,9<br />
13,1<br />
12<br />
10,1<br />
8,3<br />
H93<br />
F41<br />
3<br />
3,5<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Abb. 16: Alle Diagnosen (Angaben in %)<br />
Insgesamt d. h. unter Berücksichtigung aller gestellten Diagnosen, zeigen die <strong>Panorama</strong><br />
<strong>Fachklinik</strong>en damit im aktuellen Berichtsjahr das in Abbildung 16 dargestellte<br />
Behandlungsprofil. Rund zwei Drittel der Diagnosen beziehen sich auf depressive Episoden<br />
F32 (68 %) und knapp die Hälfte auf eine rezidivierende depressive Störung F33 (47 %). F45<br />
(somatoforme Störung; 21%) und F60 (spezifische Persönlichkeitsstörung; 19 %) folgen in<br />
der Häufigkeitsrangfolge. Neben den psychischen- und Verhaltensstörungen wurde am<br />
häufigsten die Diagnose “Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert"<br />
(H93: 4%) gestellt, wobei es sich in der Regel um Tinnitus handeln dürfte.<br />
1.2.6 Krankheitsdauer 19<br />
bis 1 Jahr<br />
18,3<br />
1 bis 2 Jahre<br />
15,1<br />
3 bis 5 Jahre<br />
28,8<br />
6 bis 10 Jahre<br />
14,2<br />
über 10 Jahre<br />
8,2<br />
über 15 Jahre<br />
12,8<br />
0 5 10 15 20 25 30 35<br />
Abb. 17: Krankheitsdauer in Jahren (Angaben in %)<br />
Viele Patienten leiden schon seit Jahren unter den Beschwerden, die sie zur Behandlung in<br />
die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en führen. Fast zwei Drittel (64 %) der Patienten sind bei<br />
19 n = 213 aus dem Therapeutenbericht, keine Angaben: n = 6 (2,7 %).
14<br />
Behandlungsbeginn bereits als chronisch krank zu bezeichnen (35 %, Krankheitsdauer von<br />
mehr als 5 Jahren) oder haben ein erhebliches Chronifizierungsrisiko (28,8 %,<br />
Krankheitsdauer von 3 bis 5 Jahren).<br />
1.3 Motivation und Therapieerwartung<br />
1.3.1 Motivation 20<br />
sehr motiviert<br />
31,5<br />
50,2<br />
motiviert<br />
41,6<br />
55,7<br />
kaum / etwas motiviert<br />
8,2<br />
6,9<br />
Therapeutensicht<br />
nicht motiviert<br />
0<br />
0,9<br />
Patientensicht<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Abb. 18: Behandlungsmotivation aus Therapeuten- und Patientensicht<br />
(Angaben in %)<br />
Die Patienten kommen ganz überwiegend mit einer guten Motivation zur Behandlung. 92 %<br />
der Patienten beschreiben sich selbst als "sehr motiviert" oder zumindest als "motiviert". Nur<br />
7 % der Patienten sehen sich selbst als wenig motiviert. Die Therapeuten beurteilen die<br />
Behandlungsmotivation ihrer Patienten, wie auch in den Vorjahren, etwas skeptischer. Aber<br />
auch sie schätzen 87 % der Patienten als "sehr motiviert" oder als "motiviert" ein. Kaum<br />
motivierte Patienten sind auch aus Sicht der Therapeuten (8 %) selten, gar nicht motivierte<br />
bilden die Ausnahme.<br />
1.3.2 Problembereiche 21<br />
Seelisches Befinden<br />
Psychisches Wohlbefinden<br />
Körperliches Befinden<br />
Selbstwerterleben/ Selbstannahme<br />
Einstellung geg. Zukunft<br />
Kontakt- & Durchsetzungsfähigkeit<br />
Private Beziehungen<br />
Krankheitsverständnis<br />
Soziale Probleme<br />
Berufliche Beziehungen<br />
43,4<br />
75,3<br />
71,7<br />
68,9<br />
68,9<br />
98,2<br />
97,3<br />
95,4<br />
87,7<br />
86,8<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Abb. 19: Problembereiche (Angaben in %)<br />
20 n = 2<strong>09</strong> aus dem Therapeutenbericht, keine Angaben: n = 10 (4,6 %) bzw. n = 218 aus dem Patientenbericht,<br />
keine Angaben: n = 1 (0,5 %).<br />
21 n = 219 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 0 (0 %).
15<br />
Offensichtlich beginnen viele Patienten ihre Behandlung zuversichtlich und zielorientiert. Sie<br />
kennen ihre Symptome und Probleme und erwarten, dass der Aufenthalt in den <strong>Panorama</strong><br />
<strong>Fachklinik</strong>en zu einer deutlichen Besserung ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt.<br />
Für den überwiegenden Teil der Patienten (98 %) sind Verbesserungen des seelischen<br />
Befindens und des psychischen Wohlbefindens (97 %) wichtig. Eine positive Veränderung<br />
des körperlichen Befindens streben 95 % der Patienten an. Auch die Verbesserung des<br />
Selbstwerterlebens (88 %) und der Einstellung gegenüber der Zukunft (87 %) wird von fast<br />
allen Patienten als Therapieziel genannt. Seltener, aber immer noch von rund drei Viertel bis<br />
zwei Drittel der Patienten werden positive Veränderung der sozialen und privaten<br />
Beziehungen erwartet. Dagegen stehen die beruflichen Probleme relativ selten im Fokus (43<br />
%).<br />
1.3.3 Therapeutische Arbeitsbeziehung 22<br />
sehr positiv<br />
ziemlich positiv<br />
leicht positiv<br />
negativ<br />
8,2<br />
10<br />
22,8<br />
26,9<br />
0 10 20 30<br />
Abb. 20: Therapeutische Arbeitsbeziehung (Angaben in %)<br />
Die Erwartung des Patienten, dass die Therapie hilft, sowie eine positive Einschätzung der<br />
therapeutischen Arbeitsbeziehung gelten als prognostisch günstige Indikatoren für das<br />
Therapieergebnis 23 . Für den Aspekt der Motivation wurde bereits festgestellt, dass der<br />
überwiegende Teil der Patienten mit ausgeprägt positiver Haltung in die Behandlung geht.<br />
Dies spiegelt sich auch in der Beurteilung der therapeutischen Arbeitsbeziehung wider. Mehr<br />
als ein Drittel (37 %) der Patienten äußern bereits nach den ersten therapeutischen<br />
Kontakten ziemlich positive oder sehr positive Erwartungen bezüglich der Behandlung und<br />
geben an, ihren Therapeuten als hilfreich zu erleben. Nur etwa 8 % beurteilen die<br />
therapeutische Arbeitsbeziehung zu Behandlungsbeginn als negativ.<br />
22 n = 149 aus dem Patientenbericht, keine Angaben: n = 70 (32 %).<br />
23 vgl. z. B. Luborsky L, Crits-Christoph P & Auerbach A (1998). Who will benefit from psychotherapy? Basic<br />
books, New York.
16<br />
2 Mit welchen therapeutischen Mitteln?<br />
2.1 Verweildauer 24<br />
Im aktuellen Berichtszeitraum verließen die Patienten im Durchschnitt nach 37,3 Tagen (s =<br />
7,5) die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en. Damit bleibt die durchschnittliche Verweildauer weiterhin<br />
leicht unter dem, was für <strong>Fachklinik</strong>en häufig als angemessen diskutiert wird. So liegt nach<br />
den letzten veröffentlichen Daten die durchschnittliche Verweildauer in psychosomatischen<br />
<strong>Fachklinik</strong>en für Krankenhausbehandlungen bei 43,3 und für Reha-Behandlungen bei 38,2<br />
Tagen 25 . Noch deutlich darüber liegen die Vorschläge einer Expertengruppe des<br />
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und<br />
Gesundheit und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern 26 , die rät,<br />
die mittlere Verweildauer in der akutstationären Behandlung von Patienten mit<br />
psychosomatischen Erkrankungen nicht unter 50 Tagen anzusetzen.<br />
unter 28 Tage<br />
5,9<br />
28-35 Tage<br />
47,5<br />
36-42 Tage<br />
32,9<br />
über 42 Tage<br />
13,7<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Abb. 21: Verweildauer in Tagen (Angaben in %)<br />
Insgesamt streuen die Behandlungen an den <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en hinsichtlich ihrer Dauer<br />
weniger als in früheren Jahren. Kurze Behandlungen von weniger als 28 Tagen sind<br />
seltener geworden (von 10 % in 2004/05 auf 6 % im Berichtsjahr), während die Häufigkeiten<br />
der vier- bis fünfwöchigen Behandlungen mit 48 % (2004/05 42 %) leicht zugenommen<br />
haben. Ähnlich sieht es auf der anderen Seite des Spektrums aus. Die langen Behandlungen<br />
von mehr als sechs Wochen (14 % gegenüber 8 % in 2004/05) haben leicht zugenommen,<br />
während die Häufigkeit der Aufenthalten von fünf oder sechs Wochen Dauer mit 33 % leicht<br />
abgenommen hat (41 % in 2004/05).<br />
2.2 Welche therapeutischen Maßnahmen sind hilfreich? -<br />
Einschätzung der Patienten<br />
Für die Behandlung steht an den <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en ein breites Spektrum<br />
therapeutischer Maßnahmen zur Verfügung. Einige dieser Maßnahmen (z. B.<br />
Einzelpsychotherapie, Sport- und Bewegungstherapie, Massage und Entspannung,<br />
Vorträge) werden sehr allgemein, andere spezifisch für bestimmte Teilgruppen von Patienten<br />
indiziert (z. B. Hypnose, Akupunktur, Phythotherapie oder Homöopathie). Die<br />
Behandlungsprogramme werden individuell zusammengestellt, wobei die therapeutischen<br />
Notwendigkeiten sowie die psychischen und physischen Möglichkeiten der Patienten<br />
berücksichtigt werden.<br />
24 n = 218 aus dem Therapeutenbericht, keine Angaben: n = 1 (0,5 %).<br />
25 Schulz H, Barghaan D, Harfst T, Dirmaier J, Watzke B, Koch U (2006) Versorgungsforschung in der<br />
psychosozialen Versorgung. Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 49:175-187.<br />
26<br />
Ergebnisbericht der Projektgruppe "Akutstationäre Versorgung von Patienten mit psychosomatischen<br />
Erkrankungen" in Bayern im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie,<br />
Frauen und Gesundheit und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern (Dezember 1999).
17<br />
Physikalisch Bewegung/Entsp. Ärztl./Naturheilkunde Psychotherapie<br />
Selbstsicherheitstraining (n=14)<br />
Einzelpsychotherapie (n=210)<br />
Visite (n=105)<br />
Aktive Musiktherapie (n=156)<br />
Gespräche Pflegepersonal (n=103)<br />
Angstexposition (n=36)<br />
Körperbildgruppe (n=47)<br />
Tanztherapie (n=182)<br />
Gehirnjogging (n=11)<br />
Körperwahrnehmungsgruppe (n=83)<br />
Familienstellen (n=39)<br />
Dialektisch Behaviorale Th. (n=36)<br />
Hüttenaufenthalt (n=34)<br />
Gruppenpsychotherapie (n=199)<br />
Atemtherapie (n=126)<br />
Schlafentzug (n=64)<br />
Hypnose (n=23)<br />
Kunst/Ausdrucksgruppe (n=34)<br />
Meditation (n=115)<br />
Ohr-Genusstherapie (n=103)<br />
Therapeutisches Malen (n=1<strong>08</strong>)<br />
Weibliche Sexualgruppe (n=26)<br />
Vorträge (n=2<strong>08</strong>)<br />
Ausleitende Verfahren (n=40)<br />
Akupunktur (n=63)<br />
Ernährungstherapie (n=14)<br />
Homöopathie (n=28)<br />
Phytotherapie (n=46)<br />
Aromatherapie (n=102)<br />
Biofeedback (n=43)<br />
Sport/Bewegungstherapie (n=180)<br />
Beckenbodengymnastik (n=82)<br />
Hochseilgarten (n=51)<br />
Ganzheitl. Bewegungstherapie (n=93)<br />
Wassergymnastik (n=67)<br />
Entspannung (n=147)<br />
Nordic Walking (n=91)<br />
Callanetics (n=28)<br />
Yoga (n=119)<br />
Massage (n=215)<br />
Hydro/Balneoherapie (n=37)<br />
Packungen (n=68)<br />
Aktive Meditation (n=115)<br />
Elektrotherapie (n=32)<br />
Qi-Gong (n=121)<br />
67,4<br />
67,8<br />
100<br />
99,5<br />
95,2<br />
94,9<br />
92,5<br />
91,7<br />
91,5<br />
91,2<br />
90,9<br />
90,4<br />
89,7<br />
88,9<br />
88,2<br />
87,4<br />
87,3<br />
85,9<br />
87<br />
85,3<br />
85,2<br />
81,6<br />
78,7<br />
76,9<br />
79,1<br />
75<br />
87<br />
84,3<br />
97,6<br />
97,5<br />
93,7<br />
92,9<br />
92,9<br />
94,4<br />
93,9<br />
92,2<br />
91,4<br />
89,6<br />
88,5<br />
85,7<br />
85,7<br />
84,9<br />
99,1<br />
97,3<br />
97,1<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Abb. 22: Akzeptanz therapeutischer Maßnahmen (Angaben in %)<br />
Insgesamt wird das Behandlungsprogramm sehr positiv angenommen. Die meisten der<br />
angewendeten Maßnahmen werden von mehr als 80 % der betroffenen Patienten als<br />
hilfreich eingeschätzt. Ausnahmen bilden das Biofeedback (67%) und Qi-Gong (68 %). Von<br />
den Psychotherapieformen wird die Einzeltherapie am häufigsten positiv eingeschätzt (100<br />
%), aber auch für die anderen Formen ist die Resonanz bei fast allen Patienten sehr positiv.
18<br />
3 Mit welchem Ergebnis<br />
3.1 Gesamteinschätzung<br />
3.1.1 Einschätzung der Veränderungen 27<br />
Allg. psych. Wohlbefinden<br />
86<br />
99,1<br />
Einstellung geg. Zukunft<br />
Krankheitsverständnis<br />
Kontakt-<br />
/Durchsetzungsfähigk.<br />
Berufl. Beziehungen<br />
13,4<br />
47<br />
81,6<br />
79,4<br />
78<br />
100<br />
96,4<br />
89,7<br />
Private Beziehungen<br />
Soziale Probleme<br />
20,4<br />
50<br />
79,1<br />
75,1<br />
Therapeutensicht<br />
Patientensicht<br />
Selbstwert/ Selbstannahme<br />
84,6<br />
96,5<br />
Seelisches Befinden<br />
88,8<br />
98,9<br />
Körperliches Befinden<br />
89<br />
81,3<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Abb. 23: Veränderungseinschätzungen aus Patienten- und Therapeutensicht<br />
(Angaben in %)<br />
Sowohl Patienten als auch Therapeuten geben zum Therapieende unabhängig voneinander<br />
ihre Einschätzung der während der Behandlung in den <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en erreichten<br />
Ergebnisse ab. Abbildung 23 zeigt für die verschiedenen Problembereiche jeweils den Anteil<br />
der Patienten, die sich nach eigenem Urteil oder im Urteil der behandelnden Therapeuten<br />
gebessert haben. Für diejenigen Bereiche, die zu Behandlungsbeginn häufig im Vordergrund<br />
standen (Abb. 19), zeigen sich durchweg sehr hohe Besserungsquoten.<br />
So liegen die Verbesserungsraten aus Sicht der Patienten im seelischen Befinden (89 %), im<br />
allgemeinen Wohlbefinden (86%) und im körperlichen Befinden (81 %) erfreulich hoch.<br />
Ähnlich positiv sehen die Betroffenen selbst die Behandlungsergebnisse in Bezug auf das<br />
Selbstwerterleben (85 %), die Kontakt- und Durchsetzungsfähigkeit (78 %) und die<br />
Einstellung gegenüber der Zukunft (82 %). Die Therapeuten sehen dabei sogar noch etwas<br />
öfter eine positive Entwicklung. Dies ist besonders auffällig bei den Veränderungen der<br />
sozialen Probleme und den beruflichen Beziehungen. Verschlechterungen werden von<br />
Patienten wie von Therapeuten sehr selten gesehen. Interessanterweise scheinen für viele<br />
27 Direkte Veränderungseinschätzung aus dem Patienten- und Therapeutenbericht; n = 219; für die Bewertung<br />
nicht ausreichende Angaben oder nicht relevanter Problembereich, für die einzelnen Skalen in der Tabelle<br />
angeführten Reihenfolge (von oben nach unten): Patienten: n=4 (1,8 %), n=13 (5,9 %), n=39 (17,8 %), n=37<br />
(16,9 %), n=92 (42,0 %), n=47 (21,5 %), n=67 (30,6 %), n=18 (8,2 %), n=5 (2,3 %), n=27 (12,3 %). Therapeuten:<br />
n=107 (48,9 %), n=90 (41,1 %), n=82 (37,4 %), n=83 (37,9 %), n=4 (1,8 %), n=32 (14,6 %), n=10 (4,6 %), n=106<br />
(48,4 %), n=130 (59,4 %), n=65 (27,7 %).
19<br />
der Patienten diese Veränderungen ihres Befindens mit einer Änderung ihres<br />
Krankheitsverständnisses verbunden zu sein.<br />
Wie im – geschützten – therapeutischen Raum der Kliniken wohl nicht anders zu erwarten,<br />
sind Veränderungen der sozialen Probleme (20 %) sowie der privaten (50 %) und beruflichen<br />
Beziehungen (13 %) im Vergleich zu den anderen Bereichen eher selten. Hier werden die<br />
Ergebnisse während der katamnestischen Zeit von besonderem Interesse sein.<br />
3.1.2 Auffälligkeitsraten 28<br />
auffälliger Verlauf<br />
8,2<br />
guter Verlauf<br />
91,8<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Abb. 24: Auffälligkeitsraten (Angaben in %)<br />
Die Gesamteinschätzung des Behandlungsergebnisses erfolgt nach der im "Heidelberger<br />
Modell" entwickelten Bewertungsregel. Dieses integriert die nach dem Konzept der<br />
"Klinischen Bedeutsamkeit" 29 bewerteten Veränderungen auf den verschiedenen<br />
Einzeldimensionen, die zur Messung des physischen, psychischen und sozialen Status<br />
sowie der psychosozialen Ressourcen der Patienten ausgewählt wurden. Dabei werden<br />
sowohl die Einschätzungen der für die Behandlung zuständigen Therapeuten als auch jene<br />
der Patienten einbezogen. Nach dieser Regel werden die Behandlungen nach ihren<br />
Ergebnissen in “auffällige” und “gute” unterschieden. Dem Urteil "auffällig" wird dabei eine<br />
Signalfunktion zugewiesen, d. h. wenn eine Behandlung ein im Sinne der vorab festgelegten<br />
Regel nicht hinreichend positives Ergebnis erzielt, wird dies als Signal verstanden, ihren<br />
Verlauf und ihr Ergebnis in einer der regelmäßig im Rahmen des QM durchgeführten<br />
Konferenzen ("interne Qualitätszirkel") klinisch zu diskutieren.<br />
Die auf diese Weise ermittelte globale Beurteilung der erreichten Ergebnisse bestätigt die<br />
positiven Urteile der Vorjahre über die Qualität der Behandlungen an den <strong>Panorama</strong><br />
<strong>Fachklinik</strong>en 30 . 92 % der Behandlungen werden in ihrem Ergebnis als mindestens "gut"<br />
beurteilt. Lediglich 8 % werden als "auffällig" bewertet, d. h. zeigen nicht hinreichend<br />
deutliche oder nicht hinreichend viele positive Veränderungen. Damit wird im aktuellen<br />
Berichtzeitraum das bereits in den Vorjahren erreichte hohe Niveau noch einmal leicht<br />
übertroffen.<br />
28 n = 219 aus Patienten- und Therapeutenbericht, keine für die Bewertung ausreichenden Angaben: n = 0.<br />
29 vgl. z. B. Kordy & Senf (1985) Überlegungen zur Evaluation psychotherapeutischer Behandlungen. PPmP 35:<br />
207-212.<br />
30 Wie bereits in der Übersicht erwähnt, wurde mit dem Übergang zum kontinuierlichen Ergebnismonitoring auch<br />
das Kerninventar der Qualitätssicherung verändert. Folglich ist die Auffälligkeitsrate des aktuellen<br />
Berichtszeitraumes nicht direkt mit den Raten früherer Berichte vergleichbar. Einen Hinweis auf die<br />
Übereinstimmung der neuen mit den alten Auffälligkeitsraten können m. E. die Veränderungsraten auf dem<br />
Beeinträchtigungsschwerescore geben, der sowohl im früheren als auch aktuellen Kerninventar enthalten ist.<br />
Dabei zeigt sich eine recht hohe Übereinstimmung bei den Auffälligkeitsraten (14,8 % in 2003/04; 13,8 % in<br />
2004/05) und den BSS-Veränderungsraten (2003/04: 77,6 % sehr verbessert oder verbessert; 2004/05: 77,8 %<br />
sehr verbessert oder verbessert).
20<br />
3.2 Therapieergebnis im Therapeutenurteil<br />
3.2.1 Beeinträchtigungsschwere 31<br />
Die Einschätzung der Beeinträchtigungsschwere (BSS) nach Schepank ist eines der beiden<br />
zentralen Einzelurteile aus der Sicht der Therapeuten. Für dieses diagnostische Instrument<br />
liegen gute Normen aus den epidemiologischen Untersuchungen der Mannheimer<br />
Arbeitsgruppe vor (vgl. z. B. Schepank, 1987). Ein Patient mit einem BSS-Summenwert über<br />
4 wird nach Schepank als "Fall" bezeichnet. Nach dieser Falldefinition werden 86,3 % der<br />
Patienten des aktuellen Berichtzeitraums zu Behandlungsbeginn von den Therapeuten als<br />
bedeutsam beeinträchtigt eingeschätzt (83 % in 2004/05). Die mittlere<br />
Beeinträchtigungsschwere bei Aufnahme beträgt 7,1 (s = 2,0) und liegt damit etwas höher<br />
als der von Schepank ermittelte Durchschnittswert in einer stationären psychotherapeutischpsychosomatischen<br />
Klientel. Der mittlere BSS-Summenwert bei Entlassung liegt bei 3,5 (s =<br />
1,9).<br />
sehr verbessert<br />
61,7<br />
verbessert<br />
unverändert<br />
19,4<br />
18,9<br />
etwas verschlechtert<br />
sehr verschlechtert<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Abb. 25: Beeinträchtigungsschwere (Angaben in %)<br />
Aufbauend auf den Referenzdaten wird ein Behandlungsergebnis dann als sehr gut<br />
bewertet, wenn aus einem "Fall" ein "Nicht-Fall" wird. Ein Ergebnis gilt als gut, wenn der BSS<br />
eine reliable Annäherung an die Werte zeigt, die normalerweise bei Nichtpatienten<br />
beobachtet werden. Negative Veränderungen werden entsprechend beurteilt.<br />
Die Anwendung dieser Bewertungsregel führt bei mehr als drei Viertel (81 %) der Patienten<br />
zum Urteil einer sehr guten Besserung (62 %) bzw. einer guten Besserung (19 %).<br />
Gegenüber früheren Jahren ist der Anteil der als "sehr verbessert" oder „verbessert“<br />
eingeschätzten Patienten nahezu konstant geblieben (78 % in 2004/05). Auch der Anteil der<br />
als "unverändert" eingeschätzten Patienten ist ähnlich wie im letzten Berichtszeitraum (19 %<br />
gegenüber 20 % in 2004/05). Einschätzungen als Verschlechterung kommen nicht vor (2 %<br />
in 2004/05).<br />
3.2.2 Globale Erfassung des Funktionsniveaus 32<br />
Zusätzlich wird das allgemeinen Funktionsniveaus anhand der GAF-Skala 33 (Global<br />
Assessment of Functioning) eingeschätzt. Dabei handelt es sich um eine globale<br />
Ratingskala, mit der ein Gesamturteil über die psychische, soziale und berufliche<br />
Leistungsfähigkeit des Patienten gegeben wird.<br />
31 n = 206 aus dem Therapeutenbericht, keine für die Bewertung ausreichenden Angaben: n = 13 (5,9 %)<br />
32 n = 2<strong>08</strong> aus dem Therapeutenbericht, keine für die Bewertung ausreichenden Angaben: n = 11 (5 %)<br />
33 Die GAF-Skala bildet die Achse V des DSM-IV (Saß, H., Wittchen, H.-U., & Zaudig, M. (1998). Diagnostisches<br />
und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV, 4. Auflage. Göttingen: Hogrefe).
21<br />
sehr verbessert<br />
25,5<br />
verbessert<br />
53<br />
unverändert<br />
15,5<br />
etwas verschlechtert<br />
2,3<br />
sehr verschlechtert<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Abb. 26: Globales Funktionsniveau (Angaben in %)<br />
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden an den <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en GAF-<br />
Skalenwerte sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Entlassung erhoben, die sich jeweils<br />
auf die letzten 7 Tage beziehen. Zusätzlich wird bei Aufnahme das allgemeine<br />
Funktionsniveau für die letzten 12 Monate beurteilt. Ein GAF-Wert kann zwischen 0 und 100<br />
liegen, wobei 100 ein vollständiges psychisches, soziales und berufliches Funktionsniveau<br />
beschreibt. In Anlehnung an Steinhausen (1987) 34 wählen wir einen Cut-off-Score von 70<br />
Punkten, um zwischen gesundem und pathologischem Funktionsniveau zu unterscheiden.<br />
Der mittlere GAF-Wert liegt bei Aufnahme bei 50,9 (7 Tage) (s = 9,0), bei Entlassung bei<br />
66,5 (s = 10,9). Die Bewertung des Behandlungsergebnisses erfolgt wieder nach dem oben<br />
beschriebenen Prinzip der „reliablen“ bzw. „klinisch-bedeutsamen“ Veränderung. Dabei zeigt<br />
sich bei einem Drittel (26 %) der Patienten eine sehr gute, d.h. klinisch bedeutsame,<br />
Verbesserung und bei der Hälfte (53 %) eine gute (d.h. reliable) Besserung.<br />
Verschlechterungen kommen nur sehr selten (2 %) vor.<br />
3.3 Therapieergebnis im Patientenurteil<br />
3.3.1 Klinisch-Psychologisches Diagnosesystem-38 35<br />
Allg. Befinden m. körperlichen Aspekten<br />
Psychische Beschwerden<br />
3,2<br />
2,7<br />
64,4<br />
68<br />
Soziale Probleme<br />
9,1<br />
42<br />
Handlungskompetenz<br />
5<br />
34,8<br />
Zufriedenheit<br />
3,2<br />
39,7<br />
verschlechtert<br />
verbessert<br />
KPD-38 Gesamtskala<br />
4,6<br />
73,1<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Abb. 27: Klinisch Psychologisches Diagnosesystem KPD-38 (Angaben in %)<br />
34 Steinhausen, H. C. (1987). Global assessment of child psychopathology. Journal of the American Academy of<br />
Child and Adolescent Psychiatry 26, 203-206.<br />
35 n = 219 aus dem Patientenbericht, für die Bewertung nicht ausreichenden Angaben für die alle Skalen n = 0 (0<br />
%).
22<br />
Das Klinisch-Psychologische Diagnosesystem 38 36 bildet das Kerninstrument für<br />
Qualitätssicherung und Ergebnismonitoring nach dem Heidelberger Modell. Es ersetzt das<br />
früher verwendete Inventar, das die Symptom-Check-List (SCL-90-R), das Inventar<br />
Interpersonaler Probleme (IIP) und den Giessener Beschwerdebogen (GBB) umfasste. Es<br />
erweitert das Inventar um ressourcenorientierte Merkmale. Im Rahmen der<br />
Qualitätssicherung werden die 5 Subskalen „Allgemeines körperliches Befinden“,<br />
„Psychische Beschwerden“, „Soziale Probleme“, „Handlungskompetenz“ und<br />
„Lebenszufriedenheit“ betrachtet.<br />
Die Bewertung des Behandlungsergebnisses in Bezug auf die Gesundheit erfolgt wieder<br />
nach dem bereits für die anderen Änderungsdimensionen explizierten Prinzip der "reliablen"<br />
bzw. "klinisch bedeutsamen" Veränderung. Um den Überblick zu erleichtern werden für die<br />
Einzelskalen die Quoten für positive und negative Änderungen jeweils gegenübergestellt.<br />
Die durch den Globalindex ausgedrückte allgemeine Befindlichkeit verbessert sich bei 73 %<br />
der Patienten (66 % in 2004/05). Eine negative Veränderung gibt es mit lediglich 5 % sehr<br />
selten. Dieses positive Bild spiegeln auch die Veränderungen auf den spezifischen Skalen<br />
wider: besonders im psychischen (68 %) und körperlichen (64 %) Befinden bei sehr seltenen<br />
negativen Veränderungen (jeweils 3 %). Auch bei den übrigen Skalen überwiegen die<br />
positiven Veränderungen die negativen bei weitem. Dabei zeigt sich eine deutliche<br />
Steigerung der Verbesserungsrate gegenüber den Vorjahren bei den psychischen<br />
Beschwerden (68 % gegenüber 53 % in 2004/05).<br />
3.4 Patientenzufriedenheit 37<br />
Behandlungsqualität<br />
Klinik entsprach Bedürfnissen<br />
würde Klinik empfehlen<br />
mit erhaltener Hilfe zufrieden<br />
besser mit Problemen umgehen<br />
würde wiederkommen<br />
Behandlungszuf. insges.<br />
gewollte Behandlung erhalten<br />
96,8<br />
91,7<br />
94,9<br />
91,7<br />
95,9<br />
94<br />
94<br />
88,9<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Abb. 28: Patientenzufriedenheit (Angaben in %)<br />
Die Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung hat in der Qualitätssicherung einen<br />
hohen Stellenwert. Auch wenn Zufriedenheit nicht mit Ergebnisqualität gleichgesetzt werden<br />
kann, ist das Patientenurteil sehr ernst zu nehmen. Gerade bei Ausbleiben der Zustimmung<br />
der Patienten muss den Gründen hierfür selbstkritisch nachgegangen werden.<br />
In den bisherigen Berichtszeiträumen hatten sich die Patienten sehr zufrieden mit der<br />
Behandlung in den <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en und den dabei erreichten Ergebnissen geäußert.<br />
Diese auch im Vergleich zu Berichten aus anderen psychosomatisch-psychotherapeutischen<br />
36 Percevic, R., Gallas, C., Wolf, M., Haug, S., Hünerfauth, T., Schwarz, M. & Kordy, H. (2005). Das Klinisch<br />
Psychologische Diagnosesystem (KPD-38): Entwicklung, Normierung und Validierung eines Selbstbeurteilungsbogen<br />
für den Einsatz in Qualitätssicherung und Ergebnismonitoring in der Psychotherapie und<br />
psychosomatischen Medizin. Diagnostica, 51, 134-144.<br />
37 n = 217 aus dem Patientenbericht, keine für die Bewertung ausreichenden Angaben: n = 2 (0,9 %).
23<br />
<strong>Fachklinik</strong>en sehr hohe Zufriedenheitsquote bestätigt sich für den aktuellen Berichtszeitraum.<br />
Die Zufriedenheitsraten liegen dabei ähnlich hoch wie in früheren Jahren. Die Patienten<br />
attestieren fast ausnahmslos eine gute Behandlungsqualität (97 %) und sind insgesamt mit<br />
der Behandlung zufrieden (94 %). Fast alle glauben, mit ihren Problemen besser umgehen<br />
zu können (96 %), würden selber wiederkommen (94 %) und die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en<br />
anderen empfehlen (95 %).<br />
4 Zusammenfassung und Ausblick<br />
Qualitätssicherung macht das Geschehen in einer Klinik transparent. Die Mitarbeiter der<br />
Klinik erhalten durch kontinuierliche Beobachtung, systematische Dokumentation und<br />
standardisierte Ergebnisevaluation eine Rückmeldung sowohl über ihre Arbeit und deren<br />
Ergebnisse als auch über die Akzeptanz, die ihre Arbeit bei den Patienten findet. Gleichzeitig<br />
erhalten auch Patienten und Kostenträger Orientierungshilfen. Insofern überrascht, dass<br />
auch heute immer noch gilt, dass "Qualitätssicherung noch keinen zentralen, systematischen<br />
Stellenwert in der medizinischen Versorgung hat" 38 . Auch wenn sich zunehmend mehr<br />
Kliniken an einer systematischen Dokumentation beteiligen, etwa unter Nutzung der Bayern-<br />
Doku oder der PsyBaDo für die Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin 39 , die in<br />
Zusammenarbeit mit der AWMF ("Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer<br />
Fachgesellschaften") erarbeitet wurde, ist eine flächendeckende QS noch in weiter Ferne.<br />
Nur wenige Kliniken nutzen die Chance, sich durch Informationen über<br />
Behandlungsergebnisse und Patientenzufriedenheit ihren zukünftigen Patienten sowie<br />
Krankenkassen bzw. -versicherungen vorzustellen.<br />
An den <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en für Psychosomatik, Psychotherapeutische Medizin und<br />
Naturheilverfahren wird seit fast fünfzehn Jahren ein Qualitätsmanagement routinemäßig<br />
durchgeführt, welches die Ergebnisqualität in den Mittelpunkt stellt. Resümiert man die<br />
Entwicklung über diesen Zeitraum hinweg, so zeigt sich, dass in bezug auf den zentralen<br />
Qualitätsindikator das bereits sehr hohe Niveau der letzten Jahre noch einmal gesteigert<br />
werden konnte. Auch die hohe Patientenzufriedenheit der letzten Jahre wurde im aktuellen<br />
Berichtszeitraum bestätigt.<br />
Im Mittelpunkt des Qualitätsmanagements der <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en steht die Qualität der<br />
Behandlungsergebnisse. Die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en arbeiten mit einem intensiven, aber in<br />
Relation zu vergleichbaren <strong>Fachklinik</strong>en eher kurzen Behandlungsprogramm mit einer<br />
mittleren Verweildauer von 37 Tagen. Das zeigen beispielsweise die bereits erwähnten<br />
Daten des statistischen Bundesamtes zur psychosomatischen Versorgung (Fußnote 25), das<br />
eine durchschnittliche Verweildauer von 38-43 Tagen in psychosomatischen Kliniken<br />
berichtet.<br />
Skalenbezeichnung Aufnahme –<br />
Entlassung<br />
Allgemeinbefinden mit körperl. Aspekten KPD-38 1,29<br />
Psychische Beschwerden KPD-38 1,06<br />
Soziale Probleme KPD-38 0,51<br />
Handlungskompetenz KPD-38 0,59<br />
Zufriedenheit KPD-38 0,95<br />
Gesamtskala KPD-38 1,14<br />
Tabelle 1. Normierte mittlere Veränderungen auf dem KPD-38<br />
38<br />
Schwartz FW et al. (1995) Gesundheitssystemforschung in Deutschland - Denkschrift. VCH<br />
Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim.<br />
39 Heuft G & Senf W (1998) Praxis der Qualitätssicherung in der Psychotherapie: Das Manual zur PsyBaDo.<br />
Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
In der vergleichsweise kurzen Behandlungszeit erreichen die Patienten der <strong>Panorama</strong><br />
<strong>Fachklinik</strong>en sehr gute Ergebnisse. Betrachtet man etwa die normierten mittleren<br />
Veränderungen (die sich mit den häufig berichteten Effektstärken vergleichen lassen), so<br />
zeigt sich eine deutliche Verbesserung des (körperlichen) Allgemeinbefindens, der<br />
psychischen Beschwerden sowie der Lebenszufriedenheit (psychometrisch gemessen mit<br />
dem KPD-38). In den geplanten katamnestischen Nachuntersuchungen (6 bzw. 12 Monate<br />
nach Klinikentlassung), die die <strong>Panorama</strong> <strong>Fachklinik</strong>en routinemäßig wieder aufnehmen<br />
werden, wird sich die Nachhaltigkeit dieser erreichten positiven Veränderungen des<br />
Gesundheitszustandes erweisen müssen.<br />
24