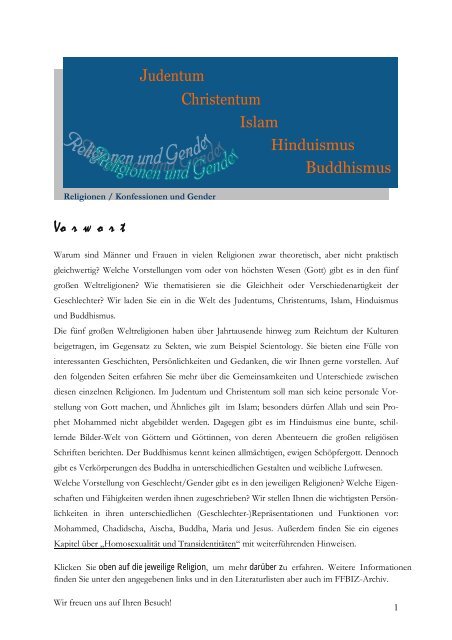Buddhismus - FFbiz
Buddhismus - FFbiz
Buddhismus - FFbiz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vo r w o r t<br />
Warum sind Männer und Frauen in vielen Religionen zwar theoretisch, aber nicht praktisch<br />
gleichwertig? Welche Vorstellungen vom oder von höchsten Wesen (Gott) gibt es in den fünf<br />
großen Weltreligionen? Wie thematisieren sie die Gleichheit oder Verschiedenartigkeit der<br />
Geschlechter? Wir laden Sie ein in die Welt des Judentums, Christentums, Islam, Hinduismus<br />
und <strong>Buddhismus</strong>.<br />
Die fünf großen Weltreligionen haben über Jahrtausende hinweg zum Reichtum der Kulturen<br />
beigetragen, im Gegensatz zu Sekten, wie zum Beispiel Scientology. Sie bieten eine Fülle von<br />
interessanten Geschichten, Persönlichkeiten und Gedanken, die wir Ihnen gerne vorstellen. Auf<br />
den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen<br />
diesen einzelnen Religionen. Im Judentum und Christentum soll man sich keine personale Vor-<br />
stellung von Gott machen, und Ähnliches gilt im Islam; besonders dürfen Allah und sein Pro-<br />
phet Mohammed nicht abgebildet werden. Dagegen gibt es im Hinduismus eine bunte, schil-<br />
lernde Bilder-Welt von Göttern und Göttinnen, von deren Abenteuern die großen religiösen<br />
Schriften berichten. Der <strong>Buddhismus</strong> kennt keinen allmächtigen, ewigen Schöpfergott. Dennoch<br />
gibt es Verkörperungen des Buddha in unterschiedlichen Gestalten und weibliche Luftwesen.<br />
Welche Vorstellung von Geschlecht/Gender gibt es in den jeweiligen Religionen? Welche Eigen-<br />
schaften und Fähigkeiten werden ihnen zugeschrieben? Wir stellen Ihnen die wichtigsten Persön-<br />
lichkeiten in ihren unterschiedlichen (Geschlechter-)Repräsentationen und Funktionen vor:<br />
Mohammed, Chadidscha, Aischa, Buddha, Maria und Jesus. Außerdem finden Sie ein eigenes<br />
Kapitel über „Homosexualität und Transidentitäten“ mit weiterführenden Hinweisen.<br />
Klicken Sie oben auf die jeweilige Religion, um mehr darüber zu erfahren. Weitere Informationen<br />
finden Sie unter den angegebenen links und in den Literaturlisten aber auch im FFBIZ-Archiv.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
Judentum<br />
Religionen / Konfessionen und Gender<br />
Christentum<br />
Islam<br />
Hinduismus<br />
<strong>Buddhismus</strong><br />
1
1. Glaubengrundsätze<br />
2. Schriften<br />
3. Strömungen<br />
4. Die Götterwelt westsemitischer Völker<br />
5. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ – Das Gottesbild JHWHs<br />
6. Verschiedene Lesarten der Schriften<br />
7. Schöpfungsmythen: Adam, Eva und Lilith<br />
Glaubengrundsätze<br />
Zum Judentum bekennen sich heute zirka 14. Millionen Menschen auf der Welt. Es ist die älteste<br />
der drei Weltreligionen mit Glauben an einen Gott (Monotheismus). Gott, Jahwe, wird als<br />
Schöpfer aller Dinge angesehen. Er hat die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Der<br />
Nomade Abraham wird als jüdischer Ur-Vater betrachtet, auf den sich auch das Christentum und<br />
der Islam beziehen. Mit Abraham beginnt die Geschichte des jüdischen Volkes. Doch ob er<br />
wirklich gelebt hat, und ob der biblische Bericht vom Auszug aus Ägypten historisch nachweisbar<br />
ist, ist in der Forschung umstritten.<br />
Die Glaubensgrundsätze stammen unter anderem aus den zehn Geboten, die in den fünf<br />
Büchern Moses, in der Tora, festgehalten wurden. Danach steht der Mensch vor Gott und ist für<br />
seine Taten verantwortlich. Juden erwarten den Messias, der kommen wird, um die Welt zu<br />
erlösen. Im Judentum gibt es keine eindeutigen Vorstellungen von einem Leben nach dem Tode.<br />
Es ist stark auf das Diesseits orientiert, das als prinzipiell gut, weil von Gott geschaffen und vom<br />
Menschen gestaltet, gilt.<br />
Judentum<br />
2
Schriften<br />
Die hebräische Bibel Tanach besteht aus der Tora (Bücher Moses mit 613 Gesetzen), den Nebiim<br />
(Bücher der Propheten) und den Ketubim (Schriften). Diese Texte bilden in anderer Anordnung<br />
und Gewichtung auch die Grundlage des Alten Testaments im Christentum. Die hebräische Bibel<br />
ist eine Sammlung verschiedener Bücher unterschiedlicher literarischer Formen: Erzählungen,<br />
Gedichte, Prophezeiungen, Gesetze. Neben den zum Teil ganz unbekannten Verfassern oder<br />
Autorengruppen arbeiteten unzählige Abschreiber, Sammler, Kommentatoren und Herausgebern<br />
an den Schriften. Eine Frau als Autorin wird nirgendwo erwähnt. In ihrer mehr als<br />
tausendjährigen Entstehungsgeschichte von den mündlichen Überlieferungen bis zu ihrer<br />
endgültigen schriftlichen Form wurde die Bibel immer wieder umgeschrieben, verändert und neu<br />
übersetzt. Da sie von Menschen gemacht ist, spiegelt sie unterschiedliche kulturelle Einflüsse,<br />
Interpretationen und Absichten.<br />
Der Talmud ist die zweite wichtige Schrift im Judentum. Er besteht aus der Mischna, eine<br />
Sammlung von religiösen Gesetzen und der Gemara, der Diskussion dieser Gesetze. Die Mischna<br />
Strömungen<br />
enthält unter anderem Regeln zum Ehe-, Familien-, und Strafrecht<br />
und stellt Reinlichkeitsgebote für die Geschlechter auf. In der<br />
Gemara, dem zweiten Teil des Talmuts, werden diese Gesetze in<br />
Form von Geschichten und Gleichnissen ausgelegt und kommentiert.<br />
Diese mündliche Lehre wurde in der Regel von männlichen jüdischen<br />
Gelehrten über Generationen hinweg verbal weitergegeben,<br />
gesammelt und schließlich in eine schriftliche Form gebracht.<br />
Das Judentum unterteilt sich heute in drei Hauptströmungen: Orthodoxes, progressives und<br />
konservatives Judentum. Das orthodoxe Judentum hält trotz gesellschaftlicher Veränderungen<br />
unverändert an den alten Gebräuchen fest. Die Thora gilt als das direkt geoffenbarte Wort<br />
Gottes. Die religiösen Schriften gehen davon aus, dass Menschen als zweierlei Geschlecht<br />
geschaffen wurden, als Mann und Frau. In den Schriften gibt es Anweisungen dazu, welche<br />
sexuellen Praktiken zwischen welchen Geschlechtern erlaubt sind, und welche nicht. Nach<br />
einigen Auslegungen lehnt die hebräische Bibel (z. B. Leviticus 18,22 und 20, 13) Homosexualität<br />
ab und sieht Strafen dafür vor.<br />
3
Das orthodoxe Judentum betrachtet die Geschlechter als gleichwertig vor Gott, aber nicht als<br />
gleichartig. Aus der Verschiedenheit der Geschlechter begründet es getrennte Arbeits- und<br />
Aufgabenbereiche. Der Mann soll sich vorrangig dem Studium der heiligen Schriften und der<br />
Religionsgesetze widmen. Die Frau ist zuständig für die Bewahrung der religiösen Tradition vor<br />
allem in der Familie. Im Judentum existiert ein Mythos der „starken jüdischen Frau“, die neben<br />
ihrer Erwerbstätigkeit und der Familienarbeit dem Mann noch den „Rücken“ für seine geistigen<br />
Studien freihält. Jüdische Gelehrte huldigen ihr dafür in zahlreichen Textstellen der Schriften<br />
(Lob der tüchtigen Hausfrau, Sprüche Salomon 12, 4). Der Zugang zu geistlichen Ämtern ist<br />
abhängig vom zugeschriebenen Geschlecht des Menschen: Männer dürfen das Amt von<br />
Geistlichen = Rabbinern übernehmen, lesen aus dem Talmud oder der Tora vor und<br />
interpretieren die Gesetze. Frauen sind davon ausgeschlossen. In den religiösen<br />
Versammlungsräumen, den Synagogen, sitzen Frauen und Männer separat, manchmal auch durch<br />
einen Vorhang getrennt.<br />
Die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, gilt als Leitlinie für das religiöse Leben im Alltag. In<br />
Tora und Talmud gibt es mehr als 613 Gesetzte: 248 Gebote und 365 Verbote. Darin ist unter<br />
anderem festgelegt, dass eine Ehescheidung nur auf Initiative des Mannes erfolgen kann. Die<br />
Frau willigt durch Berührung des Scheidungsdokumentes in die Trennung ein. Es gibt klare<br />
Reinlichkeitsvorschriften für Männer und Frauen. Der Verlust von Menstruationsblut und<br />
Sperma gelten als unrein. Der Zustand der Reinheit muss durch ein rituelles Bad wieder<br />
hergestellt werden. Der Geschlechtsverkehr zwischen Männern und Frauen ist während der<br />
Menstruation der Frau und einige Tage danach verboten. Auch nach der Geburt eines Kindes<br />
fordern die Gesetze von den Ehepartnern Enthaltsamkeit und eine Absonderung der Frau von<br />
der religiösen Gemeinschaft. Diese gilt für einen Zeitraum von 40 Tagen nach der Geburt eines<br />
Jungen und 80 Tagen nach der Geburt eines Mädchens.<br />
Das progressive Judentum entwickelte sich stark im 19. Jahrhundert mit liberalen,<br />
reformorientierten Ausprägungen. Die Offenbarungen Gottes werden als ein fortschreitender<br />
Prozess verstanden und können von Menschen neu ausgelegt werden. Die Regeln des Talmuds<br />
sind nicht göttlichen Ursprungs, sondern durch Menschen gemacht. Für das progressive<br />
Judentum sind sie abhängig von der Zeit, in der sie entstanden sind und daher veränderbar.<br />
Männer und Frauen werden im progressiven Judentum gleichgestellt. In der Synagoge sitzen die<br />
Geschlechter gemischt. Männer und Frauen haben gleichberechtigten Zugang zu den religiösen<br />
Ämtern. Schon 1936 wurde Regina Jonas als erste Rabbinerin in Deutschland eingesetzt. Generell<br />
gilt die Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Es gibt<br />
4
liberale Gemeinschaften schwuler, lesbischer und bisexueller Jüdinnen und Juden und eine erste<br />
Generation lesbischer Rabbinerinnen.<br />
Das konservative Judentum entstand im 19. Jahrhundert in Europa und bewegt sich zwischen<br />
orthodoxem und progressivem Judentum. Auch die konservative Bewegung ordiniert seit 1984<br />
Frauen als Rabbinerinnen, d.h. führt sie in ihr Amt ein.<br />
Die Götterwelt westsemitischer Völker<br />
Zur Zeit der Entstehung des Judentums beteten die Menschen im Alten Orient verschiedene<br />
Götter und Göttinnen an. Diese symbolisierten die Kräfte der Natur oder die vier Elemente,<br />
„Feuer“, "Wasser", "Luft" und "Erde". Auch jede Stadt hatte einen eigenen Schutzgott. Das<br />
Prinzip der Fruchtbarkeit wurde dabei sowohl in weiblicher als auch in männlicher Gestalt<br />
angebetet. Ischtar, die babylonische Göttin des Kampfes und der Liebe, wurde im gesamten<br />
Alten Orient unter verschiedenen Namen verehrt: Ashtar, Astarte, Ashera, Inanna. Als<br />
Doppelcharakter hat sie eine helle und dunkle Seite und tritt in unterschiedlichen<br />
Erscheinungsformen der einen Hauptgöttin auf. Sie ist die Göttin des Abend- und Morgensterns,<br />
des Himmels- und der Unterwelt, Mutter- und Liebesgöttin, Göttin der Fruchtbarkeit und der<br />
Wollust. Dargestellt wird sie oft als Kriegsgöttin mit Hörnermütze, Köchern auf dem Rücken<br />
und Pfeilen und Bogen in den Händen.<br />
Baal (Bhaal, Bel, Bēl) ist eine Bezeichnung aus dem Altertum für verschiedene Gottheiten im<br />
syrischen und levantinischen Raum. Der Begriff bedeutet Herr, Meister, Besitzer, Ehemann,<br />
König oder Gott und kann für jeden Gott benutzt werden. Er ist der Fruchtbarkeits-, Regen-,<br />
Gewitter-, Berg- und Sturmgott westsemitischer Völker. Als Ehemann der Astarte steht auch er<br />
für lebensspendende und -zerstörende Kräfte. Dargestellt wird er mit Donnerkeil und<br />
erhobenem Arm, der Blitze schleudert.<br />
Die Erzählungen über die ältesten Götter und Göttinnen des ägyptischen Raums und vieler<br />
Regionen rund um das Mittelmeer stellen sie oftmals doppelgeschlechtlich (androgyn) vor, so wie<br />
auch in der griechischen Mythologie. Die Religion des jüdischen Volkes, der 12 Stämme Israels,<br />
entstand also in einer Welt der Vielgötterei (Polytheismus). Die hebräischen Stämme führten<br />
Krieg mit anderen Völkern in der Kulturlandschaft Kanaans, die Göttinnen verehrten,<br />
5
Tempelprostitution betrieben und Sexualität als Teil ihres religiösen Lebens würdigten. In der<br />
hebräischen Bibel finden sich noch Spuren dieser Götterkulte, die scharf verurteilt werden.<br />
„Du sollst dir kein Bildnis machen“ – Das Gottesbild JHWHs<br />
Das Judentum basiert auf den Glauben an den einen<br />
Gott, der den Namen des Unaussprechlichen,<br />
Jahwe, trägt. Dieser wird unter anderem mit<br />
folgenden männlichen Beinamen belegt: Herr,<br />
Vater, Gemahl, König, Richter, Kriegsherr, Hirte.<br />
Er gilt als der Schöpfer der Welt und als eine<br />
gewaltige Macht jenseits dieser Welt. Gott wird als<br />
allwissend, allmächtig und allgegenwärtig angesehen.<br />
Er erscheint als Träger positiver menschlicher<br />
Eigenschaften in überhöhter Form, wie unfehlbare<br />
Gerechtigkeit, allumfassende Liebe und Güte. Er<br />
unterliegt keinen zeitlichen Begrenzungen und<br />
keinem Wandel, sondern gilt als ewig, also<br />
unveränderlich. Auf der einen Seite wird Jahwe von<br />
Menschen annäherungsweise in „männlichen“<br />
Bildern, Rollen und Funktion beschrieben, auf der anderen Seite erscheint er als geschlechtsloses<br />
Wesen. In der hebräischen Bibel gibt es keine Äußerungen über die Gestalt Gottes. Auch in den<br />
Berichten der Propheten, die ihn im Traum oder als Vision sahen, fällt nie ein Wort über sein<br />
Aussehen oder seine Geschlechtsmerkmale. Im Gegensatz zu vielen Göttern und Göttinnen des<br />
Polytheismus hat Jahwe keine sexuelle Biographie, keine sexuelle Partnerschaft und zeugt auch<br />
keine Nachkommen. Er soll nicht in menschlichen Abbildungen dargestellt werden<br />
(Bilderverbot).<br />
Verschiedene Lesarten der Schriften<br />
Die jüdische feministische Theologie beschäftigt sich unter anderem mit der sogenannten<br />
„weiblichen" Seite Gottes. Sie verweist dabei auf Eigenschaften, die im Hebräischen als<br />
„Schechina“ und „Hochma“ bezeichnet werden und für die Herrlichkeit und Weisheit Jahwes<br />
6
stehen. Da diese Begriffe der Grammatik nach weiblich sind, werden aus ihnen auch weibliche<br />
Tugenden abgeleitet. Die Autorinnen weisen auf Gleichnisse hin, wo Gott sich der Bibel nach<br />
selbst als „Gebärende“ oder als „Mutter“ im Verhältnis zu seinem Volke beschreibt. Er erscheint<br />
als „Bärin“, der man die Jungen geraubt hat und als „Adlermutter“, die ihre Kinder unter ihren<br />
Flügeln schützt. Wir können fragen: Werden hier Anteile der „Fruchtbarkeits- und<br />
Muttergöttinnen“ „Jahwe“ zugeschrieben und warum? Durch die Gleichsetzung von „weiblich“<br />
mit Begriffen wie „fürsorglich“, „behütend“ oder „beschützend“, schreiben manche Autorinnen<br />
dem „Weiblichen“ wesenhafte, scheinbar natürliche und immerwährende Eigenschaften zu.<br />
Dadurch wird, wie im orthodoxen Judentum, die Andersartigkeit der Geschlechter betont, und<br />
diese werden auf bestimmte Rollen und Funktionen festgelegt.<br />
Eine andere Leseart der Schriften untersucht die Beziehung zwischen Mensch und Gott wie der<br />
Autor Eilberg-Schwartz. Diese Beziehung wird mit Begriffen wie Liebe und Hingabe<br />
umschrieben. Das traditionelle Judentum fasst die Frau als den natürlichen, ergänzenden<br />
Gegenpart zum Mann auf. Aus den unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen werden<br />
Eigenschaften abgeleitet, die verschiedene Aufgaben und Gender-Rollen nach sich ziehen. Die<br />
Liebesbeziehung zwischen unterschiedlichen Geschlechtern gilt als Norm und die zwischen<br />
Gleichgeschlechtlichen als unnatürlich. Daher ist nach Eilberg-Schwartz der gläubige Jude in<br />
erster Linie ein männlicher Gläubiger. Dieser darf keine (Liebes)beziehung mit einem Gott<br />
eingehen, der männliche Geschlechtsmerkmale hat. Dadurch entstünde der Verdacht der<br />
Homoerotik. Deshalb erscheint Gott in den Schriften als geschlechtslos und körperlos. Eine<br />
eigenwillige Interpretation!<br />
Schöpfungsmythen: Adam, Eva und Lilith<br />
In der hebräischen Bibel gibt es zwei Versionen über die Entstehung<br />
der Menschen. Die erste Schöpfungsgeschichte berichtet, dass Gott<br />
den Menschen am 5. Tag nach seinem (Eben)bilde als Mann und Frau<br />
erschuf (Genesis 1). Im zweiten Schöpfungsbericht (Genesis 2-3)<br />
erschuf Gott zuerst den Mann „Adam“ und aus seiner Rippe die Frau<br />
„Eva“ als seine Helferin. In dieser Schrift steht, dass Gott ein Wesen<br />
aus der Ackererde bildete, diesem den Lebensatem einhauchte und ihn<br />
in den Garten Eden setzte. Jüdische Theologinnen gehen oft davon<br />
aus, dass dem ersten Geschöpf noch kein Geschlecht zugeordnet wurde. Für sie ist der Begriff<br />
7
„Adam“ eine Gattungsbezeichnung für Menschen und noch kein Name für einen Mann. Um die<br />
Einsamkeit dieses Wesens zu lindern, baut Gott, der zweiten Überlieferung nach, aus seiner<br />
Rippe einen zweiten Menschen. Aus dem ersten androgynen Menschen entstehen zwei, die jetzt<br />
geschlechtlich unterschieden werden. Adam erkennt Eva als ihm ähnlich. Diese Ähnlichkeit<br />
zwischen den beiden Geschlechtern wird noch durch die hebräischen Namen „Isch“ und „Ischa“<br />
betont. Der Rest der Geschichte ist bekannt: Eva verführt Adam dazu, vom Baum der<br />
Erkenntnis zu essen, und es folgt die Vertreibung aus dem Paradies. Die Einteilung in zwei<br />
Geschlechter erscheint in beiden Versionen also als gottgewollt. Am Ende der zweiten, der<br />
wahrscheinlich geschichtlich jüngeren Erzählung, wird nach der Unterschiedlichkeit der<br />
Geschlechter auch noch die Hierarchie der Geschlechter formuliert „Du hast Verlangen nach<br />
deinem Manne, er aber wird über dich herrschen“ (1. Buch Moses 3,16).<br />
Es gibt Hinweise auf weitere Versionen der Schöpfungsgeschichte auch unter Israeliten. Sie<br />
werden im jüdischen Talmud und in der hebräischen Bibel (Jesaija 34,14) erwähnt. In dieser<br />
Version ist Lilith ein erster Mensch, geschlechtslos, oder aber die erste Frau Adams vor Eva.<br />
Nach jüdischen Sagen streitet Lilith mit Adam und verschwindet aus<br />
dem Paradies in die Wüste. Sie bleibt aber unsterblich, vereinigt sich mit<br />
Dämonen und bringt Dämonenkinder zur Welt. In anderen Überlieferungen<br />
wird sie durch den Tod ihrer Kinder bestraft und verwandelt sich selbst in<br />
einen Geist, der die neugeborenen Kinder der Menschen tötet. Lilith, im Hebräischen „die<br />
Nächtliche“, wird schließlich im alten Mesopotamien zum weiblichen Dämon des<br />
Kindbettfiebers. In der Version der jüdisch-feministischen Theologie aber steht Lilith entweder<br />
für den ersten Menschen überhaupt oder aber für die eigenständige starke Frau, die Adam den<br />
Gehorsam, also die Unterordnung, verweigert. Die verschiedenen Vorstellungen zu Lilith haben<br />
vor allem im 19. Jahrhundert, während der sog. Ersten Frauenbewegung, besonders männliche<br />
Künstler zu unterschiedlichen Darstellungen angeregt.<br />
Jüdisch-rabbinische Literatur deutet eine vierte Version der<br />
Schöpfungsgeschichte an. Adam wird danach auch als zweigesichtiges,<br />
androgynes Wesen beschrieben, das männliche und weibliche Merkmale<br />
aufweist. Demnach schuf Gott den Menschen zuerst als Hermaphroditen und<br />
teilte dieses Geschöpf dann in zwei voneinander getrennte Körper. Diese<br />
Betrachtung ähnelt anderen Schöpfungsmythen. Nach persischen Legenden<br />
lebte das erste Menschenpaar, als Licht und Dunkelheit, im Garten Eden, zuerst<br />
gemeinsam in einem Körper. Auch die griechischen Mythen berichten davon,<br />
dass Prometheus den Menschen zuerst androgyn, als Wesen aus Lehm erschuf und die Göttin<br />
8
Athene ihn lebendig machte. Nach der Geschichte von Platon trennte der Göttervater Zeus die<br />
ursprünglichen Kugelmenschen, die aus drei Geschlechtern bestanden, und nahm vom<br />
weiblichen Körper ein Stück Lehm, dass er dem Manne ansetzte.<br />
Weiterführende Informationen<br />
Bet Deborah. Frauenperspektiven im Judentum<br />
http://www.bet-debora.de/<br />
http://www.talmud.de/cms/Hauptseite.45.0.html<br />
http://www.hagalil.com/judentum/<br />
http://www.religion-online.info/judentum/themen/themen.html<br />
http://www.verlagderweltreligionen.de/<br />
Bridges. A Jewish Feminist Journal<br />
http://bridgesjournal.org/<br />
Nashim. A Journal of Jewish Women´s Studies & Gender Issues<br />
http://muse.jhu.edu/demo/nashim<br />
Lilith. A Feminist History Journal: www.history.unimelb.edu.au/lilith/<br />
9
1. Glaubensgrundsätze<br />
2. Orthodoxe, Katholische und Evangelische Kirchen<br />
3. Schriften<br />
4. Geschlechterordnung, -hierarchie und –beziehungen<br />
5. Bekleidungsvorschriften für die Geschlechter<br />
6. Maria und Jesus: historische Figuren und Mythengestalten<br />
Glaubensgrundsätze<br />
Christentum<br />
Das Christentum ist mit über zwei Milliarden Anhängern noch die größte der fünf Weltreligionen.<br />
Seine Wurzeln liegen im Judentum. Die Christen glauben wie die Juden an einen Gott, von dem<br />
man sich kein Bild machen soll. Jedoch sehen die meisten Christen Gott als einen dreifaltigen<br />
Gott an (Trinität): als Vater, Sohn (Jesus Christus) und Heiligen Geist, die zusammen eine<br />
Einheit bilden. Jesus Christus ist nach der Festlegung früher Konzilien zugleich ganz Mensch und<br />
ganz Gott. Die zentralen Elemente der christlichen Lehre sind die Liebe Gottes, die Liebe zu<br />
Gott und die Nächstenliebe. Gott erlöste die Menschen von seiner Schuld oder Erbsünde durch<br />
den Tod Jesu Christi. Dieser ist nach den Zeugnissen der Apostel und der Maria Magdalena vom<br />
Tod als erster Mensch auferstanden. Gemeinsame Sakramente, d.h. heilige, zeichenhafte Rituale,<br />
aller christlichen Konfessionen und Strömungen sind die Taufe und das Abendmahl.<br />
Orthodoxe, Katholische und Evangelische Kirchen<br />
Glaubensspaltungen begleiteten die christliche Kirche, d.h. die dem Herrn gehörige<br />
Religionsgemeinschaft, von Anfang an, wie schon aus den Paulus-Briefen des Neuen Testaments<br />
hervorgeht. Im Römischen Reich wurde das Christentum im Jahr 391 Staatsreligion. Nach der<br />
Teilung des Reiches 395 entstand die orthodoxe Kirche um den Mittelpunkt Konstantinopel.<br />
10
Unterschiedliche theologische Meinungen führten 1054 zum großen Schisma, d.h. der<br />
endgültigen Kirchenspaltung. Die Kirche der „Rechtgläubigen“ der Lobpreisung des dreifaltigen,<br />
unfassbaren, unbegreifbaren Gottes ist heute ein Verband von verschiedenen Nationalkirchen,<br />
die durch Patriarchen vertreten werden. Durch Migration leben orthodoxe Christen heute in allen<br />
Teilen der Welt, wobei die USA, Australien und Deutschland zahlenmäßig am bedeutendsten<br />
sind. Wichtigste Quelle des orthodoxen Glaubens ist die Heilige Schrift. Von Bedeutung sind<br />
aber auch die Lehren der Kirchenväter (Nachfolger der Apostel = Jünger Jesu, bis etwa zum 8.<br />
Jahrhundert) und die Konzilien. Orthodoxe Christen kritisieren das Papsttum und das Dogma,<br />
d.h. die Glaubenvorschrift, der Unfehlbarkeit des Papstes. Das in orthodoxen Kirchen besonders<br />
Anziehende ist die feierliche Liturgie mit Gesängen und Symbolhandlungen, bei denen auch<br />
Ikonen als kirchlich geweihte Bilder eine große Rolle spielen. Diese Ikonen stellen z. B. Christus,<br />
Maria oder Heilige dar. Ihre Verehrung widerspricht nicht dem Bilderverbot und ist von der<br />
Anbetung Gottes zu trennen. Wie in der katholischen Kirche sind nur Männer zum Priesteramt<br />
zugelassen. Von ihnen wird ein Leben in Zölibat, ohne Ehe und Sexualität verlangt.<br />
Die katholische Kirche ist die größte Konfession innerhalb des Christentums und umfasst 23<br />
Teilkirchen. Sie entstand aus der westlichen Tradition Roms und sieht den Papst als „Nachfolger<br />
des heiligen Petrus“ und oberste, unfehlbare Autorität an. Sie teilt die sieben Sakramente<br />
(Taufe, Heilige Eucharistie/Kommunion, Salbung bzw. Firmung, Sakrament der<br />
Versöhnung/Bußsakrament, Krankensalbung, Priesterweihe, Ehe) mit den orthodoxen Kirchen.<br />
Katholische Christen verehren in den Heiligen und in Maria das vielfältige Wirken Gottes. Nach<br />
ihrer Auffassung ist Maria von der Erbsünde frei, hat Jesus vom Heiligen Geist keusch<br />
empfangen und ist in den Himmel aufgenommen worden. Für Jahrhunderte galt während<br />
katholischer Gottesdienste eine nach Geschlechtern getrennte Sitzordnung. In der katholischen<br />
Kirche sind bis heute Frauen als Priesterinnen nicht zugelassen.<br />
Zur katholischen Kirche zählt auch das in den letzten Jahrzehnten von Päpsten noch<br />
aufgewertete rechtslastige und umstrittene Opus Dei (=Werk Gottes), das 1928 in Spanien von<br />
Josemaria Escrivà gegründet wurde. Es rekrutiert neue Mitglieder als katholische Elite bevorzugt<br />
aus Studierendenkreisen, aber auch unter Staatsrepräsentanten. Opus Dei ist nicht nur eine<br />
einflussreiche Organisation im Vatikan, sondern arbeitet in 62 Ländern auf allen Kontinenten der<br />
Erde. Zu seinen Methoden gehören neben psychischer Unterwerfung und Selbstzüchtigung auch<br />
die Isolierung und Kontrolle der geheimen Mitglieder der Organisation. Darüber hinaus<br />
praktiziert Opus Dei eine strikte Geschlechtertrennung und behandelt Frauen faktisch als<br />
minderwertige Wesen. Dennoch sprach Papst Johannes Paul II 2002 den Gründer heilig und<br />
verschaffte Opus Dei innerhalb der Kirche weiteren Einfluss. Er unterstützte so die gefährliche<br />
11
und undurchsichtige Macht dieser Organisation, die bisher auch von Papst Benedikt nicht<br />
beschnitten wurde.<br />
Die evangelischen Kirchen stehen in der Tradition der Reformation, die in Deutschland durch<br />
den Mönch Martin Luther aus Wittenberg ausgelöst wurde. Er übersetzte die Bibel grundlegend<br />
neu aus der lateinischen Fassung. Die wesentlichen Glaubensgrundsätze der Protestanten sind bis<br />
heute: allein die Bibel ist Grundlage des christlichen Glaubens, nicht aber die Autorität von<br />
Päpsten oder Bischöfen. Der gläubige Mensch wird allein von Gottes Gnade und nicht durch<br />
eigene Handlungen errettet. Als Sakramente bestehen die Taufe und das Abendmahl. In den<br />
evangelischen Kirchen werden seit wenigen Jahren Frauen als Pastorinnen und Bischöfinnen<br />
beschäftigt. Schon Luther schaffte das Zölibat, d.h. die Pflicht für Priester, ehelos zu bleiben, ab.<br />
Schriften<br />
Die Luther - Bibel ist nicht ein Buch, sondern eine Sammlung von 66 verschiedenen Büchern (39<br />
Altes Testament und 27 Neues Testament). Verfasst wurden die Vorläufer von mehr als 40<br />
Schreibern aus unterschiedlichen Kulturen, an verschiedenen Orten und<br />
über einen Zeitraum von mehr als 1.500 Jahren hinweg. Die einzelnen<br />
christlichen Konfessionen erklärten unterschiedliche Schriften zu<br />
Apokryphen, d.h. zu nicht-amtlichen Überlieferungen. Die Verfasser der<br />
unterschiedlichen Bücher der Bibel sind zum größten Teil nicht bekannt..<br />
Dies gilt nicht nur für das Alte Testament sondern auch für einige der<br />
zwischen 70 und 120 nach Christi Geburt entstandenen Schriften des<br />
Neuen Testamentes. Bei einigen Autoren ist die Verfasserschaft<br />
umstritten. Das Christentum übernahm die ins Griechisch übersetzte<br />
hebräische Bibel als Altes Testament. Bis auf einige Abweichungen<br />
entspricht es der hebräischen Bibel des Judentums. Das Neue Testament<br />
enthält neben dem Bericht über das Leben Jesu (Evangelien) Geschichten<br />
über die Kirche (Apostelgeschichte) und die Briefe von den Aposteln. Unter Christen gibt es<br />
Unstimmigkeiten über die richtige Methode der Übersetzung und unterschiedliche<br />
Interpretationen der Texte. Umstritten ist auch, wie weit es sich bei den Texten um Gottes Wort<br />
handelt. Generell gilt die „Bibel“ für Gläubige jedoch als anerkannte Quelle von Informationen<br />
über Jesus und Gott allgemein.<br />
12
Geschlechterordnung, -hierarchie und -beziehungen<br />
Christen sehen Frauen wie Männer als gleichwertige Ebenbilder von Gott. Aber in der<br />
Jahrhunderte langen christlichen Überlieferung und vor allem in der Praxis gläubiger Christen<br />
gewann Maria als zugleich Jungfrau und Gottesmutter eine besondere Bedeutung. Sie gilt als<br />
„neue Eva“, die dem Teufel in Gestalt der Schlange den Kopf zertreten hat. Dennoch wird mit<br />
Hinweis auf den Schöpfungsbericht Frauen in der katholischen Kirche der Zugang zum<br />
Priesteramt verwehrt: „Weil Gott in einem Mann Mensch geworden ist, kann nur ein männlicher<br />
Priester am Altar Christus repräsentieren“, heißt es in einem offiziellen Dokument der Kirche<br />
von 1976. Der Ausschluss der Frauen von kirchlichen Ämtern wird auch mit Hinweis auf<br />
bestimmte Bibelstellen im Neuen Testament als gottgewollt dargestellt. Auf der anderen Seite<br />
betonen Christen in der Nachfolge der Apostel die Gleichheit aller Menschen vor Christus,<br />
unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Klasse oder kulturellen Zugehörigkeiten: „Hier ist nicht<br />
Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid<br />
allesamt einer in Christus Jesus“ (Paulus Brief an die Galater 3,26-28).<br />
Bekleidungsvorschriften für die Geschlechter<br />
Die alttestamentarische Textstelle „Eine Frau soll nicht Männersachen tragen, und ein Mann soll<br />
nicht Frauenkleider anziehen ....“ (5 Moses 22,4) wirft einige Fragen auf. Waren die<br />
Geschlechtergrenzen in damaliger Zeit vielleicht eher fließend und abhängig von Kleidung und<br />
Verhalten? Konnten „weibliche“ und „männliche“ Menschen ohne die entsprechende Kleidung<br />
nicht klar identifiziert werden? Bestand die Sorge, dass ein Mann, wenn er Frauenkleider trug, als<br />
Frau gelten konnte und umgekehrt? Gab es die von den biologischen und medizinischen<br />
Wissenschaften vor allem im 19. Jahrhundert behaupteten eindeutigen körperlichen Unterschiede<br />
zwischen den Geschlechtern vielleicht gar nicht immer? Auch im Neuen Testament finden sich<br />
Vorschriften für Kopfbedeckungen und Haartracht abhängig vom zugewiesenen Geschlecht. Für<br />
Frauen ist es dort eine Ehre, langes Haar zu haben, denn dieses dient ihnen angeblich als Schleier.<br />
Bei Männern ist das Tragen langer Haare dagegen eine „Unehre“ und gegen die Natur (wie im<br />
Paulus-Brief an die Korinther 1 Kor 11, 14-16). Jesus aber wird in vielen christlichen Dar-<br />
stellungen durch verschiedene Jahrhunderte mit langen Haaren dargestellt. War Jesus also zwar<br />
ganz Mensch, aber dennoch kein Mann?<br />
Nach Thomas Laqueur ist die kulturelle Vorstellung von zwei gegensätzlichen, aber aufeinander<br />
als Paar verwiesenen Geschlechtern erst im 18. Jh. entstanden. In dieser Zeit verlor die christliche<br />
13
Religion weitgehend an Autorität und Bedeutung. Denn Philosophie und Naturwissenschaften<br />
veränderten im Zeitalter der Aufklärung zusammen mit der Entdeckung ferner Kontinente das<br />
bis dahin bestehende Menschenbild. Bis zu diesem Zeitalter gingen verschiedene Gelehrte von<br />
der Existenz nur eines Geschlechts aus. Der männliche und der weibliche Körper wurden nicht<br />
als grundsätzlich verschieden angesehen. Vielmehr war der Mann die Norm oder der Standard<br />
des Menschen, von dem die Frau als unvollkommeneres Wesen abweicht. Die körperlichen<br />
Geschlechtsmerkmale von Frauen wurden als nach innen gestülpte männliche Geschlechtsorgane<br />
angesehen. Denn bis dahin unterschied man nicht zwischen „natürlichem“ Geschlecht (sex) und<br />
kulturellem Geschlecht (gender). Die im Zuge der Aufklärung vorgenommene neue<br />
Unterscheidung in zwei biologisch erklärte „natürliche“ Geschlechter führte dazu, klare, soziale<br />
und kulturelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen als „Geschlechtscharaktere“ von nur<br />
noch zwei Geschlechtern festzulegen. Daraus folgend konnten geschlechtsspezifische Gesetze,<br />
Arbeitsteilungen und Verhaltensnormen begründet werden.<br />
Maria und Jesus: historische Figuren und Mythengestalten<br />
Der Mythos von der Gottesmutter, die ein Gotteskind zur Welt bringt ist<br />
uralt. In den vorchristlichen Religionen gab es ihn schon lange, zum<br />
Beispiel als die ägyptische Himmelsgöttin Hathor oder Isis mit dem<br />
Horusknaben. Die jüdische Mutter Jesus übernimmt einige der<br />
Eigenschaften dieser Göttinnen. Die frühesten Marienbilder stammen aus<br />
dem 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Auf den meisten Abbildungen<br />
wird Maria nun als Mutter, mit dem Jesuskind auf dem Schoß oder Arm<br />
dargestellt. Im Laufe der anhaltenden Marienverehrung gab die<br />
katholische Kirche nach und nach vier Mariendogmen heraus. Danach<br />
besitzt Maria eine “unbefleckte, ewige Jungfräulichkeit“. Sie ist die Gottesmutter und frei von<br />
Sünde (1854). Außerdem wird ihr die Aufnahme in das Himmelreich bescheinigt (1950). Von<br />
christlichen Gläubigen, und sogar von Muslimen, wird Maria in ganz unterschiedlichen Rollen<br />
verehrt: als Jungfrau, als Himmelskönigin, als Schutzherrin und Führsprecherin. Sie wird als<br />
tugendhaft, gehorsam, demütig, gläubig, liebend und fürsorglich beschrieben. In ihrer Rolle als<br />
Jungfrau erscheint sie fast als androgyne, vergeistigte Gestalt. War Maria eine geheime Göttin im<br />
praktizierten Christentum? Und wer war die historische Maria?<br />
14
Maria (hebräisch Mirjam) heißt nach dem Neuen Testament die Mutter des Jesus von Nazaret.<br />
Diese jüdische Frau war mit dem Bauhandwerker Josef verlobt und lebte wahrscheinlich in der<br />
Kleinstadt Nazaret in Galiläa. Die Bibel berichtet von Maria im Zusammenhang mit der Geburt<br />
Jesu: Ein Engel verkündete ihr die jungfräuliche Empfängnis durch den Heiligen Geist. Sie<br />
flüchtete vor dem römischen Statthalter während des<br />
Kindesmords in Bethlehem mit ihrem Verlobten nach Ägypten.<br />
Später wird sie noch einmal im Zusammenhang mit der<br />
Hochzeit in Kana erwähnt. Am Ende der Evangelien benennen<br />
die Apostel sie als Zeugin für die Kreuzigung Jesus. Ihre<br />
Grabstätte und der Zeitpunkt ihres Todes sind nicht bekannt.<br />
Nach geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen fallen in<br />
der biblisch überlieferten Maria wahrscheinlich ganz<br />
unterschiedliche Frauengestalten zusammen. Im Hebräischen<br />
wird Maria als „almah“ bezeichnet. Das ist der Name für ein<br />
Mädchen oder eine junge Frau. In der griechischen<br />
Übersetzung wird daraus dann die „Jungfrau“.<br />
Jesus, der Begründer des Christentums, wurde wahrscheinlich zwischen 7 und 4 v. Chr. in<br />
Bethlehem oder Nazaret geboren und starb in den Jahren 30, 31 oder 33 n. Chr. in Jerusalem. Ab<br />
dem Alter von etwa 28 Jahren trat er im Gebiet des heutigen Israel und im Westjordanland<br />
öffentlich als Wanderprediger und Heiler auf. Wenige Jahre später wurde er von den Römern<br />
gekreuzigt. Sein genaues Todesjahr ist nicht überliefert.<br />
Das Neue Testament berichtet von den Taten und Worten Jesu, der nach christlichem Glauben<br />
ganzer Mensch und ganzer Gott ist. Es wird das Bild eines Asketen gezeichnet, der Familie und<br />
Beruf verlässt und ohne Besitz und Waffen predigend durch das Land zieht. Jesus verkündete das<br />
Reich Gottes, Nächstenliebe und Vergebung. Dabei verstieß er gegen die geltenden jüdischen<br />
Vorschriften für den Sabbat, die Achtung der Eltern und Reinlichkeitsgesetze. Er heilte sozial<br />
ausgegrenzte Menschen, wie Prostituierte und Ehebrecherinnen oder vorher Ungläubige. Er<br />
führte Lehrgespräche mit Frauen und nahm sie als Begleiterinnen an. Einige scheinen ihm von<br />
Beginn an gefolgt zu sein und ihn auch finanziell unterstützt zu haben. Sie sollen auch die letzten<br />
Zeugen seiner Hinrichtung und seiner Auferstehung geworden sein. Eine Eheschließung dieses<br />
Jesus erwähnt das Neue Testament nicht. Maria von Magdala, wird als eine seiner engsten<br />
Anhängerinnen bezeichnet.<br />
Einige feministische Theologinnen deuten Jesus vor allem als Freund und Befreier der Frauen.<br />
Andere betonen seine angeblich „weiblichen“ Eigenschaften. Auf den frühen Abbildungen<br />
15
erscheint er oft in der Rolle des guten Hirten, des Lehrers oder in der Pose des Herrschers. Er<br />
trägt in der Regel lange Haare und oft auch einen Bart. Im Mittelalter, vor allem in gotischer<br />
Kunst, wird die Menschengestalt Jesu besonders thematisiert. Er erscheint als Leidender, von<br />
Schmerzen entstellt und voller Wunden. Auf<br />
vielen Heiligenbildchen seit dem 18./19. Jh.<br />
gibt es die Darstellung des blutenden Herzens<br />
Jesu. Oder der Schmerzensmann hängt am<br />
Kreuz, trägt eine Dornenkrone und ist von<br />
einer Glorie eingefasst. Der Kunsthistoriker<br />
Steinberg weist darauf hin, dass in vielen<br />
bildlichen Darstellungen des Jesus seine<br />
„Männlichkeit“ betont wird. Manche<br />
Muttergottes zeigt auf das Geschlecht des Neugeborenen. Ein anderes Bild zeigt Jesu nach seiner<br />
Kreuzigung, halbnackt in den Armen seiner Mutter. Vor allen Dingen die Abbildungen seiner<br />
Kreuzigung zeigen seine Genitalien unverhüllt. Die Darstellung des Toten wird hier zugleich mit<br />
der Abbildung sexueller Potenz verbunden. Denn - so Steinberg - der Phallus steht als Symbol<br />
für Macht und Fruchtbarkeit und die Überwindung des Todes. Im Tod werden Körperlichkeit<br />
und Sexualität überwunden.<br />
Weiterführende Informationen<br />
Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der<br />
Antike bis Freud, Frankfurt/Main-New York 1992<br />
http://www.religioustolerance.org/christ.htm<br />
Schlangenbrut- Zeitschrift für feministische Theologie<br />
http://www.schlangenbrut.de/<br />
ESWTR - Netzwerk für Frauen aus der theologischen Forschung<br />
http://www.eswtr.org/home_d.html<br />
16
1. Glaubensgrundsätze<br />
2. Die Schriften<br />
3. Sunniten, Schiiten und Aleviten<br />
4. Der Prophet Mohammed, Chadidscha, Aischa und Fatima<br />
5. Die Geschlechterordnung im Koran<br />
6. Feministische Lesarten der Schriften<br />
Glaubensgrundsätze<br />
Islam<br />
Der Islam hat zur Zeit neben dem Christentum die meisten Gläubigen. Der Kernraum der<br />
islamischen Welt sind die arabischen Staaten, die Türkei und der Iran. Aber ungefähr ein Fünftel<br />
der Muslime lebt in Südostasien. "Islam" bedeutet "Hingabe, Annahme, Übergabe,<br />
Unterwerfung" gegenüber Allah (Gott). Allah ist weder männlich noch weiblich. Er trägt 99<br />
Namen, die seine Güte und Barmherzigkeit betonen, aber auch seine Strenge und Gerechtigkeit.<br />
Allah ist der Erste, der Letzte, der Ewige, der Unendliche, der Allmächtige, der Allwissende,<br />
Schöpfer aller Dinge, der Gerechte, der Erbarmer, der Gnädige, der Liebende, der Gütige, der<br />
Erhabene, der Wahrhaftige usw.. Eigenschaften wie „Gnade“ und „Frieden“ zählen zu seinen am<br />
häufigsten genannten Attributen. Sein Wille ist in Schriften und Gesetzen festgelegt, die alle<br />
Lebensbereiche der Gläubigen bestimmen. Den Menschen wurden die Worte Allahs vermittelt<br />
durch Mohammed, den Propheten und Religionsgründer. Mit seiner Auswanderung nach<br />
Medina, im Jahre 622 n. Chr., beginnt die islamische Zeitrechnung.<br />
Die Lehre des Islam basiert auf fünf Säulen. Die erste Säule stellt den Glauben an Gott, die<br />
Engel, die Schriften, Gottes Gesandte und den Jüngsten Tag dar. Zu den Gesandten oder<br />
Propheten gehören auch Adam, Abraham, Moses und Jesus. Mohammed wird als der letzte<br />
Prophet angesehen. Die anderen vier Säulen des Islam verpflichten die Gläubigen dazu, fünf mal<br />
täglich zu beten, Almosensteuern zu geben, vorgegebene Fastenzeiten einzuhalten und eine<br />
17
Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen. Der Islam ist eine streng monotheistische Religion, die<br />
sich stark von polytheistischen Religionen abgrenzt, in denen mehrere Götter und Göttinnen<br />
verehrt werden. Gott gilt als einzigartig, vollkommen und nicht vorstellbar. Deshalb lehnt der<br />
Islam auch die christliche Lehre vom dreifaltigen Gott (Trinität): als Vater, Sohn (Jesus Christus)<br />
und Heiliger Geist ab. Und er verbietet jede persönliche Vorstellung oder bildliche Darstellung<br />
von Allah, aber auch von lebenden Wesen. Dadurch hat der Islam eine hohe Schriftkunst<br />
(Kalligraphie) und eine Fülle von Ornamenten, besonders Arabesken (Gabelblattranken)<br />
hervorgebracht. Sie sind das Ergebnis komplizierter rechnerischer Formeln, die auf den<br />
wunderbaren Aufbau der Welt hinweisen.<br />
Die Schriften<br />
Der Koran ist seit 1.400 Jahren das zentrale Dokument des Islam, die heilige Schrift, die<br />
Nichtmuslime nicht berühren, besitzen oder herstellen sollen. Nach dem Glauben vieler Muslime<br />
enthält der Koran die wortwörtlichen Offenbarungen Gottes, die dem Propheten Mohammed im<br />
Laufe von zwei Jahrzehnten (um 610-632 n. Chr.) durch den Erzengel Gabriel übermittelt<br />
wurden. Der Koran gilt grundsätzlich als unübersetzbar, weil Gott durch Mohammed in<br />
arabischer Sprache gesprochen hat. Der Gläubige erlebt Gott in der möglichst auswendigen<br />
Rezitation der Koranverse. Es geht nicht so sehr darum, die Inhalte zu verstehen, sondern die<br />
Laute auszusprechen. Nach islamischer Überlieferung konnte selbst der Prophet weder lesen<br />
noch schreiben, daher wurde der Koran erst von seinen Anhängern schriftlich festgehalten. Nach<br />
seinem Tode, zur Zeit des ersten Kalifen (Stellvertreter des Propheten) Abu Bakr um 632 n. Chr.<br />
entstand der erste Koran-Band.<br />
Der großen teils in Reimprosa geschriebene Koran ist in 114 Suren (Kapitel) eingeteilt, die nach<br />
ihrer Länge geordnet sind. Der Inhalt besteht aus Lobpreisungen auf Allah, Ankündigungen des<br />
Jüngsten Tages, Trostworten, Ermahnungen, Warnungen und anderem. Da sich der Islam vor<br />
dem Hintergrund des Judentums und Christentums entwickelte, enthält er auch viele Elemente<br />
aus den jüdischen und christlichen Überlieferungen. Er bezeichnet die Tora, die Psalmen und das<br />
Evangelium als heilige Schriften, die von Gott stammen, aber später von Menschen verfälscht<br />
worden seien. Adam wird erwähnt, Hawwa (Eva) als sein Weib bezeichnet. Laut Koran trugen<br />
beide die Verantwortung für die Vertreibung aus dem Paradies, aber ihnen wurde von Gott<br />
verziehen. Im Islam gibt es daher keine Erbsünde. Der Mutter von Jesus, Maryam (Maria),<br />
widmet der Koran eine ganze Sure. Nach dem Glauben vieler Muslime ist Maria in den Himmel<br />
18
aufgefahren und hat Jesus in jungfräulicher Geburt zur Welt gebracht. Sie gilt als eine der vier<br />
hervorragendst Frauen der Menschheitsgeschichte, neben Chadidscha, Aischa und Fatima. Jesus<br />
wird als einer der großen Propheten angesehen, aber nicht als Gottes Sohn. Laut Koran wurde er<br />
nicht gekreuzigt, sondern von Gott errettet.<br />
Die Sunna, d.h. die Gesamtheit der Überlieferungen des Propheten Mohammed, ist die zweite<br />
wichtige Schrift im Islam. Sie beschreibt beispielhaftes, vorbildliches Verhalten und leitet daraus<br />
Handlungsanweisungen für alle gläubigen Muslime ab. Übermittelt wird sie in Form der Hadithe,<br />
d.h. Nachrichten und Erzählungen über das, was der Prophet gesagt, getan, verurteilt oder gelobt<br />
haben soll. Die Hadithe wurden zuerst in mündlicher Überlieferung weitergegeben. Sie gehen auf<br />
Freunde, Verwandte und Bekannte des Propheten zurück. Ihr Wahrheitsgehalt wird an der<br />
Glaubwürdigkeit der Personen gemessen und daran, wie nahe sie dem Propheten gestanden<br />
haben sollen. Auch der angebliche Charakter und der Ruf der Übermittler spielen eine Rolle.<br />
Eine Hadithe besteht aus zwei Komponenten: dem Inhalt und der Kette der Namen derjenigen<br />
Männer und Frauen, die sie überliefert haben. Die ersten Aufzeichnungen entstanden nach<br />
heutiger Islamforschung schon im ersten muslimischen Jahrhundert. Nach dem Tode<br />
Mohammeds kam es zu einer regelrechten Hadithe-Produktion, die zu zahlreichen,<br />
unterschiedlichen Sammlungen führte. Islamische Theologen stellten Regeln für ihre Echtheit auf<br />
und prüften die vorliegenden Quellen. Daraus entwickelten sich die weitgehend noch heute<br />
anerkannten Hadithe-Sammlungen. Im Gegensatz zum Koran gibt es aber keine von allen<br />
akzeptierte Festlegung, welche Hadithen echt sind.<br />
Der Begriff „Scharia“ wird im heutigen Sprachgebrauch für "islamisches Recht" verwendet,<br />
bedeutet im engeren Sinne jedoch die von Gott gesetzte Ordnung. Zurückzuführen ist sie auf die<br />
Schriften von islamischen Rechtsgelehrten des 7. bis 10. Jahrhunderts. Die Scharia regelt nicht<br />
nur Rechtsfragen, sondern enthält auch religiöse, ethische, moralische und soziale Gesetze,<br />
Normen und Gebote. Sie bezieht sich auf den Koran und die Hadithe als Hauptquellen.<br />
Abgesehen von einigen religiösen Gesetzen und Teilen des Familienrechts ist die Scharia auch für<br />
alle nichtmuslimischen Mitglieder in einer islamischen Gesellschaft verbindlich. Es gibt heute in<br />
Staaten mit islamischer Bevölkerungsmehrheit sehr verschiedene Modelle im Blick auf die<br />
Bedeutung der Scharia. Während etwa die Türkei ein säkularer Staat ist, dessen Verfassung keinen<br />
Bezug auf das islamische Recht nimmt, haben Pakistan oder Sudan beschlossen, die Scharia zur<br />
Grundlage der Rechtsprechung zu machen. Das kann in der Praxis heißen, dass neue Gesetze<br />
von islamischen Juristen auf ihre Vereinbarkeit mit dem überlieferten islamischen Recht<br />
überprüft werden. Dazwischen stehen Staaten wie Malaysia, die sich zwar als islamische Staaten<br />
19
ezeichnen, deren Gesetzgebungsverfahren aber säkular, also rein aufgrund einer<br />
Mehrheitsentscheidung des Parlamentes erfolgt. Saudi-Arabien hat den Koran zur Verfassung<br />
seiner Monarchie erklärt, in der Praxis aber nicht aufgehört, trotzdem andere Rechtsquellen<br />
heranzuziehen.<br />
Sunniten, Schiiten und Aleviten<br />
Die Streitigkeiten und Machtkämpfe um die Nachfolge Mohammeds führten zu Abspaltungen<br />
innerhalb des Islam und zur Herausbildung unterschiedlicher Konfessionen. Die Sunniten sind<br />
mit etwa 80-90 Prozent die zahlenmäßig größte Gruppe im Islam, gefolgt von den Schiiten und<br />
den Aleviten. Die Sunniten stellen in vielen islamischen<br />
Ländern die Mehrheit der Muslime. Im Iran, im Irak, in<br />
Bahrain und in Aserbaidschan dagegen ist der Anteil der<br />
Sunniten an der Gesamtbevölkerung am größten.<br />
Daneben gibt es noch zahlreiche kleinere Gruppen und<br />
Richtungen, unter anderem den Sufismus und<br />
Wahhabismus. Die Sunniten betrachten die ersten vier<br />
Kalifen als die rechtmäßigen Nachfolger Mohammeds.<br />
Die Schiiten und die Aleviten berufen sich hingegen auf<br />
Ali, den Cousin und Schwiegersohn des Propheten, als<br />
legitimen Erben. Beide Strömungen folgen den fünf<br />
Säulen des Islam und stimmen in wesentlichen Glaubensgrundsätzen überein. Unstimmigkeiten<br />
hingegen herrschen in Bezug auf die Gültigkeit und Echtheit bestimmter Hadithe und die<br />
Auslegung der Rechtsprechung.<br />
Die Aleviten bilden nach den Sunniten die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in der Türkei.<br />
Nach den Sunniten sind sie auch in Deutschland die zweitstärkste muslimische Konfession. Über<br />
Jahrhunderte waren sie immer wieder Anfeindungen und Verfolgungen ausgesetzt. Die Aleviten<br />
teilen nur das Glaubensbekenntnis mit den Sunniten und Schiiten. Sie folgen nicht den Geboten<br />
der Scharia und der Hadithe und legen den Koran nicht wortwörtlich aus. Die Aleviten treten<br />
stärker als andere Konfessionen im Islam ein für Religionsfreiheit, Menschenrechte und die<br />
Gleichberechtigung der Geschlechter. Männer und Frauen sitzen im Gottesdienst zusammen und<br />
haben dieselben Rechte und Pflichten. Frauen tragen in der Regel kein Kopftuch. Im Zentrum<br />
des alevitischen Denkens und Handelns stehen Liebe, Respekt und Frieden. Für sie manifestiert<br />
20
sich Gott in der Natur und im Menschen, unabhängig von seinem Geschlecht, ethnischer<br />
Zugehörigkeit oder sozialem Stand.<br />
Der Prophet Mohammed, Chadidscha, Aischa und Fatima<br />
Es gibt so gut wie keine unabhängigen zeitgenössischen Quellen zu Mohammeds Leben und<br />
Wirken. Wie auch bei Jesus ranken sich zahlreiche, zum Teil widersprüchliche Legenden und<br />
Erzählungen um seine Person. Mohammed wurde um 570 n. Chr. in Mekka geboren. In jungen<br />
Jahren soll er als Hirte, später als Karawanenführer und Angestellter der Kauffrau Chadidscha<br />
gearbeitet haben. Mit der 15 Jahre älteren Chadidscha war er 25 Jahre verheiratet. Nach ihrem<br />
Tode heiratete er neun Frauen (die Anzahl variiert je nach Quelle) und hatte zwei Sklavinnen als<br />
Nebenfrauen, unter anderem eine Christin. Im Alter von ungefähr 40 Jahren wurden ihm die<br />
ersten Offenbarungen Gottes zuerst in Träumen und Visionen, später mündlich überliefert. Er<br />
predigte gegen den Polytheismus und wurde als angefeindeter Prophet aus Mekka vertrieben.<br />
Nach seiner Übersiedlung nach Medina wurde Mohammed zum geachteten Führer der dortigen<br />
Gemeinde. Seine Feldzüge führten 630 n. Chr. zur Eroberung von Mekka und mündeten in die<br />
religiöse und politische Einigung der arabischen Stämme unter dem Islam. Nach dem Tod<br />
Mohammeds (um 632 n. Chr.) in Medina, trat Ali Bakr, sein langjähriger Freund und Vater seiner<br />
Ehefrau Aischa, seine Nachfolge an.<br />
Chadidscha, die erste Frau des Propheten, war eine wohlhabende Geschäftsfrau in hoher sozialer<br />
Stellung. Sie soll Mohammed die Ehe selbst angeboten haben. Mit ihrer Hilfe erlangte er<br />
finanzielle Unabhängigkeit und soziale Sicherheit. Nach den Hadithen ist sie die erste Person, die<br />
an seine Botschaften glaubte und ihn als Gründer einer neuen Religion unterstützte. Die<br />
islamische Geschichtsschreibung betrachtet sie daher als die erste Muslimin. Als Mutter und<br />
Vorbild aller Gläubigen wird sie hochverehrt. Chadidscha trägt den Beinamen "At-Tahira" (die<br />
Reine). Die Hadithe bezeichnen sie als entschlossene, edle und kluge Frau von vornehmer<br />
Abstammung. Die Berichte heben besonders ihre positiven Eigenschaften in ihrer Funktion als<br />
Ehefrau von Mohammed hervor. Sie erscheint als die mütterliche, beschützende Frau, die den<br />
Propheten mit ihrem Einfluss, ihrem Geld und ihrer Zuneigung unterstützte.<br />
Die spätere Ehefrau Mohammeds, Hafsa, bewahrte die erste Niederschrift des Koran auf, bis die<br />
Teile später zu einem Buch geordnet wurden. Aischa war die dritte Frau des Propheten und die<br />
Tochter seines engsten Freundes Abu Bakr. Der Prophet soll Aischa geheiratet haben, als sie<br />
neun Jahre alt war (ihr genaues Alter variiert je nach Quelle). Sie gilt als eine der gebildetsten<br />
21
Frauen der damaligen Zeit und als eine der wichtigsten Quellen für die Überlieferungen von<br />
Mohammeds Worten und Taten. Die Hadithe beschreiben Aischa als Gelehrte, Politikerin und<br />
Kriegerin, die an mehreren Schlachten Mohammeds beteiligt war. Nach seinem Tode bekämpfte<br />
sie den vierten Kalifen, Ali, den Cousin und Schwiegersohn Mohammeds. Als Lieblingsfrau des<br />
Propheten und Gegenspielerin Alis wird sie besonders von den Sunniten verehrt. Für sie stellt<br />
Aischa ein Vorbild an Frömmigkeit und eine religiöse Autorität dar.<br />
Fatima genießt als Tochter Mohammeds und Ehefrau des vierten Kalifen Ali großes Ansehen<br />
unter den Muslimen, insbesondere bei den Schiiten. Diese zählen sie zusammen mit Mohammed<br />
und den zwölf Imamen zu den „Vierzehn Unfehlbaren“. Hier sind Parallelen zu der christlichen<br />
Marienverehrung zu erkennen, da Fatima auch als „Jungfrau Fatima“ bezeichnet wird. Fatima<br />
war die einzige von Mohammeds Kindern, die männliche Nachkommen hatte und daher auch an<br />
den Streitigkeiten und Kämpfen um seine Nachfolge beteiligt war. Im Volksglauben spielt „die<br />
Hand der Fatima" oder „das Auge der Fatima“, als Abwehr gegen den bösen Blick eine wichtige<br />
Rolle. Dieses Amulett ist ein Schmuckstück in Form einer geöffneten Hand, manchmal auch mit<br />
einem Auge in der Mitte der Hand. Es soll an Fatima erinnern und symbolisiert Standhaftigkeit,<br />
Mut, Loyalität und auch Reue. Es kommt auch bei Juden häufig vor und heißt dort: die Hand der<br />
Schwester von Moses.<br />
Die Geschlechterordnung im Koran<br />
Die Lehre des Islam geht von zwei Geschlechtern aus: dem Mann und der Frau. Gegenüber Allah<br />
sind beide Geschlechter absolut gleichwertig, aber nicht<br />
gleichartig. In der gesellschaftlichen Realität vieler islamischer<br />
Länder herrscht jedoch Geschlechtertrennung, und die Frau<br />
wird als dem Mann untergeordnet angesehen. Aus der<br />
Verschiedenartigkeit der Geschlechter werden unter-<br />
schiedliche Stellungen und Aufgaben abgeleitet und mit<br />
Hinweis auf entsprechende Aussagen im Koran und in den<br />
Hadithe begründet. Daraus folgen der Ausschluss der Frauen<br />
von bestimmten religiösen und politischen Ämtern und<br />
andere Formen von Diskriminierung.<br />
22
Die Verbindung von Mann und Frau in Ehe und Familie gilt als Ideal, auch wenn die Ehe im<br />
Islam nur ein rechtlicher Vertrag ist und kein heiliger Bund. Der Koran und die Hathide sehen<br />
eine klare Aufgabenteilung für die zwei Geschlechter vor, die als gottgewollt und natürlich gilt.<br />
Der Mann ist für den Lebensunterhalt der Familie verantwortlich. Die Frau erfüllt ihre Pflichten<br />
als Ehefrau und ihre Aufgabe als Mutter. Der Koran begründet die Überordnung des Mannes<br />
über die Frau und gibt ihm das Recht, sie im Falle von Ungehorsam zu bestrafen: „Die Männer<br />
stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat<br />
und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen<br />
und diejenigen, die (ihrer Gatten) Geheimnisse mit Allahs Hilfe wahren. Und jene, deren<br />
Widerspenstigkeit ihr befürchtet: ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie! Wenn sie<br />
euch dann gehorchen, so sucht gegen sie keine Ausrede...“ (Sure 4, Vers 34; Sure 2 Vers 228).<br />
Auf der anderen Seite ist die Ehe nach islamischem Verständnis eine Einrichtung zur<br />
gegenseitigen Unterstützung, denn „...die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen<br />
Beschützer...“ (Sure 9, Vers 71). Die beiden Geschlechter sollen sich als Freunde und<br />
„Zwillingshälften“ (Sunan Dawud Abu, Hadith Nr. 226) in ihrer Verschiedenartigkeit ergänzen<br />
und sich mit Zuneigung und Achtung begegnen (Sure 30, Vers 21).<br />
Feministische Lesarten der Schriften<br />
Islamische Feministinnen, wie die Islamwissenschaftlerin Margot Badran, verweisen auf die bisher<br />
eher von männlichen Gelehrten übermittelten Lesarten und Traditionen und setzen sich für eine<br />
zeitgemäße, geschlechtsneutrale Auslegung der Schriften des Korans ein. Aus ihrer Sicht ist eine<br />
neue Interpretation des Koran die Basis für die von ihnen geforderte grundlegende Reformierung<br />
der Rechtsprechung (Scharia). Andere Autorinnen, wie die Soziologin<br />
Fatima Mernissi, verweisen auf die sich widersprechenden Aussagen in<br />
bezug auf die Geschlechterordnung, -beziehungen und -hierarchien im<br />
Koran und in den Hadithe. Sie bezweifelt die Glaubwürdigkeit der<br />
Überlieferer und die Echtheit ihrer Berichte. Die Theologin Riffat<br />
Hassan kritisiert die falsche Übersetzung und Interpretation bestimmter<br />
Koranstellen und nimmt Bezug auf den Schöpfungsmythos im Koran.<br />
Die traditionelle Übersetzung des Schöpfungsberichts lautet: „O ihr Menschen, fürchtet euren<br />
Herrn, der euch erschaffen hat aus einem einzigen Wesen; und aus ihm erschuf er seine Gattin...“<br />
(Sure 4, Vers 1). Nach der Auslegung und Übersetzung von Riffat Hassan erschuf Gott die<br />
Menschen (und nicht den Mann) als Partner und Partnerinnen aus „jener Ursubstanz“ (nafsun<br />
23
wahidatun) und nicht aus einem einzigen Wesen. Damit gleicht sie einigen jüdischen und<br />
christlichen Feministinnen.<br />
Weiterführende Informationen<br />
ZIF Zentrum für Islamische Frauenforschung und Frauenförderung<br />
http://www.zif-koeln.de/<br />
Huda -Netzwerk muslimischer Frauen e. V.<br />
http://www.huda.de/index2.php<br />
Renate Kreile „ Das Verhältnis der Geschlechter und seine Instrumentalisierung in: „Der<br />
Vordere Orient an der Schwelle zum 21. Jahrhundert“, Der Bürger im Staat, Ausgabe 3/1998:<br />
http://www.buergerimstaat.de/4_98/ueberlok.pdf<br />
Dossier zur Kopftuch-Debatte auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung<br />
http://www.bpb.de/themen/NNAABC,0,0,Konfliktstoff_Kopftuch.html<br />
Dossier zum Thema Feministischer Islam auf der Webseite des Internetportals Quantara<br />
http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-296/i.html<br />
Hawwa. Journal of Women in the Middle East and the Islamic World<br />
http://www.brill.nl/m_catalogue_sub6_id10263.htm<br />
Peripherie Schwerpunktthema “Gender und Islam“, in Heft 95, 2004<br />
http://www.zeitschrift-peripherie.de/<br />
24
1. Glaubensgrundsätze<br />
2. Schriften<br />
3. Ein Gott und viele Götter zugleich: Brahma, Vishnu und Shivas<br />
4. Vishnuismus und Shivaismus<br />
5. Die Verehrung der Göttin: Shaktismus<br />
6. Geschlechtswandlungen und das dritte Geschlecht<br />
Glaubensgrundsätze<br />
Hinduismus<br />
Den Hinduismus gibt es eigentlich gar nicht. „Hinduismus“ ist ein von westlichen<br />
Wissenschaftlern eingeführter Begriff, der nicht für eine konkrete Religion steht, sondern für eine<br />
Vielzahl von unterschiedlichen Hindu-Religionen. Entstanden ist er aus der Verschmelzung<br />
altindischer Glaubensvorstellungen mit der Religion der aus dem Norden eingewanderten Arier.<br />
Der Hinduismus umfasst zahlreiche religiöse Strömungen und Denksysteme, die zu<br />
verschiedenen Zeiten in den letzten zwei- bis drei Jahrtausenden auf dem indischen Kontinent<br />
entstanden sind. Die Hindus selbst nennen ihre religiöse Tradition auch „die ewige Ordnung“.<br />
Der Hinduismus wird oft als Polytheismus bezeichnet, weil eine große Zahl an Göttinnen und<br />
Göttern verehrt werden. Aber er kann auch als monotheistische Religion betrachtet werden, denn<br />
viele Hindus sehen in der Vielzahl der Götter und Göttinnen lediglich unterschiedliche Gesichter<br />
oder Erscheinungsformen des einen Gottes „Brahman“ oder des jeweiligen Hauptgottes oder der<br />
Hauptgöttin, die sie anbeten. Der Hinduismus geht nicht auf einen bestimmten Religionsgründer<br />
zurück. Es gibt auch kein gemeinsames für alle Gläubigen gültiges Glaubensbekenntnis. Die<br />
einzelnen Hindu-Religionen haben vielmehr unterschiedliche Gottheiten, Wege zur Erlösung von<br />
der Wiedergeburt, Kulte, Ursprünge, heilige Schriften, und diese sind in unterschiedlichen<br />
Sprachen aufgeschrieben (Sanskrit und diverse Volkssprachen).<br />
25
Aber es gibt Gemeinsamkeiten: fast alle Hindus glauben an einen Gott in irgendeiner<br />
persönlichen oder unpersönlichen Form. Sie gehen davon aus, dass Leben und Tod ein sich<br />
ständig wiederholender endloser Kreislauf (Samsara) sind, der Leiden mit sich bringt und aus<br />
dem der Mensch sich nicht aus eigenem Vermögen befreien kann. Die meisten Hindus glauben<br />
an die Reinkarnation, d.h. die Wanderung der Seele nach dem Tode und die Wiedergeburt in<br />
einer neuen Gestalt. Daraus folgt die große Bedeutung eines Gurus, geistlichen Lehrers oder<br />
„Seelenführers“ in den hinduistischen Religionen. Die Form, in der der Mensch wiedergeboren<br />
wird, ist abhängig von seinem Karma, d.h. bedingt durch Handlungen und Gedanken in seinem<br />
jeweiligen Leben. Der Mensch wird an einem ihm vorbestimmten Platz geboren und hat<br />
entsprechend diesem gesellschaftlichen Stand (und Geschlecht?) spezifische Pflichten und<br />
Rechte. In fast allen Strömungen des Hinduismus spielen Rituale eine wichtige Rolle. Die tägliche<br />
Ausübung dieser religiösen Zeremonien findet nicht nur in öffentlichen Tempeln statt, sondern<br />
vor allem im privaten Bereich: in Form von persönlichen Gebeten, Meditationen, Anbetung von<br />
Götterbildern und Opferungen von Naturprodukten. Hinzu kommt die Pilgerung zu heiligen<br />
Stätten und eine lebendige, ausgeprägte Kultur von religiösen Festen und Bestattungszeremonien.<br />
Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Verehrung der Veden (altindische heilige Texte).<br />
Trotz aller Unterschiede können Hindus der verschiedenen religiösen Richtungen weitgehend<br />
gemeinsam feiern und beten; und innerhalb einer Familie werden manchmal mehrere Götter<br />
nebeneinander angebetet. Der Hinduismus verändert sich ständig: jedes Dorf und jeder<br />
Landstrich in Indien; Nepal; Bangladesh, Sri Lanka, Bali und anderen Ländern hat seine eigenen<br />
Lokal- oder Stammesgottheiten, die durch die Identifikation mit den Hauptgöttern in die<br />
jeweilige religiöse Richtung mitaufgenommen werden. In den Hindu-Religionen steckt daher eine<br />
stark integrierende Kraft, die sich durch „Einheit in der Vielfalt“ ausdrückt, und prinzipiell für<br />
Flexibilität und Toleranz gegenüber fremden Elementen und anderen Religionen steht.<br />
Schriften<br />
Die Vielfalt der Hindu-Religionen spiegelt sich ebenfalls in der Anzahl der Schriften wider. Eine<br />
für alle Gläubigen verbindliche Schrift, wie etwa die Bibel oder den Koran, gibt es nicht. Generell<br />
wird unterschieden zwischen den Shrutis (das von Weisen/Gott Gehörte oder von Sehern<br />
Geschaute) und den Smriti (das Erinnerte). Shrutis sind die heiligen und verbindlichen Schriften,<br />
Smritis gelten als von Menschen gemacht und übermitteln die Tradition. Zu den Shrutis gehören<br />
die Veden und die Upanishaden.<br />
26
Die vier Veden (Wissen) zählen zu den wichtigsten heiligen Schriften und kommen in ihrem<br />
Umfang einer enormen Enzyklopädie gleich. Sie sind zwischen 1.000-300 v.Chr. entstanden und<br />
bestehen aus religiösen Lobpreisungen, Formeln und Liedern sowie Anweisungen zur<br />
Durchführung und Interpretationen von (Opfer)Ritualen. Die Texte sind in Prosa- und Versform<br />
geschrieben, galten früher als geheim und stellen eine Art „Priesterhandbuch“ dar. In den<br />
Gesängen wurden die göttlichen Kräfte gepriesen und in ihnen liegen auch die Wurzeln der<br />
heutigen indisch-klassischen Musik. Wie im Islam, so ist auch im Hinduismus die wortwörtliche<br />
Rezitation sehr wichtig. Die Veden wurden mündlich von Priestern zu Schülern weitergegeben<br />
und erst um das 5. Jahrhundert n.Chr. niedergeschrieben. Zum Teil gehen ihre Namen auf die<br />
angeblichen Verfasser zurück, diese sind aber nicht historisch belegt. Einerseits verboten einige<br />
Gesetzgeber Frauen das Lesen der Veden, auf der anderen Seite sollen einige Hymnen, zum<br />
Beispiel in der Rigveda, von Frauen geschrieben worden sein.<br />
Die Upanischaden (Geheimlehren) entstanden zwischen 700-200 v.Chr. und bestehen aus<br />
insgesamt 108 Büchern. Die Texte erklären und erläutern die Veden. Darüber hinaus nehmen sie<br />
in Form von philosophischen Abhandlungen zu den zentralen Lehren der Hindu-Religionen<br />
Stellung und geben religiöse Ratschläge und Empfehlungen. Die Upanischaden wurden bisher<br />
immer männlichen Verfassern zugeordnet. Erst in diesem Jahrhundert wurden die Manuskripte<br />
der Autorin Tirukkoneri Dasyai entdeckt, die im 15. Jahrhundert entstanden sind.<br />
Zur zweiten Gruppe der Schriften, den Smritis, gehören die beiden<br />
umfangreichen Helden-Epen Mahabharata und Ramayana. Sie<br />
bilden den Kern der religiösen Hindu-Literatur, aber sie erheben<br />
keinen Anspruch auf Übermittlung der absoluten Wahrheit. Die<br />
vielfältigen Mythen, Legenden und Philosophien der Hindu-<br />
Religionen werden hier in Form von Erzählungen wiedergegeben.<br />
Diese Geschichten sind in Indien bis heute sehr populär. Sie<br />
werden nicht nur auf religiösen Festen vorgelesen und haben die<br />
Malerei und Bildhauerei inspiriert sondern dienen auch als Vorlage<br />
für Kinofilme und Comics. Das Mahabharata wurde wahrscheinlich zwischen 400 v.Chr. und 400<br />
n.Chr. niedergeschrieben, geht aber auf ältere Überlieferungen zurück. Es umfasst etwa 100.000<br />
Doppelverse. Die Bhagavad Gita (Der Gesang des Erhabenen) ist Teil dieses Epos und gilt als<br />
das bedeutendste und bekannteste Werk der Hindu-Literatur. In Form eines<br />
religionsphilosophischen Gedichts erzählt es die Geschichte vom großen Krieger Arjuna und<br />
dem Gott Krishna. Der Weise Vyasa aus der indischen Mythologie wird als der Autor der<br />
Bhagavad Gita angenommen.<br />
27
Ein Gott und viele Götter zugleich: Brahma, Vishnu und Shivas<br />
Zur Zeit der Entstehung der Veden repräsentierten die Götter die Naturkräfte. Erst mit den<br />
späteren Schriften der Upanischaden entstanden die zentralen hinduistischen<br />
Glaubensvorstellungen von Erlösung, Widergeburt und der Alleinheitslehre. Diese Lehre von der<br />
Alleinheit verkörpert eine monotheistische Richtung des Hinduismus. In ihr repräsentiert<br />
Brahman das unpersönlich vorgestellte höchste Sein, das nicht nur in der Seele jedes Lebewesens<br />
enthalten ist (Atman), sondern die Seele des ganzen Kosmos darstellt (Brahman). Brahman ist<br />
das höchste Göttliche, ohne (körperliche) Form und daher nicht abbildbar. Es kann auch nicht<br />
angebetet werden, da es ja den Anbetenden mit einschließt.<br />
Daneben gibt es eine hinduistische Richtung, die Parallelen zur<br />
Dreifaltigkeit im Christentum aufweist und auch als hinduistische<br />
Trinität bezeichnet wird. Brahman (All-Eine) wird in der Dreigestalt<br />
von Brahma (nicht zu verwechseln mit Brahman) dem Schöpfer,<br />
Vishnu dem Erhalter und Shiva dem Zerstörer repräsentiert. Alle drei<br />
Götter sind unterschiedliche Erscheinungsformen des einen höchsten<br />
Wesens und seiner drei Aspekte bzw. Funktionen. Diese Dreigestalt<br />
wird entweder in einer einzigen Figur mit drei Köpfen und sechs<br />
Armen dargestellt oder als drei einzelne Gottheiten. Jedem Gott wird<br />
eine Göttin als Ehefrau zur Seite gestellt. Saraswati, die Ehefrau von Brahma, ist die Göttin der<br />
Wissenschaft, Weisheit, Poesie und Musik. Die Göttin Lakshmi und Ehefrau von Vishnu steht<br />
für Glück, Schönheit und Reichtum. Parvati, die weibliche Seite Shivas, ist die Göttin der<br />
Schönheit, des Glanzes und der Heiterkeit.<br />
Zeichnungen, Statuen und Gemälde zeigen den Gott Brahma als älteren, bärtigen Mann mit vier<br />
Gesichtern, die in alle Himmelsrichtungen zeigen, und mit vier Armen. Als eigenständige<br />
Gottheit wird er im heutigen Indien nur noch in seiner Funktion als Offenbarer der Veden<br />
verehrt. Die Strömung innerhalb des Hinduismus, die Brahma als den einen Gott anbetete, ist<br />
praktisch so gut wie nicht mehr anzutreffen. Die beiden Götter Vishnu und Shiva sind nicht nur<br />
Teil der hinduistischen Dreigestalt, die das höchste Wesen Brahman repräsentiert. Der Glaube<br />
entweder an Shiva oder Vishnu als eigenständige Hauptgottheit steht auch für die Aufteilung in<br />
zwei wichtige Glaubensrichtungen innerhalb des Hinduismus: Vishnuismus und Shivaismus.<br />
Zeitlich fällt diese Aufspaltung in die zwei Hauptströmungen mit dem Ende der Upanischaden-<br />
Zeit und der Niederschrift der beiden bedeutenden Helden-Epen zusammen.<br />
28
Vishnuismus und Shivaismus<br />
Im Vishnuismus spielt die Hingabe an einen persönlichen Gott<br />
meist eine größere Rolle als im Shivaismus. Die Gründe dafür<br />
liegen vielleicht in der weitgehend positiven Darstellung des<br />
angebeteten Gottes. Vishnu erscheint auf den Abbildungen oft<br />
als strahlender, jugendlicher Gott mit vier Armen, die eine<br />
Diskusscheibe, Keule, Muschel oder Lotusblüte halten. Eine<br />
andere Darstellung zeigt ihn schlafend auf den Windungen einer<br />
(Ur)Schlange. Die Anhänger des Vishnuismus verehren ihn als<br />
den Gott der Liebe und Gnade, der zum Menschen wird, um die<br />
Menschheit zu retten und die Weltordnung wiederherzustellen. Dabei inkarniert er sich in<br />
vielfältiger Gestalt als Mensch oder Tier und unter verschiedenen Namen. Dennoch verstehen<br />
sich viele seiner Anhänger als Monotheisten, denn sie verehren nur die unterschiedlichen Formen<br />
und Aspekte des einen Gottes Vishnu. Schon in den Veden findet sein Name Erwähnung. In<br />
seiner Reinkarnation als Krishna und Rama ist er der Held in vielen Legenden der beiden großen<br />
Hindu-Epen, Mahabharata und Ramayana. Insbesondere die Bhagavad Gita repräsentiert in der<br />
Geschichte von Arjuna und Krishna ein Modell vischnuitischen Hindu-Denkens.<br />
In der Figur des Gottes Shiva sind, wie bei Vishnu, verschiedene<br />
regionale Götter zu einer Einheit verschmolzen. Shiva erscheint in<br />
seiner unberechenbaren Doppelnatur sowohl als grausamer<br />
Zerstörer als auch als Erneuerer. In dieser Funktion symbolisiert er<br />
den hinduistischen Glauben an Reinkarnation. Auf Abbildungen tritt<br />
er in den Rollen des Herrschers mit Dreizack und Axt, des Asketen<br />
in meditativer Versenkung oder als vierarmiger Tänzer auf. Er ist<br />
sowohl der belohnende als auch der strafende Gott und wird oft mit<br />
einem um die Taille gewickelten Tigerfell und mit Schlangen um den Hals dargestellt. Shiva ist<br />
der Gott der Geschlechtlichkeit und wird nicht figürlich verehrt, sondern in seinem Symbol, dem<br />
Phallus. Zeichnungen und Gemälde zeigen ihn oft mit seiner Gattin Parvati zusammen in inniger<br />
Umarmung oder beim Geschlechtsakt. Die berühmte Skulptur in den Elephanta-Höhlen in der<br />
Nähe von Bombay bildet ihn als zweigeschlechtliche Gottheit ab, halb Mann, halb Frau, mit nur<br />
einer Brust. Als ambivalenter Gott besitzt Shiva einen weiblichen Aspekt, der als seine shakti<br />
(Energie) verehrt wird und in der Mythologie von seiner Gattin Parvati verkörpert wird.<br />
29
Die Verehrung der Göttin: Shaktismus<br />
Der Shaktismus entwickelte sich zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert; seine Ursprünge gehen aber<br />
schon auf die Veden zurück. Er spielt heute besonders in den ländlichen Gegenden Indiens eine<br />
große Rolle und bildet die dritte Hauptströmung innerhalb der Hindu-Religionen. In jedem<br />
hinduistischen Kult gibt es weibliche Gottheiten. Die Abgrenzung zu diesen Kulten liegt darin,<br />
dass im Shaktismus eine oder mehrere Göttinnen als Energien aufgefasst oder als eigenständige<br />
höchste Gottheit verehrt werden. Seine Anhänger sehen in der Shakti (Energie) die aktive<br />
weiblichen Kraft, die den Ursprung allen Lebens darstellt. Die Götter (Brahma, Vishnu und<br />
Shiva) werden als reiner passiver Geist angesehen, der erst durch die aktive Kraft der Shakti<br />
wirksam wird. Nach dieser Sichtweise verkörpert die Shakti den weiblichen Aspekt in Gestalt der<br />
Göttinnen Saraswati, Lakshmi und Paravati. In einigen Regionen Indiens, wie zum Beispiel in<br />
Bengalen, wo der vorarische Muttergöttinnenkult besonders ausgeprägt war, wird die Göttin<br />
(Devi) als Höchste Gottheit verehrt. Auch sie erscheint in ihren Funktionen als Schöpferin,<br />
Bewahrerin und Vernichterin. Sie wird sowohl in ihren gütigen, mütterlichen Aspekten als auch<br />
in ihren grausamen oder erotischen Formen verehrt und taucht in den verschiedensten Gestalten<br />
und unter unterschiedlichen Namen auf. Als Kali mit herausgestreckter,<br />
blutiger Zunge und Stoßzähnen, behängt mit einer Kette aus<br />
Totenschädeln und bekleidet mit einem Gürtel aus abgeschlagenen<br />
Händen, ist sie oft von dunkler Hautfarbe und nackt. Eine andere<br />
Darstellung zeigt sie als junge Frau, die auf dem hingestreckt liegenden<br />
Körper von Shiva steht. Als Waffen schwingende Kriegerin Durga reitet<br />
sie auf einem Löwen und tötet Dämonen. In ihren liebenden und erotischen Anteilen sieht man<br />
sie in ihrer Funktion als Ehefrau und Sexualpartnerin der Götter<br />
Brahma, Vishnu und Shiva. Viele Abbildungen zeigen sie Hand in<br />
Hand mit ihrem Ehemann, auf seinen Knien sitzend oder seine Füße<br />
streichelnd. Auch in dem berühmten Hindu-Epos Ramayana, das die<br />
Liebesgeschichte vom Gott Rama und seiner Ehefrau, der<br />
Königstochter Sita erzählt, wird das Bild einer treuen,<br />
Ungerechtigkeiten erduldenden Gattin entworfen. Gegen dieses Bild<br />
haben vor allem indische Feministinnen wie Madhu Purnima Kishwar, die Gründerin der<br />
Zeitschrift Manushi, rebelliert.<br />
30
Geschlechtswandlungen und das dritte Geschlecht<br />
Die Götter und Göttinnen im Hinduismus erscheinen zum Teil in androgynen und mehrdeutigen<br />
Gestalten. In ihren unterschiedlichen Formen und unter verschiedenen Namen treten sie in oft<br />
gegensätzlichen und widersprüchlichen Funktionen und Rollen auf. Auch die Grenzen zwischen<br />
den Geschlechtern wirken eher fließend und sind durch spielerische Übergänge geprägt. Die<br />
indische Mythologie ist voll von Beispielen für Geschlechtswandlungen, gleichgeschlechtliche<br />
Sexualität und Ideen von einem dritten Geschlecht. In der Welt der Götter verwandelt sich der<br />
männliche Krishna oder der Gott Vishnu manchmal in eine Frau und nennt sich dann Mohini.<br />
Der Gott Shiva wird erst durch die Verbindung mit dem männlichen Feuergott Agni zur<br />
Zeugung von Nachkommen fähig. Die Götter Vishnu und Shiva vereinigen sich zu der Gottheit<br />
Harihara, die aus zwei verschiedenen männlichen Hälften besteht. Kama, der Gott der Liebe,<br />
schießt Pfeile auf zwei Frauen ab, die sich anschließend ineinander verlieben. Und ein<br />
bengalisches Epos erzählt die Geschichte zweier Frauen, die zusammen den Hindu-König<br />
Bhagiratha zeugen und gebären.<br />
Der Indologe und Religionswissenschaftler Thomas Gugler weist auf die Vorstellung von einem<br />
dritten Geschlecht hin, die in Indien schon zur Zeit der Entstehung der Veden existierte. So<br />
berichteten die Veden in ihren Ritualtexten von „klibas“ oder „napumsakas“(Nichtmännchen),<br />
die als unmännliche schwache Männer, mit langen Haaren und „weibischen“ Eigenschaften, wie<br />
Geschwätzigkeit, beschrieben werden. Laut Gugler gehen auch die drei Artikel der deutschen<br />
Sprache auf Grundlagen der Sanskrit-Grammatik zurück, während die semitischen Sprachen kein<br />
grammatikalisches drittes Geschlecht kennen.<br />
Auch Hijras, wie Transsexuelle im heutigen<br />
Indien genannt werden, repräsentieren das<br />
dritte Geschlecht. Sie sind körperlich<br />
größtenteils „Männer“, die sich in der Regel als<br />
Frauen kleiden und keine eindeutig weibliche<br />
oder männliche Geschlechtsidentität haben. Die<br />
Hijras leben in eigenen Gemeinschaften und<br />
verdienen ihren Lebensunterhalt traditionell durch religiöse Tänze und Zeremonien bei<br />
Hauseinweihungen, Hochzeiten oder nach der Geburt eines Sohnes. Obwohl sich einige von<br />
ihnen zum Islam, <strong>Buddhismus</strong>, hinduistischen Richtungen oder dem Christentum bekennen,<br />
verstehen sich alle als Anhängerinnen der Göttin „Bahuchara Mata“. Auf der einen Seite stehen<br />
die Hijras außerhalb der gesellschaftlichen Norm und Ordnung, andererseits sind sie aber keine<br />
31
Außenseiter, sondern haben eine religiöse Funktion als Vermittler zwischen den Göttern und den<br />
Menschen.<br />
Nach Auffassung der Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Lidia Guzy gibt es in Indien<br />
noch eine andere Gruppe von Menschen, die gewissermaßen das dritte Geschlecht darstellen: die<br />
Asketen. Die Asketen der religiösen Gruppe Mahima Dharma in der ostindischen Provinz Orissa<br />
sagen, dass sie durch das Zölibat und die Disziplinen der Askese die Kraft der Göttin Shakti in<br />
sich tragen. Laut Guzy bündeln sie die weiblichen und männlichen Schöpfungskräfte und<br />
verwandeln sie in ein neues Geschlecht. Für ihre Anhänger sind sie Mutter und Vater zugleich.<br />
Sie sind androgyn und damit, in der hinduistischen Vorstellungswelt, dem Göttlichen nah. Dies<br />
zeige sich auch in ihrer körperlichen Erscheinung: trotz ihres athletischen Oberkörpers haben die<br />
Asketen in der Regel einen sehr rundlichen Bauch, der dem schwangeren Bauch einer Frau<br />
ähnelt, und erscheinen durch das Tragen ihrer langen Haare als „weiblich“.<br />
Weiterführende Informationen<br />
Alois Payer - Materialien zur Religionswissenschaft<br />
http://www.payer.de/hinduismus/hindu01.htm<br />
Südasien Info - das Informationsportal zu Südasien (Unter den Schlagwörtern Hinduismus,<br />
Queer, Sexualität und Gender finden sich zahlreiche Artikel zum Download)<br />
http://www.suedasien.info/keywords/Hinduismus/ und keywords/Hindu-Nationalism/<br />
Amritsa Basu: Feminism Inverted: The Real Women and Gendered Imagery of Hindu<br />
Nationalism, in: Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol. 25, 1993<br />
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=97784708<br />
32
1. Glaubengrundsätze<br />
2. Die drei Körbe und der Sanskrit-Kanon<br />
3. Theravada- und Mahayana<br />
4. Tara und die Dakinis – der Tibetische <strong>Buddhismus</strong><br />
5. Siddhartha Gautama – der historische Buddha<br />
6. <strong>Buddhismus</strong> und Gender<br />
Glaubengrundsätze<br />
<strong>Buddhismus</strong><br />
Der <strong>Buddhismus</strong> ist eine Religion, die heute nahezu in ganz Asien vertreten ist, und seit den 60er<br />
Jahren auch in westlichen Ländern großen Anklang findet. Seine Gründung geht auf Siddhartha<br />
Gautama, den historischen Buddha, zurück, der im 6. Jh. v. Chr. in Nordindien lebte. Der<br />
<strong>Buddhismus</strong> entstand in der Umgebung der Hindu-Religionen und teilt mit diesen, mit geringen<br />
Abweichungen, die Glaubensvorstellungen von Wiedergeburt und Karma. Er stellt aber auch<br />
eine Reformbewegung dar, die sich gegen die Macht der Brahmanen (Priester) im Kastensystem<br />
der hinduistischen Gesellschaften richtete. Aus buddhistischer Sicht ist das Leben der Menschen<br />
durch Leid (Alter, Krankheit, Tod), Vergänglichkeit, und Begierde gekennzeichnet. Wie die<br />
Hindu-Religionen so hat auch der <strong>Buddhismus</strong> das Ziel, dem fortlaufenden leidvollen Kreislauf<br />
von Leben, Tod und Wiedergeburt zu entkommen und einen Zustand der „Erleuchtung“<br />
(Bodhi) zu erreichen, der zum Nirvana führt (Wunsch nach Leben, aber auch nach Tod, erlischt).<br />
Buddha sah sich nicht als Überbringer einer göttlichen Offenbarung, sondern einer Erkenntnis,<br />
die jedem Menschen zugänglich ist. Seine Lehre ist eine Art Philosophie, die die Ursachen des<br />
menschlichen Leids ergründet und Wege zu seiner Überwindung aufzeigt. Die daraus gewonnene<br />
Einsicht soll in Verbindung mit der regelmäßigen Praxis bestimmter Methoden und Techniken<br />
(z. B. Meditation), durch ethisches Verhalten und durch Entwicklung bestimmter Tugenden, wie<br />
Mitgefühl, Weisheit und Selbstlosigkeit, zur Erleuchtung führen. Die drei Zufluchten des<br />
33
Buddhisten sind das Bekenntnis zu Buddha, seiner Lehre und zu einem Leben in der<br />
Gemeinschaft (Orden). Den Kern dieser Lehre bilden die Vier Edlen Wahrheiten, die den<br />
gemeinsamen Nenner aller buddhistischen Richtungen bzw. Schulen darstellen. Die erste<br />
Wahrheit stellt die Diagnose, die zweite benennt die Ursachen, die dritte Wahrheit formuliert<br />
Auswege und die vierte Wahrheit beschreibt den praktischen Weg, der zur Überwindung des<br />
Leidens führt. Dieser Weg wird als achtfacher Pfad beschrieben und beinhaltet Anweisungen zu<br />
„rechter Ansicht, rechtem Denken, rechter Rede und Handlung, rechtem Lebenserwerb, rechter<br />
Anstrengung, Achtsamkeit und Konzentration“.<br />
Von den anderen vier Weltreligionen unterscheidet sich der <strong>Buddhismus</strong> vor allen Dingen<br />
dadurch, dass er weder einen allmächtigen, ewigen Gott noch eine unsterbliche Seele kennt. Er<br />
gibt keinen Trost in irgendeiner Vorstellung von einem Paradies oder Himmel nach dem Tode.<br />
Der <strong>Buddhismus</strong> betont die Vergänglichkeit des Lebens und die Selbstverantwortung des<br />
Menschen. Er warnt vor Autoritätsgläubigkeit und mahnt zur Skepsis gegenüber Schriften,<br />
feststehenden Lehren und Vorstellungen. Zudem gilt er als außergewöhnlich tolerante Religion,<br />
in deren Namen keine Kriege geführt wurden, und die es Mönchen oder Nonnen<br />
unterschiedlicher buddhistischer Richtungen ermöglicht, in einem Kloster zusammenzuleben.<br />
Die drei Körbe und der Sanskrit-Kanon<br />
Die heilige Schrift des <strong>Buddhismus</strong>, Pali-Kanon oder Tripitaka<br />
genannt, entstand im 1. Jh. v. Chr. und geht im Gegensatz zu<br />
anderen Religionen nicht auf eine göttliche Überlieferung zurück.<br />
Diese Texte werden von den Anhängern des streng traditionellen<br />
Theravada-<strong>Buddhismus</strong> als die einzig gültige und verbindliche<br />
Schrift angesehen. Da Buddha keine schriftliche Lehre hinterlassen<br />
hatte, wurden seine Reden in vier verschiedenen Konzilien, d.h.<br />
Versammlungen von Mönchen und Nonnen, zusammengetragen<br />
und mündlich überliefert. Für die Mehrzahl der westlichen<br />
Forscher ist die erste Niederschrift des Pali-Kanons nicht das Originaldokument, sondern sie<br />
vermuten, dass eine verlorengegangene ursprüngliche Fassung in Buddhas eigener Sprache<br />
existiert hat. Der Pali-Kanon gliedert sich in drei Bereiche oder „Körbe“ (die Texte wurden auf<br />
Palmblättern geschrieben und in drei Körben aufbewahrt): Ordensregeln, die Lehrreden Buddhas<br />
und philosophische Kommentare. Der zweite Korb enthält auch die Verse der Nonnen und<br />
Mönche und die Lieder der Nonnen. Der Gelehrte Buddhaghosa (5. Jh. n. Chr.) gilt als einer der<br />
bedeutendsten Kommentatoren. Einige Kommentare der frühen Theravada-Literatur schüren die<br />
34
Furcht vor der Macht und Anziehungskraft der Frauen und bezeichnen sie als Grundlage allen<br />
Übels, als Ausdruck der Welt der Begierde und als Hindernis auf dem Weg zur Erleuchtung.<br />
Diese Aussagen müssen in Zusammenhang mit der Bedeutung der Ordenstradition gesehen<br />
werden, die auf dem Keuschheitsgelübde der Mönche basierte. Es stellt sich die Frage, ob diese<br />
Äußerungen von Buddha selbst stammen, ihm untergeschoben wurden oder an die Mönche<br />
gerichtet waren, die keine sexuellen Beziehungen und familiären Bindungen eingehen sollten.<br />
Über den Pali-Kanon hinaus gibt es eine gewaltige Sammlung an Schriften späteren Datums, der<br />
Sanskrit-Kanon genannt wird. Ein großer Teil dieser Originaltexte galt als verschwunden, nur die<br />
Übersetzungen ins Tibetanische und Chinesische blieben erhalten. Erst Mitte des 20.<br />
Jahrhunderts entdeckten westliche Forscher Teile der Original-Schriften in einer Höhle in<br />
Zentralasien. Diese Texte enthalten Legenden, Gedichte und Meditationsübungen und geben<br />
einen großen Teil der buddhistischen Philosophie und Psychologie wieder. Der Sanskrit-Kanon<br />
ist in einzelne Sutren (Leitfäden) unterteilt. Diese unterschiedlichen Sutren bilden die Grundlage<br />
für die verschiedenen Richtungen des Mahayana-<strong>Buddhismus</strong>, so steht zum Beispiel das<br />
Diamant-Sutra für den Zen-<strong>Buddhismus</strong>. In einigen Sutren spricht anstelle des Buddhas auch ein<br />
erleuchteter Mensch, z. B. die Königin Shrimala oder ein Laie (Nicht-Mönch), der Haushälter<br />
Vimalakirti. Für die Mahayana-Schulen stellt der Sanskrit-Kanon eine historische<br />
Weiterentwicklung der Schriften dar. Sie behaupten aber auch, dass ihre Lehre, die später<br />
entstand, von denjenigen Schülern Buddhas stammt, die ihm am nächsten gestanden haben. Aus<br />
der Sicht westlicher Wissenschaftler stellt der Pali-Kanon die authentischere Lehre Buddhas dar.<br />
Theravada- und Mahayana<br />
Der <strong>Buddhismus</strong> zeigte schon bald nach Buddhas Tod verschiedene Schwerpunkte,<br />
Ausprägungen und erste Abspaltungen. Im Laufe der Jahrhunderte verbreitete er sich in<br />
unterschiedlichsten Ländern und Kulturen und veränderte sich durch die Anpassung an die<br />
jeweiligen lokalen Gegebenheiten. Die buddhistischen Traditionen lassen sich grob in Theravada<br />
(Alter Weg, manchmal auch als Hinayana bezeichnet) und Mahayana (Großer Weg) einteilen.<br />
Den Theravada-<strong>Buddhismus</strong> kann man auf Ceylon, in Burma, Sri-Lanka, Thailand, Laos,<br />
Kambodscha und allgemein in Südasien finden.<br />
Im Theravada genießt das Mönchstum eine bevorzugte Stellung und nur ein Mönch kann den<br />
Zustand der Erleuchtung erreichen. Der <strong>Buddhismus</strong> ist hier vor allem eine Ordensreligion, und<br />
das Zusammenspiel zwischen Mönchen bzw. Nonnen und den Laien ist durch gegenseitige<br />
Abhängigkeit geprägt. Die Laien unterstützen die Klöster materiell und erwerben dadurch<br />
religiöse Verdienste, die sogar vererbt werden können. Die Mönche und Nonnen sind auf die<br />
35
Essensspenden der Laien angewiesen und lesen im Gegenzug dazu aus den heiligen Schriften<br />
vor. Das Theravada versteht sich als die einzig überlebende Schule des Ur-<strong>Buddhismus</strong> und als<br />
Bewahrer der zeitlosen, direkt von Buddha überlieferten Worte. Die Betonung liegt auf der<br />
Kontrolle des Geistes und auf dem Vermeiden von Leid. Das Ziel ist die Erlösung des Einzelnen<br />
und der völlige Rückzug von dieser Welt der Erscheinungen.<br />
Die Richtungen des Mahayana sind besonders in Nepal, Nordindien, Tibet, Japan, Bhutan,<br />
Taiwan, China, der Mongolei und teilweise auch in Indonesien präsent. Im Mahayana sind<br />
Mönche und Laien eher gleichgestellt, und beide haben eine Chance auf Erlösung im Nirvana.<br />
Die Sutras sprechen von einer „Buddha-Natur“, die in jedem<br />
Wesen steckt, egal ob Mönch, Laie, Frau oder Mann, und die eine<br />
größere Bedeutung erhält als der historische Buddha. Im täglichen<br />
Leben liegt der Schwerpunkt auf dem Vermeiden von Zorn und<br />
der Entwicklung von Mitgefühl. Der Kern der Lehre ist die<br />
Philosophie der selbstlosen Barmherzigkeit. Das menschliche<br />
Ideal ist der Erleuchtete (Bodhisattva), der schon zum Buddha<br />
geworden ist, aber auf das Nirvana verzichtet und aus Mitgefühl in<br />
die Welt zurückkehrt, um anderen Menschen auf dem Weg zur<br />
Erleuchtung beizustehen. Daraus resultiert die große Bedeutung der Rolle des Lehrers (Guru)<br />
und des Meister-Schüler-Verhältnisses im Mahayana-<strong>Buddhismus</strong>. Das Prinzip der<br />
Barmherzigkeit weist eine Parallele zum Christentum und der Lehre von Jesus im Neuen<br />
Testament auf.<br />
Die Lehre von Anatta gilt als die wichtigste Lehre in allen buddhistischer Richtungen und wird<br />
auch mit dem Prinzip der “Leerheit“ umschrieben. Dieser Gedanke spielt auch bei der<br />
Betrachtung der Geschlechterordnung, -hierarchien und -beziehungen im <strong>Buddhismus</strong> eine große<br />
Rolle. Leerheit bedeutet, dass es kein beständiges Ich mit wesensmäßigen, naturhaften<br />
Eigenschaften gibt, sondern nur Erscheinungen, die sich wandeln und voneinander abhängen.<br />
Das „Weibliche“ hat demnach kein eigene Wirklichkeit, so wenig wie das „Männliche“. Es gibt<br />
nur eine Ansammlung von sich konstant verändernden, physischen und psychischen<br />
Bestandteilen. Das Ziel der buddhistischen Lehre ist, sich von der Vorstellung eines festen Selbst<br />
zu lösen bzw. die Anhaftung daran loszulassen.<br />
36
Tara und die Dakinis – der Tibetische <strong>Buddhismus</strong><br />
Der Tibetische <strong>Buddhismus</strong> (Diamantweg) ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Schulen,<br />
die nicht nur in Tibet, sondern auch in Bhutan, Nepal, Indien, Japan, China und der Mongolei<br />
verbreitet sind. Er beruht auf den philosophischen Grundlagen des Mahayana, ergänzt diese aber<br />
um bestimmte Rituale, wie das Rezitieren von bestimmten Wortfolgen (Mantras) oder<br />
Körperpraktiken, wie z. B. Joga.<br />
In der Mahayana-Tradition gibt es die Vorstellung, dass jeder Bodhisattva, d. h. Erleuchtete eine<br />
Erscheinungsform von Buddha darstellt. Es wird behauptet, dass der <strong>Buddhismus</strong> keine Götter<br />
kenne, doch das stimmt nur bedingt. Die ursprünglichen Bon-Gottheiten im alten Tibet wurden<br />
in den <strong>Buddhismus</strong> integriert und verwandelten sich in männliche oder weibliche Bodhisattvas,<br />
die nun verschiedene Aspekte von Buddha darstellen. Das „weibliche Prinzip“ wird durch<br />
sogenannte weibliche Buddhas, Erleuchtete, Göttinnen oder Dakinis repräsentiert. Ein Beispiel<br />
dafür ist die Göttin Prajnaparamita, die „Vervollkommnung der Weisheit“, die als „Mutter aller<br />
Buddhas“ mit vollen Brüsten abgebildet wird.<br />
Das Sutra „der goldene Rosenkranz“ erzählt die Geschichte der<br />
Prinzessin Mond der Weisheit, die sich tagtäglich in den<br />
buddhistischen Disziplinen übte. Als ihr die Mönche den Rat gaben,<br />
ihre Kräfte einzusetzen, um in ihrem nächsten Leben als Mann<br />
wiedergeboren zu werden, lehnte sie sich gegen sie auf und sagte: „Es<br />
gibt hier keinen Mann, es gibt keine Frau, kein Selbst, keine Person<br />
und kein Bewusstsein. Die Bezeichnung „Mann“ oder „Frau“ hat<br />
keine Essenz, sondern führt die verblendete Welt irre“. Diese<br />
Aussage muss in Zusammenhang mit der buddhistischen Philosophie<br />
der Leerheit interpretiert werden. Die Legende erzählt weiter, dass sie später erleuchtet wurde,<br />
ihren Namen änderte und zu Tara der Schutzgöttin Tibets wurde. Tara ist die wichtigste<br />
buddhistische Göttin, und ihre frühesten Darstellungen fallen in das 6.<br />
Jh. n. Chr.. Sie wird in verschiedenen Farben dargestellt: als rote, gelbe<br />
und blaue Tara verkörpert sie die grausamen und zerstörerischen<br />
Aspekte der Göttin. Als weiße und grüne Tara erscheint sie in der<br />
Rolle der Mutter, Retterin, Beschützerin und symbolisiert Mitgefühl<br />
und Barmherzigkeit. In China wird sie unter dem Namen Kwan-yin<br />
verehrt, und in Japan wird sie Kwannon genannt.<br />
Wie die Shakti im Hinduismus, so gibt es auch im <strong>Buddhismus</strong> eine<br />
Form der weiblichen Energie, die hier Dakini genannt wird. Dakinis<br />
37
stellen aber auch eine Verkörperung der Tara und anderer buddhistischer Göttinnen dar. Sie sind<br />
Luftwesen (Himmels-Tänzerinnen), körperlos und unsterblich, mit sehr wechselhaftem, wildem<br />
Temperament. Die Darstellungen zeigen sie in verschiedenen Hautfarben als junge, nackte Frau<br />
mit struppigen langen Haaren, die mit wutverzerrtem Gesicht auf einen am Boden liegenden<br />
Körper herumtrampelt. Andere Abbildungen präsentieren sie, wie die Kali im Hinduismus, mit<br />
Hackmesser, blutgefüllter Schädelschale oder mit einer Krone aus menschlichen Schädeln. Die<br />
Dakinis symbolisieren die Weisheit und erscheinen den praktizierenden Buddhisten, um sie zu<br />
prüfen. Viele große Meisterinnen der religiösen Lehre, wie zum Beispiel Machig Labdrön oder<br />
Niguma, werden als Verkörperung der Dakinis betrachtet.<br />
Siddhartha Gautama – der historische Buddha<br />
Die Daten zum historischen Buddha sind umstritten. Laut Überlieferung wurde Siddhartha<br />
Gautama, als Sohn des Fürsten Shuddhodana und seiner Ehefrau Maya um 563 v. Chr. in<br />
Limbini geboren. Neue historische Theorien gehen teilweise davon aus, dass er bis zu 150 Jahre<br />
später gelebt hat. Siddhartha führte ein luxuriöses Leben, heiratete und bekam einen Sohn. Im<br />
Alter von 29 Jahren gewann er durch die Begegnung mit einem Alten, einem Kranken und einem<br />
Toten Einsicht in das Leid der Menschheit und die Vergänglichkeit des Lebens. Bald darauf<br />
verließ er seinen neugeborenen Sohn, seine Ehefrau und seine Familie und zog als Wanderasket<br />
durch das Tal des Ganges. Nach sechs Jahren des religiösen Studiums und der Meditation<br />
ereichte er mit 35 Jahren die vollkommene Erleuchtung unter dem Baum der Weisheit (bodhi).<br />
Wie Jesus im Christentum so hielt auch Siddhartha seine Lehrreden vor sozial Ausgegrenzten,<br />
wie zum Beispiel Prostituierten und Angehörigen der untersten Kasten. Aus der Gemeinschaft<br />
der ihm folgenden Mönche und Laien entstand der erste Orden. Auf die Bitte seiner Stiefmutter<br />
und Tante Mahaprajapati hin, gründete er den ersten Nonnenorden, dem diese als Nonne beitrat.<br />
Buddha lehrte bis zum Alter von 80 Jahren und starb um 483 v. Chr. an einer<br />
Lebensmittelvergiftung.<br />
Die Legenden, die sich um seine Geburt ranken, sind mit den Schilderungen von der Geburt<br />
Jesus vergleichbar. Sie berichten von einem Engel, der in Gestalt eines weißen Elefanten der<br />
Königin Maya im Traum erscheint und von ihr „Besitz nimmt“. Wie Maria im Christentum, so<br />
soll auch die Mutter von Siddhartha bis zu ihrer Empfängnis ein Leben in völliger Keuschheit<br />
geführt haben und seine jungfräuliche Geburt wird angedeutet. Maya, die Mutter von Siddhartha,<br />
stirbt eine Woche nach seiner Geburt.<br />
38
Die Figur Buddhas verkörpert das Ideal der sexuellen Enthaltsamkeit, der Vergeistigung und der<br />
Gemeinschaft unter Männern. Er wird als das positive Bild eines Mannes gezeichnet, der als<br />
Vorbild für alle buddhistischen Mönche die Bindungen an Ehe und Familie aufgibt. Anders als<br />
Jesus, der eine Ehe mit anschließender Familiengründung nie eingegangen ist, löste sich<br />
Siddhartha aus der Verantwortung gegenüber Familie, Ehefrau und Kind. Damit unterscheidet er<br />
sich vom Religionsgründer des Islam. Mohammed verblieb nach der göttlichen Offenbarung<br />
nicht nur bei seiner Familie, sondern er verbreitete seine Lehre mit Hilfe seiner Ehefrauen, seiner<br />
Tochter und seines Onkels.<br />
Der Pali-Kanon enthält eine Beschreibung Buddhas. Demnach war er ein wohlgestalteter,<br />
majestätisch großer Mann mit sehr heller, fast goldener Hautfarbe. Seine Sprache und<br />
Ausdrucksweise wird als kultiviert, klar und präzise, sein Verhalten als einnehmend und<br />
sympathisch beschrieben. Die ersten Skulpturen von Buddha tauchten erst im 1. Jh. n. Chr. auf<br />
und gehen auf die Anhänger des Mahayana zurück, die ein personales Buddha-Bildnis forderten.<br />
Die Abbildungen zeigen Buddha meist in sitzender<br />
Meditationshaltung mit einer Erhöhung auf der Schädelmitte als<br />
Kennzeichen seiner Erleuchtung. Seine Ohrläppchen sind<br />
langgezogen, seine Haare krausen sich in gedrehten Löckchen.<br />
Obwohl er in der Realität, wie alle Mönche im <strong>Buddhismus</strong>, den<br />
Kopf kurz geschoren trug. Die Kunst bildet Buddha oft<br />
wohlgenährt ab, aber nicht dick, mit goldener Hautfarbe und in<br />
eine Mönchsrobe gekleidet. Eine Bronzeskulptur in Thailand<br />
zeigt ihn als Asketen bis auf das Skelett abgemagert. Daneben<br />
gibt es die im Westen bekannte Darstellung des lachenden<br />
Buddhas mit dickem Bauch, die aus China stammt.<br />
<strong>Buddhismus</strong> und Gender<br />
In den buddhistischen Richtungen der Mahayana-Tradition gelten Frauen als Quelle höchster<br />
Weisheit. Die Frau ist in hier in ihrer Rolle als Mutter Vorbild für das Prinzip des Mitgefühls und<br />
der selbstlosen Barmherzigkeit. Im Tibetischen <strong>Buddhismus</strong> repräsentiert sie die Erkenntnis und<br />
die Leerheit. In den frühbuddhistischen Schulen des traditionellen Theravada verkörpert sie das<br />
Leid und die Begierde. Gemäß den zentralen Lehren Buddhas sind die Geschlechter jedoch nicht<br />
verschieden, und sie besitzen daher auch keine wesensmäßigen, naturhaften Eigenschaften. Die<br />
Religion des <strong>Buddhismus</strong> dient nicht zur Begründung von Unterschieden, behauptet keine<br />
Wertigkeit der Geschlechter und kann dem zur Folge auch nicht zur Rechtfertigung von<br />
39
Geschlechterhierarchien herangezogen werden. Es gibt keinen Schöpfungsmythos und keinen<br />
Schöpfergott. Insofern stellt sich nicht die Frage, ob beide Geschlechter vor Gott gleichwertig<br />
sind, oder welches Geschlecht zuerst erschaffen wurde und somit höherrangig ist.<br />
Aber es gibt Unterschiede in Bezug darauf, wie groß die Fähigkeit des Menschen ist, die<br />
Erleuchtung zu erlangen, abhängig von seinem Geschlecht. Alle drei großen Hauptrichtungen<br />
des <strong>Buddhismus</strong> lehren, dass Männern und Frauen diesen Zustand erreichen können und<br />
berichten von großen Lehrern und Meisterinnen. Doch die Aussagen in den Schriften sind<br />
widersprüchlich. Im Pali-Kanon wird Buddha zitiert, der gesagt<br />
habe „Frauen..., die ... (in die Hauslosigkeit) gegangen sind, sind<br />
fähig, ... die Vollkommenheit zu erlangen“ (I.B. Horners<br />
Übersetzung, Band 5, S. 354). In der Sammlung der wichtigsten<br />
und bekanntesten Reden Buddhas soll er hingegen der Frau die<br />
Fähigkeit zur höchsten Verwirklichung des Nirvanas<br />
(Arahatschaft) abgesprochen haben: „Unmöglich ist es und<br />
kann nicht sein, dass eine Frau einen Arahat als vollkommen<br />
Erwachten ... darstellen kann.“( (Majjhima-Nikaya 115, A:1,20).<br />
Die vollkommene Erleuchtung kann anscheinend nur in einem<br />
männlichen Körper stattfinden.<br />
In allen Schriften der Hauptrichtungen des <strong>Buddhismus</strong> gibt es Gebete, in denen man darum<br />
bittet, nicht als Frau wiedergeboren zu werden. Diese Aussagen müssen sicherlich vor dem<br />
sozialen und gesellschaftlichen Hintergrund der jeweiligen Zeit interpretiert werden. Dennoch:<br />
Frauen und Männer, Mönche und Nonnen sind bis heute nicht gleichgestellt und auch nicht<br />
gleichberechtigt. Sie unterliegen unterschiedlichen religiösen Verhaltensregeln und Ge-und<br />
Verboten, die eine Hierarchie abbilden. Dies steht im Widerspruch zu den zentralen Lehren des<br />
<strong>Buddhismus</strong>.<br />
Weiterführende Informationen<br />
http://www.buddhismus.de/<br />
Deutsche Buddhistische Union<br />
http://www.buddhismus-deutschland.de/dbu/<br />
Internationale Buddhistische Frauenvereinigung<br />
http://www.sakyadhita-europe.org/<br />
40
Quellenangaben zu den Abbildungen<br />
Abbildungen im Beitrag Judentum:<br />
Abb. Seite 2, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/judentum/index.htm<br />
Menora, Zeichnung<br />
Abb. Seite 6, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/gottbild/index.htm<br />
Schöpfungsbild der Lutherbibel, Lukas Cranach<br />
Abb. Seite 7, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/urgesch1/index.htm<br />
Sündenfall, Titzian<br />
Abbildungen im Beitrag Christentum<br />
Abb. Seite 10, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/aufersth/index.htm<br />
Auferstehung Christi, Luca della Robbia<br />
Abb. Seite 12, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/apostel/index.htm<br />
Apostel Paulus, Deonissij<br />
Abb. Seite 15, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/kindjes/index.htm<br />
Die heilige Familie, Rembrandt<br />
Abb. Seite 16, Bildzitat: Quelle:http://www.uni-leipzig.de/ru/bilder/kindjes/index.htm<br />
Grablegung Christi, Bertolomeo<br />
Abbildungen im Beitrag Islam<br />
Abb. Seite 20, 23<br />
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Otmane Khazraji<br />
Abbildungen im Beitrag Hinduismus<br />
Abb. Seite 25-31 mit freundlicher Genehmigung von Bernhardt Kern<br />
Quelle: http://www.asoka.de/hindugoetter/<br />
Abbildungen im Beitrag <strong>Buddhismus</strong><br />
Abb. Seite 33-40 mit freundlicher Genehmigung von Harri Czesla<br />
Quelle: http://www.tibet-galerie.de/<br />
41
Literaturhinweise<br />
Gender und Religion<br />
Becker, Sybille: Leib - Bildung – Geschlecht. Perspektiven für die Religionspädagogik. Reihe:<br />
Theologische Frauenforschung in Europa, Bd. 13. Münster 2005<br />
Braun, Christina von/ Brunotte, Ulrike u. a. (Hrsg.): Holy War and Gender. Gotteskrieg und<br />
Geschlecht. Reihe: Berliner Gender Studies, Bd 2. Münster 2006<br />
Bornstein, Kate: Gender Outlaw. On Men, Women, and the Rest of Us. London 1994<br />
Boyarin, Daniel: Gender. In: Taylor, Mark (Hrsg.): Critical Terms für Relgious Studies, S. 117-<br />
135. Chicago 1998<br />
Brunotte, Ulrike: Zwischen Eros und Krieg. Männerbund und Ritual in der Moderne. Berlin 2004<br />
Büschel-Thalmaier, Sandra: Dekonstruktive und rekonstruktive Perspektiven auf Identität und<br />
Geschlecht. Reihe: Theologische Frauenforschung in Europa, Bd. 19. Münster 2005<br />
Butler, Judith: Körper von Gewicht. Die Grenzen des Geschlechts. Berlin 1995<br />
Dies: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main 1991<br />
Castelli, Elizabeth A./ Rodman, Rosamond: Women, Gender, Religion. A Reader. New York<br />
2001<br />
Comstock, Gary David u.a. (Hrsg.): Queering Religion. A Critical Anthology. New York 1997<br />
Cooey, Paula/ Eakin, William/ Mc Daniel, Jay (Hrsg.): After Patriarchy. New York 1991<br />
De Haardt, Maaike/ Korte, Anne-Maria (Hrsg.): Common Bodies. Everyday Practices, Gender<br />
and Religion. Reihe: Theologische Frauenforschung in Europa, Bd. 6. Münster 2002<br />
Dunde, Siegfried Rudolf (Hrsg.): Vater im Himmel - seine Söhne auf Erden Männer und<br />
Religion. Reinbek bei Hamburg 1986<br />
Faber, Richard/ Lanwerd, Susanne: Kybele, Prophetin, Hexe. Religiöse Frauenbilder und<br />
Weiblichkeitskonzeptionen. Würzburg 1997<br />
Franke, Edith (Hrsg.): Frauen Leben Religion. Ein Handbuch empirischer Forschungsmethoden.<br />
Stuttgart 2002<br />
Grieser, Alexandra: Sexualität und Geschlechterrollen. In: Metzler Lexikon Religion. Tübingen<br />
2000<br />
Gross, Rita M.: Feminism and Religion. An Introduction. Boston 1996<br />
Heiler, Friedrich: Die Frau in den Religionen der Menschheit. New York 1977<br />
Heininger, Bernhard (Hrsg.): Geschlechterdifferenz in religiösen Symbolsystemen. Reihe:<br />
Geschlecht - Symbol – Religion, Bd.1. Münster 2003<br />
42
Ders.: Heininger, Bernhard / Böhm, Stephanie / Sals, Ulrike (Hrsg.): Machtbeziehungen,<br />
Geschlechterdifferenz und Religion. Reihe: Geschlecht - Symbol – Religion, Bd. 2. Münster 2004<br />
Jagose, Annamarie: Queer Theory. Eine Einführung. Berlin 2001<br />
Jeffers Ann/ Höpflinger, Anna-Katharina/ Pezzoli-Olgiati, Daria (Hrsg.): Gender und Religion.<br />
Ein Handbuch. Göttingen 2008<br />
Juschka, Darlene: Feminism in the Study of Religion. London 2001<br />
King, Ursula (Hrsg.): Religion and Gender. Oxford 1995<br />
Dies.: King, Ursula / Beattie, Tina: Gender, Religion, and Diversity. Cross-cultural Perspectives.<br />
London - New York 2004<br />
Kloppenborg, Ria/Wouter J. Hanegraaff (Hrsg.): Female Stereotypes in Religious Traditions.<br />
Leiden – New York 1995<br />
Kvam, Kristen E./ Schearing, Linda S./ Ziegler, Valarie H.: Eve and Adam. Jewish, Christian,<br />
and Muslim Readings on Genesis and Gender. Bloomington 1999<br />
Ladner, Gertraud: FrauenKörper in Theologie und Philosophie. Reihe: Theologische<br />
Frauenforschung in Europa, Bd. 11. Münster 2003<br />
Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike<br />
bis Freud. Frankfurt am Main - New York 1992<br />
Lukatis, Ingrid (Hrsg.): Religion und Geschlechterverhältnis. Opladen 2000<br />
Morny, Joy: Divine Love. Luce Irigaray, Women, Gender, and Religion. Manchester Studies in<br />
Religion, Culture, and Gender. Manchester 2006<br />
Nanda, Serena: Gender diversity. Crosscultural variations. Illinois 2000<br />
Parrinder, Geoffrey: Sexualität in den Religionen der Welt. Düsseldorf 2004<br />
Runzo, Joseph (Hrsg.): Love, Sex, and Gender in World Religions. Oxford 2000<br />
Schüngel-Straumann, Helga: Die Frau am Anfang. Eva und die Folgen. Reihe: Exegese in unserer<br />
Zeit, Bd. 7, Münster 1999<br />
Sharma, Arvind/ Young, Katherine K.(Hrsg.): Feminism and World Religions. New York 1999<br />
Swidler, Arlene (Hrsg.): Homosexuality and World Religions. Pennsylvania 1993<br />
Uhl, Florian/ Boelderl, Artur R. (Hrsg.): Das Geschlecht der Religion. Berlin 2005<br />
Wacker, Marie-Theres: Von Göttinnen, Göttern und dem einzigen Gott. Reihe: Theologische<br />
Frauenforschung in Europa, Band 14. Münster 2004<br />
Dies.: Mannsbilder. Kritische Männerforschung und theologische Frauenforschung. Reihe:<br />
Theologische Frauenforschung in Europa, Band 20. Münster 2006<br />
Walker Bynum, Carolyn: Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human<br />
Body in Medieval Religion. New York 1992<br />
43
Yazbeck Haddad, Yvonne /Esposito, John L.: Daughters of Abraham. Feminist Thought in<br />
Judaism, Christianity, and Islam. Florida 2001<br />
Young, Serinity (Hrsg.): An Anthology of Sacred Texts by and about Women. New York 1993<br />
Dies.: The Encyclopedia of Women and World Religion. New York 1999<br />
Gender und Judentum<br />
Beal, Timothy K.: The Book of Hiding: Gender, Ethnicity, Annihilation, and Esther. London -<br />
New York 1997<br />
Bebe, Pauline: Isha. Frau und Judentum. Egling an der Paar 2004<br />
Boyarin, Daniel/ Itzkovitz, Daniel/ Pellegrini, Ann: Queer Theory and the Jewish Question.<br />
Columbia 2003<br />
Broyde, Michael J./ Ausubel, Michael: Marriage, Sex, and Family in Judaism. Lanham 2005<br />
Eilberg-Schwartz, Howard: God´s Phallus and the Dilemmas of Masculinity. In: Boyd, Stepen B.<br />
u. a. (Hrsg.): Redeeming Men. Religion and Masculinities, S. 36-47. Louisville 1996<br />
Elior, Rachel: Men And Women. Gender, Judaism, and Democracy. Jerusalem - New York 2004<br />
Fonrobert, Charlotte Elisheva: Menstrual Purity. Rabbinic and Christian Reconstructions of<br />
Biblical Gender. Stanford 2000<br />
Gerstenberger, Erhard S.: Frauenrollen – Männerrollen. Genderstudien im Alten Testament.<br />
Reihe: Exegese in unserer Zeit, Bd. 4. Münster 2007<br />
Gottlieb, Lynn: She Who Dwells Within. Feminist Vision of a Renewed Judaism. San Francisco<br />
1995<br />
Hoffman, Lawrence A.: Covenant of Blood. Circumcision and Gender in Rabbinic Judaism.<br />
Chicago 1996<br />
Ilan, Tal: Jewish Women in Greco-Roman Palestine. An Inquiry into Image and Status. Peabody<br />
1996<br />
Knauss, Stefanie: Drachenfrau und Geistfeuer. Neue Metaphern für Gott in der jüdischen<br />
feministischen Theorie und Praxis. Münster 2002<br />
Levinson, Navé Pnina: Eva und ihre Schwestern. Gütersloh 1992<br />
Levitt, Laura: Jews and Feminism. The Ambivalent Search for Home. New York 1997<br />
Peskowitz, Miriam/ Levitt, Laura : Judaism Since Gender. New York 1997<br />
Plaskow, Judith: The Coming of Lilith. Essays on Feminism, Judaism, and Sexual Ethics. Boston<br />
2005<br />
Rakel, Claudia: Judit - über Schönheit, Macht und Widerstand im Krieg. Eine feministischintertextuelle<br />
Lektüre. Berlin 2003<br />
44
Ritter, Christine: Rachels Klage im antiken Judentum und frühen Christentum. Boston 2003<br />
Rudavsky, Tamar: Gender and Judaism. The Transformation of Tradition. New York 1995<br />
Schäfer, Peter: Mirror of His Beauty. Feminine Images of God from the Bible to the Early<br />
Kabbalah. Princeton 2002<br />
Schwartz, Joshua/ Poorthuis, Marcel: Saints and Role Models in Judaism and Christianity. Boston<br />
2004<br />
Shepard Kraemer, Ross: When Aseneth Met Joseph. A Late Antique Tale of the Biblical<br />
Patriarch and his Egyptian wife. New York 1998<br />
Standhartinger, Angela: Das Frauenbild im Judentum der hellenistischen Zeit. New York 1995<br />
Wallach-Faller, Marianne / Brodbeck, Doris/ Domhardt, Yvonne: Die Frau im Tallit. Judentum<br />
feministisch gelesen. Zürich 2000<br />
Walter, Jakob/ Zemer, Moshe: Gender Issues in Jewish Law. New York 2001<br />
Wasserfal, Raher R.: Women and Water. Menstruation in Jewish Life and Law. London 1999<br />
Wolfthal, Diane: Picturing Yiddish. Gender, Identity, and Memory in the Illustrated Yiddish.<br />
Boston 2004<br />
Zlotnick, Helena: Dinah's Daughters. Gender and Judaism from the Hebrew Bible to late<br />
antiquity. Philadelphia, University of Pennsylvania 2002<br />
Gender und Christentum<br />
Alt, Franz: Jesus - der erste neue Mann. München 1989<br />
Elsdörfer, Ulrike: Frauen in Christentum und Islam. Königstein/Taunus 2006<br />
Epp, Eldon Jay: Junia. The First Woman Apostle. Fortress, Minneapolis 2005<br />
Jensen, Anne: Gottes selbstbewusste Töchter. Frauenemanzipation im frühen Christentum?<br />
Freiburg 1992<br />
Karle, Isolde: Da ist nicht mehr Mann noch Frau. Theologie jenseits der Geschlechterdifferenz.<br />
Gütersloh 2006<br />
Klinger, Elmar/ Böhm, Stefanie/ Franz, Thomas (Hrsg.): Die zwei Geschlechter und der eine<br />
Gott. Würzburg 2002<br />
Loader, William: The Septuagint, Sexuality, and the New Testament. Grand Rapids 2004<br />
Lüninghöner, Gert/ Spilling-Nöker, Christa: Abraham & Co. Biblische Männergeschichten.<br />
Freiburg im Breisgau 1991<br />
Mollenkott, Virginia R.: Gott eine Frau? Vergessene Gottesbilder der Bibel. München 1984<br />
Moore, Stephen D./ CapelAnderson, Janice: New Testament Masculinities. Atlanta 2003<br />
45
Riegel, Ulrich: Gott und Gender. Eine empirisch-religionspädagogische Untersuchung nach<br />
Geschlechtsvorstellungen in Gotteskonzepten. Münster 2004<br />
Schüssler Fiorenza, Elisabeth: Zu ihrem Gedächnis .... Eine feministisch-theologische<br />
Rekonstruktion der christlichen Ursprünge. München 1988<br />
Schwarz, Helena: Die Bibel und der Sexus. Neukirchen 2006<br />
Steinberg, Leo The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion. Chicago 1996<br />
Wittschier, Sturmius: Männer spielen Mann. Dramen mit Gott und Vater. Salzburg 1994<br />
Wolff, Hanna: Jesus der Mann. Die Gestalt Jesu in tiefenpsychologischer Sicht. Stuttgart 1975<br />
Ziebertz, Georg: The Human Image of God. Boston 2001<br />
Gender und Islam<br />
Abdel-Wahab, Ahmad/ Gharib, Muhammad: Die Stellung der Frau im Judentum, Christentum<br />
und Islam. Kairo 2001<br />
Abu-Lughod, Lila: Remaking women. Feminism and modernity in the Middle East. Princeton<br />
1998<br />
Ahmed, Leila: Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate. Yale 1993<br />
Akashe-Böhme, Farideh: Sexualität und Körperpraxis im Islam. Frankfurt am Main 2006<br />
Ali, Shaheen Sardar: Gender and Human Rights in Islam and International Law. Boston 2000<br />
Anwar, Etin: Gender and Self in Islam. London - New York 2006<br />
Ashrof, Mohamad A.: Islam and Gender Justice. Questions at the Interface. New Delhi 2005<br />
Ask, Karin/ Tjomsland, Marit: Women and Islamization. Contemporary dimensions of discourse<br />
on gender relations. Oxford - New York 1998<br />
Awde, Nicholas: Women in Islam. An Anthology from the Quran and Hadiths. New York 2000<br />
Badran, Margot: Feminists, Islam, and Nation. Gender and the Making of Modern Egypt.<br />
Princeton 1996<br />
Barlas, Asma: Believing Women' in Islam. Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an.<br />
Texas, Austin 2002<br />
Bayes, Jane H./ Nayereh Esfahlani Tohidi: Globalization, Gender, and Religion: The Politics of<br />
Women's Rights in Catholic and Muslim Contexts. New York 2001<br />
Beinhauer-Köhler, Bärbel: Fatima bint Muhammad. Metamorphosen einer frühislamischen<br />
Frauengestalt. Wiesbaden 2002<br />
Cortese, Delia: Women and the Fatimids in the world of Islam. Edinburgh 2006<br />
46
Ghoussoub, Mai/ Sinclair-Webb, Emma: Imagined Masculinities. Male Identity and Culture in<br />
the Modern Middle East. New York 2001<br />
Gruijter de, Marjan: Fatima is the Woman Islam Wants a Woman to Be. Amsterdam 1997<br />
Hayes, Jarrod: Queer Nations. Marginal Sexualities in the Maghreb. Cambridge 2001<br />
Körner, Felix: Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology.<br />
Rethinking Islam. Würzburg 2005<br />
Mahmood, Saba: Politics of piety. The Islamic revival and the feminist subject. Princeton 2005<br />
Mernissi, Fatima: Geschlecht, Ideologie, Islam. München 1989<br />
Dies.: Die Sultanin. Die Macht der Frauen in der Welt des Islam. Hamburg 1993<br />
Dies.: Islam und Demokratie. Die Angst vor der Moderne. Hamburg 2002<br />
Mernissi; Fatima/ Kabis-Alamba, Veronika: Der politische Harem. Mohammed und die Frauen.<br />
Freiburg 1992<br />
Mir-Hosseini, Ziba: Islam and Gender. The Religious Debate in Contemporary Iran. Princeton<br />
1999<br />
Murray, Stephen O./ Roscoe, Will: Islamic Homosexualities. Culture, History, and Literature.<br />
New York 1997<br />
Okkenhaug, Inger Marie/ Flaskerud, Ingvild: Gender, Religion and Change in the Middle East.<br />
Two Hundred Years of History. Cross-Cultural Perspectives on Women. Oxford - New York<br />
2005<br />
Saeed, Abdullah: Interpreting The Qur'an. Towards A Contemporary Approach. New York 2006<br />
Schöter, Hiltrud: Das Gesetz Allahs. Menschenrechte, Geschlecht, Islam und Christentum.<br />
Königstein 2007<br />
Selim, Nahed: Nehmt den Männern den Koran! Für eine weibliche Interpretation des Islam.<br />
München 2006<br />
Tajbakhsh, M. H.: Muhammad, Ali, Fatima, Hassan and Hussein. The Family of the Prophet of<br />
Islam. Royston 1991<br />
Torab, Azam: Performing Islam. Gender and Ritual in Iran.Women and Gender. The Middle<br />
East and the Islamic World. Boston 2007<br />
Turner, Bryan: Islam, gender and the family. London 2003<br />
Waldud, Amina: Qur'an and Woman. Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.<br />
New York 1999<br />
Dies.: Inside The Gender Jihad. Women's Reform in Islam. Oxford 2006<br />
Woods, Patricia J.: Women and Feminism in Islam and Judaism. Florida 1991<br />
Yazbeck Haddad, Yvonne/ Esposito, John L.: Islam, Gender, and Social Change. New York<br />
1998<br />
47
Gender und Hinduismus<br />
Amaladass, Anand (Hrsg.): Abhirāmi Antāti. Die weibliche Dimension der Gottheit. Eine<br />
indische Perspektive. Salzburg 2004<br />
Bazaz Wangu, Madhu: Images of Indian Goddesses. New Delhi 2003<br />
Copley, Antony: Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday.<br />
New Delhi 2003<br />
Das Wilhelm, Amara: Tritiya-prakriti. Understanding Homosexuality, transgender Identity, and<br />
.… Philadelphia 2004<br />
Deheji, Vidya/ Coburn, Thomas: Devi. The Great Goddess. Female Divinity in South Asian Art.<br />
Washington 1999<br />
Fels, Eva: Auf der Suche nach dem dritten Geschlecht - Bericht über eine Reise nach Indien und<br />
über die Grenzen der Geschlechter. Wien 2005<br />
Fell McDermott, Rachel/ Kripal, Jeffrey John: Encountering Kali in the Margins, at the Center,<br />
in the West. Berkeley 2003<br />
Foulston, Lynn: At the Feet of the Goddess. The Divine Feminine in Local Hindu Religion.<br />
Brighton 2002<br />
Goldberg, Ellen: The Lord Who Is Half Woman. Ardhanarisvara in Indian and Feminist<br />
Perspective. New York 2002<br />
Guzy, Lidia u.a. (Hrsg.): Traditionen im Wandel. Weibliche Religiosität im Hinduismus, Jainismus<br />
und <strong>Buddhismus</strong>. Tübingen 2000<br />
Harlan, Lindsey/ Courtright, Paul B.: From the Margins of Hindu Marriage. Essays on Gender,<br />
Religion, and Culture. New York 1995<br />
Heller, Birgit: Heilige Mutter und Gottesbraut. Frauenemanzipation im modernen Hinduismus.<br />
Wien 1999<br />
Hirst, Jacqueline Suthren/ Thomas, Lynn (Hrsg.): Playing for Real. Hindu Role Models, Religion,<br />
and Gender. Oxford 2004<br />
Jansen, Eva Rudy: Die Bildersprache des Hinduismus. Göttinnen und Götter,<br />
Erscheinungsformen .... Südergellersen 1993<br />
Khandelwal, Meena: Women in Ochre Robes. Gendering Hindu Renunciation. New York 2003<br />
Kinsley, David: Die indischen Göttinnen. Weibliche Gottheiten im Hinduismus. Frankfurt am<br />
Main 2000<br />
Leslie, Julia: Roles and Rituals for Hindu Women. London 1992<br />
Nanda, Serena: Weder Mann noch Frau. Die Hijras in Indien. In: Völger, Gisela (Hrsg.): Sie und<br />
Er: Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich, Bd. 2. Rautenstrauch-Joest-Museum.<br />
Köln 1997.<br />
Dies.: Neither Man nor Woman. The Hijras of India. Belmont 1991<br />
48
O'Flaherty, Wendy Doniger: Women, Androgynes, and Other Mythical Beasts. Chicago 1980<br />
Dies.: Splitting the Difference. Gender and Myth in Ancient Greece and India. Oxford 1999<br />
Olson, Carl: Book of the Goddess Past and Present. An Introduction to Her Religion. Illinois<br />
2002<br />
Pintchman, Tracy: Seeking Mahadevi. Constructing the Indentities of the Hindu Great Goddess.<br />
New York 2001<br />
Schumann, Hans W.: Die großen Götter Indiens. Grundzüge von Hinduismus und <strong>Buddhismus</strong>.<br />
München 2004<br />
Sharma, Arvind: Goddesses and Women in the Indic Religious Tradition. Boston 2005<br />
Tanaka, Masakazu/ Tachikawa, Musashi u. a (Hrsg.): Living with Śakti. Gender, Sexuality, and<br />
Religion in South Asia. Senri Ethnological Studies No.50. The National Museum of Ethnology,<br />
Osaka 1999<br />
Teskey Denton, Lynn: Female Ascetics in Hinduism. State University of New York 2004<br />
Vanita, Ruth/ Kidwai, Saleem: Same-Sex Love in India. Readings from Literature and History.<br />
New York 2001<br />
Gender und <strong>Buddhismus</strong><br />
Allione, Tsultrim: Tibets weise Frauen. Berlin 2000<br />
Banks Findly, Ellison: Women's Buddhism, Buddhism's Women: Tradition, Revision, Renewal.<br />
Somerville 2000<br />
Cabezón, José Ignacio: Buddhism, Sexuality, and Gender. New York 1992<br />
Campbell, June: Traveller in Space: Gender, Identity, and Tibetan Buddhism. London - New<br />
York 2002<br />
Dies.: Göttinnen, Dakinis und ganz normale Frauen. Weibliche Identität im tibetischen Tantra.<br />
Berlin 1997<br />
Dresser, Marianne: Buddhist Women on the Edge. Contemporary Perspectives from the Western<br />
Frontier. Berkeley 1996<br />
Faure, Bernhard: The Red Thread. Buddhist Approaches to Sexuality. Princeton 1998<br />
Ders.: The Power of Denial. Buddhism, Purity, and Gender. Princeton 2003<br />
Gross, Rita M.: Buddism after Patriarchy. A Feminist History, Analysis, and Reconstruction. New<br />
York - Albany 1993<br />
Gyatso, Janet/ Havnevik, Hanna: Women in Tibet. Columbia 2005<br />
Heidegger, Simone: <strong>Buddhismus</strong>, Geschlechterverhältnis und Diskriminierung : die gegenwärtige<br />
Diskussion im Shin-<strong>Buddhismus</strong> Japans. Münster 2006<br />
Dies.: Religiöse Gegenwart Asiens. Berlin - Münster 2006<br />
49
Herrmann-Pfandt, Adelheid: Dākinīs. Zur Stellung und Symbolik des Weiblichen im tantrischen<br />
<strong>Buddhismus</strong>. Bonn 1992<br />
Karnotzki, Ilse: Das Frauenbild zur Zeit des Buddha. Stammbach 2005<br />
Khema, Ayya: Buddha ohne Geheimnis. Die Lehre für den Alltag. Stuttgart 1996<br />
Leyland, Winston (Hrsg.): Queer Dharma. Voices of Gay Buddhists. San Francisco 2000<br />
Mananzan, Mary J.: Religionen und Frauen in Asien. Wege zu einer lebensfördernden<br />
Spiritualität. Frankfurt am Main 2004<br />
Mohr, Thea: Weibliche Identität und Leerheit. Eine ideengeschichtliche Rekonstruktion der<br />
Buddhistischen Frauenbewegung. Theion Jahrbuch für Religionskultur, Bd XIII. Frankfurt am<br />
Main 2001<br />
Paul, Diana Y.: Die Frau im <strong>Buddhismus</strong>. Hamburg 1981<br />
Poggendorf-Kakar, Katharina/ Guzy, Lidia/ Zinser, Hartmut: Tradition im Wandel. Weibliche<br />
Religiosität im Hinduismus, Jainismus und <strong>Buddhismus</strong>. Tübingen 2000<br />
Shaw, Miranda: Der Tanz der Dakinis. Frankfurt am Main 2000<br />
Simmer-Brown, Judith: Dakini's Warm Breath. The Feminine Principle in Tibetan Buddhism.<br />
Boston 2001<br />
Ueki, Masatoshi: Gender Equality in Buddhism. New York 2001<br />
Berlin, im Dezember 2007<br />
Konzeption, Texte und Literatur: Dagmar Noeldge<br />
Layout: Elke Mros<br />
Ergänzung:<br />
Homosexualität und Transidentitäten<br />
in den Religionen der Welt<br />
1. Geschlechterordnung und Sexualität in den Religionen<br />
Ähnlich wie Gesellschaften ordnen auch Religionen ihre Gemeinschaft über<br />
Geschlechtszugehörigkeit oder Geschlechtszuschreibungen. Die Frage, wer Zugang zu religiösen<br />
Ämtern und heiligen Orten erhält und wem die Teilhabe an religiösen Ritualen erlaubt ist, ist<br />
meistens gebunden an die Frage von Geschlecht. In den verschiedenen Religionen der Welt<br />
lassen sich eine starke Geschlechtertrennung und geschlechtsspezifische Pflichten und Rollen in<br />
den wichtigen Bereichen religiösen Lebens beobachten. Dabei sind Männer und Frauen keine<br />
gleichen und meist keine gleichberechtigten Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft. In welcher<br />
Weise sich ein Geschlechterverhältnis konkret im religiösen Leben niederschlägt unterscheidet<br />
50
sich dabei nicht nur von Religion zu Religion, sondern auch innerhalb der verschiedenen<br />
Strömungen oder im Zuge der geschichtlichen Entwicklungen einer Religion.<br />
Die Ehe stellt für alle Religionen den richtigen und angemessenen Rahmen des Zusammenlebens<br />
von Frauen und Männern dar. Wichtig ist hierbei, dass die Ehe als ‚Mittel’ zur Regulierung und<br />
Kontrolle von Sexualität angesehen wird. Sexualität dient in Religionen, bis auf wenige<br />
Sonderströmungen wie dem indischen Tantrismus, der Fortpflanzung. Damit ist Sexualität in den<br />
Religionen meist heterosexuell ausgerichtet und sexuelle Handlungen, die keinen reproduktiven<br />
‚Zweck’ erfüllen, sind häufig verboten. Diese skizzierten religiösen Positionen zu ‚Geschlecht’<br />
und ‚Sexualität’ leiten sich aus den Interpretationen der maßgebenden Schriften der Religionen<br />
her, die sich bis heute in vielen Bereichen gelebter Religion wirkmächtig zeigen. Dennoch finden<br />
sich in Religionen, vor allem bei den Menschen, die sie leben und gestalten, immer auch<br />
Ausnahmen von diesen Regeln.<br />
2. Homosexualität<br />
Dieses religiöse Verständnis von Sexualität zeigt, dass sich die Verbote von sexuellen Handlungen<br />
vor allem darüber begründen, dass sie nicht den Zweck der Fortpflanzung erfüllen.<br />
Verboten sind damit bestimmte Handlungen, wie z.B. Oralverkehr oder Masturbation, gleich ob<br />
sie zwischen Mann und Frau oder zwischen Menschen gleichen Geschlechts stattfinden. In den<br />
normativen Schriften der Religionen finden sich aber auch ausdrückliche Verbote von Sexualität<br />
zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Diese beziehen sich insbesondere bei den<br />
monotheistischen Religionen vor allem auf männliche Homosexualität. Besonders bekannt sind<br />
die Deutungen entsprechender Stellen in der hebräischen Bibel, z.B. im Buch Leviticus, oder im<br />
Neuen Testament, z.B. im Römerbrief. Auch in Auslegungen des Koran und in der islamischen<br />
Rechtslehre, Scharia, finden sich Verbote sexueller Handlungen zwischen Männern. Weibliche<br />
Homosexualität wird seltener angesprochen und meist milder bestraft. Eine Ausnahme ist die<br />
härtere Bestrafung sexueller Handlungen unter Frauen im Hinduismus.<br />
Die Regeln der religiösen Schriften lassen sich jedoch nicht gleichsetzen mit dem, wie Menschen<br />
ihre Religion leben und lebten. Ihre Geschichte und ihre Alltagswelt sehen oft anders aus, als es<br />
die vielen religiösen Vorschriften vorsehen, und das gilt auch für ihr Sexualleben. Dass sich<br />
Menschen ausdrücklich sowohl zu ihrer Religion wie auch zu ihrer Homosexualität bekennen<br />
und diese beiden wichtigen Bereiche ihres Lebens miteinander verbinden, ist jedoch eine<br />
Entwicklung der jüngsten Zeit. Sie hängt mit gesellschaftspolitischen Veränderungen der letzten<br />
40 Jahre zusammen. Denn die Proteste der Frauen- und vor allem der Homosexuellenbewegungen<br />
haben auch innerhalb von Religionen einige Diskussionen in Gang gesetzt und ein<br />
neues Selbstbewusstsein von Schwulen und Lesben in den Religionen begründet. Dies gilt<br />
übrigens nicht nur für ‚westliche’ Länder. Auch z.B. im heutigen Iran, Südafrika oder in Indien<br />
gibt es Gruppen die sich für ihre Anerkennung als religiöse Schwule und Lesben engagieren. Ein<br />
wichtiges Thema ist dabei die Schaffung von Räumen der Anerkennung. ‚Räume’ meint hier<br />
verschiedenes: a) die Einrichtung konkreter Orte, an welchen man sich sicher und in positiver<br />
Atmosphäre religiös begegnen kann; b) die Frage der religiösen Vergemeinschaftung: gibt es eine<br />
Möglichkeit innerhalb der ‚Mehrheitsgemeinde’ einen solchen sicheren Ort einzurichten? Oder<br />
51
gründet man eine ‚eigene’, abgegrenzte Gemeinschaft? c) religiöse Lehren, welche so formuliert<br />
und gedeutet werden, dass Schwule und Lesben sich wieder finden können.<br />
Weiterhin beinhalten viele Initiationsriten verschiedener Kulturen der Welt ‚homosexuelle’<br />
Handlungen. Diese finden jedoch in einem strengen rituellen Rahmen statt und sind von<br />
symbolischer Bedeutung. Sie sind daher nicht vergleichbar mit sexuellen Handlungen oder gar<br />
einer Liebesbeziehungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts.<br />
3. Transidentitäten<br />
‚Transidentität’ meint eine Geschlechtsidentität, die sich nicht als ‚männlich’ oder ‚weiblich’<br />
versteht oder verstehen lässt und bezieht sich auf Menschen, die sich weder als Mann oder Frau<br />
fühlen. Dies kann sich auf den Körper beziehen (Transsexualität) aber auch auf<br />
geschlechtsspezifische Verhaltensweisen, Rollen oder auch Kleidung (Transgender).<br />
Häufig werden Schamanen, von welchen man richtigerweise nur mit Bezug auf den Raum<br />
Sibiriens sprechen kann, als ‚Geschlechtergrenzen überschreitend’ charakterisiert. Ähnlich wie bei<br />
bestimmten HeilerInnen und PriesterInnen einiger afrikanischer Kulturen und einigen indischen<br />
Traditionen findet dieser Wandel der geschlechtlichen „Rolle“ jedoch nur im zeitlich begrenzten<br />
Rahmen von Ritualen oder z.B. Ekstasezuständen statt. Als Beispiele für das so genannte ‚dritte<br />
Geschlecht’ lassen sich vielmehr die Hijras des indisch-pakistanischen Raums oder die ‚Zwei-<br />
Seelen-Leute’ (Two-Spirit-People) vieler nordamerikanischer Indianerkulturen benennen. Hijras<br />
sind „Männer“, welche „weibliche“ Verhaltensweisen, Rollen und den Status einer Frau<br />
annehmen, z.T. auch über Kastration. Oft wollen sie weder als ‚Frau’ noch als ‚Mann’, sondern<br />
als eigene Gruppe wahrgenommen und akzeptiert werden. Aufgrund ihrer sozial sehr schlechten<br />
Stellung leben sie in engen Gemeinschaften zusammen; sie leben von Bettelei und Prostitution.<br />
Sie sind hinduistischen oder muslimischen Glaubens und bis zu einem gewissen Grad pflegen sie<br />
eine eigene Religiosität und verehren z.B. bestimmte Gottheiten, die sich ihrer speziellen<br />
Situation annehmen sollen. Auch erfüllen sie in der breiteren Gemeinschaft besondere rituelle<br />
Aufgaben, z.B. das Segnen Neugeborener. Die ‚Zwei-Seelen-Leute’ konnten Frauen oder Männer<br />
sein, die entweder bestimmte Aufgaben oder die Kleidung des anderen Geschlechts annahmen<br />
oder ihren geschlechtlichen Status gänzlich wechselten und damit die soziale Identität des<br />
anderen Geschlechts annahmen. Zum Teil übernahmen auch sie besondere rituelle Aufgaben,<br />
wie z.B. das Heilen. Auch kam es vor, dass dieser ‚Geschlechtswechsel’ wieder rückgängig<br />
gemacht wurde. Ihnen war es möglich mit Menschen des gleichen oder des anderen Geschlechts<br />
zusammen zu leben. Viele afrikanische Kulturen kennen eine ähnliche Geschlechterwandelbarkeit<br />
und, in diesem Rahmen, die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Diese<br />
Geschlechterordnungen wandelten sich dramatisch durch die europäisch-christliche und, in<br />
Afrika, islamische Expansion und Missionierung.<br />
Heutzutage werden unter den Begriffen ‚Transgender’, ‚Transsexuell’, ‚Intersexuell’ oder auch<br />
‚queer’ verschiedene Geschlechter gefasst, die von der ‚Normalität’ der zwei Geschlechter ‚Mann’<br />
und ‚Frau’ abweichen (wollen). Ihr Engagement für gesellschaftliche und rechtliche Anerkennung<br />
findet in vielen Ländern, Kulturen und Religionen statt. Dabei vertreten sie viele unterschiedliche<br />
(Selbst-)Verständnisse und verfolgen unterschiedliche Ziele. Darin, dass zunächst einmal die<br />
52
Realität von mehr als zwei Geschlechtern überhaupt wahrgenommen und akzeptiert werden<br />
muss, sind sie sich jedoch einig.<br />
Ausgewählte Internetseiten schwuler/lesbischer/queerer Gruppen in Deutschland:<br />
Jüdisch:<br />
http://www.yachad-deutschland.de/<br />
Christlich:<br />
http://www.lsgg.org/<br />
Muslimisch:<br />
http://www.queermuslimehamburg.de/1.html<br />
Buddhistisch:<br />
http://www.kandayata.net/kandayataseiten/buddha/index.html<br />
http://www.gaysangha.de/<br />
Ausgewählte Literatur<br />
Fels, Eva: Auf der Suche nach dem dritten Geschlecht. Wien 2005.<br />
Karle, Isolde: Da ist nicht Mann noch Frau…’ .Theologie jenseits der Geschlechterdifferenz.<br />
Gütersloh 2006.<br />
Parrinder, Geoffrey: Sexualität in den Religionen der Welt. Düsseldorf 2004.<br />
Berlin, 15. Januar 2008<br />
Márcia Moser M.A.<br />
53