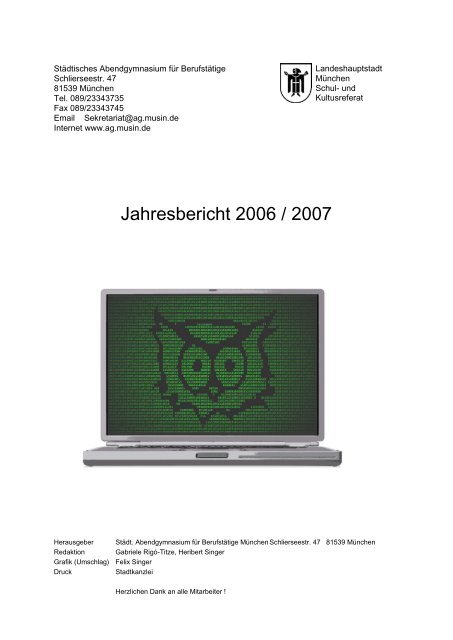Jahresbericht 2006 / 2007 - Städtisches Abendgymnasium für ...
Jahresbericht 2006 / 2007 - Städtisches Abendgymnasium für ...
Jahresbericht 2006 / 2007 - Städtisches Abendgymnasium für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Städtisches</strong> <strong>Abendgymnasium</strong> <strong>für</strong> Berufstätige<br />
Schlierseestr. 47<br />
81539 München<br />
Tel. 089/23343735<br />
Fax 089/23343745<br />
Email Sekretariat@ag.musin.de<br />
Internet www.ag.musin.de<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> / <strong>2007</strong><br />
Landeshauptstadt<br />
München<br />
Schul- und<br />
Kultusreferat<br />
Herausgeber Städt. <strong>Abendgymnasium</strong> <strong>für</strong> Berufstätige München Schlierseestr. 47 81539 München<br />
Redaktion Gabriele Rigó-Titze, Heribert Singer<br />
Grafik (Umschlag) Felix Singer<br />
Druck Stadtkanzlei<br />
Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter !
1 Inhaltsverzeichnis<br />
1 Inhaltsverzeichnis ….................................................................................... 3<br />
2 Grußwort zum Schuljahresschluss …………………………………………… 5<br />
3 Thema Computer ……………………………………………..………………… 6<br />
3.1 Studierende ................................................................................................. 6<br />
3.1.1 Unsere Studierenden zum Thema Computer ……………........................... 6<br />
3.1.2 Presse im Wandel ……………..........…....................................................... 9<br />
3.1.3 Das Ende der Zeitung? …..………………………......................................... 11<br />
3.1.4 The Start of a Wonderful Morning at Work ….............................................. 12<br />
3.1.5 Wo wären wir ohne Internet, E-Mails & Co? …………................................. 13<br />
3.2 Lehrkräfte ……………….............................................................................. 15<br />
3.2.1 Lehrkräfte und Computer ……………………………..………..……………… 15<br />
3.2.2 Computereinsatz im Physikunterricht ………………………………………… 18<br />
3.2.3 PC and Me ………………………………………………………………………. 20<br />
4 Unterrichtsgeschehen ................................................................................. 21<br />
Der Wert des <strong>Abendgymnasium</strong>s ……………………………...……………... 21<br />
4.1 Aus den 1. Klassen ..................................................................................... 22<br />
4.1.1 Nach zwei Monaten ………………………………..…………......................... 22<br />
4.1.2 Schnupperstunde in szenischem Lernen ……............................................. 25<br />
4.1.3 Bewegtes Lernen ….................................................................................... 26<br />
4.1.4 Deutsch …………………………………........................................................ 27<br />
4.1.4.1 Erwachsen zum Abitur? ………................................................................... 27<br />
4.1.4.2 Deutschunterricht – lustvoll, lehrreich, kreativ ………………....................... 30<br />
4.1.4.3 1. Klassen und Theater …………..……....................................................... 31<br />
4.1.5 Englisch ………............................................................................................ 32<br />
4.1.5.1 1. Schulaufgabe Englisch: Free Text Production ….................................... 32<br />
4.1.5.2 Advertising the AG ……………..…………………………………………...….. 33<br />
4.1.5.3 Agony Aunt ……………………………………………………………………… 36<br />
4.1.5.4 "The Picture of Dorian Gray" ………………………………………………….. 39<br />
4.1.5.5 Cars …………………………………………………………………………...…. 40<br />
4.1.6 Latein …………………………………………………………………………….. 41<br />
Römische Politik …………………………………………………………….…..<br />
4.1.7 Französisch ……………………………………………………………………... 42<br />
4.1.7.1 Une vidéo sur notre école ………..…………………………………………..... 42<br />
4.1.7.2 J'attends les vacances …………………………………………………….…… 43<br />
4.2 Aus den 2. Klassen ..................................................................................... 45<br />
4.2.1 Deutsch ....................................................................................................... 45<br />
„Werter als Bestseller“ ................................................................................<br />
4.2.2 Englisch …………………............................................................................. 47<br />
Fast Food or Slow Food? …..…………………………………………………..<br />
4.2.3 Latein …………………………………………………………………………….. 50<br />
Ausstellung Herculaneum ………………………………………………….…..<br />
4.2.4 Ethik ……………………………………………………………………………… 54<br />
Ethik – was ist das? …………………………………………………………….<br />
3
4.2.5 Biologie ………………………………………………………………………….. 56<br />
Besuch des <strong>Abendgymnasium</strong>s im Botanischen Garten<br />
4.3 Aus der Kollegstufe ..................................................................................... 57<br />
4.3.1 Deutsch ....................................................................................................... 57<br />
4.3.1.1 Abituraufsätze <strong>2006</strong> ……………………………………………………………. 57<br />
4.3.1.2 Realistischer Russe: Der Revisor …………..……........................................ 64<br />
4.3.1.3 Gerhart Hauptmann: „Bahnwärter Thiel“ ……….......................................... 66<br />
4.3.1.4 Unterrichtsgang zum Königsplatz und in die Glyptothek ……………..…..... 68<br />
4.3.1.5 Der goldene Fisch ……………………………………………………………… 70<br />
4.3.2 Englisch ...................................................................................................... 70<br />
4.3.2.1 „Dead or Alive“ ……..................................................................................... 70<br />
4.3.2.2 Measure for Measure …………………………………………………..………. 73<br />
4.3.2.3 Dialogue about the <strong>Abendgymnasium</strong> ……………………………………..… 77<br />
4.3.2.4 Recommended Reading ………………………………………………….……. 80<br />
4.3.3 Französisch ……………………………......................................................... 85<br />
Grundkurs Französisch kreativ …………….………………………………….<br />
4.3.4 Physik ………………………………………………………………...………….. 86<br />
Physik Grundkurs - multimedial ……………………………...........................<br />
4.3.5 Biologie ....................................................................................................... 87<br />
Exkursion zum Wendelstein am 14.10.06 …………….…………………......<br />
4.3.6 Englische Konversation ……………………………………………………… 88<br />
4.3.6.1 The Time Capsule ……………………………………………………………… 88<br />
4.3.6.2 New ideas ……………………………………………………………………….. 89<br />
4.4 Anderer Unterricht ....................................................................................... 95<br />
4.4.1 Wahlkurs Theater ........................................................................................ 95<br />
Neues vom Wahlunterricht „Theater“ …......................................................<br />
4.4.2 Wahlkurs Spanisch …………....................................................................... 96<br />
Eso es! Das stimmt! ………………………………………………………….....<br />
4.4.3 Wahlkurs Italienisch ……………………………………………………………. 98<br />
Perché …………………………………………………………………...……….<br />
4.4.4 Wahlkurs „kreativ schreiben“ ...................................................................... 100<br />
Einige Kostbarkeiten aus dem Wahlkurs „kreativ schreiben“ ………………<br />
4.5 Verzeichnis der Unterrichtsgänge Juni <strong>2006</strong> bis Mai <strong>2007</strong> .......................... 104<br />
5 Besondere Veranstaltungen ....................................................................... 105<br />
Wege zum Musiktheater …………………………………………………….....<br />
6 Schulbetrieb ................................................................................................ 106<br />
6.1 Das neue 8-jährige Gymnasium und der zweite Bildungsweg .................... 106<br />
6.2 AG im Internet ............................................................................................. 108<br />
6.3 Das AG in den Medien ................................................................................ 109<br />
6.4 Der „neue“ erste Schultag am <strong>Abendgymnasium</strong> …………………...……… 110<br />
7 Personalia und Verschiedenes ................................................................... 111<br />
7.1 Unsere neuen Lehrkräfte ............................................................................ 111<br />
7.2 Interview mit Herrn Walter Pfenning, dem neuen Lehrer <strong>für</strong> Latein und<br />
Französisch am AG ………………………………………..............................<br />
112<br />
7.3 Steckbrief Pohl ……………………………………………………………..…… 114<br />
7.4 Beruf „Lehrer“ unerwünscht ……………………………………………...……. 115<br />
7.5 Arbeiten im Ausland ……………………………………………………….…… 118<br />
7.6 Abendgymnasien im Ländle …………………………………………………… 124<br />
7.7 Freundeskreis des Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s e.V. ……………..…… 126<br />
4
2 Grußwort zum Schuljahresschluss<br />
Erneut neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu und das Städt. <strong>Abendgymnasium</strong> <strong>für</strong> Berufstätige<br />
ist auch dieses Jahr wieder in der Lage, den gegenwärtigen und ehemaligen Schülerinnen<br />
und Schülern, den Freunden und Fördern unserer Schule und den vorgesetzten Schulbehörden<br />
einen recht umfangreichen und detaillierten <strong>Jahresbericht</strong> vorzulegen, der einen<br />
Einblick in die Arbeit des zurückliegenden Jahres vermittelt.<br />
Seit Jahren ist es diesmal nicht der Fall, dass wir mit dem Schuljahresende ein Mitglied aus<br />
unserem Kollegium in den Ruhestand oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschieden,<br />
alle bleiben der Schule auch im kommenden Jahr erhalten. Mit Beginn des Schuljahres<br />
kamen drei neue Mitglieder in unser Lehrerkollegium, die an anderer Stelle des <strong>Jahresbericht</strong>s<br />
vorgestellt werden, so konnten wir unser bisheriges Bildungsangebot weiterhin<br />
aufrecht erhalten. In Zeiten wachsenden Lehrermangels ist dies nicht mehr selbstverständlich.<br />
Im diesjährigen <strong>Jahresbericht</strong> findet sich kein Beitrag zum pädagogischen Tag im laufenden<br />
Schuljahr, nicht weil er diesmal vielleicht ausgefallen ist, sondern er findet erst nach Redaktionsschluss<br />
am Ende des Schuljahres im Juli statt, so dass erst im kommenden Jahr darüber<br />
berichtet werden kann. Mit der israelitischen Kultusgemeinde hat die Schule einen ganztägigen<br />
pädagogischen Tag im neuen jüdischen Zentrum am Jakobsplatz in München vereinbart.<br />
Für die kommenden Herbstferien hat die Schule<br />
dann bereits die nächste pädagogische<br />
Fortbildung <strong>für</strong> das Lehrerkollegium vorbereitet,<br />
diesmal zum Abschluss der deutschen EU-<br />
Ratspräsidentschaft in Brüssel bei den EU-<br />
Einrichtungen, beim NATO-Hauptquartier und<br />
bei der bayerischen Vertretung in Brüssel,<br />
dazu wird ebenfalls im nächsten <strong>Jahresbericht</strong><br />
Genaueres zu lesen sein.<br />
An dieser Stelle möchte ich wie gewohnt allen<br />
Autoren danken, ganz besonders aber Frau<br />
Rigó-Titze und Herrn Singer <strong>für</strong> die bewährte<br />
aufwendige redaktionelle Arbeit bis zur Drucklegung.<br />
Die Stadtkanzlei hat sich auch in diesem<br />
Jahr wieder bereit erklärt, die Broschüre<br />
ohne interne Kostenverrechnung zu drucken,<br />
da<strong>für</strong> ebenfalls recht herzlichen Dank.<br />
Abschließend gilt auch den verschiedenen<br />
Dienststellen der Stadtverwaltung, vor allem<br />
der Abteilung Gymnasien im Schulreferat sowie<br />
allen Mitgliedern der Dienststelle unserer<br />
neuen Ministerialbeauftragten <strong>für</strong> die Gymna-<br />
sien in Oberbayern-West, unser Dank <strong>für</strong> die<br />
stets kompetente und kollegiale Zusammenarbeit<br />
bei der Bewältigung des Bildungsauftrages<br />
unserer Schule.<br />
Siegfried S c h a l k<br />
Schulleiter S. Schalk Foto: M. Meyer<br />
„Bester <strong>Jahresbericht</strong>-Verkäufer“<br />
5
3 Thema Computer<br />
Das Thema dieses <strong>Jahresbericht</strong>s mag vielleicht den einen überraschen, dem anderen abgedroschen<br />
erscheinen. Zum einen sehen wir uns auch in den Räumen des Anton-Fingerle-<br />
Bildungszentrums dank der Großzügigkeit der Landeshauptstadt München in fast allen<br />
Räumen von neuen Rechnern umgeben, auch wenn wir diese erst in begrenztem Umfang<br />
zum Einsatz bringen können. Andererseits gab es die zwei ausgezeichneten Abituraufsätze<br />
des letzten Schuljahres, in denen sich die Verfasser sehr kritisch bis ablehnend mit dem<br />
Computerboom auseinandersetzten (vgl. 4.3.1.1).<br />
Damit lag eigentlich die Frage auf der Hand, welche Rolle die Computertechnologie <strong>für</strong> Studierende<br />
und Lehrerschaft des Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s spielt. Natürlich haben Erwachsene,<br />
die fast durchwegs am Arbeitsplatz mit dem PC umgehen müssen, eine andere<br />
Einstellung dazu als Schülerinnen und Schüler am "normalen" Gymnasium. Ergeben hat<br />
sich auf diese Weise, wie die folgenden Artikel zeigen, eine sehr differenzierte und abwechslungsreiche<br />
Sicht auf eine Technologie, die auch aus unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken<br />
ist.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
3.1 Studierende<br />
3.1.1 Unsere Studierenden zum Thema Computer<br />
Im März <strong>2007</strong> bat ich einige Studierende um ihre Meinung zum Thema Schule und Computer.<br />
Hierzu hatte ich einen kleinen Fragekatalog vorbereitet, den 28 Schülerinnen und Schüler<br />
aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen ausfüllten. An dieser Stelle herzlichen Dank da<strong>für</strong>!<br />
Auch wenn eine solche Umfrage natürlich nicht den Anspruch erheben kann, repräsentativ<br />
zu sein, waren einige der Antworten doch recht aufschlussreich. Die ersten Fragen bezogen<br />
sich auf den Stellenwert des Computers am Arbeitsplatz und im Privatleben.<br />
Müssen Sie an Ihrem Arbeitsplatz einen Computer benutzen (nie, selten, manchmal, immer)?<br />
3 Studierende gaben an, nie mit dem PC zu arbeiten, weitere 3 tun dies manchmal, während<br />
die überwältigende Mehrheit, nämlich 22, in der Arbeit immer den Computer verwendet.<br />
Spielt der Computer in Ihrer Freizeitgestaltung eine Rolle? Falls ja: welche? Falls nein: warum<br />
nicht?<br />
6 Studierende benutzen in der Freizeit nie den Computer, 2 davon haben auch am Arbeitsplatz<br />
nichts damit zu tun. Das bedeutet also, dass es auch unter unseren Studierenden<br />
Menschen gibt, die über keinerlei Erfahrung mit dem PC verfügen. 4 Personen gaben keine<br />
Gründe an, warum sie im privaten Bereich den Computer meiden. Ein Befragter schrieb,<br />
dass er keinen Internetanschluss habe, deshalb nicht surfen könne und Computerspiele<br />
6
hasse, ein anderer meinte: "Der PC am Arbeitsplatz ist wichtiger als in der Freizeit, und Berufliches<br />
und Privates sollte man trennen (können)."<br />
Recherche, Information, E-Mail, Planung (z.B. von Reisen), Einkaufen, Reservierung (z.B.<br />
von Eintrittskarten), Bildbearbeitung, Archivierung von Fotos, Computerspiele – das sind die<br />
Dinge, mit denen sich unsere Studierenden befassen, wenn sie in ihrer Freizeit den PC<br />
hochfahren. Die meisten Begriffe wurden hierbei mehrfach genannt. Auffallend war, dass 3<br />
Schüler online Zeitung lesen. Von den insgesamt 22 Freizeit-Usern des Computers gaben 7<br />
noch zusätzlich an, dass sie den PC auch als Medium nutzen, um an zusätzliches Material<br />
oder Informationen <strong>für</strong> die Schule zu kommen.<br />
Wird in Ihren Unterrichtsstunden am <strong>Abendgymnasium</strong> gelegentlich der Computer eingesetzt?<br />
Falls ja: in welchen Fächern?<br />
24 Studierende verneinten die Frage, ob bei ihnen im Unterricht der Computer zum Einsatz<br />
komme, 4 gaben an, dass er bei ihnen zumindest gelegentlich genutzt wird. Dreimal wurde<br />
hierbei das Fach Physik und einmal das Fach Deutsch genannt.<br />
Fänden Sie es gut, wenn am <strong>Abendgymnasium</strong> häufiger am PC gearbeitet würde? Begründen<br />
Sie Ihre Antwort!<br />
Zwei Studierende konnten sich<br />
hier nicht entscheiden. Zum einen<br />
konnte man sich nicht vorstellen,<br />
in welchem Bereich diese Computer<br />
zum Einsatz kommen könnten,<br />
in der zweiten Antwort wurden<br />
einerseits konkrete Anwendungsmöglichkeiten<br />
genannt (neuere<br />
Zahlen und auch Bilder in Geographie;<br />
Chats mit Experten über<br />
ein bestimmtes Thema), andererseits<br />
wurde festgestellt, dass nicht<br />
genügend PCs zur Verfügung<br />
stehen.<br />
Von den 11 Studierenden, die sich<br />
den Einsatz von Computern im Unser Computerraum Foto: G. Rigó-Titze<br />
Unterricht wünschen, gaben 3<br />
keinen Grund an, neben einigen lapidaren Antworten ("fällt mir leicht", "mal was anderes")<br />
gab es auch interessante, konstruktive Vorschläge. Die Beschaffung von aktuellen Informationen<br />
stand dabei an erster Stelle und wurde am häufigsten genannt. Folgendes wurde<br />
ferner explizit erwähnt: das Erlangen von mehr Methodenkompetenz, das selbstbestimmte<br />
Lernen (ggf. mit anschließender Präsentation), die Möglichkeit, längere Aufsätze sauber<br />
abzutippen, und der Einsatz von PowerPoint über Beamer. In diesem Zusammenhang bedauerte<br />
ein Studierender, dass nicht jedem Schüler ein Rechner zur Verfügung steht, was<br />
aber eine sehr teure Lösung wäre. Die Studierenden nacheinander einen PC benutzen zu<br />
lassen, wäre dagegen natürlich machbar, aber sehr unbefriedigend.<br />
4 der 15 Studierenden, die gern auf den Computer im Unterricht verzichten, gaben hier<strong>für</strong><br />
keine Gründe an. Die anderen waren sich bei den teilweise mehrfachen Begründungen<br />
ziemlich einig: Man meint zum einen, dass so zu viel wertvolle Zeit verloren gehen könnte,<br />
7
und zum anderen, dass der Unterricht zu unpersönlich wäre und der Kontakt zwischen Lehrern<br />
und Schülern gestört würde. Zwei Studierende sind davon überzeugt, dass das gesprochene<br />
Wort oder der an der Tafel langsam entwickelte Hefteintrag den Stoff besser im Gedächtnis<br />
haften lassen. "Man kann schon in der Arbeit nicht auf den PC verzichten" heißt es<br />
in einer Antwort, die einen gewissen Überdruss erkennen lässt und zudem darauf hinweist,<br />
dass die Arbeit am Computer anstrengend <strong>für</strong> die Augen ist. Ein Studierender lehnt zwar<br />
den PC im Unterricht kategorisch ab, meint aber, dass dieser in Freistunden und bei Recherchen<br />
schon recht praktisch wäre.<br />
Kommunizieren Sie mit Ihren Lehrkräften manchmal über den PC? Falls ja: in welcher<br />
Form?<br />
16 Studierende haben keinen elektronischen Kontakt zu ihren Lehrkräften, 12 dagegen<br />
schon. In diesen Fällen werden Hausaufgaben, Übungsaufsätze oder andere Texte per Mail<br />
verschickt. Auch allgemeine Fragen zum Unterricht werden so schnell beantwortet, und es<br />
gibt auch Vorabkorrekturen von Referaten.<br />
Bitte machen Sie Vorschläge dazu, wie sich Ihrer Meinung nach der Computer sinnvoll in<br />
den Schulbetrieb am AG integrieren lassen könnte!<br />
Auf 11 Umfragebögen fand sich hierzu keine<br />
Antwort, 17 andere wiederum gaben teilweise<br />
sehr detailliert Auskunft. Die Vorschläge waren<br />
sehr vielfältig und widersprachen einander auch<br />
teilweise. Es folgt eine Zusammenstellung der<br />
interessantesten Beiträge:<br />
- Für Fremdsprachen wäre ein PC vielleicht<br />
sinnvoll, denn es gibt gute PC-<br />
Sprachprogramme. Internetzugang wäre<br />
wichtig, so könnte man aktuelle Themen sofort<br />
nachschlagen.<br />
- Meiner Meinung nach stört es die Kommunikation<br />
zwischen Lehrern und Schülern, wenn<br />
8<br />
Unser Foto: G. Rigó-Titze<br />
Computerraum<br />
jeder vor einem Monitor sitzt. Man muss den PC also sehr gezielt einsetzen, wenn es<br />
zum Thema passt (z.B. Deutsch: Zeitungen).<br />
- Vorschläge: Recherchen; online gestellte Aufgaben lösen, z.B. in Physik www.leifi.de;<br />
Sprachen: weitere Bedeutungen der Vokabeln, die gelernt werden sollen.<br />
- Zusendung von Unterlagen und Übungen per E-Mail, dadurch lässt sich auch Papier<br />
sparen.<br />
- Der Computer lässt sich gar nicht integrieren; es fehlt an passender Hardware und passenden<br />
Unterrichtsmaterialien.<br />
- Man sollte E-Mails des Arbeits-Accounts checken können. Freie Internetplätze zur Referatvorbereitung<br />
wären gut.<br />
- Unterrichtsbegleitendes Lernmaterial durch Zugang zu Computern im Haus; Mathe-<br />
Übungen und Sprachprogramme zum Selberlernen; über das Internet aktuelle Informationen<br />
zu Biologie, Geographie, Geschichte und Wirtschaft.
- Ich finde den Unterricht auch so gut, auch ohne Computer.<br />
- Eventuell Hinweise darauf, wie man bestimmte Programme, wie z.B. <strong>für</strong> Physik, anwenden<br />
kann.<br />
- "Overhead-Upgrade": mehr Möglichkeit als bei Arbeitsblättern; Arbeitsaufträge per E-<br />
Mail.<br />
- Informationsrecherche; Lernhilfen ausdrucken.<br />
- PowerPoint-Präsentationen, z.B. in Biologie oder Wirtschaft; Graphiken <strong>für</strong> Kurvendiskussion<br />
in Mathe; Online-Wörterbuch <strong>für</strong> Sprachen.<br />
- Es sollte ein Wahlfach <strong>für</strong> Interessenten geben. [Anm. d. Red.: Wahlfach EDV gibt es am<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> schon lange!]<br />
- Während der Schulzeiten sollte man in einem eigenen stillen Raum mindestens 2 PCs<br />
aufstellen <strong>für</strong> Internetrecherchen <strong>für</strong> die Schüler.<br />
Der PC-Raum mit mehreren PCs sollte nach Klassen fächerbezogen eingesetzt werden,<br />
z. B. mit Kopfhörern zum Sprachen-Lernen (neue Software nutzen!).<br />
Die Studierenden sollten im Sinn der Methodenkompetenz in Basisprogrammen geschult<br />
werden, die später im Studium von Vorteil sind, z.B. Word, PowerPoint, Excel, Datenbanken.<br />
Dann können auch Referate ansprechender präsentiert werden.<br />
Gegebenenfalls wäre auch der Einsatz von Digicam und Fotoapparat möglich.<br />
- Warum soll immer etwas verändert werden, wenn sich die Dinge in der Vergangenheit<br />
als "gut" bewährt haben?<br />
- 1. Vorschlag: In den Räumen sollten je nach Zahl der Schüler Computer aufgestellt werden.<br />
Die Schüler sollten jederzeit Zugang zum Computer haben, aber nicht zum Internet<br />
– und wenn, dann unter der Aufsicht eines Lehrers.<br />
2. Vorschlag: Man könnte ein paar Räume mit 20-30 Computern ausstatten. In Freistunden,<br />
wenn diese Zimmer nicht besetzt wären, könnten die Schüler sie benützen. Oder<br />
man könnte es so gestalten, dass an einem Tag der Woche eine Klasse in diesem Raum<br />
ist. Die Lehrer könnten den Lernstoff über den Computer den Schülern beibringen, weil<br />
es auch viel interessanter wäre mit den Animationen und Bildern<br />
- Ich halte Computerarbeitsplätze am AG nicht <strong>für</strong> notwendig. Jedoch würde ich es sehr<br />
vorteilhaft finden, wenn man Räume EDV-technisch so ausstattet, dass man Referate<br />
mit PowerPoint präsentieren kann.<br />
3.1.2 Presse im Wandel<br />
Noch vor wenigen Jahren behaupteten Journalisten selbstsicher, dass der Zeitung die Zukunft<br />
gehöre.<br />
Erörtern Sie anhand der Bedeutung journalistischer Arbeit der Printmedien, ob man auch<br />
heute noch annehmen kann, dass es immer Zeitungen geben wird.<br />
(Aufsatzthema Erörterung, 1.Jahrgangsstufe)<br />
Zeitungsmacher, Verleger, Journalisten und Medienbeschäftigte sehen sich größeren Veränderungen<br />
gegenüber – Veränderungen, die sich auf ihre Arbeit, die Herstellung von Zeitungen,<br />
massiv auswirken könnten.<br />
9
Rasante Entwicklungen auf dem Markt der Nachrichten- und Informationsverbreitung, die<br />
die Macher vor nicht allzu langer Zeit <strong>für</strong> undenkbar hielten, nehmen ihren Lauf und stellen<br />
zur Diskussion, ob die Zeitung als täglich oder wöchentlich erscheinendes Blatt in ihrer angestammten<br />
und vertrauten Form zukünftig Bestand haben kann. Ist ein Überarbeiten bisheriger<br />
Denkweisen nötig, um Qualitätsjournalismus weiterhin aus kaufmännischer und publizistischer<br />
Sicht machen zu können? Sind die Weichen gestellt auf veränderte Erscheinungsformen<br />
einer Zeitung, wie die Nachrichtenveröffentlichung im Internet oder als E-Paper?<br />
Oder setzt man unter Inkaufnahme von Qualitätsverlust auf Zeitungsformate wie die "Vorarlberger<br />
Nachrichten"?<br />
Als Maßstab <strong>für</strong> die journalistische Arbeit in den Printmedien ist ein berufsethisches Handeln<br />
und Arbeiten der in diesen Medien tätigen Personen anzusehen. Große Bedeutung kommt<br />
solcher journalistischer Arbeit in der Politik und Gesellschaft zu: Als überparteiliche und<br />
unabhängige Nachrichtenaufbereiter und –übermittler haben Zeitungen eine lange Tradition<br />
und sind unverzichtbar in der Ausübung ihrer Funktionen.<br />
Der Verantwortung der Journalisten obliegt es, die Wahrheit zu achten, die Würde des Menschen<br />
zu bewahren und die Öffentlichkeit wahrheitsgetreu zu unterrichten. In der Anerkennung<br />
der publizistischen Grundsätze in seiner Arbeit stärkt der Journalist einen qualitativ<br />
und ethisch gut begründeten Journalismus und schützt ihn vor Verfehlungen wie den Formen<br />
des Boulevardjournalismus.<br />
Guter Journalismus zeigt sich widerstandsfähig gegenüber der zunehmenden Einflussnahme<br />
von PR und Lobbyorganisationen auf die Berichterstattung. Im Sinne der Aufklärung übt<br />
der Journalist durch stetes Hinterfragen und selbstkritisches Arbeiten seine Kontroll- und<br />
Kritikfunktion aus. Maßgeblich <strong>für</strong> guten Journalismus sind seine Glaubwürdigkeit, gute Recherchearbeit<br />
und Transparenz. Ein Journalist ist frei und bringt in seiner Tätigkeit den Beleg<br />
da<strong>für</strong>, dass er <strong>für</strong> die Gesellschaft nicht entbehrlich ist.<br />
Eine im journalistischen Sinne gut gemachte Zeitung ist unverzichtbar in der Gesellschaft<br />
und verfügt über einen anerkannten und angestammten Platz als Nachrichtenaufbereiter<br />
und -übermittler. Unerwartet schnelle Entwicklungen im elektronischen Bereich, die Nutzung<br />
des Internets und die große Konkurrenz durch das Fernsehen ließen jedoch in der Vergangenheit<br />
das Zeitungsmachen und das Investieren in die Zeitung unrentabel werden. Bei<br />
gleichzeitiger Steigerung der Produktionskosten sanken die Werbeeinnahmen. Verleger<br />
sahen sich gezwungen, Etats zu kürzen, Redaktionen zu verkleinern, ohne die Folgen dadurch,<br />
wie den Qualitätsverlust im inhaltlichen Bereich, wirklich ernst zu nehmen und solche<br />
Trends aufzuhalten. Qualitätsverlust bedeutet auch immer Verlust zumindest von Teilen der<br />
Leserschaft, die nicht mit diesen Entwicklungen konform gehen und das bisherige Niveau<br />
vermissen.<br />
Vergleichbare Entwicklungen zum Leitmedium Fernsehen sind unverkennbar, wo mit möglichst<br />
niedrigen Produktionskosten und entsprechend niedriger Qualität Programm gemacht<br />
wird und nicht die Inhalte, sondern die Einschaltquoten Priorität haben.<br />
Als weitere Ursache <strong>für</strong> die Krisensituation der Printmedien ist der zunehmende Druck auf<br />
die Zeitungsredaktionen zu sehen: Ihre Nachrichtenverteilung dauert im Vergleich zum Online-Journalismus<br />
einfach länger. Das Durchlaufen aller neuralgischen Punkte, vom Ereignis<br />
über den Berichterstatter, die Agentur, die Zeitung, den Vertrieb bis hin zum Leser, braucht<br />
mehr Zeit als wenn die Nachricht aus dem Internet noch aktueller und schneller abrufbar ist.<br />
Allerdings birgt dies auch die Gefahr, ungenau oder schlecht recherchierte Informationen zu<br />
verbreiten, und widerspricht somit dem Pressekodex und stellt die Daseinsberechtigung von<br />
solchem Journalismus in Frage.<br />
10
Wem gehört nun die Zukunft? Eine Reaktion der Verleger auf die sich verändernde Situation,<br />
deren Tendenzen wohl verkannt oder verharmlost wurden, ist die Nutzung von Nischenmärkten<br />
zusätzlich zum ausschließlichen Herstellen von Printmedien. So werden zeitungsferne<br />
Produkte wie Bücher und Filme vermarktet, die von den Kulturredaktionen ausgesucht<br />
wurden.<br />
Andere Zeitungsmacher setzen auf andere Formate mit bewusst niedrig gehaltenem journalistischen<br />
Anspruch, wie das Beispiel der "Vorarlberger Nachrichten" zeigt, wo auch durch<br />
Diversifikation Leserschaft gewonnen wird, mit allerdings komplett journalistisch fremden<br />
Produkten wie dem Verkauf von Strom.<br />
Zweifelhaft bleibt der Versuch, die Leser in das Zeitungsmachen mit einzubeziehen, denn<br />
durch das Fehlen von Selbstkontrolle ist das Anspruchsdenken bezüglich gutem Journalismus<br />
zum Scheitern verurteilt.<br />
Anerkannte und seriöse Zeitungen versuchen durch die Verbindung mit dem Internet neue<br />
Plattformen zu gebe. Schnelle Informationsverbreitung scheint deren Wunsch und dem Zeitgeist<br />
zu entsprechen<br />
Spekulieren kann man darüber, ob es in der Zukunft noch Zeitungen geben wird. In der heutigen<br />
Erscheinungsform wird dies wohl eher weniger der Fall sein. Vielleicht wird sich die<br />
Zeitung als gedrucktes Medium in der Form eines E-Papers durchsetzen; geknüpft ist dieses<br />
wohl an die Qualitätsanpassung in diesem Medium, um das veränderte Lese- und Leserverhalten<br />
zu berücksichtigen und die Leserschaft zu binden.<br />
Ein Publikum wird es trotz allem <strong>für</strong> guten Journalismus geben, aufgeklärte, gut recherchierte<br />
Berichterstattung einzufordern ist das Recht eines jeden Lesers. Zusätzlich werden sich<br />
Formate wie das der "Vorarlberger Nachrichten" ihren Platz such und finden, wohl gibt es<br />
da<strong>für</strong> auch das entsprechende Publikum.<br />
Doreen Haring, 1a<br />
3.1.3 Das Ende der Zeitung?<br />
Über das Ende des Print-Mediums Zeitung in der Konkurrenz mit den elektronischen Medien<br />
wird schon seit langem spekuliert.<br />
Analysieren Sie den Text "Bewegte Bilder in der Tageszeitung" und überlegen Sie im Anschluss,<br />
ob das dort vorgestellte elektronische Papier das Ende der Zeitung aus Papier<br />
markiert.<br />
(Aufsatzthema Texterörterung, 2.Jahrgangsstufe)<br />
Morgens halb zehn in Deutschland .....<br />
Das ist die Zeit, in der, laut aktuellen Statistiken, die Zeitung in vielen Händen der Einwohner<br />
Deutschlands zu finden ist. Man sieht sie noch überall: in der U-Bahn, im Büro oder im Café<br />
um die Ecke zum Frühstücks-Croissant – Menschen, die ihre Köpfe in die Zeitung stecken.<br />
Doch wie lange wird es die Zeitung in Papierform noch geben? Mittlerweile haben die meisten<br />
Zeitungsmacher erkannt, dass sich die Zeiten geändert haben. Prozentual gesehen sind<br />
diejenigen ihre Hauptkunden, die in zehn bis zwanzig Jahren in Rente gehen. Ein verschwindend<br />
geringer Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist heute noch Abonnent<br />
einer Tageszeitung. Vor bereits zehn Jahren haben die ersten Zeitungsverlage einen<br />
eigenen Internetauftritt erstellt. Dieser wird mittlerweile sehr gut genutzt, mit seinen Suchfunktionen<br />
kommt man schnell zum richtigen Artikel und kann oft auch in älteren Ausgaben<br />
11
echerchieren. Der eine mag's, der andere nicht. Viele sagen immer noch: "Nichts geht über<br />
eine Tasse Kaffee am Morgen mit meiner Tageszeitung!" Und auch die zeitungslesenden U-<br />
Bahn-Fahrer bleiben doch lieber bei ihrer Zeitung in Papierform.<br />
Doch Anfang des Jahres wurde in der FAZ über eine neue Idee der Tageszeitung berichtet.<br />
Der Journalist Manfred Lindinger gibt dem Leser einen sehr detaillierten Ausblick auf die<br />
Zukunft der Zeitung. Diese soll nämlich, nach Meinung eines belgischen Verlagshauses,<br />
elektronisch und portabel sein und damit die Vorzüge einer herkömmlichen und einer Netzzeitung<br />
vereinen. Im März dieses Jahres startete in Belgien die Testphase, in der ausgewählte<br />
Leser all die Vorzüge dieser neuen Erfindung erkunden sollten: Vorzüge wie eine<br />
stündliche Aktualisierung, die Wiedergabe von bewegten Bildern sowie Interviews, die man<br />
sich anhören kann. Desweiteren ist es dem Leser möglich, e-books zu lesen, die er zuvor<br />
aus dem Internet heruntergeladen hat. Sogar die Bearbeitung eigener Dokumente soll kein<br />
Problem sein. Lindinger beschreibt die Geschichte vom elektronischen Papier sehr informativ:<br />
von der Idee über die Umsetzung bis zur Bedienung. Und er zeigt anschließend auch die<br />
Nachteile auf, wie zum Beispiel die eingeschränkte Lesbarkeit auf dem eher kleinen Display.<br />
Er macht dem Leser durch seinen Bericht deutlich, wie sehr Zeitungsverleger daran interessiert<br />
sind, sich der Schnelllebigkeit und der wachsenden Technikbegeisterung ihrer potenziellen<br />
Kunden anzupassen, um im hart umkämpften Mediendschungel überleben zu können.<br />
Manfred Lindinger schreibt sehr sachlich<br />
über dieses Thema und benutzt<br />
<strong>für</strong> die Beschreibung des Aufbaus der<br />
elektronischen Zeitung Begriffe, die<br />
selbst <strong>für</strong> einen Laien sehr verständlich<br />
sind. Zur Veranschaulichung ist in<br />
der Mitte des Berichts eine Abbildung<br />
der elektronischen Zeitung zu sehen<br />
und darunter eine Grafik, die dem<br />
Leser deutlich zeigt, wie die Zeitung<br />
lesbar gemacht wird. Der Verfasser<br />
stellt es dem Leser frei, sich selbst ein<br />
Bild zu machen, und findet es ungewiss,<br />
ob dieses Medium auf so große<br />
Akzeptanz stößt, dass sich die Einführung<br />
lohnt.<br />
12<br />
PC und Lernen 1 Foto: G. Rigó-Titze<br />
Aufgrund seiner Vorteile könnte es durchaus möglich sein, dass man in Deutschland morgens<br />
um halb zehn bald auch eine elektronische Zeitung in der Hand hält. Aber ich glaube,<br />
dass es die Zeitung in Papierform auch weiterhin geben wird, weil ich die neue Form des<br />
Zeitungslesens sehr unpraktisch finde. Ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwann einmal<br />
in der Zukunft Städte gibt, wo an jeder Ecke ein W-Lan-Point steht, dann würde diese Aktualisierung<br />
sinnvoll sein, aber bis dahin ist es besser, das Internetangebot der Tageszeitungen<br />
zu nutzen, wenn man wirklich immer "up to date" sein will. Es ist eher unwahrscheinlich,<br />
dass es Leute geben wird, die jede Stunde an ihren PC gehen, um sich die neuesten Nachrichten<br />
herunterzuladen. Praktischer wäre vielleicht eine Nachrichtenübermittlung über Satellit<br />
direkt in die Zeitung. Doch würde dies sehr unübersichtlich werden, weil die Nachrichten<br />
sich im Laufe des Jahres so sehr anhäufen würden, dass man gar nicht mehr Wichtiges<br />
von Unwichtigem trennen könnte.<br />
Was ich allerdings sehr nützlich finde, ist die Möglichkeit des Uploads von e-books und<br />
selbst erstellten Dokumenten sowie die Schreibfunktion. Dies ist ein klarer Vorteil gegenüber<br />
der herkömmlichen Papierzeitung, bei dem ich mir vorstellen kann, dass er viele Geschäfts-
leute dazu bewegt, sich <strong>für</strong> diese neue Form der Zeitung zu entscheiden. Als weiteren Vorteil<br />
könnte man die Einsparung der Druckkosten sehen – dies aber nur dann, wenn die Zeitung<br />
in Papierform komplett angeschafft würde. Und sollte dies jemals so sein, würden dadurch<br />
auch viele Arbeitsplätze verloren gehen.<br />
Sehr skeptisch bin ich gegenüber der Lebensdauer der vielen eingebauten Chips. Da sich<br />
die Zeitung rollen lässt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass früher oder später das eine<br />
oder andere Kabel bricht und dadurch den Gebrauch der Zeitung nutzlos machen würde.<br />
Manfred Lindinger schreibt auch darüber, dass die kleine Schriftgröße den Lesekomfort<br />
stark beeinträchtigt, und wenn man sich vorstellt, wie klein die Buchstaben in Papierzeitungen<br />
schon sind, ist das keine rosige Aussicht. Allerdings könnte man dagegen Abhilfe schaffen,<br />
indem das Gerät so programmiert wird, dass die Schrift beliebig vergrößert werden<br />
kann.<br />
Da die Zeitung auch hauptsächlich von Werbung lebt, kann ich mir vorstellen, wie die Zeitungsmacher<br />
die Werbung in dieses neue Medium integrieren werden: Ähnlich wie im Internet<br />
könnte bei jedem Seitenwechsel eine "Werbeunterbrechung" eingeführt werden, worauf<br />
bestimmt nur wenige Leser Wert legen.<br />
Ich denke, dass die Idee der Belgier eine sehr gute ist, aber dass die Umsetzung jetzt noch<br />
zu früh ist. Die elektronische Zeitung wird zumindest in nächster Zukunft kein ernstzunehmender<br />
Konkurrent der herkömmlichen Zeitung sein. Es wird auch weiterhin morgens um<br />
halb zehn in Deutschland ein Papierrascheln, verursacht durch das Umblättern von Zeitungen,<br />
zu hören sein. Mittendrin sitzen einige Technikfreaks, die darauf Wert legen, immer auf<br />
dem neuesten Stand zu sein. Und wieder ein paar andere werden sich in ihre Computer<br />
einloggen, um dort ihre Nachrichten zu bekommen. Dies alles ergänzt sich gut, und mit der<br />
Kombination aller drei Varianten erreicht man meiner Meinung nach die meisten Personen.<br />
Ich allerdings bin von der neuen Form des Zeitungslesens nicht überzeugt und werde mir<br />
auch weiterhin meine Zeitung jeden Morgen holen, anstatt auf die Einführung der elektronischen<br />
Zeitung in Deutschland zu warten.<br />
Djamila Suero Mercado, 2a<br />
3.1.4 The Start of a Wonderful Morning at Work<br />
Firstly, I boost my computer. That takes several minutes, enough time to make coffee. Then<br />
I have to log on my computer with my very secret password. And as usually I have to wait<br />
again until every service has started. But that's good; so can drink my hot coffee in the cold,<br />
dark night.<br />
Finally I can start my work. I can click with my mouse on the icons of my Windows Explorer,<br />
my Outlook and SQL-Enterprise applications. I go to Outlook to check my emails. What a<br />
surprise! There are just 60 emails since yesterday! That must be a good day for me. Usually<br />
there are more than one hundred emails a day. I can delete most of them because they are<br />
junk (spam).<br />
Suddenly I see a weak sunlight outside. I take a deep breath and enjoy this wonderful moment.<br />
I talk to myself. "You and you will be deleted soon. – Err – Okay." At the end there are three<br />
status mails of our system, which is installed on the customer's server. Everything is okay.<br />
13
Wonderful. And so I start my development environment "C#" and my "TODO" list in Word.<br />
My further work is to develop software for customers, to update it or to fix it.<br />
While I am working my colleagues come and start their own work day. What do you think<br />
they do? Yes, indeed! Firstly they boost their computer .....<br />
Stephan Schneider, 1d<br />
3.1.5 Wo wären wir ohne Internet, E-Mails & Co?<br />
Sicherlich kennt der eine oder andere diese Geschichte: Ein Arbeitsloser bewirbt sich um<br />
eine Stelle als Kloreiniger bei Microsoft. Der Personalchef hält ihn <strong>für</strong> eine gute Wahl und<br />
bittet ihn um seine E-Mail-Adresse, damit er ihm seinen Vertrag zuschicken kann. Der Mann<br />
antwortet, dass er keinen Computer habe und damit auch keine E-Mail-Adresse. Der Personalchef<br />
ist sichtlich geschockt und sagt: „Aber wenn Sie keine E-Mail-Adresse haben, existieren<br />
Sie virtuell gar nicht. Und weil Sie nicht existieren, gibt es auch keinen Job!“<br />
Der Mann geht, verzweifelt, mit nur noch 10 $ in der Tasche und weiß nicht mehr weiter.<br />
Spontan entscheidet er sich, in den Supermarkt zu gehen und eine Kiste mit 10 kg Erdbeeren<br />
zu kaufen. Er geht von Tür zu Tür und verkauft die Erdbeeren kiloweise. Er schafft es in<br />
zwei Stunden, sein Kapital zu verdoppeln. Er wiederholt das Ganze immer wieder. Geht<br />
jeden Tag früher aus dem Haus und kommt später heim. Sein Geld verdoppelt, verdreifacht,<br />
vervierfacht sich … Kurze Zeit später kauft er sich eine Schubkarre, dann einen Lastwagen,<br />
und später ist er Besitzer einer kleinen Flotte von Lieferwagen. 5 Jahre vergehen … Heute<br />
ist der Mann der Besitzer eine der größten Lebensmittel-Handelsketten der USA.<br />
Eines Tages entscheidet er sich <strong>für</strong> eine Lebensversicherung und bestellt einen guten Makler.<br />
Am Ende des Gesprächs bittet ihn der Makler um seine E-Mail-Adresse <strong>für</strong> die Zusendung<br />
der Vereinbarungen. Der Mann sagt ihm, dass er keine E-Mail-Adresse habe. „Seltsam“,<br />
sagt der Makler, „Sie haben keine E-Mail und trotzdem haben Sie dieses Imperium<br />
aufgebaut. Stellen Sie sich vor, wo Sie wären, wenn Sie eine E-Mail hätten!“. Der Mann<br />
denkt kurz nach und antwortet: „Ich wäre Scheißhausreiniger bei Microsoft!“<br />
HALT! Bitte nicht alle losrennen, PCs aus dem Fenster werfen und anfangen Erdbeeren zu<br />
verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich ohne meine E-Mail Millionär geworden wäre. Aber ich weiß,<br />
dass ich mir ein Leben ohne Internet & Co. nur sehr schwer, um nicht zu sagen überhaupt<br />
nicht mehr vorstellen kann.<br />
Bereits morgens, wenn der Wecker läutet und ich mit halboffenen Augen aus meinem Bett<br />
krieche, schalte ich auf dem Weg ins Bad schon mal den PC ein. Bei einer Tasse Kaffee<br />
checke ich schnell meine E-Mails und lese auch noch den letzten Klatsch & Tratsch … was?<br />
Paris Hilton im Gefängnis? Brad Pitt wieder auf Tuchfühlung mit seiner Ex? Jetzt aber ab in<br />
die Arbeit … und die gleiche Prozedur von vorne: PC an, E-Mails checken, Nachrichten lesen.<br />
Vielleicht hat sich ja in der letzten halben Stunde etwas Neues getan.<br />
Es ist schon erstaunlich, wie sehr uns die Computerwelt bereits beherrscht. Wenn ich daran<br />
denke, dass ich bis vor 8 Jahren noch keinen Internetanschluss besaß, geschweige denn<br />
eine E-Mail-Adresse, frage ich mich „Was hast du damals eigentlich gemacht? Wie hast du<br />
das nur überlebt?“.<br />
Zugegeben, die Kommunikation war vielleicht schwieriger und langsamer, aber persönlicher!<br />
Wer schreibt heutzutage noch Briefe und Karten? Schließlich gibt es ja E-Mails und E-<br />
Cards. Während mein Outlook Posteingang überflutet wird, herrscht in meinem echten Postkasten<br />
gähnende Leere (von Rechnungen und Werbungen abgesehen). Meine Kollegin sitzt<br />
14
im Büro nebenan und schickt mir eine Besprechungsanfrage, wenn wir zusammen zu Mittag<br />
essen wollen. Früher wäre man doch einfach mal kurz nach nebenan gegangen, oder?<br />
Und was war das <strong>für</strong> ein Aufwand, wenn man z. B. Referate vorbereiten musste. Zu meiner<br />
Zeit hatte jeder einen Bibliotheksausweis, es wurde tagelang in Büchern gestöbert und recherchiert.<br />
Und wenn man keinen PC hatte, wurde das Ganze auf einer Schreibmaschine<br />
getippt. Ich <strong>für</strong>chte, die jungen Leute haben eine Bibliothek noch nie von innen gesehen.<br />
Mein Neffe meinte erst kürzlich „Bibli… bibli… waaaaaas? Ich hol mir das Referat im Internet.<br />
Bei Google find ich bestimmt etwas.“<br />
Zugegeben, mein Schulalltag ist durch das Internet auch einfacher geworden. Man erhält zu<br />
jeder Tageszeit jede Information, die man benötigt. Einige Lehrer korrigieren Arbeiten und<br />
schicken sie einem per E-Mail zu … sogar sonntags.<br />
Es gibt einfach nichts, was es im Internet nicht gibt. Man muss das Haus eigentlich gar nicht<br />
mehr verlassen. Man könnte von daheim aus arbeiten, einkaufen, Bekanntschaften knüpfen<br />
… aber wollen wir das wirklich? Menschen leben ein anderes Leben in virtuellen Welten,<br />
spielen stundenlang Computerspiele, der PC bestimmt den Alltag – sowohl privat als auch<br />
im Geschäftsleben. Aber die meisten verschließen die Augen vor den Gefahren: Isolierung,<br />
Flucht in virtuelle Welten, einfache Verbreitung von gewaltverherrlichenden Videos und und<br />
und …<br />
Ja, Internet & Co. haben unser Leben vereinfacht. Aber wir sollten uns nicht so vereinnahmen<br />
lassen. Es gibt Millionen Menschen auf dieser Welt, die nicht einmal wissen, was ein<br />
Computer ist. Sind die wirklich unglücklicher als wir?<br />
Hmm, aber ich gehe jetzt erst mal meine E-Mails checken … �<br />
Yasemin Sadikoglu, K 3<br />
3.2 Lehrkräfte<br />
3.2.1 Lehrkräfte und Computer<br />
An einer kleinen Umfrage zu obigem Thema, die kurz vor den Osterferien durchgeführt wurde,<br />
beteiligten sich insgesamt 15 Kolleginnen und Kollegen.<br />
1. Wie sind Sie zu Hause elektronisch ausgerüstet?<br />
12 Lehrkräfte haben bei sich daheim einen Rechner, 2 arbeiten mit einem Notebook,<br />
und in einer Antwort hieß es. Die meisten Befragten gaben an, dass sie auch über Drucker,<br />
Brenner und Scanner verfügen, 9 erwähnten eigens ihren Internetanschluss (zumeist<br />
DSL).<br />
Einige Kollegen gaben sehr detaillierte Antworten, es wurden nämlich vielfach auch Telefon,<br />
Fax, Kopierer und Musikanlagen erwähnt. Andere wiederum fassten sich kürzer;<br />
so betonte eine Antwort "pro Person 1 PC" und eine andere lautete etwas kryptisch "<strong>für</strong><br />
mich perfekt".<br />
15
16<br />
Die Antwort "Radio: Weltempfänger; kein PC, keine Glotze" war somit die große Ausnahme<br />
bei dieser Frage.<br />
2. Wie benutzen Sie Ihren PC <strong>für</strong> schulische Belange?<br />
Von den 14 Befragten, die diese Frage beantworteten, benutzen alle ihren PC oder ihr<br />
Notebook zu Hause als Schreibmaschine, als Speicherplatz <strong>für</strong> Dateien und zur Internet-<br />
recherche. 9 Kollegen setzen sich auch an den Computer, um mit Studierenden zu<br />
kommunizieren, 12 tauschen sich auf diese Weise mit Kolleginnen und Kollegen aus.<br />
Und insgesamt 11 AG-Lehrkräfte gaben an, den Computer zur Gestaltung ihres Unterrichts<br />
einzusetzen.<br />
einige Lehrer aus dem Kollegium (v.l.n.r): Foto: W.Endraß<br />
Gerhard Köberlin (D,G,Et),Ursula Mondry (M,Sp),Peter Hawel (kath.Rel.) Gertrud von Schlichting-<br />
Schönhammer ( M,B), Anita Streicher(E,F), Hanna Schoeneich-Graf (D,G,Et), Hans König (M,PH),<br />
Siegfried Schalk (Schulleiter, D, G) Ingrid Rüttinger (stellv. Schulleiterin, M,Ek), Gabriele Rigó-Titze<br />
(D,E), Heribert Singer (M,Ph), Peter Sinhart (D,G, Et ), Brigitte Feiks (ev.Rel.), Elfriede Jakob (D,E),<br />
Dieter Viebeck (E,F), Eva-Maria Sporer (D,E), Robert Pohl (M,Ph), Gabriele Plank (WR,Ek), Werner<br />
Endraß (B,Ch), Axel Erdmann (F,L,It,Span), Walter Pfenning (F,L)<br />
3. Setzen Sie die Schul-PCs im Unterricht ein?<br />
Die Mehrheit der Befragten, nämlich 11 beantworteten diese Frage mit einem deutlichen<br />
"Nie". Auch Begründungen hier<strong>für</strong> wurden gegeben, die zumeist technische Ursachen<br />
haben, so meinen 9 Kollegen und Kolleginnen, dass der Einsatz der Schulcomputer zu
zeitintensiv sei, weil es mitunter sehr lange dauert, bis das System hochgefahren ist.<br />
Zweimal wurde die Unberechenbarkeit des Systems kritisiert sowie die Tatsache, dass<br />
die PCs in mehreren Klassenzimmern nicht zu benutzen sind.<br />
Die Antworten machten auch klar, dass sich die Lehrkräfte bewusst sind, dass der<br />
Computereinsatz eine lange Vorbereitung und Einarbeitung voraussetzt. Zwei von ihnen<br />
wünschen sich daher, sich in dieser Richtung noch weiter fortbilden zu können.<br />
In einem Beitrag wurde genannt, dass sich der Einsatz des Computers bisher inhaltlich<br />
noch nicht ergeben habe, ein weiterer gab zu bedenken, dass ein Mehrwert nur in ganz<br />
bestimmten Fällen erkennbar sei. In einer Antwort wurde bezweifelt, ob unsere Studierenden,<br />
die vielfach ihren Arbeitstag vor dem Computer-Monitor verbringen, auch in der<br />
Schule noch mit dem PC arbeiten wollen.<br />
Drei der Befragten setzen den Computer lediglich "selten" im Unterricht ein. Auch hier<strong>für</strong><br />
gab es unterschiedliche Begründungen. So hieß es zum einen, dass die Benutzung<br />
der PCs in den Klassenräumen teilweise nicht möglich und des Computer-Raums zu<br />
umständlich sei. In einer anderen Antwort wurde darauf hingewiesen, dass ein Tafelanschrieb<br />
günstiger als fertige PC-Seiten sei.<br />
Nur ein Kollege gab an, die Computerausstattung der Schule "häufig" zu nutzen: "Beamer<br />
im Physiksaal machen den Einsatz im Physikunterricht leicht möglich. Ich habe<br />
meine Unterrichtsvorbereitungen <strong>für</strong> Physik (fast) alle in HTML-Form ins Netz gestellt<br />
(pädagogische Hefte)."<br />
4. Wie oft benutzen Sie die Rechner im Lehrerzimmer?<br />
4 Lehrkräfte benutzen die PCs im Lehrerzimmer<br />
nie, dabei wurde einmal moniert,<br />
dass der Standort zu ungemütlich sei.<br />
5 Kolleginnen und Kollegen greifen eher selten<br />
darauf zurück, wobei einer auf den "Luxus"<br />
seines eigenen Dienstzimmers verweist.<br />
Sechsmal wurde geantwortet, dass die<br />
Rechner im Lehrerzimmer regelmäßig genutzt<br />
würden, in drei Fällen sogar mindestens<br />
dreimal pro Woche.<br />
5. Weitere Bemerkungen, Wünsche <strong>für</strong> die Zukunft,<br />
etc.<br />
Computer im Foto: G. Rigó-Titze<br />
Lehrerzimmer<br />
6 Kolleginnen und Kollegen hatten hierzu nichts zu sagen. Die gegebenen Antworten<br />
wiederum waren recht unterschiedlich:<br />
"Wünsche: Zuverlässigkeit der PCs und Drucker in der Schule"<br />
"a) Aufforderung an die Initiatoren der unverhältnismäßigen und eitlen Kampagne <strong>für</strong><br />
'Computer im Klassenzimmer', das verschwendete Geld wieder hereinzuarbeiten und zu<br />
bereuen, b) love, peace and all the rest"<br />
"Besserer Internetzugang in den Klassenräumen"<br />
17
Fazit:<br />
18<br />
"Die Schul-PCs scheinen recht anfällig zu sein .... große Skepsis!"<br />
"Die Ausstattung genügt meines Erachtens."<br />
"Wunsch: 1. Campuslösung, damit alle Klassenzimmer zu nutzen sind, 2. alle Klassenzimmer<br />
auf Beamer ausrüsten (Anm. d. Red.: Beameraufrüstung kommt weitgehend<br />
nach der laufenden MPE-Nachrüstung)."<br />
"Ein langes Leben!"<br />
Auch <strong>für</strong> das Lehrerkollegium des<br />
<strong>Abendgymnasium</strong>s ist der Computer<br />
ein unentbehrliches Hilfs- und Arbeitsmittel<br />
geworden, das nicht nur<br />
zur Unterrichtsvorbereitung und –<br />
gestaltung eingesetzt wird, sondern<br />
zur Kommunikation mit den berufstätigen<br />
Studierenden.<br />
Dass der PC im Unterricht noch relativ<br />
selten verwendet wird, liegt größtenteils<br />
daran, dass wir bisher noch keine<br />
Campuslösung haben und somit in<br />
fast der Hälfte der Klassenzimmer die<br />
vorhandenen Rechner <strong>für</strong> uns am AG<br />
nicht nutzbar sind.<br />
Blick in unser Lehrerzimmer Foto: G. Rigó.Titze<br />
Die Lehrkräfte unserer Schule sind<br />
durchaus bereit, in fachspezifisch sinnvoller Weise auch in Unterrichtsstunden auf das Angebot<br />
an elektronischer Ausrüstung im Anton-Fingerle-Bildungszentrum zurückzugreifen.<br />
Wir hoffen, dass die technischen Möglichkeiten hier<strong>für</strong> möglichst bald gegeben sind.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
3.2.2 Computereinsatz im Physikunterricht<br />
An mich wurde die Bitte herangetragen, <strong>für</strong> den diesjährigen <strong>Jahresbericht</strong> einen Artikel über<br />
den Einsatz von Computern in meinem Mathematik- bzw. Physik-Unterricht und meine Erfahrungen<br />
damit zu schreiben.<br />
Obwohl sich meine Begeisterung zunächst in Grenzen hielt – wie wohl viele Mathematiker /<br />
Physiker fühle ich mich eher nicht zum Schreiben berufen – habe ich mich, wie Sie an den<br />
folgenden Zeilen sehen, dann doch an die Aufgabe gemacht.<br />
Zunächst zur schlechten Nachricht. In den Klassenräumen, in denen ich Mathematik unterrichte,<br />
stehen uns bisher keine festinstallierten Beamer und teilweise keine Rechner zur Verfügung.<br />
Unsere Klassenzimmer samt Rechner sind teilweise dem Münchenkolleg zugeordnet,<br />
die mit uns die gleichen Räume nutzen. Wegen fehlender Campuslösung sind diese<br />
Rechner <strong>für</strong> uns zur Zeit nicht einsetzbar. Die Benutzung von Computern während des Unterrichtes<br />
setzt daher häufig den Raumwechsel in den Computerraum voraus. Dies ist häufig<br />
zeitaufwändig, vor allem <strong>für</strong> nur kurze Computeranwendungen, zumal die Unterrichtszeit am<br />
AG besonders knapp bemessen ist, wie beispielsweise in Mathematik, wo wir in den Jahrgangsstufen<br />
I und II mit 5 bzw. 4 Wochenstunden den Stoff etwa der Klassen 5 – 11 der
Tagesgymnasien bewältigen müssen. Kurz gesagt: in meinem Mathematikunterricht stellt<br />
der Einsatz von Computern die Ausnahme dar.<br />
Anders verhält es sich mit meinem Physikunterricht.<br />
Hier unterrichte ich im immer gleichen Physikraum, der über einen Rechner und einem festinstallierten<br />
Beamer verfügt, sodass der Einsatz ohne große Vorbereitung jederzeit, auch<br />
kurzfristig, möglich ist.<br />
Ich habe vor ca. 4 Jahren begonnen, zuerst <strong>für</strong> die 1. Jahrgangsstufe, später auch <strong>für</strong> die 2.<br />
Jahrgangsstufe und <strong>für</strong> die Grundkurse Physik in der 3. und 4. Jahrgangsstufe, meine Unterlagen<br />
in Form von virtuellen Heften ins Netz zu stellen. Ein Motiv war, unseren Studierenden,<br />
die berufsbedingt nicht immer am Unterricht teilnehmen können, die Möglichkeit zu<br />
bieten, zu Hause den versäumten Stoff nachzulesen, passende Aufgaben zu finden, diese<br />
selbstständig zu lösen und anschließend mit der Lösung, die ebenfalls in den virtuellen Heften<br />
steht, zu vergleichen. Ein weiterer Grund <strong>für</strong> die virtuellen Hefte, speziell <strong>für</strong> die 1. Jahrgangsstufe,<br />
war der Wunsch, unseren Studierenden ein Skriptum an die Hand zu geben, da<br />
<strong>für</strong> unseren Lehrplan in Jahrgangstufe 1 kaum ein geeignetes Lehrbuch existiert. Zeitaufwändige,<br />
ausführlichere Darstellungen, etwa an der Tafel, sollten so gespart werden.<br />
Der zeitliche Aufwand war <strong>für</strong> mich sehr, sehr hoch, zumal ich nicht so fit war im Erstellen<br />
von Web-Seiten.<br />
Die eigenen Ansprüche wie auch die der Studierenden an ausführlichen Darstellungen, Aufgaben<br />
(„Bitte mit Lösung!“), die Suche von geeigneten Simulationen <strong>für</strong> Versuche etc. wuchsen<br />
schnell. Die Erwartungen an das Design stiegen manchmal schneller als meine Kenntnisse.<br />
Der Spaß am Erlernen und Erstellen von HTML-Seiten hat mich dann über manche<br />
Schwierigkeiten und durch viele Nachtsitzungen getragen.<br />
Immer wieder habe ich mich mit Fragen an einzelne Studierende gewendet. Viele Anregungen<br />
waren hilfreich, manche haben mir nicht wirklich weiter geholfen, beispielsweise milde<br />
tadelnd: “Ihre Lösung ist doch sehr umständlich, machen Sie das doch mit css oder php, da<br />
geht das doch viel eleganter!“ oder amüsiert, mit einem kleinen Schuss Überheblichkeit:<br />
„Was, Sie benutzen Dreamweaver??! Ich schreibe alles gleich in HTML, da hat man einen<br />
viel kompakteren Code“. Diese Situationen hatten aber auch ihr Gutes, haben geholfen, das<br />
gefühlte Gefälle zwischen Lehrer und Schüler abzubauen, und waren damit sehr förderlich<br />
<strong>für</strong> das Klima.<br />
Im Anfang meines Unterrichts mit den virtuellen Heften musste ich dann feststellen, dass<br />
sich diese Web-Darstellungen nicht ohne Weiteres <strong>für</strong> den Unterrichteinsatz eignen. Ich habe<br />
anfangs zu Unterrichtsbeginn den Rechner eingeschaltet und habe dann in enger Anlehnung<br />
an das Skriptum unterrichtet. Ich hatte geglaubt, meine eigene Begeisterung <strong>für</strong> diese<br />
Seiten würde die Studierenden anstecken. Nach einigen Stunden musste ich enttäuscht<br />
feststellen, dass dies nicht eintrat.<br />
Ich habe mich dann umgestellt und führe meinen Unterricht wieder eher in konventioneller<br />
Form. Den Computer nutze ich immer noch häufig, aber meist nur, um Simulationen von<br />
Versuchen und Animationen zu zeigen, die den Unterricht bereichern und erlauben, komplexe<br />
Abläufe sehr anschaulich darzustellen.<br />
Heute, glaube ich, habe ich mit dem Einsatz meiner virtuellen Hefte eine geeignete Form<br />
gefunden, den Wünschen unserer Studierenden nachzukommen und auch der Rechnereinsatz<br />
im Unterricht wird positiv aufgenommen, wie ich Äußerungen der Studierenden entnehme.<br />
Heribert Singer<br />
19
3.2.3 PC and Me<br />
Als ob es nicht eh schon genug Ärgernisse im Leben gäbe! Defekter ISDN-Anschluss,<br />
Überhitzung des Rechners, kaputtes LAN-Kabel zu Hause! Nervtötend langsam oder unzuverlässig<br />
oder gar nicht funktionierende PCs im Lehrerzimmer! Mein Ärger über Computer<br />
wird stets noch dadurch gesteigert, dass ich mich auch noch über die Intensität meines eigenen<br />
Ärgers ärgern muss. Dabei sind die guten, alten, computerlosen Zeiten noch gar nicht<br />
so lange vorbei.<br />
Als ich Anfang der achtziger Jahre meinen Dienst am <strong>Abendgymnasium</strong> antrat, kam ich, wie<br />
die meisten Kollegen, häufig mit blauen Fingern in den Unterricht. Das kam von den Matrizen,<br />
die man zu Hause unermüdlich tippte, um sie dann in der Schule in einen Apparat zu<br />
klemmen, der durch Rotation (elektrisch oder manuell betrieben) die Vervielfältigung von<br />
Arbeitsblättern ermöglichte, die bei unseren Studierenden auch damals schon sehr begehrt<br />
waren – nicht zuletzt wegen des starken Spiritusgeruchs, der dem Papier entströmte (So<br />
wurde wohl auch manch eine Schulaufgabe unter der berauschenden Wirkung dieser<br />
Schnüffeldroge verfasst.).<br />
Der Nachteil des Spirit-Karbon-Verfahrens war neben den blauen Fingern aber auch oft die<br />
schlechte Leserlichkeit der Texte. Zwar gab es auch am AG bereits einen Fotokopierer, aber<br />
wir Lehrkräfte waren angehalten, ihn möglichst selten zu benutzen, und mussten über die<br />
Anzahl der Kopien genauestens Buch führen.<br />
Als dann einige Jahre später das Kopieren billiger, die Anzahl der schuleigenen Kopierer auf<br />
zwei verdoppelt wurde und diese auch in akzeptabler Geschwindigkeit arbeiteten, warf ich<br />
meine alten Matrizen weg und schaffte mir eine elektronische Schreibmaschine an. Ganz<br />
wagemutige Kollegen hatten zu dieser Zeit (es muss um 1989 gewesen sein) bereits einen<br />
Computer zu Hause – aber <strong>für</strong> mich als überzeugte Geisteswissenschaftlerin war das doch<br />
nichts – nein danke!!! Gefallen hat es mir aber doch, dass meine Schreibmaschine auch<br />
kleinere Textbausteine (wie den Kopf von Schulaufgaben) speichern konnte, wodurch diese<br />
<strong>für</strong> mich durch einfachen Tastendruck abrufbar waren.<br />
1991 oder 92 war es dann soweit! Mein damaliger Chef, natürlich ein Mathematiker, predigte<br />
unermüdlich in jeder Konferenz, dass es sich ein moderner Pädagoge einfach heute nicht<br />
mehr leisten könne, seine Schulaufgaben n i c h t mit dem Computer zu erstellen. Natürlich<br />
wollte ich auch zu diesen modernen Kollegen gehören, und so war es dann nur noch ein<br />
kleiner Schritt bis zum Kauf meines ersten PCs. Das Abspeichern von Texten empfand ich<br />
von Anfang an als sehr praktisch, auch ein gelegentliches Solitaire oder das Affen-Bananen-<br />
Spiel fanden durchaus mein Gefallen. Für eine intensivere Beschäftigung mit der elektronischen<br />
Materie konnte sich mein Philologenherz aber (noch) nicht erwärmen.<br />
So kam der nächste große Sprung <strong>für</strong> erst Ende der Neunziger: der Internetanschluss. Inzwischen<br />
möchte ich dieses Medium nicht mehr missen, in schulischer Hinsicht v.a. als<br />
Nachschlagewerk (Woher kommt der Vorname Inigo?) und Fundgrube <strong>für</strong> aktuelle Texte<br />
(Was sagt die britische Presse zur Reform des Oberhauses? Wie war die neueste Inszenierung<br />
von Schillers "Wallenstein"?). Außerdem stehe ich mit meinen Studierenden im Austausch<br />
von E-Mails. Da kann man mit mir Termine neu absprechen oder mir Hausaufgaben<br />
als Word-Anhang zukommen lassen, die ich dann entweder mit Rot korrigiert zurückmaile<br />
oder ausdrucke und korrigiert in der nächsten Stunde zurückgebe.<br />
Dankenswerter Weise sorgt unser Dienstherr, die Landeshauptstadt München, da<strong>für</strong>, dass<br />
auch wir angegrauten Pädagogen, die wir nicht mit dem Computer aufgewachsen sind und<br />
die längste Zeit unseres Lebens "ohne" verbracht haben, uns das nötige elektronische Rüst-<br />
20
zeug aneignen können. Zwei- bis dreimal pro Schuljahr begebe ich mich also ins Pädagogische<br />
Institut und besuche Veranstaltungen über Powerpoint, virtuelle Hefte, Scannen, Bildbearbeitung<br />
oder "die Nutzung von Internetressourcen <strong>für</strong> Germanisten". Mit dem Kopf voller<br />
Informationen und der Tasche voller nützlicher Handreichungen mache ich mich danach auf<br />
den Heimweg und hoffe, das eine oder andere im oder <strong>für</strong> den Unterricht anwenden zu können.<br />
Durch das Redigieren des <strong>Jahresbericht</strong>s habe ich mich, zunächst gezwungenermaßen,<br />
ziemlich intensiv mit Textverarbeitung auseinandergesetzt und dabei viel Neues gelernt. Ich<br />
stelle an mir selber fest, dass ich viel experimentierfreudiger geworden bin und mich doch<br />
schon öfter traue, eine Funktion auszuprobieren, die mir noch unbekannt ist. Es lebe die<br />
autodidaktische Methode! Trotzdem bin ich heilfroh, dass ich meinem lieben, hochgeschätzten<br />
Kollegen Heribert Singer das Scannen, Ordnen, Nummerieren und endgültige Einrichten<br />
der Seiten, kurz die ganze knifflige Aufgabe des Layout überlassen kann.<br />
Denn eines ist geblieben, auch wenn ich meinen PC inzwischen einigermaßen zufriedenstellend<br />
handhaben kann: Die technischen Raffinessen des Geräts, seine Leistungsfähigkeit<br />
interessieren mich überhaupt nicht. Wenn ich in mein Auto steige, will ich nicht wissen, was<br />
unter der Motorhaube abläuft, sondern dass mich das Fahrzeug von A nach B bringt. Ebenso<br />
soll mein Computer bitteschön das machen, was ich möchte. Er ist ein Gebrauchsgegenstand,<br />
kein Fetisch!<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
4. Unterrichtsgeschehen<br />
Der Wert des <strong>Abendgymnasium</strong>s<br />
Um fremden Wert willig und frei anzuerkennen, muss man eigenen haben. (Artur Schopenhauer)<br />
Heutzutage kennen die Leute vor allem den Preis und nicht den Wert. (Oscar Wilde)<br />
Mein Name ist Volija (27, aus Weißrussland). Ich liebe mein Leben und im Leben zu lernen.<br />
Ich habe viele Kurse und Workshops hinter mir: Reitkurs, Tauchen, Sporttanzen, Stricken,<br />
Massage, Au-pair-Zeiten in Deutschland, Österreich und Frankreich, Work Camp in Wales<br />
(Großbritannien) und ein freiwilliges soziales Jahr in Meschede, wo ich Blindenschrift gelernt<br />
habe, Kung-fu, Gitarre, orientalischen Tanz und und und ....<br />
Ich will im Jetzt leben! Wenn Sie etwas vorhaben, tun Sie es jetzt, sonst schaffen Sie es nie.<br />
Nach meiner Hochzeit am 06.06.06 habe ich auf den 11.09.06, den Schulbeginn, gewartet.<br />
Um das Land noch besser zu verstehen, um neue Freunde kennenzulernen und, vor allem,<br />
um neue Sprachkenntnisse zu erwerben.<br />
21
Um alles zu schaffen, muss man gut organisiert sein: Familie, Arbeit und <strong>Abendgymnasium</strong>.<br />
Einige haben mich schon gefragt: "Wozu? Ist es nicht zu viel?"<br />
Es ist sogar zu wenig! Ich bräuchte mehr und habe alle Möglichkeiten wahrgenommen, um<br />
meine Träume zu verwirklichen: Ergänzungsunterricht in Französisch, Wahlunterricht in<br />
Spanisch, Theater, kreatives Schreiben und seit April noch Italienisch. Ich möchte in vier<br />
Jahren drei fremde Sprachen beherrschen und mit zwei richtig loslegen.<br />
Das Lernen selbst ist nicht leicht. Aber es bringt mehr Spaß, wenn man mehr Leute aus der<br />
Schule kennt. Durch den ganzen Wahlunterricht habe ich das Gefühl, dass das <strong>Abendgymnasium</strong><br />
mein zweites Zuhause ist, wo ich mich einfach wohlfühle.<br />
Und wenn manchmal der Mathestoff nicht aus dem Kopf geht, dann fahren Sie 40 Minuten<br />
nach Gronsdorf mit dem Rad und genießen Sie die Ruhe der schlafenden Stadt.....<br />
Vielleicht kommen Sie mir entgegen.<br />
Den Mutigen gehört die Welt!<br />
Volha Zwingmann, 1a<br />
4.1 Aus den 1. Klassen<br />
4.1.1 Nach zwei Monaten<br />
am <strong>Abendgymnasium</strong> fassen einige Studierende des <strong>Abendgymnasium</strong>s ihre Eindrücke zu<br />
einzelnen Fächern zusammen. Sie sind in der Klasse 1d, besuchen also den mathematischnaturwissenschaftlichen<br />
Zweig.<br />
Englisch und Geschichte<br />
Hinsichtlich der Erwartungen an die beiden Fächer Englisch und Geschichte waren die einzelnen<br />
Studierenden geteilter Meinung, begründet durch die unterschiedlichen Vorkenntnisse<br />
der Mitschüler. Einerseits hatte man zu hohe Erwartungen gesetzt, andererseits die Fächer<br />
zu sehr unterschätzt. Dies betrifft v.a. Geschichte, ein Fach, das zu Beginn nur sehr<br />
schwer einzuschätzen ist, aber auch Englisch, denn die eigene Vorbildung ist meist lückenhaft.<br />
Im Großen und Ganzen macht es aber Spaß, die Fächer zu lernen.<br />
In einer großen Gruppe ist es immer schwer zu beurteilen, wie das Lerntempo angesetzt ist.<br />
Trotzdem kann man behaupten, es geht nicht so schnell vorwärts, dass man gleich den Faden<br />
verlieren würde. Unserer Meinung nach steht in Geschichte das Lernen im Vordergrund<br />
und in Englisch eine Mischung aus Lernen und Üben, aber überwiegend das Üben.<br />
Der bisherige Lernaufwand ist sehr gering <strong>für</strong> beide Fächer, da man eigentlich noch ziemlich<br />
am Anfang steht. Man kann, sofern die Voraussetzungen da<strong>für</strong> vorliegen, die bisherigen<br />
Themen aus dem Unterricht heraus verstehen und müsste da<strong>für</strong> zu Hause einen sehr geringen<br />
Lernaufwand betreiben.<br />
Eine bisherige Lernstrategie besteht darin, v.a. unter der Woche soviel Stoff zu sammeln wie<br />
möglich und diesen am Wochenende zu vertiefen und evt. zu verstehen. Man sollte aber<br />
auch beachten, dass dabei sehr viel Freizeit verloren geht.<br />
Florian Bach, Helga Chudalla, Burim Qeriqi, Ludwig Klatzka, Rosemarie Weprich; alle 1d<br />
22
Chemie<br />
Ich bin von Beruf Chemikant, das ist, meiner Meinung nach, ein sehr interessanter Beruf.<br />
Doch ab und zu muss man im Leben auch mehr tun als überhaupt notwendig ist. Also zum<br />
Beispiel in die Schule gehen. So besteht die Chance, natürlich eine von vielen, sich im Leben<br />
weiter zu entwickeln. Man muss sich verändern, keine Frage, aber wohin, das ist die<br />
andere Frage.<br />
Das <strong>Abendgymnasium</strong> ist eine Schule, welche Allgemeinwissen vermittelt; inwieweit das<br />
vermittelte Wissen einem mehr oder weniger weiterhilft, das wird sich zeigen. Fest steht<br />
aber, dass sich Stärken und Schwächen herausstellen werden. So zählt z.B. Chemie zu<br />
meinen Stärken, aber wer weiß, vielleicht war das auch ein schwerwiegender Fehler, denn<br />
somit versäume ich ja wichtige Kenntnisse in Physik, die ich vielleicht auch bräuchte, aber in<br />
der Zukunft nicht haben werde.<br />
Man muss mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, ob positiv oder weniger positiv, auf<br />
alle Fälle ist man aber durch jede Entscheidung um eine Erfahrung reicher geworden.<br />
P.S.: Schule – schade kon's ja net!<br />
Georg Reitebuch, 1d<br />
Mathematik und Physik<br />
Das Fach Mathematik macht mir sehr großen Spaß, besonders mit unserer Lehrkraft. Momentan<br />
ist der allgemeine Stoff noch nicht anspruchsvoll, da meine Kenntnisse bis zur Kurvendiskussion<br />
reichen.<br />
Trotz alledem lernt man immer wieder Tricks und Wege, die das Rechnen vereinfachen. Das<br />
Lerntempo geht zügig voran, <strong>für</strong> mich gerade richtig.<br />
In Mathematik steht das Üben eindeutig im Vordergrund. Die wenigen Regeln und Gesetze<br />
behält man durch das Üben; es wäre reine Zeitverschwendung, sie extra auswendig zu lernen.<br />
Panik und Zeitdruck verhindern den Abruf der Informationen, deshalb ist Üben sinnvoller,<br />
weil das Rechnen Routine bekommt. So beschränkt sich der Lernaufwand auf das Üben<br />
der gestellten Aufgaben und das Durchsehen wichtiger Gesetze von Anfang an – zumindest<br />
jetzt noch.<br />
Freu' mich schon auf die nächste Stunde!<br />
Auch Physik ist eines meiner Lieblingsfächer! Ich habe Physik statt Chemie gewählt, weil es<br />
mehr Themengebiete beinhaltet, welche mich interessieren, u.a. Quantenphysik, Optik, Astronomie<br />
und einige mehr. Da ich mich auch persönlich mit Physik auseinandersetze, ist es<br />
ideal <strong>für</strong> mich.<br />
Meine Erwartungen werden vermutlich erst in der Kollegstufe erfüllt, momentan werden die<br />
Grundinhalte durchgenommen, sodass ich dazu noch nichts sagen kann.<br />
Der Unterricht ist wiederum durch unsere Lehrkraft sehr interessant gestaltet, mit vielen<br />
praktischen Übungen, welche <strong>für</strong> das Verständnis sehr wichtig sind. Auch hier ist das Lerntempo<br />
zügig, was momentan <strong>für</strong> mich in Ordnung ist, weil ich den meisten Stoff schon kenne.<br />
Später, wenn neuer Stoff kommt, heißt es einfach dranbleiben.<br />
In Physik steht Lernen im Vordergrund, aber auch logisches Verständnis sowie mathematische<br />
Grundlagen. Der Lernaufwand wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wenn man<br />
23
nicht viele Grundkenntnisse hat, dann ist es sicherlich einiges an Stoff, aber trotz des Lernaufwands<br />
macht das Fach sehr großen Spaß.<br />
Lernstrategien muss man entwickeln, um auf Dauer effektiv lernen zu können. Einige Tricks<br />
sind u.a. den Stoff zu komprimieren und ihn eventuell auch noch farbig zu unterlegen. Bei<br />
Unklarheiten sollte man diese sofort aufschreiben und bei nächster Gelegenheit mit der<br />
Lehrkraft klären.<br />
Stephan Schneider, 1d<br />
Französisch<br />
Ich habe mich statt Latein <strong>für</strong> Französisch entschieden, denn eine Fremdsprache zu lernen,<br />
die auch aktiv anwendbar ist, ist eine super Sache! Je mehr man spricht, umso besser!<br />
Ich dachte, dass das gar nicht leicht wird (ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse), v.a.<br />
wegen der Aussprache..... Aber im Unterricht ist so viel Zeit <strong>für</strong> Übung!<br />
Natürlich steht auch in dieser Fremdsprache – wie es übrigens immer sein sollte – die<br />
Übung im Vordergrund. Dennoch sollte man regelmäßig Vokabeln lernen, denn man verliert<br />
natürlich den Spaß an der Sache, wenn man nicht mitreden kann!<br />
Ich selber verwende jeden Tag ca. 15 Minuten, um Vokabeln zu lernen bzw. zu wiederholen.<br />
Da das Lerntempo eher langsam voranschreitet, sind nie übermäßig viele Vokabeln auf.<br />
Französisch - kann ich nur empfehlen!<br />
Tanja Köhler, 1d<br />
Latein<br />
Ja zur lateinischen Sprache<br />
Als ich mich im Frühjahr <strong>2006</strong> am <strong>Abendgymnasium</strong> angemeldet habe, entschied ich mich<br />
<strong>für</strong> Latein als 2. Fremdsprache.<br />
Auch wenn Latein heutzutage nicht mehr in Europa gesprochen wird kann die Sprache sehr<br />
hilfreich sein. Egal ob beruflich oder privat im Sprachkurs, mit Latein-<br />
kenntnissen lässt sich vieles ableiten.<br />
Mein Freundeskreis hatte mich gewarnt Latein zu nehmen, weil es schwierig sei und viel<br />
zum Üben geben würde. Ich hatte trotzdem positive Erwartungen an das Fach, welche auch<br />
erfüllt worden sind.<br />
Das Lerntempo ist ziemlich schnell, aber wir müssen eben zügiger vorankommen als am<br />
Tagesgymnasium. Am Wochenende steht deshalb Lateinlernen an der Spitze des Lernprogramms.<br />
Herr Erdmann erklärt Latein verständlich mit viel Geduld und übt viel mit uns. Anhand von<br />
Beispielen aus den heutigen romanischen Sprachen können wir die Verwandt-<br />
schaft zu Latein deutlich sehen.<br />
24
Seit Anfang des Schuljahres musste ich meine Freizeitgestaltung stark einschränken. Im<br />
Vordergrund stehen Lernen und Hausaufgaben machen. Ich versuche möglichst ausgeruht<br />
zu sein, so kann ich effektiver lernen.<br />
Ganz wichtig: Schule sollte Freude bereiten, dann lernt es sich leichter!<br />
Daniela Jauß, 1d<br />
Religion<br />
Nun ja, das mit der Religion ist immer so eine Sache! Aber beziehen wir uns lieber erst einmal<br />
auf den Unterricht. Wir beschäftigen uns momentan mit der Erlösung durch Jesus Christus.<br />
Also damit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Somit dringen wir hier in Gebiete vor,<br />
in denen es mit der Beweisführung aufhört. Man beschäftigt sich mit Angelegenheiten, die<br />
auf der einen Seite sehr abstrakt sind, andererseits nach dem heutigen Stand des Denkens<br />
Geltung haben. Vieles ist sehr schwierig zu begreifen, jedoch nach längerem Darüber-<br />
Nachdenken einleuchtend. Somit wollen wir den Unterricht weiterhin aufmerksam beobachtend<br />
verfolgen.<br />
Anonymus, 1d<br />
4.1.2 Schnupperstunde in szenischem Lernen<br />
Zu Beginn des Schuljahres <strong>2006</strong>/<strong>2007</strong>, genau gesagt am 20.09.<strong>2006</strong>, bekam die<br />
Klasse 1d des <strong>Abendgymnasium</strong>s eine Schnupperstunde in szenischem Lernen.<br />
Frau Wlasak-Schulz führte unsere Klasse durch die Stunde. Unterstützt wird Frau Wlasak-<br />
Schulz dabei von Frau Dr. Steiner, welche an der LMU München Deutschlehrkräfte ausbildet.<br />
Zuerst stellten sich alle Schüler der 1d im Kreis auf. Die Blicke wurden zu Boden gesenkt<br />
und nach wenigen Sekunden sollte man sich überlegen, mit welcher Person man Blickkontakt<br />
haben möchte. Falls sich, was sehr häufig vorkam, zwei Blicke trafen, wurde daraus ein<br />
"Paar" gebildet. Das gefundene Paar stellte sich hintereinander auf und versuchte nun gemeinsam<br />
mit anderen Schülern des Kreises Blickkontakt zu haben. Daraus ergaben sich<br />
kleine Gruppen. Dieser Vorgang wurde solange wiederholt, bis die gesamte Klasse eine<br />
Gruppe war.<br />
Als nächstes bekam jeder von uns einen Holzstock. Mit diesem Stock wurden Geschicklichkeits-<br />
und Konzentrationsübungen durchgeführt. Beim Werfen des Gegenstandes von einer<br />
Hand zur anderen mit Umdrehung konnte es passieren, dass er zu Boden fiel. Dann sollte<br />
man seinen "Nachbarn" freundlich anlächeln und sich entschuldigen. Das gleiche machten<br />
wir anschließend zu zweit.<br />
Nach etwa einer Viertelstunde ging die ganze Klasse durcheinander im Raum und jeder warf<br />
jedem wieder Holzstöcke zu. Dabei durfte ein freundliches Lächeln nicht fehlen. Anschließend<br />
stellte sich jeder in Reih und Glied im Spalier auf. Diesmal warfen sich die Schüler im<br />
Zick-Zack Holzstöcke zu. Auch diese Übung wurde gesteigert, am Ende war eine hohe Konzentration<br />
gefordert.<br />
25
Zum Schluss der Stunde stellte sich die Klasse nochmals im Kreis auf. Nun sollte mit geschlossenen<br />
Augen laut von eins bis zwanzig gezählt werden, wobei keine Zahl doppelt gesagt<br />
werden durfte. Falls zwei oder mehr Schüler dieselbe Zahl riefen, musste wieder von<br />
eins angefangen werden. Unsere Klasse schaffte es stolzerweise bis zwölf! Es ist schon<br />
interessant zu sehen, dass einige Menschen zur selben Zeit denselben Gedanken haben.<br />
Durch die lockere Atmosphäre und die spielerischen Übungen kam sich unsere Klasse näher.<br />
Auf diese Art fiel ein Gespräch mit noch relativ unbekannten Mitschülern leicht, es ergab<br />
sich so gesehen von selbst. Darüber hinaus wurden auch noch die Konzentrationsfähigkeit<br />
sowie die Geschicklichkeit gesteigert.<br />
Auch wenn einige Resonanzen eher mäßig waren, <strong>für</strong> die meisten Schüler war es lustig,<br />
unterhaltsam und eine willkommene Abwechslung des Unterrichts.<br />
Im Namen der Klasse 1d möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Wlasak-Schulz <strong>für</strong> eine<br />
gelungene Schnupperstunde bedanken.<br />
Daniela Jauß, 1d<br />
4.1.3 Bewegtes Lernen<br />
Vermutliche Lernziele und Lerninhalte:<br />
1. Vereinigende Blickkontakte<br />
(Ergänzungsunterricht Physik, Teilgebiet Elektrizitätslehre)<br />
2. Stöckchenschwingen und Stöckchenfangen<br />
nach dem Motto: „Throw and catch the sticks as many as you can!“<br />
(Ergänzungsunterricht Englisch, Kapitel “My dog and me”)<br />
3. Gruppenzählen bis 20<br />
(Ergänzungsunterricht Mathematik, Thema „Intuitives Zählen im Kleinkindalter“)<br />
4. Überbrückungslächeln<br />
beziehungsweise „trans-pontaler risus sardonicus“, (Ergänzungsunterricht Latein)<br />
Erfahrungen dazu in Versform:<br />
An einem Mittwoch war es dann so weit:<br />
Frau Sporrer schickte uns zum Zeitvertreib<br />
eine Etage zur Überraschung, husch – husch, runter;<br />
wir packten in der 1d zusammen uns’ren Plunder.<br />
Einige fragten laut, was es denn dort gäbe? –<br />
Frau Schorrer grinsend und mit Humor und Häme:<br />
„Sie schreiben dort unten eine Ex !“,<br />
sprach die süß-gepfeffert weise Hex’.<br />
Schnell ergänzte sie wie ein Blitz:<br />
„Das war doch nur ein dummer Witz!“<br />
Entspannung trat spontan in die Gesichter<br />
und auch die Augen wurden wieder lichter.<br />
26
Unten verfiel Herr B. in „Logorrhoe“,<br />
Frau K. wurde am Ende ganz weiß wie Schnee.<br />
Ein Bluterguss in ihrer Hand<br />
schrie nach ’nem kühlenden Verband.<br />
Einige Schüler sahen zwar darin<br />
gar keinen pädagogisch wertvollen Sinn.<br />
Die meisten hatten aber ganz viel Spaß,<br />
grinsten und lachten ohne Unterlass.<br />
Und die Moral von der Geschicht’:<br />
Versäume diesen Unterricht<br />
nicht!<br />
Gudrun Kartarius, Klasse 1d<br />
4.1.4 Deutsch<br />
4.1.4.1 Erwachsen zum Abitur?<br />
Sie besuchen ein <strong>Abendgymnasium</strong> <strong>für</strong> berufstätige Erwachsene. Überlegen und verdeutlichen<br />
Sie, welche Probleme und Nachteile Sie im Vergleich zu den jungen "Vollzeit-<br />
Gymnasiasten" bewältigen müssen, aber auch inwiefern Berufserfahrung und Reife einen<br />
Gewinn <strong>für</strong> Ihren Schulbesuch darstellen können!<br />
AUFSATZ 1<br />
Seit September dieses Jahres besuche ich das <strong>Abendgymnasium</strong> <strong>für</strong> berufstätige Erwachsene.<br />
Bis ich mich endgültig dazu entschloss mich anzumelden, habe ich einige Tage intensiv<br />
darüber nachgedacht. Da ich Arbeitskollegen habe, die ebenfalls das AG besuchen, war<br />
ich über mögliche Probleme und Nachteile gegenüber "Vollzeit-Gymnasiasten" gut informiert.<br />
Durch diese Kollegen war mir aber auch klar, dass die Berufserfahrung und größere<br />
Reife auch einen Gewinn <strong>für</strong> meinen Schulbesuch darstellen. Diese genannten Punkte<br />
möchte ich nun erörtern.<br />
Ein Problem ist, dass meine Schulzeit schon einige Jahre zurückliegt. Somit war meine<br />
größte Schwierigkeit, täglich zu üben und die richtige Lernmethode <strong>für</strong> mich herauszufinden.<br />
Ich musste das Lernen neu erlernen. Dieses Problem haben "Vollzeit-Gymnasiasten" nicht,<br />
weil sie ständig in einem Lernprozess sind.<br />
Ein weiterer Nachteil ist sicherlich die Doppelbelastung durch Beruf und Schule. In der Arbeit<br />
muss man hundert Prozent geben. Nach acht Stunden ist man oft ausgepowert und<br />
müde. Gerade in der Anfangszeit fiel es mir schwer, mich nach oft anstrengendem Job auch<br />
in der Schule zu konzentrieren und mitzuarbeiten. Aber auch das kann man lernen.<br />
Der größte Nachteil, der im Gegensatz zu "Vollzeit-Gymnasiasten" besteht, ist der Zeitmangel.<br />
Ich habe zwischen Arbeit und Schule gerade zwei Stunden Freizeit, in der ich alle Aufgaben<br />
erledigen muss, <strong>für</strong> die ich sonst den ganzen Nachmittag Zeit hatte, beispielsweise<br />
Einkaufen, Haushalt usw. "Vollzeit-Gymnasiasten" haben den ganzen Nachmittag und am<br />
Wochenende Zeit zum Lernen, bei mir ist dies durch Wochenendarbeit zusätzlich erschwert.<br />
Also muss ich in den vorhin genannten zwei Stunden auch noch das Lernen unterbringen.<br />
27
Außerdem hat man weniger Zeit <strong>für</strong> Hobbys und andere Freizeitgestaltungen, wobei ein<br />
Ausgleich <strong>für</strong> oft stressige Tage wirklich wichtig ist. Genauso wichtig ist das Treffen mit<br />
Freunden. Durch den straffen Zeitplan ist dies oft nur sehr schwer zu ermöglichen. "Vollzeit-<br />
Gymnasiasten" gehen am Nachmittag nach Hause und haben dann oft den restlichen Tag<br />
Freizeit, die sie nach eigenem Ermessen gestalten können.<br />
Dies hört sich jetzt alles sehr negativ an, ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die Berufserfahrung<br />
und größere Reife können auch einen Gewinn <strong>für</strong> den Schulbesuch darstellen.<br />
Ein Vorteil sind beispielsweise die Vorkenntnisse in bestimmten Fächern. Ich als Krankenschwester<br />
denke, dass ich zum Beispiel in Biologie zumindest in der ersten Zeit keine Probleme<br />
haben werde. Andere Mitschüler haben Vorkenntnisse in Wirtschaft oder Englisch. Das<br />
kann ganz unterschiedlich sein.<br />
Ein weiteres Argument ist, dass sich jeder Einzelne freiwillig <strong>für</strong> die Abendschule entschieden<br />
hat. Durch die größere Reife, die alle in diesem Alter besitzen, ist man entschlossen,<br />
Angefangenes auch zu beenden. Deshalb zeigt jeder mehr Eigeninitiative als zum Beispiel<br />
"Vollzeit-Gymnasiasten", die es oft als ein Muss ansehen, in die Schule zu gehen.<br />
Der wichtigste Punkt ist <strong>für</strong> mich das Erreichen eines klar gesetzten Zieles, das ich jetzt vor<br />
Augen habe. Das, denke ich, hängt auch mit der größeren Reife zusammen. Als Jugendliche<br />
wusste ich nicht so genau, was ich arbeiten will, wenn ich die Schule beendet habe.<br />
Heute weiß ich genau, was ich machen möchte. Dieses Ziel kann ich aber nur erreichen,<br />
wenn ich das Abitur habe. Ich glaube, nicht nur ich, sondern jeder am <strong>Abendgymnasium</strong> gibt<br />
sein Bestes, um sein persönliches Ziel zu erreichen. Das ist der größte Vorteil, den wir vom<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> gegenüber den "Vollzeit-Gymnasiasten" haben.<br />
Mit all den Problemen und Nachteilen, die das <strong>Abendgymnasium</strong> mit sich bringt, meine ich,<br />
dass es eine gute Sache ist. Es lohnt sich, die ganze Energie aufzubringen und sich oft<br />
stressigen Situationen auszusetzen. Das <strong>Abendgymnasium</strong> ist nicht mit einer Tagesschule<br />
vergleichbar. Man bekommt mehr als nur Wissen beigebracht. Man schließt neue Freundschaften<br />
und verändert sein ganzes Leben und seine Gewohnheiten. Für mich bringt das<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> nur Vorteile, und ich bin froh, dass ich Arbeitskollegen habe, die mich<br />
ermutigt haben, noch einmal in die Schule zu gehen.<br />
Susanne Kuchar, 1d<br />
AUFSATZ 2<br />
Das Thema <strong>Abendgymnasium</strong> beschäftigte mich lange Zeit vor meinem Eintritt in diese<br />
Schule und beschäftigt mich immer noch. Es hat sehr viel Zeit und Überlegung beansprucht,<br />
ob ich mich letztendlich einschreibe oder nicht. Der Grund, warum ich so lange gebraucht<br />
habe mich einzuschreiben ist folgender: Es gibt nämlich Nachteile, aber auch Vorteile, als<br />
Erwachsener, und nicht als Jugendlicher, eine Schule zu besuchen.<br />
Zuerst zeige ich die Nachteile auf, die ein Schulbesuch im Erwachsenenalter mit sich bringt.<br />
Ein Nachteil ist, dass man den unvermeidlichen Berufsstress, den man manchmal bei der<br />
Arbeit hat, nicht so leicht abschütteln kann. Es gibt Tage, wo der Erfolg nicht gewährleistet<br />
ist, wenn man vergessen hat, ein wichtiges Fax zu verschicken, oder einen schwierigen<br />
Kunden am Telefon nicht beruhigen kann. Da kann es vorkommen, dass der Chef eine Rüge<br />
erteilen muss. Es ist dann schwierig, mit dem unverarbeiteten Gefühl des Versagens<br />
nach der Arbeit direkt zur Schule gehen zu müssen, wo volle Konzentration abverlangt wird.<br />
28
Nicht jeder ist in der Lage, die Vorkommnisse des Tages am Abend in der Schule auszublenden,<br />
um die volle Aufmerksamkeit dem Unterricht zu widmen.<br />
Nicht nur die Schule und der Beruf, sondern auch die Familie und Freunde benötigen die<br />
gleiche, wenn nicht mehr Aufmerksamkeit. Wenn man beispielsweise Kinder hat, so wird es<br />
<strong>für</strong> denjenigen sehr schwer, die knappe Zeit, die er zur Verfügung hat, auch richtig einzuteilen.<br />
Bei der Kindererziehung ist die Präsenz der Eltern genauso wichtig wie Geduld und Liebe.<br />
Auch kann es vorkommen, dass man keine Zeit mehr <strong>für</strong> Freunde hat, generell das soziale<br />
Leben vernachlässigt. Das schlechte Gewissen bei der Kindererziehung und soziale<br />
"Verarmung" sind wichtige Argumente, die gegen den Schulbesuch als Erwachsener sprechen.<br />
Auch aus diesem Grunde ist es wichtig, sich genau zu überlegen, ob man den Schritt wagt<br />
sich einzuschreiben. Denn man hat sich vorgenommen, die nächsten vier Jahre bis zur Reifeprüfung<br />
durchzuhalten. Als Erwachsener ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu<br />
treffen. Man kann es sich nicht mehr leisten, Zeit zu verschwenden. Es ist eine andere Sache,<br />
ob man mit sechzehn vier Jahre seines Lebens vergeudet oder mit dreißig. Denn eines<br />
sollte man nicht aus den Augen lassen: Nur weil man vielleicht die Motivation und den Ehrgeiz<br />
zeigt, heißt das noch lange nicht, dass man die Abschlussprüfung, die in Bayern bekanntlich<br />
schwieriger ist als in anderen Bundesländern, dann auch wirklich schafft.<br />
Diese Probleme und Nachteile gelten nicht <strong>für</strong> Jugendliche im Gymnasium, die den Luxus<br />
besitzen, ihre volle Zeit der Schule widmen zu können. Sie können es sich leisten, im Gegensatz<br />
zu Schülern, die berufstätig sind, den Vormittag ohne Sorgen in der Schule zu verbringen<br />
und sich abends dem Müßiggang hinzugeben.<br />
Es gibt aber auch Vorteile, die <strong>für</strong> den Besuch einer Schule als Erwachsener sprechen.<br />
Einer der Vorteile ist, dass man die Schule aus freiem Willen besucht und nicht wie in der<br />
Jugendzeit dazu gezwungen wird. Diese Tatsache führt dazu, dass man keinen Kampf mit<br />
den Eltern und den Lehrern austrägt. Der Widerwille, den man vielleicht gegen das Schulsystem<br />
empfunden hat, verliert jede Basis, da man freiwillig und somit mit einem positiven<br />
Gefühl in die Schule geht. Dadurch besitzt man eine bessere Aufnahmefähigkeit und lernt<br />
produktiver.<br />
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Erfahrungen im Berufsleben die Menschen prägen. Man<br />
lernt, um die Dinge zu erreichen und sich durchzusetzen, muss man auch etwas tun und<br />
sich da<strong>für</strong> einsetzen. Oft ist es im Beruf so, dass man sich nicht durchschummeln kann. Die<br />
Leistungen, die man erbringt, sind ersichtlich und können entscheidend sein <strong>für</strong> die Karrierelaufbahn<br />
und somit auch das Einkommen. Schließlich hat man auch gelernt, zielstrebiger zu<br />
sein.<br />
Als Erwachsener lässt man sich weniger ablenken und konzentriert sich auf die wichtigen<br />
Dinge im Leben. Der Schulabschluss zählt, sofern man sich <strong>für</strong> das <strong>Abendgymnasium</strong> entschieden<br />
hat, zu diesen Dingen. Das Ziel erst einmal vor den Augen, lassen sich Erwachsene<br />
nicht so leicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen. Wo Jugendliche vielleicht wankelmütiger<br />
und entscheidungsfauler sind, treten Erwachsene im Regelfall selbstbewusster auf.<br />
Der bewusste Eintritt in das <strong>Abendgymnasium</strong> verstärkt den Ehrgeiz nur, das zu vollenden,<br />
was man begonnen hat.<br />
Die Überlegungen, die ich am Anfang schon erwähnt habe, sind <strong>für</strong> mich immer noch präsent.<br />
Obwohl ich bereits einige Monate eine Schülerin des <strong>Abendgymnasium</strong>s bin, gibt es<br />
immer wieder Momente, wo ich mir die Frage stelle, ob meine Entscheidung richtig war. Und<br />
das, obwohl ich eine Erwachsene bin, die in ihrer Entscheidung gefestigt sein sollte. Das<br />
29
zeigt doch, dass die Zielführung weniger vom Alter als von der Willensstärke abhängt. Man<br />
sollte immer wieder die Vor- und Nachteile in den verschiedenen Stationen des Lebens abwägen.<br />
Deniz Demirel, 1c<br />
4.1.4.2 Deutschunterricht – lustvoll, lehrreich, kreativ<br />
Es ist Mittwoch, der 18. April <strong>2007</strong>. Die Klasse 1 d hat sich nach dem Ethik- und Religionsunterricht<br />
etwas müde, aber bester Laune <strong>für</strong> die letzte Unterrichtsstunde an diesem Abend<br />
wieder in Raum 230 zusammen gefunden. – Deutschunterricht bei Frau Sporrer zum grundsätzlichen<br />
Aufbau des Dramas wird Thema sein. – Während Frau Sporrer das Klassenzimmer<br />
schon betreten und freundlich gegrüßt hat, findet noch ein letzter reger kommunikativer<br />
Austausch in der Gruppe statt. Herr S. A. verausgabt sich dabei im Frühlingshormonschub<br />
mit Käuzchen- oder Täuberichrufen. Nachdem Frau Sporrer nochmals ihre Anwesenheit<br />
unterstrichen und Herrn S. A. gezielt aufgefordert hat, seine Balzrufe einzustellen, sind alle<br />
grinsend bei der Sache und überlegen noch vereinzelt, wem wohl die Balzrufe gegolten haben<br />
mögen.<br />
Im Folgenden werden die Ursprünge des europäischen Theaters beispielhaft beleuchtet:<br />
Griechische Dramen, wie "Ödipus" oder "Lysistrata" müssen mit ihren Geschichten da<strong>für</strong><br />
herhalten. Danach werden die Konfliktarten (äußerer, innerer und tragischer Konflikt), die<br />
Lösungsmöglichkeiten (Katastrophe bei der Tragödie, Happy End bei der Komödie und gegebenenfalls<br />
Open End bei modernen Stücken) und die Darstellungsformen (Dialog, Monolog<br />
und Stichomythie) des Dramas gemeinsam erarbeitet.<br />
Frau Sporrer, die nicht müde wird durch Vertiefungsfragen Sinnzusammenhänge aufzuzeigen,<br />
beflügelt unsere Phantasie am späten Abend bis zur Hochform. Zur besseren Veranschaulichung<br />
mutiert sie in Sekundenschnelle mit ausgestreckten Armen im passend grünen<br />
Kleid zum Baum. Imagination und Einfühlungsvermögen sind jetzt gefragt! Während einige<br />
Leute in der Klasse noch darüber nachsinnen, ob unsere Deutschlehrerin wohl biologisch<br />
betrachtet als Nadelgehölz, Laubbaum, Wacholderbusch oder Bonsai bestimmt werden<br />
könne, haben andere schon das frei erfundene Drama zum Verständnis und zur Einübung<br />
der Begrifflichkeiten weitergesponnen:<br />
Als Protagonist dient eine männliche Phantasiefigur, die Bäume hasst und absägen<br />
möchte.<br />
Für die Antagonistenrolle entschlüpft unserer unbändigen Phantasie eine weibliche Person,<br />
die Naturschützerin ist und Bäume um jeden Preis erhalten möchte.<br />
Dialoge und Monologe werden angedacht im Sinne einer Tragödie sowie auch Komödie.<br />
Fragen wie „Kann und darf der vom Absägen bedrohte Baum in der literarischen Gattung<br />
Drama auch sprechen?“ oder „Was kann alles im Ergebnis der Handlung passieren,<br />
wenn diese Frau und dieser Mann sich ineinander verlieben?“ beschäftigen uns dabei<br />
sehr intensiv.<br />
Und dann ertönt ganz plötzlich und unverhofft der Schulstundengong. Schon vorbei!?<br />
Angeregt und heiter gehen wir in den Feierabend und haben viel vom Stoff kapiert und behalten.<br />
– Vielen Dank an Frau Sporrer <strong>für</strong> die beschwingte und lehrreiche Deutschstunde!<br />
Wir haben uns köstlich amüsiert und unseren Horizont mit Leichtigkeit erweitert. – So macht<br />
Lernen Spaß!<br />
P.S.: Übrigens, ein Mitschüler namens D. S. schreibt darüber wirklich ein Stück mit dem Titel<br />
30
„Baum oder Nicht-Baum, das ist hier die Frage – Ich glaub’, ich steh im Wald!“ Vielleicht wird<br />
es bis zum nächsten Fasching vollendet sein. Wir sind schon ganz gespannt darauf.<br />
Gudrun Kartarius,1 d<br />
4.1.4.3 1. Klassen und Theater<br />
Auch in diesem Schuljahr war es dank der Initiative einiger Deutsch-Lehrkräfte möglich,<br />
mehrere höchst erfolgreiche Theaterbesuche <strong>für</strong> unsere Studierenden zu organisieren. Die<br />
Bedeutung solcher Unternehmungen ist in mehrfacher Hinsicht eine ganz besondere, denn<br />
sie ergänzen nicht nur die Unterrichtsstunden, sondern öffnen häufig neue Horizonte <strong>für</strong><br />
unsere berufstätigen Schülerinnen und Schüler. Dabei stellt sich immer wieder heraus, dass<br />
hinsichtlich eines Theaterbesuchs vielfach Schwellenängste bestehen, die es abzubauen gilt<br />
und die sich die Studierenden dann auch gerne nehmen lassen.<br />
Im Mai <strong>2007</strong>, nach mehreren begeistert aufgenommenen Theaterbesuchen, befragte Frau<br />
Sporrer Studierende der Klasse 1d nach ihren Eindrücken, die sich auf die Besuche von<br />
Horváths "Glaube Liebe Hoffnung" (in den Münchner Kammerspielen), Dürrenmatts "Der<br />
Besuch der alten Dame" und Thomas Manns " Buddenbrooks" (beides im Theater der Jugend<br />
in der Schauburg) stützten. Die wichtigsten Erfahrungen werden im Folgenden kurz<br />
zusammengefasst.<br />
Ganz allgemein ließ sich feststellen, dass unsere Studierenden ansonsten nicht sehr oft ins<br />
Theater gehen würden und dankbar sind <strong>für</strong> die diesbezüglichen Angebote an der Schule.<br />
Es lassen sich nämlich beispielsweise Anregungen <strong>für</strong> die Schullektüre mit nach Hause<br />
nehmen. Neben dem Theatererlebnis an sich schätzen die Studierenden aber auch den<br />
Kontakt zur eigenen Klasse und zu Mitschülern auch anderer Jahrgangsstufen, der sich so<br />
ergibt.<br />
Die wenigen negativen Erfahrungen, die gemacht wurden, waren sehr punktuell. So bemängelten<br />
mehrere Studierende die unbequemen Sitzpolster in den Theatern sowie die schlechte<br />
Qualität der Sichtverhältnisse, wenn Säulen den Blick auf die Bühne versperrten. Unverständnis<br />
herrschte darüber, dass zuspätkommenden Theaterbesuchern der Eintritt verweigert<br />
wurde und auch dass durch Rauchen auf der Bühne Hustenreiz bei den Zuschauern<br />
ausgelöst wurde. Ein Studierender kritisierte den abrupten Schluss durch einen Monolog bei<br />
den "Buddenbrooks" und hätte ein szenisches Ende besser gefunden.<br />
Viel Lob erhielten die Darsteller im "Besuch der alten Dame" <strong>für</strong> ihre Schauspielkunst, aber<br />
auch <strong>für</strong> ihre akrobatischen und gesanglichen Fähigkeiten, die in Kombination mit dem Bühnenumbau<br />
besonders gut zur Wirkung kamen. Ganz besonders waren unsere Studierenden<br />
von den Bühnenbildern beeindruckt, wobei ihnen einerseits die Symbolhaftigkeit auffiel<br />
(Wasser in "Glaube Liebe Hoffnung"), andererseits aber auch deutlich wurde, dass Theater<br />
immer durch die Kombination von vielen Einzelelementen wirkt, wozu beispielsweise auch<br />
Kostüme, Musik und Beleuchtung zählen.<br />
Bei der Schauspielerleistung wurde insbesondere der Hauptdarsteller in den "Buddenbrooks"<br />
hervorgehoben. Bei diesem Stück überzeugte die Studierenden vor allem, dass die<br />
puristische Inszenierung die einzelnen Charaktere viel mehr verdeutlicht als eine konventionelle.<br />
Es war auch neu <strong>für</strong> viele Studierende, durch Nachbesprechung zu erfahren, dass ein und<br />
dasselbe Drama ganz unterschiedlich rezipiert werden kann. Am deutlichsten war das bei<br />
dem Horváth-Stück "Glaube Liebe Hoffnung" der Fall. Hier wichen die Bewertungen der einzelnen<br />
Zuschauer sehr stark voneinander ab. Kein Problem waren <strong>für</strong> die Studierenden Auf-<br />
31
führungen ohne Pause, denn die zwei Stunden bei den "Buddenbrooks" vergingen wie im<br />
Flug, ehe die Inszenierung am Ende durch Herunterdrehen der Bühnenbeleuchtung "ausgeblendet"<br />
wurde.<br />
Fazit:<br />
Die meisten Studierenden des Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s <strong>für</strong> Berufstätige machen gern<br />
Gebrauch vom Angebot eines Theaterbesuchs. Sie sind beeindruckt davon, wie sehr die<br />
Bühnentechnik zum Verständnis des Dramentexts beitragen kann.<br />
(unter Federführung von Eva-Maria Sporrer zusammengestellt von Gabriele Rigó-Titze)<br />
4.1.5 Englisch<br />
4.1.5.1 1. Schulaufgabe Englisch: Free Text Production<br />
Try to describe a typical day in your job!<br />
A typical day in my work starts with cooking coffee for the boss. Then, if it is a good day,<br />
nice people come for examinations. If it isn't a good day, then people come with bad breath<br />
and stinky clothes. But I get used to it.<br />
It goes on with taking blood, the "search for a vein", analysing urine, writing electrocardiographics<br />
and taking blood pressures during the whole morning. The most important thing is<br />
being friendly and polite every second.<br />
What else do I have to do? Run to the phone – after the first ring it has to be answered. But<br />
it's really not so bad.<br />
I like my job. All the sick people are thankful. They enjoy talking about something different,<br />
not about feeling sad. For the five minutes when they are sitting next to me they can forget<br />
the fact that they are going to die ..... in the next 80 years or so.<br />
Irene Ludwig, 1d<br />
How I enjoyed my first school holidays<br />
COMPOSITION 1<br />
I was ill the first four days. I had a bad cold and preferred to sleep a lot. My friend visited me<br />
after work every evening and brought some fresh fruit with him. He prepared a nice tea and<br />
gave me a shoulder massage every time. This way I was able to stand my illness.<br />
After that I went shopping in Augsburg. I got a nice pair of jeans and a red pullover. On the<br />
last weekend I drove to Hüffler, Rhineland-Palatinate, where my parents live. I didn't tell<br />
them before, so they were very glad to see me. I met a lot of old friends and enjoyed the tea<br />
times with delicious cake.<br />
Gudrun Kartarius, 1d<br />
32
COMPOSITION 2<br />
During my first school holidays I had to work, but in the evenings I could do whatever I<br />
wanted.<br />
Monday: I love reading! After work I went home and made myself a cup of good tea,<br />
took my favourite book and read nearly until midnight.<br />
Tuesday: I invited some friends of mine to have dinner with me. I cooked for them. For a<br />
starter we had a salad with fresh mushrooms, then rice with vegetables. After<br />
that we had some coffee with chocolate cake.<br />
Wednesday: I took the train to Ulm. There I spent a wonderful day. I visited the "Ulmer<br />
Münster". It is gorgeous! Then I was shopping and drank a cup of coffee in a<br />
wonderful café.<br />
Thursday: Today I had to learn with my little brother because he is not good at maths.<br />
Friday, Saturday and Sunday: On these days I learnt for school.<br />
Tanja Köhler, 1d<br />
4.1.5.2 Advertising the AG<br />
Nach einem halben Jahr Englisch und der Beschäftigung mit dem Thema Werbung anhand<br />
der 5. Lektion aus unserem Lehrbuch betätigte sich die Klasse 1d als PR-Experten <strong>für</strong> das<br />
<strong>Abendgymnasium</strong>. In Gruppenarbeit entstanden die folgenden Ideen.<br />
RADIO COMMERCIAL<br />
by Somkan Akal, Daniela Jauß, Natalia Kerber<br />
Do you want to be successful? (soft music; text spoken<br />
Do you want to be your own boss? by a James Bond voice -<br />
Do you want to realise all your dreams? Sean Connery)<br />
BANG – sound of falling<br />
cardbox<br />
Then join us and start your career as soon as possible! Connery voice again<br />
The <strong>Abendgymnasium</strong> is the first step into your new future.<br />
ADVERTISEMENT IN A MAGAZINE<br />
by Ludwig Klatzka, Burim Qeriqi, Barbara Rosner, Rosemarie Weprich<br />
Colours: simply black and white<br />
Each of your evenings is boring?<br />
Just all of your friends are stupid?<br />
33
You want to escape the military?<br />
You search for a reason not to get a baby?<br />
You won't be challenged enough in the next 3 or 4 years?<br />
If you want to step up for a better career<br />
don't forget to join the <strong>Abendgymnasium</strong>!<br />
Step up on the ladder of success!<br />
34<br />
POSTER<br />
Push up your brain<br />
- get on our school train!<br />
- Do you want to change your working life or widen your horizons?<br />
- Would you like to get more professional and earn more money in future?<br />
- Do you want to make new friends and learn with them?<br />
- Do you want to know very interesting subjects and friendly, competent teachers with a<br />
lot of experience?<br />
There is only one possibility!<br />
Come to our information evenings and inform yourself under www.ag.musin.de!<br />
by Gudrun Kartarius, Stephan Schneider, Manuela van der Lieth
TV COMMERCIAL<br />
by Tanja Köhler, Hannan Klein, Christian Trummer<br />
We advertise the AG on TV with the slogan BOOST YOUR BRAIN.<br />
When the spot starts the letters AG are on the right-hand side, on top of the screen (in the<br />
corner) like a channel sign and remain till the end.<br />
In the beginning the colours of the commercial are dark and gloomy, at the end they are mul-<br />
ticoloured and happy.<br />
You can see A, a really fat man, sitting on his couch while watching "Who Will Be A Million-<br />
aire".<br />
He is wondering all the time why the candidates know so much ..... (of course because of<br />
their good education). The candidate was only answering the 500-€ question, but this is al-<br />
ready too much for the fat man.<br />
After a while he turns over his TV magazine looking for the next boring TV show. Suddenly<br />
he finds a leaflet about the Munich <strong>Abendgymnasium</strong> in it, reads it and decides to give up<br />
his lazy lifestyle to spend his evenings at the AG in a more useful way.<br />
..... ONE YEAR LATER .....<br />
Now B, his brother, is watching the "Who Will Be A Millionaire" show, and he sees his little<br />
lazy brother in this show, who answers the 1-million-euro question correctly.<br />
B is very happy about his brother's success there, because he himself attended the<br />
<strong>Abendgymnasium</strong>, too, and today he is a great architect. And all his life B was very upset<br />
about his little brother's situation.<br />
So: DON'T GIVE YOURSELF UP,<br />
BOOST YOUR BRAIN !<br />
The letters AG in the screen corner get bigger and bigger, until they are in the focus. Letters<br />
and brothers dance around happily.<br />
35
4.1.5.3 Agony Aunt<br />
Letter 1<br />
The problem:<br />
Dear Pam,<br />
I'm Harriet, 17 years old and I'm so frustrated that I don't know what to do. Last summer I<br />
finished school and half a year ago I got my first real job. I was really lucky and thought that<br />
this would change my life (in a positive way)! But instead of this, the really hard part began.<br />
Now I have to get up on time every day. I have to be smart. I have to wear a work uniform. I<br />
have to be polite to all people, even when I don't agree with them. I'm always more tired than<br />
I've been for ages and the money I earn there isn't worth the effort I have to put in. And the<br />
worst part is that people expect you to be thankful for having a job.<br />
Pam, please tell me if this will go on the rest of my life!? I can't understand why people are<br />
happy at work! Please help me to disclose this secret.<br />
The answers:<br />
1.<br />
Dear Harriet,<br />
I completely understand you. Sometimes working is really hard. But it doesn't have to be like<br />
this all the time.<br />
When you are tired, try to go to bed earlier. Every person needs a different amount of sleep,<br />
so take what you need!<br />
Being polite to other people isn't so bad, is it? What would it be like if everyone started to<br />
shout when they don't like anything? You can give your opinion in a polite way and it's okay.<br />
And if you really don't like your current job, perhaps you can learn a new one which suits you<br />
better.<br />
All the best!<br />
2.<br />
Dear Harriet,<br />
You crossed the bridge from childhood and youth to adult life. That means more freedom<br />
and autonomy but also a lot of duties and efficiency to you. You shouldn't complain about<br />
the job circumstances because they are usual. I am sorry about your low salary.<br />
If you can find better job conditions don't hesitate to change your place of work. Train your<br />
skills and be proud of every kind of success at work.<br />
Take every day as a challenge – especially when it seems to be hard – and look at the bright<br />
side of life!<br />
Hold on!<br />
Yours,<br />
Pamela<br />
36
Letter 2<br />
The problem<br />
Dear Pamela,<br />
I have got a problem about my spare time: I don't know how I can spend it.<br />
Every day I work from 9 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. After work I go<br />
to an evening school in Giesing, which is very nice, but at weekends I am free and I don't<br />
know what I can do and how I can spend my free time. Please write back and give me some<br />
advice.<br />
Yours sincerely,<br />
XYZ<br />
The answers<br />
1.<br />
Dear XYZ,<br />
I can tell from your letter that you have got a problem. You know your problem is solvable.<br />
You can contact your friend. If you haven't any friend, you have to get to know someone or<br />
you could meet your classmates and learn with them and you could do sport like swimming,<br />
jogging, etc. I wish you good luck!<br />
Pamela<br />
2.<br />
Dear XYZ,<br />
Thanks for your nowadays unusual letter because most of the people who write to me complain<br />
about too short and busy weekends. You want me to give you some advice about<br />
spending your spare-time at weekends, but you haven't told me about your hobbies or interests.<br />
I am sure you have some, but I guess you are too shy to talk about them. I think that's<br />
your problem and makes you feel lonely.<br />
So you should look around and find some friends in your neighbourhood or evening school.<br />
Trust your intuition in choosing people to talk to!<br />
Open your heart and do the first step from isolation to friendship. You won't regret it.<br />
Best wishes!<br />
Yours,<br />
Pamela<br />
Letter 3<br />
The problem<br />
Dear Pamela,<br />
I am so disappointed because everything seems to collapse. My boss says to me, "Work<br />
hard till you have finished all of your work”. But I have no time in the evening. My friends tell<br />
me that I have to come on and go out with them. But if I did everything that my boss and my<br />
friends say I would not have enough free time for myself. Because I also want to pass the<br />
37
<strong>Abendgymnasium</strong> and I don't know what will collapse first: my work, my friends or my studying<br />
at school.<br />
Please tell me how I can manage all this perfectly!<br />
?<br />
The answer<br />
Dear ?,<br />
I know from your letter that you are under high pressure and every working and school day<br />
is very stressful for you. First you should keep your body healthy, e.g. by sleeping enough or<br />
eating a lot of fruits and vegetables. Then you ought to meditate for 15 minutes every morning<br />
and evening. That will calm you down and give you the right power to cope with this most<br />
difficult situation,<br />
For school and at work you have to organise well and set your priorities. Stay polite and<br />
friendly when you have to say No or to apologise and ask for help whenever you can. I don't<br />
think you can manage all of this perfectly because nobody is omnipotent.<br />
So do your very best and let God do the rest of it.<br />
Yours,<br />
Pamela<br />
Letter 4<br />
The problem<br />
Dear Pamela,<br />
In summer I will turn my full-time job into a part-time job because I need more time to learn<br />
for the <strong>Abendgymnasium</strong>, to meet friends and to sleep enough. It is limited to three years<br />
and one month. Because I will only earn nearly half of the money then I tried to save 600<br />
euros for a kind of training in the last month.<br />
But it didn't work. So I am very frustrated now. I did my very best, e.g. I bought less expensive<br />
food or clothes and I rarely went out with friends, but the saving result was only 200<br />
euros. How will I manage the future when I spend so much money on living? My heart beats<br />
very fast when I think about running into debts. I am also frightened of higher taxes and a<br />
higher rent.<br />
What can I do? Can you give me some advice to cope with this situation?<br />
Yours,<br />
Gudrun<br />
The answer<br />
Dear Gudrun,<br />
Calm down, please! I am sure you will find a way to help yourself.<br />
First you should have a look at your bank deposits. This may help you to bridge the first<br />
year. Afterwards you can think about selling your car if you have one and don't need it for<br />
work. Before you ask the bank to lend you thousands of euros you should ask your parents<br />
or friends first because they will probably give the money to you without any interest.<br />
38
On the other hand you can look around for a 400-euro job at the weekend or a cheaper flat.<br />
Don't drive yourself crazy and stay healthy.<br />
All the best,<br />
Pamela<br />
4.1.5.4 "The Picture of Dorian Gray"<br />
Nur zu gerne machen Studierende und Lehrkräfte am <strong>Abendgymnasium</strong> von der Möglichkeit<br />
Gebrauch, auch im Unterricht der unteren Klassen Lektüre zu besprechen. Das Angebot an<br />
"Easy Readers" ist erfreulich groß und bietet <strong>für</strong> jeden Geschmack etwas. Am Ende des<br />
letzten Schuljahrs entschloss sich die Klasse 1b dazu, eine vereinfachte Fassung von Oscar<br />
Wildes Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" auf Englisch zu lesen, und war während der<br />
Lektüre höchst konzentriert bei der Sache.<br />
Das folgende Beispiel illustriert, wie wir mit dem Text umgingen. Die Aufgabe der Studierenden<br />
bestand darin, sich in Partnerarbeit zu überlegen, welche schrecklichen Gerüchte über<br />
den Titelhelden aufgrund seiner nie vergehenden Schönheit und seines unmoralischen Lebenswandels<br />
im Umlauf sein könnten. Die Resultate wurden schriftlich fixiert, die Ergebnisse<br />
von der Lehrkraft korrigiert und zu einem Arbeitsblatt zusammengestellt.<br />
"Many years passed. Yet the wonderful beauty [...] stayed with Dorian Gray. Even those who<br />
had heard terrible rumours against him, could not believe them when they met him."<br />
("The Picture of Dorian Gray", Penguin Reader, Level 4)<br />
What could those rumours be like?<br />
One of the rumours is that Dorian Gray fell in love with Lord Henry. And that was the<br />
reason for Sybil Vane's, his fiancée's, death. She came too close to Dorian. And so he<br />
killed her himself.<br />
Some people think that he has a magical item that lets him stay young.<br />
Another rumour is that Dorian Gray eats little children on every full moon to keep his<br />
beauty alive.<br />
Others believe that he gave his soul to the devil and he stays in connection with him.<br />
It is also rumoured that Dorian Gray is a black magician, who influences the people<br />
around him for his own advantage.<br />
It is also said that he bought a magical cream from a voodoo priest that keeps him young<br />
and beautiful.<br />
Some people think that Dorian Gray is Count Dracula's brother because he is very<br />
charming and his beauty never changes.<br />
39
Für ihre Mitarbeit bedanke ich mich bei Anja Blümel, Petra Dolenc, Karin Frik, Stephanie<br />
Kneifel, Matthias Meyer, Brigitte Richter, Djamila Suero Mercado und Sebastian Wildmoser<br />
(1b, Schuljahr 2005/06)<br />
4.1.5.5 Cars<br />
Composition 1<br />
My first car was a red Ford Fiesta. I took my driving test 14 years ago. Actually I had a lot of<br />
lessons. It was very difficult to reverse the car. My driving instructor had to explain a few<br />
details up to ten times! I think I drove him crazy.<br />
A pupil of my driving instructor had an accident. He crashed into a tree and died. He was a<br />
speed freak and he didn't like the highway code. His dream was to work as a racing driver.<br />
He liked Michael Schumacher very much.<br />
My second car was a white VW Polo. The car was very old and I had to call the ADAC very<br />
often. By the way, I was a gold member!<br />
I have not been to a car showroom yet. I bought my cars from a friend. I must travel by public<br />
transport at the moment and I have to earn a lot of money for my dream car!<br />
eine Studierende, 1d<br />
Composition 2<br />
Hi,<br />
I'm Burim and I work at a garage. I think that my job is good but it is nothing for women.<br />
Every day I have to repair different cars which don't work as they should, but now in summer<br />
time we have to change tyres all day long. I think it isn't very good when you must do the<br />
same work the whole day, but our company has three apprentices who do the job very well.<br />
Well, I would like to give you some information about tyre changing: first you have to lift the<br />
car, the next step is that you must take off the tyres and put on the summer tyres, check the<br />
air and fix the nuts. After all this you must lower the car.<br />
In this way you can change the tyres step by step if you like to do it yourself. My opinion is<br />
that if you can do it yourself you can save a lot of money, but don't start to change the motor<br />
because it will be more expensive than you think!<br />
I can also give you some information about cars if you would like to buy one. Should you like<br />
to drive in the mountains then you have to buy an off-road car, and if you like driving fast you<br />
must look for a sports-car. Or maybe you have children, then you must buy a hatchback.<br />
I think you know more about cars now.<br />
Yours sincerely,<br />
Burim Qeriqi, 1d<br />
40
Composition 3<br />
So, you want a story about cars? Okay, you'll get a little story.<br />
A car is a vehicle that takes you from one place to another place. It doesn't matter what the<br />
poor car thinks. Although it could. And believe me, it can and it does.<br />
Of course the cars will never talk to anybody. The reason is clear. They're shy and so they<br />
are mute for the rest of their days, going from point A to point B. Every day.<br />
You think that is nonsense? I'm crazy? If people treat their cars well then they will have cars<br />
which will never get broken. But if they don't treat them well they will get broken soon. Try it<br />
out and you will see! Believe me!<br />
Maybe one day will come when nobody will discriminate against cars any more!<br />
Stephan Schneider, 1d<br />
4.1.6 Latein<br />
Römische Politik<br />
Auch am <strong>Abendgymnasium</strong> werden im Lateinunterricht nicht nur Wortschatz, Grammatik<br />
und Übersetzungstechniken gelehrt, sondern es geht auch um Hintergrundwissen zum antiken<br />
Rom. In Schulaufgaben wird dieses Wissen regelmäßig in den sogenannten Zusatzfragen<br />
abgeprüft.<br />
Die folgenden Fragen stammen aus einer 3. Lateinschulaufgabe. Nach Übersetzung sowie<br />
Fragen zu Deklination ("nox mala – noctem malam – noctibus malis") und Konjugation ("sunt<br />
– fuerunt – fuerant") ging es um drei Zusatzfragen. Die Antworten darauf aus einer Arbeit<br />
zeugen von den soliden Kenntnissen der Studierenden und sind ein beredtes Zeugnis <strong>für</strong><br />
den Lateinunterricht an unserer Schule.<br />
1. Durch welche Staatsform wurde das Königtum nach der Revolution von 509 v.Chr. in<br />
Rom abgelöst?<br />
2. Worin lag die Schwäche der Monarchie?<br />
3. Worauf beruhten Stärke und Stabilität der neuen Staatsform?<br />
ad 1 Rom wurde 509 v.Chr. "Republik" mit entsprechender Gewaltenteilung.<br />
ad 2 Die Schwäche der Monarchie lag in der Einzelherrschaft (griechisch: monos = einer,<br />
archein = herrschen) und mangelhaften Kontrolle dieser Person.<br />
In der Regel herrschte ein König, der, wenn er charakterlich entartete, dem Volk<br />
mehr schadete als nützte.<br />
Ein Beispiel hier<strong>für</strong> ist Tarquinius Superbus und dessen Sohn. Beide schreckten vor<br />
Willkür und Verletzung anderer Menschen nicht zurück (rex = dominus = tyrannus).<br />
41
42<br />
Die Geschichtsschreiber kritisierten aber auch oft die fehlende Regierungskompetenz<br />
(mangelhafter IQ und EQ) dieser Monarchen.<br />
ad 3 Die folgenden drei Gewalten kontrollierten sich gegenseitig:<br />
a) 2 Konsuln wurden <strong>für</strong> ein Jahr gewählt. – Diese kontrollierten sich gegenseitig<br />
und stellten das "monarchische“ Element dar.<br />
b) Der Senat oder Ältestenrat regierte mit. Dieser bestand in der Regel aus<br />
ehemaligen Konsuln, also weisen und erfahrenen Leuten, die sich mit den Staatsgeschäften<br />
auskannten.<br />
c) Als dritte Gewalt regierte die Volksversammlung mit, das so genannte plebiszitäre<br />
Element (vergleiche auch die Entstehung der Demokratie im antiken Griechenland!).<br />
Keine und keiner war auf Lebenszeit mit der vollen Macht ausgestattet. So war eine Willkürherrschaft,<br />
die nicht dem Volk dient, ausgeschlossen. Die Staatsform der Republik funktionierte<br />
ca. fünf Jahrhunderte lang gut.<br />
Die Konsuln waren zu zweit und nur <strong>für</strong> ein Jahr begrenzt an der Macht. Der Senat hatte<br />
Beratungsfunktion. Es wurden vor Entscheidungen Diskurse und Diskussionen geführt, was<br />
das Beste sei. Die Volksversammlung brachte schließlich den breiten Basiswillen ein.<br />
Gudrun Kartarius, 1d<br />
4.1.7 Französisch<br />
4.1.7.1 Une vidéo sur notre école<br />
3. Schulaufgabe aus dem Französischen – Production de texte:<br />
Ecrivez 100 mots environ:<br />
Sie schicken Ihren Brieffreunden in Paris ein Video über Ihr Schulleben am AG und legen<br />
ein Begleitschreiben bei. Sie gehen darin kurz auf deren letzten Brief ein und kommen dann<br />
auf das Video zu sprechen. Sie erläutern kurz zwei Situationen, die sich an unterschiedlichen<br />
Orten der Schule abspielen, und stellen einer Person eine Frage, die diese beantwortet.<br />
Sie schließen den Brief mit einer Frage an Ihre Brieffreunde.<br />
Denken Sie an die Briefform (Anrede, Schlussformel)!<br />
Lettre 1<br />
Chère Florence, salut!<br />
Comment ça va? Merci beaucoup pour ta lettre. Nous avons aussi une vidéo sur notre<br />
école. Regardez la vidéo.<br />
C'est notre salle quand nous faisons du français. Nous faisons du français depuis six mois.<br />
Voilà la cour. Nous sommes là quand nous n'avons pas de cours. Voilà, ce sont des élèves.<br />
Je demande à un garçon: «Tu es d'où?» Il dit qu'il est de France. C'est une surprise!<br />
Nous préparons aussi une brochure pour vous. Comment est-ce que vous trouvez ça?<br />
A bientôt!<br />
La classe 1f<br />
Deniz Demirel
Lettre 2<br />
Chers amis, salut!<br />
Merci pour votre lettre. Vous posez des questions sur notre collège. J'envoie une vidéo pour<br />
vous. Je pense que ça va être intéressant. Vous allez bien rigoler!<br />
Alice est toujours malade quand nous écrivons une interrogation. Elle est à l'infirmerie. Je<br />
pense que l'interro de maths rend Alice malade!<br />
Nous sommes en salle de permanence quand un prof n'est pas là. Là, on écrit, on lit, on fait<br />
des devoirs. Et un surveillant demande toujours si nous travaillons. C'est le stress.<br />
Pendant la récré nous sommes dans la cour du collège. A la vidéo, je demande à Florence<br />
et à Frédéric: «Qu'est-ce que vous faites?» Elle répond: «Je montre mes devoirs à Frédéric.»<br />
Alors, regardez la vidéo!<br />
Est-ce que vous allez écrire une réponse? J'attends votre lettre.<br />
A bientôt!<br />
Susanne Kuchar, 1c<br />
Lettre 3<br />
Chers amis,<br />
Merci pour votre lettre. Voilà notre vidéo que vous avez demandée. Elle est sur notre collège<br />
à Munich. Nous sommes cinq élèves dans la classe de français. Et voilà Mme Wlasak-<br />
Schulz, notre prof. Elle demande toujours si on travaille. Nous avons cinq heures de cours<br />
chaque jour.<br />
Il y a aussi un self dans notre école, mais le soir, il est toujours fermé. Il y a aussi un club<br />
théâtre, mais je ne l'aime pas beaucoup.<br />
Voilà Peter. Il aime les histoires de science-fiction. Et vous? Vous aimez aussi les histoires?<br />
A bientôt!<br />
La classe 1c<br />
Benjamin Kilgus<br />
4.1.7.2 J'attends les vacances!<br />
Ce sont seulement deux jours jusqu'aux vacances. C'est super parce que j'ai besoin d'une<br />
pause de l'école. Il y a toujours beaucoup de devoirs et il faut toujours travailler. Le matin je<br />
vais d'abord au boulot et après je vais à l'école. Devant l'école il y a une cour où les élèves<br />
discutent et fument. Quand il est six heures moins cinq les jeunes vont à leurs cours. Les<br />
profs nous demandent si nous avons fait nos devoirs. On répond, qu'on a fait ses devoirs. A<br />
sept heures vingt-cinq ça sonne. C'est la récré. Pendant la récré, les gens quittent la classe<br />
et ils vont acheter quelque chose à manger ou ils restent dans leur classe et préparent leur<br />
devoirs pour les autres matières. A neuf heures cinq c'est la fin des cours. Les élèves vont à<br />
la maison ou on va au café ensembl<br />
43
Pendant mes vacances je vais aller en Italie avec mes copains. L'endroit où on va aller est<br />
tout près de la ville de Naples. Je trouve que Naples est une ville très intéressante. Nous<br />
allons visiter le volcan Vésuve et l'ancienne ville de Pompéi. Et bien sûr, nous allons jouer<br />
au beach-volley. On va souvent nager dans la mer et on va aller au lit tard le soir. Je n'ai pas<br />
eu de vacances en <strong>2006</strong> parce que je n'ai pas eu d'argent. Alors, j'ai vraiment besoin de<br />
vacances maintenant.<br />
Edyta Czubernat, 1e<br />
Salut!<br />
Je suis Anne et j'ai vingt-deux ans. Mon petit fils a deux ans et je l'emmène toujours à l'école<br />
avec moi. Quand j'ai cours avec ma classe, il est dans la crèche. Il y a deux gens qui gardent<br />
les enfants. Là, mon fils peut jouer avec les amis.<br />
Plus tard, à neuf heures cinq, j'arrive et il me raconte ce qu'il a fait pendant la soirée. A dix<br />
heures moins le quart nous rentrons à la maison. Là, nous mangeons quelque chose et<br />
après, je le mets au lit. Puh, il est déjà minuit maintenant et moi aussi, je vais au lit! Mon fils<br />
dort jusqu'à dix heures du matin, c'est bien! Puis, nous prenons le petit déjeuner et après,<br />
nous allons au terrain de jeux.<br />
Ce n'est pas toujours simple, mais c'est vraiment bien avec un enfant.<br />
Anne Scheuerer, 1e<br />
Je m'appelle Marianna Zihl et j'aime la langue française et j'aime aussi aller à l'école. Je dois<br />
faire les devoirs le soir ou le week-end. Pendant la journée je travaille jusqu'à quatre heures<br />
et demie. Puis, vite, vite, à l'école jusqu'à neuf heures! Moi, j'aime aussi faire du sport et je<br />
prends toujours la bicyclette pour aller au travail.<br />
Dans deux mois il y a les vacances d'été et je vais rendre visite à mes parents qui vivent<br />
dans un joli village. Je vais passer le premier week-end dans les montagnes et après je vais<br />
rester quelques jours chez mes parents.<br />
Eh oui, les vacances peuvent venir!<br />
Marianna Zihl, 1e<br />
44
4.2 Aus den 2. Klassen<br />
4.2.1 Deutsch<br />
"Werther" als Bestseller<br />
Der "Werther" war Goethes "Bestseller" und machte ihn mit erst 25 Jahren schnell berühmt<br />
über die deutschen Sprachgrenzen hinaus.<br />
Überlegen Sie, was diesen Roman so erfolgreich und publikumswirksam gemacht haben<br />
könnte, warum sich Goethe in späteren Jahren <strong>für</strong> diesen Roman und seinen Erfolg fast<br />
genierte und warum "Werther" heute nicht mehr den Erfolg von damals haben kann!<br />
(Textverweise beziehen sich auf die Ausgabe der "Hamburger Lesehefte".)<br />
GLIEDERUNG<br />
1. Vorstellung des Textes und Hinführung zum Thema<br />
2. Der Erfolg des "Werther"<br />
2.1 Gründe <strong>für</strong> den damaligen Erfolg<br />
2.1.1 Zeitstimmung in Deutschland<br />
2.1.2 Romanschriftstellerei in Deutschland im 18. Jh.<br />
2.1.3 Das Besondere an Goethes "Werther"<br />
2.1.4 Reaktionen der Leserschaft<br />
2.1.4.1 Begeisterung bei der Jugend<br />
2.1.4.2 Entsetzen bei Bürgertum und Kirche<br />
2.2 Gründe, warum sich Goethe später <strong>für</strong> den Roman genierte<br />
2.2.1 Vermeintliche Authentizität<br />
2.2.2 Fehlende Darstellung der Irrtümer<br />
2.2.3 Abgeschlossene Schaffensphase<br />
2.3 Ein Erfolg in der heutigen Zeit<br />
2.3.1 Gründe, die einen Erfolg in der heutigen Zeit ermöglichen<br />
2.3.2 Gründe, die gegen einen Erfolg in der heutigen Zeit sprechen<br />
3. Zeitgemäße Literatur in veralteter Sprache<br />
AUSFÜHRUNG<br />
In seinem 1772 verfassten Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers" beschreibt Goethe<br />
die selbstzerstörerische Liebe eines jungen Mannes zu einer bereits vergebenen Frau. Die<br />
unerfüllte Leidenschaft Werthers zu Lotte beendet dieser mit seinem Selbstmord. Im Folgenden<br />
wird dargestellt, worauf der große Erfolg des Werkes zur damaligen Zeit vermutlich<br />
gründete, welche die möglichen Gründe Goethes waren, sich später <strong>für</strong> sein Werk zu genieren,<br />
und ob dieser Roman seinen Erfolg in der heutigen Zeit wiederholen könnte.<br />
"Die Leiden des jungen Werthers" fand in der damaligen Zeit eine große Leserschaft, sowohl<br />
in Deutschland als auch über dessen Grenzen hinaus. Während die einen den Roman<br />
verschlangen und weiterempfahlen, fühlten sich andere Bevölkerungsteile von dem Inhalt<br />
brüskiert, und ihre Kritik steigerte die Bekanntheit des Werkes weiter. Neutralität gegenüber<br />
45
dem Roman schien nahezu ausgeschlossen. Woran lag das, warum genierte sich Goethe<br />
später <strong>für</strong> sein Werk und: Wäre der Erfolg heute auch möglich?<br />
Goethes Roman traf die deutsche Gesellschaft zu einer Zeit, als junge Männer begannen,<br />
die Vernunft der Aufklärung zu kritisieren und mehr Beachtung der Gefühle einzufordern.<br />
Die damals aktuelle Romanschriftstellerei wurde diesem Anspruch nicht gerecht. Dagegen<br />
trafen Form und Inhalt von Goethes "Werther" genau den Zeitgeist, und der starke Gegensatz<br />
schürte sowohl den Erfolg als auch die kritische Auseinandersetzung.<br />
In der Zeit der Aufklärung wurde vor allem an die menschliche Vernunft appelliert. Es galt,<br />
alle Dinge objektiv zu sehen und vernünftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Werther gesteht<br />
im Text auch zu, dass "[e]in Mensch, der sich nach ihnen [den aufgestellten Regeln] bildet,<br />
[...] nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes" hervorbringe (S. 12 Mitte). Die jungen Menschen<br />
in Deutschland vermissen indes die Anerkennung von Gefühlen. Diese Anhänger der<br />
aufkeimenden Epoche des Sturm und Drang sehen den Menschen als Abbild Gottes und die<br />
Beschränkung nur auf seine Vernunft als dem Menschen nicht gerecht werdend (S. 7 oben).<br />
Die damaligen "Erzeugnisse der deutschen Romanschriftstellerei waren in der Zeit, als 'Werther'<br />
erschien, noch recht dürftig (S. 115 oben). Während die Lyrik bereits auf den Wunsch<br />
nach Darstellung von Gefühlen eingegangen war, "war der Roman unbedeutendes Unterhaltungsschrifttum".<br />
Goethes "Werther" traf eine Lücke und schuf den "neuzeitlichen deutschen<br />
Roman" (S. 115 oben).<br />
Nicht nur, dass Goethe den Wunsch nach Gefühlen aufnahm, wählte er mit dem Briefroman<br />
eine Form, die den Gefühlen noch mehr Eindruck verlieh, da sie als eine Einbeziehung in<br />
einen authentischen Leidensweg empfunden wurde. Da nur ein Briefschreiber vorhanden<br />
war, wurde dem Leser die Möglichkeit gegeben, sich nicht nur als unbeteiligter Mitleser einer<br />
Korrespondenz, sondern als direkt einbezogener Gesprächspartner zu empfinden, dem die<br />
innersten Gefühle eines Menschen offenbart werden. Die tatsächlichen Lebensumstände<br />
Goethes kurz vor Erstellung des Romans verstärkten zudem den Eindruck der Authentizität.<br />
Die junge Generation war von dieser Gefühlsoffenbarung stark eingenommen. Der dargestellte<br />
Konflikt zwischen den eigenen Wünschen, der Liebe zu Lotte, und den Konventionen,<br />
den Moralvorstellungen, war ihnen aus ihrem eigenen Leben bekannt. Sie wehrten sich gegen<br />
die Standesgesellschaft und forderten Toleranz und Anerkennung aller Menschen im<br />
gleichen Maße (S. 8, Z. 18 f., Z. 24-26). Die Natur sollte nicht, wie damals Mode, zurecht<br />
geschnitten werden, sondern frei wachsen können (S. 6, Z. 21-22). Diese und weitere Forderungen<br />
spiegelte Goethe in seinem Roman wider und gewann die Jugend <strong>für</strong> sich.<br />
Die Bürgerschaft dagegen war in großen Teilen entsetzt. Die Darstellung des Suizids als<br />
Mittel zur Beendigung einer vermeintlichen Krankheit (S. 39 f.: Diskussion mit Albert) oder<br />
sogar als angemessenes Mittel, wenn einen das menschliche Dasein auf Erden zu sehr<br />
schmerzt (S. 11, Z. 16-18), war mit den damaligen Wertvorstellungen nicht in Einklang zu<br />
bringen. Insbesondere die christliche Kirche reagierte sehr heftig und konnte ein teilweises<br />
Verbot erreichen (S. 109 unten).<br />
Sowohl der Zuspruch der Jugend als auch das Entsetzen des Bürgertums und der Kirche<br />
sorgten <strong>für</strong> eine Popularitätssteigerung und den großen Erfolg des Werkes. Dass Goethe<br />
sich später <strong>für</strong> seinen Roman genierte, könnte an der vermuteten Authentizität, der fehlenden<br />
Darstellung von "Irrtümern" sowie am Abschluss dieser Schaffensphase liegen.<br />
Die Erlebnisse Goethes vor der Erstellung des "Werthers", die Heirat einer befreundeten<br />
Dame und der Selbstmord eines Bekannten aus unerwiderter Liebe zu einer verlobten Frau<br />
(S. 109 f.) ließen die Leserschaft Authentizität in der Geschichte wähnen. Die Vermutung<br />
liegt nahe, dass Goethe damit sein eigenes aufgewühltes Gefühlsleben in den Griff bekom-<br />
46
men wollte. Wenn dem tatsächlich so war, dann hat Goethe sein Innerstes mit allen Lesern<br />
geteilt. Jahre später, mit Abstand zu den Ereignissen, wäre er wohl eine Ausnahme, wenn er<br />
sich deswegen nicht genierte.<br />
Lessing und die Gräfin Auguste zu Stollberg mahnten in Briefen an Goethe eine objektivere<br />
Darstellung mit Aufzeigen der menschlichen Irrtümer Werthers an (S. 110 Mitte). Auch hier<br />
kann mit einigem Abstand zum Werk eine Zustimmung Goethes vermutet werden, die den<br />
Mangel anerkennt und als eigenes Defizit wertet.<br />
Darüber hinaus war die Epoche des Sturm und Drang nur eine kurze Phase im Schaffen<br />
Goethes, die er im Nachhinein vielleicht mit ganz anderen Augen gesehen hat. Da<strong>für</strong> spräche<br />
auch die Überarbeitung 1787 durch seine Hand, die einiges anders darstellt (S. 112<br />
Mitte).<br />
Unter Berücksichtigung der aktuellen Affinität zu Menschenschicksalen scheint auch ein<br />
Erfolg des Roman in der heutigen Zeit nicht ganz ausgeschlossen. Insbesondere das Fernsehen<br />
bietet immer mehr die vermeintliche Möglichkeit, am Schicksal anderer teilzunehmen.<br />
Was mit "Big Brother" angefangen hat und über Dokumentationen zum Hausbau sowie<br />
Sendungen mit rekonstruierter Umgebung in früherer Zeit weitergeht, hat heute eine große<br />
Anhängerschaft. Hinzu kommt die vermehrte Berichterstattung über tatsächliche Gräueltaten<br />
an geliebten Personen, die offensichtlich vom Publikum mit Interesse aufgenommen werden.<br />
Goethe bedient sich allerdings nach heutigem Maßstab einer veralteten Sprache, die nicht<br />
allzu leicht verdaulich ist. Hinzu kommen die gewandelten Moralvorstellungen, die heute<br />
ganz andere Lösungen anböten und Werthers Verhalten nach heutigen Gesichtspunkten<br />
schwer nachvollziehbar machen.<br />
Insgesamt könnte man Goethes "Werther" als durchaus zeitgemäße Literatur in veralteter<br />
Sprache ansehen. Ein Erfolg in der heutigen Zeit scheint nach entsprechender Überarbeitung<br />
nicht ausgeschlossen.<br />
Natalie Peters, 2b<br />
4.2.2 Englisch<br />
Fast Food or Slow Food?<br />
Composition (3. Schulaufgabe Englisch, 2a, Frau Jakob)<br />
Imagine having a chance to interview Jamie Oliver about food and cooking in Britain. Ask<br />
four questions and present four answers!<br />
Interview 1<br />
Interviewer: What was your reason for fighting for better food at schools?<br />
Jamie Oliver: I think it is no problem to serve good and healthy food at schools. We<br />
only have to think about what is sensible. People do the things they<br />
are used to. So we just have to change our minds. Forty percent of our<br />
children are overweight. This is a serious health problem.<br />
Interviewer: Do you think we can force our children to change their habits?<br />
47
Jamie Oliver: Well. If we offer our children only fat, they haven't got a choice. This<br />
way they are forced to eat unhealthy food. I think we must give them a<br />
wide range of menus. But they should all be organic.<br />
Interviewer: Do you think that fast food should be forbidden?<br />
Jamie Oliver: Oh yes! I think eating is the most important thing in life because it<br />
keeps you alive. So why hurry? But the name "fast food" expresses<br />
exactly this.<br />
Interviewer: What are your plans for the future?<br />
Jamie Oliver: I want society to be more health-conscious and I'm going to set up a<br />
company as big as McDonald's. Not only children but the whole population<br />
should be able to enjoy healthy food!<br />
Matthias Meyer, 2a<br />
Interview 2<br />
Interviewer: Mr Oliver, I have all your books at home and I really like the way you<br />
cook. Do you also like it sometimes when somebody else is cooking<br />
for you?<br />
Jamie Oliver: Well, yes, from time to time it's nice. But I need to see how they cook.<br />
What they use, how they prepare it and so on. And very often my<br />
friends give up and leave me doing the rest.<br />
Interviewer: Last year you shocked a lot of parents because of your plans of<br />
changing the diet in school cafeterias. Do you still think it was a good<br />
idea?<br />
Jamie Oliver: Yes, of course! In my opinion British kids are too fat. And the food at<br />
school cafeterias is one reason for that. I think my advice will really be<br />
successful but it still needs a little time.<br />
Interviewer: Well, then we'll talk about that again in a few years' time. What are<br />
your plans for the future?<br />
Jamie Oliver: I want to write a diet-book for pregnant women, young mothers and<br />
their babies. I've never seen anything like that so far and I think it's<br />
really important to show them how to eat in a health-conscious way.<br />
Interviewer: Oh, that's a good idea! And what about you? When are you going to<br />
get married?<br />
Jamie Oliver: Oh, not too soon. My career comes first in my life. I love my job. And<br />
I've got a lot of friends. But I'm a businessman and I have rarely got<br />
time. So it's not easy to find the right woman.<br />
Djamila Suero Mercado, 2a<br />
48
Interview 3<br />
Interviewer: Jamie Oliver, what kind of a revolution is this that have you started<br />
with your famous TV show?<br />
Jamie Oliver: Oh well. I started my own TV show because I saw that most of the<br />
British people don't know how to cook meals, which are very tasty and<br />
delicious as well. You know, most of the British are overweight, especially<br />
the children. I think this is the fault of the parents, so I decided to<br />
teach them how to cook in a better way. They should learn to take<br />
more responsibility. And now, you see, in many parts of Europe some<br />
of my followers are doing the same. And it is working ...<br />
Interviewer: Do you think you can change the situation by just cooking for the<br />
mothers, who watch you every night?<br />
Jamie Oliver: Oh yes, of course! There aren't just mothers watching me ..... I don't<br />
just "cook". I love cooking. I tell them what is good and what you can<br />
use for what purpose and I celebrate cooking! I live cooking! It should<br />
be fun, you should enjoy it, and cooking should be like a lifestyle,<br />
should be a lifestyle! Cooking and eating should be enjoyed. It should<br />
be relaxing ..... And once you have got that feeling you'll cook for yourself,<br />
for your family and you won't go out to eat unhealthy stuff at fast<br />
food restaurants.<br />
Interviewer: You mentioned that shows like yours have spread in Europe. What did<br />
you mean by that?<br />
Jamie Oliver: Oh, you must know that! You are from Germany! You should know my<br />
colleague Tim Mälzer. He has also got his own show on German television.<br />
And he told me that his show is a real success..... I've also<br />
heard of other European countries in which my show is presented with<br />
subtitles. You've just got to switch on your TV in the morning and<br />
watch a little bit, and you'll see there are a lot of shows like mine.<br />
Whenever I've got time myself, I watch them too, but don't tell anyone<br />
.....<br />
Interviewer: Why is it so important to you to look for a life which is healthier?<br />
Jamie Oliver: Why is it so important? That's an easy question. It must go "click" in<br />
your head! You must realise that you've got to change your habits.<br />
You must want to start a healthier life and you must trust yourself and<br />
then you can try it. But you must really want it, that's all, and, of<br />
course, you must learn to give up things which are not good for you.<br />
Taranom Sharif, 2a<br />
49
4.2.3 Latein<br />
Ausstellung Herculaneum<br />
„Wenn gleich Schauer mich fasst und Entsetzen, will ich beginnen ...“<br />
Ein Donner wie von einem fernen Gewittergrollen. Er kommt immer näher, schwillt an, immer<br />
lauter. Der Boden bebt. Wie von einem gewaltigen Raubtier aufgerissen öffnen sich<br />
tiefe Spalten in der Erde. Dachziegel stürzen auf die Straße. Die Gebäude der Stadt fallen in<br />
sich zusammen.<br />
Eine gewaltige schwarze Wolke bedeckt seit Tagen den östlichen Himmel. Der der Stunde<br />
entsprechende Schimmer der zarten Morgendämmerung ist nicht einmal mehr zu erahnen.<br />
Das Firmament hat sich verfinstert. Zuckende Blitze durchschneiden den dunklen Vorhang.<br />
Als würde es tiefen Atem holen, zieht sich plötzlich das Meer in sich zurück. Des Wassers<br />
beraubt winden sich zahllose Seetiere auf dem trocken gefallenen Sand. Schon hat sich die<br />
schwarze Wolke über das Meer gesenkt und verhüllt die Insel Capri in der Ferne der Bucht.<br />
Frauen heulen, Kinder jammern, Männer schreien. Sie rufen nach den Göttern. Aus Angst<br />
vor dem Tode flehen sie um ihren raschen Tod. Alles läuft durcheinander und sucht sich zu<br />
retten. Schon regnet es Asche in Flocken wie Schnee. Dann fällt die riesige schwarze Wolke<br />
in sich zusammen. Wie ein Sturzbach ergießt sich tausend Grad heißer Qualm und Rauch in<br />
die Straßen von Herculaneum. In Augenblicken wird jegliches Leben am Fuße des Vesuvs<br />
ausgelöscht. Die letzte ewige Nacht bricht über die Welt herein.<br />
TOLLER FILM!!! Fast meine ich selbst, die Asche auf meiner Haut zu spüren. Unwillkürlich<br />
sehe ich mich um, wohin kann ich noch fliehen?<br />
So täuschend echt zeigte der Spielfilm das Chaos beim Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79<br />
n. Chr. Es war heiß. Der Raum war dunkel. Viele Leute standen mit mir vor dem Bildschirm.<br />
Die Archäologische Staatssammlung in München zeigte: „Die letzten Stunden von Herculaneum“.<br />
Blickte man sich um, sah man, nachdem die Augen wieder an das Halbdunkel gewöhnt<br />
waren, Schaustücke von dem Jahrtausende alten Auswurf des Vulkans. Man konnte die<br />
zusammengebackenen Klumpen von Vulkangestein sehen, die Bimsbrocken, den kristallisierten<br />
Schwefel. Magisch beleuchtet standen in den Vitrinen die Artefakte der Bewohner<br />
von Herculaneum, kleine Bronzestatuetten, Vasen und Spiegel, alles das, was von ihrem<br />
Leben geblieben war.<br />
Ja, das war eine tolle Idee unseres Lehrers gewesen. Mit uns Lateinschülern hatte er die<br />
Ausstellung besucht, um uns einen sinnlich fassbaren Eindruck zu verschaffen von den Gegenständen<br />
der Klassikerlektüre. „Lest die Plinius-Briefe!“ rief uns Herr Walter Pfenning<br />
noch zum Abschied zu.<br />
Den ganzen Weg nach Hause sinnierte ich noch über die Ausstellung. Dann setzte ich mich<br />
in meine Küche, trank starken Kaffee und dachte dabei an die Unglücklichen in Herculaneum.<br />
Schließlich bin ich selbst auch gar nicht so weit vom Vesuv geboren. Dann erinnerte<br />
50
ich mich an die Worte von Herrn Pfenning. Vor Wochen hatte ich im Antiquariat eine stark<br />
zerlesene Ausgabe erstanden: „C. Plinius Caecilius Secundus, Epistularium libri decem“.<br />
Wo hatte ich das Buch noch gleich hingestellt? Richtig, zwischen Vergil und den Metamorphosen<br />
des Ovid fand ich, was ich suchte. Stark zerlesen, tatsächlich, und im letzten Brief<br />
im sechsten Buch ging es um das Ereignis. Noch vom Eindruck des Films und der Ausstellung<br />
gefesselt, begann ich zu lesen:<br />
C. PLINIUS SESTERTIO SUO S.<br />
Du bittest mich in deinem Brief, mein werter Valtarius, endlich auch von meinem Befinden<br />
Nachricht zu geben und über das Geschehene zu berichten, diesem denkwürdigen Naturereignis.<br />
Zunächst, sorge dich nicht, ich befinde mich wohlauf. Allerdings habe ich beim<br />
Ausbruch des Vesuvs Ängste und Gefahren dutzendweise ausgestanden und jetzt noch<br />
kann ich kaum an das Erlebte denken, ohne dass mein Herz wieder zu rasen beginnt und<br />
mein Atem stockt. Dennoch muss ich dir nun berichten. Wie sagt doch Vergil so passend:<br />
„Quamquam animus meminisse horret ... incipiam (Wenngleich Schauer mich fasst und Entsetzen,<br />
will ich beginnen.)“, und so möchte ich es tun.<br />
Als ein Mann mit wissenschaftlichen Interessen wirst du die Sache bedeutsam und wert befinden,<br />
mit allen Einzelheiten auf das genaueste geschildert zu bekommen. Durch das Grollen<br />
des Vesuvs und die aufsteigende Wolke gewarnt, hatten die Herculaneer also, ich sah<br />
es aus der Ferne selbst, sich aus der Stadt in die am Strand liegenden Bootshäuser zu retten<br />
gesucht. Tagelang harrten sie dort aus. Ganze Familien suchten dort Unterschlupf. Hunderte<br />
von Menschen befanden sich noch am offenen Strand und bei den Booten. Tagsüber<br />
sah man bisweilen die einen hierhin, die anderen dorthin laufen. Ein großes Boot, wohl das<br />
letzte am ganzen Strand, trieb kieloben in den Wellen. Die meisten aber harrten aus in den<br />
fest gebauten Bootshäusern, wohl denkend, sie seien vor den nach Erdstößen einstürzenden<br />
Wänden und den immer dichter fallenden Gesteinsbrocken und Aschefetzen ausreichend<br />
geschützt. Die Ahnungslosen! Sie rechneten nicht mit dem, was dann geschah. Dann<br />
nämlich, als die riesige Wolke plötzlich in sich zusammenfiel, verschluckte die dabei entstehende,<br />
im Anschluss daran so schnell wie der Schuss eines Pfeils an den Flanken des<br />
Bergs herabströmende Menge an heißen Gasen und Gesteinen die Unglücklichen in ihren<br />
zu ihrem Grabmal werdenden Unterständen am Strand. Später, Tage nach der Katastrophe,<br />
berichtete man mir, dass dort am Hafen kein Haus mehr zu sehen war. Wohl an die hundert<br />
Fuß hoch lagen Bimsstein und Asche, aufgeschüttet über den Zurückgebliebenen. Würde<br />
man einmal - Jahrhunderte wären dann vergangen, ahne ich - das verschüttete Herculaneum<br />
wieder ausgraben, kämen nur noch die verkohlten Skelette zu Tage, so wie sich die<br />
Lebenden im letzten Atemzuge aneinander kauerten, die Hände Schutz suchend vor das<br />
Gesicht gehoben. Das Grauen, mein lieber Valtarius, das Grauen packt mich heute noch,<br />
denke ich darüber nach.<br />
Dabei war die Schönheit meines Herculaneum viel gerühmt von Geographen und Dichtern,<br />
sicher kennst du die Stellen bei Strabon, Vergil, Martial. Von Schlamm und Lava bedeckt<br />
sieht man heute die ganze frühere Schönheit begraben und all’ überall nur rauchende Wüste.<br />
Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran denke, was nun alles verloren ist. Denk nur an<br />
die prächtige Villa des Lucius Calpurnius, Caesars Schwiegervater. Leider hast du, mein<br />
geschätzter Valtarius, die beiden meisterhaften bronzenen Skulpturen, Läufer in unglaublicher<br />
Lebensechte dargestellt, nie gesehen, die den Garten der Villa zierten. Es scheint mir<br />
der Mühe wert, dir eine genaue Schilderung zu geben. Zwei Jünglinge im Moment des Loslaufens.<br />
Den Oberkörper geneigt, den Blick konzentriert gerichtet auf die Bahn. So sind die<br />
jugendlichen Athleten in Bronze festgehalten im Sekundenbruchteil vor ihrem Wettlauf miteinander<br />
und gegen die Zeit. Jetzt aber wirst du sie auch niemals mehr sehen können, sind<br />
51
sie doch <strong>für</strong> alle Zeit verloren. Es sei denn, man grübe sie einst wieder aus. Würde man sie<br />
dann nicht in ein ‚Museion’ stellen, viele Jahre in der Zukunft? Was denkst du als Bewunderer<br />
der schönen Künste? Dicht an dicht würden sich doch dann die Besucher in großer Zahl<br />
vor ihnen drängen und mit schwärmerischen Rufen die lange nicht geschaute Schönheit<br />
dieser Kunstwerke rühmen! Dabei fanden sich in des Calpurnius Villa Dutzende solcher und<br />
viel vollendeterer Bronzen. Aber ach, alles verloren! Wer sollte auch jemals an dieser wüsten<br />
Stätte nach den Schätzen einstiger Zeiten graben?<br />
Viel Wertvolleres liegt jedoch unter Asche und Lava und wer weiß, ob man dieses so empfindliche<br />
Gut selbst durch Ausgrabung noch retten könnte. Ich denke an die wundervolle<br />
Bibliothek des Calpurnius mit ihren Hunderten von Papyrusrollen. Weit berühmt war sie <strong>für</strong><br />
die Vielzahl ausgesuchter und seltener philosophischer Texte. Du als Lehrer wissbegieriger<br />
Knaben und Mädchen hättest sie zu schätzen gewusst. So anregend, lehrreich, inspirierend<br />
und die Gedanken beflügelnd waren diese Schriften. Von weit her kamen die Studierenden,<br />
um sie im Hause des Calpurnius einzusehen. Auch diese – verbrannt, verkohlt, geschwärzt<br />
müssen sie jetzt wohl sein – <strong>für</strong> immer verloren! Selbst wenn man sie unter all dem Schutt<br />
hervorziehen könnte, könnte man die Buchrollen überhaupt noch aufrollen, geschweige<br />
denn das Verkohlte und Geschwärzte lesen? Aber wer weiß, vielleicht wird einmal in vielen,<br />
vielen Jahren ein kundiger Grieche eine treffliche Maschine erfinden, um Blatt von Blatt zu<br />
trennen und die Texte wieder lesbar zu machen. Vielleicht wird in fernen Zeiten dies die einzige<br />
Kunde von den dann verlorenen Schriften des Epikur sein, war Calpurnius doch sein<br />
getreuer Verehrer und Sammler seiner Schriften. Dabei fällt mir ein, bist du nicht ebenfalls<br />
ein Freund philosophischer Lehren, lieber Valtarius? Wie schade! Diese Bibliothek hätte dir<br />
sicher gefallen.<br />
Aber viel mehr noch ist verloren. Immer noch ist unsere Aufzählung des bejammernswerten<br />
Verlustes nicht am Ende. All die wunderbaren Malereien kommen mir zum Beispiel in den<br />
Sinn. In beinahe jeder der vielen vornehmen Villen schmückten unvergleichliche Fresken<br />
nach griechischem und modernem römischen Stil rings herum die Wände. Was gab es dort<br />
nicht alles zu sehen! Täuschend echt, als wäre dir der Blick in eine zweite, künstliche zwar,<br />
aber dennoch lebendige Welt gestattet, so groß war die Kunstfertigkeit der Maler, die in<br />
Herculaneum ihr Brot verdienten. Von den Göttern und alten Heroen konnte man sich bei<br />
Speise und Trank, bei Lektüre und bei der nächtlichen Ruhe umgeben wähnen. Ließ man<br />
die Blicke schweifen, war man beeindruckt von den Muskeln des Herkules, den schönen<br />
Augen und weiblichen Vorzügen der Venus oder man sah sich versetzt, mitten hinein in einen<br />
Gottesdienst der fremden Göttin Isis, mit Dutzenden ihrer Priesterinnen und vielen<br />
Gläubigen, so dass man fast den Weihrauch der heiligen Handlung in der Nase spürte und<br />
die exotischen Gesänge zu hören meinte. An solche und ähnliche Darstellungen in den<br />
Häusern der meiner Familie Bekannten – übrigens durchaus auch solche pikanterer Art mit<br />
erotischen Gegenständen, von denen ich dir aber nur persönlich erzählen will, wenn wir uns<br />
dereinst doch einmal, sei es hier in Italien oder bei dir in Germanien, wieder sehen – kann<br />
ich mich erinnern.<br />
Was aber ist nicht noch alles verloren? Mit einer weiteren, den gespanntesten Leser dann<br />
am Ende doch ermüdenden Aufzählung der vielen Dinge - Marmorskulpturen, Vasen, Gefäße,<br />
wertvollster Schmuck - will ich dich nicht langweilen. Denn das Bemerkenswerteste ist<br />
doch das lebendige Leben selbst der Herculaneer gewesen. Nie sind die Menschen und ihr<br />
Treiben langweilig! Ihre Sitten, ihre Träume und Wünsche und ihre Absonderlichkeiten und<br />
Verfehlungen, es ist alles mit ihnen untergegangen, begraben unter Stein und Asche. Wird<br />
man sich, in einigen Jahren vielleicht schon, nicht mehr an dieses Leben erinnern können?<br />
Oder wird man es sich vorstellen können, das mondäne Leben in dem Badeort am Meer, in<br />
den Villen mit Meerblick? Ein wunderbares Theater hatten die Herculaneer, auch das hätte<br />
dir gefallen. Dort, im Spiel, in den Tragödien und mehr noch den Komödien, sahen die Bewohner<br />
sich den Spiegel vorgehalten von den Dichtern. Selbst wenn man all die aufgezählten<br />
Dinge in ferner Zeit noch einmal ausgraben würde, das Spiel der großen Bühnenstars,<br />
52
ebenso wie der Gesang der Tenöre und die sie begleitende Musik, sie sind vergangen und<br />
verklungen <strong>für</strong> immer. Niemals kehrt das wieder!<br />
Aber, mein lieber Valtarius, ich habe all das festgehalten <strong>für</strong> dich. Ich habe nicht nur auf dein<br />
besorgtes Drängen hin, genährt von deiner Sorge um mein persönliches Wohlbefinden, diesen<br />
Brief geschrieben. Ich hoffte auch, auf diese Art dazu beizutragen, dass sich die Kunde<br />
von dem Verlorenen und der Gefahr des Verlustes, der uns in einem winzigen Augenblick<br />
alles zu nehmen vermag, verbreiten ließe. Bist du doch nun Lehrer am Gymnasium und hast<br />
gehörigen Einfluss auf die Jugend. Trotz deiner Bescheidenheit bei deinen Schilderungen<br />
weiß ich das, denn ein gemeinsamer Bekannter hat mir erst vor einigen Monaten einen treffenden<br />
Bericht von deinem neuerlichen Wirken in Germanien gegeben, sodass ich mir alles<br />
mit genauesten Einzelheiten ausmalen und bildlich vorstellen kann. Gerade hast du ja an<br />
einem ganz besonderen Gymnasium begonnen; und du lehrst dort nicht nur Grammatik und<br />
Rhetorik, sondern versuchst auch den Charakter deiner Schüler zu bilden. Da ich mich ja<br />
genau an unser früheres häufiges Beisammensein erinnere, konnte ich bei den Schilderungen<br />
meines Gewährsmanns sofort erkennen, dass du dich nicht verändert hast. Höchst engagiert<br />
und freundlich gehst du auf deine Schüler ein und ziehst Vergleiche mit den Sitten<br />
und Gebräuchen Germaniens, wenn sie den Inhalt der Klassikertexte nicht verstehen. Aber<br />
immer noch, so hörte ich, bist du manchmal abgelenkt und wirst auch rasch ungeduldig,<br />
wenn ein Schüler zögernd übersetzt. Ich sehe dich direkt vor mir, wie du dann vermutlich ein<br />
zerknirschtes Gesicht machst und an dir selbst und deinem Unterricht zweifelst. Aber deine<br />
Schüler haben dich ins Herz geschlossen und schätzen deinen Unterricht, auch das habe<br />
ich gehört. Wie wäre es nun, wenn du ihnen berichtetest von dem Untergang der Städte am<br />
Vesuv und ihrer Bewohner, damit sie im fernen Germanien nicht nur unser kampanisches<br />
Bronzegeschirr bewundern und schätzen, sondern auch das Nötige von unserem Leben<br />
verstehen und das Dahingegangene in ihrer Erinnerung bewahren, auch zur Lehre <strong>für</strong> ihr<br />
eigenes Leben?<br />
Ich habe dir geschrieben, so, als würdest du meinen Brief <strong>für</strong> künftige Leser bewahren. Du<br />
wirst das Wesentliche herauspicken, denn es ist nicht dasselbe, ob man einen Brief oder<br />
eine Geschichte an einen Freund oder <strong>für</strong> die Allgemeinheit schreibt.<br />
Vale.<br />
Ich klappte das Buch zu. Lehrer ändern sich wohl nie. Fast war ich an unseren eigenen Lateinlehrer<br />
erinnert, so lebensecht beschrieb Plinius seinen Sestertius, ... Valtarius Sestertius,<br />
wahrscheinlich kein Römer bei diesem Namen.<br />
Aber das Seltsamste kam erst Tage später. Mit meinem Gewissen im Reinen, schließlich<br />
hatte ich Herrn Pfennings gut gemeinten Rat beherzigt und einen der Plinius-Briefe über den<br />
Ausbruch des Vesuvs gelesen, ging ich in den Unterricht. Als wir über das in der Ausstellung<br />
Gesehene und von einigen bei Plinius Gelesene sprachen und ausführlich die Rede war von<br />
den beiden Briefen an Tacitus (die hatte ich natürlich wieder nicht gelesen!), versuchte ich<br />
einen Punkt mit dem dritten Brief (denjenigen an Valtarius Sestertius, den Grammatiklehrer<br />
in Germanien, den ich wohl als einzige gelesen hatte!) in der Diskussion zu machen. Erst<br />
nach einigen verwirrenden Wortwechseln wurde ich gefragt: „Welchen Brief meinen Sie<br />
denn nun?“ Die verwunderten bis überraschten, schließlich aber endgültig und über alle<br />
Maßen verwirrten Gesichter auf beiden Seiten kann man sich gar nicht vorstellen, als sich<br />
herausstellte, dass zwar in meiner Plinius-Ausgabe von 1906 im sechsten Buch ein 35. Brief<br />
enthalten war, nicht aber in derjenigen, die Herrn Pfenning ein Begriff war und die er schnell<br />
noch zur Kontrolle aus dem Lehrerzimmer herbei holte.<br />
53
Auch weitere Nachforschungen konnten diesen Umstand nicht erklären. Mich kümmert das<br />
nicht; ich feile weiter an meinen Übersetzungen aus dem Lateinischen, solange bis ich meine<br />
Abiturprüfungen bestanden habe.<br />
Giuseppina Aiello, Klasse 2 a,<br />
nach einem Besuch in der Ausstellung „Verschüttet vom Vesuv – Die letzten Stunden von Herculaneum“ in der<br />
Archäologischen Staatssammlung, Museum <strong>für</strong> Vor- und Frühgeschichte, in München (14. Juni bis 1. November<br />
<strong>2006</strong>).<br />
4.2.3 Ethik<br />
Ethik – was ist das?<br />
Nachdem in den <strong>Jahresbericht</strong>en der vergangenen Schuljahre bereits zweimal über den<br />
Besuch von Studierenden der 1. Jahrgangsstufe in der Pasinger Moschee berichtet wurde,<br />
soll diesmal das Beispiel einer Schulaufgabe aus der 2. Klasse zeigen, wie vielseitig dieses<br />
Fach ist.<br />
2c: 1. Schulaufgabe in Ethik am 29.11.<strong>2006</strong><br />
1. Platon lässt in seinem Dialog "Phaidon" seinen Lehrer Sokrates Folgendes über die<br />
menschliche Seele sagen (Sie dürfen die Aussage genauso Sokrates wie Platon zuschreiben):<br />
Über die Unsterblichkeit der Seele<br />
Und jetzt nimm alles zusammen, was wir gesagt haben, Kebes, ergibt sich da nicht aus allem,<br />
dass die Seele das Ebenmaß und der Sinn sei alles Göttlichen und Vernünftigen, jeder<br />
bleibenden Gestalt, der Unauflöslichen und in sich selbst Ruhenden, und dass der Leib zum<br />
Menschlichen und Sterblichen und Vielgestaltigen und Unvernünftigen und Auflösbaren und<br />
sich selber stets Fremden gehöre? Oder haben wir, geliebter Kebes, einen Einwand, der<br />
dagegen spräche? – Nein, wir haben keinen. – Und wenn das richtig ist, muss sich dann der<br />
Leib nicht schnell auflösen, und ist es nicht der Seele eigen, unauflösbar zu sein, wenigstens<br />
zum Teile? – Natürlich. - ... Die Seele aber, die unsichtbare, die in ein unsichtbares,<br />
hohes und reines Reich eilt, in die wahre Welt der Geister, zu dem guten und weisen Gotte,<br />
dorthin, wohin auch, so Gott will, meine Seele bald ziehen wird, die diese hohe und reine,<br />
der Geisterwelt eingeborene Seele sollte, vom Leibe entbunden, zerfallen und vergehen, wie<br />
es die Menge glaubt? Nein, nein, Kebes und Simnias, ihr Freunde: Ich sage, so die Seele,<br />
die reine Seele sich des Leibs entledigt und nichts vom Leibe mit sich schleppt, weil sie im<br />
Leben schon freiwillig nichts mit ihm gemein hatte und vor ihm geflohen und in sich selber<br />
gesammelt und nur um diese Sammlung besorgt war ... Dann, sage ich, scheidet die Seele<br />
von hinnen in das ihr angestammte, unsichtbare, göttliche, ewige Reich der Vernunft, dort<br />
darf sie sich ihres Heiles freuen, erlöst vom Irrtum, von der Sinnlosigkeit, der Angst, der wilden<br />
Liebe und allen Übeln, und dort lebt sie wahrhaftig, wie es unter den Eingeweihten<br />
heißt, mit den Göttern.<br />
(Übersetzung von J. Kassner, Jena 1920, S. 45 ff.)<br />
a) Geben Sie mit eigenen Worten wieder, wie Sokrates/Platon hier zwischen Diesseits<br />
und Jenseits unterscheidet!<br />
54
Die Seele lebt nach dem Tod im Jenseits weiter und ist das Ebenbild des Göttlichen und<br />
Vernünftigen. Der Leib löst sich nach dem Tod im Diesseits auf, die Seele bleibt. Sie eilt<br />
unsichtbar ins Jenseits, in die wahre Welt, zu den Guten und Weisen. Sie muss vom Leib<br />
entbunden werden. Schon im Diesseits ist sie nicht mit dem Leibe gleich, sondern sammelt<br />
sich nur und flieht. Sie kann auch nur unter den Göttern im Jenseits leben, wenn sie das<br />
Schlechte und Unnütze im Diesseits lässt.<br />
Sokrates und Platon sehen den Unterschied darin, dass das Diesseits schlecht ist, dass<br />
die Seele sich dort nicht wohlfühlt, aber im Diesseits ihre Erfahrungen macht und im Jenseits<br />
wieder erlöst wird. Nur die Seele kommt zu den Göttern, der Leib verbleibt im Diesseits<br />
und verfault mit allem Schlechten. Jenseits ist das Göttliche, diesseits ist das Übel.<br />
b) Welche menschlichen Eigenschaften bzw. Fähigkeiten, vielleicht auch<br />
Probleme, können Sokrates und Platon mit ihrer Unterscheidung von Leib und Seele verständlicher<br />
machen?<br />
Wenn man Menschen dazu motivieren kann, ein gutes Leben zu führen, dann erreicht man<br />
auch das Jenseits. Der Mensch hat die Aufgabe, ein aufrechtes Leben zu führen. Nicht der<br />
Leib ist das Wichtigste, denn der ist vergänglich, sondern die Seele ist es, die weiterleben<br />
wird.<br />
Platon war Anhänger der Reinkarnationslehre, d.h. wenn man nur Schlechtes tut, wird man<br />
auch im nächsten Leben bestraft. Nicht das Leben im Diesseits ist die Erfüllung, sondern<br />
im Jenseits. Das Diesseits ist nur dazu da, um Erfahrungen zu sammeln.<br />
Platon war auch Anhänger der Ideenlehre, d.h. der Mensch ist schon mit Idee (Wissen)<br />
ausgestattet, muss sie im Leben (Diesseits) nur wieder finden.<br />
c) Jetzt müssen Sie selber ein wenig philosophieren: Überlegen Sie, inwiefern die im<br />
Text vorgenommene Trennung zwischen Leib und Seele auch zu einem Problem im Bild<br />
des Menschen von sich selber werden kann!<br />
Man könnte davon ausgehen, dass man zwei Seiten in sich trägt: den Leib und die Seele<br />
(=Vernunft). Der Mensch könnte verunsichert werden: Auf was soll ich Wert legen? Der<br />
Leib ist vergänglich, die Seele nicht – aber sie wohnen in einem Körper. Ist das, was ich<br />
täglich sehe, Wahrheit oder Fiktion?<br />
Die Trennung könnte zu strikt sein und der Mensch kann nicht erkennen, auf was er Wert<br />
legen soll oder wie er sich in der Gesellschaft zu verhalten hat. Er würde das ganze Leben<br />
über Folgendes nachdenken: Warum ist der Leib vergänglich, aber meine Seele nicht?<br />
Was will ich erreichen?<br />
2. Nennen Sie eine wichtige Aussage der Sophisten oder des Aristoteles und veranschaulichen<br />
Sie diese Aussage mit einem Beispiel!<br />
Aristoteles war Materialist: Für ihn gab es erst die Materie und dann die Idee. Man macht<br />
in seinem Leben Erfahrungen, Erkenntnisse und Empirie. Der Mensch ist grundsätzlich auf<br />
der Suche nach dem Glück, und wenn Zweifel aufkommen, dann sollte er den goldenen<br />
Mittelweg wählen.<br />
Der Mensch ist das Instrument, um Erkenntnisse zu erlangen.<br />
Andrea Stocker, 2c<br />
55
4.2.4 Biologie<br />
Besuch des <strong>Abendgymnasium</strong>s im Botanischen Garten<br />
56<br />
Foto. W. Endraß<br />
Am Nachmittag des 03. Mai <strong>2007</strong> lud Herr Endraß die Schülerinnen und Schüler des<br />
<strong>Abendgymnasium</strong>s wieder zu seinem allseits bekannten und beliebten Besuch in den Botanischen<br />
Garten ein. Der Besuch wurde von Herrn Dr. Schwab, einem langjährigen Freund<br />
von Herrn Endraß, fachkundig begleitet. Er führte die Gruppe von ca. zehn Schülern mit<br />
kundigem Blick und umfangreichen Erklärungen durch den Garten.<br />
So erfuhren wir von den Gefahren des<br />
Maiglöckchensalates und den bischofsstabartigen<br />
Enden des Farnblattes. Weiter<br />
beschäftigten wir uns mit Nadel- und<br />
Laubgehölzen. Herr Dr. Schwab zeigte<br />
uns mit besonderem Engagement<br />
Flechten-Algen-Symbiosen an Kalksteinen<br />
im Alpinum. Da kein gleichartiges<br />
Silikatgestein als Anschauungsmaterial<br />
zur Verfügung stand, mussten wir auf<br />
das Spezialthema „Symbiosen an Silikatgestein“<br />
von Herrn Dr. Schwab leider<br />
verzichten.<br />
Besonders der Kontakt zu Schülern an-<br />
Foto: Anastasia Lorenz<br />
derer Klassen und die lockere, freundliche<br />
Atmosphäre schufen an diesem Nachmittag ein schönes Gegengewicht zum Lernalltag<br />
der Schule.<br />
Heiko Distler, 2 a
4.3 Aus der Kollegstufe<br />
4.3.1 Deutsch<br />
4.3.1.1 Abituraufsatz <strong>2006</strong><br />
Traditionsgemäß soll auch in diesem <strong>Jahresbericht</strong> nicht der Höhepunkt des letzten<br />
Deutsch-Abiturs fehlen. Dies bietet sich umso mehr an, als eines der im Leistungskurs gestellten<br />
Themen sich mit einem Text von Hans Magnus Enzensberger beschäftigte, in dem<br />
es um Computertechnologie ging, was bestens zu Thema des diesjährigen <strong>Jahresbericht</strong>s<br />
passt.<br />
Neu ist, dass wir damit erstmals eine Aufgabe aus der Aufsatzart "Erörterung anhand eines<br />
Texts" vorstellen. Nachdem im Abitur hierzu zwei hervorragende Aufsätze verfasst worden,<br />
haben wir uns entschlossen, auch beide zu veröffentlichen, zumal so auch deutlich wird, wie<br />
ein und dasselbe Thema auf höchst unterschiedliche Weise behandelt werden kann.<br />
AUFSATZ 1<br />
Als um 1760 in England die Dampfmaschine erfunden wurde, begann in Europa ein unumkehrbarer<br />
Prozess, den man als Industrielle Revolution bezeichnet. Der Bau von Eisenbahnen<br />
und Fabriken brachte tiefgreifende Veränderungen <strong>für</strong> Gesellschaft, Staat, Politik und<br />
Wirtschaft mit sich, die in ihrer Tragweite <strong>für</strong> die Menschheit bis dahin einmalig waren. Das<br />
Aufkommen des Industrieproletariats, der marxistischen Theorie, aber auch des Imperialismus<br />
sind vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zu sehen.<br />
In unsere Zeit fällt nun eine Erfindung, die ähnlich gravierende Umwälzungen mit sich bringt:<br />
die Erfindung des Computers. Im sogenannten "digitalen Zeitalter" setzt ein Wandel ein, der<br />
alle Bereiche des menschlichen Lebens tangiert. Die Arbeitswelt, das Freizeitverhalten und<br />
das Miteinander der Menschen verändern sich.<br />
Im Folgenden soll anhand eines Texts von Hans Magnus Enzensberger dessen Argumentationsstruktur<br />
und Position erläutert werden, auch sollen die Konsequenzen <strong>für</strong> den Umgang<br />
mit Wissen aus den Veränderungen der Informationsverarbeitung erörtert werden.<br />
Der Argumentationsstruktur Enzensbergers<br />
geht die These voran, dass<br />
die hohen Erwartungen an das Internet<br />
vor allem von den wirtschaftlichen<br />
Nutznießern jenes Mediums geschürt<br />
würden. Davon ausgehend wird das<br />
ökonomische Kalkül im "digitalen Kapitalismus"<br />
(Z. 1) untersucht. Enzensberger<br />
hegt Zweifel an der These,<br />
ob "die Umwälzungen in der Informationstechnologie"<br />
(Z. 6-7) tatsächlich<br />
immer zu hohen Produktivitätsgewinnen<br />
geführt haben. Klar<br />
scheint, dass einige Branchen enorm<br />
profitieren konnten, ob diese Profite<br />
PC und Lernen 2 Foto: G. Rigó-Titze<br />
jedoch einer Volkswirtschaft im ganzen<br />
zugute kommen, bleibt zweifelhaft und muss aufgrund der Intransparenz der Materie als<br />
"Kaffeesatzleserei" betrachtet werden.<br />
57
Dem werden nun Alltagserfahrungen gegenübergestellt, die zu Zweifeln berechtigen. Verschwendung<br />
von Papier, Zentralrechner in Büros, Banken und Versicherungen, die streiken,<br />
verursachen einer komplexen Volkswirtschaft wohl Schäden in Milliardenhöhe. Auch das<br />
2000-Problem hat uns vor Augen geführt, welche Bedrohungen mit einem Totalausfall der<br />
digitalen Technik einher gehen können. Flugzeugabstürze, Atomkraftwerke, die unkontrollierbar<br />
werden, Chaos an den computergestützten Börsen und landesweite Stromausfälle<br />
waren nur einige der möglichen Szenarien.<br />
Auch die Förderlichkeit des Internet <strong>für</strong> die Demokratie muss mit Vorsicht betrachtet werden.<br />
Die Möglichkeiten der Technik können laut Autor auch dazu führen, dass sich das Recht des<br />
Stärkeren, des "Platzhirschen" (Z. 31), durchsetzt. Ökonomische Gesichtspunkte werden<br />
dabei nur zum eigenen Vorteil in Betracht gezogen.<br />
Die "intellektuelle Potenz" (Z. 34) der digitalen Medien bleibt ebenfalls janusköpfig. Der relativ<br />
leichte Zugang zu Wissen und der Überfluss an Informationen führen dazu, dass man<br />
"den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht". Die Schlagworte von der Wissens- oder<br />
Informationsgesellschaft bleiben inhaltlich hohl und münden vielleicht sogar in ein "Blabla"<br />
(Z. 40). Die entscheidende Frage <strong>für</strong> den Nutzer der neuen Medien bleibt der Gehalt einer<br />
Information.<br />
Der Nutzen von Informationen nimmt aber oft mit deren Masse ab. Der Autor führt als Beispiel<br />
neue Lexika an, die in ihrer Reichhaltigkeit unbrauchbar werden. Immer neue "links"<br />
führen in einen undurchschaubaren Dschungel des Internet, sodass die eigentliche Ausgangsfrage<br />
in den Hintergrund tritt oder unbeantwortet bleibt.<br />
Diese Menge an Material führt laut Enzensberger zu einer Informationsflut, die nur durch<br />
eine "Ökologie der Vermeidung" (Z. 64-65) beherrschbar wird. Die Netzbetreiber begegnen<br />
diesem Problem mit immer neuen Suchmaschinen oder "Meta-Suchmaschinen" (Z. 68), die<br />
eine geeignete Suchmaschine suchen sollen. Dem stellt der Autor entgegen, dass unser<br />
Gehirn wohl die beste Suchmaschine sei.<br />
Mit dem Zugriff auf das Internet <strong>für</strong> jedermann und den darin vorhandenen Informationen<br />
gerät auch die Urheberschaft, von Texten zum Beispiel, ins Rutschen. Enzensberger macht<br />
uns bewusst, dass dem Kopieren, Eingreifen, Ergänzen und Fälschen von Texten hier Tür<br />
und Tor geöffnet ist. So kann es uns passieren, dass wir uns bei der Nutzung von Texten<br />
aus dem Internet auf gefährliches Glatteis begeben. Beispielsweise kann ein als original<br />
ausgegebener Text von Kant aus dem Internet durch Eingriffe eines Dritten verändert worden<br />
und somit unbrauchbar sein.<br />
Ebenso sind nach Enzensberger Gefahren mit der großen Speicherkapazität der Rechner<br />
verbunden. Ein technisch begrenztes Kurzzeitgedächtnis der Medien führt zum Verlust der<br />
älteren Informationen. Die Halbwertzeit von Informationen sinkt also durch neue Innovationen.<br />
Schon der Titel des Essays, aus dem der Textauszug stammt, zeigt, hier setzt sich jemand<br />
kritisch und ironisch zugleich mit den neuen Medien auseinander: "Das digitale Evangelium.<br />
Propheten, Nutznießer und Verächter". Enzensberger scheint der "Fraktion der Verächter"<br />
anzugehören. Die kritischen Thesen bezüglich der neuen Medien dominieren diesen Text.<br />
Enzensberger zieht die ökonomischen Vorteile der neuen Medien ebenso in Zweifel wie<br />
deren Nutzen <strong>für</strong> die intellektuelle Weiterentwicklung des Menschen. In ökonomischer Hinsicht<br />
profitieren einige Branchen oder Unternehmen, man denke an Microsoft und dessen<br />
Gründer Bill Gates, die Allgemeinheit muss jedoch nicht zwangsläufig profitieren. Er sieht<br />
ebenso Gefahren in der Informationsflut und der oft mangelnden Qualität der Informationen.<br />
Enzensberger nimmt bei genauer Betrachtung die Position eines Fortschrittsskeptikers ein.<br />
58
Seine Intention könnte darin bestehen, dem Leser, neben den vielen Vorteilen, die die neuen<br />
Medien zweifellos mit sich bringen, deren Gefahren und Probleme aufzuzeigen. Er mahnt<br />
und warnt uns und schärft somit das Bewusstsein <strong>für</strong> den Umgang mit den neuen Medien.<br />
Vorgefertigte Lösungen oder Verhaltensweisen gibt er dem Leser dabei nicht vor, dieser<br />
muss eigenverantwortlich die Konsequenzen aus den gewonnenen Einsichten ziehen.<br />
Hinsichtlich der sprachlich-stilistischen Gestaltung des Texts fällt auf, dass Enzensberger oft<br />
eine ironisch bis polemisch gefärbte Sprache verwendet. Schon im Titel des Essays fällt die<br />
Wendung "Das digitale Evangelium" auf. Hier wird die Technik in einen Zusammenhang mit<br />
der Religion gestellt, die sofort vielfältige Assoziationen hervorruft: Jünger, Propheten, wie<br />
im Titel, Erlösung und unbeirrbarer Glaube, um nur einige zu nennen. Mit dem Mittel der<br />
Irritation und Provokation gelingt es dem Autor hier ebenso sofort seine kritische Haltung<br />
anzudeuten.<br />
Wenn Enzensberger dann mit seiner bilderreichen Sprache dem Leser Personal vor Augen<br />
führt, das hilflos vor dunklen Bildschirmen steht (Z. 21-22), oder von einer "penetranten<br />
Computerstimme" (Z. 23) und "pestilenzialischem Musikmüll" (Z. 24) spricht, so wird durch<br />
die Hyperbel schon die Distanz des Autors deutlich. Auch die Metapher der "Platzhirsche"<br />
(Z. 31) macht den Standpunkt des Schriftstellers zum angesprochenen Problem deutlich.<br />
Mit Fachbegriffen, wie der "Shannonschen Theorie" (Z. 42), und Fremdwörteren, wie "Lemnata"<br />
(Z.50) und "konzise" (Z. 55) stellt der Autor seine Kompetenz heraus. Ebenso verwendet<br />
er Wörter, die aus dem Sprachgebrauch der neuen Medien stammen, wie "Input" (Z. 64),<br />
was zeigt, dass der Autor mit der Materie vertraut ist.<br />
Aus der oben dargelegten Position Hans Magnus Enzensbergers gehen Konsequenzen <strong>für</strong><br />
den Umgang mit Wissen hervor, diese sollen im Folgenden erörtert werden.<br />
Wissen war schon immer ein hohes Gut in der menschlichen Gesellschaft, heute nimmt seine<br />
Bedeutung eher noch zu. Daher scheint es wichtig, wer wo und wann auf ein bestimmtes<br />
Wissen zugreifen kann. Es gibt neuerdings Tendenzen, die zeigen, dass große Unternehmen<br />
versuchen, mit Hilfe der neuen Medien Wissen zu monopolisieren. Ein Beispiel da<strong>für</strong> ist<br />
die Internet-Suchmachine Google, die Bestände von Bibliotheken digitalisiert und ins Internet<br />
stellt. Die Gefahr solcher Aktionen besteht darin, dass Urheberrechte entwertet werden,<br />
was Autoren finanziellen Schaden zufügt, und von ökonomischen Interessen geleitete Unternehmen<br />
eine Deutungshoheit über den Wissensbestand der Menschheit erlangen.<br />
Auch birgt das Internet die mögliche Gefahr von Selektion von Informationen durch Unternehmen.<br />
Bei einer wachsenden Zahl von Menschen, die auf unabhängige Medien wie Zeitungen<br />
oder Bücher verzichtet und sich einseitig über Fernsehen oder Internet informiert,<br />
besteht die Gefahr einer leichten Beeinflussbarkeit. Die Konsequenz muss sein, dass Wissensbeschaffung<br />
aus neutralen Quellen, die frei von ökonomischen oder ideologischen<br />
Interessen sind, möglich bleiben muss.<br />
Ein weiterer entscheidender Punkt <strong>für</strong> den Umgang mit Wissen im Zeichen der neuen Technologien<br />
ist die frühe Vorbereitung der Menschen auf eben diese Technologien. Hier sollte<br />
bereits in der Schule angesetzt werden. Einmal ist dies eine Frage der Gerechtigkeit. Kindern<br />
aus einkommensschwachen Haushalten sollte durch die Schule der Umgang mit Computer<br />
und Internet möglich gemacht werden. Denn trotz der Effizienzfortschritte, die bei der<br />
Herstellung von Computern gemacht wurden, bleibt er mit allem Zubehör ein teurer Spaß.<br />
Ohne den Umgang mit Computern erlernt zu haben, verschlechtern sich die Chancen auf<br />
einen Arbeitsplatz drastisch. Der Zugang zu diesem Wissen sollte so vielen wie möglich<br />
ermöglicht werden.<br />
59
Zum anderen ist es notwendig, gerade Kindern und Jugendlichen den richtigen Umgang mit<br />
Internet und Computer näherzubringen. Denn sonst bleibt die von Enzensberger beschriebene<br />
Datenflut das einzige Ergebnis. Die Selektion und das Prüfen von Qualität der erhaltenen<br />
Informationen ist hier besonders wichtig. Jeder dürfte es bereits erlebt haben, mit welcher<br />
Flut von Einträgen man beim Eingeben eines Begriffs in eine Suchmaschine erschlagen<br />
wird. Trefferzahlen im sechsstelligen Bereich sind hier die Regel. Hier bedarf es hoher<br />
Kompetenzen des Nutzers, um wirklich verwertbare Informationen zu erhalten.<br />
Der Umgang mit Wissen hat sich im Zeitalter des Computers also drastisch gewandelt. Gefahren<br />
und Herausforderungen, wie sie Hans Magnus Enzensberger beschrieben hat, sind<br />
dabei vielfältig. Die Gesellschaft steht hier ähnlichen Herausforderungen gegenüber wie zu<br />
Zeiten der Industriellen Revolution. Doch ebenso wie damals wache Geister die damit verbundenen<br />
Probleme erkannt haben, so gibt es sie heute. Enzensberger ist einer von ihnen,<br />
seine Analysen und Warnungen sollten unsere Wachsamkeit erhöhen.<br />
Christian Milerferli, K4 (Abitur <strong>2006</strong>)<br />
AUFSATZ 2<br />
Computertechnologie und Internet sind nicht nur zur Basis des Arbeits- und Studentenlebens<br />
geworden, sondern sind in zunehmendem Maße dabei, auch das private Leben zu<br />
durchdringen. Die Kinder vertiefen sich in Computerspiele, Teenager und Erwachsene surfen<br />
im Internet, laden sich Musik herunter oder treiben Handel bei Ebay. Der Chatroom ist<br />
<strong>für</strong> viele zur häufig frequentierten Kontaktplattform geworden. So spielt sich <strong>für</strong> viele Menschen<br />
nicht nur die Arbeit, sondern auch ein großer Teil der Freizeitgestaltung mit dem<br />
Computer ab.<br />
Das Internet gilt als die revolutionäre Erfindung des modernen Informationszeitalters, dem<br />
man weitgehend nur positive Aspekte abgewinnen kann. Hans Magnus Enzensberger, ein<br />
ausgewiesen kritischer Geist, setzt sich in seinem Essay "Gewinn- und Verlustrechnung"<br />
kritisch mit Computer und Internet auseinander. Er überprüft gängige Positivurteile über das<br />
elektronische Medium auf ihre Stichhaltigkeit.<br />
Im Folgenden soll die Argumentationsstruktur des Textes erarbeitet und die Position des<br />
Autors geklärt werden, auch unter Berücksichtigung auffälliger sprachlich-stilistischer Mittel.<br />
Abschließend wird, unter Einbeziehung der erarbeiteten Ergebnisse aus dem Text, erörtert,<br />
welche Konsequenzen <strong>für</strong> den Umgang mit Wissen aus den Veränderungen der Informationsverarbeitung<br />
zu ziehen sind.<br />
Über Computer und Internet besteht eine Art positiver Grundkonsens, der allgemein akzeptiert<br />
und wenig hinterfragt wird. In einer "Gewinn- und Verlustrechnung" nimmt sich Enzensberger<br />
eine Reihe der gängigsten dieser Positivurteile vor, um sie auf ihre Stichhaltigkeit zu<br />
überprüfen. Es sind insgesamt acht dieser Urteile, die er jeweils in einem Textabschnitt behandelt.<br />
Mit der kurzen Einleitung besteht der Essay so aus neun Sinnabschnitten.<br />
Diese Einleitung nimmt Bezug auf den vorangegangenen Abschnitt (nicht Bestandteil des<br />
Arbeitsauftrags), in dem von den "Versprechungen des digitalen Kapitalismus" (Z. 1) die<br />
Rede gewesen ist. Der Autor fasst mit dieser Formulierung seine These zusammen, dass<br />
die hohen Erwartungen an das Internet "vor allem von den wirtschaftlichen Nutznießern dieses<br />
Mediums geschürt werden". In der Einleitung postuliert Enzensberger, wie heikel es ist,<br />
diese Versprechungen des digitalen Kapitalismus richtig einzuschätzen, und dass man sich<br />
dabei auf jeden Fall blamieren kann.<br />
60
Ab dem zweiten Abschnitt beginnt die Auseinandersetzung des Autors mit den bekannten<br />
Positivurteilen über die elektronischen Medien. Zunächst beschäftigt er sich mit den enormen<br />
ökonomischen Gewinnen, die von euphorischen Propheten des Informationszeitalters<br />
prognostiziert worden sind. Erkenntnisse aus den USA zugrunde legend, kommt Enzensberger<br />
zu dem Schluss, dass es zwar bei unmittelbar beteiligten Branchen zu enormen Gewinnen<br />
gekommen ist, dass sich dieses positive Bild jedoch nicht bestätigt, wenn man die<br />
gesamte amerikanische Wirtschaft betrachtet. Angesichts der hohen Investitionskosten <strong>für</strong><br />
die Einrichtung und Entwicklung elektronischer Medien, ist es gar nicht klar, ob die tatsächlichen<br />
Gewinne so enorm sein werden wie erwartet. Der Autor spricht von einem "Wechsel"<br />
auf die Zukunft (Z. 12) in Zusammenhang mit diesen Investitionen. Angesichts sehr komplizierter<br />
Berechnungen ist eine genaue Zukunftsprognose der zu erzielenden Effizienzgewinne<br />
nicht zu erstellen.<br />
Der dritte Abschnitt nimmt die viel gelobte Arbeitserleichterung im Alltag durch Computertechnik<br />
unter die Lupe. Seine skeptische Haltung dokumentiert der Autor durch Beispiele<br />
aus dem Büroalltag: Statt des "papierlosen Büros" hat die EDV eine große Papierverschwendung<br />
bewirkt. Simple Buchungsvorgänge können manchmal tagelang dauern, und<br />
wenn in Banken oder Versicherungen der Zentralrechner streikt, geht gar nichts mehr. Enzensberger<br />
erwähnt dann noch die bekannte Last der "Hotlines", die den Anrufer in Warteschleifen<br />
"parken" und "mit pestilenzialischem Musikmüll" (Z. 24) beschallen. Die letzte<br />
Kostprobe der bedingten Alltagstauglichkeit des Computers in diesem Abschnitt ist das sogenannte<br />
"2000-Problem",<br />
als es große Schwierigkeiten<br />
und Kosten bei der Datumsumstellung<br />
zur Jahrtausendwende<br />
gab.<br />
Der vierte Abschnitt hat den<br />
prophezeiten Abbau von Hierarchien<br />
in Betrieben durch<br />
das Internet zum Thema.<br />
Auch da ist der Autor skeptisch.<br />
Der Erhalt von hierarchischen<br />
Strukturen ist jedoch<br />
weniger der Technik als<br />
dem "Platzhirsch-Verhalten"<br />
von Posteninhabern zuzuschreiben.<br />
Daran konnte<br />
auch das Internet nichts ändern.<br />
PC und Lernen 3 Foto: G. Rigó-Titze<br />
Die viel gelobte "intellektuelle<br />
Potenz" (Z. 34) der digitalen Medien ist Schwerpunkt des fünften Abschnitts. Auch da fällt<br />
das Urteil zwiespältig aus. Schlagworte wie "Kommunikation ist alles" (Z. 37-38) oder "Informationsgesellschaft"<br />
(Z.39) sind ungenau und lassen offen, was sie überhaupt meinen:<br />
Erkenntnisse? Werbung? Bloß Daten? Oder Blabla? Auch die Shannonsche Theorie zur<br />
Berechnung des Informationsgehalts einer Zeichenmenge hilft nicht weiter, wenn es darum<br />
geht, "was wir suchen, wenn wir etwas wissen wollen" (Z. 44).<br />
Der sechste Abschnitt beschäftigt sich mit den Begriffen "sinnvolle Information" und "bloße<br />
Daten". Digitale Lexika häufen beständig neue Daten und Informationen auf, unterteilen diese<br />
jedoch in immer kleinere Einheiten, die man dann durch ständige "links" zusammensetzen<br />
muss, sodass es mit steigender Datenfülle immer schwieriger wird, sich über ein Thema<br />
ein ganzheitliches Bild zu verschaffen und so echte Kenntnis und sinnvolle Information zu<br />
erlangen. Als positives Gegenbeispiel führt der Autor alte Lexika an, die noch ausführliche<br />
61
Abhandlungen enthalten, durch die man sich ein umfassendes Bild von einem Thema machen<br />
kann. Enzensberger spricht im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Medien<br />
dagegen von "Datenschutt" und "Splitter[n]" (Z. 58).<br />
Abschnitt sieben behandelt das Thema der Materialfülle im Internet und der Auswahl geeigneter<br />
Informationen unter dem Blickwinkel einer Lösung aus dem Dilemma. Er plädiert <strong>für</strong><br />
eine "Ökologie der Vermeidung", "die schon in der Grundschule trainiert werden sollte"<br />
(Z.64-65). Dabei hält er das Gehirn immer noch <strong>für</strong> die beste Suchmaschine, da die digitalen<br />
Suchmaschinen so komplex sind, dass man <strong>für</strong> sie wiederum "Meta-Suchmaschinen"<br />
braucht, um sinnvolle Informationen herauszufiltern.<br />
Im achten Abschnitt betrachtet der Autor den allgemeinen, unbeschränkten Zugang zum<br />
Internet, der weithin als größter Vorteil dieser Technologie angesehen wird. Auch da findet<br />
Enzensberger Kritikpunkte: Das Internet hat den "Begriff des Originals" (Z. 74) und die Autorität<br />
des Autors stark beeinträchtigt, weil sich in e-Mails, Web-Botschaften oder im Netz veröffentlichten<br />
Wissensbeiträgen die tatsächliche Identität des Verfassers nicht verifizieren<br />
lässt. Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des Abschreibens und auch Veränderns<br />
von Texten im Internet. Da sich Zugangsbeschränkungen manipulieren lassen, schaffen<br />
auch sie keine Abhilfe.<br />
Der neunte und letzte Abschnitt des Essays beleuchtet die schier unbegrenzte Speicherkapazität<br />
von Computer und Internet, die mit dem "rasante[n] Innovationstempo" (Z. 83) ständig<br />
wächst und dazu führt, dass "die Halbwertzeit der Speichermedien sinkt" (Z. 84). Das<br />
führt dazu, dass man elektronische Daten aus den sechziger und siebziger Jahren nicht<br />
mehr lesen kann, weil es die damals aktuellen Lesegeräte nicht mehr gibt und die Konvertierung<br />
in aktuelle Formate sehr kostspielig ist. Enzensberger spricht in diesem Zusammenhang<br />
vom "technisch begrenzte[n] Kurzzeitgedächtnis" der neuen Medien (Z.90), das dazu<br />
führen kann, "dass wir uns immer mehr immer weniger lange merken können." (Z. 92-93)<br />
Die Position des Autors wird schon durch den Begriff des "digitalen Kapitalismus", den er in<br />
der Einleitung verwendet, deutlich. Enzensberger kommt in seiner "Gewinn- und Verlustrechnung"<br />
zu einer durchaus kritischen Sicht der digitalen Medien. Gerade weil er scheinbar<br />
unangreifbare Positivurteile kritisch seziert, wie den unbeschränkten Zugang zum Internet,<br />
und ihm dies auch schlüssig gelingt, ist seine kritische Position fundiert und wirksam. Wirksam,<br />
weil der Text aufklärerisch ist und zu kritischer Betrachtung allgemein akzeptierter<br />
Standpunkte anregt. Besonders das Postulat, das Gehirn sei immer noch die beste Suchmaschine,<br />
ist eine fast klassisch aufklärerische Aufforderung zum Selberdenken im Sinne<br />
von Kants Forderung, der Mensch müsse den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes<br />
zu bedienen.<br />
Damit ruft Enzensberger dazu auf, sich nicht ganz der Maschine respektive der Suchmaschine<br />
unterzuordnen, sondern sich als selbständig denkender Mensch den Möglichkeiten<br />
der elektronischen Medien zu nähern. Sein Hinweis, die "Ökologie der Vermeidung" müsse<br />
schon in der Grundschule trainiert werden, bezieht sich auf die beständig zunehmende<br />
Wichtigkeit von Computer und Internet auch <strong>für</strong> Kinder und die damit verbundene frühzeitige<br />
Informationsüberflutung, der man nur mit kritischer Filterung begegnen kann. Diese ist nur<br />
möglich, wenn schon Kinder lernen, Datenschutt von sinnvollen Informationen zu unterscheiden.<br />
Die politisch linke Position Enzensbergers wird durch seine Formulierung vom "digitalen<br />
Kapitalismus" deutlich. Diese unterstellt die gezielte Manipulation der Öffentlichkeit hinsichtlich<br />
der positiven Erwartungen und Grundhaltungen gegenüber Computer und Internet durch<br />
die "wirtschaftlichen Nutznießer" dieses Mediums. Enzensbergers sprachlicher Stil unterstreicht<br />
seine Absicht, eine (objektive) Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.<br />
62
Er benutzt wissenschaftliche Ausdrücke bzw. Fachbegriffe, wie "Effizienzgewinne" (Z. 11),<br />
"Investitionen" (Z. 10), "Speicherkapazität" (Z. 83), "Halbwertzeit" (Z. 85) oder "Lemnata" (Z.<br />
50). Damit zeigt Enzensberger, dass er weiß, wovon er redet. Mit diesen Begriffen aus Ökonomie,<br />
Computerfachsprache und Naturwissenschaft verdeutlicht er auch die weitreichenden<br />
Bezüge der elektronischen Medien. Trotzdem spricht er mit seinem Essay nicht nur<br />
Fachleute an, sondern quasi jeden, der Computer und Internet nutzt. Das macht er, indem<br />
er Alltagserfahrungen schildert und auch umgangssprachliche Begriffe benutzt wie "Platzhirsche"<br />
(Z. 31) und "Blabla" (Z. 40).<br />
Fachbegriffe aus dem Umfeld des Computers, wie "Suchmaschine", "e-Mail", "Web-<br />
Botschaft" und Speicherkapazität verwendet der Autor selbstverständlich, womit er einmal<br />
seine Kompetenz in Sachen Computer belegt und andererseits diese auch dem Leser zubilligt,<br />
den er als den Durchschnitts-Computer-Benutzer anspricht. Dieses Stilmittel führt zu<br />
einer hohen Bereitschaft des Lesers, sich mit den Argumenten des Autors auseinanderzusetzen.<br />
Es fällt noch auf, dass er die jeweils kritischen Positionen zu den einzelnen behandelten<br />
Urteilen über die digitalen Medien deutlich ausführt, die allgemein akzeptierten Positivurteile<br />
jedoch nicht näher beurteilt. Dadurch unterstützt Enzensberger seine Absicht, in seinem<br />
Text sowieso allgemein akzeptierte Vorteile der elektronischen Medien zu hinterfragen.<br />
Sein Text ist auch unterhaltsam. Das schafft der Autor u.a. mit treffenden, alltäglich erlebte<br />
Emotionen bezeichnenden Formulierungen und Neuschöpfungen wie "penetrante Computerstimme"<br />
(Z. 24), "pestilenzialische[r] Musikmüll" (Z. 25), "Datenschutt" (Z. 58). Auch sein<br />
letzter Satz bringt seine Kritik in ironisch überzeichneter Weise auf den Punkt: Informationsflut<br />
und rasantes Innovationstempo führen dazu, "dass wir uns immer mehr immer weniger<br />
lange merken können." (Z. 92-93)<br />
Mit Hilfe seiner klaren und verständlichen Sprache kann der Autor seine kritische Position<br />
vertreten, ist dabei aber unterhaltsam und niemals nörgelnd und lässt auch stets durchblicken,<br />
dass er kein maschinenstürmender Technikfeind ist, sondern <strong>für</strong> einen kritischen, aufgeklärten,<br />
eigenständigen Umgang mit Computer und Internet plädiert.<br />
Ausgehend von den aus dem Text erarbeiteten Positionen des Autors wird deutlich, dass <strong>für</strong><br />
den Umgang mit Wissen aufgrund von Veränderungen der Informationsverarbeitung durchaus<br />
Konsequenzen zu ziehen sind. Die wesentlichste ist die frühzeitige Schulung eigenständigen<br />
Denkens und einer selbstbewussten Haltung gegenüber der Maschine. Der Mensch<br />
sollte sich niemals dem Diktat des Internets und der Suchmaschinen unterordnen. Jedem<br />
Nutzer sollte klar sein, dass nicht alles im Internet auf verlässlichen und seriösen Grundlagen<br />
beruht und dass Daten und Informationen erst sinnvoll werden, wenn sie vom Benutzer<br />
des Internets <strong>für</strong> seine Ziele geordnet werden.<br />
Dieses aktive, nicht rein konsumierende Umgehen mit und gezielte Auswählen aus der Informationsflut<br />
des Internets muss schon im Kindheitsalter eingeübt werden. Ein bewusster,<br />
kritisch-distanzierter Umgang mit diesem Medium, den auch der Essay anstoßen will, ist<br />
da<strong>für</strong> grundlegende Bedingung. Die allzu positive, ja euphorische Haltung den elektronischen<br />
Medien gegenüber, die weit verbreitet ist, ist zur Ausbildung der Ökologie der Vermeidung<br />
nicht hilfreich.<br />
Etwas wirklich zu wissen bedeutet nicht reine Informationsaufnahme, sondern die denkende<br />
Auseinandersetzung mit dem Inhalt und das Ziehen von eigenen Schlüssen. Das war schon<br />
immer so. Doch macht es einem das Internet mit seiner Aufspaltung der Informationen in<br />
"links" und "hyperlinks" schwer, an ganzheitliches Wissen zu kommen. Das Internet erfordert<br />
63
Mühe und aktives Engagement, um es sinnvoll zu nutzen, obwohl genau das Gegenteil suggeriert<br />
wird, nämlich die elektronischen Medien würden Wissensaneignung spielerisch leicht<br />
machen. Es ist eine Frage der Qualität des Wissens, die man bekommen will. Deshalb sollte<br />
schon bei Kindern und natürlich auch bei Erwachsenen ein hoher Anspruch an die Qualität<br />
von Wissen entwickelt werden.<br />
Eine wichtige Konsequenz aus den Gegebenheiten der Informationsgesellschaft bezüglich<br />
des Umgangs mit Wissen ist auch, dass andere, nicht-elektronische Medien nicht ganz auf<br />
die Seite geschoben werden durch die weitverbreitete Interneteuphorie. Zeitungen und Bücher<br />
bieten auch eine wichtige Grundlage <strong>für</strong> Wissensaneignung. Der entscheidende Unterschied<br />
zum Internet ist die größere Ganzheitlichkeit des Wissensangebots und die eindeutig<br />
feststellbare Identität und Seriosität des Autors.<br />
Abschließend möchte ich sagen, dass ich den Essay von Enzensberger als aufklärerische<br />
und kritische Anregung betrachte. Er stellt deutlich heraus, in welchen Aspekten die elektronischen<br />
Medien kritisch zu sehen sind. Auch Enzensbergers Formulierung vom "digitalen<br />
Kapitalismus" empfinde ich als angemessen, denn ich bin überzeugt, dass die Computer-<br />
und Interneteuphorie, die weite Bevölkerungsteile befallen hat, gezielt von den ökonomischen<br />
Nutznießern dieser Technik geschürt worden ist. Werbekampagnen der Telecom, die<br />
eine "heile Cyberwelt" versprechen, unterstützen diesen Verdacht. Als Ausblick <strong>für</strong> den zukünftigen<br />
Umgang mit Wissen halte ich besonders Enzensbergers aufklärerischen Impetus<br />
im Sinne des Selberdenkens <strong>für</strong> hilfreich.<br />
Jochem Stecker, K4 (Abitur <strong>2006</strong>)<br />
4.3.1.2 Realistischer Russe: Der Revisor<br />
Ein Unterrichtsgang der besonderen Art fand am Freitag, den 11. Mai <strong>2007</strong> statt. Der<br />
Grundkurs d 42 besuchte eine Amateurtheater-Aufführung. Die Theatergruppe St. Quirin<br />
spielte im Pfarrheim zwischen Aubinger Kirche und Aubinger Bahnhof die Komödie "Der<br />
Revisor" von Nikolai Gogol. Da wir uns im Deutschunterricht gerade mit der Epoche des<br />
Realismus beschäftigten und dazu bereits Werke von deutschen Autoren wie Georg Büchner<br />
und Gottfried Keller kennengelernt hatten, bot sich die reizvolle Gelegenheit, Bekanntschaft<br />
mit einem russischen Drama aus derselben Epoche zu schließen.<br />
Die besondere Atmosphäre dieser Laientheaterproduktion sprach alle Studierenden sehr an.<br />
Es ist eben doch etwas Besonderes an Wirtshaustischen zu sitzen und in den Pausen eine<br />
bayrische Brotzeit zu sich nehmen zu können. Überrascht waren wir alle über die Direktheit<br />
der satirischen Angriffe in dem Gogol-Stück. Hier wird nämlich nichts nur zart angedeutet,<br />
sondern die Missstände werden deutlich beim Namen genannt: "Für Geld kann man alles<br />
haben!"<br />
Sehr viel Mühe hatte sich die Theatertruppe mit Kostümen und Bühnenbild gegeben, und<br />
auch die Schauspieler machten ihre Sache sehr gut; sogar fast unaussprechliche Namen<br />
wie "Ammos Fjodorowitsch Ljapkin-Tjapkin" gingen ihnen ganz flüssig über die Lippen, und<br />
schon bald war man als Zuschauer daran gewöhnt, dass sowohl Pjotr Imanowitsch Dobtschinskij<br />
als auch Pjotr Iwanowitsch Bobtschinskij mit bayrischem Tonfall sprachen. Zu lachen<br />
gab es viel an diesem Theaterabend, der sich insgesamt aber dann doch arg in die<br />
Länge zog. Der Regisseur hatte es wohl aus falsch verstandenem Respekt vor Autor und<br />
Werk leider nicht gewagt, notwendige Streichungen vorzunehmen. Das großartige Anfangstempo<br />
konnte das Ensemble nicht bis zum Ende durchhalten, es ergaben sich vielmehr<br />
deutliche Längen.<br />
64
Auch wenn wir dadurch etwas ermüdet ins Wochenende gingen, waren die Eindrücke der<br />
Theateraufführung doch stark genug, um in der Abschlussbesprechung die russische Komödie<br />
in den Kontext anderer literarischer Werke aus der Epoche des Realismus einzureihen.<br />
Wir stellten Listen von Objekten der Kritik in den einzelnen Werken zusammen, die auf<br />
dem unten stehenden Merkblatt zusammengefasst wurden. Deutlich wurde dabei, dass<br />
ganz besonders zwei Themen die Literatur des Realismus beherrschen: die hierarchisch<br />
starre Aufteilung der Gesellschaft in einzelne Klassen und das damit verbundene Obrigkeitsdenken<br />
sowie die Schein- bzw. Doppelmoral der bürgerlichen Schicht.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
Objekte der Kritik in Werken des Realismus<br />
1. In Heinrich Heines Gedichten<br />
- Zersplitterung Deutschlands<br />
- Vaterländer als Besitztümer des Fürsten<br />
- Ausbeutung der Arbeiter<br />
- Trägheit der Massen<br />
- selbstzufriedene, unpolitische Haltung<br />
- Treue gegenüber der Obrigkeit<br />
- falsche Moral<br />
2. In Georg Büchners Drama "Woyzeck"<br />
- zementierte Klassenunterschiede in Deutschland<br />
- Chancenlosigkeit des Prekariats<br />
- Ausbeutung des Menschen im hierarchischen System<br />
- skrupellose Zerstörung der Benachteiligten<br />
- einseitiges Verständnis <strong>für</strong> den "normalen, gesunden" Menschen<br />
- Sprachbarrieren<br />
- Missbrauch von Macht<br />
- falscher Moralbegriff<br />
- zwischenmenschliche Beziehungen<br />
3. In Gottfried Kellers Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe"<br />
- Bürokratie<br />
- aufkommender Kapitalismus, Geldgier<br />
- Unfähigkeit zur Eigenverantwortung<br />
- mangelndes Mitgefühl<br />
- keine individuelle Entfaltungsmöglichkeit<br />
- starre Normierung<br />
- Bedeutung des guten Rufs<br />
- Ausgrenzung bei Nichteinhaltung der Normen<br />
- Spießbürgertum und Idylle in der ländlichen Welt<br />
- Doppelmoral<br />
- Neid, Schadenfreude<br />
4. In Nikolai Gogols Komödie "Der Revisor"<br />
65
66<br />
- überbordendes, autoritäres Verwaltungswesen<br />
- Unterdrückung und Ausbeutung der kleinen Bürger<br />
- Überbewertung der Obrigkeit<br />
- Machtmissbrauch<br />
- Materialismus<br />
- Korruption und Bestechlichkeit<br />
- Hörigkeit gegenüber Höhergestellten<br />
- Habgier<br />
- Selbstgefälligkeit<br />
- Naivität und Leichtgläubigkeit<br />
- Doppelmoral und Falschheit<br />
- Wahrung des schönen Scheins<br />
4.3.1.3 Gerhart Hauptmann: "Bahnwärter Thiel"<br />
Literarische Erörterung:<br />
Höchststrafe <strong>für</strong> Thiel wegen Doppelmordes (d.h. Tötung aus Heimtücke und niederen Motiven)<br />
oder Freispruch und Einweisung in eine psychiatrische Heilanstalt wegen schwerer<br />
psychischer Störung?<br />
Verfassen Sie zu dieser Frage eine Anklagerede aus Sicht der Staatsanwaltschaft oder eine<br />
Verteidigungsrede aus Sicht des Verteidigers oder ein abwägendes Urteil des Richter!<br />
Es wird verhandelt der zweifache Mord an Lene Thiel und ihrem Sohn. Der Tat angeklagt ist<br />
Herr Thiel. Herr Thiel hat seine Frau Lene im Schlaf erschlagen und seinem Kind die Kehle<br />
durchgeschnitten. Sowohl der Staatsanwalt, der in seinem Plädoyer die Höchststrafe <strong>für</strong><br />
Doppelmord beantragt hat, als auch der Verteidiger des Herrn Thiel, der in seiner Verteidigungsrede<br />
den Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit <strong>für</strong> seinen Mandanten forderte,<br />
warten gespannt auf den Urteilsspruch des Richters.<br />
Der Richter kehrt in den Sitzungssaal zurück und die Beteiligten erheben sich. Nachdem alle<br />
wieder Platz genommen haben, verkündet der Richter sein Urteil.<br />
"Die Schöffen und ich haben alle Argumente nochmals eingehend geprüft und sind zu folgendem<br />
Urteil gelangt: Herr Thiel ist schuldig des Totschlags an seiner Frau Lene und seinem<br />
zweijährigen Sohn. Das Strafmaß wird festgelegt auf lebenslang mit Einweisung in eine<br />
psychiatrische Klinik.<br />
Zur Begründung ist Folgendes zu sagen:<br />
Herr Thiel stammt aus einer ärmlichen ländlichen Gegend. Er übt dort den Beruf des Bahnwärters<br />
aus. Nachdem die erste Frau des Herrn Thiel, Minna, bei der Geburt seines ersten<br />
Sohnes, Tobias, verstorben ist, hat er seine zweite Frau Lene, das Opfer, geheiratet und mit<br />
ihr sein zweites Kind, das zweite Opfer, gezeugt.<br />
Die Zeugenaussagen haben ergeben, dass Herr Thiel ein sehr religiöser Mensch ist, der<br />
brav jeden Sonntag zum Gottesdienst geht (S. 5, Z. 1-12). Er erfüllt seine Pflichten immer<br />
gewissenhaft, ist zuverlässig und wohl aufgrund seines Berufes auch ein pünktlicher<br />
Mensch (S. 5, Z. 4-5). Auch konnten wir den Aussagen entnehmen, dass er sehr kinderlieb<br />
ist und sich in seiner Freizeit um die Dorfjugend gekümmert hat (S. 11, Z. 16-33). Dass er
ein Sparbuch <strong>für</strong> seinen Sohn Tobias angelegt hat, zeichnet ihn doch als <strong>für</strong>sorglichen Vater<br />
aus (S.11, Z. 39 – S. 40, Z. 5). Alles dies lässt den Schluss <strong>für</strong> uns zu, dass Herr Thiel in<br />
seinem Charakter keine Ansätze zu einem gewalttätigen Menschen zeigt. Es müssen also<br />
andere Gründe dazu geführt haben, dass Herr Thiel die Tat begangen hat.<br />
Hierzu hat die weitere Befragung von Zeugen Aufschluss gebracht. Die Beziehung Herrn<br />
Thiels zu seiner ersten Frau Minna muss gut gewesen sein, denn er verehrte sie noch über<br />
ihren Tod hinaus (S. 7, Z. 28-37). Herr Thiel hatte aber gerade wegen ihres Todes Schuldgefühle<br />
und träumte nach eigenen Angaben sogar davon (S. 13, Z. 22 – S. 20, Z. 4). Die<br />
Beziehung zu seiner zweiten Faru Lene hingegen lässt sich auf eine wohl sexuelle Hörigkeit<br />
oder Abhängigkeit reduzieren, der Herr Thiel nichts entgegenzusetzen hatte (S. 14, Z. 29-<br />
36).<br />
Dies erklärt wohl auch seine Hilflosigkeit bei den Misshandlungen des ersten Sohnes Tobias<br />
durch seine zweite Frau (S. 13, Z. 43 – S. 14, Z. 36). Auch hier hat sich Herr Thiel, seiner<br />
Unfähigkeit gewiss, große Vorwürfe gemacht (S. 18, Z. 6-15). Nach Zeugenaussagen war<br />
Lene Thiel eine sehr dominante Persönlichkeit (S. 6, Z. 34-39). Zu seinem Sohn Tobias hatte<br />
Herr Thiel ein sehr enges Verhältnis (S. 9, Z. 9). Zu dem Verhältnis zu seinem zweiten<br />
Sohn konnte die Zeugenbefragung nichts Aussagekräftiges beisteuern. Ein früher Auslöser<br />
<strong>für</strong> die Tat des Herrn Thiel war folglich die Unfähigkeit, gegen die Misshandlungen des kleinen<br />
Tobias anzugehen und die allgemein ungute Familiensituation.<br />
Der entscheidende Auslöser aber war wohl der tragische Unfalltod von Tobias, der vom Zug<br />
überrollt wurde, während seine Stiefmutter auf ihn aufpassen sollte (S. 24, Z. 22 – S. 25, Z.<br />
43). Dieses Ereignis löste in Herrn Thiel eine Schocksituation aus, in der er, nach Zeugenaussagen,<br />
"gläserne Pupillen" und "Schaum vor dem Mund" bekam. Herr Thiel hat die alleinige<br />
Schuld <strong>für</strong> den Unfall seiner Frau Lene zugeschrieben und Rachegedanken schon mit<br />
der Tötungsabsicht geschmiedet (S. 24, Z. 16-18). Er hat vor der eigentlichen Tat sogar versucht,<br />
seinen zweiten Sohn zu erwürgen (S. 29, Z. 14-29).<br />
Dass er seine Frau und seinen Sohn im Schlaf getötet hat, lässt normalerweise auf heimtückischen<br />
Mord schließen, da die beiden keine Chance hatten sich zu wehren. Herr Thiel hat<br />
sich aber, wie vorher bereits erklärt, in einem Ausnahmezustand befunden und ist somit als<br />
vermindert schuldfähig einzustufen. Allein die Tatsache, dass er den ersten Tötungsversuch<br />
des zweiten Kindes unterbrochen und zeitweise sein Handeln erkannt hat (S. 29, Z. 25-29),<br />
lässt darauf schließen, dass er zur Tatzeit nicht gänzlich schuldunfähig war. Auch hat Lene<br />
Thiel die Veränderung an ihrem Mann wahrgenommen, sie hat sich mit ihm jedoch nicht<br />
befasst (S. 30, Z. 20ff.) bzw. ist nicht auf ihn eingegangen, wie es sonst auch niemend tat.<br />
Herr Thiel war in dieser Situation mit seinen angestauten Schuldgefühlen allein und abermals<br />
unfähig richtig zu handeln. Niedere Beweggründe, die <strong>für</strong> einen Mord sprechen, liegen<br />
hier auch nicht vor, denn Herr Thiel hat nicht aus Habgier oder Neid getötet.<br />
Aus diesen Gründen habe ich auf lebenslängliche Haft wegen Totschlags entschieden. Ich<br />
hoffe, dass Herr Thiel in der psychiatrischen Klinik die Hilfe erhält, die er braucht, um sein<br />
falsches Handeln zu erkennen, und die Fähigkeit erhält, dann damit zu leben, denn im<br />
Grunde ist er trotz allem kein schlechter Mensch.<br />
Sie können Berufung gegen dieses Urteil einlegen. Ihr Verteidiger wird sie hierzu beraten.<br />
Und damit schließe ich die Sitzung."<br />
Manuela Oji, K3 (Schuljahr 2005/06)<br />
67
4.3.1.4 Unterrichtsgang zum Königsplatz und in die Glyptothek<br />
Am 28.9.<strong>2006</strong> traf sich um 17 Uhr bei bestem Wies'n-Wetter der Deutsch-Grundkurs d32<br />
nicht auf dem Oktoberfest, sondern auf dem Königsplatz, um Anschauungsunterricht in Sachen<br />
Klassik zu bekommen. Dies geschah, indem wir uns mit Architektur, symbolischer Bedeutung<br />
und Geschichte dieses einzigartigen Platzes im 19. und 20. Jahrhundert auseinandersetzten.<br />
Dabei war von Ludwig I.und Leo von Klenze ebenso die Rede wie von Otto, dem<br />
Wittelsbacher auf dem Griechenthron, und vom Missbrauch des Platzes durch die vom nationalistischen<br />
Größenwahn getragene Umgestaltung des Platzes während des Dritten<br />
Reichs.<br />
Wir zogen Vergleiche zwischen den auch heute noch beeindruckenden klassizistischen<br />
Bauwerken und der klobig-unmenschlichen Nazi-Architektur ("Führerbau", heute Musikakademie)<br />
und waren uns einig darüber, dass das geplante Dokumentationszentrum über die<br />
Rolle Münchens als "Hauptstadt der Bewegung" zwischen Königs- und Karolinenplatz, just<br />
dort, wo einst das "Braune Haus" stand, einen geeigneten Platz finden wird.<br />
Nach diesem Streifzug durch die jüngere bayerische Geschichte begaben wir uns in die<br />
Glyptothek, die den meisten Studierenden unbekannt war. Wegen der Abendöffnung bis 19<br />
Uhr konnten wir alle Säle besichtigen und uns dabei ausführlicher mit einigen ausgewählten<br />
Exponaten, wie dem Münchner Kuros, dem Barberinischen Faun, den Friesen des Tempels<br />
von Ägina und der großen Apollo-Statue beschäftigen.<br />
Als Pädagogin kann ich es nur begrüßen, dass uns der Freistaat Bayern trotz leerer Kassen<br />
immer noch die Gelegenheit gibt, mit unseren Schulklassen kostenlos die staatlichen Museen<br />
zu besuchen. Dass die Resonanz bei den Studierenden durchweg positiv war, zeigte<br />
das mündliche Dankeschön einiger Kursmitglieder ebenso wie die folgenden schriftlichen<br />
Stellungnahmen sowie der mehrfach geäußerte Wunsch, dieser gemeinsame Museumsbesuch<br />
möge nicht der letzte gewesen sein.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
Das erste Mal in die Glyptothek zu gehen war ein erfreuliches Erlebnis <strong>für</strong> mich. Er war eine<br />
sehr gute Idee von unserer Grundkurslehrerin einen Ausflug dorthin zu machen, weil man<br />
alleine doch nicht solche Unternehmungen tätigt.<br />
Mich faszinierte der junge Faun, der aus Marmor gemeißelt wurde und wirklich sehenswert<br />
ist. Der Künstler hat aus einem Block Marmor den Körper detailliert (mit Sehnen und Muskeln)<br />
dargestellt. Für Maler ist dieser Faun bestimmt ein prima Modell <strong>für</strong> Studien des Körpers.<br />
Auch die Büsten mit ihren verschiedenen Gesichtszügen und -ausdrücken sind faszinierend.<br />
Da konnte man sehen, dass die menschen vor 2000 Jahren auch schon Falten und Augenringe<br />
hatten. Es war interessant zu sehen, was man alles aus Stein und Bronze formen<br />
kann.<br />
Esther Laczko, K3<br />
Oft schon am Königsplatz gewesen, immer die drei Gebäude betrachtet, aber sich selten<br />
Gedanken darüber gemacht, was dahinter steckt. So war der Ausflug des Deutsch-<br />
Grundkurses sehr geeignet, etwas Hintergrundwissen zu erfahren. Da wir gerade die<br />
deutsche Klassik behandeln, bot es sich an, sich mit der Antike, die Vorbild da<strong>für</strong> war, zu<br />
beschäftigen. Die Glyptothek mit ihren Sälen und hohen Decken ist sehr beeindruckend. Bei<br />
der Beschreibung der Figuren schließe ich mich meiner Vorschreiberin an.<br />
Christiane Bauch, K3<br />
68
Ich fahre fast täglich mit dem Fahrrad über den Königsplatz. Ich wusste bisher nur, dass<br />
König Ludwig den Platz nach griechischem Vorbild erbauen ließ. Auch der Missbrauch des<br />
Platzes durch die Nazis war mir bekannt. Zu beiden geschichtlichen Epochen erfuhr ich<br />
interessante Einzelheiten. Zusätzlich war ich auch zum ersten Mal in der Glyptothek. Auch in<br />
diesem Museum konnte ich viel über historische Ereignisse dazulernen.<br />
Bernd Goretzka, K3<br />
Ein Schulausflug ist am <strong>Abendgymnasium</strong> immer eine höchst interessante und angenehme<br />
Angelegenheit. Allerdings fällt einem beim Grundkurs Deutsch nicht unbedingt ein Museum<br />
ein, in das man geht, doch eher ein Theater. Dorthin zieht es mich persönlich auch mehr als<br />
zu den stillen alten Büsten aus der griechischen und römischen Antike. Dank zahlreicher<br />
Erklärungen unserer Lehrerin konnte ich dann doch einiges aus dem Besuch mitnehmen –<br />
ganz ohne roten Faden hätte ich mich dort doch etwas fehl am Platz gefühlt. So aber schlugen<br />
wir einige Pfade in Richtung antiker Kunstgeschichte ein: von fast industrieller Büstenfertigung<br />
über neuzeitliche Reparaturen und Ergänzungen von Statuen und Reliefs bis hin<br />
zur fast perfekten menschlichen Nachbildung – dem Barberinischen Faun, der sich unter<br />
einer hohen Kuppel der Glyptothek räkelt. Und wieder eine Fülle von Eindrücken mehr, die<br />
ich bereits am AG erhalten habe.<br />
Ferdinand Trommsdorff, K3<br />
Für mich war es bereits der zweite Besuch in der Glyptothek, und ich fand es wieder sehr<br />
interessant. Was uns als Schülern damals nicht gesagt wurde, war, wie und warum der Platz<br />
entstand, deshalb fand ich die kurze Geschichte über den Königsplatz super. Ich wusste<br />
zwar, dass König Ludwig I. den Platz bauen ließ, aber nicht warum. Auch die Ausführungen<br />
in der Glyptothek waren informativ. Ich hätte nur gern mehr Zeit gehabt, alles anzuschauen,<br />
da ich mich sehr <strong>für</strong> die griechische Geschichte interessiere. Auch die Bildhauerarbeiten<br />
faszinieren mich sehr, was die Menschen mit ihren einfachen Mitteln alles geschaffen haben:<br />
seien es Tempel oder die Figuren mit ihren verschiedenen Haltungen und die sehr detailliert<br />
dargestellten Gesichtsausdrücke.<br />
Manuela Lerchl, K3<br />
69
4.3.1.5 Der goldene Fisch<br />
Aus einer Lyriksequenz im Grundkurs d43<br />
Aufgabe: Verfassen Sie ein Gedicht über das vorliegende Kunstwerk "Der goldene Fisch"<br />
von Paul Klee (1925)<br />
Nadja Neumann, K3<br />
4.3.2 Englisch<br />
4.3.2.1 "Dead or Alive"<br />
70<br />
Der goldene Fisch<br />
Leuchtend gelb wie Gold er<br />
schwimmt vorbei, den anderen<br />
erstaunt, begierig ineinander rasend, mit<br />
überschwänglichen Gefühlen sehen ihn.<br />
Doch einer schöner als die,<br />
die unglänzend Schuppen mit<br />
sich tragen, wollen<br />
nicht ihn, ihn nicht.<br />
So ist er, den anderen<br />
vor Schönheit glühend, allein<br />
in schwarzer Einsamkeit<br />
umhüllt. Der Nachklang Neid<br />
ist in kleinsten Elementen<br />
H2O zu fühlen.<br />
What role does death play in the five scenes that were presented by the English Drama<br />
Group?<br />
1. "Arsenic and Old Lace" by Joseph Kesselring<br />
Mortimer is very happy. He has just become engaged to Elaine; his book on Thoreau<br />
is making good progress; his mad cousin Teddy, who thinks he is digging the Panama<br />
Canal in the cellar, is going to be committed to a lunatic asylum; and his Aunts<br />
Abby and Martha are as sweet as ever. But then Mortimer makes a discovery ...<br />
Killing people appears to be fun to Abby and Martha, but not to Mortimer, who is very<br />
much afraid of death and everything that has to do with it.<br />
In this play death is real. Even though we never see one there are a lot of corpses<br />
around the house. Mortimer discovers that his sweet little aunties consider it a merci-
ful deed to put homeless men without relatives to death and enjoy the funeral services<br />
of different denominations on the side.<br />
Abby and Martha see death, especially their hobby of killing people, just as a way to<br />
spend their time. The remember the peaceful face of the first guest who died in their<br />
house.<br />
For Martha and Abby death is nothing bad. They think they can help the poor lonely<br />
men by killing them. They do not feel guilty about what they have done. For Mortimer<br />
death and especially murder is something horrible and forbidden. He knows that<br />
what his aunts have done is wrong.<br />
The two old ladies have a rare attitude to death. They give up an ad about letting a<br />
room in their house and old gentlemen come to them. The ladies think that old men<br />
should not be alone at their age and help them further with a special cocktail to go to<br />
a better world.<br />
The two aunts have a very unusual pleasure: They kill lonely old men with poisonous<br />
wine! One of the aunts really has a lot of fun trying out new deadly recipes with arsenic,<br />
strychnine and cyanide. Of course they are very disappointed when their nephew<br />
Mortimer is shocked to discover a corpse in the chest in the living room.<br />
2. "Anyone for Tennis?" by Gwyn Clark<br />
To spice up their sex life, Amanda and George have agreed that on the first<br />
Wednesday of the month they can take turns to receive a lover. Unfortunately, they<br />
get the schedule mixed up and chaos ensues when both Henry and Jane, their lovers,<br />
turn upon the same day. Matters get worse when Henry drops dead – or is he<br />
just pretending?<br />
No he isn't – but he is not dead either. He is just unconscious long enough for<br />
Amanda and George to sort out their marital relationship and to discover that they<br />
suffice each other after Henry leaves together with his wife. On the other hand,<br />
Henry's wife finds out that she loves her husband. So in the end everybody is up for<br />
happiness. Death, however, is just a passing threat.<br />
Henry's alleged death is a way to find out Jane's secret. She feels bad when he is lying<br />
on Amanda's bed and seems to be dead because of their "game".<br />
The shock that Henry might be dead helps George and Amanda to find together<br />
again. What a scandal it would be if the neighbourhood found out about their secret<br />
agreement! And they certainly would have if they had seen police and a dead body<br />
being carried out of the house.<br />
This was a very strange scene but without Henry's supposed death – his short<br />
knock-out – the couple maybe would not have got the chance to find each other<br />
again. Here death plays the role of a supporter.<br />
In this scene death puts an end to the secret of the mixed up couples. It makes them<br />
realise what they have got with each other. And so at the end the true couples are<br />
together again. Death shows them here what they would lose if it really happened.<br />
In this play death spoils it for all of them! It is not clear what annoys them more:<br />
Henry's sudden "death" or their spoilt dates.<br />
71
3. "Death Knocks" by Woody Allen<br />
72<br />
Nat is spending a pleasant evening at home when a stranger turns up – and they<br />
don't come any stranger than this figure!<br />
The scene reminds me of the movie "Joe Black" with Brad Pitt and the character<br />
Death tells us the same story. Death comes to somebody totally unexpectedly and<br />
invites the person to follow him because it is time to go. What a pity for Death that he<br />
plays poker so badly!<br />
Death appears suddenly without giving a warning and could come to anyone at any<br />
time. Here the old hope that one could escape from death by one way or another is<br />
shown. In this play Woody Allen lets Nat and Death play poker in order to get one<br />
more day for Nat. I think almost everybody would like to get at least one more day<br />
when the time has come.<br />
Death comes in person to take Nat away but he bargains for his life and wins another<br />
24 hours. He is not sure if someone made fun of him because Mr Death is not behaving<br />
as we think Death would behave. He is not cruel and a rather small figure.<br />
Here death is presented as a character in the play and treated as a joke. Nat talks to<br />
him as if he were a clown.<br />
In this plot death loses all his intended threat because he is so clumsy. Death appears<br />
as a parody of himself with absolutely human ways and behaviour, allowing<br />
Nat, who is a very controlled character, to play it cool and make fun of Death – an<br />
absurd situation.<br />
Death appears very human in this play. He has to struggle like a human and also<br />
does not take himself too seriously.<br />
4. "Bang, You're Dead" by Paul Reakes<br />
Lydia is at home waiting for her husband Theo to arrive with his secretary Miss Trim,<br />
when suddenly the burglar Marcus enters and threatens to kill her. But nothing is<br />
what it appears to be in this thriller with a lot of surprising twists.<br />
It seems to me as if this play wanted to tell me: Don't play with death! First Lydia<br />
wants to kill her husband with the help of Marcus, then Marcus kills Lydia. This has<br />
been Theo's aim who wants to get rid of Lydia. But at the end none of these people<br />
gets what he wants.<br />
This play has surprising twists indeed. In the end nobody gets what he was after in<br />
the beginning, except Miss Trim who gets a husband unexpectedly, and of course<br />
Lydia loses her life. So death takes his toll indeed.<br />
Death is to help a couple to easily get rid of their spouses. Lydia thinks her husband<br />
will be killed but it is her. Her husband has a secret lover, the "burglar" Marcus. In<br />
the end none of them get what they wanted. Only Miss Trim can use the circumstances<br />
to get an advantage.<br />
Marcus and Theo kill Lydia to be free and able to live together. Death is used as the<br />
only means to divorce Theo from Lydia.
Death is a means of getting the things as you want them to be. It does not play a major<br />
part in this play. People do not ponder about it but kill to get someone out of the<br />
way so they can marry or get stuff from the safe.<br />
This is an old story, maybe a cliché, and Hollywood made many Oscars out of it.<br />
Here death is used for somebody's most important benefits: money and sex or love.<br />
5. "A Cut in the Rates" by Alan Ayckbourn<br />
It is not clear who – if anyone – is living in the house that council employee Monica<br />
Pickhart goes to in an attempt to collect some unpaid taxes. The characters she encounters<br />
there (Thomas Ratchet?, his wife Rosalinda?, a woman from upstairs?) increasingly<br />
fill her with alarm and panic.<br />
Death is used to scare off all the people who want to collect the unpaid bills.<br />
Pretending to be dead is actually a disgusting thing. You can read it in the newspaper<br />
many times of the year and every time the people have pretended death for their<br />
advantage, a better existence and an escape from the "state's eye".<br />
In this play Thomas and Rosalinda Ratchet use death as a way not to pay taxes.<br />
Thomas, the illusionist, and his "dead" wife Rosalinda cheat Monica when they present<br />
her Rosalinda as a zombie. So they use death as a cheap trick.<br />
It was funny to see how creative some people can be in order to avoid paying their<br />
utility bills. Again, death does not materialise in this play but is only used as a threatening<br />
perspective to haunt the naive tax collector.<br />
The fear of death is used to keep the IRS out of the house.<br />
Death is still a mystery. People get shocked by it and fear it. They believe almost<br />
everything, like ghosts still walking around and so on. So it is easy for people to manipulate<br />
other people and cheat them by using their fear of death.<br />
4.3.2.2 Measure for Measure<br />
(also "Maß <strong>für</strong> Maß") heißt ein Drama von Shakespeare, das in diesem Schuljahr vom Leistungskurs<br />
E 42 gelesen wurde. Wir konnten uns anfänglich nur schwer auf dieses relativ<br />
selten gespielte "Problemstück" Shakespeares einigen, bei einer Abstimmung ergab sich<br />
immer ein Gleichstand mit dem wesentlich populäreren "Sommernachtstraum", aber dann –<br />
heads or tails? - warfen wir eine Münze und entschieden so.<br />
Nach der Beendigung der Lektüre zeigten sich die Kollegiaten sehr angetan von der Komödie,<br />
die zwar bereits vor über 400 Jahren entstand, sich aber mit so aktuellen Themen wie<br />
Regierungsstil, Sexualmoral oder religiösem Fundamentalismus ebenso auseinandersetzt<br />
wie mit den alten Menschheitsfragen nach dem Sinn von Leben, Tod und Liebe. Wer jetzt<br />
allerdings meint, es handle sich um ein ausschließlich ernstes und philosophisches Stück<br />
Weltliteratur, der irrt: Die Szenen der "low comedy" mit dem Polizisten, der versucht klug<br />
daherzureden und dauernd Fremdwörter verwechselt, oder mit dem verurteilten Mörder, der<br />
sich schlichtweg weigert sich hinrichten zu lassen, weil er den Vollrausch der vergangenen<br />
Nacht noch nicht ausgeschlafen hat, gehören wohl zum Witzigsten, was der Barde aus<br />
Stratford je verfasst hat.<br />
73
Einige Compositions, die im Zuge der Beschäftigung mit "Measure for Measure" entstanden,<br />
sollen zeigen, wie kreativ und einfühlsam die Studierenden mit dem Text umgingen.<br />
1. Lucio is sorry about slandering the Duke. Write his letter of apology to Vincentio!<br />
74<br />
Dear Duke Vincentio,<br />
I am writing you this letter to confess that I might have said one or more words about<br />
you which, if they came to your ears, might sound like insults. Please let me explain how<br />
the situation arose in which some words about Your Highness may have slipped out of<br />
my mouth.<br />
I, who usually am a very thoughtful man and who never have any vicious intention,<br />
wanted to see whether the people of Vienna respect their Duke the way he deserves it.<br />
So I came to the conclusion that I would have to see the people's reaction if someone<br />
tried to slander your honour.<br />
I can report to you that almost all the people of Vienna do not like to see their Duke being<br />
slandered. There were people who I thought I had to test more thoroughly, consequently<br />
there might be the possibility that I went too far and that I myself unintentionally<br />
crossed the thin line between testing people and slandering you.<br />
I do hope you can forgive me the rather slippery way I chose, which was meant to serve<br />
you but turned out to<br />
be wrong.<br />
Yours truly,<br />
Lucio<br />
Thomas Huber, K4<br />
2. Claudio has written a book entitled "Under the Hangman's Noose" about his experiences<br />
in prison. Write down an interview with him!<br />
C = Claudio; R = Reporter<br />
R: Good morning, Lord Claudio! You have published a book entitled "Under the<br />
Hangman's Noose". What a funny title! Please explain me and the audience why<br />
you were in prison and how you enjoyed that.<br />
C: Good morning, sir. First of all, you mentioned that the title is funny. Let me explain<br />
that this is pure irony. Have you not checked that?<br />
Now my story: I was condemned to go to prison because my girlfriend, whom I<br />
love very much, was pregnant and we were not married at this time. Lord Angelo<br />
wanted to set an example and wanted my death. I have chosen the title because<br />
it shows the facts!<br />
R: Tell us about your feelings during your stay in prison!<br />
C: I still feel the fear of it, the closeness of death! And I could not accept to be dead.<br />
Not to see my new-born baby – how terrible!
And I was also sad about my sister Isabella. She didn't want to help me because<br />
she would have had to accept a mad contract with Lord Angelo: her virginity for<br />
my life! But an incident saved my life and the hangman went to a reopened<br />
brothel to enjoy himself. Everybody is happy.<br />
R: Thank you for the short interview and for sharing your experiences! I hope you<br />
won't get mad, due to your time in prison. Good morning!<br />
C: Mad? Why? Now I have a baby – a new, wonderful experience! I wish you and<br />
your audience a good time!<br />
Katharina Musch, K4<br />
3. The Duke is back! Write a short newspaper article about this event. It is up to you<br />
whether you write for a tabloid or a serious paper.<br />
THE DUKE IS BACK!<br />
Citizens of Vienna – the Duke is back!<br />
Yesterday there was a big trial in the city where Isabella, a nun, accused Angelo of having<br />
illegal sex with a woman. First nobody believed in the confession, but later on even<br />
the Duke appeared to prove it himself.<br />
Citizens of Vienna, can you believe that our angel Angelo, who sent our best people to<br />
death for even less appears now to be even worse than anybody could have thought of?<br />
Thank God our real ruler is back, so life can go on without fear for one's life! Good as<br />
the Duke is, he forgives Angelo, yet makes him marry Mariana, whom he was engaged<br />
to a long time ago. Angelo had ended the engagement due to the loss of his fiancée's<br />
dowry.<br />
There is more good news: the Duke will marry Isabella! Congratulations from all of us to<br />
our dear Duke!<br />
So finally there is only one thing to say: WELCOME BACK !!!<br />
Michaela Oji, K4<br />
4. Mariana as Mrs Angelo. Three months after her wedding to Angelo Mariana gives a<br />
spectacular interview to a women's magazine.<br />
M = Mariana; R = Reporter<br />
R: Mrs Angelo, it has now been three months since your wedding to Angelo. How<br />
would you describe your marriage?<br />
M: Well, I think I can say I'm a happy woman! I've had to wait for such a long time till<br />
my beloved husband was convinced to marry me although my dowry was gone.<br />
But as you can see, everything worked out fine for me. We are even planning to<br />
get a dog!<br />
75
76<br />
R: I think the one thing that interests our readers most is: What is your secret that<br />
allows you to lead such a complete and happy marriage?<br />
M: Well, I was engaged to Angelo for a long time as you might know but he kind of<br />
wanted to delay the wedding until my dowry would reappear. Well, then one day<br />
the Duke visited me, disguised as a friar – I recognised him at once but I didn't<br />
tell anybody! – and told me about his plan to send me to Angelo. I agreed immediately<br />
and that's the way Angelo became infatuated with me again!<br />
R: There are some rumours that Angelo was forced into this marriage by ducal assignment.....<br />
M: (furious) Not one word of these defamations is true! Fact is that Angelo became<br />
infatuated with me.<br />
R: Mrs Angelo, thank you for this most interesting interview! And good luck with<br />
your marriage!<br />
M: Anytime.<br />
Nadja Neumann, K4<br />
5. You are a citizen of Vienna. Write a letter to the editor in which you complain about the<br />
absence of Duke Vincentio and about Angelo's strict rule.<br />
Dear Sir,<br />
As you know the Duke has left Vienna without announcing it before. It was a sudden<br />
decision and thus it was not correct, no one was prepared to adjust to the imminent<br />
situation.<br />
Since the Duke has left Vienna, everything has got much worse. The Duke's deputy<br />
does not seem to be a very sympathetic person. Rumours are widely spread in Vienna<br />
that Angelo has a very strict moral attitude and that because he wants to make himself a<br />
name he has introduced very strict rules in Vienna, where innocent people are put in<br />
prison.<br />
Unfortunately Angelo is forfeited to Angelo's strict laws. Claudio is caught in prison and<br />
is condemned to death just because he made love with his fiancée. That is too strict, it<br />
is too cruel!<br />
Yesterday I tried to start a general conversation with Angelo, but he was too proud to<br />
speak to me; he just closed the door and didn't let me enter his office. How can we be<br />
governed by such an arrogant deputy, who does not even have enough patience to approach<br />
people and find solutions to their problems? I am absolutely sure that the Duke<br />
would not ever have been as strict as Angelo is. He was really a person with much wisdom.<br />
Almost nobody in Vienna can wait for the Duke to return. We want the Duke to resume<br />
his government and restore the rules!<br />
Yours truly,<br />
Farid Temori, K
6. Isabella explains to the leader of her convent that and why she has to leave the order<br />
and become Duke Vincentio's wife. Write her letter to the Mother Superior or the conversation<br />
between the two women.<br />
Dear Mother Superior,<br />
I do not know how to tell you. For four days I have run the streets up and down, I cannot<br />
sleep in the nights and during the day I find no rest and feel like lost in space. I do not<br />
know where all my spirit is gone – and all my good convictions to join your convent.<br />
During the time when my brother was in prison and waited for his death I had a big<br />
quarrel with Lord Angelo, the Duke's deputy, and while we were arguing I noticed these<br />
feelings about life, love, and all the suppressed emotions - I thought I could stand my<br />
emotions, but I couldn't, I was weak.<br />
The reason why I wanted to join the nunnery was that my emotions had got lost and my<br />
humanity had been swept away. I came to you to find myself and became aware of my<br />
feelings and emotions and I wanted to live with strength and in chastity.<br />
But the situation has changed, the Duke has proposed to me, offered me the chance to<br />
spend my life next to him and so I come to the final conclusion that I will accept his proposal<br />
and become his wife.<br />
Thank you for your love and care and the possibility to have a closer look at your convent,<br />
thank you also for accepting my decision to go. I hope that I can come back every<br />
time when I need a rest to bring my thoughts to the right order.<br />
Thank you for all the things you have done for me.<br />
Isabella<br />
Katharina Musch, K4<br />
4.3.2.3 Dialogue about the <strong>Abendgymnasium</strong><br />
Write down a dialogue between two people. One of them thinks the <strong>Abendgymnasium</strong> is a<br />
great and helpful institution of further education, while the other believes that it is just a huge<br />
waste of the taxpayers' money.<br />
Dialogue 1<br />
Eddy and Sam are both working in the same company. They share one office. In the lunch<br />
break they have a discussion about further education.<br />
Eddy: You know what, Sam, I’ve been thinking about enrolling in the <strong>Abendgymnasium</strong><br />
here in Munich to take the Abitur. I’d like to improve in the job and<br />
there’s no other possibility than to study.<br />
77
Sam: I think it’s a good idea to improve but I think it might be expensive to pay all<br />
the courses.<br />
Eddy: Don’t you know the <strong>Abendgymnasium</strong> is for free like any other public school?<br />
You only have to pay a small amount for books and for paper.<br />
Sam: What??? I beg your pardon! Did you say it was for free? I don’t think that’s<br />
alright. At a certain age the responsibility for education should lie in the hands<br />
of the people that are interested themselves and not in the hands of the state!<br />
This costs a lot of money and times are bad anyway, so we need to save<br />
money.<br />
Eddy: I don’t agree with you. It’s important that education for all ages is for free. If<br />
people can get a better education it might save them from unemployment. So<br />
the state has to pay less. That’s how money can be saved.<br />
Sam: But the <strong>Abendgymnasium</strong> takes place in the evening! You have to go there<br />
after an eight-hour day! I have heard that more than one half of the students<br />
that start drop out before they reach their Abitur. If that’s not a waste of<br />
money, what then??? You could just attend a computer course or a language<br />
course here at the company. It’s cheaper than at special institutes.<br />
Eddy: It’s a difference if you just do a course or get the qualification to study. It<br />
opens the door to much better possibilities.<br />
Sam: I am not convinced at all. If you do that you’ll probably be tired at work because<br />
you stay up late to learn.<br />
Eddy: We’ll see. I’ll prove you wrong!<br />
Karina Kienzler, K4<br />
Dialogue 2<br />
A: I heard you attend the <strong>Abendgymnasium</strong>!!!!?<br />
B: Yes, that’s right. Every evening I have to go to school – from Monday to Friday.<br />
A: Every evening? And why are you doing this?<br />
B: I want to improve my knowledge. We have to learn two languages: English, combined<br />
with Latin or French. And we have lessons in physics, maths and geography.<br />
A: What’s your goal? Do you want to study after the exam?<br />
B: I'm not sure. It’s a lot of stress and after the four years now I need a recreation break.<br />
A: How much money do you have to pay? Is it very expensive?<br />
B: No, we don’t have to pay anything! It’s for free! The teachers are paid by the City of<br />
Munich.<br />
78
A: From our taxes??? How many people start and how many of them reach the Abitur?<br />
B: In 2003 about 120 students started and now we are 35.<br />
A: So I have paid taxes for 120 people who quit. I spent my money on nothing!<br />
B: No, each of them got a certain education. Look, after two years of French you’ve a<br />
good chance to get a better job – also without the Abitur. And for many ...<br />
A: But I would prefer to give my money to normal schools – they need it to pay social<br />
workers for the children, especially for the foreigners.<br />
B: But there’s a lot of people who didn’t have a chance to take the Abitur and to study,<br />
when they were young, even if they were intelligent enough. And most of the students<br />
of the AG, who made it, now have qualified positions. They are indeed motivated<br />
and try to give society something back because of the possibility to reach their<br />
dream – the Abitur!<br />
Georgia Melchner, K4<br />
Dialogue 3<br />
Mr Black: Hello, Mr White. I haven’t seen you for quite for a while. How have you been<br />
doing?<br />
Mr White: I’m doing great. By the way, did you know that I started attending school<br />
again?<br />
Mr Black: Really? What did you do that for?<br />
Mr White: Well, a friend of mine told me about the <strong>Abendgymnasium</strong>, which allows you<br />
to do the Abitur in evening classes.<br />
Mr Black: What do you need the Abitur for? A grown man of your age! Don’t you think<br />
there are more important things than playing little boy again?<br />
Mr White: I think this is a great opportunity to get a better education. There are many<br />
different people there with a variety of backgrounds that kept them from getting<br />
that kind of education.<br />
Mr Black I think it is very normal that not everyone wastes 13 years of his life on going<br />
to school. Anyway, how can you afford such a thing? I don’t think taxi-drivers<br />
earn that much money?<br />
Mr White: Well, you haven’t heard the best of it. It’s free! And since the classes are on<br />
evenings you can continue working.<br />
Mr Black: Well, that’s nice! That means with my tax money I pay for your fancy dreams<br />
of becoming an egghead!!!!<br />
Mr White: I cannot agree with that! I think in the long run it is more expensive to have<br />
people uneducated since education reduces the likelihood of unemployment<br />
drastically. Imagine how expensive mass unemployment to the taxpayer is!<br />
79
Mr Black I haven’t seen it from that point of view. I, however, am satisfied with what I’m<br />
doing. There’s nothing wrong with fixing cars for a living. There will always<br />
cars to be fixed.<br />
Mr White: Well, I’ve got to go now. Class is starting at five o’clock.<br />
Mr Black: See you!<br />
Thomas Huber, K4<br />
4.3.2.4 Recommended Reading<br />
Studierende des Leistungskurses E 41 (Kursleiter Herr Viebeck) stellten auch in diesem<br />
Schuljahr in Referaten englischsprachige Romane aus der jüngsten Vergangenheit vor. Drei<br />
besonders gelungene Beispiele hieraus könnten auch als Lektüretipps <strong>für</strong> Leser des <strong>Jahresbericht</strong>s<br />
dienen.<br />
The Curious Incident of the Dog in the Night Time<br />
A novel by<br />
Marc Haddon<br />
1. Characters<br />
80<br />
Christopher Boone (main character):<br />
honest, smart, clever<br />
15 years old<br />
has Asperger's Syndrome ( a form of autism)<br />
mood depending on proper order of things<br />
insufferable if things go wrong<br />
has difficulty in understanding human behaviour, gestures and relationships<br />
photographic memory<br />
good at maths<br />
Ed Boone (his father)<br />
hardworking electrician<br />
patient with his son<br />
demanding, caring<br />
swears a lot<br />
problems with accepting the past<br />
lied to Christopher about his mother<br />
Judy Boone (his mother)<br />
left her family for her neighbour<br />
caring, full of love<br />
short-tempered<br />
Siobhan (his teacher)<br />
knows Christopher very well<br />
tells him exactly what to do
explains things to him<br />
encourages him to write a story<br />
2. Setting and time<br />
Swindon, a small town in England<br />
present time, about 1998<br />
3. Plot<br />
Christopher discovers the dead body of Wellington, the neighbour's dog, in the garden.<br />
Siobhan encourages him to write a story about finding out who killed this dog. As Christopher<br />
can't write fictional texts he decides to investigate this case. He forces himself to<br />
talk to strangers and writes everything in his book, even what he has learnt by talking to<br />
various neighbours: that his mother had an affair with his direct neighbour, Mr Shears.<br />
But Christopher's father finds the book and hides it. As the boy is looking for his book he<br />
finds letters from his mother addressed to himself. He concludes that his mother is still<br />
alive. While Christopher is still reading the letters his father finds him and tries to explain<br />
why he lied to him. He also confesses that he killed the dog.<br />
From this moment on Christopher is afraid of his father because he is a liar and a killer.<br />
So he leaves him and travels to his mother, who lives in London, which is a great adventure<br />
for him. Christopher's mother cares for him. After a few days they go back to their<br />
home town because Judy cannot take care of him in London. His father tries to forgive<br />
his behaviour but Christopher still ignores and fears him. In the end his father gives him<br />
a dog and they try to get along with each other.<br />
4. Literary techniques<br />
first person narrator<br />
chapters are given prime numbers<br />
alternation between the plot and subjects not connected to it (e.g. Christopher's atheism)<br />
includes different mathematical puzzles<br />
includes a lot of drawings, which are linked to the text<br />
precise and reliable narration, easy to understand<br />
adults use a lot of swear words<br />
5. Final conclusion<br />
This novel elaborates on the different perception of the world experienced by people suffering<br />
from autism.<br />
Carsten Ennulat, K 4<br />
81
The Rachel Papers<br />
by Martin Amis<br />
1. Author<br />
Martin Amis was born in Cardiff, Wales, on 25 th August 1949<br />
His father was also a novelist<br />
He names Jane Austen as his earliest influence<br />
At the age of 27 he became a literary editor<br />
With his first novel "The Rachel Papers" he won the Somerset Maugham Award<br />
He has become a famous English novelist<br />
2. Main characters<br />
Charles Highway<br />
is 19 years old<br />
approaches women systematically only to have sex with them<br />
is determined to have sex with an older woman before he turns 20<br />
is very intelligent and maybe therefore often arrogant<br />
studies literature in London, next to "women"<br />
is very sarcastic<br />
The author Martin Amis has acknowledged that Charles Highway is autobiographical.<br />
Rachel<br />
82<br />
is met by Charles at a party<br />
pretends to be very cool and somehow different from the others<br />
impresses Charles from the first moment on and his feelings for her are growing very<br />
quickly<br />
is also attracted to him after a while<br />
leaves her present boyfriend to be with Charles<br />
starts to be almost devoted<br />
Charles' family<br />
His parents are still married but his father regularly has affairs with younger women<br />
His mother just suffers it<br />
His elder sister is married to a very violent man who is not averse to alcohol<br />
Charles lives with them during his time in London<br />
3. Contents<br />
Charles Highway will shortly turn twenty<br />
He "studies" women until he meets Rachel<br />
First he has to fight for Rachel but after some ups and downs she leaves her present<br />
boyfriend to be with Charles<br />
Now Charles has to learn the difference between how to get a woman into bed and a<br />
real relationship<br />
Charles learns more and more about the PERSON (!) Rachel<br />
In between Rachel turns twenty before Charles does and so she is the "older"<br />
woman<br />
His affection for her decreases<br />
.....<br />
And now to find out if he can change his old style and if he can make this relationship<br />
work, you will have to read the book yourselves :) ...!
4. Narrative structure and technique<br />
5. Language<br />
6. Tone<br />
first person narrator, who sometimes likes to talk in the third person ("Charles, how<br />
could you ...?!")<br />
not omniscient, but limited point of view because the narrator only knows Charles'<br />
emotions for sure<br />
mostly written like a diary or journal<br />
more descriptive passages than dialogue<br />
often a foul language<br />
direct specifications and therefore sometimes a bit disgusting<br />
very emotional<br />
very sarcastic<br />
cynical sense of humour<br />
emotional – the reader will vehemently approve or disapprove of Charles' behaviour<br />
or attitude<br />
7. My opinion<br />
This book was very amusing for me because of its sarcasm.<br />
Only the flashbacks were sometimes confusing, but I got used to them after a while.<br />
Charles Highway is a young man who makes you love and hate him. Reading that book<br />
was really fun for me! Maybe not everybody will like its ending but I think it is the best<br />
one for such a story.<br />
So if you are a fan of sarcasm and irony just go ahead and read the novel!<br />
Andrea Sikic, K 4<br />
Extremely Loud and Incredibly Close<br />
by Jonathan Safran Foer<br />
1. The author Jonathan Safran Foer<br />
was born in Washington, D.C, in 1977<br />
is an American writer best known for his 2002 novel "Everything is Illuminated",<br />
which garnered him the National Jewish Book Award and the Guardian First Book<br />
Award<br />
attended Princeton University where he studied philosophy and literature<br />
has been published in the Paris Review, Conjunctions, The New York Times, and<br />
The New Yorker<br />
lives in Brooklyn with his wife (the novelist Nicole Krauss) and their son Sasha<br />
83
2. Plot<br />
84<br />
In his second novel, which was one of the first to deal with the terrorist attacks of September<br />
11, 2001 and was published in 2005, Foer uses 9/11 as a backdrop to the story<br />
of 9-year-old Oskar Schell, who must learn how to deal with the death of his father in the<br />
World Trade Center. The story is told from three different points of view, which are not all<br />
in the same time line.<br />
Foer uses an over-educated, over-sensitive and naive child as a first person narrator.<br />
The important theme is the key that Oskar finds in an envelope located in a pot belonging<br />
to his dead father. This key causes him to find the solution to a great mystery – a<br />
kind of detective story, which involves a hidden answering machine in a closet with messages<br />
from the morning of "the worst day" and feelings of hate and confusion over his<br />
mother's new friend. The key symbolises a search coming from deep within Oskar.<br />
Foer also uses two other narrators in a parallel story set in the past. These narrators are<br />
Oskar's paternal grandparents, who tell the reader the story of their childhood, courtship,<br />
marriage, and separation before the birth of Oskar's father. Their grief, like Oskar's,<br />
arises from a single horrible event – the firebombing of their home in Dresden, Germany.<br />
In their old age they only hope that the lives of their son and their grandson will be<br />
happy, but after "The worst day" one must wonder if Oskar's grief will destroy him as it<br />
destroyed his grandparents.<br />
3. Literary techniques<br />
multimedia sensibility through photos, visual tricks, type settings, spaces and blank<br />
pages as a visual dimension beyond the prose narrative<br />
images connecting ideas, topics, emotions mentioned on earlier pages<br />
first person narrator<br />
simple language<br />
parallel story in the form of a letter<br />
humorous and emotional tone<br />
4. Personal assessment<br />
Reading this novel was a new experience for me, not only because of the images causing<br />
visual effects but also because of its emotional tone, which brings tears into your<br />
eyes.<br />
In this novels I also see some parallels to Günter Grass's "Blechtrommel". Its simple language<br />
makes this book worth reading even for an inexperienced reader of English literature<br />
like me.<br />
Reading the letter part of the novel you could sometimes get confused – not knowing<br />
who the writer of the letter is. Yet all in all, it is a very impressive book, which is worth<br />
reading.<br />
Safet Vilic, K 4
4.3.3 Französisch<br />
Grundkurs Französisch kreativ<br />
Bei den folgenden Beiträgen handelt es sich um Beispiele kreativen Schreibens (nach Aufgaben<br />
aus dem Lehrbuch) von Studierenden aus dem Grundkurs f31.<br />
Cours intensif 2, p.14,6<br />
Choisissez des verbes avec le préfixe « re- » et écrivez un petit texte.<br />
L’été dernier, le petit lièvre Jacques a décidé de faire une randonnée dans le bois où il vivait.<br />
Ce jour-là, sa mère devait faire des courses, alors Jacques pouvait sortir sans être remarqué.<br />
Pendant sa randonnée, il a monté des collines, a escaladé au-dessus et au-dessous<br />
des grandes racines et il a traversé un ruisseau quand, tout à coup, un pré très vert en<br />
pente douce s’est présenté. Pour un moment, le petit lièvre n’a pas bougé parce qu’il était<br />
très étonné. Il n’avait jamais vu quelque chose d’aussi beau. Mais il n’a pas pu résister et il a<br />
commencé à faire des culbutes. Il en a fait une, deux, trois, … jusqu’à ce qu’il arrivât au bout<br />
du pré. Là, il est resté allongé et il a regardé le ciel et sans s’en apercevoir, il s’est endormi.<br />
Quand il s’est réveillé, la nuit était déjà tombée et le petit lièvre a eu peur. Où était sa mère,<br />
où était-il ? Et qui faisait tous ces bruits sinistres ? Jacques ne voulait que revoir sa mère.<br />
Alors il a commencé à remonter le pré, retraverser le ruisseau et remonter les collines, mais<br />
il ne retrouvait pas sa maison. Il repensait à toutes les bonnes heures qu’il avait passées<br />
avec sa mère et il devenait très triste parce qu’il pensait qu’il ne la reverrait jamais. Elle, elle<br />
l’avait cherché depuis quelques heures et quand elle a retrouvé son fils, tous les deux<br />
étaient très heureux et après avoir promis qu’il n’allait plus jamais s’enfuir, il a parlé et reparlé<br />
de ses aventures.<br />
Nina Reinke, f31<br />
Cours intensif 2, p.19, 1b<br />
1. Emilien a lu l’annonce d’une dame qui cherche un baby-sitter pour ses deux enfants<br />
(2 et 4ans). Il lui téléphone pour lui dire qu’il est intéressé. Ecrivez le dialogue entre<br />
Emilien et la dame.<br />
- Bonjour, Madame. Je m’appelle Emilien et j’ai besoin d’un magnétoscope.<br />
- Comment ? Je ne comprends pas !?<br />
- Alors, mon copain Xavier Richard a un magnétoscope et il a beaucoup de<br />
cassettes vidéo.<br />
- Je crois que tu as fait le mauvais numéro.<br />
- Non, Madame. Je veux gagner assez d’argent pour m’en acheter un.<br />
- Ah, tu as lu mon annonce ?<br />
- Oui. J’ai lu que vous cherchez un baby-sitter. Voilà, je suis le nouveau babysitter<br />
pour vos enfants !<br />
- Calme-toi ! Tu t’appelles Emilien et tu t’intéresses au travail de baby-sitter,<br />
c’est vrai ?<br />
- Oui. C’est vrai.<br />
- Mais as-tu déjà fait du baby-sitting ?<br />
- Non, mais ce n’est pas un problème parce que je vais être le meilleur.<br />
- Oh là là. J’ai deux enfants de 2 et 4 ans, ça ne va pas être très facile ! Mais je<br />
te donne une chance. Viens me voir lundi à la maison pour travailler une<br />
heure ! D’accord ?<br />
- D’accord. C’est super ! A lundi !<br />
Melanie Stobernack, f31<br />
85
2. Emilien fait du baby-sitting pour la première fois. Imaginez la scène. Travaillez en<br />
groupes et écrivez un petit texte.<br />
86<br />
Emilien doit faire du baby-sitting chez une dame qui a deux enfants : Pierre, deux<br />
ans, et Viktor, quatre ans.<br />
Quand il arrive, la mère dit : « Salut, Emilien ! Je n’ai pas beaucoup de temps. Pierre<br />
est au lit et Viktor est en train de regarder une cassette vidéo. Quand Pierre se réveillera,<br />
tu trouveras le repas dans le frigo. Mets-le dans le micro-ondes. Ils doivent<br />
se coucher à 19 heures. Au revoir ! »<br />
Emilien va dans la salle de séjour et s’assoit près de Viktor. Comme la vidéo est très<br />
ennuyeuse, il s’endort.<br />
Quand il se réveille, Viktor se met à rigoler. Emilien voit un rouge à lèvres dans sa<br />
main et comprend. Au moment où il veut se regarder dans le miroir, Pierre commence<br />
à pleurer. Emilien court vers Pierre et le prend dans les bras. Ils vont dans la<br />
cuisine et Emilien met le repas, que la mère a préparé, dans le micro-ondes.<br />
Tout à coup, il entend un bruit d’enfer et va voir Viktor. C’est une catastrophe ! Dans<br />
la salle de séjour, il y a un bazar.<br />
A ce moment-là, la mère arrive. Quand elle voit Emilien, elle doit rigoler et lui donne<br />
un miroir. Il doit rire aussi.<br />
Derya Acikgöz, Barbara Baumgartner, Manuela Lerchl, f31<br />
4.3.4 Physik<br />
Physik Grundkurs – multimedial<br />
Wer erinnert sich nicht an den Physikunterricht früherer Tage? Hinter dem Lehrer befand<br />
sich die dunkelgrüne Tafelfläche, beschrieben mit diversen Formeln, Berechnungen und<br />
Skizzen, und des öfteren verursachte die zum Schreiben verwendete Kreide ein unangenehmes<br />
Quietschen auf der Tafel, das einem jedes Mal aufs Neue durch Mark und Bein<br />
fuhr.<br />
Auf diesen kostenlosen Weckservice mussten wir im Physikgrundkurs des Herrn Singer verzichten.<br />
Stattdessen saßen wir im häufig abgedunkelten Raum und betrachteten die via<br />
Beamer auf die Projektionstafel geworfenen Unterrichtsskripten unseres Kursleiters.<br />
Diese Skripten hat er zuvor selbst entworfen und in eine Homepage gebastelt, die von jedem<br />
einzelnen Schüler vom heimischen Wohnzimmer aufgerufen werden konnte, vorausgesetzt<br />
natürlich, dass man über einen Internetanschluss verfügt.<br />
Nicht vergessen möchte ich in diesem Zusammenhang die vielen integrierten Java-Applets,<br />
die die zumeist recht abstrakten physikalischen Vorgänge visualisierten und somit einen<br />
nicht unbedeutenden Beitrag zum Verständnis des Unterrichtsstoffes beitrugen.<br />
Auf diesem Wege war es ebenfalls möglich die Skripten auszudrucken, was einen eindeutigen<br />
Vorteil gegenüber eigenen, manchmal unvollständigen Unterrichtsmitschriften des Tafelbildes<br />
darstellte. Einziges Problem war anfänglich die <strong>für</strong> manche Browser, so auch meinen,<br />
ungünstige Formatierung der Internetseite, was den Ausdruck zur Geduldsprobe werden<br />
ließ. Aber auch dieser Schwachpunkt wurde mit Beginn der K4 behoben.
Insgesamt ist festzustellen, dass dieses Projekt, also die Unterrichtsgestaltung mit häufigem<br />
Einsatz eines PC, eindeutig angenehmer und produktiver ist als das herkömmliche Verfahren.<br />
Vielleicht lässt sich dieses Modell in Zukunft auch auf andere Fächer ausweiten, zu<br />
wünschen wäre es jedenfalls.<br />
Ingo Lauer, K4<br />
4.3.5 Biologie<br />
Exkursion zum Wendelstein am 14.10.06<br />
"Hier ist der Beweis: Herr Endraß hat einen Vogel...............!"<br />
– das hat wohl so mancher Schüler<br />
bei diesem Anblick gedacht. Entstanden ist<br />
das Bild in luftiger Höhe am Wendelstein.<br />
Geo-biologische Führung am Wendelstein hieß<br />
die Einladung, an der sich Studierende unterschiedlicher<br />
Jahrgangsstufen beteiligten. Wir<br />
hatten uns ein herrliches Wetter mit Regenschein<br />
ausgesucht und alle Teilnehmer erschienen<br />
mit guter Laune. Gestärkt bzw. gewärmt<br />
mit heißem Tee fuhren wir gemeinsam<br />
auf den Gipfel.<br />
Foto: Stefan Beckmann<br />
Dort erwarteten uns Nieselregen, Nebelfetzen, Wind und eine beeindruckende Bergstimmung,<br />
wie sie nur bei solchem Wetter sein kann. Wir wanderten, während wir uns über den<br />
Gesteinsaufbau, die Vegetation und die Entstehung des Wendelsteins informierten, um den<br />
Gipfel und danach in die Wendelsteinhöhle. Anschließend erläuterte uns die Dame von der<br />
Wetterstation ausführlich ihre Aufgabengebiete. Wir bestaunten auch das Foto eines Tornados,<br />
das vom Wendelstein aus aufgenommen wurde.<br />
Für die Studierenden war es natürlich besonders<br />
vergnüglich anzusehen, wie die Bergdohlen<br />
um ihre Mahlzeit auf dem Kopf ihres Biologielehrers<br />
stritten. Die Tour wurde selbstverständlich<br />
mit einer Brotzeit im Bergrestaurant<br />
beendet.<br />
Werner Endraß<br />
Foto: W. Endraß<br />
87
4.3.6 Englische Konversation<br />
4.3.6.1 The Time Capsule<br />
Der Kurs sprach über die Tradition, charakteristische Gegenstände in Kirchturmspitzen oder<br />
Grundsteinen wichtiger Bauwerke zu platzieren, um künftigen Generationen Informationen<br />
über die Vergangenheit zu hinterlassen. Dabei wurde auch auf die "Zeitkapsel" der Weltausstellung<br />
in Brooklyn von 1939 und ihren Inhalt eingegangen. Schließlich erhielten die Kursmitglieder<br />
die Aufgabe, in Partnerarbeit eine Liste von ca. zehn charakteristischen Gegenständen<br />
zusammenzustellen, die sie heute in eine Zeitkapsel legen, vergraben und so <strong>für</strong> die<br />
Nachwelt in ca. 500 Jahren aufbewahren würden. Der Inhalt der Zeitkapsel sollte ein möglichst<br />
vielfältiges, präzises und aufschlussreiches Bild unserer Gegenwart vermitteln.<br />
Nachdem die Studierenden ca. 20 Minuten an ihrer Liste gearbeitet hatten, stellten die einzelnen<br />
Kleingruppen mit Tafelanschrift dem Plenum ihre Ergebnisse vor. Die Listen stammen<br />
von Heike Barnes, Christiane Bauch, Harriet Göckel, Bernd Goretzka, Nicole Heese,<br />
Susanne Menhart, Ada Samlinski, Kathleen Scheffler, Manuela Thiele.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
Time Capsule, List 1<br />
88<br />
newspapers (one tabloid, one broadsheet)<br />
a political map<br />
coins<br />
"Harry Potter"<br />
photos of various things, e.g. buildings, animals, etc.<br />
the "<strong>Jahresbericht</strong>" of the <strong>Abendgymnasium</strong><br />
a Bavarian watch, which goes backwards<br />
seeds from various plants<br />
Time Capsule, List 2<br />
several euro coins<br />
"Harry Potter" – a typical book<br />
Gameboy or another typical electronic game<br />
a mobile phone<br />
"Monopoly" – a typical board game<br />
a cassette recorder and a video recorder<br />
a techno record<br />
a Red Bull tin<br />
a piece of the Berlin Wall<br />
an IKEA catalogue<br />
a McDonald's menu<br />
a report about the lack of children<br />
a newspaper with an article on terrorism<br />
Time Capsule, List 3<br />
a 1-euro coin and a banknote
a photograph of a couple (from our course!) in Bavarian costumes<br />
a newspaper with pictures and articles about cars => to show what technological progress<br />
on earth was like at our time<br />
a mobile phone => to inform the people of the future about communication<br />
a bottle of Bavarian beer => to explain culture<br />
a map which shows places where nuclear waste is buried => to warn the next generations<br />
symbols of the great religions of our time: cross, half moon, buddha, etc.<br />
a globe => to show our understanding of the earth<br />
some dictionaries => to show that there were various languages<br />
Ötzi => to confuse the capsule finders<br />
Time Capsule, List 4<br />
This is a regional list; mainly Bavarian objects are put into the capsule.<br />
coins<br />
a newspaper<br />
an iPod with music and instructions<br />
recipes: cakes, cookies, Weißwurst, Brezn, sweet mustard, white beer, maybe whisky<br />
dirndl dress and lederhosen<br />
colourful, flavoured condoms plus instructions<br />
a memory stick plus instructions with various pictures and curricula vitae<br />
a first aid kit, including sun cream, sun protection and a sun blocker suit<br />
genetic substance stemming from the teachers of our school<br />
4.3.6.2 New ideas?<br />
Schuljahr <strong>2006</strong>/07<br />
3. Leistungserhebung im Grundkurs ekon am 15.5.<strong>2007</strong><br />
Stoff: Diskussion in einer größeren Gruppe<br />
Vertreten unterschiedlicher Standpunkte<br />
Zustimmen, Widersprechen, Einigung erzielen<br />
Situation 1<br />
The <strong>Abendgymnasium</strong> in München thinks about introducing mono-educational classes from<br />
next school year on. The female class is supposed to help students overcome their problems<br />
with sciences; the male class is supposed to reduce students' deficiencies in reading.<br />
The headmaster / headmistress hopes to come to a conclusion and final decision. In your<br />
discussion you should also consider social consequences!<br />
Participants: A = the headmistress of the school<br />
B = a teacher who is in favour of this project<br />
C = a teacher who is against this project<br />
D = an experienced student<br />
89
A: Good evening ladies, good evening gentleman! Tonight we are here to discuss this<br />
matter of really overriding importance not only for the students but as well for the<br />
teachers of our school. I'd really like to come to a conclusion today just to summarise<br />
what has happened and how we came to the central thing that mono-educational<br />
classes will be much better or give many more advantages to our students and<br />
teachers. Just to summarise things: our teachers, especially of mathematics and<br />
physics, have found out that our female students are suffering from male students<br />
because they can't follow the lessons and they are overrun by the male students.<br />
And the other way round, our teachers of German and English have found out that<br />
male students have often refused to read. They are also inhibited when it comes to<br />
reading out loud. So this is why we were thinking of mono-educational classes and<br />
therefore I would like to hear your opinions and I hope we will come to a conclusion<br />
today. It's up to you now!<br />
B: My opinion is that we have to distinguish between male and female students. It is a<br />
problem that the learning opportunities are so different and we have to support our<br />
students in different ways I think. It is very important to introduce mono-educational<br />
classes so that we can focus on the different problems. Our females have problems<br />
with sciences and the male students have problems with reading, so we ...<br />
A: We could really help them in mono-educational classes, you mean?<br />
B: Yes. When they are only among female students they would have more courage to<br />
ask things which are natural to male students.<br />
A: Well, this is only one aspect. You are against this suggestion, I think?<br />
C: Yes, I am against mono-education because I think it will not be good for our future.<br />
A: Why? Do you think it will be a social problem? Do you think that lessons ...<br />
C: In general it can't be that men are not good at languages and women are not good at<br />
sciences!<br />
A: Do you think that it is not a thing of male and female students but that it's a different<br />
problem?<br />
C: Yes! They could help each other. And if you separate them it is not good because<br />
they can't help each other any more.<br />
B: Well, but on the other hand school is important to solve these problems. Obviously<br />
these are gender problems!<br />
A: We have also got a student here, so maybe we could ask her ...<br />
D: If you separate boys from girls you make one problem go away and the next comes<br />
up! You know we had two test classes in the last month, which tried to make experiences<br />
with mono-education and I'd like to summarise them.<br />
A: Just for information: were you in one of those classes? I just can't remember.<br />
D: Yes, I was. First it was a good idea to improve the situation of female and male students<br />
but, well, we think the effects are too small. Of course the girls asked more<br />
90
questions in sciences, but the experiences of the boys were missed, their ideas, their<br />
help, they couldn't support each other. And with the boys it was the same situation.<br />
A: But from our teacher of maths I got the information that the problems were solved on<br />
a different base. The females found their own way to solve their problems in maths or<br />
sciences while the male students found different ways of solution for language problems<br />
and in the end it was more satisfying for the students. So that's the information<br />
I've got, but of course you are a student yourself ...<br />
C: But we also have female students who are good at maths and physics and we have<br />
male students who are great at languages or German.<br />
A: I think this is exactly the point because it doesn't mean that maths for female students<br />
will be worse than maths for men or will not have the same quality. The lessons<br />
will have the same quality because there are female students who are very<br />
good at maths so they can help the students who are not as good. They will find a<br />
different solution for their problems.<br />
D: It could be a solution to test pupils in several subjects to see where they are better or<br />
worse.<br />
C: There are classes where teachers see that the students are not so good, so they<br />
have to use different methods that they learn.<br />
A: But there is still this point that the two genders use different strategies for learning<br />
and this is the actual problem I want to solve here by having mono-educational<br />
classes. I may also suggest not having all lessons in mono-educational classes, but<br />
only sciences and languages. History and geography would stay in mixed classes. If<br />
you consider that our students will go to university later there will be no monoeducational<br />
lectures provided, so they will have to deal with this situation anyway<br />
somehow, but if we can find a different solution for the problem at our school, I think<br />
this would help.<br />
C: But we must teach German and maths for female and male students!<br />
A: We would always have two or three classes that are not split, then. We would never<br />
test the pupils before to see that we get all the good students in one class!<br />
C: I see no purpose, no sense!<br />
B: I think that teamwork outside of the lessons can also be done, in mixed groups. They<br />
can help each other.<br />
D: I think it is a good idea to do mono-education only in special subjects, because we<br />
have seen that in female classes there are more conflicts, the students are bitchy,<br />
difficult situations arise – I think that's not good for the social climate.<br />
A: I think our students are grown up, we are not a regular school but ...<br />
D: You can't avoid it! If you have classes that are always split up in female and male<br />
then the problems will become even bigger!<br />
A: Is it because you are a student that you are in favour of mixed classes?<br />
D: Of course! I can't say I prefer mono-education in all cases. There are some advantages<br />
but ...<br />
91
A: Will you be satisfied if we leave it that for instance geography and history will stay in<br />
mixed classes and maths and languages ...<br />
B: That would be a good compromise!<br />
A: I would say, we have only done this mono-educational course for two months, we<br />
have not had a whole year and we have not heard any other students. So I think it<br />
would be a good solution if we see after half a year when it comes to the first report<br />
what has changed. Has anything changed? Are our students satisfied? Are the<br />
teachers satisfied? Then we'll meet again and decide.<br />
C: I don't agree! I don't agree!<br />
Heike Barnes, Bernd Goretzka, Janine Heese, Kathleen Scheffler<br />
Situation 2<br />
The <strong>Abendgymnasium</strong> is looking for a partnership in order to add a new dimension to the<br />
school's profile. A board of teachers and students discusses various possibilities. The<br />
headmaster / headmistress hopes to come to a conclusion and final decision. Think of all the<br />
various implications. In your discussion you should also consider social consequences!<br />
Participants: A = the headmistress of the school<br />
B = a student suggesting a partnership with a college in the USA<br />
C = a teacher favouring a partner ship with another<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> in the east of Germany<br />
D = a student supporting the idea of a partnership with some<br />
renowned Munich firm (free decision)<br />
A: Good evening, everybody!<br />
All: Good evening!<br />
A: We are here again and hopefully we'll find a solution for our future partner or partnership.<br />
Well, I'm not in favour of anything, so convince me of your opinion, please!<br />
C: Another <strong>Abendgymnasium</strong> in the east of Germany would be a great idea! It would be<br />
a benefit for our school. We can share the costs for advertisements for example, we<br />
can exchange teachers. It's a good idea to have a partner in the east of Germany.<br />
A: I agree, it's good to get to know different manners even if it's the same institution as<br />
ours.<br />
C: Maybe with the teachers´ exchange we can see how the eastern teachers teach their<br />
pupils because they started their career in the old days of socialism, so maybe they<br />
have got another spirit, another kind of teaching<br />
A: Yes, that could be really interesting.<br />
D: I'm sorry to interrupt you, I know it sounds interesting to you because you are a<br />
teacher, too, but can I ask you where you want to get the money from for the hotel,<br />
for the teachers that we will exchange?<br />
92
C: When one of our teachers goes to their school, then perhaps they can share a flat<br />
and the families.<br />
(Laughter)<br />
D: Yes, you see, we have to make sure that they have a place to stay. Would you like to<br />
take an eastern teacher to your place?<br />
C: Yes, I would, it would be a good idea.<br />
D: So the school would not have any problems with spending money on the teachers´<br />
exchange.<br />
C: Oh no, this could be organised, it's just a question of time.<br />
D: Okay! Because I as a student, I don't really support this idea because I have to pay<br />
40 euros for my books already, so I don't want to spend more of my money on a<br />
teachers´ exchange.<br />
C: Oh no, we would even save money because we could have our advertisements in<br />
the same newspapers or magazines.<br />
A: We could also share a homepage, for instance. And I don't actually think that you as<br />
a student will have to pay for the teachers´ exchange.<br />
D: Oh, so the school will pay for the teachers´ exchange to help me to save money for<br />
my books? Thank you very much! We have to pay for every single copy, for every<br />
book that we buy extra, especially for our English and German lessons.<br />
A: Well, I think what my colleague means is – well, she's not just talking about a teachers´<br />
exchange but perhaps also about a students´ exchange.<br />
C: Oh yes, that as well!<br />
A: So that was just an example, I suppose.<br />
C: By the way, we have a lot of pupils here at this school from the eastern part of Germany.<br />
We could also discuss if in the east they also have a decreasing number of<br />
students, and we can perhaps do something about it somehow.<br />
A: (to D) Aren't you the one who is in favour of .....<br />
D: I have a good idea!<br />
A: Let us know please!<br />
D: I support the idea of a partnership with some renowned Munich firm. I have not decided<br />
about the firm yet, either Siemens or BMW. I am sure they will not go bankrupt<br />
in the next few years. And I think that our school needs money, a lot of money!<br />
Therefore I'm sure that this idea will really prove a very good one because students<br />
are quite upset about all this money we have to pay at the moment, for books, for<br />
copies, for reading! It's not only about books of course, but my idea was about a<br />
scholarship for students here at our school and that we increase the ambition of the<br />
students to learn. Maybe the firms won't pay money but they will offer a car, you<br />
93
94<br />
never know. Why not? That would be an idea, but what I find more important is a<br />
grant. Wealthy firms can afford to help our students in financial problems with a grant<br />
– maybe not only one or two students but more. It depends on how we support them<br />
with their public relations campaign.<br />
A: So if I understand you correctly you are talking more of a sponsorship than of a partnership,<br />
aren't you?<br />
D: That's what my idea of a partnership is like. We support them by wearing their tshirts.<br />
A: Really??????<br />
D: Well, that's just an idea, you see. And WE GET MONEY. Our school gets money! We<br />
need some new computers, there are different things that we need, a new taperecorder,<br />
a microphone, there are so many things. We also need a new and better<br />
cleaning firm – I mean just look at the staircases! How disgusting they are! If we had<br />
more money the building would be very neat and clean.<br />
C: But the firm BMW would expect something from us.<br />
D: Yes, we would do some advertising, as I said, we'd wear some t-shirts with their logo<br />
on it.<br />
C: Would every teacher buy a BMW?<br />
D: No!!! There is another good idea. I would love them to instal a shuttle service for our<br />
students. I mean our students travel in a BMW car, we tell everybody how great they<br />
are (even if we don't agree with it), they will pick us up at work and bring us to school<br />
and we will always be at school in time! What a great idea! We will be able to attend<br />
all our lessons, that means better results in all our tests and – what's very important –<br />
our school will change. We will be the students with the best results in the Abitur!<br />
Please imagine that! It will bring even more new students to our school.<br />
B: May I offer another suggestion? I'm a student here and I would like to suggest a partnership<br />
with a college in the USA. I think life is becoming more and more global today,<br />
so it's good to know different points of view and different ways of life and I think<br />
you can use this partnership in some lessons at our school, especially in geography,<br />
because you can learn something about the country from the people who live there<br />
or you can use it in German because you can support pupils from the USA in a German<br />
class and they support us in the English classes.<br />
C: Do you want a massacre here?<br />
B: No! No! I mean we could talk with each other in our classes but none of us is a native<br />
speaker, but it's good to talk with native speakers because you learn more idioms<br />
and special words. This would be especially good for the English Leistungskurs.<br />
C: So you think about a pupils´ exchange?<br />
B: Yes, but of course the money is very problematic. For one or two students it would be<br />
okay, but for most of us it wouldn't. I realise that.<br />
A: Well, it would be very expensive.
B: That's true for the students´ exchange. But the partnership itself is an advantage for<br />
our school.<br />
D: How will we communicate with them?<br />
B: We have two opportunities. We can use the internet or a videophone. This way we<br />
could chat or have pen-friends using the good old letter<br />
(Laughter, agitation)<br />
D: A very good idea! We could improve our English this way. Great!<br />
B: (to D) As to your suggestion: I am against it, because I think we would depend too<br />
much on this firm. You say we get their money but we have to do what they want.<br />
D: I didn't say that!<br />
A: (to B) I think I agree with you. (to D) You said we should wear their t-shirts and things<br />
like that. We're a public school and so we should be free of any sponsors. This is my<br />
opinion. But I will have to check with the Kumi.<br />
D: Well, it was my idea, so let's wait and see what the Kumi will say, what they will tell<br />
you. But it would stay in Bavaria, I mean I would like the BMW firm to sponsor us and<br />
not Apple or Google or whatever. And it would stay in Munich, so it wouldn't even be<br />
in another city.<br />
A: Okay, I will talk to the people responsible at the Kumi. Thank you very much indeed!<br />
Christiane Bauch, Harriet Göckel, Esther Laczko, Susanne Menhard<br />
4.4 Anderer Unterricht<br />
4.4.1 Wahlkurs Theater<br />
Neues vom Wahlunterricht „Theater“<br />
In diesem Schuljahr hat sich die Theatergruppe neu gebildet. Nach Ab- und Zugängen sind<br />
wir jetzt ein kleines, aber festes Team, das im nächsten Jahr auf Verstärkung hofft. Dieses<br />
Mal setzen wir keinen literarischen Text um, sondern gehen von einer kleinen Szene aus,<br />
die in der letzten Schreibwerkstatt bei Frau Rigó-Titze entstanden ist. Mehr wollen wir nicht<br />
verraten! Wir sind mitten in einem spannenden Arbeitsprozess und hoffen, unser Ergebnis<br />
bald präsentieren zu können.<br />
Die Spielleiterin Sabine Wlasak-Schulz<br />
95
"Jedes Ding hat seine Zeit." (William Shakespeare, "Komödie der Irrungen")<br />
" Wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir werden können." (William Shakespeare,<br />
"Hamlet")<br />
" Der Kummer, der nicht spricht, raunt leise zu den Herzen, bis es bricht." (William Shakespeare,<br />
"Macbeth")<br />
Warum besucht man den Wahlunterricht "Theater"?<br />
Entweder man denkt, dass man es gut kann oder... wenn man sich NOCH vieles nicht traut.<br />
So wie ich es mache. Genau hier erweitere ich meine persönlichen Grenzen und Gefühle.<br />
Was ist Theater?<br />
Alles ist Theater! Das ist HIER und JETZT, MORGEN und auch NIE! Das ist Gegenwelt!<br />
Das ist Spiegel der Zeit! Das ist Leben! Dein Leben? Mit der Sehnsucht nach Liebe und Erfolg.<br />
Es ist ein Witz und doch Realität als Waffe gegen Vergeblichkeit und Todesangst. Es<br />
ist ein Anstoß zu einem phantasievollen Umgang mit der Wirklichkeit.<br />
Hier findet man nicht nur einen neuen Freundeskreis, sondern auch neue Ideen und Lebensenergie.<br />
Nach dem gemeinsamen Theaterbesuch hast du auch die Möglichkeit zu diskutieren<br />
WER-WIE-WAS.<br />
In der Theatergruppe sieht man, wie Alltagsgegenstände Teil einer Geschichte sein können,<br />
und dann genießt man das Klatschen des Publikums - das Zeichen, dass das Spiel gelungen<br />
ist.<br />
Jeder Schritt, den man hier macht, ist nur nach vorne!<br />
Ich wünsche allen viel Mut und Zeit <strong>für</strong> ein anregendes Theaterstück!!<br />
Volha Zwingmann, 1a<br />
4.4.2 Wahlkurs Spanisch<br />
Eso es! Das stimmt!<br />
Hola! ¿Què tal? Estoy bien o estoy cansada (müde).<br />
Ich habe noch nie Spanisch gelernt und erst im <strong>Abendgymnasium</strong> lerne ich ein<br />
bisschen sprechen und schreiben.<br />
Man fängt an mit einfachem:<br />
¿cómo?<br />
mañana – morgen yo -ich<br />
hoy –heute tú - du<br />
ayer – gestern él - er<br />
¿Qué es? Was ist das?<br />
¿Qué pasa? Was ist los?<br />
96
Man kriegt mit, dass es allein <strong>für</strong> das Wort Briefmarke zwei Varianten in<br />
Spanisch gibt:<br />
Europäischer Kontinent Amerika und Canarias<br />
Briefmarke sello postal estampilla<br />
Bus autobús guagua, colectivo<br />
Wir haben ein Glück mit Herr Erdmann (Tenemos suerte con el señor<br />
Erdmann!)! In seinem Wahluntericht erfahren wir viel, nicht nur über die<br />
Sprache (la lengua), sondern auch über die Länder (los paises).<br />
Pues bien! Also gut.<br />
Ya es hora de tomar un café. Es wird Zeit, dass wir Kaffee trinken.<br />
En el bar - in der Bar<br />
El Bar es pequeño (Die Bar ist klein) pero (aber) confortable e acogedor (gemütlich).<br />
- Una mesa para dos, por favor.<br />
Einen Tisch <strong>für</strong> zwei Personen bitte.<br />
- ¿Podría ver la lista de precios, por favor?<br />
Die Preisliste bitte.<br />
- ¿Tiene platos vegetarianos?<br />
Haben Sie vegetarische Gerichte?<br />
- ¿Y para tomar? Und zum Trinken?<br />
- ¿Desea tomar algo? Möchten Sie etwas trinken?<br />
- En seguida! Gleich, sofort.<br />
Ich glaube, diesen Artikel können Sie schon im nächsten Urlaub benutzen. Haben Sie schon<br />
ein Zimmer reserviert?<br />
O en el hotel:<br />
- Buenos días! ¿Qué desea, señorita?<br />
- ¿Tiene alguna habitación libre? Haben Sie ein Zimmer frei?<br />
- Un ratito...Momentchen mal...Aquí hay gato encerrado... Da stimmt etwas nicht...<br />
- ¿Cuánto cuesta? Wieviel kostet es?<br />
- Muy bien. Sehr gut.<br />
- ¿Algo más? Noch etwas?<br />
- No, gracias, nada más, está bien.<br />
97
Hasta luego ! Bis bald!<br />
Yo deseo mucha suerte! Das müssen Sie aber jetzt selbst übersetzen können ;)<br />
Und vergessen Sie nicht, dass man verstanden wird, wenn man sich verständlich<br />
macht.<br />
Volha Zwingmann, 1a<br />
4.4.3. Wahlkurs Italienisch<br />
Perchè?<br />
Il nostro insegnante di lingue, signor Erdmann, mi ha chiesto perchè avevo scelto l'italiano<br />
come materia facoltativa.<br />
Ecco le miei ragioni:<br />
Ho un amore personale grandissimo per l'Italia con tanti aspetti.<br />
Guardo molto frequentamente dei film con attori / attrici conosciuti come Sophia Loren, Gina<br />
Lollobrigida, Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Eduardo De Filippo, Marlon Brando e<br />
Adriano Celentano.<br />
In questo contesto vorrei menzionare soprattutto i titoli "Filumena Marturano", "Sabato, Domenica,<br />
Lunedì", "La contessa di Hong Kong", "La Ciociara", "Pane, amore e mille baci",<br />
"Pane, amore e fantasia", "Pane, amore e gelosia", "Notre Dame de Paris", "Salomone e la<br />
regina de Saba" e "Il bisbetico domato".<br />
In anzitutto vale la pena vedere i film dei registi Carlo Ponti e Lina Wertmüller.<br />
Mi piacciono anche conti e favole come "Pinocchio" di Carlo Collodi o il romanzo "Io non ho<br />
paura" di Niccolò Ammaniti di cui è stato fatto un film recentemente.<br />
E' un divertimento particolare ascoltare le numerose canzoni italiane che hanno conquistato<br />
il mondo. "Una festa sui prati", "Mondo in mi 7a" (Adriano Celentano), "Gigi l'amoroso" e "O<br />
sole mio" (Dalida) fanno parte delle miei canzoni preferiti.<br />
Le opere liriche di Giuseppe Verdi, come per esempio "Nabucco", cantato da Maria Callas,<br />
fanno sognare perchè sono una vera e propria delizia per l'orecchio.<br />
Durante i miei viaggi in Italia sono stato a Verona, a Venezia, a Genova, a Bologna, a Milano,<br />
a Firenze, a Roma, a Viareggio e a Brindisi, dove oltre a tutti gli aspetti culturali il Bel<br />
Paese mi ha presentato una ricchezza enorme di paesaggi e regioni diverse – montagne,<br />
scogli, il mare, la spiaggia, bel paesi, campi di grano, uliveti, limoneti, erbe profumanti e fiori<br />
di tutti i colori, dove vi aspetta anche un panorama esaustivo di diversi piaceri aromatici e<br />
saporiti della cucina e dei vini.<br />
Così mi piace tanto preparare specialità italiane e inviterò fra poco degli amici a mangiare un<br />
menù siciliano dove servirò come dessert la famosa Cassata siciliana.<br />
Per me l'Italia semplicemente è il paese della sensualità, e già la lingua suona come musica.<br />
98
Ho fatto ottime esperienze con gli italiani dei quali aprezzo in particolare l'individualismo, la<br />
toleranza, la gentilezza et la loro disinvoltura, con la mia piena e totale ammirazione.<br />
In Italia mi sono sempre trovato come a casa, tra uguali.<br />
Mi sta molto di cuore dirvi che il mio motivo principale di studiare l'italiano è questo:<br />
Porto in me sempre il desiderio segreto et la voglia che sta al di sopra di tutte le altre cose<br />
del mondo, cioè quella di sposare una bellissima napoletana cordiale, incantevole, allegra,<br />
viva, e di avere quattro bambini con lei, due maschi e due femmine. Per questo andrò prossimamente<br />
a Napoli per fare il flirt.<br />
Siccome purtroppo non sono più così giovane, non vorrei nascondervi la poesia seguente di<br />
Lorenzo di Medici, chiamato Lorenzo il Magnifico:<br />
Quant'è bella, giovinezza,<br />
Che si fugge tuttavia!<br />
Chi vuol esser lieto, sia!<br />
Di doman non c'è certezza!<br />
Warum?<br />
Von unserem Sprachlehrer, Herrn Erdmann, wurde ich gefragt, warum ich das Wahlfach<br />
Italienisch gewählt habe.<br />
Das sind meine Gründe:<br />
Zu Italien habe ich eine ganz große persönliche Liebe in vielerlei Hinsicht.<br />
Sehr oft schaue ich mir Filme mit den bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern Sophia<br />
Loren, Gina Lollobrigida, Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Eduardo De Filippo,<br />
Marlon Brando und Adriano Celentano an.<br />
In diesem Zusammenhang möchte ich vor allem die Titel "Hochzeit auf italienisch", "Samstag,<br />
Sonntag, Montag", "Die Gräfin von Hong Kong", "Und dennoch leben sie", "Liebe, Brot<br />
und tausend Küsse", Liebe, Brot und Fantasie". "Liebe, Brot und Eifersucht", "Der Göckner<br />
von Notre Dame", "Salomon und die Königin von Saba" und "Der gezähmte Widerspenstige"<br />
erwähnen.<br />
Besonders sehenswert sind die Filme der Regisseure Carlo Ponti und Lina Wertmüller.<br />
Mir gefallen auch Märchen und Fabeln wie "Pinocchio" von Carlo Collodi oder der Roman<br />
"Ich habe keine Angst" von Niccolò Ammaniti, der aktuell auch verfilmt wurde.<br />
Ein höchst amüsantes Vergnügen ist es, die vielen italienischen Lieder zu hören, welche die<br />
Welt erobert haben. "Una festa sui prati", "Mondo in mi 7a" (Adriano Celentano), "Gigi l'amoroso"<br />
und "O sole mio" (Dalida) gehören zu meinen Lieblingsliedern.<br />
Die Opern von Giuseppe Verdi, wie zum Beispiel "Nabucco", gesungen von Maria Callas,<br />
lassen träumen, weil sie ein wahrer Hochgenuss <strong>für</strong>s Ohr sind.<br />
Auf meinen Italienreisen war ich in Verona, in Venedig, in Genua, in Bologna, in Mailand, in<br />
Florenz, in Rom, in Viareggio und in Brindisi, wo bei allen kulturellen Aspekten mir das Bel<br />
Paese (das Schöne Land) einen enormen Reichtum an Landschaften und unterschiedlichen<br />
Regionen präsentiert hat – Berge, Klüfte, das Meer, der Strand, schöne Dörfer, Kornfelder,<br />
99
Oliven- und Zitronenhaine, duftende Kräuter und Blumen in allen Farben, wo einen auch ein<br />
umfassendes Panorama an aromatischen und schmackhaften Genüssen der Küche und der<br />
Weine erwartet.<br />
So koche ich selber auch sehr gerne italienisch und werde bald Freunde zu einem sizilianischen<br />
Menü einladen, wo ich als Dessert die berühmte Cassata siciliana servieren werde.<br />
Für mich ist Italien einfach das Land der Sinnlichkeit und allein schon seoine Sprache klingt<br />
wie Musik.<br />
Mit den Italienern habe ich die besten Erfahrungen gemacht und ich schätze an ihnen mit<br />
vollkommener Bewunderung vor allem ihren Individualismus, ihre Toleranz, ihre Freundlichkeit<br />
und ihre Unbefangenheit.<br />
In Italien habe ich mich immer wie zu Hause, unter meinesgleichen gefühlt.<br />
Mir liegt es sehr am Herzen, Ihnen zu sagen, dass mein Hauptmotiv, Italienisch zu lernen,<br />
das folgende ist:<br />
Immer trage ich in mir den geheimen Wunsch und die alles auf der Welt überragende Sehnsucht,<br />
eine wunderschöne, herzliche, bezaubernde, fröhliche, lebendige Neapolitanerin zu<br />
heiraten und mit ihr vier Kinder zu bekommen, zwei Buben und zwei Mädchen. deshalb<br />
werde ich als Nächstes zum Flirten nach Neapel fahren. Da ich nicht mehr ganz so jung bin,<br />
will ich Ihnen folgendes Gedicht von Lorenzo di Medici, genannt Lorenzo der Prächtige,<br />
nicht vorenthalten:<br />
Wie schön ist die Jugend,<br />
Die ja dennoch entflieht!<br />
Wer fröhlich sein will, der sei es!<br />
Über das Morgen gibt es keine Gewissheit!<br />
Alois Zeindl, 1b<br />
4.4.4 Wahlkurs “kreativ schreiben”<br />
Einige Kostbarkeiten aus dem Wahlkurs „kreativ schreiben“<br />
Dienstagabends, nach dem regulären Unterricht, traf sich regelmäßig ein kleiner, feiner<br />
Kreis. Müde, ja, aber erwartungsvoll und unternehmungslustig stand das Grüppchen vor<br />
dem Raum 212. Nicht alle waren immer da – leider. Aber Frau Gebendorfer, Frau Hagl, Herr<br />
Etim, Herr Schneider und Frau Zwingmann – alle aus der 1. Jahrgangsstufe – haben mit<br />
ihren Ideen und ihren Persönlichkeiten die Atmosphäre und die Ergebnisse besonders stark<br />
geprägt. Der Kursleiter Herr Sinhart, selber noch in Gedanken nicht ganz losgelöst von der<br />
Doppelstunde Deutsch in der Klasse 2b, öffnete die Tür und es begann jedes Mal von<br />
Neuem der gemeinsame Versuch, in eine andere geistige Galaxie zu wechseln, eine Ecke<br />
des Gehirns zu aktivieren, die im Berufs- und Schulalltag zwar oft angesprochen wird und<br />
sich dann auch meldet, meist aber wieder recht schnell wieder auf ihren Platz zurück geschickt<br />
wird, damit sie nicht zu sehr stört: die freie Kreativität.<br />
Die Uhrzeit ist anstrengend, aber nicht ungewöhnlich <strong>für</strong> diese Art von Tätigkeit des Gehirns:<br />
Es ist die Zeit der Dichter und Denker. Franz Kafka setzte sich um diese Zeit an die Fortset-<br />
100
zung des Romans, Schiller zündete die Kerzen an und nahm den Stift zur Hand, auch Giuseppe<br />
Verdi komponierte den „Don Carlo“ und die „Traviata“ nach Sonnenuntergang, nach<br />
dem Tagwerk auf seinen Feldern.<br />
Immer begannen wir mit einer Aufwärmübung, oft auch mit dem Kennenlernen eines Text-<br />
Beispiels aus der Feder eines „Profis“. Dann kam das eigene Schreiben, manchmal nach<br />
dem Vorbild und der Anregung des gelesenen Texts, oft aber auch nur danach, was gerade<br />
„in der Luft“ lag. Was dabei entstand, ist nur zum Teil zur Veröffentlichung gedacht und geeignet.<br />
Anderes aber wollen wir – nicht ohne Neugier auf Reaktionen – dem gespannten<br />
Publikum vorstellen. Unsere Auswahl stammt aus unserer „lyrischen Phase“, den Monaten<br />
zwischen Faschings- und Pfingstferien. Davor stand kreative Prosa im Mittelpunkt – Kurzgeschichten,<br />
Situationsbeschreibungen u.ä. – und <strong>für</strong> die Sommermonate standen dramatische<br />
Übungen auf dem Plan.<br />
„Kollektiv-Haiku“<br />
Haiku sind eine typisch japanische Spezialität, eine Art Bonsai-Lyrik: Miniatur-Gedichte mit<br />
hoch konzentrierten Geschichten und Eindrücken auf kleinstem Raum, genauer: in drei Zeilen<br />
mit (in der Regel) fünf, sieben und wieder fünf Silben, wobei die erste Zeile meist ein<br />
Thema anschlägt, welches in der zweiten und dritten Zeile verdeutlicht wird. „Kollektiv“ bedeutet,<br />
dass eine(r) von uns die erste Zeile vorgab, den Zettel weiterreichte an den Nachbarn,<br />
der die zweite Zeile schrieb und ebenfalls zur Vervollständigung durch den Dritten weitergab.<br />
Die Ergebnisse sind höchst eigensinnig, zumindest in unserem Fall. Hier ein paar<br />
Kostproben:<br />
1. Mein Abendessen:<br />
Heute keine Zeit gehabt.<br />
Werde hungern!<br />
2. Das Bett ist noch leer.<br />
Es ist doch so schwer wie nie.<br />
Im Anfang liegt Glück!<br />
3. Eine tolle Frau<br />
Im Auge des Hurrikans –<br />
Jetzt alt und verbraucht.<br />
4. Ferien sind vorbei!<br />
Der Strandsand in den Schuhen<br />
Fließt aus meiner Hand<br />
5. Kaffee am Morgen –<br />
Zu früh aufgestanden heut,<br />
Kummer und Sorgen.<br />
6. Warum ist das so?<br />
Kein Problem, nur Lösungen!<br />
Frage ist Antwort!<br />
101
7. Schokolade pur.<br />
Frustessen leicht gemacht<br />
Und an dich gedacht<br />
8. C’est une catastrophe<br />
No tengo mucho dinero<br />
Aber viel Liebe.<br />
Phantasie in fremden Diensten: Übersetzungen eines chinesischen Gedichts<br />
Die Übertragung von Lyrik aus dem Chinesischen ist eine Herausforderung der Phantasie in<br />
vielerlei Hinsicht: Diese Sprache arbeitet mit Schriftzeichen <strong>für</strong> ganze Wörter; der Satzbau,<br />
also auch der sachlogische Zusammenhang und somit die wesentlichen Aussagen werden<br />
nur aus der Abfolge und dem Kontext der Wörter erkennbar. Kein Wunder, dass Übersetzungen<br />
zum Teil extrem voneinander abweichen – die Aussage, die Stimmungen, die Tonlage<br />
müssen im Kopf des Übersetzers neu „konstruiert“ werden.<br />
Wir nahmen uns das Gedicht „Nachtgedanken“ von Li Bai vor, der von 701 bis 762 lebte und<br />
in China der berühmteste Dichter seiner Zeit war. Die vier Zeilen des Gedichts lauten auf<br />
chinesisch in lateinischer Schrift (Pinjin):<br />
Chuang qian ming yue guang<br />
Yi shi di shang shuang<br />
Ju tou wang ming yue<br />
Di tou si gu xiang<br />
Die “wörtliche” Übersetzung liest sich so:<br />
Bett – vor – hell – Mond – Strahl<br />
zweifeln – ist – Erde – auf Frost<br />
heben – Kopf – blicken – hell – Mond<br />
senken – Kopf – denken – alt – Heimat<br />
Daraus heißt es nun ein Gedicht zu machen. Tempus, Kasus, die ganze Grammatik und<br />
somit das logische Gerüst der Sätze – alles eine Sache des Kontexts bzw. des Sprachgefühls<br />
des jeweiligen Übersetzers. Hier ein paar Beispiele unserer Interpretationen:<br />
1. Ich schlafe nicht, der Mond ist kalt,<br />
ich frier in meiner Einsamkeit<br />
ich heb den Kopf im hellen Mond<br />
die Heimat fehlt – ich quäle mein Hirn.<br />
2. Ich schlafe nicht<br />
Des Mondes Flucht<br />
Zeigt mir den Schatten<br />
Von Heimatsucht<br />
102
3. Ich schlafe nicht<br />
Des Mondes Licht<br />
Zeigt mir den Schatten<br />
Von Heimatsicht<br />
4. Vor meinem Bett: der helle Strahl des Mondes<br />
Ich weiß nicht, ob die Erde liegt im Frost<br />
Ich schaue auf und seh die Helligkeit des Mondes<br />
Gesenkten Haupts such ich der Heimat Trost<br />
Es gibt erstaunlich viele „professionelle“ Übersetzungen dieses Gedichts von Li Bai, die wir<br />
natürlich erst nach unseren eigenen Versuchen lasen – meist mit Staunen, manchmal mit<br />
Kopfschütteln, manchmal mit Stolz auf die eigene Leistung.<br />
Hans Bethge (1876-1946; einige seiner Nachdichtungen inspirierten den Komponisten Gustav<br />
Mahler zu seiner 9. Sinfonie „Das Lied von der Erde“)<br />
Ich hob das Haupt – ich meinte erst, es sei<br />
Der Reif der Frühe, was ich schimmern sah,<br />
dann aber fühlte ich: der Mond, der Mond!<br />
Und neigte das Gesicht zur Erde hin,<br />
und meine Heimat winkte mir von ferne.<br />
Manfred Hausmann (1898-1986; wurde noch in den 1960er Jahren vor allem von jüngeren<br />
Leuten gelesen)<br />
Vor meiner Bettstatt lag wie Reif so weiß<br />
Des Mondlichts mitternächtiges Gegleiß.<br />
Ich hob das Haupt – der Mond schien voll und blank –<br />
Und ließ es wieder sinken, heimwehkrank.<br />
Günter Eich (1907-1972; gilt bis heute als einer der wichtigsten Dichter der Nachkriegszeit)<br />
Vor meinem Bette das Mondlicht ist so weiß,<br />
Dass ich vermeinte, es sei Reif gefallen.<br />
Das Haupt erhoben schau ich auf zum Monde,<br />
Das Haupt geneigt denk ich des Heimatdorfs.<br />
Zum Schluss noch ein Gedicht von unserem Teilnehmer Stephan Schneider, welches nicht<br />
unmittelbar im Kurs, sondern parallel dazu entstanden ist, und gewisse Erinnerungen im<br />
Leser hervorrufen dürfte:<br />
Abenteuerlicher Arbeitstag<br />
103
Müder Morgen<br />
Mit viel Kummer und Sorgen<br />
Arbeit häuft<br />
Die Zeit läuft<br />
Stressig wird’s<br />
Nervender Chef<br />
Nervende Kunden<br />
Machen die Runden<br />
Noch stressiger wird’s!<br />
Es dämmert<br />
Die Schulglocke hämmert<br />
Am Ende der Stund<br />
Läuft man sich die Füße wund<br />
Nacht zieht durchs Land<br />
Zuhause ist man entspannt<br />
Im Bette<br />
Und starrt zur Decke<br />
Als dann sich die Augenlider schließen<br />
Es erwachet nun neuer Morgen<br />
Mit der Hoffnung ohne Kummer und Sorgen!<br />
Peter Sinhart<br />
4.5 Verzeichnis der Unterrichtsgänge: Juni <strong>2006</strong> bis Mai <strong>2007</strong><br />
12.7.06 1a/2b Theaterbesuch<br />
20.7.06 E 32 „Dead or alive“ (fünf engl. Einakter) / English<br />
Drama Group<br />
21.07.06 G31 Unterrichtsgang zur Münchener Stadtgeschichte<br />
26.07.06 1a/d Unterrichtsgang „Mittelalter“<br />
20./21.9.06 1 Projekt zum Kennen lernen (Szenisches Lernen)<br />
„Wahrnehmen und wahrgenommen werden“<br />
28.09.06 d32 Besuch der Glyptothek<br />
29.09.06 2a Patrick Süßkind: "Das Parfüm"<br />
07.10.06 1 Szenisches Lernen (Samstag)<br />
12.10.06 2a/ Archäologische Staatssammlung „Die letzten Stunden<br />
lat41 von Herculaneum – Das Ende einer Stadt“<br />
14.10.06 K3/4 Exkursion zum Wendelstein (Samstag)<br />
27.10.06 D31/d43 Hypo-Kunsthalle: „Der Kuss“ von Rodin<br />
04.11.06 D31 Sophokles: „Antigone“<br />
09.11.06 WU: Vortrag: "Wohlstand <strong>für</strong> Alle und Globalisierung"<br />
Politik<br />
104
09.11.06 E42 Sasha Baron Cohen: "Borat"<br />
11.11.06 WU: Dürrenmatt: Besuch der alten Dame (Samstag)<br />
Theater<br />
16.11.06 geo41 Geografische Gesellschaft: Darfurkonflikt<br />
18.11.06 WU: Schiller: "Maria Stuart" (Samstag)<br />
Theater<br />
07.12.06 1a/2a Besuch der Süddeutschen Zeitung<br />
09.12.06 WU: Dürrenmatt: "Besuch der alten Dame" (Samstag)<br />
20.12.06 E41 Ch. Dickens: "Christmas Carol"<br />
21.12.06 eko Ch. Dickens: "Christmas Carol"<br />
18.01.07 1c Dürrenmatt: "Besuch der alten Dame"<br />
01.02.07 D41 Literaturhaus: „Pacific Palisades“<br />
04.02.07 WU: Horváth: „Glaube Liebe Hoffnung“ (Sonntag)<br />
Theater<br />
09.02.07 d32, d33 Literaturhaus: "Pacific Palisades"<br />
15.02.07 Alle Vortrag: "Wege in die Oper" (Staatsintendant Klaus<br />
Schultz)<br />
26.02.07 Opernbesuch: "Der Barbier von Sevilla"<br />
17.03.07 WU: Horváth: "Glaube Liebe Hoffnung" (Samstag)<br />
Theater<br />
12.05.07 WU: Thomas Mann: "Buddenbrocks", dramatisiert<br />
Theater von John von Düffel (Samstag)<br />
11.05.07 d32 Nikolai Gogol: "Der Revisor"<br />
16.05.07 1a/d Besuch einer Moschee<br />
I. Rüttinger<br />
5. Besondere Veranstaltungen<br />
Wege zum Musiktheater<br />
(Über den Charakter der Oper)<br />
Vortrag von Prof. Klaus Schultz<br />
Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz<br />
Am 15. 2. <strong>2007</strong> hielt Herr Prof. Klaus Schultz diesen Vortag<br />
in der Mensa des A.-Fingerle -Zentrums. Eingeladen hatten<br />
der „Freundeskreis des Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s“ und<br />
die Schulleitung, es war eine verpflichtende Schulveranstaltung.<br />
Die Mensa war so voll, dass noch Stühle herbeigeschafft<br />
werden mussten.<br />
Herr Prof. Schultz gliederte seinen Vortrag in drei Teile:<br />
Ein historischer Rückblick<br />
Das Wesen der Oper<br />
Das Gärtnerplatztheater und die Oper „Der Barbier<br />
von Sevilla“, die von vielen Studierenden besucht<br />
wurde.<br />
Im historischen Rückblick ging er auf die Entstehung der<br />
Oper in Venedig vor 400 Jahren ein: Am 24. 2. 1607 war die<br />
Foto: von G. v. Schlichting –<br />
Schönhammer<br />
Uraufführung des „Orfeo“ von Claudio Monteverdi. Daran sieht man schon, dass die Oper<br />
eine Wiedergeburt des antiken Theaters mit handelnden Einzelpersonen und Chor sein<br />
105
sollte, aber es entstand etwas Neues in der Verschmelzung von Text und Musik. Die Rezitative<br />
treiben die Handlung voran, die Musik der Arien verbreitert den Augenblick: Der Text<br />
dauert vielleicht 7 Sekunden, die Arie aber (eventuell als Dacapo-Arie noch mit Wiederholung<br />
des Anfangsteils) braucht wohl 7 Minuten. In der Arie bleibt eigentlich die Zeit stehen,<br />
der Sänger drückt im Gesang die Gefühle seiner Rolle aus, die man auch ohne den Text<br />
verstehen würde.<br />
Die Oper braucht ein eigenes Gebäude, nicht nur als Schutz vor schlechtem Wetter, auch<br />
<strong>für</strong> die Akustik. In der Gliederung in Parkett <strong>für</strong> das bürgerliche Publikum, Logen und Ränge<br />
<strong>für</strong> die Aristokratie zeigte sich die Ständegesellschaft der Barockzeit, denn die Oper war<br />
zuerst Hoftheater – in München seit 1753 – erst später wurde sie auch <strong>für</strong> das Bürgertum<br />
geöffnet.<br />
Bis ins 19. Jahrhundert wurden nur aktuelle Stücke gespielt, die Opernhäuser hatten fest<br />
angestellte Komponisten, die die allerneusten Libretti vertonten. Man schätzt, dass es mehr<br />
als 50000 Opern gibt, im derzeitigen Repertoire sind weniger als 200! Noch Mozart brauchte<br />
<strong>für</strong> jede seiner Opern einen Auftrag. Erst im 19. Jahrhundert wurde der Komponist als<br />
schöpferischer Mensch wahrgenommen (und sah sich auch so), der sich nichts befehlen<br />
lässt und unabhängig von Aufträgen arbeitet. Man denke nur an Richard Wagner. Erst im<br />
19. Jahrhundert besann man sich auch auf die historischen Stücke, und seitdem spielt man<br />
eigentlich immer wieder dasselbe (Mozart, Rossini, Puccini, Wagner, Verdi...), wenig Modernes.<br />
Herr Prof. Schultz ging auch auf die derzeitige „Opernkrise“ ein, wo das Publikum Neues<br />
ablehnt und die Musiker durch die Möglichkeit der Aufzeichnung auf Schallplatte oder CD<br />
selbst ihre größten Konkurrenten sind. Wozu soll man also den teuren Opernbetrieb bezahlen,<br />
wenn man doch alles auf CD hören oder im Fernsehen sehen kann!<br />
Dagegen kann man sagen, dass in Deutschland immerhin mehr Leute ins Theater als zu<br />
Fußballspielen gehen. Die Situation im Theater ist doch etwas anderes, als wenn man zu<br />
Hause eine Oper im Fernsehen sieht oder eine CD hört: Menschen kommen hier und jetzt<br />
zusammen, hören und sehen gemeinsam, was auf der Bühne geschieht, das hat immer<br />
noch einen starken sozialen Reiz.<br />
Außerdem gibt es durchaus erfolgreiche moderne Opern, das Publikum kann lernen, das<br />
Neue zu begreifen und zu schätzen.<br />
Zum Schluss erläuterte Prof. Schultz die Inszenierung der Rossini-Oper „Der Barbier von<br />
Sevilla“ und machte damit Lust auf den anstehenden Opernbesuch.<br />
An dem Vortrag von Prof. Schultz faszinierte, dass er in freier Rede sein Publikum fesselte,<br />
dennoch sein Konzept durchhielt und sein Zeitraster einhielt. Er konnte seine Begeisterung<br />
<strong>für</strong> die Oper auf uns übertragen. Das merkte man auch an der lebhaften Diskussion im Anschluss<br />
an seinen Vortrag.<br />
G. v. Schlichting – Schönhammer<br />
6. Schulbetrieb<br />
6.1 Das neue 8-jährige Gymnasium und der Zweite Bildungsweg<br />
Im laufenden Schuljahr ist an den Tagesgymnasien die neue 8-jährige Form des Gymnasiums<br />
(G8) die 8. Jgst. erreicht und im Jahr 2011 wird das erste Abitur des neuen G8 stattfinden.<br />
Die Abiturprüfungen des Jahres 2011 stellen <strong>für</strong> die Gymnasien, die Hochschulen<br />
und <strong>für</strong> den Arbeitsmarkt eine besondere Herausforderung dar, weil neben dem neuen G8<br />
auch das letzte Abitur nach dem bisherigen G9 mit Kollegstufe stattfinden wird.<br />
106
Das <strong>Abendgymnasium</strong> ging lange Zeit davon aus, dass wir im Jahr 2011 noch das letzte<br />
G9-Abitur mitschreiben und erst ab 2012 das neue Abitur unter den Bedingungen des G8.<br />
Anfang Januar fand eine erste gemeinsame Sitzung der bayerischen Kollegs und Abendgymnasien<br />
mit dem ISB und dem Staatsministerium <strong>für</strong> Unterricht und Kultus statt zu der<br />
Frage, wie die veränderten Bedingungen des G8 auf den Zweiten Bildungsweg übertragen<br />
werden können.<br />
Dabei wurde deutlich, dass das Staatsministerium <strong>für</strong> Unterricht und Kultus die beiden Abiturprüfungen<br />
des Jahres 2011 zeitlich entflechten muss, sodass das letzte G9-Abitur voraussichtlich<br />
schon zu Beginn des Kalenderjahres 2011 stattfinden wird und die Kursphase<br />
der Kollegstufe deshalb <strong>für</strong> diesen Jahrgang in die 11. Jgst. vorgezogen werden muss. Dies<br />
ist <strong>für</strong> das <strong>Abendgymnasium</strong> nicht möglich, denn die zweijährige Vorbereitungsphase auf die<br />
Kollegstufe würde auf eineinhalb Jahre verkürzt werden. In dieser kurzen Zeit kann die Vorbereitung<br />
auf die Kollegstufe nicht geleistet werden und zudem wären Schwierigkeiten mit<br />
der Anerkennung der Abschlüsse des <strong>Abendgymnasium</strong>s durch die KMK-Vorgaben zu erwarten.<br />
Dies führte schließlich zu der Entscheidung, dass das <strong>Abendgymnasium</strong> bereits im kommenden<br />
Schuljahr <strong>2007</strong>/08 in der 1. Jgst. mit den Bedingungen des neuen G8 anfangen<br />
muss, damit durch die zweijährige Einführungsphase eine hinreichende Vorbereitung auf die<br />
neue Oberstufe gewährleistet ist. Damit ist zugleich die Entscheidung verbunden, dass das<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> 2011 nicht mehr das letzte G9-Abitur, sondern ebenfalls das neue G8-<br />
Abitur mitschreiben wird. Den Abendgymnasien liegt sehr daran, dass die Abiturprüfungen<br />
des Zweiten Bildungsweges - soweit möglich und sinnvoll – den Bedingungen der regulären<br />
Tagesgymnasien angeglichen sind. Das Abitur des <strong>Abendgymnasium</strong>s muss weiterhin<br />
gleichartig und gleichwertig gegenüber dem Abitur der Tagesgymnasien sein<br />
Dies führte dazu, dass unsere Schule in verschiedenen Lehrerkonferenzen und Fachsitzungen<br />
im ablaufenden Schuljahr mit der künftigen Stundentafel und den neuen Lehrplänen in<br />
der 1. und 2. Jgst. auseinandersetzte, damit eine möglichst erfolgreiche Vorbereitung auf<br />
die kommende neue Oberstufe gewährleistet ist.<br />
Auf der Basis der neuen Lehrpläne <strong>für</strong> das G8 haben die verschiedenen Fachschaften neue<br />
Lehrplan-Entwürfe <strong>für</strong> die 1. und 2. Jgst. unserer Schule erarbeitet. In der kommenden<br />
Oberstufe werden schließlich die regulären Lehrpläne der Oberstufe der Tagesgymnasien<br />
gelten, um die Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit der Oberstufe und der Abiturprüfungen<br />
sicher zu stellen. Der Grundsatz der 5 Abiturprüfungsfächer im neuen Abitur wird <strong>für</strong> das<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> ebenso verbindlich sein.<br />
Offen ist noch, welche Fächer mit welcher Stundenzahl an der Oberstufe des <strong>Abendgymnasium</strong>s<br />
künftig verpflichtend sein werden und wie die künftigen Seminarfächer im Zweiten<br />
Bildungsweg gehandhabt werden. Die Wochenstundenzahl <strong>für</strong> einen Berufstätigen, der am<br />
Abend ein Gymnasium besucht, ist dabei nicht beliebig erweiterbar. Dies mit den anderen<br />
bayerischen Abendgymnasien, dem ISB und dem Staatsministerium zu vereinbaren, wird<br />
Aufgabe im kommenden Schuljahr sein.<br />
Mit den anderen bayerischen Abendgymnasien und mit dem Bayerischen Staatsministerium<br />
<strong>für</strong> Unterricht und Kultus wurde <strong>für</strong> die 1. und 2. Jgst. ab kommendem Schuljahr folgende<br />
neue Stundentafel vereinbart:<br />
107
A G M A G W<br />
1. Klasse 2. Klasse 1. Klasse 2. Klasse<br />
Rel./Eth. 1 1 1 1<br />
Deutsch 3 3 3 3<br />
Englisch 4 4 4 4<br />
Latein/Französ. 3 3 3 3<br />
Mathematik 5 5 5 5<br />
Physik 2 2 - 1<br />
Biologie (mit Chemie) 1 1 1 1<br />
Geschichte (mit Sozialk.) 1 1 1 1<br />
Wirtschaft/Recht - - 2 1<br />
20 WoSt 20 WoSt 20 WoSt 20 WoSt<br />
Bei den diesjährigen Informationsabenden haben wir die Interessenten und kommenden<br />
Schülerinnen/Schüler des <strong>Abendgymnasium</strong>s bereits so ausführlich wie derzeit möglich über<br />
die Bedingungen des neuen G8 und deren Umsetzung auf unsere Schule informiert. Ob<br />
dieser neue Weg zum Abitur Auswirkungen auf die Anmeldungen an unsere Schule und<br />
künftig auf die Erfolgsaussichten der Abiturprüfungen haben wird, kann derzeit noch nicht<br />
prognostiziert werden.<br />
Siegfried S c h a l k<br />
6.2 AG im Internet<br />
Nachdem sich ja einiges tut in der<br />
bayerischen Schullandschaft,<br />
bleibt auch das <strong>Abendgymnasium</strong><br />
von größeren Veränderungen nicht<br />
verschont. Auch bei und wird die<br />
Einführung des G8 einige gravierende<br />
Neuerungen mit sich bringen<br />
(vgl. dazu den Artikel des<br />
Schulleiters, 6.1). Für unseren<br />
Webmaster, Herrn Singer bedeutet<br />
dies, dass die Homepage des<br />
Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s in<br />
entsprechender Weise aktualisiert<br />
werden muss.<br />
In diesem Zusammenhang entstand<br />
die Idee, die Seite ganz generell<br />
zu überarbeiten und dazu Homepage AG Foto: G. Rigó-Titze<br />
auch die Meinung unserer Studierenden<br />
einzuholen. Wir verfassten also einen Fragebogen und verteilten ihn in allen Jahrgangsstufen.<br />
Darin baten wir um Verbesserungsvorschläge, welcher Art auch immer, sowie<br />
um die Beantwortung der folgenden Fragen:<br />
1. Wie findet man sich auf der Seite zurecht?<br />
2. Sind die wesentlichen Informationen zur Schule übersichtlich und umfassend dargestellt?<br />
3. Vermissen Sie Inhalte?<br />
108
4. Haben Sie Überflüssiges entdeckt?<br />
5. Ist die Seite gut verlinkt?<br />
6. Wie finden Sie die graphische Gestaltung der Homepage?<br />
7. Hätten Sie Lust, auf freiwilliger Basis an der Homepage mitzuarbeiten, beispielsweise<br />
eine Seite von Studierenden <strong>für</strong> Studierende zu gestalten?<br />
Das Echo seitens der Schülerschaft war zunächst sehr groß. Die weitaus meisten, die wir<br />
persönlich ansprachen, kannten die Seite, lobten ihren Inhalt, aber fanden das Layout etwas<br />
langweilig und bieder gestaltet. "Ja, die Informationen sind schon gut, aber die Aufmachung....!"<br />
hieß es immer wieder. Spontan erklärten sich ca. zehn Studierende, vor allem<br />
aus einer 1. Klasse, bereit, bei einer Neugestaltung der Homepage mitzuwirken.<br />
Die Realität sah dann natürlich wieder ganz anders aus. Der Rücklauf auf die Umfrage war<br />
eher dürftig, die Resonanz insgesamt aber eher positiv. Wir erhielten von vier Schülerinnen<br />
konkrete Hinweise, Tipps und Verbesserungsvorschläge, die wir gesammelt haben und in<br />
die Umgestaltung der Seite einarbeiten werden. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank<br />
an Frau Acikgöz, Frau Bauch (beide K3), Frau Zihl (1e) und Frau Zwingmann (1a)!<br />
Gegen Ende des 1. Halbjahres luden dann Herr Singer und ich interessierte Studierende zu<br />
einer Besprechung über die Neugestaltung der Homepage ein. Leiser folgte nur ein Schüler<br />
dieser Aufforderung: Herr Ludwig Klatzka aus der Klasse 1d. Aber Quantität ist ja nicht so<br />
wichtig wie Qualität! Herr Klatzka hatte sich bereits intensiv mit unserer Seite beschäftigt<br />
und brachte konkrete Vorschläge und Anregungen mit, nicht nur zur graphischen Gestaltung,<br />
sondern auch zum Impressum und zur Verlinkung, die wir gerne aufgriffen.<br />
Inzwischen ist die Überarbeitung der Homepage in vollem Gange. Herr Klatzka hofft, sie bis<br />
zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen zu haben. Wir freuen uns ganz besonders<br />
darüber, dass ein Mitglied unserer Schule seine im Beruf angeeigneten Fähigkeiten<br />
und Fertigkeiten freiwillig <strong>für</strong> das <strong>Abendgymnasium</strong> zur Verfügung stellt.<br />
Und wie wird sie denn nun aussehen, die neue Homepage? Allzuviel wollen wir natürlich<br />
nicht verraten, sondern uns mit ein paar Andeutungen begnügen: Die Farbgestaltung wird<br />
völlig neu, eine Art Hufeisen wird es geben, und unsere Eule wird häufiger über den Monitor<br />
flattern. Lassen Sie sich einfach im neuen Schuljahr überraschen!<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
6.3 Das AG in den Medien<br />
Kaum waren im Schuljahr <strong>2006</strong>/07 die Abiturienten in Bayern entlassen und auch die wunderschön<br />
gestaltete Abiturfeier am <strong>Abendgymnasium</strong> zu Ende, da erschienen in der Wochenendausgabe<br />
der Süddeutschen Zeitung vom 1./2.7.<strong>2006</strong> auf einer ganzen Seite im Lokalteil<br />
fünf Berichte über außergewöhnliche Absolventen der letzten Reifeprüfung. Unter<br />
dem einleitenden Slogan "Fünf Abiturienten und fünf verschiedene Wege, den begehrten<br />
Zugang zum Hochschulstudium zu erlangen" berichteten Journalisten über eine Absolventin<br />
des "Abibac", einer deutsch-französischen Hochschulreife, über eine Abiturientin aus der<br />
privaten Rudolf-Steiner-Schule, über einen 25-jährigen, der in Hessen das sogenannte<br />
"Nichtschülerabitur" der Studiengemeinschaft Darmstadt erworben hat, und über einen jungen<br />
Mann, der trotz seiner schweren Knochenkrebserkrankung und monatelanger Krankenhausaufenthalte,<br />
betreut von der "Staatlichen Schule <strong>für</strong> Kranke", sein Abitur mit der Note<br />
2,2 bestanden hat.<br />
109
Der fünfte Artikel befasst sich mit einer Abiturientin des Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s,<br />
Frau Christa Türck. Unter der Überschrift "Vom Airbus auf die Schulbank – Eine Stewardess<br />
erfüllt sich mit 57 Jahren den Traum von der Hochschulreife" stellt Janek Schmidt unsere<br />
ehemalige Studierende vor. Im Gespräch mit dem Journalisten stellt Frau Türck ihren Entschluss<br />
das AG zu besuchen als einen Versuch dar, nach langem, von Unstetigkeit geprägten<br />
Leben "wieder mit den Füßen auf den Boden zu kommen".<br />
Frau Türck hatte in ihrer Jugend "nur eine Zwergenschule auf dem Land und eine Mittelschule"<br />
besucht, ihre Wissbegierde und Offenheit führte sie schließlich auf das Städtische<br />
<strong>Abendgymnasium</strong>. Aufrichtig berichtet Frau Türck aber auch über manche Schwierigkeiten<br />
und Rückschläge, die es während des Schulbesuchs zu überwinden gilt, beispielsweise<br />
auch mit schlechten Noten zurecht zu kommen: "In meinem Alter, wenn man ja eigentlich<br />
über alles erhaben wird, war das nicht ganz einfach – aber insgesamt eine sehr positive<br />
Erfahrung."<br />
Zu den positiven Erfahrungen rechnet unsere frühere Studierende auch die Solidarität und<br />
Hilfsbereitschaft ihrer Mitschüler, die ihr, v.a. in den ersten beiden Schuljahren, als sie noch<br />
berufstätig war und wegen ihres Einsatzes auf Langstreckenflügen manche Schultage versäumte,<br />
"zuverlässig wie ein Uhrwerk" alles auf- und mitgeschrieben haben.<br />
Frau Türck freut sich auf ihr Ethnologiestudium, das sie schon bald beginnen wird. Der SZ-<br />
Artikel wird illustriert durch ein sehr sympathisches Foto, das unsere strahlende Abiturientin<br />
im Foyer unserer Schule neben der Bronzebüste des milde lächelnden Anton Fingerle zeigt.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
6.4 Der "neue" erste Schultag am <strong>Abendgymnasium</strong><br />
Im Juli <strong>2006</strong> trafen sich einige Lehrkräfte unter der Leitung von Frau Rüttinger, um gemeinsam<br />
zu besprechen, wie der Ablauf des ersten Schultags insbesondere <strong>für</strong> unsere Neulinge<br />
verbessert werden könnte. Gemeinsam erstellten wir eine Liste von Vorschlägen, die dann<br />
am 11.9.<strong>2006</strong>, unserem Schulbeginn auch umgesetzt wurden. Und so sah der erste Schulabend<br />
<strong>für</strong> unsere fünf 1. Klassen aus:<br />
Bereits unten im Foyer wurden die Neuankömmlinge von Frau Schoeneich-Graf und Herrn<br />
König begrüßt, die ihnen anhand vorbereiteter Listen auch halfen, ihre jeweilige Klasse zu<br />
finden.<br />
Die Klassenzimmer waren bereits ab 17.30 Uhr geöffnet, um unangenehmes Warten auf<br />
dem Flur zu verhindern. Ab 17.45 Uhr war dann auch die Klassleitung in den Zimmern, um<br />
die neuen Studierenden zu begrüßen und Namenskärtchen <strong>für</strong> die Bänke zu verteilen. Übrigens<br />
trugen an diesem Abend alle Lehrkräfte auch selber Namensschilder angesteckt oder<br />
umgehängt und waren so leichter und persönlicher ansprechbar.<br />
Zudem hatte das Sekretariat eine Liste "Who's Who am <strong>Abendgymnasium</strong>" erstellt, die im<br />
Schaukasten und in den einzelnen Klassenzimmern ausgehängt wurde. Darauf sind mit Foto<br />
und Namen einige der häufigsten Ansprechpartner <strong>für</strong> unsere Studierenden zu sehen.<br />
Um 18.00 Uhr begann dann wie üblich der Unterricht am AG mit der Klassleiterstunde, allerdings<br />
dauerte diese bis 19.15 Uhr und bot damit genügend Gelegenheit, die Studierenden<br />
mit den wesentlichen Punkten der Haus- und Verfahrensordnung sowie dem Terminplan<br />
110
ekannt zu machen. Nebenbei konnten auch die meisten der wichtigsten Formalien, wie die<br />
Ausgabe der MVV-Anträge, das Ausfüllen von Gastschülerformularen und Unterlagen <strong>für</strong><br />
das Sekretariat, erledigt werden.<br />
Danach genossen unsere Neulinge von 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr ihre erste und einzige lange<br />
Pause am AG. Man traf sich danach wieder mit der Klassleitung im Klassenzimmer und begab<br />
sich dann gemeinsam auf einen kleinen Rundgang durch das Schulhaus. Schließlich<br />
sollten die neuen Studierenden ja wissen, wo die Toiletten sind, wie der Fluchtweg gekennzeichnet<br />
ist und welches Treppenhaus zu den Unterrichtsräumen führt. Ganz besonders<br />
hingewiesen wurde auf folgende Orte: Sekretariat, Direktoriat, Schaukasten mit Vertretungsplänen<br />
und Informationen, Bücherei, Lehrerzimmer mit Briefkasten <strong>für</strong> Entschuldigungen,<br />
Fachräume <strong>für</strong> Physik, Chemie, Biologie sowie Raum E 77 <strong>für</strong> katholische Religion,<br />
Kantine, Pausenraum und Aula.<br />
Nach diesem Rundgang, bei dem es wegen der großen Zahl an Neulingen in den Fluren<br />
teilweise etwas eng wurde, trafen sich alle Studierenden in der Aula. Dort wurden sie nochmals<br />
vom Schulleiter Herrn Schalk und seiner Stellvertreterin Frau Rüttinger willkommen<br />
geheißen. Auf der Bühne anwesend waren ferner noch Frau Klauser <strong>für</strong> das Sekretariat sowie<br />
einige Lehrkräfte: Frau Rigó-Titze <strong>für</strong> das Entschuldigungswesen, Frau Streicher als<br />
Beratungslehrkraft, Frau Mondry als Leiterin der lernmittelfreien Bibliothek, Herr Endraß und<br />
Herr Sinhart als Verbindungslehrer. Aber nicht nur sie richteten ein paar Worte an die neuen<br />
Studierenden, sondern auch Miryam Faki, Katharina Musch, Helmut Bauer und Karl Ritter<br />
als Studierende der oberen Klassen sowie Adam Egerer, ein Abiturient des letzten Schuljahrs.<br />
Motiviert durch die freundlichen, ermunternden Worte lauschte die neuen AG-ler dann noch<br />
einer kurzen Einführung durch Thomas Klauser, den Leiter der Stadtbücherei Obergiesing<br />
im Haus, ehe noch individuelle Fragen an die anwesenden Studierenden und Lehrkräfte<br />
gestellt werden konnten und kurz vor 21.00 Uhr ein erster Schulabend voll von neuen Eindrücken<br />
und Gesichtern zu Ende ging.<br />
Gabriele Rigó-Titze<br />
7. Personalia und Verschiedenes<br />
7.1 Unsere neuen Lehrkräfte<br />
Nachdem am Ende des vergangenen Schuljahrs drei Kolleginnen das Städtische<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> verließen, durften wir zu Beginn des Schuljahrs <strong>2006</strong>/07 drei neue<br />
Lehrkräfte an unserer Schule begrüßen. Walter Pfenning, Robert Pohl und Eva-Maria<br />
Sporrer (hier in alphabetischer Reihenfolge genannt) unterrichten seit September Vollzeit<br />
am <strong>Abendgymnasium</strong>, und zwar in folgenden Fächern: Herr Pfenning Latein und<br />
Französisch, Herr Pohl Mathematik und Physik, Frau Sporrer Deutsch und Geschichte.<br />
In den unten stehenden Beiträgen stellen sich unsere Neuen vor: Herr Pfenning in einem<br />
Interview, Herr Pohl in einem Steckbrief und Frau Sporrer in einem Selbstportät.<br />
111
7.2 Interview mit Herrn Walter Pfenning,<br />
dem neuen Lehrer <strong>für</strong> Latein und<br />
Französisch am AG<br />
Herr Pfenning, ein solches Gespräch beginnt man ja<br />
meist mit der Frage nach den Ursprüngen.<br />
Ich bin eigentlich stark in Bayern verwurzelt: geboren<br />
in München, aufgewachsen in Gauting, und mein<br />
Abitur habe ich am Gymnasium in Tutzing gemacht.<br />
Haben Sie dann auch an der Münchener Uni studiert?<br />
Ja, ich habe dort Französisch und Latein studiert,<br />
musste dabei auch noch das Graecum nachmachen.<br />
Das meiste hab' ich zwar schon vergessen, aber die<br />
Schrift kann ich noch lesen.<br />
Sind Sie während des Studiums auch ins Ausland<br />
gegangen?<br />
112<br />
Foto: W. Endraß<br />
Ja, ich war ein dreiviertel Jahr als assistant d'allemand in Caen, in der Normandie. Das waren<br />
meine ersten Erfahrungen mit dem Beruf als Lehrer.<br />
Hat es Ihnen gefallen?<br />
O ja, sehr gut. Das lyçée in Caen war zwar nicht überragend, aber ich hatte brave Schüler.<br />
In den oberen Klassen habe ich allein Landeskunde unterrichtet, bei den jüngeren Schülern<br />
war meistens ein französischer Lehrer mit dabei. Vor allem aber hatte ich viel Freizeit, und<br />
konnte noch bestehende Freundschaften knüpfen.Caen ist eine sehr schöne Stadt. Es gibt<br />
dort sehr viele gotische Kirchen und Klöster und eine hübsche Altstadt, die im 2. Weltkrieg<br />
bzw. nach der Landung der Alliierten stark zerstört und großen Teils wieder aufgebaut wurde.<br />
Die Umgebung (Küste und Hinterland, u.a. die „Suisse normande“) sind landschaftlich<br />
ganz reizvoll.<br />
Und dann ging es wieder zurück nach München?<br />
Ja. Ich habe ziemlich lange studiert. Während des Studiums habe ich noch meinen Zivildienst<br />
im Krankenhaus Rechts der Isar abgeleistet. Danach habe ich öfters <strong>für</strong> den Kreisjugendring<br />
im Jugendlager Kapuzinerhölzl gearbeitet.<br />
Sind Sie nach dem Studium gleich ins Referendariat eingestiegen?<br />
Ja, ich war an zwei Seminarschulen in München: am Oskar-von-Miller-Gymnasium <strong>für</strong> Französisch<br />
und am Maxgymnasium <strong>für</strong> Latein. Meine Zweigschule war das Gymnasium Icking.<br />
Haben Sie auch, wie viele Kollegen, die Referendarzeit in schlechter Erinnerung?<br />
Es war unterschiedlich. Die Zeit am Maxgymnasium habe ich als ziemlich unangenehm<br />
empfunden. Zusammengefasst möchte ich es eigentlich so bezeichnen: Ich habe als Referendar<br />
auf unangenehme Weise was gelernt.
Und nach dem Zweiten Staatsexamen ist es Ihnen wohl so ergangen wie vielen anderen<br />
jungen Gymnasiallehrern damals: Sie haben keine Stelle bekommen.<br />
Das ist richtig. Ich war zunächst noch Aushilfe an Schulen in Ottobrunn und Pocking, wo es<br />
mir wegen der netten Kollegen recht gut gefallen hat. Anschließend hatte ich etliche Gelegenheitsjobs,<br />
bis ich schließlich eine Umschulung gemacht habe. Das war eine völlig andere<br />
Materie: Informationsorganisation, da ging es um Office Programme, Einführung in BWL und<br />
vor allem Programmierung.<br />
Hat Ihnen diese Umschulung dann zu einem Arbeitsplatz verholfen?<br />
Ja. ich habe mit einem Kollegen und Freund aus der Umschulung bei einer Münchner IT-<br />
Firma angefangen. Lustigerweise hat sich herausgestellt, dass auch noch eine andere umgeschulte<br />
Lateinlehrerin dort beschäftigt war, mit der ich dann lange Jahre zusammengearbeitet<br />
habe.<br />
Was war Ihr Aufgabenfeld in dieser Firma?<br />
Ich habe Programme <strong>für</strong> Finanzbuchhaltung und Bilanz betreut und damit verbundene Aufgaben<br />
bearbeitet (kommerzieller Standard-Software). Insgesamt 19 Jahre war ich dort. In<br />
der Zeit wurde die Firma bereits zweimal aufgekauft und dann kam es schließlich zur betriebsbedingten<br />
Kündigung.<br />
Haben Sie dann gleich daran gedacht, wieder zur Schule zurückzukehren?<br />
Sogar schon eher! Vor drei Jahren, als ich noch gar nicht gekündigt war, habe ich bereits<br />
beim Landschulheim Schondorf nachgefragt, aber man hat mich dort nicht genommen. Als<br />
dann die Kündigung kam, habe ich mich gleich bei der Stadt München beworben.<br />
Wieso bei der Stadt und nicht beim Staat?<br />
Irgendwie ist mir die Landeshauptstadt München als Arbeitgeber sympathischer. Außerdem<br />
wollte ich gern in München bleiben. Ich bin zwar ledig und habe von da her keine Verpflichtungen,<br />
aber meine Mutter lebt in Gauting. Sie ist weit über 80 und ich muss mich vermehrt<br />
um sie kümmern.<br />
Wie sah dann Ihre Rückkehr in den Lehrerberuf aus?<br />
Im Frühjahr letzten Jahres hat man mir eine Krankheitsvertretung am Adolf-Weber-<br />
Gymnasium angeboten. Erst hatte ich schon meine Zweifel, ob ich da<strong>für</strong> überhaupt noch<br />
geeignet bin!<br />
Und dann?<br />
Ganz leicht fiel mir das Unterrichten zu Anfang nicht, denn vor der Klasse muss man doch<br />
ständig präsent sein. Zuvor konnte ich so vor mich hin arbeiten, aber an der Schule kann<br />
man sich keine Absencen erlauben. Ich habe aber hoffentlich schon viel dazugelernt!<br />
Und wie gefällt es Ihnen an unserer Schule?<br />
Das <strong>Abendgymnasium</strong> hat eigentlich nur Vorteile. Das Arbeitsklima ist äußerst angenehm,<br />
die Kolleginnen und Kollegen sind alle nach wie vor sehr nett und hilfsbereit, und die Studierenden<br />
sind freundlich und motiviert. Nur mit der ungewohnten Arbeitszeit musste ich mich<br />
ziemlich umstellen. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, sich den Tag richtig einzuteilen.<br />
113
Unterrichten Sie eigentlich lieber Latein oder Französisch?<br />
Das ist schwer zu sagen. Spontan würde ich sagen: Beides zusammen. Latein schätze ich,<br />
weil es eine so analytische Sprache ist. Französisch fasziniert mich auch sehr, weil es aktuell<br />
und zeitbezogen ist.<br />
Erzählen Sie uns bitte jetzt noch über Ihre Hobbys!<br />
Ich liebe die klassische Musik! Ich habe selbst Klarinette gespielt, es aber leider vor geraumer<br />
Zeit aufgegeben mangels Gelegenheit, mit anderen zusammen zu musizieren, was sicher<br />
mehr motiviert.<br />
Gehen Sie gern in die Oper oder ins Konzert? Und wer sind Ihre Lieblingskomponisten?<br />
Die Oper schätze ich nicht so sehr wie Orchestermusik: Symphonien oder auch Kammermusik.<br />
Lieblingskomponisten? Da gibt es mehrere. Vielleicht Beethoven und Schostakowitsch.<br />
Und Schubert!<br />
Gibt es auch einen Lieblingsautor?<br />
Ja. Halldór Laxness, weniger weil er Nobelpreisträger ist, sondern weil er erstaunlich vielseitig<br />
ist. Seine Werke sind alle ganz unterschiedlich, und dabei herrscht ein meist bissiger<br />
oder sarkastischer Ton vor. Das gefällt mir. Auch V.S. Naipaul mag ich. Noch ein Nobelpreisträger!<br />
Was mögen Sie sonst noch?<br />
Ich spiele gern Schach. Und ich mag Karikaturen, leider gibt es aber nur wenig gute. Ich<br />
liebe einfach skurrile Sachen!<br />
Nun die letzte Frage: Was sind Ihre Wünsche <strong>für</strong> die Zukunft?<br />
Ich möchte mich beruflich gut einarbeiten – ansonsten bin ich <strong>für</strong> alles offen.<br />
Herr Pfenning, wir bedanken uns <strong>für</strong> das Interview, und hoffen, dass es Ihnen am <strong>Abendgymnasium</strong><br />
auch weiterhin gut gefällt.<br />
7.3 Steckbrief Pohl<br />
Name: Pohl<br />
Vorname: Robert<br />
Geburtsort: Saaldorf im schönen<br />
Berchtesgadener Land<br />
Abitur: 1968 im Rupprecht-<br />
Gymnasium in München<br />
Studium: Mathematik, Physik,<br />
Informatik<br />
114<br />
Foto: W. Endraß
Berufslaufbahn: St-Anna-Gymnasium, Willi-Graf-Gymnasium, Instituto Ballester<br />
Buenos Aires, St.-Anna-Gymnasium, Colégio Humboldt São<br />
Paulo, Sophie-Scholl-Gymnasium, AG<br />
Familie: verh., Zwillinge Anna und Benedikt, 23 Jahre<br />
Hobbys: Reisen und die Welt und andere Kulturen erleben; Brasilien<br />
Sport: Joggen, Rennradfahren, Segeln, Gebirge<br />
Lieblingslektüre: Frank Schätzing: Der Schwarm; David Guterson: Schnee, der<br />
auf Zedern fällt; Bruce Chatwin: Traumpfade<br />
Lieblingsmusik: Bob Marley, Janis Joplin, Violinkonzert Ludwig van Beethoven<br />
Meinung über das AG: ich fühle mich wohl<br />
Wünsche <strong>für</strong> die Zukunft: dass es so bleibt<br />
7.4 Beruf „Lehrer“: unerwünscht<br />
Lehrerin zu sein, war <strong>für</strong> mich bis vor zehn Jahren absolut indiskutabel. Meine Leidenschaft<br />
galt dem Theater, später der Politik.<br />
Als mir eine Berufsberaterin in der Schule aufgrund meiner Lieblingsfächer Deutsch, Latein,<br />
Religion und Sozialkunde auch auf Nachfrage nur den Lehrerberuf anzubieten hatte, war ich<br />
empört über diese grenzenlose Phantasielosigkeit: In den 70er Jahren konnte man sich <strong>für</strong><br />
eine weibliche Akademikerin als Berufsziel offensichtlich nur Lehrerin, allenfalls noch Ärztin<br />
vorstellen.<br />
Nach einem Semester Theaterwissenschaften warf ich<br />
enttäuscht das Handtuch, denn dieses Studium an der<br />
LMU München erwies sich als Miniatur-Ableger der Germanistik<br />
mit rigoroser Beschränkung auf Dramen und<br />
mit hochgeistigen Seminaren über einen gewissen<br />
Herrn Karasek: eine etwas magere Ausbeute aus meiner<br />
Sicht. Aus einem niederbayerischen Einödhof kommend,<br />
überaus schüchtern und gerade erst mit der großen<br />
weiten Welt München etwas vertraut werdend, wagte<br />
ich nicht den Sprung nach Wien oder Berlin, wo<br />
Theaterwissenschaften sehr viel mehr praxisbezogener<br />
sein sollten.<br />
Als „Enkelin“ der 68er hatte ich natürlich eine hohe Affinität<br />
zur Weltverbesserung und deshalb entschloss ich<br />
mich, Politologin zu werden. Auf Drängen meiner Mutter<br />
– „Damit du auch etwas Ordentliches und Brauchbares<br />
Foto: W Endraß<br />
in der Tasche hast!“ – studierte ich parallel <strong>für</strong> das Lehramt,<br />
um meine Berufschancen durch das anspruchsvollere Staatsexamen in Kombination<br />
mit einem Magister zu verbessern. Denn die Aussichten <strong>für</strong> akademische Berufseinsteiger<br />
begannen damals schon massiv zu bröckeln: Der promovierte Taxifahrer wurde zum Synonym<br />
<strong>für</strong> die Bildungsoffensive der Sozialdemokraten.<br />
115
Aber Lehrerin? Niemals!<br />
Abgesehen davon, dass damals ein Quasi-Einstellungsstopp <strong>für</strong> Lehrer bereits in vollem<br />
Gange war, wurde ich zudem durch meine ersten Erfahrungen im Praktikum an einer Mädchenschule<br />
nur vollends in meiner Selbsteinschätzung bestätigt, ungeeignet <strong>für</strong> die Schule<br />
zu sein. Meine erste Unterrichtsstunde vor 14-jährigen Mädchen wurde mit der Bemerkung<br />
quittiert: „Mei, ist die süß!“ Für eine optimale Lehrer-Schüler-Beziehung sicherlich keine tragfähige<br />
Basis!<br />
In Unkenntnis über das hohe Anforderungsprofil seitens des Kultusministeriums an einen<br />
bayerischen Schullehrer – danach kommt nur mehr der liebe Gott – teilten meine potenziellen<br />
Arbeitgeber jedoch nicht meine Meinung über meine Zusatzqualifikation. Man belehrte<br />
mich bei meiner Stellensuche, dass mein 1. Staatsexamen ein deutlicher Hinweis sei, dass<br />
ich eigentlich eine sichere Beamtenstelle angestrebt hätte, dabei jedoch gescheitert sei (ein<br />
K.O.-Kriterium par excellence!), und als Lehrerin (was ich ja noch nicht einmal war!) sei ich<br />
mentalitätsbedingt <strong>für</strong> die freie Wirtschaft sowieso unbrauchbar: Lehrer seien nämlich rechthaberische<br />
Besserwisser, Einzelkämpfer mit hoher Beratungsresistenz, unfähig zu kooperativer<br />
Kommunikation. Außerdem sei ich überqualifiziert.<br />
Meinen ersten Job nach dem Studium verdankte ich konsequenterweise dann auch nicht<br />
meiner fachlichen Kompetenz. Die Sekretärin der Redaktion Naturwissenschaft und Technik<br />
eines öffentlich-rechtlichen Senders entschied sich <strong>für</strong> mich als Briefkastentante oder Dr.<br />
Sommer der Knoff-hoff-Show, weil ich wie sie aus Niederbayern stammte und wir den gleichen<br />
Mädchennamen hatten!<br />
Nach knapp einem Jahr Fernsehkarriere wechselte ich in eine frei gewordene Stelle als<br />
Hausfrau und Mutter einer Patchwork-Familie und widmete mich dem Projekt „Erziehung<br />
von drei Kindern, Hausverwaltung, Gartengestaltung und Nachhilfe <strong>für</strong> Nachbarskinder“.<br />
Nach einigen Jahren bei freier Kost und Logis ohne eigenes Einkommen – abgesehen von<br />
ein paar Dokumentarfilmen, die ich <strong>für</strong> einen Fernsehsender drehte, um meiner freilich<br />
selbst gewählten Hausfrauenidylle und –isolation zu entkommen - , musste ich mich nach<br />
einigen Jahren und dem Erwerb von Humankapital in Form von zwei Kindern erneut nach<br />
einer bezahlten Arbeit umsehen. Ein damals – und auch heute – nahezu aussichtsloses<br />
Unterfangen! Ende Dreißig, mit jahrelanger Absenz vom Berufsleben machte ich mir keine<br />
Illusionen, dass meine als „Familienmanagerin“ so hoch gelobten Soft Skills wie Lernbereitschaft<br />
und Anpassungs-, Team-, Moderations-, Kommunikations-, Improvisations-, ja sogar<br />
Therapie- und – und – und-Fähigkeiten einen Begeisterungsschrei in der Arbeitswelt auslösen<br />
würden.<br />
Da kam die rettende Erinnerung einer meiner zahlreichen Tanten: „Du hast doch das 1.<br />
Staatsexamen. Mach’ doch dein Referendariat nach! Lehrer werden jetzt doch überall gebraucht.“<br />
Uff! Schon längst vergessen – oder verdrängt? – holte mich mein Lehrerin-<br />
Schicksal wieder ein. Sollte Mama doch Recht behalten, ich doch was Ordentliches gelernt<br />
haben?<br />
Zähneknirschend und voller Angst – ich war noch immer furchtbar schüchtern – machte ich<br />
mich auf den Weg zur Lehramtsassessorin.<br />
Und ich wurde vom Saulus zum Paulus.<br />
Insbesondere die Hilfsbereitschaft und das Entgegenkommen der Schüler meinen zaghaften<br />
Unterrichtsversuchen gegenüber ließen mich eine neue Welt entdecken: Kinder und junge<br />
Menschen nahmen Rücksicht auf meine anfänglichen Unsicherheiten, zeigten mir ihre Zufriedenheit<br />
mit meinem Unterrichtsstil, lobten mich sogar, machten mir Mut, gaben mir zudem<br />
neue Impulse – kurzum, ich begann, meine Klientel, die meine Persönlichkeitsentwicklung<br />
so aktiv und vehement unterstützte, zu lieben.<br />
116
Nach meiner Ausbildung war der Arbeitsmarkt doch nicht so rosig wie erhofft, zumal <strong>für</strong><br />
Deutschlehrer. Trotzdem versuchte ich zwei lange Jahre, als Krankheitsvertretung an privaten<br />
und öffentlichen Schulen <strong>für</strong> eine akzeptable Festanstellung Fuß zu fassen; inklusive<br />
systemimmanenter Arbeitslosigkeit – ohne Arbeitslosengeld – von Mai bis September, da<br />
nach den Abschlussprüfungen keine Vertretungslehrer mehr angefordert werden. Natürlich<br />
bekam ich Angebote von Privatschulen, jedoch zu unzumutbaren Arbeitsbedingungen, wie<br />
beispielsweise sechs Deutschklassen à 30 Schüler und mehr oder 28 Unterrichtsstunden<br />
plus Nachmittagsbetreuung – soviel zur hohen Qualität von Privatschulen. Als ich von höchster<br />
Stelle endlich aufgeklärt wurde, dass meine Bemühungen sowieso sinnlos seien, weil<br />
man mit über 40 Jahren im öffentlichen Dienst nicht nur nicht mehr verbeamtet, sondern<br />
auch nicht eingestellt werde, da <strong>für</strong> den Steuerzahler unzumutbar, nahm ich ein einjähriges<br />
Ausbildungsangebot des Arbeitsamtes zur Verlagsangestellten an.<br />
Danach fand ich umgehend einen Arbeitsplatz bei einem renommierten Verlag. Aber auch<br />
hier war meine niederbayerische Herkunft mit entsprechenden autochthonen Sprachkenntnissen<br />
ausschlaggebend. Denn am ersten Arbeitstag eröffnete mir mein Chef und Alt-68er:<br />
„ Eich Lehrergschwerl hob i g’fressn. Oba wenigstens ko i mit Eana boarisch red’n bei dene<br />
vuin Ossis im Verlag.“<br />
Zuständig <strong>für</strong> Verkauf, Marktanalysen und Marktaktivitäten <strong>für</strong> Metall-Fachzeitschriften vornehmlich<br />
in der Schweiz, Osteuropa, Russland, USA und China, europaweit unterwegs auf<br />
internationalen Messen hatte ich nun ein interessantes, vielseitiges und abwechslungsreiches<br />
Tätigkeitsfeld, das mir unendlich viel Spaß machte.<br />
Der Lehrerberuf ließ mich trotzdem nicht mehr los; um nicht aus der Übung zu kommen,<br />
erteilte ich verlagsintern Excel-Schulungen.<br />
Nach sechs Jahren startete ich versuchshalber bei der Stadt München eine Anfrage nach<br />
einer freien Stelle und bekam nach einiger Zeit die Zusage <strong>für</strong> das <strong>Abendgymnasium</strong>.<br />
Warum tauscht man eine schlecht bezahlte gegen eine mit genau 3130 Euro brutto honorierte<br />
noch schlechter bezahlte Stelle, einen absolut sicheren Job gegen eine erneute Probezeit<br />
von sechs Monaten, einen Job in einem der angesehensten deutschen Verlage gegen<br />
einen mit denkbar miserablem Image, eine 45- gegen eine 50- bis 60-Stunden-Woche,<br />
oft ohne freies Wochenende?<br />
Weil es sich lohnt!<br />
Denn ich kann alle meine Interessen mit meinen erworbenen Fähigkeiten kombinieren und<br />
umsetzen: Ich mache nun Marketing und Verkauf von Wissen, das seinerseits nie stehen<br />
bleiben wird. Meine Kunden, die ich umwerben muss, sind begeisterungsfähig. Meine Tätigkeiten<br />
und Kontakte sind so vielseitig wie meine Schüler. Die Resonanz und Kontrolle durch<br />
die Schüler erfolgen umgehend und unverfälscht, sowohl die positive als auch die negative.<br />
Und vor allem schließt sich der Kreis: Ich versuche Schmierentheater * im besten Sinne zu<br />
machen. Spätberufen ist mein Berufswunsch Wirklichkeit geworden: Ich bin eine glückliche<br />
Lehrerin und wünsche mir nur noch, dass es auch meine Schüler mit mir sind.<br />
* Wer ein Hohelied auf das Schmierentheater hören möchte, der lese bitte nach bei Katharina<br />
Knie von Carl Zuckmayer.<br />
Eva-Maria Sporrer<br />
117
7.5 Arbeiten im Ausland<br />
Ein Interview mit Robert Pohl, Lehrer <strong>für</strong> Mathematik und Physik am Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong><br />
Herr Pohl, wann sind Sie denn zum ersten Mal ins Ausland gegangen?<br />
Das war 1986, nach Buenos Aires. Ich wollte immer schon ins Ausland gehen, die Welt kennenlernen.<br />
Ist es sehr kompliziert, sich <strong>für</strong> so einen Auslandseinsatz zu bewerben?<br />
Zuständig da<strong>für</strong> ist die ZfA, die Zentrale <strong>für</strong> das Auslandsschulwesen, beim Bundesverwaltungsamt<br />
in Köln. Und man muss die Freistellung vom hiesigen Schuldienst beantragen. Bei<br />
mir hat alles insgesamt zwei Jahre gedauert.<br />
War Argentinien dann das einzige Angebot?<br />
Nein, man hat mir auch Kairo angeboten, aber meine Frau war damals hochschwanger, da<br />
war uns das zu unsicher und wir haben abgelehnt. Dann hatte ich ein Angebot nach Mol in<br />
Belgien. Die dortige europäische Schule ist eine sehr gute Schule, aber nach Belgien zu<br />
gehen, fand ich damals zu langweilig. Ich habe mir gedacht, da kann ich gleich in Bayern<br />
bleiben, da ist es wenigstens schöner als in Belgien. Und dann kam das Angebot <strong>für</strong> Buenos<br />
Aires.<br />
Hatten Sie denn schon Spanischkenntnisse, dass man Sie ausgerechnet nach Südamerika<br />
schicken wollte?<br />
Nein, überhaupt nicht. Sprachkenntnisse sind bei der ZfA keine Voraussetzung. Man hat<br />
mich wohl genommen, weil es besonders schwierig ist, Mathe-Physik-Lehrer ins Ausland zu<br />
vermitteln.<br />
Und mittlerweile sind Mathe-Physik-Lehrer auch im Inland äußerst gefragt! Wie alt waren<br />
denn Ihre Kinder, als Sie nach Argentinien gezogen sind?<br />
Sie waren 2¼ Jahre alt. Wir waren sehr froh damals, dass wir keinen Kinderwagen mehr<br />
mitnehmen mussten. Da<strong>für</strong> haben wir sie viel getragen, was ganz schön anstrengend war!<br />
Ist es ein großer Kulturschock, wenn man als Europäer nach Argentinien kommt?<br />
Überhaupt nicht! Das kommt daher, dass man in Argentinien fast nur Weiße sieht. Wenn<br />
man den Rio de la Plata überquert, ist das schlagartig anders, denn in Uruguay gibt es sehr<br />
viele Schwarze. Buenos Aires erscheint im ersten Moment sehr europäisch, denn es gibt<br />
viele Nachfahren europäischer Einwanderer: v.a. Italiener, Spanier und Juden sowie Engländer<br />
und Russen im Süden – und natürlich auch Deutsche. Die argentinische Gesellschaft<br />
ist sehr gemischt und tolerant, aber jeder Bewohner ist immer in erster Linie Argentinier und<br />
dann erst Italiener, Spanier usw. Es gibt viele sehr gebildete Menschen, die oftmals sogar<br />
dreisprachig sind: Sie sprechen Spanisch, die Sprache ihres Herkunftslandes und noch Englisch.<br />
Woher kamen denn die Schüler, die Sie in Buenos Aires unterrichtet haben?<br />
118
Die kamen aus dem gehobenen Mittelstand. Die Nachfrage war relativ groß; es gab viele<br />
deutsche Schulen in der Stadt. Meine Schule war eine dreizügige argentinisch-deutsche<br />
Schule. Man konnte entweder dort den argentinischen Abschluss machen oder auf der Goethe-Schule<br />
das deutsche Abitur. Die Schule war aufgeteilt in Primariar und Sekundariar, und<br />
ich habe an der Sekundariar unterrichtet.<br />
Hat sich auch Ihre Familie dort wohlgefühlt?<br />
Ja. Wir waren insgesamt fünf Jahre dort. Meine Frau hat viele Kurse besucht und die Kinder<br />
versorgt. Die gingen in den argentinischen Kindergarten. Zu Hause haben wir natürlich nur<br />
Deutsch geredet, aber es war toll zu sehen, wie sie problemlos zwischen den Sprachen hin-<br />
und hergesprungen sind.<br />
Können Ihre Kinder denn noch Spanisch?<br />
Leider haben sie das meiste wieder vergessen. Zumindest mein Sohn. Meine Tochter ist<br />
erstaunlich schnell wieder ins Spanische hineingekommen, als wir später von Brasilien aus<br />
in ein spanischsprachiges Nachbarland gefahren sind.<br />
Eingeschult wurden Ihre Kinder dann aber in München.<br />
In Puchheim. Wir kamen im Februar zurück, sie gingen dann noch ein halbes Jahr in einen<br />
Kindergarten und wurden dann eingeschult.<br />
Aber bestimmt sind Sie während Ihrer Zeit in Argentinien auch manchmal nach Deutschland<br />
geflogen.<br />
Natürlich; an Weihnachten zum Beispiel.<br />
Sind Sie auch in Argentinien viel gereist?<br />
Oh ja! Im Sommer hatten wir zehn Wochen Ferien am Stück und da sind wir viel herumgereist.<br />
Wir waren in Paraguay und unten in Patagonien. Nur in die Antarktis haben wir es leider<br />
nicht geschafft.<br />
Kennen Sie das Buch "In Patagonien. Reise in ein fernes Land" von Bruce Chatwin?<br />
Aber ja, ein tolles Buch! Patagonien ist wirklich sehr faszinierend, eine wunderschöne Landschaft<br />
und höchst interessante Einwohner. Da gibt es beispielsweise noch Nachfahren von<br />
religiösen Sekten, die vor langer Zeit aus Europa auswandern mussten und auf abenteuerliche<br />
Weise ins verlassene, windige Patagonien gelangt sind.<br />
Und wie war das Leben in Buenos Aires?<br />
Buenos Aires ist eine tolle Stadt, die unendlich viel bietet. Was ich damals alles unternommen<br />
habe! Ich habe die vielen Museen besucht, hatte ein Opernabo und ein Segelboot am<br />
Rio de la Plata und habe sogar Tango tanzen gelernt.<br />
Sind Sie nach Ihrer argentinischen Zeit dann bald weiter nach Brasilien?<br />
Nein. Erst einmal war ich sieben Jahre lang am St.-Anna-Gymnasium. Ich war dort nach<br />
kurzer Zeit arbeitsmäßig sehr eingebunden: Ich habe die EDV betreut und den Stundenplan<br />
gemacht. Aber dann hat es mich schon wieder gejuckt, ich wollte weg und habe mich beworben.<br />
Ich wollte gern wieder nach Lateinamerika und habe auch ein Angebot bekommen,<br />
aber meine Familie, v.a. mein Sohn, wollte nicht nach Mexiko - wegen der Erdbeben. Chile<br />
119
hätte mich auch sehr gereizt, aber schließlich habe ich eines schönen Tages im September<br />
einen Anruf von der ZfA bekommen. Ausgerechnet <strong>für</strong> eines der wenigen Länder Südamerikas,<br />
in denen nicht Spanisch gesprochen wird! Man hat mir São Paulo angeboten; ich musste<br />
mich aber innerhalb von 14 Tagen entscheiden. Am 25. Januar sind wir dann geflogen.<br />
Das war schon sehr wenig Zeit, um unseren Hausstand in Puchheim aufzulösen und alles<br />
zu organisieren!<br />
120<br />
Rio de Janeiro, Zuckerhut und die Buchten, gesehen vom Corcovado (Christus) aus Foto: R. Pohl<br />
Brasilien ist ja ein riesig großes Land. Wieso gibt es denn ausgerechnet in São Paulo eine<br />
deutsche Schule?<br />
Die wenigsten Deutschen wissen, dass São Paulo die größte deutsche Industriestadt der<br />
Welt ist. VW, Mercedes, Siemens, Bosch, Chemie- und Pharmaindustrie – alle sind in São<br />
Paulo, während bei uns die Industrie ja auf das ganze Land verteilt ist. Das deutsche Generalkonsulat<br />
in São Paulo ist sicherlich wichtiger als die deutsche Botschaft in Brasilia.<br />
Hat man Ihnen denn geholfen, in São Paulo eine Wohnung zu finden?<br />
Oh ja, die Betreuung war sehr gut, übrigens wie schon zuvor in Buenos Aires. Ich hatte jeweils<br />
einen Betreuungslehrer, der mir am Anfang bei den praktischen Dingen geholfen hat.<br />
Hat sich <strong>für</strong> Sie Brasilien sehr stark von Argentinien unterschieden?
Es ist völlig anders! Die Bevölkerung ist stark nach Rassen durchmischt: Es gibt Weiße,<br />
Schwarze, Indianer und Asiaten. Und natürlich vielfältige Mischungen zwischen diesen<br />
Gruppen. Eine Theorie besagt, dass jeder Brasilianer, so weiß er auch erscheinen mag, auf<br />
alle Fälle wenigstens einen Tropfen schwarzes Blut hat. Vielleicht ist deshalb der afrikanische<br />
Einfluss so sehr stark spürbar. Ich würde sogar so sagen: Brasilien ist ein afrikanisches<br />
Land in Südamerika. Da<strong>für</strong> ist der indianische Einfluss geringer als anderswo. Überall in<br />
Südamerika ist die Indio-Kultur entlang der Anden noch sehr stark. In Brasilien gibt es sie<br />
eigentlich nur am Amazonas.<br />
Es heißt ja immer, Brasilien sei ein tolerantes Land, in dem es – anders als beispielsweise in<br />
den USA - keine Diskriminierung aufgrund von Rassenzugehörigkeit gebe. Trifft das zu?<br />
Auf dem Papier, laut Recht gibt es wirklich keine Diskriminierung, aber in der Gesellschaft<br />
kann man schon gewaltige Unterschiede erkennen. Es gibt eine sehr reiche weiße Oberschicht<br />
– so reich, dass man es sich hier kaum vorstellen kann. Schwarze findet man kaum<br />
in oberen Positionen, zum Beispiel in der Wirtschaft. Ganz unten auf der sozialen Rangleiter<br />
stehen aber die Indianer. Alles in allem ist die brasilianische Gesellschaft aber eine extrem<br />
offene Gesellschaft. Ich war überall willkommen, ich habe mich immer angenommen gefühlt.<br />
Als ich erzählt habe, dass ich wieder nach Deutschland zurückkehre, hat man mich immer<br />
wieder gefragt: "Warum gehst du denn? Gefällt es dir nicht mehr hier bei uns?" Ich kann mir<br />
nicht vorstellen, dass jemand das in Deutschland zu einem Türken sagen würde, der vorhat<br />
in die Türkei zurückzukehren. Diesbezüglich könnten wir noch unendlich viel von den Brasilianern<br />
lernen!<br />
Worin sehen Sie jetzt im Nachhinein den Hauptunterschied zwischen Argentinien und Brasilien?<br />
Beide Nationen sind sehr aufgeschlossen und zeigen ein tolerantes Verhalten. Die Argentinier<br />
haben aber, um es vorsichtig zu formulieren, ein etwas übertriebenes Selbstbewusstsein,<br />
während die Brasilianer wesentlich zurückhaltender sind. Das zeigt sich auch in der<br />
Musik. Oder im Fußball. Da sind ja Brasilien und Argentinien immer schon die größten Konkurrenten<br />
in Südamerika. Einmal war ich bei einem Länderspiel der beiden Nationalteams.<br />
Da war von Konkurrenzdruck oder Aggressivität nichts zu spüren, weder bei den Spielern<br />
noch bei den Zuschauern. Das Spiel verlief ganz ruhig. Brasilien hat übrigens gewonnen.<br />
Hat es denn der ganzen Familie Pohl in São Paulo gefallen?<br />
Oh ja! Wir waren 6½ Jahre dort. Meine Kinder sind auf dieselbe Schule gegangen, an der<br />
ich unterrichtet habe, und haben ihr Abitur in Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Mathematik<br />
und Biologie abgeleg<br />
Erzählen Sie uns bitte etwas über diese Schule!<br />
Es war eine kleine brasilianisch-deutsche Schule mit drei Zügen. Es gab zwei brasilianische<br />
Züge mit Schwerpunkt Deutsch und deutschsprachigem Fachunterricht. Der dritte Zug war<br />
zu 50 Prozent brasilianisch und zu 50 Prozent deutsch. Diesen Zweig besuchten beispielsweise<br />
meine Kinder, Kinder von Leuten aus der Wirtschaft oder von Konsulatsangehörigen,<br />
Kinder aus deutsch-brasilianischen Familien, die Wert auf deutschen Hintergrund gelegt<br />
haben. Es gab aber auch reine Brasilianer – viele von denen wechselten nach der 8. Klasse<br />
von einem brasilianischen auf den deutschen Zweig – oder Brasilianer asiatischer Abstammung.<br />
Interessanterweise waren das zumeist auch die Spitzenschüler, viel motivierter und<br />
belastbarer als alle anderen.<br />
Welchen Schulabschluss haben die Absolventen denn erworben?<br />
121
Auf den brasilianischen Zweigen hat man nach elf Jahren den brasilianischen Abschluss<br />
gemacht, am deutschen Zweig war es das deutsche Abitur nach zwei weiteren Jahren. Inzwischen<br />
ist es nur noch ein Jahr mehr, wegen G8. Wir mussten die Abituraufgaben selber<br />
erstellen, die wurden dann nach Deutschland geschickt, durchgesehen und genehmigt. Laut<br />
KMK-Beschluss muss das alles so abgesichert sein. Da meine Kollegen in São Paulo ja aus<br />
unterschiedlichen Bundesländern kamen, war es notwendig, bei der Festlegung von Stoff<br />
und Aufgaben zusammenzuarbeiten und sich zu einigen.<br />
Außerdem hatten wir an unserem Institut in São Paulo noch eine Berufsschule, die in Zusammenarbeit<br />
mit der Industrie und der Handelskammer einen dualen Schulabschluss ermöglicht<br />
hat. Die Schüler gehen, nachdem sie den brasilianischen Abschluss gemacht haben,<br />
in eine Firma, um dort eine Ausbildung zu machen, z.B. zu einer Versicherung, wenn<br />
sie im kaufmännischen Bereich arbeiten wollen. Sie haben dann in dieser Zeit immer wieder<br />
Schule im Blockunterricht und legen nach drei Jahren eine Abschlussprüfung ab. Damit haben<br />
sie eine abgeschlossene Berufsausbildung, die auch in Deutschland anerkannt wird.<br />
Zusätzlich können die Schüler im Abendunterricht noch Englisch, Deutsch und Mathematik<br />
belegen und so das deutsche Fachabitur bekommen.<br />
Sao Paulo, das Zentrum, gesehen vom Edificio Italia einem der höchsten Foto: R. Pohl<br />
Gebäude (45 Stock) im Zentrum von Sao Paulo<br />
Gehen denn sehr viele Brasilianer nach Deutschland?<br />
Ja. Ich weiß das über meine Kinder, die immer noch viel Kontakt zu brasilianischen Freunden<br />
haben. Und selber bekomme ich es auch mit. Im Moment wohnt bei mir ein ehemaliger<br />
Schüler, der in der 8. Klasse Physik bei mir hatte. Jetzt möchte er an der FH studieren. Ein<br />
anderer studiert EDV, er hat sich auf Computer-Sicherheit spezialisiert und wird damit sicher<br />
ein gesuchter Mann. Er hat schon als Schüler in São Paulo erfolgreich versucht, über den<br />
122
Computer an unsere Schulaufgaben zu kommen. Der macht bestimmt Karriere! Viele Brasilianer<br />
studieren in Deutschland, vor allem Köln und Aachen sind sehr beliebt.<br />
Herr Pohl, wie war denn die Rückkehr nach Deutschland?<br />
Das zweite Mal war es besser, denn ich wusste schon, was mich erwartet.<br />
Das klingt recht negativ. Haben Sie denn schlechte Erfahrungen gemacht?<br />
Ja, bei vielen im Kollegium – aber natürlich nicht hier am AG! Dieses Interview ist eigentlich<br />
das erste Mal, dass man sich an einer Schule ernsthaft <strong>für</strong> meine Zeit im Ausland interessiert.<br />
Bisher hatte ich keine oder meist negative Resonanz. Das fing an mit falschen Vorstellungen<br />
über meine Auslandsarbeit und reichte bis zu Neid und Abneigung. Niemand will<br />
wirklich wissen, was du gemacht hast, alle glauben, du hattest High Life am Strand. Immer<br />
wieder sind diese Klischees gekommen: Strand, Copacabana, Nichtstun. Dabei saß ich 100<br />
km vom Meer entfernt in einer 20-Millionen-Stadt mit <strong>für</strong>chterlichem Klima und viel Verkehr.<br />
Viele Neider sind auch der Meinung, dass man im Ausland reich wird. Natürlich verdient<br />
man mehr Geld als zu Hause in Deutschland, aber da<strong>für</strong> sind die Kosten, beispielsweise<br />
<strong>für</strong>s Wohnen, auch viel höher. Und Kinder großzuziehen kostet schließlich auch enorm viel.<br />
Haben Sie denn durch Ihre Auslandsaufenthalte auch etwas dazugelernt?<br />
Ja, ich habe zum ersten Mal deutlich erkannt, wie wichtig Sprache <strong>für</strong> uns Menschen ist.<br />
Und das, obwohl ich Mathematiker bin. Sprachen zu lernen, sich mit einer fremden Sprache<br />
auseinanderzusetzen ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung, wenn man im Ausland lebt,<br />
sondern auch eine tolle Erfahrung. In Brasilien gibt es ein Gesetz, das jedem Ausländer eine<br />
Übergangsfrist von zwei Jahren gibt, um Portugiesisch zu lernen. Danach wird er behandelt<br />
wie jeder normale Brasilianer. Ich glaube, auch hier könnte Deutschland noch einiges lernen.<br />
Ich hatte in São Paulo deutsche Kollegen, die fünf oder sechs Jahre dort gelebt haben<br />
und dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind, ohne auch nur in Ansätzen Portugiesisch<br />
gelernt zu haben. Sie haben nicht einmal den Versuch unternommen.<br />
Das ist wirklich kaum nachzuvollziehen!<br />
Etwas anderes kann ich auch nicht nachvollziehen. Nach keinem meiner Aufenthalte in<br />
Südamerika hat mich jemand von offizieller Seite nach meinen Eindrücken und Erfahrung<br />
befragt. Wir deutschen Lehrer im Ausland bringen doch so vielfältige, in der Praxis erprobte<br />
Erfahrungen mit, die sich bestimmt sinnvoll auswerten lassen würden. Wir sind ja alle irgendwie<br />
Experten <strong>für</strong> den Unterricht, auch den Fachunterricht, mit Deutsch als Fremdsprache.<br />
Ich habe gehört, dass in einigen anderen Bundesländern durchaus Wert auf ein Feedback<br />
in dieser Richtung gelegt wird, aber in Bayern ist das nicht der Fall. Das verstehe ich<br />
nicht, und ich finde es sehr schade.<br />
Zum Abschluss noch eine Frage: Was ist das Wichtigste, wenn man <strong>für</strong> längere Zeit ins<br />
Ausland geht, um dort zu arbeiten?<br />
Du musst flexibel sein, du musst zusammenarbeiten können, du musst offen sein und dich<br />
auf ein völlig anderes Leben einstellen können.<br />
Herr Pohl, dieses Motto gilt sicher nicht nur <strong>für</strong> die Arbeit in exotischen Ländern, sondern<br />
auch <strong>für</strong> die Arbeit an unserer "exotischen" Schule. Wir hoffen, es gefällt Ihnen bei uns.<br />
Herzlichen Dank <strong>für</strong> dieses Interview!<br />
123
7.5 Abendgymnasien im Ländle<br />
Unsere diesjährige Abiturientin Karina Kienzler ist erst mit Beginn der Kollegstufe, also in<br />
der 3. Jahrgangsstufe, in das Städtische <strong>Abendgymnasium</strong> in München eingetreten. Trotzdem<br />
ist sie mit Sicherheit unsere Studierende mit der größten und breitesten <strong>Abendgymnasium</strong>s-Erfahrung.<br />
Der Grund hier<strong>für</strong>: Sie hat in den Jahren davor bereits drei andere Abendgymnasien<br />
kennengelernt – alle im Nachbarland Baden-Württemberg. Über ihre Erfahrungen<br />
und Eindrücke gab sie uns am 26. März <strong>2007</strong> das folgende Interview.<br />
Frau Kienzler, Sie haben vor dem Münchner <strong>Abendgymnasium</strong> bereits württembergische<br />
Abendgymnasien besucht. Was waren Ihre Stationen im einzelnen?<br />
Ich war in Baden-Württemberg an insgesamt drei Abendgymnasien: in Ulm, in Stuttgart und<br />
in Göppingen. In meiner Heimatstadt Heidenheim gibt es leider kein eigens <strong>Abendgymnasium</strong>.<br />
Das klingt so, als ob es in Baden-Württemberg sehr viele Abendgymnasien gäbe.<br />
So ist es. Fast jeder Landkreis hat sein eigenes AG. Diese Schulen sind zumeist staatlich<br />
anerkannte Privatschulen, die durch die private Initiative von pensionierten Lehrern getragen<br />
werden.<br />
Das bedeutet aber, dass der Weg zum Abitur mit etlichen Kosten verbunden ist.<br />
Richtig. Bis zum Abi kommen da schon leicht über € 2000 zusammen.<br />
Haben sich die Schulen, die Sie besucht haben, denn sehr stark voneinander unterschieden?<br />
Oh ja, allerdings! Diese Abendgymnasien waren sehr unterschiedlich.<br />
Dann erzählen Sie doch bitte einmal der Reihe nach!<br />
Meine erste Station war das <strong>Abendgymnasium</strong> in Ulm. Dort war ich ein halbes Jahr in der<br />
Klasse K1. Die entspricht der 10.Klasse am Tagesgymnasium. Ich musste nur das zweite<br />
Halbjahr machen, weil ich bereits den Realschulabschluss hatte. Wie hier dauert das<br />
<strong>Abendgymnasium</strong> in Baden-Württemberg auch vier Jahre.<br />
Wie war denn die Schule organisiert?<br />
Das Ganze lief über die Volkshochschule. Ich musste mich dort anmelden und dabei eine<br />
Gebühr von DM 450,-- <strong>für</strong> die gesamten vier Jahre entrichten. Heute muss man eine Verwaltungspauschale<br />
von € 40 und ein monatliches Schulgeld von € 50 bezahlen.<br />
Das ist nicht gerade billig!<br />
Auch in Stuttgart kostet die Anmeldung inzwischen € 50 und das Halbjahr € 270! In Ulm war<br />
der Schulleiter ein pensionierter Lehrer, der die Schule stark geprägt und zusammengehalten<br />
hat. Unterrichtet wurden wir von Gymnasiallehrern, die hauptsächlich an normalen Gymnasien<br />
tätig waren. Wir haben immer wieder gehört, dass sie nur mit viel Überredungskraft<br />
dazu gebracht werden konnten, auch am <strong>Abendgymnasium</strong> zu arbeiten.<br />
124
Warum denn das?<br />
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Eingangsklasse immer sehr groß war: Es gab<br />
zwischen 40 und 50 Schüler dort. Diese Zahl hat sich aber dann im Laufe der Zeit auf 20 bis<br />
25 halbiert.<br />
Welche Fächer wurden unterrichtet?<br />
Es war so ähnlich wie in München. Wir hatten Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik,<br />
Physik und Geschichte, allerdings weder Religion noch Ethik. Die zweite Fremdsprache<br />
konnte nicht ausgewählt werden, sondern wurde nach Rücksprache mit der Klasse festgelegt<br />
– in meinem Fall eben Französisch. Die zweite Fremdsprache konnte erlassen werden,<br />
falls man sie schon einmal an einem Gymnasium in den Klassen 7 bis 10 belegt hatte und<br />
dabei Note 3 erzielt hatte. Ausländische Schüler konnte auch eine sog. Feststellungsprüfung<br />
in einer anderen Fremdsprache ablegen und damit die zweite Fremdsprache ersetzen. Ach<br />
ja, noch etwas: Sowohl in Ulm als auch später in Göppingen war <strong>für</strong> alle Schüler ein halbes<br />
Jahr Chemie Pflicht, weil sonst viele Dinge in der Biologie nicht verstanden werden. Danach<br />
ging es mit Biologieunterricht weiter.<br />
Gab es sonst noch Unterschiede zum Münchener <strong>Abendgymnasium</strong>?<br />
Die Unterrichtszeit ging bis 21.30 Uhr. Nach der 12. Klasse konnte man die Fachhochschulreife<br />
ohne eigene Prüfung machen, man durfte aber in keinem Fach schlechter als 5 Punkte<br />
sein. Einige, die ursprünglich nur das Fachabitur angestrebt haben, dann aber zu schlechte<br />
Noten hatten, habe dann deshalb noch ein Jahr weitergemacht und das allgemeine Abitur<br />
gemacht.<br />
Hat es Ihnen am Ulmer <strong>Abendgymnasium</strong> gefallen?<br />
Oh ja, es war sehr schön dort, aber wegen der Arbeit musste ich nach einem Jahr die Schule<br />
wechseln und nach Stuttgart gehen.<br />
Das ist aber doch auch in Baden-Württemberg! Gab es da denn überhaupt gravierende Unterschiede<br />
zu Ulm?<br />
Aber ja! Zwar war die Schule von der Größe her vergleichbar mit München, aber das Besondere<br />
besteht darin, dass es einen Abendzug und einen Wochenendzug gab. Der Abendzug<br />
wird jeweils abends unter der Woche unterrichtet – so wie hier in München – von 17 bis<br />
21.30 Uhr. Der Wochenendzug dagegen hat am Freitag von 17 bis 21.30 Uhr Unterricht und<br />
Samstag ganztägig von 9 bis 21.30 Uhr.<br />
Das klingt ja sehr gut, aber reicht diese Unterrichtszeit im Wochenendzug denn überhaupt<br />
aus?<br />
Durchaus, man muss aber daheim viel mehr lernen. Außerdem gibt es unter Woche sogenannte<br />
Kontaktstunden <strong>für</strong> Schüler, die Probleme mit dem Stoff haben.<br />
War dieser Wochenendzug in Stuttgart denn sehr beliebt?<br />
Ja schon. Es gab ca. 30 Schüler im Wochenendzug. Ein Wechsel in den Abendzug war jederzeit<br />
ohne Probleme möglich, umgekehrt war es nicht so einfach. Wenn man vom Abendzug<br />
auf den Wochenendzug wechseln wollte, musste man einen Antrag stellen, der nur genehmigt<br />
wurde, wenn die Kapazität es erlaubte.<br />
125
Wie lange sind Sie denn in Stuttgart geblieben?<br />
Ein Jahr. Ich habe dann <strong>für</strong> ein Jahr die Schule unterbrochen, weil ich eine Ausbildung<br />
machte und es zeitlich nicht mehr zu schaffen war. Danach habe ich eine Stelle in Göppingen<br />
bekommen und beschlossen, dort wieder das <strong>Abendgymnasium</strong> zu besuchen. Um mich<br />
wieder ans Lernen und an den Stoff zu gewöhnen, habe ich die 11. Klasse freiwillig wiederholt.<br />
Dort hat es Ihnen dann, glaube ich, am wenigsten gefallen.<br />
Das stimmt. Es war eine sehr kleine Schule, die sehr autoritär geleitet wurde. Eines der wenigen<br />
positiven Dinge war, dass wir die Bücher ausleihen konnten. Wir mussten aber auch<br />
pro Halbjahr € 30 Schulgeld bezahlen. Das Klima an der Schule war sehr schlecht: Es gab<br />
strenge Lehrer, die uns Hausaufgaben gaben und keinerlei Rücksicht auf unsere Berufstätigkeit<br />
nahmen. Der Druck auf die Schüler war so groß, dass es auch kaum Solidarität untereinander<br />
gab. Wenn man beispielsweise einmal gefehlt hat, hat einem niemand Unterlagen<br />
geliehen, weil die Angst vor den autoritären Lehrern so groß war. Sie haben uns behandelt<br />
wie Kinder! Es gab Tafeldienst und Tagebuchdienst, und wir mussten uns Sätze anhören<br />
wie "Ihnen erklär' ich nichts mehr, Sie machen ja auch keine Hausaufgaben!" Hier in München<br />
geht es viel offener, freundlicher und erwachsenengerechter zu.<br />
Das hören wir natürlich sehr gerne! Wird denn nun Ihr Abitur in Bayern <strong>für</strong> Sie einfacher<br />
oder schwerer sein?<br />
In Baden-Württemberg gibt es ja auch das Zentralabitur, und stofflich bestehen, soviel ich<br />
weiß, kaum Unterschiede. Den größten Unterschied gibt es in Mathe. Das ist hier einfacher,<br />
weil es in der Kollegstufe und beim Abi keine Vektorenrechnung und auch keinen graphischen<br />
Taschenrechner gibt. Das Beste <strong>für</strong> mich ist, dass ich in Baden-Württemberg in Mathematik<br />
Abitur hätte schreiben müssen und das in Bayern nicht zu tun brauche. Ich bin<br />
nämlich so schlecht in Mathe! Deshalb freue ich mich, dass hier in München mein drittes<br />
schriftliches Abiturfach Deutsch sein kann.<br />
Dann bedauern Sie es also nicht, nach Bayern gekommen zu sein?<br />
Überhaupt nicht!<br />
Frau Kienzler, dann bleibt uns nur, Ihnen <strong>für</strong> Ihr Abitur viel Erfolg und bestes Gelingen zu<br />
wünschen!<br />
7.6 Freundeskreis des Städtischen <strong>Abendgymnasium</strong>s e. V.<br />
„Normale“ Schulen haben ihren Elternbeirat, der als Sponsor einspringt, wenn die Schule<br />
oder einzelne Schüler dringend Hilfe brauchen, und die Schulgemeinschaft unterstützt. Das<br />
AG hat seinen Freundeskreis aus Studierenden und Ehemaligen, Angestellten und Lehrkräften.<br />
Auch im vergangenen Schuljahr hat der Verein wieder in bewährter Manier das Leben<br />
um den Schulalltag herum bereichert.<br />
Das nun schon etablierte Seminar „Lernen lernen“ konnte diesmal erweitert werden um eine<br />
Veranstaltung, die dazu verhelfen sollte, den Durchhänger zu bewältigen, der viele Studierende<br />
auf halber Strecke ereilt. Ein erheblicher Teil der Kosten wurde durch den Verein getragen.<br />
126
Freundlicherweise hat uns ein Ehemaliger darauf aufmerksam gemacht, dass die Hans<br />
Böckler Stiftung Stipendien <strong>für</strong> den Zweiten Bildungsweg ausgibt. Weitere Informationen<br />
sind unter http://www.boeckler.de zu finden.<br />
Das Abitur muss nicht das Endziel bleiben. Auch <strong>für</strong> die Absolventen des <strong>Abendgymnasium</strong>s<br />
gibt es „Wege ins Studium“, wie von Renate Heese in einem Vortrag aufgezeigt<br />
wurde.<br />
Im Rahmen der Vortragsreihe durften wir auch Herrn Michael Skasa zu „Samuel Beckett“,<br />
Frau Annette Bechteler zum Thema „Regenwald“ und Herrn Dr. Peter Bammes zu einer<br />
„Reise in die Tiefen des Universums“ begrüßen.<br />
Darüber hinaus hat uns Herr Staatsintendant Dr. Klaus Schultz in der Schulveranstaltung<br />
„Wege in die Oper“ mit der Geschichte dieses Metiers vertraut gemacht. Interessenten hatten<br />
Gelegenheit zu günstigen Eintrittspreisen den „Barbier von Sevilla“ im Gärtnerplatztheater<br />
anzusehen.<br />
Daneben wurden auch Schulfahrten und der Kindergarten wieder finanziell bezuschusst.<br />
Dessen Betreuung ging in diesem Jahr von Frau Völkl an Herrn Sinhart über.<br />
Für ihr unermüdliches Engagement nicht nur in Sachen Kindergarten kann der Freundeskreis<br />
Frau Völkl nicht genug danken. Ein kleines Zeichen der Anerkennung war die Verleihung<br />
der Ehrenmitgliedschaft.<br />
Zu einem Besuch auf unserer Internet-Seite (www.abendgymnasium.info), die wieder unser<br />
Ex-Schüler Nikolaos Hondrogiannis gewartet hat, möchte ich gerne einladen. Hier finden<br />
sich z. B. Hinweise auf die anstehenden Veranstaltungen und Vorträge. Man gelangt dort<br />
auch zu der Plattform, die eingerichtet wurde, damit ehemalige Schüler verschiedenster<br />
Jahrgänge Kontakt pflegen und sich austauschen können.<br />
Zur Mitgliedschaft im Freundeskreis lade ich ebenfalls ein. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf<br />
25 Euro.<br />
Wir hoffen aber auch tatkräftige Unterstützung, z. B. in Sachen Betreuung unserer Homepage.<br />
Als Ansprechpartner des Vereins stehen in der Schule Herr Sinhart (2. Vorsitzender) und<br />
Frau von Schlichting-Schönhammer (Kassenwartin) zur Verfügung. Zum Vorstand gehören<br />
außerdem unsere Geschäftsführerin Frau Völkl (ehemalige Lehrkraft) und unser Schriftführer<br />
Herr Polzer (Abiturient 2004).<br />
Waltraud Lederer<br />
127