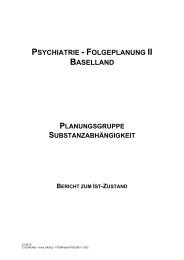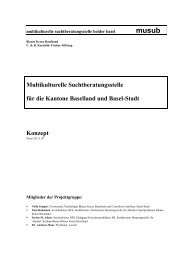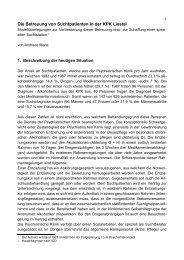Tagungsbericht «Spezialfach für unlösbare Fälle - Praxis T-15
Tagungsbericht «Spezialfach für unlösbare Fälle - Praxis T-15
Tagungsbericht «Spezialfach für unlösbare Fälle - Praxis T-15
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rückblick Verabschiedung Dr. Cahn<br />
Spezialfach<br />
für unlösbare Fälle<br />
«Was ist der Mensch?» lautete der Titel der Tagung am <strong>15</strong>. November 2007 zur Pensionierung von Theodor Cahn,<br />
der während 29 Jahre Chefarzt der Kantonalen Psychiatrischen Klinik (KPK) war. Das Spektrum der Tagung reichte vom<br />
sehr Persönlichen in der «zeitgeschichtlichen Erfahrung» über das philosophische Ergründen, das psychoanalytische<br />
Nachfragen bis hin zu den ökonomischen Aspekten in der Psychiatrie. Das war wohl von den Organisatoren so gewollt<br />
und entspricht sicher dem Denken von Theodor Cahn.<br />
Sein Referat «Psychiatrie und ihre Grenzen als meine zeitgeschichtliche<br />
Erfahrung» beginnt Cahn mit einer Fallvignette:<br />
«Ein psychotischer, älterer Patient soll ins Altersheim.<br />
Dieser Patient sträubt sich heftig in einer vernünftigen Argumenten<br />
unzugänglichen, wahnhaften Art. Dann bittet<br />
er um ein Gespräch mit dem Chefarzt. Ich gehe darauf<br />
ein, es gelingt jedoch auch mir nicht, in ein vernünftiges<br />
Gespräch mit dem Patienten zu kommen. Wissen Sie die<br />
Lösung?» Cahn fragt uns nach der Lösung. Schon sind wir<br />
als Zuhörer mittendrin in diesem Raum der Psychiatrie, in<br />
dem wir Lösungen suchen müssen, obwohl wir wissen,<br />
dass es oft keine gibt, und eben gerade darin der Patient<br />
als Subjekt begründet ist. Dass er selbst keine Lösung findet,<br />
hat ihn ja gerade zu uns gebracht, nicht weil wir die<br />
Lösung hätten, das erwartet höchstens die Aussenwelt und<br />
diese auch oft nur im Sinne von das Störende beseitigen.<br />
Nein, doch eher, weil wir dem Patienten genau in diesem<br />
Unklaren, Unsicheren, noch nicht Beantworteten zu begegnen<br />
bereit sind.<br />
Noch vorher schildert uns in seiner Begrüssung Dr. Emanuel<br />
Isler, Chefarzt KJPD, diesen Theodor Cahn als einen<br />
redlichen Intellektuellen (siehe auch Seite 11). Dr. Charles<br />
Battegay, stellvertretender Chefarzt, beschreibt den von<br />
Cahn gestalteten Raum der KPK als geprägt von Angstfreiheit,<br />
Respekt und Diskussionskultur, von Delegation der<br />
Macht und Verantwortung an die Peripherie. Er fordert<br />
die Mitarbeiter der Klinik für die Zukunft auf: «Seid unbequem,<br />
seid kritisch, seid loyal!»<br />
Von Cahn selbst hören wir, wie der Umbruch der 68er Jahre<br />
ihn mitprägte. Zusammen mit anderen suchte Cahn nach<br />
Möglichkeiten, die Kritik auch in ein Handeln umzusetzen.<br />
Sie besuchten Franco Basaglias Klinik in Gorizia. Cahn war<br />
beeindruckt von der Atmosphäre in Basaglias Klinik, welche<br />
vor allem vom Pflegepersonal in aktiver Weise gestaltet<br />
wurde. Eine Erfahrung, welche später unübersehbar die<br />
Reformanstrengungen in der KPK prägte. Aber noch vorher<br />
kamen die ersten Umsetzungserfahrungen in der Psychiatrischen<br />
Universitätsklinik in Basel, die noch unsicher<br />
tastend, vielleicht auch naiv in ein Scheitern mündeten.<br />
Dieses Scheitern aber führte bei Cahn nicht zur Abwendung<br />
von diesen Zielen, auch nicht von der Psychoanalyse,<br />
sondern eben zur Analyse der Ursachen dieses Scheiterns.<br />
Cahn folgerte: «1. Wir hatten zuwenig Kontakt zu der Basis,<br />
den einfachen Mitarbeitern. 2. Unsere Machtbasis war<br />
ungenügend. 3. In der Ausgrenzung, der Sondersituation<br />
als Freiraum liegt eine grosse Gefahr.» Cahn ging in die freie<br />
<strong>Praxis</strong>, blieb aber seinem Anspruch treu, Sozialpsychiatrie<br />
mit der Psychotherapie zu verbinden.<br />
An diesem Punkt, wo alles hätte anders weitergehen können,<br />
wenn nicht die politische Konstellation Cahn zur Bewerbung<br />
für die Stelle des Chefarztes der KPK verführt hätte,<br />
ein kleiner Exkurs in das Referat von Prof. Emil Angehrn<br />
mit dem Titel «Von der Fragwürdigkeit des Menschen».<br />
Er sieht die Frage nach dem «Was ist der Mensch?» als die<br />
zusammenfassende der vorangehenden drei Fragen Kants<br />
nach dem «Was kann ich wissen?», «Was darf ich hoffen?»<br />
13
Rückblick Verabschiedung Dr. Cahn<br />
und «Was soll ich tun?». Emil Angehrn versucht nun nicht,<br />
diese Fragen zu beantworten, sieht eher das fragwürdige<br />
dieses Unterfangens. Er kommt zum Schluss, der Mensch<br />
ist das Wesen, welches die Frage nach sich selbst stellt, sich<br />
mit sich selbst darüber verständigt.<br />
Als ein gelegentlich in der Philosophie Wildernder liess sich<br />
Cahn verführen, zum Glück. In dieser Pioniersituation gab<br />
es viel zu fragen, zu hoffen und zu tun. Es gab aber auch<br />
Gegenströmungen: die Restauration der konventionellen<br />
Psychiatrie zusammen mit einer operationalisierten, kriterienbasierten<br />
Diagnostik, unter Auslassung des subjektiven<br />
Erlebens, und schliesslich der machtvolle Einzug betriebswissenschaftlichen<br />
Denkens.<br />
Dem Ökonomischen geht Dr. Gerhard Ebner, Direktor der<br />
UPK Basel, nach. Er sieht uns in Zukunft eher noch mehr<br />
mit Zwängen konfrontiert, nicht mehr das Mögliche zu tun,<br />
sondern nur noch das Optimale und schlägt evidenzbasierte<br />
Prozessabläufe als Mittel der klinischen Arbeit vor.<br />
Demgegenüber sieht Dr. Hanspeter Wengle, Chefarzt der<br />
Psychiatrischen Klinik Wil, in den definierten Prozessabläufen<br />
die therapeutische Freiheit in Gefahr. Dr. Markus<br />
Huber, freipraktizierender Psychiater, plädiert für das Nicht-<br />
Wissenschaftliche, das Nicht-Wissen neben dem medizinischen<br />
Wissen.<br />
Theo Cahn waren ökonomische Überlegungen auch nicht<br />
fremd. Die Frage für ihn war wohl aber nicht, ob ökonomisches<br />
Denken und psychiatrische Versorgung sich unüberwindbar<br />
gegenüberstehen, sondern welche psychiatrische<br />
Versorgung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen<br />
realisiert werden kann und soll. Aus dem Vollen konnte da<br />
nie geschöpft werden. Jedoch zeigt seine Arbeit in Liestal,<br />
dass gerade die Entwicklungen, wie Wengle sie aufzählt,<br />
eben nicht mit einem Beziehungs- und Identitätsverlust verbunden<br />
sein müssen, sondern in einer Kultur der Gemeinschaftlichkeit<br />
zur Qualität der Beziehungen und zu einer<br />
sicheren Identität beitragen können.<br />
Dem Negativen, dem Loch, dem Nichtgewussten nähert<br />
sich Dr. med. Raymond Borens, Psychoanalytiker in Basel<br />
mit der Frage: «Wer weiss eigentlich, der Patient oder der<br />
Psychiater?». Für Borens stellte Sigmund Freud nicht sein<br />
Wissen oder das der Medizin ins Zentrum, sondern richtete<br />
Fragen an den Patienten. Nicht dass der Patient wüsste,<br />
was ihm fehlt, das ist nicht gemeint, das Leiden liege im<br />
Nicht-Gewussten, in diesem Loch, das Freud das Unbewusste<br />
nannte.<br />
In den politisch ungemein wichtigen Folgeplanungen zum<br />
Psychiatriekonzept I und II ging es darum, die Fragen der Gegenwart<br />
zu klären, das Wissen zu vervollständigen und auch<br />
das Nicht-Wissen zu sichten, sowie Rahmenbedingungen für<br />
die handelnden Antworten der Zukunft abzustecken.<br />
Eine Zukunft, welche nun ohne die Anleitung und sachte<br />
Führung durch Theodor Cahn stattfinden wird. Das stimmt<br />
traurig, macht auch Angst. Uns wird fehlen – wie Wengle<br />
es treffend sagt –, dass Cahn lange nichts sagt, immer noch<br />
nichts sagt, bevor er dann etwas Glasklares, oft auch Humorvolles<br />
äussert. Dieses Nichts-Sagen als Raum des Denkens,<br />
des sich selbst Befragens, gab uns selbst ja auch Raum zu<br />
denken.<br />
Übrigens, Cahns Auflösung des therapeutischen Rätsels am<br />
Schluss seines Referats ist so einfach, wie herausfordernd:<br />
«Es gab keine Lösung für das therapeutische Problem mit<br />
dem psychotischen Patienten!» Das ist zu akzeptieren. Für<br />
Cahn ist die Psychiatrie eben das Spezialfach für unlösbare<br />
Probleme. Der Patient überraschte dann aber alle nach dem<br />
Gespräch mit seiner Eröffnung: «Ich werde ins Altersheim<br />
gehen und ich werde mich anständig benehmen!» Dass<br />
Theodor Cahn sich anständig benehmen wird, wissen wir,<br />
wir kennen nichts anderes von ihm. Wir hoffen aber, dass<br />
er uns in Zukunft als Berater und Experte auch im «Altersheim»<br />
noch etwas erhalten bleiben wird. ■<br />
Dr. Urs Argast, Psychiater Liestal<br />
Offizielle Feier zur Verabschiedung von Dr. med. Theodor Cahn,<br />
Chefarzt der Kantonalen Psychiatrischen Klinik,<br />
am 29. November 2007 im Schloss Ebenrain in Sissach.<br />
14<br />
Auf dem Bild sind zu sehen (von links nach rechts):<br />
Regierungsrat Peter Zwick, Vorsteher der Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion,<br />
Dr. med. Theodor Cahn, scheidender Chefarzt KPK, seine<br />
Ehefrau Annette Cahn, Rita Bachmann, Landrätin und ehemalige Präsidentin<br />
der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommis sion, sowie Hans-<br />
Peter Ulmann, Direktor.