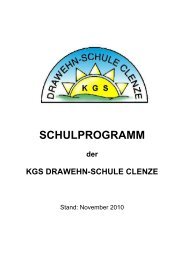0. Schulprofil - Drawehn-Schule Clenze
0. Schulprofil - Drawehn-Schule Clenze
0. Schulprofil - Drawehn-Schule Clenze
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SCHULPROGRAMM<br />
der<br />
KGS DRAWEHN-SCHULE CLENZE<br />
Stand: Dezember 2009
<strong>0.</strong> <strong>Schulprofil</strong><br />
I. Leitbild<br />
Inhalt<br />
II. Organisation von Lernprozessen<br />
1. Stundentafel<br />
2. Rahmenrichtlinien und Stoffverteilungspläne<br />
3. Grundsätze der Leistungsbeurteilung<br />
4. Eingangsphase<br />
5. Schulformübergreifender Unterricht<br />
6. Epochaler Unterricht<br />
7. Schullaufbahn-Beratung<br />
8. Fremdsprachenberatung<br />
9. Abschlüsse<br />
1<strong>0.</strong>Schulordnung und Schulvertrag<br />
III. Erwerb von Schlüsselqualifikationen<br />
1. Schlüsselqualifikationen<br />
2. Offener Unterricht<br />
3. Arbeitstechniken<br />
4. Lernen mit Neuen Medien<br />
5. Förderung und Durchlässigkeit<br />
6. Ganztagsangebot<br />
7. Profilbildung in den Aufgabenfeldern<br />
1. musisch-kulturell<br />
2. gesellschaftswissenschaftlich<br />
3. sprachlich-literarisch<br />
4. mathematisch-naturwissenschaftlich<br />
5. Sport und Bewegung<br />
6. Wirtschaft<br />
7. Religion und Werte und Normen<br />
8. Mobilität<br />
IV. Zusammenarbeit<br />
1. Interne Zusammenarbeit<br />
1. Teams und Tandems<br />
2. Schülervertretung<br />
3. Eltern<br />
4. nicht-unterrichtendes Personal<br />
5. Beratungslehrerin<br />
2. Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern<br />
1. Offene <strong>Schule</strong><br />
2. Soziale Dienste<br />
3. Schulträger<br />
- 2 -
4. Betriebe<br />
5. Arbeitsamt<br />
6. Partnerschulen<br />
7. Öffentlichkeit<br />
V. Organisationsstrukturen<br />
1. Geschäftsverteilung<br />
2. Konferenzen<br />
VI. Unterstützungspotenziale<br />
1. Fortbildungskonzept<br />
2. Schulinterne Lehrerfortbildungen<br />
VII. Evaluation<br />
1. Interne Evaluation<br />
2. Externe Evaluation<br />
3. EFQM<br />
Anlagen<br />
A1 aktuelle Stundentafel<br />
A2 schuleigene Stoffverteilungspläne für alle Fächer<br />
A3 Prozess und fachbezogene Grundsätze der Leistungsbeurteilung<br />
A4 aktuelles Angebot im Wahlpflichtbereich<br />
A5 Schaubild über zu erreichende Abschlüsse<br />
A6 Schulordnung<br />
A7 Schulvertrag<br />
A8 Zusammenstellung und Konkretisierung der Schlüsselqualifikationen<br />
A9 schuleigener Katalog zu erlernender Arbeitstechniken für alle Fächer<br />
A10 aktuelles AG-Angebot<br />
A11 Deeskalationsleitfaden<br />
A12 Geschäftverteilungsplan<br />
A13 Schaubild Konferenzstruktur<br />
A14 Interne Evaluation AG-Angebot<br />
A15 Externe Evaluation Arbeitstechniken<br />
A16 Ergebnisse der Befragung durch die Hochschule Vechta (Kurzfassung)<br />
A17 Maßnahmenkataloge nach EFQM 2003<br />
A18 Wegweiser soziale Dienste im Landkreis<br />
A19 Ergebnisse aus EFQM 2003/04<br />
A20 Ziele und Leitsätze nach den EFQM – Ergebniskriterien 6 bis 9<br />
A21 Maßnahmenkataloge aus EFQM für das Schuljahr 2004/05<br />
- 3 -
A22 Brandschutzordnung Stand Oktober 2004<br />
A23 Geschäftsordnung des <strong>Schule</strong>lternrates für 2004 – 2006<br />
A24 Umfrage 2006<br />
A25 Projekte an der DSC<br />
A26 Kriterienkatalog Kopfnoten<br />
A27 Integrationskonzept (Gesamtkonferenz Juni 2006)<br />
A28 Umfrageergebnisse Schnuppertage an der BBS 2007<br />
A29 Suchtpräventionskonzept (Gesamtkonferenz Juli 2007)<br />
A30 Umfrage und Fazit 2008 (Vorstellung auf der Gesamtkonferenz Oktober 2008)<br />
A31 Beratungskonzept 2009<br />
Die als „A“ gekennzeichneten Anlagen des Schulprogramms liegen in der <strong>Schule</strong> als<br />
Kopierexemplar vor. Sie sind nicht Bestandteil dieser Veröffentlichung<br />
- 4 -
<strong>0.</strong> <strong>Schulprofil</strong><br />
Name der <strong>Schule</strong>: KGS <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> <strong>Clenze</strong><br />
Anschrift: Uelzener Straße 10<br />
29459 <strong>Clenze</strong><br />
Telefon: (0049) 05844/98810<br />
Telefax: (0049) 05844/988120<br />
e-mail: verwaltung@drawehn-schule.de<br />
Homepage: www.drawehn-schule.de<br />
Anzahl der Schüler: 770 ( Stand 01.11.2009 )<br />
Anzahl der Lehrkräfte: 61<br />
<strong>Schule</strong>: Kooperative Gesamtschule<br />
Schulstufen: Sekundarstufe I (alle drei Schulzweige)<br />
Fremdsprachen: Englisch ab Klasse 5<br />
Französisch ab Klasse 6 im Realschul- und<br />
Gymnasialzweig<br />
Latein ab Klasse 6 im Gymnasialzweig<br />
Besonderheiten: Höherwertiger Unterricht ab Klasse 6<br />
Schulzweigübergreifender Unterricht ab Klasse 5 in den<br />
Fächern Musik, Kunst, Sport, Textiles Gestalten, Werken<br />
Ganztagsschule seit dem 01.08.2007<br />
Arbeitsgemeinschaften: wechselnde Angebote (Theater, Handball, Kunst,<br />
Schulband u.a.)<br />
Anerkannt als: COMENIUS-Projekt-<strong>Schule</strong><br />
<strong>Schule</strong> ohne Rassismus<br />
Pilotschule Schulprogrammentwicklung und externe<br />
Evaluation, QuiSS Teil B + C<br />
Umweltschule in Europa<br />
- 5 -
I. Leitbild<br />
Gelebte Demokratie und Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld sind<br />
die Ziele für die Arbeit der Schulgemeinschaft der KGS <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>.<br />
So wird sie den Schülerinnen und Schülern, die heute in einem sich ständig<br />
verändernden sozialen Umfeld leben, gerecht. Die Identifikation mit dem Ganzen<br />
fördert die Verantwortung für die Gemeinschaft. Es ist notwendig, die Folgen des<br />
Zerfalls traditioneller Bindungen und der zunehmend passiven Wahrnehmung in<br />
einer medienorientierten Umwelt aufzufangen und zu verarbeiten. Die Methodik<br />
eines handlungsorientierten Unterrichts ist daher anzustreben.<br />
Ebenso müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Zugriffsmöglichkeiten auf<br />
neue Informationsquellen und Technologien vertraut machen. Pädagogische Leitlinie<br />
muss daher sein, gleichzeitig die sich neu eröffnenden Chancen zu vermitteln und<br />
die damit verbundenen Gefahren zu verdeutlichen.<br />
Auf der Basis kognitiver Lerninhalte gilt es in unserer äußerst schnelllebigen Zeit, in<br />
der die Gültigkeitsdauer von gespeichertem Wissen stetig verkürzt wird, vermehrt<br />
Schlüsselqualifikationen<br />
zu erwerben im Bereich der Methoden-, Handlungs- und Sozialkompetenz.<br />
Dabei ist<br />
das Miteinander Lernen<br />
Schwerpunkt der Arbeit unserer Gesamtschule. Es verstärkt die gegenseitige<br />
Achtung und Anerkennung sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl.<br />
Das Einbringen der jeweiligen spezifischen Fähigkeiten des Einzelnen in eine<br />
Gruppe und der erfolgreiche gemeinsame Unterricht sind eine wichtige<br />
Grunderfahrung.<br />
Es ist durchaus kein Widerspruch, dass auch und gerade<br />
Individuelles Lernen<br />
jedem Kind die Möglichkeit eröffnen muss, erfolgreich zu lernen, in seinem<br />
Selbstwertgefühl bestärkt zu werden und letztlich Freude am Lernen zu erleben.<br />
Solche Entwicklungen der Kinder müssen auch nach erfolgter Wahl der Schulform<br />
Veränderungen ihrer Schullaufbahn zulassen. Dieses wird durch höherwertigen<br />
Unterricht und Durchlässigkeit zwischen den Schulzweigen ermöglicht.<br />
Die traditionell engen sozialen Bindungen der Schülerinnen und Schüler<br />
untereinander können so trotz unterschiedlicher Schullaufbahnen erhalten bleiben.<br />
- 6 -
Dies alles soll münden in der positiven Gestaltung eines vielfältigen<br />
gemeinsamen Schullebens<br />
in dem sich alle Beteiligten wohl fühlen können.<br />
Verstärkte<br />
Öffnung der <strong>Schule</strong><br />
mit vermehrter Einbeziehung der Bewohner unseres Lebensraumes ist deshalb Ziel<br />
unserer schulischen Arbeit und sollte eine Isolierung unserer Institution noch stärker<br />
als bisher überwinden helfen.<br />
- 7 -
1. Stundentafel<br />
II. Organisation von Lernprozessen<br />
Die Stundentafel legt die zu unterrichtenden Fächer in ihrem Umfang für die<br />
verschiedenen Jahrgänge und Schulzweige fest.<br />
Der Unterricht der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> <strong>Clenze</strong> richtet sich nach den Stundentafeln der<br />
einzelnen Schulformen. Abweichungen sind von der zuständigen Behörde genehmigt<br />
worden.<br />
Anlage A1: Stundentafel KGS<br />
2. Rahmenrichtlinien – schuleigene Stoffverteilungspläne<br />
Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an den aktuellen Curricularen Vorgaben, den<br />
Bildungsstandards und den Rahmenrichtlinien / Kerncurricula des<br />
Kultusministeriums. Sie sind für das jeweilige Fach und den jeweiligen Schulzweig<br />
vorgegeben. Damit stellt die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> die Vergleichbarkeit der<br />
Unterrichtsinhalte mit anderen <strong>Schule</strong>n sicher.<br />
Auf der Grundlage der Richtlinien sind darüber hinaus für jedes Unterrichtsfach und<br />
jede Klassenstufe schuleigene Stoffverteilungspläne erarbeitet worden. Während die<br />
Richtlinien einen weiten Rahmen der Unterrichtsinhalte vorgeben, ermöglicht der<br />
Unterricht nach unseren eigenen Stoffverteilungsplänen den problemlosen Übergang<br />
zwischen den Schulzweigen, erleichtert den Lehrerwechsel und sichert Standards.<br />
Die Stoffverteilungspläne werden regelmäßig von den Fachkonferenzen überarbeitet<br />
und an die jeweils aktuellen Richtlinien angeglichen.<br />
Anlage A2: Stoffverteilungspläne<br />
3. Fächerübergreifende Grundsätze der Leistungsbeurteilung<br />
Die Bewertungskriterien (u.a. die prozentuale Gewichtung der erbrachten Leistungsbereiche)<br />
werden von den Fachkonferenzen auf der Grundlage der gültigen<br />
rechtlichen Vorgaben beschlossen. Dabei sind die Schlüsselqualifikationen zu<br />
berücksichtigen.<br />
Die Bewertungskriterien werden den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld des<br />
Unterrichts transparent gemacht.<br />
Fächerübergreifende Projekte werden von den beteiligten Kolleginnen und Kollegen<br />
nach jeweiliger Absprache gemeinsam beurteilt.<br />
In einigen Fachbereichen befinden sich die Grundsätze zur Leistungsbeurteilung in<br />
Überarbeitung.<br />
Anlage A3: Fachspezifische Grundsätze zur Leistungsbeurteilung<br />
- 8 -
4. Eingangsphase<br />
Neu eingeschulte und neu zusammen gesetzte Klassen beginnen das Schuljahr mit<br />
der Eingangsphase.<br />
Je nach Absprache erhalten die Klassenlehrer-Tandems die Möglichkeit für ein bis<br />
zwei Wochen möglichst viele Stunden in den neuen Klassen zu unterrichten und so<br />
die Grundlage für eine stabile Klassengemeinschaft und erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
zu legen. Während dieser Zeit können Schülerinnen und Schüler sich in der<br />
neuen <strong>Schule</strong> eingewöhnen und einander kennen lernen.<br />
Insbesondere in den neuen fünften Klassen wird die Eingangsphase nach dem<br />
Methodenkonzept von Enger gestaltet. Dieses Konzept ist im Schuljahr 2007/2008<br />
neu eingeführt worden und wird nach und nach auf unsere <strong>Schule</strong> angepasst.<br />
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten mit Beginn des neuen Schuljahres das „rote<br />
Buch“.Hier kann man alles finden, was für sie und ihre Eltern wichtige und<br />
interessant ist. Außerdem lässt sich das „rote Buch“ ausgezeichnet zur Organisation<br />
und Strukturierung des Schulalltages verwenden.<br />
5. Schulformübergreifender Unterricht<br />
Schulformübergreifender Unterricht umfasst einen Teil des Stundenangebots für alle<br />
Schülerinnen und Schüler und soll – neben der Vermittlung fachlicher Inhalte – ganz<br />
besonders dazu dienen, soziale Kompetenzen zu stärken und das Selbstverständnis<br />
der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> als einer Einheit zu festigen. Im einzelnen handelt es sich um<br />
folgende Bereiche:<br />
Pflichtbereich<br />
• Sportunterricht in Klasse 5 und 6 koedukativ; ab Kl.7 geschlechtsgetrennt in<br />
Doppelstunden<br />
Wahlpflichtbereich I/Musisch-Kulturelle Bildung<br />
Jahrgang 5<br />
• Belegung der Fächer Kunst, Musik, Textiles Gestalten und Werken für jeweils<br />
ein Halbjahr<br />
Jahrgang 6<br />
• Belegung zweier Kurse aus den og. Fächern<br />
• Wahl nach Neigung<br />
• Wahl für ein Jahr<br />
Jahrgang 7<br />
• Schüler des Haupt- und Realschulzweiges wählen einen Kurs aus den<br />
folgenden Fächern: Ku, Mu, TG, GW<br />
• Wahl nach Neigung<br />
• Teilnahme für ein Schuljahr<br />
• Schüler des Gymnasialzweiges wählen nur zwischen den Fächern Ku und<br />
Mu,die Wahl ist verbindlich für die nächsten vier Schuljahre<br />
Jahrgang 8<br />
• Schüler des Haupt- und Realschulzweiges wählen einen Kurs aus den<br />
folgenden Fächern: Ku, Mu, TG, GW<br />
- 9 -
• Wahl nach Neigung<br />
• Teilnahme für ein Schuljahr<br />
Jahrgang 9 + 10<br />
• Schüler des Haupt- und Realschulzweiges wählen einen Kurs aus den<br />
folgenden Fächern: Ku, Mu, TG, GW für die nächsten zwei Schuljahre<br />
• Wahl nach Neigung<br />
• Schüler des Gymnasialzweiges erhalten zusätzlich (siehe Jahrgang 7) zwei<br />
Wochenstunden Unterricht in dem jeweils nicht gewählten Fach (Ku oder Mu)<br />
Wahlpflichtbereich II für den HS und RS-Zweig<br />
Jahrgang 6<br />
• Zwei Kurse , die zum Erwerb vertiefter Kenntnisse in einem Fachbereich<br />
beitragen<br />
• schulformspezifisch<br />
• Wahl für ein Jahr<br />
• umfasst den Französisch-Unterricht im RS-Zweig<br />
Jahrgang 7, 8<br />
• Zwei Kurse , die zum Erwerb vertiefter Kenntnisse in einem Fachbereich<br />
beitragen<br />
• schulformübergreifend<br />
• Wahl für ein Jahr<br />
• umfasst den Französisch-Unterricht im RS-Zweig<br />
Jahrgänge 9/10<br />
• Zwei Kurse, die zum Erwerb vertiefter Kenntnisse in einem Fachbereich<br />
beitragen<br />
• Schulform- und jahrgangsübergreifend<br />
• Wahl für ein Jahr<br />
• umfasst den Französisch-Unterricht im RS-Zweig<br />
Anlage A4: Aktuelles Wahlpflichtangebot<br />
6. Epochaler Unterricht<br />
Als KGS hat die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> die Möglichkeit, Unterrichtsfächer, die dem<br />
gleichen Fachbereich angehören, epochal zu erteilen. Die Länge der jeweiligen<br />
Unterrichtsepoche hängt vom Stundenanteil des zu erteilenden Faches in der<br />
Stundentafel ab. Epochaler Unterricht ermöglicht intensive unterrichtliche Arbeit über<br />
einen bestimmten Zeitraum hinweg.<br />
Epochaler Unterricht kann grundsätzlich in allen Fächern organisiert werden.<br />
- 10 -
7. Schullaufbahn-Beratung<br />
Die Schullaufbahnberatung ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit<br />
der Gesamtschule und findet überall dort statt, wo Schülerinnen und Schüler Hilfe<br />
brauchen bei der Wahl von Bildungswegen, Fächern und Kursen.<br />
Ansprechpartnerinnen und –partner sind grundsätzlich alle Lehrkräfte, insbesondere<br />
die Klassenlehrerinnen und –lehrer, so wie die Beratungnslehrerin. In besonderen<br />
Fällen kann der Rat von Fachbereichsleiterinnen und –leitern und Mitgliedern der<br />
Schulleitung eingeholt werden.<br />
Erklärtes Ziel ist es, heraus zu finden, warum Wunsch und Empfehlung auseinander<br />
gehen und entsprechende Konsequenzen aufzuzeigen, um besonders in eklatanten<br />
Fällen einen schulischen Misserfolg möglicherweise rechtzeitig zu verhindern, aber<br />
auch, um leistungsstarke Schülerinnen und Schüler angemessen zu fördern.<br />
Im Laufe des 1<strong>0.</strong> Schuljahres finden eingehende Beratungen über die weitere<br />
Schullaufbahn für unsere Schülerinnen und Schüler statt. Im Rahmen des Unterrichts<br />
beraten Klassen- und Wirtschaftlehrerinnnen und –lehrer über mögliche<br />
Ausbildungswege. Die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit besucht unsere<br />
Abschlussklassen regelmäßig. Außerdem informieren weiterführende <strong>Schule</strong>n hier<br />
im Hause auf Veranstaltungen über ihre Anforderungen und ihr Angebot.<br />
Das Ziel dieser vielfältigen Beratungsmöglichkeiten ist es, den Schülerinnen und<br />
Schülern der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten die<br />
bestmögliche Fortsetzung ihrer Ausbildung zu ermöglichen.<br />
8. Fremdsprachen-Beratung<br />
Im Realschul- sowie im Gymnasialzweig stellt sich Lernenden und Eltern die Frage<br />
nach der Wahl einer zweiten Fremdsprache. Im Realschulzweig kann neben der für<br />
alle verbindlichen Fremdsprache Englisch eine zweite Fremdsprache gewählt<br />
werden: Französisch wird hier ab der Klasse 6 als vierstündiger Wahlpflichtkurs<br />
angeboten. Das Beherrschen einer zweiten Fremdsprache ist Voraussetzung für<br />
einen eventuellen Wechsel in den Gymnasialzweig.<br />
Für die Gymnasiasten ist ab der sechsten Klasse die Wahl einer zweiten<br />
Fremdsprache Pflicht: Latein oder Französisch stehen zur Wahl. Welche der beiden<br />
Sprachen mehr zum eigenen Lernerprofil passt, ist oft eine schwierige Entscheidung.<br />
Der Fachbereich Sprachen unterstützt Eltern und Lernende bei der<br />
Entscheidungsfindung:<br />
- An einem Informationsabend vorwiegend für Eltern stellen Vertreter aller<br />
Fremdsprachen ihren Sprachlehrgang vor. Sie stehen neben allgemeinen<br />
Entscheidungshilfen auch zu persönlichen, individuellen Gesprächen bereit.<br />
- Am Ende der fünften Klasse werden den Lernenden „Schnupper-“ und<br />
Informationsstunden angeboten, die auf ihre Belange zugeschnitten sind und sie bei<br />
der Fremdsprachenwahl begleiten.<br />
Eltern und Lernende können so bei ihrer Entscheidung auf ein breit angelegtes<br />
Stützungsangebot der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> zurückgreifen und eventuelle<br />
Fehlentscheidungen verhindern.<br />
- 11 -
9. Abschlüsse<br />
Folgende Abschlüsse können die Schülerinnen und Schüler der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong><br />
erreichen:<br />
• Hauptschulabschluss nach Klasse 9<br />
• Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss (nach Klasse 10)<br />
• Sekundarabschluss I - Realschulabschluss<br />
• Erweiterter Sekundarabschluss I (berechtigt zum Eintritt in die gymnasiale<br />
Oberstufe)<br />
Anhang A5: Schaubild über zu erwerbende Abschlüsse<br />
1<strong>0.</strong> Schulordnung und Schulvertrag<br />
Die Schulordnung der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> richtet sich an die gesamte<br />
Schulgemeinschaft und wird allen ausgehändigt. SchülerInnen, LehrerInnen und<br />
Eltern unterschreiben einen Schulvertrag, in dem sie diese Schulordnung<br />
anerkennen. Diese Schulordnung und der Schulvertrag sind in unserem „roten Buch“<br />
abgedruckt.<br />
Änderungen der Schulordnung sind nur auf Beschluss der Gesamtkonferenz<br />
möglich.<br />
Ziel der gemeinsamen Verpflichtung zur Einhaltung des Schulvertrages ist es, die<br />
Schulgemeinschaft zu stärken und eine geordnete und angstfreie Schulatmosphäre<br />
zu gewährleisten,<br />
Anlage A6: Schulordnung<br />
Anlage A7: Schulvertrag<br />
- 12 -
III. Erwerb von Schlüsselqualifikationen<br />
1. Schlüsselqualifikationen<br />
Offener Unterricht erleichtert den Zugang zu Schlüsselqualifikationen.<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> schafft die notwendigen Voraussetzungen um<br />
Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, insbesondere in den Bereichen<br />
Können<br />
Handeln<br />
Reflektieren<br />
Wissen<br />
Wollen.<br />
Fachspezifische Besonderheiten werden durch die Fachbereichskonferenzen<br />
diskutiert und abgesprochen, sowie in die schuleigenen Stoffverteilungspläne (II.2)<br />
und das Programm zum Erlernen von Arbeitstechniken (III.3) eingearbeitet.<br />
Verschiebungen, die aufgrund der lern- und gruppenspezifischen Bedingungen<br />
erforderlich sind, werden im Tandem bzw. mit den betroffenen Fachlehrkräften<br />
abgesprochen.<br />
Anhang A8: Ausführungen und Konkretisierungen Schlüsselqualifikationen<br />
2. Offener Unterricht<br />
Zu den bewährten Unterrichtsformen treten vermehrt offene, d. h. solche, die einen<br />
besseren Zugang zu den oben genannten Schlüsselqualifikationen ermöglichen<br />
sollen.<br />
Das Ziel muss sein, die Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem und<br />
verantwortlichem Arbeiten zu führen und ihre Interessen und Fähigkeiten zu<br />
entwickeln und zu fördern.<br />
Dabei ist entdeckendes, handlungsorientiertes Lernen in den Vordergrund zu rücken<br />
und individuelles Fortschreiten zu ermöglichen. Als Arbeitsformen bieten sich an:<br />
Wochen-/Themenplan, Freiarbeit u. ä.<br />
Einen besonderen Stellenwert besitzt die Arbeit in Projekten. Sie sind in der Regel<br />
fächerübergreifend angelegt und themengebunden. Sie finden mindestens zweimal<br />
pro Jahr statt, wobei die Themen von Fachkonferenzen im Stoffverteilungsplan (II.1)<br />
ausgewiesen und vom Team (IV.1.1) vorbereitet werden.<br />
Projekte, die nur einige Stunden umfassen, Projekttage und –wochen zu<br />
verschiedenen Themen finden regelmäßig statt. Inzwischen liegt eine umfangreiche<br />
Liste für alle Klassenstufen vor, die die Projekte umfasst, die an unserer <strong>Schule</strong><br />
durchgeführt werden.<br />
Anhang A25: Projekte an der DSC<br />
Die unterschiedlichen Ausprägungen des offenen Unterrichts bewirken einen hohen<br />
Grad der Individualisierung des Lernens für die Schülerinnen und Schüler der KGS.<br />
Deshalb ist es nur natürlich, ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der<br />
- 13 -
Klassenräume zu richten. Selbst gestaltet, mit eigenen Unterrichtsmaterialien<br />
ausgestattet, ermöglichen sie eine hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler<br />
und eine Vielfalt des modernen Unterrichts.<br />
3. Arbeitstechniken<br />
Arbeitstechniken sind Techniken, die der Auswahl, dem Erwerb, der Verarbeitung<br />
und dem Weitergeben von Wissensstoff dienen. Sie dienen der Entwicklung der<br />
Fähigkeit, die zur Bewältigung neuer und unvorhergesehener Situationen<br />
erforderlichen Lernprozesse selbst kompetent organisieren zu können, orientieren<br />
sich also am Ziel des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen.<br />
In der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> ist das Erlernen und Trainieren von Arbeitstechniken fester<br />
Bestandteil des Fachunterrichts und kann im Wahlpflichtangebot für die Realschulund<br />
Hauptschulklassen vertieft werden.<br />
Die Fachkonferenzen haben einen Katalog von Arbeitstechniken für die jeweiligen<br />
Fächer, alle Klassenstufen und Schulzweige entwickelt, die aufeinander aufbauen<br />
und einander ergänzen. Der Arbeitstechniken-Katalog ist auf die Stoffverteilungspläne<br />
abgestimmt und unterliegt einer ständigen Überprüfung durch die Fachkonferenzen.<br />
Im Schuljahr 2001/02 hat sich die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> einer externen Evaluation ihres<br />
Konzepts zum Erwerb von Arbeitstechniken gestellt. Die Ergebnisse der Evaluation<br />
waren Gegenstand einer Dienstbesprechung, eines Auswertungstreffens und<br />
bildeten die Grundlage für das Angebot schulinterner Lehrerfortbildung (SchiLf, VI.2).<br />
Im Schuljahr 2007/2008 hat die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> die Methodentage nach Enger<br />
eingeführt. Sie werden ca einmal im Monat durchgeführt und sind in diesem Jahr bis<br />
zur Klasse 7 hochgelaufen. Die Methodentage sollen dazu dienen, die<br />
Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler weiter zu entwickeln und Zeit und<br />
Raum zum Erwerb von Arbeitstechniken zu geben.<br />
Anlage A9: Arbeitstechniken-Katalog für alle Fächer<br />
4. Lernen mit Neuen Medien<br />
Der Umgang mit neuen Medien ist eine der zu erwerbenden Schlüsselkompetenzen<br />
für unsere Schüler und Schülerinnen und Bestandteil des Arbeitstechniken-Katalogs<br />
(III.3).<br />
Im Laufe der Schuljahre sollen die Schülerinnen und Schüler Sicherheit im<br />
Anwenden von gängigen Textverarbeitungsprogrammen, Tabellenkalkulation, dem<br />
Erstellen von Datenbanken und Homepages sowie in der Internetrecherche<br />
gewinnen, aber auch den verantwortlichen Umgang mit dem Medium Computer<br />
lernen.<br />
Neben dem Informatik-Unterricht stehen integrierte Konzepte des<br />
Kompetenzerwerbs im Vordergrund.<br />
Informatik-Unterricht findet statt in:<br />
• Klasse 5 (achtwöchiger Kompaktkurs mit 2 Wochenstunden)<br />
- 14 -
• Klasse 6 (achtwöchiger Kompaktkurs mit 1 Wochenstunde)<br />
• Klasse 9/10 (Wahlpflichtkurse für RS/HS)<br />
• Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag (Klasse 7/8)<br />
• Klasse 6 (Wahlpflichtkurs für HS/RS)<br />
• Klasse 7 (Wahlpflichtkurs für HS/RS)<br />
• in verschiedenen Unterrichtsprojekten (u. a. Chemie, Politik)<br />
Die Möglichkeiten für den integrierten Informatik-Unterricht wurden durch die<br />
Anschaffung eines Laptops und eines Beamers erweitert. Außerdem kommen<br />
interaktive Whiteboards im Unterricht zum Einsatz. Die Kolleginnen und Kollegen<br />
erhalten regelmäßig bedarfsorientierte Schulungen durch die Informatik-Lehrkräfte<br />
und die Multiplikatoren für Interaktive Whiteboards.<br />
5. Förderung und Durchlässigkeit<br />
Die im Erlass vorgesehene Durchlässigkeit ist bestimmendes Element unserer KGS.<br />
Die Schülerinnen und Schüler haben bei sehr gutem bis gutem Erfolg die<br />
Möglichkeit, die Fächer Mathematik und Englisch im nächsthöheren Schulzweig zu<br />
besuchen. Dazu wird der Stundenplan so gestaltet, dass die Fächer Mathematik und<br />
Englisch in den betreffenden Schulzweigen parallel liegen. Über die Zuweisung in<br />
den höherwertigen Unterricht entscheiden abgebende und aufnehmende<br />
Lehrkräfte aufgrund der Leistungen im Vorjahr. Die Schülerin/der Schüler sowie die<br />
Erziehungsberechtigten werden in den Entscheidungsprozess einbezogen. Die<br />
Teilnahme am höherwertigen Unterricht wird im Zeugnis vermerkt und kann eine<br />
gute Vorbereitung für den Aufstieg in einen höheren Schulzweig sein.<br />
Fester Bestandteil des AG-Angebots ist die Hausaufgabenhilfe. Lehrkräfte<br />
unterstützen Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Fächern und bieten ihnen<br />
so die Chance, ihre Schwächen auszugleichen.<br />
Nach Abschluss des regulären Unterrichts in Klasse 10 besteht die Möglichkeit der<br />
freiwilligen Teilnahme an einem Vorbereitungskurs auf die Sekundarstufe II.<br />
6. Ganztagsangebot<br />
Ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften ist ein<br />
Gütesiegel für die pädagogische Qualität einer Ganztagsschule.<br />
Das Ganztagsangebot der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> mit seinen verschiedenen<br />
Arbeitsgemeinschaften, die den Schülerinnen und Schülern zur Auswahl stehen, soll<br />
bei den Schülern vorhandene Stärken fördern, Interesse für Neues wecken und das<br />
Miteinander der Schulgemeinschaft vertiefen. Aus diesen Gründen wurde das schon<br />
seit vielen Jahren bestehende AG- Angebot noch deutlich erweitert.<br />
Ein wichtiges Merkmal für eine Arbeitsgemeinschaft ist die Freiwilligkeit. Eine AG<br />
besteht aus einer Gruppe von Menschen, die sich freiwillig dafür entschieden hat,<br />
einer ganz bestimmten Tätigkeit über einen längeren Zeitraum gemeinsam<br />
nachzugehen. Wenn die freiwillige Entscheidung für eine Arbeitsgemeinschaft<br />
gefallen ist, soll sie eine gewisse Verbindlichkeit aufweisen, damit sich die Mitglieder<br />
- 15 -
der AG aufeinander verlassen können. Arbeitsgemeinschaften können sich inhaltlich<br />
auf den Unterricht beziehen, müssen es aber nicht.<br />
An der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> spielen Arbeitsgemeinschaften eine wichtige Rolle im<br />
pädagogischen Konzept, weil sie einerseits Ausdruck vielfältiger Lern- und<br />
Erfahrungsmöglichkeiten sind und andererseits eine Form sinnvoller<br />
Freizeitgestaltung darstellen. Die <strong>Drawehn</strong>- <strong>Schule</strong> <strong>Clenze</strong> bemüht uns, ein breites<br />
Feld möglichst unterschiedlicher Arbeitsgemeinschaften anzubieten, um damit<br />
verschiedenen Bedürfnissen und Zielen gerecht zu werden.<br />
Die Merkmale der an der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> angebotenen AGs lassen sich wie folgt<br />
zusammenfassen:<br />
• Die Teilnahme an den AGs ist freiwillig. Eine Anmeldung gilt immer für ein<br />
Schulhalbjahr.<br />
• Alle AGS werden jahrgangsübergreifend angeboten, so dass Jüngere von<br />
Älteren lernen können, aber auch umgekehrt.<br />
• Viele Arbeitsgemeinschaften werden immer wieder angeboten, so dass jeder<br />
über einen langen Zeitraum hinweg seine Fähigkeiten systematisch erweitern<br />
kann.<br />
• Ein breites Spektrum an Themen wird angeboten, so dass viele<br />
Schülerinteressen abgedeckt werden können.<br />
• Es werden viele Fachleute von außerhalb der <strong>Schule</strong> eingebunden, die ihren<br />
Erfahrungsschatz an die Schülerinnen und Schüler weitergeben.<br />
• Die Förderung und Forderung von Schülerinnen und Schülern wird sowohl im<br />
sprachlichen wie auch im mathematisch naturwissenschaftlichen Bereich<br />
intensiv betrieben.<br />
• Die Teilnahme an den AGs wird auf dem Zeugnis bescheinigt.<br />
Ein letzter wichtiger Bestandteil im Komplex Ganztagsangebot ist die Möglichkeit, ein<br />
warmes Mittagessen in der <strong>Schule</strong> zu bekommen. Das ausgewogene Angebot und<br />
der Verwendung von frischen Produkten zu einem angemessenen Preis soll die<br />
Akzeptanz einer warmen Mahlzeit in der <strong>Schule</strong> erhöhen und einen wichtigen Beitrag<br />
zu Gesundheitsförderung bei den Schülern leisten.<br />
Anlage A10: Aktuelles AG-Angebot<br />
- 16 -
7. Schwerpunkte der Fachbereiche<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> bietet neben den herkömmlichen Unterrichtsinhalten eine Reihe<br />
von inhaltlichen Schwerpunkten an, die mit dem Ziel des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen,<br />
korrespondieren.<br />
7.1 Musisch-künstlerisches Aufgabenfeld<br />
In den Jahrgangsstufen 5 - 7 gibt es jeweils eine „Big-Band-Beginners-Gruppe<br />
(BBB). Mit der Einschulung entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für das<br />
Erlernen eines Big-Band-Instruments, das mit Unterstützung des Fördervereins<br />
geleast werden kann. Zusätzlich zum Musikunterricht lernt die BBB in Arbeitsgemeinschaften<br />
und Einzel- bzw. Klein-Gruppenunterricht, so dass bereits nach<br />
einem halben Jahr erste kleine Auftritte möglich sind. Zusätzlich übt am Mittwoch<br />
Nachmittag eine Junior-Big-Band, die Jahrgänge 8 – 10 bilden dann die School- Big-<br />
Band der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>.<br />
In der 1<strong>0.</strong> Jahrgangsstufe nehmen alle Schülerinnen und Schüler an den<br />
„Künstlertagen“ teil. Mehr als zwanzig Künstlerinnen und Künstler aus der Region<br />
öffnen für drei Tage ihre Ateliers und Werkstätten für die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>. In dieser<br />
Zeit erleben die Schülerinnen und Schüler ihren Arbeitsalltag und können auch<br />
selber künstlerisch und kreativ tätig sein.<br />
In der Vorweihnachtszeit findet die Veranstaltung „Kaffee, Kunst und Kuchen“<br />
statt. (Verkaufs-)Ausstellungen und Vorführungen hierfür werden in den Kursen des<br />
MuKuBi-Unterrichts vorbereitet. Zu diesem Anlass wird die <strong>Schule</strong> zu einem<br />
beliebten Treffpunkt für Besucher aus der ganzen Region.<br />
Die Mittwoch-Nachmittag AG- „Theater“ bereitet regelmäßig Aufführungen vor.<br />
Zwei pädagogische Aspekte prägen das Profil in diesem Aufgabenfeld besonders.<br />
Zum einen versteht sich die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> als <strong>Schule</strong> der Region. Die<br />
Schwerpunktsetzung im kulturellen Bereich kann zum Gemeindeleben beitragen und<br />
öffnet die <strong>Schule</strong> für Außenstehende. Zum anderen ermöglicht sie unseren<br />
Schülerinnen und Schülern besondere Fähigkeiten zu erwerben und Einblick in für<br />
sie häufig fremde Lebensfelder zu gewinnen.<br />
7.2 Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld<br />
Die Schülerinnen und Schüler der <strong>Drawehn</strong>- <strong>Schule</strong> sollen Demokratie lernen und<br />
leben. Dieses Ziel soll mit einer Reihe besonderer Aktivitäten erreicht werden.<br />
Für die 8. – 1<strong>0.</strong> Jahrgangsstufe wird jedes Jahr ein Planspiel „Wahlen“<br />
durchgeführt. Schulzweig- und jahrgangsübergreifend gründen Schülerinnen und<br />
Schüler Parteien, überlegen sich Ziele, simulieren einen Wahlkampf, führen die<br />
Wahlen durch und werten sie aus.<br />
Die Schüler und Schülerinnen der 1<strong>0.</strong> Klassen erhalten außerdem die Möglichkeit,<br />
eine Plenarsitzung des niedersächsischen Landtages in Hannover zu besuchen und<br />
an einer anschließenden Diskussion mit den Abgeordneten aktiv teilzunehmen.<br />
- 17 -
Der Besuch der Gedenkstätte Bergen- Belsen im Rahmen des Projekts<br />
„Nationalsozialismus“ trägt außerdem einen wichtigen Teil zur politischen Bildung<br />
der Schülerinnen und Schüler bei.<br />
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Projekttage im Fach Geschichte in den<br />
Jahrgängen 5 (Steinzeit) und 6 (Mittelalter). Fächerübergreifende Projekte wie<br />
beispielsweise die Umweltprojekttage in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich<br />
Naturwissenschaften sollen außerdem das Umweltbewusstsein der Schülerinnen<br />
und Schüler fördern.<br />
Alle Aktivitäten finden über die Grenzen der Schulzweige hinweg statt, so dass<br />
„Demokratie lernen“ auch im Schulalltag praktiziert wird.<br />
7.3 Sprachlich-literarisches Aufgabenfeld<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> sieht es als eine vorrangige Aufgabe, die Lesekompetenz der<br />
Schülerinnen und Schüler zu stärken.<br />
Neben der konsequenten Umsetzung des Programms zu den Lern- und Arbeitstechniken<br />
im Unterricht (III.3) finden dazu für die 6. Klassen regelmäßig<br />
Lesewochen statt. Gemeinsames Lesen in ansprechender Atmosphäre und<br />
Umgebung soll die Leselust und –freude der Kinder stärken. Außerdem beteiligt sich<br />
die <strong>Schule</strong> regelmäßig am regionalen und – bei entsprechender Qualifikation – am<br />
überregionalen Vorlesewettbewerb der 6. Klassen. Ergänzt wird dieses Angebot<br />
durch Einführungsveranstaltungen in den Umgang mit unserer Schülerbücherei.<br />
Hier können die Schülerinnen und Schüler täglich aus mehr als 2000 Büchern Leseund<br />
Lernmaterial entleihen.<br />
Einen weiteren Beitrag zur Leseförderung bietet der Leseraum, der mindestens<br />
einmal im Schuljahr eingerichtet wird. Für zwei Wochen wird ein Klassenraum<br />
umgestaltet und regt dann zum Schmökern an. Eine Vielzahl von Büchern wird<br />
ausgelegt und verlockt zum Neugierig-Werden und Sich-Festlesen. Die Bücher<br />
widmen sich einem jährlich wechselnden Thema (z.B. Sport, Reisen, Liebe …).<br />
Neben der Schülerbücherei bieten private Bestände der Lehrkräfte, örtliche und<br />
regionale öffentliche Büchereien ein breites Spektrum von verschiedenen<br />
Leseangeboten. Auch die örtliche Zeitung liegt tagesaktuell aus. Der Raum ist zum<br />
Thema passend dekoriert, und „Lümmelecken“, Kissenlandschaften und Lesezelte/ -<br />
höhlen ermöglichen einen Kontakt zum geschriebenen Wort, der sich von<br />
herkömmlichen Leserfahrungen angenehm unterscheidet. Der Leseraum wird in den<br />
beiden Wochen stark und gerne frequentiert.<br />
Einen zweiten Schwerpunkt des Aufgabenfeldes bildet der Auf- und Ausbau<br />
internationaler Kontakte und Partnerschaften. Neben der Verbesserung der<br />
fremdsprachlichen Kompetenzen ist es das Ziel der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>, den<br />
Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungen außerhalb ihres eigenen<br />
Erfahrungskreises zu ermöglichen und Offenheit und Toleranz für andere<br />
Lebensgewohnheiten und –weisen zu stärken.<br />
Angeregt durch die erfolgreiche Arbeit als COMENIUS-Projektschule ist ein<br />
Schüleraustausch mit der Partnerschule College Blaise Pascal in Viarmes/<br />
Frankreich entstanden. Französischlernende Schülerinnen und Schüler der<br />
Klassenstufen 8 und 9 können für knapp zwei Wochen den Schulalltag ihrer<br />
Altersgenossinen und –genossen in Frankreich kennen lernen und umgekehrt.<br />
- 18 -
Der jüngste Austausch unserer <strong>Schule</strong> besteht mit der (Tegla skolan, Skara) in<br />
Schweden. In kurzer Zeit ist er dennoch fester Bestandteil der schulischen<br />
Auslandskontakte geworden. Das Interesse am gegenseitigen Kennenlernen der<br />
anderen Kultur ist sehr ausgeprägt. Gemeinsames Verständigungsmedium ist das<br />
Englische, das sich als ‚lingua franca’ besonders bewährt. So können bei diesem<br />
interkulturellen Kontakt besonders auch Lerner ohne Kenntnisse einer zweiten<br />
Fremdsprache zum Zuge kommen.<br />
Seit dem Jahr 2002 besteht eine Schulpartnerschaft mit der Zespol Szkol in<br />
Objierze/Polen. Das Angebot zur Teilnahme am Schüleraustausch richtet sich<br />
vorwiegend an Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrganges. Ziel gerade dieser<br />
Partnerschaft ist es, Schülerinnen und Schüler mit den Lebensgewohnheiten und<br />
dem Alltag in einem mit vielen Vorurteilen behafteten Land bekannt zu machen und<br />
so zum Abbau von Vorurteilen beizutragen. Gestützt werden die Aktivitäten durch<br />
vielfältige gemeinsame Projekte im musisch-kulturellen Aufgabenfeld.<br />
Die besondere Lage der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>, in einiger Entfernung zu Städten mit<br />
einem umfangreichen Kulturprogramm, erschwert vielen Jugendlichen regelmäßige<br />
Teilhabe an der kulturellen Vielfalt ihrer Region. Insbesondere der Besuch eines<br />
Theaters ist für viele <strong>Drawehn</strong>-Schüler eine besondere – teilweise erstmalig<br />
gemachte – Erfahrung. Deshalb lädt die DSC einmal jährlich eine englischsprachige<br />
Theatertruppe zu sich ein. Ein großer Teil der Schülerschaft kann dann an<br />
Aufführungen von englischsprachigen Stücken teilnehmen. Die Theaterstücke sind<br />
speziell für junge Menschen geschrieben und spiegeln oft Erfahrungen aus ihrer<br />
Erlebniswelt wider (Essstörungen, Mobbing, Ausgrenzung von Ausländern usw.). Bei<br />
der Theateraufführung Erlebtes kann im Unterricht wieder aufgegriffen, verarbeitet<br />
und vertieft werden. Die Englisch-Lehrkräfte bereiten die Zuschauer auf die Stücke<br />
inhaltlich und sprachlich vor, so dass eine Verzahnung des Theaterbesuchs mit dem<br />
Unterricht gewährleistet ist. Viele Jugendliche machen während der Aufführungen die<br />
wertvolle Erfahrung, dass ihre Sprachkompetenz im Englischen gut genug ist, um<br />
auch einem komplexeren Bühnenstück über längere Zeit zu folgen. Die Begegnung<br />
mit dem Theater wird von den meisten Lernenden als sehr angenehm und<br />
bereichernd empfunden.<br />
7.4 Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld<br />
Die Auszeichnung als Umweltschule in Europa wurde der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> im Jahr<br />
2003 für ihr „besonderes Engagement zur nachhaltigen Verbesserung der Umwelt“<br />
verliehen.<br />
Damit wurde unter anderem der COMENIUS-Projektbeitrag „Umwelt und kulturelles<br />
Erbe“ anerkannt. Über drei Jahre hinweg hat eine Klassenstufe der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong><br />
zusammen mit insgesamt 12 Lehrkräften im Rahmen von Projekttagen und während<br />
des Unterrichts gearbeitet.<br />
Als Ergebnis konnten zwei Ausstellungen präsentiert werden, außerdem wurde eine<br />
Webseite gestaltet, die über die Schulhomepage unter www.drawehn-schule.de<br />
abgerufen werden kann.<br />
Unabhängig vom COMENIUS-Projekt wird der Schwerpunkt der Umweltbildung an<br />
der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> durch schulzweigübergreifende Projektarbeit in den<br />
Jahrgängen unterstützt. Im 7. Jahrgang arbeiten die verschiedenen Unterrichtsfächer<br />
an einem Projekt zum Thema „Müll“, im 8. Jahrgang folgt dann das „Wasser-Projekt“.<br />
Schülerinnen und Schüler lernen Umweltbildung als einen selbstverständlichen<br />
- 19 -
Bestandteil des Unterrichts und als wichtiges Element schulformübergreifender<br />
Zusammenarbeit kennen. Das im Schuljahr 2005/06 im 5. Jahrgang erstmals<br />
durchgeführte Projekt zum Thema „Knochen, Skelett ...“ ist bei den unterrichtenden<br />
Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern auf so große<br />
Resonanz gestoßen, dass es auch in den nächsten Schuljahren<br />
schulzweigübergreifend angeboten werden soll. Auch das neu zu belebende Projekt<br />
„Wald“ soll zukünftig eine handlungsorientierte und sinnliche Auseinandersetzung mit<br />
dem Lebensraum Wald ermöglichen.<br />
Einen weiteren Aspekt der Umweltbildung stellen die Aktivitäten im Bereich<br />
„Energie-Contracting“ dar. Seit Beginn des Schuljahres 2002/03 existiert an der<br />
<strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> eine Arbeitsgruppe, der ein Kollege und eine Kollegin, Schülerinnen<br />
und Schüler sowie der Hausmeister angehören. Diese Arbeitsgruppe hat<br />
systematisch in verschiedenen Bereichen den Umgang mit Energieressourcen in der<br />
<strong>Schule</strong> analysiert, veröffentlicht und Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die sich zur<br />
Zeit in der Umsetzung befinden.<br />
Neu im Angebot seit dem Schuljahr 2005/06 ist ein Wahlpflichtkurs „Biologie“ im<br />
9. Jahrgang. Dieser WPK nimmt sich derzeit der Gestaltung eines Atriums an, in dem<br />
ein Biotop entstehen soll. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten dazu<br />
eigenständig die Planungen und werden diese dann auch - mit fachlicher<br />
Unterstützung - eigenhändig umsetzen.<br />
Im Bereich Mathematik werden die Schülerinnen und Schüler seit einigen Jahren in<br />
den Gebrauch grafikfähiger Taschenrechner mit Computer-Algebra-System<br />
eingeführt. Gleichzeitig erlernen die Schülerinnen und Schüler den sinnvollen<br />
Umgang mit Tabellenkalkulations- und Präsentationsprogrammen.<br />
Diese Kompetenzen werden auch in den Wahlpflichtkursen „Informatik“ vermittelt,<br />
in denen auch noch andere Themen behandelt werden: Zu nennen sind der sichere<br />
Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen, mit Flash-Animations-Programmen, bei<br />
der Homepage-Erstellung und bei der Recherche im Internet. Auch der Entwurf von<br />
Datenbanken spielt in den WPK der älteren Jahrgänge eine Rolle.<br />
7.5 Aufgabenfeld Sport und Bewegung<br />
Bewegung, Sport und Spiel sind für ein lebendiges Schulleben von besonderer<br />
Bedeutung. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, vielfältige<br />
Bewegungsmöglichkeiten anzubieten, um die Schüler zum spontanen Spielen und<br />
Sporttreiben zu motivieren.<br />
Jährliche sportliche Höhepunkte sind an unserer <strong>Schule</strong> die regelmäßig<br />
stattfindenden Turniere in verschiedenen Ballsportarten (Fußball, Handball,<br />
Basketball). Ach die Schulmeisterschaft „Stärkste Schülerin/Stärkster Schüler“<br />
ist ein fester Bestandteil des sportlichen Lebens an unserer <strong>Schule</strong> geworden.<br />
Da die <strong>Drawehn</strong> – <strong>Schule</strong> eine enge Kooperation mit der Handball- und<br />
Turnabteilung des örtlichen Sportvereins pflegt, nehmen Schulmannschaften in<br />
beiden Sportarten - neben Fußball - seit Jahren erfolgreich am Wettbewerb „Jugend<br />
trainiert für Olympia“ teil.<br />
- 20 -
Weitere sportliche Veranstaltungen sind die Sportabzeichentage in der<br />
Leichtathletik und im Schwimmen und die in Zusammenarbeit mit der<br />
Schülervertretung organisierte lange Ballnacht.<br />
7.6 Aufgabenfeld Arbeit/Wirtschaft<br />
Neben der Vermittlung von Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge ist die<br />
Entwicklung von Berufswahlkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern die<br />
zentrale Aufgabe des Fachbereichs Arbeit/Wirtschaft.<br />
Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass über 85% der Schülerinnen und<br />
Schüler zu den „Berufsbildenden <strong>Schule</strong>n“ oder zur Gymnasialen Oberstufe<br />
wechseln.<br />
Verantwortlich für diesen Zustand ist die miserable Ausbildungsplatzsituation des<br />
Landes bzw. die hierzu im Vergleich noch mal deutlich schlechtere Situation des<br />
Landkreises Lüchow-Dannenberg.<br />
Zentrale Punkte bei der Bildung der Berufswahlkompetenz sind die beiden 10tägigen<br />
Berufspraktika in den Jahrgangsstufen 9 und 10 sowie die Beratung durch Frau<br />
Hadenfeldt vom Arbeitsamt (siehe Punkte 4 und 5 außerschulische Partner).<br />
Des Weiteren wird der AW – Unterricht durch eine Anzahl von Projekten wie zum<br />
Beispiel dem Börsenplanspiel Investor, einer Ausbildungsplatzrallye durch <strong>Clenze</strong>,<br />
einem „Internetrecherche-Tag“ mit Frau Hadenfeldt, Betriebserkundungen,<br />
Bewerbungstraining mit außerschulischen Partnern oder einem „Skateboardrennen<br />
zur Berufsorientierung“ veranstaltet von dem Bildungswerk der Niedersächsischen<br />
Wirtschaft ergänzt.<br />
7.7 Aufgabenfeld Religion und Werte und Normen<br />
In einer Welt, in der oft ethische Orientierungen fehlen, Werte und Normen und der<br />
christliche Glaube kaum noch eine Rolle spielen, versuchen die<br />
ReligionspädagogInnen der DSC die Sinnfragen des Lebens für die Schülerinnen<br />
und Schüler zum Thema zu machen, um gemeinsame Antworten zu finden.<br />
So wird zum Beispiel das Tabuthema „Tod“ zum Thema für einen Projekttag oder die<br />
Frage „Was geschah Ostern?“ in einem von Schülerinnen und Schülern gestalteten<br />
Gottesdienst beantwortet.<br />
7.8 Aufgabenfeld Mobilität<br />
Der Lernbereich „Mobilität“ ist ein überaus komplexes Feld. Themen dieses<br />
Lernbereichs finden sich in fast allen Schulfächern wieder. So wird an unserer<br />
<strong>Schule</strong>, in Eigenverantwortung der Lehrkräfte, in den entsprechenden Lernfeldern<br />
immer wieder der Lernbereich „Mobilität“ aufgegriffen und mit den Schülern<br />
praxisorientiert bearbeitet.<br />
Auch wurden in den letzten Jahren zu diesem Lernbereich projektorientierte<br />
Veranstaltungen wie die Verkehrstage (Klassenstufen 5-10 / 2 Schultage) und das<br />
ADAC Programm „Achtung Auto“ für die Jahrgangsstufe 5 durchgeführt.<br />
- 21 -
Um einen außerschulischen Lernort für unsere <strong>Schule</strong> zu erschließen, besuchte eine<br />
Kollegin eine Informationsveranstaltung der Autostadt Wolfsburg. Sie bietet ein<br />
höchst attraktives und umfassendes Lehr- und Lernspektrum mit unterschiedlichen<br />
„Inszenierungen“ zu Mobilität an und soll in der Zukunft auch von Klassen unserer<br />
<strong>Schule</strong> genutzt werden.<br />
Das ADAC Programm „Achtung Auto“ wird seit dem Schuljahr 2005/06 kontinuierlich<br />
mit der Jahrgangsstufe 5 durchgeführt und ist ein fester Bestandteil der<br />
Einführungswoche geworden.<br />
- 22 -
1. Interne Zusammenarbeit<br />
1.1 Teams und Tandems<br />
IV. Zusammenarbeit<br />
Die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen<br />
miteinander und mit den Schülerinnen und Schülern ist ein Kernelement des<br />
pädagogischen Konzepts der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>. Hierbei spielen insbesondere zwei<br />
Aspekte eine Rolle.<br />
Alle Lehrkräfte, die in einer Klasse unterrichten bilden ein Team, wobei möglichst<br />
viele Fächer von möglichst wenigen Kolleginnen bzw. Kollegen unterrichtet werden.<br />
Die Teambildung soll auf Basis weitgehender Freiwilligkeit geschehen. Die Einsatzdauer<br />
in einer Klasse liegt in allen Schulzweigen bei zwei Schuljahren. Eine<br />
Sonderregelung gilt für die Hauptschule, dort arbeiten die Teams in den Klassen 5<br />
bis 7 für drei Jahre zusammen. Teamsitzungen finden mindestens zweimal im<br />
Schuljahr, jeweils zu Beginn des Halbjahres statt. Auf diesen Sitzungen wird ein<br />
gemeinsames pädagogisches Vorgehen in der Klasse abgesprochen. Darüber<br />
hinaus werden Termine koordiniert und fachübergreifender Unterricht geplant.<br />
Zwei Lehrkräfte führen gemeinsam eine Klasse und bilden ein Tandem. Es verfügt<br />
unter Berücksichtigung der Vorgaben frei über die Anlage seiner vorgegebenen<br />
Wochenstunden in der jeweiligen Klasse. Eine Doppelbelegung kann im<br />
Hauptschulzweig in geringem Maß nach Absprache im Stundenplan vorgesehen<br />
werden.<br />
1.2 Schülervertretung<br />
Das kooperative Lernen und die gemeinsame Gestaltung des Schullebens erfordert<br />
die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ideen zu entwickeln und<br />
gewinnbringend in das Schulleben einzubringen und so die verantwortungsbewusste<br />
und kritische Teilnahme an der Demokratie zu trainieren. Deshalb werden in allen<br />
Fächern solche Fähigkeiten gefördert, die den Schülerinnen und Schülern zu einer<br />
verantwortungsbewussten Mitgestaltung ihres Schullebens verhelfen und die<br />
Kommunikation untereinander als einer wichtigen Voraussetzung für eine<br />
erfolgreiche Interessenvertretung zu verbessern.<br />
Deshalb gibt es an der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> folgende Angebote und Möglichkeiten:<br />
• Die Schülervertretung (SV) kommt einmal monatlich zusammen und<br />
bestimmt am Schuljahresbeginn Stufen- und SchulsprecherInnen.<br />
• Die SV hat einen eigenen Raum, in dem wichtige Materialien zentral<br />
gelagert werden können und in dem die Schülerinnen und Schüler<br />
zusammen kommen können.<br />
• Es gibt einen zentralen SV-INFO-Kasten.<br />
• Zwei gewählte Kontaktlehrkräfte stehen der SV als Unterstützung zur<br />
Verfügung.<br />
• Im Rahmen des GSW-Unterrichts und in den Eingangsphasen des neuen<br />
Schuljahres wird das Thema Schülervertretung regelmäßig behandelt.<br />
- 23 -
• Die SV hat einen eigenen Menupunkt auf der Homepage der <strong>Drawehn</strong>-<br />
<strong>Schule</strong> und informiert regelmäßig über Konferenzen und andere<br />
Angelegenheiten.<br />
1.3 Eltern<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> bemüht sich um kooperative und konstruktive Zusammenarbeit<br />
mit den Eltern in verschiedenen Bereichen. Neben der gesetzlich vorgesehenen<br />
Mitwirkung in den Gremien sind Eltern dazu eingeladen, sich an weiteren<br />
schulischen Aktivitäten wie etwa Projekttagen oder der Gestaltung der Nachmittag-<br />
AG zu beteiligen. Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Sprechtage geben<br />
den Eltern Gelegenheit, sich zu informieren.<br />
Ein 2002 fertig gestellter Leitfaden zur Deeskalation bestimmt die Grundsätze der<br />
Konfliktbearbeitung und –lösung an der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>. Sowohl für Konflikte<br />
zwischen Schülerinnen und Schülern als auch für Konflikte mit Lehrkräften gilt hierbei<br />
der Grundsatz im Normalfall den Kontakt zu den direkt Beteiligten zu suchen.<br />
Alle Eltern der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> erhalten ein Exemplar des Leitfadens. Die<br />
Wirksamkeit des Vorgehens soll bis zum Ende des Schuljahres 2005/06 geprüft<br />
werden.<br />
Anlage A11: Deeskalationsleitfaden<br />
Anlage A23: Geschäftsordnung des <strong>Schule</strong>lternrates<br />
1.4 Nicht-unterrichtendes Personal<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> versteht sich als Gemeinschaft aller an ihr beteiligten Gruppen.<br />
Dazu gehören neben Schülern, Kollegen und Eltern auch die Angehörigen des nichtunterrichtenden<br />
Personals: Hausmeister und Busfahrer, Medienassistent,<br />
Sekretärinnen, Reinigungskräfte und weitere Hilfskräfte. Ihr Beitrag zur Umsetzung<br />
und zum Gelingen der pädagogischen Ziele wird gewürdigt, sie werden durch<br />
regelmäßige Gespräche in Prozessabläufe einbezogen.<br />
1.5 Beratungslehrerin<br />
Seit Beginn des Schuljahres 2005/06 können drei Beratungsstunden pro Woche<br />
angeboten werden.<br />
Beratungslehrer sind Ansprechpartner für<br />
• Schüler/innen<br />
• Kollegen/Kolleginnen<br />
• Eltern<br />
Sie beraten bei<br />
• schulischen und privaten Problemen der Schüler/innen<br />
• Fragen der Schullaufbahn<br />
• Leistungs- und Lernproblemen<br />
• Erziehungsfragen der Eltern<br />
- 24 -
Sie verweisen auf Beratungsstellen im Landkreis, sollte das Problem schwerwiegender<br />
sein.<br />
Die Beratung erfolgt<br />
• freiwillig<br />
• vertraulich<br />
• ohne Auftrag durch andere Personen<br />
Das Beratungskonzept geht davon aus, dass der/die Ratsuchende ein Interesse an<br />
der Bearbeitung seiner Probleme hat. Dabei ist der/die Beratungslehrer/in<br />
Begleiter/in.<br />
Anlage A31: Beratungskonzept der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> <strong>Clenze</strong><br />
2. Zusammenarbeit mit externen Partnern<br />
2.1 Offene <strong>Schule</strong><br />
Der Begriff „Offene <strong>Schule</strong>“ kann nicht nur als Öffnung der <strong>Schule</strong> für die Schülerin<br />
und den Schüler gesehen werden, sondern beinhaltet die Öffnung der <strong>Schule</strong> für<br />
Eltern, Ehemalige und andere Interessierte, für Institutionen und Vereine.<br />
Um diese zügig voranzutreiben, bietet die <strong>Schule</strong><br />
Arbeitsgemeinschaften (III.6)<br />
an drei Nachmittagen der Woche an. Ein Teil der AGs wird von Eltern und<br />
kompetenten Fachleuten geleitet. Denkbar sind dabei auch Angebote, die nicht nur<br />
aus dem Schulalltag erwachsen, z.B. Erste-Hilfe-Kurse.<br />
Gleichzeitig soll die <strong>Schule</strong> sich zu einem<br />
Kulturzentrum (III.7.1)<br />
entwickeln. Unter dem Begriff „ Kunst zum Anfassen“ finden, Ausstellungen, Theaterund<br />
Musikaufführungen und andere Veranstaltungen statt.<br />
Aus Eltern, LehrerInnnen und SchülerInnen bestehende Arbeitsgruppen organisieren<br />
regelmäßig wiederkehrende<br />
Schulveranstaltungen<br />
wie z.B. Abschlussfeiern, Sportwettbewerbe, die “Kaffee-Kunst-Kuchen“ - Aktion im<br />
Dezember u.a.m.<br />
Die <strong>Schule</strong> soll mehr als bisher<br />
Kommunikationszentrum<br />
für Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen werden. Dazu soll eine Eltern-<br />
LehrerInnen-SchülerInnen-Cafeteria zu Sprechtagen, Berufs- und Problemberatung<br />
(Agentur für Arbeit, Jugendamt, Beratungslehrkraft), Stammtisch für Eltern und<br />
Lehrkräfte beitragen.<br />
2.2 Soziale Dienste<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> arbeitet im Bedarfsfall mit verschiedenen Trägern sozialer<br />
Dienste zusammen. Ansprechpartnerin hierfür ist die Beratungslehrkraft.<br />
Anlage A 18: Wegweiser soziale Dienste für den Landkreis<br />
- 25 -
3 Schulträger<br />
Der Schulleiter koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 40 – <strong>Schule</strong> und<br />
Bildung- der Kreisverwaltung Lüchow-Dannenberg.<br />
4 Betriebe<br />
Alle Schülerinnen und Schüler der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> werden im Fach Wirtschaft<br />
unterrichtet. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern Berufsorientierung und –<br />
vorbereitung zu ermöglichen. Einblicke in die Arbeitswelt verschaffen regelmäßig<br />
stattfindende Betriebspraktika (HS 8, 9, RS9,10 +GY 10).<br />
Im Rahmen der Betriebspraktika findet eine enge Kooperation mit Betrieben der<br />
Region statt, die in jedem Schuljahr rund 130 Praktikumsplätze zur Verfügung<br />
stellen. Die Betreuung durch die Betriebe während der Praktika verläuft überwiegend<br />
positiv, die verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen halten gute Kontakte zu<br />
Betrieben der Region.<br />
Die Teilnahme der Fachbereichsleitung Wirtschaft an Dienstbesprechungen im<br />
Landkreis und am Arbeitskreis <strong>Schule</strong>-Wirtschaft gewährleistet den Austausch mit<br />
potentiellen Arbeitgebern.<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> ist darum bemüht, Schulabgängerinnen und –abgänger in<br />
direktem Kontakt mit Betrieben zu vermitteln und sieht darin einen möglichen Weg<br />
um ihre Schülerinnen und Schüler in der strukturschwachen Region zu unterstützen.<br />
5 Agentur für Arbeit<br />
Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit wird durch den Fachbereich<br />
Wirtschaft koordiniert (s. III.7.6).<br />
6 Auslandskontakte<br />
Auslandskontakte verhelfen zu einem umfassenderen Weltbild, zu mehr Offenheit<br />
und mehr Verständnis für anders Denkende und anders Lebende.<br />
Aus diesem Grund bemüht sich die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> möglichst vielseitige Kontakte<br />
mit Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schülern unserer<br />
Partnerschulen herzustellen. Angestrebt werden ein regelmäßiger Austausch, Arbeit<br />
an gemeinsamen Projekten und briefliche Kontakte (III.7.3).<br />
• Mit der polnischen Partnerschule Zespól Szkól im. Adama Mickiewicza in<br />
Objezierze bei Poznan findet seit 2002 ein regelmäßiger Schüleraustausch<br />
statt. Für die Schülerinnen und Schüler, die am deutsch-polnischen<br />
Jugendaustausch teilnehmen findet im zweiten Schulhalbjahr im Rahmen<br />
des AG-Nachmittags ein polnischer Sprachkurs statt, der von<br />
polnischstämmigen Eltern durchgeführt und zwei weiteren KollegInnen<br />
betreut wird.<br />
- 26 -
• Angeregt durch die erfolgreiche Arbeit als COMENIUS-Projektschule ist ein<br />
Schüleraustausch mit der Partnerschule College Blaise Pascal in<br />
Viarmes / Frankreich entstanden. Dieser Austausch wird von den<br />
KollegInnen, die Französisch unterrichten, vorbereitet.<br />
• Im Schuljahr 2006/2007 fand im Mai erstmals ein Schüleraustausch mit der<br />
Partnerschule Tegla skolan in Skara / Schweden statt. Dieser Austausch<br />
wird im Rahmen des AG- Nachmittags von zwei KollegInnen vorbereitet.<br />
7 Öffentlichkeit<br />
Die positive Wahrnehmung der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> und ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit<br />
stärkt die Stellung als <strong>Schule</strong> der Region.<br />
Regelmäßige Kontakte zu Medien, insbesondere zur regionalen Presse, ermöglichen<br />
es der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong>, ein breites Publikum über aktuelle Geschehnisse und<br />
Vorhaben zu informieren.<br />
Die schuleigene Homepage wird regelmäßig aktualisiert und verfügt über einen<br />
hohen Informations- und Anschaulichkeitswert (www.drawehn-schule.de).<br />
In Zusammenarbeit mit einem professionellen Schulfotografen wird alle zwei Jahre<br />
ein Schuljahrbuch erstellt, an dessen inhaltlicher Gestaltung sich viele Kolleginnen<br />
und Kollegen beteiligen.<br />
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> ist es nicht nur, über die <strong>Schule</strong><br />
zu informieren, sondern allen an ihr Beteiligten die Möglichkeit zu bieten, sich dieser<br />
Gemeinschaft zugehörig zu fühlen und an ihrem Erfolg mitzuwirken.<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit wird von einem Mitglied der Schulleitung verantwortlich<br />
koordiniert.<br />
- 27 -
1. Geschäftsverteilung<br />
V. Organisationsstrukturen<br />
Die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> wird von einer Kollegialen Schulleitung geleitet. Unterstützt wird<br />
diese dabei von den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung.<br />
Die Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche der Funktionsträger sind im Geschäftsverteilungsplan<br />
festgelegt, der regelmäßig in Absprache mit den Beteiligten überarbeitet<br />
und der Schulgemeinschaft mitgeteilt wird.<br />
Anlage A12: Geschäftsverteilungsplan<br />
2. Konferenzen<br />
Der Rahmen für die schulische und unterrichtliche Arbeit wird von der Gesamtkonferenz<br />
und verschiedenen Teilkonferenzen bestimmt. Zuständigkeiten und<br />
Zusammensetzung der Gremien sind gesetzlich verankert.<br />
Anlage A13: Schaubild Konferenzstruktur der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong><br />
- 28 -
VI. Unterstützungspotenziale<br />
1. Fortbildungskonzept (Gesamtkonferenz April 2008)<br />
1.1 Vorbemerkungen<br />
Fortbildungen sind Ideen- und Energiespender für eine wandlungsfähige<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklung. Sie haben die Aufgabe, Lehrerinnen und Lehrer bei der<br />
Entwicklung ihrer fachlichen, didaktischen, methodischen und erzieherischen<br />
Kompetenzen zu unterstützen.<br />
Anregungen in vernachlässigten Tätigkeitsfeldern, neue Sichtweisen zur Bewältigung<br />
schultypischer Probleme sowie Weiterqualifizierung in vertrauten Bereichen stützen<br />
die persönliche Weiterentwicklung jeder Lehrkraft.<br />
Fortbildungen sollen bestimmte Ansprüche des Schulprogramms erfüllen und mit<br />
dessen Zielen im Einklang stehen.<br />
Die zunehmend selbstbestimmte <strong>Schule</strong>ntwicklung erfordert mit dem Festlegen auf<br />
ein schulspezifisches Programm auch darauf zugeschnittene Fortbildungen.<br />
Dies wird einerseits in schulinternen Fortbildungen berücksichtigt, erfordert<br />
andererseits auch, Fortbildungswünsche an dafür vorgesehene Einrichtungen<br />
(Regionale Fortbildung der Landesschulbehörde, NILS und andere öffentliche sowie<br />
private Anbieter) zu richten. Ergänzt wird die Auseinandersetzung auf dieser Ebene<br />
durch die Angebotsvielfalt öffentlicher und privater Einrichtungen.<br />
Die DSC gehört zur Fortbildungsregion 10 der Landesschulbehörde Lüneburg.<br />
Die Fortbildungsbeauftragte für die Regionale Lehrerfortbildung in unserer Region ist<br />
Gudrun Teickner ( Tel. 04131 / 15-2172).<br />
Vordringlich werden Projekte gefördert, die den bildungspolitischen Schwerpunkten<br />
entsprechen.<br />
1.2 Die verschiedenen Fortbildungsbereiche<br />
An der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> haben wir die folgenden Fortbildungsbereiche festgestellt.<br />
• Fortbildungen, die sich durch neue Erlasse ergeben<br />
- Einführung der neuen Bildungsstandards<br />
- Implementierung der neuen Kerncurricula<br />
- Abschlussprüfung in Klasse 9 des Hauptschulzweiges und Klasse 10<br />
des Haupt- und Realschulzweiges<br />
- zentrale Vergleichsarbeiten<br />
-<br />
• Fortbildungen, die sich auf Schul- und Unterrichtsentwicklung beziehen<br />
- Fortschreibung / Umsetzung des Schulprogramms<br />
- Weiterentwicklung in den Bereichen Erziehung und Unterricht<br />
- Lions Quest<br />
- Schwerpunkte ( Präventionskonzept,....)<br />
- Methodenkompetenz<br />
- 29 -
-<br />
• Fortbildungen mit fachlich relevanten Schwerpunkten<br />
- neue didaktisch- methodische Ansätze ( Stationenlernen,...)<br />
- Schülerfirma<br />
- Einsatz neuer Medien<br />
-<br />
• Fortbildungen zur Qualifizierung von Mitarbeitern<br />
- Konferenzen leiten<br />
- Mitarbeiter führen / Gespräche führen<br />
- Elternarbeit<br />
- fachliche Weiterbildung<br />
- 30 -
1.3 Abläufe bei Fortbildungen<br />
Fortbildungen im Fachbereich<br />
extern schulintern<br />
1. Lehrkräfte melden den Bedarf beim FBL<br />
und klären Fragen mit ihm ab.<br />
2. FBL setzen sich mit der Did. Leiterin ins<br />
Benehmen.<br />
3. Lehrkräfte stellen Antrag beim stellv. SL.<br />
4. Lehrkräfte nehmen nach Genehmigung an<br />
FoBi teil. Wenn nicht anders angeordnet,<br />
fährt grundsätzlich nur eine Lehrkraft.<br />
5. Lehrkräfte informieren auf Fachkonferenz<br />
über FoBi.<br />
6. FBL melden die Teilnahme an<br />
Fortbildungen mit Name, Thema, Datum<br />
an die Did. Leiterin.<br />
- 31 -<br />
Fortbildung für Teile des Kollegiums<br />
1.Initiator/Organisator der FoBi führt<br />
Vorgespräche um Bedarf zu klären.<br />
2. Initiator/Organisator klärt Voraussetzung<br />
mit der Schulleitung zur Genehmigung<br />
- Zeitraum / Ort<br />
- Referent/in<br />
- Anzahl Teilnehmer bei Unterrichtsausfall<br />
- Umfang bei Unterrichtsausfall<br />
- externe Teilnehmer<br />
- Nutzung schulischer Ressourcen<br />
- Kosten / Zahlungswege<br />
3. Initiator/Organisator lädt Teilnehmer ein.<br />
4. Teilnehmer melden an Initiator/Organisator<br />
zurück.<br />
5. Initiator/Organisator sorgt für Ablauf der<br />
Veranstaltung.<br />
6. Initiator/Organisator sorgt für Evaluation der<br />
FoBi.<br />
7. Initiator/Organisator melden die Teilnahme an<br />
Fortbildungen mit Name, Thema, Datum an<br />
die Did. Leiterin.<br />
Die Did. Leiterin führt die Fortbildungsliste für die ganze <strong>Schule</strong>.
extern<br />
1. Lehrkräfte melden den Bedarf bei der Did.<br />
Leiterin und klärt Fragen mit ihr ab.<br />
2. Lehrkräfte stellen Antrag beim stellv. SL.<br />
3. Lehrkräfte nehmen nach Genehmigung an FoBi<br />
teil. Wenn nicht anders angeordnet,<br />
fährt grundsätzlich nur eine Lehrkraft.<br />
4. Lehrkräfte informieren im entsprechenden<br />
Gremium über FoBi.<br />
5. Lehrkräfte melden die Teilnahme an<br />
Fortbildungen mit Name, Thema, Datum<br />
an die Did. Leiterin.<br />
fachübergreifende Fortbildungen<br />
- 32 -<br />
schulintern<br />
Fortbildungen für das gesamte Kollegium = SchiLf<br />
(siehe VI. 2.)<br />
Fortbildungen für Teile des Kollegiums<br />
1.Initiator/Organisator der FoBi führt<br />
Vorgespräche um Bedarf zu klären<br />
2. Initiator/Organisator klärt Voraussetzung<br />
mit SL zur Genehmigung<br />
- Zeitraum / Ort<br />
- Referent/in<br />
- Anzahl Teilnehmer<br />
- Umfang bei Unterrichtsausfall<br />
- externe Teilnehmer<br />
- Nutzung schulischer Ressourcen<br />
- Kosten / Zahlungswege<br />
3. Initiator/Organisator lädt Teilnehmer ein<br />
4.Teilnehmer melden an Initiator/Organisator zurück<br />
5. Initiator/Organisator sorgt für Ablauf der<br />
Veranstaltung<br />
6. Initiator/Organisator sorgt für Evaluation der<br />
FoBi<br />
7. Initiator/Organisator melden die Teilnahme an<br />
Fortbildungen mit Name, Thema, Datum an<br />
die Did. Leiterin.<br />
Die Did. Leiterin führt die Fortbildungsliste für die ganze <strong>Schule</strong>.
1.4 Dokumentation der Fortbildung<br />
Die Kolleginnen und Kollegen der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> dokumentieren im eigenen<br />
Interesse ihre Fortbildungs-aktivitäten in einem Portfolio. Fortbildungsnachweise<br />
können von ihnen über die Schulsekretärin der Personalakte zugeordnet werden.<br />
Die Lehrkräfte berichten über Fortbildungen auf Fachkonferenzen und<br />
Dienstbesprechungen. Ziel dieses Verfahrens ist es, die eigenen Fortbildungsaktivitäten<br />
im Hinblick auf Schwerpunktbildung und Nachhaltigkeit zu reflektieren und<br />
daraus Bedarf abzuleiten, sowie möglichst viele Kolleginnen und Kollegen an neuen<br />
Erkenntnissen und Erfahrungen teilhaben zu lassen.<br />
1.5 Finanzierung<br />
• Werden innerhalb der <strong>Schule</strong> Fortbildungsmaßnahmen initiiert, die den<br />
schulischen Entwicklungszielen dienen und die in das Fortbildungskonzept<br />
eingebettet sind, kann dieses Projekt über die Fortbildungsbeauftragte von der<br />
Landesschulbehörde mit einer Teilfinanzierung unterstützt werden. Dafür sind<br />
Zielvereinbarungen zu treffen, die am Ende der Maßnahme evaluiert werden<br />
müssen.<br />
• Für Fortbildungen, bei denen die Reisekosten erstattet werden, können die<br />
Anträge bei der Landesschulbehörde eingereicht werden.<br />
• Für Fortbildungen, bei denen die Reise- oder Fortbildungskosten behördlich<br />
nicht erstattet werden, gibt es bei der Landesschulbehörde einen<br />
Fortbildungstopf. Dieser Fortbildungstopf enthält einen für unsere <strong>Schule</strong><br />
festgelegten Betrag. Erstattungsanträge müssen über den Schulassistenten<br />
eingereicht werden. Beiträge aus diesem Topf werden so lange ausgezahlt,<br />
bis dieser Topf erschöpft ist.<br />
1.6 Wo findet man Fortbildungsangebote für unsere <strong>Schule</strong>?<br />
• Das Serviceheft der Fortbildungsregion 10 gibt es nicht mehr.<br />
Fortbildungsangebote werden jetzt regelmäßig einmal in der Woche der<br />
<strong>Schule</strong> per Post zugeschickt.<br />
• Regionale Lehrerfortbildungen des Dezernates 4 können unter<br />
www.vedab.de abgefragt werden.<br />
• Angebote vom NILS können unter www.vedab.de abgefragt werden.<br />
• Angebote, die uns per E-Mail zugeschickt werden oder per Liste erreichen,<br />
werden über die Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter oder über die<br />
Didaktische Leiterin weitergereicht.<br />
• Angebote der Fachmoderatoren<br />
- 33 -
• Angebote des BNW<br />
• Angebote von SCHUBZ<br />
• Angebote der Schulbuchverlage<br />
• Fortbildungen können über die Fortbildungsbeauftragten beantragt werden.<br />
• Fortbildungen können bei Bedarf über die Fortbildungsbeauftragte beantragt<br />
werden.<br />
•<br />
2. Schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLf)<br />
Der SchiLf kommt im Kollegium der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> eine besondere Bedeutung zu.<br />
Zum einen bietet sich hier Gelegenheit für gemeinsames Lernen und Arbeiten zu<br />
Themen, die aus dem Kollegium heraus entwickelt werden. Zum anderen fördert die<br />
SchiLf den Teamgeist innerhalb des Kollegiums und die Identifikation mit der <strong>Schule</strong>.<br />
Schulinterne Lehrerfortbildungen sind – neben den übrigen Fortbildungsangeboten –<br />
eine Möglichkeit Impulse von außen, z.B. durch Referenten, in die <strong>Schule</strong> und den<br />
Unterricht hinein zu tragen und stärken die offene <strong>Schule</strong>.<br />
In der <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> hat die SchiLf ihren festen Platz. Ergänzt wird das Angebot<br />
im laufenden Schuljahr durch Veranstaltungen z.B. im Rahmen von<br />
Dienstbesprechungen, Fachkonferenzen oder Arbeitsgruppen.<br />
Die inhaltliche Gestaltung der SchiLf orientiert sich an dem zuvor ermittelten Bedarf<br />
im Kollegium.<br />
Regelmäßige Evaluationen überprüfen den Erfolg der schulinternen Lehrerfortbildungen.<br />
- 34 -
1. Interne Evaluation<br />
VII. Evaluation<br />
Seit 1999 ist die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> Pilotschule und nimmt am bundesweiten QuiSS-<br />
Modellversuch für Schulprogrammentwicklung und Evaluation teil.<br />
Vor diesem Hintergrund wurden und werden verschiedene Verfahren der internen<br />
Evaluation erprobt. Ziel ist es, mit Hilfe geeigneter Instrumente und Methoden, den<br />
Erfolg des pädagogischen Handelns in unterschiedlichen Bereichen selber zu prüfen.<br />
Dabei kann es um Überprüfungen im kleinen Rahmen gehen (z.B. durch<br />
Befragungen zum Erfolg des eigenen Unterrichts nach einer Unterrichtseinheit oder<br />
durch Feedbacks zu Konferenzen), aber auch um die Betrachtung größerer<br />
Teilbereiche.<br />
Im Jahr 2001 hat die Arbeitsgruppe „Schulprogramm“ eine umfangreiche interne<br />
Evaluation zur Mittwoch-AG durchgeführt und aus deren Ergebnissen konzeptionelle<br />
Vorschläge zu deren Verbesserung abgeleitet und entwickelt.<br />
Gegenwärtig wird auf Teilkonferenzen über unterschiedliche Verfahren der internen<br />
Evaluation berichtet und diskutiert.<br />
Anlage A14: Interne Evaluation AG-Angebot und konzeptionelle Überlegungen<br />
2. Externe Evaluation<br />
Seit 2001 hat die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> sich verschiedenen Maßnahmen der externen<br />
Evaluation gestellt. Ziel der freiwilligen Teilnahme an diesen Maßnahmen war bzw.<br />
ist es, die <strong>Schule</strong> auch für den Blick von außen zu öffnen und mit Hilfe externer<br />
Betrachter und Unterstützer möglicherweise neue Perspektiven für die pädagogische<br />
Arbeit zu gewinnen. Dem liegt die Einschätzung zugrunde, dass eine offene <strong>Schule</strong>,<br />
die ihre Schülerinnen und Schüler auf eine sich ständig wandelnde Umwelt<br />
vorbereiten will, selber bereit sein muss, neue Wege zu gehen und sich selber zu<br />
öffnen, um dieses Ziel zu erreichen.<br />
Im Schuljahr 2000/01 hat die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> an einer Befragung durch die<br />
Hochschule Vechta unter Leitung von Prof. Holtappels teilgenommen. Gegenstand<br />
der umfangreichen Befragung waren über 100 Fragen zur Einschätzung der<br />
Leistungen der <strong>Schule</strong> in verschiedenen Bereichen, die von Kolleginnen und<br />
Kollegen sowie von Schülerinnen und Schülern beantwortet wurden, die außerdem in<br />
Mathematik und Problemlösendem Denken befragt wurden. Die Befragungen wurden<br />
an 20 niedersächsischen <strong>Schule</strong>n durchgeführt, so dass die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> die<br />
Einschätzung ihrer Leistungen mit der anderer <strong>Schule</strong>n vergleichen konnte.<br />
Die Auswertung der ersten Umfrage liegt der <strong>Schule</strong> vor und wurde der<br />
Schulgemeinschaft vorgestellt.<br />
Im Schuljahr 2001/02 hat sich die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> im Rahmen des QuiSS-Versuchs<br />
einer Evaluation durch ein externes Team unterzogen. Gegenstand dieser<br />
Evaluation war die Umsetzung des Programms zum Erlernen von Arbeitstechniken<br />
- 35 -
(III.3). Befragt wurden alle Schülerinnen und Schüler sowie die Unterrichtenden. Die<br />
schulweit gültigen Ergebnisse dieser externen Evaluation wurden dem Kollegium<br />
vorgestellt, die individuellen Ergebnisse den Unterrichtenden unter Wahrung der<br />
Anonymität im verschlossenen Umschlag zur Verfügung gestellt. Die allgemeinen<br />
Ergebnisse wurden mit Interessierten ausgewertet und zu verbessernde Bereiche auf<br />
einer späteren SchiLf (VI.2) aufgegriffen.<br />
3. EFQM<br />
Seit Beginn des Schuljahres 2002/03 beteiligte sich die <strong>Drawehn</strong>-<strong>Schule</strong> am Modellversuch<br />
zum Umsetzungsmanagement nach EFQM (European Foundation for<br />
Quality Management). Ziel dieses Versuchs, an dem sich in Niedersachsen zehn<br />
<strong>Schule</strong>n beteiligten, war es, zu erproben, ob dieses Vorgehen geeignet ist,<br />
systematische Verbesserungen der Schulqualität zu erreichen.<br />
Ein Schuljahr lang haben Kolleginnen und Kollegen eine systematische Bestandsaufnahme<br />
aller schulischen Bereiche vorgenommen und in einem umfangreichen<br />
Kursbuch zusammengestellt. Mit Hilfe eines externen Moderators wurden daraus in<br />
einem Konsensmeeting unter Einbeziehung vieler an <strong>Schule</strong> beteiligten Gruppen<br />
Verbesserungsbereiche erarbeitet, anschließend priorisiert und dann als<br />
Maßnahmenkataloge zusammen gefasst.<br />
Im Schuljahr 2003/04 erprobten verschiedene Arbeitsgruppen die Umsetzung von<br />
Verbesserungsmaßnahmen und informierten die Schulgemeinschaft regelmäßig über<br />
ihre Arbeit. Außerdem wurde im Frühjahr 2004 eine Befragung durchgeführt und<br />
ausgewertet. Die Erkenntnisse aus dieser Befragung sollten mit in das zweite<br />
Konsensmeeting einfließen. Bei diesem Konsensmeeting im Juni 2004 wurde ein<br />
vorläufiges Fazit gezogen, neue Verbesserungsbereiche identifiziert und ihre<br />
Umsetzung für das Schuljahr 2004/05 geplant.<br />
Im Schuljahr 2004/05 haben wir im Herbst 04 den „Hauptschultag“ durchgeführt<br />
( eine der geplanten Verbesserungsmaßnahmen ) . Alle Klassenlehrerinnen und<br />
Klassenlehrer, interessierte Kolleginnen/ Kollegen und die Schulleitung haben<br />
insbesondere die Erkenntnisse und Probleme aus der Befragung im Frühjahr<br />
genauer analysiert . Es wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation<br />
formuliert und gleichzeitig auch ihre Umsetzung geplant. Im Februar 2005 wurde dies<br />
auf einer schulzweigbezogenen SchiLF weiterentwickelt und überprüft.<br />
Im Dezember 2005 wurden alle neuen Kolleginnen auf einer Dienstbesprechung in<br />
die Arbeit nach dem EFQM – Modell eingeführt. Seit dem haben die folgenden<br />
Steuergruppen die Arbeit wieder aufgenommen:<br />
AG 1 - „Steuergruppe Zukunft“<br />
Die Schulprogrammgruppe hat sich im Mai 2009 in die „Steuergruppe Zukunft“<br />
umgewandelt. Diese Steuergruppe entwickelt Konzepte zur Umgestaltung unserer<br />
<strong>Schule</strong> und unseres Unterrichtes (z:B: neue Rhythmisierung des Schultages,<br />
Raumkonzept, Optimierung des Ganztagsangebotes,...). Ziel ist es, unsere <strong>Schule</strong> fit<br />
für die Zukunft zu machen.<br />
AG 2 - Prozessgruppe<br />
Beschreibung von Abläufen an unserer <strong>Schule</strong><br />
- 36 -
AG 3 - Indikatoren/Umfragengruppe<br />
Indikatoren festlegen, Daten erheben und auswerten<br />
Im Frühjahr 2006 wurde erneut eine Befragung aller SchülerInnen, Eltern und<br />
KollegInnen durchgeführt. Diese Umfragen wurden von der zuständigen<br />
Arbeitsgruppe(AG 3) ausgewertet und analysiert. Die Auswertung wurde auf der<br />
Gesamtkonferenz und den einzelnen Schulzweigkonferenzen vorgestellt.<br />
Es zeigte sich eine Stabilisierung der guten Werte aus dem Jahr 2004. Bei<br />
Abweichungen nach unten wurden die möglichen Ursachen besprochen und<br />
Maßnahmen zur Verbesserung beschlossen.<br />
Die Dritte Umfrage wurde in gleicher Form im Frühjahr 2008 durchgeführt. Auch bei<br />
dieser Umfrage ergab sich eine weitere Stabilisierung der Werte aus den vorherigen<br />
Umfragen auf einem hohen Niveau. Zu der Kolleginnen- und Kollegenumfrage wurde<br />
im Mai 2008 eine SchiLF durchgeführt. Dort erfolgte eine Auswertung unter dem<br />
Oberthema: „Optimierung des Betriebsklimas“. Diese Fortbildung führte dazu, dass<br />
ein großer Teil des Kollegiums an einem Teamcoaching / einer Supervision mit einer<br />
externen Moderatorin teilnehmen wollte. Diese Sitzungen wurden an fünf<br />
Nachmittagen durchgeführt und sind im September 2009 abgeschlossen worden. Die<br />
Ergebnisse dieses Teamcoachings / dieser Supervision werden mit der nächsten<br />
Umfrage evaluiert.<br />
Anlage A15: Externe Evaluation Arbeitstechniken<br />
Anlage A16: Ergebnisse der Befragung durch die Hochschule Vechta (Kurzfassung)<br />
Anlage A17: Maßnahmenkataloge nach EFQM 2003<br />
Anlage A19: Ergebnisse des EFQM-Prozesses aus 2003/04<br />
Anlage A20: Maßnahmenkataloge nach EFQM für das Schuljahr 2004/05<br />
Anlage A24: Umfrage 2006<br />
Anlage A30 Umfrage 2008<br />
- 37 -