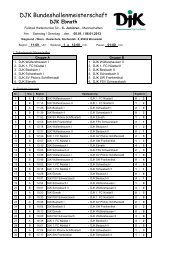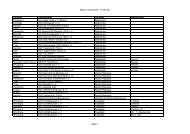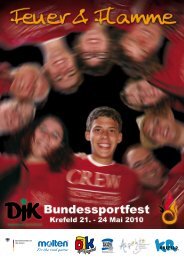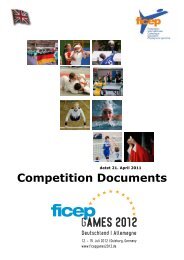Intranet: Geplatzte Träume â neue Chancen
Intranet: Geplatzte Träume â neue Chancen
Intranet: Geplatzte Träume â neue Chancen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Geplatzte</strong> Träume – <strong>neue</strong> <strong>Chancen</strong><br />
Realistische Zielsetzungen für das <strong>Intranet</strong> in der Unternehmenskommunikation<br />
von Jörg Pfannenberg und Jessica Durst<br />
Für die Hälfte der DAX100-Unternehmen ist das <strong>Intranet</strong> laut eigener Einschätzung<br />
heute das wichtigste Medium der Mitarbeiterkommunikation. Am Anfang der<br />
<strong>neue</strong>n Medien stand das Versprechen von Partizipation und Transparenz. In der<br />
betrieblichen Kommunikation lauteten die Zielsetzungen Effizienz durch PR nach<br />
innen, Steigerung von Integration und Motivation der Mitarbeiter sowie Verbesserung<br />
der Arbeitsleistung.<br />
Inzwischen haben fast alle Mitarbeiter Zugang zu dem <strong>neue</strong>n Medium: 59 % der<br />
Beschäftigten in deutschen Unternehmen konnten bereits Ende 2001 das <strong>Intranet</strong><br />
direkt am Arbeitsplatz-PC nutzen, 21 % hatten Zugang über Terminals, PC-Kioske<br />
oder Internetcafés (vgl. Mast 2002, S. 15) 1 .<br />
Doch nicht alle Blütenträume reiften. Das <strong>Intranet</strong> hat in der internen Kommunikation<br />
keinen qualitativen Sprung bewirkt. Die Mediengeschichte des <strong>Intranet</strong>s und<br />
die Analyse seiner spezifischen Eigenschaften verdeutlichen, was dieses Medium<br />
tatsächlich leisten kann und was nicht. Aktuelle Trends deuten an, welche Möglichkeiten<br />
zusätzlich freigesetzt werden können.<br />
Das trügerische Versprechen: Partizipation und Effizienz<br />
Das Demokratisierungsversprechen ist eine Konstante der Medienevolution, so<br />
der Medientheoretiker Siegfried J. Schmidt: „Bei der Durchsetzung jedes <strong>neue</strong>n<br />
Mediums erhoffen sich (beziehungsweise verheißen) die Befürworter einen <strong>neue</strong>n<br />
Demokratisierungsschub im Sinne einer gerechteren Teilhabe an den <strong>neue</strong>n<br />
kognitiven und kommunikativen (weniger an den <strong>neue</strong>n ökonomischen) Möglichkeiten<br />
des jeweiligen Mediums“ (Schmidt 2000, S. 188).<br />
Demokratisierung und Partizipation waren Ende der 80er Jahre die Versprechen,<br />
mit denen die Internet-Technologie vorangetrieben wurde. „Das Internet […] wurde<br />
von einflussreichen Politikern wie Al Gore […] als Wiederbelebung der athenischen<br />
Agora gefeiert. Weltweite und zeitgleiche Kommunikation aller mit allen,<br />
kostenloser Zugang zu allen verfügbaren Informationsbeständen, Kreativität durch<br />
Interaktivität, freie Wahl von temporär begrenzbaren Sozialverbindungen waren<br />
die verlockenden Perspektiven für Net-User weltweit“ (Schmidt 2000, S. 189).<br />
1 Unter Leitung von Prof. Claudia Mast werden die Leiter Unternehmenskommunikation von<br />
DAX100-Unternehmen jährlich zur Entwicklung der internen Kommunikation befragt. Im Jahr 2001<br />
nahmen 51, 2002 39 Unternehmen an der Befragung teil.
Diesem Impetus folgten in den 90er Jahren mit der Einführung des <strong>Intranet</strong>s auch<br />
die Unternehmen. Es sollte die offene Kommunikation über alle Abteilungs- und<br />
Hierarchiegrenzen hinweg ermöglichen. L. Nikolaus Guntrum und Friedmar<br />
Nusch, ehemaliger Leiter Unternehmenskommunikation bei Hoechst, lobten 1998:<br />
„Wie im Internet nehmen die Informationen ihren eigenen Weg, abseits traditioneller<br />
Hierarchien der Informationsvermittlung und außerhalb der Informationskaskade“<br />
(Guntrum/Nusch 1998, S. 199). Auch Banken begeisterten sich plötzlich für<br />
die Idee des „hierarchiefreien“ Unternehmens: Die Dresdner Bank beispielsweise<br />
proklamierte 1999 den „offenen, konstruktiven Dialog über alle Hierarchien, Bereichs-,<br />
Abteilungs- und Ländergrenzen“ (Dresdner Bank, zit. in: Mast 2002, S. 8)<br />
hinweg.<br />
Diese Zielsetzungen folgten den sich wandelnden Ansprüchen der Mitarbeiter<br />
an ihren Arbeitsplatz, „die Arbeit auf sich und nicht sich auf die Arbeit zu beziehen“.<br />
Der Arbeitssoziologe Martin Baethge beschreibt bereits 1990 in seinem Aufsatz<br />
„Arbeit, Vergesellschaftung, Identität – zur zunehmenden Subjektivierung der<br />
Arbeit“ die Verbreitung dieses subjektzentrierten Arbeitsverständnisses – weg von<br />
der Orientierung an hohem Einkommen hin zur besonderen Wertschätzung interessanter<br />
Arbeit, zur gesellschaftlichen Legitimierbarkeit beruflichen Handelns und<br />
zur Verwirklichung eigener Ideen. Zum ersten Mal beharrten nicht nur wenige<br />
Kreative, sondern alle Beschäftigten darauf, dieses Arbeitsverständnis in der betrieblichen<br />
Umwelt zu verwirklichen (vgl. Baethge 1990, S. 260ff). Glaubt man Befragungen<br />
von Universitätsabsolventen, so sind die Auswahlkriterien bei der Arbeitgeberwahl<br />
ein gutes Arbeitsklima, klare Karrierechancen und die Identifikation<br />
mit Unternehmen und Produkt. Hohes Gehalt spielt demnach die geringste Rolle<br />
(vgl. Kienbaum, zit. in: Kaufmann 2003).<br />
In der aktuellen Diskussion um das <strong>Intranet</strong> ist das Demokratisierungsversprechen<br />
zu einem Effizienzversprechen ermäßigt. In einer umfassenden Untersuchung<br />
zum <strong>Intranet</strong>, durchgeführt von Claus Hoffmann im Jahre 1999 2 , bezeichnen<br />
Kommunikationsverantwortliche als Zielsetzungen des Mediums vor allem die<br />
Befriedigung der Kommunikationsbedürfnisse der Mitarbeiter und PR nach innen.<br />
Verständnis, Transparenz, Partizipation an Entscheidungen und zwischenmenschliche<br />
Beziehungen erscheinen weniger wichtig.<br />
2 Auf der Basis von Ergebnissen aus Expertengesprächen mit zwölf Entscheidungsträgern befragte<br />
Hoffmann 136 Kommunikationsverantwortliche der umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland<br />
schriftlich zum Einsatz des <strong>Intranet</strong>s als Medium der Mitarbeiterkommunikation.<br />
2
Bedeutung einzelner Ziele der Mitarbeiterkommunikation im <strong>Intranet</strong><br />
Kommunikationsbedürfnisse Mitarbeiter<br />
PR nach innen<br />
Integration der Mitarbeiter<br />
Motivation der Mitarbeiter<br />
Aufgabenerfüllung und Arbeitsleistung<br />
Meinungsbildung der Mitarbeiter<br />
Verständnis, Transparenz<br />
Unternehmenskultur, Betriebsklima<br />
Entwicklung, Qualifizierung der Mitarbeiter<br />
Vertrauensbildung und Sicherheitsgefühl<br />
Partizipation an Entscheidungen<br />
Konfliktmanagement<br />
Zwischenmenschl. Beziehungen Mitarbeiter<br />
(Hoffmann 2001)<br />
Das <strong>Intranet</strong> ist zu einem Tool geworden, das die Leistungsfähigkeit fast aller<br />
Funktionen steigern soll.<br />
Einsatzfelder des <strong>Intranet</strong>s in Organisationen<br />
Verwaltung<br />
Archive<br />
Data-Warehouse<br />
Projektkalkulation<br />
Projektüberwachung<br />
Adress- und Telefonlisten<br />
F & E<br />
CAD-Daten<br />
Entwicklungsbibliotheken<br />
Simultaneous Engineering<br />
(Hoffmann 2001)<br />
Beschaffung<br />
Bestellformulare und<br />
Bestellüberwachung<br />
Lieferanten- und<br />
Produktkataloge<br />
Elektronische Ausschreibungen<br />
Kommunikation<br />
Mitarbeiterkommunikation<br />
PR nach innen<br />
Krisenkommunikation<br />
<strong>Intranet</strong>-<br />
Anwendungen<br />
Produktion<br />
Arbeitsplanung<br />
Lagerverwaltung<br />
Qualitätsmanagement<br />
Fertigungssteuerung<br />
Auftrags- und<br />
Terminverfolgung<br />
4,40<br />
4,19<br />
4,12<br />
4,09<br />
3,99<br />
3,80<br />
3,80<br />
3,71<br />
3,57<br />
3,48<br />
3,13<br />
3,02<br />
2,98<br />
n = 95<br />
1 2 3 4 5<br />
völlig<br />
unwichtig<br />
unwichtig mittel wichtig sehr<br />
wichtig<br />
Personalwesen<br />
Online-Stelleninformation<br />
und -bewerbung<br />
Elektronische Personalakte<br />
Aus- und Weiterbildung<br />
Vorschlagswesen<br />
Arbeitszeitkonten<br />
Marketing &<br />
Vertrieb<br />
Produktinformationen<br />
Online-Store<br />
Schulung<br />
Kundendienst<br />
Software-Updates<br />
Problemmeldung<br />
Fehlerbeseitigung<br />
Wartung und Diagnose<br />
Die wirtschaftlichen Vorteile des <strong>Intranet</strong>-Einsatzes sehen die meisten Kommunikationsverantwortlichen<br />
dabei vor allem in der verringerten Suchzeit, dem<br />
Wissensaustausch, der Prozessoptimierung und dem verringerten Papierverbrauch<br />
(vgl. add-all 2003, S. 26). Argumente wie die Ersparnis an Briefmarken,<br />
3
weniger Geschäftsreisen etc. finden sich in der Literatur immer wieder. Glaubt<br />
man der Rechnung von Netscape, beträgt der Return on Investment für die Informationsbereitstellung<br />
im <strong>Intranet</strong> bis zu 2.063 % (vgl. Netscape, zit. in: Schelian<br />
2003). Im Alltag sind diese Rechnungen jedoch wenig belastbar: Keineswegs<br />
werden Brief, Fax und Telefon durch <strong>Intranet</strong> und E-Mail ersetzt. Sie werden vielmehr<br />
zusätzlich zu den „alten“ Medien eingesetzt, dies zeigt die Entwicklung der<br />
Porto- und Netzkosten.<br />
Die Vorstellung, dass die <strong>neue</strong>n Medien zu mehr Partizipation führen, hat sich als<br />
illusionär erwiesen. Zwar steht den Partizipationswünschen der Mitarbeiter in der<br />
Kommunikation zumindest technisch gesehen nichts mehr im Wege: Laut einer<br />
Studie der add-all AG unterstützten bereits Anfang 2003 rund 43 % der 125 befragten<br />
Unternehmen ihr <strong>Intranet</strong> durch ein Content-Management-System (vgl.<br />
add-all 2003, S. 29). Mit ihm kann theoretisch jeder Mitarbeiter ohne HTML-<br />
Kenntnisse eigene Inhalte in das <strong>Intranet</strong> einstellen. Doch nur in 16 % der Unternehmen<br />
wird dies genutzt. In der Regel werden die Daten zentral von einer Stelle<br />
oder einem Verantwortlichen der Abteilung gepflegt (vgl. add-all 2003, S. 17).<br />
Und auch das Versprechen effizienter Kommunikation hat sich nicht erfüllt.<br />
Die Kommunikationsverantwortlichen in deutschen Unternehmen sehen beim<br />
<strong>Intranet</strong>-Einsatz Probleme in den Bereichen Informationsüberlastung und Informationsholschuld.<br />
Probleme der <strong>Intranet</strong>-Nutzung (Mehrfachnennungen möglich)<br />
(Hoffmann 2001)<br />
Informationsüberlastung<br />
Informationsholschuld<br />
Ausschluss von Mitarbeitern<br />
Bereitschaft der Wissensweitergabe<br />
Strukturierung, Überschaubarkeit,<br />
Auffinden Informationen<br />
Qualifikation der Mitarbeiter,<br />
Medienkompetenz<br />
Technologische Barrieren<br />
Nennungen:<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
57<br />
56<br />
55<br />
60<br />
63<br />
71<br />
71<br />
n = 95<br />
4
Die Medieneigenschaften des <strong>Intranet</strong>s und die sozialen Kontexte<br />
seiner Nutzung<br />
Der Rekurs auf die Medientheorie und Studien zur Mediennutzung verdeutlichen,<br />
was das <strong>Intranet</strong> in der Unternehmenskommunikation leisten kann – und was<br />
nicht.<br />
Der IT-Einsatz senkt oft Produktivität anstatt sie zu steigern. Die Arbeitsmaschine<br />
Computer soll primär Komplexität reduzieren und Vorgänge im Büro beschleunigen.<br />
„Computer heutiger Bauart sind jedoch komplexe Maschinen. Mit der<br />
immer schneller voranschreitenden Technologie explodiert die Komplexität regelmäßig.<br />
[…] Service-, Wartungs- und Beratungskosten steigen steil an“ (Accenture/Horx<br />
2003, S. 18). Hinzu kommt, dass immer mehr Daten ausgewählt, interpretiert<br />
und in Wissen transformiert werden müssen. Die Folge dieses Informations-<br />
Wissens-Paradoxon: „Der wachsende Computereinsatz führt nicht zu Rationalisierungseffekten,<br />
sondern zu massiven Investitionsanforderungen bei teuren Humanressourcen!“<br />
(Accenture/Horx 2003, S. 18).<br />
Die geringe Media Richness der <strong>neue</strong>n Medien schränkt die Möglichkeiten<br />
von Orientierung und Emotionalisierung ein. Im Gegensatz zur Face-to-face-<br />
Kommunikation ist technisch vermittelte Kommunikation (Telefon, Teletext,<br />
Computer) vermittlungsarm. D. h. es fehlen medial verfügbare soziale Hinweise<br />
(„social cues“), die die Kommunikation erleichtern. Die Wahrnehmung des<br />
Kommunikationspartners ist eingeschränkt, der soziale Kontext und der Status<br />
der Personen werden weitgehend ausgeblendet. So fehlen Vertrauenssignale wie<br />
Augenkontakt, Händeschütteln etc. „Cues-filtered-out“-Studien in den 90er Jahren<br />
belegen, dass computervermittelte Kommunikation „depersonalisiert“, stärker<br />
aufgabenorientiert und strukturiert verläuft. Durch die wegfallenden Kontrollmechanismen<br />
können sich Kommunikationsabläufe jedoch auch freier und sozial<br />
unkontrollierter entfalten. Dies birgt allerdings die Gefahr der ungehemmten Mediennutzung<br />
(„Flaming“). Man neigt dazu, auf „böse“ E-Mails viel schneller zu reagieren<br />
als dies in der direkten Kommunikation der Fall wäre (vgl. Hoffmann 2001,<br />
S. 122ff). Für den Einsatz in der internen Kommunikation folgt daraus, dass das<br />
<strong>Intranet</strong> nicht in allen Kommunikationssituationen Vorteile bietet. „Insbesondere<br />
bei Themen mit hoher persönlicher Betroffenheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit oder<br />
Ungewissheit ist die <strong>Intranet</strong>-Kommunikation hinsichtlich des Kommunikationserfolgs<br />
der Face-to-face-Kommunikation meist unterlegen“ (Hoffmann 2001, S. 272f).<br />
Die Entpersonalisierung der Kommunikation reduziert die Kooperationsbereitschaft.<br />
Unternehmen sind keine idealen Kommunikationsgemeinschaften,<br />
daran kann auch das <strong>Intranet</strong> nichts ändern: „Unternehmensmitglieder operieren<br />
als beobachtete Beobachter. Jeder dieser Beobachter agiert im Unternehmen in<br />
einer bestimmten Rolle – soll heißen, es gibt auch noch ein Leben außerhalb des<br />
Unternehmens“ (Schmidt 2003, S. 369). Demnach stimmen Mitarbeiter ihren<br />
Kommunikationspartnern immer nur strategisch im Sinne ihrer Rolle zu. Kommt es<br />
zu Meinungsverschiedenheiten, ist das <strong>Intranet</strong> nicht der ideale Austragungsort,<br />
denn ohne visuellen Kontakt benötigen die Kommunikationsteilnehmer mehr Zeit<br />
5
und erreichen seltener eine Übereinstimmung als in der Face-to-face-Kommunikation<br />
– dies belegt bereits eine Studie zur Audio- und Videokommunikation von<br />
Short/Williams/Christie aus den 70er Jahren (vgl. Hoffmann 2001, S. 133).<br />
Im <strong>Intranet</strong> entstehen <strong>neue</strong> medienspezifische Hierarchie-Signale. Thomas<br />
Mickeleit, ehemaliger Leiter Unternehmenskommunikation von IBM, beschwor<br />
noch 2002 den Geist der hierarchiefreien Kommunikation: „Im letzten Jahr hat das<br />
<strong>Intranet</strong> den Vorgesetzten abgelöst“ (zit. in: Mast 2002, S. 12). In der Tat bestätigen<br />
Mitarbeiterbefragungen, dass das <strong>Intranet</strong> nach dem Kollegen die wichtigste<br />
Informationsquelle geworden ist (vgl. Mast 2002, S. 12). Da sich die Mitarbeiter<br />
alle für sie relevanten Informationen ohne Filterung durch das Management nun<br />
aus dem <strong>Intranet</strong> ziehen können, sind die Vorgesetzten nicht mehr zwangsläufig<br />
Kommunikationsquelle Nr. 1. Laut Mast können sie diesen Ruf nur behalten,<br />
„wenn sie im persönlichen Gespräch überzeugen“ (Mast 2001).<br />
Doch die Kommunikationsverantwortlichen der deutschen Unternehmen sind<br />
skeptisch, ob das <strong>Intranet</strong> den Kontakt zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern<br />
intensiviert hat: Für 68 % der Befragten trifft dies nicht oder nur teilweise zu,<br />
lediglich 24 % meinen, dass sich die Kommunikation verbessert hat. Dies hängt<br />
eng zusammen mit der mangelnden Dialogorientierung des Mediums: Nur 15 %<br />
der befragten Kommunikationsverantwortlichen sind der Ansicht, dass die Prozesse<br />
der Mitarbeiterinformation im <strong>Intranet</strong> dialogorientiert verlaufen. Nur noch<br />
ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass <strong>Intranet</strong>-Kommunikation weniger<br />
durch Hierarchien beeinflusst wird als andere Formen der Mitarbeiterkommunikation<br />
(vgl. Hoffmann 2001, S. 227ff). Das <strong>Intranet</strong> und andere moderne Kommunikationsmittel<br />
wie das Handy erzeugen eine „Illusion der Erreichbarkeit“. Tatsächlich<br />
aber rufen die parallel angewandten Kommunikationsmittel „Strategien des<br />
Verbergens“ hervor. Hierdurch ergeben sich <strong>neue</strong> Hierarchieprobleme und die<br />
Tatsache, dass wir immer mehr Zeit mit sinnlosen Kontaktversuchen verbringen<br />
(vgl. Accenture/Horx 2003, S. 18).<br />
Bei den elektronischen Medien ist die Medienkompetenz zu einem <strong>neue</strong>n sozialen<br />
Selektionsmechanismus geworden. Laut der ARD/ZDF-Online-Studie<br />
2003 nutzt rund die Hälfte der Deutschen das Internet zumindest gelegentlich (vgl.<br />
van Eimeren/Gerhard/Frees 2003, S. 339). Die Medienkompetenz der Mitarbeiter<br />
in Unternehmen ist Spiegelbild einer <strong>neue</strong>n Zweiklassengesellschaft mit dem distinktiven<br />
Merkmal Nutzung der modernen Medien. Viele Unternehmen haben daher<br />
nachhaltig mit „Soft Wiring“-Blockaden, d. h. „Techno-Analphabetismus“ und<br />
allgemeiner Technophobie, zu kämpfen (vgl. Hoffmann 2001, S. 77).<br />
6
Optimale Nutzung des <strong>Intranet</strong>s als Leitmedium der internen Kommunikation<br />
Ausdifferenzierung des Medien-Portfolios und klare Zuweisungen von Funktionalitäten.<br />
Seit Wolfgang Riepl (1913) ist bekannt: Die Evolution <strong>neue</strong>r Medien<br />
führt zu keiner Verdrängung der alten Medien, sondern zu einer funktionalen<br />
Ausdifferenzierung des Mediensystems. Dieses Gesetz bestätigt sich auch beim<br />
Medien-Portfolio von Unternehmen. Bei 55 % der DAX 100 Unternehmen hat das<br />
<strong>Intranet</strong> nur geringe Auswirkungen auf die Printmedien und erfüllt eine eher<br />
ergänzende Funktion (vgl. Mast 2003, S. 19). Vor allem die direkte Kommunikation<br />
kann nicht ersetzt werden: Nach wie vor werden Beziehungen in Unternehmen<br />
primär durch die Face-to-face-Kommunikation geprägt. Je mehr virtuelle Kommunikation<br />
in einem Unternehmen stattfindet, desto größer wird das Bedürfnis der<br />
Mitarbeiter nach personeller Kommunikation.<br />
Kommunikationsmanagement. Das Management muss für eine Balance<br />
zwischen virtueller und persönlicher Kommunikation sorgen (vgl. Mickeleit 2000).<br />
Die geringe Media Richness des <strong>Intranet</strong>s muss durch andere Kommunikationskanäle<br />
kompensiert werden: Medien zur Vermittlung von Hintergrundinformationen<br />
bleiben nach wie vor die Mitarbeiterzeitschrift, Face-to-face-Kommunikation und<br />
schriftliche Mitteilungen.<br />
Modell der Informationsüberflutung und Effektivität: Medienmanagement<br />
Medium<br />
» Face-to-face<br />
» Videokonferenz/Business TV<br />
» Internet/<strong>Intranet</strong><br />
» Telefon/Telefonkonferenz<br />
» Voice Mail<br />
» E-Mail Kolloboration/Chat<br />
» E-Mail<br />
» Brief, Flyer, Broschüre<br />
(Bachmann 2002)<br />
Media Richness<br />
hoch » überkompliziert<br />
» zu viele Kanäle<br />
mittel<br />
niedrig<br />
» nichtssagend<br />
» unpersönlich<br />
niedrig mittel hoch<br />
Komplexität<br />
Mit dem Vermittlungsreichtum eines Mediums hängt auch dessen „soziale<br />
Präsenz“ zusammen, d. h. die Fähigkeit, sozial-psychische Nähe zu vermitteln<br />
(vgl. Höflich 1998, S. 77). Direkte Kommunikation kann nur dann ohne Effizienzverluste<br />
ersetzt werden, wenn die „soziale Präsenz“ des Mediums den kommunikativen<br />
Anforderungen angemessen ist. „Je mehr persönliche Bezüge Aufgabensituationen<br />
fordern oder wenn diese mehrdeutig sind, um so weniger lohnt sich die<br />
Verwendung eines Mediums, zumal eines mit geringer ‚sozialer Präsenz’“ (Höflich<br />
1998, S. 78).<br />
7
Media Richness des <strong>Intranet</strong>s erhöhen. Die Vermittlungsarmut des <strong>Intranet</strong>s<br />
kann durch die Aufbereitung der Inhalte teilweise gemildert werden – damit erweitern<br />
sich die Einsatzmöglichkeiten. Das <strong>Intranet</strong>-Design hat erheblichen Einfluss<br />
auf die Möglichkeiten zu emotionalisieren und zu orientieren. Die Einstellung der<br />
Inhalte in Datenbankstrukturen mit entsprechender technischer Navigation bietet<br />
wenig emotionale Anreize und kaum inhaltliche Orientierung. Die Annäherung an<br />
journalistische Darstellungsformen und der Einsatz von Multimedialität können die<br />
Media Richness dagegen erhöhen. Publikumsmedien wie z. B. Spiegel Online<br />
machen vor, welche Emotionalisierungs- und Orientierungsmöglichkeiten journalistische<br />
Online-Medien bieten.<br />
Media Richness in journalistischen Online-Medien: Spiegel Online<br />
8
Die von JP:PR entwickelte GKN infoline, die <strong>Intranet</strong>-Tageszeitung der EnBW<br />
Kernkraft GmbH Kernkraftwerk Neckarwestheim, ist in Design und Navigation an<br />
hochwertigen Publikumsmedien orientiert. Sie wurde 2001 als bisher einziges<br />
Medium dieser Art mit dem „Goldenen Pfeiler“ der Deutschen Public Relations<br />
Gesellschaft (DPRG) ausgezeichnet.<br />
Preisträger des „Goldenen Pfeilers“: GKN infoline<br />
Kooperationsbereitschaft. Foren und Fachdialoge können die mangelnde<br />
Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter im <strong>Intranet</strong> erhöhen. 45 % der Unternehmen<br />
schlugen bereits 2002 den Weg geschlossener Nutzergruppen ein,<br />
jeweils 14 % der Unternehmen bieten Zugangsberechtigungen für einzelne<br />
Geschäftsbereiche bzw. im Projektmanagement an (vgl. Mast 2002, S. 17).<br />
Medienkompetenz. Soziale Unterschiede im Medienverhalten von Mitarbeitern<br />
können nur eingeschränkt bearbeitet werden. Mögliche Wege Medienkompetenz<br />
aufzubauen sind:<br />
• Exklusivität. Schnelle, wichtige Informationen werden nur über das <strong>Intranet</strong><br />
zugänglich gemacht. Die Mitarbeiter werden so gezwungen, ihre <strong>Intranet</strong>-<br />
Nutzung zu intensivieren.<br />
• Attraktion. Das <strong>Intranet</strong> enthält attraktive Features und Services, z. B.<br />
Kantinenplan, Gewinnspiele.<br />
• Schulungen. Gezieltes Medientraining in Seminaren.<br />
• Subventionierung. Der Arbeitgeber bezuschusst die Heim-PCs und Internetanschlüsse<br />
seiner Mitarbeiter.<br />
9
• Privates Surfen. Effizientes Arbeiten mit Internet und <strong>Intranet</strong> lernen die Mitarbeiter<br />
nur über den täglichen, eigenmotivierten Umgang mit den Medien. Es<br />
ist jedoch immer noch umstritten, ob den Mitarbeitern der freie, unbegrenzte<br />
Zugang zum Internet am Arbeitsplatz auch für private Zwecke gewährt werden<br />
soll. Nur 4 % der Unternehmen sehen dies als selbstverständlich an, bei einem<br />
Viertel dürfen die Mitarbeiter offensichtlich aus Angst vor Produktivitätsverlusten<br />
unter keinen Umständen privat surfen (vgl. Cap Gemini/Ernst & Young<br />
2003, S. 7) 3 .<br />
Die Funktionen des <strong>Intranet</strong>s: Umfassende Arbeitsplattform und Tool des<br />
Issue Managements<br />
In Anschluss an Rommert (2002, S. 101ff) kann das <strong>Intranet</strong> folgende Funktionen<br />
erfüllen:<br />
1. Umfassende Arbeitsplattform – Workplace on demand. Das <strong>Intranet</strong> ermöglicht<br />
weltweit verfügbare elektronische Arbeitsplätze: Sämtliche Informationen,<br />
Arbeitsmittel und Online-Tools, die Mitarbeiter brauchen, um ihre Aufgaben erfolgreich<br />
und effizient erledigen zu können, sind auf jedem Arbeitsplatz-PC und zu<br />
jeder Zeit verfügbar. Hierzu gehören E-Mail, News, Foren, Personalmanagement,<br />
Expertise-Suche, Marktdaten, Zusammenarbeit, CRM, Kostenmanagement,<br />
Fortbildung, Communities, Software-Installation, Reisemanagement, IT-Tools,<br />
Präsentationen u. a..<br />
2. Wirklichkeitskonstruktion managen. Zu den Aufgaben des Managements<br />
gehört es, „für akzeptierte, gemeinsame Interpretationen und Erklärungen einer<br />
widersprüchlichen Wirklichkeit zu sorgen, die als Basis für das produktive Handeln<br />
dienen können“ (Kieser/Woywode 1999, S. 278). Über das <strong>Intranet</strong> erhalten die<br />
Mitarbeiter Anschlüsse an die Wirklichkeitskonstruktionen des Unternehmens, sie<br />
fühlen sich an diesen Prozessen der Wirklichkeitskonstruktion beteiligt (vgl. Rommert<br />
2002, S. 103ff). Sie können abgleichen, ob ihre Interpretation vom Unternehmen<br />
mit der des Managements übereinstimmt.<br />
3. Issue Management. Bisher war das Themenmanagement in der Mitarbeiterkommunikation<br />
themenzentriert. Gefragt wurde primär, welche Themen für das<br />
Mitarbeitermedium geeignet sind, und dann, wie sie aufbereitet werden. Durch die<br />
Erweiterung des Medien-Portfolios hat sich das Redaktionsmanagement verändert:<br />
Am Anfang steht nun das Thema (Issue). Aus einem systematisch gemanagten<br />
Issue-Pool werden die Themen den verschiedenen Medien zugeordnet,<br />
die crossmediale Verknüpfung wird geplant. Erst dann folgt die medienspezifische<br />
Bearbeitung.<br />
3 Von April bis August 2002 wurden 83 Human-Resources-Manager, Vorstände bzw. Geschäftsführer<br />
von deutschen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen befragt.<br />
10
Crossmedia: Redaktionelle Produktionsprozesse<br />
Themenmanagement<br />
Ereignisse und<br />
Nachrichtenlage<br />
Aktive Themenplanung<br />
Redaktionsstrategien<br />
(Mast 2003)<br />
Speicherung<br />
von Zusatzmaterial<br />
Codierung<br />
der Inhalte<br />
Situation der<br />
Rechte<br />
Zielgruppen Ansprechpartner<br />
Content-Pool Auswahl und<br />
Vernetzung<br />
Themenselektion<br />
Medienspezifische<br />
Bearbeitung<br />
Optimierung Anreicherung<br />
Anreicherung Format Wiederverwertung<br />
Nachrecherchen Darstellungsformen<br />
Dokumentation<br />
Archiv<br />
Verlinkung Anmutung Entsorgung:<br />
Was soll<br />
gelöscht<br />
werden?<br />
Gemeinsam mit dem Kunden Cognis hat JP:PR hierfür ein elektronisches Tool<br />
entwickelt, das Issue Management und Redaktionsmanagement verknüpft.<br />
Elektronisches Tool zur Verknüpfung von Issue Management und Redaktionsmanagement<br />
11
4. Veränderungskommunikation. Das <strong>Intranet</strong> kann Strukturentwicklungen<br />
fördern und Prozessmodifikationen unterstützen (vgl. Rommert 2002, S. 110).<br />
Für die Steuerung von Veränderungsprozessen in Unternehmen hat die Unternehmensberatung<br />
Strasser & Strasser ein browsergestütztes IT-Tool („Change-<br />
Portal“) entwickelt, das Projektmanagement, Projektkommunikation, Befragungsinstrument<br />
und Interaktion integriert. Die Implementierung erfolgt innerhalb<br />
von zwei Tagen, Menüstruktur und Design können flexibel an das bestehende<br />
<strong>Intranet</strong> des Unternehmens angepasst werden. Das Tool erfüllt folgende<br />
Funktionen:<br />
• Content-Management- und Redaktionssystem. Tagesaktuelle zielgruppengerechte<br />
Information<br />
• Projektmanagement-Tool. Task- und Projektmanagement zur Planung, Dokumentation<br />
und Kontrolle aller Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse<br />
• Integrierte Umfrage-Software. Einholen von Mitarbeitermeinungen durch beliebig<br />
gestaltbare Stimmungsbarometer und umfassende Mitarbeiterbefragungen,<br />
echtzeitige Auswertung<br />
• Themenspezifische Diskussionsforen. Austausch von Erfahrung und Wissen<br />
sowie Verbreitung von Best Practices<br />
• Suchmaschine. Auffinden und Austauschen problemrelevanter Informationen.<br />
Change-Portal der Stadtsparkasse Oberhausen<br />
12
5. Gestaltung der Beziehungen zwischen Unternehmen und Umwelt.<br />
Die Bezeichnung „firmeninternes Netzwerk“ ist irreführend: Das <strong>Intranet</strong> ist das<br />
ideale Tool für den Umgang mit Informationen, die das Unternehmen aus Interaktionen<br />
mit seiner Umwelt, d. h. Kunden, Wettbewerbern, Lieferanten etc., erzeugt.<br />
Auch unternehmensrelevante Informationen aus Politik und Wirtschaft sowie zu<br />
Markt und Standort sollten einfließen. Dies gibt der Unternehmenstätigkeit Kontext,<br />
generiert Sinn und erhöht in Veränderungsprozessen den Sense of Urgency.<br />
Acht Zukunftstrends im <strong>Intranet</strong><br />
Wie wird sich das <strong>Intranet</strong> weiter entwickeln? Aus heutiger Sicht lassen sich acht<br />
Zukunftstrends ausmachen:<br />
• Hybridstrukturen. Das <strong>Intranet</strong> wird in Zukunft noch stärker als bisher Plattform<br />
für andere Medien werden – z. B. für das Business-TV. Treiber für die<br />
Hybridisierung sind vor allem die sinkenden Speicherkosten für Daten. Nach<br />
dem Moor’schen Gesetz verdoppeln sich jeweils innerhalb von 18 Monaten die<br />
Speicher-Kapazitäten, und damit sinken die Kosten: z. B. lag 1988 der Preis für<br />
die Speicherung von 20 Filmen bei 5.400.000 Euro, 2000 bei 648 Euro; 2005<br />
werden es voraussichtlich nur noch 5 Euro sein (vgl. Mercer Management<br />
Consulting/HypoVereinsbank 2002). Derzeit setzt bereits rund ein Viertel der<br />
DAX100-Unternehmen vorproduzierte Sendungen via <strong>Intranet</strong> ein bzw. überträgt<br />
live Veranstaltungen über <strong>Intranet</strong> und Internet (vgl. Mast 2003, S. 17).<br />
Anders als beim herkömmlichen Business-TV können alle Mitarbeiter einfach<br />
vom Arbeitsplatz auf Sendungen zugreifen, die Kosten sind gering und die<br />
Qualität ist mittlerweile annehmbar. Durch die Integration des Business-TV im<br />
<strong>Intranet</strong> werden mediale Brüche weitestgehend aufgehoben (vgl. Rommert<br />
2002, S. 89): Der Mitarbeiter kann sich durch vorbereitete Links direkt mehr<br />
Wissen zu dem Thema der Sendung erschließen oder im selben Medium<br />
Feedback geben, statt wie bisher zum Telefon greifen zu müssen.<br />
• Vernetzung von Beruf und Privatem. Mit dem Handy hat der Einzug des<br />
Berufslebens ins Private begonnen, mit dem Laptop als mobilem Arbeitsplatz<br />
dringen weitere Funktionalitäten der Office-Welt ins Private ein. Heimarbeitsplätze<br />
sind weiter auf dem Vormarsch, um Mitarbeiter nicht zu verlieren (vor<br />
allem Frauen), aber auch, um zusätzliche Arbeitsleistungen in der Freizeit<br />
einzufordern.<br />
• Neue Web-Darstellungsformen. Eng mit der Hybridisierung der <strong>neue</strong>n Medien<br />
hängt der Trend zum multimedialen und emotionalen Erzählen zusammen –<br />
wie es in den Publikumsmedien geschieht. Was im Online-Journalismus<br />
bereits häufig zu finden ist, wird sich auch in den <strong>Intranet</strong>s der Unternehmen<br />
etablieren (vgl. Heijnk 2002, S. 142ff):<br />
− Integration von Audio- und Videosequenzen<br />
− Animation/Grafimation<br />
− Interaktive Services (personalisierte Anrede, Anwender-Rechner etc.)<br />
− Slideshows<br />
− Hypermedia Patchworks<br />
13
− Web-Specials<br />
− Virtual Reality<br />
− Infoseek-Sites.<br />
• Outsourcing von standardisierbaren Leistungen. JP:PR realisiert seit<br />
mehreren Jahren online-journalistische Leistungen für mehrere seiner Kunden.<br />
Bisher ist Outsourcing in der Kommunikation allerdings der Ausnahmefall: Nur<br />
2 % der von der add-all AG befragten Unternehmen lassen von einer externen<br />
Agentur Inhalte in ihr <strong>Intranet</strong> einstellen (vgl. add-all 2003, S. 17). Doch werden<br />
immer mehr Geschäftsprozesse in deutschen Unternehmen mit Erfolg ausgelagert,<br />
Spezialisten arbeiten oft schneller und preiswerter (vgl. Kuhn 2003,<br />
S. 59f). Der Trend geht dahin, alle Commodities an externe Dienstleister zu<br />
vergeben, nur Management und Steuerung der Zentralfunktionen bleiben im<br />
Unternehmen. Das Unternehmen kann sich auf das Kerngeschäft fokussieren<br />
und die Arbeitsprozesse beschleunigen.<br />
Zusammenarbeit von Kunde und JP:PR bei der Erstellung von<br />
Mitarbeitermedien<br />
Kunde<br />
Agentur<br />
Monitoring, Recherche<br />
(Themenfindung)<br />
»Laufend<br />
Intern<br />
» Management<br />
» Aktivitäten<br />
der Bereiche<br />
» Rubriken<br />
im <strong>Intranet</strong><br />
Unternehmensstrategie<br />
» Unternehmensinterne<br />
Projekte<br />
des Kunden<br />
Extern<br />
» Branchen/Märkte<br />
» Kunden<br />
» Pressebeobachtung<br />
» Sonstiges<br />
Info +<br />
Material<br />
an Agentur<br />
Vorschlag<br />
Thema,<br />
inkl. Aufbereitung,Interviewpartner,<br />
etc.<br />
Redaktionskonferenz,<br />
Themenfindung<br />
» Alle 6-8 Wochen<br />
Auf Basis des<br />
Redaktionsplans:<br />
» Verbindliche<br />
Festlegung<br />
Themen<br />
» Vorl. Festlegung<br />
für übernächste<br />
Ausgabe des<br />
Printmediums<br />
inkl.<br />
» Benennung<br />
Ansprech- und<br />
Interviewpartner<br />
» Festlegung<br />
Berichtsform<br />
Vorschläge<br />
von Agentur<br />
» Verknüpfung<br />
aktueller Themen<br />
mit U-Strategie<br />
» Aktueller Aufhänger<br />
für<br />
U-strategische<br />
Themen/Projekte<br />
<strong>Intranet</strong><br />
Text/Produktion<br />
» Laufend<br />
Kontaktherstellung<br />
Ansprech- und<br />
Interviewpartner<br />
beim Kunden<br />
Aktualisierung<br />
Red.-plan<br />
Entscheidung: Welche<br />
Themen sollen in das<br />
Printmedium, welche<br />
in das <strong>Intranet</strong><br />
Gespräche,<br />
Interviews,<br />
ergänzende<br />
Recherchen<br />
Texten<br />
Freigabe durch<br />
Kommunikationsabteilung<br />
Freigabe d.<br />
Fachverantwortlichen<br />
Satz,<br />
Layout<br />
Parallel: Pflege/Aktualisierung langfristiger Themenpool<br />
Endgültige<br />
Freigabe<br />
durch den<br />
Vorstand<br />
Übergabe<br />
Druckdaten<br />
an Kommunikationsabteilung<br />
14
• Wissensmanagement als Weitergabe von Erfahrungen. Nicht nur die Erzeugung<br />
von Wissen, sondern auch die Frage, wie Wissen über hierarchische<br />
und funktionale Barrieren hinweg gemanagt und verteilt werden kann, gewinnt<br />
zunehmend an Bedeutung. So genannte Wissensmanagement-Datenbanken<br />
helfen, Wissen konzernweit zugänglich zu machen. Allerdings geht es dabei<br />
nicht um die Anhäufung von nicht interpretierten Produktinformationen und ihre<br />
Ablage in Datenbanken, sondern um die Aufbereitung, das Verfügbarmachen<br />
und die Promotion von Erfahrung:<br />
− Mittels strukturierter Interviews („Team Debriefings und Customer Debriefings“)<br />
wird das Wissen gesammelt. So werden unterschiedliche Blickwinkel<br />
erfasst, es entsteht ein komplettes Bild auch über Funktionsgrenzen hinweg<br />
und aus der Kundenperspektive.<br />
− Die Wissens-Bausteine („Knowledge Pieces“) sind als Fallstudien in Form<br />
von Erfahrungsberichten aufbereitet. Sie beantworten die wichtigsten Fragen:<br />
Was war beabsichtigt?, Was haben wir wirklich erreicht?, Was sind die<br />
Gründe für die Zielabweichung?, Was wollen wir beibehalten? und Was<br />
wollen wir ändern?<br />
− Der Aufbau der Datenbank orientiert sich an der Struktur des Geschäftsprozesses.<br />
− Ein eigenes Portal im <strong>Intranet</strong> bewirbt die Leistungen des Wissensmanagements<br />
durch Meldungen, Berichte, journalistische Features und Interviews.<br />
Wettbewerbe und Auszeichnungen incentivieren das Verfügbarmachen<br />
wie auch die Nutzung von Wissen durch die Mitarbeiter.<br />
• Individualisierung. Die Mitarbeiter werden durch „Mitarbeiterportale“ wie<br />
Kunden behandelt, ihnen werden je nach individuellen Bedürfnissen/Interessen<br />
verschiedene Services geboten (vgl. Cap Gemini/Ernst & Young 2003, S. 4).<br />
In einigen Unternehmen können sich die Mitarbeiter bereits ihre <strong>Intranet</strong>-<br />
Eingangsseite gemäß ihrer Bedürfnisse selbst konfigurieren. So erhält jeder<br />
Mitarbeiter auf Anhieb nur die Informationen, die er zu seiner Aufgabenerfüllung<br />
benötigt bzw. die er persönlich wünscht. Die Informationsprozesse<br />
beschleunigen sich. Barrieren bei der Einführung bzw. dem Ausbau von Mit-<br />
arbeiterportalen sind derzeit noch die hohen Kosten und teilweise auch die<br />
befürchtete mangelnde Akzeptanz durch die Mitarbeiter (vgl. Cap Gemini/<br />
Ernst & Young 2003, S. 10).<br />
• Internationalisierung. In der klassischen Matrixstruktur sind Geschäftsbereiche<br />
und Funktionen zu managen. Die Navigation im <strong>Intranet</strong> kann hier bequem<br />
über zwei Listen erfolgen. In internationalen Unternehmen kommt eine dritte<br />
Ebene hinzu: Regionen/Länder. Diese dreidimensionale Struktur lässt sich<br />
durch die Navigation kaum noch abbilden, es besteht die Gefahr von Redundanz<br />
durch mehrfaches Einstellen von Informationen, Informationen sind nur<br />
noch schwer auffindbar.<br />
• Smart Gadgets. Auch in der professionellen Kommunikation sind „Kommunikations-Tools,<br />
deren Gebrauch instinktiv erlernt werden kann und deren<br />
Einfachheit klare Antworten auf die digitale Alltagsverwirrung bietet“ (Accenture/Horx<br />
2003, S. 17), auf dem Vormarsch: Das Handy als Internet-Device und<br />
der Laptop als mobiles Büro mit allen Funktionen sind dabei erst der Anfang.<br />
15
Literaturverzeichnis<br />
Accenture/Horx, Matthias: Accent on the Future. Die Zukunftsstudie von<br />
Accenture und Matthias Horx. Wien 2003<br />
add-all AG: <strong>Intranet</strong> Studie 2003. Eine Studie der add-all AG. Friedrichsdorf 2003<br />
Baethge, Martin: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität – zur zunehmenden<br />
normativen Subjektivierung der Arbeit. In: Zapf, W. (Hrsg.): Die Modernisierung<br />
moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 25. Deutschen Soziologentages<br />
in Frankfurt a. M. 1990, S. 260-278<br />
Bachmann, Bernhard: Von der Mitarbeiterkommunikation zur effektiven Unternehmenskommunikation.<br />
Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren. Präsentation<br />
Frankfurt a. M., 29.10.2002<br />
Bruhn, Manfred: Kommunikationspolitik. Bedeutung, Strategien, Instrumente.<br />
München 1997<br />
Cap Gemini/Ernst & Young: Business-to-Employee-Studie. Neue Möglichkeiten<br />
durch Mitarbeiterportale. Berlin 2003<br />
van Eimeren, Birgit/Gerhard, Heinz/Frees, Beate: ARD/ZDF-Online-Studie 2003.<br />
Internetverbreitung in Deutschland: Unerwartet hoher Zuwachs. In: Media<br />
Perspektiven 8/2003, S. 338-358<br />
Guntrum, L. Nikolaus/Nusch, Friedmar: Hoechst Online Relations – Digitalisierung<br />
der Konzernkommunikation und veränderte interne Kommunikation.<br />
In: Krzeminski, Michael/Zerfaß, Ansgar (Hrsg.): Interaktive Unternehmenskommunikation.<br />
Internet, <strong>Intranet</strong>, Datenbanken, Online-Dienste und Business-TV<br />
als Bausteine erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit. Frankfurt a. M. 1998, S.193-208<br />
Heijnk, Stefan: Texten fürs Web. Grundlagen und Praxiswissen für Online-<br />
Redakteure. Heidelberg 2002<br />
Höflich, Joachim R.: Interaktive Medien und organisationsinterne Kommunikation.<br />
Erkenntnisse und Perspektiven. In: Krzeminski, Michael/Zerfaß, Ansgar (Hrsg.):<br />
Interaktive Unternehmenskommunikation. Internet, <strong>Intranet</strong>, Datenbanken, Online-<br />
Dienste und Business-TV als Bausteine erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Frankfurt a. M. 1998, S. 73-92<br />
Hoffmann, Claus: Das <strong>Intranet</strong>. Ein Medium der Mitarbeiterkommunikation.<br />
Konstanz 2001<br />
Kaufmann, Matthias: Jungmanager. Wird schon werden (2). 2003. Online:<br />
http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,261035-2,00.html.<br />
Abgerufen: 22.09.2003.<br />
Kieser, Alfred/Woywode, Michael: Evolutionstheoretische Ansätze. In: Kieser,<br />
Alfred (Hrsg.): Organisationstheorien. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage.<br />
Stuttgart/Berlin/Köln 1999, S. 253-285<br />
Kuhn, Thomas: Fit machen. In: Wirtschaftswoche Nr. 34. 14.08.2003, S. 59-61<br />
16
Mast, Claudia: Crossmedia in der internen Unternehmenskommunikation. Ergebnisse<br />
der DAX-KOM-Umfragen und Schlussfolgerungen. Stuttgart 2003<br />
Mast, Claudia: Kommunikation in Unternehmen. Siegeszug des <strong>Intranet</strong>. Stuttgart<br />
2002<br />
Mast, Claudia: Die Geister, die sie riefen… 2001. Online: http://www.media.unihohenheim.de/html/projekte/puplikationen/aufsaetze_und_beitraege/<br />
dax_100.html. Abgerufen: 23.03.2004.<br />
Mast, Claudia: Löst das <strong>Intranet</strong> den Chef ab? 2000. Online:<br />
http://www.media.uni-hohenheim.de/html/projekte/puplikationen/<br />
aufsaetze_und_beitraege/loest_das_intranet_den_chef_ab.html.<br />
Abgerufen: 08.03.2004.<br />
Mercer Management Consulting/HypoVereinsbank: Medien-Studie 2006. Entwicklung<br />
der Speicherkosten. 2002. Online: http://www.wuv.de/daten/studien/<br />
022002/490/1507.html. Abgerufen: 28.04.2004.<br />
Mickeleit, Thomas: Face-to-Face in virtualisierten Unternehmen. 2000. Online:<br />
http://www.media.uni-hohenheim.de/html/akademie/wissenstransfer/<br />
face_to_face.html. Abgerufen: 28.04.2004.<br />
Pfannenberg, Jörg: Veränderungskommunikation – Den Change-Prozess<br />
wirkungsvoll unterstützen. Grundlagen, Projekte, Praxisbeispiele.<br />
Frankfurt a. M. 2003<br />
Rommert, Frank-Michael: Hoffnungsträger <strong>Intranet</strong>: Charakteristika und Aufgaben<br />
eines <strong>neue</strong>n Mediums der internen Kommunikation. München 2002<br />
Schelian IT-Beratung: <strong>Intranet</strong> unter der Lupe – Zahlen, Fakten und<br />
statistische Daten 2002. 2002. Online: http://www.schelian.de/<br />
DesktopDefault.aspx?tabid=103. Abgerufen: 07.08.2003.<br />
Schmidt, Siegfried J.: Unternehmenskultur als Grundlage jeder Integration von<br />
Unternehmenskommunikation. In: Bergmann, G./Meurer G. (Hrsg.): Best Patterns<br />
Erfolgsmuster für zukunftsfähiges Management. Neuwied 2003, S. 360-373<br />
Schmidt, Siegfried J.: Kalte Faszination: Medien, Kultur, Wissenschaft in der<br />
Mediengesellschaft. Weilerswist 2000<br />
Anschriften der Autoren:<br />
Jörg Pfannenberg, JP:PR PR-Beratung, Grafenberger Allee 115, 40237 Düsseldorf<br />
Jessica Durst, Apffelstaedtstraße 19, 48149 Münster<br />
17