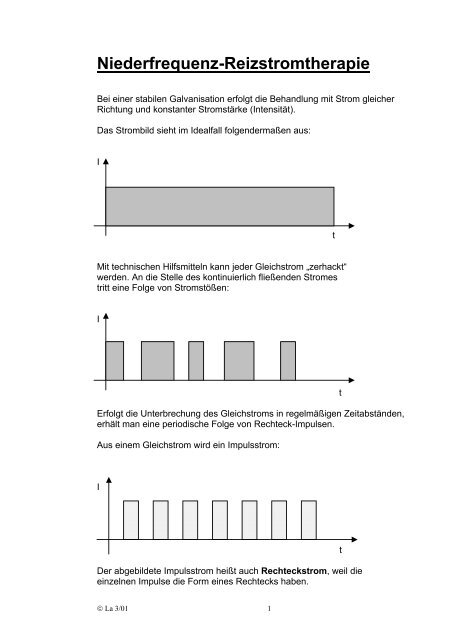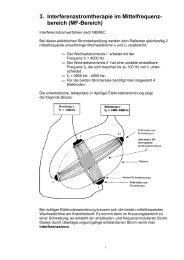Niederfrequenz-Reizstromtherapie
Niederfrequenz-Reizstromtherapie
Niederfrequenz-Reizstromtherapie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Niederfrequenz</strong>-<strong>Reizstromtherapie</strong><br />
Bei einer stabilen Galvanisation erfolgt die Behandlung mit Strom gleicher<br />
Richtung und konstanter Stromstärke (Intensität).<br />
Das Strombild sieht im Idealfall folgendermaßen aus:<br />
I<br />
Mit technischen Hilfsmitteln kann jeder Gleichstrom „zerhackt“<br />
werden. An die Stelle des kontinuierlich fließenden Stromes<br />
tritt eine Folge von Stromstößen:<br />
I<br />
Erfolgt die Unterbrechung des Gleichstroms in regelmäßigen Zeitabständen,<br />
erhält man eine periodische Folge von Rechteck-Impulsen.<br />
Aus einem Gleichstrom wird ein Impulsstrom:<br />
I<br />
Der abgebildete Impulsstrom heißt auch Rechteckstrom, weil die<br />
einzelnen Impulse die Form eines Rechtecks haben.<br />
© La 3/01 1<br />
t<br />
t<br />
t
• Jeder einzelne Impuls ist ein elektrischer Stromstoß, der in<br />
seiner Grundform beliebig verändert werden kann.<br />
Die wichtigsten Impulsformen heißen:<br />
I<br />
I<br />
I<br />
© La 3/01 2<br />
t<br />
t<br />
t<br />
Rechteck-Impuls<br />
mit steilem, sprunghaftem<br />
Anstieg<br />
Dreieck-Impuls<br />
mit linearem Anstieg<br />
Dreieck-Impuls<br />
mit exponetiellem Anstieg<br />
(= Exponential-Impuls)<br />
Definition von Rechteck-, Dreieck- und Exponentialstrom<br />
Die bei einer Strombehandlung erzielte Wirkung auf die Muskulatur hängt unter<br />
anderem von der Frequenz der verabreichten Impulse und der Impulsform ab.<br />
Kommen die Stromstöße mehr als 20mal pro Sekunde, handelt es sich um eine<br />
Impulsserie oder um Serienimpulse.<br />
Entscheidend bei einer Serienimpulsstrombehandlung ist nicht die Grundform<br />
des einzelnen Impulses, sondern die Frequenz der Serienimpulse.<br />
Serienimpulse lösen am gesunden, quergestreiften Muskel<br />
bei genügend hoher Stromstärke eine Dauerkontraktion aus.
Definition:<br />
I<br />
Ein Rechteckstrom ist eine durch Pausen unterbrochene<br />
Serienimpulsfolge. Jeder Impuls der Serie hat eine rechteckige<br />
Grundform.<br />
Rechteckstrom<br />
τ R<br />
Τ<br />
T = Periodendauer in Millisekunden (ms), setzt sich zusammen aus T u. R.<br />
Aus der Periodendauer T kann man die Impulsfolgefrequenz f<br />
berechnen.<br />
Impulsfolgefrequenz f = 1 / T in Hertz (Hz) oder Kilohertz (kHz)<br />
τ = Dauer eines Einzelimpulses (sprich: „tau“; griech. Buchstabe)<br />
R = Pausendauer (R = Refraktärzeit) in Millisekunden (ms)<br />
I = Stromstärke (Intensität) in Milliampere (mA)<br />
Definition:<br />
I<br />
Ein Dreieckstrom ist eine periodische Folge von dreiecksförmigen<br />
Serienimpulsen. Jeder Impuls der Serie hat entweder einen<br />
linearen Anstieg (= Sägezahnform) oder einen verzögerten<br />
Anstieg (= Exponentialform).<br />
Dreieckstrom<br />
© La 3/01 3<br />
t<br />
t
• Bei den bisher besprochenen dreiecks- oder rechtecksförmigen<br />
Stromstößen, die auch unter der Bezeichnung „faradischer Strom“ dem<br />
Patienten verabreicht werden, ist wegen der relativ kurzen Impulszeit die<br />
Form des Impulsanstiegs nicht besonders entscheidend.<br />
• Anders verhält es sich beim Exponentialstrom.<br />
• Bei dieser Strombehandlung steht die Form des Einzelimpulses im<br />
Vordergrund.<br />
Einzelimpulsbehandlung<br />
Definition:<br />
Kennzeichen der Einzelimpulsbehandlung sind Stromstöße von<br />
längerer Dauer und einer so niederen Impulsfolgefrequenz, dass<br />
nach der jeweils ausgelösten Muskelkontraktion eine ausreichende<br />
Entspannungszeit folgt.<br />
Ein Exponentialstrom ist eine durch längere Pausen unterbrochene<br />
Folge dreiecksförmiger Impulse mit verzögertem Anstieg gemäß<br />
einer Exponentialform.<br />
Der einzelne Impuls besitzt eine relativ lange Impulsdauer.<br />
A = Stromstärke (Intensität) in Milliampere (mA)<br />
B = Anstiegssteilheit in Milliampere pro Millisekunden (mA/ms)<br />
C = Impulsdauer in Millisekunden (ms)<br />
D = Pausendauer in Millisekunden (ms)<br />
Universalreizstromgeräte verfügen über Drehknöpfe und Tasten, um die 4<br />
Reizstromkenngrößen (Intensität, Impulsdauer, Impulsform und Pausendauer)<br />
unabhängig voneinander einstellen zu können.<br />
© La 3/01 4
Durch Drehen an den entsprechenden Knöpfen kann der im obigen Beispiel<br />
gezeigte Exponentialstrom mit dreiecksförmigen Impulsen in einen<br />
Exponentialstrom mit trapezförmigen Impulsen umgewandelt werden:<br />
Wirkungen des niederfrequenten Reizstromes (Impulsstromes)<br />
Die wichtigsten therapeutischen Wirkungen des NF-Stromes (NF =<br />
<strong>Niederfrequenz</strong>) sind:<br />
Reizwirkung auf die Muskulatur<br />
Bei genügend hoher Stromstärke, bei bestimmter Impulsdauer und geeigneter<br />
Impulsfolgefrequenz werden Substrate - das sind z.B. Substanzen, die Tröger<br />
bestimmter chemischer, elektrischer Vorgänge sind -, wie Nerven und Muskeln,<br />
gereizt.<br />
Jeder gesunde Muskel antwortet nach überschreiten der Reizschwelle auf<br />
einen Einzelimpuls mit einer einmaligen Zuckung.<br />
Reizt man den gesunden Muskel jedoch mit einer ganzen Serie von rasch<br />
aufeinanderfolgenden Impulsen (Serienimpulse oder Impulsserien), kommt es<br />
zu einer Muskeldauerkontraktion – auch Muskeltetanus - die so lange anhält,<br />
wie der Strom fließt.<br />
Diese tetanisierenden Ströme hießen früher „faradische Ströme“. Unter dem<br />
Oberbegriff „faradischer Strom“ versteht man in der Elektrotherapie alle Serienimpulse,<br />
die aufgrund ihres günstigen Verhältnisses Impulsdauer / Impulsperiodendauer<br />
(= Tastverhältnis τ : T ) am gesunden Muskel eine Kontraktion<br />
herbeiführen.<br />
Analgetische (schmerzstillende) Wirkung<br />
Besonders schmerzlindernd wirken die verschiedenen „diadynamischen“<br />
Stromformen nach BERNARD.<br />
Hyperämisierende (durchblutungsfördernde) Wirkung<br />
Die analgetisch wirksamen Reizströme beeinflussen auch die vasomotorischen,<br />
vegetativen Nervenfasern. Durch diese direkte Reizung kommt es im<br />
Behandlungsgebiet zu einer Vasodilatation (Gefäßerweiterung) und somit zu<br />
einer besseren Durchblutung.<br />
Muskeldetonisierende (entspannende) Wirkung<br />
Reflektorisch verspannte Muskeln lassen sich durch direkte Reizstromeinwirkung<br />
- besonders wenn die Impulsfrequenz zwischen 75 Hz und 200 Hz<br />
liegt - entspannen.<br />
© La 3/01 5
Suggestivwirkungen<br />
Reizstrombehandlungen<br />
Faradisation - Schwellstromtherapie - Elektrogymnastik<br />
Unter Faradisation versteht der Arzt die Anwendung von niederfrequenten<br />
tetanisierenden (faradischen) Reizströmen zu Heilzwecken.<br />
Der dem Patienten verabreichte Strom ist gekennzeichnet durch:<br />
• Intensität = die Stromstärke<br />
• Impulsdauer = die Stromflussdauer des Einzelimpulses<br />
• Impulsform = die Anstiegssteilheit (Anstiegszeit) und<br />
die Abstiegszeit (Abfallzeit) des Einzelimpulses<br />
• Pausendauer = die Zeitdauer zwischen zwei Impulsen<br />
Die Serienimpulse haben eine Frequenz von 40 Hz bis 80 Hz.<br />
Die Impulsdauer reicht von 0,5 ms bis 5 ms.<br />
Oft wird der neofaradische Strom eingesetzt. Seine Kenngrößen<br />
sind:<br />
Frequenz f = 50 Hz<br />
Impulsdauer τ = 1 ms<br />
Pausendauer R = 19 ms<br />
Die Impulsperiodendauer beträgt somit T = 20 ms<br />
(f = 1/T = 50 Hz = 1/20 ms)<br />
I<br />
τ R t<br />
© La 3/01 6<br />
T
I<br />
Vom ungeschwellten Impulsstrom zum Schwellstrom<br />
I<br />
Nachteile des oben abgebildeten „ungeschwellten“ Impulsstromes:<br />
� belästigt sensible Nerven (Schmerzrezeptoren)<br />
� verursacht „unphysiologische“ Dauerkontraktion der Skelettmuskulatur<br />
Um diese „Nachteile“ auszuschalten haben die handelsüblichen <strong>Reizstromtherapie</strong>geräte<br />
entsprechende Bedienungseinheiten, die aus dem ungeschwellten<br />
Reizstrom einen „therapiefreundlichen“ Schwellstrom machen.<br />
� Die Schwellimpulsdauer liegt normalerweise bei 1 s.<br />
� Die Schwellfrequenz kann über einen Regler von 6 - 45 Schwellungen<br />
pro Minute variiert werden.<br />
� Die Schwellstrombehandlung heißt auch Elektrogymnastik.<br />
Behandlungstechnik und Dosierung<br />
Die Reizung des Muskels erfolgt bei der (Neo)-Faradisation und Schwellstrombehandlung<br />
normalerweise nicht direkt an der Muskelfaser.<br />
Der zu behandelnde Muskel wird indirekt über den gesunden, intakten motorischen<br />
Nerv gereizt und zur Kontraktion gebracht.<br />
Der verabreichte Schwellstrom ahmt auf diesem Wege die natürlichen physiologischen<br />
Verhältnisse einer Willkürinnervation des Muskels nach.<br />
Das Anlegen der Elektroden geschieht ähnlich wie bei der Galvanisation. Ein<br />
feuchter Viskoseschwamm oder Stoffunterlagen verhindern den direkten<br />
Kontakt zwischen der Metallelektrode und der Haut!<br />
© La 3/01 7<br />
t<br />
t
Bi- und unipolare Elektrodentechnik<br />
� Bei der bipolaren Elektrodentechnik arbeitet man mit zwei<br />
großflächigen Plattenelektroden. Die Anode (+) wird in der Regel<br />
proximal (nächstliegend), die Kathode (-) distal (entfernt liegend) von der<br />
Muskelgruppe angesetzt.<br />
� Bei der monopolaren (unipolaren) Elektrodentechnik hat man zwei<br />
verschieden große Elektroden:<br />
Die großflächige Elektrode ist, wird proximal befestigt und heißt auch<br />
indifferente Elektrode.<br />
Die kleinere Elektrode wird distal, als aktive, differente Reizelektrode<br />
am Nerven- oder Muskelreizpunkt angesetzt.<br />
Besondere Bedeutung kommt der monopolaren Elektrodentechnik<br />
hauptsächlich bei den verschiedenen Formen der niederfrequenten<br />
Elektrodiagnostik (galvanischer und faradischer Test) zu.<br />
� Bei der Elektrogymnastik wird soviel Stromstärke gegeben, bis die<br />
erwünschten Muskelkontraktionen kräftig auftreten.<br />
� Bei einer Schwellstrombehandlung bevorzugt man für kleine Muskeln<br />
eine hohe Schwellfrequenz, für größere Muskeln wählt man eine niedere<br />
Schwellfrequenz und passt die Pausendauer der Ermüdbarkeit der<br />
Muskeln an.<br />
� Bei schweren Schädigungen werden zwischen den Schwellungen<br />
längere Pausen eingelegt.<br />
� Die Behandlungsdauer pro Sitzung liegt bei etwa 20 Minuten.<br />
� Tägliche Behandlungen sind in der Regel erforderlich.<br />
� Die Behandlungsserie ist zu Ende, wenn das Behandlungsziel erreicht<br />
ist.<br />
Die elektrische Übungsbehandlung kann eine echte, aktive<br />
Übungsbehandlung nur ergänzen, fast niemals aber ersetzen!<br />
Indikationsbeispiele<br />
Die Anwendung von (neo)-faradischen Strömen ist angezeigt bei folgenden<br />
Fällen:<br />
• Behandlung von Inaktivitätsatrophien (Muskelschwund infolge Untätigkeit<br />
oder Nichtbeanspruchung)<br />
• Unterstützung anderer Therapiemaßnahmen, die auf eine Kräftigung geschwächter<br />
Muskulatur hinzielen<br />
• Durchführung von Intentionsübungen (Anspannungsübungen) bei<br />
Gewohnheitsübungen und funktionellen Restlähmungen<br />
• chronische habituelle Obstipation (gewohnheitsmäßige Stuhlverstopfung)<br />
• Atemgymnastik bei Asthma<br />
• Elektrogymnastik der Wadenmuskulatur als vorbeugende Maßnahme<br />
• einer Blutgefäßverstopfung<br />
• Hypalgesie (verminderte Schmerzempfindlichkeit)<br />
• Hypästhesie (verminderte Berührungsempfindlichkeit)<br />
© La 3/01 8
Exponentialstrombehandlung<br />
Eine niederfrequente <strong>Reizstromtherapie</strong> mittels dosierbarer einzelner dreiecksförmiger<br />
Stromimpulse mit verzögertem Anstieg (= Exponentialstrom) und<br />
relativ langer Impulsdauer kommt für folgende Behandlungsfälle in Frage:<br />
a) Total denervierte Muskulatur<br />
Bei total denervierter Muskulatur ist aus irgendwelchen Gründen die Verbindung<br />
zwischen dem motorischen Nerv und seinem Erfolgsorgan, dem<br />
Muskel, ausgeschaltet. Es besteht die Gefahr einer Muskelatrophie<br />
(Muskelschwund). Nach einiger Zeit entarten die Muskelfasern und an die Stelle<br />
von Muskelgewebe tritt Fett und Bindegewebe.<br />
Bestehen echte Chancen, dass die gestörte Nervenbahn wieder eines Tages<br />
voll funktionsfähig wird (Reinnervation des Muskels), lohnt sich der Einsatz von<br />
Exponentialstrom. Die langwierige und zeitintensive elektrische Übungsbehandlung<br />
kann dann die Muskelatrophie wesentlich hinauszögern.<br />
Oszilloskopbild eines Exponentialstromimpulses<br />
Behandlungsweise:<br />
Der Therapieerfolg hängt von der richtigen Wahl folgender Faktoren ab:<br />
Impulsdauer<br />
Bei schwerer Schädigung etwa 400 ms - 800 ms; bei zunehmender<br />
Heilung kurzer, etwa 100 ms - 300 ms; zum Schluss Reizung mit<br />
Neofaradischem Strom oder Schwellstrom.<br />
Pausendauer<br />
Faustregel: etwa 3- bis 5mal länger als Impulsdauer.<br />
Einzelreizungen<br />
Am Anfang etwa 10mal; später 20- bis 30mal und mehr pro Sitzung.<br />
Anzahl der Sitzungen<br />
Täglich oder mindestens 3mal pro Woche bis zum Wiedereintritt der<br />
Reinnervation.<br />
© La 3/01 9
Stromstärke (Intensität)<br />
Der Stromimpuls besitzt eine geringe Steilheit, aber eine relativ hohe Intensität.<br />
Stromstärke steigern, bis kräftige Muskelzuckung auftritt.<br />
Bei schwächer werdenden Muskelkontraktionen während der Übungsbehandlung<br />
die Ermüdungszeichen nicht durch weiteres Steigern der<br />
Stromstärke beseitigen, sondern durch größere Pausen zwischen den<br />
Einzelimpulsen!<br />
b) Glatte Muskulatur<br />
Bei chronisch habitueller Obstipation sowie bei Blasen- und Wehenschwäche<br />
ist unter Umständen ebenfalls eine Reizstrombehandlung mit Exponentialstromimpulsen<br />
sinnvoll.<br />
Die glatte Muskulatur des Darmes, der Blase und der Gebärmutter wird durch<br />
die Bauchdecke hindurch gereizt. Glatte Muskulatur ist ein iteratives Gewebe<br />
(Iteration = Wiederholung). Sie kann daher nicht durch einen Einzelimpuls zur<br />
Kontraktion gebracht werden.<br />
Bei einer elektrischen Übungsbehandlung von glatter Muskulatur verwendet<br />
man Exponentialimpulsfolgen mit einer Frequenz von 1 Hz bis 0,5 Hz.<br />
Die Impulsdauer variiert von 150 ms bis 300 ms.<br />
Bei bestimmten Obstipationsformen beträgt die Behandlungsdauer 30 min. bis<br />
45 min. Die Behandlung erfolgt täglich oder mindestens 3mal wöchentlich.<br />
Die Stromstärke soll subjektiv noch gut erträglich sein.<br />
Zum Einsatz kommen große Plattenelektroden (etwa 200 cm2), die über dem<br />
Colon ascendens (aufsteigender Ast des Grimmdarms) und über dem Colon<br />
descendens (absteigender Teil des Grimmdarms) auf der Bauchdecke<br />
angebracht werden.<br />
Es ist auf eine gute Unterpolsterung zu achten!<br />
© La 3/01 10
I<br />
Diadynamische Strombehandlung<br />
Der haushaltsübliche Wechselstrom aus der Steckdose hat sinusförmiges<br />
Aussehen und besitzt eine Frequenz von 50 Hertz (Hz). Zeichnet man den<br />
Stromverlauf eine Sekunde lang auf, so erhält man 50 positive und 50 negative<br />
Sinushalbwellen.<br />
50 Hz-Wechselstrom<br />
Ein Schwingungsvorgang (eine Periode) setzt sich aus einer positiven und einer<br />
negativen Sinushalbwelle zusammen.<br />
Die Periodendauer T für eine Schwingung ergibt sich aus der Formel.<br />
T = 1 / f = 1 / 50 Hz = 1 Sekunde/ 50 = 20 Millisekunden (ms)<br />
Jede einzelne Sinushalbwelle dauert demnach 10 ms.<br />
Der franz. Zahnarzt BERNARD hat im Jahre 1950 herausgefunden, dass eine<br />
Kombination von Sinushalbwellen und Gleichstrom beim Patienten schmerzlindernde<br />
und durchblutungsfördernde Effekte hervorruft.<br />
Unter der Bezeichnung diadynamische Ströme oder Bernardsche Ströme<br />
werden diese galvano-faradischen Impulsstromfolgen heute in der Praxis<br />
eingesetzt.<br />
Definition:<br />
Eine diadynamische Strombehandlung erfolgt mit einem Bernardschen<br />
Strom, der sich aus 2 Stromanteilen zusammensetzt:<br />
1. ein Gleichstromanteil als Basisstrom (etwa 2 mA)<br />
2. eine gleichgerichtete Sinushalbwelle vom 50 Hz-Wechselstrom<br />
als Impulsstrom.<br />
Die gleichgerichteten Sinushalbwellen von 10 ms Impulsdauer werden<br />
„frequenzmoduliert“ verabreicht. Allgemein versteht man unter der Modulation<br />
eines Stromes die Veränderung seiner Grundform.<br />
© La 3/01 11<br />
T<br />
T<br />
t
Bei der Frequenzmodulation der Bernardschen Ströme wird der verabreichte<br />
Impulsstrom bezüglich der Zahl der Impulse pro Zeiteinheit variiert.<br />
Man erhält dadurch insgesamt folgende 5 diadynamische Ströme nach<br />
Bernard:<br />
1. monophase fixe (MF)<br />
Die Impulsstromkomponente besteht aus einweggleichgerichtetem<br />
50 Hz-Wechselstrom. Die negative Sinushalbwellen fehlen daher.<br />
2. diphase fixe (DF)<br />
Die Impulsstromkomponente besteht aus vollweggleichgerichtetem<br />
50 Hz-Wechselstrom. Die ursprünglich negativen Sinushalbwellen<br />
werden zu positiven Halbwellen geformt und den anderen<br />
Sinushalbwellen hinzugefügt.<br />
© La 3/01 12
3. module en courtes periodes (CP)<br />
Die Stromform CP besteht im Prinzip aus den beiden Stromformen<br />
MF und DF.<br />
Diese beiden Stromformen werden jeweils eine Sekunde lang<br />
abwechselnd geschaltet.<br />
4. module en longue periodes (LP)<br />
Die Stromform LP ist eine Mischung zwischen der Stromform MF und<br />
einer weiteren Form MF, die um eine Phase verschoben an- und<br />
abschwellend dazwischen geschaltet wird.<br />
5. rhytme syncope (RS)<br />
Bei der Stromform RS dauert die Stromform MF ein Sekunde,<br />
danach tritt eine Pause von einer Sekunde ein, bevor die Stromform<br />
MF erneut einsetzt.<br />
© La 3/01 13
Wirkungen und Indikationsbeispiele diadynamischer Ströme<br />
Eine diadynamische Strombehandlung wirkt hauptsächlich<br />
� analgetisch (schmerzlindernd) und<br />
� hyperämisierend (durchblutungssteigernd)<br />
in der behandelten Körperregion.<br />
Stromform Wirkung Indikationsbeispiel<br />
DF schmerzstillend<br />
durchblutungsfördernd<br />
sympathikusdämpfend<br />
MF schmerzstillend<br />
CP schmerzstillend<br />
resorptionsfördernd<br />
muskeldetonisierend<br />
LP schmerzstillend<br />
RS tetanisierend auf<br />
nicht denervierte<br />
Muskeln<br />
© La 3/01 14<br />
- Behandlung von vegetativen<br />
Störungen<br />
- Behandlung von funktionellen und<br />
organischen<br />
Durchblutungsstörungen<br />
- Behandlung von peripheren<br />
sympa-thisch bedingten<br />
Schmerzzuständen, oft<br />
Anfangsbehandlung vor anderen<br />
Stromformen<br />
- Behandlung von spastischen<br />
Schmerz-zuständen<br />
- Folgebehandlung nach einer DF-<br />
Behandlung<br />
- Distorsion (Gelenkverstauchung)<br />
- Kontusion (Quetschung)<br />
- Arthralgien (Gelenkschmerzen)<br />
- Neuralgien (Nervenschmerzen)<br />
- Varizen (Krampfadern)<br />
- Myalgien (Muskelschmerzen)<br />
- Arthralgien (Gelenkschmerzen)<br />
- Neuralgien (Nervenschmerzen)<br />
- Inaktivitätsatrophie (Muskelschwund<br />
auf Grund von Nichtbeanspruchung)<br />
- Elektrogymnastik<br />
Behandlungstechnik und Dosierung diadynamischer Ströme<br />
Voraussetzungen für einen optimalen Heilerfolg bei einer diadynamischen<br />
Strombehandlung sind<br />
1. eine dem Krankheitsbild angepasste Stromform<br />
2. die richtige Wahl der Elektroden und ihre Positionierung<br />
3. die richtige Stromdosierung.
Die Art der Krankheit bestimmt in der Regel den Applikationsort. Daher können<br />
die diadynamischen Ströme auf unterschiedliche Art und Weise verabreicht<br />
werden.<br />
Wichtige Applikationsformen sind beispielsweise:<br />
a) die Schmerzpunkt-Applikation<br />
Hierbei wird direkt am Ort des größten Schmerzes eine kleine Schalenelektrode<br />
aufgesetzt. Manchmal ist es günstig, wenn diese Elektrode negativ gepolt ist.<br />
Die andere Elektrode wird in unmittelbarer Nachbarschaft angelegt.<br />
b) die Nervenstamm-Applikation<br />
Bei bestimmten Nervenerkrankungen werden die beiden Elektroden an<br />
derjenigen Stelle, wo der Nerv oberflächennah verläuft, in Längsrichtung<br />
angelegt.<br />
c) die paravertebrale (neben dem Wirbel liegend) Applikation<br />
Hierbei werden zu beiden Seiten der Wirbelsäule die Elektroden angelegt. Im<br />
Halsbereich arbeitet man mit kleinen Elektrodenschalen, im Lendenbereich<br />
nimmt man große Elektrodenschalen.<br />
d) die vasotrope (auf die Gefäße einwirkende) Applikation<br />
Bei dieser Behandlungsform werden die Elektroden längs der Gefäßstrombahn<br />
angelegt. Es werden damit periphere Durchblutungsstörungen behandelt.<br />
e) Applikation zur Durchführung einer Elektrogymnastik<br />
Die Elektroden werden im betreffenden Muskelbereich so angelegt, dass die<br />
Muskel von einem Strom durchflossen und zur Kontraktion gebracht werden.<br />
Behandlungshinweise:<br />
o Im Normalfall erfolgt die Behandlung täglich.<br />
o Eine Behandlungsserie dauert etwa 6- bis 10mal.<br />
o Zu Beginn der Behandlung wird der galvanische Stromanteil<br />
(= Basisstrom) sensibel unterschwellig auf 1 - 2 mA eingestellt.<br />
Danach wird langsam - etwa 20 bis 40 Sekunden lang - die<br />
Intensität des diadynamischen Stromanteils soweit erhöht, bis der<br />
Patient angibt, dass er den Strom nach anfänglichem Kribbeln als<br />
deutliches Prickeln empfindet. Bei auftretender Gewöhnung kann<br />
der Strom etwas nachgeregelt werden.<br />
o Eine optimale Behandlung dauert mit einer Stromart etwa 3 – 6<br />
Minuten.<br />
© La 3/01 15
Prinzipieller Aufbau eines NF- Reizstrom-<br />
Therapiegerätes<br />
Es gibt einfache Geräte mit großer Bedienungsvereinfachung, die nur eine<br />
Behandlung mit konstantem Gleichstrom (Galvanisation) und faradischem<br />
Strom (Faradisation) ermöglichen.<br />
Daneben sind aber auch Reizstromgeräte auf dem Markt, die universell fur<br />
diagnostische und elektrotherapeutische Zwecke einsetzbar sind. Diese<br />
größeren Reizstromgeräte ermöglichen beispielsweise die Aufnahme von<br />
Reizstärke-Reizzeit-Charakteristiken (I/t-Kurven).<br />
Man ermittelt auf einfache Weise damit die Rheobase (= geringste Stromstörke,<br />
die eben noch eine Muskelzuckung hervorruft) und die Chronaxie (= Zeit,<br />
innerhalb der ein elektrischer Strom mit doppelter Rheobasenstromstärke auf<br />
einen Muskel einwirken muss, um ihn zur Kontraktion zu bringen).<br />
Das Reizstromgerät eignet sich somit zur Beurteilung von Entartungsgrad eines<br />
schlaffen Muskels und zur Beurteilung des Heilungsverlaufs schlaffer<br />
Lähmungen.<br />
Zur elektrischen Übungsbehandlung liefern universell einsetzbare NF-<br />
Reizstromgeräte die wichtigsten Stromformen, wie zum Beispiel Gleichstrom,<br />
faradischer und neofaradischer Strom, Exponentialstromimpulse,<br />
diadynamische Ströme nach Bernard usw.<br />
Jedes Reizstromgerät besteht aus dem Geräteteil und verschiedenen<br />
Applikationselektroden als Zubehör.<br />
Das Geräteteil enthält die Stromversorgung, das Netzteil, Impulserzeuger,<br />
Impulsformer, Schwellstromerzeuger, den Endverstärker und eine Vielzahl von<br />
Drucktasten und Reglern zum Einstellen von Impulszeiten, Impulsfrequenzen,<br />
Stromstärke, Schwellfrequenzen usw .<br />
Es gibt auch kleinere Elektrotherapiegeräte, die aufgrund moderner<br />
elektronischer Bauelemente fast alle Stromformen liefern können.<br />
© La 3/01 16
Allgemeine Hinweise und Behandlungsregeln für das<br />
Arbeiten mit Gleichstrom und mit niederfrequentem<br />
Impulsstrom<br />
⇒ Vor Beginn der Behandlung muss der Stromstärkeregler<br />
(Intensitätsregler) auf NULL stehen!<br />
⇒ Zum Schluss der Behandlung die Elektroden erst abnehmen,<br />
wenn kein Strom mehr fließt!<br />
⇒ Grundsätzlich die Elektroden so befestigen, dass sie während<br />
der Behandlung nicht vom Patienten abfallen oder sonst wie<br />
entfernt werden.<br />
⇒ Die Patienten dürfen die elektrische Behandlung unter keinen<br />
Umständen als unangenehm empfinden!<br />
⇒ Es darf daher während der elektrischen Übungsbehandlung<br />
nicht zu Schmerzen, Brennen und anderen Missempfindungen<br />
kommen!<br />
⇒ Der Behandler sollte in Sicht- und Rufweite des Patienten<br />
bleiben. Nur so können Strombelästigungen beim<br />
Behandelnden vermieden werden.<br />
⇒ Bei einer längeren Behandlungsdauer muss auf eine<br />
vernünftige physiologisch korrekte Lagerung des Patienten<br />
geachtet werden. Vernachlässigt man diesen Gesichtspunkt,<br />
können Patienten, die beispielsweise einen Bandscheibenschaden<br />
haben, durch eine schlechte Lagerung mehr Schaden<br />
als Nutzen von der Behandlung haben.<br />
⇒ Vor dem Anlegen der Elektroden wird die Beschaffenheit der<br />
Haut überprüft!<br />
⇒ Auf Hautwunden und Schrunden dürfen die Elektroden nicht<br />
aufgelegt werden!<br />
⇒ Beim Einstecken der Elektrodenkabel auch auf die vorgeschriebene<br />
Polung achten. Im Normalfall gilt: rot = Anode und<br />
blau = Kathode<br />
⇒ Behandlungszeit an einer Behandlungsuhr einstellen!<br />
⇒ Elektroden mit feuchtem Schwamm unterpolstern! Darauf<br />
achten, dass auch während der Behandlung bei Bewegungen<br />
des Patienten an keiner Stelle ein direkter Kontakt zwischen<br />
blankem Elektrodenblech und der Haut des Patienten zustande<br />
kommen kann!<br />
⇒ Die elektrische Behandlung ist kontraindiziert bei<br />
Schwangerschaft sowie bei hochentzündlichen, akuten oder<br />
fieberhaften Erkrankungen.<br />
⇒ Auch Patienten, die einen Herzschrittmacher tragen oder zu<br />
Blutungen neigen, sollen nicht elektrotherapeutisch behandelt<br />
werden.<br />
© La 3/01 17