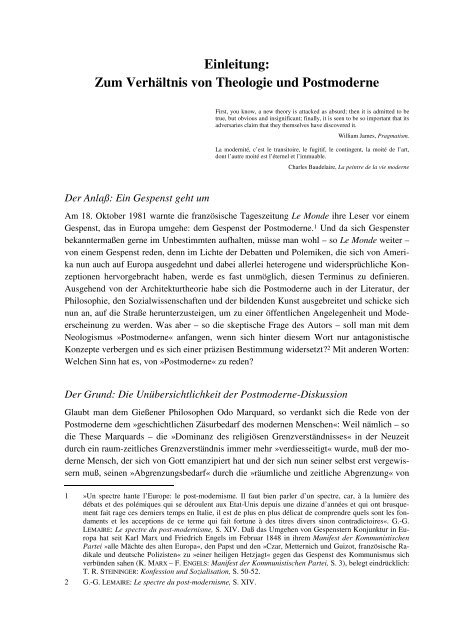Einleitung: Zum Verhältnis von Theologie und ... - Schnell-heisch.de
Einleitung: Zum Verhältnis von Theologie und ... - Schnell-heisch.de
Einleitung: Zum Verhältnis von Theologie und ... - Schnell-heisch.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Einleitung</strong>:<br />
<strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne<br />
First, you know, a new theory is attacked as absurd; then it is admitted to be<br />
true, but obvious and insignificant; finally, it is seen to be so important that its<br />
adversaries claim that they themselves have discovered it.<br />
William James, Pragmatism.<br />
La mo<strong>de</strong>rnité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moité <strong>de</strong> l’art,<br />
dont l’autre moité est l’éternel et l’immuable.<br />
Charles Bau<strong>de</strong>laire, La peintre <strong>de</strong> la vie mo<strong>de</strong>rne<br />
Der Anlaß: Ein Gespenst geht um<br />
Am 18. Oktober 1981 warnte die französische Tageszeitung Le Mon<strong>de</strong> ihre Leser vor einem<br />
Gespenst, das in Europa umgehe: <strong>de</strong>m Gespenst <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne. 1 Und da sich Gespenster<br />
bekanntermaßen gerne im Unbestimmten aufhalten, müsse man wohl – so Le Mon<strong>de</strong> weiter –<br />
<strong>von</strong> einem Gespenst re<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn im Lichte <strong>de</strong>r Debatten <strong>und</strong> Polemiken, die sich <strong>von</strong> Amerika<br />
nun auch auf Europa ausge<strong>de</strong>hnt <strong>und</strong> dabei allerlei heterogene <strong>und</strong> wi<strong>de</strong>rsprüchliche Konzeptionen<br />
hervorgebracht haben, wer<strong>de</strong> es fast unmöglich, diesen Terminus zu <strong>de</strong>finieren.<br />
Ausgehend <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Architekturtheorie habe sich die Postmo<strong>de</strong>rne auch in <strong>de</strong>r Literatur, <strong>de</strong>r<br />
Philosophie, <strong>de</strong>n Sozialwissenschaften <strong>und</strong> <strong>de</strong>r bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kunst ausgebreitet <strong>und</strong> schicke sich<br />
nun an, auf die Straße herunterzusteigen, um zu einer öffentlichen Angelegenheit <strong>und</strong> Mo<strong>de</strong>erscheinung<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Was aber – so die skeptische Frage <strong>de</strong>s Autors – soll man mit <strong>de</strong>m<br />
Neologismus »Postmo<strong>de</strong>rne« anfangen, wenn sich hinter diesem Wort nur antagonistische<br />
Konzepte verbergen <strong>und</strong> es sich einer präzisen Bestimmung wi<strong>de</strong>rsetzt? 2 Mit an<strong>de</strong>ren Worten:<br />
Welchen Sinn hat es, <strong>von</strong> »Postmo<strong>de</strong>rne« zu re<strong>de</strong>n?<br />
Der Gr<strong>und</strong>: Die Unübersichtlichkeit <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
Glaubt man <strong>de</strong>m Gießener Philosophen Odo Marquard, so verdankt sich die Re<strong>de</strong> <strong>von</strong> <strong>de</strong>r<br />
Postmo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>m »geschichtlichen Zäsurbedarf <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnen Menschen«: Weil nämlich – so<br />
die These Marquards – die »Dominanz <strong>de</strong>s religiösen Grenzverständnisses« in <strong>de</strong>r Neuzeit<br />
durch ein raum-zeitliches Grenzverständnis immer mehr »verdiesseitigt« wur<strong>de</strong>, muß <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rne<br />
Mensch, <strong>de</strong>r sich <strong>von</strong> Gott emanzipiert hat <strong>und</strong> <strong>de</strong>r sich nun seiner selbst erst vergewissern<br />
muß, seinen »Abgrenzungsbedarf« durch die »räumliche <strong>und</strong> zeitliche Abgrenzung« <strong>von</strong><br />
1 »Un spectre hante l’Europe: le post-mo<strong>de</strong>rnisme. Il faut bien parler d’un spectre, car, à la lumière <strong>de</strong>s<br />
débats et <strong>de</strong>s polémiques qui se déroulent aux Etat-Unis <strong>de</strong>puis une dizaine d’années et qui ont brusquement<br />
fait rage ces <strong>de</strong>rniers temps en Italie, il est <strong>de</strong> plus en plus délicat <strong>de</strong> comprendre quels sont les fondaments<br />
et les acceptions <strong>de</strong> ce terme qui fait fortune à <strong>de</strong>s titres divers sinon contradictoires«. G.-G.<br />
LEMAIRE: Le spectre du post-mo<strong>de</strong>rnisme, S. XIV. Daß das Umgehen <strong>von</strong> Gespenstern Konjunktur in Europa<br />
hat seit Karl Marx <strong>und</strong> Friedrich Engels im Februar 1848 in ihrem Manifest <strong>de</strong>r Kommunistischen<br />
Partei »alle Mächte <strong>de</strong>s alten Europa«, <strong>de</strong>n Papst <strong>und</strong> <strong>de</strong>n »Czar, Metternich <strong>und</strong> Guizot, französische Radikale<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>utsche Polizisten« zu »einer heiligen Hetzjagt« gegen das Gespenst <strong>de</strong>s Kommunismus sich<br />
verbün<strong>de</strong>n sahen (K. MARX – F. ENGELS: Manifest <strong>de</strong>r Kommunistischen Partei, S. 3), belegt eindrücklich:<br />
T. R. STEININGER: Konfession <strong>und</strong> Sozialisation, S. 50-52.<br />
2 G.-G. LEMAIRE: Le spectre du post-mo<strong>de</strong>rnisme, S. XIV.
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 2<br />
an<strong>de</strong>ren Menschen <strong>de</strong>cken. 3 Im »räumlichen Ent<strong>de</strong>ckungs<strong>de</strong>nken« fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rne Mensch<br />
<strong>de</strong>n »konkreten Raum <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> als Chance für Län<strong>de</strong>r- <strong>und</strong> Einflußbereichsgrenzen« <strong>und</strong> im<br />
»zeitlichen Entwicklungs<strong>de</strong>nken« erfährt er die »konkrete Zeit als Chance für Temporalgrenzen<br />
d. h. Epochenschwellen«. 4 Doch weil die Raumgrenzen durch die Globalisierungsten<strong>de</strong>nzen<br />
mehr <strong>und</strong> mehr relativiert wor<strong>de</strong>n sind, gewinnen die »historischen Zäsuren« <strong>und</strong> Zäsurverschiebungen<br />
zunehmend an Be<strong>de</strong>utung. In <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong> <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne kündigt sich eine<br />
solche Zäsurverlagerung an: <strong>von</strong> <strong>de</strong>r »Mittelalter-Neuzeit-Zäsur« hin zur »Neuzeit-Nachneuzeit-Zäsur«.<br />
5<br />
Aber – so Marquard weiter – unsere Zeit hat nicht nur einen, son<strong>de</strong>rn viele Namen: »Sie<br />
gilt als ›Industriezeitalter‹ o<strong>de</strong>r ›Spätkapitalismus‹ o<strong>de</strong>r ›Zeitalter <strong>de</strong>r wissenschaftlich-technischen<br />
Zivilisation‹ o<strong>de</strong>r ›Atomzeitalter‹; sie gilt als Zeitalter <strong>de</strong>r ›Arbeitsgesellschaft‹ o<strong>de</strong>r<br />
›Freizeitgesellschaft‹ o<strong>de</strong>r ›Informationsgesellschaft‹; sie gilt als Zeitalter <strong>de</strong>r ›funktionalen<br />
Differenzierung‹ o<strong>de</strong>r ›Epoche <strong>de</strong>r Epochisierung‹ o<strong>de</strong>r ›postkonventionelles Zeitalter‹ o<strong>de</strong>r<br />
einfach als ›Mo<strong>de</strong>rne‹ o<strong>de</strong>r auch schon als ›Postmo<strong>de</strong>rne‹ <strong>und</strong> so fort. Diese Vielnamigkeit ist<br />
indirekte Anonymität: unsere Zeit <strong>und</strong> Welt befin<strong>de</strong>t sich – scheint es – auch <strong>de</strong>swegen in<br />
einer Orientierungskrise, weil sie zunehmend nicht mehr weiß, mit welcher dieser Kennzeichnungen<br />
sie sich i<strong>de</strong>ntifizieren muß«. 6 Jürgen Habermas bezeichnet darum – im Unterschied zu<br />
einer sich ihrer selbst gewissen Mo<strong>de</strong>rne – die gegenwärtige Situation als »neue Unübersichtlichkeit«<br />
7 <strong>und</strong> trifft damit sicher das Gefühl vieler Zeitgenossen. Wie aber läßt sich nun in all<br />
dieser Unübersichtlichkeit eine Übersicht gewinnen?<br />
Einiges spricht für <strong>de</strong>n Begriff Postmo<strong>de</strong>rne, nicht nur weil er <strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Zeitanalytikern<br />
am meisten diskutierte Begriff ist, son<strong>de</strong>rn vor allem, weil sich unter »Postmo<strong>de</strong>rne« viele <strong>de</strong>r<br />
partikularen Gegenwartsbezeichnungen subsumieren lassen. 8 Doch das Problem mit diesem<br />
»Zeitzeichenwort« 9 besteht darin, daß gera<strong>de</strong> dadurch, daß »Postmo<strong>de</strong>rne« als Sammelbecken<br />
für verschie<strong>de</strong>ne, teilweise auch sich gegenseitig ausschließen<strong>de</strong>n Programme fungiert, eine<br />
exakte Definition mit <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n Anlagerung <strong>und</strong> Überlagerung heterogener Konzepte<br />
immer schwieriger wird: »Postmo<strong>de</strong>rne« wird zu einem »Passepartoutbegriff«, in <strong>de</strong>n sich<br />
Beliebiges einordnen läßt. 10 Der Bamberger Philosoph Wolfgang Welsch spricht darum auch<br />
<strong>von</strong> einem »diffusen Postmo<strong>de</strong>rnismus«: »Das Credo dieses diffusen Postmo<strong>de</strong>rnismus<br />
scheint zu sein, daß alles, was <strong>de</strong>n Standards <strong>von</strong> Rationalität nicht genügt o<strong>de</strong>r Bekanntes<br />
allenfalls verdreht wie<strong>de</strong>rgibt, damit auch schon gut, ja gar gelungen sei, daß man <strong>de</strong>n Cock-<br />
3 O. MARQUARD: Temporale Positionalität, S. 343, 345. Drastischer formuliert Peter Sloterdijk die Konsequenzen<br />
<strong>de</strong>r Verdiesseitigung in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Kultur: »Eine neuheidnische Kultur, die an ein Leben<br />
nach <strong>de</strong>m Tod nicht glaubt, muß es darum vor diesem suchen«. P. SLOTERDIJK: Kritik <strong>de</strong>r zynischen Vernunft,<br />
S. 10.<br />
4 O. MARQUARD: Temporale Positionalität, S. 345.<br />
5 A.a.O., S. 348.<br />
6 O. MARQUARD: Apologie <strong>de</strong>s Zufälligen, S. 76.<br />
7 J. HABERMAS: Die Krise <strong>de</strong>s Wohlfahrtsstaates <strong>und</strong> die Erschöpfung utopischer Energien, S. 147.<br />
8 Nach Hermann Kurzke mag das Wort Postmo<strong>de</strong>rne unglücklich gewählt sein, doch es hat »<strong>de</strong>n entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Platzvorteil, daß es schon da ist. Eine neuzubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Vokabel, die <strong>de</strong>n Geist unserer Zeit treffend<br />
markieren könnte, müßte dagegen erst durchgesetzt wer<strong>de</strong>n«. H. KURZKE: Die Postmo<strong>de</strong>rne frißt ihre Revolution,<br />
S. 30.<br />
9 T. RENDTORFF: Religion in <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne, S. 311.<br />
10 Vgl. U. ECO: Nachschrift zum »Namen <strong>de</strong>r Rose«, S. 77.
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 3<br />
tail nur or<strong>de</strong>ntlich mixen <strong>und</strong> mit reichlich Exotischem versetzen müsse. Man kreuze Libido<br />
mit Ökonomie, Digitalität <strong>und</strong> Kynismus, vergesse Esoterik <strong>und</strong> Simulation nicht <strong>und</strong> gebe<br />
auch noch etwas New Age <strong>und</strong> Apokalypse hinzu – schon ist <strong>de</strong>r postmo<strong>de</strong>rne Hit fertig. Solcher<br />
Postmo<strong>de</strong>rnismus <strong>de</strong>r Beliebigkeit, <strong>de</strong>s Potpourri <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Abweichung um je<strong>de</strong>n (eigentlich<br />
um keinen) Preis erfreut sich gegenwärtig großer Beliebtheit <strong>und</strong> Verbreitung«. 11<br />
Die Proklamation <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne hat daher auch zahlreiche Kritiker auf <strong>de</strong>n Plan gerufen,<br />
die die Re<strong>de</strong> vom Anbruch einer »Post-Mo<strong>de</strong>rne« aus verschie<strong>de</strong>nen Grün<strong>de</strong>n für verfehlt<br />
halten. Der prominenteste Kritiker <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne, Jürgen Habermas, hält die Postmo<strong>de</strong>rne<br />
für ein neokonservatives <strong>und</strong> antimo<strong>de</strong>rnes Projekt <strong>und</strong> die Re<strong>de</strong> <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne darum<br />
für unbegrün<strong>de</strong>t, weil sich die postmo<strong>de</strong>rne Rationalitätskritik in Selbstwi<strong>de</strong>rsprüche verstrickt,<br />
wenn sie meint, die Vernunft durch Argumente liquidieren zu können: ihr Dilemma<br />
ist, daß sie <strong>de</strong>n Ast, auf <strong>de</strong>m sie sitzt, abzusägen beabsichtigt. 12 Für <strong>de</strong>n Literaturwissenschaftler<br />
Dieter Borchmeyer macht die Ausrufung <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>swegen keinen Sinn, weil<br />
sich »die meisten vermeintlich essentiellen Distinktiva« <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne alle schon in <strong>de</strong>r<br />
literarischen Mo<strong>de</strong>rne dieses Jahrh<strong>und</strong>erts nachweisen lassen. 13 Und <strong>de</strong>m Kulturwissenschaftler<br />
Richard Münch zufolge kann nur <strong>de</strong>rjenige vom »En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne <strong>und</strong> <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne«<br />
re<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n »Sinn <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne nicht begriffen hat«, daß nämlich je<strong>de</strong> Verän<strong>de</strong>rung<br />
»nur eine neue Konkretisierung <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne« ist <strong>und</strong> damit je<strong>de</strong> Theorie <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne<br />
<strong>de</strong>m Innovationsprinzip <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne verhaftet bleibt. 14 Der unaufmerksame Zeitgenosse<br />
– so <strong>de</strong>r Bayreuther Politologe Michael Zöller – mag das Wort »Postmo<strong>de</strong>rne« für eine<br />
»Werbei<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s Postministers« halten, doch dieses Wort zeigt an, »daß ein neues Zeitalter<br />
angesagt ist: die Postmo<strong>de</strong>rne«. 15 Zöller zeigt sich jedoch skeptisch hinsichtlich <strong>de</strong>s<br />
Gebrauchswertes <strong>von</strong> »Postmo<strong>de</strong>rne«, weil die Vorsilbe »das Neue« nur dadurch zu beschreiben<br />
weiß, daß es nicht mehr »das Alte« sei. 16<br />
Es ist das Verdienst Wolfgang Welschs, daß er mit seinem 1987 erschienenen Buch Unsere<br />
postmo<strong>de</strong>rne Mo<strong>de</strong>rne, das mittlerweile zu einem Standardwerk für die Postmo<strong>de</strong>rne-<br />
Diskussion im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum gewor<strong>de</strong>n ist, <strong>de</strong>n Versuch unternommen hat, einerseits<br />
<strong>de</strong>n feuilletonistischen <strong>und</strong> diffusen Postmo<strong>de</strong>rnismus in einen veritablen, präzisen <strong>und</strong><br />
effizienten Postmo<strong>de</strong>rnismus zu überführen <strong>und</strong> an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>r gegen das postmo<strong>de</strong>rne Projekt<br />
gerichteten Kritik die Gr<strong>und</strong>lage zu entziehen. Dies ist ihm in wesentlichen Punkten auch<br />
gelungen. Gleichwohl hat auch er – trotz brillanter Rhetorik – we<strong>de</strong>r diejenigen Stimmen, die<br />
die Postmo<strong>de</strong>rne nicht durch »radikale Pluralität« son<strong>de</strong>rn durch »Ganzheitlichkeit« charakterisiert<br />
sehen wollen, noch diejenigen, die die Postmo<strong>de</strong>rne nicht als »exoterische Alltagsform<br />
<strong>de</strong>r einst esoterischen Mo<strong>de</strong>rne«, son<strong>de</strong>rn durchaus als eine neue Epoche verstehen wollen,<br />
zum Verstummen bringen können. 17 Dennoch bleiben Welschs Systematisierungs- <strong>und</strong> Klä-<br />
11 W. WELSCH: Unsere postmo<strong>de</strong>rne Mo<strong>de</strong>rne, S. 2.<br />
12 J. HABERMAS: Zwischen Heine <strong>und</strong> Hei<strong>de</strong>gger, S. 124; J. HABERMAS: Die Krise <strong>de</strong>s Wohlfahrtsstaates <strong>und</strong><br />
die Erschöpfung utopischer Energien, S. 145; J. HABERMAS: Die Mo<strong>de</strong>rne – ein unvollen<strong>de</strong>tes Projekt,<br />
S. 444, 464.<br />
13 D. BORCHMEYER: Postmo<strong>de</strong>rne, S. 312.<br />
14 R. MÜNCH: Die Kultur <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne, S. 855.<br />
15 M. ZÖLLER: Die Gnosis <strong>de</strong>r Yuppies, S. 27.<br />
16 Ebd.<br />
17 W. WELSCH: Unsere postmo<strong>de</strong>rne Mo<strong>de</strong>rne, S. 4, 202.
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 4<br />
rungsversuche auf <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Gebieten <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion – nicht zuletzt<br />
auch die <strong>von</strong> ihm formulierten Implikationen für das religiöse Denken 18 – wegweisend.<br />
So haben dann auch Theologen im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum die <strong>von</strong> Welsch formulierte<br />
Frage, ob die »Verabschiedung <strong>de</strong>s Einen« <strong>und</strong> »<strong>de</strong>r Übergang zu radikaler Vielheit, in <strong>de</strong>r das<br />
Eine nur eines neben An<strong>de</strong>ren ist, theologisch fruchtbar, ja überhaupt mitgemacht wer<strong>de</strong>n«<br />
kann, 19 als Herausfor<strong>de</strong>rung für die <strong>Theologie</strong> aufgenommen. Doch beschäftigen sich Theologen<br />
nicht erst seit <strong>de</strong>m Bekanntwer<strong>de</strong>n <strong>von</strong> Welschs Publikationen mit <strong>de</strong>m Thema Postmo<strong>de</strong>rne:<br />
In <strong>de</strong>n USA sind seit Anfang <strong>de</strong>r achtziger Jahre neben zahlreichen Zeitschriftenbeiträgen<br />
auch etliche Monographien erschienen, die sich <strong>de</strong>zidiert mit <strong>de</strong>m Thema Postmo<strong>de</strong>rne<br />
auseinan<strong>de</strong>rsetzen. 20 Allerdings erhält die theologische Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion in Amerika<br />
ihre wesentlichen Impulse nicht <strong>von</strong> <strong>de</strong>r <strong>von</strong> Lyotard <strong>und</strong> Welsch initiierten Pluralismus-<br />
Diskussion, son<strong>de</strong>rn entwe<strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>n sprachphilosophischen Theorien <strong>de</strong>s Poststrukturalismus<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Dekonstruktion o<strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Holismustheorien philosophischer o<strong>de</strong>r physikalischer<br />
Provenienz. Somit ist die theologische Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion insgesamt ebenfalls<br />
durch eine Vielzahl unterschiedlicher Programme, Konzeptionen, Positionen <strong>und</strong> Entwürfe<br />
gekennzeichnet, die auf je unterschiedliche Weise auf die Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r allgemeinen<br />
Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion zu antworten versuchen.<br />
Das Motiv: Eine kritische Analyse <strong>de</strong>r theologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
Das Anliegen dieser Arbeit besteht nun aber we<strong>de</strong>r darin, <strong>de</strong>n zahlreichen Postmo<strong>de</strong>rne-<br />
Theorien eine weitere hinzuzufügen, noch darin, eine Apologie <strong>de</strong>s Begriffs »Postmo<strong>de</strong>rne«<br />
zu betreiben, son<strong>de</strong>rn darin, die vorhan<strong>de</strong>ne Unübersichtlichkeit <strong>de</strong>r theologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
zu strukturieren <strong>und</strong> die einzelnen theologischen Programme einer kritischen<br />
Analyse zu unterziehen, um dann auch weiterführen<strong>de</strong> Perspektiven für die <strong>Theologie</strong><br />
aufzeigen zu können. Weil die Beiträge zur theologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion jedoch<br />
zumeist <strong>von</strong> <strong>de</strong>n ästhetischen, sprachwissenschaftlichen, philosophischen, <strong>und</strong> soziologischen<br />
Postmo<strong>de</strong>rne-Konzeptionen unmittelbar abhängen, ist eine angemessene Bewertung <strong>de</strong>r theologischen<br />
Programme ohne eine eingehen<strong>de</strong> Analyse <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
Bereichen <strong>de</strong>r Kultur nicht möglich: Mark Taylors »postmo<strong>de</strong>rne A/<strong>Theologie</strong>« ist<br />
ohne die sprachphilosophischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>s Poststrukturalismus <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Dekonstruktion<br />
gar nicht <strong>de</strong>nkbar, <strong>und</strong> Hermann Timms Programm einer »Postmo<strong>de</strong>rnisierung <strong>de</strong>r Religion«<br />
basiert in wesentlichen Punkten auf <strong>de</strong>n ästhetischen Postmo<strong>de</strong>rne-Konzeptionen aus <strong>de</strong>r Architektur<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Literaturwissenschaft; das Anliegen <strong>von</strong> Lindbecks »postliberaler <strong>Theologie</strong>«<br />
läßt sich zwar durchaus auch ohne Lyotards Sprachspielkonzeption verstehen, doch das<br />
gemeinsame Anliegen (das alles an<strong>de</strong>re als zufällig ist) wird erst in <strong>de</strong>r Zusammenschau <strong>von</strong><br />
philosophischer <strong>und</strong> theologischer Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion <strong>de</strong>utlich; in <strong>de</strong>r theologischen<br />
18 Vgl. dazu: W. WELSCH: Religiöse Implikationen <strong>und</strong> religionsphilosophische Konsequenzen ›postmo<strong>de</strong>rnen‹<br />
Denkens.<br />
19 A.a.O., S. 128.<br />
20 Daß sich in <strong>de</strong>n USA schon seit längerem eine theologische Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion etabliert hat, wird<br />
<strong>von</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschsprachigen Theologen, die sich mit <strong>de</strong>m Thema Postmo<strong>de</strong>rne beschäftigen, nur teilweise<br />
wahrgenommen. Insofern schließt die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit eine Informationslücke <strong>und</strong> bietet damit gleichzeitig<br />
einen Einblick in einen Teilbereich <strong>de</strong>r amerikanischen Gegenwartstheologie.
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 5<br />
Diskussion um Pluralismus <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne wird nicht nur explizit auf die Pluralismustheorien<br />
<strong>von</strong> Lyotard <strong>und</strong> Welsch Bezug genommen, son<strong>de</strong>rn die Antworten auf die Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
dieser Diskussion wer<strong>de</strong>n auch bewußt in Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>und</strong> in Abgrenzung<br />
zu diesen Konzeptionen entworfen; ebenso setzen die Entwürfe einer »ganzheitlichen« <strong>Theologie</strong><br />
die philosophischen Holismustheorien voraus. Aufgr<strong>und</strong> dieser Depen<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r theologischen<br />
<strong>von</strong> <strong>de</strong>r ästhetischen, philosophischen <strong>und</strong> soziologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
schien es notwendig, die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit <strong>von</strong> vornherein möglichst interdisziplinär zu konzipieren.<br />
Der Gießener Systematiker Konrad Stock hat in einem Aufsatz über die Lage <strong>de</strong>r Systematischen<br />
<strong>Theologie</strong> in <strong>de</strong>r Gegenwart die theologische Aufgabe folgen<strong>de</strong>rmaßen bestimmt:<br />
»Ob progressiver o<strong>de</strong>r konservativer Provenienz – die Proklamation einer Postmo<strong>de</strong>rne hat<br />
Anhalt an <strong>de</strong>n ambivalenten Resultaten <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rnisierungsprozesse, die <strong>de</strong>n Alltag spätindustrieller<br />
Gesellschaften bestimmen. Es fragt sich jedoch, worauf Zeitdiagnosen ihre Plausibilität<br />
<strong>und</strong> Überzeugungskraft grün<strong>de</strong>n <strong>und</strong> unter welchen Bedingungen sie zum Formelement<br />
in <strong>de</strong>r Darstellung theologischer Erkenntnis gemacht wer<strong>de</strong>n können. Nach<strong>de</strong>m die Systematische<br />
<strong>Theologie</strong> die Zeitdiagnose lange Zeit auf eine vergleichsweise intuitive Art praktiziert<br />
hat, scheint es mir an <strong>de</strong>r Zeit zu sein, die Bedingungen für eine sachgemäße, <strong>de</strong>m Gegenstand<br />
<strong>de</strong>r <strong>Theologie</strong> entsprechen<strong>de</strong> Verknüpfung <strong>von</strong> theologischer Argumentation <strong>und</strong> Zeitdiagnose<br />
zu thematisieren <strong>und</strong> in eine zusammenhängen<strong>de</strong> Diskussion zu überführen«. 21<br />
Dazu will die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit einen Beitrag leisten. Allerdings soll hier nicht <strong>de</strong>r Zusammenhang<br />
<strong>von</strong> »theologischer Argumentation« <strong>und</strong> »Zeitdiagnose« theoretisch aufgearbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Intention <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit besteht vielmehr darin, die verschie<strong>de</strong>nen<br />
Zeitdiagnosen <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion einerseits auf ihre »Plausibilität <strong>und</strong> Überzeugungskraft«<br />
hin zu überprüfen <strong>und</strong> an<strong>de</strong>rerseits die theologische Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
systematisch daraufhin zu befragen, ob ihre »Verknüpfung <strong>von</strong> theologischer Argumentation<br />
<strong>und</strong> Zeitdiagnose« <strong>de</strong>m »Gegenstand <strong>de</strong>r <strong>Theologie</strong>« entspricht. Dies ist jedoch – im Gegensatz<br />
zu einer bloß oberflächlichen <strong>und</strong> eklektischen Aneignung <strong>de</strong>s Themas Postmo<strong>de</strong>rne, die<br />
sich bei Theologen (aber nicht nur bei Theologen) großer Beliebtheit erfreut – nur über eine<br />
umfassen<strong>de</strong> <strong>und</strong> kritische Analyse <strong>de</strong>r allgemeinen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion möglich.<br />
Zur Methodik <strong>und</strong> Struktur <strong>de</strong>r Arbeit<br />
Sowohl im Ersten als auch im Zweiten Hauptteil wer<strong>de</strong>n die verschie<strong>de</strong>nen Postmo<strong>de</strong>rne-<br />
Konzeptionen zuerst ausführlich referiert, um dann in <strong>de</strong>n kurzen Zusammenfassungen am<br />
En<strong>de</strong> eines je<strong>de</strong>n Kapitels eine erste Konzentration <strong>de</strong>r einzelnen Standpunkte zu erreichen.<br />
Nach <strong>de</strong>r Darstellung folgt dann in <strong>de</strong>n Auswertungskapiteln am En<strong>de</strong> eines je<strong>de</strong>n Hauptteiles<br />
eine kritische Analyse <strong>de</strong>r jeweiligen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion. Diese Trennung <strong>von</strong> Darstellung<br />
<strong>und</strong> Kritik ist notwendig, um zunächst die durchgängigen Strukturen <strong>und</strong> übergreifen<strong>de</strong>n<br />
Argumentationsmuster zwischen <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Bereichen <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
in <strong>de</strong>n Blick zu bekommen, um dann anschließend eine angemessene Bewertung <strong>de</strong>r einzelnen<br />
Positionen sowie <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion insgesamt vornehmen zu können.<br />
21 K. STOCK: Das Denken <strong>de</strong>s Glaubens, S. 78.
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 6<br />
Der Erste Hauptteil <strong>de</strong>r Arbeit hat die Aufgabe, die Genese <strong>de</strong>s Begriffs »Postmo<strong>de</strong>rne«<br />
innerhalb <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Bereiche <strong>de</strong>r Kultur (Architektur, Literaturwissenschaft, Philosophie<br />
<strong>und</strong> Soziologie) nachzuzeichnen, die wichtigsten Postmo<strong>de</strong>rne-Konzeptionen vorzustellen,<br />
die Beziehungslinien zwischen <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Sektoren herauszuarbeiten <strong>und</strong> eine<br />
kritische Analyse <strong>de</strong>r einzelnen Positionen vorzunehmen, um erstens einen <strong>de</strong>taillierten Überblick<br />
<strong>de</strong>r Diskussion zu gewinnen <strong>und</strong> zweitens eine f<strong>und</strong>ierte Gr<strong>und</strong>lage für die theologische<br />
Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion zu erarbeiten:<br />
In <strong>de</strong>r Diskussion um die postmo<strong>de</strong>rne Architektur geht es zunächst darum, die Krisenphänomene<br />
<strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Architektur herauszuarbeiten, um dann zu einer ersten Definition<br />
postmo<strong>de</strong>rner Architektur vorzustoßen, die anschließend am Beispiel <strong>de</strong>r Stuttgarter Neuen<br />
Staatsgalerie konkret erläutert wird. Nach <strong>de</strong>r Kritik an <strong>de</strong>r postmo<strong>de</strong>rnen Architektur, die<br />
schon sehr bald nach <strong>de</strong>n ersten Manifesten postmo<strong>de</strong>rner Architektur laut wur<strong>de</strong>, wer<strong>de</strong>n<br />
schließlich verschie<strong>de</strong>ne Definitionen <strong>und</strong> Richtungen postmo<strong>de</strong>rner Architektur vorgestellt<br />
(Kapitel I).<br />
Nach<strong>de</strong>m schon in <strong>de</strong>n späten fünfziger <strong>und</strong> <strong>de</strong>n sechziger Jahren das Prädikat »postmo<strong>de</strong>rn«<br />
zur Charakterisierung verschie<strong>de</strong>ner Literaturrichtungen sporadisch verwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>,<br />
wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Literaturwissenschaft dann zum einen die formal-ästhetischen Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
<strong>von</strong> Umberto Ecos Roman Der Name <strong>de</strong>r Rose <strong>und</strong> zum an<strong>de</strong>ren die<br />
sprachphilosophischen Implikationen dieses Romans ins Zentrum <strong>de</strong>r Analyse gerückt: die<br />
Verwirrung <strong>und</strong> Zerstreuung <strong>de</strong>r Zeichen, die vom französischen Poststrukturalismus <strong>und</strong><br />
<strong>de</strong>r amerikanischen Dekonstruktion sprachtheoretisch begrün<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Der Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit Poststrukturalismus <strong>und</strong> Dekonstruktion folgen dann noch einige Alternativvorschläge<br />
zur Definition <strong>de</strong>r postmo<strong>de</strong>rnen Literatur (Kapitel II).<br />
Die Präsentation <strong>de</strong>r philosophischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion gilt zunächst <strong>de</strong>r Darstellung<br />
<strong>von</strong> Lyotards Postmo<strong>de</strong>rne-Konzeption, seiner Sprachspieltheorie <strong>und</strong> seiner Theorie<br />
<strong>de</strong>r Gerechtigkeit, dann aber auch <strong>de</strong>n Weiterentwicklungen seines Programms <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
Gegenkonzeptionen: Welschs Mo<strong>de</strong>ll einer »transversalen Vernunft«, Rortys »Neopragmatismus«,<br />
Vattimos »schwachem Denken«, Sloterdijks »kritischer Theorie <strong>de</strong>r Mobilmachung«<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n Gegenkonzeptionen <strong>von</strong> Koslowski, Hübner <strong>und</strong> Spaemann, die die Postmo<strong>de</strong>rne<br />
durch eine Suche nach »Ganzheitlichkeit« charakterisiert sehen. Schließlich<br />
kommt auch <strong>de</strong>r avancierteste Kritiker <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne <strong>und</strong> gegenwärtige Projektleiter <strong>de</strong>s<br />
unvollen<strong>de</strong>ten Projektes <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne zu Wort: Jürgen Habermas (Kapitel III).<br />
In <strong>de</strong>r soziologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion konzentriert sich die Abgrenzung zur Mo<strong>de</strong>rne<br />
auf die Begriffe »postmo<strong>de</strong>rne Gesellschaft«, »postindustrielle Gesellschaft« <strong>und</strong><br />
»postmo<strong>de</strong>rne Kultur«, die aus je unterschiedlicher Perspektive eine gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong> Transformation<br />
<strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Gesellschaft <strong>und</strong> Kultur anzeigen. Zugleich aber wer<strong>de</strong>n auch die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Soziologie in Frage gestellt: <strong>Zum</strong> einen wird gegen die Religionssoziologie<br />
<strong>de</strong>r Verdacht erhoben, Religion auf ein gesellschaftliches Phänomen zu reduzieren<br />
<strong>und</strong> sie allein um ihrer Nützlichkeit willen zu akzeptieren, <strong>und</strong> zum an<strong>de</strong>ren wird<br />
gegen die gesamten Sozialwissenschaften <strong>de</strong>r Verdacht erhoben, daß diese mit ihren Metho<strong>de</strong>n<br />
ein technisches Herrschaftswissen liefern, um neben <strong>de</strong>r technischen Beherrschung<br />
<strong>de</strong>r Natur nun auch die Beherrschung <strong>de</strong>r Gesellschaft in <strong>de</strong>n Griff zu bekommen (Kapitel<br />
IV).
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 7<br />
Das Auswertungskapitel am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Hauptteiles hat dann die Aufgabe, die Diskussion<br />
zunächst zu bün<strong>de</strong>ln <strong>und</strong> die Gemeinsamkeiten <strong>und</strong> Unterschie<strong>de</strong> hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
Bestimmung <strong>von</strong> »Mo<strong>de</strong>rne« <strong>und</strong> »Postmo<strong>de</strong>rne« in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Bereichen herauszuarbeiten,<br />
um danach die einzelnen Konzeptionen auch einer <strong>de</strong>taillierten Kritik unterziehen<br />
<strong>und</strong> weiterführen<strong>de</strong> Perspektiven formulieren zu können (Kapitel V).<br />
Angesichts <strong>de</strong>r unzähligen internationalen Monographien, Sammelbän<strong>de</strong> <strong>und</strong> Aufsätze zum<br />
Thema Postmo<strong>de</strong>rne, die seit Beginn <strong>de</strong>r achtziger Jahre erschienen sind, ist es notwendig,<br />
sich im Ersten Hauptteil auf die vier Hauptbereiche <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion (Architektur,<br />
Literaturwissenschaft, Philosophie <strong>und</strong> Soziologie) zu konzentrieren. Die eher peripheren Bereiche<br />
wie Musik, Kunst, Film <strong>und</strong> Tanz, die die in <strong>de</strong>n vier Hauptbereichen entwickelten<br />
Konzepte auf ihre Disziplinen anwen<strong>de</strong>n <strong>und</strong> fortschreiben, können lei<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Darstellung<br />
nicht berücksichtigt wer<strong>de</strong>n. 22 Aber auch innerhalb <strong>de</strong>r vier Hauptbereiche ist eine Selektion<br />
<strong>de</strong>rjenigen Positionen, die im Haupttext dargestellt wer<strong>de</strong>n sollen, unumgänglich: Randthemen<br />
<strong>und</strong> Nebenschauplätze <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion können nicht ausführlich behan<strong>de</strong>lt<br />
wer<strong>de</strong>n. 23 Auf diese wird in <strong>de</strong>n Anmerkungen mit zahlreichen Literaturangaben hingewiesen,<br />
um <strong>de</strong>m interessierten Leser eine weiterführen<strong>de</strong> Lektüre zu ermöglichen. 24<br />
Der Zweite Hauptteil ist ganz dku theologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskusssion gewidmet.<br />
Wie im Ersten Hauptteil sind auch hier Darstellung <strong>und</strong> Kritik <strong>von</strong>einan<strong>de</strong>r getrennt: Nach <strong>de</strong>r<br />
Darstellung <strong>de</strong>r drei thematischen Schwerpunkte, die sich in <strong>de</strong>r theologischen Diskussion<br />
herauskristallisieren, schließt sich auch hier in einem vierten Kapitel eine Kritik <strong>de</strong>r theologischen<br />
Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion an:<br />
Ausgelöst durch die architekturtheoretische, literaturwissenschaftliche, philosophische <strong>und</strong><br />
soziologische Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion stellen sich einige Theologen <strong>de</strong>r Frage, welche<br />
Konsequenzen sich aus <strong>de</strong>m »radikalen« gesellschaftlichen, kulturellen, ethischen <strong>und</strong> ästhetischen<br />
Pluralismus <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne für <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Kirche ergeben <strong>und</strong> wie mit<br />
<strong>de</strong>m Pluralismus innerhalb <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Kirche umgegangen wer<strong>de</strong>n soll (Kapitel I).<br />
22 Vgl. zur Postmo<strong>de</strong>rne in <strong>de</strong>r Musik: S. CONNOR: Postmo<strong>de</strong>rnist Culture, S. 184-198; H. DANUSER: Die<br />
Musik <strong>de</strong>s 20. Jahrh<strong>und</strong>erts, S. 392-415; P. KEMPER: Flucht nach vorn o<strong>de</strong>r Sieg <strong>de</strong>s Vertrauten?; W.<br />
KONOLD: Komponieren in <strong>de</strong>r »Postmo<strong>de</strong>rne«; L. SAMAMA: Neoromantik in <strong>de</strong>r Musik; im Film:<br />
TH. ELSAESSER: American Graffiti <strong>und</strong> Neuer Deutscher Film; G. BRUNO: Ramble City; im Tanz:<br />
R. COPELAND: Postmo<strong>de</strong>rn Dance/Postmo<strong>de</strong>rn Architecture/Postmo<strong>de</strong>rnism; L. UTRECHT: Postmo<strong>de</strong>rne-<br />
Tanz; in <strong>de</strong>r Kunst: S. SCHMIDT-WULFFEN: Auf <strong>de</strong>r Suche nach <strong>de</strong>m postmo<strong>de</strong>rnen Bild; F. FEHÉR: Der<br />
Pyrrhussieg <strong>de</strong>r Kunst im Kampf um ihre Befreiung; C. BÜRGER: Das Verschwin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Kunst;<br />
P. BÜRGER: Der Alltag, die Allegorie <strong>und</strong> die Avantgar<strong>de</strong>; A. MARTIS: Die Verantwortung <strong>de</strong>r Bil<strong>de</strong>r;<br />
W. CH. ZIMMERLI: Wie autonom kann Kunst sein? Vgl. zu <strong>de</strong>n genannten <strong>und</strong> weiteren Bereichen <strong>de</strong>r<br />
Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion die ausführliche Bibliographie in: W. WELSCH (Hrsg.): Wege aus <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne,<br />
S. 275-315.<br />
23 Das in dieser Arbeit vorgestellte Material stellt <strong>de</strong>swegen auch lediglich einen begrenzten Ausschnitt <strong>und</strong><br />
eine subjektive Auswahl aus <strong>de</strong>n vielfältigen Möglichkeiten, die Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion zu beschreiben,<br />
dar. Gleichwohl ist diese Selektion we<strong>de</strong>r zufällig noch beliebig: <strong>Zum</strong> einen sollte ein möglichst breites<br />
Spektrum <strong>von</strong> Positionen <strong>und</strong> Programmen aufgenommen wer<strong>de</strong>n, um sich nicht <strong>von</strong> vornherein auf nur eine<br />
Strömung <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion festzulegen, <strong>und</strong> zum an<strong>de</strong>ren sollten primär diejenigen Beiträge<br />
vorgestellt wer<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong>r Diskussion die nachhaltigsten Wirkungen hervorgerufen haben.<br />
24 Um bei <strong>de</strong>n zahlreichen Literaturhinweisen Unübersichtlichkeit, mögliche Verwechslungen <strong>und</strong> falsche<br />
Bezüge zu vermei<strong>de</strong>n, wird die Literatur in <strong>de</strong>n Anmerkungen immer mit <strong>de</strong>m Namen <strong>de</strong>s Autors <strong>und</strong> mit<br />
einem Kurztitel aber ohne Erscheinungsort angegeben. Die ausführlichen Literaturangaben fin<strong>de</strong>n sich in<br />
<strong>de</strong>r Bibliographie am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Arbeit. »A.a.O.« <strong>und</strong> »ebd.« wer<strong>de</strong>n nur dann verwen<strong>de</strong>t, wenn diese sich<br />
auf das in <strong>de</strong>r unmittelbar vorausgehen<strong>de</strong>n Anmerkung zitierte Werk eines Autors beziehen.
<strong>Einleitung</strong>: <strong>Zum</strong> Verhältnis <strong>von</strong> <strong>Theologie</strong> <strong>und</strong> Postmo<strong>de</strong>rne 8<br />
Auf <strong>de</strong>m Hintergr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r sprachphilosophischen <strong>und</strong> literaturwissenschaftlichen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
beschäftigen sich dann vor allem amerikanische Theologen mit <strong>de</strong>n Implikationen,<br />
die die poststrukturalistische Sprachphilosophie <strong>und</strong> die Dekonstruktion auf die<br />
<strong>Theologie</strong> – insbeson<strong>de</strong>re die theologische Re<strong>de</strong> <strong>von</strong> Gott – haben (Kapitel II).<br />
Einen dritten Diskussionsschwerpunkt bil<strong>de</strong>t das aus <strong>de</strong>r philosophischen <strong>und</strong> soziologischen<br />
Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion bekannte Stichwort »Ganzheitlichkeit«, das <strong>von</strong> einigen<br />
Theologen aufgegriffen <strong>und</strong> theologisch rezipiert wird: <strong>Zum</strong> einen wird gefragt, welchen<br />
Beitrag <strong>de</strong>r christliche Glaube zu einem ganzheitlichen Verständnis <strong>de</strong>s Menschen <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Welt leisten kann, <strong>und</strong> zum an<strong>de</strong>ren, wie eine »ganzheitliche« <strong>Theologie</strong> konzipiert wer<strong>de</strong>n<br />
könnte (Kapitel III).<br />
Ein abschließen<strong>de</strong>s Kapitel ist <strong>de</strong>r kritischen Analyse <strong>de</strong>r theologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
gewidmet: Hier wer<strong>de</strong>n zunächst Konvergenzen <strong>und</strong> Divergenzen <strong>von</strong> allgemeiner<br />
<strong>und</strong> theologischer Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion herausgearbeitet, dann einige übergreifen<strong>de</strong><br />
Themen <strong>de</strong>r theologischen Diskussion erörtert <strong>und</strong> anschließend die einzelnen Positionen<br />
besprochen (Kapitel IV).<br />
Wie im Ersten Hauptteil sollen auch hier die Zusammenfassungen am En<strong>de</strong> eines je<strong>de</strong>n Kapitels<br />
eine Kurzinformation über die wichtigsten Themen <strong>de</strong>r Diskussion ermöglichen. Den drei<br />
ersten Kapiteln im Zweiten Hauptteil ist darüber hinaus auch jeweils ein kurzer Überblick<br />
vorangestellt, <strong>de</strong>r zum einen die Funktion hat, die Beziehungslinien <strong>und</strong> Anknüpfungspunkte<br />
zur allgemeinen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion anzu<strong>de</strong>uten, <strong>und</strong> zum an<strong>de</strong>ren über die Problemstellungen<br />
zu informieren, die <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Theologen als Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-<br />
Diskussion wahrgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Im Epilog wird dann <strong>de</strong>r Versuch unternommen, die theologische Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion<br />
zu bilanzieren <strong>und</strong> Prospektiven für die <strong>Theologie</strong> zu entwickeln. Das Anliegen besteht<br />
aber we<strong>de</strong>r darin, die verschie<strong>de</strong>nen theologischen Konzepte zu synthetisieren, noch darin,<br />
eine weitere theologische Postmo<strong>de</strong>rne-Konzeption zu entwickeln. Vielmehr soll nach <strong>de</strong>n<br />
Chancen <strong>und</strong> Grenzen <strong>de</strong>r einzelnen Beiträge zur theologischen Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion gefragt<br />
wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> die bleiben<strong>de</strong>n Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne-Diskussion für <strong>Theologie</strong><br />
<strong>und</strong> Kirche benannt wer<strong>de</strong>n.