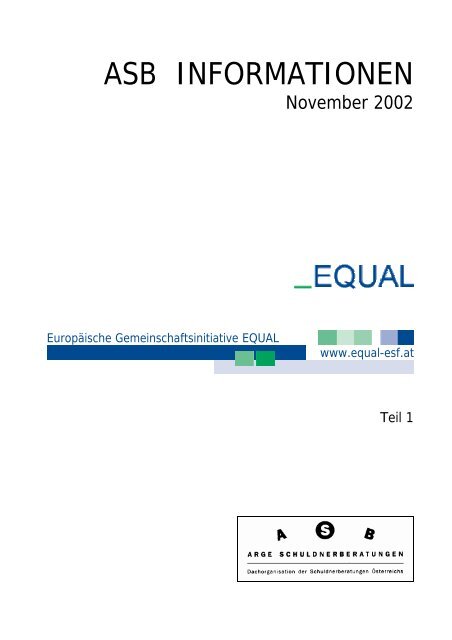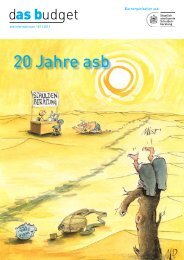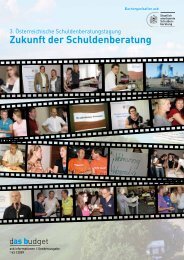ASB INFORMATIONEN - ASB Schuldnerberatungen GmbH
ASB INFORMATIONEN - ASB Schuldnerberatungen GmbH
ASB INFORMATIONEN - ASB Schuldnerberatungen GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ASB</strong> <strong>INFORMATIONEN</strong><br />
November 2002<br />
Europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL<br />
www.equal-esf.at<br />
Teil 1
Seite 2 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Die Europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL wird gefördert aus Mitteln von:<br />
Impressum:<br />
Herausgeber,<br />
Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:<br />
Vereinsvorstand:<br />
Verein ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong> (<strong>ASB</strong>)<br />
Dachorganisation der <strong>Schuldnerberatungen</strong> Österreichs<br />
GF: Dr. Hans W. Grohs<br />
Scharitzerstraße 10, 4020 Linz<br />
Mag. Peter Niederreiter, DSA Ferdinand Herndler, Mag. H. Christof<br />
Lösch, DSA Alexander Maly, DSA Peter Kopf, Mag. Thomas Pachl,<br />
Ronald Kotulski, Mag. Anna Peck, Mag. Thomas Berghuber, Dr.<br />
Helmut Prislan.<br />
Redaktionsteam: Mag. Thomas Berghuber, Dr. Hans W. Grohs, DSA Alexander A.<br />
Maly, DSA Ferdinand Herndler.<br />
Endredaktion und Layout:<br />
Titelseite:<br />
Kontaktadresse/Zusendungen/Beiträge:<br />
Druck:<br />
Blattlinie:<br />
Josef Haslinger, Mag. Harald Hauer, Dr. Hans W. Grohs<br />
Logo: EQUAL-Homepage Österreich (www.equal-esf.at), <strong>ASB</strong><br />
Informationen p.A.<br />
ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong>, Scharitzerstraße 10, 4020 Linz<br />
Tel.: 0732/65 36 31, Fax: 0732/65 36 30<br />
E-mail-Adresse: grohs-asb@aon.at<br />
Homepage: www.schuldnerberatung.at<br />
Eigenvervielfältigung<br />
Diskussions- und Informationsplattform der österreichischen<br />
Schuldnerberatungsstellen<br />
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung der<br />
Redaktion wiedergeben<br />
Jahresabonnement: Mitglieder: Euro 21,80; Nichtmitglieder: Euro 36,34<br />
Die Informationen erscheinen mindestens dreimal jährlich<br />
Bankverbindung: VKB Linz: BLZ 18600, Kontonummer: 10.623.023<br />
Copyright ©:<br />
Auszugsweiser Nachdruck und Verwertung nicht namentlich<br />
gekennzeichneter Artikel unter genauer Quellenangabe gestattet.<br />
Die Rechte namentlich gekennzeichneter Artikel liegen bei den<br />
Autoren. Diese Texte dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder<br />
zur Gänze noch auszugsweise wiedergegeben werden.
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 3<br />
Editorial<br />
Zum Ersten...<br />
Zum Zweiten...<br />
Zum Dritten...<br />
Freitag, der 13te, ist<br />
für viele ein schlechtes<br />
Omen, ein Unglückstag.<br />
Nicht so für uns. Am<br />
Freitag dem 13.12.1991<br />
fand die Gründungsversammlung<br />
des Vereins<br />
Arge <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
in Salzburg statt. Zu<br />
diesem Zeitpunkt war der<br />
Begriff Schuldnerberatung<br />
noch weitgehend<br />
unbekannt. Die Tätigkeit<br />
für viele eine diffuse Angelegenheit.<br />
Ein paar<br />
„überzeugte Besserwisser“<br />
schließen sich zusammen<br />
und versuchen<br />
das Unmögliche. Das<br />
Unmögliche war, aus der<br />
Erkenntnis, dass Überschuldung<br />
zu Verzweiflung,<br />
Armut und Existenzkrisen<br />
führt, ein Unterstützungsangebot<br />
in<br />
ganz Österreich zu etablieren.<br />
Die Personen, die<br />
aus welchen Gründen<br />
immer, zahlungsunfähig<br />
waren, aus der Abhängigkeit<br />
von Sozialhilfe<br />
und Arbeitslosenunterstützung<br />
in ein unbehindertes<br />
Leben, Wirtschaften<br />
und Arbeiten zurückzubegleiten.<br />
Nach 11 Jahren am Freitag<br />
dem 13.12.2002<br />
wird der Verein Arge<br />
<strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
aufgelöst werden. Nicht<br />
weil es keine Überschuldeten<br />
mehr gibt, sondern<br />
weil das Angebot des<br />
Vereins derart komplex<br />
und vielfältig geworden<br />
ist, dass die Rechtsform<br />
des Vereins zu kurz<br />
greift. Eine stabile, nach<br />
vorne gerichtete Arbeit<br />
braucht eine stabile, zukunftsweisende<br />
Rechtsform.<br />
Daher entschlossen<br />
sich die Mitglieder des<br />
Vorstandes und des Vereins<br />
in Form einer gemeinnützigen<br />
Gesellschaft<br />
mit beschränkter<br />
Haftung weiterzumachen.<br />
Koordination bevorrechteter<br />
<strong>Schuldnerberatungen</strong>,<br />
sowie der Aus- und<br />
Fortbildung, Qualitätssicherung,<br />
Vernetzung im<br />
In- und Ausland, Informationsaustausch,<br />
wissenschaftliche<br />
Analyse,<br />
die Abwicklung von Treuhandschaften<br />
im Schuldenregulierungsverfahren<br />
und etliches mehr werden<br />
so weiterbetreut und<br />
weiterentwickelt.<br />
Ein deutliches Zeichen,<br />
dass wir in ein neues<br />
Stadium unserer kurzen<br />
Geschichte eintreten, ist<br />
die Bewilligung des<br />
mehrjährigen Projektes<br />
„Schulden-Shredder“<br />
durch das Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und<br />
Arbeit. Es weist sowohl<br />
nach Europa als auch auf<br />
unsere Wurzeln zurück.<br />
Dieses Projekt basiert auf<br />
der EU-Gemeinschaftsinitiative<br />
Equal. Zum Thema<br />
Schulden als Arbeitsmarkthindernis<br />
konnten<br />
wir eine österreichweite<br />
Partnerschaft gründen, in<br />
der neben den Sozialpartnern<br />
Arbeiter- und<br />
Wirtschaftskammer, die<br />
Abteilung Konsumentenschutz<br />
des BMJ, etliche<br />
<strong>Schuldnerberatungen</strong>,<br />
aber auch Caritas und<br />
Verein Neustart über drei<br />
Jahre Mittel zur Verfügung<br />
haben, um in diesem<br />
Umfeld innovative<br />
Beratungsmodelle zu<br />
konzipieren und zu erproben.<br />
Es ist als Thema in der<br />
gesamteuropäischen<br />
Equalprojektszene ohne<br />
vergleichbares Beispiel<br />
und zeigt damit unsere<br />
Vorreiterrolle. Es ermöglicht<br />
parallel zum Schuldnerberatungsalltag<br />
ein<br />
geeignetes Maß an Analyse,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
mit dem Ziel<br />
einer nachhaltigen Verbesserung<br />
nicht nur unseres<br />
Beratungsalltags<br />
sondern auch eine Erhöhung<br />
der Chancen auf<br />
Entschuldung für die<br />
betroffenen<br />
und Personen.<br />
Haushalte<br />
Und bis zum nächsten ...<br />
Rückblickend auf die elf Jahre Arbeit in der Arge <strong>Schuldnerberatungen</strong> ist es mir ein Anliegen einen der vielen<br />
Erfolgsfaktoren besonders hervorzuheben. Es ist die überwiegend sachorientierte, unabhängige und kooperative<br />
Zusammenarbeit der <strong>Schuldnerberatungen</strong>, die wir als MitarbeiterInnen der <strong>ASB</strong> koordinieren dürfen.<br />
Die durch diesen Faktor des an der Sache orientierten gemeinsamen Interesses entstehende Energie<br />
sollte auch künftig ohne Reibungsverluste für die <strong>Schuldnerberatungen</strong> und die Überschuldeten eingesetzt<br />
werden können.
Seite 4 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Editorial 3<br />
Inhaltsverzeichnis 4<br />
Statistik 5<br />
Eckdaten der <strong>Schuldnerberatungen</strong> 5<br />
Privatkonkurse im Überblick 6<br />
Externe Statistik 9<br />
Recht-Ecke 10<br />
Literaturhinweise 13<br />
Schwerpunktthema:<br />
- Europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL 15<br />
- EQUAL – Österreich 17<br />
- EQUAL – „Schulden-Shredder“ – Aufnahmehindernis Schulden 20<br />
- Modulsplitter – Im Überblick 23<br />
Themensplitter<br />
- Probieren kann man es ja ... 24<br />
- „eJustiz“ oder „Im Dienste des Bürgers (?)“ 24<br />
- Chaos bei Jugendkonten der Banken 25<br />
- <strong>ASB</strong>-Arbeitsgruppe „Jugend und Schulden“ 26<br />
- Erste Erfahrungen mit dem Webportal – www.schuldnerberatung.at 29<br />
Pressespiegel 30<br />
Kuriosa 31<br />
Tipps - Serie 10 33<br />
Leistungen - Abonnement 34
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 5<br />
Statistik<br />
Eckdaten der <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
Betrachtungszeiträume: 1.1.1995 bis 30.6.2002 und 1.1.2002 bis 30.6.2002<br />
125.423 Erstkontakte<br />
1995 – 1. Halbjahr<br />
2002<br />
(seit Inkrafttreten des Schuldenregulierungsverfahrens)<br />
nahmen österreichweit<br />
125.423 Personen mit<br />
den <strong>Schuldnerberatungen</strong> erstmals<br />
Kontakt auf.<br />
1. Halbjahr 2002 waren es 9.826 Erstkontakte,<br />
die in den <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
registriert wurden.<br />
74.071 Erstgespräche<br />
1995 - 1. Halbjahr<br />
2002<br />
wurde mit 74.071 Personen ein<br />
Erstgespräch geführt. D.h. 59 Prozent<br />
der Personen, die erstmalig mit<br />
der Schuldnerberatung Kontakt<br />
aufgenommen haben, sind auch zu<br />
einem Beratungsgespräch in die<br />
Schuldnerberatung gekommen.<br />
1. Halbjahr 2002 nahmen 5.608 Personen ein<br />
Erstgespräch (= intensives<br />
Beratungsgespräch in einer<br />
Schuldnerberatung) in Anspruch.<br />
D.h. 57,1 Prozent<br />
der Erstkontakte mündeten<br />
in eine Erstberatung.<br />
Durchschnittsverschuldung: rd. 1 Mio. ATS bzw. 72.449,- Euro<br />
1995 - 1. Halbjahr<br />
2002<br />
lag die Durchschnittsverschuldung<br />
bei 981.667,- ATS oder 72.449 Euro<br />
mit einem Gesamtverschuldungsvolumen<br />
von 71,1 Mrd. ATS oder 5,2<br />
Mrd. Euro.<br />
1. Halbjahr 2002 wurde sie mit 1.035.987,-<br />
ATS oder 75.288 Euro beziffert.<br />
Im Vergleich zum Gesamtjahr<br />
2001 ist die mittlere<br />
Verschuldung geringfügig<br />
gestiegen (1,7 %).<br />
Rd. 26 Prozent Arbeitslose<br />
1995 - 1. Halbjahr<br />
2002<br />
sind rund 51 Prozent des Klientels<br />
der <strong>Schuldnerberatungen</strong> einer<br />
geregelten Arbeit nachgegangen.<br />
Die Anzahl an arbeitslos geführten<br />
Klienten lag bei 26,1 Prozent.<br />
1. Halbjahr 2002 lagen die in Arbeit befindlichen<br />
KlientInnen bei 52,4<br />
Prozent. Gegenüber dem<br />
Jahr 2001 ist die Zahl der<br />
arbeitslos Gemeldeten um 2<br />
Prozent gestiegen.<br />
9.183 außergerichtliche Ausgleiche, rd. 62 Prozent abgelehnt<br />
1995 - 1. Halbjahr<br />
2002<br />
wurden österreichweit 9.183 außergerichtliche<br />
Ausgleiche zum Abschluss<br />
gebracht. Davon wurden rd.<br />
62 Prozent abgelehnt.<br />
1. Halbjahr 2002 lag der Prozentsatz der außergerichtlichen<br />
Ausgleiche,<br />
die abgelehnt wurden, bei<br />
71,4 Prozent. Gegenüber<br />
dem Jahr 2001 sind diese<br />
um 10 Prozentpunkte gesunken.
Seite 6 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Die Grafik zeigt, die von den Schuldnern angebotenen außergerichtlichen Ausgleiche wurden von den Gläubigern<br />
im 1. Halbjahr 2002 wieder vermehrt – über 2/3 - abgelehnt.<br />
Außergerichtliche Ausgleiche<br />
80,00%<br />
70,00%<br />
62,40%<br />
60,00%<br />
50,00%<br />
40,00%<br />
37,60%<br />
30,00%<br />
20,00%<br />
1995<br />
(1097)<br />
1996<br />
(997)<br />
1997<br />
(1242)<br />
1998<br />
(1466)<br />
1999<br />
(1448)<br />
2000<br />
(1423)<br />
2001<br />
(1453)<br />
1. Hj<br />
2002<br />
´95 bis<br />
1. Hj 02<br />
angenommen 49,68% 45,74% 34,54% 34,79% 33,01% 37,03% 38,49% 28,61% 37,60%<br />
abgelehnt 50,32% 54,26% 65,46% 65,21% 66,99% 62,97% 61,51% 71,39% 62,40%<br />
10.824 Schuldenregulierungsverfahren mit Hilfe der <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
1995 - 1. Halbjahr<br />
2002<br />
unterstützten die <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
10.824 SchulderInnen in<br />
beratender, begleitender oder vor<br />
Gericht vertretender Funktion. Das<br />
ergibt einen Anteil von 57 Prozent,<br />
der bis dahin insgesamt bei Gericht<br />
eingebrachten Schuldenregulierungsverfahren.<br />
Es wurden in diesem<br />
Zeitraum 5.734 SchuldnerInnen<br />
von den <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
vertreten.<br />
1. Halbjahr 2002 wurden mit Unterstützung<br />
der <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
1.050 Verfahren bei Gericht<br />
beantragt und 621 SchuldnerInnen<br />
vor Gericht vertreten.<br />
Der Unterstützungsanteil der<br />
<strong>Schuldnerberatungen</strong> an den<br />
beantragten Privatkonkursverfahren<br />
lag bei 67 Prozent.<br />
Privatkonkurse im Überblick<br />
Betrachtungszeiträume: 1.1. bis 30.9.2002 und 1.1.1995 bis 30.9.2002<br />
Quelle: Insolvenzdatei - www.edikte.justiz.gv.at<br />
19.877 Konkursanträge<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
wurden 19.877 Konkursanträge in<br />
Österreich seit der Einführung des<br />
Privatkonkurses bei Gericht eingebracht.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
wurden 2.845 Anträge gestellt. Gegenüber<br />
dem Vorjahr sind die Anträge um<br />
2,6 Prozent (2.772 Konkursanträge)<br />
angestiegen.
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 7<br />
16.659 Konkurseröffnungen<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
konnten rd. 84 Prozent der oben<br />
erwähnten Privatkonkursanträge<br />
bei Gericht eröffnet werden.<br />
Am zahlreichsten wurden Privatkonkurse<br />
eröffnet:<br />
in Wien mit 3.102 (18,6 % Bundesanteil),<br />
in Oberösterreich mit 2.711 (16,3<br />
%),<br />
in Kärnten mit 2.430 (14,6 %) und<br />
in Tirol mit 2.247 (13,5 %).<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
wurden 2.401 Privatkonkurse eröffnet,<br />
im Vergleich zum Vorjahr sind sie um<br />
4,2 Prozent gestiegen.<br />
Gegenüber dem Vergleichzeitraum 2001<br />
hat das Bundesland Burgenland den<br />
höchsten Zuwachs an Neueröffnungen<br />
mit 46,4 Prozent, gefolgt von Tirol mit<br />
17,9 Prozent und Wien mit 11,8 Prozent.<br />
Prognose: Im Jahr 2002 wird es voraussichtlich<br />
rd. 3.200 Konkurseröffnungen<br />
geben. Gegenüber dem Vorjahr<br />
würde der Anstieg an Eröffnungen somit<br />
bei ca. 5 Prozent liegen.<br />
14.090 Konkursaufhebungen (=Erledigungen)<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
wurden 14.090 Konkurse aufgehoben.<br />
Davon konnten 67,8 Prozent<br />
als Zahlungsplan und 25,7 Prozent<br />
als Abschöpfungsverfahren abgeschlossen<br />
werden. Seit der Einführung<br />
des Schuldenregulierungsverfahrens<br />
sind die Aufhebungen nach<br />
Zahlungsplänen stetig von anfangs<br />
57,5 Prozent auf 72,1 Prozent gestiegen.<br />
Hingegen sind die<br />
Zwangsausgleiche von rd. 15 Prozent<br />
auf 1,8 Prozent zurückgegangen.<br />
Die Abschöpfungsverfahren<br />
lagen im Durchschnitt bei 25,7<br />
Prozent.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
endeten die Schuldenregulierungsverfahren<br />
zu 72,1 Prozent (N=1.580) in<br />
Zahlungsplänen und zu 24,6 Prozent<br />
(N=538) in Abschöpfungsverfahren.<br />
Den größten Anteil an Abschöpfungsverfahren<br />
hatte das Bundesland Wien<br />
mit 26,8 Prozent zu verbuchen, gefolgt<br />
von Tirol mit 17,1 Prozent und Kärnten<br />
mit 13,9 Prozent.<br />
Gegenüber dem Jahr 2001 ist der Anteil<br />
der Zahlungspläne als Aufhebungsgrund<br />
um rd. 2 Prozentpunkte gestiegen,<br />
hingegen sind die Abschöpfungsverfahren<br />
um 1 Prozent gesunken.<br />
In diesem Zeitraum wurden 30 Ergebnisse,<br />
die bereits rechtsgültig aufgehoben<br />
waren, in Abschöpfungsverfahren<br />
(26,7 %) oder die Zahlungsplanquote<br />
(50%) abgeändert bzw. nachgebessert.<br />
6,1 Monate (Durchschnitts-)Verfahrensdauer: vom Konkursantrag bis Konkursaufhebung<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
lag die durchschnittliche Verfahrensdauer<br />
bei 185,5 Tagen oder<br />
6,1 Monaten (N= rd. 14.000).<br />
In den Bundesländern Burgenland<br />
und Wien dauerten die Verfahren<br />
um rd. 31 Tage (N=2.843) länger<br />
als im Schnitt. In Kärnten<br />
(N=2.205) wurde die kürzeste<br />
Durchschnittsverfahrensdauer mit<br />
4,6 Monate (138,4 Tage) ermittelt.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
betrug die durchschnittliche Dauer der<br />
Konkursverfahren etwa 3,7 Monate<br />
oder 113,5 Tage (N=977). Die Durchschnittsverfahrensdauer<br />
hat sich gegenüber<br />
dem Vorjahr nicht wesentlich<br />
verändert.
Seite 8 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
31,7 Prozent Masseverwalteranteil<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
betrug der durchschnittliche Masseverwalteranteil<br />
im Schuldenregulierungsverfahren<br />
rd. 31,7 Prozent<br />
(N=16.659). Lag er im Jahr 1995<br />
noch über 50 Prozent, so ist er bis<br />
2002 stetig auf 31,7 Prozent zurückgegangen.<br />
Im Bundesland Oberösterreich lag<br />
dabei der Masseverwalteranteil im<br />
Durchschnitt bei etwa 87,4 Prozent.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
lag der Masseverwalteranteil im Bundesschnitt<br />
bei 26,5 Prozent. In Oberösterreich<br />
lag dieser Anteil bei 86,9 Prozent.<br />
Gegenüber 2001 ist der Anteil an<br />
Masseverwaltern in Konkursverfahren<br />
unverändert.<br />
6,3 Prozent Arbeitslose; 8,2 Prozent Pensionisten<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
waren die Berufsgruppen Arbeiter<br />
und Angestellte mit über 70 Prozent<br />
am stärksten vertreten. Dieser Prozentsatz<br />
hat sich seit 1995 nicht<br />
wesentlich verändert. Im gleichen<br />
Zeitraum lagen die Gruppen der als<br />
arbeitslos geführten bei 6,3 Prozent,<br />
der Pensionisten bei 8,2 Prozent<br />
und der Selbständigen bei 7<br />
Prozent.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
lag der Arbeitslosenanteil bei 6 Prozent,<br />
gegenüber dem Jahr 2001 ist dieser<br />
Anteil gleichgeblieben. Die anderen<br />
Berufsgruppen, wie Beamte, Hausfrauen,<br />
Pensionisten, Selbständige usw.<br />
haben sich ebenfalls nicht wesentlich<br />
verändert.<br />
Durchschnittsalter 43,2 Jahre<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
lag das Durchschnittsalter der<br />
Schuldner, die einen Antrag auf<br />
Privatkonkurs gestellt haben, bei<br />
43,2 und das Medianalter bei 42<br />
Jahren. Rd. 54 Prozent der Antragsteller<br />
waren zwischen 30 und<br />
45 Jahre alt. Die Altersgruppe der<br />
35- bis 40-jährigen nahm dabei den<br />
größten Anteil mit 20,2 Prozent ein.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
lag das Durchschnittsalter bei 41 und<br />
das Medianalter bei 39,8 Jahren.<br />
55,3 Prozent der Antragsteller waren<br />
zwischen 30 und 45 Jahre alt. Den<br />
größten Anteil nahm dabei die Altersgruppe<br />
der 35 bis 40-jährigen mit 20,3<br />
Prozent ein.<br />
34,3 Prozent Frauen<br />
1.1.1995 –<br />
30.9.2002<br />
lag der Frauenanteil bundesweit an<br />
eröffneten Privatkonkursen bei rd.<br />
einem Drittel.<br />
In diesem Zeitraum verzeichnete<br />
Vorarlberg mit 27,4 Prozent den<br />
niedrigsten und Salzburg mit rd.<br />
40,2 Prozent den höchsten Frauenanteil.<br />
1.1. 2002 –<br />
30.9.2002<br />
lag bei eröffneten Privatkonkursen der<br />
Frauenanteil bei 35,2 Prozent. Im Bundesland<br />
Burgenland war der Frauenanteil<br />
mit 28,1 Prozent am niedrigsten und<br />
in Salzburg mit 42,3 Prozent am höchsten.<br />
Josef Haslinger, <strong>ASB</strong>
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 9<br />
Externe Statistik<br />
Lehrlingsstudie der Schuldnerberatung-NÖ<br />
Kurzer Überblick – April 2002<br />
Von der SB NÖ wurde in Zusammenarbeit mit Landesrätin<br />
Kranzl die Finanzgebarung und das Konsumverhalten<br />
von Lehrlingen erhoben.<br />
Methodik: postalische Fragebogenerhebung an 23<br />
NÖ-Berufsschulen (5321 Fragebögen).<br />
Eckdaten zur Befragung: Rd. 2050 Fragebögen (15<br />
Berufsschulen) wurden retourniert und ausgewertet<br />
(Rücklaufquote: 39 %).<br />
Eckdaten zur Studie: Von den ausgewerteten Fragebögen<br />
entfielen ¾ auf Männer und ¼ auf Frauen.<br />
Am Häufigsten vertreten war die Altersgruppe<br />
der 18-jährigen mit 33 %, gefolgt von den 17-<br />
jährigen mit 24 %.<br />
65 Prozent der Befragten verdienen zwischen 290<br />
€ bis 581 €. Über 436 € lagen 62 % der Männer<br />
und nur 33 % der Frauen.<br />
Über ein eigenes Girokonto verfügen 85 Prozent.<br />
52 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen<br />
haben einen Überziehungsrahmen.<br />
29 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen<br />
nutzen die Möglichkeit der Kontoüberziehung.<br />
Aktuelles Konsumverhalten: Mit der Lehrlingsentschädigung<br />
finanzieren fast alle ein Handy, ¾ ein<br />
KFZ.<br />
Zukünftiges Konsumverhalten: Unter den dringlichen<br />
Anschaffungen in den nächsten Jahren gaben<br />
60 Prozent den Führerschein und das Auto an. Der<br />
überwiegende Teil (ca. 80 %) möchte die Anschaffungen<br />
über Erspartes finanzieren.<br />
Weitere Informationen zur Studie: Doris Stöger;<br />
SB-NÖ - Wiener Neustadt; Tel.: 02622/84855.<br />
Zusammenfassung von Josef Haslinger, <strong>ASB</strong><br />
Die Presse, 25.7.2002
Seite 10 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Recht-Ecke<br />
Wissenswertes aus Gewerbeordnungsnovelle 2002 für SB<br />
Die Gewerbeordnungsnovelle 2002 (BGBl I<br />
2002/111) ist im Kernbereich seit 1.8.02 in Kraft.<br />
§ 13 GewO wurde neu verfasst, sodass die Konkurseröffnung<br />
keinen Gewerbeausschluss– bzw.<br />
Gewerbeentziehungsgrund mehr darstellt. (Hintergrund:<br />
Da die Entfaltung wirtschaftlicher Tätigkeiten<br />
auf selbständiger Basis unvermeidlich mit einem<br />
Risiko verbunden ist, soll die Teilnahme am<br />
Markt auch möglich sein, wenn dieses Risiko<br />
schlagend wurde).<br />
Gem. Abs. 1 sind von der Gewerbeausübung jedoch<br />
Personen ausgeschlossen, die zu einer mehr<br />
als dreimonatigen Freiheitsstrafe oder mehr<br />
als 180 Tagsätzen Geldstrafe verurteilt wurden,<br />
sowie generell alle Personen mit einer Verurteilung<br />
wegen betrügerischer Krida, Schädigung<br />
fremder Gläubiger, Begünstigung eines<br />
Gläubigers oder grob fahrlässiger Beeinträchtigung<br />
von Gläubigerinteressen (§§ 156<br />
bis 159 StGB).<br />
Gemäß Abs. 3 erfolgt ein Ausschluss von der Gewerbeausübung<br />
auch dann, wenn der Konkurs<br />
mangels eines kostendeckenden Vermögens<br />
nicht rechtskräftig eröffnet wurde und zwar<br />
solange diese Eintragung in der Insolvenzdatei<br />
noch ersichtlich ist.<br />
Unter bestimmten Umständen kann die Gewerbebehörde<br />
gemäß § 26 Abs. 2 GewO Nachsicht von<br />
Ausschlussgründen gewähren.<br />
Zusammenfassung Mag. Harald Hauer, <strong>ASB</strong><br />
(Details siehe ZIK 5/2002, S. 161 f.)<br />
Rechtsgültigkeit von E-Mails - Vertragsrücktritt mit E-Mail?<br />
Auch wenn es zweifellos eine gewisse Erleichterung<br />
darstellen würde; nach derzeitiger Rechtsprechung<br />
lautet die Antwort: nein. Laut Paragraf 3<br />
des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) muss<br />
der Rücktritt nämlich schriftlich erklärt werden. Ein<br />
herkömmliches E-Mail erfüllt dieses Schriftlichkeitsgebot<br />
grundsätzlich nicht. Es ist daher dringend<br />
zu empfehlen, den Rücktritt per eingeschriebenen<br />
Brief zu erklären (nach derzeitiger Rechtsprechung<br />
muss man davon ausgehen, dass auch<br />
der Rücktritt per Fax unwirksam ist). Das Schriftlichkeitsgebot<br />
wäre mit einem E-Mail nur dann<br />
erfüllt, wenn es mit einer so genannten „sicheren<br />
Signatur“ im Sinne des Signaturgesetzes versehen<br />
wäre. Diese elektronische Unterschrift gewährleistet,<br />
dass der Absender eines E-Mails tatsächlich<br />
identifiziert werden kann. Sichere Signaturen werden<br />
von Zertifizierungsdienste-Anbietern ausgestellt.<br />
Weitere Hinweise über derartige Signaturen<br />
und die bisher tätigen Zertifizierungsanbieter finden<br />
Sie auf der Website der Telekom-Control<br />
Kommission (www.rtr.at).<br />
Quelle: Konsument Heft 9/2002,<br />
http://www.konsument.at/konsument/print.asp?id<br />
=13603;<br />
Bankomatkartenmissbrauch<br />
Der Missbrauch von Bankomatkarten nimmt zu.<br />
Die Geschädigten sind über die hohen Schäden<br />
entsetzt. Die Banken klären über das Risiko zuwenig<br />
auf. Die Bankomatbedingungen erweisen sich<br />
als kundenfeindlich.<br />
Der VKI hat zunehmend mit Verbraucherbeschwerden<br />
rund um den Missbrauch von Banko-<br />
matkarten zu tun. Es hat den Anschein, als würden<br />
die Schadensfälle zunehmen. So verwies die Kriminalpolizei<br />
auf 50 Bankomatkartendiebstähle in<br />
zweieinhalb Monten allein in Vorarlberg (ORFON<br />
20.8.2002). Eine österreichweite Statistik von<br />
Missbrauchsfällen fehlt; ebenso wie eine – von den<br />
betreibenden Banken unabhängige - Aufsicht.
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 11<br />
Bankomatkartenmissbrauch<br />
Bei den Missbrauchsfällen muss man zwei Fallgruppen<br />
unterscheiden:<br />
Fall 1: Karte verloren/gestohlen<br />
In der Masse der Missbrauchsfälle wurde den geschädigten<br />
Bankkunden die Bankomatkarte idR<br />
gestohlen. Kurz nach dem Diebstahl wird an Bankomaten,<br />
aber insbesondere auch an Geldausgabeautomaten<br />
in Filialen der kontoführenden Bank<br />
Geld behoben. Die Täter verwenden die gestohlene<br />
Karte und tippen den richtigen PIN-Code ein.<br />
Daraus ziehen die Banken immer wieder den –<br />
voreiligen – Schluss, dass der Bankkunde den PIN-<br />
Code offenbar aufgeschrieben und mit der Karte<br />
verwahrt habe; eine Sorgfaltswidrigkeit nach den<br />
Bankomat-Bedingungen.<br />
Es gibt aber viele Möglichkeiten für Kriminelle, den<br />
PIN-Code auszuspionieren. Das beginnt beim Blick<br />
über die Schulter im Supermarkt, setzt sich über<br />
Spiegel, Mini-Cameras und andere technische<br />
Hilfsmittel fort und endet bei Attrappen von Bankomat-Kassen<br />
oder Zugangsgeräten für Bankfilialen.<br />
Die Frage, ob sich der PIN-Code auch „knacken“<br />
läßt, ist umstritten. Sicher ist: Der Code steht nicht<br />
am Magnetstreifen der Karte. Doch man findet dort<br />
Zahlenkombinationen, aus denen der Bankomat<br />
den richtigen PIN-Code errechnen kann. Wenn<br />
daher kriminelle Organisationen diesen Rechenvorgang<br />
kennen, dann ist der richtige Code errechenbar.<br />
Die Bankomatbetreiber beschwören, dass<br />
dieser Rechenvorgang nicht bekannt sei. In Gerichtsverfahren<br />
vor deutschen Gerichten haben<br />
Sachverständige nicht ausgeschlossen, dass das<br />
„Knacken“ des Codes doch schon vorgekommen<br />
sei. Das Indiz: Das sprunghafte Ansteigen von<br />
Missbrauchsfällen zu bestimmten Zeiten in<br />
Deutschland.<br />
Nach den Bankomatbedingungen haftet der Kunde<br />
nach Verlust oder Diebstahl der Karte bis längstens<br />
4 Stunden nach Meldung des Verlustes an die Bank<br />
(oder die österreichweite Sperr-Hot-Line). Die Haftung<br />
ist der Höhe nach nur insoweit begrenzt, als<br />
es für verschiedene Behebungen Limits gibt (siehe<br />
unten).<br />
Fall 2: Karte nicht abhanden / mysteriöse Behebungen<br />
Der VKI hatte sich in letzter Zeit auch mit Schadensfällen<br />
auseinanderzusetzen, wo Bankkunden<br />
immer im Besitz ihrer Bankomatkarte waren und<br />
von unbekannten Tätern dennoch Geldbehebungen<br />
stattgefunden haben. In solchen Fällen kamen<br />
offensichtlich Doubletten von Bankomatkarten zum<br />
Einsatz. Die Herstellung einer Doublette ist relativ<br />
simpel. Die Kriminellen kopieren mit Hilfe von Attrappen<br />
von Bankomatkassen bzw Zugangsgeräten<br />
bei Bankfilialen den Magnetstreifen von Bankomatkarten<br />
und spielen die Daten auf eine Doublette.<br />
Wenn dann der Bankkunde auch noch seinen PIN-<br />
Code auf der Attrappe eintippt, dann haben die<br />
Gauner alles (Kopie der Karte und Code) um sich<br />
an Geldausgabeautomaten zu bedienen. Der Kunde<br />
merkt diese Manipulationen erst, wenn ihm<br />
diese Beträge abgebucht werden.<br />
Wiewohl die Bankomatbedingungen für diesen Fall<br />
vorsehen, dass der Schaden von der Bank nicht<br />
auf den Kunden überwälzt werden kann, bedarf es<br />
in der Praxis doch immer wieder der Intervention<br />
des VKI, um die Banken daran zu erinnern.<br />
Hohe Limits / Hohes Risiko<br />
Da die Bankomatbedingungen dem Kunden – bei<br />
Diebstahl/Verlust der Karte – bis 4 Stunden nach<br />
Meldung das gesamte Risiko zuschieben, ist die<br />
Frage wesentlich, wie hoch dieses Risiko ist. In<br />
allen Fällen, die an den VKI herangetragen wurden,<br />
waren die Kunden entsetzt darüber, wie hoch<br />
dieses Risiko tatsächlich war.<br />
Vor Jahren war es noch relativ überschaubar: Man<br />
konnte mit der Bankomatkarte pro Tag am Bankomat<br />
nur ATS 5000.- beheben (für Einkäufe an<br />
der Bankomat-Kasse bestand ein Wochenlimit von<br />
ATS 15.000.-). Dieses Limit und damit Risiko ist<br />
den Kunden allgemein bekannt. Mit 1.1.2002 wurde<br />
dieses Limit für Geldbehebungen – so nicht<br />
anders vereinbart oder „verordnet“ (siehe unten) –<br />
auf 400 € festgesetzt.<br />
Dazu kommt die Möglichkeit an Geldausgabeautomaten<br />
in den Filialen der kontoführenden Bank –<br />
ebenfalls mit Karte und Code – Geld zu beheben.<br />
Die Limits dafür sind bei den Banken verschieden.<br />
Vor wenigen Jahren gab es Grenzen von ATS<br />
20.000,- (1.453,46 €) pro Tag. Heute sind 3000 €<br />
(ATS 41.280,90) gängig. Dem VKI liegen aber<br />
auch Schadensfälle vor, wo solche Grenzen nicht<br />
pro Tag, sondern pro Behebung vorgesehen sind.<br />
Das Ergebnis: Wenn die Gauner 9 mal hintereinander<br />
ATS 30.000.- (2.180,19 €) bekommen, dann ist<br />
in wenigen Minuten das Konto mit ATS 270.000.-<br />
(19.621,67 €) im Minus.<br />
Schließlich wurden auch die Bankomat-Limits „flexibilisiert“;<br />
d.h. die Bank kann nun mit dem Kunden<br />
auch höhere Limits als 400.- € pro Tag vereinbaren.<br />
Der technische Hintergrund für diese Maß-
Seite 12 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
nahme: Wurden früher die Bankomatbehebungen<br />
unabhängig vom Kontostand verwaltet, so ist jetzt<br />
der Durchgriff auf das Konto möglich. Die Bank<br />
garantiert das Limit nur, wenn damit der Überziehungsrahmen<br />
des Kontos nicht überzogen wird.<br />
Wird der Rahmen überschritten, sollte – theoretisch<br />
– keine Auszahlung erfolgen. Doch auch diese<br />
Sicherheitsgrenze funktioniert in der Praxis nicht.<br />
Dem VKI liegen Fälle vor, wo der gewährte Überziehungsrahmen<br />
durch missbräuchliche Behebungen<br />
Dritter auch noch überzogen werden konnte.<br />
Ein hohes Limit bedeutet also ein hohes Risiko. Ich<br />
kann – das wird von den Banken beworben – jetzt<br />
„ein Möbelstück um ATS 25.000.- kaufen“. „Genießen<br />
Sie jetzt: mehr Liquidität“, „mehr Flexibilität“<br />
und „mehr Komfort“. Ein Begriff fehlt in der Aufzählung:<br />
„mehr Risiko“. Auf das Risiko hoher Limits<br />
wird wenig oder gar nicht hingewiesen.<br />
Die Erhöhung von Limits – bei Bankomat und/oder<br />
Geldausgabeautomat im Foyer – wird von manchen<br />
Banken einseitig durchgeführt. Am Kontoauszug<br />
steht etwa zu lesen: „Ab 19.5.2002 können Sie<br />
mit Ihrer Bankkarte und Ihrem Code täglich Bargeld<br />
bis zu EUR 3.000.- an allen Geldausgabeautomaten<br />
beheben.“ Was großzügig klingt, bedeutet<br />
eine erhebliche Erhöhung des persönlichen Risikos.<br />
Der VKI geht davon aus, dass durch einseitige<br />
Erklärung der Bank das Risiko nicht einfach erhöht<br />
werden kann und man daher Anspruch auf Rückerstattung<br />
jenes Betrages hat, der über wirklich vereinbarte<br />
Limits hinaus – aufgrund missbräuchlicher<br />
Behebungen – abgebucht wird.<br />
Sperr-Zeit – „Die Lizenz zum Patzen?“<br />
In den Bankomatbedingungen sehen die Banken<br />
vor, dass der Kunde erst bis maximal 4 Stunden<br />
nach der Verlustmeldung seiner Karte von der<br />
Haftung befreit wird. Es ist aber in keiner Weise<br />
einsichtig, weshalb es Kreditkartenorganisationen<br />
möglich ist, eine Karte binnen Minuten weltweit zu<br />
sperren, dieser Vorgang aber bei der Bankomatkarte<br />
bis zu 4 Stunden dauern soll.<br />
In einem konkreten Fall hat eine Bank freimütig<br />
offengelegt, dass damit offenbar auch eigene Fehler<br />
abgepuffert werden sollen. Der Kunde hatte<br />
Minuten nach dem Diebstahl telefonisch den Verlust<br />
gemeldet. Die Bank brauchte etwa eine Stunde<br />
um die Meldung weiterzugeben und daraufzukommen,<br />
dass irrtümlich das falsche Konto gesperrt<br />
worden war. Warum soll der Kunde für diese<br />
Schlampereien haften?<br />
Tipps für den Bankkunden<br />
! Karte gut verwahren und regelmäßig prüfen, ob<br />
diese noch vorhanden ist.<br />
! PIN-Code merken, nicht gemeinsam mit der<br />
Karte verwahren und niemanden – auch nicht im<br />
Familienkreis – weitergeben.<br />
! Bei Bankomatbehebungen und Zahlungen an<br />
Bankomatkassen sich gegen den „Blick über die<br />
Schulter“ so gut es geht abschirmen.<br />
! An Bankomatkassen zunächst einmal den falschen<br />
Code eingeben. Bemerkt die Kassa den Fehler<br />
nicht, dann stehen Sie vor einer Attrappe.<br />
! Kontoauszüge sofort genau kontrollieren. Gegen<br />
missbräuchliche Buchungen sofort (schriftlich/eingeschrieben)<br />
Widerspruch erheben. Bankomatkarte<br />
nicht mehr benutzen.<br />
! Im Fall der Feststellung des Abhandenkommens<br />
der Karte sofort Meldung an die Bank (während<br />
Banköffnungszeit in Filiale – außerhalb Banköffnungszeit<br />
beim Sperrtelefon/Nummer auf jedem<br />
Bankomat ersichtlich). Telefonsperre am nächsten<br />
Bankwerktag in Filiale erneuern. Polizeiliche Anzeige<br />
erstatten.<br />
! Risiko minimieren durch Herabsetzung der Limits.<br />
Versuchen Sie mit Ihrer Bank sämtliche Limits<br />
der Karte (Bankomat, Bankomatkasse, Geldausgabeautomat<br />
in Filiale) auf ein für sie erträgliches<br />
Maß herabzusetzen (schriftliche Vereinbarungen!).<br />
!Verzichten Sie auf großzügige Überziehungsrahmen,<br />
wenn Sie diese nicht benötigen.<br />
Quelle: Verein für Konsumenteninformation (VKI),<br />
Rechtsabteilung: Dr. Peter Kolba
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 13<br />
Literaturhinweise<br />
Tatort Banken<br />
Maly, Alexander A.: Tatort Banken – Österreich, Schuldenfalle Europas, Preis 15,80 Euro<br />
Kämpfen auch Sie gegen Ihre Schulden?<br />
Sie sind damit nicht alleine.<br />
Die Verschuldung privater Haushalte steigt dramatisch,<br />
finanzielle Totalzusammenbrüche sind an<br />
der Tagesordnung.<br />
Jährlich werden in Österreich weit über eine Million<br />
Pfändungen bewilligt.<br />
Dabei sind die Probleme mit der steigenden Verschuldung<br />
hausgemacht: Österreich leistet sich<br />
eine Rechtsprechung, die einzigartig auf der ganzen<br />
Welt ist und Verschuldung fördert.<br />
Dieses Buch analysiert in anschaulicher und leicht<br />
verständlicher Form:<br />
Wie mit überschuldeten Menschen ein Riesengeschäft<br />
gemacht wird.<br />
Wer die Hauptverantwortung für das Schlamassel<br />
trägt.<br />
Warum die Schuldner immer jünger werden.<br />
Eine kleine Gesetzesänderung im Jahr 1986 brachte<br />
ein unglaubliches Wachstum sogenannter Konsumkredite.<br />
Deren bekannteste Form ist der Girokonto-Überzug.<br />
Er gilt mittlerweile als „Einstiegsdroge"<br />
für die spätere Schuldnerkarriere. Banken<br />
lassen offenbar nichts unversucht, um Kunden das<br />
Überziehen ihrer Konten schmackhaft zu machen.<br />
Großzügige „Überziehungsrahmen" werden eingeräumt<br />
und mit immer neuen Begriffen, wie „Ihre<br />
persönliche Einkaufsreserve" wird verschleiert,<br />
dass Geld ausgegeben werden soll, das eigentlich<br />
gar nicht vorhanden ist. Auf neue Formen des<br />
Zahlungsverkehrs, wie die von vielen Dienstleistern<br />
„verordneten" Einziehungsermächtigungen, trüben<br />
den Überblick über die eigenen Finanzen und führen<br />
zu immer höheren Kontoüberziehungen. Diese<br />
können oft nur noch mit Krediten abgedeckt werden,<br />
und das Kontoüberziehungsspiel beginnt von<br />
vorne. Ein Kreislauf entsteht, bei dem die finanzierenden<br />
Banken kein Risiko eingehen. So „hilft" der<br />
österreichische Staat mit jährlich unglaublichen<br />
760.000 Lohnpfändungen und 890.000 Gerichtsvollzieherpfändungen,<br />
Forderungen, die in Verzug<br />
geraten sind, einzutreiben. Auch die privaten Eintreiber<br />
(Inkassobüros) verzeichnen steigende Umsätze.<br />
Aus dem Zahlungsverzug ist ein blühendes Geschäft<br />
geworden. Die speziell österreichische<br />
Rechtslage macht das möglich. Da sich die Banken<br />
bei privaten Schuldnern kaum Risiken, aber gute<br />
Geschäfte erwarten, hat die Jagd nach immer jüngeren<br />
und unerfahreneren Kunden begonnen.<br />
Junge Menschen werden zum Schulden machen<br />
ermuntert, noch bevor sie eigenes Geld verdienen.<br />
Die politisch Verantwortlichen stecken den Kopf in<br />
den Sand. Da sie häufig selbst Eigentümer von<br />
Banken sind, haben sie sich deren Strategie angeeignet:<br />
Probleme kleinreden oder schweigend aussitzen.<br />
Zum Autor: Alexander Anton Maly, Jahrgang 1955, Diplomierter Sozialarbeiter, Schuldnerberater der ersten<br />
Stunde in Wien, tätig in der Schuldnerberatung der Stadt Wien:
Seite 14 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Zahlreiche Fachpublikationen zum Thema, Buchautor, Mitglied der ministeriellen Arbeitsgruppe zur Erstellung<br />
des Privatkonkurses. Vorher tätig als Sozialarbeiter im Projekt „Streetwork“, Amt für Jugend und Familie,<br />
Lehrbeauftragter an der Bundesakademie für Sozialarbeit und an der Fachhochschule für Sozialarbeit in<br />
Wien.<br />
Hinweis: Exemplare können ab Dezember 2002 über die ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong> bezogen werden.<br />
Kodek, Georg: Handbuch Privatkonkurs; Manz<br />
Verlag; Wien 2002; 338 Seiten; ISBN 3-214-<br />
12938-4; 79 Euro. Erschienen am: 16.09.2002<br />
Einen umfassenden Überblick über die Sonderbestimmungen<br />
für das Konkursverfahren natürlicher<br />
Personen bietet das im Manz Verlag erschienene<br />
"Handbuch Privatkonkurs". Autor Georg Kodek,<br />
seines Zeichens Universitätsdozent und Richter am<br />
Landesgericht Eisenstadt, spannt den Bogen seiner<br />
Abhandlung von Fragen der Zuständigkeit über die<br />
Konkursvoraussetzungen, insbesondere auch die<br />
Konkurseröffnung trotz fehlenden kostendeckenden<br />
Vermögens bis hin zu Zahlungsplan, Abschöpfungsverfahren<br />
und Verfahrenskosten. Die Änderungen<br />
durch die Insolvenzrechts-Novelle 2002<br />
wurden berücksichtigt, auch zahlreiche bisher unveröffentlichte<br />
Entscheidungen hat Kodek eingeflochten.<br />
Vogler-Ludwig, Kurt; Plesnila-Frank, Carlotta:<br />
Insolvenzberatung in Bayern – Effektivität und<br />
Effizienz des Förderprogramms zur Insolvenzberatung<br />
nach § 305 InsO (Insolvenzordnung) in Bayern.<br />
München, Mai 2002<br />
Die Studie untersucht die Effektivität und Effizienz<br />
der Insolvenzberatung in Bayern. Die Evaluierung<br />
soll Grundlage für die Neugestaltung der überwiegend<br />
von Wohlfahrtsverbänden und Kommunen<br />
durchgeführten Schuldner- und Insolvenzberatung<br />
sein. Sie wurde auf Basis eigener empirischer Erhebungen<br />
bei den 119 Schuldnerberatungsstellen<br />
in Bayern erstellt.<br />
Die Studie wurde im Auftrag des Bayerischen<br />
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,<br />
Familie und Frauen von der Fa. ECONOMIX – Research<br />
und Consulting erstellt.<br />
Der Endbericht ist downloadbar unter<br />
http://www.economix.org/insolv.htm.<br />
OÖ Rundschau, 1.8.2002
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 15<br />
Schwerpunktthema<br />
Europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL / Teil 1<br />
Ausgangssituation<br />
Auszug aus dem Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft (2000/C 127/02).<br />
Beschluss der Gemeinschaftsinitiative EQUAL<br />
Am 14. April 2000 hat die Kommission der Europäischen<br />
Gemeinschaften die vorliegenden Leitlinien<br />
für die Gemeinschaftsinitiative mit der Bezeichnung<br />
EQUAL genehmigt.<br />
Allgemeiner Strategieansatz<br />
Die Strategie für EQUAL baut gleichermaßen auf<br />
den Zielen des „Nationaler Aktionsplans gegen<br />
Armut und soziale Ausgrenzung“ (NAP) wie auf<br />
den Erfahrungen der Vorperiode auf. Die ESF-<br />
Maßnahmen im Rahmen von Beschäftigung und<br />
ADAPT wurden in die Programmplanungsperiode<br />
1995-1999 laufend evaluiert. Auf Grundlage dieser<br />
Erkenntnisse soll mit EQUAL die Möglichkeit geschaffen<br />
werden neue Methoden zur Zielerreichung<br />
(siehe unten unter Ziele von EQUAL) zu entwickeln<br />
und den daraus gewonnenen Mehrwert EU-weit zu<br />
verbreiten.<br />
Legende: ADAPT ist ein Förderprogramm der Europäischen<br />
Kommission, das zwischen 1995 und 2001 umgesetzt wurde.<br />
ADAPT war das erste Instrument europäischer Arbeitsmarktpolitik,<br />
in dem alle vier Säulen (siehe unten) der gemeinsamen<br />
Beschäftigungsstrategie verwirklicht wurden. Die Mittel von<br />
ADAPT kamen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).<br />
Gemeinschaftsfinanzierung von Europäische Sozialfonds (ESF) und nationalen Trägern<br />
Im Rahmen von EQUAL wird eine Gemeinschaftsfinanzierung<br />
in Form von Zuschüssen des Europäite<br />
Hoheitsgebiet der Europäischen Union (alle EU-<br />
bereitgestellt. EQUAL erstreckt sich auf das gesamschen<br />
Sozialfonds (ESF) und nationalen Trägern Mitgliedsstaaten).<br />
Ziel von EQUAL<br />
Ziel von EQUAL ist die Förderung neuer Methoden<br />
zur Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten<br />
jeglicher Art im Zusammenhang mit<br />
dem Arbeitsmarkt durch transnationale Zusammenarbeit.<br />
Politischer Kontext<br />
Die Festlegung von beschäftigungspolitischen Leitlinien<br />
(aufgebaut auf den vier Säulen: Beschäftigungsfähigkeit,<br />
Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit<br />
und Chancengleichheit) sowie ihre Umsetzung<br />
in nationale Aktionspläne für Beschäftigung<br />
durch die Mitgliedstaaten bilden den Rahmen für<br />
eine finanzielle Unterstützung auf EU-Ebene, insbesondere<br />
über die Strukturfonds.<br />
Auf Gemeinschaftsebene besteht eine integrierte<br />
Strategie zur Bekämpfung von Diskriminierungen<br />
(insbesondere von Diskriminierungen aus Gründen<br />
des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft,<br />
der Religion oder der Weltanschauung, einer<br />
Behinderung, des Alters oder der sexuellen<br />
Ausrichtung) und sozialer Ausgrenzung (insbesondere<br />
am Arbeitsmarkt).<br />
Allgemeine Grundsätze<br />
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Ungleichheit<br />
und Diskriminierung am Arbeitsmarkt (Arbeitslose,<br />
Beschäftigte und Gender/Gleichheit) soll EQUAL<br />
versuchsweise neue Wege zur Umsetzung der<br />
Beschäftigungspolitik entwickeln, umsetzen und<br />
verbreiten.
Seite 16 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Die „Vier Säulen“ der europäischen Beschäftigungsstrategie<br />
Beschäftigungsfähigkeit<br />
Zugangserleichterung<br />
zum Arbeitsmarkt; Bekämpfung<br />
von Rassismus<br />
und Fremdenfeindlichkeit<br />
am Arbeitsmarkt<br />
Unternehmergeist<br />
Erleichterung der Unternehmensgründung;<br />
Stärkung<br />
der Sozialwirtschaft<br />
(Verbesserung der Qualität<br />
am Arbeitsplätze)<br />
Anpassungsfähigkeit<br />
Förderung des lebenslangen<br />
Lernens und einer integrationsfördernden<br />
Arbeitsgestaltung;<br />
Förderung der<br />
Anpassungsfähigkeit am<br />
strukturellen, wirtschaftlichen<br />
Wandel, sowie die<br />
der<br />
Nutzung von neuen Informations-<br />
und Kommunikationstechniken<br />
Chancengleichheit von<br />
Frauen und Männern<br />
Erleichterung der Wiedereingliederung<br />
am Arbeitsmarkt<br />
in Verbindung<br />
mit der Vereinbarkeit von<br />
Beruf und Familie; Abbau<br />
geschlechtsspezifischen<br />
Diskrepanzen am<br />
Arbeitsmarkt<br />
Querschnittsthemen<br />
Zusätzlich zur thematischen Schwerpunktsetzung<br />
gibt es allgemeine Querschnittsthemen, wie das<br />
Kriterium des Gender Mainstreaming (Chancengleichheit<br />
von Männern und Frauen auf allen Ebenen)<br />
und die Nutzung des beschäftigungspolitischen<br />
Potentials neuer Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
(IKT), die in allen Modulen<br />
bzw. Arbeitspaketen berücksichtigt werden müssen.<br />
Transnationale Kooperation<br />
Die Transnationale Kooperation von Partnerschaften<br />
aus mehreren Mitgliedstaaten ist ein wesentlicher<br />
Bestandteil des EQUAL-Programms. Das Programm<br />
setzt auf die Fruchtbarkeit des Austausches<br />
und der gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten zur<br />
Überwindung von Diskriminierungen und Ungleichheiten<br />
auf dem Arbeitsmarkt.<br />
Von EQUAL zu fördernde Aktionen<br />
Aktion 1 Aktion 2 Aktion 3 Aktion 4:<br />
Vorbereitungsphase zur Realisierung der Arbeitsprogramme<br />
Thematische Vernetzung,<br />
Konstituierung der Entwicklungspartnerschaftelungspartnerschaften<br />
der Entwick-<br />
Verbreitung beispielhafter<br />
Lösungen und Umsetzung<br />
und zur Erarbeitung des<br />
in die einzelstaatliche<br />
Arbeitsprogramms auf<br />
Politik<br />
nationaler und transnationaler<br />
Ebene<br />
Technische Unterstützung<br />
bei der Programmumsetzung<br />
von Aktion 1, 2 und<br />
3.<br />
Die Aktionen 1 bis 3 erfolgen im wesentlichen hintereinander.<br />
Mit der Aktion 3 soll aber begonnen<br />
werden, sobald Ergebnisse aus der Aktion 2 zur<br />
Verbreitung verfügbar sind.<br />
EQUAL-Finanzierung<br />
Der Beitrag des Europäischen Sozialfonds zu<br />
EQUAL beträgt für den Zeitraum 2000-2006 insgesamt<br />
(EU-weit) 2.847 Millionen EUR (oder 39,2<br />
Mrd. ATS).<br />
Zusammenfassung von Josef Haslinger, <strong>ASB</strong><br />
Quelle: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft (2000/C 127/02).und<br />
www.equal-esf.
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 17<br />
EQUAL – Österreich<br />
Gemeinschaftsinitiative EQUAL in Österreich<br />
Im Mai 2001 wurde das österreichische Programm<br />
im Rahmen der neuen Gemeinschaftsinitiative für<br />
den Zeitraum 2000 - 2006 genehmigt.<br />
Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL - die zu gleichen<br />
Teilen aus dem Europäischen Sozialfonds<br />
(esf) und aus nationalen Mitteln (Bundesministerien)<br />
finanziert wird - hat das Ziel, neue Wege:<br />
in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht zu<br />
beschreiten und<br />
zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten<br />
im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt<br />
zu finden und zu erproben.<br />
Das Programm ist stark thematisch ausgerichtet<br />
und basiert auf der gemeinsamen Arbeit unterschiedlicher<br />
AkteurInnen im Arbeitsmarkt- und<br />
Bildungsbereich. Die Umsetzung des Programms<br />
erfolgt in Entwicklungspartnerschaften (EP)<br />
(mit mind. 6 PartnerInnen, davon ein transnationaler<br />
Partner).<br />
Die Gemeinschaftsinitiative wird in Österreich federführend<br />
vom Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Arbeit, in Kooperation mit dem Bundesministerium<br />
für Bildung, Wissenschaft und Kultur und dem<br />
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen<br />
durchgeführt.<br />
Grundsatz für Österreich<br />
Die Arbeitsmarktpolitik in Österreich basiert auf der<br />
Kombination eines Bündels von Maßnahmen aus<br />
Wirtschaft- und Sozialpolitik und auf der Betonung<br />
des sozialen Dialogs zwischen ArbeitgeberInnen<br />
und ArbeitnehmerInnen. Damit soll präventiv Arbeitslosigkeit<br />
vermieden und kurativ bestehende<br />
Arbeitslosigkeit bekämpft werden.<br />
Koordinierungsstelle EQUAL BÜRO ÖSTERREICH (EBÖ)<br />
Homepage: www.equal-esf.at<br />
Das EQUAL BÜRO ÖSTERREICH (EBÖ) - im Auftrag<br />
der Bundesministerien - unterstützt die Abwicklung<br />
des Programms und ist Ansprechpartner für alle an<br />
EQUAL Interessierten.<br />
Die EQUAL-Homepage beinhaltet im Überblick<br />
nachstehende Rubriken:<br />
Programminformationen zum Gemeinschaftsprojekt<br />
Entwicklungspartnerschaften<br />
News – tagesaktuelle Informationen<br />
Veranstaltungen (Veranstaltungskalender)<br />
Downloads (Inhalte: Verordnungen, Gesetze,<br />
Richtlinien, Leitlinien ...)<br />
Dialogforum (Fragen stellen und Informationen<br />
beschafften)<br />
EQUAL-Finanzierung in Österreich<br />
Der Europäische Sozialfonds (esf) wird in EQUAL-<br />
Österreich rund 101,7 Mio. EUR für die Förderung<br />
von Menschen mit Problemen im Zusammenhang<br />
mit dem Arbeitsmarkt bereitstellen. D.h. in Summe<br />
werden in Österreich von 2000 bis 2006 für das<br />
EQUAL-Projekt (Aktion 1 bis 4) 203,4 Mio. EUR (rd.<br />
2,8 Mrd. ATS) zur Verfügung gestellt.<br />
Für Österreich stehen somit vom EU-weiten<br />
EQUAL-Gesamtbudget rd. 3,6 Prozent zur Verfügung.
Seite 18 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Zeitrahmen der 3 Aktionen<br />
Zeitrahmen im Überblick<br />
Abgabetermin<br />
für Aktion 1<br />
15.8.01<br />
PROJEKT<br />
START<br />
Abgabetermin<br />
für Aktion 2+3<br />
30.4.02<br />
PROJEKT<br />
ENDE<br />
1.8.01 15.8.01 15.11.0 15.5.02<br />
15.9.02 15.9.05<br />
Konzept für<br />
Aktion 1<br />
Projektgenehmigung<br />
11/01<br />
Dauer: 6 Monate<br />
Projektgenehmigung<br />
23.7.02<br />
Projektphase<br />
AKTION 1<br />
Dauer: 36 Monate<br />
Projektphase<br />
AKTION 2<br />
Projektphase<br />
AKTION 3<br />
Aktion 1:<br />
Die Aktion 1 war als Vorbereitungsphase zur<br />
Konstituierung der Entwicklungspartnerschaften<br />
auf nationaler und transnationaler Ebene und Konzeptionierung<br />
für die in Aktion 2 durchzuführenden<br />
Aktivitäten vorgesehen.<br />
An der Aktion 1, die mit 15.05.2002 abgeschlossen<br />
worden ist, haben sich insgesamt 80 Entwicklungspartnerschaften<br />
beteiligt.<br />
Dauer der Aktion 1: 15.11.2001 bis 15.5.2002<br />
Die Themenwahl der eingereichten Entwicklungspartnerschaften zeigte dabei folgendes Bild:<br />
Thema<br />
Anzahl<br />
1A Reintegration 34 Anträge<br />
1B Maßnahmen für Behinderte 18 Anträge<br />
2 Bekämpfung von Rassismus 10 Anträge<br />
3 Sozialwirtschaft 30 Anträge<br />
4 Lebensbegleitendes Lernen 27 Anträge<br />
5 Reduzierung geschlechtsspezifischer Segregation 21 Anträge<br />
6 Maßnahmen für AsylwerberInnen 4 Anträge<br />
7 nicht eindeutig einem Thema zugeordnet 4 Anträge<br />
Insgesamt<br />
80 Anträge
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 19<br />
Aktion 2:<br />
In dieser Phase erfolgt die Umsetzung der Arbeitsprogramme<br />
der Entwicklungspartnerschaften<br />
(EP). Mit 30.8.2002 wurden nachfolgende Projekte<br />
formal/inhaltlich genehmigt und zur Durchführung<br />
der Aktion 2 und 3 beauftragt.<br />
Einreichungsendzeitpunkt für die Aktion 2 und 3:<br />
30.4.2002<br />
Dauer der Aktion 2: September 2002 bis September<br />
2005 – 36 Monate.<br />
Thema BM-Ressort Anzahl<br />
1A Reintegration arbeitsmarktferner Personengruppen BMWA 15 EP<br />
1B Integration von Behinderten BMSG 6 EP<br />
2 Bekämpfung von Rassismus BMWA 8 EP<br />
3 Sozialwirtschaft BMWA 12 EP<br />
4 Lebensbegleitendes Lernen BMWA/BMBWK 3 EP<br />
5 Reduzierung geschlechtsspezifischer Segregation BMWA 11 EP<br />
6 Maßnahmen für AsylwerberInnen BMWA 3 EP<br />
Insgesamt<br />
58 EP<br />
Legende: BM = Bundesministerium; BMWA = Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; BMSG = Bundesministerium<br />
für Soziales und Generationen; BMBWK = Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst; EP = Entwicklungspartner.<br />
Aktion 3:<br />
Um eine möglichst nachhaltige Verbreitung der<br />
entwickelten, innovativen Lösungsansätze zu erzielen,<br />
ist eine gesonderte Aktion für die Vernetzung,<br />
Verbreitung beispielhafter Lösungen und die Integration<br />
der Ergebnisse und<br />
Erfahrungen in Politik und Praxis („Mainstreaming”)<br />
vorgesehen.<br />
Dauer der Aktion 3: verläuft eher parallel zur<br />
Aktion 2 – bis September 2005.<br />
EQUAL ÖSTERREICH Periodikum (EQUartAL)<br />
EQUartAL – Informationen im Überblick:<br />
Inhalt des EQUartAL werden Kurzzusammenfassungen<br />
der Entwicklungspartnerschaften sein, die<br />
für die Aktion 2, 3, transnationale Kooperation<br />
zugelassen worden sind.<br />
In einer Art Directory soll EQUartAL ein gebundenes,<br />
gedrucktes Nachschlagewerk werden, das auf<br />
einen Blick über die Inhalte und Vorhaben aller EP<br />
Auskunft geben wird (nicht tagesaktuell).<br />
Im November 2002 soll nach Möglichkeit die erste<br />
Ausgabe des EQUartAL erscheinen.<br />
Zusammenfassung von Josef Haslinger, <strong>ASB</strong><br />
Quelle: www.equal-esf.at
Seite 20 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
EQUAL – „Schulden-Shredder“ – Aufnahmehindernis Schulden<br />
Projekt der ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong> - <strong>ASB</strong><br />
Entwicklungspartner und transnationale Partner<br />
Das Projekt „Schulden-Shredder“ besteht aus 15 EntwicklungspartnerInnen:<br />
EntwicklungspartnerInnen<br />
1 ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong> - <strong>ASB</strong><br />
Status<br />
Inhaltliche Gesamtkoordination;<br />
Modulverantwortung für Modul 1+4<br />
2 Public_Management Consulting Gmbh (PMC) Finanzielle Gesamtverantwortung<br />
3 Piber KEG Mitarbeit Modul 1+4<br />
4 Schuldnerberatung Tirol-Rechtsladen Verantwortung für Modul 2<br />
5 Schuldnerberatung KWH Wien Verantwortung für Modul 3<br />
6 Caritas Graz Mitarbeit Modul 3<br />
7 Schuldnerberatung Steiermark <strong>GmbH</strong> Mitarbeit Modul 3<br />
8 Neustart (ehemals VBSA Wien) Mitarbeit Modul 3<br />
9 Caritas Verband Salzburg Mitarbeit Modul 3<br />
10 Schuldnerberatung Salzburg Mitarbeit Modul 3<br />
11 Caritas Österreich Strategischer Partner<br />
12 Arbeiterkammer Wien Strategischer Partner<br />
13 Wirtschaftskammer Österreich Strategischer Partner<br />
14 Bundesministerium für Justiz Strategischer Partner<br />
15 Schuldnerberatung NÖ g<strong>GmbH</strong> Strategischer Partner<br />
und 4 transnationalen PartnerInnen:<br />
transnationalen PartnerInnen<br />
Staat<br />
1 Heureka Bildungsseminar <strong>GmbH</strong>/Quedlinburg Deutschland<br />
2 Verein Bildungszentrum Salzkammergut/ Ebensee Österreich<br />
3 Sächsische Aufbau und Qualifizierungsgesellschaft mbH (SAQ)/ Zwickau Deutschland<br />
4 Regionale Entwicklungsagentur des Bezirkes Usti/ Most Tschechien
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 21<br />
Themenwahl, Aktionsphasen und Finanzierung<br />
Das Projekt „Schulden-Shredder“ ist in das<br />
Schwerpunktthema: „Erleichterung des Zugangs<br />
zum Arbeitsmarkt: Reintegration in den Arbeitsmarkt<br />
und Bekämpfung von fortgesetzter Ausgrenzung,<br />
Erleichterung der Integration von Behinderten.“<br />
einzuordnen (siehe dazu oben: Zeitrahmen<br />
der 3 Aktionen, Thema A1).<br />
Das Projekt gliedert sich in 3 Phasen<br />
Aktion 1: Vorbereitungsphase<br />
Dauer: 15.11.02 - 15.5.02<br />
Geplantes Budget: 39.350 EURO<br />
Vereinbarungen treffen zwischen den Entwicklungspartnern (EP): Rolle der einzelnen EPs, detailliertes Arbeitsprogramm,<br />
Finanzplan, Verantwortung...<br />
Aktion 2: Umsetzungsphase<br />
Dauer: Sept. 02 bis Sept. 05 (36 Monate)<br />
Geplantes Budget: 1.019.233 EURO<br />
Umsetzung der vier Module<br />
Aktion 3: Verbreitungsphase (etwa Zeitgleich mit Aktion 2)<br />
Dauer: Sept. 02 bis Sept. 05 (36 Monate)<br />
Geplantes Budget: 181.002 EURO<br />
Verbreitung der Resultate, thematische Vernetzung und Sicherung der Nachhaltigkeit<br />
Geplantes Gesamtbudget (aller 3 Aktionen):<br />
rd. 1,24 Mio. EURO<br />
Zusätzliches, spezielles Querschnittsthema<br />
Ein zusätzliches EP-internes Querschnittsthema,<br />
welches in der EP „Schulden – Shredder“ projektübergreifend<br />
behandelt wird, ist die Situation<br />
gescheiterter Selbständiger.<br />
Transnationale Kooperation – „Wege zur Arbeit“<br />
Eine transnationale Vereinbarung im Rahmen des<br />
EQUAL Projektes „Schulden-Shredder“ zur Zusammenarbeit<br />
unter dem Titel „Wege zur Arbeit“ wurde<br />
mit zwei deutschen PartnerInnen aus den neuen<br />
Bundesländern, einem/r tschechischem/r und<br />
einem/r österreichischen PartnerIn geschlossen.<br />
Gerade in den neuen deutschen Bundesländern<br />
und in Tschechien, die einen sozialen Wandel vom<br />
kommunistischen zum marktwirtschaftlichen System<br />
vollzogen haben, ist die Überschuldung von<br />
Privatpersonen seit der Wende extrem angestiegen.<br />
Auch ist dort ein hoher Anteil von Arbeitslosen<br />
von Überschuldung betroffen, weswegen sich<br />
eine Kooperation mit diesen Ländern interessant<br />
gestalten wird.<br />
Rechtsformkooperation<br />
Zur Umsetzung des Projektes und zur Klärung der<br />
Haftungsfrage wurde eine eigene Rechtsform gegründet,<br />
eine Kommanditerwerbsgesellschaft<br />
(KEG) mit dem Namen Public Management & Consulting<br />
Gmbh & Co SCHULDEN-SHREDDER KEG an<br />
der 8 PartnerInnen beteiligt sind.
Seite 22 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Ausgangsproblematik<br />
Mehr als 180.000 Haushalte in Österreich sind<br />
überschuldet. Lebenssituationen wie Ver- und Ü-<br />
berschuldung verursachen Probleme bei der Arbeitsuche<br />
bzw. beim Arbeitsplatzerhalt (Dilemma:<br />
... => keine Arbeit => keine Schuldenregelung =><br />
keine Arbeit => ...).<br />
Durch gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren<br />
(seit 1995 möglich) kann die Schuldensituation von<br />
Arbeitnehmern teilweise bereinigt werden. Arbeitslose,<br />
Personen in kurzzeitigen oder prekären Arbeitsverhältnissen<br />
bzw. mit geringem Einkommen<br />
haben de facto diese Möglichkeit nicht (70% aller<br />
nicht möglichen Schuldenregulierungsverfahren<br />
betreffen diese Gruppe; Quelle: „Vom Schuldenregulierungsverfahren<br />
ausgeschlossen“ – Gemeinsame<br />
Erhebung der AK Wien und der ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong>,<br />
Linz 1999).<br />
Aus weiteren statistischen Daten der <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
ergibt sich ein Anteil der Arbeitslosen am<br />
Klientel von 26%, ehemals Selbstständiger von<br />
25% sowie Alleinziehende von 31%. Die Arbeitslosenquote<br />
der <strong>Schuldnerberatungen</strong> ist signifikant<br />
höher als es dem vergleichbaren Bevölkerungsdurchschnitt<br />
entspricht (2001: 26,74% arbeitslos;<br />
Quelle: Konkurs- und Eckdatenreport der ARGE<br />
<strong>Schuldnerberatungen</strong> 2001).<br />
Die häufigsten Verschuldungsursachen sind mangelnder<br />
Umgang mit Geld (26%), gescheiterte<br />
Selbstständigkeit (25%) und Arbeitslosigkeit<br />
(21%).<br />
Für ArbeitgeberInnen besteht ein erhöhter Zeitund<br />
Arbeitsaufwand und ein rechtliches Risiko<br />
(Drittschuldneranfragen, -haftung, Pfändungsberechnung<br />
...). Folglich sind von Exekution bedrohte<br />
Personen vom Verlust des sicheren Arbeitsplatzes<br />
bedroht bzw. haben geringere Chancen wieder in<br />
den Arbeitsprozess eingegliedert zu werden.<br />
Verschuldung ist somit eine strukturelle Diskriminierung<br />
am Arbeitsmarkt von der eine weite Zielgruppe,<br />
ausgehend von sozialen Randgruppen und<br />
arbeitsmarktfernen Personen über Beschäftigungslose<br />
bis hin zu ArbeitnehmerInnen und Selbstständigen<br />
unmittelbar betroffen ist.<br />
Gesamtstrategie und arbeitsmarktpolitische Zielsetzung<br />
Es geht um die Entwicklung neuer und spezialisierter<br />
Angebote abgestimmt auf arbeitsmarktrelevante<br />
Problemgruppen und die Entschärfung des Tabus<br />
„Schulden“ (Motto: „Über Schulden und Geld<br />
spricht man nicht“) und „Arbeitsmarkthindernis<br />
Schulden“.<br />
Von Verschuldung unmittelbar Betroffene (ArbeitnehmerInnen,<br />
arbeitsmarktferne Personen, Beschäftigungslose)<br />
sowie mittelbar Betroffene (ArbeitgeberInnen,<br />
Arbeitsvermittlungsstellen) erhalten<br />
sofort und unmittelbar Information zur Problematik<br />
und zu Lösungsmöglichkeiten.<br />
Für MitarbeiterInnen in Beratungsdiensten<br />
(Schuldnerberatungsstellen, Sozialberatungsstellen,<br />
Arbeitsvermittlungsstellen, Qualifizierungsmaßnahmen<br />
etc.) werden zielgruppenspezifische<br />
Konzepte zur Beratung erstellt, insbesondere für<br />
besonders vom Tabu „Schulden“ betroffene Personengruppen<br />
Beschäftigungslose, Alleinerziehende,<br />
Straffällige und ehemals Selbstständige.<br />
Das Selbsthilfepotential dieser Betroffenen wird<br />
gestärkt, indem der Zugang zu Regelungsmaßnahmen<br />
erleichtert und mit IKT unterstützt wird.<br />
Zudem werden Online-Selbsthilfe-Tools (Softwareprogramme)<br />
und KundInnen-PC´s in Beratungsstellen<br />
(„Schulden-Shredder“) für Betroffene zur<br />
Verfügung gestellt, die keinen Zugang zu PC´s<br />
haben.<br />
Mittel- und langfristig werden durch das Projekt die<br />
Chancen auf Arbeitsaufnahme und Arbeitsplatzerhalt<br />
für Verschuldete erhöht. Grundsätzlich werden<br />
volkswirtschaftliche Mittel (Arbeitslosenunterstützung,<br />
Notstandshilfe, Sozialhilfe etc.) eingespart<br />
und das Steuer- und Sozialversicherungsaufkommen<br />
erhöht.<br />
Die finanziell kritische Situation der Sozialbudgets<br />
der Länder erfordert neue und ergänzende Methoden<br />
und Modelle zur Beratung der im Projekt umfassten<br />
Zielgruppen , um den Entwicklungen gerecht<br />
zu werden (insbesondere der Entwicklung in<br />
der Nachfrage nach Schuldnerberatung – dzt. bestehen<br />
Wartezeiten auf Erstgespräche bis zu 3<br />
Monate nach Kontaktaufnahme).<br />
Konkrete Modulziele<br />
Verbesserter Zugang zum Arbeitsmarkt für Verund<br />
Überschuldete durch zielgruppenspezifische<br />
Angebote, insbes. für Beschäftigungslose, Haftentlassene,<br />
ehemals Selbständige (Arbeitsmarktinteg-
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 23<br />
ration), AlleinerzieherInnen und arbeitsmarktferne<br />
Personen.<br />
Arbeitsplatzsicherung für überschuldete ArbeitnehmerInnen<br />
Gerichtliches Schuldenregulierungsverfahren auch<br />
für Arbeitslose, Personen in kurzzeitigen oder prekären<br />
Arbeitsverhältnissen bzw. mit geringem Einkommen<br />
Sensibilisierung von ArbeitgeberInnen und Arbeitsvermittlungsstellen<br />
für die Situation überschuldeter<br />
ArbeitnehmerInnen<br />
Legislative Initiativen<br />
Modulsplitter – Im Überblick<br />
Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4:<br />
Infodienstcenter<br />
ArbeitgeberInnen-<br />
Sensibilisierung und<br />
Prävention<br />
Neue Konzepte für<br />
Zielgruppen mit Nähe<br />
zur Arbeitsmarktproblematik<br />
„Schulden-Shredder“<br />
in Beratungsstellen<br />
Kurzfassung<br />
Geplant ist die Entwicklung<br />
eines Webportals mit um eine Hilfestellung für Entwicklung von Integraden-Shredder“<br />
in Bera-<br />
Bei diesem Modul geht es Es geht dabei um die PC´s sollen als „Schul-<br />
einem ExpertInnen- überschuldete ArbeitnehmerInnen<br />
und Bebeitsmarkt<br />
vor allem über werden, welche sozial<br />
tionsmodellen am Artungsstellen<br />
aufgestellt<br />
Datenbanksystem zur<br />
österreichweiten, virtuellen<br />
Information und Bera-<br />
gezielte Information und en Beratungskonzepten den Zugang zu neuen<br />
schäftigungslose durch die Erarbeitung von neu-<br />
benachteiligten Personen<br />
tung für unmittelbar und Aufklärung (Sensibilisierung)<br />
von ArbeitgeberInpen<br />
wie Arbeitslose in und selbständige Vorar-<br />
für bestimmte Zielgrup-<br />
Technologien ermöglichen<br />
mittelbar Betroffene (Verschuldete<br />
Personen in nen im Umgang mit überschuldeten<br />
Personen vor, hende in Betreuung der spätere Beratung ermög-<br />
Maßnahmen, Alleinerziebeiten<br />
für eine eventuelle<br />
verschiedenen sozialen<br />
Situationen, ArbeitgeberInnen,<br />
Arbeitsvermitt-<br />
Entschuldungsprozess. mehrfachen Problemlagen len Kreditberechnungen,<br />
während und nach einem Caritas, Personen mit lichen. Auf den PC´s sollungsstellen,<br />
Selbständige,<br />
SchuldnerberaterIn-<br />
der Motivation von Ardulumsetzung<br />
überneh-<br />
Gläubigerlisten und<br />
Eine Studie zur Situation und Straffällige. Die Mo-<br />
Pfändungsberechnungen,<br />
nen, BeraterInnen aus beitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen<br />
bei tung KWH Wien, Schuld-<br />
KlientInnen zur selbstänmen<br />
die Schuldnerbera-<br />
Haushaltsbücher den<br />
anderen sozialen Einrichtungen,....).<br />
Das Infodienstcenter<br />
soll gleichstellt<br />
werden und Infor-<br />
Caritas Graz, Schuldner-<br />
Verfügung stehen. Die<br />
Überschuldung soll ernerberatung<br />
Steiermark, digen Erarbeitung zur<br />
zeitig eine österreich - mationsmaterialien daraus<br />
erarbeitet werden. tasverband Salzburg, dination dieses Moduls,<br />
beratung Salzburg, Cari-<br />
<strong>ASB</strong> übernimmt die Koor-<br />
und europaweite Beobachtungsstelle<br />
sein. Ein Schwerpunkt soll im Verein NEUSTART. Die weitere PartnerInnen sind<br />
Dieses Modul versteht Bereich der Schuldenprävention<br />
auf der gezielten Wien übernimmt die Ko-<br />
Schuldnerberatung NÖ.<br />
Schuldnerberatung KWH die Piber KEG und die<br />
sich als Klammermodul, in<br />
das Informationen und Information über die besondere<br />
Verschuldungssiordination<br />
dieses Moduls.<br />
Inhalte, die in den anderen<br />
Modulen entwickelt tuation von Jugendlichen/Lehrlingen<br />
liegen,<br />
werden, einfließen. Die<br />
Verantwortung für die im Hinblick auf deren<br />
Modulumsetzung übernimmt<br />
die ARGE Schuldaufbau.<br />
Die Verantwor-<br />
kontinuierlichen Existenznerberatungen,<br />
Partner tung für die Modulumsetzung<br />
übernimmt die<br />
ist die Piber KEG.<br />
Schuldnerberatung Tirol-<br />
Rechtsladen.<br />
Zusammenfassung von Mag. Christa Leitner<br />
und Josef Haslinger, <strong>ASB</strong><br />
In der nächsten Ausgabe der <strong>ASB</strong>-Informationen (Dez. 2002) wird im Detail über die 4 Module berichtet.
Seite 24 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Themensplitter<br />
Probieren kann man es ja ...<br />
Drei Tatsachenberichte, bei denen man sich wünschen<br />
würde, es wären Märchen:<br />
Fall 1:<br />
Der erste betrifft eine junge Frau, die mit 18 Jahren<br />
(damals noch minderjährig) ohne pflegschaftsgerichtliche<br />
Genehmigung eine Mithaftung für ihren<br />
Vater eingeht, der einen Konsumkredit in Anspruch<br />
nimmt. Der Vater gerät in der Folge in Zahlungsverzug;<br />
die Bank klagt (natürlich nicht nur<br />
den Vater). Die Tochter – nunmehr volljährig –<br />
unternimmt nichts gegen die Klage. Es ergeht ein<br />
Versäumungsurteil, das rechtskräftig wird. Nach<br />
jahrelangen Exekutionen begibt sich die Frau im<br />
Alter von 29 Jahren in die Schuldenberatung –<br />
einziger Ausweg aufgrund bestehender Zahlungsunfähigkeit:<br />
ein Privatkonkurs.<br />
Fall 2:<br />
Der zweite Sachverhalt ist noch krasser: Hier geht<br />
eine 15jährige türkische Jugendliche – natürlich<br />
ohne pflegschaftsgerichtliche Genehmigung – eine<br />
Bürgschaft für den Kredit ihrer Eltern (ATS<br />
310.000,00) ein. Mit 16 Jahren unterschreibt sie<br />
nochmals als Mitschuldnerin für ATS 110.000,00.<br />
Dieses Rechtsgeschäft lässt sich die Bank vom<br />
Vater genehmigen. Auch hier geraten die Eltern in<br />
Zahlungsverzug; „leider“ ist die junge Frau nun<br />
volljährig und weiß nicht, dass sie gegen die Klage<br />
der Bank mit Erfolg vorgehen könnte, weil die eingegangenen<br />
Haftungen „faul“ sind. Es ergeht ein<br />
Versäumungsurteil, das in Rechtskraft erwächst.<br />
Fall 3:<br />
Tatsachenbericht Nr. 3 handelt von einem<br />
18jährigen Türken, der – als man in Österreich erst<br />
mit 19 volljährig wurde – eine Bürgschaft für seinen<br />
Bruder eingegangen ist. Eigenes Einkommen<br />
hatte er bereits (ATS 16.000,00 netto). Anhaltspunkte<br />
für eine Sittenwidrigkeit ergeben sich nicht.<br />
Eine Anfechtung der Bürgschaft wegen mangelnder<br />
Geschäftsfähigkeit scheidet aus, weil nach<br />
geltendem IPR das Personalstatut der Türkei gilt<br />
(dort gibt es schon länger als in Österreich die<br />
Volljährigkeitsgrenze von 18 Jahren).<br />
In allen drei Fällen dasselbe Muster:<br />
Die Banken sichern sich ihre Kreditvergaben mit<br />
durch und durch fragwürdigen Praktiken ab. Sie<br />
schrecken nicht davor zurück, junge, teilweise<br />
noch minderjährige Menschen in eine Mithaftung<br />
zu nehmen, welche die Existenz dieser Menschen<br />
unter Umständen stark beeinträchtigen kann.<br />
Als Schuldenberater steht man solchen Praktiken<br />
ohnmächtig gegenüber. Was tun? – Ein generelles<br />
Verbot von Bürgschaften gesetzlich verankern!<br />
Ich höre bereits das Gegenargument der Kreditgeber:<br />
Dann können sich eben künftig weit weniger<br />
Leute ihre Wünsche erfüllen. Wie fadenscheinig! –<br />
Vielleicht können sich dann auch Banken weniger<br />
Wünsche erfüllen!? Sich weniger Wünsche erfüllen<br />
zu können, soll aber manchmal gar nicht so<br />
schlecht sein.<br />
Mag. Eike Grabher<br />
IfS-Schuldenberatung Bregenz<br />
„eJustiz“ oder „Im Dienste des Bürgers (?)“<br />
Aus den Materialien einer BMJ-Pressekonferenz zur<br />
Modernisierung der Verfahrensautomatisation in<br />
der Justiz unter dem Titel „eJustiz im Dienste des<br />
Bürgers“<br />
Das Unternehmen Justiz:<br />
- Gerichte auf 4 Ebenen: Oberster Gerichtshof<br />
(OGH), 4 Oberlandesgerichte (OLG), 21 Landesgerichte<br />
(LG), 166 Bezirksgerichte (BG);<br />
- Ca. 7.400 MitarbeiterInnen (Stand: 1.7.2002),<br />
davon sind: 1.992 RichterInnen und StaatsanwältInnen,<br />
5.417 andere Bedienstete, dazu<br />
kommen noch 3.365 MitarbeiterInnen bei 29<br />
Justizanstalten;<br />
- Jahresbudget: 810 Mio. Euro Ausgaben und<br />
647 Mio. Euro Einnahmen. 80 Prozent des Justiz-Budgets<br />
wird durch Einnahmen abgedeckt.
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 25<br />
Pro Jahr ca. 3,6 Mio. neue Fälle in insgesamt<br />
40 unterschiedlichen Verfahrensarten.<br />
Das ergeben:<br />
- 820.00 Zivilverfahren<br />
- 1.180.000 Exekutionsverfahren<br />
- 114.00 Strafverfahren<br />
- 610.000 staatsanwaltschaftliche Verfahren<br />
(= in Summe: 2,7 Mio. Verfahren)<br />
Rationalisierungen durch<br />
- Poststrasse im Bundesrechenzentrum (ca. 8,5<br />
Mio. Postsendungen im Jahr = ca. 24 Mio. Seiten)<br />
- ca. 3.500 TeilnehmerInnen im Elektronischen<br />
Rechtsverkehr (ERV) mit ca. 1,8 Mio. Eingaben<br />
(80% der Klagen der BG’s, 60% der Vollstreckungsanträge)<br />
und 3,7 Mio. elektronischen<br />
Zustellungen<br />
- Ediktsdatei (95%-ige Verringerung der Publikationskosten)<br />
Diese Zahlen veranschaulichen m.E. deutlich, in<br />
welch hohem Maß automationsunterstützt gearbeitet<br />
wird und wie sehr die Klientel der <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
zu beachten hat, dass in dieser Maschinerie<br />
keine ungerechtfertigen Vollstreckungstitel<br />
und –maßnahmen in Rechtskraft erwachsen. Ob,<br />
wie im Titel der Pressekonferenz angeführt, tatsächlich<br />
alles „im Dienste des Bürgers“ erfolgt,<br />
bleibt zu hoffen aber auch fraglich…<br />
Quelle: www.bmj.gv.at/aktuelles/; Präsentationsunterlagen<br />
des BMJ zur Pressekonferenz<br />
(28.10.02) „eJustiz im Dienst des Bürgers – Modernisierung<br />
der Verfahrensautomation Justiz<br />
(VJ)“.<br />
Zusammenfassung von<br />
Mag. Harald Hauer, <strong>ASB</strong><br />
Chaos bei Jugendkonten der Banken<br />
Wiener Jugendanwaltschaft deckt Missstände auf<br />
U-Titel: Präsentation der Erhebungsergebnisse bei Zinsen, Überziehungen, Bankomatkarte, falscher oder<br />
unzureichender Beratung<br />
Immer wieder melden sich in der Kinder- und Jugendanwaltschaft<br />
Wien Jugendliche oder besorgte<br />
Eltern und berichten, dass in den Bankfilialen falsche<br />
oder unzureichende Beratung (zu Zinsen,<br />
Überziehungen, Bankomatkarte) gegeben werden,<br />
dass Überziehungen bei Jugendkonten toleriert<br />
werden, dass unter 14-jährige zur Unterschriftenleistung<br />
zu einer Kontoeröffnung angehalten werden<br />
und einiges mehr. So hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft<br />
Wien eine Erhebung mit der<br />
bewährten Methode des Mystery Shopping durchgeführt,<br />
um diese Situation näher zu betrachten.<br />
Die Erhebung:<br />
Der männliche Jugendliche stellte sich (wahrheitsgemäß)<br />
mit folgenden Angaben vor:<br />
Jugendlich - 16 Jahre - kein Einkommen - Schüler -<br />
Nachhilfe und Ferialpraxis sind seine Einkommensquellen.<br />
Er möchte gerne ein Jugendkonto eröffnen und<br />
interessiert sich für die Bedingungen dafür.<br />
Besonderes Augenmerk legt er auf Zinsen, Kunden/Bankomatkarte,<br />
Überziehungsrahmen.<br />
Die Eltern gestatten die Eröffnung eines Kontos,<br />
aber wollen mit dem Konto nichts zu tun haben -<br />
also keine Unterschriften leisten. Diese Ausgangssituation<br />
war in allen Instituten bei allen Kundenbetreuern<br />
gleich. Unterschiedlich jedoch die Ergebnisse<br />
der Gespräche.<br />
Es wurden 7 verschiedene Bankinstitute (PSK, BA-<br />
CA. BAWAG, Raiffeisen, Erste Bank, HYPO NÖ,<br />
Volksbank) und insgesamt 15 Filialen besucht.<br />
Die Ergebnisse:<br />
Die Berater sind nicht auf Auskünfte über Jugendkonten<br />
vorbereitet (53 % mussten nachfragen<br />
oder nachtelefonieren).<br />
Die Differenzen in den einzelnen Informationsmaterialien<br />
(Internet, Prospekte, Infoblätter) und der<br />
mündlichen Beratung sollten vermieden werden<br />
(z.B. veraltete Prospekte werden ausgehändigt).<br />
Die Informationen in einzelnen Filialen eines Institutes<br />
sind manchmal unterschiedlich. Bei 57 % der<br />
Banken (4 von 7 Instituten) wurden unterschiedliche<br />
Infos in den beiden Zweigstellen gegeben.<br />
Die Beratungsdauer scheint größtenteils zu kurz zu<br />
sein, um einen wirklichen Überblick über die Bedingungen<br />
zu geben (kürzeste Beratung: 10 Sekunden,<br />
durchschnittliche Beratung: 7 Minuten).<br />
Habenzinsen bewegen sich zwischen 0,25 Prozent<br />
und 4 Prozent. Sollzinsen bewegen sich zwischen 0<br />
Prozent (da keine Überziehung offiziell möglich<br />
ist) und 9,5 Prozent.<br />
Kunden-/Bankomatkarte - Überziehungsrahmen:<br />
Hier reicht die mündliche Auskunft von Bankomatkarte<br />
sofort und ohne Unterschrift der Eltern bis<br />
ausschließlich Überziehung mit Elternunterschrift<br />
möglich.
Seite 26 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Die Forderungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft<br />
Wien:<br />
Jugendliche sind auch Kunden und sollten daher<br />
zumindest ebenbürtig wie Erwachsene betreut<br />
werden.<br />
Da Jugendliche in der Regel die Informationen<br />
ernst nehmen, die sie erhalten, sollten für die Berater<br />
und die Jugendliche eindeutige Infostandards<br />
gegeben sein: Internethomepage mit allen Detailinfos<br />
und nicht nur Allgemeinplätze und Lockangebote<br />
aus dem Freizeitbereich.<br />
Jugendclubs können ein wesentlicher Faktor für die<br />
Institutsbindung von Jugendlichen sein, doch auch<br />
klare Sachinformationen (Zinsen, Kosten, Kontoführung,<br />
Überziehungen) müssen gegeben werden.<br />
Die Problematik der Kontoüberziehungen von Jugendlichen<br />
muss neu überdacht werden und allen<br />
Instituten gleich vorgegeben werden. Auch wenn<br />
dadurch genauere Bestimmungen im Bankwesengesetz<br />
notwendig sind. Daher hat auch der Gesetzgeber<br />
zu überlegen, welche Richtlinien im<br />
Bankwesengesetz geändert bzw. noch dazugenommen<br />
werden sollten.<br />
Die Bedingungen rund um die Handhabung von<br />
Bankomatkarten sollten für alle Jugendlichen gleich<br />
sein und nicht vom Bankinstitut abhängen. Jugendliche<br />
ohne Einkommen muss es verwehrt<br />
werden, sich auch nur geringfügig zu verschulden.<br />
Wenn ein Jugendkonto Überziehungen aufweist,<br />
muss durch vorherige Unterschriftenleistung der<br />
Eltern garantiert sein, dass diese die Schulden<br />
abdecken müssen. Jugendlichen mit eigenem Einkommen<br />
dürfte eine Überziehung nur bis zu einem<br />
sehr geringen Betrag möglich sein.<br />
Die Werbemaßnahmen der Institute für die jeweiligen<br />
Jugendkonten müssen seriös und sorgsam<br />
gehandhabt werden.<br />
Die beiden Jugendanwälte Pinterits und<br />
Schmid zu diesem Ergebnissen:<br />
Erst wenn obige Rahmenbedingungen erfüllt sind,<br />
können Eltern die Bankgeschäfte ihrer Jugendlichen<br />
vertrauensvoll in die Hände der Institute legen.<br />
Die Banken müssten sich bewusst werden, dass sie<br />
eine wichtige Aufgabe im Lernprozess der Jugendlichen<br />
besitzen, wenn es um den Umgang mit Geld<br />
geht. Sie haben daher äußerste Sorgfaltspflicht in<br />
der Betreuung ihrer jugendlichen Kunden zu garantieren.<br />
Gleichzeitig ist es Aufgabe des Staates den Banken<br />
klarere Richtlinien für ihre Bankgeschäfte mit Jugendlichen<br />
vorzugeben und diese im Bankwesengesetz<br />
festhalten.<br />
„Es dürfte niemanden in Österreich mehr möglich<br />
sein, mit Schulden von Jugendlichen Geld zu verdienen“,<br />
schlossen die beiden Jugendanwälte Pinterits<br />
und Schmid.<br />
Pressegespräch vom 2.10.02, im Cafe Stein, mit<br />
Monika Pinterits, Anton Schmid (beide Wiener Jugendanwälte)<br />
und Alexander A. Maly (Schuldnerberater<br />
der Stadt Wien)<br />
<strong>ASB</strong>-Arbeitsgruppe „Jugend und Schulden“<br />
Das erste Treffen der <strong>ASB</strong>-Arbeitsgruppe „Jugend und Schulden“ fand am 8.8.2002 statt. Mag. Martin Moser<br />
(Schuldnerberater der Schuldnerberatung Tirol – Rechtsladen) ist für die Koordinierung der Arbeitsgruppe<br />
zuständig.<br />
Situation der präventiven Jugendarbeit und deren Zielsetzungen in den jeweiligen<br />
Bundesländern:<br />
Kärnten<br />
Schuldnerberatung Kärnten<br />
Personelle Ressourcen:<br />
Für die Koordinierung und Durchführung präventiver<br />
Maßnahmen (Schuldenprävention) werden<br />
40h/Woche zur Verfügung gestellt.<br />
Im Auftrag der Soziallandesrätin wurden folgende<br />
Projekte entwickelt:<br />
- Projekt „Mit mir nicht“: Es wurde eine MultiplikatorInnen-Mappe<br />
erstellt und druckreif<br />
gemacht. Hiefür wurden EUR 50.000,- für die<br />
Ausarbeitung und für das Drucken (400 Exemplare)<br />
aufgewendet.<br />
- Weiters werden LehrerInnenseminare direkt<br />
vor Ort (in Schulen) im Ausmaß von jeweils<br />
2 Stunden abgehalten. Die erstellte MultiplikatorInnen-Mappe<br />
soll als Lehrbehelf dienen.
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 27<br />
- Ab Herbst 2002 wird für das Abhalten von<br />
Seminaren eine vollbeschäftigte Präventionskraft<br />
in der Schuldnerberatung Kärnten angestellt.<br />
Die Plattform „Schuldenfragen“ wurde<br />
von der zuständigen Soziallandesrätin ins Leben<br />
gerufen.<br />
Niederösterreich<br />
Schuldnerberatung NÖ<br />
Lt. NÖ Sozialhilfegesetz ist die Schuldnerberatung<br />
NÖ für die Durchführung von präventiven Maßnahmen<br />
in bezug auf „Schulden“ neben der Beratung<br />
von SchuldnerInnen zuständig. An der Umsetzung<br />
dieser gesetzlichen Auflage wird gearbeitet:<br />
Vorträge an Schulen finden laufend statt.<br />
Personelle Ressourcen:<br />
In Amstetten werden 20 Wochenstunden nur für<br />
Jugendarbeit reserviert.<br />
Projekte:<br />
- Schulwettbewerb „Null Defizit“: Sieger wurden<br />
im ORF Radio (Radiobeitrag) gesendet.<br />
- „born 2 b free“ - Plakataktion für Jugendli<br />
che: Aufgrund der Herabsetzung der Volljährigkeit<br />
von 19 auf 18 Jahre wurde eine Plakataktion<br />
zum Thema „Volljährigkeit und Schulden“<br />
gestartet.<br />
- Empirische Studie an Berufsschulen in<br />
NÖ: In Zusammenarbeit mit der LRin Kranzl<br />
wurde ein Fragebogen erstellt und an 23 Berufsschulen<br />
in Niederösterreich verschickt. Ü-<br />
ber 2.000 Fragebögen wurden retourniert und<br />
ausgewertet. Die Studie gibt einen Überblick<br />
zur gegenwärtigen Finanzgebarung der Jugendlichen<br />
und Einschätzungen über das aktuelle<br />
und zukünftige Konsumverhalten (siehe<br />
dazu Seite 9, Lehrlingsstudie).<br />
- Vorträge zu einschlägigen Themen: wie Leasing,<br />
Kredite etc...<br />
Oberösterreich<br />
Verein für prophylaktische Sozialarbeit –<br />
Schulden- und Familienberatung<br />
Personelle Ressourcen:<br />
Für die Schuldenprävention stehen 40h/Woche zur<br />
Verfügung und weitere 5h/Woche für Schulbesuche.<br />
Projekte:<br />
- „Prophylaktischer Herbst“: 8 Abende in<br />
kleinen Gruppen und 1 großer Vortrag über<br />
Hauswirtschafts-Pädagogik mit Karl Kollmann<br />
von der Arbeiterkammer Wien.<br />
- Inszenierung eines Theaterstückes „Cash<br />
Dog“ - 2 Aufführungen im Landestheater in<br />
Linz.<br />
- Kinoclip mit Computeranimation wurde von<br />
der Fachhochschule Hagenberg erstellt und<br />
wird im Herbst 02 gestartet. Der Kinoclip wird<br />
in diversen Kinos als Vorspann gezeigt.<br />
- Handyratgeber als Begleitmaterial<br />
- Seminar für und mit Lehrlingen – auf Initiative<br />
diverser, oberösterreichischer Firmen<br />
- Schuldenprävention an Hauptschulen<br />
(Schulstunden)<br />
Schuldnerberatung Oberösterreich – Klartext<br />
Personelle Ressourcen:<br />
2 Mitarbeiter á 30 Wochenstunden und eine Verwaltungskraft<br />
mit 20 Wochenstunden stehen zur<br />
Verfügung.<br />
Ausgangssituation (Erfahrungswerte):<br />
Prävention schon im Kindergarten anbieten.<br />
Klartext geht weg von Beratung in Haupt- und<br />
höheren Schulen hin zu Volksschulen. Die Erfahrung<br />
zeigt, dass bei Kindern gute Erfolge erzielbar<br />
sind, da diese entwicklungspsychologisch in einer<br />
stabilen Phase sind. Es werden Workshops ab 3<br />
Stunden angeboten.<br />
Projekte:<br />
- „Schuldenkoffer“ wird 2003 überarbeitet<br />
- Homepage „Klartext“ wird überarbeitet<br />
- Ab Herbst 2002 Beratung in der Volksschule<br />
St. Oswald/Mühlviertel von 6-10 Jährigen (6<br />
Unterrichtsblöcke pro Klasse ). In Zukunft sollen<br />
Volksschulen dieses Angebot gegen Honorar<br />
beziehen.<br />
Salzburg<br />
Schuldnerberatung Salzburg<br />
Personelle und finanzielle Ressourcen:<br />
Derzeit keine Ressourcen für Prävention vorhanden.<br />
Es stehen Überlegungen an, wie Prävention<br />
finanziert werden kann.<br />
Es werden sporadisch Vorträge durchgeführt.<br />
Matthias Reiter hat eine Diplomarbeit zum Thema<br />
„Sucht“ in Arbeit, mit ihm könnte in Zukunft zusammengearbeitet<br />
werden
Seite 28 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Tirol<br />
Schuldnerberatung Tirol – Rechtsladen<br />
Personelle Ressourcen:<br />
Voraussichtlich kann erstmals nächstes Jahr<br />
(2003) eine Präventionsstelle mit 20 Wochenstunden<br />
für Jugendarbeit eingerichtet werden.<br />
Zusage über eine Startfinanzierung über EUR<br />
22.000,-- von dem sogenannten „Pakt für Arbeit<br />
und Wirtschaft“ liegt vor.<br />
Projekte:<br />
Es gibt ein Konzept für direkte Jugendinformation<br />
an Berufsschulen und mittleren Schulen.<br />
(Dieses wurde als Pilotprojekt letztes Jahr erfolgreich<br />
ausprobiert.)<br />
Zielsetzungen:<br />
Direkte Informationen zur „Schuldenproblematik“<br />
in Schulklassen – Berufsschulen und mittlere Schulen.<br />
Derzeit ist kein Einsatz von MultiplikatorInnen und<br />
keine Erstellung von Broschüren geplant, aber<br />
langfristig wünschenswert.<br />
Vorarlberg<br />
IfS-Schuldenberatung<br />
Personelle Ressourcen:<br />
50.000,-- € werden (lt. Landtagsbeschluss) für die<br />
Jugendarbeit bereitgestellt. Dies bedeutet eine<br />
Halbtagsstelle für die Schuldnerberatung zur Jugendarbeit.<br />
Projekte:<br />
- regelmäßige Vorträge, wobei jeweils Kosten<br />
von EUR 215,-- für 2 Unterrichtseinheiten verrechnet<br />
werden.<br />
- SchuldnerberaterInnenkiste: einjähriges<br />
Projekt.<br />
- Herbst 02: "Cash & Co" - neues Spiel (auf<br />
CD-Rom) für Jugendliche und Junggebliebene<br />
zum Thema "Umgang mit Geld". CD-Rom wird<br />
von der Raiffeisen Bank finanziert.<br />
- Internationales Computerprogramm<br />
(SUPRO – Suchtprophylaxe in Dornbirn)<br />
- Konzept „Schuldenfrei ins Leben“<br />
Ziele:<br />
- MultiplikatorInnen - Ausbildung wäre erwünscht<br />
- Fachtagung über Prävention. Finanzielle und<br />
inhaltliche Unterstützung vom Büro für Zukunftsfragen.<br />
Ein Wettbewerb für Jugendliche<br />
soll stattfinden, welche die Tagung selbst präsentieren.<br />
Ziele der Arbeitsgruppe<br />
- Austausch der Aktivitäten: Informationsfluss,<br />
Unterlagen, Vermittlung und inhaltliche Auseinandersetzung<br />
sollen gepflegt werden.<br />
- Österreichweite Projekte entwickeln<br />
- Internationaler Austausch entwickeln und<br />
„pflegen“<br />
- Finanzierung: Evaluation - „Wird Prävention<br />
effizient und effektiv eingesetzt und wie verkaufe<br />
ich Prävention?“<br />
- Aus- und Weiterbildung von Präventionsbeauftragen<br />
(z.B. Vortragender Karl Kollmann von<br />
AK-Wien)<br />
- Bundesweite Absprache in Grundsatzfragen,<br />
Abgleichen von Präventionsdaten (Kennzahl:<br />
Wie viele Präventionsbeauftragte sind pro wieviel<br />
Einwohner notwendig bzw. erforderlich?)<br />
- Auftragsvergabe für gemeinsame Agenda.<br />
Entwicklung und Produktion eines Films für<br />
ganz Österreich.<br />
- Inhaltliche Debatten: z.B. Zielgruppen analysieren,<br />
Altersgruppen und Unterschiede in Präventionsarbeit<br />
erkennen (vorbereitete Themen)<br />
- EU - Projekte<br />
- Einbindung aller Bundesländer<br />
Nächstes Thema: „Wie verkaufe ich Prävention?“ –<br />
Finanzierungsmodelle (Fundraising...), Erfolgsnachweis-Evaluation.<br />
Bericht von Mag. Thomas Pachl (GF der Schuldnerberatung<br />
Tirol – Rechtsladen) und Mag. Christa<br />
Leitner (Equal-Beauftragte der <strong>ASB</strong>)
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 29<br />
Erste Erfahrungen mit dem Webportal – www.schuldnerberatung.at<br />
Was man/frau wissen sollte:<br />
Seit 4.7.2002 ist das gemeinsame Webportal der<br />
<strong>Schuldnerberatungen</strong> online. Anliegen dieses Projekts<br />
ist es, als Schuldnerberatung einheitlich im<br />
Internet aufzutreten und dadurch<br />
- Verwirrungen durch verschiedene Internetadressen<br />
zu vermeiden,<br />
- Informations- und Ratsuchenden im Internet<br />
gebündelt Information zur Verfügung zu stellen<br />
und<br />
- die gemeinnützigen <strong>Schuldnerberatungen</strong> von<br />
gewerblichen Beratungsstellen abzugrenzen.<br />
JedeR SchuldnerberaterIn sollte daher die Links<br />
www.schuldnerberatung.at<br />
oder<br />
www.schuldenberatung.at kennen und weitergeben.<br />
Eigene Homepages (von <strong>Schuldnerberatungen</strong>)<br />
können darüber hinaus mit<br />
.../Beratungsstellenkürzel 1 direkt erreicht werden,<br />
sodass obige Adressen von jeder Beratungsstelle<br />
auch zur Bewerbung der eigenen Homepage verwendet<br />
werden können.<br />
Was sich derzeit tut:<br />
Im Zeitraum vom 4.7.02 bis 7.11.02 (ca. vier Monate)<br />
haben insgesamt rd. 6.000 InternetanwenderInnen<br />
das Webportal aufgerufen, wobei die<br />
Zugriffszahlen monatlich um 20% bis 30% steigen.<br />
1<br />
Anwendungsmöglichkeiten: z.B. Homepage des KWH:<br />
www.schuldnerberatung/kwh , Schuldnerberatung OÖ:<br />
www.schuldnerberatung.at/sbooe oder IfS-Schuldenberatung:<br />
www.schuldenberatung.at/ifs) etc.<br />
Im Oktober griffen täglich ca. 55 Personen, an<br />
Werktagen ca. 64 Personen, auf das Portal zu.<br />
Auch ohne besondere Maßnahmen zur Bewerbung<br />
des Portals sind die Zahlen also steigend.<br />
Welche Auswirkungen Aktionen zur Verbreitung<br />
des Portals haben können, sieht man an den<br />
Zugriffszahlen Anfang November ´02. In der ORF-<br />
Sendung „Help TV“ wurde am Mittwoch, dem<br />
6.11.02, nach einem Beitrag über die Praktiken<br />
unseriöser Kreditvermittler als weiterhelfende Informationsquelle<br />
die Website der <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
www.schuldnerberatung.at bekannt gegeben.<br />
In den folgenden Tagen verdreifachte sich die<br />
Zahl der Zugriffe auf das Webportal. Dies mit dem<br />
für Beratungen angenehmen Nebeneffekt, dass<br />
durch die Informationen auf dem Portal etwaige<br />
telefonische Anfragen gleich an die örtlich zuständigen<br />
Beratungsstellen geleitet werden und dadurch<br />
Kapazitäten und Ressourcen gespart werden.<br />
Bei überregionalen PR-Aktionen eignet sich<br />
das Webportal somit ideal als Anlaufstelle für weitergehende<br />
Informationen.<br />
Wie es weitergeht:<br />
Im Zuge des Equalprojekts „Schulden-Shredder“<br />
(siehe Schwerpunktthema dieser und der nächsten<br />
<strong>ASB</strong>-Informationen) wird das Portal einen weiteren<br />
Innovations- und Informationsschub erfahren und<br />
innerhalb der nächsten drei Jahre zu einem Infodienst-Center<br />
ausgebaut.<br />
Mag. Harald Hauer, <strong>ASB</strong><br />
Oberösterreichische Nachrichten, 23.10.2002
Seite 30 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Pressespiegel<br />
Datum Medium Titel SB Schlagwort<br />
31.05.2002 OÖ Nachrichten Schuldenfalle als Theaterstück VPS Prävention<br />
31.05.2002 OÖ Nachrichten<br />
Jung, lässig, pleite - Schuldnerberatung gibt zwei Gastspiele<br />
auf Linzer Bühne VPS Prävention<br />
05.06.2002 Stadt Anzeiger SMS-Falle! Faule Geschäfte mit der Liebe SBS Handy<br />
07.06.2002 OÖ Nachrichten Rubik: IN VPS Prävention<br />
13.06.2002 ORF<br />
Kredithöhe und Schuldenberg - Wie kannst Du noch ruhig<br />
schlafen! SB-OÖ Prävention<br />
01.07.2002 Konsument Missbrauch mit Schuldnerberatung Ö Schuldnerberatung<br />
04.07.2002 Kirchenzeitung Aufgeschnappt – Handy Schulden VPS Handy<br />
17.07.2002 Wann & Wo "Die sind doch alle selber schuld ...!" IfS Verschuldung<br />
18.07.2002 Vbg. Nachrichten Vom Schuldenberg fast erdrückt IfS Verschuldung<br />
19.07.2002 Der Standard Zugang zum Privatkonkurs erleichtert VPS Privatkonkurs<br />
25.07.2002 Die Presse Lehrlinge tappen in die Schuldenfalle SB-NÖ Jugendverschuldung<br />
28.07.2002 Wann & Wo "Unterschrieben ist schnell, zurückzahlen dauert Jahre" IfS Kredite<br />
01.08.2002 Linzer Rundschau Schuldenfalle schnappt bei Jungen öfter zu VPS Verschuldung<br />
04.08.2002 Kleine Zeitung Notruf! Viele Jugendliche stehen vor Schuldenberg SB-T Jugendverschuldung<br />
13.08.2002 Vbg. Nachrichten "Schuldenfrei in Leben" starten IfS Jugendverschuldung<br />
13.08.2002 Vbg. Nachrichten Junge Männer mit zum Teil horrenden Schuldenbergen IfS Verschuldung<br />
19.08.2002 Vorarlb. Online "Schuldenfrei ins Leben" IfS Jugendliche<br />
20.08.2002 apa-online Hochwasser: Schuldnerberatung erwartet Ansturm SB-OÖ Verschuldung<br />
23.08.2002 Life Radio Hochwasser und Schuldnerberatung SB-OÖ Verschuldung<br />
24.08.2002 OÖ Heute Hochwasser und Schuldnerberatung SB-OÖ Verschuldung<br />
28.08.2002 Tips Perg/Enns Schuldenberg reduzieren, aber wie? VPS Verschuldung<br />
29.08.2002 Der Einkauf Jugendverschuldung nimmt dramatische Formen an! IfS Jugendverschuldung<br />
01.09.2002 Wienerin Wieder mal Pleite?<br />
<strong>ASB</strong>/SB-<br />
OÖ Verschuldung<br />
19.09.2002 Radio OÖ Euro als Schuldenfalle ... SB-OÖ EURO<br />
02.10.2002 Apa-online Pressegespräch: Chaos bei Jugendkonten der Banken<br />
Mag.<br />
Wien Banken/Konto<br />
05.10.2002 Vbg. Nachrichten Schuldenberg in Vorarlberg IfS Jugendverschuldung<br />
05.10.2002 Vbg. Nachrichten Mit Geld muss man umgehen können IfS Prävention<br />
08.10.2002<br />
IfS-Informationen -<br />
Online "Vom richtigen Umgang mit Geld - schuldenfrei in Leben" IfS Prävention<br />
14.10.2002 Vorarlb. Online Rat bei Schuldenberatung IfS Prävention<br />
15.10.2002 Der Standard Mit Witz aus der Schuldenfalle IfS Prävention<br />
15.10.2002 Der Standard CD-Spiel, um Schulden zu vermeiden IfS Prävention<br />
15.10.2002 Vbg. Nachrichten Projekt: Spielend Schulden vermeiden lernen IfS Prävention<br />
16.10.2002 OÖ Nachrichten Aha-Erlebnis SB-OÖ Prävention<br />
16.10.2002 OÖ Nachrichten Kinder im Konsumrausch: Schule startet Pilotprojekt SB-OÖ Prävention<br />
16.10.2002 Neue Kronenzeitung Christkind fliegt mit dem Euro in die Schuldenfalle<br />
SB-<br />
OÖ/VPS EURO<br />
16.10.2002 Wann & Wo "Die Schuldenfalle schnappt bei immer mehr Jungen zu" IfS Prävention<br />
16.10.2002 OÖN-Online Inder im Konsumrausch: Schule startet Pilotprojekt SB-OÖ Prävention<br />
18.10.2002 Bezirksblatt Schwaz Verlockung mit bösen Folgen SB-T Verschuldung<br />
20.10.2002 Kurier Bereits Taferlklassler im "Konsumrausch" SB-OÖ Prävention<br />
23.10.2002 Wann & Wo Sokrates und der Schuldenberater IfS Prävention<br />
25.10.2002 Vbg. Nachrichten Arme Banken IfS Banken
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 31<br />
Kuriosa<br />
BANKEN: Konsumentenschützer warnen - Kleinkredite für Private bald aus dem Automaten?<br />
WIEN. - Noch sind es die deutschen Banken, die<br />
ernsthaft an der Vergabe von Kleinkrediten am<br />
Bankautomaten arbeiten. Die österreichischen<br />
Konsumentenschützer warnen aber schon vorsorglich<br />
davor. Es sei "gesellschaftspolitisch unverantwortlich",<br />
so der Leiter der Dienstleistungsabteilung<br />
des Vereins für Konsumenteninformation<br />
(VKI), Max Reuter.<br />
In Deutschland sind die Vorbereitungsarbeiten für<br />
den Kreditautomaten schon weit gediehen. Rund<br />
60 Prozent der deutschen Geldinstitute investieren<br />
laut einer Studie bereits in die automatischen Kreditmaschinen.<br />
Die ersten sollen bereits im Laufe<br />
des nächsten Jahres in Dienst gehen.<br />
Laut dieser Untersuchung können Banken damit<br />
die Bearbeitungskosten für wenig lukrative Kleinkredite<br />
um bis zu 70 Prozent senken. Bis zu welcher<br />
Höhe die Automaten einen Kredit bewilligen,<br />
hänge von der Risikobereitschaft der<br />
einzelnen Banken und natürlich der Kreditwürdigkeit<br />
der Kunden ab, so Jörg Forthmann<br />
von Mummert Consulting, dessen Firma die Studie<br />
gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut und dem "manager<br />
magazin" herausgab.<br />
Gerade so genannte Konsumentenkredite für den<br />
Kauf von Haushaltsgeräten, Möbeln, Autos oder<br />
Reisen seien dafür geeignet. Dass auch Firmenkredite<br />
am Automaten abgewickelt werden, dagegen<br />
sperren sich die Banken laut dieser Untersuchung<br />
aber. Sie wollen dieses Geschäft weiter über den<br />
Bankberater abwickeln.<br />
Bereits jetzt gibt es in verschiedenen Bankfilialen<br />
vereinzelt Kundenterminals, über die auch Kredite<br />
beantragt werden können. Eine gültige Unterschrift<br />
gehöre aber immer unter den Kreditvertrag, so ein<br />
Sprecher der Deutschen Bank. Bei der größten<br />
deutschen Bank laufen derzeit Tests mit der digitalen<br />
Unterschrift, die dann die eigenhändige Unterschrift<br />
online ersetzen könnte.<br />
Die Konsumentenschützer stoßen sich vor allem<br />
daran, dass die Kreditautomaten nicht im Sinne<br />
der gesetzlich vorgeschriebenen Aufklärungspflichten<br />
agieren können. Im Gegenteil: An die Kreditvergabe<br />
müssen in Zukunft strengere Maßstäbe<br />
angelegt werden. Der Kreditgeber müsse alle notwendigen<br />
Schritte setzen, um sicherzustellen, dass<br />
der Kreditnehmer den Kredit auch wirklich zurückzahlen<br />
könne, so Konsumentenschützer Reuter.<br />
Die Verschuldung der privaten Haushalte sei ein<br />
generelles Problem, so Reuter. Die Banken müssten<br />
in die Pflicht genommen werden, nicht sorglos<br />
Kredite zu vergeben. Automaten seien ein Weg in<br />
die falsche Richtung.<br />
OÖN - Online, 23.10.2002<br />
Weg ist das Handy<br />
NEW YORK. - New York plant ein strenges Gesetz<br />
gegen Handy-Rüpel: Wer vergisst, sein Handy im<br />
Theater abzuschalten, dem wird es abgenommen.<br />
Und er muss 50 Dollar (ca. 50 Euro) zahlen.<br />
Kleine Zeitung - Online, 27.9.2002<br />
Karyn baut Schuldenberg als Internet-Schnorrerin ab<br />
NEW YORK. - "Hallo! Mein Name ist Karyn, ich bin<br />
wirklich nett und ich bitte Sie um Hilfe."<br />
Unter der Internet-Adresse savekaryn.com bittet<br />
eine junge Amerikanerin, ihr beim Abbau ihrer<br />
Schulden von ungerechnet 20.000 Euro behilflich<br />
zu sein.<br />
Karyn ist dreist, aber ehrlich: Sie berichtet nicht<br />
etwa von Ausgaben wegen einer angeblichen Notsituation,<br />
sondern gesteht ganz offen, dass sie vor<br />
allem deshalb kurz vor dem Bankrott steht, weil sie<br />
sich viel zu oft Designerkleidung kaufte.<br />
"Ich werde hier keine Schluchz-Geschichte erfinden,<br />
um Ihr Mitleid zu erregen", beteuert Karyn,<br />
die ihren Nachnamen nicht verraten will, weil ihr<br />
die hohe Schuldenlast doch ein wenig peinlich ist.<br />
Sie verrät nur wenige Details: Sie ist 26, arbeitet<br />
beim Fernsehen und kam vor einigen Jahren aus<br />
einem Kaff im mittleren Westen der USA nach New<br />
York.<br />
Dort entwickelte sie schnell eine Leidenschaft für<br />
den Einkauf in teuren Boutiquen, bis sie plötzlich
Seite 32 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
bei diversen Kreditkarten-Firmen mit umgerechnet<br />
20.000 Euro in der Kreide stand.<br />
Mit der Bitte, ihr mit einem oder einigen Dollars<br />
aus der Klemme zu helfen, konnte Karyn nach<br />
eigenen Angaben bereits Hunderte von Spendern<br />
anlocken, überwiegend Amerikaner, aber auch<br />
Deutsche, Kanadier, Neuseeländer sowie mindestens<br />
zwei überhaupt nicht geizige Schotten. Sie<br />
schickten insgesamt fast 3.000 Dollar - über ein<br />
Online-Zahlungssystem, aber auch auf dem traditionellen<br />
Postweg, in Umschlägen, in denen Dollarscheine<br />
und Schecks steckten.<br />
Viele Geldgeber belassen es nicht bei einem Kleinbetrag.<br />
Karyn erhielt bereits mehrere Einzelspenden<br />
in Höhe von 100 Dollar. Außerdem versteigert<br />
sie auf Auktions-Websites einige der edlen Kleidungsstücke,<br />
die ihren Schuldenberg so hoch werden<br />
ließen.<br />
Zur finanziellen Rettung Karyns könnte auch ein<br />
Filmstudio beitragen. Denn nun interessiert sich<br />
sogar Hollywood für die bizarre Geschichte der<br />
Cyber-Bettlerin, vor allem seit sie böswillige Konkurrenz<br />
bekommen hat. Für besonders unterhaltsames<br />
Surfen im Internet sorgt inzwischen eine<br />
Website, deren Name dontsavekaryn.com ein<br />
deutliches Signal ist.<br />
Karyn soll nicht gerettet werden, denn sie übernimmt<br />
keine Verantwortung für ihr Leben, sagt ein<br />
Karyn-Hasser namens Ben. Statt dessen soll man<br />
lieber ihm Spenden schicken. Das Geld will er mit<br />
seinem Freund Bob verprassen. Auf sein Konto<br />
gingen bisher 100 Dollar ein.<br />
Frage der Redaktion: „Ob das auch in Österreich<br />
funktioniert?!“<br />
OÖN - Online, 27.08.2002<br />
Spielsucht: Spielen bis nichts mehr geht – Ratgeber<br />
...Der wohl bekannteste Spielsüchtige ist Fjodor<br />
Dostojewski. Der russische Schriftsteller zählte ab<br />
1862 zu den Stammgästen der Spielbank in Wiesbaden.<br />
Er hat gebangt und gelitten, seine ganze<br />
Barschaft verspielt und geriet an den Rand seiner<br />
Existenz. Wegen des finanziellen Desasters musste<br />
er neue Geldquellen erschließen und so schrieb er<br />
innerhalb von vier Wochen seine Autobiographie.<br />
Das Werk erschien unter dem Titel "Der Spieler"<br />
und zählt zur Weltliteratur...<br />
Anmerkung der Redaktion: „Wer zusätzliche Talente<br />
hat, der kann es sich richten/leisten!“<br />
Quelle: www.hr-online.de/d/themen/ratgeber/...<br />
Der „Kuckuck“ flog diesmal zum mazedonischen Botschafter<br />
OSZE-Diplomat wohnt anonym in Wien<br />
Eine Pfändung hat kurzfristig zu einer diplomatischen<br />
Verstimmung zwischen Österreich und Mazedonien<br />
geführt. Wie am Samstag bekannt wurde,<br />
ließ ein Gerichtsvollzieher kürzlich die Wiener<br />
Wohnung des mazedonischen OSZE-Botschafters<br />
Aleksander Tavciovski per Gerichtsbeschluss öffnen.<br />
Dies führte zu einem Protest des OSZE-<br />
Botschafters wegen einer Verletzung seiner diplomatischen<br />
Immunität. Wie der frühere österreichische<br />
Botschafter in Mazedonien, Harald Kotschy,<br />
Samstag erklärte, habe sich die Protokollabteilung<br />
des Außenamts bei Tavciovski für den Zwischenfall<br />
entschuldigt.<br />
Da die Wohnung nicht entsprechend gekennzeichnet<br />
war, konnte der Gerichtsvollzieher nicht ahnen,<br />
dass es sich um eine Diplomatenwohnung handelte.<br />
Tavciovski will in Österreich offenbar aus Sicherheitsgründen<br />
anonym wohnen.<br />
Die Zeitung „Dnevnik“ hatte am Freitag berichtet,<br />
dass „Behörden“ der Stadt Wien „gewaltsam“ in<br />
die Wohnung eingedrungen seien, weil der Botschafter<br />
dem Vermieter „vier Euro“ geschuldet<br />
habe.<br />
Kurier - Online, Chronik, 23.06.2002<br />
Frankreichs neues Kabinett ...<br />
Zentrumsorientierung der Ministerriege Frankreichs<br />
Uhren gehen wieder einmal anders. Das erweiterte<br />
Kabinett von Premier Jean-Pierre Raffarin ist wohl<br />
das eigenartigste und linkeste aller bürgerlichen<br />
Regierungsteams, die zuletzt in der EU ans Ruder<br />
kamen. Finanzminister Francis Mer, der als Manager<br />
Europas größten Stahlkonzern sanierte, ist ein<br />
katholischer Asket mit ausgeprägter sozialer Ader,<br />
gutem Draht zu den Gewerkschaften und kritischer<br />
Distanz zum extremen Wirtschaftsliberalismus.<br />
Letzteres gilt auch für Arbeitsminister Francois<br />
Fillon. Innenminister Nicolas Sarkozy will gegen die
Nr. 3/2002 <strong>ASB</strong>-Informationen Seite 33<br />
Jugendkriminalität härtest durchgreifen, der Sohn<br />
ungarischer Einwanderer stemmt sich aber in der<br />
laufenden EU-Debatte über Immigration gegen die<br />
Hardliner, die Sanktionen gegen die Ursprungsländer<br />
fordern. An seiner Seite wirkt als Minister<br />
für „urbane Erneuerung“ ein sprühender<br />
Zentrumspolitiker, Jean-Louis Borloo, der<br />
totale Schuldenstreichung für eine Million<br />
verarmter Familien fordert. Die Staatssekretärin<br />
(im Umweltbereich) Tokia Saifi ist die erste<br />
junge Franko-Maghrebinerin in einer Regierung. An<br />
Stelle des bisherigen Europaministers, der wegen<br />
einer Schmiergeld-Affäre zurücktrat, amtiert jetzt<br />
Noelle Lenoir, eine brillante Juristin und EU-<br />
Bioethik-Expertin, die der SP nahesteht. Diese<br />
Zentrumsorientierung und Öffnung ist wohl auch<br />
Folge der beinharten Abgrenzung nach rechtsaußen,<br />
die den Sieg der Bürgerlichen in Frankreich<br />
begleitet hat. - Danny Leder Paris<br />
Kurier - Online, Außenpolitik, 19.6.2002<br />
Tipps - Serie 10<br />
" SCHNELL IM WINWORD "<br />
AUTOKORREKTUR – die DRITTE und WEITERFÜHRUNG – EURO und CENT<br />
Wie wir die Autokorrektur bequem zum Ersetzen auch bereits formatierter Zeichen einsetzen können,<br />
haben wir letztes Mal dargestellt. Die Autokorrektur kann auch verwendet werden, um das offizielle<br />
Cent-Zeichen ¢ zu erstellen. In der Praxis findet dieses Zeichen zwar noch nicht sehr häufig Anwendung,<br />
man sollte es zumindest aber kennen. Eine Tastaturkombination wie für den EURO (AltGr e =<br />
€) bietet Windows dazu in den Standardeinstellungen leider nicht.<br />
DARSTELLUNG DES CENT ZEICHENS ¢<br />
- Möglichkeit 1 – mit der Nummerntastatur<br />
Dazu muss man wissen, dass jedes Zeichen einen Zahlencode hat, mit dem es dargestellt werden<br />
kann. Dieser Code lautet für den Cent: 0162. Also ALT-Taste drücken und auf der Nummerntastatur<br />
0162 eingeben. Das ergibt zwar ein ¢, ist aber umständlich.<br />
- Möglichkeit 2 – Autokorrektur<br />
Man kann daher als Alternative in der Autokorrektur einen Eintrag erstellen der z.B. die Zeichenfolge<br />
Seite 34 <strong>ASB</strong>-Informationen Nr. 3/2002<br />
Leistungen - Abonnement<br />
Angebote der <strong>ASB</strong> - Arge <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
• Unterstützung bei Diplomarbeiten, Studien,<br />
udg., die in den Bereich der Verschuldung fallen.<br />
• Klärung von Fragen und allgemeine Informationen<br />
zum Privatkonkurs (Schuldenregulierungsverfahren),<br />
Verschuldung und Treuhandschaft.<br />
• Statistische Daten zur Verschuldung und zum<br />
Privatkonkurs.<br />
• Liste der <strong>Schuldnerberatungen</strong> in Österreich<br />
und CDN (consumer debt net).<br />
• Broschüren (bzw. Literatur) zur Verschuldung<br />
und Privatkonkurs.<br />
• Fortbildungsprogramm<br />
Abonnement<br />
Sollten Sie Lust auf einen regelmäßigen Bezug der Informationen bekommen haben, so schicken Sie untenstehende<br />
Erklärung möglichst bald ab.<br />
___________________________________<br />
Name/Bezeichnung<br />
___________________________________<br />
___________________________________<br />
Adresse<br />
Ich bestelle ein Jahresabonnement der<br />
<strong>ASB</strong><br />
“<strong>ASB</strong> Informationen”.<br />
ARGE <strong>Schuldnerberatungen</strong><br />
Den Preis von Euro 36,34 (Mitglieder Euro 21,80) Scharitzerstraße 10<br />
überweise ich auf das Konto VKB Linz,<br />
4020 Linz<br />
BLZ 18600, Kontonr.: 10.623.023<br />
____________________________<br />
Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung<br />
_____________<br />
Datum