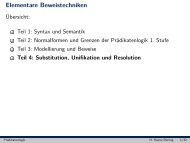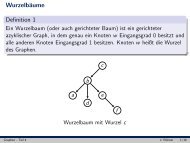Simulation von Papier- und Farbeigenschaften in der ...
Simulation von Papier- und Farbeigenschaften in der ...
Simulation von Papier- und Farbeigenschaften in der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diplomarbeit<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Papier</strong>- <strong>und</strong> <strong>Farbeigenschaften</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Dokumentenvoransicht e<strong>in</strong>er<br />
Webapplikation<br />
<strong>von</strong><br />
Ron Reckersbr<strong>in</strong>k<br />
Matr.-Nr.: 6176797<br />
Pa<strong>der</strong>born, den 31 März 2009<br />
vorgelegt bei<br />
Prof. Dr. Gerd Szwillus<br />
<strong>und</strong><br />
Dr. Michael J. Tauber<br />
Universität Pa<strong>der</strong>born<br />
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik <strong>und</strong> Mathematik<br />
Institut für Informatik<br />
AG Mensch-Computer-Interaktion <strong>und</strong> Softwaretechnologie
Eidesstattliche Erklärung<br />
Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter <strong>und</strong> nur mit den<br />
angegebenen Quellen <strong>und</strong> Hilfsmitteln angefertigt zu haben.Alle Stellen, die aus den<br />
Quellen entnommen wurden, s<strong>in</strong>d als solche kenntlich gemacht worden.<br />
Diese Arbeit hat <strong>in</strong> gleicher o<strong>der</strong> ähnlicher Form noch ke<strong>in</strong>er Prüfungsbehörde<br />
vorgelegen.<br />
Pa<strong>der</strong>born, den 31.03.09 ________________________<br />
Ron Reckersbr<strong>in</strong>k
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis.............................................................................................................iii<br />
Abbildungsverzeichnis....................................................................................................v<br />
Formelverzeichnis...........................................................................................................vi<br />
1. E<strong>in</strong>leitung......................................................................................................................1<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen....................................................................................................................3<br />
2.1 Farbmodelle <strong>und</strong> Farbräume........................................................................................3<br />
2.2 Farbmanagement..........................................................................................................8<br />
2.2.1 Farbmanagementsystem nach ICC-Standard............................................................9<br />
2.2.2 W<strong>in</strong>dows Color System (WCS).............................................................................19<br />
2.2.3 Kalibrierung <strong>und</strong> Profilierung.................................................................................20<br />
2.2.4 Softproof.................................................................................................................23<br />
2.3 Webtechnologien zur Darstellung <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n...........................................................24<br />
2.4 Opazitäts- <strong>und</strong> Transparenzmessung..........................................................................26<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation..........................................................................29<br />
3.1 <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung........................................................................................29<br />
3.1.1 Voraussetzungen für die <strong>Simulation</strong>........................................................................30<br />
3.1.2 <strong>Simulation</strong> bei Bilddateien......................................................................................32<br />
3.1.3 <strong>Simulation</strong> bei PDF-Dokumenten...........................................................................37<br />
3.1.4 <strong>Simulation</strong> bei Layoutdokumenten.........................................................................40<br />
3.2 <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität.............................................................................................41<br />
3.2.1 Auswirkungen <strong>und</strong> Simulierbarkeit <strong>der</strong> Opazität....................................................41<br />
3.2.2 Bestimmung <strong>der</strong> Opazität........................................................................................43<br />
3.2.3 Konzept zu Opazitätsprofilen..................................................................................51<br />
3.3 Workflow zur Eigenschaftensimulation.....................................................................61<br />
3.3.1 Schritt 1 – Rasterung, Separation <strong>und</strong> Formatierung...............................................61<br />
3.3.2 Schritt 2 - <strong>Simulation</strong>..............................................................................................63<br />
3.3.3 Workflowdurchführung...........................................................................................66<br />
3.3.4 Workflowsteuerung.................................................................................................67<br />
3.4 Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong>........................................................................................69<br />
iii
Inhaltsverzeichnis<br />
4. Prototypische Implementierung...................................................................................71<br />
4.1 Serverseitige Implementierung..................................................................................71<br />
4.1.1 Datei- <strong>und</strong> Verzeichnisstruktur................................................................................72<br />
4.1.2 Programmausführung..............................................................................................74<br />
4.2 Clientseitige Implementierung...................................................................................76<br />
4.3 Die zu simulierenden Druckbed<strong>in</strong>gungen..................................................................78<br />
5. <strong>Simulation</strong>squalität......................................................................................................80<br />
5.1 Qualität <strong>der</strong> Farbsimulation.......................................................................................80<br />
5.2 Qualität <strong>der</strong> Opazitätssimulation................................................................................81<br />
6. Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick..................................................................................82<br />
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs..........................................................84<br />
Anhang B - Beispiele.......................................................................................................91<br />
Anhang C - Opazitätsprofil..............................................................................................94<br />
Anhang D - CD-Rom.....................................................................................................101<br />
Quellenverzeichnis.......................................................................................................102<br />
iv
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 2.1.1 - Normfarbtafel.................................................................................................3<br />
Abb. 2.1.2 - L*a*b*-Farbraum...........................................................................................5<br />
Abb. 2.1.3 - Vergleich <strong>von</strong> RGB Farbräumen....................................................................6<br />
Abb. 2.1.4 - HSB(HSV)-Farbraum....................................................................................8<br />
Abb. 2.2.1 - ICC-Workflow..............................................................................................10<br />
Abb. 2.2.2 - Druckeroptionen HP Deskjet 959C..............................................................11<br />
Abb. 2.2.3 - Dialog zur Profilkonvertierung <strong>in</strong> Photoshop 7.0.........................................12<br />
Abb. 2.2.4 - Fogra Lab-Separationstestbild......................................................................14<br />
Abb. 2.2.5 - Relativ farbmetrische Transformation mit Tiefenkomp. mit W<strong>in</strong>ACE.........15<br />
Abb. 2.2.6 - Relativ farbmetrische Transformation mit Tiefenkomp. mit LCMS.............15<br />
Abb. 2.2.7 - Histogramme des Quellbild im WideGamut-Farbraum................................16<br />
Abb. 2.2.8 - Tonwertkorrigiertes Differenzbild................................................................17<br />
Abb. 2.2.9 - WCS Pipel<strong>in</strong>e...............................................................................................20<br />
Abb. 2.2.10 - Softproof unter Photoshop 7.0....................................................................24<br />
Abb. 3.1.1 - ICCView- Gamutvergleich Monitor vs. „ISO coated v2 (ECI)“...................31<br />
Abb. 3.1.2 - Proof<strong>in</strong>g-Workflow für Bilddateien..............................................................32<br />
Abb. 3.1.3 - Verfärbungsbeispiel......................................................................................34<br />
Abb. 3.1.4 - Farbumfang-Warnung <strong>in</strong> Photoshop.............................................................36<br />
Abb. 3.1.5 - Proof<strong>in</strong>g-Workflow für PDF-Dokumente mit Ghostscript............................39<br />
Abb. 3.2.1 - Durchschlagsimulation.................................................................................42<br />
Abb. 3.2.2 - CMYK-Messchart mit Schrittweite <strong>von</strong> 10 %..............................................53<br />
Abb. 3.2.3 - RGB-Farbwürfel..........................................................................................55<br />
Abb. 3.2.4 - RGB Messchart............................................................................................56<br />
Abb. 3.2.5 - Farbraumvergleich.......................................................................................60<br />
Abb. 3.3.1 - Workflowdarstellung....................................................................................66<br />
Abb. 3.4.1 - Blätteranimation mit Flex.............................................................................70<br />
Abb. 4.1.1 - Verzeichnisstruktur des serverseitigen Prototypen.......................................72<br />
Abb. 4.1.2 - Beispiel für e<strong>in</strong>e erzeugte Verzeichnisstruktur.............................................73<br />
Abb. 4.2.1 - Anzeige <strong>der</strong> „image.html“............................................................................76<br />
Abb. 4.2.2 - Anzeige <strong>der</strong> „document.html“......................................................................78<br />
v
Formelverzeichnis<br />
Formel 2.1.1 - Berechnung des rel. Farbanteils z im Yxy-Farbmodel...............................4<br />
Formel 2.2.1 - Gammafunktion nach [W3C96]...............................................................22<br />
Formel 2.4.1 - Berechnung des Transmissionsgrad.........................................................26<br />
Formel 2.4.2 - Berechnung des Remissionsgrad.............................................................26<br />
Formel 2.4.3 - Berechnung <strong>der</strong> Opazität m. Transmissions- bzw. Remissionsgrad.........26<br />
Formel 2.2.4 - Berechnung <strong>der</strong> Opazität m. Reflexionsfaktoren nach DIN 53146..........27<br />
Formel 2.4.5 - Berechnung des Durchsche<strong>in</strong>effekt.........................................................28<br />
Formel 2.4.6 - Berechnung des Durchschlageffekt .........................................................28<br />
Formel 2.4.7 - Berechnung <strong>der</strong> Transparenz mit Reflexionsfaktoren..............................28<br />
Formel 3.2.2.1 - CIELAB-Farbabstandsformel...............................................................44<br />
Formel 3.2.2.2 - Berechnung <strong>der</strong> Opazität mit L*a*b*-Farbwert....................................44<br />
Formel 3.2.2.3 - Umrechnung des prozentualen L*-Wert <strong>in</strong> Tonwertstufen....................45<br />
Formel 3.2.2.4 - Berechnung <strong>der</strong> Opazität mit L*-Wert..................................................45<br />
Formel 3.2.2.5 - Umrechnung <strong>der</strong> Opazität f. auf gespiegelte Rückseite........................50<br />
Formel 3.2.3.1 - Interpolation <strong>der</strong> Opazität.....................................................................52<br />
Formel 3.2.3.2 - Berechnung <strong>der</strong> Gesamtopazität <strong>der</strong> Farbkanäle...................................53<br />
Formel 3.2.3.3 - Umrechnung RGB-Farbwert <strong>in</strong> CMY-Farbwert....................................58<br />
Formel 3.2.3.4 - Berechnung des Schwarzaufbaus..........................................................58<br />
vi
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Die Darstellung <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Dokumenten als Vorschau f<strong>in</strong>det im Internet häufig<br />
Anwendung. Die relativ kle<strong>in</strong>en, als sogen. „Thumbnails“ bekannten Vorschauen dienen dabei<br />
eher <strong>der</strong> Navigation <strong>und</strong> optischen Aufbereitung e<strong>in</strong>er Webanwendung. Es gibt jedoch auch<br />
größere <strong>und</strong> detailreichere Vorschauen, die dem Anwen<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en konkreten E<strong>in</strong>druck <strong>von</strong> dem<br />
Bild o<strong>der</strong> Dokument vermitteln sollen.<br />
E<strong>in</strong> Anwendungsbeispiel für solche größeren Vorschauen s<strong>in</strong>d kommerzielle Angebote <strong>der</strong><br />
Druck<strong>in</strong>dustrie für den Vertrieb <strong>von</strong> Druckerzeugnissen. Neben allgeme<strong>in</strong> öffentlichen<br />
Angeboten für Kunstdruck, Poster <strong>und</strong> <strong>der</strong> Gleichen, gibt es auch Angebote für Unternehmen<br />
über die im allg. Werbemittel entwe<strong>der</strong> bestellt o<strong>der</strong> für den Druck freigegeben werden können.<br />
Diese Bil<strong>der</strong> <strong>und</strong> Dokumente liegen zumeist <strong>in</strong> gängigen Dateiformaten wie dem TIFF- o<strong>der</strong><br />
PDF-Format, o<strong>der</strong> auch als Layoutdokument <strong>in</strong> Adobes InDesign-Format o<strong>der</strong> QuarksXPress-<br />
Format vor, <strong>von</strong> denen e<strong>in</strong>e Vorschau im JPEG-Format erstellt wird. Der potenzielle K<strong>und</strong>e<br />
kann sich dann mittels dieser Vorschau e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck <strong>von</strong> dem als Druckerzeugnis<br />
angebotenen Bild o<strong>der</strong> Dokument machen.<br />
Es kommt jedoch nicht selten vor, dass <strong>der</strong> K<strong>und</strong>e nach Erhalt des Druckerzeugnisses enttäuscht<br />
ist, da das Druckerzeugnis mehr o<strong>der</strong> weniger stark <strong>von</strong> <strong>der</strong> Vorschau <strong>und</strong> dem damit erzeugten<br />
E<strong>in</strong>druck abweicht. Dies mag für Privatanwen<strong>der</strong> vielleicht ärgerlich se<strong>in</strong>, bedeutet aber für<br />
Unternehmen evtl. unvorhergesehene, unnötige Kosten, da z.B. e<strong>in</strong>e größere Auflage an<br />
bestellten Werbemitteln nicht verwendet werden kann <strong>und</strong> neu bestellt werden muss.<br />
Gr<strong>und</strong> für die oben erwähnten Abweichungen zwischen Vorschau <strong>und</strong> tatsächlichem<br />
Druckergebnis ist, dass die erstellten Vorschaubil<strong>der</strong> nur auf den Informationen aus dem<br />
zugr<strong>und</strong>e liegenden digitalen Bild o<strong>der</strong> Dokument basieren <strong>und</strong> alle weiteren E<strong>in</strong>flüsse, die sich<br />
auf das Ersche<strong>in</strong>ungsbild des Druckergebnisses auswirken, nicht berücksichtigt werden. Und<br />
eben diese weiteren E<strong>in</strong>flussfaktoren s<strong>in</strong>d zahlreich <strong>und</strong> vielfältig <strong>und</strong> begründen sich auf den<br />
Eigenschaften des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> verwendeten Druckfarbe.<br />
Zu den Eigenschaften des <strong>Papier</strong>s zählen z.B. die <strong>Papier</strong>farbe, die die Druckfarbe an<strong>der</strong>s<br />
ersche<strong>in</strong>en lässt, die Saugfähigkeit, die den Kontrast durch Farbvermischung bee<strong>in</strong>flusst, die<br />
Opazität (Licht<strong>und</strong>urchlässigkeit), die bei mehrseitigen Dokumenten die nachfolgenden Seiten<br />
durch die Betrachtete h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>en lässt, sowie die Struktur <strong>und</strong> Glanzeigenschaften des<br />
<strong>Papier</strong>.<br />
Bei den <strong>Farbeigenschaften</strong> s<strong>in</strong>d z.B. <strong>der</strong> Farbton, <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> im Dokument verwendeten Farbe<br />
abweichen kann, die Trocknungszeit, die, wenn sie länger ist, den Kontrast durch<br />
Farbvermischung verschlechtert <strong>und</strong> ggf. weitere beson<strong>der</strong>e Eigenschaften wie das<br />
Reflextionsverhalten <strong>von</strong> Son<strong>der</strong>farben mit Metallpigmenten, anzuführen.<br />
Ziel <strong>der</strong> Diplomarbeit ist es, das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild sowie die Opazität e<strong>in</strong>es<br />
Druckerzeugnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Webapplikation zu simulieren, <strong>in</strong>dem die hierfür relevanten<br />
Eigenschaften untersucht, sowie Verfahren zur Quantifizierung <strong>der</strong> Auswirkungen <strong>und</strong><br />
Methoden zur Berücksichtigung <strong>der</strong> Eigenschaften bei <strong>der</strong> Vorschaudarstellung untersucht,<br />
entwickelt <strong>und</strong> qualitativ beurteilt werden.<br />
1
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Des Weiteren wurden die Verfahren angewendet, die Methoden <strong>in</strong> prototypischer Form<br />
implementiert <strong>und</strong> die daraus resultierenden <strong>Simulation</strong>en durch subjektive Wahrnehmung<br />
bewertet.<br />
In Kapitel 2 werden zunächst, die für diese Diplomarbeit relevanten Farbmodelle <strong>und</strong><br />
Farbräume, sowie das, für die Druck<strong>in</strong>dustrie absolut notwendige, Farbmanagement untersucht<br />
<strong>und</strong> erläutert. Weitere Bestandteile dieses Kapitels s<strong>in</strong>d außerdem die bereits existierenden<br />
Verfahren zur Messung <strong>und</strong> <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Auswirkungen <strong>von</strong> <strong>Papier</strong>- <strong>und</strong> <strong>Farbeigenschaften</strong>,<br />
sowie die webbasierenden Technologien zur Darstellung <strong>von</strong> Dokumentenvorschauen.<br />
Auf den Gr<strong>und</strong>lagen aufbauend wird <strong>in</strong> Kapitel 3 e<strong>in</strong> Konzept zur <strong>Simulation</strong> des farblichen<br />
Ersche<strong>in</strong>ungsbildes sowie e<strong>in</strong> Konzept zur <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> durch die Opazität verursachten<br />
Auswirkungen vorgestellt <strong>und</strong> erläutert, <strong>und</strong> fließen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Konzept e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen<br />
Workflows zusammen.<br />
In Kapitel 4 wird die prototypische Implementierung erläutert mit <strong>der</strong> die Konzepte des<br />
vorangegangenen Kapitels umgesetzt wurden. Die <strong>Simulation</strong>squalität ist dann Gegenstand des<br />
Kapitel 5, <strong>in</strong> dem das Konzept aus Kapitel 3 h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Qualität<br />
untersucht <strong>und</strong> beurteilt sowie die <strong>Simulation</strong>squalität des Prototypen aus Kapitel 4 bewertet<br />
wird.<br />
Abschließend wird diese Arbeit <strong>in</strong> Kapitel 6 zusammengefasst, <strong>und</strong> es wird e<strong>in</strong> Ausblick auf<br />
mögliche <strong>Simulation</strong>serweiterungen gegeben.<br />
2
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
2.1 Farbmodelle <strong>und</strong> Farbräume<br />
In Farbmodellen werden Farbvalenzen nach bestimmten Kriterien wie z.b. e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Menge<br />
<strong>von</strong> Farbvalenzen, aus denen weitere Farbvalenzen gemischt werden können, beschrieben. E<strong>in</strong><br />
Farbraum basiert auf e<strong>in</strong>em Farbmodell <strong>und</strong> stellt die Menge <strong>der</strong> <strong>in</strong> dem Farbraum verfügbaren/<br />
verwendbaren Farbvalenzen dar, die je nach verwendetem Farbmodell <strong>und</strong> technischen<br />
Gegebenheiten e<strong>in</strong> Teilmenge <strong>der</strong> gesamten, für das menschliche Auge sichtbaren Farbvalenzen<br />
ist.<br />
Es existieren sehr viele Farbmodelle <strong>und</strong> für jedes dieser Farbmodelle gibt es m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en,<br />
aber auch bis zu unendlich vielen Farbräumen, was aus den weiteren Erläuterungen noch<br />
ersichtlich wird. Im Folgenden werden e<strong>in</strong>ige <strong>der</strong> wichtigsten Farbmodelle <strong>und</strong> ihre Farbräume,<br />
die <strong>in</strong> <strong>der</strong> Computertechnologie <strong>und</strong> <strong>der</strong> Druckbranche verwendet werden, erläutert. Hierzu<br />
zählen:<br />
– Das CIE XYZ-System (Normvalenzsystem)<br />
– Das L*a*b*-Farbmodell<br />
– Bitmap<br />
– Die Grauskala (Grayscale)<br />
– das RGB-Farbmodell <strong>und</strong> dessen Farbräume<br />
– das CMY(K)-Farbmodell <strong>und</strong> dessen Farbräume<br />
– HSB-Farbmodell (HSV-Farbmodell)<br />
– Volltonfarbpaletten<br />
Das CIE XYZ-System<br />
Das CIE XYZ-System, auch Normvalenzsystem o<strong>der</strong> CIE-System genannt, ist e<strong>in</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> CIE<br />
(Commission <strong>in</strong>ternationale de l'éclairage) entwickeltes Farbmodell. Mit diesem System können<br />
mit den drei so genannten Primärvalenzen X(Rot), Y(Grün), <strong>und</strong> Z(Blau) alle für das<br />
menschliche Auge erfassbaren Farbvalenzen beschrieben werden, den XYZ-Farbraum. Das aus<br />
dem XYZ-System abgeleitete Yxy-Modell wird häufig zur visuellen Veranschaulichung des<br />
XYZ-Farbraums verwendet. (s. Abb. 2.1.1)<br />
Abb. 2.1.1 Normfarbtafel [An1]<br />
3
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Diese zweidimensionale Darstellung heißt Normfarbtafel <strong>und</strong> ist wegen <strong>der</strong> Form auch<br />
allgeme<strong>in</strong> als „Schuhsohle“ bekannt. Sie zeigt den relativen Farbanteil x <strong>der</strong> Farbvalenz X (Rot)<br />
<strong>und</strong> den relativen Farbanteil y <strong>der</strong> Farbvalenz Y (Grün). Der relative Farbanteil z <strong>von</strong> Z (Blau)<br />
ist <strong>in</strong> dieser Darstellung nicht notwendig, da sich dieser aus x <strong>und</strong> y errechnen lässt.[Lo98]<br />
z = 1-x-y (Formel .2.1.1)<br />
Die Kurve <strong>von</strong> Violett über Grün nach Rot nennt man den Spektralfarbenzug <strong>und</strong> repräsentiert<br />
alle im Licht enthaltenen Spektralfarben. Die Gerade zwischen Violett <strong>und</strong> Rot ist die Purpur-<br />
Gerade. Die auf ihr bef<strong>in</strong>dlichen Farbvalenzen sowie alle vom Spektralfarbenzug <strong>und</strong> Purpur-<br />
Geraden e<strong>in</strong>gegrenzten Farben s<strong>in</strong>d nicht im Farbspektrum enthalten <strong>und</strong> können nur durch<br />
Mischung <strong>von</strong> Spektralfarben erreicht werden.<br />
Bei Punkt x=0,333 y=0,333 ist die Mittelpunktfarbart, bei <strong>der</strong> die Anteile <strong>der</strong> drei Farbvalenzen<br />
X, Y <strong>und</strong> Z gleich s<strong>in</strong>d, weshalb dieser Punkt e<strong>in</strong>e unbunte Farbvalenz darstellt. Alle<br />
Farbvalenzen auf e<strong>in</strong>er Geraden <strong>von</strong> <strong>der</strong> Mittelpunktfarbart zum Spektralfarbenzug o<strong>der</strong> zur<br />
Purpur-Geraden haben den selben Buntton, dessen Sättigung <strong>von</strong> <strong>der</strong> Mittelpunktfarbart nach<br />
außen h<strong>in</strong> zunimmt.<br />
Was <strong>in</strong> dieser Darstellung jedoch nicht berücksichtigt wird ist die Helligkeit, die bei dem Yxy-<br />
Modell durch das Y repräsentiert wird. Die Abb. 2.1.1 zeigt lediglich e<strong>in</strong>e Ebene <strong>der</strong> Y-Achse<br />
auf <strong>der</strong> alle mischbaren Farbvalenzen bei gleicher Helligkeit <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Primärvalenzen<br />
dargestellt wird.[Kr01]<br />
Der XYZ-Farbraum wird vom Anwen<strong>der</strong> e<strong>in</strong>es Computers meist nie direkt verwendet, spielt<br />
aber für das Farbmanagement e<strong>in</strong>e sehr wichtige Rolle, da er als e<strong>in</strong>deutiger Farbraum zum<br />
Umrechnen <strong>von</strong> Farb<strong>in</strong>formationen <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em Farbraum <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en verwendet wird.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus wird er zum Vergleichen verschiedener Farbräume verwendet. Hierzu mehr im<br />
Kap. 2.2.1.1.<br />
Das L*a*b*-Farbmodell<br />
Das L*a*b*-Farbmodell ist e<strong>in</strong>e CIE Weiterentwicklung des Yxy-Farbmodells <strong>und</strong><br />
berücksichtigt die <strong>der</strong> menschlichen Wahrnehmung entsprechenden Farbabstände. Es ist somit<br />
auch e<strong>in</strong>e Verbesserung des XYZ-Farbsystem.[KR01]<br />
Dieses System beschreibt die Farben anhand <strong>der</strong> Koord<strong>in</strong>aten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Kugel, wobei die L*-<br />
Achse <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vertikalen steht <strong>und</strong> die Helligkeit mit Schwarz am unteren Ende bis Weiß am<br />
Oberen beschreibt. Auf <strong>der</strong> Horizontalen stehen rechtw<strong>in</strong>klig zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> die Achsen a* <strong>und</strong> b*,<br />
die die Farben beschreiben. Die a*-Achse reicht dabei <strong>von</strong> Grün bis zu Magenta <strong>und</strong> die b*-<br />
Achse <strong>von</strong> Blau bis Gelb.<br />
Der L*a*b*-Farbraum umfasst ebenso wie <strong>der</strong> XYZ-Farbraum alle für den Menschen<br />
sichtbaren Farben <strong>und</strong> ist ebenso systemübergreifend e<strong>in</strong>deutig, weshalb er auch im<br />
Farbmanagement für die Umrechnung <strong>von</strong> Farbräumen verwendet wird. Darüber h<strong>in</strong>aus wird<br />
dieser Farbraum auch als Arbeitsfarbraum benutzt <strong>und</strong> Bilddateien im L*a*b*-Farbraum<br />
abgespeichert.<br />
4
Abb.2.1.2 L*a*b*-Farbraum [Al1]<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Bitmap (Monochrom)<br />
Dieses Farbsystem stammt aus den Anfängen <strong>der</strong> Bilddarstellung am Computer <strong>und</strong> besteht nur<br />
aus den Farben Schwarz <strong>und</strong> Weiß. Hierbei wird für jedes Pixel e<strong>in</strong>es Rasterbildes nur jeweils<br />
e<strong>in</strong> Bit an Informationen verwendet, nämlich ob e<strong>in</strong> Pixel schwarz o<strong>der</strong> weiß ist.<br />
Die Grauskala (Grayscale)<br />
Die Grauskala be<strong>in</strong>haltet nur die unbunten Farben <strong>von</strong> schwarz bis weiß <strong>und</strong> den dazwischen<br />
liegenden Abstufungen. Wie viele Abstufungen e<strong>in</strong>e Grausskala hat hängt <strong>von</strong> <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong><br />
für die Information verwendeten Bits ab. Üblicherweise werden 8 Bits verwendet, mit denen<br />
256 Abstufungen dargestellt werden können.<br />
Das RGB-Farbmodell<br />
Das RGB-Farbmodell basiert auf dem Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> additiven Farbmischung, bei <strong>der</strong> mittels<br />
Mischung <strong>von</strong> roten, grünen <strong>und</strong> blauen Licht e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Farbvalenz entsteht. So entsteht aus<br />
<strong>der</strong> Mischung <strong>von</strong> rotem <strong>und</strong> grünen Licht e<strong>in</strong> gelbes Licht, aus <strong>der</strong> Mischung <strong>von</strong> Grün <strong>und</strong><br />
Blau die Farbe Cyan <strong>und</strong> aus Rot <strong>und</strong> Blau entsteht Magenta. Werden alle drei Gr<strong>und</strong>farben<br />
gemischt so entsteht Weiß.<br />
Fast alle selbstleuchtenden Ausgabegeräte wie Fernsehgeräte, Monitore, Beamer, etc. basieren<br />
auf diesem Pr<strong>in</strong>zip, aber auch Licht empfangende Geräte wie Scanner, digitale Kameras, etc.<br />
zerlegen das empfangende Licht <strong>in</strong> die Bestandteile Rot, Grün <strong>und</strong> Blau.<br />
Jedes auf dem RGB-Modell aufbauende Gerät besitzt e<strong>in</strong>en ganz eigenen <strong>von</strong> den an<strong>der</strong>en<br />
Geräten verschiedenen Farbraum, den Gamut. Gr<strong>und</strong> für die Unterschiede s<strong>in</strong>d die technischen<br />
Eigenschaften <strong>der</strong> Geräte wie. z.b. die Leuchtkraft, denn stark gesättigte Farben erfor<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e<br />
dem entsprechende Leuchtkraft des Monitors. Aber auch fabrikneue, baugleiche Geräte<br />
unterscheiden sich, wenn auch für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar.<br />
Durch die Notwendigkeit geme<strong>in</strong>samer, systemübergreifen<strong>der</strong> Arbeitsfarbräume wurden<br />
zahlreiche Farbräume durch Organisationen <strong>und</strong> Unternehmen entwickelt. Diese lehnen sich<br />
zum e<strong>in</strong>en an die technischen Gegebenheiten an aber auch an die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Anwendungsbereiche wie z.b. Farbumfang, Gamma (s. Kap. 2.2.3.2) <strong>und</strong> Weißpunkt (s. Kap.<br />
2.2.3.1).<br />
In <strong>der</strong> Tabelle 2.1.1 werden die für die Computertechnologie <strong>und</strong> Bildbearbeitung wichtigsten<br />
<strong>und</strong> am weitest verbreiteten Farbräume erläutert. Die Abb. 2.1.3 zeigt den Vergleich des<br />
Farbumfangs e<strong>in</strong>iger dieser Farbräume anhand <strong>der</strong> aus Abb. 2.1.1 bekannten Normfarbtafel.<br />
5
Abb. 2.1.3 Vergleich <strong>von</strong> RGB Farbräumen [Ufg1]<br />
Name Gamma / Weißpunkt Beschreibung<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
sRGB 2.2 / 6500 K Geeignet für Bil<strong>der</strong> im Internet <strong>und</strong> PC<br />
Anwendungen, die ke<strong>in</strong> Farbmanagement<br />
unterstützen, da die meisten Monitore diesen<br />
Farbraum komplett darstellen können. Wegen<br />
se<strong>in</strong>es ger<strong>in</strong>gen Farbumfang nicht für die<br />
professionelle Bildbearbeitung geeignet.<br />
Adobe RGB (1998) 2.2 / 6500 K Großer, fast alle Druckfarben umfassen<strong>der</strong><br />
Farbraum, <strong>der</strong> häufig zur Bearbeitung <strong>von</strong> für<br />
den Druck bestimmten Bil<strong>der</strong> verwendet wird.<br />
Wegen des Gamma <strong>von</strong> 2.2 eher für den PC<br />
geeignet.<br />
eciRGB 1.8 / 5000 K Wird <strong>von</strong> <strong>der</strong> ECI (European Color Initiative)<br />
für die Verwendung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Druckvorstufe<br />
empfohlen, da dieser Farbraum alle Farben<br />
des Vierfarbdrucks abdeckt. Wegen des<br />
Gamma <strong>von</strong> 1.8 eher für Mac OS geeignet.<br />
Wide Gamut RGB 2.2 / 5000 K Sehr großer Farbraum.<br />
Apple RGB 1.8 / 6500 K Geeignet für Bil<strong>der</strong> <strong>in</strong> Anwendungen, die ke<strong>in</strong><br />
Farbmanagement unterstützen, unter MacOS.<br />
ColorMatch RGB 1.8 / 5000 K Bis auf e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Weißpunkt dem Apple<br />
RGB sehr ähnlich.<br />
LStar-RGB L* / 5000 K Großer Arbeitsfarbraum <strong>und</strong> <strong>der</strong> Erste mit<br />
e<strong>in</strong>er Koord<strong>in</strong>atenverteilung gemäß <strong>der</strong> L*-<br />
Achse des L*a*b*-Farbraums.<br />
eciRGB v2 L* / 5000 K Gleicher Farbumfang wie eciRGB, aber mit<br />
<strong>der</strong> L* Koord<strong>in</strong>atenverteilung.<br />
Tab. 2.1.1 RGB-Farbräume [Fr05][Kr01]<br />
6
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Bil<strong>der</strong> im RGB-Farbraum werden überwiegend <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Farbtiefe <strong>von</strong> 8 Bit pro Farbkanal, d.h.<br />
mit 24 Bit, bearbeitet <strong>und</strong> gespeichert. Je<strong>der</strong> Farbekanal kann dabei 256 Abstufungen annehmen<br />
was <strong>in</strong>sgesamt zu über 16,7 Millionen Farben führt. Zur Bearbeitung bzw. Angabe <strong>in</strong><br />
Bildbearbeitungsprogrammen wird für jeden Kanal entwe<strong>der</strong> die Dezimaldarstellung <strong>von</strong> 0 bis<br />
255 o<strong>der</strong> die Hexadezimaldarstellung <strong>von</strong> 00 bis FF <strong>der</strong> Abstufungen angegeben, wobei 0 bzw.<br />
00 ke<strong>in</strong>e, <strong>und</strong> 255 bzw. FF volle Farb<strong>in</strong>tensität des Kanals angibt. Die Abstufungen <strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>zelnen Kanäle werden dann als Tripel, wie z.b. (0,255,255) bzw. #00FFFF zusammengefasst.<br />
Häufig ist auch <strong>von</strong> dem rgba-Farbraum die Rede, was etwas irreführend ist, denn hierbei<br />
handelt es sich nicht um e<strong>in</strong>e Farbraumdef<strong>in</strong>ition wie aus Tab.2.1.1. Mit rgba ist lediglich e<strong>in</strong><br />
RGB-Farbraum wie z.b. e<strong>in</strong>er aus <strong>der</strong> Tab. 2.1.1 geme<strong>in</strong>t, <strong>der</strong> um e<strong>in</strong>en weiteren Kanal<br />
erweitert wurde, <strong>der</strong> Information zu <strong>der</strong> Transparenz des Bildes be<strong>in</strong>haltet, dem Alpha-Kanal.<br />
Bei e<strong>in</strong>igen Dateiformaten kann mit Hilfe des Alpha-Kanals für jeden Bildpunkt die<br />
Transparenz beschrieben werden. So kann z.B. bei dem GIF-Format unterschieden werden ob<br />
e<strong>in</strong> Bildpunkt vollständig o<strong>der</strong> nicht transparent ist. Beim PNG-Format ist sogar e<strong>in</strong>e Abstufung<br />
<strong>der</strong> Transparenz <strong>in</strong> 256 Stufen bei 8Bit Farbtiefe möglich.<br />
Das CMY(K) Farbmodell<br />
Das CMY-Farbmodell basiert auf dem Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> subtraktiven Farbmischung, bei <strong>der</strong> durch die<br />
Mischung <strong>der</strong> Farben Cyan, Magenta <strong>und</strong> Gelb (Yellow) weitere Farben entstehen. Entgegen<br />
<strong>der</strong> additiven Farbmischung werden hier aber ke<strong>in</strong>e Lichtfarben gemischt, son<strong>der</strong>n durch<br />
Auftragen e<strong>in</strong>er Druckfarbe auf e<strong>in</strong>em Körper Farbanteile aus dem reflektierenden<br />
Lichtspektrum absorbiert.<br />
Wird e<strong>in</strong> weißes Blatt <strong>Papier</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> Sonne angestrahlt, reflektiert es das Licht, wodurch es uns<br />
weiß ersche<strong>in</strong>t. Wird die Druckfarbe Cyan aufgetragen so absorbiert es den Rotanteil des<br />
Lichtes, wodurch nur <strong>der</strong> Grün- <strong>und</strong> Blauanteil des Lichtes das Blatt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Farbe Cyan<br />
ersche<strong>in</strong>en lässt. Würde statt <strong>der</strong> Druckfarbe Cyan die Druckfarbe Magenta verwendet, würde<br />
<strong>der</strong> Grünanteil absorbiert, <strong>und</strong> im Falle <strong>von</strong> Gelb würde <strong>der</strong> Blauanteil absorbiert. E<strong>in</strong>e<br />
Komb<strong>in</strong>ation <strong>der</strong> Druckfarben Cyan <strong>und</strong> Magenta würde den Rotanteil <strong>und</strong> Grünanteil des<br />
Lichtes absorbieren, wodurch das Blatt Blau ersche<strong>in</strong>en würde, etc. E<strong>in</strong>e Mischung aller drei<br />
Gr<strong>und</strong>farben hätte zur Folge, das sämtliches Licht absorbiert <strong>und</strong> das Blatt <strong>Papier</strong> <strong>in</strong> Schwarz<br />
ersche<strong>in</strong>en würde.<br />
Da Druckfarben aber nie e<strong>in</strong>e 100%ige Re<strong>in</strong>heit besitzen, würde uns das Blatt <strong>Papier</strong> bei e<strong>in</strong>er<br />
Mischung <strong>der</strong> 3 Gr<strong>und</strong>farben als dunkles Braun <strong>und</strong> nicht als Schwarz ersche<strong>in</strong>en. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> wurde das CMY-Farbmodell um die Druckfarbe Schwarz zum CMYK-Farbmodell<br />
erweitert. Das „K“ steht für den englischen Begriff „Keyplate“, wobei es sich um die schwarze<br />
Druckplatte beim Vierfarbendruck handelt. Darüber h<strong>in</strong>aus führt die zusätzliche Verwendung<br />
<strong>der</strong> schwarzen Druckfarbe zu e<strong>in</strong>er Reduzierung des Verbrauchs <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Druckfarben <strong>und</strong><br />
ist daher ökologisch sowie ökonomisch s<strong>in</strong>nvoll.[Kr01]<br />
Auf dem CMYK-Farbmodell basieren die meisten Druckverfahren <strong>der</strong> Druck<strong>in</strong>dustrie, wird<br />
aber ebenso bei handelsüblichen Farbdruckern verwendet. Wie auch bei den Geräten mit RGB-<br />
Farbraum hat jedes Druckverfahren o<strong>der</strong> vielmehr jede Druckmasch<strong>in</strong>e ihren ganz eigenen<br />
CMYK-Farbraum, da auch hier technische <strong>und</strong> physikalische Eigenschaften die verfügbaren<br />
Farben bestimmen. E<strong>in</strong>fluss nehmen z.b. die Druckfarbe selbst, die Menge <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Druckmasch<strong>in</strong>e aufgetragenen Druckfarbe <strong>und</strong> die <strong>Papier</strong>farbe, um nur E<strong>in</strong>ige zu nennen.<br />
Wie bei dem RGB-Farbmodell gibt es auch für das CMYK-Farbmodell <strong>von</strong> Organisationen <strong>und</strong><br />
Unternehmen standardisierte Farbräume, o<strong>der</strong> vielmehr standardisierte Druckbed<strong>in</strong>gungen,<br />
sodass die daraus entwickelten Farbräume ziemlich präzise den Gamut wie<strong>der</strong>geben.<br />
7
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Zu nennen wären hier z.B. die Euroscale coated v2, Euroscale uncoated v2, ISO coated v2 ECI,<br />
ISO uncoated, u.v.a.m. Sowohl die Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. als auch die ECI<br />
(European Color Initiative) empfehlen bei unbekannter Druckausgabe den ISO coated v2 ECI<br />
als CYMK Arbeitsfarbraum.[Fo08][EC08]<br />
HSB-Farbmodell (HSV-Farbmodell)<br />
Mit diesem Farbmodell wird dem menschlichen Verständnis <strong>von</strong> Farbe Rechnung getragen,<br />
<strong>in</strong>dem es die Farbvalenzen nach den Eigenschaften Farbton (Hue), Sättigung (Saturation) <strong>und</strong><br />
Helligkeit (Brightness bzw. Value) beschreibt. Da bei diesem Farbmodell die Farbtöne auf<br />
e<strong>in</strong>em Kreis angeordnet werden, werden diese mit e<strong>in</strong>er Gradzahl deklariert, wobei Rot bei 0°<br />
über die Farben Gelb (60°), Grün(120°), Cyan(180°), Blau (240°) <strong>und</strong> Magenta (300°) bis h<strong>in</strong><br />
zu 360°, bei <strong>der</strong> wie<strong>der</strong> Rot erreicht wird.<br />
Die Sättigung <strong>und</strong> Helligkeit werden prozentual angegeben, wobei 0% Sättigung e<strong>in</strong> unbunte<br />
Farbvalenz darstellt, also je nach Helligkeit Schwarz, Weiß o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Grauton, <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e 100%<br />
Sättigung den Farbton <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensivsten Farbvalenz beschreibt. Die Helligkeit ist bei 0%<br />
unabhängig <strong>von</strong> Farbton o<strong>der</strong> Sättigung <strong>in</strong> jedem Fall Schwarz. [Kr01]<br />
Die Abb.2.1.4 zeigt den HSB-Farbraum <strong>in</strong> zwei unterschiedlichen Darstellungen:<br />
Abb. 2.1.4 HSB(HSV)-Farbraum [Pro1][Wi1]<br />
Volltonfarbpaletten<br />
Volltonfarbpaletten werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Druck<strong>in</strong>dustrie beim Vierfarbdruck zusätzlich o<strong>der</strong> anstelle<br />
<strong>der</strong> 4 Druckfarben (Prozessfarben) Cyan, Magenta, Gelb <strong>und</strong> Schwarz verwendet. Zum e<strong>in</strong>en<br />
hat dies den H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, dass bestimmte Farbtöne nicht mit dem CMYK Farbraum dargestellt<br />
werden können, wie z.b. sehr <strong>in</strong>tensive Grüntöne o<strong>der</strong> aber Son<strong>der</strong>farben wie z.B Silber <strong>und</strong><br />
Gold. Zum An<strong>der</strong>en ist es beim großflächigen Drucken e<strong>in</strong> <strong>und</strong> des selben Farbtons<br />
ökonomischer diesen, anstatt ihn aus den CMYK-Farben zu mischen, als Volltonfarbe zu<br />
drucken.<br />
Die bekanntesten Farbpaletten s<strong>in</strong>d die des gleichnamigen Druckfarbenherstellers Pantone <strong>und</strong><br />
die HKS-Farbpaletten <strong>der</strong> Druckfarbenhersteller Hostmann-Ste<strong>in</strong>berg, K+E <strong>und</strong> Schm<strong>in</strong>cke.<br />
Bei <strong>der</strong> Verwendung <strong>von</strong> Volltonfarben bei <strong>der</strong> Bildbearbeitung werden diese <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
zusätzlichen Kanal gespeichert.<br />
2.2 Farbmanagement<br />
Unter Farbmanagement ist das Erhalten <strong>der</strong> Farbkonsistenz <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Reproduktionsworkflows<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> E<strong>in</strong>gabe mit z.b. Kameras, Scanner etc. über die Bearbeitung bis h<strong>in</strong> zur<br />
Ausgabe mit z.b. Monitor, Drucker, Offsetdruck etc. zu verstehen.<br />
8
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Dies war zu e<strong>in</strong>er Zeit, <strong>in</strong> <strong>der</strong> es im professionellen Bereich zumeist geschlossene Systeme gab,<br />
die Abstimmung <strong>der</strong> Geräte aufe<strong>in</strong>an<strong>der</strong>. Die rasante Entwicklung <strong>der</strong> Computer<strong>in</strong>dustrie mit<br />
e<strong>in</strong>er Vielzahl unterschiedlichster E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Ausgabegeräte <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene Öffnung<br />
dieser geschlossenen Systeme machte es notwendig, e<strong>in</strong> Farbmanagementsystem zu<br />
entwickeln, um die Farbkonsistenz auf verteilten <strong>und</strong> unterschiedlichsten E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Ausgabegeräten<br />
zu gewährleisten.<br />
Der Ansatz hierzu ist die Verwendung <strong>von</strong> geräteunabhängigen Farbräumen, die Umrechnung<br />
<strong>der</strong> geräteabhängigen Farbräume <strong>in</strong> diese geräteunabhängigen Farbräume <strong>und</strong> umgekehrt die<br />
Umrechnung <strong>der</strong> geräteunabhänigen Farbräume <strong>in</strong> den jeweiligen Gerätefarbraum.<br />
2.2.1 Farbmanagementsystem nach ICC-Standard<br />
Die „Foschungsgesellschaft Druck e.V.“ (kurz: Fogra) forcierte 1992 die Gründung <strong>der</strong> „ICC“,<br />
dem „International Color Consortium“, bestehend aus zahlreichen namhaften Software- <strong>und</strong><br />
Hardwareherstellern wie u.a. „Adobe“, „Sun Mircosytems“, „Silicon Graphics“, „Apple“,<br />
„Microsoft“ <strong>und</strong> „L<strong>in</strong>oType-Hell“ (heute: Heidelberger Druckmasch<strong>in</strong>en AG).<br />
Die ICC verabschiedete 1993 den bis dato sehr erfolgreichen ICC-Standard. Dieser Standard<br />
sieht vor, dass Farb<strong>in</strong>formationen mit Hilfe <strong>von</strong> Profildateien, den ICC-Profilen, durch Color<br />
Management Modules (kurz: CMM) <strong>von</strong> e<strong>in</strong>en Farbraum <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Farbraum<br />
umgerechnet werden. Als geräteunabhängiger Farbraum, dem Profile Connection Space (kurz:<br />
PCS) wurde <strong>der</strong> CIE XYZ-Farbraum <strong>und</strong> <strong>der</strong> CIE L*a*b*-Farbraum (s. Kap. 2.1) festgelegt.<br />
E<strong>in</strong> typischer Workflow <strong>in</strong> <strong>der</strong> Reproduktion ist das Scannen o<strong>der</strong> Fotografieren <strong>von</strong> Objekten,<br />
<strong>der</strong>en Farben mit Hilfe des jeweiliges Geräteprofils <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en PCS umgerechnet werden <strong>und</strong><br />
anschließend entwe<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Gerätefarbraum dem sogen. Gamut o<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en<br />
standardisierten Farbraum wie z.b den Arbeitsfarbraum AdobeRGB transformiert werden.<br />
Für die standardisierten Arbeitsfarbräume existieren ICC-Profile, die, sofern sie nicht bereits mit<br />
dem Betriebssystem, <strong>der</strong> Gerätetreibersoftware o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bildbearbeitungs-software ausgeliefert<br />
wurden, im Internet auf den entsprechenden Seiten zum Download angeboten werden. E<strong>in</strong>e<br />
Umrechnung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en standardisierten Arbeitsfarbraum ist gr<strong>und</strong>sätzlich zu empfehlen, da es<br />
e<strong>in</strong>erseits die Bildbearbeitung <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits die Weitergabe <strong>der</strong> Bilddateien erleichtert. E<strong>in</strong>e<br />
im H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> durchgeführte Umrechnung <strong>in</strong> den Monitor Gamut ist gr<strong>und</strong>sätzlich dann<br />
notwendig, wenn <strong>der</strong> Arbeitsfarbraum nicht auch <strong>der</strong> Monitorfarbraum ist, da ansonsten die<br />
Darstellung auf dem Monitor zu völlig an<strong>der</strong>en Farben führen kann, <strong>und</strong> so e<strong>in</strong>e vernünftige<br />
Bildbearbeitung unmöglich ist.<br />
Nach e<strong>in</strong>er evtl. Bildbearbeitung ist dann e<strong>in</strong>e Konvertierung <strong>in</strong> den Farbraum des jeweiligen<br />
Druckgerätes bzw. <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e notwendig, um auch an dieser Schnittstelle e<strong>in</strong>e<br />
Farbkonsistenz zu gewährleisten.<br />
Häufig entspricht <strong>der</strong> Arbeitsfarbraum dem des Ausgabegerätes bzw. bildet den Gamut des<br />
Ausgabegerätes so präzise ab, dass Abweichungen nur m<strong>in</strong>imal o<strong>der</strong> aber, je nach<br />
Anwendungsbereich, nicht relevant s<strong>in</strong>d. Beispiele hierfür s<strong>in</strong>d <strong>der</strong> sRGB-Farbraum, <strong>der</strong> dem<br />
Gamut e<strong>in</strong>es gewöhnlichen PC-Monitors relativ gut entspricht <strong>und</strong> deshalb bei den meisten<br />
W<strong>in</strong>dows<strong>in</strong>stallationen auch als Standardprofil für den Monitor ausgewählt ist.<br />
Bei MacOS-Systemen wird hierfür <strong>der</strong> AppleRGB verwendet.Bei <strong>der</strong> Druckausgabe ist dies<br />
ähnlich, da standardisierte Druckverfahren zu nahezu identischen Farbräumen führen, die<br />
wie<strong>der</strong>um als Profil vorliegen. Abb. 2.2.1 zeigt e<strong>in</strong>en exemplarischen ICC-Workflow.<br />
9
2.2.1.1 ICC-Profile<br />
Abb. 2.2.1 ICC-Workflow<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
E<strong>in</strong> ICC-Profil beschreibt e<strong>in</strong>en Farbraum <strong>und</strong> die entsprechende Umrechnung <strong>von</strong> <strong>und</strong> <strong>in</strong> den<br />
Profile Connection Space (kurz: PCS), den geräteunabhängigen XYZ-Farbraum <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> Lab-<br />
Farbraum. E<strong>in</strong> Profil liegt entwe<strong>der</strong> als Datei mit <strong>der</strong> Endung .icc <strong>und</strong> .icm vor o<strong>der</strong> wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong><br />
Bild o<strong>der</strong> Dokument e<strong>in</strong>gebettet. Des Weiteren werden ICC-Profile <strong>in</strong> Matrix-basierte <strong>und</strong> LUTbasierte<br />
Profile unterteilt, die die beiden möglichen Transformationsmethoden wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
Bei Matrix-basierten Transformationen können nur RGB-Farbwerte <strong>in</strong> XYZ-Werte <strong>und</strong> vice<br />
versa umgerechnet werden. Hierbei werden die RGB-Werte zunächst durch die pro Kanal<br />
vorhandenen Tone Reproduction Curves (kurz: TRC) l<strong>in</strong>earisiert <strong>und</strong> dann mittels e<strong>in</strong>er 3x3-<br />
Matrix <strong>in</strong> die XYZ-Werte umgerechnet.<br />
Bei e<strong>in</strong>er TRC handelt es sich entwe<strong>der</strong> um e<strong>in</strong>e Kurve aus Stützstellen, <strong>der</strong>en<br />
dazwischenliegende Werte <strong>in</strong>terpoliert werden, o<strong>der</strong> aber um e<strong>in</strong>e Funktion wie die<br />
Gammafunktion im Falle e<strong>in</strong>es Monitorprofils (siehe 2.2.3.2 Gamma). Bei <strong>der</strong> 3x3Matrix<br />
handelt es sich um die Primärvalenzen des XYZ-Farbsystems (s. Kap.2.1).<br />
Die Umrechnung <strong>der</strong> so errechneten XYZ-Farbwerte <strong>in</strong> den Zielfarbraum werden durch das<br />
Zielprofil bestimmt. Im Falle e<strong>in</strong>es Matrix-basierten Zielprofils werden die erhaltenen XYZ-<br />
Farbwerte zunächst durch die 3x3-Matrix <strong>in</strong> RGB-Werte umgerechnet <strong>und</strong> anschließend durch<br />
die TRCs del<strong>in</strong>earisiert bzw. korrigiert.<br />
Bei <strong>der</strong> LUT-basierten Transformation werden, ähnlich wie bei <strong>der</strong> Matrix-basierten<br />
Transformation, die Farbwerte vor o<strong>der</strong> nach <strong>der</strong> eigentlichen Transformation pro Farbkanal<br />
durch e<strong>in</strong>e als 1D-Input-Table bzw. als 1D-Output-Table bezeichnete Anpassungskurve vor-<br />
bzw. nachkorrigiert. Dies dient z.b. bei CMYK-Farbräumen zum Ausgleich des<br />
Tonwertzuwachses. Die eigentliche Transformation f<strong>in</strong>det über e<strong>in</strong>e als CLUT bezeichnete<br />
mehrdimensionale Tabelle statt, bei <strong>der</strong> die zu transformierenden Farbwerte nachgeschlagen<br />
bzw. nicht vorhandene durch das Color Management Module (kurz: CMM) <strong>in</strong>terpoliert werden.<br />
Während bei <strong>der</strong> Matrix-basierten Transformation lediglich RGB-Werte <strong>in</strong> XYZ-Werte <strong>und</strong> vice<br />
versa umgerechnet werden können, kann bei <strong>der</strong> LUT-basierten Transformation <strong>von</strong> RGB o<strong>der</strong><br />
CMYK <strong>in</strong> XYZ o<strong>der</strong> L*a*b* <strong>und</strong> umgekehrt umgerechnet werden. Bei Profilen, die für die<br />
Konvertierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en CMYK-Farbraum e<strong>in</strong>gesetzt werden, spricht man wegen <strong>der</strong> Separation<br />
<strong>in</strong> die vier Zielkanäle auch <strong>von</strong> sogenannten Separationsprofilen.[Hu02]<br />
10
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Das ICC-Profil ist aktuell <strong>in</strong> <strong>der</strong> Version 4 spezifiziert, die auch <strong>von</strong> den meisten CMMs<br />
unterstützt werden. Dennoch liegen diverse wichtige ältere Arbeitsfarbräume <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
überwiegend genutzten Version 2 vor. Selbst neuere Arbeitsfarbräume wie <strong>der</strong> Lstar RGB s<strong>in</strong>d<br />
sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong> Version 2 als auch Version 4 verfügbar.<br />
Mit <strong>der</strong> Version 4 wurden <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Mehrdeutigkeiten aus <strong>der</strong> Spezifikation <strong>der</strong> Version 2<br />
konkretisiert <strong>und</strong> <strong>der</strong> PCS präziser def<strong>in</strong>iert. Dies führt zu weniger Interpretationsunterschieden<br />
bei den CMM-Herstellern <strong>und</strong> soll so bei verschiedenen CMMs zu den gleichen<br />
Transformationsergebnissen führen. [ICC1]<br />
Der <strong>in</strong>teressierte Leser f<strong>in</strong>det sowohl die Spezifikation <strong>der</strong> Version2 als auch die <strong>der</strong> Version4<br />
unter http://www.color.org/icc_specs2.xalter.(Stand 25.03.09)<br />
2.2.1.2 Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent<br />
Der Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent (kurz: RI), <strong>in</strong> Adobe Anwendungen als „Priorität“ o<strong>der</strong> bei den HP<br />
Druckertreibern unter W<strong>in</strong>dows auch als „ICM-Absicht“ bezeichnet (siehe Abb. 2.2.2 <strong>und</strong> Abb.<br />
2.2.3), ist die Verfahrensweise, mit <strong>der</strong> bestimmt wird, wie die Farben e<strong>in</strong>es Bildes im<br />
Quellfarbraum <strong>in</strong> die Farben des Zielfarbraums umgerechnet werden sollen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt, dass die Auswahl des Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents ke<strong>in</strong>e Auswirkungen auf das<br />
Ergebnis hat, also die Ergebnisse identisch s<strong>in</strong>d, sofern alle Farbvalenzen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bild<br />
verwendet werden, <strong>in</strong> die gleichen Farbvalenzen des Zielfarbraums umgerechnet werden<br />
können.<br />
In den meisten Fällen ist es jedoch eher so, dass das Bild Farbvalenzen des Quellfarbraums<br />
enthält, welche nicht <strong>in</strong> die gleiche Farbvalenz des Zielfarbraums umgerechnet werden können,<br />
da sie dort gar nicht existieren. In diesem Fall s<strong>in</strong>d die Ergebnisse zum Teil sehr stark<br />
abweichend <strong>von</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>und</strong> sollten je nach Verwendungszweck bzw. nach Motiv des Bildes<br />
gewählt werden.<br />
Es stehen <strong>in</strong>gesamt 4 Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents zur Verfügung, auch wenn sie <strong>in</strong> unterschiedlichen<br />
Anwendungen unterschiedlich bezeichnet werden, wie die Abb.2.2.2. <strong>und</strong> Abb.2.2.3 zeigt.<br />
Abb. 2.2.2 Druckeroptionen HP Deskjet 959C<br />
11
Abb. 2.2.3 Dialog zur Profilkonvertierung <strong>in</strong> Photoshop 7.0<br />
Nachfolgend s<strong>in</strong>d die 4 Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents erläutert:<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
– Absolut farbmetrisch (Absolute colorimetric)<br />
Alle Farbvalenzen des Quellfarbraums, die auch im Zielfarbraum enthalten s<strong>in</strong>d, werden <strong>in</strong><br />
diese umgerechnet. Farbvalenzen die außerhalb des Zielfarbraums liegen, werden <strong>in</strong> die <strong>der</strong><br />
Farbvalenz am nächsten liegenden Farbvalenz umgerechnet. Die Farbe wird also auf die<br />
Hülle des Zielfarbraums gelegt. Dies hat zur Folge, dass Farb<strong>in</strong>formationen verloren gehen,<br />
wodurch Konturen mit Farben außerhalb des Zielfarbraums verfälscht o<strong>der</strong> gar nicht mehr<br />
dargestellt werden können. E<strong>in</strong> Beispiel hierfür wäre e<strong>in</strong> Farbverlauf, <strong>der</strong>, da nicht alle<br />
Farben dargestellt werden können, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gleich bleibenden Farbe endet, <strong>der</strong> Farbverlauf<br />
also „abgeschnitten“ wird.<br />
Die Beson<strong>der</strong>heit dieses Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents ist, dass Bereiche, die dem Weißpunkt des<br />
Quellfarbraums entsprechen, im Zielfarbraum nicht zwangsläufig ebenfalls dem Weißpunkt<br />
enstprechen, wodurch es möglich ist, das Medienweiß (auch: <strong>Papier</strong>weiß) im Zielfarbraum<br />
zu simulieren.<br />
– Relativ farbmetrisch (Relative colorimetric)<br />
Der relativ farbmetrische Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent verhält sich bei <strong>der</strong> Umrechnung <strong>der</strong><br />
Farbvalenzen identisch zum absolut farbmetrischen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent. Im Zielfarbraum<br />
vorhandene Farbvalenzen werden auch <strong>in</strong> diese umgerechnet, <strong>und</strong> die außerhalb des<br />
Zielfarbraums liegenden Farbvalenzen werden <strong>in</strong> die <strong>der</strong> Farbvalenz nächstliegende<br />
Farbvalenz umgerechnet. Der Unterschied zum absolut farbmetrischen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent<br />
besteht dar<strong>in</strong>, dass die Farben so umgerechnet werden, dass die relativen Abstände <strong>der</strong><br />
Farben zum Weißpunkt des Quellfarbraums auch im Zielfarbraum erhalten bleiben.<br />
– Perzeptiv (Perceptual)<br />
Beim perzeptiven o<strong>der</strong> auch photographischem Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent werden immer die<br />
relativen Abstände <strong>der</strong> Farbvalenzen erhalten. S<strong>in</strong>d im Bild des Quellfarbraums<br />
ausschließlich Farbvalenzen, die im Zielfarbraum abgebildet werden können, werden diese<br />
<strong>in</strong> die Farbwerte des Zielfarbraums umgerechnet. S<strong>in</strong>d Farbwerte außerhalb des<br />
Zielfarbraums im Bild enthalten, werden diese <strong>in</strong> die jeweils nächstliegende Farbvalenz<br />
umgerechnet. Der gesamte Rest <strong>der</strong> Farbvalenzen wird unter E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> relativen<br />
Abstände zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> <strong>in</strong> den Zielfarbraum herunter gerechnet. Das Bild wird also <strong>in</strong> den<br />
„kle<strong>in</strong>eren“ Zielfarbraum gestaucht, um so alle im Bild enthaltenden Konturen zu erhalten,<br />
<strong>und</strong> damit auch den Gesamte<strong>in</strong>druck des Bildes zu bewahren, weshalb dieser Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g<br />
Intent vorzugsweise bei Photographien verwendet wird.<br />
12
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
– Sättigung (Saturation)<br />
Dieser nur für Grafiken geeignete Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent wird vermutlich am seltensten<br />
angewendet, da mit diesem e<strong>in</strong>e möglichst gute Sättigung <strong>der</strong> Farben angestrebt wird.<br />
Zusätzlich zum Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent steht bei <strong>der</strong> Konvertierung häufig auch die Option <strong>der</strong><br />
Tiefenkompensierung <strong>und</strong> die <strong>der</strong> Verwendung e<strong>in</strong>es Dithers zur Verfügung.<br />
Bei Verwendung <strong>der</strong> Tiefenkompensierung wird vor <strong>der</strong> eigentlichen Konvertierung <strong>der</strong><br />
Schwarzpunkt des Quellfarbraums dem des Zielfarbraums angepasst, d.h. das tiefste Schwarz<br />
des Zielfarbraums wird zum tiefsten Schwarz des Quellfarbraums.<br />
Im Falle e<strong>in</strong>es tieferen Schwarzpunktes des Quellfarbraums im Vergleich zum Zielfarbraum<br />
würde dadurch vermieden, dass Farben, die dunkler als <strong>der</strong> Schwarzpunkt des Zielfarbraums<br />
s<strong>in</strong>d, zu diesem Schwarz umgerechnet werden, wodurch die Zeichnung <strong>in</strong> den tiefen Farbtönen<br />
verloren g<strong>in</strong>ge.<br />
Im umgekehrten Fall, bei dem <strong>der</strong> Schwarzpunkt des Quellfarbraums heller ist als <strong>der</strong> des<br />
Zielfarbraums, wird bei <strong>der</strong> Tiefenkompensierung <strong>der</strong> Schwarzpunkt im Quellfarbraum herab<br />
gesetzt, wodurch <strong>der</strong> Dynamikbereich des Zielfarbraums bei <strong>der</strong> Konvertierung ausgenutzt<br />
wird.<br />
Die Tiefenkompensierung wird zumeist <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit dem relativ farbmetrischen<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent e<strong>in</strong>gesetzt, um Zeichnungen <strong>in</strong> dunklen Bereichen zu erhalten. Bei dem<br />
perzeptiven Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent ist e<strong>in</strong>e Verwendung <strong>der</strong> Tiefenkompensation nicht notwendig, da<br />
die Anpassung des Schwarzpunktes bereits mit <strong>der</strong> Anpassung <strong>der</strong> Farbvalenzen zum Erhalt <strong>der</strong><br />
relativen Farbabstände durchgeführt wird.[SD1]<br />
Bei Farbraumkonvertierungen kann es passieren, dass bei ansonst sanften Verläufen e<strong>in</strong>zelne<br />
Farben nicht im Zielfarbraum enthalten s<strong>in</strong>d, was wie<strong>der</strong>um dazu führen kann, dass <strong>der</strong><br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent sichtbare Abstufungen <strong>in</strong>nerhalb des Verlaufes produziert, dem so genannten<br />
„Band<strong>in</strong>g“.[Br05]<br />
Um dies zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, kann bei <strong>der</strong> Konvertierung e<strong>in</strong> Dither verwendet werden, <strong>der</strong> diesen<br />
sanften Verlauf durch sanftes Vermischen <strong>von</strong> Pixeln <strong>in</strong> den angrenzenden Farben simuliert.<br />
2.2.1.3 Color Management Module (CMM)<br />
E<strong>in</strong> CMM ist e<strong>in</strong> Farbrechner, <strong>der</strong> Farb<strong>in</strong>formationen e<strong>in</strong>es Bildes <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en<br />
Farbraum gemäß <strong>der</strong> vier Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents <strong>und</strong> <strong>der</strong> zusätzlichen Konvertierungsoptionen<br />
Tiefenkompensation <strong>und</strong> Dither<strong>in</strong>g umrechnet. Es gibt nur wenige CMMs, wobei die<br />
Bekanntesten aus dem Hause Microsoft, mit dem mit W<strong>in</strong>dows ausgelieferten ICM2 (Image<br />
Color Match<strong>in</strong>g), <strong>von</strong> Apple, mit dem ebenfalls im Betriebssystem <strong>in</strong>tegrierten ColorSync 2.0,<br />
<strong>und</strong> <strong>von</strong> Adobe, mit <strong>der</strong> <strong>in</strong> ihren Anwendungen enthaltenden Adobe Color Eng<strong>in</strong>e (kurz: ACE)<br />
kommen. Sowohl die ICM2 als auch das ColorSync 2.0 basieren auf dem Farbrechner <strong>der</strong><br />
Heidelberger Druckmasch<strong>in</strong>en AG (ehemals: L<strong>in</strong>oType-Hell). Die Vorgängerversionen <strong>von</strong><br />
ICM2 <strong>und</strong> ColorSync 2.0 basieren nicht auf dem L<strong>in</strong>oType-Hell Farbrechner <strong>und</strong> spielen<br />
heutzutage ke<strong>in</strong>e Rolle mehr. [Hu02]<br />
Es gibt aber auch noch weitere CMMs, <strong>von</strong> denen zum<strong>in</strong>dest zwei e<strong>in</strong>e relativ wichtige Rolle<br />
spielen. Beim Ersten handelt es sich um das LittleCMS (kurz: LCMS), welches e<strong>in</strong>e<br />
OpenSource Entwicklung <strong>und</strong> <strong>in</strong> vielen OpenSource Anwendungen enthalten ist. So wird es<br />
z.B. <strong>in</strong> vielen L<strong>in</strong>ux Distributionen [ICC2] <strong>und</strong> auch <strong>in</strong> dem weit verbreiteten<br />
Bildbearbeitungsprogramm „ImageMagick“ verwendet.<br />
Beim zweiten OpenSource Farbrechner handelt es sich um das ArgyllCMS, welches ebenfalls<br />
weit verbreitet ist <strong>und</strong> bspw. <strong>in</strong> <strong>der</strong> Internetanwendung ICCView auf http://www.iccview.de<br />
verwendet wird.<br />
13
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Da die ICC zwar die Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents <strong>und</strong> auch die Profile spezifiziert, jedoch ke<strong>in</strong>e genauen<br />
Vorgaben zur Umrechnung <strong>der</strong> Farbwerte gemacht hat, ist die Umsetzung <strong>der</strong> CMMs den<br />
jeweiligen Entwicklern überlassen. Dies führt dazu, dass sich bei <strong>der</strong> Verwendung des selben<br />
Profils auf unterschiedlichen CMMs die Transformationsergebnisse unterscheiden. Um dem<br />
entgegen zu wirken, hat die ICC mit <strong>der</strong> Version 4 ihrer Spezifikation, Mehrdeutigkeiten aus <strong>der</strong><br />
Version 2 ausgeräumt. [ICC1]<br />
Die Qualität <strong>der</strong> CMMs ist nur schwer zu beurteilen, da letztlich ke<strong>in</strong>e <strong>der</strong> Umsetzungen als<br />
falsch o<strong>der</strong> als <strong>von</strong> <strong>der</strong> Spezifikation abweichend bezeichnet werden kann. Das führt dazu, dass<br />
die Anwen<strong>der</strong> selbst darüber zu entscheiden haben, welches CMM für welchen<br />
Anwendungszweck die jeweils besten Ergebnisse liefert.<br />
Es hat sich aber gezeigt, dass die Unterschiede <strong>in</strong> den Ergebnissen <strong>von</strong> Transformationen mit<br />
verschiedenen CMMs eher ger<strong>in</strong>gfügig s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> häufig nur bei sehr genauer Betrachtung <strong>der</strong><br />
Ergebnisse überhaupt visuell wahrzunehmen s<strong>in</strong>d, sodass die Qualität e<strong>in</strong>er Transformation <strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie <strong>von</strong> den verwendeten Profilen abhängt.[Hu02]<br />
Bestätigt wird die Aussage über die ger<strong>in</strong>gfügigen Unterschiede bei den Transformationen durch<br />
die im Folgenden erläuterte Analyse <strong>der</strong> Bildunterschiede <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n, die mit verschiedenen<br />
CMMs unter gleichen Voraussetzungen transformiert wurden.<br />
Um e<strong>in</strong>en möglichst großen Unterschied bei <strong>der</strong> Transformation zu erhalten, bietet sich die<br />
Transformation e<strong>in</strong>es Bildes mit möglichst vielen Farben e<strong>in</strong>es möglichst großen Farbraums <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> Bild mit e<strong>in</strong>em wesentlich kle<strong>in</strong>eren Farbraum an. Bei den ersten Versuchen handelte es sich<br />
deshalb um e<strong>in</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> Fogra bereitgestelltes Separationstestbild im L*a*b*-Farbraum im<br />
TIFF-Format [Fog1], welches <strong>in</strong> den kle<strong>in</strong>eren, häufig <strong>in</strong> Druckereien verwendeten, CMYK<br />
Farbraum „ISO coated v2 (ECI)“ transformiert wurde.<br />
Abb. 2.2.4 zeigt das verwendete Separationstestbild, wenn auch nicht farbtreu, zur<br />
Verdeutlichung dieses Versuch. Es enthält mehrere Schnitte des L*a*b*-Farbraum durch die<br />
Helligkeitsachse L* <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en L*/a* Schnitt.<br />
Abb.2.2.4 Fogra Lab-Separationstestbild [Fog1]<br />
14
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Bei <strong>der</strong> Konvertierung <strong>in</strong> den CMYK Farbraum hat sich jedoch gezeigt, dass die Verwendung<br />
des L*a*b*-Bildes zu nicht vergleichbaren Resultaten führt, da das CMM „LittleCMS“ e<strong>in</strong>e,<br />
<strong>von</strong> den an<strong>der</strong>en CMMs abweichende, Def<strong>in</strong>ition des L*a*b*-Farbraums verwendet. Bei dem<br />
LCMS wird gemäß <strong>der</strong> TIFF6.0 Spezifikation e<strong>in</strong> Weißpunkt <strong>von</strong> D65 verwendet, während alle<br />
an<strong>der</strong>en CMMs e<strong>in</strong>en D50-Weißpunkt verwenden.<br />
Für das LCMS wird zwar unter http://www.littlecms.com/tiff8adobe.zip e<strong>in</strong> ICC-Profil<br />
angeboten, das e<strong>in</strong>e Umrechnung des D65 <strong>in</strong> den D50 Farbraum <strong>und</strong> umgekehrt erlaubt, jedoch<br />
kommt es auch bei dessen Verwendung noch zu Farbabweichungen. Die Abb 2.2.5 zeigt e<strong>in</strong>e,<br />
mit <strong>der</strong> ACE unter W<strong>in</strong>dows (im Folgenden: W<strong>in</strong>ACE) durchgeführte relativ farbmetrische<br />
Transformation mit Tiefenkompensierung, welche repräsentativ für die Transformationen mit<br />
<strong>der</strong> ACE unter Mac (im Folgenden: MacACE), <strong>der</strong> ICM <strong>und</strong> ColorSync steht.<br />
Abb. 2.2.6 zeigt das mit dem LCMS, unter Verwendung <strong>der</strong> selben Optionen, transformierte<br />
Bild.<br />
Abb. 2.2.5 Relativ farbmetrische Transformation mit Tiefenkompensation mit W<strong>in</strong>ACE<br />
Abb. 2.2.6 Relativ farbmetrische Transformation mit Tiefenkompensation mit LCMS<br />
15
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Der deutlichste Unterschied ist bei dem Schnitt L*=0 zu sehen, wobei anzunehmen ist, dass bei<br />
LCMS <strong>der</strong> Schwarzpunkt des L*a*b*-Farbraums an<strong>der</strong>s def<strong>in</strong>iert ist. Diese Schwarzpunkt<br />
bed<strong>in</strong>gte Farbabweichung zieht sich bei zunehmen<strong>der</strong> Helligkeit mit abnehmen<strong>der</strong> Stärke durch<br />
den gesamten Farbraum. Weniger deutlich fallen die Farbabweichungen bei den extrem<br />
negativen a* <strong>und</strong> b* Werten auf, die sich bei allen L*-Schnitten an <strong>der</strong> äußeren l<strong>in</strong>ken <strong>und</strong><br />
unteren Seite bef<strong>in</strong>den.<br />
E<strong>in</strong>e Anfrage an den Hersteller des L*a*b*-Profils <strong>und</strong> Mitentwickler <strong>von</strong> LittleCMS<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Vermutung, dass die starken Abweichungen des L*=0-Schnitt wegen e<strong>in</strong>er<br />
möglichen, zu Adobe abweichenden, Spezifikation des L*a*b*-Farbraums entsteht, <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es<br />
möglichen Fehlers im L*a*b*-Profil h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> Falschfarben bei den niedrigen a* <strong>und</strong> b*<br />
Werten, blieb bis zum Abgabezeitpunkt dieser Arbeit lei<strong>der</strong> unbeantwortet.<br />
Da die Falschfarben aber nur bei den extrem negativen a* <strong>und</strong> b* Werten auftreten spielen sie <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Praxis ke<strong>in</strong>e Rolle. Die Farbabweichung, die vermutlich auf die Def<strong>in</strong>ition des<br />
Schwarzpunktes zurückzuführen s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d da deutlich gravieren<strong>der</strong>.<br />
Da für e<strong>in</strong>en Vergleich <strong>der</strong> CMMs e<strong>in</strong> Quellbild im L*a*b*-Farbraum aus den oben genannten<br />
Gründen entfällt, bietet sich als Nächstes e<strong>in</strong> Bild mit großem RGB-Farbraum an, dem<br />
WideGamutRGB. Hierzu wurde das Fogra Separationstestbild perzeptiv vom L*a*b*-Farbraum<br />
<strong>in</strong> den WideGamutRGB-Farbraum konvertiert. Das Ergebnis ist e<strong>in</strong> Bild, dessen RGB-Werte,<br />
wie das Photoshop Histogramm <strong>in</strong> Abb. 2.2.7 zeigt, relativ gleichmäßig verteilt s<strong>in</strong>d, <strong>und</strong> sich<br />
das Bild somit für den nachfolgenden Versuch eignet.<br />
Abb. 2.2.7 Histogramme des Quellbild im WideGamut-Farbraum<br />
Das im WideGamutRGB-Farbraum vorliegende Quellbild wurde anschließend mit<br />
verschiedensten Optionen mit <strong>der</strong> W<strong>in</strong>ACE <strong>und</strong> ICM unter Photoshop 7.0 auf W<strong>in</strong>dows, mit den<br />
CMMs MacACE <strong>und</strong> ColorSync unter Photoshop CS2 auf MacOS, mit LCMS unter<br />
ImageMagick auf L<strong>in</strong>ux <strong>und</strong> mit ArgyllCMS unter W<strong>in</strong>dows <strong>in</strong> den CMYK-Farbraum „ISO<br />
coated v2 (ECI)“ konvertiert.<br />
16
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Bei den verwendeten Konvertierungsarten handelte es sich um alle vier verschiedenen<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents, wobei <strong>der</strong> relativ farbmetrische <strong>und</strong> perzeptive Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent sowohl mit<br />
als auch ohne Tiefenkompensierung durchgeführt wurde. Die Tiefenkompensation ist bei <strong>der</strong><br />
absolut farbmetrischen Transfomation nicht möglich <strong>und</strong> wurde beim Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent<br />
„Sättigung“, welcher eher selten verwendet wird, vernachlässigt. E<strong>in</strong>e Tiefenkompensierung ist<br />
mit <strong>der</strong> ArgyllCMS offenbar lei<strong>der</strong> nicht möglich, zum<strong>in</strong>dest gab die Dokumentation hierzu<br />
ke<strong>in</strong>erlei H<strong>in</strong>weise.<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Transformationen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sg. 34 Bil<strong>der</strong> mit sechs Bil<strong>der</strong>n je CMM bzw. vier Bil<strong>der</strong>n<br />
beim ArgyllCMS. Beim visuellen Vergleich <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>, die unter den gleichen Optionen<br />
transformiert wurden, lassen sich lediglich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Bereichen bei genauerer Betrachtung<br />
Unterschiede erkennen. Um diese farblichen Abweichungen quantifizieren <strong>und</strong> analysieren zu<br />
können, wurde unter Verwendung <strong>von</strong> ImageMagick für jede Transformation mit jeweils allen<br />
an<strong>der</strong>en, mit den selben Optionen, transformierten Bil<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> Differenzbild berechnet. In den<br />
Differenzbil<strong>der</strong>n enthält jedes Pixel e<strong>in</strong>en Farbwert, <strong>der</strong> die Differenz <strong>der</strong> Farbwerte <strong>der</strong> selben<br />
Pixel <strong>der</strong> zu vergleichenden Bil<strong>der</strong> darstellt.[IM1]<br />
Am Differenzbild lässt sich so erkennen, ob <strong>und</strong> wie stark die Farbwerte jedes Pixel <strong>der</strong> beiden<br />
zu vergleichenden Bil<strong>der</strong>n abweichen.<br />
Die so berechneten 80 Differenzbil<strong>der</strong> ersche<strong>in</strong>en bei <strong>der</strong> visuellen Begutachtung allesamt<br />
Schwarz, d.h. sofern überhaupt Differenzen existieren, diese sehr kle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d. Zur<br />
Veranschaulichung zeigt Abb. 2.1.1.x e<strong>in</strong> sehr stark tonwertkorrigiertes Differenzenbild, damit<br />
Differenzen überhaupt sichtbar werden.<br />
Abb. 2.2.8 Tonwertkorrigiertes Differenzbild<br />
17
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Mit dem Photoshop Histogramm konnte <strong>von</strong> jedem <strong>der</strong> 80 Differenzbil<strong>der</strong> <strong>der</strong> Mittelwert <strong>der</strong><br />
Tonwerte <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Standardabweichung bezogen auf Helligkeit (Lum<strong>in</strong>anz) des Bildes <strong>und</strong> für<br />
jeden Farbkanal e<strong>in</strong>zeln ausgewertet werden.(s. Anhang A)<br />
Wie <strong>in</strong> den Tabellen A.1 bis A.5 des Anhangs A zu sehen ist, s<strong>in</strong>d die Farbwerte <strong>in</strong> den<br />
Differenzbil<strong>der</strong>n <strong>von</strong> W<strong>in</strong>ACE- <strong>und</strong> MacACE-Transformationen sehr niedrig, <strong>und</strong> auch die<br />
Differenzbil<strong>der</strong> <strong>der</strong> beiden ACEs mit e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en CMM unterscheiden sich nur sehr wenig.<br />
Das diese Bil<strong>der</strong> überhaupt Differenzen aufweisen, lässt die Vermutung zu, dass es sich hierbei<br />
evtl. um versions- o<strong>der</strong> platformabhängige R<strong>und</strong>ungsdifferenzen handelt.<br />
Um die weitere Analyse zu vere<strong>in</strong>fachen, wurden die Werte <strong>der</strong> MacACE <strong>und</strong> <strong>der</strong> W<strong>in</strong>ACE<br />
gemittelt <strong>und</strong> als ACE zusammengefasst, sowie die Lum<strong>in</strong>anzwerte wegen den extrem niedrigen<br />
Werten vernachlässigt.(s. Anhang A – Tab.A.6 <strong>und</strong> Tab.A.7)<br />
Um die Höhe <strong>der</strong> Differenzen besser e<strong>in</strong>ordnen zu können, wurden die Tonwertmittel <strong>und</strong> <strong>der</strong>en<br />
Standardabweichung für jede Transformationsart gemittelt <strong>und</strong> auch die Spanne, die Differenz<br />
aus maximalen <strong>und</strong> m<strong>in</strong>imalen Mittelwert bzw. Standardabweichung, errechnet.<br />
Außerdem wurden zur besseren optischen Darstellung die Tonwertmittel <strong>und</strong> auch die<br />
Standardabweichungen farblich unterlegt. „Grün“ bedeutet e<strong>in</strong>en Wert unterhalb des<br />
Mittelwertes, „Gelb“ markiert Werte oberhalb des Mittelwertes, <strong>und</strong> „Rot“ kennzeichnet die<br />
höchsten Werte bei <strong>der</strong> jeweiligen Transformationsart.<br />
Es ist sofort erkennbar, dass bei <strong>der</strong> relativ farbmetrischen Transformation mit<br />
Tiefenkompensation, bei <strong>der</strong> perzeptiven Transformation mit Tiefenkampensation sowie bei <strong>der</strong><br />
sättigungorientierten Transformation nur Differenzbil<strong>der</strong>, bei denen e<strong>in</strong> Bild des ICM zum<br />
Vergleich steht, Werte über den Mittelwerten auftreten. Alle an<strong>der</strong>en Differenzbil<strong>der</strong> liegen<br />
dagegen unterhalb des Mittelswertes.<br />
Wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber auch bei <strong>der</strong> absolut <strong>und</strong> relativ<br />
farbmetrischen sowie <strong>der</strong> perzeptiven Transformation haben die Vergleiche mit ICM nicht nur<br />
höhere Werte als im Mittel, son<strong>der</strong>n immer auch die Höchsten.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Farbabweichungen s<strong>in</strong>d diese sehr niedrig. Bei allen Transformationen<br />
ohne Tiefenkompensation liegen die mittleren Tonwertmittel unter 0,5 <strong>von</strong> 256 Tonwertstufen.<br />
Auch die Standardabweichungen liegen bei allen Transformationen ohne Tiefenkompensierung<br />
im Mittel unter 1. Differenzbil<strong>der</strong>, bei denen die zu vergleichenden Bil<strong>der</strong> mit Tiefenkompensierung<br />
transformiert wurden, weisen nur ger<strong>in</strong>gfügig höhere Werte auf.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich liegen die Transformationsergebnisse <strong>der</strong> verschiedenen CMMs sehr nah<br />
beie<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, <strong>und</strong> obwohl das ICM die höchsten Abweichungen zu den an<strong>der</strong>en CMMs<br />
aufweisen, s<strong>in</strong>d diese nur ger<strong>in</strong>g. Alle farblichen Abweichungen s<strong>in</strong>d so ger<strong>in</strong>g, dass diese nur<br />
bei e<strong>in</strong>er genaueren Betrachtung <strong>und</strong> im direkten Vergleich auffallen.<br />
Anwen<strong>der</strong> sollten trotz <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Unterschieden dennoch prüfen, wie sie welches CMM<br />
e<strong>in</strong>setzten, da diese Eigenschaften aufweisen können, die zu ungewollten Überraschungen<br />
führen können, wie z.B. die unterschiedliche Def<strong>in</strong>ition des Weißpunktes des L*a*b*-<br />
Farbraums im Falle des LCMS o<strong>der</strong> die vermutlich fehlende Tiefenkompensierung bei dem<br />
Argyll CMS.<br />
Für das ArgyllCMS sei hier noch anzumerken, dass es als das E<strong>in</strong>zige, <strong>der</strong> <strong>in</strong> dieser Arbeit<br />
betrachteten CMMs, noch nicht die Version 4 <strong>der</strong> ICC-Spezifikation unterstützt [Arg1]<br />
18
2.2.2 W<strong>in</strong>dows Color System (WCS)<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Dieses Color Management System wurde <strong>von</strong> Microsoft als Bestandteil <strong>von</strong> W<strong>in</strong>dows Vista<br />
e<strong>in</strong>geführt <strong>und</strong> besteht im wesentlichen aus zwei Bestandteilen, dem ICM, welches weiterh<strong>in</strong><br />
die Farbraumkonvertierung nach ICC-Spezifikation durchführt, <strong>und</strong> <strong>der</strong> „Color Infrastructure<br />
and Translation Eng<strong>in</strong>e“ (kurz: CITE), mit <strong>der</strong> e<strong>in</strong> neues Konzept zur Farbraumkonvertierung<br />
umgesetzt wurde.<br />
Bei Letzterem werden geräteabhängige Messdaten <strong>in</strong> sog. Device Model Profiles vorgehalten,<br />
bei denen es sich um Profildateien im XML-Format handelt, <strong>und</strong> die an <strong>der</strong> Endung .cdmp zu<br />
erkennen s<strong>in</strong>d. Diese Daten werden durch das Device Model, e<strong>in</strong>er geräteabhängen<br />
Umrechnungsvorschrift, <strong>in</strong> den CIE XYZ-Farbraum transformiert. Das WCS be<strong>in</strong>haltet bereits<br />
zahlreiche Device Models für e<strong>in</strong>e große Anzahl unterschiedlicher Gerätetypen, kann aber durch<br />
weitere Modelle <strong>von</strong> Hardwareherstellern <strong>und</strong> Entwicklern ergänzt werden.<br />
Die nun im XYZ-Farbraum vorliegenden Daten werden dann durch das Color Appearance<br />
Model <strong>in</strong> den CIECAM02-Farbraum (CIEJCh) umgerechnet, e<strong>in</strong>em relativ neuen, <strong>von</strong> <strong>der</strong> CIE<br />
entwickelten Farbraum, auf den im Folgenden nicht weiter e<strong>in</strong>gegangen wird. Zur Umrechnung<br />
werden hierbei Parameter aus den Color Appearance Model Profiles (Dateiendung .camp)<br />
herangezogen, welche die Betrachterbed<strong>in</strong>gungen, wie z.B. die Umgebungsbeleuchtung etc.,<br />
def<strong>in</strong>ieren.<br />
Das Ergebnis <strong>der</strong> Umrechnung ist die Gamut Bo<strong>und</strong>ery Def<strong>in</strong>ition (kurz: GBD), welche mit<br />
Gamut Mapp<strong>in</strong>g Models (GMM) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e GBD umgerechnet wird. Es existieren 3<br />
gr<strong>und</strong>legende, den Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents <strong>der</strong> ICC ähnelnde, GMMs, dem BasicPhoto, M<strong>in</strong>imum<br />
Color Difference (M<strong>in</strong>CD) <strong>und</strong> HueMap. Weitere GMMs können entwickelt <strong>und</strong> dem System<br />
h<strong>in</strong>zugefügt werden.<br />
Die Verwendung <strong>der</strong> GMMs wird durch die Gamut Mapp<strong>in</strong>g Model Profiles (kurz: GMMP)<br />
gesteuert werden. Diese besitzen die Endung .gmmp. In W<strong>in</strong>dows Vista s<strong>in</strong>d bereits folgende<br />
GMMPs enthalten:<br />
– Photo.gmmp<br />
Dieser GMMP verwendet das GMM BasicPhoto <strong>und</strong> entspricht dem perzeptiven<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent.<br />
– Proof<strong>in</strong>g.gmmp<br />
Verwendet den GMM M<strong>in</strong>CD <strong>und</strong> entspricht dem relativ farbmetrischen<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent.<br />
– MediaSim.gmmp<br />
Verwendet ebenfalls den GMM M<strong>in</strong>CD <strong>und</strong> entspricht dem absolut<br />
farbmetrischen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent.<br />
– Graphics.gmmp<br />
Entspricht dem Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent „Sättigung“ <strong>und</strong> verwendet den GMM HueMap.<br />
Nach Umrechnung <strong>der</strong> GBD wird dieser durch das Color Appearance Model wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> den<br />
XYZ-Farbraum transformiert <strong>und</strong> anschließend durch das Device Model <strong>in</strong> den Gerätefarbraum.<br />
[Ne07]<br />
Abb. 2.2.2.1 zeigt den gesamten WCS Workflow.<br />
Da das WCS bisher nur bei W<strong>in</strong>dows Vista e<strong>in</strong>gesetzt wird, ist dieses bisher nicht weit<br />
verbreitet. Aufgr<strong>und</strong> dessen, <strong>und</strong> <strong>der</strong> Tatsache, dass sich die Industrie <strong>und</strong> die Anwen<strong>der</strong> bei <strong>der</strong><br />
Unterstützung bzw. Nutzung des WCS zurückhalten, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter<br />
auf das WCS e<strong>in</strong>gegangen, sollte hier aber aufgr<strong>und</strong> des neuen Konzeptes zum<strong>in</strong>dest kurz<br />
angesprochen worden se<strong>in</strong>.<br />
19
2.2.3 Kalibrierung <strong>und</strong> Profilierung<br />
Abb. 2.2.9 WCS Pipel<strong>in</strong>e [MS2]<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Um Farben auf e<strong>in</strong>em Monitor überhaupt korrekt darzustellen zu können, ist es notwendig,<br />
diesen präzise e<strong>in</strong>zustellen <strong>und</strong> auch korrekt anzusteuern. Auch wenn häufig nur <strong>von</strong><br />
Monitorkalibrierung <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> -profilierung die Rede ist, so unterteilt die Fogra den gesamten<br />
Prozess <strong>in</strong> die drei Schritte Kalibrierung, Charakterisierung <strong>und</strong> Profilierung.<br />
Bei <strong>der</strong> Kalibrierung handelt es sich um die Monitore<strong>in</strong>stellungen Helligkeit, Kontrast, Gamma<br />
(s.Kap.2.2.3.2) <strong>und</strong> Weißpunkt (s.Kap.2.2.3.1), um so unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
wahrnehmungsgemäßen Helligkeitsdifferenzierung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Umgebungsbeleuchtung die<br />
technischen Möglichkeiten des Monitors soweit wie möglich auszunutzen.<br />
Die E<strong>in</strong>stellungen s<strong>in</strong>d hierbei entgegen <strong>der</strong> Reihenfolge <strong>der</strong> Schnittstellen über die<br />
Steuerungssignale, die <strong>von</strong> <strong>der</strong> Software zum Monitor gesendet werden, vorzunehmen. D.h., es<br />
werden zunächst die den Möglichkeiten entsprechend E<strong>in</strong>stellungen am Monitor selbst<br />
vorgenommen, da hier die präzisesten E<strong>in</strong>stellungen vorgenommen werden können.<br />
Anschließend werden E<strong>in</strong>stellungen an <strong>der</strong> Grafikkarte selbst vorgenommen, d.h. sofern die<br />
Möglichkeit besteht, e<strong>in</strong>e LookUpTable (kurz: LUT) auf die Grafikkarte zu laden (s.<br />
Kap.2.2.3.2). Die letzten Korrekturen werden dann im ICC-Profil h<strong>in</strong>terlegt.<br />
Ist <strong>der</strong> Vorgang <strong>der</strong> Kalibrierung abgeschlossen, wird <strong>der</strong> Monitor charakterisiert, <strong>in</strong>dem die an<br />
die Grafikkarte gesendeten Steuerungswerte, also die RGB-Farbwerte, den daraus<br />
resultierenden <strong>und</strong> gemessenen XYZ-Farbwerten <strong>in</strong> Tabellen gegenübergestellt werden. Diese<br />
Charakterisierungstabellen werden im Schritt <strong>der</strong> Profilierung dazu verwendet, um e<strong>in</strong> ICC-<br />
Profil zu errechnen, welches es ermöglicht, die RGB-Werte <strong>in</strong> XYZ- o<strong>der</strong> L*a*b*-Werte <strong>und</strong><br />
umgekehrt die XYZ- bzw. L*a*b*-Werte <strong>in</strong> die entsprechenden RGB-Werte um zurechnen.<br />
[Fo08]<br />
20
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Der oben beschriebene Prozess kann sowohl visuell, mit Programmen wie z.B. Adobe Gamma,<br />
o<strong>der</strong> aber auch messtechnisch durch die Verwendung <strong>von</strong> Kolorimeter o<strong>der</strong> Spektrometer <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong>en Software vorgenommen werden. Letztere werden direkt am Monitor angebracht <strong>und</strong><br />
messen die ausgegebenen Farben, die dann zumeist über e<strong>in</strong> direkt mit dem PC verb<strong>und</strong>enen<br />
USB-Kabel an die Software gesendet <strong>und</strong> weiterverarbeitet werden. Bei beiden Varianten wird<br />
<strong>der</strong> Benutzer <strong>von</strong> <strong>der</strong> Software zumeist <strong>in</strong> angemessener Weise durch den Kalibrierung-,<br />
Charakterisierung- <strong>und</strong> Profilierungsprozess geführt.<br />
Wegen <strong>der</strong> höheren Genauigkeit <strong>und</strong> den mo<strong>der</strong>aten Preisen für qualitativ hochwertige<br />
Messgeräte <strong>von</strong> Herstellern, wie u.a. „X-rite“ (ehemals: „Gretag Macbeth“), „DataColor“,<br />
„Intergrated Color Solutions“ etc., ist die messtechnische Variante <strong>der</strong> visuellen vorzuziehen.<br />
Die Fogra empfiehlt, vor <strong>der</strong> Kalibrierung <strong>und</strong> Profilierung den Monitor wegen möglicher<br />
Schwankungen bei <strong>der</strong> Ausgabe aufwärmen zu lassen, <strong>und</strong> im Anschluss an die Profilierung das<br />
Ergebnis visuell zu begutachten, <strong>und</strong> wenn möglich auch messtechnisch zu validieren, um das<br />
Profil ggf. zu korrigieren. Des Weiteren sollten <strong>der</strong> Kalibrierungs- <strong>und</strong> Profilierungsprozess <strong>in</strong><br />
regelmäßigen Abständen wie<strong>der</strong>holt werden, um so den sich än<strong>der</strong>nden Leistungseigenschaften<br />
des Monitors Rechnung zu tragen.[Fo08]<br />
Zur E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Farbtreue <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es ICC-Workflows müssen zusätzlich zum Monitor<br />
auch alle an<strong>der</strong>en E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Ausgabegeräte kalibriert <strong>und</strong> profiliert werden. Dies gilt für Scanner<br />
<strong>und</strong> Digitalkameras genau so wie für Druckmasch<strong>in</strong>en o<strong>der</strong> T<strong>in</strong>tenstrahldrucker. Wie dies im<br />
E<strong>in</strong>zelnen funktioniert, sei an dieser Stelle nicht <strong>in</strong>teressant, zumal die Kalibrierung <strong>und</strong><br />
Profilierung für Druckmasch<strong>in</strong>en dem gelernten Drucker überlassen werden sollte.<br />
2.2.3.1 Normlichtart & Weißpunkt<br />
Die Lichtverhältnisse haben e<strong>in</strong>en entscheidenen E<strong>in</strong>fluß auf die Farbvalenz. So wirkt bspw. das<br />
<strong>Papier</strong>weiß dieses Dokumentes bei Tageslicht am Fenster bläulich, während es bei e<strong>in</strong>er<br />
Beleuchtung mit normalen Glühlampen eher als rötlich empf<strong>und</strong>en wird. Gr<strong>und</strong> hierfür ist die<br />
spektrale Zusammensetzung des Lichtes e<strong>in</strong>er Lichtquelle, <strong>der</strong> relativen spektralen<br />
Strahlungsverteilung. Man bezeichnet Licht mit e<strong>in</strong>er bestimmten relativen spektralen<br />
Strahlungsverteilung auch als Lichtart<br />
Physikalisch betrachtet, besteht Licht aus Strahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen, wobei<br />
die Strahlen e<strong>in</strong>er Wellenlänge jeweils beim Auftreffen auf die Netzhaut des Auges die<br />
Farbvalenz e<strong>in</strong>er Spektralfarbe erzeugt. E<strong>in</strong>e Mischung <strong>von</strong> Strahlen unterschiedlicher<br />
Wellenlängen hat die Entstehung e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en Farbvalenz zur Folge. Dies ist das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong><br />
additiven Farbmischung, wie es bei dem XYZ-Farbmodell <strong>und</strong> dem RGB-Farbmodell <strong>in</strong><br />
Kap.2.1 bereits erläutert wurde <strong>und</strong> welche auf diesem natürlichen Zusammenhang basieren.<br />
Licht besteht, mit Ausnahme e<strong>in</strong>es Lasers, welcher nur Licht e<strong>in</strong>er bestimmten Wellenlänge<br />
ausstrahlt, immer aus e<strong>in</strong>er Mischung <strong>von</strong> Strahlen verschiedener Wellenlängen, <strong>der</strong>en<br />
Farbvalenz die Lichtfarbe ist. Trifft Licht auf e<strong>in</strong> Objekt, werden je nach Beschaffenheit <strong>der</strong><br />
Oberfläche Strahlen absobiert, transmittiert o<strong>der</strong> reflektiert. Die durch e<strong>in</strong> Objekt reflektierten<br />
Strahlen <strong>in</strong> ihrer spektralen Zusammensetzung erzeugen im menschlichen Auge die Farbvalenz<br />
des Objekts. Dies ist das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> subtraktiven Farbmischung, die Gr<strong>und</strong>lage des CMYK-<br />
Farbmodels (s. Kap 2.1).<br />
Wird e<strong>in</strong> <strong>und</strong> das selbe Objekte mit Licht <strong>in</strong> unterschiedlicher Lichtfarbe angestrahlt, so werden<br />
<strong>von</strong> dem Licht unterschiedliche Anteile <strong>der</strong> Wellenlängenbereiche absorbiert, transmittiert <strong>und</strong><br />
reflektiert, was dazu führt, dass das Objekt für uns <strong>in</strong> unterschiedlichen Farbvalenzen ersche<strong>in</strong>t.<br />
21
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Neben <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> Lichtart durch die relative spektrale Strahlungsverteilung kann<br />
diese, wenn auch nicht so präzise, durch die Farbtemperatur beschrieben werden.<br />
Stark vere<strong>in</strong>facht basiert diese Art <strong>der</strong> Beschreibung auf <strong>der</strong> Temperatur, bei <strong>der</strong> e<strong>in</strong> ideal<br />
schwarzer Hohlkörper, <strong>der</strong> „Planksche Strahler“, e<strong>in</strong> Licht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Lichtfarbe<br />
emittiert. Die durch den „Plankschen Strahler“ erzielbaren Lichtarten werden <strong>in</strong> Kelv<strong>in</strong><br />
angegeben <strong>und</strong> können im Yxy-Farbmodel als „Plankscher Farbenzug“ (auch: Black-Body<br />
Kurve) e<strong>in</strong>gezeichnet werden. (s. Abb. 2.1.1)[Lo89]<br />
Die Lichtfarbe reicht dabei mit steigen<strong>der</strong> Farbtemperatur <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em dunklen rötlichen Licht<br />
über weiß bis h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em hellen bläulichen Licht.<br />
Bestimmte Lichtarten wurden standardisiert bzw. genormt, um je nach Anwendungsfall e<strong>in</strong>e<br />
gleich bleibende Beleuchtung zu garantieren. Die für das Arbeiten am Monitor <strong>und</strong> für die<br />
Druck<strong>in</strong>dustrie wichtigsten Normlichtarten s<strong>in</strong>d die D65-Normlichtart mit 6500K <strong>und</strong> die D50-<br />
Normlichtart mit 5000K, mit denen <strong>der</strong> Weißpunkt des Monitors bestimmt wird. Monitore<br />
werden <strong>in</strong> aller Regel mit e<strong>in</strong>em Farbtemperatur <strong>von</strong> 6500K betrieben, da dies e<strong>in</strong> gutes Bild für<br />
die Arbeit am Monitor ergibt. Da <strong>in</strong> <strong>der</strong> Druckvorstufe <strong>und</strong> Druck<strong>in</strong>dustrie aber<br />
Farbbeurteilungen unter <strong>der</strong> Normlichtart D50 vorgenommen werden, ist 5000K ebenfalls e<strong>in</strong>e<br />
bei Monitoren gern e<strong>in</strong>gestellte Farbtemperatur, um Farben für den Druck bereits auf dem<br />
Monitor beurteilen zu können.<br />
2.2.3.2 Gamma<br />
Aus technischen Gründen entspricht das E<strong>in</strong>gangssignal e<strong>in</strong>es CRT-Monitors (CRT = Cathode<br />
Ray Tube) nicht dem Ausgangssignal, d.h. die l<strong>in</strong>eare Erhöhung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>gangsspannung<br />
resultiert nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em l<strong>in</strong>earen Anstieg des vom Monitor ausgesandten Lichtes. Dieses<br />
nichtl<strong>in</strong>eare Verhalten lässt sich durch e<strong>in</strong>e Funktion beschreiben, bei <strong>der</strong> sowohl das<br />
E<strong>in</strong>gangssignal (<strong>in</strong>put) als auch das Ausgangssignal (output) zwischen 0 für ke<strong>in</strong> Signal <strong>und</strong> 1<br />
für maximale Signalstärke skaliert ist. Die Formel 2.2.1 beschreibt den Zusammenhang<br />
zwischen E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Ausgangssignal als Funktion mit γ als Exponent für das E<strong>in</strong>gangssignal.<br />
[W3C96]<br />
output = <strong>in</strong>put γ<br />
(Formel 2.2.1)<br />
E<strong>in</strong> l<strong>in</strong>earer Zusammenhang zwischen E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Ausgangssignal wäre bei γ = 1 gegeben. Da<br />
CRT-Monitore im Mittel e<strong>in</strong> Gamma <strong>von</strong> 2,5 haben, werden bei <strong>der</strong> Darstellung e<strong>in</strong>er Grauskala<br />
zwar das Schwarz <strong>und</strong> Weiß korrekt dargestellt, jedoch s<strong>in</strong>d die Graustufungen im dunklen<br />
Bereich viel zu schwach <strong>und</strong> im hellen Bereich viel zu stark ausgeprägt, was die Skala<br />
<strong>in</strong>sgesamt viel zu dunkel ersche<strong>in</strong>en lässt. Die gilt analog für die Tonwertstufen <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Farbkanäle Rot, Grün <strong>und</strong> Blau.<br />
Diesem Verhalten kann durch e<strong>in</strong>e Gammakorrektur entgegengewirkt werden, <strong>in</strong>dem die<br />
darzustellenen Tonwertstufen entwe<strong>der</strong> bereits so vorliegen, dass <strong>der</strong>en Darstellung auf dem<br />
Monitor zu gleichmäßigen Tonwertstufen führt, die Tonwertstufen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Grafikkarte anhand<br />
e<strong>in</strong>er Tabelle, <strong>der</strong> LookUpTable (kurz: LUT) umgerechnet werden, o<strong>der</strong> aber <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er<br />
entsprechenden Software so umgerechnet, dass die Darstellung auf dem Monitor korrekt ist.<br />
Bei <strong>der</strong> Gammakorrektur wird aber nicht die gesamte Nichtl<strong>in</strong>earität des Monitors korrigiert,<br />
son<strong>der</strong>n „nur“ e<strong>in</strong> Gamma <strong>von</strong> 2,2. Gr<strong>und</strong> hierfür ist das nichtl<strong>in</strong>eare Verhalten <strong>der</strong><br />
menschlichen Wahrnehmung auf Helligkeitsunterschiede bei unterschiedlicher Umgebungsbeleuchtung.<br />
Für die Arbeit an Monitoren wird e<strong>in</strong> leicht gedimmter Raum angenommen, bei<br />
dem das Gamma <strong>der</strong> menschlichen Wahrnehmung ungefähr dem Quotienten <strong>von</strong> 2,5/2,2<br />
entspricht. Generell gilt also, dass e<strong>in</strong> Gammawert <strong>von</strong> 2,2 zu korrigieren ist.[W3C96]<br />
22
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Auf PC-Systemen müssen bei Softwareprogrammen, die ke<strong>in</strong> Farbmanagement unterstützen,<br />
e<strong>in</strong>schließlich <strong>der</strong> GUI des Betriebssystems, für den Gammawert <strong>von</strong> 2,2 vorkorrigierte Daten<br />
vorliegen. Farbmanagement unterstützende Softwareprogramme (wie z.B Adobe Photoshop)<br />
können Daten, die nicht <strong>in</strong> <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen vorkorrigierten Form vorliegen, dah<strong>in</strong>gehend<br />
umrechnen.<br />
Bei Mac-Systemen verhält sich dies etwas an<strong>der</strong>s. Bei diesen Systemen muss zwar ebenfalls e<strong>in</strong><br />
Gamma <strong>von</strong> 2,2 korrigiert werden, da sich die Monitore technisch nicht unterscheiden, sie<br />
verfügen im Gegensatz zu PCs jedoch immer über e<strong>in</strong>e LUT <strong>in</strong> <strong>der</strong> Grafikkarte, die e<strong>in</strong>e<br />
Teilkorrektur des Monitorgamma vornimmt.<br />
In <strong>der</strong> Standarde<strong>in</strong>stellung werden beim MacOS die Daten über die LUT <strong>der</strong> Grafikkarte soweit<br />
korrigiert, dass die Daten zur Monitorausgabe bei Softwareprogrammen ohne<br />
Farbmanagementunterstützung (auch hier e<strong>in</strong>schließlich die GUI des MacOS) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er für den<br />
Gammawert <strong>von</strong> 1,8 vorkorrigierten Form vorliegen müssen. Für Farbmanagement<br />
unterstützende Software gilt auch bei Mac-Systemen, dass Daten <strong>in</strong> die jeweils erfor<strong>der</strong>liche<br />
Gammakorrektur umgerechnet werden können.<br />
Diese unterschiedliche Vorgehensweise bei <strong>der</strong> Gammakorrektur ist <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong> dafür, dass<br />
Bil<strong>der</strong>, die zur Darstellung auf dem PC vorkorrigiert wurden <strong>und</strong> auf e<strong>in</strong>em Mac dargestellt<br />
werden, zu hell <strong>und</strong> zu blass ersche<strong>in</strong>en, da sie für MacOS überkorrigiert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> vice versa<br />
Bil<strong>der</strong>, die zur Betrachtung auf MacOS vorkorrigiert wurden, auf e<strong>in</strong>em PC zu dunkel<br />
dargestellt werden, also nicht stark genug korrigiert s<strong>in</strong>d.<br />
Bei Farbmanagement unterstützen<strong>der</strong> Software, ob auf Mac o<strong>der</strong> auf PC, spielt dies ke<strong>in</strong>e Rolle,<br />
da e<strong>in</strong>e Umrechnung <strong>der</strong> Gammakorrektur durch die Software möglich ist, sofern dass Bild über<br />
die Information <strong>der</strong> verwendeten Gammakorrektur verfügt, wie z.B. mit Hilfe e<strong>in</strong>es ICC-Profils,<br />
o<strong>der</strong> aber vom Anwen<strong>der</strong> ausgewählt wurde.<br />
Relativ neu ist die Gammakorrektur mithilfe <strong>der</strong> L*-Achse des L*a*b*-Farbraums, da diese<br />
dem Helligkeitsempf<strong>in</strong>den des menschlichen Auges präziser entspricht.<br />
Zum Thema „Gamma“ sei noch anzumerken, dass sich die obigen, auf das Monitorgamma<br />
bezogene Aussagen <strong>in</strong> ähnlicher Weise auch für an<strong>der</strong>e Geräte wie Scanner, Film- <strong>und</strong><br />
Fotoapparate, sowie auf Drucker <strong>und</strong> Druckmasch<strong>in</strong>en übertragen lassen.<br />
2.2.4 Softproof<br />
Die ISO 12646 def<strong>in</strong>iert e<strong>in</strong>en Softproof folgen<strong>der</strong>maßen:<br />
„An e<strong>in</strong>em Monitor vorgenommene Darstellung <strong>der</strong> Druckdaten mit dem Zweck, den<br />
farblichen E<strong>in</strong>druck des Farbauszugsvorganges (Aufbereitung) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weise<br />
nachzustellen, welche den farblichen E<strong>in</strong>druck auf e<strong>in</strong>er Druckmasch<strong>in</strong>e nahezu<br />
nachbilded“ (2008, Forga Softproof Handbuch, S.6):<br />
E<strong>in</strong> Softproof, also die <strong>Simulation</strong> e<strong>in</strong>es Druckergebnisses auf dem Monitor, erlaubt die<br />
farbliche Beurteilung e<strong>in</strong>es Bildes o<strong>der</strong> Dokuments als Druckerzeugnis, ohne dass dieses <strong>in</strong><br />
gedruckter Form vorliegt, um so gegenüber e<strong>in</strong>es Andrucks o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>es Proofdrucks (<strong>Simulation</strong><br />
<strong>der</strong> Druckbed<strong>in</strong>gungen auf e<strong>in</strong>em speziellen Drucker) Zeit <strong>und</strong> Kosten e<strong>in</strong>zusparen.<br />
Erste Voraussetzung, um überhaupt die Farbausgabe e<strong>in</strong>er Druckmasch<strong>in</strong>e simulieren zu können<br />
ist, dass e<strong>in</strong> passendes ICC-Profil vorliegt, welches den Gamut <strong>der</strong> Komb<strong>in</strong>ation aus<br />
Druckmasch<strong>in</strong>eneigenschaften, Druckfarbe <strong>und</strong> Bedruckstoff beschreibt, sei es e<strong>in</strong><br />
Standardprofil e<strong>in</strong>es standardisierten Druckverfahrens (s. Kap.2.1) o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> speziell erstelltes<br />
Profil. Das Bild o<strong>der</strong> Dokument muss dann unter Verwendung e<strong>in</strong>es dem Zwecke dienlichen<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent (zumeist perzeptiv o<strong>der</strong> relativ farbmetrisch mit Tiefenkompensierung) <strong>in</strong><br />
diesen Farbraum konvertiert werden.<br />
23
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Die daraus entstehenden L*a*b*-Farbwerte werden absolut farbmetrisch auf dem Monitor<br />
dargestellt, da so sowohl <strong>der</strong> Weißpunkt als auch <strong>der</strong> Schwarzpunkt des Separationsprofils,<br />
welche das <strong>Papier</strong>weiß <strong>und</strong> die schwarze Druckfarbe repräsentieren, nicht als Weiß- <strong>und</strong><br />
Schwarzpunkt übernommen werden, d.h. die Farbe des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> die schwarze Farbe korrekt<br />
simuliert werden.[Fo08]<br />
Abb 2.2.10 zeigt die Optionen zum E<strong>in</strong>richten e<strong>in</strong>es Softproofs mit Adobe Photoshop 7.0.<br />
In diesem Beispiel wird e<strong>in</strong> Bild relativ farbmetrisch <strong>und</strong> mit Tiefenkompensierung <strong>in</strong> das<br />
Euroscale Coated v2 Profil konvertiert. Die Option „<strong>Papier</strong>weiß“ unter „Simulieren“ ist<br />
aktiviert, um so die L*a*b*-Werte absolut farbmetrisch auf dem Monitor wie<strong>der</strong>zugeben. Da bei<br />
<strong>der</strong> absolut farbmetrischen Transformation ke<strong>in</strong>e Tiefenkomensierung möglich ist, ist bei<br />
aktivierter <strong>Simulation</strong> des <strong>Papier</strong>weiß auch automatisch die Option „Schwarze Druckfarbe“<br />
aktiviert <strong>und</strong> kann nicht deaktiviert werden.<br />
Abb. 2.2.10 Softproof unter Photoshop 7.0<br />
E<strong>in</strong>e weitere Voraussetzung zur Durchführung e<strong>in</strong>es Softproofs ist e<strong>in</strong> Monitor, dessen Gamut<br />
möglichst den gesamten Gamut <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e abdeckt, sodass auch möglichst alle Farben<br />
des Drucks korrekt dargestellt werden können. Dieser muss dabei präzise kalibriert <strong>und</strong><br />
profiliert se<strong>in</strong> (s. Kap. 2.2.3). Welche E<strong>in</strong>stellungen beim Monitor gewählt werden, hängt<br />
hierbei zum e<strong>in</strong>em vom Zweck des Softproofs ab, aber auch <strong>von</strong> den Präferenzen des Benutzers.<br />
2.3 Webtechnologien zur Darstellung <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n<br />
Die Darstellung <strong>von</strong> Bilddateien <strong>in</strong> Webapplikationen kann durch verschiedene Technologien<br />
erfolgen. Die wohl häufigste Form ist die Referenzierung <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n im HTML-Quellcode<br />
durch den -Tag. Diese Bil<strong>der</strong> werden dann durch den Browser bzw. dessen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g-<br />
Eng<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terpretiert <strong>und</strong> dargestellt.<br />
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt das es auch den HTML-Tag gibt, mit dem es<br />
möglich ist Bil<strong>der</strong> darzustellen <strong>und</strong> mit <strong>der</strong> clientseitigen Skriptsprache JavaScript sogar<br />
manipuliert <strong>und</strong> erstellt werden können. Dies wird jedoch nicht weiter betrachtet, da <strong>der</strong><br />
-Tag Teil <strong>der</strong> noch nicht als Standard verabschiedeten HTML5 Spezifikation ist, die<br />
<strong>von</strong> diversen Browsern noch nicht unterstützt wird.[Moz1]<br />
24
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
An<strong>der</strong>e Webtechnologien werden h<strong>in</strong>gegen als eigenständige Software <strong>in</strong> den HTML-Code<br />
e<strong>in</strong>gebettet. Auch wenn diese zwar im Browser dargestellt werden, so verwenden sie dennoch<br />
ihre eigenen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g-Eng<strong>in</strong>es. So ist z.B. sowohl für die Funktionalitäten als auch für die<br />
Darstellung <strong>von</strong> JavaApplets die Installation <strong>der</strong> Java-Laufzeitumgebung notwendig. Weitere<br />
Beispiele s<strong>in</strong>d die, als „Rich Internet Application“ (kurz: RIA) bekannten Webtechnologien wie<br />
Adobe Flex, Microsoft Silverlight <strong>und</strong> JavaFX.<br />
Auch wenn mit diesen Webtechnologien e<strong>in</strong>e Darstellung <strong>von</strong> Bil<strong>der</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Webapplikation<br />
ohne weiteres möglich ist, so heißt dies aber noch nicht, dass die Bil<strong>der</strong> auch farbtreu dargestellt<br />
werden. Ist, wie im Falle dieser Arbeit, e<strong>in</strong>e farbtreue Darstellung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> notwendig, so ist<br />
zunächst zu untersuchen, welche Webtechnologie das Farbmanagement nach dem ICC-Standard<br />
unterstützt <strong>und</strong> wenn nicht, wie die Farben <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> <strong>in</strong>terpretiert <strong>und</strong> dargestellt werden <strong>und</strong>,<br />
ob dies dazu genutzt werden kann Bil<strong>der</strong> dennoch farbtreu darzustellen.<br />
Browser<br />
Lei<strong>der</strong> hat sich die Farbmanagementunterstützung bei Browsern noch nicht vollständig<br />
durchgesetzt, sodass dieses „Feature“ nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Browsern zur Verfügung steht.<br />
Hierzu gehören <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> populäre Browser „Firefox“ ab <strong>der</strong> Version 3 <strong>und</strong> <strong>der</strong> Browser<br />
„Safari“.[App1] Beim Firefox ist die Farbmanagementunterstützung standardmäßig deaktiviert,<br />
kann aber ohne weiteres über die Konfiguration aktiviert werden.[MZ1]<br />
Der „InternetExplorer“ bietet ke<strong>in</strong>e Farbmanagementunterstützung, <strong>in</strong>terpretiert jedoch alle<br />
Farb<strong>in</strong>formationen als sRGB-Farbwerte, wodurch zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>e farbtreue Darstellung <strong>von</strong><br />
Bil<strong>der</strong>n im sRGB-Farbraum möglich ist.<br />
Da die 3 Browser lt. Net Applications im Februar 2009 zusammen e<strong>in</strong>en Marktanteil <strong>von</strong> über<br />
97% ausmachten, wurde <strong>in</strong> dieser Arbeit auf die Untersuchung weiter Browser verzichtet.[NA1]<br />
Java Applets<br />
Durch die Java-Laufzeitumgebung verfügen Applets über volle Farbmanagementunterstützung<br />
mit <strong>der</strong> gr<strong>und</strong>sätzlich die farbtreue Darstellung <strong>von</strong> Bilddaten möglich ist. Gezeigt werden kann<br />
dies an dem Beispiel des „Dalim Dialogue“, e<strong>in</strong>em Applet mit dem das „Softproof“-Konzept<br />
umgesetzt wurde, <strong>und</strong> das <strong>von</strong> <strong>der</strong> Specifications Web Offset Publications (kurz: SWOP), e<strong>in</strong>er<br />
Organisation <strong>in</strong> <strong>der</strong> amerikanischen Druck<strong>in</strong>dustrie, für Farbtreue zertifiziert wurde. [DS05]<br />
RIA-Technologien<br />
Bei den „Rich Internet Application“-Technologien lassen sich lediglich für Adobe Flex konkrete<br />
Aussagen zu dessen Farbmanagementunterstützung f<strong>in</strong>den, weshalb sowohl JavaFX als auch<br />
Silverlight im weiteren Verlauf nicht mehr betrachtet werden.<br />
E<strong>in</strong>e Farbmanagementunterstützung bei Adobe Flex ist erst seit <strong>der</strong> vor kurzem erschienenen<br />
Version 10 des, für Flex-Applikationen notwendigen, Adobe Flash Players gegeben. Lei<strong>der</strong><br />
handelt es sich nicht um e<strong>in</strong>e umfassende Farbmanagementunterstützung, sodass ke<strong>in</strong>e <strong>in</strong> den<br />
darzustellenden Bil<strong>der</strong> e<strong>in</strong>gebetteten ICC-Profile berücksichtigt werden <strong>und</strong> das für die Bil<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> sRGB-Farbaum angenommen wird. Auf <strong>der</strong> Ausgabeseite f<strong>in</strong>det jedoch e<strong>in</strong>e Transformation<br />
<strong>der</strong> sRGB-Farbwerte <strong>in</strong> den Farbraum des, für den Monitor verwendeten ICC-Profils statt.<br />
[Ado1]<br />
25
2.4 Opazitäts- <strong>und</strong> Transparenzmessung<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>von</strong> gedruckten Dokumenten kann man häufig beobachten, dass die<br />
nachfolgende(n) Seite(n) o<strong>der</strong> aber auch die bedruckte Rückseite durch die gerade betrachtete<br />
Seite h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>t. Dazu fällt auf, dass die Stärke, mit <strong>der</strong> die Seiten h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>en,<br />
abhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Papier</strong>sorte ist <strong>und</strong> das dieser Effekt des „Durchsche<strong>in</strong>ens“ auf e<strong>in</strong>er<br />
unbedruckten Stelle des <strong>Papier</strong>s stärker ist als auf e<strong>in</strong>er Bedruckten.<br />
Dies liegt zum E<strong>in</strong>en an <strong>der</strong> Eigenschaft des <strong>Papier</strong>s, nicht völlig blickdicht zu se<strong>in</strong>, was <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Ausprägung bei verschiedenen <strong>Papier</strong>sorten variiert, <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en, im Falle <strong>der</strong> bedruckten<br />
Stellen des <strong>Papier</strong>s, dass die Druckfarbe selbst <strong>in</strong> Abhängigkeit ihres Deckungsvermögens mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger stark die bedruckte Seite <strong>und</strong> damit auch die nachfolgende Seiten h<strong>in</strong>durch<br />
sche<strong>in</strong>en lässt.<br />
Die Eigenschaft des „Durchsche<strong>in</strong>ens“ bei <strong>Papier</strong>en <strong>und</strong> Druckfarben wird <strong>in</strong> Industrie <strong>und</strong><br />
Wissenschaft als Opazität (Licht<strong>und</strong>urchlässigkeit) o<strong>der</strong> als Transparenz (Lichtdurchlässigkeit)<br />
bezeichnet. Die Opazität <strong>und</strong> Transparenz wird dabei häufig <strong>in</strong> Prozent angegeben, wobei e<strong>in</strong><br />
Stoff mit e<strong>in</strong>er Opazität <strong>von</strong> 0 % völlig lichtdurchlässig <strong>und</strong> bei 100% völlig licht<strong>und</strong>urchlässig<br />
ist. Bei <strong>der</strong> Transparenz ist es genau umgekehrt. Transparenz <strong>von</strong> 0% bedeutet absolute<br />
Licht<strong>und</strong>urchlässigkeit während 100% absolute Lichtdurchlässigkeit bedeutet.<br />
Physikalisch betrachtet ist die Transparenz nichts an<strong>der</strong>es als das <strong>in</strong> Verhältnis setzen <strong>der</strong> auf<br />
den Stoff auftreffenden Licht<strong>in</strong>tensität zu <strong>der</strong> durch den Stoff h<strong>in</strong>durch gelassenen<br />
(transmittierten) Licht<strong>in</strong>tensität. Anstatt dies prozentual anzugeben, wird hierbei für die<br />
Transparenz bei Durchsichtsproben <strong>der</strong> Transmissionsgrad (T) als Verhältnis zwischen<br />
transmittierter Licht<strong>in</strong>tensität I1 zur auftreffenden Licht<strong>in</strong>tensität I0 <strong>und</strong> bei Aufsichtproben, als<br />
Remission bezeichnet, mit dem Remissionsgrad (R) als Verhältnis des remittierten, <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Probe zurückgeworfenen Licht<strong>in</strong>tensität I1 zur auf die Probe auftreffenden Licht<strong>in</strong>tensität I0<br />
angegeben.[KK07]<br />
T = I1<br />
I0<br />
R = I1<br />
I0<br />
(Formel 2.4.1)<br />
(Formel 2.4.2)<br />
Sowohl <strong>der</strong> Transmissions- als auch <strong>der</strong> Remissionsgrad kann Werte zwischen 0 <strong>und</strong> 1<br />
annehmen, welche aussagen, dass bei e<strong>in</strong>em Wert <strong>von</strong> 0 ke<strong>in</strong> Licht <strong>von</strong> <strong>der</strong> Probe transmittiert<br />
bzw. remittiert wird <strong>und</strong> bei e<strong>in</strong>em Wert <strong>von</strong> 1 das gesamte Licht transmittiert bzw. remittiert<br />
wird. Bei dem Letzteren handelt es sich jedoch um e<strong>in</strong>en theoretischen Wert.[Lo89]<br />
Die Opazität als Gegenteil <strong>der</strong> Transparenz <strong>und</strong> Remission wird als Verhältnis <strong>der</strong> auf die Probe<br />
auffallenden zum transmittierten bzw. remittierten Licht<strong>in</strong>tensität, also als Kehrwert des<br />
Transmissions- bzw. Remissionsgrad, angegeben.[KK07]<br />
O = I0<br />
I1<br />
o<strong>der</strong> O = 1<br />
T bzw. O = 1<br />
R<br />
(Formel 2.4.3)<br />
26
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
In dieser Abhängigkeit nimmt die Opazität bei e<strong>in</strong>em Transmissions- bzw. Remissionsgrad <strong>von</strong><br />
1 den Wert 1 an, <strong>der</strong> die völlige Lichtdurchlässigkeit beschreibt.<br />
Bei e<strong>in</strong>em gegen 0 laufenden Transmissions- bzw. Remissionsgrad geht <strong>der</strong> Opazitätswert gegen<br />
Unendlich.<br />
Zur Messung <strong>der</strong> Opazität <strong>und</strong> Transparenz ist vom Deutschen Institut für Normung jeweils e<strong>in</strong><br />
Verfahren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Norm „DIN 53146 04.2000 – Prüfung <strong>von</strong> <strong>Papier</strong> <strong>und</strong> Pappe – Bestimmung<br />
<strong>der</strong> Opazität“ <strong>und</strong> <strong>der</strong> „DIN 53147 01.1993 – Prüfung <strong>von</strong> <strong>Papier</strong> – Bestimmung <strong>der</strong><br />
Transparenz“ festgelegt worden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Ersteres auch<br />
durch die ISO, <strong>der</strong> „International Organization for Standardization“, mit <strong>der</strong>, mir lei<strong>der</strong> nicht<br />
vorliegenden Norm ISO 2471 <strong>in</strong>ternational genormt wurde.[Lo98]<br />
Nach DIN 53146 ist die Opazität e<strong>in</strong>es <strong>Papier</strong>s das prozentuale Verhältnis des Reflexionsfaktors<br />
R0 zum Reflexionsfaktors R∞, wobei e<strong>in</strong> Reflexionsfaktor R nach DIN 53145-1 03.2000 stark<br />
vere<strong>in</strong>facht das Verhältnis <strong>der</strong> <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er Probe reflektierten Strahlungsleistung im Verhältnis zur<br />
reflektierten Strahlungsleistung e<strong>in</strong>es vollkommen mattweißen Körpers (zumeist e<strong>in</strong> Preßl<strong>in</strong>g<br />
aus Bariumsulfatpulver nach DIN 5033 <strong>und</strong> DIN 5033-9) darstellt.<br />
Der Reflexionsfaktor R0 ist <strong>der</strong> gemessene Reflexionsfaktor e<strong>in</strong>er Probe auf e<strong>in</strong>er Unterlage,<br />
dessen eigener Reflexionsfaktor ≤0,5% ist <strong>und</strong> als Hohlkörper bezeichnet wird.<br />
Der Reflexionsfaktor R∞ ist <strong>der</strong> gemessene Reflexionsfaktor e<strong>in</strong>er Probe, die auf e<strong>in</strong>em Stapel<br />
<strong>Papier</strong> <strong>der</strong> gleichen Sorte gemessen wird. Die Stapeldicke muss dabei m<strong>in</strong>destens so groß<br />
gewählt se<strong>in</strong>, dass bei e<strong>in</strong>er Verdoppelung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Blätter ke<strong>in</strong>e Än<strong>der</strong>ung des<br />
Reflexionsfaktors <strong>der</strong> Probe gemessen werden kann. Nach Messung <strong>der</strong> beiden Faktoren ergibt<br />
sich die Opazität <strong>der</strong> Probe wie folgt:<br />
O = R0<br />
∗ 100 [%] (Formel 2.2.4)<br />
R∞<br />
Da e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne Probe <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Messung nur die Opazität e<strong>in</strong>er bestimmten Stelle e<strong>in</strong>er<br />
e<strong>in</strong>zelnen <strong>Papier</strong>seite angibt, müssen bei jedem Probeblatt jeweils 5 Probestellen auf <strong>der</strong><br />
Oberseite <strong>und</strong> jeweils 5 Probestellen auf <strong>der</strong> Unterseite gemessen werden. Von allen<br />
Opazitätswerten wird dann das arithmetische Mittel errechnet.<br />
Im Falle <strong>von</strong> Unterschieden >0,2% bei den Seitenmittelwerten muss das arithmetische Mittel für<br />
jede Seite geson<strong>der</strong>t bestimmt <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Standardabweichung nach DIN 53804-1 errechnet<br />
werden.<br />
Des Weiteren schreibt die DIN 53146 die Auswahl <strong>und</strong> Verwendung <strong>von</strong> Proben nach den<br />
Bestimmungen <strong>der</strong> Norm DIN EN ISO 168 <strong>von</strong> August 2002 vor. Diese Norm bestimmt u.a. die<br />
Anzahl <strong>der</strong> zu verwendenden Probeseiten <strong>in</strong> Abhängigkeit vom gesamten Lieferposten <strong>und</strong><br />
Regeln zur Entnahme <strong>und</strong> Vorbereitung <strong>der</strong> Probeseiten.<br />
Die zur Berechnung <strong>der</strong> Opazität verwendeten Reflexionsfaktoren können <strong>in</strong> abgewandelter<br />
Form auch für die Berechnung weiterer Eigenschaften unter zur Hilfenahme <strong>von</strong> Probedrucken<br />
verwenden verwendet werden.<br />
So kann <strong>der</strong> als „Durchsche<strong>in</strong>en“ bezeichnete, vom Druckpapier abhängige Reflexionsverlust<br />
Ds, durch die zusätzliche Messung des Reflexionsfaktors RD e<strong>in</strong>es unbedruckten <strong>Papier</strong>s auf<br />
e<strong>in</strong>em Stapel <strong>Papier</strong> <strong>der</strong> gleichen Sorte, dessen oberstes Blatt auf <strong>der</strong> Oberseite bedruckt ist, wie<br />
folgt errechnet werden:<br />
27
Ds =<br />
R∞ − RD<br />
R ∞<br />
∗ 100 [%] = 100 – O [%] (Formel 2.4.5)<br />
2. Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei <strong>der</strong> Berechnung <strong>der</strong> Opazität anstatt <strong>von</strong> R0 im Zähler<br />
<strong>der</strong> Wert <strong>von</strong> RD zu verwenden ist.<br />
Mittels des Reflexionsfaktors RuS e<strong>in</strong>es auf <strong>der</strong> Rückseite bedruckten <strong>Papier</strong>s auf e<strong>in</strong>em Stapel<br />
<strong>der</strong> gleichen <strong>Papier</strong>sorte kann des Weiteren <strong>der</strong> als „Durchschlagen bezeichnete, <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Druckfarbe abhängige Reflexionsverlust Di berechnet werden.<br />
Di =<br />
R0 − RuS<br />
R0<br />
∗ 100 [%] (Formel 2.4.6)<br />
Zusammengefasst werden die beiden Reflexionverluste als Dp „Durchdrucken“.<br />
Die Messung <strong>der</strong> Transparenz bei transparenten <strong>Papier</strong>en nach DIN 53147 wird mit <strong>der</strong><br />
folgenden Formel berechnet:<br />
T = � �Rw − R0� ∗ � 10000<br />
R �w�<br />
− R0� (Formel 2.4.7)<br />
R0 ist hierbei <strong>der</strong> bereits aus <strong>der</strong> Opazitätsberechnung bekannte Reflexionsfaktor des <strong>Papier</strong>s<br />
auf e<strong>in</strong>em „Hohlkörper“. R(w) ist <strong>der</strong> Reflexionsfaktor e<strong>in</strong>er weißen Unterlage <strong>und</strong> Rw <strong>der</strong><br />
Reflexionsfaktors e<strong>in</strong>es Blattes auf <strong>der</strong> weißen Unterlage.<br />
Ohne weiterführend auf dieses Verfahren e<strong>in</strong>zugehen, sei noch anzumerken, dass ebenso wie bei<br />
<strong>der</strong> Norm zur Opazitätbestimmung auch die Norm zur Transparenzbestimmung diverse<br />
Verweise auf weitere Normen be<strong>in</strong>haltet, die Bestimmungen für die Messbed<strong>in</strong>gungen<br />
enthalten.[Lo89]<br />
28
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Wird e<strong>in</strong> digital vorliegendes Bild o<strong>der</strong> Dokument auf e<strong>in</strong>em Drucker o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Druckmasch<strong>in</strong>e ausgedruckt, so weicht das Ersche<strong>in</strong>ungsbild des Ausdrucks mehr o<strong>der</strong> weniger<br />
stark <strong>von</strong> se<strong>in</strong>er digitalen Vorlage ab. Um Anwen<strong>der</strong>n <strong>von</strong> Webapplikationen e<strong>in</strong>en konkreteren<br />
E<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong>es solchen Druckerzeugnisses bieten zu können, ohne dass ihnen dieses vorliegt,<br />
müssen die für das Ersche<strong>in</strong>ungsbild maßgeblichen Eigenschaften des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Druckfarbe simuliert werden.<br />
Im Folgenden wird e<strong>in</strong> Konzept erläutert, mit dem die, für das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild sowie<br />
die für die Opazität e<strong>in</strong>es Druckerzeugnisses, maßgeblichen Eigenschaften simuliert werden<br />
können. Diese werden <strong>in</strong> Kap.3.1 für die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung <strong>und</strong> <strong>in</strong> Kap.3.2 für die<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität zunächst differenziert betrachtet. In Kap. 3.3 werden beide Konzepte <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Workflow zusammengeführt. Abschließend wird <strong>in</strong> Kap. 3.4. die<br />
Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Webapplikation erörtert.<br />
Begleitend zum theoretischem Konzept, werden <strong>in</strong> diesen Kapiteln zum Teil auch konkretere<br />
Möglichkeiten zu Umsetzung aufgezeigt <strong>und</strong> erläutert.<br />
3.1 <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung<br />
Alle Eigenschaften des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> Druckfarbe, die e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf das farbliche<br />
Ersche<strong>in</strong>ungsbild e<strong>in</strong>es Druckerzeugnisses haben, können mit dem <strong>in</strong> Kap. 2.2.4 vorgestellten<br />
Konzept des „Softproof<strong>in</strong>g“ am Monitor simuliert werden, da dessen farbliche Auswirkungen<br />
durch Messungen erfasst werden können <strong>und</strong> dann als Charakterisierung e<strong>in</strong>er def<strong>in</strong>ierten<br />
Druckbed<strong>in</strong>gung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ICC-Profil vorliegen. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit seien<br />
im Folgenden e<strong>in</strong>ige dieser Eigenschaften sowie <strong>der</strong>en Berücksichtigung im ICC-Profil,<br />
erläutert:<br />
– Die Farbe des <strong>Papier</strong>s, die nicht nur unbedruckt <strong>von</strong> <strong>der</strong> Farbe <strong>der</strong> digitalen<br />
Vorlage abweicht, son<strong>der</strong>n ebenfalls die Farbgebung <strong>der</strong> verwendeten<br />
Druckfarbe bee<strong>in</strong>flusst. Die Farbe des unbedruckten <strong>Papier</strong>s wird hierbei als<br />
Weißpunkt im ICC-Profil h<strong>in</strong>terlegt. Weiter bee<strong>in</strong>flusst die Farbe des <strong>Papier</strong>s<br />
auch die Farbgebung <strong>der</strong> Druckfarben bei denen dies über die Messungen mit<br />
erfasst wird.<br />
– Die Farbe <strong>der</strong> Druckfarbe selbst, <strong>der</strong>en Farbgebung auf dem <strong>Papier</strong> durch<br />
Messungen erfasst wird.<br />
– Der Tonwertzuwachs, <strong>der</strong> mehrere Eigenschaften des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> Druckfarbe<br />
zusammenfasst <strong>und</strong> das Verlaufen <strong>der</strong> Druckfarbe auf dem <strong>Papier</strong> beschreibt.<br />
E<strong>in</strong>e den Tonwertzuwachs bee<strong>in</strong>flussende Eigenschaft des <strong>Papier</strong>s ist z.B. die<br />
Saugfähigkeit, aber auch die Eigenschaften <strong>der</strong> Druckfarbe wie z.B. die<br />
Trockungszeit o<strong>der</strong> die Viskosität. Die Farbgebung wird durch den<br />
Tonwertzuwachs <strong>in</strong>sofern bee<strong>in</strong>flusst, als dass e<strong>in</strong> stärkerer Verlauf <strong>der</strong><br />
aufgetragenen Druckfarbe das Bild dunkler wirken lässt. Der Tonwertzuwachs<br />
wird im ICC-Profil durch Korrekturkurven berücksichtigt.(s. Kap 2.2.1.1)<br />
29
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Neben den Auswirkungen <strong>der</strong> Eigenschaften des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> Druckfarbe bee<strong>in</strong>flusst die<br />
auch Umgebung, <strong>in</strong> <strong>der</strong> das Druckerzeugnis betrachtet wird, dessen Farbgebung erheblich. Dies<br />
wird ebenfalls berücksichtigt, <strong>in</strong>dem die Messungen unter def<strong>in</strong>ierten Bed<strong>in</strong>gungen, <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Regel dem Normlicht D50, durchgeführt <strong>und</strong> im ICC-Profil h<strong>in</strong>terlegt werden.<br />
Die für e<strong>in</strong>e Umsetzung des „Softproof“-Konzeptes notwendigen Voraussetzungen werden <strong>in</strong><br />
Kap 3.1.1 aufgeführt <strong>in</strong> dessen Anschluss das Konzept für die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung für<br />
Bilddateien <strong>in</strong> Kap.3.1.2, für PDF-Dokumente <strong>in</strong> Kap. 3.1.3 <strong>und</strong> für Layoutdokumente <strong>in</strong> Kap.<br />
3.1.4 differenziert betrachtet werden.<br />
3.1.1 Voraussetzungen für die <strong>Simulation</strong><br />
Damit die Farbgebung e<strong>in</strong>es Ausdrucks überhaupt simuliert werden kann, ist das Vorhandense<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>es hochwertigen ICC-Profils, welches die Druckbed<strong>in</strong>gung beschreibt, sowie für die<br />
farbtreue Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong>, e<strong>in</strong> kalibrierter <strong>und</strong> profilierter Monitor notwendig.<br />
Für jede Druckbed<strong>in</strong>gung die simuliert werden soll ist jeweils e<strong>in</strong> eigenes ICC-Profil zu<br />
verwenden, welche die jeweiligen Gegebenheiten des Drucks berücksichtigt. Hierzu muss für<br />
jede Komb<strong>in</strong>ation aus Drucker o<strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e, <strong>der</strong> zu verwendenden <strong>Papier</strong>sorte <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
zu verwendenden Druckfarbe e<strong>in</strong> eigenes Profil erstellt werden.<br />
Wie im E<strong>in</strong>zelnen e<strong>in</strong>e Druckmasch<strong>in</strong>e kalibriert <strong>und</strong> profiliert wird, wird an dieser Stelle nicht<br />
weiter erörtert, da dies durch die Druckereien zu erfolgen hat. Ob dabei die Druckmasch<strong>in</strong>en so<br />
e<strong>in</strong>gerichtet werden, dass Standardprofile wie z.B. die <strong>der</strong> ECI verwendet werden können, o<strong>der</strong><br />
ob die Druckmasch<strong>in</strong>en für jede <strong>Papier</strong>sorte <strong>und</strong> Druckfarben Komb<strong>in</strong>ation profiliert werden,<br />
sei dabei ebenfalls <strong>der</strong> Druckerei überlassen.<br />
Die Profilierung e<strong>in</strong>es Desktop Druckers wird hier ebenfalls nicht ausführlich erörtert, da dies<br />
zum e<strong>in</strong>en abhängig vom jeweiligen Drucker ist <strong>und</strong> sich <strong>von</strong> Messgerät zu Messgerät<br />
unterscheiden kann. Generell werden bei <strong>der</strong> Profilierung aber e<strong>in</strong> o<strong>der</strong> mehrere Messcharts den<br />
sogen. „Targets“ ausgedruckt, dass heißt e<strong>in</strong> Probeausdruck, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e bestimmte Menge an<br />
Farben enthält. Dessen geräteunabhängigen Farbwerte (XYZ-Farbwerte o<strong>der</strong> L*a*b*-<br />
Farbwerte) werden dann mit e<strong>in</strong>em Messgerät wie z.B. e<strong>in</strong>em Spektralphotometer bestimmt <strong>und</strong><br />
können den Farbwerten, die an den Drucker gesendet wurden, gegenüber gestellt werden. Aus<br />
den gegenüber gestellten Farbwerten wird dann e<strong>in</strong> Profil erstellt, mit dem es möglich ist, nicht<br />
gemessene Farbwerte zu <strong>in</strong>terpolieren.<br />
Für die Farbtreue bei <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong>, also <strong>in</strong> diesem Fall des Monitors auf dem<br />
das Druckerzeugnis simuliert werden soll, ist <strong>der</strong> Endanwen<strong>der</strong> verantwortlich. Dieser sollte<br />
über e<strong>in</strong>en präzise kalibrierten <strong>und</strong> profilierten Monitor verfügen, dessen Gamut größer ist als<br />
<strong>der</strong> Gamut <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e. Nähere Informationen zur Monitorkalibrierung <strong>und</strong><br />
-profilierung können <strong>in</strong> Kap. 2.2.3 „Kalibrierung <strong>und</strong> Profilierung“ nachgelesen werden.<br />
Ob <strong>der</strong> Monitor Gamut größer o<strong>der</strong> kle<strong>in</strong>er ist als <strong>der</strong> Gamut <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e, kann mit<br />
e<strong>in</strong>em GamutViewer wie z.B. ICCView auf www.iccview.de überprüft werden. Abb. 3.1.1 zeigt<br />
den Vergleich des Druckmasch<strong>in</strong>enprofiles „ISO coated v2 (ECI)“ mit dem aktuellen<br />
Monitorprofil e<strong>in</strong>es „Fujitsu Siemens ScaleoView“ Monitors <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em L*a*b*-<br />
Koord<strong>in</strong>atensystem.<br />
30
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Das Monitorprofil wird <strong>in</strong> dieser Ansicht als farblicher Raum dargestellt <strong>und</strong> das<br />
Druckmasch<strong>in</strong>enprofil als Gitternetz, welches überwiegend <strong>in</strong>nerhalb des Farbraums des<br />
Monitors liegt. Die Teile des Gitternetzes, die außerhalb des Monitorfarbraums liegen zeigen die<br />
Farbbereiche <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e an, die an diesem Monitor nicht dargestellt werden können,<br />
was <strong>in</strong> diesem Fall e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>er Rot-Magenta Bereich <strong>und</strong> e<strong>in</strong> größerer Grün-Cyan Bereich ist.<br />
Abb. 3.1.1 ICCView- Gamutvergleich Monitor vs. „ISO coated v2 (ECI)“<br />
Dass <strong>der</strong> Gamut <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e Farben enthält, die nicht im Gamut des Monitors enthalten<br />
s<strong>in</strong>d, heißt aber nicht, dass Druckerergebnisse im Farbraum <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>e generell nicht<br />
auf diesem Monitor simuliert werden können. Enthält das Druckergebnis selbst nur Farbtöne die<br />
auch mit dem Monitor dargestellt werden können, so kann es <strong>von</strong> diesem auch farbtreu<br />
dargestellt werden.<br />
Enthält es dagegen Farbtöne außerhalb des Monitorgamut, so werden diese entwe<strong>der</strong> gemäß des<br />
relativ farbmetrischen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents „abgeschnitten“, o<strong>der</strong> das gesamte Bild wird, unter<br />
Verlust <strong>der</strong> gesamten Farbtreue, aber mit Erhalt des Ersche<strong>in</strong>ungsbildes gemäß des perzeptiven<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents <strong>in</strong> den Monitorgamut gestaucht. (s. Kap. 2.2.1.2)<br />
Aber auch e<strong>in</strong> präzise kalibrierter <strong>und</strong> profilierter Monitor kann nur dann e<strong>in</strong>e das<br />
Druckergebnis simulierende Bilddatei farbrichtig wie<strong>der</strong>geben, wenn die Technologie, mit <strong>der</strong><br />
es dargestellt wird, das Farbmanagement unterstützt <strong>und</strong> den Farbraum des Bildes kennt, das<br />
ICC-Profil also <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bilddatei e<strong>in</strong>gebettet ist.<br />
Im Falle fehlen<strong>der</strong> Farbmanagementunterstützung ist e<strong>in</strong>e farbtreue Wie<strong>der</strong>gabe nur dann<br />
möglich, wenn das Bild <strong>in</strong> dem Farbraum vorliegt, mit dem auch die darstellende Software<br />
Bilddateien standardmäßig <strong>in</strong>terpretiert.<br />
31
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
E<strong>in</strong> Beispiel hierfür ist <strong>der</strong> sich für die Verwendung im Internet durchgesetzte sRGB-Farbraum,<br />
<strong>der</strong> vom „Internet Explorer“ standardmäßig zur Interpretation <strong>von</strong> Farb<strong>in</strong>formationen verwendet<br />
wird.(s. Kap. 2.3)<br />
Für nicht kalibrierte <strong>und</strong> profilierte Monitore, auch wenn sie wie im Falle <strong>der</strong> W<strong>in</strong>dows<br />
Systemen, standardmäßig mit dem sRGB-Profilen betrieben werden, ist ke<strong>in</strong>e farbtreue<br />
<strong>Simulation</strong> des Druckergebnisses möglich, obwohl diese <strong>in</strong> den meisten Fällen wohl immer<br />
noch e<strong>in</strong>en besseren E<strong>in</strong>druck vermitteln können als e<strong>in</strong>e Darstellung ohne <strong>Simulation</strong>.<br />
3.1.2 <strong>Simulation</strong> bei Bilddateien<br />
Um die Farben e<strong>in</strong>er ausgedruckten Bilddatei zu simulieren, wird das Konzept des Softproofs<br />
angewendet. In <strong>der</strong> Abb. 3.1.2 ist <strong>der</strong> dafür notwendige Workflow dargestellt <strong>und</strong> kann<br />
vollständig automatisiert durchgeführt werden.<br />
Der Workflow<br />
Abb. 3.1.2 Proof<strong>in</strong>g-Workflow für Bilddateien<br />
Das fertiggestellte <strong>und</strong> im Arbeitsfarbraum vorliegende Bild ist die Ausgangsdatei (1) des<br />
Workflows. In welchem Farbraum diese Datei vorliegt ist dabei unerheblich <strong>und</strong> vom jeweiligen<br />
Bearbeiter bestimmt worden. Die Bilddatei (1) wird dann mit e<strong>in</strong>em CMM (7) (s. Kap. 2.2.1.3)<br />
unter Verwendung des für die jeweiligen Druckbed<strong>in</strong>gungen erstellten ICC-Profils (2)<br />
transformiert/separiert. Dies kann automatisiert vorgenommen werden o<strong>der</strong> aber <strong>der</strong> jeweilige<br />
Bearbeiter konvertiert das Bild beispielsweise mit Photoshop <strong>in</strong> den Druckausgabefarbraum.<br />
E<strong>in</strong>e automatische Transformation stellt e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>griff <strong>in</strong> den betrieblichen Workflow dar, <strong>der</strong><br />
evtl. nicht gewünscht ist, hat aber den Vorteil, dass bei e<strong>in</strong>em Bild, welches unter verschieden<br />
Druckbed<strong>in</strong>gungen ausgegeben werden soll, die jeweilige Separation nicht mehrfach <strong>von</strong> dem<br />
Bearbeiter vorgenommen werden muss. Im Falle e<strong>in</strong>er Separation durch den Bearbeiter ist die<br />
automatische Transformation A überflüssig <strong>und</strong> die Ausgangsdatei des Workflows ist die für die<br />
Druckausgabe separierte Datei (3).<br />
32
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Welche CMM für die automatische Separation verwendet wird, ist wegen <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen<br />
Unterschiede bei den Transformationsergebnissen (s. Kap.2.2.1.3) eigentlich unerheblich.<br />
Wichtig ist jedoch die Bestimmung des Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents, wobei üblicherweise die relativ<br />
farbmetrische Transformation mit Tiefenkompensierung o<strong>der</strong> aber die perzeptive<br />
Transformation verwendet wird. Es ist jedoch <strong>in</strong> jedem Fall zu empfehlen, das Ergebnis <strong>der</strong><br />
Separation vor dem eigentlich Druck visuell zu überprüfen.<br />
Die separierte Bilddatei (3) wird dann zur <strong>Simulation</strong> des farblichen Ersche<strong>in</strong>ungsbildes absolut<br />
farbmetrisch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en größeren, geräteunabhängigen Farbraum transformiert (Transformation<br />
B). Hier bietet sich <strong>der</strong> L*a*b*-Farbraum an, es kann aber pr<strong>in</strong>zipiell je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e größere<br />
geräteunabhängige Farbraum wie z.b. <strong>der</strong> CIE XYZ-Farbraum verwendet werden. Außerdem<br />
muss für die Datei (4) das TIFF-Format gewählt werden, da dieses e<strong>in</strong> breite<br />
Farbraumunterstützung hat <strong>und</strong> unter an<strong>der</strong>em auch den L*a*b*-Farbraum unterstützt.<br />
Im Anschluß wird dann die Bilddatei (4) relativ farbmetrisch <strong>in</strong> den gewünschten RGB-<br />
Augabefarbraum konvertiert (Transformation C), wobei <strong>in</strong> die daraus resultierende(n)<br />
Bilddatei(en) (6) das jeweilige ICC-Profil (5) e<strong>in</strong>gebettet werden muss. Die E<strong>in</strong>bettung des<br />
Profils ist notwendig, damit die zur Darstellung des Bildes verwendete Farbmanagement<br />
unterstützende Software o<strong>der</strong> Technologie die Farbwerte auch korrekt <strong>in</strong>terpretieren kann.<br />
Das Dateiformat, die Auflösung <strong>und</strong> Bildmaße <strong>der</strong> Bilddatei (6) können je nach<br />
Verwendungszweck ausgewählt werden. Bei <strong>der</strong> Auflösung zur Ausgabe auf dem Monitor bietet<br />
sich selbstverständlich 72dpi an <strong>und</strong> als Dateiformat u.a. JPEG o<strong>der</strong> PNG.<br />
Der bei <strong>der</strong> Transformation C verwendete Zielfarbraum wäre optimalerweise das Monitorprofil<br />
des jeweiligen Endanwen<strong>der</strong>s, um so e<strong>in</strong>e weitere clientseitige Farbraumtransformation zu<br />
vermeiden. Dem Endanwen<strong>der</strong> sollte daher die Möglichkeit gegeben se<strong>in</strong>, se<strong>in</strong> Monitorprofil<br />
auf das System hochzuladen.<br />
Alternativ stehen dem Anwen<strong>der</strong> aber alle gängigen RGB-Profile, wie AdobeRGB,<br />
WideGamutRGB, AppleRGB, etc. zur Verfügung. Hier sollte <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en größeren<br />
Farbraum als den se<strong>in</strong>es Monitor wählen, denn die Wahl e<strong>in</strong>es Kle<strong>in</strong>eren hätte e<strong>in</strong>en unnötigen<br />
Verlust an Farb<strong>in</strong>formationen zur Folge. In den meisten Fällen ist daher e<strong>in</strong> Farbraum wie z.B.<br />
<strong>der</strong> WideGamutRGB die richtige Wahl.<br />
Detail zum Softproof<br />
Der im Workflow durch die Transformation A <strong>und</strong> B durchgeführte Softproof kann pr<strong>in</strong>zipiell<br />
auch durch e<strong>in</strong>e absolut farbmetrische Transformation, unter Verwendung <strong>der</strong> Ausgabeprofile<br />
(5), direkt <strong>in</strong> die Ausgabedatei (6), zusammengefasst werden. Allerd<strong>in</strong>gs kommt es häufig bei<br />
älteren Profilen mit 6500K-Weißpunkt (siehe Tab 2.1.1) zu e<strong>in</strong>er rötlichen Verfärbung.<br />
In Abb 3.1.3 s<strong>in</strong>d zwei absolut farbmetrische Transformationen e<strong>in</strong>es im „ISO coated v2 (ECI)“<br />
Farbraum vorliegenden Bildes dargestellt. Zum E<strong>in</strong>en wurde es <strong>in</strong> den „WideGamutRGB“<br />
(l<strong>in</strong>ks) mit e<strong>in</strong>em Weißpunkt <strong>von</strong> 5000K, zum An<strong>der</strong>en <strong>in</strong> den „AdobeRGB (1998)“ (rechts) mit<br />
e<strong>in</strong>em Weißpunkt <strong>von</strong> 6500K konvertiert.<br />
33
Abb. 3.1.3 Verfärbungsbeispiel<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Gr<strong>und</strong> für die rötliche Verfärbung ist e<strong>in</strong>e fehlerhafte Umrechnung, bei <strong>der</strong> die Farben des<br />
Separationsprofils, die üblicherweise bei e<strong>in</strong>er D50 Umgebungsbeleuchtung gemessen wurden,<br />
zunächst <strong>in</strong> den PCS umgerechnet werden <strong>und</strong> diese Farbwerte dann ohne Berücksichtigung,<br />
dass das Zielprofil mit e<strong>in</strong>em Weißpunkt <strong>von</strong> 6500K als Umgebungsbeleuchtung das Normlicht<br />
D65 verwendet, e<strong>in</strong>fach <strong>in</strong> diesen umgerechnet werden.An dieser Stelle müsste eigentlich e<strong>in</strong>e<br />
Anpassung <strong>der</strong> Farbwerte an die sich geän<strong>der</strong>te Umgebungsbeleuchtung vorgenommen werden.<br />
Um dies an e<strong>in</strong>em greifbaren Beispiel zu formulieren, könnte man sich vorstellen, man<br />
betrachtet die selbe <strong>Papier</strong>sorte e<strong>in</strong>mal unter dem Licht e<strong>in</strong>er Tischlampe <strong>und</strong> e<strong>in</strong>mal bei<br />
Tageslicht am Fenster würde, auch wenn im ersten Moment beide <strong>Papier</strong>e jeweils als Weiß<br />
empf<strong>und</strong>en würden, das <strong>Papier</strong> unter <strong>der</strong> Tischlampe leicht rötlich, <strong>und</strong> das <strong>Papier</strong> am Fenster<br />
eher bläulich ersche<strong>in</strong>en. Würde man nun das <strong>Papier</strong>, welches <strong>von</strong> <strong>der</strong> Tischlampe beleuchtet<br />
würde, mit zum Fenster nehmen, <strong>und</strong> würde sich das Ersche<strong>in</strong>ungsbild des <strong>Papier</strong>s nicht an die<br />
geän<strong>der</strong>ten Beleuchtungsbed<strong>in</strong>gungen anpassen, so würden sich die beiden <strong>Papier</strong>e im direkten<br />
Vergleich vom Ersche<strong>in</strong>ungsbild her deutlich unterscheiden, obwohl es sich um dieselbe<br />
<strong>Papier</strong>sorte handelt. Die Abb. 3.1.3 stellt genau diesen unnatürlichen Vergleich dar.<br />
Wegen dieser falschen Behandlung <strong>der</strong> Umgebungsbeleuchtung wird, wenn auch nur optional,<br />
bei neueren RGB-Profilen als e<strong>in</strong>heitliche Umgebungsbeleuchtung das Normlicht D50<br />
verwendet. Des Weiteren werden die Farbwerte bei <strong>der</strong> Ausgabe durch die zusätzlichen<br />
Informationen des optionalen „Chromatic Adaption Tag“ an die jeweils benötigte<br />
Umgebungsbeleuchtung angepasst. Nähere Information hierzu s<strong>in</strong>d unter<br />
http://www.color.org/ICC_M<strong>in</strong>or_Revision_for_Web.pdf (Stand 18.01.09) erhältlich.[ICC3]<br />
Da, wie gesagt, die Verwendung <strong>der</strong> D50 Umgebungsbeleuchtung <strong>und</strong> des<br />
„ChromaticAdaptionTag“ nur optional s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> das Verhalten auch weiterh<strong>in</strong> bei älteren<br />
Profilen wie dem „AdobeRGB (1998)“ auftritt, ist e<strong>in</strong>e Unterteilung <strong>in</strong> die Transformation A<br />
<strong>und</strong> B notwendig, da hierbei durch die relativ farbmetrische Transformation <strong>in</strong> Transformation<br />
B e<strong>in</strong>e Anpassung an den Weißpunktes <strong>und</strong> somit auch an die verwendete<br />
Umgebungsbeleuchtung vorgenommen wird.<br />
34
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Dass diese Unterteilung <strong>der</strong> Transformation auch bei Zielfarbräumen mit 5000K Weißpunkt<br />
angewendet wird, dient lediglich <strong>der</strong> e<strong>in</strong>heitlichen Behandlung <strong>der</strong> Dateien <strong>und</strong> hat nur<br />
marg<strong>in</strong>ale Auswirkungen auf die Qualität <strong>der</strong> Transformationsergebnisse.<br />
So zeigt e<strong>in</strong>e testweise mit verschiedenen CMMs durchgeführte Transformation des im „ISO<br />
coated v2 (ECI)“ Farbraum vorliegenden Bildes e<strong>in</strong>mal absolut farbmetrisch <strong>in</strong> den<br />
WideGamutRGB <strong>und</strong> e<strong>in</strong>mal zunächst absolut farbmetrisch <strong>in</strong> den L*a*b*- <strong>und</strong> anschließend<br />
relativ farbmetrisch <strong>in</strong> den WideGamutRGB-Farbraum, nur unwesentliche Unterschiede im<br />
Resultat.<br />
CMM Lum<strong>in</strong>anz Rot Kanal Grün Kanal Blau Kanal<br />
Standard-<br />
Standard-<br />
Standard-<br />
Standard-<br />
Mittelwert abweichung Mittelwert abweichung Mittelwert abweichung Mittelwert abweichung<br />
W<strong>in</strong>ACE 0,27 0,44 0,29 0,46 0,27 0,44 0,43 0,50<br />
MacACE 0,24 0,43 0,32 0,47 0,24 0,43 0,43 0,50<br />
ColorSy nc 0,27 0,44 0,29 0,45 0,27 0,44 0,39 0,49<br />
ICM 0,49 0,51 0,50 0,54 0,48 0,53 0,74 0,70<br />
Argy llCMS 0,25 0,43 0,28 0,45 0,25 0,43 0,43 0,50<br />
LittleCMS 0,24 0,43 0,31 0,46 0,24 0,43 0,42 0,50<br />
Tab. 3.1.1 Vergleich direkte o<strong>der</strong> zweistufige Transformation je CMM<br />
Die Tab. 3.1.1 zeigt die Ergebnisse dieses Vergleichs <strong>und</strong> gibt dazu die Tonwertmittel <strong>und</strong> <strong>der</strong>en<br />
Standardabweichungen <strong>der</strong>, wie schon bei den <strong>in</strong> Kap. 2.2.1.3 verwendeten, errechneten<br />
Differenzbil<strong>der</strong> aus dem Ergebnis <strong>der</strong> direkten <strong>und</strong> <strong>der</strong> zweistufigen Transformation je CMM.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass die verwendeten CMMs bei den zweistufigen Transformationen mit<br />
Abweichungen im Mittel durchweg <strong>von</strong> höchstens 0,5 <strong>von</strong> 256 Tonwertstufen <strong>und</strong> mit<br />
Standardabweichungen, mit Ausnahme <strong>der</strong> ICM, <strong>von</strong> maximal 0,5 Tonwertstufen nahezu<br />
identische Ergebnisse zu den direkten Transformationen liefern.<br />
Trotz <strong>der</strong> erläuterten Problematik ist dennoch e<strong>in</strong>e Zusammenfassung <strong>der</strong> Transformationen A<br />
<strong>und</strong> B möglich, sofern das verwendete CMM diesen Schritt zusammenfassend ausführen kann<br />
bzw. <strong>in</strong> <strong>der</strong> API als Funktion zur Verfügung stellt.<br />
Optionale Erweiterung des Workflows<br />
E<strong>in</strong>e weitere zum „Proof<strong>in</strong>g“ gehörende optionale Funktionalität ist die Gamut-Warnung. Diese<br />
Funktion erlaubt es, verwendete Farben des aktuellen Farbraums, die nicht im Zielfarbraum<br />
enthalten s<strong>in</strong>d, durch auffällige Farbtöne zu ersetzten, um so den Betrachter auf diese<br />
Diskrepanz aufmerksam zu machen. Üblicherweise wird diese, <strong>in</strong> Photoshop als Farbumfang-<br />
Warnung bezeichnete, Funktion dazu verwendet, um zu überprüfen, ob e<strong>in</strong> im Arbeitsfarbraum<br />
vorliegendes Bild farbtreu auf e<strong>in</strong>em Drucker o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Druckmasch<strong>in</strong>e ausgegeben werden<br />
kann.<br />
Da im oben vorgestellten Workflow bereits e<strong>in</strong>e Separation <strong>in</strong> den Ausgabefarbraum<br />
durchgeführt wurde, <strong>und</strong> die Intention dieses Workflows die farbliche <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong><br />
Druckausgabe ist <strong>und</strong> nicht Teil des Bildbearbeitungsprozesses se<strong>in</strong> soll, ist die Funktion <strong>der</strong><br />
Gamut-Warnung <strong>in</strong>sofern <strong>von</strong> Interesse, als dass sie den Betrachter bei <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong><br />
<strong>Simulation</strong> darauf h<strong>in</strong>weisen kann, dass Farben <strong>der</strong> simulierten Druckausgabe nicht farbtreu auf<br />
dem Monitor dargestellt werden können.<br />
35
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Abb. 3.1.4 zeigt auf <strong>der</strong> l<strong>in</strong>ken Seite e<strong>in</strong> Proofbild (3), dessen Ausgabe auf e<strong>in</strong>em Monitorprofil<br />
mit Hilfe <strong>der</strong> Proof-Funktionen <strong>von</strong> Photoshop zum E<strong>in</strong>en mit (rechts oben) <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en<br />
ohne Farbumfang-Warnung (rechts unten) simuliert wurde. Wie zu erkennen ist, werden im<br />
blauen Bereich bei Verwendung <strong>der</strong> Farbumfang-Warnung e<strong>in</strong>ige graue Streifen <strong>und</strong> Punkte<br />
angezeigt. Diese weisen darauf h<strong>in</strong>, dass die Farben dieser Pixel auf dem Monitor nicht farbtreu<br />
angezeigt werden können. Dass es sich hierbei offensichtlich um Cyan-ähnliche Farben handelt,<br />
deckt sich auch mit dem Gamutvergleich aus Abb. 3.1.1<br />
Verwendung <strong>von</strong> CMMs<br />
Abb.3.1.4 Farbumfang-Warnung <strong>in</strong> Photoshop<br />
Plattform CMM Kommentar<br />
L<strong>in</strong>ux/Unix/Solar<br />
is<br />
ArgyllCMS Direkte Ausführung o<strong>der</strong> Drittprogramm wie z.B.<br />
Ghostscript<br />
LittleCMS Zugriff über CMM-API o<strong>der</strong> Drittprogramm wie z.B.<br />
ImageMagick<br />
W<strong>in</strong>dows ICM Zugriff über W<strong>in</strong>dows API<br />
AdobeCMM<br />
(Standalone ACE)<br />
Die AdobeCMM entspricht <strong>der</strong> ACE <strong>und</strong> kann bei<br />
www.adobe.com zur freien Verwendung<br />
heruntergeladen werden. Zugriff über CMM-API<br />
Argyll Direkte Ausführung o<strong>der</strong> Drittprogramm wie z.B.<br />
Ghostscript<br />
LittleCMS Direkte Ausführung o<strong>der</strong> Drittprogramm wie z.B.<br />
ImageMagick<br />
MacOS ColorSync Zugriff über MacOS API<br />
AdobeCMM<br />
(Standalone ACE)<br />
Die AdobeCMM entspricht <strong>der</strong> ACE <strong>und</strong> kann bei<br />
www.adobe.com zur freien Verwendung<br />
heruntergeladen werden. Zugriff über CMM-API<br />
ArgyllCMS Zugriff über CMM-API o<strong>der</strong> Drittprogramm wie z.B.<br />
Ghostscript<br />
LittleCMS Direkte Ausführung o<strong>der</strong> Drittprogramm wie z.B.<br />
ImageMagick<br />
Tab. 3.1.2 CMM´s für verschiedene Plattformen<br />
36
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Je nachdem auf welcher Plattform <strong>der</strong> erläuterte Workflow realsiert wird, stehen<br />
unterschiedliche CMMs zur Verfügung. Tabelle 3.1.2 zeigt e<strong>in</strong>e Auswahl an frei verwendbaren<br />
CMMs die auf unterschiedlichen Plattformen direkt, über APIs o<strong>der</strong> über Drittprogramme<br />
angesprochen werden können. Ggf. können weitere CMMs, wie z.b. die L<strong>in</strong>oType-Hell CMM,<br />
verwendet werden.<br />
Sofern die Transformationen A <strong>und</strong> B des Workflows zusammengefasst werden sollen, ist zu<br />
prüfen, ob die jeweiligen CMMs e<strong>in</strong>e solche Funktion hierzu bereitstellen. Gleiches gilt für die<br />
Verwendung <strong>der</strong> Gamut-Warnung. So werden bspw. beide Funktionen <strong>von</strong> <strong>der</strong> CMM<br />
„LittleCMS“ unterstützt <strong>und</strong> stehen <strong>in</strong> dessen API durch die Funktion<br />
„cmsCreateProof<strong>in</strong>gTransform“ zur Verfügung.[Lapi] Da mit Photoshop ebenfalls das direkte<br />
„Proof<strong>in</strong>g“ <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Gamut-Warnung möglich s<strong>in</strong>d, ist e<strong>in</strong>e solche Funktion evtl. ebenfalls <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> API <strong>der</strong> ACE, <strong>der</strong> ICM <strong>und</strong>/o<strong>der</strong> ColorSync enthalten.<br />
3.1.3 <strong>Simulation</strong> bei PDF-Dokumenten<br />
Die meisten Bilddateiformate beschreiben ihren Inhalt dadurch, dass jedem <strong>der</strong> zeilen- <strong>und</strong><br />
spaltenweise angeordneten Bildpunkten, den Pixeln, e<strong>in</strong> Farbwert zugewiesen ist. Man spricht<br />
hier deshalb auch <strong>von</strong> „Raster Image“. PDF-Dokumente h<strong>in</strong>gegen beschreiben die Darstellung<br />
ihrer Seite bzw. Seiten anhand e<strong>in</strong>er Seitenbeschreibungssprache, e<strong>in</strong>er Programmiersprache,<br />
mit <strong>der</strong> sowohl <strong>der</strong> Inhalt <strong>in</strong> Form <strong>von</strong> Text, Grafiken <strong>und</strong> Bil<strong>der</strong>n als auch dessen Position bei<br />
<strong>der</strong> Darstellung beschrieben wird.<br />
Da es sich beim Druckprozess um e<strong>in</strong>en pixelweise Ausgabe handelt, ist bei PDF-Dokumenten<br />
e<strong>in</strong> Zwischenschritt notwendig, bei <strong>der</strong> die Seitenbeschreibung <strong>in</strong>terpretiert <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
pixelbasierte Darstellung umgewandelt wird. Bei diesem Zwischenschritt spricht man vom<br />
Rastern, das durch sogen. RIPs (RIP = Raster Image Processor) durchgeführt wird. Bei RIPs für<br />
PDF-Dokumente handelt es sich zumeist um Software, wenngleich diese, wie bei dem PDF<br />
verwandten PostScript, auch <strong>von</strong> Hardware durchgeführt werden kann.<br />
Die bekannteste RIP-Software als Desktopanwendung ist <strong>der</strong> kostenlose „Adobe Rea<strong>der</strong>“ <strong>und</strong><br />
„Adobe Acrobat“. Der bekannteste auch serverseitig verwendbare RIP ist das frei verwendbare<br />
„Ghostscript“, weshalb sich das nachfolgende Konzept ausschließlich auf „Ghostscript“ bezieht.<br />
E<strong>in</strong>e Umsetzung mit e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>em RIP als „Ghostscript“ sei hiermit aber nicht<br />
ausgeschlossen, müsste aber funktionell <strong>von</strong> Fall zu Fall geprüft werden.<br />
Farbmanagement mit PDF Dokumenten<br />
PDF-Dokumente unterstützen Farbmanagement nach dem ICC-Standard <strong>in</strong>sofern, als dass sie<br />
Arbeitsfarbräume für RGB, CMYK <strong>und</strong> Graustufen be<strong>in</strong>halten, <strong>der</strong>en ICC-Profile mit <strong>in</strong> das<br />
PDF-Dokument e<strong>in</strong>gebettet werden können. Somit s<strong>in</strong>d alle im PDF enthaltenen Farben, sei es<br />
die Farbe e<strong>in</strong>es Textes o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>es importieren Bildes, e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>deutigen Farbraum zugewiesen.<br />
Werden Bil<strong>der</strong> importiert, die e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en Farbraum als e<strong>in</strong>en <strong>der</strong> drei def<strong>in</strong>ierten<br />
Arbeitsfarbräume haben, so kann <strong>der</strong> dazugehörige Farbraum ebenfalls <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es ICC-<br />
Profils <strong>in</strong> das PDF e<strong>in</strong>gebettet werden, sodass dieses Bild auch weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Farbraum<br />
vorliegt. Würde das ICC-Profil nicht mit e<strong>in</strong>gebettet, so würde das Bild automatisch, je nach Art<br />
<strong>der</strong> Farbwerte, e<strong>in</strong>em <strong>der</strong> drei Arbeitsfarbräume zugewiesen.<br />
37
Farbmanagement mit „Ghostscript“<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
„Ghostscript“ unterstützt Farbmanagement nach dem ICC-Standard lediglich auf <strong>der</strong><br />
E<strong>in</strong>gabeseite, d.h. bei <strong>der</strong> Interpretation des PDF-Dokuments. Somit ist „Ghostscript“ <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Lage, die <strong>in</strong> PDF-Dokumenten enthaltenen Farbwerte <strong>in</strong> den geräteunabhängigen CIE XYZ-<br />
Farbraum umzurechnen. Da es <strong>in</strong> <strong>der</strong> Dokumentation <strong>von</strong> „Ghostscript“ ke<strong>in</strong>erlei H<strong>in</strong>weise<br />
dazu gibt, ob <strong>und</strong> wie es möglich ist, „Ghostscript“ konkret anzuweisen, für die Interpretation<br />
<strong>der</strong> Farbwerte e<strong>in</strong> bestimmtes ICC-Profil zu verwenden, müssen <strong>in</strong> dem PDF-Dokument die zu<br />
verwendenden ICC-Profile e<strong>in</strong>gebettet se<strong>in</strong>.<br />
Auf <strong>der</strong> Ausgabeseite, d.h <strong>der</strong> Ausgabe <strong>der</strong> Rasterung, verwendet „Ghostscript“ das<br />
Farbmanagementkonzept <strong>von</strong> „PostScript“. Bei diesem Konzept wird e<strong>in</strong> CSA<br />
(ColorSpaceArray) verwendet, um geräteabhängige Farbwerte <strong>in</strong> den XYZ-Farbraum<br />
umzurechnen <strong>und</strong> umgekehrt e<strong>in</strong> CRD (ColorRen<strong>der</strong><strong>in</strong>gDictionary), um XYZ-Farbwerte <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>en geräteabhängigen Farbraum umzurechnen.<br />
Da aus e<strong>in</strong>em ICC-Profil sowohl e<strong>in</strong> CSA als auch e<strong>in</strong> CRD berechnet werden kann, ist es trotz<br />
<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Ausgabeseite fehlenden Farbmanagementunterstützung nach ICC-Standard möglich,<br />
mit „Ghostscript“ e<strong>in</strong>e Farbraumtransformation bzw. Separation <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en, durch e<strong>in</strong> ICC-Profil<br />
beschriebenen, Zielfarbraum durchzuführen. Hierbei können auch die verschiedenen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g<br />
Intents sowohl mit als auch ohne Tiefenkompensation berücksichtigt werden, <strong>in</strong>dem aus dem<br />
ICC-Profil für jede Transformationsart e<strong>in</strong> eigenes CRD berechnet wird.[OCW1][MD02][Ado2]<br />
Zu Ghostscript ist noch zu bemerken, dass als Farbrechner das ArgyllCMS verwendet wird,<br />
weshalb <strong>der</strong>zeit lei<strong>der</strong> nur ICC-Profile <strong>in</strong> <strong>der</strong> Version 2 unterstützt werden, also alle im PDF<br />
e<strong>in</strong>gebetteten Profile dieser Version entsprechen müssen. Da die wichtigsten Arbeitsfarbräume<br />
auch <strong>in</strong> Version 2 vorliegen, spielt dieses Problem eher e<strong>in</strong>e untergeordnete Rolle.<br />
Workflow bei PDF-Dokumenten<br />
Die Abb. 3.1.5 auf <strong>der</strong> nächsten Seite zeigt den Workflow zur <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> farblichen<br />
Ersche<strong>in</strong>ung e<strong>in</strong>es Druckerzeugnisses bei e<strong>in</strong>em PDF-Dokument unter <strong>der</strong> Verwendung <strong>von</strong><br />
„Ghostscript“.<br />
Ausgangsbasis bei <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> ist entwe<strong>der</strong> e<strong>in</strong> bereits für die Druckausgabe separiertes<br />
PDF-Dokument (1) o<strong>der</strong> aber e<strong>in</strong> sogen. medienneutrales PDF-Dokument (2). Beim Ersten<br />
wurden alle Farbwerte bereits <strong>in</strong> den Zielfarbraum transformiert <strong>und</strong> <strong>der</strong> Zielfarbraum <strong>in</strong> Form<br />
e<strong>in</strong>es ICC-Profils im PDF e<strong>in</strong>gebettet. Beim Zweiten handelt es sich um e<strong>in</strong> PDF-Dokument,<br />
welches noch durch „Ghostscript“ separiert werden muss <strong>und</strong> <strong>in</strong> dem alle verwendeten<br />
Farbräume als ICC-Profil e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d.<br />
Die Rasterung <strong>und</strong> Separation (Transformation A <strong>und</strong> B) werden <strong>von</strong> Ghostsript <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Schritt durchgeführt <strong>und</strong> unterscheiden sich bei bereits separierten <strong>und</strong> medienneutralen PDF-<br />
Dokumenten lediglich dadurch, dass bei dem bereits separierten PDF (1) das CRD (3a)<br />
verwendet werden muss, das e<strong>in</strong>er relativ farbmetrischen Farbraumtransformation <strong>in</strong> den<br />
Zielfarbraum entspricht, woh<strong>in</strong>gegen beim medienneutralen PDF (2) das CRD (3b) <strong>der</strong><br />
gewünschten Transformationsart gewählt werden kann.<br />
38
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die Verwendung des, <strong>der</strong> relativ farbmetrischen Transformation entsprechenden, CRDs bei<br />
bereits separierten Dokumenten ist obligatorisch, da die <strong>von</strong> Ghostscript aus dem PDF-<br />
Dokument <strong>in</strong> den XYZ-Farbraum umgerechneten Farbwerte bereits die korrekten Farbwerte<br />
s<strong>in</strong>d, <strong>und</strong> diese lediglich zur Ausgabe wie<strong>der</strong> <strong>in</strong> den Farbwert des Ausgabefarbraums<br />
umgerechnet werden müssen.<br />
Resultat <strong>der</strong> Rasterung <strong>und</strong> Separation (Transformation A <strong>und</strong> B) ist <strong>in</strong> beiden Fällen, je Seite<br />
des Dokumentes, e<strong>in</strong> separiertes Bild (4) im TIFF-Format, für die jeweils die nachfolgenden<br />
Transformationen C <strong>und</strong> D durchgeführt werden müssen. Die Transformationen C <strong>und</strong> D<br />
entsprechen dabei den aus Kap 3.1.1 bekannten Transformation B <strong>und</strong> C aus Abb. 3.1.2..<br />
Abb. 3.1.5 Proof<strong>in</strong>g-Workflow für PDF-Dokumente mit Ghostscript<br />
39
Rasterung <strong>und</strong> Separierung mit Ghostscript<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die für die Separierung des PDF-Dokumentes <strong>von</strong> „Ghostcript“ benötigten CRDs können bspw.<br />
mit dem frei verwendbaren Tool icc2ps aus dem ICC-Profil generiert werden.[Lau1]<br />
Das Programm wird unter L<strong>in</strong>ux über Kommandozeile mit folgendem Befehl ausgeführt:<br />
icc2ps -o iccprofil.icm -t 1 -b -c 2 > crd.ps<br />
Beschreibung <strong>der</strong> Parameter<br />
-o gibt an, das e<strong>in</strong> CRD erstellt werden soll<br />
-t 1 Wahl des Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent<br />
0=Perzeptiv, 1=relativ farbmetrisch, 2=Sättigung, 3=absolut farbmetrsich<br />
-b Verwendung <strong>der</strong> Tiefenkompensation<br />
-c 2 gibt die Qualität des CRDs an<br />
0=Niedrig, 1=Normal(Standard), 2=Hoch<br />
Zusätzlich muss je<strong>der</strong> CRD-Datei folgende Zeile angefügt werden um Ghostscript bei dessen<br />
Verwendung anzuweisen, anstatt des Standardfarbraums das <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datei vorhandene CRD zu<br />
verwenden[Ado4]:<br />
„/Current /ColorRen<strong>der</strong><strong>in</strong>g f<strong>in</strong>dresource setcolorren<strong>der</strong><strong>in</strong>g“<br />
Die Rasterung <strong>und</strong> Separation mit Ghostscript wird unter L<strong>in</strong>ux durch folgende Kommandozeile<br />
ausgeführt:<br />
gs -dUseCIEColor -sDEVICE=tiff32nc -o Output_%d.tif -f crd.ps Input.pdf<br />
Beschreibung <strong>der</strong> Parameter<br />
-dUseCIEColor Verwendung des CIE XYZ Farbraums als PCS<br />
-sDEVICE= Wahl des Ausgabeformats.<br />
„tiff32nc“ für TIFF im CMYK-Farbraum<br />
„tiff24nc“ für TIFF im RGB-Farbraum<br />
-o Output_%d.tif Angabe des Namens <strong>der</strong> Ausgabedatei(n).<br />
„%d“ ist Platzhalter für Nummerierung bei mehrseitigen<br />
PDFs, wobei für jede Seite e<strong>in</strong>e Bilddatei generiert wird.<br />
-f crd.ps Angabe <strong>der</strong> CRD enthaltenden PS-Datei<br />
3.1.4 <strong>Simulation</strong> bei Layoutdokumenten<br />
„Adobe InDesign“ <strong>und</strong> „QuarkXpress“ s<strong>in</strong>d die wohl die bekanntesten <strong>und</strong> im professionellen<br />
Bereich auch die am häufigsten anzutreffenden Formate für Layoutdokumente. Für die<br />
Berechnung e<strong>in</strong>es Vorschaubildes, sei es nun durch die direkte Berechnung e<strong>in</strong>er Bilddatei o<strong>der</strong><br />
die Berechnung e<strong>in</strong>es PDF-Dokumentes, aus dem dann durch Rasterung e<strong>in</strong>e Bilddatei erstellt<br />
wird, lagen zum Zeitpunkt dieser Arbeit ke<strong>in</strong>e Informationen über e<strong>in</strong>e frei verwendbare<br />
Software vor, die dazu <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage wäre diese Berechnungen durchzuführen.<br />
40
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Sollte e<strong>in</strong>e kommerzielle Lösung zur Verfügung stehen, sei es für die jeweiligen Formate <strong>der</strong><br />
„InDesign Server“ o<strong>der</strong> „QuarkXPress Server“, o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Lösung e<strong>in</strong>es Drittanbieters wie z.B.<br />
<strong>der</strong> „Helios ImageServer“, mit <strong>der</strong> es möglich ist, solche Konvertierungen durchzuführen, so ist<br />
jeweils zu prüfen, wie <strong>und</strong> für welche Formatversionen diese verwendet werden können.<br />
Sollte ke<strong>in</strong>e solche Lösung zur Verfügung stehen, so ist <strong>von</strong> dem Layoutdokument durch das<br />
entsprechende Layoutprogramm e<strong>in</strong> PDF zu generieren, welches dabei entwe<strong>der</strong> für die<br />
Druckbed<strong>in</strong>gungen separiert werden <strong>und</strong> das entsprechende Ausgabeprofil enthalten muss, o<strong>der</strong><br />
aber, wenn das PDF medienneutral bleiben soll, alle im Layoutdokument verwendeten<br />
Farbräume als ICC-Profil be<strong>in</strong>halten muss.<br />
Für an<strong>der</strong>e Layoutdokumentformate, wie z.B. das des freien Layoutprogramms „Scribus“, s<strong>in</strong>d<br />
jeweils separat die Möglichkeiten <strong>der</strong> Vorschaugenerierung zu untersuchen.<br />
3.2 <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität<br />
Die Berücksichtigung <strong>der</strong> Opazität <strong>von</strong> <strong>Papier</strong> <strong>und</strong> Druckfarbe ist e<strong>in</strong> weiterer, wichtiger Schritt<br />
um das Ersche<strong>in</strong>ungsbild e<strong>in</strong>es Druckerzeugnisses am Bildschirm zu simulieren. In Kap. 3.2.1<br />
werden zunächst die Auswirkungen <strong>der</strong> Opazität betrachtet <strong>und</strong> hergeleitet, wie diese simuliert<br />
werden können. In Kap. 3.2.2 werden Methoden vorgestellt, mit denen es möglich ist, die<br />
Auswirkungen <strong>der</strong> Opazität zu quantifizieren <strong>und</strong> für die <strong>Simulation</strong> nutzbar zu machen.<br />
Die Möglichkeit zur <strong>Simulation</strong> sowie die Möglichkeit zur Bestimmung e<strong>in</strong>er für die <strong>Simulation</strong><br />
anwendbaren Maßzahl werden <strong>in</strong> dem, <strong>in</strong> Kap. 3.2.3 erläuterten Konzept zur Verwendung <strong>von</strong><br />
Opazitätsprofilen verwendet, mit denen es möglich ist, die e<strong>in</strong>mal an e<strong>in</strong>em Druckerzeugnis<br />
ermittelten Auswirkungen zu abstrahieren <strong>und</strong> bei verschiedenen digitalen Bil<strong>der</strong>n zu<br />
simulieren.<br />
3.2.1 Auswirkungen <strong>und</strong> Simulierbarkeit <strong>der</strong> Opazität<br />
Die Auswirkungen <strong>der</strong> Opazität lassen sich <strong>in</strong> zwei unterschiedliche Effekte differenzieren, den<br />
Effekt des „Durchschlagens“ <strong>und</strong> den des „Durchsche<strong>in</strong>ens“.<br />
Beim Ersten handelt es sich um die Sichtbarkeit <strong>der</strong> bedruckten Rückseite e<strong>in</strong>es Blattes, welche<br />
abhängig ist <strong>von</strong> <strong>der</strong> Opazität des <strong>Papier</strong>s, <strong>der</strong> Opazität <strong>der</strong> Druckfarbe auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite des<br />
Blattes <strong>und</strong> <strong>der</strong> Tiefe, mit <strong>der</strong> die Druckfarbe <strong>der</strong> Rückseite <strong>in</strong> das <strong>Papier</strong> e<strong>in</strong>gedrungen ist, was<br />
im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Opazität e<strong>in</strong>e Reduzierung <strong>der</strong> Opazität des <strong>Papier</strong>s darstellt.<br />
Beim Zweiten handelt es sich um die Sichtbarkeit <strong>der</strong> Folgeblätter durch das gerade betrachtete<br />
Blatt, <strong>und</strong> ist abhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Opazität des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> Opazität <strong>der</strong> Druckfarbe auf<br />
Vor<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Rückseite des gerade betrachteten Blattes.<br />
Um die Auswirkungen <strong>der</strong> Opazität zu simulieren muss zunächst <strong>der</strong> Effekt des<br />
„Durchschlagen“ <strong>der</strong> Rückseite simuliert werden, auf dessen Resultat im Anschluss <strong>der</strong> Effekt<br />
des „Durchsche<strong>in</strong>ens“ simuliert wird.<br />
<strong>Simulation</strong> des Durchschlagffektes<br />
Der Effekt des „Durchschlagens“ lässt sich simulieren, <strong>in</strong>dem die Farben <strong>der</strong> Rückseite <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Intensität <strong>in</strong> die Darstellung <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite des digitalen Bildes e<strong>in</strong>gemischt werden, wie es<br />
auch bei <strong>der</strong> Betrachtung des Blattes passieren würde.<br />
41
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Dies kann dadurch realisiert werden, <strong>in</strong>dem die digitale Rückseite spiegelverkehrt als Ebene<br />
über das Bild <strong>der</strong> digitalen Vor<strong>der</strong>seite gelegt wird. Damit die Ebene <strong>der</strong> spiegelverkehrten<br />
Rückseite die Vor<strong>der</strong>seite nicht überdeckt, muss sie so starke Transparenzen enthalten, dass die<br />
Farben <strong>der</strong> Rückseite nur leicht e<strong>in</strong>gemischt werden. Wie stark die Transparenzen für die<br />
<strong>Simulation</strong> se<strong>in</strong> müssen, hängt dabei da<strong>von</strong> ab, wie stark die Opazität <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite<br />
verwendeten Druckfarbe ist, sowie <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>Papier</strong>opazität bzw. <strong>der</strong> durch die auf <strong>der</strong> Rückseite<br />
aufgetragenen Druckfarben „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität.<br />
Die selben Schritte können dann, ebenfalls zur <strong>Simulation</strong> des Durchschlageffektes, auf <strong>der</strong><br />
Rückseite angewendet werden, wobei im S<strong>in</strong>ne des Blättern, die aktuelle Rückseite zur<br />
Vor<strong>der</strong>seite wird <strong>und</strong> die aktuelle Vor<strong>der</strong>seite zu dessen Rückseite.<br />
Abb 3.2.1 veranschaulicht die zur <strong>Simulation</strong> des Durchschlageffektes notwendigen Schritte.<br />
<strong>Simulation</strong> des Durchsche<strong>in</strong>effektes<br />
Abb. 3.2.1 Durchschlagsimulation<br />
Um nun den Durchsche<strong>in</strong>effekt zu simulieren, muss jedem Pixel <strong>der</strong> Durchschlagsimulation<br />
e<strong>in</strong>e, sich aus <strong>der</strong> Opazität des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> Opazität <strong>der</strong> Farbe auf Vor<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Rückseite<br />
ergebenden Opazität zugewiesen werden. Dieses Bild enthält nun Transparenzen, die, wenn das<br />
Bild über e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es Bild gelegt wird, das Ersche<strong>in</strong>ungsbild <strong>der</strong> nachfolgenden Seite<br />
durchsche<strong>in</strong>en lassen.<br />
S<strong>in</strong>d sowohl die Durchschlagsimulationen als auch die Zuweisung <strong>der</strong> Opazität zur <strong>Simulation</strong><br />
des Durchsche<strong>in</strong>effektes für die Vor<strong>der</strong>- <strong>und</strong> für die Rückseite bei jedem Blatt e<strong>in</strong>es<br />
mehrseitigem Dokumentes durchgeführt worden, so ist zur vollständigen <strong>Simulation</strong> des<br />
Durchsche<strong>in</strong>effektes jeweils das zu betrachtende Blatt auf das <strong>der</strong> nachfolgenden zu legen,<br />
welches wie<strong>der</strong>um auf dessen nachfolgende Seite gelegt wurde u.s.w.<br />
42
3.2.2 Bestimmung <strong>der</strong> Opazität<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen die Auswirkungen <strong>der</strong><br />
Opazität erfasst <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er für die <strong>Simulation</strong> verwendbaren Maßzahl aufbereitet werden. Die<br />
Erste, <strong>in</strong> Kap.3.2.2.1 vorgestellte, Methode ist die Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit dem<br />
Reflexionsfaktor, die, da sie im weiteren Verlauf für diese Arbeit nicht relevant ist, nur <strong>der</strong><br />
Vollständigkeit halber vorgestellt wird<br />
Weiter werden die Methoden zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit dem L*a*b*-Farbwert <strong>in</strong> Kap.<br />
3.2.2.2 sowie mit den L*-Wert <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.3 erörtert, die dann <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.4 verglichen,<br />
dessen Anwendbarkeit <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.5 <strong>und</strong> dessen Genauigkeit <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.6 erläutert wird.<br />
Abschließend wird <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.7 die Methode des Schätzens zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität<br />
ohne Messgerät angesprochen.<br />
3.2.2.1 Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit dem Reflexionsfaktor<br />
Alle zur <strong>Simulation</strong> notwendigen Opazitätswerte können gem. <strong>der</strong> <strong>in</strong> Kapitel 2.4 beschriebenen<br />
Opazitätsmessung ermittelt werden. Die dort beschriebene Vorgehensweise setzt zum E<strong>in</strong>en die<br />
Verfügbarkeit e<strong>in</strong>es Spektralphotometers voraus, welches den gemessenen Reflexionsfaktor<br />
ausgibt, <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en e<strong>in</strong>en Hohlkörper als Messunterlage. Da Beide im Rahmen dieser<br />
Arbeit nicht zur Verfügung stehen wird dieses Verfahren im weiteren Verlauf nicht betrachtet.<br />
3.2.2.2 Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit dem L*a*b*-Farbwert<br />
Betrachtet man e<strong>in</strong>e Probe auf zwei farblich unterschiedlichen Unterlagen, so kann sich auch<br />
das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild <strong>der</strong> Probe, bed<strong>in</strong>gt durch dessen Opazität, unterscheiden. Die<br />
Tatsache, dass sich die Opazität auf das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild auswirkt, ermöglicht es,<br />
anhand des Farbwertes e<strong>in</strong>er Probe auch Rückschlüsse auf die Opazität zu ziehen.<br />
Das folgende Verfahren verwendet den L*a*b*-Farbwert zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität e<strong>in</strong>er<br />
Probe, wenngleich wegen <strong>der</strong> fehlenden Möglichkeit zur Opazitätsbestimmung anhand <strong>der</strong><br />
Reflexionsfaktoren ke<strong>in</strong>e konkrete Aussage über dessen Genauigkeit gemacht werden kann.<br />
Benötigte L*a*b*-Farbwerte<br />
Um die Opazität e<strong>in</strong>er Probe bestimmen zu können, werden drei L*a*b*-Farbwerte benötigt.<br />
Erster L*a*b*-Farbwert ist <strong>der</strong> Farbwert <strong>der</strong> Probe, wenn diese e<strong>in</strong>e Opazität <strong>von</strong> 0 %<br />
aufweisen würde, d.h vollständig durchsichtig wäre. Dies kann dadurch erreicht werden, <strong>in</strong>dem<br />
<strong>der</strong> Farbwert <strong>der</strong> Unterlage gemessen wird, die auch für die weiteren Messungen verwendet<br />
wird.<br />
Als ideale Unterlage wäre e<strong>in</strong> Hohlkörper zu verwenden, da dessen Farbwert dem<br />
Schwarzpunkt des L*a*b*-Farbraums entspricht, also L*=0, a*=0 <strong>und</strong> b*=0. Steht ke<strong>in</strong><br />
Hohlkörper zur Verfügung, so ist e<strong>in</strong>e Unterlage zu verwenden, die dunkler als die zu messende<br />
Probe ist.<br />
43
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Der zweite benötigte Farbwert ist <strong>der</strong> <strong>der</strong> Probe, wenn diese e<strong>in</strong>e Opazität <strong>von</strong> 100% aufweisen<br />
würde, also vollständig <strong>und</strong>urchsichtig wäre. Dies kann dadurch erreicht werden, <strong>in</strong>dem die<br />
Probe auf e<strong>in</strong>em Stapel des gleichen Material gemessen wird. Die Dicke des Stapels muss dabei<br />
so gewählt werden, dass e<strong>in</strong>e Verdoppelung <strong>der</strong> Dicke ke<strong>in</strong>e Verän<strong>der</strong>ung des gemessenen<br />
Farbwertes mehr verursacht. In <strong>der</strong> Norm DIN 53146, welche die Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit<br />
Reflexionsfaktoren beschreibt, wird im allg. <strong>von</strong> 8 - 16 Blatt <strong>Papier</strong> als Stapeldicke<br />
ausgegangen, bei denen <strong>der</strong> Reflexionsfaktor ke<strong>in</strong>e meßbare Verän<strong>der</strong>ung mehr aufweist (s.<br />
DIN 53146 S.2). Dies kann im allg. auch auf die Stapeldicke zur Messung <strong>der</strong> L*a*b*-<br />
Farbwerte übertragen werden.<br />
Zuletzt wird noch <strong>der</strong> Farbwert <strong>der</strong> Probe benötigt, bei <strong>der</strong> die Probe direkt auf <strong>der</strong> Unterlage<br />
liegt.<br />
Berechnung <strong>der</strong> Opazität<br />
Da <strong>der</strong> Farbwert <strong>der</strong> direkt auf <strong>der</strong> Unterlage liegenden Probe, zum<strong>in</strong>dest theoretisch, im<br />
L*a*b*-Farbraum auf e<strong>in</strong>er Geraden zwischen den beiden an<strong>der</strong>n Farbwerten liegt, kann die<br />
Opazität mit <strong>der</strong> mit 100 multiplizierten relativen Länge (ΔE*ab) <strong>der</strong> Geraden vom Farbwert<br />
(a) <strong>der</strong> Unterlage zum Farbwert (b) <strong>der</strong> Probe auf <strong>der</strong> Unterlage zu <strong>der</strong> Länge (ΔE*ac) <strong>der</strong><br />
Geraden vom Farbwert (a) <strong>der</strong> Unterlage zum Farbwert (c) <strong>der</strong> vollständig opaken Probe<br />
angegeben werden.<br />
Die jeweiligen Längen <strong>der</strong> Geraden ΔE* können durch die CIELAB-Farbabstandsformel<br />
berechnet werden, die wie folgt def<strong>in</strong>iert ist[Lo89]:<br />
ΔE ∗ = � ΔL ∗ a 2 � Δa ∗ a 2 �Δb ∗ a 2<br />
mit<br />
ΔL*= L*Probe1 – L*Probe2<br />
Δa*= a*Probe1 – a*Probe2<br />
Δb*= b*Probe1 – b*Probe2<br />
(Formel 3.2.2.1)<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> CIELAB-Abstandsformel kann die Opazität (O) e<strong>in</strong>er Probe wie folgt berechnet<br />
werden:<br />
O = ΔE∗ ab<br />
ΔE ∗ ac ∗ 100 (Formel 3.2.2.2)<br />
mit<br />
ΔE ∗ ab = � ΔL ∗ ab 2 �Δa ∗ ab 2 � Δb ∗ ab 2<br />
ΔE ∗ ac = � ΔL ∗ ac 2 � Δa ∗ ac 2 � Δb ∗ ac 2<br />
ΔL*ab = L*b - L*a<br />
ΔL*ac = L*c - L*a<br />
Δa*ab = a*b - a*a<br />
Δa*ac = a*c - a*a<br />
Δb*ab = b*b - b*a<br />
Δb*ac = b*c - b*a<br />
44
H<strong>in</strong>weis zur Umsetzung<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Obwohl <strong>in</strong> den meisten Anwendungen, so auch <strong>in</strong> Photoshop, die Helligkeit L* prozentual mit<br />
Werten zwischen 0 <strong>und</strong> 100 angegeben wird, unterteilt sich die L*-Achse dennoch <strong>in</strong><br />
Tonwertabstufungen gemäß <strong>der</strong> verwendeten Farbtiefe. In dem meisten Fällen ist dies 8 Bit,<br />
also 256 Tonwertstufen.<br />
Sollte das Messgerät die Helligkeit L* prozentual angeben, ist vor <strong>der</strong> Berechnung <strong>der</strong><br />
Farbabstände die Helligkeit <strong>in</strong> die <strong>der</strong> verwendeten Farbtiefe entsprechende Tonwertstufe<br />
umzurechnen, sodass auf <strong>der</strong> L*-Achse die gleiche Maße<strong>in</strong>heit verwendet wird wie auf <strong>der</strong> a*-<br />
<strong>und</strong> b*-Achse. Im Falle e<strong>in</strong>er Farbtiefe <strong>von</strong> 8 Bit kann die Umrechnung wie folgt durchgeführt<br />
werden:<br />
L ∗ = L ∗ �%� ∗ 255<br />
(Formel 3.2.2.3)<br />
100<br />
mit<br />
L*(%) = Angabe <strong>der</strong> Helligkeit mit Werten zwischen 0 <strong>und</strong> 100<br />
3.2.2.3 Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit L*<br />
Da sich die drei verwendeten Farbwerte <strong>in</strong>nerhalb des L*a*b*-Farbraums auf e<strong>in</strong>er Geraden<br />
bef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> durch die absichtlich dunklere Unterlage alle unterschiedliche Helligkeitswerte<br />
aufweisen, kann die Berechnung <strong>der</strong> Opazität drastisch vere<strong>in</strong>facht werden, <strong>in</strong>dem lediglich <strong>der</strong><br />
L*-Wert zur Berechnung herangezogen wird. Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Tatsache, dass das Längenverhältnis<br />
<strong>der</strong> Farbabstände im dreidimensionalen Raum dem Längenverhältnis <strong>der</strong> Helligkeitsunterschiede<br />
auf <strong>der</strong> L*-Achse gleicht, gleichen sich ebenfalls die errechneten Opazitäten,<br />
weshalb die folgende Formel zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität, zum<strong>in</strong>dest theoretisch, ausreicht:<br />
O = L∗b−L ∗ a<br />
L ∗ c−L ∗ ∗ 100 (Formel 3.2.2.4)<br />
a<br />
mit<br />
L*a = Helligkeitswert bei 0%iger Opazität <strong>der</strong> Probe<br />
L*b = Helligkeitswert <strong>der</strong> Probe für die die Opazität bestimmt werden soll<br />
L*c = Helligkeitswert bei 100%iger Opazität <strong>der</strong> Probe<br />
3.2.2.4 L*a*b* vs. L*<br />
Bei <strong>der</strong> Anwendung des Verfahrens zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit dem Helligkeitswert L*<br />
ist zu berücksichtigen, dass es bei <strong>der</strong> Berechnung <strong>der</strong> Opazität anhand <strong>von</strong> Farbwerten, die<br />
e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>gen Helligkeitsunterschied aufweisen, zu Ungenauigkeiten kommen kann.<br />
Gr<strong>und</strong> hierfür ist, dass nur ger<strong>in</strong>ge Abweichungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Helligkeit erhebliche Auswirkungen<br />
auf die errechnete Opazität haben, woh<strong>in</strong>gegen bei <strong>der</strong> Opazitätsberechnung anhand des<br />
gesamten L*a*b*-Farbwerts durch die E<strong>in</strong>beziehung <strong>der</strong> a*- <strong>und</strong> b*-Werte diese, kompensiert<br />
werden.<br />
45
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die folgenden beiden Beispielberechnungen zeigen, dass es bei <strong>der</strong> Berechnung <strong>der</strong> Opazität<br />
mit Farbwerten <strong>von</strong> großem Helligkeitsunterschied zu be<strong>in</strong>ahe ke<strong>in</strong>em Unterschied im Ergebnis<br />
kommt, während bei <strong>der</strong> Berechnung <strong>der</strong> Opazität mit Farbwerten mit sehr ger<strong>in</strong>gen<br />
Helligkeitsunterschieden die Unterschiede <strong>der</strong> Ergebnisse signifikant höher s<strong>in</strong>d.<br />
Beispiel 1<br />
In diesem Beispiel wird die Opazität e<strong>in</strong>er <strong>Papier</strong>sorte bestimmt. Zunächst wurde<br />
hierfür <strong>der</strong> Farbwert e<strong>in</strong>es schwarzen Kartonpapiers als Unterlage gemessen,<br />
anschließend <strong>der</strong> Farbwert des <strong>Papier</strong>s direkt auf <strong>der</strong> Unterlage <strong>und</strong> zuletzt <strong>der</strong><br />
Farbwert des <strong>Papier</strong>s auf e<strong>in</strong>em Stapel <strong>der</strong> gleichen <strong>Papier</strong>sorte.<br />
Die Dicke des Stapels wurde dabei nicht anhand <strong>von</strong> Farbunterschieden bestimmt,<br />
son<strong>der</strong>n lediglich mit mehr als 20 Blatt <strong>Papier</strong> als opak angenommen. Die Farbwerte<br />
wurden mehrfach bestimmt <strong>und</strong> zur weiteren Verwertung gemittelt. Die Ergebnisse <strong>der</strong><br />
Messung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Anhang B - Tab.B.1 enthalten.<br />
Die Messungen wurden mit dem Spektralphotometer „ColorMunki Photo“ des Her-<br />
stellers „X-Rite“ durchgeführt, welches bei <strong>der</strong> Ausgabe des L*a*b*-Farbwertes e<strong>in</strong>e<br />
Farbtiefe <strong>von</strong> 8Bit verwendet, sowie den L*-Wert prozentual ausgibt <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>e<br />
Umrechnung gemäß <strong>der</strong> Formel 3.2.2.3 vorgenommen werden muss.<br />
Gemessene L*a*b*-Farbwerte:<br />
Unterlage = L*a*b*(26,01; 0,69; -0,76)<br />
<strong>Papier</strong> auf Unterlage = L*a*b*(90,84; 0,24; -2,22)<br />
<strong>Papier</strong> auf Stapel = L*a*b*(92,68; 1,18; -3,24)<br />
Umrechnung <strong>der</strong> L*-Werte gem. <strong>der</strong> Formel 3.2.2.3<br />
L* <strong>der</strong> Unterlage 26,01*255/100 = ~66,33<br />
L* des <strong>Papier</strong>s auf Unterlage 90,84*255/100 = ~231,64<br />
L* des <strong>Papier</strong>s auf Stapel 92,68*255/100 = ~236,33<br />
Berechnung <strong>der</strong> Opazität anhand <strong>der</strong> L*a*b*-Farbwerte gem. Formel 3.2.2.1<br />
ΔE ∗ ab = ��231,64−66,33� 2 � �0,24−0,69� 2 � �−0,76−�−2,22�� 2<br />
=�165,31 2 � �−0,45� 2 � �1,46� 2<br />
.<br />
= 165,3170596 .<br />
ΔE ∗ ac = ��236,33−66,33� 2 � �1,18−0,69� 2 � �−3,24−�−0,76�� 2<br />
=�170 2 � 0,49 2 � �−2,48� 2<br />
.<br />
= 170,0187945 .<br />
O = ΔE∗ab ΔE ∗ ∗ 100<br />
ac<br />
=<br />
.<br />
165,3170596<br />
∗ 100<br />
170,0187945<br />
= ~97,23 .<br />
46
Berechnung <strong>der</strong> Opazität anhand <strong>der</strong> Helligkeit L* gem. Formel 3.2.2.4<br />
O = 90,84−26,01<br />
∗ 100<br />
92,68−26,01<br />
= ~97,24 .<br />
Wie zu sehen, unterscheiden sich die Ergebnisse nur ger<strong>in</strong>gfügig.<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Beispiel 2<br />
In diesem Beispiel soll <strong>der</strong> Durchschlageffekt berechnet werden, d.h. <strong>in</strong> welcher<br />
Intensität die auf <strong>der</strong> Rückseite gedruckte Farbe durch das <strong>Papier</strong> h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>t.<br />
Als Messwerte wurde e<strong>in</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite bedrucktes Blatt auf e<strong>in</strong>em Stapel des<br />
gleichen <strong>Papier</strong>s gemessen, da dieses den selben Farbwert hat, als wäre e<strong>in</strong> vollständig<br />
durchsichtiges <strong>Papier</strong> auf <strong>der</strong> Rückseite bedruckt worden.<br />
Würde <strong>von</strong> <strong>der</strong> bedruckten Rückseite auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite nichts zu erkennen se<strong>in</strong>, wäre<br />
das <strong>Papier</strong> vollständig opak, weshalb hierfür <strong>der</strong> Farbwert e<strong>in</strong>es Blatt <strong>Papier</strong>s auf<br />
e<strong>in</strong>em Stapel des gleichen <strong>Papier</strong>s herangezogen wurde. Als dritter Farbwert wurde <strong>der</strong><br />
Farbwert e<strong>in</strong>es auf <strong>der</strong> Rückseite bedruckten <strong>Papier</strong>s auf e<strong>in</strong>em Stapel des gleichen<br />
<strong>Papier</strong> gemessen. Um <strong>in</strong> diesem Beispiel die Unterschiede <strong>der</strong> Rechenmethoden bei<br />
nur ger<strong>in</strong>gen Helligkeitsunterschieden zu verdeutlichen, wurde e<strong>in</strong>e mit e<strong>in</strong>em hellen<br />
Gelb bedruckte Probe verwendet.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Farbmessung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Anhang B - Tab. B.2 aufgeführt <strong>und</strong> gemittelt.<br />
Gemessene L*a*b*-Farbwerte:<br />
Vor<strong>der</strong>seite des bedruckten <strong>Papier</strong>s = L*a*b*(91,01; -3,19; 28,75)<br />
<strong>Papier</strong> mit bedruckter Rückseite auf Unterlage = L*a*b*(92,35; 0,98; 0,16)<br />
<strong>Papier</strong> auf Stapel = L*a*b*(92,68; 1,18; -3,24)<br />
Umrechnung <strong>der</strong> L*-Werte gem. Formel 3.2.2.3<br />
L* <strong>der</strong> Unterlage 91,01*255/100 = ~232,08<br />
L* des <strong>Papier</strong>s auf Unterlage 92,35*255/100 = ~235,49<br />
L* des <strong>Papier</strong>s auf Stapel 92,68*255/100 = ~236,33<br />
Berechnung <strong>der</strong> Opazität anhand <strong>der</strong> L*a*b*-Farbwerte gem. Formel 3.2.2.1<br />
ΔE ∗ ab = ��235,49−232,08� 2 � �0,98−�−3,19�� 2 � �0,16−28,75� 2<br />
=�3,41 2 � 4,17 2 � �−28,59� 2<br />
.<br />
= 29,09304212 .<br />
ΔE ∗ ac = ��236,33−232,08� 2 � �1,18−�−3,19�� 2 � �−3,24−28,75� 2<br />
=� 4,25 2 � 4,37 2 � �−31,99� 2<br />
.<br />
= 32,56561837 .<br />
47
O = ΔE∗ab ΔE ∗ ∗ 100<br />
ac<br />
= 870,2986<br />
∗ 100<br />
1088,697<br />
= ~89,34 .<br />
Berechnung <strong>der</strong> Opazität anhand <strong>der</strong> Helligkeit L* gem. Formel 3.2.2.4<br />
O = 92,35−91,01<br />
∗ 100<br />
92,68−91,01<br />
= ~80,24 .<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Wie zu sehen ist, können bei niedrigen Helligkeitsunterschieden die Ergebnisse bei<strong>der</strong><br />
Rechenmethoden stark <strong>von</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> abweichen. Gleichzeitig sei aber zu anzumerken, dass <strong>der</strong><br />
Unterschied bei <strong>der</strong> Anwendung <strong>der</strong> Opazität gerade wegen <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Helligkeitsunterschiede<br />
nicht so ausgeprägt wahrgenommen wird.<br />
3.2.2.5 Anwendbarkeit <strong>der</strong> Opazitätsbestimmung anhand L*a*b* bzw. L*<br />
Um die <strong>in</strong> Kap.3.2.2.2 <strong>und</strong> Kap. 3.2.2.3 vorgestellten Methoden zur Opazitätsbestimmung für<br />
die <strong>Simulation</strong> des Durchsche<strong>in</strong>effektes sowie des Durchschlageffektes anzuwenden, wird nun<br />
erörtert, welche Farbwerte hierzu gemessen werden müssen, <strong>und</strong> wie sich die daraus<br />
errechneten Opazitäten für die <strong>Simulation</strong> nutzen lassen. Im Folgenden werden dazu <strong>der</strong><br />
Durchsche<strong>in</strong>effekt <strong>und</strong> <strong>der</strong> Durchschlageffekt getrennt betrachet.<br />
Anwendbarkeit beim Durchsche<strong>in</strong>effekt<br />
Für die <strong>Simulation</strong> des Durchsche<strong>in</strong>effektes werden, wie <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.2 bereits beschrieben, die<br />
Opazität des <strong>Papier</strong>s sowie die Opazität <strong>der</strong> Farbe sowohl auf Vor<strong>der</strong>- wie auch auf <strong>der</strong><br />
Rückseite benötigt. Wie <strong>in</strong> Beispiel 1 schon vorweggenommen, werden für Berechnung <strong>der</strong><br />
Opazität des <strong>Papier</strong>s <strong>der</strong> L*a*b*-Wert <strong>der</strong> Unterlage, <strong>der</strong> L*a*b*-Wert des <strong>Papier</strong>s auf e<strong>in</strong>em<br />
ausreichend dicken Stapel des gleichen <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> L*a*b*-Wert e<strong>in</strong>es Blatt <strong>Papier</strong>s direkt<br />
auf <strong>der</strong> Unterlage benötigt.<br />
Um die Opazität <strong>der</strong> Farbe zu bestimmen können, kann anstatt e<strong>in</strong>es unbedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s<br />
e<strong>in</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite bedrucktes Blatt <strong>Papier</strong> genommen werden, dessen Farbwert zum E<strong>in</strong>en<br />
direkt auf <strong>der</strong> Unterlage <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en auf dem Stapel des selben <strong>Papier</strong>s gemessenen<br />
werden muss. Aus diesen L*a*b*-Werten kann dann die Opazität des mit <strong>der</strong> jeweiligen Farbe<br />
e<strong>in</strong>seitig bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s errechnet werden. Von dieser Opazität lässt sich weiter die<br />
Opazität des <strong>Papier</strong>s abziehen, wodurch man die Opazität <strong>der</strong> Farbe erhält.<br />
Beträgt die Opazität des bedruckten <strong>Papier</strong>s 100%, das <strong>Papier</strong> ist also völlig opak, kann die<br />
Farbopazität nicht errechnet werden, was aber für den Durchsche<strong>in</strong>effekt ke<strong>in</strong>en Unterschied<br />
macht, denn dann kann das Folgeblatt sowieso nicht h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>en. Die Opazität ist <strong>in</strong><br />
diesem Fall also <strong>in</strong>sgesamt bereits 100%.<br />
48
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die Aufsummierung <strong>der</strong> Opazität des <strong>Papier</strong>s sowie <strong>der</strong> Opazitäten <strong>der</strong> Druckfarbe auf <strong>der</strong><br />
Vor<strong>der</strong>- <strong>und</strong> auf <strong>der</strong> Rückseite muss fallweise unterschiedlich vorgenommen werden <strong>und</strong> lässt<br />
sich folgen<strong>der</strong>maßen beschreiben:<br />
– Ist das Blatt we<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>- noch auf <strong>der</strong> Rückseite bedruckt, <strong>der</strong> Farbwert<br />
e<strong>in</strong>es Pixel auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite sowie das gleiche Pixel <strong>der</strong> spiegelverkehrten<br />
Rückseite e<strong>in</strong>es Bildes also weiß, ist lediglich die Opazität des <strong>Papier</strong>s zu<br />
verwenden.<br />
– Ist das Pixel des Blattes entwe<strong>der</strong> nur auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite o<strong>der</strong> nur auf <strong>der</strong><br />
Rückseite bedruckt, ist die Opazität des mit <strong>der</strong> jeweiligen Farbe auf <strong>der</strong><br />
Vor<strong>der</strong>seite bedruckten <strong>Papier</strong>s zu verwenden.<br />
– S<strong>in</strong>d bei dem Bildpunkt sowohl die Vor<strong>der</strong>- als auch die Rückseite bedruckt, kann<br />
die Opazität <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite bedruckten <strong>Papier</strong>probe e<strong>in</strong>mal mit <strong>der</strong> Farbe<br />
<strong>der</strong> Rückseite <strong>und</strong> e<strong>in</strong>mal mit <strong>der</strong> Farbe <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite addiert werden. Von<br />
diesem Wert wird anschließend die „re<strong>in</strong>e“ <strong>Papier</strong>opazität e<strong>in</strong>mal abgezogen. Ist<br />
das daraus resultierende Ergebnis größer o<strong>der</strong> gleich 100 so ist e<strong>in</strong>e Opazität <strong>von</strong><br />
100% zu verwenden.<br />
Anwendbarkeit beim Durchschlageffekt<br />
Da die für die <strong>Simulation</strong> des Durchschlageffektes benötigte Tiefe, mit <strong>der</strong> die Farbe <strong>der</strong><br />
Rückseite <strong>in</strong> das <strong>Papier</strong> e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht messbar ist,<br />
muss die Intensität, mit <strong>der</strong> die Farben <strong>der</strong> Rückseite durch das <strong>Papier</strong> durchschlagen an<strong>der</strong>s<br />
simuliert werden.<br />
Hierzu wird, wie bereits im Beispiel 2 erläutert, angenommen, dass, wenn das <strong>Papier</strong> selbst e<strong>in</strong>e<br />
Opazität <strong>von</strong> 0% hätte, <strong>der</strong> Farbwert e<strong>in</strong>es Bildpunktes auf <strong>der</strong> unbedruckten Vor<strong>der</strong>seite aber<br />
mit bedruckter Rückseite dem Farbwert e<strong>in</strong>er mit <strong>der</strong> gleichen Farbe bedruckten Vor<strong>der</strong>seite<br />
entspricht.<br />
Des Weiteren kann da<strong>von</strong> ausgegangen werden, dass wenn <strong>der</strong> Bildpunkt <strong>der</strong> Rückseite trotz<br />
E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gens <strong>der</strong> Farbe <strong>in</strong> das <strong>Papier</strong> nicht auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite sichtbar ist, das <strong>Papier</strong> völlig opak<br />
ist, <strong>und</strong> <strong>der</strong> Bildpunkt auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite den gleichen Farbwert hat wie e<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>em Stapel<br />
gemessenes Blatt <strong>Papier</strong>.<br />
Dritter zu messen<strong>der</strong> Farbwert zur Durchschlagsimulation ist <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite zu<br />
messende Farbwert e<strong>in</strong>es Bildpunktes, dessen Rückseite bedruckt ist.<br />
Die aus diesen Farbwerten errechnete Opazität muss kle<strong>in</strong>er o<strong>der</strong> gleich <strong>der</strong> Opazität des<br />
<strong>Papier</strong>s se<strong>in</strong>, da das E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen <strong>der</strong> Farbe im S<strong>in</strong>ne des Durchlageffektes e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung <strong>der</strong><br />
<strong>Papier</strong>opazität darstellt.<br />
Dies wäre aber nur die <strong>Simulation</strong> des Durchschlageffektes bei e<strong>in</strong>er unbedruckten Vor<strong>der</strong>seite.<br />
Berücksichtigt werden muss aber ebenfalls die Opazität <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite aufgetragenen<br />
Druckfarbe, die, wie bereits erläutert, aus <strong>der</strong> Opazität e<strong>in</strong>es auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite bedruckten<br />
Blattes abzüglich <strong>der</strong> „re<strong>in</strong>en“ <strong>Papier</strong>opazität berechnet werden kann, um sie dann zu <strong>der</strong><br />
„reduzierten“ <strong>Papier</strong>opazität zu addieren.<br />
49
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Der Umstand, dass die Opazität des auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s 100% haben<br />
kann <strong>und</strong> daraus nicht die Opazität <strong>der</strong> Farbe selbst errechnet werden kann, macht zwar beim<br />
Durchsche<strong>in</strong>effekt ke<strong>in</strong>en Unterschied, ist jedoch für die Durchschlagsimulation sehr wohl<br />
relevant.<br />
Kann die Opazität e<strong>in</strong>er Farbe nicht errechnet werden so kann auch nicht die Opazität bestimmt<br />
werden, mit <strong>der</strong> die Vor<strong>der</strong>seite die Rückseite e<strong>in</strong>es Blattes durchsche<strong>in</strong>en lässt. Hier ist<br />
abzuwägen, ob für diese Farben e<strong>in</strong>e geson<strong>der</strong>te Messung mit e<strong>in</strong>em, mit <strong>der</strong> selben Druckfarbe<br />
bedruckten, weniger opaken <strong>Papier</strong> wie<strong>der</strong>holt wird, o<strong>der</strong> aber ob die Druckfarbe als völlig opak<br />
angenommen wird, also bei diesen Bildpunkten die Rückseite nicht zu sehen ist.<br />
Nachdem nun für jeden Bildpunkt e<strong>in</strong>e Opazität bestimmt wurde, die die Intensität bestimmt,<br />
mit <strong>der</strong> die Rückseite bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite ersche<strong>in</strong>t, kann nun die<br />
spiegelverkehrte Rückseite als Ebene über das Bild <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite gelegt werden.<br />
Da sich die Opazitäten auf die Vor<strong>der</strong>seite beziehen, müssen diese zur Anwendung jedoch zuvor<br />
auf die spiegelverkehrte Rückseite wie folgt umgerechnet werden:<br />
O = 100-Ov (Formel 3.2.2.5)<br />
mit<br />
O = Für die Rückseite zu verwendenden Opazitäten.<br />
Ov = Berechnete Opazität, die sich auf die Vor<strong>der</strong>seite bezieht.<br />
3.2.2.6 Genauigkeit <strong>der</strong> Opazitätsbestimmung <strong>und</strong> <strong>Simulation</strong><br />
Die mit diesen Methoden errechneten Opazitäten <strong>und</strong> die daraus resultierende <strong>Simulation</strong> s<strong>in</strong>d<br />
lei<strong>der</strong> nur so genau wie die Messwerte selbst. Deswegen sollten die Farbwerte zur Steigerung<br />
<strong>der</strong> Genauigkeit immer mehrmals gemessen <strong>und</strong> dann gemittelt werden.<br />
Gr<strong>und</strong> hierfür ist, dass die gemessenen Farbwerte, trotz, <strong>der</strong> auf den ersten Blick gleichen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen, verschieden se<strong>in</strong> können. Zum E<strong>in</strong>en liegt das an <strong>der</strong> nicht homogenen<br />
Faserdichte des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en an <strong>der</strong> Faserrichtung, die <strong>von</strong> Herstellung des <strong>Papier</strong>s<br />
abhängig ist.<br />
Daher ist zu empfehlen, gr<strong>und</strong>sätzlich mehrfache Messungen auf verschiedenen <strong>Papier</strong>proben<br />
zu machen, <strong>und</strong> dies sowohl mit als auch quer zur Faserrichtung. Die DIN 53146 zur<br />
Bestimmung <strong>der</strong> Opazität anhand <strong>der</strong> Reflexionsfaktoren for<strong>der</strong>t darüber h<strong>in</strong>aus sogar die<br />
Messung sowohl auf <strong>der</strong> Ober- als auch auf <strong>der</strong> Unterseite des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Vorgehensweise<br />
bei <strong>der</strong> Probenahme nach <strong>der</strong> Europäischen Norm ISO 186, die u.a. auch die Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Masch<strong>in</strong>enrichtung for<strong>der</strong>t, mit <strong>der</strong> das <strong>Papier</strong> hergestellt wurde.<br />
E<strong>in</strong>erseits hängt also die Genauigkeit <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> <strong>von</strong> dem, <strong>in</strong> die Messung <strong>in</strong>vestierten,<br />
Aufwand ab, aber an<strong>der</strong>seits auch <strong>von</strong> <strong>der</strong> verwendeten Formel zur Berechnung <strong>der</strong> Opazität (s.<br />
Kap. 3.2.2.4).<br />
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass wenn auf präzise Messungen verzichtet <strong>und</strong><br />
entschieden wird, dass die Berechnung <strong>der</strong> Opazität nur anhand <strong>der</strong> Helligkeitswerte<br />
durchzuführen ist, es zu ungenauen Ergebnissen kommen kann, die dann entwe<strong>der</strong> durch<br />
erneute, genauere Messung o<strong>der</strong> aber durch subjektiv geschätzte Werte korrigiert werden<br />
können.<br />
50
3.2.2.7 Bestimmung <strong>der</strong> Opazität durch Schätzen<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die bisherigen Methoden setzten die Verwendung e<strong>in</strong>es Farbmessgerätes wie bspw. e<strong>in</strong>es<br />
Spektralphotometers voraus. Es ist aber auch möglich die benötigten Opazitäten durch Schätzen<br />
zu bestimmen.<br />
E<strong>in</strong>e Vorgehensweise hierzu wäre, die ausgedruckten Proben durch „ausprobieren“ <strong>in</strong> Photoshop<br />
nachzuahmen. So kann die Opazität des <strong>Papier</strong> dadurch geschätzt werden <strong>in</strong>dem e<strong>in</strong> Probedruck<br />
auf e<strong>in</strong>en Stapel des gleichen <strong>Papier</strong>s gelegt wird <strong>und</strong> dieses mit e<strong>in</strong>em weiteren, unbedruckten<br />
Blatt <strong>Papier</strong> abdeckt wird. Nun kann man <strong>in</strong> Photoshop über die digitale Vorlage e<strong>in</strong>e weiße<br />
Ebene legen <strong>und</strong> dessen Opazität mit <strong>der</strong> <strong>in</strong> Photoshop als Deckkraft benannten Funktion so zu<br />
verän<strong>der</strong>n, das <strong>der</strong> Durchsche<strong>in</strong>effekt am Bildschirm möglichst dem <strong>der</strong> realen Probe entspricht.<br />
In gleicher Weise ist es auch möglich den Durchschlageffekt o<strong>der</strong> die Farbopazität durch<br />
Verwendung <strong>von</strong> farbigen Ebenen abzuschätzen.<br />
3.2.3 Konzept zu Opazitätsprofilen<br />
Welches Verfahren zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität letztendlich auch verwendet wird, so ist es<br />
doch unmöglich, dies für alle druckbaren Farbtöne durchzuführen. Benötigt wird also e<strong>in</strong>e<br />
gewisse Auswahl an Farben, für die die Opazitäten bestimmt werden, <strong>und</strong> <strong>von</strong> denen man dann<br />
auf die Opazitäten an<strong>der</strong>er Farben schließen kann.<br />
Es liegt nahe, die Opazitäten <strong>der</strong> Farben zu bestimmen, die auch beim Druck verwendet werden,<br />
<strong>und</strong> aus denen auch die an<strong>der</strong>en Farbtöne „gemischt“ werden. Beim Vierfarbendruck s<strong>in</strong>d dies<br />
selbstverständlich die Farben Cyan, Magenta, Gelb <strong>und</strong> Schwarz, für die bei unterschiedlicher<br />
Helligkeit bzw. bei unterschiedlich aufgetragener Farbmenge die Opazität bestimmt werden<br />
muss, die dann als Referenzwerte dienen, aus denen für jeden an<strong>der</strong>en Farbton die jeweilige<br />
Opazität berechnet werden kann<br />
Für Drucker <strong>und</strong> Druckmasch<strong>in</strong>en die über e<strong>in</strong> ICC-Profil im CMYK-Farbraum verfügen ist<br />
diese Vorgehensweise recht e<strong>in</strong>fach <strong>und</strong> unproblematisch, woh<strong>in</strong>gegen bei Druckern mit RGB<br />
Profilen, die zum Glück nur häufig bei Desktop Druckern zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> nicht im<br />
professionellen Bereich, das Verfahren ungleich komplizierter ist <strong>und</strong> darüber h<strong>in</strong>aus noch<br />
Abzüge <strong>in</strong> <strong>der</strong> Genauigkeit <strong>in</strong> Kauf genommen werden müssen.<br />
3.2.3.1 Opazitätsprofile beim Vierfarbendruck mit CMYK-Farbprofil<br />
Das Verfahren beim Vierfarbendruck mit CMYK-Farbprofil ist deswegen so e<strong>in</strong>fach, da e<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />
diesen Farbraum konvertiertes Bild o<strong>der</strong> Dokument für jedes e<strong>in</strong>zelne Pixel durch se<strong>in</strong>en<br />
CMYK-Farbwert die mengenmäßige Verwendung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Farbbestandteile beschreibt. So<br />
wird bspw. bei e<strong>in</strong>em dunkelblauen Pixel mit dem Farbwert CMYK(100;89;3;17) 100% <strong>der</strong> für<br />
den Bildpunkt maximal möglichen Menge an Cyan verwendet, 89% <strong>der</strong> möglichen Menge an<br />
Magenta, 3% des möglichen Gelb <strong>und</strong> 17% <strong>der</strong> möglichen Farbmenge <strong>von</strong> Schwarz.<br />
Wird nun separat für jede <strong>der</strong> Farben <strong>in</strong> dieser mengenmäßigen Verwendung die Opazität<br />
bestimmt, so können diese anschließend e<strong>in</strong>fach aufaddiert <strong>und</strong> dem Bildpunkt zugewiesen<br />
werden.<br />
51
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Da es aber zu aufwendig wäre, für jede Tonwertstufe <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen CMYK-Farben auch noch<br />
die Opazitäten zu bestimmen, müssen diese auf e<strong>in</strong>zelne Tonwertstufen e<strong>in</strong>grenzt werden, aus<br />
<strong>der</strong>en Opazitäten dann die Opazitäten <strong>der</strong> noch fehlenden Tonwertstufen <strong>in</strong>terpoliert werden<br />
können.<br />
Für die Interpolation wird e<strong>in</strong> l<strong>in</strong>eares Verhalten <strong>der</strong> Opazität zwischen zwei berechneten<br />
Opazitäten angenommen, anhand <strong>der</strong>er die Opazität (O) e<strong>in</strong>er bestimmten auf das <strong>Papier</strong><br />
aufgetragenen Menge <strong>der</strong> Druckfarbe wie folgt errechnet werden kann:<br />
O = Ob−Oa<br />
∗ �F −Fa��Oa (Formel 3.2.3.1)<br />
Fb−Fa<br />
mit<br />
F = Farbmenge, für die die Opazität bestimmt werden soll <strong>in</strong> %<br />
Fa = zu F nächst niedrigere Farbmenge %, dessen Opazität bereits bestimmt wurde<br />
Fb = zu F nächst höhere Farbmenge %, dessen Opazität bereits bestimmt wurde<br />
Oa = Opazität bei Fa<br />
Ob = Opazität bei Fb<br />
Beispiel 3<br />
In diesem Beispiel soll die Opazität e<strong>in</strong>es mit re<strong>in</strong>em Magenta bedruckten Blatt<br />
<strong>Papier</strong>s <strong>in</strong>terpoliert werden. Die verwendete Farbmenge beträgt 74% des maximalen<br />
Auftrags. Für dieses Beispiel wird angenommen, dass die Opazität bei e<strong>in</strong>er<br />
Farbmenge <strong>von</strong> 70% bzw. 80% anhand <strong>von</strong> Messwerten errechnet wurde <strong>und</strong> 89 %<br />
bzw. 95% beträgt. Hieraus ergibt sich:<br />
O = 95−89<br />
∗�74−70� � 89 = 94,1<br />
80−70<br />
mit<br />
F = 74<br />
Fa = 70<br />
Fb = 80<br />
Oa = 89<br />
Ob = 95<br />
Die Opazität des Blattes <strong>Papier</strong> mit 74% <strong>der</strong> maximal möglichen Farbmenge <strong>von</strong><br />
Magenta beträgt 91,4 %.<br />
Die Möglichkeit <strong>der</strong> Interpolation reduziert den Messaufwand erheblich <strong>und</strong> kann je nach<br />
Anfor<strong>der</strong>ung an die Genauigkeit variiert werden. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>grenzung <strong>der</strong> zu messenden<br />
Tonwertstufen je Druckfarbe auf 10 mit e<strong>in</strong>er Schrittweite <strong>von</strong> 10% bei <strong>der</strong> aufgetragenen<br />
Farbmenge stellt dabei subjektiv e<strong>in</strong> recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Messaufwand <strong>und</strong><br />
Genauigkeit <strong>der</strong> <strong>in</strong>terpolierten Opazitäten dar.<br />
Aus dieser reduzierten Anzahl an zu messenden Farbtönen lässt sich im jeweiligen Farbraum<br />
des Druckers e<strong>in</strong> Messchart erstellen, drucken <strong>und</strong> messen. Abb. 3.2.2 zeigt e<strong>in</strong> solches<br />
Messchart für e<strong>in</strong>en CMYK-Farbraum mit e<strong>in</strong>er Schrittweite <strong>von</strong> 10%.<br />
52
Abb. 3.2.2 CMYK-Messchart mit Schrittweite <strong>von</strong> 10 %<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Um nun die Opazität e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>seitig bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s zu berechnen, reicht es aus, die<br />
<strong>in</strong>terpolierten Opazitäten <strong>der</strong> jeweiligen Druckfarben bei <strong>der</strong> durch den CMYK-Farbwert<br />
bestimmten aufgetragenen Farbmenge zu addieren <strong>und</strong> hier<strong>von</strong> dann 3 mal die „re<strong>in</strong>e“<br />
<strong>Papier</strong>opazität abzuziehen.<br />
O = O(CP) + O(MP) +O(YP) +O(KP) – 3O(P) (Formel 3.2.3.2)<br />
mit<br />
O(CP) = <strong>in</strong>terpolierte Opazität des mit Cyan bedruckten <strong>Papier</strong>s<br />
O(MP) = <strong>in</strong>terpolierte Opazität des mit Magenta bedruckten <strong>Papier</strong>s<br />
O(YP) = <strong>in</strong>terpolierte Opazität des mit Gelb bedruckten <strong>Papier</strong>s<br />
O(KP) = <strong>in</strong>terpolierte Opazität des mit Schwarz bedruckten <strong>Papier</strong>s<br />
O(P) = <strong>Papier</strong>opazität<br />
Bei dieser Vorgehensweise wurde bisher aber noch nicht die für die Durchschlagsimulation<br />
benötigte „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität berücksichtigt. Da <strong>der</strong> für die Berechnung <strong>der</strong><br />
„reduzierten“ <strong>Papier</strong>opazität benötigte Farbwert des <strong>Papier</strong>s auf e<strong>in</strong>em Stapel, sowie <strong>der</strong><br />
Farbwerte des, auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite bedruckten, Blattes auf e<strong>in</strong>em Stapel bereits bekannt s<strong>in</strong>d,<br />
müssen die Farbwerte des Messchart mit <strong>der</strong> bedruckten Seite nach unten auf e<strong>in</strong>em Stapel des<br />
gleichen <strong>Papier</strong>s gemessenen werden, um so die für die Berechnung <strong>der</strong> „reduzierten“<br />
<strong>Papier</strong>opazität benötigten 3 L*a*b-Farbwerte zu komplettieren.<br />
Die „reduzierten“ <strong>Papier</strong>opazitäten <strong>der</strong> je Druckfarbe fehlenden Tonwertstufen können wie<br />
gewohnt gem. Formel 3.2.3.1 <strong>in</strong>terpoliert werden. Für die Berechnung <strong>der</strong> „reduzierten“<br />
<strong>Papier</strong>opazität bei <strong>der</strong> Verwendung e<strong>in</strong>er aus den Druckfarben gemischten Farbe ist es jedoch<br />
53
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
nicht möglich, die „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität je<strong>der</strong> Druckfarbe zu berücksichtigen. We<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Addition, noch Mittelwert o<strong>der</strong> gewichteter Mittelwert machen an dieser Stelle S<strong>in</strong>n.<br />
Stattdessen kann zur Annäherung aber die „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität <strong>der</strong> Druckfarbe verwendet<br />
werden, die bei ihrer jeweiligen aufgetragenen Farbmenge den niedrigsten L*-Wert aufweist, da<br />
die Helligkeit maßgeblich für die Wahrnehmung des „Durchschlagens“ o<strong>der</strong> „Durchsche<strong>in</strong>ens“<br />
ist.<br />
Um zu bestimmen, welche <strong>der</strong> Druckfarben <strong>in</strong> ihrer mengenmäßigen Verwendung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Bildpunkt die Dunkelste ist, muss für die jeweiligen Farbanteile des CMYK-Farbwertes <strong>der</strong> L*-<br />
Wert bestimmt werden. Da zu je<strong>der</strong> im Messchart verwendeten Farbmenge bzw. Tonwertstufe<br />
e<strong>in</strong>er Druckfarbe auch <strong>der</strong> L*-Wert vorliegt, können die gesuchten L*-Werte anhand <strong>der</strong> L*-<br />
Werte <strong>der</strong> nächst höheren <strong>und</strong> nächst niedrigeren Tonwertstufe je Druckfarbe auf die gleiche<br />
Weise <strong>in</strong>terpoliert werden wie die Opazität.<br />
Beispiel 4<br />
In diesem Beipiel wird die „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität e<strong>in</strong>es auf <strong>der</strong> Rückseite<br />
Blau bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s berechnet. Aus <strong>der</strong> Bilddatei ist bekannt, dass das<br />
Blau den CMKY-Farbwert(100;82;0;0) hat. Des Weiteren kennen wir durch die<br />
Messung <strong>der</strong> L*a*b*-Farbwerte auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite des Messcharts die L*-Werte<br />
des CMKY-Farbwertes(100;0;0;0), des CMYK-Farbwertes(0;90;0;0) sowie des<br />
CMYK-Farbwertes(0;80;0;0).<br />
Außerdem ist <strong>der</strong> L*-Wert des <strong>Papier</strong>s CMYK(0;0;0;0) durch die Messung des<br />
L*a*b*-Farbwertes e<strong>in</strong>es Stapel <strong>Papier</strong>s bekannt, dessen „reduzierte“ Opazität 100%<br />
ist. Durch die Messung des Messcharts mit bedruckter Seite nach unten, <strong>der</strong><br />
Berechnung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Interpolation ist weiter auch die „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität<br />
(Ored) je<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Druckfarbe bei allen Tonwertstufen bekannt.<br />
Da dieses Beispiel lediglich den „Rechenweg“ verdeutlichen soll, s<strong>in</strong>d die hier<br />
verwendeten L*-Werte <strong>und</strong> Opazitäten fiktiv.<br />
CMYK(100;0;0;0): L*(100;0;0;0)= 58% Ored(Cyan, 100%) = 91%<br />
CMYK(0;90;0;0): L*(0;90;0;0)= 60% Ored(Magenta, 90%) = 92%<br />
CMYK(0;80;0;0): L*(0;80;0;0)= 57% Ored(Magenta, 80%) = 90%<br />
CMYK(0;0;0;0): L*(0;0;0;0)=93% Ored(<strong>Papier</strong>weiß)= 100%<br />
Berechnung des L*-Wertes <strong>der</strong> CMYK-Werte<br />
L*(100;0;0;0) bereits bekannt.<br />
L ∗ �0 ;82;0; 0�= L∗�0;90 ;0;0�− L ∗ �0;90 ;0 ;0�<br />
∗�82−80��L<br />
90−80<br />
∗ � 0;80;0 ;0�<br />
= 60−57<br />
∗2�57<br />
10<br />
.<br />
=57,6 .<br />
54
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Da <strong>der</strong> L*-Wert bei dem CMYK-Wert(0;82;0;0) niedriger ist als <strong>der</strong> <strong>von</strong><br />
CMYK(100;0;0;0) ist für den CMYK-Farbwert(100;82;0;0) die reduzierte Opazität<br />
bei dem CMYK(0;82;0;0) zu verwenden.<br />
Berechnung <strong>der</strong> „reduzierten“ <strong>Papier</strong>opazität<br />
Ored �Magent a ,82 %� = 92−90<br />
10<br />
∗ 2 � 90=90,4=~90 %<br />
3.2.3.2 Opazitätsprofile beim Vierfarbendruck mit RGB-Farbprofil<br />
Wie bereits angedeutet, ist das Verfahren bei Druckern mit RGB-Profilen komplizierter. Solche<br />
Drucker verwenden selbstverständlich auch die CYMK-Farben, das verwendete Druckerprofil<br />
ist jedoch im RGB-Farbraum.<br />
D.h, dass Bil<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Dokumente, die <strong>in</strong> den Farbraum des Druckers konvertiert wurden,<br />
ebenfalls RGB-Werte enthalten <strong>und</strong> diese auch so an den Drucker geschickt werden. Da <strong>der</strong><br />
eigentlich Druck jedoch <strong>in</strong> den CMYK-Farben stattf<strong>in</strong>det, muss entwe<strong>der</strong> <strong>in</strong> den<br />
Druckertreibern o<strong>der</strong> im Gerät selbst e<strong>in</strong>e „versteckte“ Umwandlung <strong>der</strong> RGB-Werte <strong>in</strong><br />
CMYK-Werte durchgeführt werden.<br />
Für das für die Berechnung <strong>der</strong> Opazität notwendige Messchart bedeutet dies aber nicht, dass<br />
die Farben Rot, Grün <strong>und</strong> Blau <strong>in</strong> verschieden Tonwertstufen verwendet werden können. Gr<strong>und</strong><br />
hierfür ist, dass die Farben bereits durch mehrere Druckfarben dargestellt werden <strong>und</strong> somit e<strong>in</strong>e<br />
höhere Opazität aufweisen als die im RGB-Farbraum durch Farbaddition erreichbaren<br />
Druckfarben Cyan, Magenta <strong>und</strong> Gelb. D.h. e<strong>in</strong>e Addition <strong>der</strong> Opazitäten ist nicht möglich. Für<br />
die Bestimmung <strong>der</strong> Opazität können jedoch zwei unterschiedliche Methoden angewendet<br />
werden.<br />
Methode 1<br />
Erste Methode wäre die Verwendung e<strong>in</strong>es Messcharts, welches über den gesamten RGB-<br />
Farbraum verteilte Farben enthält, dessen Opazitäten dann bestimmt werden können, <strong>und</strong> aus<br />
denen die Opazitäten <strong>von</strong> nicht im Messchart enthaltenden Farben <strong>in</strong>terpoliert werden können.<br />
Um die Vorgehensweise plastischer zu erläutern stelle man sich den RGB-Farbraum als Würfel<br />
wie <strong>in</strong> Abb.3.2.3 vor.<br />
Abb. 3.2.3 RGB-Farbwürfel<br />
55
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die drei Achsen des Würfels stellen die e<strong>in</strong>zelnen Kanäle des RGB-Farbraums dar, die im Falle<br />
e<strong>in</strong>er 8 Bit-Farbtiefe jeweils aus 256 Farbabstufungen bestehen. Um nun gleichmäßig über den<br />
gesamten Farbraum verteilte Farben für das Messchart auszuwählen, können je Kanal Farben<br />
mit gleichem Abstand ausgewählt werden.<br />
D.h, werden je Achse 5 Tonwertstufen mit e<strong>in</strong>er Schrittweite <strong>von</strong> 64 Tonwertstufen gewählt,<br />
wären damit <strong>in</strong>sgesamt 5*5*5 = 125 Farben ausgewählt, die dann gedruckt, gemessen <strong>und</strong><br />
dessen Opazität berechnet werden müsste. Ist e<strong>in</strong>e höhere Genauigkeit gefor<strong>der</strong>t, <strong>und</strong> es würden<br />
9 Tonwertstufen pro Kanal mit e<strong>in</strong>er Schrittweite <strong>von</strong> 32 Tonwertstufen ausgewählt, so wären<br />
es bereits 9^3= 729 Farben.<br />
Durch die gleichmäßig ausgewählten Farben entstehen <strong>in</strong>nerhalb des RGB-Würfels kle<strong>in</strong>ere<br />
Würfel, <strong>der</strong>en Ecken aus den ausgewählten Farben bestehen, <strong>und</strong> mit dessen berechneten<br />
Opazitäten die Opazitäten je<strong>der</strong>, auf den Kanten des kle<strong>in</strong>en Würfels liegende Farbe <strong>in</strong>terpoliert<br />
werden kann. Aus diesen <strong>in</strong>terpolierten Werten können dann wie<strong>der</strong>um die Opazitäten für jede<br />
<strong>in</strong>nerhalb des kle<strong>in</strong>en Würfels liegende Farbe <strong>in</strong>terpoliert werden.<br />
Bei dieser Methode wird schnell klar, dass <strong>der</strong> Messaufwand <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Verhältnis zu <strong>der</strong><br />
ger<strong>in</strong>gen Genauigkeit <strong>der</strong> <strong>in</strong>terpolierten Opazitäten steht, zumal, wie bereits erwähnt, RGB-<br />
Profile wahrsche<strong>in</strong>lich ausschließlich bei Druckern im nicht professionellen Bereich zu f<strong>in</strong>den<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Methode 2<br />
Die zweite Methode zur Opazitätsbestimmung bei CMYK-Druckern mit RGB-Profil ist <strong>der</strong><br />
Methode bei Druckern mit CMYK-Profil sehr ähnlich. Hier wird ebenso e<strong>in</strong> Messchart<br />
verwendet, welches die CMYK-Farben <strong>in</strong> unterschiedlichen Tonwertstufen enthält. Der<br />
Unterschied liegt jedoch dar<strong>in</strong>, dass die Farbwerte als RGB-Werte angegeben werden müssen.<br />
Abb. 3.2.4 zeigt e<strong>in</strong> solches Messchart dessen Schrittweite <strong>der</strong> Farbtöne 32 Tonwertstufen<br />
beträgt. In Tab. 3.2.1 s<strong>in</strong>d die für das <strong>in</strong> Abb.3.2.4 dargestellte Messchart verwendeten RGB-<br />
Farbwerte angegeben sowie die beim Druck theoretische verwendete Farbmenge.<br />
Abb. 3.2.4 RGB Messchart<br />
56
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Schwarz Cyan Magenta Gelb Theoretische<br />
Farbmenge<br />
RGB(255;255;255) RGB(0;255;255) RGB(255;0;255) RGB(255;255;0) 100,00%<br />
RGB(123;123;123) RGB(0;123;123) RGB(123;0;123) RGB(123;123;0) 87,50%<br />
RGB(191;191;191) RGB(0;191;191) RGB(191;0;191) RGB(191;191;0) 75,00%<br />
RGB(159;159;159) RGB(0;159;159) RGB(159;0;159) RGB(159;159;0) 67,50%<br />
RGB(127;127;127) RGB(0;127;127) RGB(127;0;127) RGB(127;127;0) 50,00%<br />
RGB(95;95;95) RGB(0;95;95) RGB(95;0;95) RGB(95;95;0) 37,50%<br />
RGB(63;63;63) RGB(0;63;63) RGB(63;0;63) RGB(63;63;0) 25,00%<br />
RGB(31;31;31) RGB(0;31;31) RGB(31;0;31) RGB(31;31;0) 12,50%<br />
Tab. 3.2.1 RGB-Farbwerte für CMYK-Messfel<strong>der</strong><br />
Die Messung <strong>der</strong> für die Berechnung <strong>der</strong> Opazitäten notwendigen L*a*b*-Farbwerte, die<br />
Berechnung <strong>der</strong> Opazitäten sowie die Interpolation erfolgt <strong>in</strong> <strong>der</strong> gleichen Art <strong>und</strong> Weise wie bei<br />
Druckern <strong>und</strong> Druckmasch<strong>in</strong>en mit CMYK-Farbprofil.<br />
Wenn nun zur <strong>Simulation</strong> des Durchschlag- bzw. Durchsche<strong>in</strong>effektes die Opazität e<strong>in</strong>es<br />
Bildpunktes benötigt wird, so lässt sich an dessen RGB-Wert jedoch nicht direkt ableiten,<br />
welche Messwerte zur Opazitätsberechnung <strong>und</strong> -<strong>in</strong>terpolation verwendet werden müssen.<br />
Hierzu müssen die RGB-Farbwerte <strong>in</strong> CMYK-Farbwerte umgerechnet werden, anhand <strong>der</strong>er<br />
dann über die theoretisch verwendete Farbmenge die Messwerte zur Opazitätsberechnung <strong>und</strong><br />
-<strong>in</strong>terpolation ermittelt werden können.<br />
E<strong>in</strong>schub zur Umrechnung <strong>von</strong> RGB-Farbwerte <strong>in</strong> CMYK-Farbwerte<br />
Wie bereits <strong>in</strong> Kap.2.1 beschrieben, können aus den drei Druckfarben Cyan, Magenta<br />
<strong>und</strong> Gelb alle an<strong>der</strong>en Farben gemischt werden. Es lassen sich daher alle RGB-<br />
Farbwerte <strong>in</strong> CMY-Farbwerte <strong>und</strong> vice versa umrechnen.<br />
Die zusätzliche Verwendung e<strong>in</strong>er schwarzen Druckfarbe aus qualitativen,<br />
ökonomischen <strong>und</strong> ökologischen Gründen hat zur Folge, dass sich die Anteile <strong>der</strong><br />
CMY-Farben, also <strong>der</strong> Farbaufbau, än<strong>der</strong>t. An dieser Stelle kann E<strong>in</strong>fluss darauf<br />
genommen werden, zu welchen Zwecken <strong>und</strong> <strong>in</strong> welchen Mengen die schwarze<br />
Druckfarbe verwendet wird.<br />
Zwei, auch <strong>in</strong> Photoshop verwendete Methoden, mit denen <strong>der</strong> Farbaufbau durch die<br />
schwarze Druckfarbe erweitert <strong>und</strong> berechnet werden kann, s<strong>in</strong>d die Methoden UCR<br />
(Un<strong>der</strong> Color Removal) <strong>und</strong> GCR (Grey Component Replacement).<br />
Beim UCR werden alle Grautöne, d.h. alle Farben bei denen die Farbanteile <strong>von</strong> Cyan,<br />
Magenta <strong>und</strong> Gelb gleich s<strong>in</strong>d, mit <strong>der</strong> schwarzen Druckfarbe ersetzt. Der Farbaufbau<br />
aller bunten Farben, bleibt dabei unverän<strong>der</strong>t.<br />
Bei <strong>der</strong> Methode GCR werden nicht nur alle Grautöne durch die schwarze Druckfarbe<br />
ersetzt, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> graue Anteil <strong>der</strong> Buntfarben. D.h, <strong>der</strong> Farbanteil, bei dem<br />
<strong>von</strong> Cyan, Magenta <strong>und</strong> Gelb die gleiche Farbmenge verwendet wird, wird durch die<br />
schwarze Druckfarbe ersetzt. Die Farbmenge, die <strong>von</strong> maximal zwei <strong>der</strong> drei CMY-<br />
Farben zusätzlich zum Aufbau <strong>der</strong> bunten Farbe benötigt wird, bleibt unverän<strong>der</strong>t.<br />
57
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Bei beiden Methoden gibt es weitere Möglichkeiten, mit denen sich <strong>der</strong><br />
Schwarzaufbau weiter def<strong>in</strong>ieren lässt, aber auf die hier nicht weiter e<strong>in</strong>gegangen<br />
werden. E<strong>in</strong> Beispiel hierfür wäre, dass die Farben auf dem Druckerzeugnis satter<br />
ersche<strong>in</strong>en können, wenn e<strong>in</strong> Teil des schwarzen Farbanteils, durch CMY-Farben<br />
aufgebaut werden.[Kr01]<br />
Die RGB-Farbwerte werden wie folgt <strong>in</strong> CMY-Farbwerte umgerechnet[IM2]:<br />
C = QuantumRange – R (Formel 3.2.3.3)<br />
M = QuantumRange – G<br />
Y = QuantumRange – B<br />
mit<br />
C, M, <strong>und</strong> Y = Tonwertstufen <strong>der</strong> Farbkanäle Cyan, Magenta, <strong>und</strong> Gelb.<br />
R, G, <strong>und</strong> B = vorhandene Tonwertstufen <strong>der</strong> Farbkanäle Rot, Grün <strong>und</strong> Blau.<br />
QuantumRange = <strong>von</strong> <strong>der</strong> Farbtiefe abhängige Anzahl möglicher Tonwertstufen<br />
im Falle e<strong>in</strong>er 8 Bit Farbtiefe QuantumRange = 255.<br />
Mit den CMY-Farbwerten wird aber noch nicht die schwarze Druckfarbe verwendet, weshalb<br />
<strong>der</strong> Farbaufbau neu berechnet werden muss. Da aber, wie wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> den meisten Fällen,<br />
nicht bekannt ist, nach welcher Methode <strong>der</strong> Drucker den Farbaufbau berechnet, kann diese nur<br />
vermutet werden, auch wenn dies dazu führt, dass die <strong>Simulation</strong> ungenauer wird.<br />
Sollte die UCR-Methode gewählt werden, reicht es aus, die jeweiligen gleichen Tonwertstufen<br />
<strong>der</strong> CMY-Farbwerte durch die gleiche Tonwertstufe bei K zu ersetzten. So kann z.B. <strong>der</strong> CMY-<br />
Farbwert (58;58;58) <strong>in</strong> den CMYK-Farbwert (0;0;0;58) umgesetzt werden.<br />
Wird die GCR-Methode gewählt, wird die Umrechnung wie folgt durchgeführt [IM2]:<br />
K = M<strong>in</strong> �C ,M , K � .<br />
C =<br />
M =<br />
Y =<br />
QuantumRange∗�C−K �<br />
QuantumRange−K<br />
QuantumRange∗� M −K �<br />
QuantumRange− K<br />
QuantumRange∗�Y −K �<br />
QuantumRange−K<br />
(Formel 3.2.3.4)<br />
mit<br />
C, M, Y, K = Tonwertsufe <strong>der</strong> Kanäle Cyan, Magenta, Gelb <strong>und</strong> Schwarz<br />
QuantumRange = <strong>von</strong> <strong>der</strong> Farbtiefe abhängige Anzahl an Tonwertstufen<br />
58
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Anschließend kann sowohl bei <strong>der</strong> UCR- als auch bei <strong>der</strong> GCR-Methode <strong>der</strong> Schwarzaufbau<br />
weiter def<strong>in</strong>iert werden, worauf an dieser Stelle aber verzichtet wird. Des Weiteren handelt es<br />
sich bei den Werten <strong>in</strong> dieser Darstellung zunächst um die Tonwertstufen <strong>und</strong> müssen gemäß <strong>der</strong><br />
Farbtiefe <strong>in</strong> die prozentuale Darstellung <strong>der</strong> verwendeten Farbmenge umgerechnet werden.<br />
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die GCR-Methode ohne e<strong>in</strong>e weitere Def<strong>in</strong>ition des<br />
Schwarzaufbaus verwendet, da sehr wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> den meisten Fällen diese Methode vom<br />
Drucker verwendet wird, es jedoch ke<strong>in</strong>erlei Information bzgl. des Schwarzaufbaus gibt.<br />
Beispiel 5<br />
In diesem Beispiel wird die Umrechnung e<strong>in</strong>es Orange-Farbtons mit dem RGB-<br />
Farbwert (223;166;97) bei e<strong>in</strong>er Farbtiefe <strong>von</strong> 8 Bit <strong>in</strong> den CMYK-Farbwert<br />
anhand <strong>der</strong> GCR-Methode durchgeführt.<br />
Schritt 1: Umrechnung des RGB-Farbwerts <strong>in</strong> den CMY-Farbwert<br />
C = 255 – R = 255 – 223 = 32<br />
M = 255 – G = 255 – 166 = 89<br />
Y = 255 – B = 255 – 97 = 158<br />
Schritt 2: E<strong>in</strong>beziehung des schwarzen Kanals mit <strong>der</strong> GCR-Methode<br />
K = M<strong>in</strong>�32, 89,158� = 32 .<br />
C = 255∗�32−32�<br />
255−32<br />
M = 255∗�89−32�<br />
255−32<br />
Y = 255∗�159−32�<br />
255−32<br />
0<br />
= = 0 .<br />
223<br />
14535<br />
= = ~65 .<br />
223<br />
= 32385<br />
223<br />
= ~145<br />
Schritt 3: Umrechnung <strong>der</strong> Tonwertstufen <strong>in</strong> prozentual verwendete Farbmenge<br />
K = 32<br />
∗ 100 = ~13<br />
255<br />
C = 0<br />
∗ 100 = 0 .<br />
255<br />
M = 65<br />
∗ 100 = ~25<br />
255<br />
Y = 145<br />
∗ 100 = ~57<br />
255<br />
59
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Schwachstellen<br />
Wie bereits erwähnt <strong>und</strong> aus den Ausführungen ersichtlich, ist die Bestimmung <strong>der</strong> Opazitäten<br />
bei Druckern mit RGB-Profil zum Teil ungenau. Ungenauigkeiten können dabei zum E<strong>in</strong>en bei<br />
<strong>der</strong> Umrechnung <strong>der</strong> RGB-Werte <strong>in</strong> die CMYK-Werte entstehen, <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en dadurch,<br />
dass nicht gewährleistet ist, dass die mit RGB-Farbwerten erstellten Messfel<strong>der</strong> des Messcharts<br />
mit <strong>der</strong> jeweiligen „re<strong>in</strong>en“ Druckfarbe gedruckt werden.<br />
Die Ursache liegt <strong>in</strong> den Unterschieden <strong>der</strong> Farbmodelle. Wie <strong>in</strong> Abb. 3.2.5 zu sehen ist, wird <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Normfarbtafel <strong>der</strong> RGB-Farbraum als Dreieck dargestellt, während <strong>der</strong> CMYK-Farbraum<br />
e<strong>in</strong> Sechseck ist.<br />
Abb. 3.2.5 Farbraumvergleich<br />
Um den Gamut des Druckers abzudecken, muss <strong>der</strong> RGB-Farbraum des Profils also größer se<strong>in</strong><br />
als <strong>der</strong> Gamut. Dies bedeutet aber auch, dass <strong>der</strong> Farbraum Farben enthält, die nicht im<br />
Farbumfang des Druckers liegen, das Profil somit nicht farbtreu ist <strong>und</strong> somit für e<strong>in</strong>e<br />
<strong>Simulation</strong> nicht <strong>in</strong> Betracht kommt. E<strong>in</strong> Beispiel für e<strong>in</strong>e solche Konstellation ist die<br />
standardmäßige Verwendung des sRGB-Farbraums bei T<strong>in</strong>tenstrahldruckern wie sie z.B. häufig<br />
bei Hewlett&Packard Desktop Druckern anzutreffen ist.<br />
E<strong>in</strong> profilierter Drucker verwendet jedoch e<strong>in</strong>en Farbraum, welcher vollständig <strong>in</strong>nerhalb des<br />
Druckergamuts liegt <strong>und</strong> dadurch <strong>in</strong>sgesamt kle<strong>in</strong>er ist, also nicht den Farbumfang des Druckers<br />
ausnutzt.<br />
Lei<strong>der</strong> ist bei solchen Profilen nicht gewährleistet, das <strong>der</strong> Mittelpunkt e<strong>in</strong>er Geraden zwischen<br />
den Primärvalenzen des RGB-Farbraums auf <strong>der</strong> Primärvalenz des CMYK-Farbraums liegt. Es<br />
ist sogar nicht e<strong>in</strong>mal gewährleistet, dass <strong>der</strong> Mittelpunkt auf <strong>der</strong> Geraden zwischen Weißpunkt<br />
<strong>und</strong> Primärvalenz des CMYK-Farbraum liegt. D.h., dass z.B. <strong>der</strong> RGB-Farbwert(0;255;255),<br />
<strong>der</strong> im RGB-Farbraum e<strong>in</strong> „re<strong>in</strong>es“ Cyan repräsentiert, nicht nur dazu führt, dass die Druckfarbe<br />
Cyan nicht mit e<strong>in</strong>er Farbmenge <strong>von</strong> 100% ausgedruckt wird, son<strong>der</strong>n sogar dazu, dass nicht<br />
e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong> „re<strong>in</strong>es“ Cyan ausgedruckt wird.<br />
60
3.3 Workflow zur Eigenschaftensimulation<br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Um das Ersche<strong>in</strong>ungsbild e<strong>in</strong>es Druckerzeugnisses <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Webapplikation zu simulieren,<br />
müssen die Konzepte, mit denen e<strong>in</strong>zelne Ausprägungen des Ersche<strong>in</strong>ungsbildes simuliert<br />
werden können, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gesamtkonzept zusammenfließen. Im Folgenden wird hierzu e<strong>in</strong><br />
Konzept erläutert, mit dem die <strong>in</strong> Kap.3.1 erläuterte <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung als auch die <strong>in</strong><br />
Kap. 3.2 erläuterte <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Workflow umgesetzt werden<br />
können.<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n dieses geme<strong>in</strong>samen Workflows zur <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung <strong>und</strong> Opazität steht<br />
das E<strong>in</strong>stellen <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> <strong>und</strong> Dokumente <strong>in</strong> das System. Hierbei kann es sich um bereits für die<br />
jeweilige Druckbed<strong>in</strong>gung separierte Objekte handeln, o<strong>der</strong> aber die Objekte liegen<br />
medienneutral vor. Während bereits separierte Objekte den gesamten Workflow nur e<strong>in</strong>mal<br />
durchlaufen, so müssen medienneutrale Objekte den Workflow für jede zu simulierende<br />
Druckbed<strong>in</strong>gung erneut durchlaufen.<br />
Am Ende des Workflows steht die Vorschau des separierten Objektes, die Vorschau <strong>in</strong> <strong>der</strong> die<br />
Farbgebung des gedruckten Objektes simuliert wird (s Kap. 2.2.4 Softproof), <strong>und</strong> die Vorschau,<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> sowohl die Farbgebung als auch die Opazität des gedruckten Objektes simuliert wird.<br />
Letzteres unterteilt sich wie<strong>der</strong>um <strong>in</strong> die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung <strong>und</strong> Opazität bei e<strong>in</strong>em<br />
e<strong>in</strong>seitigen Druck sowie beim beidseitigen Druck.<br />
Zusätzlich steht bei medienneutralen Objekten parallel zum Workflow die Option e<strong>in</strong>er<br />
Vorschaugenerierung des unseparierten Bildes o<strong>der</strong> Dokumentes zur Verfügung.<br />
Der Workflow lässt sich zur Umsetzung <strong>und</strong> Beschreibung <strong>in</strong> zwei wesentliche Schritte<br />
unterteilen. Im ersten Schritt werden die Separation, Rasterung <strong>und</strong> Formatierung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> Dokumente <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Bilddatei, bzw. bei mehrseitigen Dokumenten <strong>in</strong> je e<strong>in</strong>e Bilddatei pro<br />
Seite durchgeführt. Diese Bilddateien bilden die Schnittstelle zum zweiten Schritt des<br />
Workflows, <strong>in</strong> dem für die separierten Bil<strong>der</strong>n, dessen Farbgebung <strong>und</strong> Opazität als<br />
Druckerzeugnis berechnet <strong>und</strong> simuliert wird.<br />
In Kap. 3.3.1 wird <strong>der</strong>, die Rasterung, Separation <strong>und</strong> Formatierung durchführende erste Schritt<br />
des Workflows erläutert. Im anschließenden Kap. 3.3.2 wird dann <strong>der</strong>, die <strong>Simulation</strong><br />
durchführende zweite Schritt erläutert. In Kap. 3.3.3 wird die Durchführung <strong>und</strong> <strong>in</strong> Kap. 3.3.4<br />
die Steuerung des Gesamtworkflows betrachtet.<br />
3.3.1 Schritt 1 – Rasterung, Separation <strong>und</strong> Formatierung<br />
In diesem Teilworkflow werden die <strong>in</strong> das System e<strong>in</strong>gestellten Objekte für den, die <strong>Simulation</strong><br />
durchführenden, zweiten Teil des Workflows aufbereitet <strong>und</strong> formatiert. Hierfür müssen die<br />
Objekte e<strong>in</strong>en jeweils auf ihren Typ <strong>und</strong> ihre Eigenschaften abgestimmten Prozess durchlaufen,<br />
an dessen Ende e<strong>in</strong> o<strong>der</strong> mehrere, <strong>in</strong> den Farbraum des Druckbed<strong>in</strong>gung separierte, Bilddateien<br />
liegen.<br />
Diese Bil<strong>der</strong> müssen wegen <strong>der</strong> breiten Farbraumunterstützung im TIFF-Format vorliegen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist es für den zweiten Schritt des Workflows erfor<strong>der</strong>lich, dass diese Bil<strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Auflösung <strong>und</strong> <strong>in</strong> dem Maß vorliegen, mit denen die späteren Vorschaubil<strong>der</strong> auf dem<br />
Monitor dargestellt werden.<br />
61
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die Auflösung <strong>und</strong> die Maße s<strong>in</strong>d dabei freigestellt, es bietet sich jedoch bei Vorschaubil<strong>der</strong>n<br />
e<strong>in</strong>e Auflösung <strong>von</strong> 72 dpi an, sowie e<strong>in</strong> Maß, das es erlaubt, das Bild auf dem Monitor als<br />
Ganzes zu betrachten. Bei e<strong>in</strong>er üblichen Monitorauflösung <strong>von</strong> 1280x1024 Pixel wäre dies z.B.<br />
e<strong>in</strong> maximales Bildmaß <strong>von</strong> 1000x700 Pixel.<br />
Objektabhängige Prozesse<br />
Die Prozesse, die die <strong>in</strong> das System e<strong>in</strong>gestellten Objekte aufbereiten, können sich erheblich<br />
unterscheiden, was <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie vom Typ des Objektes abhängt. An zweiter Stelle ist zu<br />
differenzieren, ob es sich um e<strong>in</strong> bereits separiertes Objekt handelt o<strong>der</strong> nicht. Im Folgenden<br />
werden vier wesentlichen Unterscheidungen für die Objekte getroffen, die jeweils e<strong>in</strong>en an<strong>der</strong>en<br />
Prozess durchlaufen müssen:<br />
– separierte Bilddatei<br />
Prozess muss Formatierung durchführen.<br />
– medienneutrale Bilddatei<br />
Prozess muss Separierung <strong>und</strong> Formatierung durchführen.<br />
– separiertes PDF<br />
Prozess muss Rasterung <strong>und</strong> Formatierung durchführen.<br />
– medienneutrales PDF<br />
Prozess muss Rasterung, Separierung <strong>und</strong> Formatierung durchführen.<br />
Über diese E<strong>in</strong>teilung h<strong>in</strong>aus unterscheiden sich die Bilddateien <strong>in</strong> ihrem Format, dem<br />
verwendeten Kompressionsverfahren sowie weiteren Bildeigenschaften, die ggf. jeweils e<strong>in</strong>e<br />
geson<strong>der</strong>te Handhabung notwendig machen. So gibt es z.B. Bilddateien wie das Vektor EPS,<br />
welche e<strong>in</strong> Bild nicht anhand <strong>von</strong> Bildpunkten beschreiben son<strong>der</strong>n dazu Vektoren verwenden<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Folge dessen e<strong>in</strong>e Rasterung durchgeführt werden muss.<br />
Des Weiteren können Bilddateien z.B. anstatt <strong>der</strong> üblichen 8 Bit Farbtiefe auch e<strong>in</strong>e Farbtiefe<br />
<strong>von</strong> 16 o<strong>der</strong> sogar 32 Bit haben, o<strong>der</strong> aber sie verfügen über Ebenen o<strong>der</strong> Beschneidungspfade<br />
(auch: Freistellpfad o<strong>der</strong> clipp<strong>in</strong>g path) die berücksichtigt werden müssen.<br />
Bei PDF-Dokumenten ist ebenfalls nicht gewährleistet, dass e<strong>in</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> selbe Prozess alle ihm<br />
übergebenen Dokumente erfolgreich rastern <strong>und</strong> separieren kann, da es zum E<strong>in</strong>en zahlreiche<br />
Formatversionen gibt <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en auch hier Eigenschaften wie z.B. die Funktion des<br />
Überdrucken e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Behandlung notwendig machen.<br />
Alle diese Beson<strong>der</strong>heiten werden an dieser Stelle nicht weiter betrachtet <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d Teil e<strong>in</strong>er<br />
konkreten Planung e<strong>in</strong>es Systems <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d ebenso abhängig <strong>von</strong> den Anfor<strong>der</strong>ungen an dieses<br />
System. Gr<strong>und</strong>sätzlich können aber Prozesse für alle Dateiformate <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Eigenschaften<br />
implementiert werden, für die, mit welchen „Mitteln“ auch immer, e<strong>in</strong>e Rasterung <strong>und</strong> farbtreue<br />
Separierung möglich ist.<br />
62
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Prozessauswahl<br />
Da es we<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Auswahl noch bei <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> zu verwendenden Bildbearbeitungssoftware,<br />
RIPs o<strong>der</strong> CMMs konzeptionelle E<strong>in</strong>schränkungen gibt, besteht ebenfalls die<br />
Möglichkeit, diese beliebig zu komb<strong>in</strong>ieren. Hierdurch können zahlreiche unterschiedliche<br />
Prozesse entstehen, die zur Separartion, Rasterung <strong>und</strong> Formatierung frei gewählt werden<br />
können.<br />
So ist es beispielsweise möglich, für e<strong>in</strong> <strong>in</strong> das System e<strong>in</strong>gestelltes medienneutrales PDF, zur<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Druckbed<strong>in</strong>gung A e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es RIP <strong>und</strong> e<strong>in</strong> an<strong>der</strong>es CMM zu verwenden als zur<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Druckbed<strong>in</strong>gung B.<br />
3.3.2 Schritt 2 - <strong>Simulation</strong><br />
Ausgangspunkt dieses Teilworkflows ist das separierte Bild, bzw. die für jede Seite e<strong>in</strong>es<br />
Dokumentes gerasterten <strong>und</strong> separierten Bil<strong>der</strong> im TIFF-Format, die diesen Teilworkflow<br />
jeweils e<strong>in</strong>zeln durchlaufen müssen. Der Teilworkflow umfasst die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung<br />
<strong>und</strong> die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität.<br />
Während die Farbgebungssimulation völlig unabhängig durchlaufen werden kann, ist die<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität auf die Teil- <strong>und</strong> En<strong>der</strong>gebnisse <strong>der</strong> Farbgebungsimulation angewiesen<br />
<strong>und</strong> kann erst nach dessen Fertigstellung vollständig abschließen.<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n dieses Teilworkflows muss zunächst auf Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> Maße, <strong>der</strong> Auflösung <strong>und</strong> des<br />
Farbraums des separierten Bildes e<strong>in</strong>e weißes Bild generiert werden, welches e<strong>in</strong> unbedrucktes<br />
Blatt <strong>Papier</strong> repräsentiert <strong>und</strong> im weiteren Verlauf dazu genutzt wird, die Rückseite e<strong>in</strong>es<br />
e<strong>in</strong>seitig bedruckten Blattes darzustellen.<br />
Weiter muss sowohl <strong>von</strong> dem separierten Bild als auch <strong>von</strong> <strong>der</strong> weißen Rückseite jeweils e<strong>in</strong><br />
Proofbild berechnet werden, <strong>in</strong>dem es, wie <strong>in</strong> Kap 3.1.2 erläutert, absolut farbmetrisch <strong>in</strong> den<br />
L*a*b-Farbraum konvertiert wird. Auch hier muss wegen <strong>der</strong> Unterstützung des L*a*b*-<br />
Farbraums das TIFF-Format verwendet werden.<br />
Von dem separierten Bild <strong>und</strong> <strong>der</strong> weißen Rückseite sowie dessen Proofbil<strong>der</strong>n muss<br />
anschließend e<strong>in</strong>e Konvertierung zu den jeweiligen Vorschaubil<strong>der</strong>n erfolgen. Bei den<br />
Proofbil<strong>der</strong>n hat dies wegen <strong>der</strong> Farbteue relativ farbmetrisch, <strong>und</strong> bei den separierten Bil<strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> dessen Rückseite zur Erhaltung des Motive<strong>in</strong>drucks perzeptiv o<strong>der</strong> relativ farbmetrisch mit<br />
Tiefenkompensation zu erfolgen.<br />
Des Weiteren müssen die Vorschauen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dateiformat gespeichert werden, welches sich<br />
zur Darstellung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Webapplikation eignet.<br />
Anbieten würde sich hierfür entwe<strong>der</strong> das JPEG- o<strong>der</strong> das PNG-Format. Das GIF-Format sollte<br />
nicht verwendet werden, da es nur <strong>in</strong>dizierte Farben enthält, d.h., dass bei <strong>der</strong> Konvertierung <strong>in</strong><br />
dieses Format e<strong>in</strong>e Farbtabelle mit nur 256 Farben erstellt wird, mit dem sich das Bild zwar<br />
platzsparend, aber ke<strong>in</strong>esfalls farbtreu darstellen lässt.[Ke03]<br />
63
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Die Wahl <strong>der</strong> Ausgabefarbräume ist ebenfalls freigestellt, es ist aber dr<strong>in</strong>gend zu empfehlen, den<br />
sRGB-Farbraum zu verwenden, da sich dieser als Standardfarbraum für Bil<strong>der</strong> im Internet<br />
durchgesetzt hat (s. Kap.2.3). Es sollten aber auch weitere Standardfarbräume verwendet<br />
werden, die größer als <strong>der</strong> sRGB-Farbraum s<strong>in</strong>d, wie z.B. <strong>der</strong> AdobeRGB- o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
WideGamutRGB-Farbraum. Hierdurch kann Anwen<strong>der</strong>n, die über Monitore mit größerem<br />
Gamut verfügen, Rechnung getragen werden.<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität<br />
Wie bei <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Farbgebung wird auch für die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität zunächst das<br />
am Anfang dieses Teilworkflows stehende, separierte Bild verwendet. Von diesem müssen<br />
zunächst die Farbwerte jedes se<strong>in</strong>er Pixel ausgelesen werden, um dessen Opazität nach <strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
Kap. 3.2 vorgestellten Vorgehensweise berechnen zu können.<br />
Da sich so, im Falle e<strong>in</strong>es mehrseitigen Dokumentes, lediglich die Opazitäten zur <strong>Simulation</strong><br />
e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>seitig bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s berechnen lassen, muss für die <strong>Simulation</strong> des<br />
beidseitigen Drucks zusätzlich, je nach dem, ob es sich bei <strong>der</strong> aktuellen Seite um e<strong>in</strong>e gerade<br />
o<strong>der</strong> ungerade Seitenzahl handelt, das separierte Bild <strong>der</strong> davor liegenden bzw. <strong>der</strong><br />
nachfolgenden Seite e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
Dies setzt selbstverständlich voraus, dass die Rasterung, Separation <strong>und</strong> Formatierung <strong>der</strong><br />
vorherigen bzw. nachfolgenden Seite abgeschlossen ist. Handelt es sich bei <strong>der</strong> aktuellen Seite<br />
um die letzte Seite, <strong>und</strong> hat diese e<strong>in</strong>e ungerade Seitenzahl, so reicht zur Berechnung <strong>der</strong><br />
Opazität die zusätzliche Verwendung des weißen Bildes als Rückseite aus.<br />
Zusammenfassend muss für die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität bei e<strong>in</strong>seitig bedrucktem <strong>Papier</strong>, zum<br />
E<strong>in</strong>en die Opazität des bedruckten Blattes aus Sicht <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite, zum Zweiten<br />
spiegelverkehrt aus Sicht <strong>der</strong> Rückseite <strong>und</strong> zum Dritten die durch die auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite<br />
aufgetragene Druckfarbe „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität <strong>der</strong> Rückseite berechnet werden.<br />
Bei beidseitig bedrucktem <strong>Papier</strong> muss die Opazität des Blattes aus Sicht <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite <strong>und</strong><br />
unter Berücksichtigung <strong>der</strong> bedruckten Rückseite, sowie die durch die auf <strong>der</strong> Rückseite<br />
aufgetragenen Druckfarben bed<strong>in</strong>gte, „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
auf <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite aufgetragenen Druckfarbe berechnet werden.<br />
Zur Opazitätssimulation <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>seitig bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s müssen die den<br />
Durchsche<strong>in</strong>effekt betreffenden Opazitätswerte auf die im jeweiligen Ausgabefarbraum<br />
vorliegenden Proofvorschauen angewendet werden.<br />
Für die Rückseite h<strong>in</strong>gegen müssen zunächst die den Durchschlageffekt betreffenden Opazitäten<br />
auf die spiegelverkehrten Proofvorschauen <strong>der</strong> aktuellen Seite angewendet werden. Die hieraus<br />
resultierenden Bil<strong>der</strong> müssen dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Schritt über die Proofvorschauen <strong>der</strong><br />
weißen Rückseite gelegt werden.<br />
Erst jetzt können auf diese den Durchschlageffekt simulierenden Bil<strong>der</strong> die spiegelverkehrten<br />
Opazitätswerte des Durchsche<strong>in</strong>effektes angewendet werden.<br />
64
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Zur Opazitätssimulation <strong>der</strong> Vor<strong>der</strong>seite e<strong>in</strong>es beidseitig bedruckten Blatt <strong>Papier</strong>s müssen<br />
zunächst die den Durchschlageffekt betreffenden Opazitätswerte <strong>in</strong> Abhängigkeit da<strong>von</strong>, ob die<br />
aktuelle Seitenzahl gerade o<strong>der</strong> ungerade ist, auf die spiegelverkehrten Proofvorschauen <strong>der</strong><br />
vorherigen bzw. nachfolgenden Seite angewendet werden. Die hieraus resultierende Bil<strong>der</strong><br />
können nun auf die jeweiligen Proofvorschauen <strong>der</strong> aktuellen Seite gelegt werden. Auf diese<br />
den Durchschlageffekt simulierenden Bil<strong>der</strong> können nun die den Durchsche<strong>in</strong>effekt betreffende<br />
Opazitäten angewendet werden.<br />
Sollte es sich bei <strong>der</strong> aktuellen Seite um die letzte Seite e<strong>in</strong>es Dokumentes handeln, <strong>und</strong> hat<br />
diese e<strong>in</strong>e ungerade Seitenzahl, so s<strong>in</strong>d für die <strong>Simulation</strong> des Durchschlageffektes anstatt <strong>der</strong><br />
Proofvorschauen <strong>der</strong> nachfolgenden Seite die Proofvorschauen <strong>der</strong> weißen Rückseite zu<br />
verwenden.<br />
Bis zu diesem Punkt des Workflows wurde <strong>der</strong> Durchschlageffekt sowohl beim e<strong>in</strong>seitigen als<br />
auch beim beidseitigen Druck simuliert. Der Durchsche<strong>in</strong>effekt ist jedoch trotz Anwendung <strong>der</strong><br />
Opazitäten noch nicht vollständig simuliert, da die nachfolgenden Blätter noch nicht durch das<br />
Betrachtete h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>t.<br />
Um dies zu simulieren, muss für alle Seiten e<strong>in</strong>es Objektes die <strong>Simulation</strong> des<br />
Durchschlageffekts sowie die Anwendung <strong>der</strong> Opazität des Durchsche<strong>in</strong>effektes abgeschlossen<br />
se<strong>in</strong>. Erst dann ist es möglich, die e<strong>in</strong>zelnen Blätter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Reihenfolge übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> zu legen,<br />
sodass die jeweils nachfolgenden Seiten, durch das aktuell betrachtete Bild h<strong>in</strong>durch sche<strong>in</strong>en,<br />
wie es auch bei <strong>der</strong> Betrachtung des Druckerzeugnisses passieren würde.<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Opazitätsimulation<br />
Wurden, wie oben beschrieben, die zu simulierenden Opazitäten berechnet, so kann dessen<br />
nachfolgende <strong>Simulation</strong> durch Anwendung <strong>der</strong> Opazitätswerte auf die Bil<strong>der</strong> sowie dessen<br />
Überlagerung sowohl serverseitig als auch clientseitig durchgeführt werden, wobei Letzteres<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> clientseitig verwendeten <strong>und</strong> <strong>in</strong> Kap. 3.4 erläuterten Technologie abhängt.<br />
Auch die Umsetzung <strong>der</strong> serverseitigen <strong>Simulation</strong> kann sich abhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> verwendeten<br />
Bildbearbeitungssoftware unterscheiden, weshalb sich das nachfolgende Konzept zur<br />
serverseitigen Umsetzung <strong>der</strong> Opazitätssimulation auf die Verwendung des Bildbearbeitungsprogramms<br />
„ImageMagick“ beziehen <strong>und</strong> sich deshalb evtl. nur teilweise o<strong>der</strong> sogar gar nicht<br />
auf die Verwendung e<strong>in</strong>er an<strong>der</strong>en Bildbearbeitungssoftware übertragen lassen.<br />
Wird „ImageMagick“ verwendet, so können aus den berechneten Opazitäten sogenannte<br />
Masken erstellt werden. Hierbei handelt es sich um Bilddateien mit Grauskala-Farbraum, bei<br />
dem die Schattierungen <strong>von</strong> Schwarz bis Weiß die Opazitätswerte <strong>von</strong> 0% bis 100 %<br />
repräsentieren. E<strong>in</strong>e Maske kann dadurch als e<strong>in</strong>e Bilddatei verstanden werden, die lediglich<br />
den Alpha-Kanal darstellt.<br />
Wird e<strong>in</strong>e Maske auf e<strong>in</strong> Bild angewendet, werden das Bild <strong>und</strong> <strong>der</strong> Alpha-Kanal zu e<strong>in</strong>er neuen<br />
Bilddatei zusammengeführt. Da das Zielformat den Alpha-Kanal unterstützen muss, muss<br />
entwe<strong>der</strong> das TIFF o<strong>der</strong> das PNG-Format verwendet werden, wobei <strong>in</strong> diesem Anwendungsfall<br />
aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Verwendbarkeit <strong>in</strong> Internetanwendungen, das PNG-Format zu wählen ist.<br />
65
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Durch die Berechnung <strong>der</strong> Opazitätswerte entstehen so für jede Seite e<strong>in</strong>es Objektes <strong>in</strong>sgesamt<br />
fünf Masken, wobei drei Masken <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> beim e<strong>in</strong>seitigen Druck <strong>und</strong> zwei Masken <strong>der</strong><br />
<strong>Simulation</strong> beim beidseitigen Druck dienen. Diese Masken können, <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>in</strong> Kap. 3.3.2.2<br />
beschrieben Vorgehensweise, auf die Proofbildvorschauen bzw. auf die gespiegelten<br />
Proofbildvorschauen angewendet werden. Die anschließende Überlagerung <strong>der</strong> so entstanden<br />
Bil<strong>der</strong> kann durch e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Bildkomposition erfolgen.<br />
3.3.3 Workflowdurchführung<br />
Betrachtet man den gesamten Workflow, so fällt auf, dass <strong>in</strong> dessen Verlauf zahlreiche<br />
prozessorlastige Bildkonvertierungen durchgeführt werden. Die Abb. 3.3.1 zeigt dies anhand<br />
<strong>von</strong> Zwischenergebnissen, die während <strong>der</strong> Durchführung des Workflows entstehen.<br />
Abb. 3.3.1 Workflowdarstellung<br />
66
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Wegen dieser Prozessorlastigkeit kann e<strong>in</strong> solcher Workflow aus Performancegründen<br />
selbstverständlich nicht erst bei clientseitigen Anfragen, son<strong>der</strong>n muss beim E<strong>in</strong>stellen <strong>der</strong><br />
Bil<strong>der</strong> <strong>und</strong> Dokumente <strong>in</strong> das System angestoßen werden. Der e<strong>in</strong>zige Teilworkflow, <strong>der</strong> auf<br />
e<strong>in</strong>e clientseitige Anfrage h<strong>in</strong> gestartet werden muss, ist <strong>der</strong> Fall, dass <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> die<br />
Vorschauen zu e<strong>in</strong>em Objekt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>von</strong> ihm hochgeladenen ICC-Profil angezeigt bekommen<br />
möchte. In e<strong>in</strong>em solchen Fall müssen die folgenden Bestandteile des Gesamtworkflows unter<br />
Verwendung des hoch geladenen ICC-Profils ausgeführt werden:<br />
– Vorschauberechnung des Objektes, sofern dieses nicht bereits separiert ist<br />
– Vorschauberechnung <strong>der</strong> separierten TIFF-Dateien<br />
– Vorschauberechnung <strong>der</strong> Proofbil<strong>der</strong><br />
– <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität durch Anwendung <strong>der</strong> bereits vorhandenen Opazitäten auf<br />
die Proofbil<strong>der</strong> sowie dessen anschließende Bildkomposition<br />
3.3.4 Workflowsteuerung<br />
Wird e<strong>in</strong> Objekt zur Eigenschaftensimulation <strong>in</strong> das System e<strong>in</strong>gestellt, so benötigt das System<br />
weitere Informationen anhand denen <strong>der</strong> zu durchlaufende Workflow gesteuert werden kann.<br />
Die vom System benötigten Informationen lassen sich unterteilen <strong>in</strong><br />
– Objektbezogene Informationen,<br />
– Informationen zur Druckbed<strong>in</strong>gung <strong>und</strong><br />
– Informationen zur Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong>.<br />
Objektbezogene Informationen<br />
Die objektbezogenen Informationen werden vom System dazu verwendet, um die auf das<br />
jeweilige Objekt abgestimmten Prozesse <strong>und</strong> Teilprozesse zu verwenden. Hierzu zählen<br />
Informationen zum Typ <strong>und</strong> den Eigenschaften des Objekts sowie die für die <strong>Simulation</strong> zu<br />
verwendende Druckbed<strong>in</strong>gung. Weitere Informationen wären z.B. konkrete Angaben zur<br />
Auswahl bestimmter namentlich festgelegter Prozesse <strong>und</strong> Teilprozesse.<br />
Während das System durch e<strong>in</strong>e Analyse des Objektes Informationen zu dessen Typ <strong>und</strong><br />
zum<strong>in</strong>dest auch e<strong>in</strong>en Teil se<strong>in</strong>er Eigenschaften selbstständig ermitteln kann, so s<strong>in</strong>d die<br />
Informationen zu den zu verwendenden Druckbed<strong>in</strong>gungen sowie Angaben zur Prozessauswahl<br />
<strong>von</strong> außen bereitzustellen. Da die Art <strong>der</strong> Informationsbereitstellung ke<strong>in</strong>erlei konzeptionellen<br />
E<strong>in</strong>schränkungen unterliegt, kann dies z.B. über e<strong>in</strong>e Datenbank o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e XML-Datei erfolgen.<br />
Denkbar ist aber auch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>bettung <strong>der</strong> Informationen als Meta<strong>in</strong>formation <strong>in</strong> die Datei selbst<br />
was z.B. über Adobes Extensible Metadata Platform (kurz: XMP) realisierbar wäre. Mehr<br />
Informationen zu XMP s<strong>in</strong>d unter http://www.adobe.com/products/xmp/(Stand 25.03.09)<br />
verfügbar.<br />
67
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Zur Veranschaulichung <strong>der</strong> bereitzustellenden, objektbezogenen Informationen zeigt das<br />
folgende Beispiel anhand e<strong>in</strong>er XML-Datei, welche für zwei <strong>in</strong> das System e<strong>in</strong>gestellte Objekte<br />
Informationen darüber be<strong>in</strong>haltet, welche Eigenschaften diese Objekte haben, welche<br />
Druckbed<strong>in</strong>gungen jeweils simuliert werden, <strong>und</strong> welche Prozesse <strong>und</strong> CMMs dazu verwendet<br />
werden soll.<br />
Beispiel 6<br />
<br />
<br />
<br />
data/Images/Beispielbild.tif<br />
<br />
profiles/AdobeRGB1998.icc<br />
<br />
<br />
pr<strong>in</strong>terprofiles/Canon_iP4200_OfficePlus.icm<br />
pr<strong>in</strong>terprofiles/Canon_iP4200_OfficePlus.xml<br />
<br />
<br />
pr<strong>in</strong>terprofiles/ISOcoated_v2_eci.icc<br />
pr<strong>in</strong>terprofiles/ISOcoated_v2_eci.xml<br />
<br />
<br />
<br />
data/Dokumente/UPB_W<strong>in</strong>fo_2008_FINAL.pdf<br />
<br />
<br />
<br />
pr<strong>in</strong>terprofiles/Canon_iP4200_OfficePlus.icm<br />
pr<strong>in</strong>terprofiles/Canon_iP4200_OfficePlus.xml<br />
<br />
<br />
<br />
Informationen zur Druckbed<strong>in</strong>gung<br />
Hierzu zählt zum E<strong>in</strong>en das ICC-Profil mit dem die Farbgebung simuliert wird <strong>und</strong> zum<br />
An<strong>der</strong>en das unter <strong>der</strong> Druckbed<strong>in</strong>gung ermittelte Opazitätsprofil zur Berechnung <strong>der</strong> zu<br />
simulierenden Opazitätswerte.<br />
Während das ICC-Profil dem System selbstverständlich als Datei vorliegen muss, gibt es für das<br />
Opazitätsprofil ke<strong>in</strong>e Vorgaben. Es bietet sich jedoch die Verwendung e<strong>in</strong>er XML-Datei an, da<br />
diese auf e<strong>in</strong>fache Weise auch <strong>in</strong> an<strong>der</strong>en Systemen wie<strong>der</strong>verwendet werden kann. Im Anhang<br />
B - Beispiel B.1 ist e<strong>in</strong> denkbarer Aufbau e<strong>in</strong>es Opazitätsprofils als XML-Datei aufgeführt.<br />
Informationen zur Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong><br />
Bei diesen Informationen handelt es sich um die vom System zu verwendenden<br />
Ausgabefarbräume, die <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es ICC-Profils vorliegen müssen.<br />
Zum E<strong>in</strong>en muss im System m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> ICC-Profile als Ausgabefarbraum h<strong>in</strong>terlegt se<strong>in</strong>,<br />
die <strong>der</strong> Workflow standardmäßig zur Vorschaugenerierung verwendet.<br />
Zum An<strong>der</strong>en können vom Anwen<strong>der</strong> ICC-Profile hochgeladen werden, wodurch die<br />
Ausführung e<strong>in</strong>zelner Teile des Workflows angestoßen wird.<br />
68
3.4 Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong><br />
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Für e<strong>in</strong>e farbtreue Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> stehen die drei Webtechnologien HTML,<br />
JavaApplets <strong>und</strong> Adobe Flex zur Verfügung, da für diese webbasierenden Technologien <strong>in</strong> Kap<br />
2.3 e<strong>in</strong>e Farbmanagementunterstützung verifiziert werden konnte.<br />
Je nach verwendeter Technologie stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung <strong>der</strong><br />
<strong>Simulation</strong> zur Verfügung, die im Folgenden erläutert werden. Unabhängig da<strong>von</strong>, mit welcher<br />
Technologie die <strong>Simulation</strong> auch dargestellt wird, so sollte <strong>der</strong> H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em neutralen<br />
Farbton gehalten se<strong>in</strong>, sodass das Farbwahrnehmung des Betrachters nicht verfälscht wird.<br />
Üblicherweise, wie auch bei Photoshop, wird hierzu e<strong>in</strong> Grauton mit mittlerer Helligkeit<br />
verwendet.<br />
HTML<br />
Soll die <strong>Simulation</strong> durch das -Tag <strong>in</strong> HTML dargestellt werden, so stehen 2<br />
Möglichkeiten zur Verfügung. Bei <strong>der</strong> Ersten wird das simulierende Bild e<strong>in</strong>fach im HTML<br />
referenziert. Das vom Server „gelieferte“ Bild muss dabei zur <strong>Simulation</strong> des<br />
Durchsche<strong>in</strong>effektes durch Bildkomposition alle nachfolgenden Seiten berücksichtigen.<br />
Bei <strong>der</strong> zweiten Variante wird die Bildkomposition zur <strong>Simulation</strong> des Durchsche<strong>in</strong>effektes <strong>der</strong><br />
nachfolgenden Seiten nicht serverseitig durchgeführt, son<strong>der</strong>n durch die Verwendung <strong>von</strong><br />
Ebenen <strong>in</strong> HTML. Dies kann durch die Verwendung des HTML Block-Elementes unter<br />
Verwendung des CSS-Attribut „<strong>in</strong>dex-z“ realisiert werden. Hierzu muss sowohl das Bild <strong>der</strong><br />
aktuellen Seite als auch die <strong>der</strong> nachfolgenden Seiten je <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em -Element plaztiert <strong>und</strong><br />
dann unter Verwendung des <strong>in</strong>dex-z <strong>in</strong> <strong>der</strong> richtigen Reihenfolge übere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gelegt werden.<br />
[SH1]<br />
Durch zur Hilfenahme <strong>von</strong> JavaScript-Funktionalitäten kann weiter e<strong>in</strong>e Blätterfunktion<br />
implementiert werden, die es erlaubt, ohne Neuladen <strong>der</strong> gesamten Seite <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mehrseitigen<br />
Dokument zu blättern.<br />
Die Verwendung dieser Technologie hat den Vorteil, das ke<strong>in</strong>e zusätzlich Software <strong>in</strong>stalliert<br />
werden muss <strong>und</strong> somit e<strong>in</strong>er breiten Masse <strong>von</strong> Anwen<strong>der</strong>n zugänglich ist.<br />
Negativ zu bewerten ist, dass <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> evtl. nicht über e<strong>in</strong>en farbmanagementfähigen<br />
Browser verfügt bzw. das bei <strong>der</strong> Verwendung des Internet Explorers lediglich Bil<strong>der</strong> im sRGB-<br />
Farbraum korrekt angezeigt werden.<br />
JavaApplet<br />
Mit JavaApplets kann nicht nur die volle Farbmanagementunterstützung vorgegeben, son<strong>der</strong>n<br />
durch die Verwendung <strong>der</strong> umfangreichen Java-Laufzeitumgebung auch zahlreiche<br />
Bildmanipulationen <strong>und</strong> Animationen durchgeführt werden.<br />
Hierdurch ist es möglich, Teile des serverseitigen Workflows auf die Clientseite zu verlagern<br />
<strong>und</strong> durch Animationen die <strong>Simulation</strong> noch realistischer aussehen zu lassen, wie z.B. e<strong>in</strong><br />
animiertes Blättern durch e<strong>in</strong> Dokument bei <strong>der</strong> beim Anheben e<strong>in</strong>es Blattes <strong>der</strong><br />
Durchsche<strong>in</strong>effekt auf die nachfolgenden Blätter ausgeblendet wird. E<strong>in</strong>e weitere<br />
Anwendungsmöglichkeit ist das sanfte E<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Ausblenden des durch die Opazität<br />
verursachten Durchschlag- <strong>und</strong> Durchsche<strong>in</strong>effektes.<br />
69
3. Konzept zur Eigenschaftensimulation<br />
Nachteil dieser Technologie ist, dass zur Darstellung die Java-Laufzeitumgebung auf dem Client<br />
benötigt wird <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Installation evtl. durch firmen<strong>in</strong>terne IT-Sicherheitrichtl<strong>in</strong>ien untersagt<br />
ist.<br />
Adobe Flex<br />
Mit Adobe Flex stehen zur Dartstellung ebenfalls zahlreiche Animationsmöglichkeiten zur<br />
Verfügung. Abb. 3.4.1 zeigt beispielhaft die Umsetzung e<strong>in</strong>er Blätteranimation e<strong>in</strong>es<br />
mehrseitigen Dokumentes die im Internet auf <strong>der</strong> Seite<br />
http://reach.<strong>in</strong>m.com/eLibrary/eLibrary.html (Stand 25.03.09) betrachtet werden kann.<br />
Außerdem bietet Adobe Flex die Möglichkeit e<strong>in</strong>er pixelgenauen Manipulation <strong>der</strong> Bilddaten<br />
mit <strong>der</strong> die Opazität zur Laufzeit mit sanften Übergängen e<strong>in</strong>- <strong>und</strong> ausgeblendet werden kann.<br />
[Ado1]<br />
E<strong>in</strong> Artikel zur Umsetzung <strong>von</strong> Bildanimationen <strong>und</strong> -manipulationen steht auf<br />
http://www.<strong>in</strong>si<strong>der</strong>ia.com/2008/03/image-manipulation-<strong>in</strong>-flex.html (Stand 23.03.09) zur<br />
Verfügung.<br />
Abb. 3.4.1 Blätteranimation mit Flex<br />
70
4. Prototypische Implementierung<br />
4.1 Serverseitige Implementierung<br />
Die serverseitige Implementierung des Prototypen ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Scriptsprache PHP 4 geschrieben<br />
<strong>und</strong> setzt den Workflow aus Kap. 3.3 <strong>in</strong>sofern um, als dass es durch manuelles Starten via Shell<br />
unter Angabe des Pfades e<strong>in</strong>er Bilddatei o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>es PDF Dokumentes die Ausgabe auf e<strong>in</strong>em<br />
Drucker o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>er Druckmasch<strong>in</strong>e mit ICC-Profil im CMYK- o<strong>der</strong> RGB-Farbraum sowohl<br />
h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> farblichen Ersche<strong>in</strong>ung als auch den durch die Opazität des <strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Farbe entstehende Durchsche<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Durchdruckeffekt simuliert.<br />
Die Wahl <strong>der</strong> Scriptsprache PHP 4 zur prototypischen Implementierung wurde aus subjektiven<br />
Gründen gefällt. Gründe dafür s<strong>in</strong>d, dass ich mit <strong>der</strong> Sprache die meisten Programmiererfahrungen<br />
habe <strong>und</strong> sich me<strong>in</strong>er Me<strong>in</strong>ung nach e<strong>in</strong>e Skriptsprache beson<strong>der</strong>s gut für e<strong>in</strong>e<br />
prototypische Implementierungen eignet. Der Prototyp wurde auf e<strong>in</strong>em L<strong>in</strong>uxsystem<br />
implementiert <strong>und</strong> verwendet folgende frei verfügbare Software, mit <strong>der</strong>en Versionen <strong>der</strong><br />
Prototyp erfolgreich getestet wurde:<br />
– PHP 4.3.9<br />
– Ghostscript 8.5.7<br />
– ImageMagick 6.4.2<br />
– tifficc v5.0(LittleCMS Tool zur Anwendung <strong>von</strong> ICC-Profilen auf TIFF-Dateien)<br />
– icc2ps v1.5 (LittleCMS Tool zum Erstellen <strong>von</strong> CRDs aus ICC-Profilen)<br />
Der Prototyp kann sämtliche <strong>von</strong> „ImageMagick“ unterstützen Bilddateiformate verarbeiten,<br />
sofern diese ke<strong>in</strong>e Eigenschaften haben, die e<strong>in</strong>er beson<strong>der</strong>en Handhabung bedürfen.<br />
(Stand 13.03.09, http://imagemagick.org/script/formats.php)<br />
Die Unterstützung <strong>der</strong> PDF-Dokumente ist abhängig <strong>von</strong> „Ghostscript“, wobei mir zum<br />
aktuellen Zeitpunkt ke<strong>in</strong>e Formatversionen bekannt s<strong>in</strong>d, die „Ghostscript“ nicht verarbeiten<br />
könnte. Erfolgreich getestet wurde <strong>der</strong> Prototyp mit den PDF-Versionen 1.4 <strong>und</strong> 1.6.. Beson<strong>der</strong>e<br />
Eigenschaften <strong>der</strong> Dokumente werden, wie auch bei den Bilddateien, nicht berücksichtigt.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Farbräume <strong>der</strong> zu verarbeitenden Objekte ist bei Bilddateien ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>bettung <strong>der</strong><br />
ICC-Profile notwendig, müssen aber <strong>in</strong> jedem Fall dem System als Profildatei zur Verfügung<br />
stehen. Bei PDF-Dokumenten verhält es sich aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> mangelnden Möglichkeit<br />
„Ghostscript“ anzuweisen zur Separierung bestimmte ICC-Profile zu verwenden, genau<br />
umgekehrt. Bei PDF-Dokumenten ist die E<strong>in</strong>bettung aller <strong>in</strong> ihnen enthaltenden Farbräume<br />
notwendig <strong>und</strong> muss dem System nicht explizit bekannt gemacht werden.<br />
71
4.1.1 Datei- <strong>und</strong> Verzeichnisstruktur<br />
4. Prototypische Implementierung<br />
In Abb. 4.1.1 ist die Verzeichnisstruktur des Prototypen abgebildet, <strong>in</strong> dessen Wurzelverzeichnis<br />
die Datei „ma<strong>in</strong>.php“ abgelegt ist.<br />
Abb. 4.1.1 Verzeichnisstruktur des serverseitigen Prototypen<br />
Im Unterverzeichnis „data“ werden alle Objekte abgelegt, für die die Druckbed<strong>in</strong>gung simuliert<br />
werden sollen. Dessen Unterstruktur ist frei wählbar, die Unterverzeichnisse „Dokumente“ <strong>und</strong><br />
„Images“ also nicht obligatorisch.<br />
Das Verzeichnis „previews“ enthält alle vom System generierten Vorschaubil<strong>der</strong> sowie die vom<br />
System zur späteren Verwendung generierten Bilddateien <strong>und</strong> Masken. Die Unterverzeichnisse<br />
werden vom System <strong>in</strong> <strong>der</strong> gleichen Struktur angelegt wie die des Verzeichnisses „data“.<br />
Das Verzeichnis „<strong>in</strong>cludes“ enthält diverse <strong>von</strong> <strong>der</strong> „ma<strong>in</strong>.php“ benötigte PHP-Dateien sowie<br />
das Verzeichnis „images“, <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>e Vorlage zum Erzeugen <strong>der</strong> weißen Rückseite h<strong>in</strong>terlegt<br />
ist.<br />
Das Verzeichnis „logs“ enthält lediglich e<strong>in</strong>e Ausgabedatei, <strong>in</strong> die die Shellausgaben <strong>der</strong><br />
verwendeten Fremdsoftware umgeleitet werden.<br />
In „pr<strong>in</strong>terprofiles“ s<strong>in</strong>d alle zu simulierenden Druckbed<strong>in</strong>gungen als ICC-Profil h<strong>in</strong>terlegt. Des<br />
Weiteren enthält es die kle<strong>in</strong>e Skriptdatei „generateCRDSet.php“, welches, wie <strong>der</strong> Name schon<br />
andeutet, aus e<strong>in</strong>er o<strong>der</strong> mehren bei <strong>der</strong> Ausführung angegeben ICC-Profilen mit Hilfe des Tools<br />
„icc2ps“ e<strong>in</strong>en Satz ColorRen<strong>der</strong><strong>in</strong>gDictionarys (kurz: CRD) erzeugt <strong>und</strong> im selben Verzeichnis<br />
ablegt.<br />
Im Verzeichnis „profiles“ s<strong>in</strong>d die ICC-Profile <strong>der</strong> gängigsten Arbeitsfarbräume sowie spezielle<br />
Monitorprofile enthalten. Diese Profile werden für die Farbraumtransformation bei<br />
unseparierten Objekten sowie als Ausgabefarbraum bei <strong>der</strong> Vorschaugenerierung verwendet.<br />
Auch hier ist das kle<strong>in</strong>e Skript „generateCRDSet.php“ h<strong>in</strong>terlegt. Weiter enthält das „profiles“-<br />
Verzeichnis das Unterverzeichnis „proof<strong>in</strong>g“, welches das ICC-Profil des <strong>von</strong> „LittleCMS“<br />
verwendeten L*a*b*-Farbraums enthält.<br />
Das „temp“-Verzeichnis wird vom System genutzt, um Zwischenergebnisse <strong>in</strong> Form <strong>von</strong><br />
Dateien zu h<strong>in</strong>terlegen. Nach dessen Verwendung werden Unterverzeichnisse <strong>und</strong> Dateien<br />
<strong>in</strong>nerhalb dieses Verzeichnisses automatisch wie<strong>der</strong> entfernt.<br />
72
4. Prototypische Implementierung<br />
Bei Ausführung des Prototypen wird im „previews“-Verzeichnis für das Objekt, für das die<br />
<strong>Simulation</strong> durchgeführt wird, e<strong>in</strong> gleichnamiges Verzeichnis <strong>in</strong> <strong>der</strong> gleichen<br />
Verzeichnisstruktur wie unter „data“ angelegt.<br />
Unterhalb dieses Objektverzeichnisses wird für jede zu simulierende Druckbed<strong>in</strong>gung e<strong>in</strong><br />
weiteres Unterverzeichnis angelegt. Die Namen <strong>der</strong> Verzeichnisse setzen sich dabei jeweils<br />
zusammen aus dem Namen des ICC-Profils ohne Date<strong>in</strong>amenserweiterung, dem verwendeten<br />
Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intent <strong>und</strong>, sofern die Tiefenkompensierung verwendet wird, das Kürzel „BPC“ als<br />
Abkürzung für „BlackPo<strong>in</strong>tCompensation“.<br />
Handelt es sich um e<strong>in</strong> unsepariertes Objekt, so wird zusätzlich das Verzeichnis „unseparated“<br />
angelegt. Unterhalb dieses Verzeichnisses wird e<strong>in</strong> Verzeichnis „previews“ angelegt, <strong>in</strong> dem<br />
wie<strong>der</strong>um für jeden Ausgabefarbraum e<strong>in</strong> Verzeichnis mit dem Namen des ICC-Profils angelegt<br />
wird <strong>und</strong> <strong>in</strong> dem jeweils die Vorschauen des unseparierten Objektes abgelegt werden.<br />
Unterhalb <strong>der</strong> Verzeichnisse <strong>der</strong> Druckbed<strong>in</strong>gung wird das Verzeichnis „work“ angelegt, <strong>in</strong>dem<br />
alle für e<strong>in</strong>e spätere Verwendung berechneten Bilddateien abgelegt wurden. Hierzu zählen die<br />
separierten Bil<strong>der</strong> <strong>in</strong>klusive die generierte weiße Rückseite, <strong>der</strong>en Proofbil<strong>der</strong>, sowie <strong>der</strong>en<br />
spiegelverkehrte Bil<strong>der</strong>. Außerdem wird das Verzeichnis „masks“ angelegt, welches die zur<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität verwendeten Masken enthält.<br />
Des Weiteren werden die Verzeichnisse „previews“, „proofs“ <strong>und</strong> „opacity“ angelegt, unterhalb<br />
denen jeweils für alle Ausgabefarbräume e<strong>in</strong> Verzeichnis angelegt wird <strong>und</strong> die alle zur<br />
Darstellung im Client benötigten Vorschauen enthalten. Das Verzeichnis „previews“ enthält die<br />
Vorschauen des separierten Objektes, das Verzeichnis „proofs“ die Vorschauen, <strong>in</strong> denen die<br />
Farbgebung simuliert wird <strong>und</strong> das Verzeichnis „opacity“ die Vorschauen, <strong>in</strong> denen sowohl<br />
Farbgebung als auch die Opazität simuliert wird. Abb. 4.1.2 zeigt e<strong>in</strong> Beispiel für e<strong>in</strong>e solche<br />
Verzeichnisstruktur, bei dem für das unseparierte PDF-Dokument „BeispielPDF.pdf“ zwei<br />
Druckbed<strong>in</strong>gungen simuliert wurden.<br />
Abb. 4.1.2 Beispiel für e<strong>in</strong>e erzeugte Verzeichnisstruktur<br />
73
4. Prototypische Implementierung<br />
Da durch diese Art <strong>der</strong> Datei- <strong>und</strong> Verzeichnisstruktur im nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> alle Bilddateien<br />
problemlos wie<strong>der</strong>gef<strong>und</strong>en werden können, ist für den Prototyp die Verwendung e<strong>in</strong>er<br />
Datenpersistenz nicht notwendig.<br />
4.1.2 Programmausführung<br />
Der Prototyp muss <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Wurzelverzeichnis unter Angabe <strong>der</strong> Objekte e<strong>in</strong>schließlichen<br />
<strong>der</strong>en relativen Pfaden ausgeführt werden. E<strong>in</strong>e beispielhafte Ausführung sieht wie folgt aus:<br />
/usr/b<strong>in</strong>/php ma<strong>in</strong>.php data/Dokumente/BeispielPDF.pdf<br />
Im ersten Schritt werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> „ma<strong>in</strong>.php“ die genauen Eigenschaften <strong>der</strong> Objekte, für die die<br />
<strong>Simulation</strong> durchgeführt werden soll, sowie die Details <strong>der</strong> zu simulierenden Druckbed<strong>in</strong>gungen<br />
geladen. Für das Laden dieser, zur Steuerung des Workflows benötigten, objektbezogenen<br />
Informationen (Siehe Kap.3.3.4) ist die Funktion „loadJobProperties()“ <strong>in</strong> <strong>der</strong> Skriptdatei<br />
„<strong>in</strong>cludes/Jobs.php“ zuständig.<br />
Diese gibt e<strong>in</strong> mehrdimensionales Array zurück, das Informationen darüber enthält, <strong>von</strong><br />
welchem Typ das Objekt ist, <strong>und</strong> ob es bereits separiert wurde o<strong>der</strong> nicht. Außerdem enthält es<br />
Informationen über jede für die jeweiligen Objekte zu simulierenden Druckbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong><br />
Form <strong>von</strong> Dateipfaden <strong>der</strong> zu verwendenden ICC-Profile sowie <strong>der</strong> zu verwendenden Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g<br />
Intents mit o<strong>der</strong> ohne Tiefenkomensation.<br />
Da bei diesem Prototyp ke<strong>in</strong>e Datenpersistenz verwendet wird, <strong>und</strong> auch das Auslesen <strong>und</strong><br />
Parsen <strong>von</strong> XML-Dateien e<strong>in</strong>gespart wurde, s<strong>in</strong>d alle Daten <strong>in</strong> <strong>der</strong> „Jobs.php“ selbst enthalten,<br />
<strong>in</strong> die auch weitere e<strong>in</strong>gepflegt werden können.<br />
Anhand diesen als „JobProperties“ bezeichneten Informationen wird nun <strong>in</strong> <strong>der</strong> „ma<strong>in</strong>.php“ <strong>der</strong><br />
gesamte Workflow <strong>von</strong> den Funktionen „processImage()“ für Bilddateien <strong>und</strong> „processPDF()“<br />
für PDF-Dokumente übernommen. Handelt es sich bei den, den Funktionen übergebenen<br />
Objekten um nicht separierte Objekte, so werden <strong>von</strong> diesen zunächst Vorschauen <strong>in</strong><br />
verschiedenen Ausgabefarbräumen generiert. Welche Farbräume bzw. welche ICC-Profile dazu<br />
verwendet werden, wird zuvor mit <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datei „<strong>in</strong>cludes/MonitorProfiles.php“ def<strong>in</strong>ierten<br />
Funktion „loadMonitorProfiles()“ abgefragt, die e<strong>in</strong> Array mit den Pfaden <strong>der</strong> zu verwendenden<br />
ICC-Profile zurück liefert.<br />
Die zu verwendenden ICC-Profile s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datei „<strong>in</strong>cludes/MonitorProfiles.php“ def<strong>in</strong>iert<br />
<strong>und</strong> können ohne Weiteres ergänzt werden.<br />
Zur Generierung <strong>der</strong> Vorschauen wird bei PDF-Dokumenten die Software „Ghostscript“ zur<br />
Rasterung verwendet sowie „ImageMagick“ zur weiteren Formatierung. Bei Bilddateien wird<br />
beides <strong>von</strong> „ImageMagick“ übernommen. Die Programme werden dabei durch Ausführung <strong>von</strong><br />
Kommandozeilenbefehlen durchgeführt, die mit PHP durch die Funktion „shell_exec()“<br />
ausgeführt werden können.<br />
Sowohl bei <strong>der</strong> „processImage()“ als auch bei <strong>der</strong> „processPDF()“ werden die im folgenden<br />
erläuterten Schritte bei bereits separierten Objekten nur e<strong>in</strong>mal durchgeführt <strong>und</strong> bei<br />
unseparierten Objekten für jede aus den „JobProperties“ bekannte zu simulierende<br />
Druckbed<strong>in</strong>gung.<br />
74
4. Prototypische Implementierung<br />
Der erste Schritt ist hier die Separierung <strong>und</strong> Formatierung <strong>der</strong> Bilddateien bzw. die Rasterung,<br />
Separierung <strong>und</strong> Formatierung <strong>der</strong> PDF-Dokumente. Bei Bilddateien wird dieses durch<br />
„ImageMagick“ durchgeführt <strong>und</strong> resultiert <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er separierten Bilddatei im TIFF-Format <strong>in</strong><br />
den für die Darstellung im Client benötigten Auflösungen <strong>und</strong> Maßen.<br />
Bei PDF-Dokumenten wird die Rasterung <strong>und</strong> Separierung sowie e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Formatierung<br />
durch „Ghostscript“ unter Verwendung <strong>der</strong> zuvor <strong>in</strong> „pr<strong>in</strong>terprofiles“ erzeugten CRDs<br />
durchgeführt. Für weitere Formatierungen wird dann wie<strong>der</strong>um „ImageMagick“ verwendet. Da<br />
e<strong>in</strong> PDF-Dokument evtl. mehr als nur e<strong>in</strong>e Seite hat, wird für jede Seite e<strong>in</strong>e eigene TIFF-Datei<br />
erzeugt, die im „work“-Verzeichnis des jeweiligen, vom Objektnamen <strong>und</strong> Druckbed<strong>in</strong>gung<br />
abhängigen, Pfades abgelegt werden.<br />
Eigentlich wäre bei bereits separierten Objekten ke<strong>in</strong>e Separierung mehr notwendig, da aber<br />
“Ghostscript“ sowie die Art <strong>in</strong> <strong>der</strong> hier „ImageMagick“ verwendet wird, dies notwendig macht,<br />
ist die Verwendung des relativ farbmetrischen Ren<strong>der</strong><strong>in</strong>g Intents ohne Tiefenkompensierung zur<br />
Erhaltung <strong>der</strong> Farbtreue obligatorisch.<br />
In den nächsten Schritten wird unter Verwendung <strong>von</strong> „ImageMagick“ jeweils die weiße<br />
Rückseite generiert, die separierten Bil<strong>der</strong> horizontal gespiegelt, <strong>und</strong> <strong>von</strong> jedem TIFF-Bild wird<br />
e<strong>in</strong> Proofbild im L*a*b*Farbraum erstellt. Da alle Bil<strong>der</strong> für e<strong>in</strong>e spätere Verwendung wie<strong>der</strong><br />
verwendet werden können, werden diese <strong>in</strong> dem „work“-Verzeichnis abgelegt.<br />
Im weiteren Schritt werden alle Bil<strong>der</strong> jeweils <strong>in</strong> die durch „loadMonitorProfiles()“ bekannten<br />
Ausgabefarbräume konvertiert. Für die Proofbil<strong>der</strong> wird dabei zur E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Farbtreue e<strong>in</strong>e<br />
relativ farbmetrische Transformation durchgeführt, woh<strong>in</strong>gegen bei den lediglich separierten<br />
Bil<strong>der</strong>n zusätzlich die Tiefenkompensierung durchgeführt wird.<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> für die Verwendung <strong>der</strong> Tiefenkompensation ist, dass das Bild ansonsten zu blass<br />
ersche<strong>in</strong>en würde, da das im Bild dargestellte <strong>Papier</strong>weiß zwar dem Weißpunkt des Farbraums<br />
entspricht, das tiefste Schwarz jedoch nicht dem Schwarzpunkt des Ausgabefarbraums<br />
entsprechen würde.<br />
Weiter werden die für die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität notwendigen Messwerte <strong>und</strong> Opazitätswerte<br />
geladen. Diese s<strong>in</strong>d für jede Druckbed<strong>in</strong>gung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datei<br />
„<strong>in</strong>cludes/Opacity<strong>Simulation</strong>Data.php“ h<strong>in</strong>terlegt <strong>und</strong> werden mit <strong>der</strong> Funktion<br />
„loadOpacity<strong>Simulation</strong>Data()“ abgerufen.<br />
Die Mess- <strong>und</strong> Opazitätsdaten werden zusammen mit den separierten Bil<strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Pfadangabe des „masks“-Verzeichnis an die Funktion „createOpacityMasks()“ übergeben. Diese<br />
ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datei „<strong>in</strong>cludes/Masks.php“ def<strong>in</strong>iert <strong>und</strong> erzeugt die Masken, mit <strong>der</strong> die Opazität<br />
simuliert wird, <strong>und</strong> legt diese im Verzeichnis „masks“ ab.<br />
Die Funktion „createOpacityMasks()“ liest hierzu zunächst, mit Hilfe <strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
„<strong>in</strong>cludes/Image.php“ def<strong>in</strong>ierten Funktion „readIMimagetxt()“, die Farbwerte aus den<br />
jeweiligen separierten Bil<strong>der</strong> als CMYK-Farbwerte aus. Liegt das separierte Bild im RGB-<br />
Farbraum vor, so werden diese, aus den <strong>in</strong> Kap. 3.2.3.2 erläuterten Gründen <strong>und</strong> mit <strong>der</strong><br />
ebenfalls <strong>in</strong> Kap.3.2.3.2 erläuterten Vorgehensweise, <strong>in</strong> CMYK-Farbwerte umgerechnet.<br />
Weiter wird, mit <strong>der</strong> <strong>in</strong> Kap. 3.2.3.1 <strong>und</strong> Kap. 3.2.3.2. erläuterten Vorgehensweise, für jeden<br />
Bildpunkt e<strong>in</strong> Opazitätswert errechnet, die als Masken zusammengefügt werden <strong>und</strong> als PNG-<br />
Datei im „masks“ abgelegt werden.<br />
75
4. Prototypische Implementierung<br />
Die nun vorliegenden Masken werden auf die jeweils im Ausgabefarbraum vorliegenden<br />
Proofbil<strong>der</strong> angewendet, um die Opazität zu simulieren. Die geschieht bei „processImage()“<br />
durch den Aufruf <strong>der</strong> ebenfalls <strong>in</strong> „<strong>in</strong>cludes/Masks.php“ def<strong>in</strong>ierten Funktion<br />
„composeMasksAndProofsForImages()“ <strong>und</strong> bei „processPDF()“ durch den Aufruf <strong>der</strong><br />
Funktion „composeOnesidedMasksAndProofsForPDFs()“ zur <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität beim<br />
e<strong>in</strong>seitigem Druck <strong>und</strong> zur <strong>Simulation</strong> beim beidseitigen Druck die Funktion<br />
„composeDoublesidedMasksAndProofsForPDFs()“.<br />
Während <strong>der</strong> Ausführung des serverseitigen Prototyps wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Shell ausgegeben, <strong>in</strong> welchem<br />
Teilprozess sich das Skript aktuell bef<strong>in</strong>det <strong>und</strong>, ob diese erfolgreich durchgelaufen o<strong>der</strong><br />
fehlgeschlagen s<strong>in</strong>d.<br />
4.2 Clientseitige Implementierung<br />
Bei dem prototypischen Client handelt es sich um zwei e<strong>in</strong>fache um JavaScript-Funktionalitäten<br />
ergänzte HTML-Seiten, die die serverseitig generierten Vorschaubil<strong>der</strong> anzeigen. Zur<br />
Betrachtung dieser Seiten sollte, zur korrekten farblichen Darstellung, e<strong>in</strong><br />
farbmanagementfähiger Browser sowie e<strong>in</strong> kalibrierter <strong>und</strong> profilierter Monitor verwendet<br />
werden. Sollte ke<strong>in</strong> farbmanagementfähiger Browser zur Verfügung stehen, ist <strong>der</strong> „Internet<br />
Explorer“ zu verwenden, sodass zum<strong>in</strong>dest die Vorschauen im sRGB-Farbraum farblich korrekt<br />
dargestellt werden können. (s. Kap 2.2.3 <strong>und</strong> Kap. 2.3)<br />
Während die „image.html“ dazu verwendet werden kann, Bil<strong>der</strong>vorschauen zu präsentieren, ist<br />
die „document.html“ durch e<strong>in</strong>e Blätterfunktion sowie e<strong>in</strong>er Funktion zum Wechsel <strong>der</strong> Ansicht<br />
zwischen e<strong>in</strong>seitigem <strong>und</strong> beidseitigem Druck für die Anzeige <strong>von</strong> Dokumentenvorschauen<br />
optimiert.<br />
Abb. 4.2.1 Anzeige <strong>der</strong> „image.html“<br />
76
4. Prototypische Implementierung<br />
In Abb. 4.2.1 wird die Anzeige e<strong>in</strong>er Bildvorschau mit <strong>der</strong> „image.html.“ dargestellt. Wie sofort<br />
auffällt, ist <strong>der</strong> H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, wie bei Photoshop, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mittelhellen Grauton gehalten.<br />
Funktionen betreffend verfügt die Seite über e<strong>in</strong> Auswahlfeld, mit dem zwischen den<br />
Vorschauen <strong>der</strong> verschieden <strong>in</strong> das System e<strong>in</strong>gestellten Bilddateien gewechselt werden kann.<br />
Mit e<strong>in</strong>em weiteren Auswahlfeld kann <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> die für das aktuell ausgewählte Objekt<br />
verfügbaren, simulierten Druckbed<strong>in</strong>gungen auswählen.<br />
Hierbei ist standardmäßig „not selected“ ausgewählt, wodurch die Vorschau des unseparierten<br />
Objektes angezeigt wird. Wählt <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Druckbed<strong>in</strong>gung aus, so wird die Vorschau<br />
des separierten Bildes angezeigt.<br />
Weiter hat <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> die Möglichkeit, sich die simulierte Farbgebung <strong>der</strong> aktuellen<br />
Druckbed<strong>in</strong>gung anzeigen zu lassen, <strong>in</strong>dem er die Checkbox „Color“ aktiviert. Durch die<br />
zusätzliche Aktivierung <strong>der</strong> Checkbox „Opacity“ wird darüber h<strong>in</strong>aus noch die simulierte<br />
Opazität angezeigt. Das Aktivieren <strong>der</strong> Opazität schließt die Farbsimulation mit e<strong>in</strong>, weshalb<br />
diese Checkbox „Color“, sofern nicht bereits aktiviert, ebenfalls mit aktiviert wird. Ist die<br />
Opazität aktiviert, so hat <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> weiter durch Anklicken des Bildes o<strong>der</strong> des Buttons<br />
unterhalb des Bildes die Möglichkeit sich die Rückseite des Objektes anzeigen zu lassen auf <strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Durchdruckeffekt dargestellt wird.<br />
In welchem Farbraum die Vorschauen angezeigt werden, kann <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> durch e<strong>in</strong> weiteres<br />
Auswahlfeld bestimmen. Zur Auswahl stehen <strong>der</strong>zeit <strong>der</strong> sRGB Farbraum, <strong>der</strong> auch<br />
standardmäßig ausgewählt ist, sowie <strong>der</strong> WideGamutRGB <strong>und</strong> e<strong>in</strong> speziell erstelltes<br />
Monitorprofil. Letzteres soll, genau wie die deaktivierte Uploadmöglichkeit, lediglich andeuten,<br />
dass <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er solchen Anwendung die Verwendung <strong>von</strong>, vom Anwen<strong>der</strong> hochgeladenen<br />
Monitorprofilen möglich se<strong>in</strong> sollte.<br />
Die Auswahlmöglichkeit „Onesided“ <strong>und</strong> „Doublesided“ ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> „image.html“ deaktiviert, da<br />
es sich nur um e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnes Objekt handelt, bei dem die Ansicht e<strong>in</strong>es beidseitigen Drucks<br />
nicht möglich ist.<br />
Die Anzeige <strong>der</strong> HTML-Seite „document.html“ ist, wie <strong>in</strong> Abb. 4.2.2 zu sehen, funktional <strong>und</strong><br />
visuell sehr ähnlich zur „image.html“. Bei <strong>der</strong> „document.html“ ist es jedoch noch zusätzlich<br />
möglich, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mehrseitigen Dokument zu blättern, <strong>in</strong>dem man auf die jeweilige Seite des<br />
Dokumentes klickt, o<strong>der</strong> aber die darunter liegenden Buttons verwendet. Des Weiteren ist hier<br />
die Option zur Betrachtung des e<strong>in</strong>seitigen bzw. beidseitigem Druck aktiviert, mit <strong>der</strong> zu jedem<br />
Zeitpunkt zwischen den Ansichten gewechselt werden kann.<br />
Um zu guter Letzt noch technisch auf den prototypischen Client e<strong>in</strong>zugehen, werden die<br />
JavaScript-Funktionalitäten dazu genutzt, aus den ausgewählten Optionen wie ausgewähltes<br />
Objekt, zu simulierende Druckbed<strong>in</strong>gung u.s.w e<strong>in</strong>en Dateipfad zusammen zu setzen, <strong>der</strong> den<br />
Dateipfaden <strong>der</strong> serverseitig generierten Vorschaubil<strong>der</strong>n entspricht, <strong>und</strong> dass diese<br />
Bilddateireferenzen bei e<strong>in</strong>er Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> ausgewählten Optionen dynamisch ausgetauscht<br />
werden.<br />
Da bei diesem Prototypen zum E<strong>in</strong>en auf die eigentlich notwendige Client-Server-<br />
Kommunikation verzichtet wurde <strong>und</strong> zum Zweiten beide Seiten lediglich die serverseitig<br />
generierten Vorschauen anzeigen müssen, s<strong>in</strong>d die im Prototypen zur Wahl stehenden<br />
Beispielbil<strong>der</strong> <strong>und</strong> -dokumente <strong>in</strong> den HTML-Seiten statisch festgelegt. Diese können aber ohne<br />
großen Aufwand ausgetauscht o<strong>der</strong> um weitere Bil<strong>der</strong> <strong>und</strong> Dokumente ergänzt werden.<br />
77
Abb. 4.2.2 Anzeige <strong>der</strong> „document.html“<br />
4.3 Die zu simulierenden Druckbed<strong>in</strong>gungen<br />
4. Prototypische Implementierung<br />
Im Prototyp s<strong>in</strong>d <strong>der</strong>zeit zwei simulierbare Druckbed<strong>in</strong>gungen h<strong>in</strong>terlegt. Bei <strong>der</strong> Ersten handelt<br />
es sich um die Ausgabe auf dem Desktop T<strong>in</strong>tenstrahldrucker „Canon Pixma ip4200“ unter<br />
Verwendung des <strong>Papier</strong>s „Office Plus“. Bei <strong>der</strong> zweiten Druckbed<strong>in</strong>gung handelt es sich um<br />
e<strong>in</strong>en standardisierten Offsetdruck nach „ISO 12647-2:2004/Amd 1“ (Stand 16.03.09,<br />
http://www.eci.org/doku.php?id=de:downloads)<br />
Während für die zweite Druckbed<strong>in</strong>gung das frei verwendbare ICC-Profil<br />
„ISOcoated_v2_eci.icc“ <strong>der</strong> ECI verwendet wird, wurde bei <strong>der</strong> ersten Druckbed<strong>in</strong>gung die<br />
Komb<strong>in</strong>ation aus <strong>Papier</strong> <strong>und</strong> Drucker mit Hilfe des Spektralphotometers „ColorMunki Photo“<br />
des Herstellers „X-Rite“ profiliert <strong>und</strong> liegt unter dem Namen „Canon_iP4200_OfficePlus.icm“<br />
vor.<br />
Zur Profilierung wurde den Anweisungen <strong>der</strong> Profilierungssoftware folgend zunächst e<strong>in</strong><br />
Messchart mit 50 farbigen Messfel<strong>der</strong>n ausgedruckt, welches nach e<strong>in</strong>er vorgegebenen<br />
Trocknungszeit mit dem Spektralphotometer vermessen werden konnte. Im Anschluss folgte <strong>der</strong><br />
Ausdruck e<strong>in</strong>es weiteren, aus 50 farbigen Messfel<strong>der</strong>n bestehenden Messcharts, das lt. Software<br />
aus den Ergebnissen <strong>der</strong> ersten Messung errechnet wurde. Dieses konnte wie<strong>der</strong>um nach e<strong>in</strong>er<br />
vorgegebenen Trocknungszeit vermessen werden. Nach Abschluss <strong>der</strong> Messung wurde <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Software das ICC-Profil generiert.<br />
Für die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität wurde auf dem „Canon Pixma ip4200“ e<strong>in</strong> mit je 8<br />
Tonwertstufen je Druckfarbe versehendes Messchart (s. Abb. 3.2.4) <strong>in</strong>sgesamt 4 mal<br />
ausgedruckt. Mit dem Spektralphotometer „ColorMunki“ wurde <strong>der</strong> L*a*b*-Farbwert jedes <strong>der</strong><br />
<strong>in</strong>sgesamt 128 Messfel<strong>der</strong> jeweils 2 mal längs <strong>und</strong> 2 mal quer zur Faserrichtung des <strong>Papier</strong>s auf<br />
e<strong>in</strong>em aus mehr als 20 Blatt bestehenden <strong>Papier</strong>stapel gemessen.<br />
78
4. Prototypische Implementierung<br />
Gleiches wurde mit <strong>der</strong> bedruckten Seite nach unten <strong>und</strong> e<strong>in</strong> weiteres Mal mit <strong>der</strong> bedruckten<br />
Seite nach oben auf e<strong>in</strong>em als Hohlkörper verwendeten schwarzen Kartonpapier wie<strong>der</strong>holt.<br />
Zudem wurde <strong>der</strong> L*a*b*-Farbwert des <strong>Papier</strong>s auf e<strong>in</strong>em Stapel <strong>Papier</strong> sowie auf dem<br />
schwarzen Kartonpapier gemessen. Auch hier wurden bei 4 verschiedenen Blättern jeweils 4<br />
Stellen 2 mal längs <strong>und</strong> 2 mal quer zur Faserrichtung gemessen. Abschließend wurde auch <strong>der</strong><br />
Farbwert des schwarzen Kartonpapiers nach dem gleichen Pr<strong>in</strong>zip <strong>in</strong>sgesamt 32 mal gemessen.<br />
Aus den Messwerten wurde jeweils <strong>der</strong> L*-Wert <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Excel-Tabelle übertragen <strong>in</strong> <strong>der</strong> die<br />
Mittelwerte errechnet wurden, <strong>und</strong> aus denen gemäß <strong>der</strong> Formel 3.2.2.4 die Opazitäten<br />
errechnet werden konnten. In Anhang C s<strong>in</strong>d die Messwerte, Mittelwerte <strong>und</strong> Opazitäten<br />
aufgeführt.<br />
Die errechneten Opazitäten wurden e<strong>in</strong>er manuellen Korrektur unterzogen, bei <strong>der</strong> die<br />
Opazitäten, die größer als 100% s<strong>in</strong>d, auf 100% abger<strong>und</strong>et wurden. Diese „falschen“<br />
Opazitäten s<strong>in</strong>d mit leichten Abweichungen bei den Messungen zu erklären, bei denen <strong>der</strong><br />
gemessene Helligkeitswert L* e<strong>in</strong>es Messfeldes auf dem schwarzen Kartonpapier heller waren<br />
als die Messung des selben Messfeldes auf e<strong>in</strong>em Stapel <strong>Papier</strong>. Dies tritt aber lediglich bei<br />
Messfel<strong>der</strong>n auf, die fast o<strong>der</strong> vollständig opak s<strong>in</strong>d.<br />
Des Weiteren wurden Opazitäten korrigiert, die offensichtlich unlogisch s<strong>in</strong>d. Diese s<strong>in</strong>d bei den<br />
sehr hellen <strong>und</strong> rückseitig gemessenen Messfel<strong>der</strong>n aufgetreten <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d, wie <strong>in</strong> Kap. 3.2.2.6<br />
bereits erläutert, bed<strong>in</strong>gt durch den ger<strong>in</strong>gen Helligkeitsunterschied zwischen dem Messfeld <strong>und</strong><br />
dem <strong>Papier</strong>. Die Opazitäten s<strong>in</strong>d deswegen unlogisch, da bei e<strong>in</strong>er abnehmend aufgedruckten<br />
Farbmenge die durch den Durchdruckeffekt verursachte „reduzierte“ <strong>Papier</strong>opazität nicht<br />
größer, wie eigentlich zu erwarten wäre, son<strong>der</strong>n kle<strong>in</strong>er wird. Diese Werte wurden durch<br />
subjektive Schätzwerte korrigiert.<br />
Die gemessenen L*-Werte sowie die korrigierten Opazitäten wurden zur Verwendung im<br />
Prototypen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Datei „<strong>in</strong>cludes/Opacity<strong>Simulation</strong>Data.php“ h<strong>in</strong>terlegt. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
wurden die Werte zu Demonstrationszwecken für die Druckbed<strong>in</strong>gung „ISOcoated v2 (ECI)“<br />
übernommen, da für diese ke<strong>in</strong>e Messcharts zur Verfügung standen.<br />
79
5. <strong>Simulation</strong>squalität<br />
Die Qualität <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> lässt sich differenzieren <strong>in</strong> die Qualität <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong><br />
farblichen Ersche<strong>in</strong>ung, die <strong>in</strong> Kap. 5.1 untersucht wird, sowie auf die Qualität <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong><br />
<strong>der</strong> Opazität, die Gegenstand des Kap.5.2 ist.<br />
5.1 Qualität <strong>der</strong> Farbsimulation<br />
Das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild e<strong>in</strong>es Druckerzeugnisses kann mit Hilfe des Softproof-Konzept<br />
farbverb<strong>in</strong>dlich simuliert werden. [FO08]<br />
Dies gilt nicht nur für Desktopanwendungen, son<strong>der</strong>n, wegen den verfügbaren<br />
farbmanagementunterstützenden Webtechnologien , auch für Webapplikationen.<br />
Ob e<strong>in</strong>e <strong>Simulation</strong> farbverb<strong>in</strong>dlich ist o<strong>der</strong> nicht, hängt hierbei lei<strong>der</strong> nicht nur <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Durchführung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> selbst ab, son<strong>der</strong>n auch <strong>von</strong> Faktoren auf die das System lei<strong>der</strong><br />
entwe<strong>der</strong> nur begrenzt o<strong>der</strong> sogar ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss nehmen kann.<br />
Rasterung <strong>und</strong> Separierung<br />
Für e<strong>in</strong>e farbverb<strong>in</strong>dliche systemseitige Durchführung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> ist e<strong>in</strong>e hochwertige<br />
Separierung des Dokumentes o<strong>der</strong> des Bildes <strong>in</strong> den Ausgabefarbraum, sowie für Dokumente<br />
e<strong>in</strong>e hochwertige Rasterung notwendig.<br />
Während zur Beurteilung <strong>der</strong> Qualität e<strong>in</strong>er Rasterung die verwendete Seitenbeschreibungsprache<br />
verwendet werden kann ist die Bewertung <strong>der</strong> Separationsqualität<br />
schwieriger. Zum E<strong>in</strong>en kann hier zwar als Maß sicherlich die Präzision <strong>der</strong><br />
Farbwertumrechnung <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> beiden Farbräumen enthaltenden Farbwerten sowie die<br />
verwendete Schwarzaufbaumethode (s. E<strong>in</strong>schub zur Umrechnung <strong>von</strong> RGB- <strong>in</strong> CMYK-<br />
Farbwerte <strong>in</strong> Kap. 3.2.3.1) verwendet werden. Zum An<strong>der</strong>en gibt es aber ke<strong>in</strong> Maß für die<br />
Umrechnung <strong>von</strong> den, nicht im Zielfarbraum enthaltenden, Farbwerten. Bei Letzterem kann die<br />
Qualität also nur subjektiv beurteilt werden.<br />
Da das <strong>in</strong> dieser Arbeit vorgestellte Konzept sowohl die Verwendung des RIPs als auch die<br />
Verwendung des CMMs freistellt ist die Qualität somit abhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong>, bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
des Konzeptes, verwendeten Software.<br />
Die Qualtität <strong>der</strong> Rasterung <strong>und</strong> Separierung des, im Rahmen dieser Arbeit erstellten<br />
Prototypen, wurde nicht umfassend untersucht. Jedoch lieferte das für die Rasterung im<br />
Prototypen verwendete RIP „Ghostscript“ subjektiv gute Ergebnisse, was <strong>von</strong> <strong>der</strong> Tatsache, dass<br />
die Verwendung <strong>von</strong> „Ghostscript“ sehr weit verbreitet ist, untermauert wird. Auch die<br />
verwendeten CMMs liefern subjektiv gute Ergebnisse die sich im Vergleich zu den Ergebnissen<br />
an<strong>der</strong>er CMMs nur ger<strong>in</strong>gfügig unterscheiden. (s. Kap 2.2.1.3)<br />
Formatierung<br />
Weiter ist für e<strong>in</strong>e farbverb<strong>in</strong>dliche <strong>Simulation</strong> bei <strong>der</strong> systemseitigen Durchführung auf<br />
jegliche Art <strong>von</strong> Formatierungen zu verzichten, welche e<strong>in</strong>en Verlust <strong>von</strong> Farb<strong>in</strong>formationen zur<br />
Folge hätten. Hierzu zählen sicherlich Formatierungen die die Auflösung die Maße <strong>und</strong> die<br />
Qualität e<strong>in</strong>es Bildes verän<strong>der</strong>n.<br />
80
5. <strong>Simulation</strong>squalität<br />
Das vorgestellte Konzept gibt ke<strong>in</strong>erlei Formatierungen vor <strong>und</strong> empfiehlt diese nur für die<br />
<strong>Simulation</strong> <strong>in</strong> Vorschaubil<strong>der</strong>n bei denen sicherlich ke<strong>in</strong> Anspruch auf Farbverb<strong>in</strong>dlichkeit<br />
besteht. Trotz <strong>der</strong> im Prototyp verwendeten Formatierungen liefert dieser Vorschaubil<strong>der</strong> <strong>in</strong><br />
denen das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild subjektiv gut simuliert wird.<br />
ICC-Profil<br />
Die Qualität <strong>der</strong> ICC-Profile <strong>der</strong> Druckers o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Druckmasch<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d ebenfalls<br />
entscheidend für die Qualtität <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong>, wobei hierauf aber nur bed<strong>in</strong>gt E<strong>in</strong>fluss<br />
genommen werden kann. Hierbei ist natürlich die Qualtität e<strong>in</strong>es professionell erstellten ICC-<br />
Profil für Druckmasch<strong>in</strong>en wesentlich besser als die e<strong>in</strong>es profilierten Desktop-Druckers.<br />
Darstellung auf dem Monitor<br />
Während die zu verwendende Technologie zur Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong><br />
Farbmanagementunterstützung noch durch das System vorgegeben werden kann (siehe<br />
Kap.3.4), so ist dennoch nicht zu gewährleisten, dass <strong>der</strong> Endanwen<strong>der</strong> über e<strong>in</strong>en präzise<br />
kalibrierten <strong>und</strong> profilierten Monitor verfügt, <strong>der</strong> alle im Bild o<strong>der</strong> Dokument enthaltenden<br />
Farben darstellen kann.<br />
5.2 Qualität <strong>der</strong> Opazitätssimulation<br />
Entscheidend für die Qualität <strong>der</strong> Opazitätssimulation ist im wesentlichen <strong>der</strong> Aufwand mit dem<br />
das Opazitätsprofil erstellt wird, d.h. zum E<strong>in</strong>en mit welcher Präzision die zur Bestimmung <strong>der</strong><br />
Opazität notwendigen Messwerte ermittelt werden <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>en das Verfahren, mit denen<br />
aus den Messwerten dann, die als Referenz verwendeten Opazitäten bestimmt werden (siehe<br />
Kap. 3.2.2)<br />
Des Weiteren hängt die Qualität auch da<strong>von</strong> ab, ob es sich bei dem Drucker o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Druckmasch<strong>in</strong>e um e<strong>in</strong> Gerät handelt, bei denen die verwendeten Druckfarben den im ICC-<br />
Profil verwendeten Farbkanälen entspricht. Wie <strong>in</strong> Kap. 3.2.3 erläutert entstehen bei <strong>der</strong><br />
<strong>Simulation</strong> bei CMYK-Druckern die e<strong>in</strong> RGB-Farbprofil verwenden, Ungenauigkeiten durch<br />
die Umrechnung <strong>der</strong> RGB-Farbwerte <strong>in</strong> CMYK-Farbwerte sowie durch die nicht klare<br />
Trennung <strong>der</strong> Druckfarben im Messchart.<br />
Trotz <strong>der</strong> Wahl des, <strong>in</strong> den sehr hellen Farbbereichen, ungenaueren Verfahrens <strong>der</strong><br />
Opazitätsbestimmung mit dem Helligkeitswert L* bei e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> den CMYK-Farben druckenden<br />
Desktop-Druckers mit e<strong>in</strong>em RGB-Farbprofil (siehe Kap 4.3) ist die <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität<br />
durch den Prototypen im direkten Vergleich mit e<strong>in</strong>em Ausdruck des simulierten Bildes o<strong>der</strong><br />
Dokumentes subjektiv gut.<br />
Hieraus lässt sich e<strong>in</strong> verbesserte <strong>Simulation</strong>squalität, bei <strong>der</strong> Wahl des genaueren Verfahrens<br />
zur Bestimmung <strong>der</strong> Opazität mit dem L*a*b*-Farbwert sowie die <strong>Simulation</strong>en bei e<strong>in</strong>em<br />
CMYK-Drucker/Druckmasch<strong>in</strong>e mit CMYK-Farbprofil, ableiten.<br />
81
6. Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick<br />
Im Verlauf dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass sowohl das farbliche Ersche<strong>in</strong>ungsbild als<br />
auch <strong>der</strong> durch die Opazität entstehende Durchschlags- <strong>und</strong> Durchsche<strong>in</strong>effekt bei<br />
Druckerzeugnissen mit relativ ger<strong>in</strong>gen Aufwänden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Dokumentenvoransicht e<strong>in</strong>er<br />
Webapplikation mit subjektiv guten Ergebnissen simuliert werden kann.<br />
Hierfür wurde e<strong>in</strong> Konzept vorgestellt mit dem sich solche Webapplikationen realisieren lassen<br />
<strong>und</strong> das zum E<strong>in</strong>en, zur <strong>Simulation</strong> des farblichen Ersche<strong>in</strong>ungsbildes, auf dem bereits<br />
existierenden Konzept des „Softproof<strong>in</strong>gs“ <strong>und</strong> zum An<strong>der</strong>n, zur <strong>Simulation</strong> <strong>der</strong> Opazität, auf<br />
dem im Verlauf dieser Arbeit entwickelten Konzept zur Opazitätssimulation basiert.<br />
Das Konzept des „Softproof<strong>in</strong>g“ wurde hierzu <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Workflow umgesetzt, <strong>der</strong> e<strong>in</strong>e<br />
farbverb<strong>in</strong>dliche <strong>Simulation</strong> des farblichen Ersche<strong>in</strong>ungsbildes <strong>von</strong> Druckerzeugnissen aus den<br />
gängigsten Bilddateien <strong>und</strong> PDF-Dokumenten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Webapplikation ermöglicht, <strong>und</strong> sich<br />
hierfür bei den Methoden <strong>der</strong> weit verbreiteten Farbmanagementsysteme nach ICC-Standard<br />
bedient.<br />
Für das Konzept <strong>der</strong> Opazitätssimulation, wurden zunächst die Auswirkungen <strong>der</strong> Opazität auf<br />
das Ersche<strong>in</strong>ungsbild <strong>von</strong> Druckerzeugnissen, sowie <strong>der</strong>en Simulierbarkeit untersucht. In e<strong>in</strong>em<br />
weiteren Schritt wurde dann für die Quantifizierung <strong>der</strong> Auswirkungen e<strong>in</strong> Messverfahren<br />
eruiert für dessen, als Farbwerte des L*a*b*-Farbraums vorliegende, Messergebnisse zwei<br />
alternative, auf <strong>der</strong> Farbmetrik basierende <strong>und</strong> qualitativ unterschiedliche Verfahren zur<br />
Berechnung <strong>der</strong> Opazität entwickelt <strong>und</strong> gegenübergestellt wurden.<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage dieser Möglichkeiten zur Opazitätsbestimmung wurde dann für professionelle<br />
Drucker <strong>und</strong> Druckmasch<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> herkömmliche Bürodrucker an<strong>der</strong>seits jeweils e<strong>in</strong><br />
Messchart zur Erstellung <strong>von</strong> Opazitätsprofilen sowie e<strong>in</strong>e Methode zur Bestimmung <strong>der</strong><br />
Opazität aller <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em digitalen Bild o<strong>der</strong> Dokument enthaltenden Pixels durch Interpolation<br />
aus den, durch das Opazitätsprofil gegebenen, Opazitätswerten entwickelt.<br />
Beide Teilkonzepte wurden daraufh<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Konzept e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Workflows<br />
zusammengeführt, <strong>und</strong> die Darstellung <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> des farblichen Ersche<strong>in</strong>ungsbildes <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> Opazität anhand farbmanagementfähigen Webtechnologien konkretisiert.<br />
Mit e<strong>in</strong>er prototypischen Implementierung konnte anschließend die Umsetzbarkeit dieses<br />
Konzeptes bewiesen <strong>und</strong> die Qualität <strong>der</strong> <strong>Simulation</strong> subjektiv als gut bewertet werden, sodass<br />
die Umsetzbarkeit dieses Konzeptes als Bestandteil e<strong>in</strong>es Bestell- <strong>und</strong> o<strong>der</strong><br />
Druckfreigabeprozesses für Druckerzeugnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er webbasierenden Lösung gegeben ist.<br />
In weiteren Schritten können nun, neben <strong>der</strong> E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung weiterer Bild <strong>und</strong><br />
Dokumentdateiformate <strong>und</strong> -eigenschaften <strong>in</strong> den Workflow dieses Konzeptes, aufbauend auf<br />
diesem Konzept weitere <strong>Papier</strong>-<strong>und</strong> <strong>Farbeigenschaften</strong> auf dessen Simulierbarkeit untersucht<br />
werden.<br />
82
6. Zusammenfassung <strong>und</strong> Ausblick<br />
So könnte bspw. untersucht werden <strong>in</strong>wiefern sich die, durch die <strong>Papier</strong>struktur verursachte<br />
Wolkigkeit e<strong>in</strong>es Ausdrucks simulieren lässt. Weitere Beispiele s<strong>in</strong>d die Glanzeigenschaften des<br />
<strong>Papier</strong>s <strong>und</strong> <strong>der</strong> Farbe, <strong>und</strong> die beson<strong>der</strong>en Reflexionseigenschaften <strong>von</strong> Druckfarben mit<br />
Metallpigmenten, die <strong>in</strong> Abhängigkeit <strong>der</strong> Intensität <strong>und</strong> Lokalisation e<strong>in</strong>er Lichtquelle zu<br />
simulieren wären.<br />
Des Weiteren muss die zukünftige Entwicklung des Farbmanagements beobachtet werden, da<br />
e<strong>in</strong>e stärkere Verbreitung <strong>von</strong> neueren Konzepten wie bspw. dem des, <strong>in</strong> Kap. 2.2.2<br />
untersuchten, „W<strong>in</strong>dowsColorSystem“ ggf. Anpassungen des <strong>Simulation</strong>skonzeptes erfor<strong>der</strong>lich<br />
machen.<br />
83
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.1 CMM Vergleich - Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 1<br />
84
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.2 CMM Vergleich – Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 2<br />
85
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.3 CMM Vergleich – Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 3<br />
86
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.4 CMM Vergleich – Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 4<br />
87
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.5 CMM Vergleich – Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 5<br />
88
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.6 Bere<strong>in</strong>igter CMM Vergleich – Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 1<br />
89
Anhang A - Messergebnisse des CMM-Vergleichs<br />
Tab. A.7 Bere<strong>in</strong>igter CMM Vergleich – Auswertung Differenzbil<strong>der</strong> Teil 2<br />
90
Anhang B - Beispiele<br />
Tab. B.1 Messergebnisse zu Beispiel 1<br />
91
Tab. B.2 Messergebnisse zu Beispiel 2<br />
Anhang B - Beispiele<br />
92
Anhang B - Beispiele<br />
<br />
<br />
<br />
Canon iP4200_OfficePlus.icm<br />
Canon Pixma ip4200 with OfficePlus paper<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
93.15<br />
<br />
<br />
90.89<br />
<br />
<br />
26.4<br />
<br />
<br />
62.6<br />
<br />
<br />
62.6<br />
<br />
<br />
89.8<br />
<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<br />
96.64<br />
100<br />
99.46<br />
99.25<br />
98.47<br />
98.59<br />
98.46<br />
98.51<br />
97.57<br />
.<br />
.<br />
.<br />
89.07<br />
89.76<br />
89.46<br />
88.78<br />
87.75<br />
85.93<br />
83.36<br />
76.58<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<br />
<br />
Beispiel B.1 Aufbau e<strong>in</strong>es Opazitätsprofil im XML-Format<br />
93
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
Anhang C.1 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 1<br />
94
Anhang C.2 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 2<br />
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
95
Anhang C.3 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 3<br />
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
96
Anhang C.4 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 4<br />
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
97
Anhang C.5 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 5<br />
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
98
Anhang C.6 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 6<br />
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
99
Anhang C.7 Messdaten zu Druckbed<strong>in</strong>gung 7<br />
Anhang C - Opazitätsprofil<br />
100
Anhang D - CD-Rom<br />
Die dieser Arbeit beigefügten CD enhält:<br />
– Diese Arbeit als PDF-Dokument<br />
– Die Prototypische Implementierung aus Kap. 4<br />
101
Quellenverzeichnis<br />
[Ado1] Adobe® Flex 3.3 Language Reference<br />
http://livedocs.adobe.com/flex/3/langref/package-summary.html (Stand23.03.09)<br />
[Ado2] 2008, Adobe Systems Incorporated, Document management – Portable document<br />
format Part 1: PDF1.7 First Edition<br />
http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/PDF32000_2008.pdf (Stand25.01.09)<br />
[Ado3] 2006, Adobe Systems Incorporated, PDF Reference Sixth Edition version 1.7<br />
http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference_archive.html (Stand 25.03.09)<br />
[Ado4] 1999, Adobe Systems Incorporated, PostScript® LANGUAGE REFERENCE<br />
third edition<br />
http://www.adobe.com/products/postscript/pdfs/PLRM.pdf (Stand 25.01.09)<br />
[Al08] 2008, A. Al<strong>der</strong>son, Onl<strong>in</strong>eartikel mit dem Titel: Image Manipulation <strong>in</strong> Flex<br />
http://www.<strong>in</strong>si<strong>der</strong>ia.com/2008/03/image-manipulation-<strong>in</strong>-flex.html (Stand 23.03.09)<br />
[Al1] Abb. 2.1.2 Lab-Farbraum nach Ralph Altmann<br />
http://www.heise.de/foto/Mehr-Bits-fuer-Farbe--/artikel/106500/6 (Stand 25.03.09)<br />
[App1] Safari Features<br />
http://www.apple.com/safari/features.html (Stand 23.03.09)<br />
[An1] Abb. 2.1.1 Normfarbtafel nach Torge An<strong>der</strong>s<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/CIE-Normvalenzsystem (Stand 25.03.09)<br />
[Arg1] ArgyllCMS Limitations<br />
http://www.argyllcms.com/doc/Limitations.html (Stand11.01.08)<br />
[Br05] 2005, Thomas Bredenfeld, Adobe Photoshop CS2 professionell<br />
[DIN53145] 2000, DIN, DIN 53145 - Prüfung <strong>von</strong> Pappe <strong>und</strong> <strong>Papier</strong> – Meßgr<strong>und</strong>lagen zur<br />
Bestimmung des Reflexionsfaktors, Teil 1 & Teil 2<br />
[DIN53146] 2000, DIN, DIN 53146 - Prüfung <strong>von</strong> Pappe <strong>und</strong> <strong>Papier</strong> – Bestimmung <strong>der</strong> Opazität<br />
[DIN53147] 1993, DIN, DIN 53147 - Prüfung <strong>von</strong> <strong>Papier</strong> – Bestimmung <strong>der</strong> Transparenz<br />
[DS05] SWOP® Soft Proof<strong>in</strong>g Application Data Sheet for DALiM DiALOGUE<br />
http://www.swop.org/ads/Dalim%20Dialogue%20Apple%2023.pdf (Stand 23.03.09)<br />
[EC07] 2007, ECI, ISO coated v2 (ECI)<br />
http://www.eci.org/doku.php?id=de:downloads (Stand 25.03.09)<br />
[EC08] 2008, ECI, ECI-Offsetprofile 2008<br />
http://www.eci.org/doku.php?id=de:downloads (Stand 25.03.09)<br />
[Fo08] 2008, Fogra, Softproof Handbuch<br />
http://forschung.fogra.org/dokumente/upload/Softproof_HandbuchV1_47d2c.pdf<br />
(Stand 25.03.09)<br />
102
[Fr05] 2005, Mart<strong>in</strong> Frech, Randgebiete Jahrgang 2 Nr2<br />
http://www.medienfrech.de/randgebiete/archiv/R2-2005.pdf (Stand 25.03.09)<br />
Quellenverzeichnis<br />
[Fog1] Separationstestbild <strong>der</strong> Fogra<br />
http://forschung.fogra.org/<strong>in</strong>dex.php?menuid=50&downloadid=60&reporeid=0)<br />
(Stand 21.12.08)<br />
[Hu02] 2002, Huneke, ICCView - Internetseite zur Visualisierung <strong>von</strong> ICC-Profilen mit<br />
Hilfe <strong>von</strong> 3D-Farbraummodellen<br />
http://www.iccview.de/images/stories/iccview/ICCView-Colormanagement.pdf<br />
(Stand 12.11.08)<br />
[ICC1] Paper mit dem Titel: „The reasons for chang<strong>in</strong>g to the v4 ICC profile format“<br />
http://www.color.org/advantagesv4.pdf (Stand 25.03.09)<br />
[ICC2] http://www.color.org/opensource.xalter (Stand 17.11.2008)<br />
[ICC3] 2001, ICC, Specification ICC.1:2001-04 – File Format for Color Profiles<br />
http://www.color.org/ICC_M<strong>in</strong>or_Revision_for_Web.pdf (Stand 18.01.09)<br />
[IM1] Examples of ImageMagick Usage – Image compar<strong>in</strong>g<br />
http://www.imagemagick.org/Usage/compare/#difference) (Stand 21.12.08)<br />
[IM2] ImageMagick command-l<strong>in</strong>e options - colorspace<br />
http://imagemagick.org/script/command-l<strong>in</strong>e-options.php#colorspace<br />
(Stand 22.02.09)<br />
[ISO168] 2002, DIN, DIN EN ISO 186 - <strong>Papier</strong> u. Pappe – Probenahme zur Bestimmung <strong>der</strong><br />
Durchschnittsqualität<br />
[Ke03] 2003, Sascha Kerksen, Kompendium <strong>der</strong> Informationstechnik<br />
http://bk-werne.de/doc/kit/itkomp17001.htm (Stand 12.03.09)<br />
[KK07] 2007, Hans K. Kerner, Horst Kernen, Lexikon <strong>der</strong> Reprotechnik - Zweite erweiterte<br />
Auflage<br />
[Kr01] 2001, Helmut Kraus, Scans, Pr<strong>in</strong>ts & Proofs<br />
[Lapi] little cms Eng<strong>in</strong>e 1.17 - API Def<strong>in</strong>ition<br />
http://www.littlecms.com/LCMSAPI.TXT (Stand 18.01.09)<br />
[Lau1] LittleCMS – Additional utilitis – Profile to PostScript<br />
http://www.littlecms.com/newutils.htm#icc2ps (Stand 25.01.09)<br />
[Lo98] 1998, Hansl Loos, Farbmessung – Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Farbmetrik <strong>und</strong> ihre<br />
Anwendungsbereiche <strong>in</strong> <strong>der</strong> Druck<strong>in</strong>dustrie<br />
[MD02] 2002, T.Merz, O.Drümmer, PostScript- & PDF-Bibel<br />
http://www.pdflib.com/developer/technical-documentation/books/postscript-pdf-bibel/<br />
(Stand 25.01.09)<br />
103
[Moz1] Mozilla - Canvas tutorial<br />
https://developer.mozilla.org/en/Canvas_tutorial (Stand 23.03.09)<br />
Quellenverzeichnis<br />
[MS1] MSDN Library - Us<strong>in</strong>g Color Management on the Internet<br />
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd372212(VS.85).aspx (Stand 23.03.09)<br />
[MS2] WCS Pipel<strong>in</strong>e nach Microsoft<br />
http://download.microsoft.com/download/f/0/5/f05a42ce-575b-4c60-82d6-<br />
208d3754b2d6/W<strong>in</strong>dowsColorSystem_API.ppt (Stand 25.03.09)<br />
[MZ1] Firefox - Gfx.color management.mode<br />
http://kb.mozillaz<strong>in</strong>e.org/Gfx.color_management.enabled (Stand 23.03.09)<br />
[NA1] NetApplication - Browser market share<br />
http://marketshare.hitsl<strong>in</strong>k.com/browser-market-share.aspx?qprid=1)<br />
(Stand 23.03.09)<br />
[Ne07] 2007, Neumann, W<strong>in</strong>dows Vista Color Management<br />
http://www.piagatfcolor.org/documents/11%20Vista_WCS_Neumann2.pdf<br />
(25.03.09)<br />
[OCW1] Oryanos ColourWiki<br />
https://www.oyranos.org/wiki/<strong>in</strong>dex.php?title=Ghostscript (Stand 25.01.09)<br />
[Pro1] http://process<strong>in</strong>g.org/learn<strong>in</strong>g/tutorials/color/ (Stand 25.03.09)<br />
[SD1] ScanDig - Anwendung <strong>von</strong> Farbmanagement <strong>in</strong> Photoshop<br />
http://www.filmscanner.<strong>in</strong>fo/Farbmanagement_Photoshop.html (Stand 12.11.08)<br />
[SH1] SelfHTML<br />
http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/positionierung.htm#z_<strong>in</strong>dex (Stand 25.03.09)<br />
[Ufg1] Abb. 2.1.3 Vergleich <strong>von</strong> RGB Farbräumen nach Gerhard Funk<br />
http://www.dma.ufg.ac.at/app/l<strong>in</strong>k/Gr<strong>und</strong>lag%3AAllgeme<strong>in</strong>e/module/16579?step=7<br />
(Stand 25.03.09)<br />
[Ufg2] Abb.3.2.5 Farbraumvergleich<br />
http://www.dma.ufg.ac.at/app/l<strong>in</strong>k/Allgeme<strong>in</strong>:Module/module/15518/sub/15627<br />
(Stand 25.03.09)<br />
[W3C96] PNG (Portable Network Graphics) Specification – Gamma Tutorial<br />
http://www.w3.org/TR/PNG-GammaAppendix.html (Stand31.12.2008)<br />
[Wi1] http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum (Stand 25.03.09)<br />
104