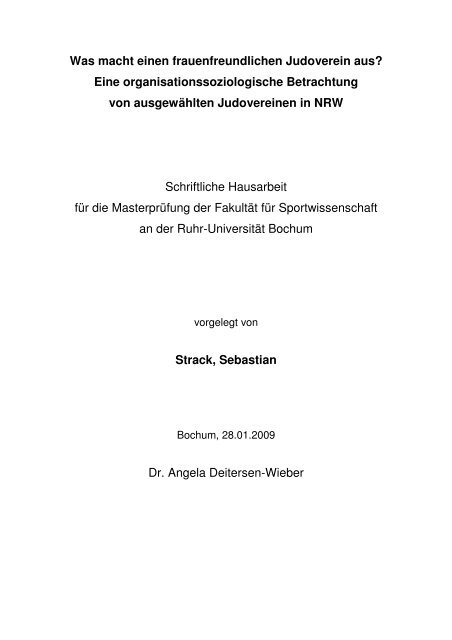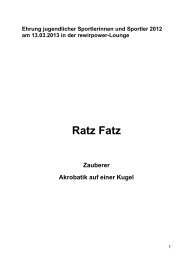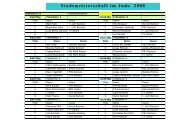Frauenfeundlicher Judoverein - Sportjugend Bochum
Frauenfeundlicher Judoverein - Sportjugend Bochum
Frauenfeundlicher Judoverein - Sportjugend Bochum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Was macht einen frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> aus?<br />
Eine organisationssoziologische Betrachtung<br />
von ausgewählten <strong>Judoverein</strong>en in NRW<br />
Schriftliche Hausarbeit<br />
für die Masterprüfung der Fakultät für Sportwissenschaft<br />
an der Ruhr-Universität <strong>Bochum</strong><br />
vorgelegt von<br />
Strack, Sebastian<br />
<strong>Bochum</strong>, 28.01.2009<br />
Dr. Angela Deitersen-Wieber
Inhaltsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis................................................................... IV<br />
Abbildungsverzeichnis.................................................................... VI<br />
Tabellenverzeichnis........................................................................ VII<br />
Symbolverzeichnis ........................................................................ VIII<br />
1. Einleitung................................................................................ 1<br />
2. Zum Forschungsstand........................................................... 3<br />
3. Organisationsform Sportverein ............................................ 6<br />
3.1 Der Sportverein als Rechtskörper...........................................................6<br />
3.1.1 Der Sportverein als Teil des Dritten Sektors...............................................6<br />
3.1.2 Besonderheiten von Sportvereinen ............................................................7<br />
3.1.3 Konstitutive Merkmale des Vereins und die Abhängigkeit von den<br />
Interessen der Mitglieder............................................................................9<br />
3.2 Die soziale Architektur von Sportvereinen ..........................................11<br />
3.2.1 Ziele der Sportorganisation ......................................................................11<br />
3.2.1.1 Arten von Zielen .......................................................................................11<br />
3.2.1.2 Funktionen von Organisationszielen.........................................................13<br />
3.2.1.3 Probleme der Zielbestimmung und Durchführung ....................................14<br />
3.2.2 Die Struktur von Sportvereinen ................................................................15<br />
3.2.2.1 Formen der Arbeitsteilung und ihre Auswirkung auf die Organisation......15<br />
3.2.2.2 Besonderheiten der Strukturmuster von Sportvereinen............................19<br />
3.2.2.3 Elemente eines Organisationsdesigns .....................................................20<br />
3.2.2.4 Koordination und Kontrolle .......................................................................21<br />
3.2.2.5 Formen der Kontrolle................................................................................24<br />
3.2.3 Formen der Ausgestaltung der sozialen Architektur.................................25<br />
3.2.4 Wandel in Sportvereinen ..........................................................................27<br />
3.3 Sportvereine als Personenvereinigung ................................................29<br />
3.3.1 Organisationskultur...................................................................................29<br />
3.3.1.1 Elemente der Organisationskultur ............................................................30<br />
3.3.1.2 Bestimmungsfaktoren der Organisationskultur.........................................32<br />
3.3.1.3 Funktionen der Organisationskultur..........................................................33<br />
3.3.2 Demographie einer Sportorganisation......................................................33<br />
3.3.3 Das Verhältnis zwischen Individuum und Organisation............................34<br />
3.3.4 Mitgliedereinbindung in Sportvereinen .....................................................36<br />
3.3.5 Gefährdete Integration..............................................................................37<br />
3.3.6 Emotionen in Sportorganisationen............................................................39<br />
3.3.6.1 Kommunikation und Interpretation von Emotionen...................................40<br />
3.3.6.2 Funktionen von Emotionen.......................................................................40<br />
3.3.6.3 Emotionsarbeit und Emotionsmanagement..............................................41<br />
II
4 Frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong> – Organisationssoziologischen<br />
Möglichkeiten zur Förderung von<br />
Mädchen und Frauen ........................................................... 43<br />
4.1 Frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong>.............................................................43<br />
4.1.1 Judo-geschichtlicher Überblick im Bezug auf Frauen...............................43<br />
4.1.2 Begriffsbestimmung: Frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong>...............................45<br />
4.1.3 Untersuchungsmöglichkeiten zum frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong>...........46<br />
4.2 Die Aufgabe des <strong>Judoverein</strong>s als Teil des dritten Sektors.................47<br />
4.3 Die soziale Architektur von <strong>Judoverein</strong>en und die Möglichkeit<br />
diese zu gestalten...................................................................................48<br />
4.3.1 Die Ziele des <strong>Judoverein</strong>s ........................................................................49<br />
4.3.2 Die Struktur von <strong>Judoverein</strong>en .................................................................51<br />
4.4 Der <strong>Judoverein</strong> als Personenvereinigung............................................53<br />
4.4.1 Organisationskultur...................................................................................53<br />
4.4.2 Demographie von <strong>Judoverein</strong>en...............................................................53<br />
4.4.3 Das Verhältnis zwischen Individuum und Organisation............................53<br />
5 Zur empirischen Untersuchung .......................................... 55<br />
5.1 Gegenstand und Ziel der Untersuchung ..............................................55<br />
5.2 Hypothesen und untersuchungsleitende Fragen ................................55<br />
5.3 Techniken der Datengewinnung ...........................................................57<br />
5.3.1 Methode und Methodenkritik ....................................................................57<br />
5.3.2 Besonderheit von qualitativer Fragenabschnitte.......................................59<br />
5.4 Auswahl der zu untersuchenden Vereine.................................................61<br />
5.5 Durchführung der Befragung ....................................................................61<br />
6 Auswertung der Datenerhebung......................................... 62<br />
6.1 Überblick über die befragten Vereine...................................................62<br />
6.1.1 Geschlechtsspezifische Mitgliederstruktur................................................62<br />
6.1.2 Mitgliederstruktur der ausgewählten Vereine ...........................................64<br />
6.2 Prüfung der Thesen................................................................................66<br />
7 Folgerungen und Forderungen ......................................... 117<br />
Anhang ............................................................................................. IX<br />
Literaturverzeichnis................................................................... XXVII<br />
III
Abkürzungsverzeichnis<br />
Abb. ...................................................................Abbildung<br />
bzw. ...................................................................beziehungsweise<br />
d. h. . ..................................................................dass heißt<br />
DJB ....................................................................Deutscher Judo-Bund<br />
e. D. ...................................................................eigene Darstellung<br />
etc. ....................................................................et cetera<br />
e. V. ...................................................................eingetragener Verein<br />
f. ........................................................................folgende<br />
ff. .......................................................................fortfolgende<br />
ggf. .....................................................................gegebenenfalls<br />
ggü. ....................................................................Gegenüber<br />
i. d. R. ................................................................in der Regel<br />
Kap. ...................................................................Kapitel<br />
k. A. ...................................................................keine Angabe<br />
km ......................................................................Kilometer<br />
LSB ...................................................................Landessportbund<br />
m. ......................................................................männlich<br />
m. E....................................................................meines Erachtens<br />
NWJV.................................................................Nordrhein-Westfälischer JudoVerband<br />
NRW ..................................................................Nordrhein-Westfalen<br />
o. ä.....................................................................oder ähnliches<br />
o. g. ....................................................................oben genannt(en)<br />
S. .......................................................................Seite<br />
s. .......................................................................siehe<br />
Tab. ...................................................................Tabelle<br />
u. a.....................................................................unter anderem<br />
u. ä.....................................................................und ähnliches<br />
u. U. ...................................................................unter Umständen<br />
vgl. ....................................................................vergleiche<br />
w. ......................................................................weiblich<br />
Z. .......................................................................Zeile<br />
IV
z. B. ...................................................................zum Beispiel<br />
z. T. ....................................................................zum Teil<br />
V
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 3.1: Der Dritte Sektor zwischen Staat, Markt & informellen Sektor............7<br />
Abb. 3.2: Der Verein als ein Mix von Besonderheiten sozialer Gruppen und<br />
formaler Organisation .......................................................................8<br />
Abb. 3.3: Die Übersetzung von ideologischen Zielen in Sachziele...................12<br />
Abb. 3.4: Das hierarchische Zielsystem einer Sportorganisation .....................13<br />
Abb. 3.5: Formen der Arbeitsteilung.................................................................16<br />
Abb. 3.6: Matrixstruktur einer Sportorganisation ..............................................18<br />
Abb. 3.7: Beispiel für eine flache Organisation.................................................18<br />
Abb.3.8: Die Bestandteile eines Organisationsdesigns....................................20<br />
Abb. 3.9: Die Determinanten der Organisationsstruktur...................................26<br />
Abb. 3.10: Idealtypus und Wirklichkeit .............................................................28<br />
Abb. 3.11: Zuordnung der Elemente einer Organisationsstruktur ....................30<br />
Abb. 3.13: Spannungsverhältnis zwischen Individuum & Organisation ...........35<br />
Abb. 3.13: Inter-Rollenkonflikt eines Übungsleiters..........................................39<br />
VI
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 6.1: Anteil weiblicher Mitglieder ...............................................................63<br />
Tab. 6.2: Minderjährige Mitglieder ...................................................................64<br />
Tab. 6.3: Volljährige Mitglieder ........................................................................65<br />
Tab. 6.4: Ortsgröße .........................................................................................66<br />
Tab. 6.5: Art des Vereins (e. D.).......................................................................68<br />
Tab. 6.6: Gründungsjahr .................................................................................69<br />
Tab. 6.7: Vergrößerungspotential ....................................................................70<br />
Tab. 6.8: Fluktuation .......................................................................................71<br />
Tab. 6.9: Fluktuation im Verein 9 ....................................................................72<br />
Tab. 6.10: Art der Mitgliedergewinnung 1 .......................................................77<br />
Tab. 6.11: Art der Mitgliedergewinnung 2 .......................................................80<br />
Tab. 6.12: Art der Mitgliedergewinnung 3 .......................................................81<br />
Tab. 6.13: Vereinsphilosophie .........................................................................85<br />
Tab. 6.14: Trainingsbeteidigung ......................................................................87<br />
Tab. 6.15: Wettkampfteilnahme ......................................................................89<br />
Tab. 6.16: Mannschaften ................................................................................90<br />
Tab. 6.17: Mannschaften 2 ..............................................................................91<br />
Tab. 6.18: Wettkampfniveau ...........................................................................92<br />
Tab. 6.19: Besondere Sportangebote .............................................................95<br />
Tab. 6.20: Besondere wöchentliche Sportangebote ........................................96<br />
Tab. 6.21: Zusätzliche, unregelmäßige Sportangebote ...................................97<br />
Tab. 6.22: Außersportliche Angebote ..............................................................98<br />
Tab. 6.23: Versammlungsbeteiligung ............................................................103<br />
Tab. 6.24: Personalstruktur ...........................................................................105<br />
Tab. 6.25: Umgang mit dem Geschlecht .......................................................107<br />
VII
Symbolverzeichnis<br />
€.........................................................................Euro<br />
%........................................................................Prozent<br />
&.........................................................................und<br />
VIII
1. Einleitung<br />
Mit dem Slogan „Judo tut Deutschland gut“ wirbt der deutsche Judo-Bund für<br />
diese Sportart. Andere Kampagnen gehen noch einen Schritt weiter und<br />
verwenden einen Slogan wie „Judo für alle“. Doch wird dies auch tatsächlich so<br />
gelebt? Aber wenn ja, wie kommt es dann, dass der Frauenanteil bei den 50<br />
größten Vereinen in NRW zwischen 19 % und 48 % liegt?<br />
„Was macht einen frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> aus? Eine organisationssoziologische<br />
Betrachtung ausgewählter Vereine in NRW“ lautet der Titel dieser<br />
Masterarbeit, die sich einem komplexen Thema nähern will. Das Ziel ist es<br />
herauszufinden, welche Besonderheiten einen <strong>Judoverein</strong> ausmachen, die zu<br />
einem höheren weiblichen Mitgliederanteil führen. Dabei wird der Fokus nicht auf<br />
pädagogische und didaktische Themen, sondern auf die Struktur und die<br />
Angebote des Vereins gelegt, d. h. wo liegen die organisationssoziologischen<br />
Unterschiede in den Vereinen, die zu einer Beeinflussung des Frauenanteils<br />
führen. Aus wissenschaftlicher Sicht und zur Unterstützung von engagierten<br />
Menschen im <strong>Judoverein</strong> soll diese Arbeit einen Beitrag leisten, Kriterien zu<br />
sondieren, die zu einem höheren weiblichen Mitgliederanteil führen. Auf dem<br />
konkurrenzvollen Markt des Freizeitsports sollen damit die Sportart Judo und die<br />
<strong>Judoverein</strong>e gestärkt werden.<br />
Zur Annäherung an das Thema wird im Kapitel 2 zunächst der aktuelle<br />
Forschungsstand skizziert und darauf hingewiesen, dass bisher weder<br />
organisationssoziologische Untersuchungen über <strong>Judoverein</strong>e, noch Untersuchungen<br />
und Arbeiten zur Geschlechterthematik im <strong>Judoverein</strong> gemacht<br />
wurden. Einzig die unveröffentlichte kleine Hausarbeit des Autors zum Seminar<br />
Sport und Geschlecht an der Ruhr-Universität <strong>Bochum</strong> geht dieser Thematik nach.<br />
Das dritte Kapitel schafft die wissenschaftliche Grundlage zur Analyse von<br />
Vereinen indem auf die Besonderheiten der Organisationsform eines Sportvereins<br />
eingegangen wird. Dabei wird zunächst der Sportverein als Rechtskörper<br />
beschrieben und anschließend die soziale Architektur sowie die Herausforderungen<br />
beim Zusammentreffen von Individuen und Organisation dargestellt.<br />
1
Im vierten Kapitel wird nach der Herleitung des Begriffs „frauenfreundlich“ ein<br />
Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Sportart Judo mit Schwerpunkt<br />
Frauen gegeben, um anschließend die Erkenntnisse des vorherigen dritten<br />
Kapitels auf einen <strong>Judoverein</strong> zu übertragen.<br />
Das fünfte Kapitel stellt den Übergang zur empirischen Umfrage dar. Nach einer<br />
erneuten Konkretisierung der Zielstellung werden untersuchungsleitende<br />
Hypothesen formuliert, verschiedene Untersuchungstechniken betrachtet und die<br />
Kriterien zur Auswahl des Vereins sowie die eigentliche Durchführung der<br />
Befragung beschrieben.<br />
Die Auswertung des im Anhang befindlichen Fragebogens bildet den Kern dieser<br />
Arbeit im sechsten Kapitel. Dort werden 24 <strong>Judoverein</strong>e unter organisationssoziologischen<br />
Gesichtspunkten untersucht. Dabei hat die eine Hälfte der Vereine<br />
einen höheren weiblichen Mitgliederanteil und die andere Hälfte einen niedrigeren<br />
weiblichen Anteil. Die Arbeit geht vor allem vergleichend vor. Hierzu werden<br />
ausführliche Befragungen mit Personen durchgeführt, die durch Ihren Einsatz<br />
ihren jeweiligen Verein führen und prägen. Ohne Ergebnisse vorwegzunehmen,<br />
bezeichneten alle Befragten ihre jeweiligen Vereine als frauenfreundlich,<br />
unabhängig vom weiblichen Mitgliederanteil von 19 % oder 48 %. Die Gründe<br />
hierfür und warum bei der einen Gruppe weniger Mädchen und Frauen im Verein<br />
sind, soll versucht werden zu klären.<br />
In dem abschließenden siebten Kapitel werden die Folgerungen aus der<br />
Untersuchung zusammengefasst und Forderungen aufgeführt, die zu einer<br />
Verbesserung des weiblichen Mitgliederanteils führen könnten.<br />
2
2. Zum Forschungsstand<br />
Im Bereich der Sportsoziologie liegen zum Judo und zu <strong>Judoverein</strong>en noch keine<br />
Arbeiten unter der Geschlechterperspektive vor. Dies ergaben zumindest die<br />
Bibliotheksrecherchen und die Anfragen an alle Judo-Landesfachverbände in<br />
Deutschland.<br />
Im Rahmen des Hauptseminars Sport und Geschlecht an der Ruhr-Universität<br />
<strong>Bochum</strong> hat der Autor dieser Arbeit im Jahr 2008 eine Hausarbeit erstellt mit dem<br />
Titel „Mädchen und Jungen im Judo – Förderung des Kampfverhaltens durch<br />
Implementierung struktureller Maßnahmen“. Im Rahmen dieser Hausarbeit wurde<br />
ein <strong>Judoverein</strong> dargestellt, der aufgrund seiner strukturellen Maßnahmen einen<br />
höheren weiblichen Mitgliederanteil aufwies. Doch in der hiesigen Masterarbeit<br />
werden in einem deutlich größerem Umfang <strong>Judoverein</strong>e organisationssoziologisch<br />
unter der Geschlechterperspektive betrachtet und verglichen.<br />
Die sonstige judospezifische Literatur geht zum größten Teil auf pädagogische<br />
und didaktische Themen ein. Folgende Werke gehen dabei auf die Geschlechterthematik<br />
unter pädagogisch-didaktischen Gesichtpunkten ein:<br />
• Das 2008 erschienene Werk „Ringen und Kämpfen Zweikampfsport“, herausgegeben<br />
vom Landessportbund, der <strong>Sportjugend</strong> NRW, dem NW Judo-<br />
Verband e.V. und dem Ringerverband NRW e.V. geht in den didaktischmethodischen<br />
Grundlinien mit folgender Aussage auf den koedukativen Unterricht<br />
ein (S. 16):<br />
„Im Inhaltsbereich 9 [Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport] ist grundsätzlich<br />
koedukativer Unterricht möglich und auch sinnvoll, da weitestgehend Partnerübungen und<br />
Zweikampfspiele durchgeführt werden und sich bei freiwilliger Partnerwahl so automatisch<br />
eine innere Differenzierung ergibt.“<br />
• Bertrams, A.: (2004). Ringen, Kämpfen, Zweikampfsport – ein Bewegungsfeld,<br />
in dem Mädchen und Jungen gemeinsam agieren können.<br />
• Bruhn, A.: (1998). Kämpfen: Für Mädchen kein Thema.<br />
• Dirnbacher, H.: (1993). Mädchen brauchen Kraft – Mädchen haben Kraft..<br />
• Funke-Wieneke, J.: (1994). Pankration im Schulsport? Versuch einer sonderpädagogischen<br />
Argumentation zum Vorhaben der „Selbstverteidigung<br />
für Mädchen“.<br />
• Jakob, M.: (1998). Wenn Mädchen kämpfen – Zweikampfsport.<br />
3
• Krüger, M.: (1992). Selbstverteidigung für Mädchen – ein Thema für die<br />
Sportpädagogik und den Sportunterricht.<br />
• Rosenberg, C.: (2003). Workshop zum Jahresthema: Denkanstöße für den<br />
weiblichen Trainingsalltag.<br />
• Ketelhut, R.; Gutt, J.: (1999). Kinder-Judo – Ein fröhliches Lehrbuch für<br />
Jungen und Mädchen.<br />
Das folgende Werk stellt eine Sportpsychologische Arbeit dar, die auch<br />
Geschlechtervergleiche beinhaltet.<br />
• Teipel, D. & Heinemann, D. & Kemper, R.(2001). Ärgerkontrolle im Judo.<br />
Die im oberen dargestellte Literatur hat im Rahmen der hiesigen organisationssoziologischen<br />
Untersuchung nur eine geringe Bedeutung. Trainern, die Judo als<br />
einen Sport verstehen, der für beiderlei Geschlechter ist, finden hier besondere<br />
mädchengerechte Anregungen.<br />
Zum Bereich Sportverein gibt es einige Werke zum Geschlechterverhältnis in<br />
Sportvereinen und Sportverbänden, aber kaum eine Darstellung aus<br />
Geschlechterperspektive über die verschiedenen Vereine einer Sportart und<br />
überhaupt keine aus dem Bereich Judo. Die folgenden Werke geben einen<br />
Überblick über die Geschlechterforschung im Sport und stammen zum größten<br />
Teil aus dem Handbuch Sport und Geschlecht, welches von Ilse Hartman-Tews<br />
2006 herausgegeben wurde:<br />
• Dahmen, B.: Frauenförderung und Gender Mainstreaming – Gleichstellungsstrategien<br />
im Sport.<br />
• Kugelmann, U. & Röger, U. & Weigelt, Y.: Zur Koedukationsdebatte: Gemeinsames<br />
oder getrenntes Sporttreiben von Mädchen und Jungen.<br />
• Combrink, C. & Dahmen, B. & Hartmann-Tews, I.: Führung im Sport – eine<br />
Frage des Geschlechts?<br />
• Burrmann, U.: Geschlechterbezogenen Partizipation im Freizeit- und Breitensport.<br />
4
• Kleindienst-Cachay, C. & Heckememeyer, K.: Frauen in Männerdomänen<br />
des Sports.<br />
• Gieß-Stüber, P. Frühkindliche Bewegungsförderung, Geschlecht und Identität.<br />
• Hartmann-Tews, I. Soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport und in<br />
den Sportwissenschaften.<br />
• Bauer, J. & Brettschneider, W.-D. (1999). Vereinsorganisierter Frauensport.<br />
• Heinemann, Klaus. (2007). Einführung in die Soziologie des Sports.<br />
• Schmidt, W. (2003). Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht.<br />
• Schmidt, W. & Zimmer, R. (2008). Zweiter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht.<br />
Schwerpunkt Kindheit.<br />
• Combrink, C. Geschlechterverhältnis in Sportvereinen und –verbänden.<br />
Letzt genannte sagt in ihrem Fazit (S. 208) folgendes:<br />
„Vereine und Verbände im Sport sind als konstituierte Organisationen durch eine Vielzahl<br />
sozialer Strukturen gekennzeichnet. Diese werden seit geraumer Zeit von der sportwissenschaftlichen<br />
Geschlechterforschung dahingegen untersucht, inwiefern Geschlecht innerhalb<br />
dieser Strukturen eine Bedeutung erhält oder auch nicht. Auffällig ist, dass die meisten<br />
Studien die Geschlechterrelevanz fokussieren und nur wenige explizit nach Neutralisierungstendenzen<br />
forschen.“<br />
Sportartspezifisch sucht die vorliegende Arbeit nach Neutralisierungstendenzen,<br />
indem durch den Vergleich mehrerer <strong>Judoverein</strong>e unter der besonderen<br />
Betrachtung des weiblichen Mitgliederanteils Faktoren/ Anzeichen gesucht<br />
werden, die dazu führen, dass es im <strong>Judoverein</strong> zu einem anteilig etwa<br />
gleichgewichtigen Miteinander von Mädchen bzw. Frauen und Jungen bzw.<br />
Männer kommen kann. Wodurch das weibliche Geschlecht im entsprechenden<br />
Verein durch die demokratische Entscheidungsstruktur eine etwa gleichwertige<br />
Wahl- und Entscheidungsmacht besitzt, und damit also, bei Abstimmungen<br />
Frauen nicht durch einen geringeren Anteil im Verein grundsätzlich benachteiligt<br />
wären. Dem gegenüber orientieren sich viele Gleichstellungsstrategien im Sport<br />
daran, Mädchen und Frauen erst einmal einen uneingeschränkten Zugang zu den<br />
Bereichen des Sports zu ermöglichen (vgl. Dahmen, 2006, S. 311).<br />
5
3. Organisationsform Sportverein<br />
Im folgendem wird der Sportverein unter organisatorischen Gesichtpunkten<br />
analysiert und seine Besonderheiten herausgearbeitet. Im Wesentlichen können<br />
dabei die drei Perspektiven Rechtskörper, soziale Architektur, Personenvereinigung<br />
unterschieden werden.<br />
3.1 Der Sportverein als Rechtskörper<br />
Ein Sportverein besitzt in der Regel eine von einzelnen Personen unabhängige<br />
und daher eigenständige Rechtskörperschaft, die dadurch gekennzeichnet ist,<br />
dass die einzelnen Individuen einen Teil ihrer Ressourcen wie Arbeit oder Geld<br />
diesem Rechtskörper zur Verfügung stellen (vgl. Heinemann, 2004, S. 77).<br />
3.1.1 Der Sportverein als Teil des Dritten Sektors<br />
Die Organisationsform des Sportvereins gehört zum so genannten Dritten Sektor,<br />
der sich zwischen den Polen Markt und Staat und informeller Sektor positioniert.<br />
Der Dritte Sektor umfasst neben den Sportvereinen und Sportverbänden ein<br />
breites Spektrum von Organisationen, wie beispielsweise Wohlfahrtsverbände,<br />
Stiftungen, Genossenschaften oder alternativen Betrieben. Es werden in diesem<br />
Sektor Aufgaben übernommen, die von Staat und Wirtschaft nicht wahrgenommen<br />
werden. Vereine schützen die Interessen organisationsfähiger Gruppierungen,<br />
zeigen neue Aufgaben auf und wirken damit als Warnanlage für das politische und<br />
wirtschaftliche System (vgl. Sills, 1968, S. 374). Im Gegensatz zu sportlichen<br />
Aktivitäten mit Familie oder Freundeskreis hat sich bei einem Sportverein eine<br />
formale Organisationsform gebildet, die im Unterschied zu Unternehmen keine<br />
eigenwirtschaftlichen Ziele verfolgt (vgl. Heinemann, 2004, S. 77).<br />
6
Abb. 3.1: Der Dritte Sektor zwischen Staat, Markt & informellen Sektor (Heinemann, 2004, S. 77)<br />
Damit stellen Sportvereine ein wichtiges Gegengewicht zu den großen<br />
Organisationen in Staat und Wirtschaft dar. Gleichzeitig bilden sie einen wichtigen<br />
Teil der politischen Öffentlichkeit, denn sie sind „Zentren des<br />
Meinungsaustausches, der Meinungsbildung und Information“ (Pflaum, 1954,<br />
179). Sie können als informeller Einflusskanal für nicht-politische Eliten auf<br />
politische Entscheidungen wirken (vgl. Rossi 1966, 68-69) oder mit ihren<br />
möglichen Zielsetzungen, strukturellen Besonderheiten und möglichen<br />
Integrationswirkungen zu einer bedeutenden Säule einer Zivilgesellschaft werden.<br />
(vgl. Heinemann, 2007, S 148).<br />
3.1.2 Besonderheiten von Sportvereinen<br />
In Sportvereinen vermengen sich Elemente sozialer Gruppen und formaler<br />
Organisation (vgl. Abb. 3.2). Zwar verfolgen Sportvereine das Ziel, ihren<br />
Mitgliedern Sporttreiben zu ermöglichen, aber die Beziehungen in Vereinen sind<br />
nicht immer eindeutig funktional spezifisch. So erreichen die herausgebildeten<br />
sozialen Strukturen nicht den Grad der Formalisierung, der für formale<br />
Organisationen typisch ist. Darüber hinaus bestimmt oft ein starkes „Wir-Gefühl“<br />
ihre Existenz. Meist existieren formale Autoritätsstrukturen, doch ihr Einfluss hängt<br />
von der Ausstrahlung und Überzeugungskraft der Amtsinhaber ab.<br />
7
Abb. 3.2: Der Verein als ein Mix von Besonderheiten sozialer Gruppen und formaler Organisation<br />
(Heinemann, 2004, S. 81)<br />
Die Vermengung der z. T. widersprüchlichen Besonderheiten von Gruppen und<br />
formalen Organisationen kann in verschiedenen Vereinstypen unterschiedlich<br />
ausfallen. Vereine können sich eher den Eigenheiten sozialer Gruppen oder den<br />
Besonderheiten formaler Organisationen annähern. Inwieweit das eine oder das<br />
andere der Fall ist, hängt u. a. von der Größe des Vereins, seinem Alter, der Zahl<br />
der angebotenen Sportarten, aber auch von den jeweiligen Interessen der<br />
Mitglieder ab.<br />
Heinemann beschreibt die Vermengung zweier entgegengesetzter Strukturprinzipien<br />
wie folgt:<br />
„In Vereinen müssen zwei miteinander letztlich unverträgliche Strukturformen in ein und<br />
derselben Einheit miteinander verknüpft werden. So müssen alle Struktureigenschaften der<br />
Organisation neben ihren primären Zwecken auch die Funktion der Einbindung der<br />
Mitglieder und ehrenamtlichen Mitarbeiter erfüllen.“ (Heinemann, 2004, S. 82)<br />
Die motivierende Kraft der Mitglieder zur Erfüllung von Vereinsaufgaben kann<br />
durch Arbeitsteilung und Formalisierung beeinträchtigt werden. Daher dürfen<br />
Sitzungen nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten gestaltet werden, sondern sie<br />
dienen auch der sozialen Integration und Kommunikation. Der Verein muss sich<br />
auf zeitliche Verfügbarkeit, fachliche Kompetenz und Engagementbereitschaft<br />
einstellen und daher organisatorische Regelungen und individuelle Festlegungen<br />
zur Durchführung und Aufrechterhaltung des Vereinsangebots treffen. Diese<br />
Regelungen und Festlegungen können zur Begrenzung des Arbeitseinsatzes der<br />
ehrenamtlichen Mitarbeiter führen, was auch vor Überlastung der Mitarbeiter<br />
schützt. Aber mit der Verringerung des zeitlichen Aufwandes<br />
verringert sich<br />
zugleich die Einbindung in die Gruppe, es verringern sich Möglichkeiten der<br />
Selbstentfaltung, also Gegebenheiten, die wesentlich zur Freiwilligenarbeit<br />
motivieren (vgl. Horch, 1987, S. 136). Die gängige Analyse in der Organisationsforschung<br />
sieht eine Trennung vor, welche aber bei Vereinen nicht durchzuhalten<br />
ist, da sich die Perspektive der Organisation und der Mitglieder sich immer wieder<br />
vermengen (vgl. Heinemann, 2004, S. 82).<br />
8
3.1.3 Konstitutive Merkmale des Vereins und die Abhängigkeit von den<br />
Interessen der Mitglieder<br />
Mit den zuvor dargestellten Herausforderungen lassen sich für den Rechtskörper<br />
Verein folgende konstitutive Merkmale aufzeigen.<br />
• Orientierung an den Interessen der Mitglieder<br />
„Interessenorientierung bedeutet, dass Mitgliedschaft begründet wird und die Mitglieder<br />
dem Verein Ressourcen (im wesentlichen Mitgliedsbeiträge und Zeit für ehrenamtliche<br />
Mitarbeit) zur Verfügung stellen, solange der Verein ein den Interessen seiner Mitglieder<br />
entsprechendes Leistungsangebot macht.“ (Heinemann, 2004, S. 82)<br />
Ziele der Organisation und Mitgliedschaftsmotivation der Mitglieder sind nicht<br />
voneinander getrennt. Die Leistungsstrukturen müssen den Erwartungen der<br />
Mitglieder entsprechen (vgl. Blau & Scott, 1993, S. 45).<br />
• Freiwillige Mitgliedschaft<br />
Eine Person kann sich für einen Verein entscheiden, wenn Ziele und Angebote<br />
seinen Interessen und Wünschen entsprechen. Anderseits kann diese Person<br />
austreten, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden.<br />
„Freiwillige Mitgliedschaft ist Voraussetzung und Rechtfertigung für eine Autonomie der<br />
Vereine. (…) Autonomie bedeutet u. a. auch, dass der Verein die Bereitstellung von<br />
Ressourcen durch die Mitglieder (z. B. Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Mitarbeit)<br />
zur Bedingung der Mitgliedschaft machen kann, die Mitgliedschaft also freiwillig, die<br />
Leistungen aber verpflichtend sind.“ (Heinemann, 2004, S. 83)<br />
• Unabhängigkeit von Dritten<br />
Die Unabhängigkeit begründet sich darauf, dass sich der Verein durch die<br />
finanziellen und sonstigen Leistungen der Mitglieder selbst trägt, also aus<br />
eigener Kraft, woraus sich auch die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit<br />
ergeben. Diese Unabhängigkeit macht den Verein abhängig von den Beiträgen<br />
und der Freiwilligenarbeit der Mitglieder.<br />
• Freiwilligenarbeit<br />
Freiwilligenarbeit stellt in Vereinen eine wesentliche Ressource dar, die für die<br />
Leistungserstellung selbst eine zentrale Bedeutung besitzt (vgl. Winkler, 1988,<br />
S. 29). Aber ehrenamtliche Tätigkeit ist meist Laienarbeit – neben den hohen<br />
Kosten der Entscheidungsfindung ein Grund dafür, dass man davon ausgehen<br />
muss, dass Vereine oft weniger effizient arbeiten als kommerzielle Betriebe<br />
9
(vgl. Weber, 1911; Heinemann & Schubert, 1994). Freiwillige Mitarbeit gibt<br />
dem Mitglied die Möglichkeit sich zu engagieren, sein Engagement teilweise zu<br />
verweigern oder aus dem Verein auszutreten, wodurch dem Verein der Austritt<br />
und damit der Verlust von Mitgliedsbeiträgen droht.<br />
• Demokratische Entscheidungsstruktur<br />
Demokratische Entscheidungsstrukturen sind für Vereine verbindlich. Es<br />
erfolgen Entscheidungen direkt oder indirekt durch die Mitglieder in demokratischen<br />
Abstimmungen. Die Machtbasis in Vereinen ist das Stimmrecht.<br />
Dabei dürfen die meist hohen Kosten der Entscheidungsfindung in<br />
demokratischen Gremien nicht unterschätzt werden: Sehr unterschiedliche<br />
Bereitschaft zur Mitarbeit bei den einzelnen Mitgliedern; seltenen Sitzungen;<br />
Besetzung der Gremien nach Wahl oder Delegation, bei denen fachliche<br />
Kompetenz nicht notwendigerweise den Ausschlag gibt; hohe zeitliche<br />
Belastung der einzelnen Mitglieder durch Ämterhäufung; unklare Festlegung<br />
der Ziele und Aufgabenfelder und dadurch geringere Kontrolle des Arbeitserfolges;<br />
ungenügende Abstimmung zwischen einzelnen Gremien, mit der Zahl<br />
der Gremien wachsende Partikularinteressen, die eine Gesamtverantwortung<br />
erschweren und eine sehr stark personenbezogenen Arbeitsweise und<br />
Kommunikation sind einige Gründe für Ineffizienz und Unzulänglichkeiten auf<br />
Freiwilligenarbeit basierender demokratischer Entscheidungsfindung (vgl.<br />
Heinemann, 2004, S. 84.) Die demokratische Entscheidungsstruktur in einem<br />
Verein gibt dem Mitglied durch sein Stimmrecht das Einflussmittel des<br />
Widerspruchs.<br />
Die Besonderheiten von Sportvereinen führen häufig zu einer eher improvisierten<br />
Organisation, die durch einen hohen Anteil von informeller Kommunikation<br />
gekennzeichnet ist. Die einzelnen Mitglieder können ihre Kompetenz einbringen<br />
und versuchen durch mögliche Sanktionen (z. B. Einschränken ihres<br />
Engagements) ihre Interessen durchzusetzen. Grundsätzlich hängt der Verein von<br />
den Eigenheiten der Mitglieder ab, die wiederum nicht zwingend von Effizienz,<br />
sondern eher von Emotionen getrieben werden, d. h. die Mitglieder streben nicht<br />
zwingend nach Wirtschaftlichkeit (vgl. Heinemann, 2004, S. 86)<br />
10
3.2 Die soziale Architektur von Sportvereinen<br />
Bei einem Sportverein handelt es sich um eine soziale Architektur, d. h. um eine<br />
bewusst und rational gestaltete Ordnung (vgl. Heinemann, 2004, S. 86), die im<br />
Folgendem näher untersucht wird.<br />
3.2.1 Ziele der Sportorganisation<br />
Die zentrale Aufgabe in einer Sportorganisation ist es ihre jeweiligen, vielfältigen<br />
Ziele zu erreichen. Die Organisationsstruktur sollte so gestaltet sein, dass der<br />
Verein die angestrebten Ziele erreichen kann. Doch damit die Ziele zur<br />
Orientierung und Klarheit für diejenigen dienen können, die sich im Verein<br />
engagieren, müssen die Ziele zunächst eindeutig festgelegt werden. Dabei<br />
besteht die Herausforderung in der Erarbeitung von klaren Zielvorgaben.<br />
Allgemeine Ziele stehen in der Regel in der Satzung von Vereinen, doch diese<br />
können veraltet sein oder so allgemein verfasst sein, dass sie nur als<br />
Leitvorstellung verwendet werden können.<br />
3.2.1.1 Arten von Zielen<br />
Das primäre Ziel einer Organisation ist das Ziel der Systemerhaltung, d. h. die<br />
Sicherung des Überlebens der Organisation. Ein weiteres Ziel ist die<br />
Herausbildung einer spezifischen Ideologie bzw. Organisationsphilosophie und<br />
somit die Schaffung von Werten und Visionen. Dadurch betont der Verein seine<br />
Verantwortung und seine Dienste für das Gemeinwohl und versucht sich<br />
gegenüber Dritten aufzuwerten. Neben ideologischen Zielen verfolgt ein Verein<br />
auch Sachziele wie beispielsweise die Art der bereitgestellten Sportprodukte (vgl.<br />
Heinemann, 2004, S. 95 ff.). Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang<br />
zwischen ideologischen Zielen eines Sportvereins und ihrer Umsetzung in<br />
Sachziele. So können die ideologischen Ziele Gemeinwohl und Sport für alle<br />
erreicht werden, indem zum Beispiel die Sachziele Talentförderung oder<br />
Seniorensport angestrebt werden.<br />
11
Abb. 3.3: Die Übersetzung von ideologischen Zielen in Sachziele (Heinemann, 2004, S. 98)<br />
Damit Sachziele realisiert werden können, müssen diese in operative Ziele<br />
umgesetzt werden, die festlegen, was getan werden muss, um die Sachziele zu<br />
erreichen. Zur weiteren Konkretisierung müssen die operativen Ziele operationalisiert<br />
werden, denn operationale Ziele ermöglichen die operativen Ziele in<br />
empirisch ermittelbare Messwerte umzuwandeln, so dass festgestellt werden<br />
kann, ob die gesetzten Ziele in der Tat erreicht wurden.<br />
Bei dieser Operationalisierung der Sachziele ergeben sich gerade für Sportvereine<br />
unter anderen folgende Probleme:<br />
• Personenbezogene Dienstleistungen lassen sich nicht ohne Weiteres mit<br />
operationalen Zielen standardisieren und kontrollieren.<br />
• Bildungs- und Erziehungsziele sind nicht quantifizierbar und operationalisierbar,<br />
vielmehr können sie nur reflektiert und diskutiert werden.<br />
• Die Festlegung operativer Ziele kann die Erreichung der Sachziele<br />
erschweren, verfälschen oder gar verhindern. Operative Ziele können das<br />
Verhalten u. U. in einer Form steuern, dass es zu Widersprüchen mit den<br />
Sachzielen bzw. der Organisationsphilosophie kommen kann.<br />
Das Problem bei dem Erreichen aller Ziele besteht in dem Zusammenspiel der<br />
einzelnen Ziele. Wird der Erfolg alleine an operationalen Zielen gemessen, besteht<br />
die Gefahr, dass die ursprünglichen Sachziele und insbesondere die<br />
ideologischen Ziele aus dem Fokus verschwinden (vgl. Heinemann, 2004, S. 101)<br />
Weitere Ziele sind Motivationsziele und positionale Ziele.<br />
12
„Motivation bedeutet, dass in einer Organisation ein bestimmtes, auf die Erreichung der Ziele<br />
der Organisation ausgerichtetes Verhalten bewirkt, gelenkt, erhalten und gegebenenfalls<br />
auch wieder beendet wird. Bei diesem Typus von Zielen geht es also letztlich um eine<br />
adäquate Einbindung der Mitglieder bzw. Mitarbeiter in die Organisation und die Schaffung<br />
einer erforderlichen Leistungsbereitschaft.“ (Heinemann, 2004, S. 101 f.)<br />
Sportvereine sind mit ihrem Umfeld verbunden. In diesem Geflecht der Einbettung<br />
muss sich ein Verein seine Position und seinen Einfluss erkämpfen.<br />
„Positionale Ziele beinhalten also, welche Einflusschancen die Organisation gegenüber der<br />
kommunalen Verwaltung oder gegenüber anderen Organisationen erringen möchte und<br />
welche Formen der Kooperation mit anderen Organisationen für erstrebenswert gehalten<br />
werden und welches Image sie in der Öffentlichkeit anstreben.“ (Heinemann, 2004, S. 102)<br />
Abb. 3.4: Das hierarchische Zielsystem einer Sportorganisation (Heinemann, 2004, S. 102)<br />
Verschiedene Ziele sind hierarchisch geordnet und sie stehen in einem sinnvollen<br />
Zusammenhang. Erst aus diesem Kanon von Zielen entwickeln sich die Strukturen<br />
der Organisation und das Handeln, das zur Erreichung der Ziele erforderlich ist.<br />
Die Abb. 3.4 dient der Veranschaulichung der beschriebenen Ziele.<br />
Darüber hinaus lassen sich Ziele in kontinuierliche und einmalige Ziele unterteilen,<br />
wobei letztgenannte zu genau definierten, zeitlich befristeten Projekten führen.<br />
3.2.1.2 Funktionen von Organisationszielen<br />
Die Notwendigkeit, klare Ziele zu formulieren und darüber auch Konsens zu<br />
erzielen, wird mit der Bedeutung und den Funktionen deutlich, die die Ziele in<br />
einer Sportorganisation besitzen:<br />
• Ziele sind Grundlage der Entscheidungsfindung, was bedeutet, dass Ziele<br />
Handlungs- und Entscheidungsalternativen reduzieren<br />
13
• Ziele sind Vorraussetzung für eine Leistungs- und Erfolgskontrolle, wodurch<br />
dann Ergebnisse analysiert und kritisch hinterfragt werden können<br />
• Ziele verringern Risiken und Unsicherheiten, was einen positiven<br />
psychologisch-symbolischen Effekt bewirkt. Wer sich klare Ziele setzt,<br />
verringert subjektiv Unsicherheiten, weil man von der Gewissheit ausgehen<br />
kann, alles unternommen zu haben, um seine Ziele zu erreichen.<br />
• Ziele motivieren die Mitarbeiter und binden diese in einen Sportverein ein.<br />
Ziele sind Orientierungspunkte für das Handeln der Mitglieder und die<br />
Einbindung gelingt umso eher, je mehr die Mitglieder auch an dem Prozess<br />
der Festlegung der Ziele beteiligt wurden und wenn über die Ziele Konsens<br />
besteht.<br />
• Ziele dienen der Legitimation und dies gilt im Besonderen für ideologische<br />
Ziele. Sie sind Instrumente, um öffentliche Anerkennung zu erhalten,<br />
Vertrauen zu gewinnen und das Image zu verbessern.<br />
3.2.1.3 Probleme der Zielbestimmung und Durchführung<br />
„Gerade in großen Sportvereinen und Verbänden, in denen die Ziele der Organisation mit<br />
den Interessen der Mitglieder übereinstimmen müssen, da diese Ziele das Motiv für die<br />
Mitgliedschaft sind, wird es schwer sein, einen klar formulierten und gleichzeitig von allen<br />
Mitgliedern anerkannten Zielkatalog festzulegen. Dies gilt nicht nur für die ideologischen<br />
Ziele, sondern auch für viele Sachziele. Das hat zur Folge, dass Ziele nur sehr global und<br />
allgemein, oft ohne konkreten Inhalt formuliert sind, man sagt auch, bloße „Leerformeln“<br />
sind. In diesen allgemeinen Formeln kann sich dann zwar jeder mit seinen Vorstellungen<br />
wiederfinden. Als Richtlinien organisatorischen Handelns und vor allem zur Bestimmung<br />
erfolgreicher Arbeit der Organisation und ihrer Effizienz nutzten solche Formeln allerdings<br />
wenig.“ (Heinemann, 2004, S. 105)<br />
„Ziele und Aufgaben sind das Resultat permanenter Verhandlungsprozesse zwischen<br />
verschiedenen Gruppierungen der Mitglieder, Abteilungen, Koalitionen etwa um<br />
Budgetaufteilung, Aufgabenverteilung, Aufrechterhaltung von Privilegien, Einflusschancen,<br />
Verantwortung, Sicherung von Mehrheiten und Wiederwahl, Zugeständnisse und<br />
Verpflichtungen an die verschiedenen Interessengruppierungen etc. (…) In der Fähigkeit<br />
bzw. dem Recht, Ziele setzen zu können bzw. in der Verpflichtung, die Ziele akzeptieren zu<br />
müssen, drückt sich ein Gefälle von Macht und Herrschaft aus.“ (Heinemann, 2004, S 106)<br />
Ziele in einem Sportverein sind nicht als objektiv, d. h. vom Einzelnen unabhängig<br />
zu sehen, sondern nur als sozial konstruierten Tatbestand. Ziele von Sportvereinen<br />
sind nicht eindeutig zu bestimmen, sondern sie sind subjektive Konzepte,<br />
die von den Deutungen und Bedeutungen, von Wertvorstellungen und Bestrebungen,<br />
Interpretationen und relativer Relevanz der verschiedenen Personen<br />
und Personengruppen abhängig. Ziele schaffen die Orientierung, an denen sich<br />
Entscheidungen in einem Sportverein auszurichten haben. Es sollte also Klarheit<br />
14
darüber bestehen, wohin der Sportverein steuern will. Der Prozess der Zielbestimmung<br />
ist selbst ein politischer Prozess, in dem unterschiedliche Interessen,<br />
Einflusschancen und damit auch Konflikte ausgetragen werden. Dieser Prozess ist<br />
nie endgültig abgeschlossen (vgl. Heinemann, 2004, S 108 f.).<br />
3.2.2 Die Struktur von Sportvereinen<br />
Im Folgenden wird zuerst in Anlehnung an Heinemann „Sportorganisation“ die<br />
Struktur von Sportorganisationen dargestellt. Im Anschluss wird auf die<br />
Problematik der Übertragung dieses Strukturbegriffes auf die Masse der Sportvereine<br />
eingegangen. Klaus Heinemann (2004, S. 110) verdeutlicht die Struktur<br />
von Sportorganisationen folgender Maßen:<br />
„Die Struktur ist die dauerhafte Ordnung einer Sportorganisation; sie kann als Skelett einer<br />
Organisation verstanden werden. Mit ihr wird beschrieben, welche „Stellen“ bzw. Positionen<br />
bzw. Abteilungen es in einer Organisation gibt, und welche Aufgaben und welche<br />
Verantwortungen ihnen zugeordnet werden; wie die Hierarchie gestaltet ist, wer also<br />
Anforderungen geben kann und wer diese Anforderungen auszuführen hat; wie die<br />
Koordination der verschiedenen, arbeitsteilig erfüllten Aufgaben erfolgt; in welcher Form die<br />
Erfüllung der Anweisungen und Verpflichtungen der Mitarbeiter/ Mitglieder kontrolliert wird.“<br />
3.2.2.1 Formen der Arbeitsteilung und ihre Auswirkung auf die Organisation<br />
Unter Arbeitsteilung wird die Differenzierung und Aufgliederung von Aufgaben in<br />
unterschiedliche Teilaufgaben verstanden. Dabei ist zwischen horizontaler/<br />
funktionaler und vertikaler/ hierarchischer Gliederung einer Sportorganisation (vgl.<br />
Abb. 3.5) zu unterscheiden.<br />
15
Abb. 3.5: Formen der Arbeitsteilung (Heinemann, 2004, S. 111)<br />
Bei der horizontalen Arbeitsteilung wird zwischen segmentierter, objektbezogener<br />
und funktionsspezialisierte Arbeitsteilung unterschieden. Wird eine Organisation in<br />
Bereiche gegliedert, die ähnliche Arbeiten zu erledigen haben, so ist dies als<br />
segmentierte Arbeitsteilung zu bezeichnen, sofern eine Aufteilung nach unterschiedlichen<br />
Regionen oder Märkten vorliegt. Solch eine Teilung findet man häufig<br />
bei Sportfachverbänden, so hat z. B. jeder Landesverband in etwa die gleichen<br />
Aufgaben, aber jeweils in unterschiedlichen Regionen. Hingegen liegt eine objektbezogene<br />
Arbeitsteilung vor, wenn ähnliche Aufgaben an unterschiedlichen<br />
Objekten erledigt werden müssen (vgl. Heinemann, 2004, S. 112). Dies gilt u. a.<br />
für Sportvereine, die mehrere Sportarten in entsprechenden Abteilungen anbieten<br />
z. B. gibt es eine Sparte für Fußball, Leichtathletik und Judo. Bei einer<br />
funktionsspezialisierte Arbeitsteilung müssen unterschiedliche Funktionen am<br />
gleichen Objekt erfüllt werden, z. B. kann ein Trainer – und zwar für alle Sportler –<br />
für Konditionstraining, ein weiterer für Strategie und Taktik und ein weiterer für die<br />
Wettkampforganisation verantwortlich sein. Diese lässt sich nochmals unterteilen<br />
in verkettete und inklusive Arbeitsteilung.<br />
16
„Bei einer verketteten Arbeitsteilung wird die Gesamtaufgabe in Teilaufgaben aufgegliedert,<br />
und zwar so, dass die Teilaufgaben hintereinander erfüllt werden müssen. (…) Eine inklusive<br />
Arbeitsteilung ist dann gegeben, wenn verschiedene Mitarbeiter einem Vorgesetzten<br />
zuarbeiten, der wiederum innerhalb einer Organisation eine Teilaufgabe zu erfüllen hat, die<br />
erforderlich ist, damit die Organisation ihre Ziele erreichen kann.“ (Heinemann, 2004, S.<br />
114 f.)<br />
Des Weiteren muss noch unterschieden werden in den Grad der Spezialisierung,<br />
also den Umfang der Zerlegung in funktionale Teilaufgaben, und inwieweit<br />
Abteilungen gebildet worden sind, d. h. einzelne Aufgaben in Arbeitsbereiche<br />
zusammengefasst werden (vgl. Heinemann, 2004, S. 116 f.). Es gibt einerseits<br />
eine Funktionsgliederung, welche eine Abteilungsbildung entsprechend der<br />
Stellung in der Wertschöpfungskette darstellt, und andererseits eine<br />
Aufgabengliederung, welche nach zu erfüllenden Aufgaben bzw. bereitgestellter<br />
Produkte gegliedert ist. Letzteres erfolgt in Sportvereinen, in denen nach<br />
verschiedenen Sportarten, die dort angeboten und betrieben werden können,<br />
gegliedert wird.<br />
Eine Verknüpfung der beiden Formen der Bildung von Abteilungen ist die Matrix-<br />
Organisation. Abb. 3.6 zeigt das Grundprinzip einer Matrixstruktur, wie sie in<br />
großen Sportvereinen mit verschiedenen Sparten A-D verwirklicht werden<br />
könnten. Auf der einen Seite besteht eine Abteilungsbildung entsprechend der<br />
verschiedenen Sportarten. Der Leiter der jeweiligen Abteilung ist für alle mit seiner<br />
Sportart zusammenhängenden Fragen verantwortlich. Aber für verschiedene<br />
Funktionen in der Wertschöpfungskette werden besondere Stellen eingerichtet,<br />
die alle Sportarten versorgen. Eine Stelle entwickelt neue Sportprogramme, mit<br />
denen sensibel auf die Entwicklung neuer Sportarten und Veränderungen in den<br />
Interessen der Sportler und neuer Mitglieder reagiert werden kann. Eine andere<br />
entwickelt Zusatzprogramme (Reisen, kulturelle Aktivitäten, Sport für<br />
Sondergruppen), eine weitere bietet den Mitgliedern aller Abteilungen eine<br />
allgemeine Beratung an (Gesundheit und Ernährung, medizinischer und<br />
psychologischer Dienst etc.), weitere Abteilungen sind für Finanz- und<br />
Mitgliederverwaltung, für Marketing und Werbung und für die Schulung und<br />
Weiterbildung der Mitglieder in den verschiedenen Aufgaben und Funktionen<br />
zuständig.<br />
„Es ist dabei klar zu regeln, dass die Leiter der Sparten für den Erfolg ihrer Abteilung<br />
verantwortlich sind und entsprechende Anweisungen geben können, die Leiter der<br />
Funktionsabteilungen in ihrem Bereich Verantwortung tragen und zwischen den beiden eine<br />
sinnvolle Koordination stattfindet.“ (Heinemann, 2004, S. 119).<br />
17
Abb. 3.6: Matrixstruktur einer Sportorganisation (Heinemann, 2004, S. 118)<br />
Die in einer Organisation verwirklichten Formen der Arbeitsteilung werden in<br />
einem Organisationsplan (Organigramm) dargestellt.<br />
Eine weitere Dimension einer Arbeitsteilung ist der Rang der jeweiligen<br />
Teilaufgaben in einem hierarchischen gegliederten Gefüge der Organisation, also<br />
eine Aufteilung in oben und unten. Aufgrund der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft<br />
und Mitarbeit ist die Tiefe der Organisationsstruktur in vielen Sportvereinen im<br />
Verhältnis zu anderen Sportorganisationen relativ flach, d. h. es existieren<br />
unterhalb der Führungsebene nur wenige weiteren Entscheidungsebenen (vgl.<br />
Heinemann, 2004, S. 123). Diese flache Organisationsstruktur gilt u. a. für<br />
Sportvereine wo der Vereinsvorstand die Organisationsspitze und wo Sportabteilungen<br />
die einzige Untergliederung bilden.<br />
Abb. 3.7: Beispiel für eine flache Organisation (Heinemann, 2004, S. 123)<br />
Zusammengefasst ist „die Struktur einer Organisation ist so zu gestalten, dass die Ziele so gut wie<br />
möglich erreicht werden können. Aber diese so einfach klingende Aufgabe ist nur sehr schwer zu<br />
erfüllen, denn:<br />
• Es gibt nicht „das“ Ziel einer Organisation, sondern ein ganzes, z. T. in sich<br />
widersprüchliches Zielbündel, das selbst ein sich ständig änderndes Ergebnis<br />
organisationspolitischer Auseinadersetzungen ist.<br />
• Aus Zielen leiten sich nicht zwingend „die“ beste Organisationsstruktur ab. Viele Wege<br />
führen gleichermaßen zum Ziel. Auch über jedes Element einer Struktur muss in Kenntnis<br />
seiner Vor- und Nachteile entschieden werden. (…)<br />
• Organisationen lassen sich (…) nur in geringem Umfang durch Strukturen steuern.<br />
Strukturen sollen optimale Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich die Mitglieder/<br />
Mitarbeiter mit ihren Potentialen optimal im Interesse der Organisation entfalten können.<br />
(…)<br />
• Ein unabänderlicher Grundsatz in einer Organisation muss sein: Entscheidungskompetenz<br />
und Verantwortung müssen in einer Hand liegen. Man kann niemand für die Folgen seines<br />
18
Handelns verantwortlich machen, der darüber nicht eigenständig entscheiden durfte.“<br />
(Heinemann, 2004, S. 127)<br />
3.2.2.2 Besonderheiten der Strukturmuster von Sportvereinen<br />
Die Übertragung des gerade erläuterten Strukturbegriffes auf Sportvereine ist<br />
schwierig, weil es sich bei Sportvereinen um eine eigentümliche Mischung von<br />
Elementen sozialer Gruppen und formaler Organisationen handelt (vgl. Kap.<br />
3.1.2).<br />
„Der Sportverein unterscheidet sich in wichtigen Merkmalen von formalen Organisationen<br />
wie Betrieben und Verwaltung, aber auch von sozialen Gruppen. Die Aufgabenerfüllung ist<br />
personenbestimmt, Führung basiert auf persönlicher Ausstrahlung und Autorität, die<br />
Kontrolle erfolgt im wesentlichen durch soziale Beziehungen.“ (Heinemann, 2007, S. 136).<br />
Dies wird in den folgenden Punkten deutlich, in denen typische Muster der<br />
Steuerung und Koordination des Verhaltens in Sportvereinen dargestellt werden.<br />
Interaktionsverfestigung: Das Verhalten in einem Sportverein wird in wesentlich<br />
geringerem Ausmaß als in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen durch<br />
festgelegte, bewusst auf das Ziel ausgerichtete und rational geplante Regeln<br />
gesteuert. Formalisierte Mitgliedschaftsanforderungen sind sehr gering (oft nur<br />
Mitgliedsbeitragszahlung) und die Mitarbeit und Zusammenarbeit ist stärker durch<br />
informelle soziale Prozesse gesteuert, die sich wiederum erst im Laufe der Zeit<br />
verfestigen (vgl. Heinemann, 2004, S. 120 f.).<br />
Personalisierung: In Sportvereinen sind Positionen wenig differenziert und ihre<br />
Aufgaben wenig standardisiert, so dass Ämter meist wesentlich von dem<br />
Engagement und den Fähigkeiten des jeweiligen Amtsinhaber bestimmt werden.<br />
(vgl. Heinemann, 2004, S. 121). Im Gegensatz zur Standardisierung und<br />
Spezialisierung in professionellen Organisationen tritt im Sportverein „in relativ<br />
hohem Ausmaß eine Personalisierung der Verhaltenserwartungen“ (Heinemann,<br />
2007, S. 135) auf.<br />
Informelle Kontrolle: Bis auf die Androhung des Ausschlusses bzw. den<br />
Ausschluss gibt es im Sportverein in der Regeln nur informelle Sanktionen, wie<br />
Tadel, Ironisierung, Scherze, demonstratives Schweigen, abrupter Themenwechsel,<br />
Unaufmerksamkeit u. ä. unter den Mitgliedern.<br />
19
Selbstbestimmung und Führung: „Da der Verein in der Regel aus Gründen der<br />
Motivation der Mitglieder weniger arbeitsteilig organisiert sein kann als z. B. ein<br />
Betrieb, besteht nur ein geringer Koordinationsbedarf.“ (Heinemann, 2004, S.<br />
121). Es erfolgt eher Selbstabstimmung in Zusammenkünften, Treffen, Komitees<br />
u. ä. Die Führung basiert auf persönlicher Ausstrahlung und Überzeugungskraft<br />
einzelner.<br />
Einflussnahme über persönliche Beziehungen: Umweltkontakte laufen im<br />
Sportverein vor allem über konkrete Personen mit besonderen Beziehungen.<br />
„Durch Mitgliedschaft und Mitarbeit in verschiedenen Vereinen kann der Verein im<br />
Einzelfall über ein Geflecht von Beziehungen verfügen, das den direkten Zugang<br />
zu vielen relevanten Institutionen und Personen ermöglicht.“ (Heinemann, 2004<br />
S. 122)<br />
3.2.2.3 Elemente eines Organisationsdesigns<br />
Die bisherigen Ausführungen stellten formal die Bausteine vor, mit denen die<br />
soziale Architektur der Sportorganisation ausgestaltet werden kann. Mintzberg<br />
(1979) gibt diesen Bausteinen eine konkrete, inhaltliche Ausführung. So<br />
unterscheidet er folgende fünf Bestandteile (vgl. Abb.3.8), die im folgendem aus<br />
Sicht eines Sportvereins beschrieben werden.<br />
Abb.3.8: Die Bestandteile eines Organisationsdesigns (Heinemann, 2004, S. 128)<br />
Die strategische Spitze eines Sportvereins ist der Leiter der Organisation, der die<br />
gesamte Organisation überblicken muss. Er ist verantwortlich für die Planung der<br />
20
längerfristigen Entwicklung des Vereins und überwacht bzw. kontrolliert die Arbeit<br />
und kümmert sich um die Beschaffung der erforderlichen Ressourcen für den<br />
operativen Kern der Organisation. Zu dem operativen Kern zählen die Trainer, die<br />
die breite Basis bilden, um den Sport den Mitgliedern und Kunden anzubieten. In<br />
der Autoritätshierarchie zwischen operativem Kern und strategischer Spitze ist ab<br />
einer gewissen Größe ein mittleres Linienmanagement nötig, um den Vereinsleiter<br />
zu unterstützen. Im Sportverein zählen hierzu die Abteilungsleiter. Zur Erledigung<br />
bestimmter administrativer und technischer Aufgaben können in einem größeren<br />
Sportverein weitere Mitarbeiter benötigt werden, die u. a. für die Arbeitsvorbereitung<br />
zuständig sind, wie z. B. die Platzpflege (Greenkeeper, Hallenwart<br />
etc.). Weitere unterstützende Einheiten wie z. B. Mitarbeiter in einer Cafeteria oder<br />
eine Sekretärin zur Mitgliederverwaltung können für einen Sportverein notwendig<br />
sein.<br />
Die strategische Spitze, das mittlere Linienmanagement und die breite operative<br />
Basis sind normalerweise durch eine Autoritätskette miteinander verbunden. Die<br />
Technostruktur und die unterstützenden Einheiten erbringen für alle drei Ebenen<br />
Serviceleistungen, sie sind getrennt von dieser Autoritätsachse und daher auf der<br />
Abb. 3.8 an den beiden Seiten platziert.<br />
Die aufgeführten Bestandteile einer Organisation bedürfen jeweils entsprechender<br />
Koordination und Kontrolle. Hierauf wird im Folgenden eingegangen. Der<br />
Sportverein unterliegt hierbei wieder besonderen Bedingungen.<br />
3.2.2.4 Koordination und Kontrolle<br />
Um optimale Ziele in der Sportorganisation zu erreichen, muss es gelingen, die<br />
spezialisierten Arbeitsbereiche zu koordinieren. Dabei gilt es zu verhindern, dass<br />
partikulare Interessen und egoistisches Streben einzelner Bereiche in einer<br />
Organisation (Personen, Abteilungen, Sparten, Mitgliedsverbände) überhand<br />
nehmen. Diese Gefahr besteht, da Mitarbeiter bzw. Mitglieder der Teilbereiche<br />
eine individuelle Wahrnehmung und Wirklichkeitsinterpretation sowie Denkgewohnheiten<br />
haben und sich eigene Ziele und Aufgaben definieren. Dadurch<br />
können sich innerhalb eines Vereins Subkulturen entwickeln, die zu vielfältigen<br />
Konflikten, Grabenkämpfen, Fehlabstimmungen und Kommunikationsbarrieren<br />
führen können (vgl. Heinemann, 2004, S. 130).<br />
21
Um dem entgegen zu wirken stehen die Instrumente gegenseitige Abstimmung<br />
und die Anordnung zur Verfügung.<br />
Koordination durch gegenseitige Abstimmung<br />
Gegenseitige Absprache und Verhandeln<br />
„Gegenseitige Absprache ist ein informelles oder auch institutionell festgelegtes Verhalten,<br />
bei dem Mitarbeiter miteinander kommunizieren und dabei eine Verständigung über die<br />
anstehenden Probleme, die Art, wie diese Probleme bewältigt werden können und den<br />
Beitrag, den jeder der Beteiligten dazu erbringen soll, erzielen.“ (Heinemann, 2004, S. 130).<br />
Vorzufinden ist dies u. a. in Sportvereinen, da hier „nur ein geringes Maß an<br />
Formalisierung und Standardisierung möglich ist, da Mitgliedschaft und Mitarbeit<br />
freiwillig sind, so dass die Bereitschaft, sich formalen Regeln oder gar bürokratischen<br />
Standards unterzuordnen, gering ist“ (Heinemann, 2004, S.131)<br />
Demokratische Entscheidungen<br />
„Demokratische Entscheidung bedeutet die Öffnung der sozialen Beziehungen innerhalb der<br />
Organisation nach den Grundsätzen der Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit (Schluchter,<br />
1972, S. 161). Jedes Mitglied hat das gleiche Stimmrecht; die Koordination erfolgt durch<br />
Mehrheitsentscheidungen.“ (Heinemann, 2004, S. 132)<br />
Dies ist für Vereine verbindlich. Nach Satzungen bestimmen die Mitglieder – direkt<br />
oder indirekt – gleichberechtigt, was in ihrem Verein geschehen soll. Formal<br />
zumindest liegen die Geschicke des Vereins in der Hand des souveränen<br />
Mitglieds (vgl. Heinemann, 2004, S. 132).<br />
Anordnung<br />
Macht und Herrschaft - Amtskompetenz<br />
„Herrschaft soll die Chance heißen, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei anderen<br />
Personen Gehorsam zu finden (Weber, 1956, 28). Diese Chance soll im Folgenden als<br />
Amtskompetenz bezeichnet werden. (…) Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer<br />
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen, gleichviel<br />
worauf diese Chance beruht. (Weber, 1956, 28).“ (Heinemann, 2004, S. 134)<br />
In Sportvereinen kann es zu Formen der Oligarchisierung kommen, „durch die die<br />
demokratische Verfassung des Vereins unterlaufen wird, indem es wenige und immer wieder<br />
dieselben sind, die über die Geschicke des Vereins entscheiden; diese wenigen bleiben über<br />
längere Zeiträume, oft mehrere Jahrzehnte, im Amt; sie bilden eine eigene subkulturelle,<br />
geschlossene Gruppierung.“ (Heinemann, 2004, S. 134)<br />
Jedoch „aufgrund der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft werden sich die Mitglieder<br />
nicht gegen ihren Willen den Anordnungen etwa der Vorstandsmitglieder beugen“<br />
(Heinemann, 2007, S. 150), sondern im Extremen ihre Mitgliedschaft beenden.<br />
22
Fachliche Autorität<br />
„Fachliche Autorität oder funktionale Autorität basiert auf einer Anerkennung der besonderen<br />
fachlichen Kompetenz, des spezifischen Wissens und der (bewiesenen) Fähigkeit einer<br />
Person zur Lösung von abgebbaren Problemen. Sie begründet sich auf einer<br />
Folgebereitschaft für Sachargumente.<br />
Dem gegenüber ist Amtskompetenz durch Recht, Regeln und Verfahren begründet, an eine<br />
Position (Amt) gebunden und damit legitimiert. Fachliche Autorität ist an die jeweilige Person<br />
gebunden und durch ihre besondere fachliche Kompetenz begründet. Fachliche Autorität<br />
legitimiert sich nicht durch Verfahren, sondern durch die Inhalte der Kompetenz.<br />
Folgebereitschaft resultiert nicht, wie bei der Amtsautorität aus „Gehorsam“, sondern aus der<br />
Anerkennung der Kompetenz. (…) Da die Anerkennung der fachlichen Autorität – im<br />
Gegensatz zur Amtsautorität – an die Person mit ihren besonderen Fähigkeiten,<br />
Kompetenzen und Qualifikationen gebunden ist, bleibt Fachautorität labil, weil sie ständig<br />
neu unter Beweis gestellt werden muss; es besteht eine strukturelle Unsicherheit, sowohl bei<br />
den Personen, die eine solche Autorität genießen („werde ich in meiner fachlichen Autorität<br />
noch anerkannt?“), als auch bei denen, die der funktionalen Autorität vertrauen („versteht er<br />
wirklich etwas von der Sache?“). Mit der fachlichen Autorität ist ein „Misstrauen auf Dauer“<br />
verbunden. (…) [Daher ist] Formalisierung und damit die Verfestigung der funktionalen<br />
Autorität in eine Amtsautorität (ist) eine wichtige und häufig zu beobachtende Tendenz zur<br />
Stabilisierung funktionaler Autoritätsstrukturen.“ (Heinemann, 2004, S. 135 f.)<br />
Sportvereine haben oft neben einem gesetzlich vorgeschriebenen,<br />
geschäftsführenden Vorstand einen erweiterten Vorstand. Dies kann die Funktion<br />
haben, dass durch Überführung von funktionaler Autorität in Amtsautorität eine<br />
größere Anzahl an Mitarbeitern in ihrer Machtausübung gestärkt werden wird.<br />
„Autorität in Vereinen muss sich [vor allem] (also) aus Charisma, Fachkompetenz,<br />
Erfahrung, besonderem Wissen, Beziehungen und Überzeugungskraft entwickeln;<br />
sie ist damit an Eigenschaften und Leistungsvermögen der Person gebunden.“<br />
(Heinemann, 2007, S. 150)<br />
Formalisierung<br />
„Formalisierung bedeute, dass die Erfüllung von Aufgaben, die dabei erforderliche<br />
Arbeitsteilung, die Arbeitsbeziehungen und die Art der Kommunikation in einer Organisation<br />
nach festgelegten Regeln und Normen erfolgt, die meist schriftlich festgelegt sind.<br />
Formalisierung beinhaltet also verbindliche Dauerregelung des Handelns in Organisationen.<br />
Sie ist das Gegenteil von Improvisation von Fall zu Fall. (…) Formalisierung setzt voraus,<br />
dass Mitglieder bereit sind, sich formalen Regeln zu unterwerfen. Diese Voraussetzung ist<br />
meist nur erfüllt, wenn man Mitarbeiter vertraglich dazu verpflichten kann, also am ehesten<br />
in Betrieben und Behörden, in denen ein Gehalt bezahlt wird (…), kaum aber in freiwilligen<br />
Vereinigungen (also z. B. Sportvereinen) denn: die Mitgliedschaft ist freiwillig, so dass<br />
Mitglieder kaum bereit sein werden, sich zu strikt festgelegten Verhaltensweisen und<br />
Arbeitsleistungen verpflichten zu lassen.“ (Heinemann, 2004, S. 138)<br />
Programmierung von Entscheidungen<br />
„Programmierung von Entscheidungen bedeutet, dass a.) heterogene Umweltinformationen<br />
so selektiert werden, dass nur noch jene in der Organisation gelangen, die für die<br />
Entscheidungsfindung relevant sind, b.) dass die Kommunikation innerhalb der Organisation<br />
festgelegt und invariant gesetzt wird (…) Die Rationalität der Programmierung von<br />
Einzelfallentscheidungen liegt dabei nicht in der Entscheidung über den Einzelfall, sondern<br />
in der Art der Programmierung der Entscheidungsfindung.“ (Heinemann, 2004, 138)<br />
23
Ein Programm kann z. B. den „Laufplan“ eines Aufnahmewunsches einer Person<br />
in einem Sportverein bis zur Genehmigung festlegen.<br />
Standardisierung<br />
„Standardisierung bedeutet, dass sich eine einheitliche Technologie bei Produkten<br />
bzw. Produktionsverfahren zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe bzw.<br />
Lösung eines spezifischen Problems allgemein durchgesetzt hat.“ (Heinemann,<br />
2004, S. 141) Dieses Verfahren kommt in Sportvereinen äußerst selten vor.<br />
<strong>Judoverein</strong>e haben vom entsprechenden Fachverband auf Landesebene eine<br />
Vorgabe in der Technikvermittlung. So hat der Deutsche Judo Bund eine<br />
Ausbildungsordnung und Prüfungsordnung vorgegeben, die die <strong>Judoverein</strong>e<br />
befolgen müssen, wenn sie ihren Mitgliedern offizielle Judogürtel verleihen wollen.<br />
Gewisse Gürtelfarben sind nötig, wenn die Mitglieder an offiziellen Wettkämpfen<br />
teilnehmen wollen.<br />
3.2.2.5 Formen der Kontrolle<br />
„Man wird nie völlig darauf verzichten können zu kontrollieren, dass die Arbeit in<br />
der Sportorganisation auch zu dem gewünschten Ergebnis führt, also die<br />
Organisation effizient ihre Ziele erreicht und ihre Mission erfüllt.“ (Heinemann,<br />
2004, S. 141)<br />
Unterscheiden lässt sich in prozessorientierte und ergebnisorientierte Kontrolle.<br />
Als Instrumente der Kontrolle gelten:<br />
• Kontrolle durch Technik im Rahmen eines arbeitsteilig gegliederten<br />
Arbeitsablaufs, wodurch der einzelne in den Spielräumen des erlaubten<br />
bzw. möglichen Handelns eingeschränkt wird.<br />
• Kontrolle durch eine entsprechende Schneidung der Aufgaben bzw.<br />
der Stellenanforderung<br />
• Kontrolle durch Leistungsanreize, also durch Gestaltung der Entlohnung<br />
und anderer Gratifikationen (z. B. durch das Graduierungssystem im Judo)<br />
• Kontrolle durch den Vorgesetzten also die direkte Überwachung der<br />
Untergebenen durch die übergeordneten Instanzen<br />
• Kontrolle durch Kollegen. „Diese Form der Kontrolle wird vor allem dann<br />
besonders ausgeprägt und wirksam sein, wenn eine gegenseitige Abhängigkeit der<br />
24
Mitarbeiter voneinander besteht, also die Leistung und damit auch die erzielbare<br />
individuelle Gratifikation des einen durch die Leistung des anderen mitbestimmt werden.<br />
Dabei besitzen die Mitarbeiter vielfältige und oft subtil wirkende Instrumente der Kontrolle<br />
und der Sanktion, die von gegenseitiger Unterstützung, über Formen eines Tadels, der<br />
Ironisierung, des Scherzes, demonstratives Schweigens, der Verweigerung der Kommunikation<br />
über die verschiedenen Formen des Mobbings bis hin zum Ausschluss aus der<br />
Gruppe reichen können.“ (Heinemann, 2004, S. 145)<br />
Dieses Instrument der Kontrolle hat in Sportvereinen im Verhältnis zu den<br />
anderen Instrumenten der Kontrolle eine große Bedeutung. Ob und wie sich<br />
Mitglieder eines Vereinsvorstandes und die Trainer für die Belange des<br />
Sportvereins engagieren, unterliegt einer gewissen Kontrolle der Mitglieder.<br />
In Sportvereinen ist die Möglichkeit der Verwendung der aufgezeigten Instrumente<br />
der Kontrolle sehr viel geringer als in staatlichen Verwaltungen oder<br />
kommerziellen Betrieben. Daher sind „Selektion, Sozialisation, Einbindung und<br />
Schaffen von Vertrauen (…) [hier] die vorherrschenden Instrumente der Kontrolle“<br />
(Heinemann, 2004, S. 146).<br />
Heinemann (2004, S. 146) nennt zu den Formen der Kontrolle folgendes Fazit:<br />
„Die erste Frage ist nicht, wie kontrolliert werden soll, sondern ob bzw. in welchem Umfang<br />
dies erforderlich ist. Zunächst sollte man auf die Leistungsbereitschaft, das Engagement und<br />
die Loyalität der Mitarbeiter setzen und zwar in der Erkenntnis, a.) dass Vieles in einer<br />
Organisation sowieso nicht kontrollierbar und steuerbar ist und b.) dass Kontrolle und<br />
Sanktionen zwar dazu führen können, dass schädliches Verhalten vermieden wird, nicht<br />
aber zu einer besonderen Engagementbereitschaft motiviert. (Innerorganisatorische)<br />
Sozialisation und eine gute Personalpolitik, die zu einer Einbindung der Mitarbeiter in die<br />
Organisation führen, ist oft wirksamer als eine direkte unpersönliche oder persönliche<br />
Kontrolle.“<br />
3.2.3 Formen der Ausgestaltung der sozialen Architektur<br />
Je nach der unterschiedlichen Form der im letzten Kapitel dargestellten,<br />
verschiedenen Determinanten entwickeln sich verschiedene Strukturprofile bzw.<br />
Konfigurationen. Die Abb. 3.9 gibt hierzu einen Überblick über die verschiedenen<br />
Determinanten, die auf die Struktur einer Organisation Einfluss nehmen.<br />
25
Abb. 3.9: Die Determinanten der Organisationsstruktur (Heinemann, 2004, S. 147)<br />
Aufbauend auf den Strukturelementen einer Organisation lassen sich nach<br />
Mintzberg (1989) fünf verschiedene Konfigurationstypen identifizieren.<br />
Das bürokratische Modell:<br />
„Das bürokratische Modell besitzt alle sechs Bestandteile der Konfiguration einer<br />
Organisation in gut ausgeprägter Form. (…) Es ist das typische Modell der staatlichen<br />
Verwaltung, in denen standardisierte Abläufe die Regel sind.“ (Heinemann, 2004, S. 148)<br />
Sportvereine lassen sich in aller Regel mit diesem Modell nicht abbilden.<br />
Die Organisation der Professionals:<br />
„Die Organisation der Professionals ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine große und<br />
auch stark differenzierte operative Basis besitzt, während die anderen Bestandteile einer<br />
Organisation nur schwach ausgeprägt vorhanden sind. (…) Die Mitarbeiter in der operativen<br />
Basis sind in erster Linie qualifizierte Professionals“ Heinemann, 2004, S. 152).<br />
Die innovative Organisation (Adhocracy):<br />
„Die innovative Organisation ist durch eine lose, flexible, fließende Struktur gekennzeichnet,<br />
die sich immer wieder selbst verändert und selbst erneuert. Sie kann als ein<br />
organisatorisches Zeltdach für immer wieder sich neu bildende Arbeitszusammenhänge,<br />
multidisziplinäre Arbeitsteams und Projekte verstanden werden.“ (Heinemann, 2004, S. 154)<br />
Die diversifizierte Organisation:<br />
„Die diversifizierte Organisation ist dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Einheiten<br />
weitgehend selbstständig arbeiten, aber unter einer zentralen Verwaltungsstruktur oder<br />
einem Dachverband zusammengefasst werden. (…) Typisch für diesen Organisationstypus<br />
sind auch einzelne Vereine, die sich in Dachverbänden zusammenschließen. (…) Der<br />
Kontext, in dem dieser Organisationstypus entsteht, besteht oft aus stark differenzierten<br />
Märkten [z. B. Sportarten] (…) So entstehen typischerweise Landesfachverbände im Sport,<br />
die die regionalen Belange der in ihr organisierten Vereine besser vertreten können als<br />
Bundesverbände.“ (Heinemann, 2004, S. 150 f.)<br />
26
Die einfache Struktur:<br />
„Die einfache Struktur verfügt lediglich über zwei Ebenen: Der strategischen Spitze und dem<br />
operativen Kern. Die Struktur ist wenig differenziert; die Arbeitsteilung ist nur gering<br />
entwickelt: Eine Hierarchie ist kaum ausgeprägt; die Herrschaft ist auf den Chef der<br />
Organisation konzentriert; er bestimmt – oft charismatisch oder autoritär – die Geschicke der<br />
Organisation. Die Organisation ist also zentralistisch geprägt. Die Koordination erfolgt im<br />
Wesentlichen über informelle Abstimmung und direkte Anordnungen; es besteht stets für alle<br />
Mitarbeiter ein direkter Kontakt zur strategischen Spitze. Die Entscheidungen erfolgen<br />
schnell, flexibel, spontan und oft intuitiv.“ (Heinemann, 2004, S. 147)<br />
Zu diesem Konfigurationstyp zählen kleine Sportorganisationen, die sich in eng<br />
begrenzten Marktnischen etablieren u. a. kleine Sportvereine und relativ autonome<br />
Sportabteilungen. Das eine Vielzahl von Sportvereinen unter den Konfigurationstyp<br />
„Die einfache Struktur“ fällt, liegt vor allem an den Besonderheiten der<br />
Strukturmuster von Sportvereinen, die im Kapitel 3.2.2.2 beschrieben wurden.<br />
3.2.4 Wandel in Sportvereinen<br />
„Organisationsentwicklung, mit der eine Sportorganisation „fit“ gehalten werden soll, ist eine<br />
ständige Herausforderung für das Management, die allerdings nicht nur darin besteht,<br />
Veränderungen zu planen, sondern auch darin, die vielfältigen Widerstände zu überwinden,<br />
die jeder Veränderung entgegenstehen. Oft aber verändert sich eine Organisation auch als<br />
nicht intendierte Folge von Entscheidungen. So kann eine Organisation entstehen, die man<br />
eigentlich so nicht gewollt hat.“ (Heinemann, 2004, S. 161)<br />
Im Kapitel 3.1.3 wurden Vereine durch ihre konstitutiven Variablen definiert. Diese<br />
Variablen dienen den Mitgliedern dazu, Ziele des Vereins und ihre Interessen in<br />
Übereinstimmung zu bringen. Vereinsentscheidungen hin zu Kommerzialisierung,<br />
Politisierung, Oligarchisierung oder Professionalisierung können dazu führen, dass<br />
„nicht intendiert die konstitutiven Merkmale verändert und damit Möglichkeiten der<br />
Mitglieder, ihre Interessen durchzusetzen, beschnitten werden“ (Heinemann,<br />
2004, S. 161). Damit kann es zu einer Differenz zwischen dem Idealtyp des<br />
Sportvereins und der Realität kommen. Im Folgenden wird hier stichpunktartig<br />
darauf eingegangen (vgl. Abb.3.10.):<br />
27
Abb. 3.10: Idealtypus und Wirklichkeit (Heinemann, S.162)<br />
Kommerzialisierung:<br />
• Mitglieder werden zu Kunden – zunehmend instrumentelle, zweckorientierte<br />
Erwartungshaltung der Mitglieder.<br />
• Abhängigkeit von Dritten – Leistungen müssen den Bedingungen entsprechen,<br />
unter denen sie für Marktpartner attraktiver sind.<br />
• Größere Unabhängigkeit der Entscheidungsträger – durch größere Flexibilität<br />
in der Art der Erfüllung ihrer Aufgaben.<br />
• Verlust von Funktionen – wie der sozial-integrativen und der kontaktstiftenden<br />
Funktionen: Daraus folgend gibt es eine geringe ehrenamtliche<br />
Mitarbeit und somit auch geringe Einflussnahme.<br />
• Wachsende Bürokratisierung – typische wirtschaftliche Systemrationalitäten<br />
und daran angepasster Strukturen.<br />
Politisierung:<br />
• Abhängigkeit von staatlichen Einnahmen bzw. Zuschüsse<br />
• Geringere Abhängigkeit von den Ressourcen der Mitglieder<br />
(Mitgliedsbeiträge, Freiwilligenarbeit)<br />
• Geringere demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
• Geringere Bereitschaft der Mitglieder zur Unterstützung<br />
• Bedrohung der Autonomie des Vereins<br />
Oligarchisierung:<br />
• Möglichkeit der Partizipation wird nur von wenigen Mitgliedern wahrgenommen.<br />
Dies kann entweder Folge oder Auslöser von Oligarchsierung<br />
sein (vgl. Heinemann, 2004, S. 165).<br />
28
• Teilnahme an Vereinsversammlungen sowie Mithilfe und konkretes<br />
„Mitanpacken“ der Mitglieder sind vergleichsweise gering ausgeprägt.<br />
• Wenige oder im Extremfall nur einer entscheidet über die Geschicke des<br />
Vereins (vgl. Heinemann, 2007, S. 151)<br />
• Jüngeren wird keine bedeutende Position in Aussicht gestellt, da Ältere an<br />
ihren Ämtern haften. Es besteht die Gefahr der Abwanderung dieser<br />
Mitglieder.<br />
Aus dem aufgeführten Wandel ergeben sich Folgeprobleme, die zusammengefasst<br />
als „Funktionsverlust“ gekennzeichnet werden können. Denn die den<br />
Vereinen als intermediäre Gruppe zugeschriebenen wesentlichen Beiträge zur<br />
Lösung zentraler Probleme von Gesellschaft und Individuum in modernen Gesellschaften<br />
erwachsen zu einem großen Teil gerade aus ihren Strukturbesonderheiten.<br />
Sie gehen mit dem zunehmenden Verlust dieser Besonderheiten entsprechend<br />
verloren. (vgl. Heinemann, 2004, S. 165 f.)<br />
3.3 Sportvereine als Personenvereinigung<br />
Die vorangegangenen Kapitel behandeln Sportorganisationen als Rechtskonstruktion<br />
und soziale Architektur. Da Organisationen auch Gemeinschaften von<br />
und mit Menschen sind, wird nun in diesem Kapitel das sich daraus ergebene<br />
Verhältnis zwischen Individuum und Organisation näher betrachtet.<br />
3.3.1 Organisationskultur<br />
Die im Kapitel 3.2 dargestellte soziale Architektur der Sportorganisation stellt<br />
bildlich gesprochen nur das tragende „Skelett“ einer Organisation dar. Die<br />
Organisationskultur ist das, was bei der sozialen Architektur noch fehlt.<br />
„Organisationskultur kann 1. mit ihren Elementen und 2. mit ihren Funktionen beschrieben<br />
werden.<br />
Zu den Elementen zählen<br />
a) gemeinsam geteilte Werte, die z. B. in einer Organisationsphilosophie ihren<br />
Niederschlag finden,<br />
b) durch Rituale, Mythen, Geschichten, Symbole und Zeichen, durch die gemeinsame<br />
Bedeutungen und Interpretationen zum Ausdruck gebracht werden,<br />
c) durch Alltagsroutinen und eingespielte Handlungsmuster, die zusammenkommen<br />
d) ihren materiellen Ausdruck etwa in der architektonischen Gestaltung der Gebäude und<br />
Räume, der Möblierung etc finden.<br />
29
Unter einem funktionalen Aspekt kann Organisationskultur verstanden werden als eine Form<br />
der Konstruktion, Interpretation und Deutung der Organisationswirklichkeit ihrer Mitglieder,<br />
durch die Handeln Sinn und Bedeutung verliehen wird. Sie ist ein Bedeutungs- und<br />
Verständigungsrahmen.“ (Heinemann, 2004, S. 168)<br />
Abb. 3.11: Zuordnung der Elemente einer Organisationsstruktur (Heinemann, 2004, S. 171)<br />
3.3.1.1 Elemente der Organisationskultur<br />
Die vier Elemente einer Organisationskultur hängen eng miteinander zusammen.<br />
Durch die Organisationsphilosophie erfährt das Alltagsgeschäft mit seinen<br />
täglichen Routinen, wechselnden Aufgaben, Entscheidungszwängen und<br />
Ereignissen laut Heinemann (2004, S. 171) eine „kulturelle Überhöhung“. Auch<br />
wenn der Einzelne nur unbedeutende Teilaufgaben erfüllt, in täglicher Routine<br />
versinkt, den Überblick zu verlieren droht, weiß er sich doch als Teil des Ganzen<br />
und der Mission verpflichtet. Zeichen, Symbole und Rituale sollen demgegenüber<br />
auf Strukturen verweisen, sie verständlich machen und sie legitimieren.<br />
Organisationsphilosophie<br />
„Organisationsphilosophie kann als eine Sinnkonstruktion interpretiert werden, die<br />
das alltäglich Handeln und Entscheiden der Mitglieder einer Organisation<br />
symbolisch überhöht und Erfahrungen, Routinen, Motivation, Handlungen und<br />
Entscheidungen in einen allgemeinen, für alle gleichermaßen gültigen, vertrauten<br />
und plausiblen Wert- und Interpretationszusammenhang stellt.“ (Heinemann, 2004,<br />
S. 171)<br />
Beispiel für eine Philosophie kann das Selbstverständnis eines Sportvereins z. B.<br />
als „Solidargemeinschaft“ oder „Dienstleistungsbetrieb“ sein. Als weiteres kann sie<br />
sich darauf beziehen, inwieweit sich der Sportverein vorrangig dem Breiten-<br />
30
Freizeitsport oder in welchem Umfang dem Leistungssport verpflichtet fühlt. Eine<br />
dritte Kennung erfasst u. U. das Innovationspotential eines Sportvereins.<br />
Mit der Organisationsphilosophie werden Ziele der Sportorganisation moralisch<br />
„aufgeladen“; es werden die besonderen Verpflichtungen einer Sportorganisation<br />
gegenüber der „Allgemeinheit“, ihr „gesellschaftlicher Beitrag“ und ihre „ethische<br />
Verantwortung“ herausgestellt (Osterloh, 1991).<br />
Bedeutungsstruktur: Rituale, Zeichen, Symbole<br />
„Rituale sind festgelegte, stets in gleicher Form ablaufende Handlungsmuster mit<br />
symbolischem Aussagegehalt. Symbole und Zeichen sind Verweisungen und Botschaften<br />
für handlungsbestimmende Werte und Strukturen, Überzeugungen und Sinngehalte. Es<br />
sind „verschlüsselte“ Botschaften, die entziffert und deren Bedeutung interpretiert werden<br />
müssen.“ (Heinemann, 2004, S. 173)<br />
Alltagsroutinen<br />
Bei der Alltagsroutine geht es darum in welcher Art und Weise die<br />
Vereinsphilosophie konkret in der Bewältigung der täglichen Aufgaben umgesetzt<br />
wird, wie Probleme gelöst, wie miteinander kooperiert und kommuniziert wird.<br />
Sichtbare Artefakte der Organisationskultur<br />
„Die Eigenheiten einer Organisationskultur werden nach außen durch eine<br />
Vielzahl von Artefakten sichtbar gemacht. Es sind materialisierte, in<br />
Sachstrukturen eingebundene Formen des Ausdrucks der Organisationskultur.“<br />
(Heinemann, 2004, S. 176)<br />
Differenzierungen des Konzepts der Organisationskultur<br />
Die Organisationskultur in einer Sportorganisation ist nicht immer eine Einheitskultur,<br />
sondern kann Subkulturen oder Fragmentkulturen enthalten. Wenn eine<br />
Sportkultur aus mehreren Subkulturen besteht, dann bedeutet dies für den<br />
Sportverein, dass sich die einzelnen Abteilungen unterschiedliche Symbole und<br />
Rituale zunutze machen, eigene Alltagsroutinen entstehen oder dass die Vereinsphilosophie<br />
verschiedenartige Aussagen beinhaltet. (vgl. Heinemann, 2004, S.<br />
177). Dazu entgegengesetzt kann eine Organisationskultur auch in eine Vielzahl<br />
von Fragmenten zerfallen mit unterschiedlichen Interpretationen und<br />
Alltagsroutinen.<br />
Heinemann (2004, S. 177) fasst dies im Ganzen so zusammen:<br />
31
„Von keinem der drei Vorstellungen – Einheitskultur, Subkultur und Fragmentkultur – wird<br />
man sagen können, dass sie uneingeschränkt richtig oder falsch sind. Vielmehr ist die<br />
Ausgestaltung der Kultur<br />
a.) in jeder Sportorganisation unterschiedlich und<br />
b.) abhängig von spezifischen Besonderheiten der Organisation – ihrem Alter, ihrer<br />
Größe, ihrem Leistungsprogramm, dem Typus der Sportorganisation als freiwillige<br />
Vereinigung oder kommerzieller Betrieb, dem jeweiligen Führungsstil bis hin zu den<br />
besonderen Merkmalen der führenden Persönlichkeiten. Es ist eine Aufgabe zu<br />
„lesen“, welche der drei genannten Formen der Ausprägung einer<br />
Organisationskultur in der jeweiligen Sportorganisation verwirklicht ist.“ [Subkultur<br />
in Judoabteilungen eines Mehrspartenverein]<br />
3.3.1.2 Bestimmungsfaktoren der Organisationskultur<br />
Die Ausgestaltung der Organisationskultur hängt von folgenden Faktoren ab:<br />
Kulturspezifische Einflussfaktoren: Das kulturelle Selbstverständnis, die Einstellungen<br />
und Mentalitäten der Mitglieder prägen die Organisationskultur. „Dieser<br />
„Import“ kulturspezifischer Eigenheiten erfolgt nicht nur von Gesellschaft zu<br />
Gesellschaft unterschiedlich, sondern auch entsprechend der kulturellen<br />
Unterschiede, die schichtenspezifisch bestehen“ (Heinemann, 2004, S. 179).<br />
Organisationskultur als Variable des Organisationsmanagements: Das<br />
Management kann zur Festigung oder Veränderung der Organisationskultur<br />
bewusst gestaltende Elemente einsetzen. Ob diese Elemente (Leitbild, Rituale,<br />
Konzeptionen) wirklich die Organisationskultur prägen, hängt davon ab, ob sie bei<br />
den jeweiligen Mitgliedern Eingang gefunden haben.<br />
A-rationale Konstruktion der Organisationskultur: Jede Sportorganisation<br />
bildet eine eigene soziale Wirklichkeit auf dem Hintergrund ihrer Tradition und<br />
Geschichte. Viele Elemente der Organisationskultur sind weder Widerspiegelung<br />
der kulturellen Gegebenheiten eines Landes noch bewusst gestaltete Variablen<br />
des Organisationsmanagements. (vgl. Heinemann, 2004, S. 180)<br />
Psychodynamische Prägung der Organisationskultur: „Die spezifische Kultur<br />
einer Sportorganisation kann schließlich in Teilen als Ergebnis und Ausdruck<br />
spezifischer Charaktereigenschaften und psychischer Eigenheiten der prägenden<br />
Persönlichkeiten angesehen werden“ (Heinemann, 2004, S. 180 f.)<br />
32
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Entstehung der Kultur einer<br />
Sportorganisation eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren zusammenwirkt.<br />
3.3.1.3 Funktionen der Organisationskultur<br />
Die Organisationskultur kann folgende wichtige Funktionen erfüllen (vgl.<br />
Heinemann, S. 181 ff.):<br />
• Vermittlung von Sicherheit und dem Gefühl der Zusammengehörigkeit<br />
• Motivation<br />
• Vergrößerung öffentlicher Anerkennung<br />
• Schaffung von Vertrauen<br />
• Abgrenzung von anderen und Schaffung eines Wir-Gefühls<br />
„Will man sich in einer Organisation zurechtfinden, muss man nicht nur das typische Netz<br />
der Interaktionsmuster, Beziehungen, tradierter Normierungen, Stile des Verhaltens und der<br />
Aufgabenerfüllung etc. kennen, sondern sich in einem gewissen Umfang auch damit<br />
identifizieren. Die Organisation ist damit zugleich ein Lernmilieu, in das man sich mit seinen<br />
subkulturellen Eigenheiten, mit dem je individuellen Sportverständnis, der Amtsauffassung<br />
von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, der Organisationsphilosophie etc einbinden muss“<br />
(Heinemann, 2004, S. 183)<br />
Heinemann fasst die Vereinskultur in einem anderen Werk (2007, S. 138)<br />
folgender Maßen zusammen:<br />
„Soziale Gegebenheiten und Ereignisse in einem Verein dürfen nicht allein als objektive<br />
Tatbestände, die man als Variablen etwa „von außen“ empirisch ermitteln kann, gesehen<br />
werden. Objektive Gegebenheiten haben eine Bedeutung: Über Werte und Philosophien<br />
werden gemeinsame Erfahrungen sinnhaft geordnet; über Rituale, Zeichen und Symbole<br />
werden Gemeinsamkeiten und das Gefühl der Zusammengehörigkeit geschaffen, Ereignisse<br />
verständlich gemacht, ein Image produziert und Handlungen legitimiert. Man darf aber die<br />
Vereinskultur nicht mit ihren einzelnen Elementen verwechseln. Erst in der Summe und in<br />
ihren jeweiligen Verbindungen und Verflechtungen ergibt sich das, was die Kultur eines<br />
Sportvereins ausmacht. Danach bedeutet Vereinskultur unter funktionalen Gesichtpunkten<br />
eine Form der Konstruktion, Interpretation und Deutung der Organisationswirklichkeit durch<br />
Vereinsmitglieder, durch die Handeln Sinn und Deutung verliehen wird. Sie ist ein<br />
Bedeutungs- und Verständigungsrahmen.“<br />
3.3.2 Demographie einer Sportorganisation<br />
Die Zahl der Mitglieder in Vereinen hat sich aufgrund neuer Sportangebote im<br />
Freizeit- und Gesundheitssport deutlich vergrößert; doch zeigt die Sozialstruktur<br />
deutliche Ungleichgewichte auf (vgl. Heinemann, 2007, S. 271). „In keiner<br />
Sportorganisation ist die Struktur der Mitglieder ein getreues Abbild der<br />
33
Bevölkerungsstruktur; in jeder Organisation erfolgt eine Selektion – gewollt oder<br />
ungewollt – nach bestimmten Kriterien.“ (Heinemann, 2007, S. 275).<br />
Ein Verein wird geprägt von unterschiedlichen Personen, die sich nach gewissen<br />
Merkmalen in unterschiedliche Gruppen wie Geschlecht, Alter, Nationalität,<br />
berufliches Knowhow oder familiärer Hintergrund zusammenfassen lassen. Die<br />
Demographie einer Organisation beschreibt und analysiert dieses Gruppen bzw.<br />
Strukturen in einem Verein, Diese Untersuchung ist von Relevanz, da das äußere<br />
Erscheinungsbild, aber auch die innere Struktur und folglich auch das<br />
Leistungsvermögen einer Sportorganisation maßgeblich von der Demographie<br />
beeinflusst werden. Untersuchungen über die Mitgliederstruktur belegen, dass<br />
sich in Vereinen tendenziell eine homogene Zusammensetzung in Bezug auf<br />
soziodemographische Merkmalen einstellt, da dies eine wesentliche<br />
Voraussetzung für das Funktionieren eines Vereins darstellt. (vgl. Heinemann,<br />
2004, S. 184 ff.). Dies könnte auch der Grund sein, warum viele Vereine nicht<br />
„Sport für alle“ anbieten, sondern beabsichtigt oder unbeabsichtigt versuchen eine<br />
homogene Gruppe mit ihrem Konzept anzusprechen (vgl. Heinemann, 2007, S.<br />
271).<br />
Die Demographie eines Sportvereins resultiert aus einem komplexen Prozesses<br />
der Rekrutierung und der Auswahl von neuen Mitgliedern bzw. Mitarbeitern. Wie<br />
Sportvereine neue Mitglieder gewinnen, wirkt sich nicht nur auf die Struktur der<br />
Mitgliedschaft aus, sondern hat auch Folgen für die soziale Integration der<br />
Mitglieder, die Engagementbereitschaft, verfügbare fachliche Kompetenzen u. ä.<br />
(vgl. Heinemann, 2004, S. 186). Daher muss ein Sportverein sorgfältig planen, wie<br />
er seine Mitglieder und Mitarbeiter anwirbt.<br />
3.3.3 Das Verhältnis zwischen Individuum und Organisation<br />
Sportorganisationen sind geschaffen, um Ziele zu verwirklichen, nicht notwendigerweise<br />
zum Gefallen und zur Freude der in ihnen agierenden Personen.<br />
Aber Mitglieder bzw. Personen haben ihren Eigensinn. Sie sind nicht ohne<br />
weiteres bereit, uneingeschränkt den Anforderungen, Ansprüchen und Zwängen<br />
der Organisation zu folgen. So entstehen Spannungsverhältnisse zwischen den<br />
(Sach-)Zwängen, die rationale Planung mit sich bringt und der Widerspenstigkeit<br />
der in ihr agierenden Persönlichkeiten (s. Abb. 3.12).<br />
34
Abb. 3.12: Spannungsverhältnis zwischen Individuum & Organisation (Heinemann, 2004, S. 189)<br />
Es lässt sich hier von einer gegenseitigen Abhängigkeit sprechen, was in der<br />
Abbildung der Doppelfeil zwischen Individuum und Organisation verdeutlicht. Der<br />
Sportverein als Organisation braucht die Arbeitskraft, die Fähigkeiten, die Ideen,<br />
die Erfahrungen und Ressourcen (Geld und Zeit) ihrer Mitglieder. Die Mitglieder<br />
benötigen den Sportverein vor allem zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse bzw. zur<br />
Verwirklichung ihrer Freizeit- und Sportinteressen.<br />
„Wenn die Verbindung zwischen Individuum und Organisation unzulänglich ist, entstehen für<br />
beide Nachteile: Organisationen werden Mitglieder nur zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen,<br />
sie also auszubeuten versuchen, Mitglieder sind unzufrieden, schlecht motiviert und fühlen<br />
sich unzulässig ausgenutzt. (…) Eine gelungene Einbindung der Individuen in eine<br />
Organisation nutzt also beiden: Die Individuen finden ihre Arbeit bzw. Mitgliedschaft<br />
bedeutsam und zufrieden stellend und sie sind entsprechend motiviert, sich zu engagieren<br />
und die Organisation erhält jene Fähigkeiten, Ideen, Kompetenzen, Erfahrungen und<br />
Ressourcen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.“ (Heinemann, 2004, S. 190)<br />
Bei einem Spannungsverhältnis zwischen Organisation und Individuum kann es,<br />
wenn es zu Lasten des Individuums und zugunsten der Anforderungen und<br />
Zwänge der Organisation gelöst wird, zur Entfremdung führen. Entfremdung kann<br />
als ein Zustand bezeichnet werden, in dem das materielle und soziale Umfeld,<br />
also die Sportorganisation, dem Individuum als etwas Fremdes erscheint, d. h.<br />
konkret, dass es seine individuellen Fähigkeiten, Interessen, und Wünsche in<br />
diesem Umfeld nicht verwirklichen kann, es dieses auch nicht zu verändern<br />
vermag und daher seine Tätigkeiten als inhaltslos, sinnlos und beziehungslos<br />
erscheinen (Israel, 1972).<br />
„Es ist offensichtlich, dass es Gefängnissen und Militär leichter haben, die Anpassung ihrer<br />
„Mitglieder“ zu erzwingen als Sportvereine.“ Heinemann, 2004 189) „Sportmanagement ist<br />
35
eine Gratwanderung zwischen zu rigider Festlegung der Strukturen und zu großer<br />
Flexibilität. Werden die Individuen durch ein hohes Maß an Strukturbildung und<br />
Formalisierung gesteuert, kann dies dazu führen, dass dem Einzelnen ein zu geringer<br />
Spielraum verbleibt, individuelle Motivationen, Interessen und Kompetenzen einzusetzen.<br />
(…) Aber treibt man die Flexibilität und Offenheit der sozialen Architektur zu weit, kann dies<br />
dazu führen, dass jeder seine eigenen Motive und Interessen ins Spiel bringt und die<br />
Organisation sich zu einer politischen Arena entwickelt, in der vielfältige Konflikte zu hohen<br />
Reibungsverlusten führen.“ (Heinemann, 2004, S. 193)<br />
3.3.4 Mitgliedereinbindung in Sportvereinen<br />
Wie kann es gelingen ein Individuum mit seinen unterschiedlichen Interessen und<br />
Bedürfnissen an eine Organisation zu binden? Und was ist die Motivation für den<br />
einzelnen überhaupt einzutreten? Nur ein motiviertes Mitglied wird den Bedarf<br />
verspüren, die Ziele des Vereins aktiv zu vertreten. „Die Art der Einbindung ergibt<br />
sich daraus, in welcher Form das jeweilige Mitglied die Angebote des Vereins<br />
tatsächlich wahrnimmt. Danach ergeben sich vier Einbindungsdimensionen.“<br />
(Heinemann, 2004, S. 206)<br />
• Grad der Wahrnehmung des Sportangebots (Aktivitätsgrad)<br />
• Grad der Wahrnehmung zusätzlicher Angebote (Grad der Teilhabe)<br />
• Grad der Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen<br />
(Partizipationsgrad)<br />
• Grad der freiwilligen, unbezahlten Mitarbeit (Engagement)<br />
„Empirische Untersuchungen (vgl. etwa Heinemann & Horch, 1991 und Heinemann &<br />
Schubert, 1994) weisen darauf hin, dass Mitgliedschaft durch eine Kombination vielfältiger<br />
materieller und immaterieller Anreize an den Verein gebunden wird. Damit ist zugleich<br />
gesagt, dass die klassische Anreiz-Beitragstheorie wenig taugt, um die Mitgliedschaft in<br />
Vereinen zu erklären. (…) [Dazu] besteht ein (ebenso) widersprüchliches Nebeneinander<br />
von solidarischer Einstellung, hoher Partizipationsbereitschaft und Konsumentenhaltung der<br />
Mitglieder. (…) Für Sportvereine ist eine widersprüchliche Mischung aus sowohl<br />
überwiegend materiell zu verstehenden Leistungsangeboten – vor allem also die Möglichkeit<br />
zum Sportreiben – als auch von nicht-materiellen Anreizen der Gemeinschaft und<br />
Identifikation typisch. Zugleich besteht ein ebenso widersprüchliches Nebeneinander von<br />
solidarischer Einstellung, hoher Partizipationsbereitschaft und Konsumentenhaltung der<br />
Mitglieder. (Heinemann, 2004, S. 209)<br />
„Eine wichtige Aufgabe ist es, die Mitglieder bzw. Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie den<br />
Handlungsspielraum, der ihnen durch die Strukturen der Sportorganisation zwangläufig<br />
gelassen wird, so ausfüllen, dass die Ziele der Organisation optimal erreicht werden. Die<br />
Instrumente, die dazu zur Verfügung stehen, liegen einmal in der Rekrutierung der<br />
geeigneten Mitarbeiter. Da man aber nicht vermuten kann, dass Motivationen situationsunabhängig<br />
wirksam werden, kommt es entscheidend auf die Ausgestaltung des Kontextes<br />
an, in dem die Mitglieder eingebunden sind. Man muss motivierende Rahmenbedingungen<br />
schaffen. Dazu gehören neben den Anreizsystemen vor allem die sensible Beachtung und –<br />
im Rahmen des Möglichen – die Ausformung der Organisationskultur, die Gestaltung der<br />
Arbeitsaufgaben, die Vermittlung von Zielen und die angemessene Einbindung in soziale<br />
Gruppen. Dabei aber darf nicht übersehen werden, dass es keine für alle gleiche und<br />
36
wirksame Verfahren gibt, die den Einzelnen gut motivieren könnten.“ (Heinemann, 2004, S.<br />
220)<br />
3.3.5 Gefährdete Integration<br />
Werden die Mitglieder nicht ausreichend integriert und eingebunden, kann dies zu<br />
nicht normenkonformen Verhalten führen.<br />
„Abweichendes Verhalten von Personen oder Gruppen in einer Organisation verletzt gültige<br />
und allgemeine anerkannte Normen, Regeln und Vorschriften, weicht also von diesen ab.<br />
Abweichendes Verhalten ist eine Form nicht statthaften und daher sanktionierten, nicht<br />
normenkonformen Verhaltes.“ (Heinemann, 2004, S. 223)<br />
Je Ausprägung dieses Verhaltens ist es vom jeweiligen Leiter des Vereins<br />
entweder zu dulden oder zu sanktionieren (vgl. Heinemann, 2004, S. 220 ff.). Die<br />
Herausforderung für den Sportmanager liegt darin abzuschätzen, inwiefern das<br />
Verhalten von Vorteil sein kann. Dabei gilt es aber abzuwägen, ob der Zweck die<br />
Mittel heiligt. Häufig ist die mangelnde Integration auch nicht eindeutig zu<br />
identifizieren, da nicht zwingend öffentlich abgewichen wird. Letztendlich ist es<br />
schwierig richtig mit dem abweichenden Verhalten anderer umzugehen und dem<br />
womöglich mit Sanktionen zu begegnen (vgl. Heinemann, 2004, S. 224).<br />
Die wesentlichen Ausprägungen von negativen Verhaltensformen sind Mobbing,<br />
Korruption und soziale Konflikte.<br />
• Mobbing<br />
„Mobbing kann mit folgenden Merkmalen definiert werden: Es sind<br />
1. Formen von Kommunikationen oder Handlungen von<br />
2. einzelnen Mitgliedern/ Mitarbeitern oder auch Gruppen in einer Organisation, (…) die<br />
3. über einen längeren Zeitraum andauern und systematisch und absichtlich erfolgen, die<br />
4. das Ziel haben, diese Person dadurch zu schädigen, also zu demütigen, einzuschüchtern<br />
oder aus ihrer Position zu verdrängen, wobei<br />
5. die betroffene Person kaum die Möglichkeit hat, sich angemessen zu wehren oder<br />
dieser Situation zu entkommen.“ (Heinemann, 2004, S. 224)<br />
„Mobbing ist kein Randphänomen.“ (Heinemann, 2004, S. 227). In<br />
Sportvereine wie auch anderen Sportorganisationen gibt es Mobbing. Es führt<br />
über kurz oder lang dazu, dass die gemobbten Mitglieder den Verein<br />
verlassen. Daher sind durchgehend Trainer und Vorstand gefordert, jede Form<br />
des Mobbings zu unterbinden und die Mobbingopfer zu schützen.<br />
37
• Korruption<br />
„Korruption, auch Bestechung stellt eine Rechtsverletzung im Amt dar, in der der<br />
Amtsinhaber – der Bestochene – private Vorteile (z. B. Geldzahlungen oder Sachleistungen)<br />
von anderen annimmt und als Gegenleistungen seine Amtspflichten dadurch verletzt, dass<br />
er entgegen bestehender Vorschriften und den Interessen seiner Organisation dem<br />
Bestecher Vorteile verschafft oder verspricht, die er ohne diese Bestechung nicht erhalten<br />
würde. Vorteilnahme ist dadurch definiert, dass ein Amtsinhaber private Vorteile<br />
entgegennimmt und dafür Entscheidungen trifft, die in seinem Ermessen liegen, also nicht<br />
gegen Rechtsvorschriften verstoßen.“ (Heinemann, 2004, S. 227)<br />
Möglichkeiten und Formen der Korruption bzw. Bestechung sind vielfältig.<br />
Schwierig ist die statistische Erfassung ihres Umfangs, da Korruption nur<br />
wirksam und sinnvoll ist, wenn sie versteckt geschieht und damit geheim bleibt.<br />
• Soziale Konflikte<br />
„Ein sozialer Konflikt liegt vor, wenn unterschiedliche, nicht gleichermaßen erfüllbare<br />
Verhaltenserwartungen an den Inhaber einer Position in einer Organisation gerichtet werden<br />
bzw. Interessen verschiedener Personen oder sozialer Konflikte nicht gleichermaßen<br />
erfüllbar sind. Soziale Konflikte erwachsen also nicht aus persönlicher Abneigung, sondern<br />
aus Widersprüchen oder Gegensätzlichkeiten, die in der Struktur einer Organisation<br />
angelegt sind.“ (Heinemann, 2004, S. 230)<br />
Diese Definition macht deutlich, dass soziale Konflikte abzugrenzen sind von<br />
feindseligen Haltungen. Soziale Konflikte bieten eine Chance zur Anpassungen<br />
und Änderung der Organisation sowie deren Strukturen und sind daher nicht<br />
grundsätzlich etwas Negatives.<br />
Folgende soziale Konflikte sind zu unterscheiden:<br />
o Rollenkonflikt<br />
Inter-Rollen-Konflikt (z. B. Rolle einer Person in der<br />
Sportpolitik im Verband und als Mitglied im Verein)<br />
Intra-Rollen-Konflikt (z. B. der Übungsleiter der zwischen dem<br />
Trainingsauftrag des Vereinsvorstandes und den Interessen<br />
seiner zu trainierenden Mitglieder – siehe hierzu auch<br />
Abbildung 3.13)<br />
o Interessenkonflikt (z. B. Ansprüche auf knappe Ressourcen)<br />
o Zielkonflikt (verschiedene Personen mit unterschiedlichen Zielen)<br />
o Konflikte über die Mittel und Wege der Zielverwirklichung<br />
o Herrschaftskonflikte<br />
38
Abb. 3.13: Inter-Rollenkonflikt eines Übungsleiters (Heinemann, 2004, S. 232)<br />
Als Möglichkeiten soziale Konflikte zu bewältigen bzw. zu schlichten gibt es,<br />
o Vorgesetztenentscheidung<br />
o Demokratische Mehrheitsentscheidungen<br />
o Trennung<br />
o Vermittlungsrollen<br />
o Überprüfungsverfahren (um den „sachlichen Kern“ darzulegen)<br />
o Formalisierung<br />
Die Konfliktverlagerung, also eine Inhaltsverschiebung und/oder eine<br />
Adressatenverschiebung, führen dazu dass man ohne sorgfältige Diagnose sich<br />
nicht sicher sein kann, wer einerseits der wirkliche Verursacher ist, was der<br />
Auslöser war und was der eigentliche Grund für den Konflikt ist. „Man kann Gefahr<br />
laufen, mit Personen einen Konflikt zu „lösen“, der ursprünglich einen völlig<br />
anderen Inhalt hatte und zwischen völlig anderen Parteien ausgetragen werden<br />
muss.“ (Heinemann, 2004, S. 236)<br />
3.3.6 Emotionen in Sportorganisationen<br />
Im Sportverein ist mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Emotionen zu<br />
rechnen. Diese Emotionen kann man unter dem Gesichtspunkt beurteilen, welche<br />
Funktionen sie erfüllen, also inwieweit sie dazu beitragen, dass der Sportverein<br />
durch diese Emotionen seine Ziele besser erreichen kann und dass die Mitglieder<br />
39
ihre Interessen besser durchsetzen können. Emotionen lassen sich hierbei<br />
unterscheiden in (vgl. Heinemann, 2004, 238 ff.):<br />
• Aktivitätsbezogenen Emotionen, die im Handlungsvollzug selbst entstehen<br />
(„Mitgliedergefühle“, „Sportgefühle“, „Zuschaueremotionen“)<br />
• Bindungsgefühle, also Emotionen der Zugehörigkeit, der Einbindung und<br />
der Identifikation (Vereinstreue, Loyalität, Identifikation, Solidarität, Zugehörigkeitsgefühle)<br />
sowie eine Raumbindung (emotionale Bindung an<br />
räumlichen Gegebenheiten)<br />
• Emotionen in sozialen Beziehungen (Freundschaft, Feindschaft, Neid,<br />
Missgunst, Enttäuschung, Verärgerung)<br />
• Emotionelles Klima in Gruppen (Cliquen, Freundeskreise, Mitglieder von<br />
Kommissionen wie Vorstand oder Mannschaften)<br />
• Emotionelles Klima in Organisationen (kalt und unpersönlich oder<br />
Solidarität und Zusammengehörigkeitsgefühl, Misstrauen und Angst oder<br />
Aufbruchstimmung und Optimismus)<br />
3.3.6.1 Kommunikation und Interpretation von Emotionen<br />
„Emotionen bewegen den einzelnen ausschließlich in seinem Innern. Was sich dort abspielt,<br />
können andere nie mit letzter Sicherheit erfahren, denn: Emotionen müssen kodiert werden,<br />
um sie anderen zu vermitteln. Verbale Berichte, Körpersprache, spontane (auch<br />
physiologische) Reaktionen und kontrollierte Verfahrensformen sind jene Möglichkeiten, die<br />
andere über die emotionelle Befindlichkeit informieren (können). (…) Emotionsexpressionen<br />
sind weiter abhängig von Sprachfähigkeit, Körperbeherrschung, Situationswahrnehmung etc.<br />
der Einzelnen. (…) Diese so kodierten Gefühlsäußerungen müssen von anderen wiederum<br />
dekodiert werden, also als Ausdruck bestimmter Gefühle gelesen werden. (…) Zur korrekten<br />
Dekodierung des Gefühlsausdrucks durch Dritte gehören Eigenerfahrung, Aufmerksamkeit<br />
und ergänzende Wahrnehmungen (etwa zum geäußerten Wort), Menschenkenntnis und<br />
schließlich Zeit und Geduld, weil man sich erst im Laufe der Zeit und nach vielen Proben und<br />
Belegen z. B. des Vertrauens oder der Sympathie eines anderen sicher sein kann. Nur wenn<br />
ein so kodiertes Gefühl – hoffentlich korrekt – dekodiert wurde, kann seine Bedeutung und<br />
sein Sinngehalt auch angemessen gedeutet werde“ (Heinemann, 2004; 241 f.).<br />
3.3.6.2 Funktionen von Emotionen<br />
„Emotionen können in einer Organisation positive ebenso wie negative Wirkungen entfalten.<br />
Dabei ist strikt zu unterscheiden: Positive und negative Wirkungen für Organisationen und<br />
positive bzw. negative Wirkungen für einzelne Mitglieder, d. d. Emotionen können dazu<br />
beitragen, dass die Ziele der Organisation leichter oder auch schwerer erreicht werden und<br />
sie können bewirken, dass Mitglieder ihre Interessen leichter oder schwerer in einer<br />
Organisation durchsetzen können. Dieselbe Emotion kann für die Organisation positiv<br />
(negativ) und für das Individuum negativ (positiv) wirken.“ (Heinemann, 2004, S. 247) „Ob<br />
also etwa Enttäuschung über den Konkurrenten bzw. Mitspieler eher die Leistungsbereitschaft<br />
lähmt oder anspornt, ob Geselligkeit zu zerstörerischem Mobbing führt oder letztlich<br />
40
der Kitt ist, der eine Sportorganisation oder eine Gruppe zusammenhält, ob zerstörtes<br />
Vertrauen die Aufmerksamkeit des Einzelnen erhöht oder damit das Risiko, enttäuscht zu<br />
werden, verringert oder zu einem Abbruch von Beziehungen und das Sinnen auf Rache<br />
führt, kann nur in jedem Einzelfall entschieden werden.“ (Heinemann, 2004, S. 243 f.)<br />
Lutz Gerdes (2001) macht in seiner Dissertation „Dialogik im Partnerkontaktsport“<br />
auf die besondere Funktion von Körperkontakt im Judo aufmerksam. Die durch<br />
den Körperkontakt entstehenden Emotionen in den Beziehungen unter den<br />
Mitgliedern können bei entsprechendem Emotionsmanagement der Sportorganisation<br />
und entsprechender Emotionsarbeit der Mitglieder eine wichtige<br />
Funktionen für die Persönlichkeitsbildung des Einzelnen und für die Stimmung in<br />
der Gruppe haben.<br />
3.3.6.3 Emotionsarbeit und Emotionsmanagement<br />
Unter Emotionsarbeit ist zu verstehen, dass Mitglieder bzw. Mitarbeiter<br />
Techniken einsetzen, um angemessen Emotionen zu zeigen, unangemessenen zu<br />
unterdrücken und Emotionen andere im eigenen Interesse zu beeinflussen. Zu<br />
unterscheiden sind einerseits in ungeregelter Emotionsarbeit beruhend auf<br />
Erfahrungen und Intuition und andererseits in formeller Emotionsarbeit, bei der die<br />
Bedingungen, unter denen diese Arbeit geleistet wird ebenso wie die Techniken<br />
ihrer Ausführung festgelegt sind.<br />
Emotionsmanagement sind eingesetzte Strategien der Sportorganisation, um<br />
positiv Emotionen zu entwickeln und negative Emotionen zu unterdrücken. Hierzu<br />
stehen im Prinzip vier unterschiedliche Strategien zur Verfügung.<br />
• Normative Festlegungen: So genannte feeling rules legen fest, welche<br />
Gefühle in der jeweiligen Situation erwartet werden.<br />
• Selektion: „Hochschild (1979) macht mit dem Begriff „emotionale Stigmatisierung“ darauf<br />
aufmerksam, dass die Merkmale Geschlecht, Alter, ethische Zugehörigkeit, vor allem,<br />
wenn sie mit sichtbaren Charakteristika verbunden sind, erwartbar machen, dass die<br />
jeweilige Person bestimmt Gefühle in der erforderlichen Vielfalt und Intensität ausdrücken<br />
und vermitteln. Solche emotionellen Stigmatisierungen sind wichtige Selektionskriterien bei<br />
der Auswahl von Personen für bestimmt Aufgaben und Positionen. Bewusst oder<br />
unbewusst spielt bei der Auswahl neuer Mitglieder, aber auch etwa für einen Vorstand, für<br />
die Mitglieder in einer Kommission eine Rolle, inwieweit diese Mitglieder auch emotionell<br />
integriert werden können, ob – wie es umgangssprachlich heißt – die „Chemie stimmt“.<br />
Dies ist wohl auch ein Grund dafür, dass viele Vereine, eher geschlossene Gesellschaften<br />
sind, man lieber „unter sich“ bleiben möchte, eben weil man sich dann auch emotional<br />
besser versteht.“ (Heinemann, 2004, S. 249 f.)<br />
41
• Sozialisation: Sozialisation im Rahmen des Emotionsmanagements<br />
bedeutet, dass man lernen muss, welche Emotionen in welchen Situationen<br />
der betreffenden emotionellen Organisationskultur wie zu zeigen sind.<br />
• Interpretative Strategien: „Wenn trotz allem „negative“ Emotionen ausbrechen, kann<br />
man sie uminterpretieren. Ein bekannter Mechanismus der Umdeutung ist die ex post<br />
Rationalisierung. Emotionsgeleitete Entscheidungen werden als höchst vernünftig<br />
umgemünzt.“ (Heinemann, 2004, S. 250)<br />
Abschließend macht hierzu Heinemann (2004, S. 254) deutlich:<br />
„Der angemessenen Umgang mit eigenen Emotionen und den Emotionen anderer, das<br />
sorgfältige Codieren und Decodieren von Emotionen, die Interpretation der Funktion, der<br />
Einsatz der Techniken das Emotionsmanagements und der Emotionsarbeit sind für die<br />
erfolgreiche Arbeit mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger als viele andere Strategien<br />
des Managements.“<br />
42
4 Frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong> - Organisationssoziologischen<br />
Möglichkeiten zur Förderung von Mädchen und Frauen<br />
Äußerst ausführlich wurde in Kap. 3 auf die Organisationsform Sportverein<br />
eingegangen. Dabei fand die Annäherung an den Sportverein von den drei Seiten<br />
Rechtskörper, soziale Architektur und Personenvereinigung statt. An dieser<br />
Struktur orientierend wird auf die organisationssoziologischen Möglichkeiten zur<br />
Förderung von Mädchen und Frauen im Judosport eingegangen.<br />
4.1 Frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong><br />
Zunächst soll auf die Bezeichnung frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong> näher<br />
eingegangen werden. Ein frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong>, was ist das? Was<br />
bedeutet frauenfreundlich und wie entwickelte sich geschichtlich Judo für Frauen?<br />
4.1.1 Judo-geschichtlicher Überblick im Bezug auf Frauen<br />
Zuerst eine kleine Begriffsbestimmung zum Judo. Das Wort setzt sich aus den<br />
Silben „Ju“ und „do“ zusammen. „Ju“ bedeutet soviel wie Sanftheit oder<br />
Nachgeben, „do“ hingegen steht für Weg oder Prinzip. Judo bedeutet also soviel<br />
wie „sanfter Weg“ oder der „Weg des Nachgebens“.<br />
Der Begründer des Judo ist Jigoro Kano, der 1882 in Tokio eine eigene<br />
Sportschule – den Kodokan (Haus zum Erlernen des Weges) eröffnete. Von dort<br />
aus begann Kano seine Lehre verknüpft mit der buddhistischen Religion zu<br />
verbreiten. Seiner Philosophie nach sollte Judo gleichzeitig ein geistiges und<br />
körperliches Training sein, das Geist und Körper in einen Zustand der Harmonie<br />
und Ausgeglichenheit versetzt (ein Grundkonzept der meisten Kampfsportarten).<br />
Die Entstehung des Judo in Deutschland geschah als 1906 japanische<br />
Kriegsschiffe zu einem Freundschaftsbesuch nach Kiel kamen. Die Japaner<br />
zeigten dem deutschen Kaiser Wilhelm II ihre Nahkampfkünste vor. Dieser war<br />
begeistert und ließ seine Kadetten in der Kunst unterrichten. Der damals<br />
bedeutendste deutsche Schüler Erich Rahn gründete die erste deutsche Schule<br />
für asiatische Kampfkünste, deren Techniken noch Jiu-Jitsu genannt wurden.<br />
43
Es folgt ein chronologischer Überblick über die weitere Entwicklung von (vgl.<br />
Gösche, Andree, Fischer, 2002, S. 18 ff.):<br />
• 1922 wurde in Frankfurt der erste deutsche Jiu-Jitsu Verein gegründet und<br />
es fanden die ersten deutschen Meisterschaften statt.<br />
• Die erste Europa-Meisterschaft für Männer wurde 1934 ausgerichtet.<br />
• 1956 fand die erste Judo-Weltmeisterschaft für Männer statt<br />
• 5. April 1957 legt Ilse Brief als erste Frau in Deutschland erfolgreich die Prüfung<br />
zum ersten Dan ab (schwarzer Gürtel).<br />
• Zur olympischen Disziplin für Männer wurde Judo dann im Jahre 1964 in<br />
Tokio.<br />
• 1968 dürfen auf Beschluss der Jahreshauptversammlung des DJB Kata-<br />
Meisterschaften auch für Frauen und Mädchen durchgeführt werden. (Kata<br />
ist kein Zweikampf sondern eine Demonstration von Techniken)<br />
• 17. November 1970 fanden die ersten Deutschen Judo-Damen-Meisterschaften<br />
in Rüsselsheim statt<br />
• 1975 findet dann die erste Europameisterschaft der Damen statt.<br />
• 19. bis 22. November 1987 war in der Essener Grugahalle die Judo-<br />
Weltmeisterschaft der Frauen und Männer.<br />
• 1988 Judo wird als Demonstrationswettbewerb für Frauen in das Programm<br />
der Olympischen Spiele in Seoul aufgenommen.<br />
• Einführung der 1. Judo-Bundesliga Frauen-<br />
• 1995 Astrid Arndt wird Weltmeisterin im Superleichtgewicht bei den Weltmeisterschaften<br />
der Blinden und Sehgeschädigten in Colorado Springs.<br />
Judo ist heute mit über 6 Millionen Sportlern in über 150 Ländern der weltweit am<br />
meisten verbreitete Kampfsport. In Deutschland betreiben etwas weniger als<br />
200.000 Menschen Judo, wobei der Anteil an weiblichen Judokas seit etwa zehn<br />
Jahren bei knapp einem Drittel liegt. 1959 betrug der weibliche Anteil noch etwa<br />
6 %.<br />
Gemäß den vom NWJV zur Verfügung gestellten Daten zählte dieser Judo-<br />
Verband 57.310 Mitglieder (68 % männlich, 32 % weiblich), wohingegen der<br />
sportartübergreifende Anteil an weiblichen Mitgliedern im LSB NRW heute etwa<br />
44
39 % beträgt. Etwa 75 % der Judokas sind minderjährig. Hiervon ist der größte<br />
Teil der Judokas zwischen 7 und 14 Jahren.<br />
Heute gibt es im Judo und dessen Regelwerk für Mädchen und Jungen sowie<br />
Männer und Frauen keine nennenswerten Unterschiede mehr. Offizielle<br />
Wettkämpfe erfolgen geschlechtsspezifisch und in entsprechend angepassten<br />
Gewichtsklassen.<br />
Zum aller größten Teil wird Judo in den Vereinen in geschlechtergemischten<br />
Gruppen trainiert, so dass dort z. T. auch geschlechtergemischte Kämpfe stattfinden.<br />
Seit 2007 ist es in Deutschland auf speziell ausgeschriebenen Turnieren<br />
möglich, dass in der Altersklasse U11 (unter 11 Jahre) auch geschlechtergemischte<br />
Kämpfe stattfinden. Hierzu gibt es ablehnende und zustimmende<br />
Meinungen. Die Personen, die dies ablehnen, wollen ihre Jungen und Mädchen<br />
schützen. Einerseits vor der angeblichen Aggressivität der Jungen, also zum<br />
Schutz der Mädchen, und anderseits zum Schutz der Jungen, vor einer als<br />
peinlich gedeuteten Niederlage. Die Befürworter sehen die Möglichkeit von<br />
offiziellen geschlechtergemischten Kämpfen einerseits als einen positiven Beitrag<br />
zur gesellschaftlichen Geschlechterwahrnehmung (Mädchen können auch<br />
Kämpfen und gegen Jungen gewinnen) und anderseits sehen sie eine<br />
pragmatische Lösung, die es durch Zusammenlegung der Geschlechtsgruppen in<br />
den jeweiligen Gewichtsklassen ermöglicht, mehr Wettkämpfe durchführen zu<br />
können.<br />
4.1.2 Begriffsbestimmung: Frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong><br />
Das Wort frauenfreundlich setzt sich zusammen aus dem Nomen Frauen und dem<br />
Adjektiv freundlich. Frau ist einerseits eine Geschlechtsbezeichnung und<br />
anderseits eine Altersbezeichnung. Im Rahmen dieser Masterarbeit ist der Begriff<br />
Frau i. d. R. als Geschlechterbezeichnung gemeint, d.h. es sind ausdrücklich auch<br />
Mädchen hiermit angesprochen. Freundlich beschreibt das deutsche Wörterbuch<br />
der Brockhaus Enzyklopädie (1996) folgendermaßen:<br />
• „freundlich drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene<br />
Sache [Judo] für jemanden [Frauen] (,etwas) günstig, angenehm, für (etwas)<br />
[Frauen] gut geeignet ist (…) [und/oder]<br />
45
• drückt in Bildung mit Substantiven ein freundliches Entgegenkommen aus:<br />
wohlgesinnt gegenüber jemandem [Frauen], (etwas)“<br />
Damit bedeutet frauenfreundlicher <strong>Judoverein</strong>, dass einerseits Judo in einem<br />
<strong>Judoverein</strong> für Frauen geeignet, angenehm und günstig ist und anderseits dass<br />
die Mitglieder in einem <strong>Judoverein</strong> wohlgesinnt gegenüber Frauen in ihrem Verein<br />
sind und ihnen ein freundliches Entgegenkommen anbieten.<br />
Judo wird fast ausschließlich koedukativ angeboten, also für Mädchen/ Frauen<br />
gemeinsam mit Jungen/ Männern. Meiner Auffassung ist ein Judoangebot nur für<br />
Mädchen bzw. Frauen auch nicht frauenfreundlicher als ein koedukatives<br />
Judoangebot, da es möglich ist das Judotraining so zu differenzieren, dass<br />
Männer wie Frauen hier gut zu Recht kommen. Des Weiteren kann sogar<br />
gesellschaftlich in Frage gestellt werden, ob eine Separierung von Frauen in einer<br />
zusätzlichen Gruppe sinnvoll ist, da dies kein wohlgesinntes Gegenübertreten der<br />
Männer ggü. den Frauen abverlangen würde.<br />
4.1.3 Untersuchungsmöglichkeiten zum frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong><br />
Um zu analysieren, ob Judo und der <strong>Judoverein</strong> frauenfreundlich ist, kann im<br />
Wesentlichen auf der medizinischen, der persönlichen oder der strukturellen<br />
Ebene untersucht werden:<br />
1. Eine medizinische Untersuchung hinsichtlich der Belastungen des Judo auf<br />
die Frau ist für breitensportliches Judo nicht nötig, da es unbestritten keine<br />
besonderen negativen Belastungen für Frauen im Vergleich zu den Männern<br />
aufweist. Wenn überhaupt wäre eine medizinische Untersuchung zum<br />
breitensportlichen Judo bei schwangeren Frauen angebracht. Im hochleistungssportlichen<br />
Judo ist die Untersuchung sowohl für Männer als auch für<br />
Frauen zu empfehlen, um Verletzungen und Spätfolgen präventiv entgegenzuwirken.<br />
2. Eine weitere Art der Untersuchung wäre auf der persönlichen Ebene von<br />
Frauen möglich. Im Konkreten befragt man diese wie sie zu Judo und dem<br />
<strong>Judoverein</strong> stehen. Dabei könnten zunächst Frauen befragt werden, die<br />
nicht Judo betreiben, warum sie dies nicht tun. Als zweites könnten die<br />
Frauen befragt werden, die Judo betreiben, wie geeignet sie Judo bei ihrem<br />
46
Judoanbieter finden und ob ihnen die anderen Mitglieder insbesondere die<br />
Männer wohlgesinnt gegenübertreten. Zuletzt könnten diejenigen Frauen<br />
befragt werden, die Judo in der Vergangenheit betrieben haben, warum sie<br />
mit der Sportart aufgehört oder den Judoanbieter verlassen haben und wie<br />
geeignet sie Judo für Frauen halten.<br />
3. Die dritte Art der Untersuchung kann, wie im Rahmen dieser Masterarbeit<br />
geschehen, auf organisationssozilogischer Ebene geschehen.<br />
4.2 Die Aufgabe des <strong>Judoverein</strong>s als Teil des dritten Sektors<br />
Die Ausübung von Judo ist in Deutschland zwar auch in Kampfsportschulen<br />
möglich, aber ohne ein gemeinnütziger Sportverein zu sein, können deren<br />
Teilnehmer nicht an offiziellen Maßnahmen der Judoverbände wie Turniere,<br />
Lehrgänge und Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen.<br />
<strong>Judoverein</strong>e, und hiermit sind in dieser Arbeit auch Judoabteilungen gemeint,<br />
übernehmen als Sportvereine und damit als Teil des dritten Sektors Aufgaben, die<br />
der Staat und die Wirtschaft nicht wahrnehmen (siehe auch Kapitel 3.1.1) Die<br />
entscheidende Aufgabe von <strong>Judoverein</strong>en ist es, Judo anzubieten. Das Spektrum,<br />
was sich hinter Judo verbirgt, ist dabei sehr breit. Es reicht von einer asiatischen<br />
Philosophie bis hin zu einer olympischen Zweikampfsportart.<br />
Um als Sportverein zu gelten und damit auch staatliche Fördermöglichkeiten zu<br />
nutzen, müssen einige Merkmale erfüllt werden. Der Sportverein ist eine<br />
Vermengung von sozialer Gruppe und formaler Organisation, die miteinander<br />
letztlich unverträgliche Strukturformen darstellen. Damit sind Versammlungen<br />
einerseits Mittel zur sozialen Integration und Kommunikation und anderseits<br />
können sie unter dem Diktat der Effektivität stehen (siehe Kap. 3.1.2.). Unter<br />
welchen Gesichtspunkten in einem <strong>Judoverein</strong> die Versammlungen durchgeführt<br />
werden, ist dem Verein und damit dem Vorstand und den Mitgliedern selbst<br />
überlassen. Ob sie also Versammlungen zur Integration von Mitgliedern nutzen,<br />
um u. a. Randgruppen zu integrieren, bleibt ihnen überlassen.<br />
Der <strong>Judoverein</strong> hat eigentlich die Aufgabe sich an den Interessen der Mitglieder zu<br />
orientieren (siehe Kap. 3.1.3)<br />
Da die Mitgliedschaft freiwillig ist, kann das Mitglied bei Nichtgefallen den Verein<br />
verlassen oder sich für die Veränderung des Vereins einsetzen. Wie viele<br />
47
weibliche Mitglieder wählen den Weg des Austritts aus dem Verein? Gibt es in<br />
bestimmten Vereinen eine geringere Fluktuation der weiblichen Mitglieder?<br />
Durch die Unabhängigkeit von Dritten ist der <strong>Judoverein</strong> auf Freiwilligenarbeit und<br />
Mitgliedsbeiträge angewiesen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit Mädchen und<br />
Frauen Interesse haben sich durch ihre Freiwilligenarbeit einzubringen und falls ja,<br />
ob ihnen von den anderen Mitgliedern dazu die Möglichkeiten gegeben werden?<br />
Doch ermöglicht die demokratische Entscheidungsstruktur den weiblichen<br />
Mitgliedern sich und seine eventuell spezifisch weiblichen Ideen einzubringen?<br />
Die Besonderheiten des Sportvereins und damit auch des <strong>Judoverein</strong>es ist häufig<br />
eine eher improvisierte Organisation mit einem hohen Anteil informeller<br />
Kommunikation (siehe Kap. 3.1.3). Inwiefern sich weibliche Mitglieder die<br />
Möglichkeit der Kommunikation zu Nutze machen können, entscheidet auch über<br />
die Möglichkeiten ihres Einflusses.<br />
Einem weiblichen Mitglied oder den weiblichen Mitgliedern stehen im Rechtskörper<br />
<strong>Judoverein</strong> viele Möglichkeiten zur Verfügung sich einzubringen. Der<br />
Verein im Allgemeinen und Judo durch seinen Fassettenreichtum bieten viele<br />
Ansatzpunkte. Jedoch können anderseits die anderen Mitglieder, die sich schon<br />
länger im <strong>Judoverein</strong> engagieren, das Engagement des weiblichen Mitglied oder<br />
der weiblichen Mitglieder durch Verweigerung der Unterstützung oder Ausnutzung<br />
der bestehenden Mehrheitsverhältnisse in Versammlung verhindern. Dabei sind<br />
die Eigenheiten der Mitglieder nicht zwingend von Effizient, sondern eher von<br />
Emotionen getrieben.<br />
4.3 Die soziale Architektur von <strong>Judoverein</strong>en und die Möglichkeit<br />
diese zu gestalten<br />
Zur sozialen Architektur gehören die Ziele, die Struktur, die Formen der<br />
Ausgestaltung und der Wandel eines <strong>Judoverein</strong>s, auf die nachfolgend jeweils<br />
eingegangen wird.<br />
48
4.3.1 Die Ziele des <strong>Judoverein</strong>s<br />
Judo als ein zum Schutz des Menschen reglementiertes Kampfsportsystem, mit<br />
dem der Gegner hautnahe bezwungen werden kann, ist für viele ein attraktiver<br />
Wettkampfsport. Das Ziel des <strong>Judoverein</strong>s ist es Judo zu betreiben und zu<br />
fördern. Wie schon erwähnt bietet Judo viele verschiedene Fassetten, so dass<br />
Judo im weitesten Sinne von allen Menschen betrieben werden kann bis auf von<br />
Babys und Kleinkindern. Judo ist auch für Behinderte und auch für Senioren<br />
möglich. Judo kann ebenso als Mittel der Prävention und Rehabilitation nutzbar<br />
gemacht werden. Auch kann es zur Therapie von verhaltensauffälligen Menschen<br />
eingesetzt werden. Weit verbreitet ist Judo natürlich auch als olympische Sportart.<br />
Doch die Frage ist, ob es hierbei geschlechterspezifisch unterschiedliche<br />
Interessen gibt?<br />
Neben dem Hauptziel Judo ist das zweite Hauptziel des Vereins die Systemerhaltung,<br />
also das Überleben des Vereins. Ein weiteres Ziel ist die Herausbildung<br />
einer spezifischen Ideologie bzw. Organisationsphilosophie und somit die Schaffung<br />
von Werten und Visionen (siehe Kap. 3.2.1). Stellt die Organisationsphilosophie<br />
eine Basis für Frauen her sich wohl zufühlen? Oder stimmen die<br />
Werte und Visionen der weiblichen Mitglieder nicht mit denen des <strong>Judoverein</strong>s<br />
überein? Dies lässt sich im Besonderen daran erkennen, ob weibliche Mitglieder<br />
im <strong>Judoverein</strong> vertreten sind und mit welchem Anteil an der Gesamtzahl der<br />
Mitglieder.<br />
Ob der <strong>Judoverein</strong> die klassischen ideologischen Ziele von Sportvereinen wie<br />
'Gemeinwohl’ und ’Sport für alle’ umsetzt, kann an den Sachzielen beurteilt<br />
werden (s. Kapitel 3.2.1.1). Herrscht das alleinige Ziel der Talentförderung und<br />
des internationalen Wettkampferfolgs vor, so wird das ideologische Ziel ’Sport für<br />
alle’ nicht ausreichend umgesetzt, da allen gar nicht die körperlichen<br />
Voraussetzungen zur Verfügung stehen, diese Sachziele zu erreichen. Werden<br />
Interessen von Minderheiten, also eventuell der weiblichen Minderheit im<br />
<strong>Judoverein</strong> unbeachtet gelassen, ist das ideologische Ziel ’Gemeinwohl und Sport<br />
für alle’ auch nicht vollständig umgesetzt.<br />
Aus der Analyse der Stärkemeldungen aller <strong>Judoverein</strong>e in NWJV und der<br />
Recherche auf deren Homepages lässt sich schlussfolgern, dass dort bei allen -<br />
außer einem Verein - Judo für das weibliche und das männliche Geschlecht in<br />
koedukativem Training angeboten wird. Die Ausnahme bildet der Frauen<br />
49
Selbstverteidigungsverein Münster e.V., der ausschließlich weibliche Mitglieder<br />
hat. Alle anderen 563 Vereine im NWJV scheinen das Sachziel zu haben Judo<br />
nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen anzubieten. Die Umsetzung des<br />
Sachziels Judo Frauen scheint den Vereinen unterschiedlich gut zu gelingen, oder<br />
sie scheinen unterschiedlich viel Wert auf dieses Ziel zu legen. Es gibt Vereine mit<br />
verschwindend wenigen weiblichen Mitgliedern und Vereine mit einem weiblichen<br />
Mitgliederanteil von mehr als 50 %. Im Durchschnitt sind 31,5 % weibliche<br />
Mitglieder in den Vereinen des NWJVs.<br />
Die Masterarbeit versucht herauszufinden, was organisationssoziologisch dazu<br />
beiträgt, dass das Sachziel Judo für Mädchen und Frauen von bestimmten<br />
Vereinen so umgesetzt wird, dass es zu einem weiblichen Mitgliederanteil von<br />
37 % und mehr kommt. Damit das Sachziel, Judo für Mädchen und Frauen<br />
anzubieten, realisiert werden kann, muss dieses in operative Ziele umgesetzt<br />
werden. Operative Ziele wären u. a. das Werben um weibliche Mitglieder in der<br />
Öffentlichkeit, damit diese aufmerksam auf den <strong>Judoverein</strong> werden, das Anbieten<br />
von konkreten Trainingszeiten sowie das Einsetzen von adäquaten Trainern.<br />
Operationale Ziele sind im Hinblick auf die hiesige Untersuchung z. B. das Ziel<br />
den weiblichen Mitgliederanteil zu erhöhen oder die Fluktuation der weiblichen<br />
Mitglieder zu verringern. Ein weiteres operatives Ziel könnte die Verbesserung der<br />
Integration von weiblichen Mitgliedern sein. Hierbei lässt sich das operative Ziel<br />
nicht unmittelbar in ein operationales Ziel umwandeln. (siehe Kap. 3.2.1.1).<br />
In Kap. 3.2.1.2. wird die Notwendigkeit beschrieben Ziele klar zu formulieren.<br />
Jedoch ist zu vermuten, dass aufgrund der meist nur ehrenamtlichen Tätigkeiten<br />
der Mitglieder über die Gesamtheit der Ziele und die Zielerreichung Klarheit<br />
besteht. Dies lässt sich u. a. aus der nicht erfolgten oder sehr schleppend<br />
erfolgten Auskunft über die Ein- und Austritte und der daraus resultierenden<br />
Fluktuation folgern. Oder auch genauere Angaben bezüglich der prozentualen<br />
regelmäßigen Anwesenheit der Mitglieder in ihrer Trainingsgruppe. Mit beiden<br />
Informationen könnten Rückschlüsse auf die Qualität des Trainings- und<br />
Vereinsangebot geschlossen werden. Erfragt wurde in der Untersuchung auch,<br />
wie wichtig den <strong>Judoverein</strong>en Bewegung, Gemeinschaft, Gürtelprüfungen, hohe<br />
Mitgliederstärke, Wettkampf, Judomannschaften und Wettkampf auf hohem<br />
Niveau oder etwas anderes (sonstiges) ist. Nur vier von 24 Vereinen nannten Ziele<br />
50
wie Wertevermittlung und Persönlichkeitsförderung unter sonstiges. Dies soll nicht<br />
heißen, dass die anderen Vereine diese Ziele nicht hätten, aber sie sind<br />
anscheinend den Befragten des Vereins nicht bewusst. Wenn schon der Befragte,<br />
als eine prägende Person im Verein die Ziele nicht nennen kann, dann werden<br />
den anderen Mitgliedern die Ziele wahrscheinlich auch nicht bewusst sein.<br />
In Kap. 3.2.1.3. wird auf die Probleme der Zielbestimmung und Durchführung<br />
hingewiesen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Ziele in Sportvereinen oft nur<br />
sehr global und allgemein, oft ohne konkreten Inhalt formuliert sind, d. h. bloße<br />
Leerformeln sind. Der Prozess einer Zielbestimmung ist ein politischer Prozess, in<br />
dem unterschiedliche Interessen, Einflusschancen und damit auch Konflikte<br />
ausgetragen werden. Die Umsetzung des Ziels, wie Förderung der Gemeinschaft<br />
der Mädchen, kann Ausgaben hervorrufen, die an einer anderen Stelle zu<br />
Einsparungen führen müssten.<br />
Die Veränderung eines <strong>Judoverein</strong> hin zu einem frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong><br />
setzt einen politischen Prozess im Verein in Gang, der auch zu einem großen<br />
Streit unter den Mitgliedern führen kann, weil über Ziele nachgedacht und andere<br />
Prioritäten gesetzt werden und damit für manche Mitglieder liebgewordene Dinge<br />
geändert oder abgeschafft werden könnten.<br />
4.3.2 Die Struktur von <strong>Judoverein</strong>en<br />
Aus der Gruppe der fünfzig größten <strong>Judoverein</strong>e in NRW sind 33 echte<br />
<strong>Judoverein</strong>e. Der Rest organisiert Judo als eine Abteilung innerhalb eines<br />
Sportvereins, wobei diese eine ähnlich komplexe Organisationsstruktur haben<br />
kann, wie ein echter bzw. unabhängiger <strong>Judoverein</strong> (siehe Kap. 3.2.2.1).<br />
Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, ob es strukturbedingte Unterschiede gibt,<br />
die einen unterschiedlichen Frauenanteil verursachen.<br />
Aufgrund der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft und Mitarbeit ist die Tiefe der<br />
Organisationsstruktur in vielen Sportvereinen und damit auch <strong>Judoverein</strong>en im<br />
Verhältnis zu anderen Sportorganisationen relativ flach, d. h. es existieren<br />
unterhalb der Führungsebene nur wenige weitere Entscheidungsebenen. Es gibt<br />
in Sportvereinen den Vorstand als Organisationsspitze und falls vorhanden als<br />
einzige Untergliederung die Sportabteilungen. Dabei ist die Aufgabenerfüllung<br />
personenbestimmt, d. h. Führung basiert auf persönlicher Ausstrahlung oder<br />
51
Autorität, und die Kontrolle erfolgt im Wesentlichen durch soziale Beziehungen.<br />
Damit hängt die Möglichkeit zur eventuellen Förderung von Frauen im <strong>Judoverein</strong><br />
an bestimmten einflussreichen Personen im Verein. Eine Person, die den Verein<br />
entsprechend frauenfreundlicher Ziele verändern will, muss zur Zusammenarbeit<br />
mit den anderen Engagierten die informellen sozialen Prozesse kennen, um<br />
Erfolgschancen zu haben. Die Positionen des Vorstandes eines <strong>Judoverein</strong>s<br />
werden vermeintlich wie bei anderen Sportvereinen wenig differenziert und ihre<br />
Aufgaben wenig standardisiert sein, so dass auch hier Ämter meist wesentlich von<br />
dem Engagement und den Fähigkeiten des jeweiligen Amtsinhabers bestimmt<br />
sind. Damit ist zu vermuten, dass die engagiertesten im <strong>Judoverein</strong>, ihren Verein<br />
besonders durch ihre persönlichen Fähigkeiten und Vorstellungen beeinflussen<br />
und dadurch zu mehr oder weniger frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> beitragen (vgl.<br />
Kap. 3.2.2.2).<br />
Im Rahmen der Koordination und Kontrolle besteht auch im <strong>Judoverein</strong> die<br />
Gefahr, dass Trainer eine individuelle Wahrnehmung und Wirklichkeitsinterpretationen<br />
haben und sich eigene Ziele und Aufgaben definieren. Daher kann der<br />
Trainer mit anderen Zielen Judo unterrichten als vom Verein vorgesehen. Da es<br />
sich bei dem Großteil der Trainer um ehrenamtlich tätige Personen handelt, ist vor<br />
allem die gegenseitige Absprache und das Verhandeln mit der entsprechenden<br />
Person der Weg zur Veränderung. Will oder kann man nicht mit der entsprechenden<br />
Person verhandeln, kann durch eine demokratische Entscheidung<br />
aller Mitglieder oder durch den Vorstand oder dem Trainerteam derjenige durch<br />
zum Einlenken gezwungen werden. Dies kann dazu führen, dass der<br />
entsprechende Trainer sein Amt nicht mehr wahrnehmen will und dem Verein<br />
nicht mehr zur Verfügung steht, was zu einem noch viel größeren Problem werden<br />
kann, wenn nicht genügend Trainer zur Verfügung stehen. (vgl. Kap. 3.2.2.4).<br />
Als neu gewählter Vorsitzender eines <strong>Judoverein</strong>s hat man nicht automatisch die<br />
Autorität die Dinge zu ändern. Die Autorität muss sich erst aus Charisma,<br />
Fachkompetenz, Erfahrung, besonderem Wissen, Beziehungen und<br />
Überzeugungskraft entwickeln (vgl. Kap. 3.2.2.4). Die Instrumente der Kontrolle<br />
sind in einem Sportverein und damit auch in einem <strong>Judoverein</strong> sehr viel geringer<br />
als in staatlichen Verwaltungen oder kommerziellen Betrieben. Daher sind<br />
Selektion, Sozialisation, Einbindung und Schaffen von Vertrauen die<br />
vorherrschenden Instrumente der Kontrolle (vgl. Kap. 3.2.2.5).<br />
52
4.4 Der <strong>Judoverein</strong> als Personenvereinigung<br />
4.4.1 Organisationskultur<br />
Die Organisationskultur besteht aus Organisationsphilosophie, Bedeutungsstrukturen,<br />
Alltagsroutinen, sichtbaren Artefakten der Organisationskultur und<br />
ihren Differenzierungen. Sie bildet ein komplexes Gebilde ab, das von außen<br />
kaum empirisch ermittelt werden kann. Das Zurechtfinden in einem <strong>Judoverein</strong><br />
bedingt, dass man nicht nur das typische Netz der Interaktionsmuster,<br />
Beziehungen, tradierte Normierungen, Verhaltensstile etc. kennen muss, sondern<br />
sich auch mit dem <strong>Judoverein</strong> identifizieren kann (vgl. Kap. 3.2.1.3).<br />
Die Organisationskultur eines <strong>Judoverein</strong>s könnte einen wichtigen Einfluss haben,<br />
ob sich weibliche Mitglieder dort wohl fühlen. Im Rahmen der hiesigen<br />
Untersuchung wird durch die offenen Fragen versucht, Einblicke in die<br />
Organisationskultur zu erlangen.<br />
4.4.2 Demographie von <strong>Judoverein</strong>en<br />
Ein Verein wird geprägt von unterschiedlichen Personen, die sich nach gewissen<br />
Merkmalen in unterschiedliche Gruppen wie Geschlecht, Alter, Nationalität,<br />
berufliches Knowhow oder familiären Hintergrund zusammenfassen lassen (vgl.<br />
Kap. 3.3.2.).<br />
In der hiesigen Untersuchung wird anhand von ausgewählten <strong>Judoverein</strong>en<br />
untersucht, warum diese unterschiedliche demographische Ausprägungen haben,<br />
und sich daher in ihrem Anteil an weiblichen Mitgliedern unterscheiden. Wie<br />
schaffen es gewisse <strong>Judoverein</strong>e, dass sie anteilig mehr Mädchen beheimaten?<br />
Gibt es Anzeichen, die die Rekrutierung und Auswahl von neuen weiblichen<br />
Mitgliedern verbessern?<br />
4.4.3 Das Verhältnis zwischen Individuum und Organisation<br />
Zwischen dem <strong>Judoverein</strong> und seinen Mitgliedern besteht ein Abhängigkeitsverhältnis<br />
(vgl. Kap. 3.3.3). Folglich ist dem <strong>Judoverein</strong> daran gelegen, dass die<br />
Mitglieder eingebunden sind (vgl. Kap. 3.3.4.). Gelingt dies nicht ausreichend, so<br />
kann es zu nicht normenkonformen Verhalten führen, worunter Mobbing,<br />
53
Korruption und soziale Konflikte fallen (vgl. Kap. 3.3.5.). Insbesondere in Vereinen<br />
ist aufgrund der eher informellen Strukturen mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher<br />
Emotionen zu rechnen. Außerdem sagt man den beiden<br />
Geschlechtern nach, dass sie mit Emotionen anders umgehen können und diese<br />
anders zeigen. Daher könnte der Anteil der weiblichen Mitglieder in einem<br />
<strong>Judoverein</strong> stark davon abhängen, wie gut die Qualität der Emotionsarbeit der<br />
Trainer ist.<br />
54
5 Zur empirischen Untersuchung<br />
5.1 Gegenstand und Ziel der Untersuchung<br />
„Was macht einen frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> aus? Eine organisationssoziologische<br />
Betrachtung ausgewählter <strong>Judoverein</strong>e in NRW“ so lautet der Titel<br />
dieser Masterarbeit. Was sind die wesentlichen Merkmale eines frauenfreundlichen<br />
<strong>Judoverein</strong>s. Empirische Untersuchungen zu dieser Thematik im<br />
Rahmen von <strong>Judoverein</strong>en liegen nicht vor. Doch auf dem umkämpften Sportmarkt<br />
ist diese Untersuchung für <strong>Judoverein</strong>e von Interesse, um weibliche<br />
Mitglieder zu halten und neue hinzuzugewinnen. Als Variable dieser Untersuchung<br />
wird der Anteil an weiblichen Mitgliedern in einem <strong>Judoverein</strong> betrachtet. Dabei<br />
wird nicht untersucht, wie sich die weiblichen Mitglieder im Einzelnen im<br />
<strong>Judoverein</strong> fühlen, sondern warum aus sportorganisatorischen Gründen unterschiedliche<br />
Frauenquoten in <strong>Judoverein</strong>en vorherrschen.<br />
5.2 Hypothesen und untersuchungsleitende Fragen<br />
Die Objekte der Untersuchung sind <strong>Judoverein</strong>e bzw. Judoabteilungen. Ihre<br />
jeweiligen Mitglieder sind die Variablen und hier besonders der prozentuale Anteil<br />
an weiblichen Mitgliedern. Aber auch die Art und Weise wie die <strong>Judoverein</strong>e<br />
organisiert und strukturiert sind, stellen Variablen dar. Was verursacht in einem<br />
<strong>Judoverein</strong> einen höheren weiblichen Mitgliederanteil (> 36 %) und was einen<br />
niedrigeren (< 27 %). Der zu erklärende, bekannte Tatbestand, die abhängige<br />
Variable ist der höhere bzw. niedrigere Anteil weiblicher Mitglieder. Die gesuchten,<br />
unbekannten Tatbestände, die unabhängigen Variablen, sollen anhand dieser<br />
organisationssoziologischen Untersuchung von ausgewählten <strong>Judoverein</strong>en aus<br />
NRW herausgefunden werden. Lässt sich ein Ursachen-Wirkungs-Zusammenhang<br />
finden? Zur näheren Untersuchung der o. g. Fragestellung wurden Hypothesen<br />
erstellt, um daraus untersuchungsleitende Fragen abzuleiten. Als<br />
Hypothesen zum Ursache-Wirkungs-Zusammenhang sind folgende Zusammenhangsvermutungen<br />
zu nennen:<br />
1) In größeren Städten haben <strong>Judoverein</strong>e einen niedrigeren Anteil an<br />
weiblichen Mitgliedern.<br />
55
2) In Städten, in denen es weniger Sportvereine gibt, ist der Anteil weiblicher<br />
Mitglieder im Judo höher.<br />
3) In Städten, in denen es viele <strong>Judoverein</strong>e gibt, ist der Anteil weiblicher<br />
Mitglieder höher.<br />
4) Reine <strong>Judoverein</strong>e haben einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
5) Jüngere <strong>Judoverein</strong>e haben einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
6) <strong>Judoverein</strong>e, die kaum noch Mitglieder aufnehmen können, haben einen<br />
geringeren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
7) <strong>Judoverein</strong>e mit einem höheren Anteil weiblicher Mitglieder haben eine<br />
geringere Fluktuation ihrer weiblichen Mitglieder im Verhältnis zu Vereinen<br />
mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil.<br />
8) Die Art der Mitgliedergewinnung (u. a. Werbung und die Art der<br />
Vereinsartikel in Zeitungen) hat einen Einfluss auf den Anteil der weiblichen<br />
Mitglieder.<br />
9) <strong>Judoverein</strong>e in denen der Judo-Wettkampfsport eine geringe Priorität unter<br />
den Trainings- und Vereinszielen besitzt, haben einen höheren Anteil<br />
weiblicher Mitglieder.<br />
10) <strong>Judoverein</strong>e, in denen die weiblichen Mitglieder genauso regelmäßig bzw.<br />
regelmäßiger am Training teilnehmen wie männliche, haben einen höheren<br />
Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
11) <strong>Judoverein</strong>e in denen weniger Mitglieder an Wettkämpfen teilnehmen, haben<br />
einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
12) An die Interessen von Mädchen und Frauen angepasste Sportangebote und<br />
außersportliche Angebote führen zu einem höheren Anteil weiblicher<br />
Mitglieder.<br />
13) In <strong>Judoverein</strong>en in denen mehr weibliche Mitglieder an Versammlungen<br />
teilnehmen ist der Anteil weiblicher Mitglieder größer.<br />
14) Je höher der weibliche Anteil im Verein, der sich für den Verein engagiert,<br />
desto höher ist der weibliche Anteil der Mitglieder.<br />
15) In <strong>Judoverein</strong>en in denen ein höherer Anteil weiblicher Mitglieder vorhanden<br />
ist, finden die Interviewpartner den Umgang mit weiblichen Mitgliedern<br />
leichter bzw. ihnen fällt kein Unterschied ggü. männlichen Mitgliedern auf.<br />
16) Im Training in <strong>Judoverein</strong>en mit einem höheren Anteil weiblicher Mitglieder<br />
wird differenzierter auf das jeweilige Geschlecht eingegangen.<br />
56
17) Die Interviewpartner aus <strong>Judoverein</strong>en mit einem höheren Anteil an<br />
weiblichen Mitgliedern tätigen ausführlichere Aussagen zur Frage, was einen<br />
mädchen- und frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> ausmacht.<br />
5.3 Techniken der Datengewinnung<br />
Zur Unersuchung der o. g. Frage können unterschiedliche Techniken zur<br />
Datengewinnung herangezogen werden. Im Wesentlichen lassen sich diese<br />
Techniken in schriftliche, mündliche und telefonische Datenerhebung unterscheiden,<br />
wobei die Ergebnisse der letzten beiden nicht wesentlich voneinander<br />
abweichen (vgl. Heinemann, 1998, S. 112). Aufgrund der im Kap. 4 dargestellten<br />
komplexen und zumeist vergleichsweise informellen Organisationsstruktur, wurde<br />
sich für eine telefonische Befragung mit Hilfe eines Interviewleitfadens<br />
entschieden.<br />
5.3.1 Methode und Methodenkritik<br />
Bei einer Befragung werden die Zielpersonen persönlich von einem Interviewer zu<br />
den einzelnen Punkten des Fragebogens befragt. Die Antworten werden von<br />
Interviewer notiert und ggf. sogar aufgezeichnet, um offene Fragen besser<br />
auswerten zu können Als Vorteile dieser Befragungsform lassen sich folgende<br />
Punkte nennen (vgl. Heinemann, 1998, S. 91):<br />
• Breite Anwendungsmöglichkeiten: Es können Tatbestände ermittelt werden,<br />
die nicht beobachtbar sind – also Bedeutungen, Motive, Einstellungen,<br />
Meinungen, Sinndeutungen, Bewertungen, Emotionen etc.<br />
• Fehlende räumliche und zeitliche Begrenzungen: Die Daten, die erfasst<br />
werden, sind nicht auf bestimmte Räume und Zeiten des Geschehens beschränkt.<br />
• Möglichkeiten der Themenzentrierung: Befragungen können durch die<br />
Formulierung des Fragebogens gesteuert und damit auf einen bestimmten<br />
Zweck hin ausgerichtet, also auf das Forschungsproblem hin fokussiert<br />
werden.<br />
• Neolokale Einsatzmöglichkeit: Befragungen sind nicht an Ort und Zeit des<br />
Geschehens gebunden, sie lassen sich im Prinzip überall durchführen.<br />
57
• Standardisierung und Repräsentativität der Ergebnisse: Die Möglichkeit der<br />
Standardisierung des Fragebogens ist hoch; dadurch werden die Befragungsergebnisse<br />
von verschiedenen Personen miteinander vergleichbar.<br />
• Selbst- und Fremdbeobachtung: Mit der Befragung können sowohl Selbstbeurteilungen<br />
als auch Beobachtungen, die die befragte Person über ein<br />
Geschehen bzw. bei anderen Personen gemacht hat, erfasst werden.<br />
Als Nachteile der Befragung gelten folgende Punkte (Heinemann, 1998, S. 92 ff.):<br />
• Künstlichkeit der Messsituation: Befragungen sind nicht lose Gespräche,<br />
wie sie den Befragten aus vielen Alltagssituationen vertraut sind. Der Interviewer<br />
stellt Fragen und erwartet, dass der Befragte sie wahrheitsgemäß<br />
beantwortet.<br />
• Begrenzter Wahrheitsgehalt der Antworten: Eine Befragung hat im Prinzip<br />
nur dann einen Wert, wenn vorausgesetzt werden kann, dass auch aufrichtig<br />
und wahrheitsgemäß geantwortet wird.„<br />
• Begrenzte Kontrolle der Messsituation: Die Antworten hängen wesentlich<br />
von den situativen Gegebenheiten ab, in denen die Befragung durchgeführt<br />
wird. Die Messsituation selbst ist schwer kontrollierbar.<br />
• Deuten des gemeinten Sinns des Gesagten: Befragungen setzen voraus,<br />
dass alle – Interviewer ebenso wie die Befragten – eine gemeinsame Sprache<br />
sprechen, d.h. alle unter dem, was gesagt wird, dasselbe verstehen.<br />
Nicht alle Begriffe haben für alle befragten Personen, die gleiche Bedeutung,<br />
so dass Fragen je unterschiedlich verstanden und damit anders beantwortet<br />
werden. Es kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden,<br />
dass der Befragte die Fragen bzw. einzelne Begriffe so versteht, wie<br />
sie bei der Frageformulierung gemeint war.<br />
• Grenzen des Sprachschatzes: Wir können nicht alles, was wir wissen und<br />
fühlen verbal ausdrücken<br />
• Ausfallquoten: Die befragten müssen sich überhaupt bereit erklären, an<br />
dem Interview teilzunehmen<br />
In dieser Untersuchung überwiegen m. E. die Vorteile gegenüber den Nachteilen<br />
einer Befragung. Die Interviewtermine sind nach den Wünschen der Be-<br />
58
fragten zustande gekommen und die meisten stellten ihre Zeit für das Interview<br />
zur Verfügung. Die Interviews werden nur von einer Person durchgeführt und<br />
erfolgen zum größten Teil per Telefon, da dies die folgenden Vorteile bedeutet<br />
(vgl. Heinemann, 1998, S. 112f):<br />
• Es bestehen keine regionalen Beschränkungen, die ansonsten durch hohe<br />
Weg- und Zeitkosten bestünden.<br />
• Es entfallen Einflüsse, die durch unterschiedliches Auftreten und Erscheinungsbild<br />
des Interviewers verursacht sein könnten.<br />
• Der Fragebogen ist in einem Computer eingegeben, die Befragung erfolgt<br />
vom Computer aus, und auch die Antworten werden direkt in den Computer<br />
eingegeben.<br />
• Es sind im Gegensatz zur schriftlichen Befragung Verzweigungen, Filterungen<br />
etc. möglich, so dass man sich besser an unterschiedliche Antworten<br />
verschiedener Zielpersonen anpassen kann; auch ist man nicht auf geschlossene<br />
Fragen beschränkt.<br />
• Durch die direkte Aufzeichnung der Telefonbefragung per Mikrofon können<br />
qualitative Interviewteile besser ausgewertet werden.<br />
• Grundsätzlich besitzen die Telefonbefragungen Kostenvorteile. Da keine<br />
Fahrtkosten und die Kosten für die Entsprechende Fahrzeit für Interviewer<br />
und Befragten entstehen.<br />
5.3.2 Besonderheit von qualitativer Fragenabschnitte<br />
Bei der Frageformulierung wird auf eine sorgfältige Formulierung geachtet.<br />
Zusätzlich werden Fragen des Fragebogens von Prof. Dr. Klaus Heinemann<br />
(1994) genutzt.<br />
Der Interviewleitfaden besteht sowohl aus Fragen, die quantifizierbar zu<br />
beantworten sind, als auch offene Fragen, die nicht unmittelbar quantifizierbar<br />
sind. Bei Bedarf werden weitere Fragen zur Präzisierung der Untersuchung<br />
durchgeführt. Dies geschieht vor allem dann, wenn der Befragte Aussagen tätigt,<br />
die vom Fragekatalog wegführen, aber trotzdem von Interesse für die<br />
Untersuchung sind. Abhängig von der Auskunftsbereitschaft und –kompetenz der<br />
befragten Personen dienen die zuvor aufgeführten grundlegenden Fragen mehr<br />
59
als Grundlage eines Gesprächsleitfadens. Dadurch erhält die Befragung größere<br />
qualitative Abschnitte. Hierdurch entstehen weitere Vorteile:<br />
• Es können Fragen und ihre Reihenfolge flexibler aus dem jeweiligen Verlauf<br />
des Gesprächs, der Auskunfts- und Gesprächsbereitschaft und der individuellen<br />
Kompetenz und Erfahrung der jeweiligen Zielperson formuliert<br />
werden.<br />
• Dabei kann man leichter auf die für die jeweiligen Befragten relevanten Gesichtspunkte,<br />
ihre Erfahrungen, ihre Biographien, ihre Kompetenzen und<br />
Erlebnisse eingehen.<br />
• Des Weiteren ist die Interviewsituation dadurch weniger künstlich. Die Befragten<br />
können ihre Gesprächsbeiträge freier formulieren, so wie sie es in<br />
Alltagsgesprächen gewohnt sind.<br />
• Es erfolgt nicht bereits durch den Fragebogen eine Informationsselektion;<br />
man bleibt vielmehr offen für „Überraschungen“.<br />
• Es bestehen vermutlich geringere Hemmungen, über subjektives Erleben,<br />
Motive, Bewertungen, Emotionen etc Auskunft zu geben.<br />
Nachteile der qualitativen Interviewteile sind (vgl. Heinemann, 1998, S. 115 f.):<br />
• Einzelmessungen sind nicht wiederholbar.<br />
• Eine repräsentative Stichprobe ist nicht möglich, lediglich eine Auswahl „typischer<br />
Fälle“, so dass eine Verallgemeinerung der gewonnenen Daten nur<br />
begrenz erfolgen kann.<br />
• Die Interviewführung verlangt in hohem Maß Einfühlungsvermögen in die<br />
Person der Befragten, Sensibilität, um Vertrauen zu gewinnen und Grenzen<br />
der Auskunftsbereitschaft ertasten zu können und zugleich hohe fachliche<br />
Kompetenz, um in der Gesprächsführung die für die Problemstellung relevanten<br />
Tatbestände richtig abschätzen und erfragen zu können.<br />
• Die Auswertung qualitativer Interviews verlangt hohe Sachkompetenz und<br />
ist zugleich ungemein zeitaufwendig.<br />
60
5.4 Auswahl der zu untersuchenden Vereine<br />
Im Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband (NWJV) sind 564 Vereine gemeldet. Im<br />
Anhang (Anhang 1 bis 3) sind beispielsweise die 111 Vereine mit der höchsten<br />
Frauenquote aufgeführt. Doch die Untersuchung im Rahmen der Masterarbeit<br />
beschränkt sich auf die 50 größten Vereine im NWJV. Aus diesen werden die 13<br />
Vereine mit dem geringsten sowie 13 Vereine mit dem höchsten weiblichen<br />
Mitgliederanteil ausgewählt und genauer betrachtet Zur Datengewinnung werden<br />
fragengeleitete Interviews mit jeweils einem Vertreter der ausgewählten<br />
<strong>Judoverein</strong>e geführt.. Die Ansprechpartner wurden über eine Recherche der<br />
Homepages der ausgewählten <strong>Judoverein</strong>e ausgesucht und mit einem erfahrenen<br />
Landeskampfrichter und erfahrenen Schulsportbeauftragten des NWJVs abgestimmt.<br />
Mit den so ermittelten Personen wurde ein fragengestütztes Interview<br />
geführt. Zwei von den 13 Vereinen mit geringeren Frauenanteil standen für ein<br />
Interview nicht zur Verfügung. Nahezu alle Interviews wurden per Telefon geführt<br />
und per Mikrofon aufgezeichnet, sowie ein Großteil des Gesprächs der jeweiligen<br />
Interviews wurde ergänzend schriftlich fixiert.<br />
5.5 Durchführung der Befragung<br />
Die Befragten werden jeweils zu Beginn der Befragung darauf hingewiesen, dass<br />
die Daten aus dem Interview streng vertraulich behandelt und anonymisiert<br />
verarbeitet werden. Alle Befragten werden darüber informiert, dass sie aufgrund<br />
der Komplexität der Fragestellung jederzeit auch weitere Informationen zum<br />
Sachverhalt geben dürfen bzw. sollen.<br />
Die gesammelten Daten sind in der Software MaxQDA verarbeitet und die<br />
Mitschnitte der Telefonbefragungen sind digitalisiert. Beides liegt der Arbeit im<br />
Anhang bei.<br />
Abschließend ist hier darauf hinzuweisen, dass eine hohe Bereitschaft der<br />
Befragten Rede und Antwort zu geben vorlag. Die Interviews dauerten im Schnitt<br />
eine Stunde. Es gab aber auch Telefonbefragungen, die an die vier Stunden<br />
dauerten. Die judobegeisterten Befragten schienen sich solidarisch mit dem auch<br />
judobegeisterten Interviewer zu zeigen und nahmen sich daher viel Zeit.<br />
61
6 Auswertung der Datenerhebung<br />
6.1 Überblick über die befragten Vereine<br />
Die 50 größten <strong>Judoverein</strong>e werden jährlich im Fachorgan des NWJVs namens<br />
„Budoka“ als Rangliste abgedruckt. Da einige Vereine 2008 die gleiche Anzahl<br />
gemeldeter Mitglieder haben, werden 53 Vereine untersucht. Die Datenerhebung<br />
durch die Befragungen sind unter der Bedingung geführt worden, dass die Daten<br />
anonymisiert in dieser Arbeit dargestellt werden. Daher werden in dieser Arbeit<br />
keine Vereinsnamen oder Personennamen genannt, sondern jeder Verein wird<br />
durch eine Nummer dargestellt, die zugleich kenntlich macht, an welcher Stelle<br />
der Verein unter der Betrachtung des weiblichen Mitgliederanteils steht. Die<br />
fettgedruckten Zeilen weisen die Vereine auf, die befragt wurden Bei zwei<br />
Vereinen bestand nicht die Bereitschaft an dem Interview teilzunehmen, so dass<br />
diese beiden Vereine (Verein 49, Verein 51). im folgendem nicht weiter<br />
berücksichtigt werden.<br />
6.1.1 Geschlechtsspezifische Mitgliederstruktur<br />
Im Folgenden werden die statistischen Zahlen genauer dargestellt. Die<br />
Mitgliedsstärke der 53 größten Vereine reicht von 157 bis 563 aktiven Mitgliedern<br />
und die Spanne an weiblichen Mitgliederanteil liegt zwischen 19 % bis 47,8 %. Der<br />
weibliche Mitgliederanteil der ausgewählten dreizehn Vereine mit einem höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil weist eine Spanne von 37,0 % bis 47,8 % auf. Die<br />
Spanne der dreizehn Vereine mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil<br />
reicht von 19 % bis 26,3 % weiblicher Mitglieder. Der Durchschnitt liegt bei 31,6 %<br />
weiblichem Mitgliederanteil. Am 1. Januar 2008 gehörten dem NWJV 564 Vereine<br />
mit 57.310 Mitgliedern an (39.243 männlich, 18.067 weiblich). Damit ist der<br />
Durchschnittswert an weiblichen Mitgliedern der 53 größten Vereine von 31,6 %<br />
ähnlich dem Durchschnittswert aller Vereine im NWJV von 31,5 %.<br />
62
Tab. 6.1: Anteil weiblicher Mitglieder (eigene Darstellung)<br />
Verein Kreis aktive männl. weibl. Anteil<br />
Mitglieder<br />
weiblich<br />
Verein 1 <strong>Bochum</strong>/En 205 107 98 47,8%<br />
Verein 2 Märkischer K 280 148 132 47,1%<br />
Verein 3 Coesfeld 259 140 119 45,9%<br />
Verein 4 Krefeld 157 93 64 40,8%<br />
Verein 5 Köln 206 125 81 39,3%<br />
Verein 6 <strong>Bochum</strong>/En 133 81 52 39,1%<br />
Verein 7 Aachen 276 169 107 38,8%<br />
Verein 8 Kleve 295 181 114 38,6%<br />
Verein 9 <strong>Bochum</strong>/En 176 106 68 38,6%<br />
Verein 10 Recklinghausen 177 109 68 38,4%<br />
Verein 11 Köln 212 132 80 37,7%<br />
Verein 12 Aachen 239 149 90 37,7%<br />
Verein 13 Dortmund 211 133 78 37,0%<br />
Verein 14 Düsseldorf 457 291 166 36,3%<br />
Verein 15 Essen 168 107 61 36,3%<br />
Verein 16 Paderborn 210 137 73 34,8%<br />
Verein 17 Recklinghausen 216 142 74 34,3%<br />
Verein 18 Düsseldorf 261 174 87 33,3%<br />
Verein 19 Köln 408 273 135 33,1%<br />
Verein 20 Köln 254 170 84 33,1%<br />
Verein 21 Köln 157 106 51 32,5%<br />
Verein 22 <strong>Bochum</strong>/En 232 157 75 32,3%<br />
Verein 23 Duisburg 265 180 85 32,1%<br />
Verein 24 Köln 138 94 44 31,9%<br />
Verein 25 Krefeld 375 256 119 31,7%<br />
Verein 26 Recklinghausen 331 272 104 31,4%<br />
Verein 27 Köln 333 230 103 30,9%<br />
Verein 28 Gütersloh 224 155 69 30,8%<br />
Verein 29 Aachen 238 165 73 30,7%<br />
Verein 30 Bonn 212 147 65 30,7%<br />
Verein 31 Kreveld 258 179 79 30,6%<br />
Verein 32 Aachen 262 183 79 30,2%<br />
Verein 33 Wuppertal 230 161 69 30,0%<br />
Verein 34 Herford 306 218 88 28,8%<br />
Verein 35 Paderborn 211 151 60 28,4%<br />
Verein 36 Düsseldorf 190 136 54 28,4%<br />
Verein 37 Wuppertal 226 163 63 27,9%<br />
Verein 38 <strong>Bochum</strong>/En 201 146 55 27,4%<br />
Verein 39 Düsseldorf 271 197 74 27,3%<br />
Verein 40 Steinfurt 168 123 45 26,8%<br />
Verein 41 Bonn 316 234 83 26,3%<br />
Verein 42* <strong>Bochum</strong>/En 325 240 85 26,2%<br />
Verein 43 Unna/Hamm 216 160 56 25,9%<br />
Verein 44 Siegerland 247 186 61 24,7%<br />
Verein 45 Köln 155 117 38 24,5%<br />
Verein 46 Bielefeld 225 170 55 24,4%<br />
Verein 47 Essen 314 239 75 23,9%<br />
Verein 48 Bonn 563 429 134 23,8%<br />
Verein 49 Recklinghausen 237 184 53 22,4%<br />
Verein 50 Köln 364 283 81 22,3%<br />
Verein 51 Düsseldorf 228 180 48 21,1%<br />
Verein 52 Bonn 486 384 102 21,0%<br />
Verein 53 Steinfurt 315 255 60 19,0%<br />
* 436 Mitglieder, 28,2% wegen Kooperation<br />
63
Die Anzahl der aktiv gemeldeten Mitglieder wird zum Teil nicht exakt der<br />
tatsächlichen Anzahl an aktiven Judoka im Verein entsprechen, sondern etwas<br />
geringer sein. So kann es sein, dass Vereine aus Kostengründen Mitglieder als<br />
passiv melden, wenn diese 6 Jahre und jünger sind, da diese Personen noch nicht<br />
an Wettkämpfen, Gürtelprüfungen und Lehrgängen teilnehmen<br />
6.1.2 Mitgliederstruktur der ausgewählten Vereine<br />
Im Folgenden wird dargestellt, was für eine Mitgliederstruktur die ausgewählten 26<br />
Vereine im Bereich Judo aufweisen. Hierzu werden zwei Tabellen abgebildet,<br />
wobei die eine die Mitgliederstruktur der minderjährigen Mitglieder anzeigt und die<br />
andere die der volljährigen.<br />
Tab. 6.2: Minderjährige Mitglieder (eigene Darstellung)<br />
Verein Judoka 0-6 Judoka 7-14 Judoka 15-18 Gesamt Anteil Minderjähriger<br />
männl.weibl. männl. weibl. männl.weibl. Mind.* gesamt weibl.<br />
Verein 1 0 1 43 46 20 10 120 58,5% 47,5%<br />
Verein 2 27 20 104 89 11 8 259 92,5% 45,2%<br />
Verein 3 32 19 74 71 18 19 233 90,0% 46,8%<br />
Verein 4 16 12 49 36 11 7 131 83,4% 42,0%<br />
Verein 5 13 5 70 33 6 4 131 63,6% 32,1%<br />
Verein 6 0 0 56 36 7 5 104 78,2% 39,4%<br />
Verein 7 9 2 97 62 21 13 204 73,9% 37,7%<br />
Verein 8 20 11 113 76 25 16 261 88,5% 39,5%<br />
Verein 9* 24 5 70 53 2 4 158 89,8% 39,2%<br />
Verein 10 14 4 54 45 19 8 144 81,4% 39,6%<br />
Verein 11 9 5 72 51 15 6 158 74,5% 39,2%<br />
Verein 12 0 0 94 60 18 16 188 78,7% 40,4%<br />
Verein 13 22 8 55 44 10 12 151 71,6% 42,4%<br />
Verein 41 33 7 145 50 14 6 255 80,7% 24,7%<br />
Verein 42 7 7 128 45 32 12 231 71,1% 27,7%<br />
Verein 43 7 1 70 34 26 11 149 69,0% 30,9%<br />
Verein 44 4 3 71 29 19 13 139 56,3% 32,4%<br />
Verein 45 19 7 48 17 12 2 105 67,7% 24,8%<br />
Verein 46 2 4 93 29 29 5 162 72,0% 23,5%<br />
Verein 47 22 5 103 41 27 12 210 66,9% 27,6%<br />
Verein 48 0 0 355 107 34 17 513 91,1% 24,2%<br />
Verein 49 7 1 105 30 27 12 182 76,8% 23,6%<br />
Verein 50 26 2 184 64 24 8 308 84,6% 24,0%<br />
Verein 51 24 4 92 31 10 0 161 70,6% 21,7%<br />
Verein 52 77 16 232 67 21 5 418 86,0% 21,1%<br />
Verein 53 12 2 162 38 29 15 258 81,9% 21,3%<br />
* Anteil weiblicher Mitglieder: 2007 44,4%, 2006 42,2%, 2005 41,2%, 2004 48,9%<br />
64
Tab. 6.3: Volljährige Mitglieder (eigene Darstellung)<br />
Verein Judoka 19-26 Judoka 27-40 Judoka 41-60 Judoka 61-99 Gesamt Anteil Volljähriger<br />
männl.weibl. männl. weibl. männl.weibl. männl. weibl. Erw.* gesamt weibl.<br />
Verein 1 22 23 13 9 9 9 0 0 85 41,5% 48,2%<br />
Verein 2 2 0 1 1 3 13 0 1 21 7,5% 75,0%<br />
Verein 3 9 4 4 4 3 2 0 0 26 10,0% 38,5%<br />
Verein 4 7 3 4 4 5 3 1 0 27 16,6% 37,0%<br />
Verein 5 4 3 9 11 19 24 4 1 75 36,4% 52,7%<br />
Verein 6 6 1 6 2 6 7 0 1 29 21,8% 39,3%<br />
Verein 7 12 10 16 6 13 12 1 2 72 26,1% 42,9%<br />
Verein 8 15 5 3 3 5 3 0 0 34 11,5% 32,4%<br />
Verein 9* 2 2 3 1 5 3 0 0 16 10,2% 37,5%<br />
Verein 10 9 2 5 5 7 4 1 0 33 18,6% 33,3%<br />
Verein 11 13 8 12 8 6 2 5 0 54 25,5% 33,3%<br />
Verein 12 13 4 8 1 15 9 1 0 51 21,3% 27,5%<br />
Verein 13 9 4 10 6 17 4 10 0 60 28,4% 23,3%<br />
Verein 41 17 6 9 0 15 13 1 0 61 19,3% 31,1%<br />
Verein 42 34 13 18 3 20 5 1 0 94 28,9% 22,3%<br />
Verein 43 16 3 20 7 20 0 1 0 67 31,0% 14,9%<br />
Verein 44 26 6 19 4 40 6 7 0 108 43,7% 14,8%<br />
Verein 45 9 5 11 3 14 4 4 0 50 32,3% 24,0%<br />
Verein 46 22 5 13 5 10 7 1 0 63 28,0% 27,0%<br />
Verein 47 12 5 15 6 44 5 16 1 104 33,1% 16,5%<br />
Verein 48 15 8 12 3 13 4 0 0 55 8,9% 27,3%<br />
Verein 49 23 6 10 1 10 3 2 0 55 23,2% 18,2%<br />
Verein 50 20 6 14 0 14 1 1 0 56 15,4% 12,5%<br />
Verein 51 14 4 19 4 17 5 4 0 67 29,4% 19,4%<br />
Verein 52 10 2 22 4 20 8 0 0 66 14,0% 21,2%<br />
Verein 53 31 5 15 6 0 0 57 18,1% 8,8%<br />
* Anteil weiblicher Mitglieder: 2007 44,4%, 2006 42,2%, 2005 41,2%, 2004 48,9%<br />
Es wird deutlich, dass generell weit mehr Minderjährige als Erwachsene Judo<br />
betreiben. Der niedrigste Anteil an Minderjährigen liegt bei 56,3 %, der höchste bei<br />
92,5 %. Im Durchschnitt sind es 76,8 % Minderjährige im Verein. Dieser<br />
Durchschnittswert ist ähnlich dem aller Vereine im NWJV von 75,3 %. Zwischen<br />
den Vereinen mit einem höheren bzw. einem niedrigeren weiblichen<br />
Mitgliederanteil gibt es keinen signifikanten Unterschied. Die mit Abstand größte<br />
Altersklasse ist die der 7 bis 14 Jährigen.<br />
65
6.2 Prüfung der Thesen<br />
1) In größeren Städten haben <strong>Judoverein</strong>e einen niedrigeren Anteil an<br />
weiblichen Mitgliedern.<br />
Die Daten in der Tab. 6.4 belegen, dass es keinen Zu-<br />
sammenhang zwischen der Größe des Ortes in dem<br />
ein Verein ansässig ist und dem Anteil an weiblichen<br />
Mitgliedern gibt. Damit ist die These dass Mädchen<br />
nicht zum Judo kommen würden, weil sie in der<br />
Großstadt viele andere „mädchen- bzw. frauengerechtere“<br />
Freizeitangebote nutzen könnten widerlegt.<br />
Auffallend ist, dass drei Vereine aus dem Kreis<br />
<strong>Bochum</strong> / Ennepetal stammen, konkret aus <strong>Bochum</strong><br />
und Herne; und sie einen höheren weiblichen<br />
Mitgliederanteil haben sowie zwei Vereine aus Köln.<br />
Dem gegenüber stehen drei Vereine, die aus dem Kreis<br />
Bonn stammen und einen niedrigen weiblichen<br />
Mitgliederanteil aufweisen. Hieraus lässt sich folgern,<br />
dass ein gewisses Image der Sportart Judo in gewissen<br />
Städten vorherrschen könnte, was zu einem<br />
niedrigeren bzw. höheren Mitgliederanteil führt. Dies<br />
kann u. a. an der zum Teil engeren Zusammenarbeit<br />
Tab. 6.4: Ortsgröße (e. D.)<br />
Verein Ortsgröße<br />
Verein 1 < 250.000*<br />
Verein 2 < 250000<br />
Verein 3 < 20.000<br />
Verein 4 < 50.000<br />
Verein 5 > 500.000<br />
Verein 6 < 500.000*<br />
Verein 7 < 20.000<br />
Verein 8 < 50.000<br />
Verein 9 < 500.000*<br />
Verein 10 < 50.000<br />
Verein 11 > 500.000<br />
Verein 12 < 50.000<br />
Verein 13 > 500.000<br />
Verein 41 < 50.000***<br />
Verein 42 < 100.000<br />
Verein 43 < 100.000<br />
Verein 44 < 250.000<br />
Verein 45 < 20.000<br />
Verein 46 < 500.000<br />
Verein 47 > 500.000<br />
Verein 48 < 500.000***<br />
Verein 50 < 50.000<br />
Verein 52 < 500.000***<br />
Verein 53 < 50.000<br />
* Kreis <strong>Bochum</strong> / Ennepetal<br />
** Köln<br />
*** Kreis Bonn<br />
der Nachbarvereine liegen. In <strong>Bochum</strong> waren etwa 38 % der 2008 beim Verband<br />
gemeldeten Mitglieder weiblich, was die Hypothese eines positiveren Images für<br />
Frauenjudo in dieser Stadt bestätigt. Köln weißt sehr viele kleine Vereine auf. 16<br />
von 24 Vereinen in Köln haben weniger als 60 Mitglieder. Sie haben mit ca. 50<br />
Mitgliedern etwa nur die Hälfte an Mitgliedern als der Durchschnitt aller<br />
<strong>Judoverein</strong>e im NWJV (ca. 100 Mitglieder). Nur zwei von diesen 16 Vereinen<br />
weisen einen höheren weiblichen Mitgliederanteil auf. Der Durchschnittswert der 8<br />
weiteren Vereine ist 33,5 %. Hier stellen die beiden größeren ausgewählten<br />
Vereine und ein weiterer Verein nur einen höheren Anteil an weiblichen<br />
Mitgliedern auf. Von dem einen Verein sind die beiden anderen Vereine etwa 5 km<br />
Luftlinie entfernt, was damit auch die Hypothese eines positiveren Images für<br />
Frauenjudo in einem gewissen Ortsteil bestätigt.<br />
66
Dem gegenüber gibt es in Bonn 8 Vereine und der Durchschnitt des weiblichen<br />
Anteils liegt bei 24,16 %. In Bonn scheint ein weniger gutes Image für Frauenjudo<br />
zu bestehen. Trotzdem hat ein Verein aus Bonn mit etwa 100 Mitgliedern deutlich<br />
abweichend vom Durchschnitt einen weiblichen Mitgliederanteil von 45,79 %.<br />
Es scheint Gegenden zu geben, in denen Judo ein besonderes frauenfreundliches<br />
Image hat oder durch besondere Maßnahmen von den Vereinen im Ort / Ortsteil<br />
das Interesse von Mädchen und Frauen zum Judo verstärkt geweckt wird.<br />
2) In Städten, in denen es weniger Sportvereine gibt, ist der Anteil weiblicher<br />
Mitglieder im Judo höher.<br />
Im Vergleich der Vereine mit niedrigerem weiblichen Mitgliederanteil und höherem<br />
Anteil gibt es bis auf zwei Vereine keinen Unterschied betreffend der Anzahl von<br />
Sportvereinen in der Stadt. Diese beiden Vereine sind in kleinen Städten mit<br />
weniger als 20.000 Einwohnern beheimatet und damit gibt es dort aufgrund der<br />
Größe der Stadt weniger Sportvereine. Damit lässt sich jedoch kein Zusammenhang<br />
wie in der Hypothese angegeben begründen. Die oben genannte Hypothese<br />
ist somit zu verwerfen.<br />
3) In Städten, in denen es viele <strong>Judoverein</strong>e gibt, ist der Anteil weiblicher<br />
Mitglieder höher.<br />
Einen höheren weiblichen Mitgliederanteil weisen Vereine auf, die einerseits<br />
keinen weiteren <strong>Judoverein</strong> im Ort haben (5 Vereine) und anderseits Vereine die<br />
viele (> 10) Vereine im Ort haben (4 Vereine). Damit lassen sich von der Anzahl<br />
an <strong>Judoverein</strong>en im Ort keine Rückschlüsse auf den Anteil an weiblichen<br />
Mitgliedern im jeweiligen Verein schließen. Die Hypothese ist damit zu verwerfen.<br />
Zusammenfassung der Hypothesen 1-3<br />
Die Anzahl der Einwohner, die Anzahl aller Sportvereine im Ort und die Anzahl der<br />
<strong>Judoverein</strong>e im Ort stellen keine Abhängigkeit zum Anteil weiblicher Mitglieder im<br />
Verein dar. Um herauszufinden wie groß das konkurrenzartige Freizeitangebot für<br />
Mädchen und Frauen in der Umgebung der entsprechenden <strong>Judoverein</strong>e ist, ist<br />
eine ausführliche, differenzierte Analyse jeder Vereinsumgebung nötig, die im<br />
Rahmen dieser Hausarbeit nicht möglich ist.<br />
67
4) Reine <strong>Judoverein</strong>e haben einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
Judoanbieter, die an den Meisterschaften des NWJV und des DJB teilnehmen<br />
wollen, müssen Judo in einem gemeinnützigen Verein anbieten. Dies ist möglich<br />
in Vereinen, die sich hauptsächlich Judo anbieten, oder die eine eigene<br />
Judoabteilung haben. Judoabteilungen haben aufgrund der Abhängigkeit zum<br />
Gesamtverein nicht die Entscheidungsfreiheiten, die eigenständige <strong>Judoverein</strong>e<br />
haben. Daher könnte es sein, dass reine <strong>Judoverein</strong>e aufgrund größerer<br />
Entscheidungsfreiheit im jeweiligen Vereinshandeln einen höheren weiblichen<br />
Mitgliederanteil haben. Es kann natürlich auch sein, dass die verschiedenen<br />
Sportartenangebot in einem Mehrspartenverein und die Fluktuation zwischen den<br />
Abteilungen eines Großvereins eine Rolle spielen.<br />
Die Auswertung der Daten ergibt, dass es keinen Zusammenhang zwischen der<br />
Art des Vereins und dem Anteil an weiblichen Mitgliedern gibt. Ob es sich um<br />
einen reinen <strong>Judoverein</strong> oder ob es sich um eine Judoabteilung handelt, ist<br />
unabhängig vom Anteil der weiblichen Mitglieder. Zwar sind 12 von den 13<br />
Vereinen mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil eigenständige<br />
<strong>Judoverein</strong>e, wohingegen bei den 11 Vereinen mit niedrigeren weiblichen nur 8<br />
eigenständig sind.<br />
Doch die drei entsprechenden Judoabteilungen<br />
haben eine besondere Stellung im Verein. Eine<br />
ist eine relativ autonome Judoabteilung mit<br />
eigener Judohalle und Bundesligamannschaften.<br />
Beim zweiten Verein handelt es sich<br />
um einen Polizeisportverein, in dem Kampfsport<br />
eine besondere Stellung hat, und der auch eine<br />
eigene Judohalle hat. Der dritte Verein hat<br />
mehrere Angestellte im Bereich Judo.<br />
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem<br />
Anteil weiblicher Mitglieder und ob es sich beim<br />
Verein um einen <strong>Judoverein</strong> handelt oder nicht.<br />
Tab. 6.5: Art des Vereins (e. D.)<br />
Verein<br />
Art des Vereins<br />
Verein 1 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 2 Abteilung<br />
Verein 3 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 4 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 5 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 6 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 7 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 8 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 9 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 10 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 11 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 12 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 13 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Anteil <strong>Judoverein</strong> 12 von 13<br />
Verein 41 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 42 Abteilung**<br />
Verein 43 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 44 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 45 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 46 <strong>Judoverein</strong><br />
Verein 47 Abteilung**<br />
Verein 48 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 50 Abteilung**<br />
Verein 52 <strong>Judoverein</strong>*<br />
Verein 53 <strong>Judoverein</strong><br />
Anteil <strong>Judoverein</strong> 8 von 11<br />
* <strong>Judoverein</strong> mit weiteren Abteilungen<br />
** autonome Abteilung<br />
68
5) Jüngere <strong>Judoverein</strong>e haben einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
Die 13 <strong>Judoverein</strong>e mit einem höheren weiblichen<br />
Mitgliederanteil sind im Schnitt 1979 gegründet<br />
worden. Nimmt man die drei Vereine heraus, die im<br />
21. Jahrhundert zu eigenständigen <strong>Judoverein</strong>en<br />
wurden, vorher aber schon als Judoabteilung<br />
existierten, ergibt sich ein Durchschnittswert von<br />
1972. Damit sind durchschnittlich diese Vereine im<br />
Vergleich zu den Vereinen mit einem niedrigeren<br />
Anteil um 9 Jahren bzw. 6 Jahren jünger. Damit ist<br />
zwar die oben formulierte Hypothese bestätigt, aber<br />
das Gründungsjahr allein kann nicht dafür<br />
verantwortlich sein, dass der Anteil an weiblichen<br />
Mitgliedern höher ist. Einerseits sind die Vereine 5,<br />
10, 12 und 13 schon über 45 Jahre alt und sie<br />
haben einen höheren weiblichen Mitgliederanteil.<br />
Andererseits sind im Vergleich zum Durchschnitt<br />
die Vereine 43 und 46 jüngere Vereine und sie<br />
haben einen niedrigeren Anteil weiblicher<br />
Mitglieder.<br />
Tab. 6.6: Gründungsjahr (e. D.)<br />
Verein Gründungsjahr<br />
Verein 1 2003*<br />
Verein 2 1983<br />
Verein 3 1987<br />
Verein 4 1987<br />
Verein 5 1956<br />
Verein 6 1973<br />
Verein 7 1974<br />
Verein 8 1988<br />
Verein 9 2003*<br />
Verein 10 1958<br />
Verein 11 2006*<br />
Verein 12 1962<br />
Verein 13 1952<br />
Durchschnitt 1979 / 1972**<br />
Verein 41 1985<br />
Verein 42 1966<br />
Verein 43 2007*<br />
Verein 44 1950<br />
Verein 45 1969<br />
Verein 46 1993<br />
Verein 47 1949<br />
Verein 48 1960<br />
Verein 50 1959<br />
Verein 52 1959<br />
Verein 53 1969<br />
Durchschnitt 1970 / 1966**<br />
* eigenständig<br />
** ohne gekennzeichnete Vereine<br />
Das Gründungsjahr könnte einen Einfluss auf den weiblichen Mitgliederanteil<br />
haben, wenn die Gründungsmitglieder den Verein mit ihrem Menschenbild und<br />
ihren besonderen gesellschaftlichen Vorstellungen - was die Partizipation von<br />
Mädchen und Frauen im Judo betrifft - auch bis in die Gegenwart hinein geprägt<br />
haben.<br />
69
6) <strong>Judoverein</strong>e, die kaum noch Mitglieder aufnehmen können, haben einen<br />
geringeren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
Drei von 24 Vereinen könnten laut Befragung nur noch die Mitgliederanzahl im<br />
Bereich der älteren Jugendlichen und Erwachsenen steigern (vgl. Tab. 6.7). Zwei<br />
weitere Vereine können im Bereich der Kinder unter 10 Jahren ihre Kapazitäten<br />
nicht mehr erweitern. Den weiteren 19 Vereinen ist eine Erhöhung der Kapazität<br />
möglich. Bei der Höhe der Kapazitätserweiterung gibt es keinen Zusammenhang<br />
zum Anteil der weiblichen Mitglieder im jeweiligen Verein.<br />
Demnach hätten all jene noch freie Kapazitäten, um Werbung für Mädchen und<br />
Frauen zu machen und mehr Mädchen und Frauen im Judo als Mitglieder zu<br />
gewinnen. Die oben genannte Hypothese ist zu verwerfen.<br />
Tab. 6.7: Vergrößerungspotential (e. D.)<br />
Verein Aussage Erhöhung<br />
Verein 1 hängt vom Alter ab (Jugendliche/Erwachsene) unter 10 %<br />
Verein 2 50 Mitglieder ca. 15 %<br />
Verein 3 200 ca. 75 %<br />
Verein 4 50 ca. 30 %<br />
Verein 5 ja<br />
Verein 6 50 ca. 35 %<br />
Verein 7 50 ca. 20 %<br />
Verein 8 40 ca. 15 %<br />
Verein 9 130 ca. 60 %<br />
Verein 10 100 ca. 55 %<br />
Verein 11 150 ca. 70 %<br />
Verein 12 ja, aber nur noch bei den Erwachsenen unter10 %<br />
Verein 13 100 ca. 50 %<br />
Verein 41 ja, unbegrenzt (Drei-Fach-Halle von Mo-Fr) unbegrenzt<br />
Verein 42 150 ca. 50 %<br />
Verein 43 100 ca. 50 %<br />
Verein 44 60-80 ca. 30 %<br />
Verein 45 40, jedoch keine im Bereich der 5-9 Jährigen ca. 25 %<br />
Verein 46 70 ca. 30 %<br />
Verein 47 ja, aber nur noch bei den Erwachsenen unter 10 %<br />
Verein 48 300 ca. 50 %<br />
Verein 50 200 ca. 55 %<br />
Verein 52 150 ca. 30 %<br />
Verein 53 150, jedoch nur für Personen ab 10 Jahren ca. 45 %<br />
70
7) <strong>Judoverein</strong>e mit einem höheren Anteil weiblicher Mitglieder haben eine<br />
geringere Fluktuation ihrer weiblichen Mitglieder im Verhältnis zu Vereinen<br />
mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil.<br />
Für diese Hypothese liegen nicht<br />
genügend Daten vor, um sie zu<br />
beantworten. Die Fluktuation der<br />
weiblichen Mitglieder der Vereine 9,<br />
47, 48 und 52 ist deutlich höher als die<br />
Fluktuation der männlichen Mitglieder<br />
bzw. sie ist mit 40,5 % sehr hoch.<br />
Eine Fluktuation von 18 % und<br />
weniger weisen die Vereine 1, 2, 6, 7<br />
und 8 auf, die alle einen höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil haben.<br />
Aufgrund der Fluktuation der anderen<br />
Vereine und vieler fehlender Angaben,<br />
lässt sich aber kein Zusammenhang<br />
zwischen der Höhe der Fluktuation<br />
und der Höhe des weiblichen<br />
Mitgliederanteils feststellen.<br />
In den Vereinen 1, 2, 6, 7 und 8<br />
scheinen sich die meisten Mitglieder<br />
wohl zu fühlen, denn nur wenige<br />
Verein männlich weiblich gesamt<br />
Verein 1 13,1% 16,3% 14,6%<br />
Verein 2 k.A. k.A. 18,0%<br />
Verein 3 k.A. k.A. 19,0%<br />
Verein 4 41,9% 34,4% 38,9%*<br />
Verein 5 k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 6 k.A. k.A. 18,0%<br />
Verein 7 13,0% 15,9% 14,1%<br />
Verein 8 k.A. k.A. 13,6%<br />
Verein 9 24,5%** 40,6%*** 30,0****<br />
Verein 10 22,9% 23,5% 23,2%<br />
Verein 11 k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 12 k.A. k.A. 25,0%<br />
Verein 13 k.A. k.A. 43,0%<br />
Verein 41 k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 42 k.A. k.A. 25,0%<br />
Verein 43 k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 44 k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 45 k.A. k.A. 25,0%<br />
Verein 46 k.A. k.A. 50,0%<br />
Verein 47 16,0% 26,1% 18,2%<br />
Verein 48 42,7% 40,5% 42,2%<br />
Verein 50 k.A. k.A. 28,0%<br />
Verein 52 29,2% 39,2% 31,4%<br />
Verein 53 25,5% 23,3% 25,1%<br />
* Hallenwechsel<br />
** 19,9% 1.Halbjahr, 29,1% 2.Halbjahr 2008<br />
*** 36,1% 1.Halbjahr, 46,1% 2.Halbjahr 2008<br />
**** näheres in seperater Darstellung<br />
kursiv = geschätzt, k.A. = keine Angaben<br />
Mitglieder verlassen den jeweiligen Verein. In diesen Vereinen sind zwischen<br />
38 % und 48 % weibliche Mitglieder, also mehr als 7 % Mädchen und Frauen im<br />
Vergleich zum Durchschnitt in NRW.<br />
Tab. 6.8: Fluktuation (e. D.)<br />
Zu Verein 9 liegen mehr Daten vor, die nachfolgend dargestellt werden.<br />
71
Exkurs: Mitgliederentwicklung im Verein 9:<br />
Verein 9 ist ein junger, dynamischer <strong>Judoverein</strong>. In weniger als drei Jahren haben<br />
sich die Mitgliedszahlen verdoppelt. In diesem Zeitraum stieg die Anzahl der<br />
weiblichen Mitglieder um 33,8 % und die Anzahl der männlichen Mitglieder stieg<br />
um 61,9 %. Dieser ungleiche Mitgliederzuwachs führte dazu, dass der Anteil der<br />
weiblichen Mitglieder deutlich von 42,2 % auf 29,5 % zurückging. 2008 gab es<br />
sogar einen Rückgang der Anzahl weiblicher Mitglieder um 4,6 %. Folgende Daten<br />
verdeutlichen ergänzend diesen Rückgang. Von den 24 weiblichen Mitgliedern,<br />
die 2007 in den Verein eingetreten sind, sind Anfang 2009 nur noch 9 Mitglieder<br />
übrig. Dies sind 37,5 %, was deutlich geringer ist als bei den männlichen<br />
Mitgliedern (73,1 %). Damit blieben 63,6 % der weiblichen Mitglieder, die 2007<br />
eingetreten sind, weniger als ein Jahr im Verein (männliche Mitglieder 33,33 %),<br />
was 2008 zu einer Fluktuation von 40,6 % führte (2.Halbjahr 2008 sogar 45,1 %).<br />
Damit ist die Fluktuation 2008 bei den weiblichen Mitgliedern (40,6 %) um 16,1 %<br />
höher als bei den männlichen Mitgliedern. Diese hohe Fluktuationsdifferenz gab<br />
es bis auf das Ausnahmejahr 2005 (siehe Tabelle) auch im Jahr 2006. Hier gab es<br />
eine deutlich höhere Fluktuation bei den männlichen Mitgliedern – 37,1 % bei den<br />
männlichen (2.Halbjahr sogar 48,4 %) und 21,1 % bei den weiblichen Mitgliedern.<br />
Tab. 6.9: Fluktuation im Verein 9 (e. D.)<br />
Jahr 2008 2007<br />
weiblicher Anteil (in %) 39,1 (Anfang) 29,6 (Ende) 33,8 44,4 (Anfang) 39,1 (Ende) 41,2<br />
männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt<br />
NWJV Stärkemeldung<br />
Anfang des Jahres 106 68 174 65 52 117<br />
Ende des Jahres 155 65 220 106 68 174<br />
Wachstum 31,6% -4,6% 20,9% 38,7% 23,5% 32,8%<br />
Eintritte 79 27 106 52 24 76<br />
davon 2009 noch da 75 25 100 38 9 47<br />
Anteil noch da 94,9% 92,6% 94,3% 73,1% 37,5% 61,8%<br />
1. Quartal 27,9% 29,6% 28,3% 11,5% 20,8% 14,5%<br />
2. Quartal 24,1% 33,3% 26,4% 23,1% 33,3% 26,3%<br />
3. Quartal 13,9% 7,4% 12,3% 15,4% 29,2% 19,7%<br />
4. Quartal 34,2% 29,6% 33,0% 50,0% 16,7% 39,5%<br />
Austritte 32 27 59 15 11 26<br />
Verweildauer<br />
< 1 Jahr 31,3% 18,5% 25,4% 33,3% 63,6% 30,8%<br />
> 1 und < 2 37,5% 48,2% 42,4% 33,3% 90,9% 23,1%<br />
> 2 Jahre 31,3% 33,3% 32,2% 33,3% 27,3% 46,2%<br />
Fluktuation<br />
1.Halbjahr 19,9% 36,1% 25,4% 23,4% 16,7% 20,6%<br />
2.Halbjahr 29,1% 45,1% 34,5% 11,7% 20,0% 15,1%<br />
Gesamt 24,5% 40,6% 30,0% 17,5% 18,3% 17,9%<br />
72
2006 2005 2004<br />
41,2 (Anfang) 44,4 (Ende) 43,1 41,2 (Anfang) 42,2 (Ende) 41,7<br />
männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt<br />
59 43 102 50 35 85 23 22 45<br />
65 52 117 59 43 102 50 35 85<br />
9,2% 17,3% 12,8% 15,2% 18,6% 16,7% 54,0% 37,1% 47,1%<br />
31 16 47 40 28 68 32 20 52<br />
11 6 17 14 9 23 4 9 13<br />
35,5% 37,5% 36,2% 35,0% 32,1% 33,8% 12,5% 45,0% 25,0%<br />
38,7% 31,3% 36,2% 37,5% 42,9% 39,7% 31,3% 15,0% 25,0%<br />
16,1% 25,0% 19,2% 12,5% 25,0% 17,6% 21,9% 5,0% 15,4%<br />
6,5% 6,3% 6,4% 5,0% 3,6% 4,4% 3,1% 5,0% 3,8%<br />
38,7% 37,5% 38,3% 45,0% 28,6% 38,2% 43,8% 75,0% 55,8%<br />
23 10 33 38* / 43 21* / 27 59* / 70 10 6 16<br />
13,0% 10,0% 12,1% 41,9% 22,2% 34,3% 50,0% 0,0% 25,0%<br />
39,1% 50,0% 42,4% 16,3% 3,7% 11,4% 40,0% 50,0% 43,8%<br />
47,8% 40,0% 45,5% 41,9% 74,1% 54,3% 10,0% 50,0% 31,3%<br />
25,8% 16,8% 21,9% 44,0% 35,9% 40,6% 16,4% 28,1% 21,5%<br />
48,4% 25,3% 38,4% 113,8% 102,6% 109,1% 38,4% 14,0% 27,7%<br />
37,1% 21,1% 30,1% 69,7%* / 78,9% 53,8%* / 69,2 % 63,1%* / 74,9% 27,4% 21,1% 24,6%<br />
* Versuch der Abwahl des Vorsitzenden -> Austritt aller Aikidokas und Ju-Jutsukas, sowie 11 Judokas<br />
Gründe und Thesen für den Rückgang der weiblichen Mitglieder<br />
Im Rahmen einer kleinen Hausarbeit in der Sportsoziologie des Modul 2 Master of<br />
Education an der Ruhr-Universität <strong>Bochum</strong> stellt der Autor dieser Masterarbeit im<br />
Februar 2008 den Verein 9 als Best Pactice Beispiel für einen frauenfreundlichen<br />
<strong>Judoverein</strong> dar. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein 9 noch einen weiblichen<br />
Mitgliederanteil von 39,1 %. Folgende Thesen, die den höheren weiblichen<br />
Mitgliederanteil begründen sollten, stellt der Autor dort dar:<br />
• Jeder und Jede wird so angenommen wie er bzw. sie ist (hohe Adressatenorientierung)<br />
• Wichtigkeit einer hohen Wertschätzung des Anfänger-Seins, was dazu führe,<br />
dass die Judoanfänger weitere Mitglieder werben. Hierbei werben Judoanfängerinnen<br />
besser als Judoanfänger.<br />
• U11-Kreisliga beim Budoka Höntrop für Jungen und Mädchen attraktiv<br />
• hoher Anteil an weiblichen Trainern und Trainerassistenten<br />
• überproportional viele weibliche Trainer und Trainerassistenten beim Training<br />
der 5 bis 9 Jährigen<br />
• paritätische Besetzung in den Führungsgremien<br />
• Werbung speziell für Mädchen und Frauen<br />
Diese genannten Aussagen werden weiterhin im Verein 9 umgesetzt bzw. sie<br />
haben ihre Wichtigkeit beibehalten. Inhaltlich wie strukturell erfolgten keine<br />
nennenswerten Änderungen.<br />
73
Als Thesen für den Rückgang des weiblichen Mitgliederanteils nennt die<br />
Sportliche Leitung des Vereins folgende Gründe:<br />
1. Hoher Einfluss der sportlichen Leitung im Rahmen des Einsatzes als<br />
Trainer<br />
Die sportliche Leitung konnte sich im Besonderen im 2. Halbjahr 2008 nicht<br />
wie üblich einsetzten (Krankheit, Studium). Des Weiteren gab es vor den<br />
Sommerferien eine wichtige Vereinsversammlung, die viel Zeit zur<br />
Vorbereitung benötigte.<br />
Der etwas geringere Einsatz des sportlichen Leiters aufgrund von erhöhten<br />
Beanspruchungen im Rahmen des Studiums könnte auch ein Grund<br />
gewesen sein, dass verhältnismäßig viele männliche Mitglieder im 2.<br />
Halbjahr 2006 den Verein verließen (Fluktuation 48,4 %).<br />
Zuletzt führten auch die besonderen Beanspruchungen einer im Sommer<br />
2005 stattgefundenen außerordentlichen Jahreshauptversammlung zur<br />
Reduzierung des Einsatzes der sportlichen Leitung als Trainer 2005. Das<br />
schlechte Klima im Allgemeinen und der reduzierte Trainereinsatz der<br />
sportlichen Leitung hatte Einfluss auf die Fluktuation (2005 74,9 %).<br />
2. Weniger Feingefühl der neu eingesetzten Trainer<br />
Eine Trainerin und ein Trainer führen nicht mehr das Training zweier<br />
Teilgruppen. Hierfür folgten wiederum auch eine Trainerin und ein Trainer,<br />
die aber aufgrund ihrer etwas provozierenden Art dazu beitrugen, dass<br />
manche Mädchen den Verein verließen.<br />
3. Wichtigkeit der Integration der weiblichen Mitglieder<br />
Weiblichen Mitgliedern sind anscheinend die Einbindung und die<br />
Atmosphäre wichtiger als den männlichen Mitgliedern. Die ausgetretenen<br />
weiblichen Jugendlichen wurden nicht ausreichend genug in die Gruppe<br />
eingebunden. Dem gegenüber gibt es in derselben Gruppe 9 weibliche<br />
Jugendliche die schon seit 2004 Mitglied im Verein sind und sehr gut<br />
integriert scheinen. Diese homogene weibliche Jugendgruppe ließ<br />
anscheinend eine Integration der anderen weiblichen Jugendlichen nicht<br />
ausreichend zu. Hier sind die Trainer gefordert durch spezifische<br />
74
Maßnahmen im und außerhalb des Trainings einzugreifen, um die<br />
Mitglieder zu integrieren. Aufgrund der unter Punkt 1 erwähnten<br />
Trainerengpässe fehlte hierzu qualifiziertes Personal.<br />
Ähnlich scheint, wie schon erwähnt, die problematische Atmosphäre zurzeit<br />
um die außerordentliche Jahreshauptversammlung 2005 herum mit dazu<br />
beigetragen zu haben, dass die Fluktuation bei 74,9 % lag. Diese negative<br />
Atmosphäre wirkte sich auf beiderlei Geschlechter etwa gleich aus.<br />
4. Die Problematik einer geschlechterneutralen Werbung<br />
Die ab Mitte 2007 erfolgte verstärkte Bewerbung des Vereinstrainings führte<br />
zu deutlich mehr männlichen Personen, die in den Verein eingetreten sind.<br />
2007 waren es 24 weibliche und 52 männliche Mitglieder und 2008, als die<br />
Werbung noch weiter erhöht wurde, sogar 27 weibliche und 79 männliche<br />
Neumitglieder. 80 Prozent derer denen die Werbung galt waren zwischen 5<br />
und 8 Jahre alt. Die Eltern der Kinder in diesem Altersbereich scheinen auf<br />
die Art des sportlichen Engagements ihrer Kinder einen deutlichen Einfluss<br />
zu haben. Geschlechterstereotype Vorurteile scheinen viele Eltern zu<br />
prägen, so dass mehr Eltern ihre Jungen zum Judo schicken und weniger<br />
Eltern ihre Mädchen. Dem gegenüber scheint die Mund-zu-Mund-<br />
Propaganda der weiblichen Mitglieder ein sehr wichtiges Mittel zu sein,<br />
durch das weitere Mädchen in den Verein kommen.<br />
Des Weiteren scheint die geschlechtsspezifische Werbung in Kindergärten<br />
unter dem Motto „starke Mädchen braucht das Land“ nicht angemessen<br />
gewesen zu sein, denn es kamen keine weiteren Mädchen. Die<br />
geschlechtsspezifische Werbung sollte eher Themen ansprechen wie<br />
Selbstverteidigung und Stärkung des Selbstvertrauens durch Judo und<br />
damit eher schüchterne Personen ansprechen. Die allgemeine Werbung<br />
durch Werbeflyer und Ausgänge sollte mädchen- und frauenfreundlich<br />
gestaltet sein, d. h. es sollten weibliche Mitglieder abgebildet sein und im<br />
Text darauf aufmerksam gemacht werden, dass Judo durch seine<br />
verschiedenen Attribute (u.a. Wettkampf, Selbstverteidigung) männlich wie<br />
weibliche Personen anspricht. Beim Verteilen von Werbeflyern in<br />
Kindergärten und Grundschulen sollte unbedingt auch die Kindergartenbzw.<br />
die Schulleitung auf Judo für Mädchen hingewiesen werden.<br />
75
5. Ein geringer weiblicher Anteil in Gruppen erschwert das Hinzugewinnen<br />
von weiteren Mädchen<br />
In vier von sechs Gruppen für Kinder im Alter von 5 bis 7 bzw. 7bis 9<br />
Jahren sind weniger als 20 % Mädchen, d. h. hier sind nur ein bis vier<br />
Mädchen angemeldet. Dies scheint eine Quote zu sein, die das<br />
Hinzugewinnen weiterer Mädchen erschwert.<br />
Zusammenfassend scheinen im Verein 9 der geringere zeitliche Trainingseinsatz<br />
der sportlichen Leitung über einen gewissen Zeitraum und die Ausdehnung der<br />
Werbung für den Verein zu Folgeeffekten geführt haben wie Verschlechterung der<br />
Trainingsatmosphäre und vielen männlichen Neuzugängen, so dass der Anteil der<br />
weiblichen Mitglieder von etwa 40 % auf etwa 30 % innerhalb eines Jahres<br />
zurückgegangen ist.<br />
76
8) Die Art der Mitgliedergewinnung (u. a. Werbung und die Art der<br />
Vereinsartikel in Zeitungen) hat einen Einfluss auf den Anteil der weiblichen<br />
Mitglieder.<br />
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung zur Art der Mitgliederwerbung<br />
dargestellt. Wie werden die Menschen auf das Judoangebot der Vereine<br />
aufmerksam?<br />
In den unten aufgeführten Tabellen zur Mitgliederwerbung verdeutlichen die<br />
angegebene Zahlen die Priorität der entsprechenden Werbeart (1 = hoch) bzw. die<br />
Häufigkeit der Art von Presseberichten (1 = größter Anteil).<br />
Tab. 6.10: Art der Mitgliedergewinnung 1 (e. D.)<br />
Verein Mitglieder werben Mitglieder Aushänge Presse- Tag der Aktionen bes. Schul- Judo Home- sonstiges<br />
geschlechterspezifische Werbung Werbe- berichte offenen aufStadt- projekte/ AG page Priorität Beschreibung<br />
Priorität Anteil Alter flyer Tür teilfesten - aktionen<br />
Verein 1 1 k.A. k.A. n.n. 4 n.n. n.n. 2 5 3 n.n.<br />
Verein 2 1 mehr Mädchen 9-11 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. 3 n.n. 4 Schwer mobil<br />
(Übergewichtige)<br />
Verein 3 1 mehr Mädchen 7-10 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1 Ärzte, an den Verein<br />
herantretende<br />
Kindergärten<br />
Verein 4 1 k.A. 5-14 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. n.n. 3 n.n.<br />
Verein 5 1 beide gleich 7-10 3 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 2 n.n.<br />
Verein 6 1 mehr Mädchen k.A. 2 4 n.n. 4 n.n. 4 4 n.n.<br />
Verein 7 1 beide gleich k.A. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 2 3 Judokas aus anderen<br />
Vereinen (ca.10)<br />
Verein 8 2 k.A. 7-14 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 2 2 Aktionen mit dem<br />
Jugendamt<br />
Verein 9* 3 mehr Mädchen 7-10 1 2 n.n. 4 n.n. n.n. 5 n.n.<br />
Verein 10 1 beide gleich 7-14 3 3 n.n. n.n. 3 n.n. n n.n.<br />
Verein 11 1 beide gleich 7-10 3 n.n. n.n. n.n. 2 n.n. 3 n.n.<br />
Verein 12 1 k.a. k.A. n.n. 2 n.n. n.n. n.n. n.n. 3 4 2 Vorführungen,<br />
Karnevalsumzug<br />
Verein 13 1 beide gleich 15-18** 4 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.<br />
Verein 41 1 beide gleich 5-14 1 1 n.n. n.n. nn n.n. n.n. n.n.<br />
Verein 42 1 k.A. k.A. 3 2 3 3 3 3 3 3 vieles<br />
Verein 43 1 beide gleich 7-10 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. n.n. 2 n.n.<br />
Verein 44 2 k.A. k.A. n.n. 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n n.n.<br />
Verein 45 1 beide gleich 5-10 n.n. n.n. n.n. 3 n n.n. 2 n.n.<br />
(bes 6-7)<br />
Verein 46 2 beide gleich 15-18 n.n. n.n. nn n.n. 1 n.n. n.n. 3 Kinderaktionen bei<br />
Heimkämpfen der<br />
Mannschaft<br />
Verein 47 1 beide gleich 10-14 n.n. n.n. 3 n.n. n n.n. 2 n.n.<br />
Verein 48 n.n. k.A. k.A. n.n. n.n. n.n. n.n. 1 n.n. n.n. n.n.<br />
Verein 50 3 beide gleich 5-6 n.n. 2 n.n. 4 1 n.n. 4 n.n.<br />
Verein 52 2 beide gleich 7-10 n.n. 1 n n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.<br />
Verein 53 1 n.n. 2 n n.n. n.n. 3 n.n. n.n.<br />
k.A. = keine Angaben * weiblicher Mitgliederanteil Ende 2008 nur noch 30%, Anfang 2008 aber 40%. ** wegen Prämien für die Mitgliederwerbung<br />
Elf von zwölf Vereinen mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil geben an,<br />
dass die meisten Personen durch Mitglieder des Vereins geworben werden. Dem<br />
gegenüber geben nur sechs von elf Vereinen mit einem niedrigeren weiblichen<br />
Mitgliederanteil dies an. Vier Vereinsvertretern aus Vereinen mit einem höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil fiel auf, dass Mädchen häufiger Freundinnen mit in den<br />
Verein bringen. Verein 9 stellte nach der Analyse des deutlichen Rückgangs des<br />
Anteils weiblicher Mitglieder im eigenen Verein fest, dass je mehr Werbung der<br />
Verein macht (ausgenommen „Mitglieder werben Mitglieder“) desto geringer wird<br />
der Anteil der weiblichen Mitglieder im Verein. Durch die Werbung stieg deutlich<br />
77
die Anzahl der männlichen Mitglieder und die Anzahl der weiblichen Mitglieder<br />
stagnierte. Somit scheint das Werben neuer Mitglieder durch die eigenen<br />
weiblichen Mitglieder einen sehr wichtigen Einfluss auf den Anteil der weiblichen<br />
Mitglieder im Verein zu haben.<br />
Die Auswertung der Angaben der Befragten zur Gruppengröße ergibt, dass<br />
Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil im Durchschnitt etwas<br />
größere Gruppen haben (26 zu 21 Gruppenteilnehmern). Die größere Gruppengröße<br />
führt dazu, dass mehr Mädchen in der Gruppe sind. Damit haben Mädchen,<br />
soweit sie noch nicht oder nur ungern mit Jungen trainieren, mehr potentielle<br />
Partnerinnen. Bei der Wahl des richtigen Trainingspartners kann das Geschlecht<br />
des potentiellen Partners eine Rolle spielen, aber auch die jeweilige körperliche<br />
Statur (Körpergröße, Gewicht) und das Trainingsinteresse. Damit sind größere<br />
Gruppen für einen höheren weiblichen Mitgliederanteil von Vorteil, weil dadurch<br />
eher ein weibliches Mitglied eine passende Partnerin findet. Dem gegenüber führt<br />
eine zu kleine Gruppengröße dazu, dass ein weibliches Mitglied keine passende<br />
Partnerin für ihr Training findet und damit die Freude am Sport verliert. Stehen<br />
passende Partnerinnen zur Verfügung können sich die weiblichen Mitglieder<br />
besser entfalten, was dann auch dazu führt dass die weiblichen Mitglieder weitere<br />
Freundinnen mitbringen.<br />
Um das Bewerben potentielle Mitglieder durch die eigenen Mitglieder als Verein<br />
noch weiter zu verstärken, ist zu empfehlen, dass weitere Anreize für die<br />
weiblichen Mitglieder geschaffen werden, um noch mehr Freundinnen<br />
mitzubringen. Dies könnte durch eine Werbeprämie geschehen, wie z. B. einem<br />
Vereins-T-Shirt für das werbende und für das geworbene neue Mitglied. Dies<br />
müsste so bekannt gemacht werden, dass auch die Eltern des jungen Mitglieds<br />
sich an der Werbung beteiligen. Damit greift dies verstärkt auch in dem Bereich<br />
der 5 bis 10 Jährigen, in dem viele Personen mit Judo anfangen (siehe<br />
entgegengesetzt hierzu Verein 13, der dies nicht ausreichend bei den Eltern der<br />
Kinder bekanntmachte und daher eher die 15 bis 18 Jährigen sich durch die<br />
Werbeprämie ansprechen ließen).<br />
14 Vereine gaben an, dass auch über die Homepage Menschen in den Verein<br />
finden. Diesen Werbeeffekt könnte der Verein nutzen, um das Hinzugewinnen von<br />
weiblichen Mitgliedern zu verstärken, indem viele Bilder von weiblichen Mitgliedern<br />
auf der Homepage veröffentlicht werden.<br />
78
Vierzehn Vereine geben an, dass Presseberichte auf das Werben von Mitgliedern<br />
im Durchschnitt an Wichtigkeit an zweiter Stelle stehe. Auf die Frage, welche<br />
Inhalte von der Presse abgebildet werden, nannten 20 Vereine an erster Stelle<br />
Wettkampfberichte (siehe Tab. 6.11). Als weitere Presseberichtsinhalte nannten<br />
die Vereine vor allem Gürtelprüfungen und Vereinsaktivitäten. Obwohl alle Vereine<br />
sich ausgiebig um das Training von Anfängern kümmern, nennen nur sechs<br />
Vereine das Thema Werbung in der Presse. Ob das Bewerben von Anfängergruppen<br />
durch Zeitungen nicht abgedruckt wird oder ob die Vereine dies kaum bei<br />
der Presse bekanntmachen, wurde nicht erfragt.<br />
79
Tab. 6.11: Art der Mitgliedergewinnung 2 (e. D.)<br />
Verein Pressepräsents Spezielle Anfängergruppen<br />
Wettkampf- Gürtel- Vereins- Werbung Vorstellung bes. sonstiges ja / nein Art der spezillen Anfängergruppen<br />
erfolge prüfungen aktivitäten Mitglieder<br />
Verein 1 1 2 3 n.n. n.n. n.n. ja 1 Bewegunserziehung (5-7), 1 spezielle<br />
Anfängergruppen, Differenzierung im Training<br />
Verein 2 1 2 n.n. n.n. 5w/1m* n.n. ja Kinder unter 8 Jahren<br />
Verein 3 2 1 4 3 n.n. n.n. ja Judo-Spielend-Lernen für 5-7 Jährige in<br />
Gruppen bis zu 10 Kindern<br />
Verein 4 1 2 n.n. 3 n.n. n.n. ja Eltern-Kind, Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche ab<br />
13 Jahren<br />
Verein 5 n.n n.n. 1 n.n. n.n. n.n. ja 2 mal U11- Anfänger, 1 mal Anfängertraining für<br />
Ewachsenen<br />
Verein 6 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. ja Schul AG, zwei mal pro Woche für 4-6 Jährige<br />
Verein 7 1 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. ja freitags 2 Gruppen (ab 6 bzw. 9 Jahre),<br />
montags parallel ab 11 Jahre<br />
Verein 8 2 1 n.n. n.n. n.n. 3** ja 2 mal für 4-6 Jährige<br />
Verein 9 2 6 1 3 4 5*** ja 7 mal jeweils für 5-7 bzw. 8-10 Jährige<br />
Verein 10 1 3 2 n.n. n.n. n.n. ja für 4-6 Jährige und Kinder ab 6 Jahren<br />
Verein 11 1 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. ja 3 mal pro Jahr ein sechswöchiger Kurs<br />
Verein 12 1 2 n.n. n.n. n.n. n.n. ja 3 Anfängergruppen für 6-12Jährige<br />
Verein 13 1 2 3 n.n. 3 n.n. ja im laufenden Trainingsbetrieb durch<br />
Untergruppen<br />
Verein 41 1 n.n. 1 n.n. n.n. n.n. ja 4-6 Jährige (3), 7-9 Jährige (1), 10-12 Jährige<br />
Verein 42 1 2 n.n. n.n. n.n. n.n. ja 4-6 Jährige (1) und parallel zum<br />
Breitensporttraining<br />
Verein 43 1 2 n.n. n.n. n.n. n.n. ja 3 Trainingszeiten für Anfänger im Kindesalter<br />
Verein 44 1 2 3 (Lehrgänge) n.n. n.n. n.n. ja parallel zum regulären Training durch eienen<br />
Sozialpädagogen<br />
Verein 45 1 3 2 n.n. n.n. n.n. ja eine Gruppe Judo spielend lernen (5-7 Jährige)<br />
Verein 46 1 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. ja Schulaktion 1.Klasse (2), Judo und Spielen (4),<br />
Judo für Quereinsteiger für Erwachsene (1)<br />
Verein 47 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. ja 2 Gruppen für 5-7 Jährige, in den anderen<br />
Gruppen durch Assistenzstrainer<br />
Verein 48***** 1 n.n. n.n. 2 n.n. n.n. ja 13 Gruppen für 4-6 Jährige ohne Judoanzug<br />
((Ringen, Raufen - Grundlagenmotorik)<br />
Verein 50 1 n.n. 2 n.n. n.n. n.n. ja eine Gruppe für 5-6 Jährige<br />
Verein 52 1 n.n. n.n. 2 n.n. n.n. ja zahlreiche Anfängergruppen für Kinder ab 4, ab<br />
6, ab 8. ab 10 Jahren<br />
Verein 53 1 3 2 4 n.n. n.n. ja 5 Anfängergruppen für 5-10 Jährige, 1<br />
Anfängergruppe für 9-12-Jährige<br />
* Kadereinladungen von 5 weiblcihen und einem männlichen Judoka<br />
** Selbstsicherheitstraining für Mädchen und Frauen, Gewaltprävention<br />
*** Vereinsportraits **** Zeitabschnitte ***** aktive Mitglieder + 120 passive Mitglieder (unter 6 Jahren)<br />
Zusammengefasst sind die Vereine zum größten Teil mit Wettkampfberichten in<br />
der Zeitung vertreten. 15 Vereine haben eigene Judomannschaften. Bei diesen<br />
Vereinen nimmt somit die Berichterstattung über die Ligakämpfe einen hohen<br />
Anteil der Presseberichte ein. Unter geschlechtsspezifischer Betrachtung der<br />
Vereine mit Judomannschaften fällt folgendes auf: 5 von 6 Vereinen mit einem<br />
höheren weiblichen Mitgliederanteil haben weibliche Judomannschaften. Dem<br />
gegenüber haben nur vier von neun Vereinen mit einem niedrigeren weiblichen<br />
Mitgliederanteil weibliche Judomannschaften. Dies lässt sich einerseits durch den<br />
niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil begründen. Andererseits ist anzunehmen,<br />
dass die Presseberichterstattung über die Männermannschaften auch dazu<br />
beiträgt, dass potentielle Mitglieder eher männlich sind. Die Berichterstattung über<br />
die weiblichen Mannschaften könnte auf der anderen Seite dazu beitragen, dass<br />
die Anzahl der potentiellen weiblichen Mitglieder steigt. Vier der fünf <strong>Judoverein</strong>e<br />
80
mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil und mit Judomannschaften haben<br />
weibliche Mannschaften in höheren Ligen.<br />
Des Weiteren gab keiner der befragten Vereine an, dass die Artikel nicht<br />
geschlechterneutral seien (Verein 41 gab sogar eine eher weiblich dominierte<br />
Berichterstattung an) (siehe Tab. 6.12). Damit ist zu vermuten, dass die Berichte<br />
über weiblicher Mitglieder den gleichen oder sogar größeren Raum in den<br />
Zeitungen einnehmen und in Folge dessen von den Betrachtern wahrgenommen<br />
werden und bei diesen der Zusammenhang von Judo, weiblichem Geschlecht und<br />
dem betreffenden <strong>Judoverein</strong> entsteht, was damit auch zur Werbung für<br />
potentielle weibliche Mitglieder beitragen könnte. Dieser Effekt könnte auch bei<br />
den vier Vereinen mit Frauenmannschaften und niedrigerem weiblichen Mitgliederanteil<br />
entstehen, aber dieser Effekt wird wahrscheinlich durch die<br />
Berichterstattung der Männermannschaften überlagert, dadurch dass drei von vier<br />
Frauenmannschaften jeweils mehr Männermannschaften im eigenen Verein<br />
gegenüberstehen.<br />
Tab. 6.12: Art der Mitgliedergewinnung 3 (e. D.)<br />
Zeitungsartikel spezielle Mädchen-/Frauenwerbung Programme/ Projekte/ Aktionen zur<br />
Geschlechterneutral Mädchen- und Frauen förderung Frauen-Mannschaften Männermannschaften Gruppen-<br />
Verein ja / nein ja/nein im Konkreten ja/nein im Konkreten Art und Anzahl Anzahl und Art größe<br />
Verein 1 ja ja Homepage ja Wettkampfmannschaften Landesliga, Regionalliga Landesliga, Bezirksliga 20-40<br />
Verein 2 ja ja Weltfrauentag, Vorführungen nein 0 0 26-30<br />
Verein 3 ja nein nein Landesliga Bezirksliga 16-30<br />
Verein 4 ja ja Selbstverteidigung nein Landesliga Bezirksliga k.A.<br />
Verein 5 ja ja Selbstverteidigung ja Frauen-SV-Kurse 0 0 k.A.<br />
Verein 6 ja ja Weltfrauentag nein Landesliga Landesliga 30-40<br />
Verein 7 ja nein SV-Einheiten partiell im Training nein 0 0 21-25<br />
Verein 8 ja ja Selbstsicherheitskurse nein 0 0 max. 20<br />
Verein 9 ja ja Vereinsportrait ja Essen gehen, Amazonenturnier 0 0 15-45<br />
Verein 10 ja nein ja 2 SV-Kurse pro Jahr 0 0 16-40<br />
Verein 11 ja nein ja SV-Kurse Regionalliga Oberliga 16-20<br />
Verein 12 ja ja Schaukasten nein 0 0 26-30<br />
Verein 13 ja ja Tai-Ju-Bo (Airobik) nein 0 Landesliga k.A.<br />
Verein 41 nein (eher weiblich)** nein ja SV-Kurse 0 Oberliga, Landesliga 11-25<br />
Verein 42 ja nein nein 1.Bundesliga, Oberliga 1.Bundesl., Regional., 10-30<br />
Oberl.<br />
Verein 43 ja nein nein 0 0 11-30<br />
Verein 44 ja nein nein Oberliga Regional., Landesl., 16-20<br />
Bezirksl.<br />
Verein 45 ja nein nein 0 Bezirksliga 16-20<br />
Verein 46 ja nein nein Regionalliga Frauen Landesliga 16-25<br />
Verein 47 ja nein nein 0 0 26-30<br />
Verein 48 ja nein nein 0 Regionalliga 1-25<br />
Verein 50 ja nein nein Landesliga Landesliga, Bezirksliga 31-35<br />
Verein 52 k.A. ja 2 Judogruppe (6-9, 8-12 Jahre) nein 0 Oberliga, Landesliga 16-20<br />
Verein 53 ja ja 2 Judogruppen (6-9, 8-13 Jahre) nein 0 Oberliga, Landesliga 21-25<br />
* 1.Bundesliga Männer ist oft und groß in der Zeitung ** zwei Pressewartinnen<br />
Abschließend scheint sich das Vorhandensein eigener Frauenmannschaften im<br />
Judo positiv auf den Anteil der weiblichen Mitglieder auszuwirken. Daher ist zu<br />
empfehlen sich als <strong>Judoverein</strong> neben der Bildung einer Männermannschaft auch<br />
für die Bildung einer Frauenmannschaft einzusetzen. Auch wenn der Aufwand<br />
wahrscheinlich höher sein wird, da nicht so viele weibliche Kämpferinnen zur<br />
81
Verfügung stehen und daher auch andere Vereine betreffend der Bildung einer<br />
Frauenmannschaft angesprochen und mit ihnen kooperiert werden muss, scheint<br />
dies lohnenswert, da dadurch im Endeffekt mehr Mädchen in den Verein kommen<br />
und bleiben. Verein 1 beschreibt, dass er seine Frauenlandesliga zur Bindung<br />
seiner weiblichen Judokas nutzt. Hier sei nicht das Siegen der Mannschaft,<br />
sondern die Bindung und Einbindung von weiblichen Jugendlichen das Ziel. Als<br />
einziger Verein bezeichnet er seine Frauenmannschaften als Programm zur<br />
Mädchen und Frauenförderung. Verein 1 stellt mit nur 205 aktiven Mitgliedern vier<br />
Mannschaften, davon zwei Herren und zwei Damenmannschaften. Des Weiteren<br />
ist Verein 1 auch bei den Kindern und Jugendlichen bemüht Mannschaften zu<br />
bilden. Für die Bildung der Kinder-, Jugend- und Seniorenmannschaften werden<br />
Kooperationen mit anderen Vereinen und Wettkämpfern eingegangen sowie<br />
Kontakte zu den Vereinen aus der Umgebung gepflegt. Zwei Damenmannschaften<br />
stellt sonst nur noch Verein 42. Dort herrscht eine andere Perspektive für die<br />
beiden Frauenmannschaften als bei Verein 1. Als Stützpunktverein mit je einer<br />
weiblichen und einer männlichen Mannschaft in der 1. Bundesliga steht<br />
Wettkampfleistung an oberster Stelle. Die zweite Damenmannschaft wurde 2006<br />
gegründet, erreichte 2007 den dritten Platz und stieg 2008 als Landesmeister in<br />
die Oberliga auf. Auf Verein 42 wird bei der Hypothese 11 genauer eingegangen.<br />
Zuletzt ist auf die besondere Werbung für Mädchen und Frauen sowie besondere<br />
Programme, Projekte und Aktionen zur Mädchen- und Frauenförderung der<br />
befragten Vereine hinzuweisen. In der obigen Darstellung (siehe Abb. 6.12)<br />
werden die beiden Themen besondere Werbung, besondere Aktionen nicht<br />
getrennt dargestellt. Elf Vereine mit einem höheren und nur zwei Vereine mit<br />
einem niedrigeren weiblichen Frauenanteil machen bzw. machten besondere<br />
Werbung oder besondere Aktionen für Mädchen und Frauen. Zuerst zu den elf<br />
Vereinen, die einen höheren weiblichen Mitgliederanteil haben:<br />
Zwei Vereine bieten Werbung über die Homepage bzw. einen Schaukasten an<br />
und werben dort für Judo als für Mädchen und Frauen geeignete Sportart.<br />
Drei Vereine bewerben die Sportart Judo im Rahmen des Weltfrauentags, durch<br />
öffentliche Vorführungen und durch Vereinsportraits in der Presse.<br />
Weitere sieben Vereine bieten bzw. haben zusätzliche Selbstverteidigungskurse<br />
(Selbstsicherheitskurse, Tai-Ju-Bo-Aerobic) für Frauen angeboten bzw. betreiben<br />
82
partiell im Judotraining judobezogene Selbstverteidigungseinheiten und Bewerben<br />
diese in der Presse als Aktionen für Frauen.<br />
Die Vereine 2 (eine Gruppe für Frauen und weibliche Jugend), 4 (gesondertes<br />
Ligatraining für die Frauenmannschaft), 8 (Selbstsicherheitskurse), 10 (zwei<br />
Selbstverteidigungskurse im Jahr), 52 (zwei Mädchengruppen für 6 - 9 Jährige<br />
und 8 - 12 Jährige) und 53 (Mädchengruppe für 8 - 13 Jährige) bieten<br />
regelmäßiges Training speziell für Mädchen bzw. Frauen an. Es ist zu vermuten,<br />
dass durch das Bewerben solcher Angebote der Verein und die Sportart Judo von<br />
der Öffentlichkeit vor Ort verstärkt als ein Freizeitangebot für Mädchen und Frauen<br />
wahrgenommen wird.<br />
Die Vereine 52 und 53 bieten als Verein mit einem weiblichen Mitgliederanteil von<br />
ca. 20 % jeweils zwei Kindergruppen an (6 - 8 Jährige und 9 - 12 bzw. 9 - 13<br />
Jährige). Dies wird deswegen gemacht, weil andere Gruppen im Verein so wenige<br />
Mädchen haben, dass diesen entsprechende Trainingspartnerinnen fehlen und<br />
diese daher auch über kurz oder lang den Verein verlassen würden, so die<br />
Vereinsvertreter. Dem entgegengesetzt steht im Verein 2, in dem eine Gruppe von<br />
weiblichen Jugendlichen und Erwachsenen einmal pro Woche trainiert. Der<br />
Trainingsraum ist recht klein und da viele weibliche Judokas im Verein sind, wurde<br />
ergänzend diese Trainingseinheit eingerichtet. Anzumerken ist noch, dass Verein<br />
2 sowie die Vereine 52 und 53 die jeweiligen reinen weiblichen Gruppen nicht als<br />
Programme, Aktionen, Projekte zur Frauenförderung verstehen. Warum die<br />
Befragten so antworteten wurde nicht hinterfragt.<br />
Der Verein 41, als Verein mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil, hat<br />
durch zahlreiche Aktionen wie Selbstverteidigungskurse und reine Judo-Mädchengruppen<br />
versucht zusätzliche weibliche Mitglieder an den Verein zu binden. Die<br />
entsprechenden Aktionen funktionierten entweder nicht dauerhaft oder sie kamen<br />
gar nicht zustande. So wurde beispielsweise die Gründung einer Judo-<br />
Mädchengruppe für 8 - 12 Jährige im Jahr 2008 angeboten, aber es gab nicht<br />
ausreichende Teilnehmerinnen. Entweder wollten die Mädchen nicht aus ihrer<br />
Trainingsgruppe heraus oder sie wollten nicht nur mit Mädchen trainieren, weil sie<br />
nicht auf die Zweikämpfe mit den Jungen verzichten wollten. Die Vereinsleitung<br />
folgert, dass bei Mädchen im Ganzen etwas weniger Interesse an Wettkämpfen<br />
besteht, und dadurch weniger Mädchen im Verein sind. Darüber hinaus gäbe es<br />
eine etwas geringere wettkampforientierte Förderung der Mädchen durch das<br />
83
Elternhaus sowie vorherrschenden Geschlechterstereotypen, die das Miteinander<br />
von körperbetontem, hautnahem Kämpfen und Mädchen bzw. Frauen als nicht<br />
passend ansehen. Außerdem sei das Grundinteresse von Mädchen und Frauen<br />
am Sport im Verhältnis zu dem der Jungen und Männer geringer, wodurch<br />
schneller andere Interessen (z. B. im Rahmen der Pubertät) wichtiger als Sport<br />
werden, wodurch dann mit Judo aufgehört wird. Die gesamten Aussagen machen<br />
deutlich, dass ein entsprechendes Image und die öffentliche Wahrnehmung einen<br />
großen Teil dazu beitragen, wie viele Mädchen in den Verein kommen.<br />
Viele der hier gemachten Aussagen, basieren auf den Aussagen der Vereinsvertreter.<br />
Deren Wahrnehmung ist subjektiv, genaue Analysen über die Vereinswerbung,<br />
die Wahrnehmung des Vereins in der Öffentlichkeit und die damit<br />
zusammenhängende Mitgliedergewinnung lagen bei den Vereinen nicht vor. Solch<br />
eine Analyse wäre empfehlenswert, da der Wettbewerb bei Freizeitangeboten für<br />
Kinder und Jugendliche insbesondere durch die geringere Geburtenzahlen<br />
zunehmend ist.<br />
Nachfolgend wird nun versucht inwieweit das Vereinsangebot und die<br />
dazugehörige Vereinsphilosophie dazu beitragen, ob mehr Mädchen und Frauen<br />
im Verein bleiben.<br />
84
9) <strong>Judoverein</strong>e in denen der Judo-Wettkampfsport eine geringe Priorität<br />
unter den Trainings- und Vereinszielen besitzt, haben einen höheren Anteil<br />
weiblicher Mitglieder.<br />
Die Frage nach den wichtigsten Trainings- und Vereinszielen gibt einen ersten<br />
Überblick über die Vereinsphilosophie (siehe Tab. 6.13).<br />
Tab. 6.13: Vereinsphilosophie (e. D.)<br />
Verein Beweg- Wett- Gemein- Gürtel- hohe Judo- Wettkampf<br />
ung kampf schaft prüfung Mitglieder- mann- auf hohem<br />
stärke schaften Niveau sonstiges<br />
Verein 1 2 1 "Die Mitglieder möglichst lange<br />
an den Judosport und den<br />
Verein binden"<br />
Verein 2 2 1 2<br />
Verein 3 3 1 2<br />
Verein 4 1 1<br />
Verein 5 1 1<br />
Verein 6 2 1<br />
Verein 7 2 1 1 "Erziehungsprinzip" -<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
durch Judo<br />
Verein 8 1 1 2<br />
Verein 9 1 1 Persönlichkeitsentwicklung<br />
Judo sowie Ringen und Raufen<br />
Verein 10 1 2 2<br />
Verein 11 3 2 1 2<br />
Verein 12 1 4 3 2 "Judo-Werte-Vermittlung",<br />
"Spass am Sport-Hauptsache<br />
Sport"<br />
Verein 13 1 3 2 3<br />
Verein 41 1 1<br />
Verein 42 2 2 1<br />
Verein 43 1 3 2<br />
Verein 44 1 2 1 1 "Mitglieder halten"<br />
Verein 45 1 3 2<br />
Verein 46 1 1 2<br />
Verein 47 1 2<br />
Verein 48 1 "Judo-Werte im Vordergrund -<br />
Achtung, Respekt, Höfflichkeit,<br />
Fleiß … (101f.)"<br />
Verein 50 2 4 (8)* 1 7 (3)* 3 6 5<br />
Verein 52 1 2 Sundsvall-Konzept (Fun-Judo,<br />
Technik-Judo, Ippon-Judo)<br />
Verein 53 1<br />
* Aussagewert des Befragten, der aus der Sicht seiner Mitglieder antwortet<br />
Zwölf von 13 Vereinen mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil geben<br />
Gemeinschaft eine hohe Priorität unter ihren Vereinszielen. Verein 12 nennt vor<br />
der Gemeinschaft an erster Stelle Bewegung und an zweiter Stelle die Vermittlung<br />
von Judo-Werten. Diese Wertevermittlung zielt im Ganzen betrachtet auch dahin,<br />
dass das Leben des Einzelnen in der Gemeinschaft funktioniert. Im Folgenden<br />
hierzu eine kurze Erklärung:<br />
Dieser Wertekatalog wurde vom Deutschen Judobund (DJB) zusammengestellt<br />
und u. a. für die Ausbildung der 5 bis7 jährigen Kinder sowie in der allgemeinen<br />
85
Judo Ausbildungs- und Prüfungsordnung festgeschrieben. Die Judoausbildung<br />
beinhaltet nicht nur die Beherrschung von Judotechniken und ihre taktische<br />
Anwendung, sondern sie verlangt auch die Persönlichkeitsentwicklung und<br />
Erziehung durch Judo. Als Judo-Werte werden genannt: Respekt, Höflichkeit,<br />
Wertschätzung, Selbstbeherrschung, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Mut,<br />
Bescheidenheit und Ernsthaftigkeit. Des Weiteren wurden vom DJB Plakate<br />
produziert, die die Judo-Werte um den japanischen roten Punkt herum abbilden<br />
und die jeweiligen Werte durch gezeichnete Bilder illustrieren.<br />
Die Befragten aus den Vereinen mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil<br />
nennen verschiedene Eigenschaften als erste Priorität. Die meisten Nennungen<br />
erhält das Wettkämpfen (9 von 11 Vereinen). Dem gegenüber nennen sieben<br />
Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil Wettkampf nicht an<br />
oberster Priorität, sondern an zweiter, dritter und vierter Stelle. Damit bestätigt<br />
diese Befragung die oben genannte Hypothese.<br />
86
10) <strong>Judoverein</strong>e, in denen die weiblichen Mitglieder genauso regelmäßig<br />
bzw. regelmäßiger am Training teilnehmen wie männliche, haben einen<br />
höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
Wettkampfsport verlangt eine regelmäßige Teilnahme am Training und<br />
mehrfaches Training pro Woche. Daher könnte ein Zusammenhang zwischen der<br />
Trainingshäufigkeit und der Art der Wettkampfteilnahme bestehen. Auf der<br />
anderen Seite lässt sich auch die o. g. Hypothese 10 aufstellen. Doch ein<br />
wesentlicher Unterschied zwischen der Häufigkeit der Trainingsteilnahme der<br />
weiblichen bzw. männlichen Mitglieder ist gemäß der nachfolgenden Tabelle nicht<br />
zu sehen.<br />
Tab. 6.14: Trainingsbeteidigung (e. D.)<br />
Verein Minderjährige Erwachsenen<br />
weiblich männlich weiblich männlich<br />
Verein 1 70% 70% 40% 40%<br />
Verein 2 80% 80% 80% 80%<br />
Verein 3 90% 90% 90% 90%<br />
Verein 4 k.A. k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 5 80% 80% 70% 70%<br />
Verein 6 60% 60% 70% 30%<br />
Verein 7 80% 80% 30% 30%<br />
Verein 8 90% 90% 90% 90%<br />
Verein 9 70% 70% 90% 90%<br />
Verein 10 70% 70% 60% 60%<br />
Verein 11 70% 70% 40% 40%<br />
Verein 12 65% 65% 40% 40%<br />
Verein 13 65% 65% 65% 65%<br />
Verein 41 80% 80% 80% 80%<br />
Verein 42 70% 70% 80% 80%<br />
Verein 43 50% 50% 50% 50%<br />
Verein 44 70% 70% 70% 70%<br />
Verein 45 70% 70% 30% 30%<br />
Verein 46 70% 70% 50% 50%<br />
Verein 47 80% 80% 40% 40%<br />
Verein 48 70% 70% 90% 90%<br />
Verein 50 80% 80% 80% 80%<br />
Verein 52 90% 90% 70% 70%<br />
Verein 53 90% 90% 70% 70%<br />
Die Trainingshäufigkeit der Vereine 1 bis 13 und der Vereine 41 bis 53 unterscheidet<br />
sich nicht nennenswert. In Vereinen mit einem höheren weiblichen<br />
Mitgliederanteil und einem niedrigerem weiblichen Mitgliederanteil scheinen nach<br />
dieser Art der Befragung keine signifikanten Unterschiede zu bestehen.<br />
Insgesamt scheint die Angabe der geschlechtsspezifischen Trainingsteilnahme für<br />
die Befragten schwierig zu sein. Vielleicht geht es vielen so wie bei dem Befragten<br />
aus Verein 42 der sagt: „Diese Frage habe ich mir nie gestellt und daher habe ich<br />
auch nie darauf geachtet.“ Wiederum lässt sich auch schlussfolgern, dass<br />
Unterschiede in der Trainingsteilnahme gering sind und daher nicht auffallen.<br />
87
Jedoch ist hier darauf hinzuweisen, dass die Frage im Rahmen des Interviews<br />
(„Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent Ihrer Judokas in Ihrem Verein regelmäßig,<br />
d. h. mindestens einmal pro Woche, Judo betreiben?“) allgemeiner gehalten war.<br />
Um genauere Angaben zur Trainingsteilnahme zu erhalten, hätten folgende<br />
begleitenden Fragen gestellt werden sollen:<br />
• In wie viel Prozent der Trainingsgruppen im Verein werden Anwesenheitslisten<br />
geführt?<br />
• Wie oft und nach welchen Kriterien werden die Listen ausgewertet?<br />
• Wie oft trainieren im Durchschnitt pro Quartal jeweils die Menschen in den<br />
Altersklassen U8, U11, U14, U17, U20, Frauen/ Männer oder in den nach<br />
Alter differenzierten Trainingsgruppen?<br />
• Welche Gruppen (Geschlecht, Wettkampfniveau, Helfer) der jeweiligen Altersklassen<br />
bzw. Trainingsgruppe nehmen öfter am Training teil?<br />
Geschlechterübergreifend gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen<br />
der Häufigkeit der Trainingsteilnahme von Minderjährigen zu Erwachsenen in<br />
Vereinen mit höherem weiblichen Mitgliederanteil und niedrigerem weiblichen<br />
Mitgliederanteil. Die oben genannte Hypothese konnte also nicht bestätigt werden.<br />
88
11) <strong>Judoverein</strong>e in denen weniger Mitglieder an Wettkämpfen teilnehmen,<br />
haben einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder.<br />
Die Befragung der 24 Vereine<br />
ergab, dass die Wettkampfbeteiligung<br />
bei einem Großteil der<br />
Vereine unter 30 % liegt. Dabei<br />
haben <strong>Judoverein</strong>e mit einem<br />
geringeren weiblichen Mitgliederanteil<br />
im Durchschnitt keine<br />
höhere<br />
Wettkampfbeteiligung.<br />
Etwa 40 % der Vereine haben im<br />
Erwachsenenbereich eine geringere<br />
Wettkampfbeteiligung als<br />
bei den Minderjährigen.<br />
Verein 42 und Verein 53 geben<br />
eine Wettkampfbeteiligung von<br />
50 % und mehr an. Hierbei ist<br />
jedoch zu hinterfragen, ob die<br />
Angaben der Befragten sich auf<br />
bestimmte Gruppen reduzieren<br />
und nicht die Gesamtanzahl der<br />
Mitglieder beachtet.<br />
Verein Minderjährige Erwachsenen<br />
weiblich männlich weiblich männlich<br />
Verein 1 30% 30% 50% 50%<br />
Verein 2 40% 30% 5% 5%<br />
Verein 3 20% 20% k.A. k.A.<br />
Verein 4 k.A. k.A. k.A. k.A.<br />
Verein 5 5% 5% 5% 5%<br />
Verein 6 40% 40% 20% 30%<br />
Verein 7 17% 20% 17% 20%<br />
Verein 8 5% 7% 5% 7%<br />
Verein 9 20% 20% 5% 5%<br />
Verein 10 25% 20% 5% 5%<br />
Verein 11 20% 30% k.A. k.A.<br />
Verein 12 20% 20% 10% 10%<br />
Verein 13 30% 30% 20% 20%<br />
Verein 41 20% 20% 20% 20%<br />
Verein 42 50% 50% 70% 70%<br />
Verein 43 15% 15% 5% 5%<br />
Verein 44 25% 20% 15% 15%<br />
Verein 45 15% 15% 15% 30%<br />
Verein 46 20% 20% 20% 20%<br />
Verein 47 30% 30% 10% 10%<br />
Verein 48 22% 22% k.A. k.A.<br />
Verein 50 25% 25% k.A. k.A.<br />
Verein 52 10% 10% 10% 10%<br />
Verein 53 50% 50% 50% 50%<br />
Auch wenn im Ganzen die Richtigkeit der Angaben zu dieser Schätzfrage nicht<br />
gewährleistet ist, weil zur Berechnung viele Gruppen miteinbezogen werden<br />
müssten und auch Anfänger noch nicht an Wettkämpfen teilnehmen dürfen, ist die<br />
oben genannte Hypothese zu verwerfen, da von keinen geschlechtsspezifischen<br />
Unterschieden berichtet wurde und auch der obigen Tabelle kein Unterschied zu<br />
entnehmen ist.<br />
Tab. 6.15: Wettkampfteilnahme (e. D.)<br />
Die Teilnahme an Wettkämpfen ist für einen Verein mit Aufwand verbunden und<br />
mit steigender Liga auch mit höheren Kosten. Damit lässt sich anhand der<br />
jeweiligen Ligazugehörigkeit auch die Wichtigkeit des Wettkampfsports als Teil der<br />
Vereinsphilosophie beschreiben. Erläuternd ist zu sagen, dass im Judo ein<br />
ordentliches Ligasystem nur bei den Erwachsenen vorliegt. Im Jugendbereich gibt<br />
89
es Turniere und Meisterschaften für Mannschaften, aber ein ordentliches Ligasystem<br />
gibt es nicht, da hierzu den Vereinen in den jeweiligen Alterklassen (U14,<br />
U17, U20) eine ausreichende Anzahl an Kämpfern fehlt.<br />
Jugendliche ab 16 Jahren (ab dem letzten Jahrgang der U17) dürfen aber bereits<br />
in den Mannschaften der Erwachsenen teilnehmen<br />
Tab. 6.16: Mannschaften (e. D.)<br />
Frauen-Mannschaften Männermannschaften<br />
Verein Art und Anzahl Anzahl und Art<br />
Verein 1 Landesl. Regional. Landesliga, Bezirksliga<br />
Verein 2 0 0<br />
Verein 3 Landesliga Bezirksliga<br />
Verein 4 Landesliga Bezirksliga<br />
Verein 5 0 0<br />
Verein 6 Landesliga Landesliga<br />
Verein 7 0 0<br />
Verein 8 0 0<br />
Verein 9 0 0<br />
Verein 10 0 0<br />
Verein 11 Regionalliga Oberliga<br />
Verein 12 0 0<br />
Verein 13 0 Landesliga<br />
Verein 41 0 Oberliga, Landesliga<br />
Verein 42 1.Bundesl., Oberl. 1.Bundesl., Regional., Oberl.<br />
Verein 43 0 0<br />
Verein 44 Oberliga Regional., Landesl., Bezirksl.<br />
Verein 45 0 Bezirksliga<br />
Verein 46 Regionalliga Landesliga<br />
Verein 47 0 0<br />
Verein 48 0 Regionalliga<br />
Verein 50 Landesliga Landesliga, Bezirksliga<br />
Verein 52 0 Oberliga, Landesliga<br />
Verein 53 0 Oberliga, Landesliga<br />
Von den befragten Vereinen stellen 15 Vereine mindestens eine Mannschaft,<br />
davon 6 von 13 Vereinen mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil und 9 von<br />
11 Vereinen mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil. Aufgeteilt nach<br />
Ligaklasse ergeben sich folgende Klassenzugehörigkeiten:<br />
Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil stellen nur 13<br />
Mannschaften, davon sieben Mannschaften in der untersten Klasse, drei in der<br />
vorletzten Klasse, eine in der vierthöchsten Klasse und zwei Frauenmannschaften<br />
in der dritthöchsten Klasse.<br />
Vereine mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil stellen hingegen 22<br />
Mannschaften, davon fünf Mannschaften in der untersten Klasse, sieben in der<br />
90
vorletzten Klasse, vier in der vierthöchsten Klasse, vier in der dritthöchsten Klasse<br />
und ein Verein mit einer Frauen- und Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga.<br />
Trotzdem stellen nur vier Vereine fünf Frauenmannschaften von den Vereinen, die<br />
einen niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil haben und dem gegenüber stellen<br />
fünf Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil sechs Mannschaften.<br />
Damit sind dies auf der einen Seite 23 % Frauenmannschaften und auf der<br />
anderen Seite 46 % Frauenmannschaften.<br />
Das unterschiedliche Vorhanden sein von Judomannschaften macht zum einem<br />
deutlich, dass in Vereine mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil mehr<br />
Wert auf den Wettkampfsport gelegt wird und damit für die Vereinsphilosophie von<br />
Bedeutung ist. Zum anderen scheint es so, dass bei den Vereinen mit einem<br />
niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil das Wettkämpfen in Frauenmannschaften<br />
eine geringere Stellung hat als das der Männer. Diese These wird durch die<br />
nachfolgend aufgeführte Tabelle bestärkt. Hieraus wird deutlich, dass trotz eines<br />
geringeren weiblichen Mitgliederanteils potentielle Wettkämpferinnen zur Mannschaftsbildung<br />
zur Verfügung stünden.<br />
Tab. 6.17: Mannschaften 2 (e. D.)<br />
Verein Mitgliederstärke 08 Anteil Frauen-Mannschaften Männermannschaften Judoka 15-18 Judoka 19-26 Judoka 27-40 potentielle Wettkämpfer<br />
aktiv männl. weibl. weibl. Art und Anzahl Anzahl und Art männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. gesamt männl. weibl.<br />
Verein 1 205 107 98 47,8% Landesl. Regional. Landesliga, Bezirksliga 20 10 22 23 13 9 97 55 42<br />
Verein 2 280 148 132 47,1% 0 0 11 8 2 0 1 1 23 14 9<br />
Verein 3 259 140 119 45,9% Landesliga Bezirksliga 18 19 9 4 4 4 58 31 27<br />
Verein 4 157 93 64 40,8% Landesliga Bezirksliga 11 7 7 3 4 4 36 22 14<br />
Verein 5 206 125 81 39,3% 0 0 6 4 4 3 9 11 37 19 18<br />
Verein 6 133 81 52 39,1% Landesliga Landesliga 7 5 6 1 6 2 27 19 8<br />
Verein 7 276 169 107 38,8% 0 0 21 13 12 10 16 6 78 49 29<br />
Verein 8 295 181 114 38,6% 0 0 25 16 15 5 3 3 67 43 24<br />
Verein 9* 176 106 68 38,6% 0 0 2 4 2 2 3 1 14 7 7<br />
Verein 10 177 109 68 38,4% 0 0 19 8 9 2 5 5 48 33 15<br />
Verein 11 212 132 80 37,7% Regionalliga Oberliga 15 6 13 8 12 8 62 40 22<br />
Verein 12 239 149 90 37,7% 0 0 18 16 13 4 8 1 60 39 21<br />
Verein 13 211 133 78 37,0% 0 Landesliga 10 12 9 4 10 6 51 29 22<br />
Verein 41 316 234 83 26,3% 0 Oberliga, Landesliga 14 6 17 6 9 0 52 40 12<br />
Verein 42 325 240 85 26,2% 1.Bundesl. Oberl. 1.Bundesl., Regional., Oberl. 32 12 34 13 18 3 112 84 28<br />
Verein 43 216 160 56 25,9% 0 0 26 11 16 3 20 7 83 62 21<br />
Verein 44 247 186 61 24,7% Oberliga Regional., Landesl., Bezirksl. 19 13 26 6 19 4 87 64 23<br />
Verein 45 155 117 38 24,5% 0 Bezirksliga 12 2 9 5 11 3 42 32 10<br />
Verein 46 225 170 55 24,4% Regionalliga Landesliga 29 5 22 5 13 5 79 64 15<br />
Verein 47 314 239 75 23,9% 0 0 27 12 12 5 15 6 77 54 23<br />
Verein 48 563 429 134 23,8% 0 Regionalliga 34 17 15 8 12 3 89 61 28<br />
Verein 50 364 283 81 22,3% Landesliga Landesliga, Bezirksliga 24 8 20 6 14 0 72 58 14<br />
Verein 52 486 384 102 21,0% 0 Oberliga, Landesliga 21 5 10 2 22 4 64 53 11<br />
Verein 53 315 255 60 19,0% 0 Oberliga, Landesliga 29 15 31 5 15 95 75 20<br />
Um die Stellung des Wettkampfes im Rahmen der Vereinsphilosophie in den<br />
untersuchten Vereinen weiter zu belegen dient die nachfolgende Tabelle über das<br />
Niveau der Einzelwettkämpfe:<br />
91
Tab. 6.18: Wettkampfniveau (e. D.)<br />
Verein Niveau bei Einzelwettkämpfen (Aussage der Befragten)<br />
Verein 1 ganz wenige bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
Verein 2 Deutschland und auch International (U17/U20)<br />
Verein 3 Landesebene (NRW)<br />
Verein 4 ganz wenige bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
Verein 5 Kreis, Bezirk<br />
Verein 6 Landesebene (NRW), bis Westdeutsche Meisterschaften<br />
Verein 7 bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
Verein 8 bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
Verein 9 Landesebene (NRW)<br />
Verein 10 Landesebene (NRW), bis Westdeutsche Meisterschaften<br />
Verein 11 bis zur Deutschen Meisterschaft (auch Deutsche Meisterin)<br />
Verein 12 ganz wenige bis zur Westdeutschen Meisterschaft<br />
Verein 13 k.A.<br />
Verein 41 bis International (u.a. Trainerin, die auf Teilzeittrainerin arbeitet)<br />
Verein 42 National und International<br />
Verein 43 ganz wenige bis zur Westdeutschen Meisterschaft<br />
Verein 44 wenige bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
Verein 45 wenige bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
Verein 46 regelmäßig bei Westdeutschen Meisterschaften, wenige bei Deutschen<br />
Verein 47 Landesebene (NRW)<br />
Verein 48 National und International<br />
Verein 50 regelmäßig bei Westdeutschen Meisterschaften, wenige bei Deutschen<br />
Verein 52 regelmäßig bei Westdeutschen Meisterschaften, wenige bei Deutschen<br />
Verein 53 bis zur Deutschen Meisterschaft<br />
16 Vereine geben an, dass Wettkämpfer aus ihrem Verein die Deutschen Meisterschaften<br />
besucht hätten. Auffallend ist, dass dies nur 6 von 13 Vereinen mit<br />
höherem weiblichen Mitgliederanteil angaben und dem gegenüber 10 von 11<br />
Vereinen. Verein 42 ist der einzige Verein der seine Wettkämpfer für das Kämpfen<br />
in der Mannschaft der 1. Bundesliga bezahlt. Im nachfolgenden Abschnitt wird auf<br />
das Wettkämpfen von Frauen im Verein 42 und die Bezahlung eingegangen.<br />
Exkurs: Das Wettkämpfen von Frauen im Verein 42:<br />
In Verein 42 hat im letzten Jahrzehnt ein Wandel im Umgang mit Frauen<br />
stattgefunden, der vielleicht bezeichnend für viele andere leistungssportausgerichtete<br />
<strong>Judoverein</strong>e ist.<br />
Auf die Frage „Wie hat der Wandel hin zu national und international erfolgreichen<br />
Frauen im Wettkampfjudo stattgefunden?“ gab es folgende Antwort:<br />
"Dies kam nicht von oben, nach dem Motto, wir werden jetzt ein frauenfreundlicher<br />
<strong>Judoverein</strong>. Dieses Lob kann ich uns leider nicht geben. Dies ist von alleine passiert. Also im<br />
U17 Bereich hatten wir auf einmal fünf bis sechs erfolgreiche Mädchen, dann einen<br />
engagierten Trainer (männlich), der diese geputscht und weitere Mädchen aus der<br />
Umgebung dazu geholt hatte. Und wenn man Erfolg mit denen haben kann, was bei uns das<br />
einzig Wahre ist, kümmert man sich auch mehr darum und es werden die Jungen etwas<br />
vernachlässigt. (...) Blumen drehen sich immer zum Licht [Trainerverhalten]. Zu den Frauen:<br />
92
Da waren ein paar Frauen, die haben gesagt sie wollen kämpfen. Sie haben sich<br />
angemeldet in der Landesliga [2001]. Sie sind dann immer weiter aufgestiegen und dadurch<br />
wurden sie langsam akzeptiert.“ (Z. 83f.)<br />
Der Vereinsvertreter macht deutlich, dass die Unterstützung der Mädchen keine<br />
durch den Vorstand geplante Aktion zur Frauenförderung war. Das eigene<br />
Interesse einer kleinen wettkampfbegeisterten Mädchengruppe in der Altersklasse<br />
U17 war der Beginn. Ein engagierter Trainer, der die Fähigkeiten dieser Mädchen<br />
ernst nahm, setzte sich im Anschluss für sie ein. Neben dem besonderen Einsatz<br />
des Trainers beim Training und der Betreuung auf Wettkämpfen, kümmert er sich<br />
auch darum, dass zusätzlich Trainingspartnerinnen aus benachbarten Vereinen<br />
am gemischt geschlechtlichen Vereinstraining teilnehmen. Im Gegensatz zu den<br />
ca. 15 Jahre alten Mädchen benötigten die wettkampfbegeisterten Frauen keine<br />
Unterstützung, um sich an der Landesliga anzumelden. Die Aussage „Blumen<br />
drehen sich immer zum Licht“ macht deutlich, dass die Trainer im Verein durch<br />
Wettkampferfolge ihrer Schützlinge Motivation erhalten und sich für die<br />
entsprechenden Judokas einzusetzen, unabhängig davon welchen Geschlechts<br />
diese Judokas sind. Dies bestätigt auch folgende Aussage des Vereinsvertreters:<br />
„Wenn man eine Klicke hat von drei bis vier guten Judoka egal ob Mädchen oder Jungen,<br />
die sich gegenseitig motivieren und Spass am Training haben, die die Trainer motivieren und<br />
die Trainer haben mehr Spass mit den guten als mit denen die nicht geradeaus gehen<br />
können, dann puscht sich das so gegenseitig. Jetzt ist da im Moment eine Klicke von drei bis<br />
vier um die Europameisterin, die sich gegenseitig motivieren und Spass an Leistung haben.<br />
Diese ziehen dann auch die anderen nach unter dem Motto 'wir können mit der Mannschaft<br />
um die Deutsche Meisterschaft mitkämpfen’. Das steckt an und das wollen die anderen dann<br />
auch.“ (Z. 310)<br />
Diese die Trainer ansteckende Begeisterung ist heute im Gegensatz zu früher<br />
geschlechterunabhängig:<br />
„Früher war es schon ein männlich dominierter Verein und da wurde Frauenjudo immer ein<br />
bisschen verächtlicht angekuckt. Und es gab mehr Typen im <strong>Judoverein</strong>, Mannsbilder, die<br />
sagen Frauenjudo 'Oh mein Gott' - hochnäsig und arrogant gegenüber dem Frauenjudo,<br />
richtige Machos eben. Ein richtiger Machoverein war der Verein früher.“ (Z. 85)<br />
Die aktuelle geschlechterspezifische Vereinssituation ist so der Befragte heute<br />
deutlich besser. Jedoch weiterhin kritisch äußert er sich zur Situation der<br />
Bezahlung der Wettkämpfer und Wettkämpferinnen in der 1. Bundesliga.<br />
„Auch heute ist es noch nicht gleichberechtigt, wenn ich sehe was die Frauen kriegen in der<br />
Bundesliga und was die Männer. Da sind Welten dazwischen. Bei den Frauen ist das eher<br />
Hobby mit einem kleinen Taschengeld an den vier Kampftagen, so dass sie nicht noch<br />
draufzahlen müssen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und bei den Herren gibt es viele die<br />
Geld bekommen. Wenn ich als Kassierer und Frauentrainer im Vorstand sage, wie billig<br />
93
unsere Frauen sind, gibt es auf der anderen Seite Personen, die sagen, unsere Regionalliga<br />
bekommt doch nur das und das. Darauf sage ich, schaut - das ist Regionalliga und das<br />
andere ist 1. Bundesliga, da gibt es nichts höheres. Darauf entgegnen andere, ja ja aber die<br />
sind ja erst 2 Jahre dabei, die müssen sich erstmal beweisen. Dies spricht schon auch<br />
Bände. Die Bundesligasaison der Frauen kostet im Bezug zur Bundesligasaison der Männer<br />
dem Verein etwa ein Achtel. Die Zahlen sind natürlich verfälschend wegen den Unterschieden<br />
in den Kadergrößen und den Wettkampftagen [Der Kadar ist bei den Herren um<br />
50% größer und es gibt 9 anstelle von 4 Kampftagen] (…) Die Frage ist aber, warum hält<br />
sich der Verein so viele Top-Herren und so wenig Top-Frauen. Bei den Frauen könnte man<br />
mit weniger Geld mehr Erfolge holen.“ (Z. 86-88)<br />
Der Befragte schildert kritisch die geschlechterspezifische Art der Bezahlung, und<br />
stellt sich die Frage, warum sich der Verein nicht mehr exzellente Wettkämpferinnen<br />
einkauft, um damit sogar kostengünstiger mehr Wettkampferfolge<br />
mit der Mannschaft zu erreichen. Es scheint eine gewisse Skepsis im Vorstand zu<br />
herrschen, ob diese Einkaufspolitik von den Mitgliedern, den Zuschauern, der<br />
Öffentlichkeit und den Sponsoren akzeptiert werden würde. Ein paar<br />
Verantwortlichen im Verein scheinen die Investition in weibliches Wettkampfjudo<br />
auch heute noch weniger Wert zu sein. Die Zuschauerzahlen seien bei den<br />
Mannschaftskämpfen der Frauen geringer. Aber sind die Zuschauerzahlen<br />
geringer, weil die Frauenmannschaft noch nicht so lange existiert (1. Bundesliga<br />
seit 2007 (Herrenbundesliga 1977), Beginn der Frauenmannschaft 2002) oder weil<br />
die Zuschauer Frauenkämpfe als weniger sehenswert erachten oder weil man die<br />
Frauenkämpfe nicht so inszeniert wie die Männerkämpfe?<br />
Wie sich der Verein mit seiner Frauen-Bundesliga weiterentwickelt und ob sich die<br />
Meinungen über Wettkämpferinnen verbessert, ist zu beobachten. Wie groß wird<br />
sich wohl der Werbeeffekt durch die erfolgreichen Frauen auf den Anteil der<br />
weiblichen Mitglieder im Verein auswirken?<br />
94
12) An die Interessen von Mädchen und Frauen angepasste Sportangebote<br />
und außersportliche Angebote führen zu einem höheren Anteil weiblicher<br />
Mitglieder.<br />
Bei der Prüfung der achten Hypothese wurde bereits berichtet, dass sieben von<br />
dreizehn Vereinen (höherer weiblicher Anteil) ergänzendes Selbstverteidigungstraining<br />
anbieten. Da dies im Trainingsplan aber nur einen sehr geringen Teil<br />
einnimmt, werden im Folgenden die angepassten Sportangebote sowie außersportlichen<br />
Angebote untersucht und der Frage nachgegangen, wie sich die<br />
Angebote bei den unterschiedlichen Vereinensgruppen unterscheiden.<br />
Folgend werden die Sportangebote dargestellt, die sich an bestimmt Zielgruppen<br />
richten.<br />
Tab. 6.19: Besondere Sportangebote (e. D.)<br />
Vereinsangebote Vereine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53<br />
Besondere Angebote für bestimmt Zielgruppen<br />
Judo spielend lernen 2 x x x 2 6 1 x x x x x 13 1 2<br />
Mutter/Vater/Eltern und Kind x x x 1<br />
reine Männer-/ Jungenangebote<br />
reine Frauen-/Mädchenangebote x x 2 1<br />
Erwachsene Quereinsteiger x x x x x x x x x 2<br />
Behinderte x x x<br />
Prävention/ Gesundheitsport x x<br />
Rehabilitation<br />
x<br />
sonstiges (siehe unter der Tabelle - A, B, ...) A B C C<br />
Summe an verschiedenen Angeboten 4 3 3 3 3 0 1 4 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 2 1 1 1 5 1<br />
Besondere Angebote für bestimmt Zielgruppen- sonstiges:<br />
A Bewegungserziehung für 5-7 Jährige<br />
B Familienjudo<br />
C Anlehnung an das Sundsvall-Trainingskonzept<br />
Bei den besonderen Angeboten für bestimmte Zielgruppen fällt auf, dass<br />
tendenziell die Vereine 1 bis 13 mehr Angebote haben. Wenn die Vereine 41 bis<br />
53 bestimmte Zielgruppenangebote haben, dann ist immer (außer Verein 53) ein<br />
Angebot für Kinder (Judo spielend lernen) dabei. Drei dieser Vereine bieten noch<br />
ein Angebot für erwachsene Quereinsteiger. Einzig Verein 52 fällt aus dem<br />
Rahmen. Hier wird in fünf Rubriken etwas angeboten. Weiter unten wird auf<br />
Verein 52 besonders eingegangen. Ein besonderes Angebot nur für Mädchen<br />
bieten in beiden Vereinskategorien jeweils zwei Vereine an. Verein 2 hat ein<br />
einmal in der Woche stattfindendes Training für weibliche Jugendliche und<br />
Erwachsene. Viele dieser Teilnehmerinnen trainieren auch in der weiteren<br />
geschlechtergemischten Gruppe. Verein 8 bietet regelmäßig Selbstsicherheitsx<br />
= mindestens 1<br />
95
kurse für Mädchen und Frauen an. Dem gegenüber bieten die Vereine 52 und 53<br />
jeweils zwei Trainingseinheiten für Kinder bzw. Jugendliche.<br />
Es scheint einen Einfluss auf den weiblichen Mitgliederanteil durch Zielgruppenangebote<br />
zu geben, auch wenn die meisten Angebote nicht geschlechterspezifisch<br />
sind. Vielleicht deutet eine Vielzahl an Angeboten auf eine Vereinsphilosophie<br />
hin, der es wichtig ist, dass man sich um alle Menschen, mit ihren<br />
unterschiedlichsten Eigenschaften kümmert. Des Weiteren hat das Vereinsangebot<br />
mit seinen verschiedenen Angeboten auf die Wahrnehmung des Vereins<br />
in der Öffentlichkeit einen Einfluss, wodurch dann mehr weibliche Personen in<br />
diese Vereine finden.<br />
Die folgende Tab. 6.19 gibt die speziellen, wöchentlichen Angebote an, die neben<br />
dem normalen Judotraining ergänzend stattfinden.<br />
Tab. 6.20: Besondere wöchentliche Sportangebote (e. D.)<br />
spezielle, wöchentliche Angebote Vereine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53<br />
Gürtelprüfungstraining x x 1 x x x x x x<br />
gesondertes Wettkampftraining x x x x x 1 x x x x x x x<br />
Fitnesstraining x x x<br />
Kraftraining x x x x 2 x<br />
Lauftraining x 1 x x<br />
sonstiges (siehe unter der Tabelle - 1, 2, ...) 1 2<br />
Summe an verschiedenen Angeboten 5 1 0 1 0 0 2 2 2 1 2 3 3 3 2 0 0 1 3 0 1 1 3<br />
zeitlich begrenzte Kursangebote n n n n j n n j n j j j j j n n n n n n j n j n<br />
(j = ja, n = nein, siehe unter der Tabelle (Verein …:)<br />
Zeitlich begrenzte Kursangebote:<br />
Verein 5: Selbstverteidigungstraining<br />
Verein 8: Selbstsicherheitstraining, Gewaltprävention<br />
Verein 10: Judo Selbstverteidigungskurse übers Bildungswerk<br />
Verein 11: drei jeweils sechswöchige Judoanfängerkurse<br />
Verein 12: Judokurse in den Sommerferien<br />
Verein 13: Tai-Ju-Bo (10er Karte)<br />
Verein 41: Aerobic, Ju-Jutsu<br />
Verein 52: Judokurs für 6-8 Jährige<br />
x = mindestens 1<br />
Im Vergleich der beiden Vereinsgruppen sind zu den speziellen, wöchentlichen<br />
Angeboten keine Auffälligkeiten hinsichtlich des weiblichen Anteils zu entdecken.<br />
Nach Aussagen der Vereine, die Selbstverteidigungskurse anbieten, gibt es<br />
hierdurch nicht verhältnismäßig mehr weibliche Eintritte als männliche. Einige<br />
Vereine äußern sogar, dass diese Kurse gar nichts bringen würden, um mehr<br />
Mitglieder im Bereich Judo zu erhalten. In den Vereinen 5, 8, 10 und 13 wirkt sich<br />
das Interesse an Selbstverteidigungstraining auch auf das Judotraining aus, da es<br />
gelegentlich unter dem Aspekt der Selbstverteidigung vermittelt wird. Verein 1<br />
bietet keine Selbstverteidigungskurse an, sondern ein Judotraining, mit einem<br />
96
hohen Anteil an judospezifischen Spielen, Übungen und Kämpfen. Außerhalb<br />
dieses Trainings bietet er viele, spezielle wöchentliche stattfindende Sportangebote<br />
an, um das Judotraining weiter zu ergänzen. Es finden Gürtelprüfungstraining,<br />
gesondertes Wettkampftraining, Fitnesstraining, Krafttraining und Lauftraining<br />
statt. Verein 1 hat einen weiblichen Mitgliederanteil von 47,8 %. Dieses<br />
inhaltlich klare und differenzierte Sportangebot scheint einen positiven Einfluss auf<br />
den Anteil weiblicher Mitglieder zu nehmen.<br />
Im Folgenden werden die unregelmäßigen Sportangebote dargestellt.<br />
Tab. 6.21: Zusätzliche, unregelmäßige Sportangebote (e. D.)<br />
zusätzliche, unregelmäßige Sportangebote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53<br />
Gürtelprüfungslehrgänge 9 x 4 4 2 5 1 x 4 x 20<br />
Lehrgänge x 4 x 2 x x 3 2 3 x 6 15 3 1 2 x 3 1<br />
Vereinsmeisterschaft 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x 1<br />
Judosafari 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1<br />
Judosportabzeichen 1 1 x 1 1 x<br />
Laufen, Walken, Volkslauf 3 x x x 1 1<br />
Schwimmen, Klettern 2 x 3 2 2 x 1 2 2 3<br />
Fußballturnier 1 x<br />
Sportfeste 1 x<br />
allgemeines Sportabzeichen 1<br />
sonstiges (siehe unter der Tabelle - I, II, ...) I II III IV<br />
Summe an verschiedenen Angeboten 8 6 6 3 3 3 4 4 6 3 4 4 6 5 3 3 4 1 4 4 1 4 1 5<br />
Sonstige - zusätzliche, unregelmäßige Sportangebote:<br />
I Taishi, Massageabend, Aerobic<br />
x = mindestens 1<br />
II 4 Randori Turniere (Kessler)<br />
III Fitness Test (2)<br />
IV Austausch mit anderen Vereinen, Fahrten zu internationalen Wettkämpfen, Dojo-Lager<br />
Das vielfältigste Angebot bietet der Verein mit dem höchsten Anteil an weiblichen<br />
Mitgliedern. Dies scheint kein Zufall, denn auch über alle Vereine und Angebote<br />
summiert, haben die Vereine mit höheren weiblichen Anteil ein höheres Angebot<br />
(durchschnittlich 4,4 Angebote pro Verein, versus 3,2).<br />
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass sich durch ein diversifiziertes Angebot<br />
mehr Menschen angesprochen bzw. im Verein wohl fühlen. Die weiblichen<br />
Mitglieder scheinen sich von den unterschiedlichen Angeboten stärker<br />
angesprochen zu fühlen, wodurch sie überproportional in den Verein kommen und<br />
dort länger bleiben, was dann zu einem höheren Mitgliederanteil führt.<br />
Die folgende Tabelle zeigt die außersportlichen Angebote.<br />
97
Tab. 6.22: Außersportliche Angebote (e. D.)<br />
außersportliche Angebote Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53<br />
Feiern zu besonderen Anlässen 7 4 1 3 4 2 1 2 1 7 2 1 3 6 1 2 1 1 1 2 1 x<br />
Gesellige Angebote 1 2 3 x 2 2 1 1 3 1 1 2 2 x<br />
Tagesausflüge 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 x 1<br />
Hallenübernachtung, Freizeiten, Reisen 4 3 1 1 1 2 1 4 1 2 3 2 4 3 1 1 1 3 1 x 3<br />
Spieltreffs, Spielfest 1 2<br />
Hobbyaktivitäten 1<br />
sonstiges (siehe unter der Tabelle - a, b, ...) a b c d<br />
Summe an verschiedenen Angeboten 4 4 6 3 1 5 2 4 5 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2<br />
Sonstige - außersportliche Angebote:<br />
a Wettkampfeinführung für die 4-8 jährigen Mitglieder und deren Eltern (inkl. Grillen)<br />
b 3 Turnierwochenende (also Ausrichtung von Turnieren plus geselligem Teil)<br />
c Hausaufgabenbetreuung im Rahmen des Teilzeitinternats<br />
d geselliges Beisammensein nach dem Freitags-Training<br />
x = mindestens 1<br />
Die Vereine 1 bis 13 bieten im Vergleich zu den anderen Vereinen mehr<br />
verschiedenartige außersportliche Angebote an, also mehr in der Summe und in<br />
der Art. Aber in der Anzahl der Angebote insgesamt bieten die Vereine mit<br />
höherem Frauenanteil deutlich mehr Aktivitäten an.<br />
Nach der Analyse der außersportlichen Angebote lässt sich bestätigen, dass:<br />
Vereine mit einem größeren Anteil außersportlicher Aktivitäten einen höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil haben. Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass die<br />
Zeit von Vereinspersonal von stärker wettkampforientierten Vereinen durch<br />
zusätzliche Turniere und Wettkämpfe zu knapp ist um noch weitere außersportliche<br />
Aktivitäten zu planen und durchzuführen.<br />
Das sich im Verein einsetzenden Personal ist, nach einem Exkurs zu Verein 52,<br />
Thema der nächsten Hypothese.<br />
Exkurs: Besondere Betrachtung der Verein 9 und 52<br />
Verein 52 bietet ein umfangreiches wöchentliches Sportangebot für verschiedene<br />
Zielgruppen. In 5 Rubriken bietet er spezielle Zielgruppenangebote. Damit liegt er<br />
deutlich über dem Gesamtdurchschnitt von 1,8. Selbst Verein 1 mit dem höchsten<br />
weiblichen Mitgliederanteil von 47,8 % bietet nur in 4 verschiedenen Rubriken ein<br />
Zielgruppenangebot.<br />
Das umfangreiche Zielgruppenangebot von Verein 52 lässt sich hauptsächlich auf<br />
zwei Faktoren zurückführen. Erstens ist dieser Verein mit 486 gemeldeten aktiven<br />
Judoka der zweitgrößte Verein in NRW und zweitens ist eine Vergrößerung der<br />
Trainingsstätte in Planung, womit eine Vergrößerung der Mitgliederzahl nötig ist<br />
und daher viele Zielgruppen angesprochen werden sollen. Trotzdem ist der<br />
98
weibliche Mitgliederanteil mit 21 % geringer als bei allen anderen größeren<br />
<strong>Judoverein</strong>en außer bei einem (Verein 53).<br />
Eine Ursache könnte in der Art der Anwendung eines speziellen Trainingskonzeptes,<br />
welches sich an das Trainingskonzepts eines schwedischen <strong>Judoverein</strong>s<br />
aus Sundsvall anlehnt, liegen. Dieses Konzept wurde für<br />
Wettkampfbegeisterte sowie Wettkampfuninteressierte erstellt. Der schwedische<br />
Verein in Sundsvall bietet seinen Mitgliedern die Gruppentypen Fun, Technik und<br />
die Ippon an. Bei der letztgenannten ist der Erfolg im Judowettkampf das<br />
wichtigste Trainingsziel. In der Technikgruppe steht das Erlernen der vielfältigen<br />
Judotechniken im Zentrum und die Fun-Gruppe legt Wert auf einer spielerischen<br />
Vermittlung von Judo und allgemeinen Bewegungsfähigkeiten. Doch auch<br />
Verein 9 orientiert sich an dem schwedischen Konzept und hatte Anfang 2008<br />
einen deutlich höheren weiblichen Mitgliederanteil von 38,6 %. Es scheinen jedoch<br />
drei Gründe für diesen großen Unterschied im weiblichen Mitgliederanteil<br />
verantwortlich zu sein:<br />
1. In Verein 9 erfolgt die Separierung in drei verschiedene Trainingstypen in<br />
der jeweiligen Trainingszeit. Etwa 50 % der Trainingszeit trainieren die Mitglieder<br />
zusammen und die andere Zeit wird in einer der drei Trainingstypen<br />
trainiert. Die Mitglieder können jedes Quartal frei wählen, an welchem der<br />
drei Trainingstypen sie teilnehmen wollen. Dies ist deshalb so reglementiert,<br />
um den Trainern die Möglichkeit zu geben, ein Trainingsprogramm zu<br />
gestalten und um den Trainern die Zeit zu geben die Lernenden kennenzulernen.<br />
Durch diese Art der Differenzierung trainieren die Mitglieder gemeinsam<br />
in einer Halle und auch mindestens 50 % der Trainingszeit mit<br />
weiteren im Durchschnitt 34 Mitgliedern. Dadurch wird es ermöglicht, dass<br />
mehr weibliche Mitglieder zusammen trainieren. Diese fühlen sich aufgrund<br />
genügend weiterer weiblicher Mitglieder wohler und werben weitere weibliche<br />
Personen zum Vereinseintritt. Dem gegenüber bietet der Verein 52 drei<br />
verschiedenen Trainingstypen zu verschiedenen Zeiten und Tagen an und<br />
musste aufgrund einer kleineren Gruppengröße reine Mädchengruppen einrichten.<br />
Die Anzahl der Mädchen in den regulären Gruppen war sehr gering<br />
und die Mädchen fühlten sich dort nicht wohl, da ihnen nicht geügend Partnerinnen<br />
zur Verfügung standen. Die beiden Mädchengruppen sind an zwei<br />
verschiedenen Tagen und nach Alter differenziert. Damit muss bei einem<br />
99
altersbedingten Gruppenwechsel auch der Trainingstag gewechselt werden,<br />
was damit zu einer höheren Fluktuation führt. Es gibt nur an einem<br />
Tag für das entsprechende Alter ein Angebot ausschließlich für Mädchen.<br />
Damit haben im Gegensatz zu den Jungen interessierte Mädchen, die mit<br />
Judo beginnen wollen, nur einen Wochentag zur Auswahl. Alle interessierten<br />
Mädchen, die aber an diesem Tag etwas anderes in ihrer Freizeit machen,<br />
können in Verein 52 nicht mit Judo anfangen, was zu deutlich weniger<br />
Eintritten im Verhältnis zu den männlichen Personen führt, die jeden<br />
Wochentag Judo machen können (2007: 93 männlich, 29 weiblich).<br />
2. Verein 52 und Verein 9 unterscheiden sich deutlich betreffend ihrer Trainer.<br />
Verein 52 beschäftigt einen männlichen Hauptamtlichen, eine männliche<br />
Teilzeitkraft, 5 weitere männliche Trainer und 8 jugendliche männliche Trainerassistenten.<br />
Im Bereich des weiblichen Trainingspersonals gibt es insgesamt<br />
nur 2 Trainerassistentinnen. Die hauptamtliche Kraft und die Teilzeitkraft<br />
kommen beide aus dem Leistungssport und haben aufgrund ihres<br />
Migrationshintergund Defizite in der deutschen Sprache.<br />
In Verein 9 sind 68 % der Trainern und Trainerhelfern weiblich. Einerseits<br />
ist anzunehmen, dass das weibliche Personal besser auf spezifisch weibliche<br />
Belange der Mitglieder eingehen kann, und andererseits nimmt das<br />
weibliche Personal für die weiblichen Mitglieder eine geschlechtsspezifische<br />
Vorbildfunktion ein. Auch könnte es sein, dass mehr weibliche Personen in<br />
den Verein kommen, weil sie sehen, dass dort viele weibliche Trainerinnen<br />
und Trainerhelferinnen aktiv sind.<br />
3. Verein 52 betreibt laut Angabe des Befragten über die Presseberichte die<br />
meiste Werbung für neue Mitglieder. Hier wird über die Zeitung in zweiter<br />
Priorität nach den Wettkampfberichten für Trainingsangebote des Vereins<br />
geworben. Die Werbung von neuen Mitgliedern scheint wenig weibliche Interessierte<br />
anzusprechen und auf der anderen Seite viele männliche Interessierte<br />
(Eintritte männlich 93, Eintritte weiblich 29).<br />
Bei der Prüfung der 7. Hypothese wird berichtet, dass Verein 9 vor einer<br />
umfangreichen Werbung für den Verein einen hohen weiblichen<br />
Mitgliederanteil hatte mit etwa 40 % (auch noch Anfang 2008) und dass<br />
dieser durch die Werbung Ende 2008 auf 30 % zurückgegangen ist.<br />
100
Verein 9 und Verein 52 bieten Judo in seiner ganzen Bandbreite an, vom Ringen<br />
und Raufen bis hin zum olympischen Wettkampf-Judo. Einflussfaktoren wie<br />
Trainingsgruppengröße und Anteil der weiblichen Trainer und Trainerhelfer sowie<br />
eine nicht zielgerichtete Werbung scheinen deutlich auf den Anteil weiblicher<br />
Mitglieder einzuwirken. Größere geschlechtsgemischte Gruppen mit möglichst<br />
vielen weiblichen Trainern und Trainerhelfern tragen offensichtlich zu einem<br />
höheren Anteil an weiblichen Mitgliedern bei. Mitglieder werben Mitglieder stellt<br />
neben einer zielgerichteten Werbung einen wichtigen Beitrag dar, wodurch mehr<br />
Mädchen in einen <strong>Judoverein</strong> finden.<br />
Der Anteil der weiblichen Menschen, die sich in den jeweiligen Vereinen einsetzen<br />
wird nun genauer dargestellt.<br />
101
13) In <strong>Judoverein</strong>en in denen mehr weibliche Mitglieder an Versammlungen<br />
teilnehmen ist der Anteil weiblicher Mitglieder größer.<br />
Die im Rahmen der Befragung zu dieser Thematik gestellten Fragen führten nicht<br />
zur Bestätigung der Hypothese, aber auch nicht zu ihrem Verwerfen. Die<br />
Befragten stellten keinen Unterschied betreffend der Beteiligung der Geschlechter<br />
fest. Um genauere Angaben von den Befragten zu bekommen, hätten Anwesenheitslisten<br />
mehrerer Versammlungen ausgewertet werden müssen. Dies war aber<br />
aufgrund der ohnehin umfangreichen Befragung nicht von den Befragten zu<br />
verlangen.<br />
Im Ganzen liegt die Beteiligung der Mitglieder an Versammlungen im Schnitt bei<br />
12 %. Der Durchschnitt der Versammlungsbeteiligung bei den Vereinen mit einem<br />
höheren weiblichen Mitgliederanteil liegt mit 13,6 % leicht über dem<br />
Durchschnittswert der anderen Vereine (10 %). Sechs der 13 Vereine mit einem<br />
höheren weiblichen Mitgliederanteil haben eine Regelung für ein Stimmrecht für<br />
Eltern von Minderjährigen. Dem gegenüber haben dies nur drei von den anderen<br />
elf Vereinen. Folglich bieten Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil<br />
ihren Mitgliedern durch das Elternstimmrecht anteilig mehr Mitbestimmung. Aber<br />
die Möglichkeit der Mitbestimmung wird in der Versammlung nur von wenigen<br />
Eltern genutzt. Bei im Schnitt mehr als 85 % der Mitglieder scheint die Bereitschaft<br />
gering zu sein, sich durch die Teilnahme an einer formalen Versammlung<br />
verantwortlich in den Verein einzubringen. Doch die Möglichkeit der<br />
Mitbestimmung hängt nicht alleine an diesem in einer Satzung festgeschriebenen<br />
Stimmrecht ab, sondern kann auch durch Gespräche und informelle Treffen (u. a.<br />
Elternabende) ausgeübt werden.<br />
102
Tab. 6.23: Versammlungsbeteiligung (e. D.)<br />
Versammlungsbeteiligung (Anteil von der Gesamtmitgliederzahl)<br />
Anzahl der Anwesende Eltern von Minderjährigen Mitglieder- Minderjährige Erwachsene<br />
Verein Anwesenden in Prozent Stimmrecht Anteil anzahl Anzahl Anzahl<br />
Verein 1 20** 10% k.S. 0% 205 120 85<br />
Verein 2 28** 10% Stimmrecht 30%** 280 259 21<br />
Verein 3*** 26** 10% Stimmrecht 30%** 259 233 26<br />
Verein 4 23 15% k.S. 0% 157 131 26<br />
Verein 5*** 20** 10% k.S. 0% 206 131 75<br />
Verein 6 26** 10% Stimmrecht 50% 133 104 29<br />
Verein 7 85* 30% k.S. 60%* 276 204 72<br />
Verein 8 20** 7% Stimmrecht 20%** 295 261 34<br />
Verein 9**** 35 20% Stimmrecht 30% 176 158 18<br />
Verein 10 35 20% Stimmrecht 20%** 177 144 33<br />
Verein 11 20** 10% k.S. 0% 212 158 54<br />
Verein 12**** 20 10% k.S. 0% 239 188 51<br />
Verein 13**** 30** 15% k.S. 0% 211 151 60<br />
Verein 41 20** 5% k.S. 0% 316 255 61<br />
Verein 42*** 25 8% k.S. 0% 325 231 94<br />
Verein 43 15 7% k.S. 20%** 216 149 67<br />
Verein 44 25** 10% Stimmrecht 40%** 247 139 108<br />
Verein 45 25 15% Stimmrecht 20% 155 105 50<br />
Verein 46***** 70 30% Stimmrecht 60% 225 162 63<br />
Verein 47 35 12% k.S. 5% 314 210 104<br />
Verein 48 20** 4% k.S. 10% 563 513 50<br />
Verein 50 20 4% k.S. 0% 364 308 56<br />
Verein 52 45** 10% k.S. 0% 486 418 68<br />
Verein 53 17 5% k.S. 0% 315 258 57<br />
k.S. kein Stimmrecht<br />
* Jahresehrung in Jahreshauptversammung integriert (inkl. Kinder)<br />
** nachträglich errechnet<br />
*** vor allem Trainer und Vorstand<br />
**** Jugendversammlung erwähnt<br />
***** Umbruch im Verein<br />
Etwa 30 % der Anwesenden sind Eltern von minderjährigen Mitgliedern, die im<br />
Schnitt 75,3 % der Gesamtmitgliederanzahl im Verein darstellen. Damit liegt der<br />
Anteil der Eltern von minderjährigen Mitgliedern, die eine Versammlung besuchen<br />
bei 2 % bis 8 %. Ob die nicht anwesenden Mitglieder bzw. deren Eltern zufrieden<br />
sind und daher eine Versammlungsteilnahme für nicht notwendig halten oder ob<br />
sie bei Unzufriedenheit andere Wege nutzen, um dies deutlich zu machen<br />
(Gespräch mit Trainern, Austritt aus dem Verein) ist offen (vgl. Kap 4.2). Im Schnitt<br />
nehmen weniger als 30 Personen an Versammlungen teil. Dabei bilden der<br />
Vorstand und die Trainer einen Großteil der Versammlung. Verein 7 und Verein 46<br />
weisen eine mehr als doppelt so hohe Teilnehmerzahl auf (85 bzw. 70). Verein 7<br />
verbindet die Ehrung der Wettkämpfer mit der Versammlung und erhält dadurch<br />
zusätzliche 50 Personen in der Versammlung. Verein 46 hatte an der letzten<br />
Versammlung deutlich mehr Teilnehmer, da sich der Verein laut Befragtem in<br />
einem Umbruch befand und die Frage zu beantworten galt, ob man sich eine<br />
103
Oberliga-Mannschaft der Männer und eine Regionalliga-Mannschaft der Frauen<br />
finanziell leisten kann bzw. leisten will. Zusätzliche Mitglieder scheinen also dann<br />
eine Versammlung zu besuchen, wenn sie persönlich eingebunden sind (Ehrung,<br />
Wettkampfteilnahme der Mannschaften, finanzieller Nachteil bzw. Vorteil). Der<br />
Verein als Ganzes und die damit zusammenhängende Teilnahme an dem<br />
höchsten Entscheidungsgremium des Vereins ist für den Großteil der Mitglieder<br />
anscheinend uninteressant. Dies betrifft zugleich <strong>Judoverein</strong>e mit einem höheren<br />
wie mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil.<br />
104
14) Je höher der weibliche Anteil im Verein, der sich für den Verein<br />
engagiert, desto höher ist der weibliche Anteil der Mitglieder.<br />
In den Vereinen 1 bis 13 liegt der Durchschnitt der sich engagierenden Personen<br />
in Funktionen bei 17 männlichen und 13 weiblichen Personen. Bei den Vereinen<br />
41 bis 53 liegt dieser hingegen bei 17 männlichen und 7 weiblichen Personen.<br />
Damit ist in Vereinen mit einem geringeren weiblichen Mitgliederanteil der Anteil<br />
der weiblichen Funktionäre geringer.<br />
Tab. 6.24: Personalstruktur (e. D.)<br />
Vereine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 53<br />
Personal<br />
(männlich/weiblich)<br />
Gesamtzahl der<br />
30/30 22 15/15 k.A. 25/25 12/13 k.A. k.A. 15/20 12/8 15/20 50 27/18 40 20/5 8/7 20/10 6/6 20/10 k.A. k.A. k.A. k.A. 15/6<br />
Ehrenamtlichen<br />
Vorstand 9/7 2/4 3/1 4/2 4/0 5/0 4/1 3/2 3/1 4/1 4/2 4/2 11/2 4/2 14/0 4/3 5/2 5/1 4/1 8/1 3/0 2/0 3/0 3/0<br />
Jugendvorstand 5/5 0/2 2/2 2/0 2/0 3/3 2/2 1/3 4/5 1/1 3/1 3/3 1/1 2/4 0/1 9/1 0/1 0/1 2/3 0 1/3 1/2 1/0 1/1<br />
Ausschüsse/ sonstiges 4/10 0 0 0 0 3/12 0 0 0 0 ***** 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0<br />
Trainer 10/9 5/6 12/9 7/8 6/2*** 5/3 5/5 9/5 3/4 7/3 4/2 8/2 17/8 7/3 13/7 6/2 5/2 3/2 10/3 9/2 9/1 4/0 5/0 9/1<br />
Trainerhelfer * 0/6 9/12 k.A. k.A. 4/6 4/0 4/5 2/7 2/3 3/3 0/5 10 5/5 0 3/2 2/1 4/2 k.A. 14/6 0 1/2 8/2 7/3<br />
weiblicher Anteil Trainer, 47,4 70,6 50 53,3 25 50 35,7 43,5 68,8 40 41,7 46,7 32 40 35 30,8 30 36,4 23,1 19,5 10 28,6 13,3 20<br />
-helfer<br />
Summe der Personen in 28/31 7/18 26/24 13/10 12/2 17/9 15/8 17/15 12/17 14/8 14/8 16/13 34/11 18/14 27/8 22/8 12/6 12/6 16/7 31/9 13/6 7/4 18/2 20/5<br />
Funktion**<br />
weiblicher Anteil der 52,5 72 48 43,5 14,3 34,6 34,8 46,9 58,6 36,4 36,4 44,8 24,4 43,8 22,9 26,7 33,3 33,33 30,4 22,5 20,7 36,4 10 20<br />
Funktionäre<br />
3 Engagiertesten 1/2 0/3 2/1 k.A. 2/1 0/3 2/1 2/2**** 1/2 2/1 2/1 2/1 k.A. 1/1 2/1 2/1 3/0 2/1 2/1 2/1 3/0 3/0 3/0 2/1<br />
Bezahlte Mitarbeiter 0 0 0 0 1/1 0 0 2/2 1/1 0 0 0 0 1/2 3/1 0 0 0 0 0 4/2 3/0 3/0 0<br />
Position des Befragten Vo/Tr Pr/Tr Ge Ge/Tr Vo/Tr Ge Sp/Tr Vo/Tr Ju/Tr Vo/Tr Vo/Tr Vo/Tr Vo/Tr Vo Ka/Tr Vo/Tr Ste/Tr Ge Vo/Tr Vo/Tr Vo/Tr Abt/Tr Abt/Tr Vo/Tr<br />
Geschlecht des Befragten m w w m m m m w w m m m m w m w m m m m m m m m<br />
Vereinsgröße 205 280 259 157 206 133 276 295 176 177 212 239 211 436# 325 216 247 155 225 314 563 364 486 315<br />
Anteil weibl. Mitglieder 47,8 47,1 45,9 40,8 39,3 39,1 38,8 38,6 38,6 38,4 37,7 37,7 37,0 28,2# 26,2 25,9 24,7 24,5 24,4 23,9 23,8 22,3 21 19<br />
* sehr viele der Jugendlichen im Verein besuchen, die vom Vereinsleiter organisierte Gruppenhelferausbildung Vo Vorsitzender Ju Jugendvertreterin<br />
** Summe der Personen in Funktion beinhaltet auch doppelte Nennungen (z.B. Vorsitzender und Trainer Tr Trainer Ka Kassierer<br />
*** Haupttrainer ist weiblich Pr Pressewart Ste Stellverstetender Abteilungsleiter<br />
**** zwei Ehepaare Ge Geschäftsführer Abt Abteilungsleiter<br />
***** Elternsprecher 6 Familien, Elternvertreter 2 Frauen Sp Sportlicher Leiter # feste Kooperation mit dem Eitorfer Judo-Club<br />
Die Vereine 1 bis 13 haben einen weiblichen Anteil bei den Funktionären von<br />
43,3 % und bei den Mitgliedern von 40,5 %, wohingegen die Vereine 41 bis 53<br />
einen Anteil 29,1 % weiblicher Funktionäre und einen Anteil von 23,8 % an<br />
weiblichen Mitgliedern haben. Damit setzen sich bei allen untersuchten Vereinen<br />
prozentual mehr Mädchen und Frauen für den Verein ein als es ihrem Anteil an<br />
weiblichen Mitgliedern entspricht. Bei den Vereinen mit einem niedrigeren<br />
weiblichen Mitgliederanteil ist die Differenz mit 5,3 Prozentpunkten etwas höher<br />
als bei den Vereinen mit einem höheren Mitgliederanteil (2,8 Prozentpunkte).<br />
Vergleicht man die beiden Vereinsgruppen, dann ist die o g. Hypothese erneut<br />
kritisch zu betrachten. Bei den Vereinen steigt nicht mit dem Anteil der weiblichen<br />
Funktionäre der Anteil der weiblichen Mitglieder; z.B. Verein 1 52,5 %, Verein 2<br />
72 %, Verein 5 14,3 %, Verein 9 58,6 %, Verein 13 24,4 %, Verein 41 43,8 %,<br />
Verein 52 10 % und Verein 53 20 %.<br />
105
Betrachtet man das Verhältnis der Trainer und Trainerhelfer lässt sich dieser<br />
Zusammenhang auch nicht bestätigen. Im Schnitt setzten sich 46,5 % weibliche<br />
Mitglieder als Trainer in den Vereinen 1 bis 13 ein. Bei den Vereinen 41 bis 53<br />
sind es mit durchschnittlich 26,1 % weniger, doch auch hier gibt es Ausnahmen.<br />
So liegt der Verein 41 mit 40 % weiblichen Trainern und Trainerhelfern deutlich<br />
über dem Durchschnitt.<br />
Im Rahmen dieser Befragung war es nicht möglich genau zu recherchieren,<br />
welche Trainer mit welchem Geschlecht sich wie umfangreich für die Mitglieder in<br />
einem bestimmten Alter einsetzen. Verein 5 mit einem Anteil von nur 25 %<br />
weiblichen Trainern erläuterte, dass die Haupttrainerin des Vereins eine Frau ist,<br />
die viele Mädchen und Jungen vom Judo begeistert.<br />
Die Auswertung über die Menschen, die sich für den Verein einsetzen lässt die<br />
Folgerung zu, dass der Umfang des Einsatz von weiblichen wie männlichen<br />
Trainern und Trainerhelfern von etwa je 50 %, einen positiven Effekt auf den Anteil<br />
von weiblichen Mitgliedern hat.<br />
Bis auf wenige Ausnahmen trainieren in den befragten <strong>Judoverein</strong>en männliche<br />
und weibliche Mitglieder zusammen. Im folgenden Abschnitt werden die offenen<br />
geschlechterspezifischen Fragen über das Judotraining ausgewertet.<br />
106
15) In <strong>Judoverein</strong>en in denen ein höherer Anteil weiblicher Mitglieder<br />
vorhanden ist, finden die Interviewpartner den Umgang mit weiblichen<br />
Mitgliedern leichter bzw. ihnen fällt kein Unterschied ggü. männlichen<br />
Mitgliedern auf.<br />
Tab. 6.25: Umgang mit dem Geschlecht (e. D.)<br />
Umgang Geschlecht Training - einfacher Wettkampf - einfacher<br />
Verein d. Befragten männl. weibl. k.U.* männl. weibl. k.U.<br />
Verein 1 m x x<br />
Verein 2 w x x<br />
Verein 3 w x x<br />
Verein 4 m x x<br />
Verein 5 m x x<br />
Verein 6 m x x<br />
Verein 7 m x x<br />
Verein 8 w x x<br />
Verein 9 w x x<br />
Verein 10 m x x<br />
Verein 11 m x x<br />
Verein 12 m x x<br />
Verein 13 m k.A. k.A.<br />
Verein 41 w x x<br />
Verein 42 m x x<br />
Verein 43 w x x<br />
Verein 44 m x x<br />
Verein 45 m x x<br />
Verein 46 m x x<br />
Verein 47 m x x<br />
Verein 48 m x x<br />
Verein 50 m x x<br />
Verein 52 m x x<br />
Verein 53 m x x<br />
* k.U. kein Unterschied<br />
Auf die Frage, mit welchem Geschlecht ist ihrer Meinung nach der Umgang im<br />
Training bzw. im Wettkampf einfacher, antworteten die männlichen Befragten wie<br />
folgt: Vier der Befragten sagten, im Training sei der Umgang mit Jungen einfacher,<br />
fünf weitere sagten, es sei mit Mädchen einfacher und die restlichen acht nannten<br />
keine Unterschiede. Zum Verhalten bei Wettkämpfen sagten sieben Männer es sei<br />
mit Jungen einfacher, vier nannten die Mädchen und sechs nannten keinen<br />
Unterschied.<br />
Die sechs Frauen antworteten folgendermaßen: Vier Frauen nannten keinen<br />
Unterschied im Umgangen mit Mädchen/ Frauen bzw. Jungen/ Männer im<br />
Training sowie bei Wettkämpfen. Eine Frau empfindet es mit Jungen einfacher<br />
und die andere mit Mädchen.<br />
107
Damit empfinden die Befragten summiert 22-mal keinen Unterschied, 13-mal mit<br />
Jungen einfacher und 11-mal mit Mädchen einfacher.<br />
Die Befragten aus den Vereinen 1 bis 13 empfinden es 10-mal mit einem<br />
bestimmten Geschlecht einfacher (6-mal Jungen, 4-mal Mädchen) und 14-mal<br />
empfinden sie keinen Unterschied. Dem Gegenüber empfinden es die Vereine 41<br />
bis 53 14-mal mit einem bestimmten Geschlecht leichter und 8-mal empfinden sie<br />
keinen Unterschied. Damit haben die Befragten aus den Vereinen 41 bis 53 mehr<br />
vorlieben gegenüber einem Geschlecht. 7mal empfindet es jemand aus dieser<br />
Gruppe mit Mädchen einfacher und 7-mal empfindet es jemand mit Jungen<br />
einfacher.<br />
Mit diesen Daten lässt sich die Hypothese nicht bestätigen, auch deshalb nicht<br />
weil die Beantwortung der Frage vom Geschlecht des Interviewpartners<br />
beeinflusst wird. Um bessere Aussagen zu der Frage zu bekommen, mit welchem<br />
Geschlecht der Umgang einfacher ist, müssten zumindest alle Trainer und<br />
Trainerhelfer befragt werden.<br />
Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass Trainer, die Menschen trainieren und<br />
betreuen, mit denen sie besser umgehen können, also mit einem gewissen<br />
Altersbereich, einem Geschlecht oder einer Leistungsklasse.<br />
108
16) Im Training in <strong>Judoverein</strong>en mit einem höheren Anteil weiblicher<br />
Mitglieder wird differenzierter auf das jeweilige Geschlecht eingegangen.<br />
Die Interviewten wurden gefragt, wo sie einen Unterschied im Verhalten als<br />
Trainer gegenüber den weiblichen und den männlichen Judokas sehen und<br />
worauf als Trainer besonders zu achten ist. Mit dieser vorgegebenen Frage und<br />
der vorausgehenden Frage, mit welchem Geschlecht sie den Umgang im Training<br />
und im Wettkampf einfacher fänden, entwickelte sich mit den Befragten ein<br />
offenes Gespräch. Die wichtigsten Aussagen sind hier dargestellt.<br />
Die Aussagen aus diesem offenen Gespräch werden hier in mehrere Rubriken<br />
eingeteilt und die Aussagen der Vereine 1 bis 13 und 41 bis 53 in der jeweiligen<br />
Rubrik untereinander gestellt und jeweils am Ende miteinander verglichen:<br />
Geschlechterspezifischer Umgang mit den Judoka als Trainer<br />
Befragte oder Befragter aus den Vereinen 1 bis 13:<br />
• Allgemein die Judokas beobachten und helfend zur Seite stehen, wenn es einen Konflikt gibt<br />
oder wenn es jemanden nicht so gut geht. (vgl.. Befragte aus Verein 3, Z. 311)<br />
• Man muss die Gefühle der Mädchen beachten, wenn sie sich dazu äußern oder wenn man sie<br />
beobachtet, dass sie nicht mit einem Jungen trainieren wollen, weil es ihnen unangenehm ist.<br />
Man darf dann keinen Druck aufbauen und die Mädchen dazu zwingen mit Jungen zu kämpfen.<br />
(vgl. Befragte aus Verein 2, Z. 295)<br />
• nicht unbedingt darauf bestehen, dass ein Junge mit einem Mädchen trainieren muss (vgl.<br />
Befragte aus Verein 2, Z. 289)<br />
• „Unser Verein bietet ein umfangreiches sportliches und außersportliches Angebot. Alles kann<br />
freiwillig von Mitgliedern genutzt werden. Es soll kein Mitglied zu irgendetwas gezwungen<br />
werden, ob direkt oder eher unterbewusst.“ (s. Befragte aus Verein 9, Z. 300)<br />
• „Man braucht Fingerspitzengefühl und Erfahrung. (…) Ich versuche immer ein lockeres, nettes<br />
Verhältnis zu den Jugendlichen zu finden. Ich denke, ich bin zu den Jungen etwas robuster als<br />
zu den Mädchen.“ (s. Befragter aus Verein 10, Z. 298)<br />
• „Mädchen sind oft nachtragender, und man kann damit ein Vertrauensverhältnis zerrütten, dass<br />
man eine doofe Bemerkung macht, die bei Jungen schnell vergessen ist, aber bei Mädchen<br />
noch länger nachhallt.“ (s. Befragter aus Verein 11, Z. 295)<br />
• Der Umgang kann mit Jungen direkter erfolgen. (s. Befragter aus Verein 1, Z. 280)<br />
Befragte oder Befragter aus den Vereinen 41 bis 53:<br />
• Der Befragte schildert, dass jugendliche und erwachsene Judo-Neueinsteiger Schwierigkeiten<br />
mit dem hautnahen Körperkontakt haben, im Besonderen mit dem anderen Geschlecht. Er<br />
kommt zu folgendem Schluss: „Gerade bei den Kleineren sollte man darauf achten, dass sie<br />
gemischt trainieren, damit sie sich von Anfang an als mehr oder weniger gleichberechtigt<br />
sehen.“ (s. Befragte Verein 43, Z. 287 f.)<br />
• „Bei 14/15-jährigen Mädchen kommt schon mal eine gewisse Neugier auf [Trainer<br />
anzumachen], und dann bekommen unsere Trainer eine extra Schulung, wie der Umgang mit<br />
Mädchen im Training abläuft und worauf zu achten ist.“ (Befragte aus Verein 41, Z. 323)<br />
• Als Trainer soll man, so der Befragte, zu seinen Schülern das richtige Maß an Nähe und<br />
Distanz wahren. Die gilt im Umgang mit Mädchen und Jungen. Des Weiteren soll man Werte<br />
leben. (vgl. Befragter aus Verein 48, Z. 337 ff.)<br />
• „Man muss als Trainer schon ein bisschen vorsichtiger sein, da Mädchen und Frauen doch<br />
weitaus empfindlicher reagieren auf das, was man sagt und wie man als Mann reagiert. Bei<br />
Jungen und Männer kann man das schon mal abtun und schon mal flapsig sein. Die Mädchen<br />
109
und Frauen legen es schneller auf die Goldwaage. (…) Wenn der Junge irgendwie Scheiße<br />
gemacht hat, dann kann man ihm in den Arsch treten. Aber man kann keinen Mädchen in den<br />
Arsch treten, sonst gibt es großes Theater. Es ist schwieriger mit Mädchen, da muss man<br />
individueller im Training mit umgehen.“ (s. Befragter aus Verein 53, Z. 297 ff.)<br />
• „Man muss vorsichtiger im Umgang sein, man muss sich mehr Gedanken machen. (…) Ich<br />
könnte einer Frau jetzt nicht sagen, jetzt beweg deinen Arsch! (…) Oder du hast ganz schön<br />
zugenommen, du musst mal auf dein Gewicht achten. Dies alles kann ich Männern ohne<br />
Probleme sagen, Frauen aber nicht.“ (s. Befragter aus Verein 42, Z. 303)<br />
• „Das ist schwierig. Mit Mädchen muss man ein bisschen leiser, ruhiger, netter reden. Es sind<br />
Mädchen, dass ist halt so. Mit Jungen kann man einen Witz machen. Die Mädchen sind dann<br />
[bei einem Witz] viel schneller beleidigt. Meine Chefin sagt, sie sind sensibler. Du musst mehr<br />
Pflege in Mädchen investieren.“ (s. Befragter aus Verein 52, Z. 305-309) Dieser Trainer scheint<br />
besonders dann Probleme mit den Mädchen zu bekommen, wenn sie durch die Pubertät ihren<br />
eigenen Willen, ihren eigenen Kopf bekommen.<br />
• „Man soll darauf achten, dass Jungen die Mädchen nicht unsittlich berühren, z. B. an den<br />
Brüsten beim Bodenrandori (Übungskampf in der Bodenlage). (…) „Ich mache nicht mit einem<br />
Jungen, gibt es bei mir nicht. Ein Junge ist genau so ein Mensch wie ein Mädchen. (…) und<br />
daher kann man auch gemeinsam kämpfen, im Besonderen im Kindesalter. Und bei solchen<br />
Dingen [dass Mädchen nicht mit Jungen trainieren wollen und umgekehrt] lasse ich erst gar<br />
nicht zu, dass da rumgezickt wird.“ (s. Befragter aus Verein 48, Z.341)<br />
• „Es trainieren Mädchen und Jungen zusammen. Und wir haben da noch nie Unterschiede<br />
gemacht.“ (s. Befragter aus Verein 47, Z. 336)<br />
Die Befragten der Vereine 41 bis 53 äußern sich mehr über die Schwierigkeiten<br />
mit Mädchen bzw. Frauen und sind dabei zum Teil recht derbe in ihrer Wortwahl,<br />
während die Aussagen der Befragten der Vereine 1 bis 13 eher ihren<br />
differenzierten Umgang mit den Frauen bzw. Mädchen zum Thema haben. Diese<br />
unterschiedliche Sichtweise und das an der Wortwahl abzulesende Feingefühl<br />
könnten eine Ursache für den höheren Anteil an weiblichen Mitgliedern in den<br />
Vereinen 1 bis 13 sein.<br />
Acht geben als Trainer in bestimmten Situationen<br />
Befragte oder Befragter aus den Vereinen 1 bis 13:<br />
• Bei Randoris im Training acht geben, wenn etwas nicht in Ordnung ist und steuernd<br />
eingreifen..(vgl. Befragter Verein 7, Z. 299)<br />
• „Wenn ein Junge dabei ist gegen ein Mädchen zu verlieren, dann ist zu beobachten, dass der<br />
Junge aggressiver wird, als wenn ein Mädchen gegen einen Jungen verliert. Daher acht geben,<br />
dass es nicht zu solchen ungleichen Paarungen kommt oder dem Mädchen sagen, dass es<br />
vorsichtiger mit dem Jungen umgehen solle.“ (s. Befragte aus Verein 2 Z. 289)<br />
• Besonders bei gemischtgeschlechtlichen Kämpfen als Trainer darauf achten, dass der Partner<br />
nicht grob ist, sondern verstärkt auf Technik achtet. (vgl. Befragte aus Verein 3, Z.290)<br />
• „In allen kampfähnlichen Situationen müssen die Trainer wachsam sein, denn aus jedem<br />
freudvollem Kämpfchen, kann ein Streit entstehen.“ Bei einem Streit haben die Trainer/innen<br />
das Ziel, dass die Streitparteien möglichst mit einer Win-Win-Situation aus dem geklärten Streit<br />
herausgehen. „Man muss die Mitglieder kennen, um Personen, die schneller einen Streit<br />
provozieren, im Auge zu haben.“ (vgl. Befragte aus Verein 9, Z. 301)<br />
Die Tatsache, dass sich nur Befragte aus der Gruppe der Vereine 1 bis 13 zu<br />
diesem Thema äußerten, belegt, dass diese sensibler im Umgang mit den<br />
110
Trainingsteilnehmern und –teilnehmerinnen sowie mit der Gruppe sind, was<br />
natürlich von Bedeutung für den Verbleib der Mädchen und Frauen in den<br />
<strong>Judoverein</strong>en ist.<br />
Unterschiedliches Verhalten der Geschlechter<br />
Befragte oder Befragter aus den Vereinen 1 bis 13:<br />
• „Menschen sind alle unterschiedlich, es gibt schüchterne Jungen und aggressive Mädchen.<br />
Alle muss man so nehmen, wie sie sind und sie bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung<br />
unterstützen.“ (s. Befragte aus Verein 9, Z.302)<br />
• „Wir nehmen die Judokas so, wie sie sind, die Mädchen sind eher zickig und die Jungen<br />
dagegen eher rotzig.“ [lachender Unterton] (s. Befragte Verein 8, Z. 283)<br />
• Bei Randoris (Übungskämpfe) empfinden Mädchen das Verlieren gegen Jungen als nicht so<br />
tragisch. Aber wenn ein Junge dabei ist gegen ein Mädchen zu verlieren, dann ist öfter zu<br />
beobachten, dass der Junge aggressiver wird. (vgl. Befragte aus Verein 2, Z. 289)<br />
• Die Mädchen meiden Trainingsgegner mit einem harten Griff und die Jungen versuchen, ob sie<br />
auch einen harten Griff anwenden können. (vgl. Befragte aus Verein 3, Z. 284)<br />
• Jungen kommen mit Konkurrenz besser klar als Mädchen. (vgl. Befragter aus Verein 1, Z. 281)<br />
• „Man braucht länger, um mit Frauen richtig klar zu kommen. Bis die Frauenmannschaft sich<br />
erst mal gefunden hat, war extrem schwierig. (…) Bei den Männern stellt sich viel schneller<br />
eine Hackordnung ein, und diese wird akzeptiert. Also wer ist die erste Reihe in der Liga und<br />
wer ist die zweite Reihe.“ (s. Befragter aus Verein 4, 301)<br />
• Frauen sind emotionaler und sind oft technisch versierter. (vgl. Befragter aus Verein 4, Z. 301)<br />
• Mädchen äußern ihre Gefühle mehr nach außen. Jungen dagegen verdrängen negative<br />
Gefühle eher. (vgl. Befragte aus Verein 3, Z. 282 f.)<br />
• Mädchen sind feinfühliger („Bei den Jungen kann man eher mal ein hartes Wort sagen.“), und<br />
man darf keine Personen bevorzugen, denn sie werden schneller eifersüchtig. Bei Streitigkeiten<br />
unter den Mädchen dauert die Lösung länger. (vgl. Befragter aus Verein 7, Z. 296)<br />
• „Mädchen haben mehr Gemeinschaftsgefühl. (…) Die Mädchen sind trainingsfleißiger und die<br />
Jungen ein bisschen fauler.“ (s. Befragter aus Verein 12, Z. 309 ff.)<br />
• Frauen kann man viel schneller an den Verein binden; auch als Übungsleiterin. Frauen sind<br />
eher bereit sich dort zu engagieren als Männer. (vgl. Befragter aus Verein 4, Z. 302)<br />
• Frauen legen viel Wert auf Sauberkeit. (vgl. Befragte aus Verein 3, Z. 290)<br />
• Frauen achten mehr darauf, dass sie sich nicht verletzen. (vgl. Befragte aus Verein 3. Z. 290)<br />
Befragte oder Befragter aus den Vereinen 41 bis 53:<br />
• „Bei den Kindern hat man viele Mitglieder, und sobald sie in die Pubertät kommen, wird es<br />
weniger. Da die Mädchen eher in die Pubertät kommen, hören diese auch eher auf als die<br />
Jungen. Das merkt man gewaltig, die Jungen bleiben länger dabei als die Mädchen. Wenn ein<br />
Mädchen länger bleibt, dann kommt später in dem Moment, wo sie einen Freund hat, der<br />
anderweitig unterwegs ist, oft der Austritt aus dem Verein.“ (s. Befragter aus Verein 45, Z. 296)<br />
• „Leistungsbezogen trainierende Mädchen und Frauen sind noch mehr auf die enge Beziehung<br />
zum Trainer angewiesen als Jungen und Männer.“ (s. Befragter aus Verein 53, Z.297)<br />
• „Mädchen hören besser zu, sie bringen die Leistung auf einem Wettkampf und sind im Ganzen<br />
eher bei der Sache. Dagegen sind die Jungen ein bisschen larifari.“ (s. Befragter aus Verein 44,<br />
Z. 288)<br />
• „Die Mädchen hören besser, die tun besser, die sind ehrgeiziger. Wenn ich hier meine Gruppe<br />
durchgehe und ich habe 20 Jungen und 10 Mädchen, dann sind davon 9 Mädchen, die topfit<br />
sind, fleißig üben und keinen Quatsch machen und ehrgeizig sind. Und von den 20 Jungen sind<br />
vielleicht 6 Jungen da, die den Mädchen entsprechen würden.“ (s. Befragter aus Verein 48, Z.<br />
334)<br />
• „Frauen sind ehrgeiziger (…) betreffend Leuten, die Leistung bringen wollen. (…) [Ansonsten]<br />
gibt es da keine Besonderheiten.“ [ehemaliger Frauenbundesliga-Trainer] (s. Befragter aus<br />
Verein 46, Z. 293 ff.)<br />
111
• „Frauen sind viel komplizierter als Männer. (…) Männer schaffen ein Arrangement. Die mögen<br />
sich vielleicht auch nicht besonders, aber im Sinne der Sache, um im Judo weiterzukommen,<br />
schaffen sie ein Arrangement. Frauen, die sich nicht mögen, die würden nie zusammen<br />
trainieren für ein bestimmtes Ziel. (…) Was wir ganz massiv festgestellt haben, dass<br />
verschiedenen Mädchen bei uns, die den Trainingsort wechselten, mir sagen, ich höre mit Judo<br />
auf, weil ich gar nicht hierein komme in die Gruppe der Mädchen. Die Mädchen mobben und<br />
lassen sie ganz subtil außen vor. (…) Dieses Sticheln kenne ich bei den Jungen gar nicht. (…)<br />
Wenn es um den Leistungssport geht, dann sind Frauen konsequenter und gradliniger, aber<br />
nicht so kooperativ in der Gruppe. Die Jungen äußern sich sehr schnell im positiven wie<br />
negativen Sinne. Die Frauen sind oft diplomatischer. (…) Warum kommen die nicht so aus sich<br />
heraus, warum sagen die nicht ‚ich finde das scheiße’?“ (s. Befragter aus Verein 50, Z. 313 ff.)<br />
Die Aussagen der Vertreter der Vereine 41 bis 53 sind weitgehend auf Wettkampf<br />
und Leistung bezogen und zum Teil wieder sehr derbe in der Wortwahl. Dagegen<br />
äußern sich auch hier die Befragten der Vereine 1 bis 13 feinfühliger und<br />
vielschichtiger.<br />
Besondere Problematik für Trainer bei taktilem Kontakt mit Mädchen:<br />
Befragte oder Befragter aus den Vereinen 1 bis 13:<br />
• „Wenn du einen Jungen nach dem Kampf in den Arm nimmst und ihm sagst, das hast du toll<br />
oder nicht toll gemacht, dann ist das gar kein Problem. Und wenn du ein Mädchen in den Arm<br />
nimmst, dann musst du immer schon aufpassen, dass du nicht als pädophil beschrieben wirst.<br />
Wobei Mädchen, nach meiner persönlichen Meinung, es mehr bräuchten, mal in den Arm<br />
genommen zu werden nach einem Kampf, um einen persönlicheren Kontakt herzustellen, weil<br />
die Mädchen emotionaler sind und Jungen eher nicht so emotional.“ (s. Befragter aus Verein 4,<br />
Z.292)<br />
• „Wir haben bei uns die Grundregel, dass sich bei Verletzungen von Judokas die Männer um die<br />
Jungen und die Frauen um die Mädchen kümmern. Die machen wir, weil man ja bei<br />
Verletzungen die Judokas besonders untersuchen und damit auch anfassen muss. Wir haben<br />
festgestellt, dass sich die Kinder damit wohler fühlen.“ (s. Befragte aus Verein 8, Z. 289)<br />
• „Zur Wettkampfbetreuung ist bei uns immer mindestens ein männlicher und ein weiblicher<br />
Trainer dabei. Gerade nach einem schwierigen, verlorenen Kampf helfen neben Worten der<br />
Trainer auch Dinge wie eine Umarmung und ähnliches. Hier ist es besser, wenn dies der<br />
Trainer mit demselben Geschlecht tut.“ (s. Befragte Verein 9, Z. 303)<br />
Offensichtlich machen sich vor allem Vertreter aus der Gruppe der Vereine 1 bis<br />
13 differenzierte Gedanken zum Umgang mit Mädchen, in diesem Fall zum<br />
taktilen Kontakt und haben sehr feinfühlende Lösungen für diese Problematik.<br />
112
17) Die Interviewpartner aus <strong>Judoverein</strong>en mit einem höheren Anteil an<br />
weiblichen Mitgliedern tätigen ausführlichere Aussagen zur Frage, was<br />
einen mädchen- und frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> ausmacht.<br />
Auch hier werden die Aussagen der Vereine 1 bis 53 (gekürzt) untereinander<br />
gestellt und zuletzt verglichen. Im Folgenden die Aussagen der Vereinsvertreter:<br />
Befragter aus Verein 1:<br />
• Ein Verein, in dem Mädchen/Frauen im Vergleich zu den Jungen/Männern gleich behandelt und<br />
gefördert werden oder besser bzw. gezielter gefördert werden, d. h. viele Mädchen- /<br />
Frauenmannschaften Förderung von Mädchen zu Trainerassistentinnen / Gruppenhelferinnen /<br />
Übungsleiterinnen / Trainerinnen viele gesellige, freizeitorientierte Vereinsangebot (vgl. Verein 1<br />
Z. 285 ff.)<br />
Befragte aus Verein 2:<br />
• Dass es für Frauen eine spezielle Frauengruppe gibt, weil weibliche Judo-Späteinsteiger oft die<br />
Schwierigkeit mit Körperkontakt ggü. Männern haben<br />
• Wir überlassen den Kindern eigentlich immer selbst, was sie machen möchten. Auch den<br />
Wettkampf betreffend, bei uns wird also keiner gedrängt hinzugehen.<br />
• Wir versuchen unsere Großen (junge Erwachsene), die nicht mehr Wettkämpfen möchten, in<br />
die Trainerschiene zu ziehen.<br />
• Des Weiteren werden ihnen Lehrgänge angeboten, bei denen die Geselligkeit einen großen<br />
Stellenwert hat.<br />
Befragte aus Verein 3:<br />
Man ist frauenfreundlich, wenn man auch das Gespräch nicht fehlen lässt.<br />
Dass man jeden so nehmen kann, wie er ist; körpermäßig, gewichtsmäßig und auch von der<br />
Mentalität.<br />
Gründe für Frauenfreundlichkeit im Verein:<br />
• Jeder respektiert jeden.<br />
• „Ich habe auch Trainer, die sehr hart sind, die aber mit Frauen so umgehen, dass Frauen sagen<br />
können, ’Ich lerne, ich kann da was machen, ich kann mich ausprobieren und bis an meine<br />
Grenzen gehen’, aber eben nicht so hart, dass man am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett<br />
kommt.“<br />
• „Wenn ich in der Halle bin und sehe die Gesichter der Mädchen oder der Jungen und merke, da<br />
stimmt was nicht, dann ist es ganz wichtig, dass jemand einen Draht dafür hat, ob es ein<br />
Trainer ist oder ganz egal wer. (…) Dem anderen gegenüber die Aufmerksamkeit schenken.“<br />
• „Dass nicht der Sport im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Nicht die Leistung ist wichtig,<br />
sondern dass jeder etwas für sich selber tut, ganz egal welche Sportart." (s. Befragte aus<br />
Verein 9, Z. 303 ff.)<br />
Befragter aus Verein 4:<br />
„Die Mannschaften kosten eine Menge Geld, dass darf man ja auch nicht aus dem Auge lassen.“<br />
(…) [Betreuung, Startgebühren, Rückennummern, Getränke, Fahrtkosten] (s. Befragter aus Verein<br />
4, Z. 306)<br />
Befragter aus Verein 5:<br />
„Wir sind frauenfreundlich. Wir haben kompetente Trainer, die mit beiden Geschlechtern gut<br />
klarkommen.“ (s. Befragter aus Verein 5, Z. 274)<br />
113
Befragter aus Verein 6:<br />
„Ja, mein Verein ist frauenfreundlich.“ Es gibt fünf Trainer und drei Trainerinnen sowie 4<br />
Sportassistenten und sogar 6 Assistentinnen. Es werden beim Training und Wettkampf beide<br />
Geschlechter gleich gefördert, dies erkennt man auch daran, dass der Verein eine<br />
Frauenmannschaft und eine Herrenmannschaft hat. (vgl. Befragter aus Verein 6, Z. 189ff.)<br />
Befragter aus Verein 7:<br />
„Da wo Mädels ohne irgendwelche Nachteile trainieren können. Behandelt werden wie jeder<br />
andere“, die gleichen Rechte haben und ihre Meinung sagen dürfen. (vgl. Befragter aus Verein 7,<br />
Z. 301 ff.)<br />
Befragte aus Verein 8:<br />
„Hierunter verstehe ich, dass der Vorstand und das Trainerteam paritätisch besetzt sind und dass<br />
auf die Wünsche der Judokas eingegangen wird. So geschieht es bei uns.“ (s. Befragte aus Verein<br />
8, Z. 291ff.)<br />
Befragte aus Verein 9:<br />
„Wir haben das Vereinsmotto ’Judo für jeden’. Unser Ziel ist für alle Interessierten Judo anzubieten,<br />
wobei bei uns Judo sehr weit gefasst ist; von Übungen zur Gewöhnung an Partnerkontakt, über<br />
Spiele und Kampfspiel bis hin zum olympischen Judozweikampf. Durch viele differenzierte<br />
Gruppen wird versucht möglichst allen Interessen gerecht zu werden. Neben dem wöchentlichen<br />
Training wird flexibel auf die Wünsche der Mitglieder eingegangen. Es haben die Kinder und<br />
Jugendlichen immer die Möglichkeit Wünsche zu äußern, die dann durch oder mit der<br />
Vereinsleitung oder sogar selbstständig umgesetzt werden – unter dem Motto ’das sind wir alle’.<br />
Durch unser Vereinskonzept fühlen sich viele Menschen angesprochen, unabhängig davon ob<br />
männlich oder weiblich.“ (s. Befragte aus Verein 9, Z. 306)<br />
Befragter aus Verein 10:<br />
„Dass sie [Mädchen/ Frauen] sich genauso wohl fühlen wie die männlichen [Mitglieder] im Verein.“<br />
(s. Befragter aus Verein 10, Z. 304)<br />
Befragter aus Verein 11:<br />
Es geht darum, dass Mädchen und Frauen voll integriert seien müssen im Vereinsleben. Bei uns<br />
sind Mädchen gerne gesehen, und Mädchen kommen bei uns genauso zu ihrem Recht wie<br />
Jungen. Es werden immer noch Vereinsangeboten gesucht, die über das Wettkämpfen<br />
hinausgehen. (vgl. Befragter aus Verein 11, Z. 299 ff.)<br />
Befragter aus Verein 12:<br />
„Ein Verein, in dem neben den männlichen Trainern auch genügend weibliche Trainer vorhanden<br />
sind, dass also Ansprechpartner da sind. Mädchen müssen mit Frauen als Trainerinnen<br />
kommunizieren können. (…) Es sind nicht nur organisatorische Dinge, sondern es sind oft<br />
Einzelpersonen, die da was ausmachen können. Das müssen nicht nur Frauen sein, sondern auch<br />
Männer. Wie sie die Ansprachen halten und wie das Training erfolgt, ist sehr wichtig. Dazu gehört<br />
es, dass ein Gemeinschaftsgefühl da ist. Frauen und Mädchen hält man im Verein, wenn sie sich<br />
wohl fühlen und sie eine Gemeinschaft finden. (…) Wir sind so eine kleine Familie.“ Da Kinder im<br />
Alter von 6 bis 10 Jahren kaum männliche Lehrer kennen, ist es einfacher, wenn bei diesem Alter<br />
Frauen das Training leiten.“ (s. Befragter aus Verein 12, Z. 316 ff.)<br />
Der Befragte aus Verein 13 konnte sich zu dem Thema aus zeitlichen Gründen nicht äüßern<br />
114
Befragte aus Verein 41:<br />
„Es wäre traurig, wenn diese Frage einem <strong>Judoverein</strong> gestellt werden müsste, weil Mädchen und<br />
Jungen gemeinsam trainieren. Gerade Judo ist ein Sport wo es keine Unterschiede gibt. (…) Wir<br />
haben 40 % Mädchen und 60 % Jungen durchgängig, egal ob Mädchen und Frauen oder Jungen<br />
und Männer.“ (s. Befragte aus Verein 41, Z. 329) – Die Stärkemeldung 2008 besagt aber, dass –<br />
anders als von der Befragten geschätzt – der weibliche Anteil bei den Minderjährigen bei 24,7 %<br />
und bei den Erwachsenen bei 31,1 % liegt.<br />
Befragter aus Verein 42:<br />
„Ich verstehe darunter, dass sie absolut gleichberechtigt sind in allen Belangen und dass sie in<br />
keiner Weise benachteiligt werden – Zugänge zu allen Wettkämpfen und zu allen Ämter haben,<br />
dass sie dieselben Chancen haben. (…)<br />
Bei der Frage nach der Frauenfreundlichkeit im eigenen Verein antwortet er zurückhaltend, kritisch<br />
mit ja: „Skala 1 bis 5 – nicht besonders, aber eigentlich schon, aber nicht außerordentlich. Bei uns<br />
ist die Gleichberechtigung gegeben, wir haben auch weibliche Trainer, und es wird niemand der<br />
Weg in den Vorstand abgeschlossen, nur weil man eine Frau ist.“ (s. Befragter aus Verein 42, Z.<br />
306-308)<br />
Befragte aus Verein 43:<br />
„Keine Diskriminierung durch frauenfeindliche Sprüche.“ Oder dass keine Rücksicht genommen<br />
würde beim gemischt geschlechtlichen Randori [Trainingskampf]. Frauenfreundlich nennt die<br />
Befragte, dass sie die Vorsitzende des Vereins sei und relativ viele Frauen als Trainer und<br />
Trainerhelfer vorhanden seien. [30,8 % weibliche Trainer/-helfer, 25,9 weibliche Mitglieder] (s.<br />
Befragte aus Verein 43, Z. 292-296)<br />
Befragter aus Verein 44:<br />
„Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Keine Ahnung, ich trainiere beide zusammen.“<br />
(s. Befragter aus Verein 44, Z. 294)<br />
Befragter aus Verein 45:<br />
„Was soll ich dazu sagen, dass weiss ich gar nicht. Wenn der Verein Rücksicht auf deren Belange<br />
nimmt.“ (s. Befragter aus Verein 45, Z. 305)<br />
Befragter aus Verein 46:<br />
„Bei uns sind Frauen zu 100 % berechtigt zu allem, was die Männer dürfen. Ich würde sogar<br />
sagen, wenn sie besser sind, werden sie auch noch besser behandelt.“ Bei der Anfrage, wie groß<br />
der Anteil der weibliche Mitglieder im Verein sind, wird geantwortet 1/3 zu 2/3 wie der Durchschnitt<br />
[in Wirklichkeit 24,4 %] (s. Befragter aus Verein 46, Z. 303)<br />
Befragter aus Verein 47:<br />
„Wir machen keine Unterschiede, außer einer eigenen Umkleide natürlich. Ansonsten machen wir<br />
alle gerne Judo miteinander. (…) Es steckt im Judo aufgrund seiner Philosophie eigentlich schon<br />
drin, dass man Rücksicht nimmt.“ Auf die Frage, was verstehen sie unter einem frauenfreundlichen<br />
<strong>Judoverein</strong>, antwortet er: „Gar nichts!“ (s. Befragter aus Verein 47, Z. 340 ff.)<br />
Befragter aus Verein 48:<br />
„Weiblichkeit mit gleichen Rechten, gleichberechtigt dem männlichen Geschlecht gegenüber. Dass<br />
man die Mädchen angemessen behandelt. Dass die Trainer keine sexistischen Aussagen machen<br />
und die Finger bei sich lassen. (…) [Mit dem Anteil an weiblichen Mitgliedern] liege ich eigentlich im<br />
Schnitt. [Durchschnitt etwa 31 % in diesem Verein 23,8 %] (s. Befragter aus Verein 48, Z. 350-356)<br />
Der Befragte aus Verein 49 konnte sich zu dem Thema aus zeitlichen Gründen nicht äüßern<br />
115
Befragter aus Verein 50:<br />
„Dass jedes Mädchen herzlich willkommen ist, wenn sie beim Judo andoggen will und sich für<br />
diese Sportart interessiert. Was bei uns ist dies der Fall. Jeder ist herzlich willkommen, egal wie<br />
dick, wie groß, wie schwer. [Was tut ihr dafür?] „Dass wir für keine besondere Brötchen backen, für<br />
die Männer nicht wie für die Frauen. Keiner wird bei irgendwelchen Sachen außen vor gelassen.“<br />
(s. Befragter aus Verein 50, Z. 319f.)<br />
Der Befragte aus Verein 51 konnte sich zu dem Thema aus zeitlichen Gründen nicht äußern<br />
Befragter aus Verein 52:<br />
„Dass man die Mädchen nicht nur gut behandelt, sondern auch, dass sie gerne am Training<br />
teilnehmen. Dass sie wie die Jungen auch glücklich sind. Und dass man diesen Unterschied nicht<br />
mehr merkt, dass also der Wettkampf etwas für Jungen und für Mädchen ist.“ (s. Befragter aus<br />
Verein 52)<br />
Befragter aus Verein 53:<br />
„Für mich ist das ein Verein, wo Mädchen und Frauen genau die gleiche Rolle im Verein spielen<br />
wie Jungen und Männer, d. h. in Organisation, in Verantwortung und in der Teilnahme am<br />
Vereinsleben. Leider Gottes ist es bei uns im Judo so, dass wir nicht so viele Frauen haben.<br />
Vielleicht weil Judo nicht diese Popularität bei Mädchen und Frauen hat wie im Männerbereich. Der<br />
Zweikampf ist immer noch die Männerdomäne, aber im Grunde bin ich darüber froh, dass wir zwar<br />
wenige, aber zwei-drei Frauen haben, die richtig aktiv sind und sich auch um die Mannschaft mit<br />
kümmern und das vorantreiben und auch andere jüngere Mädchen ansprechen und ich nicht als<br />
männlicher Trainer auf sie zugehen muss, sondern sie sich darum kümmern. Das finde ich sehr<br />
gut. Es kann nicht sein, dass ich als Trainer immer da stehe und den Leuten versuche irgendetwas<br />
zu erzählen, was sie machen sollen. Sondern das muss aus der Gruppe kommen (…) Da muss<br />
dann diese Vereinsgemeinschaft entstehen (…) und die Zugehörigkeit (…) deutlich werden. (…)<br />
Und ich denke, wir haben im Judo durch die Mannschaften immer noch gute Möglichkeiten, sie [die<br />
Mädchen] beim Judo zu halten, dass sie weiter mitmachen und den Verein unterstützen und<br />
Vorbilder sind für die kleineren Mädchen, die irgendwann auch mal in der Mannschaft kämpfen<br />
könnten. Wir haben ja eh so wenig Mädchen, und wenn wir denen nicht noch weitere Alternativen<br />
anbieten können und auch die Gemeinschaft des Vereins anbieten können, auch als<br />
Gruppengemeinschaft nur mit Frauen. Die Frauen dann sagen können, ich gehöre auch zur<br />
Mannschaft, dass ist ganz wichtig. Dies ist für die Vereins- und Judokarriere ganz entscheidend,<br />
und es ist auf jeden Fall zu fokussieren. Wobei es hierbei auch nicht wichtig ist, dass man eine<br />
Mannschaft aufbaut, die jetzt nicht unbedingt in der Regionalliga oder Bundesliga kämpft, sondern<br />
es geht um die Mannschaft, die irgendwo hinfährt, es braucht gar nicht so weit weg zu sein, aber<br />
eben dieser Teamgeist dann da ist.“ (s. Befragter aus Verein 53)<br />
Abgesehen von den Aussagen des Befragten aus Verein 53 wird deutlich, dass<br />
die Vertreter der Vereine 41 bis 53 keine genauen Vorstellungen davon haben, ob<br />
ihr Verein frauenfreundlich ist und warum. Sie haben zum Teil noch nicht einmal<br />
eine realistische Vorstellung von dem Frauenanteil in ihrem Verein. Darüber<br />
hinaus betonen viele von ihnen, dass sie sich gleichgeschlechtlich behandeln,<br />
d. h. sie behandeln die Mädchen/ Frauen so wie die Jungen/ Männer. Doch<br />
gerade dadurch gehen sie gerade nicht auf die besonderen Anforderungen von<br />
Mädchen/ Frauen ein. Dagegen nennen die Vertreter der Vereine 1 bis 13 meist<br />
recht konkrete Maßnahmen bzw Aspekte, die die Frauenfreundlichkeit ihres<br />
Vereins ausmachen.<br />
116
7 Folgerungen und Forderungen<br />
Was macht einen frauenfreundlichen <strong>Judoverein</strong> aus? Es sind keine großen<br />
Unterschiede, die die <strong>Judoverein</strong>en mit einem niedrigeren und einem höheren<br />
Judoanteil unterscheiden. Alle 24 untersuchten Vereine bieten gemischtgeschlechtliches<br />
Judotraining an. Spezielle Mädchen- bzw. Frauen-Gruppen sind<br />
kaum im Vereinsangebot; wöchentlich bietet ein Verein mit einem höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil eine Gruppe für weibliche Jugendliche und Frauen an<br />
und zwei Vereine mit einem niedrigeren weiblichen Mitgliederanteil bieten jeweils<br />
zwei Angebote für Minderjährige an.<br />
Die Auswertung der Mitgliederzahlen aller Vereine in NRW hat ergeben, dass 111<br />
Vereine Judo anbieten mit einem Anteil an weiblichen Mitgliedern von mindestens<br />
37 %. Davon sind 13 <strong>Judoverein</strong>e Teil der 50 größten <strong>Judoverein</strong>e in NRW. Damit<br />
hat ein Viertel der größten Vereine und ein Fünftel aller <strong>Judoverein</strong>e einen<br />
weiblichen Mitgliederanteil von mehr als 37 %. Dies sollte alle anderen Vereine<br />
ermutigen, ihren Verein hin zu mehr Frauen im Verein zu modifizieren. Oder<br />
zumindest sollten die Vereine überprüfen, ob sie wirklich frauenfreundlich sind<br />
oder dies werden möchten. Sich nur auf der Statistik auszuruhen und nur<br />
zufrieden mit dem Durchschnitt (31,5 %) zu sein, zeichnet dann eben auch nur<br />
einen durchschnittlichen Verein aus.<br />
Die Aussagen von Vereinsvertretern, es gäbe in der Großstadt viele andere<br />
Mädchen und frauengerechtere Freizeitangebote und daher kämen weniger<br />
Mädchen ist mit dieser Arbeit widerlegt. Außerdem ist bei 80 % der Befragten eine<br />
Kapazitätserweiterung möglich und damit ist nach meiner Auffassung ein Freiraum<br />
für weibliche potentielle Mitglieder vorhanden.<br />
Im Vergleich der 24 Vereine sind folgende Faktoren deutlich geworden, die zu<br />
einem höheren weiblichen Mitgliederanteil beitragen:<br />
75,3 % der Mitglieder in einen <strong>Judoverein</strong> sind Minderjährige. Der größte Teil ist<br />
unter 14 Jahre alt. Kinder können schwieriger als Erwachsene ihre individuellen<br />
Interessen, Wünsche und Bedürfnisse mitteilen. Die Verantwortung diese<br />
wahrzunehmen liegt bei den Trainern, da sie den größten Kontakt aus dem Verein<br />
117
mit den Kindern haben. Sie müssen entsprechend sensibel sein, um auch kritische<br />
Äußerungen und negative Emotionen zu steuern. Diese fehlende Sensibilität und<br />
die nötige Ausdrucksfähigkeit wurde in Verein 52 besonders deutlich, der nur<br />
einen weiblichen Mitgliederanteil von 21 % aufweist. Auch die Aussagen von<br />
Verein 9 machen besonders deutlich wie wichtig, das Vorhandensein von gut<br />
qualifizierten Trainern für den weiblichen Mitgliederanteil ist. Es ist nötig, dass der<br />
Trainer und die Gruppe zusammen passen. Das also für das entsprechende Alter<br />
auch der passen Trainertyp eingesetzt wird. Dabei ist es weniger wichtig, dass<br />
sich Trainerinnen um Mädchen und Frauen und Trainer um Jungen kümmern,<br />
sondern es gibt genauso Trainer, die den Umgang mit Mädchen leichter finden<br />
und Frauen den Umgang mit Jungen. Im Ganzen sollten etwa jeweils 50 %<br />
männliche und weibliche Trainer aktiv sein, was in vielen Vereinen mit einem<br />
höheren weiblichen Mitgliederanteil auch gegeben ist. Bei fast allen untersuchten<br />
Vereinen ist die Beteiligung der Mitglieder an Versammlungen gering (z. T. unter<br />
15 %). Dies könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass geschlechtertypischen<br />
Probleme selten angesprochen werden.<br />
Die Befragten aus den Vereinen mit einem höheren Mitgliederanteil, die den<br />
Verein und das Training prägen, äußern sich differenzierter und feinfühliger in der<br />
Wortwahl zum Umgang der Geschlechterthematik. Dem Gegenüber gibt es<br />
Befragte, die ihren weiblichen Mitgliederanteil deutlich höher einschätzen als er<br />
wirklich ist. Zum Teil wird sich zur Frage der Frauenfreundlichkeit so geäußert,<br />
dass man alle gleichberechtigt behandeln würde, indem man die Mädchen und<br />
Frauen genauso behandeln wie die Jungen und Männer. Womit sie im Endeffekt<br />
weniger auf die besonderen Bedürfnisse von Mädchen und eben eher auf die<br />
Bedürfnisse der Jungen eingehen.<br />
Zur Überprüfung der Vereinsqualität sollten Fluktuationswerte und Austritte sowie<br />
deren Gründe geschlechterspezifisch ausgewertet werden. Sowie das Training<br />
von außen beobachtet und reflektiert werden. Meiner Auffassung stellt bei<br />
unveränderter Vereinssituation eine höhere Fluktuation von weiblichen Mitgliedern<br />
ein Warnzeichen zur Trainingsqualität dar. Um rechtzeitig steuernd eingreifen zu<br />
können sollten Anwesenheitslisten regelmäßig auch geschlechterspezifisch ausgewertet<br />
werden.<br />
118
Als weiterer Punkt werden Gründe genannt, warum mehr Mädchen in manche<br />
Vereine kommen. Die Untersuchung hat ergeben, dass in manchen Orten bzw.<br />
Ortsteilen ein positiveres Image für Mädchen und Frauen zu herrschen scheint. In<br />
<strong>Bochum</strong> betreiben etwa 38 % Mädchen und Frauen in Vereinen Judo und in Bonn<br />
nur 24 %. Hierzu tragen Presseberichte über Judo mit weiblichen Mitgliedern bzw.<br />
Wettkämpferinnen einen entscheidenden Einfluss und damit stellen weibliche<br />
Judomannschaften auch einen wichtigen Werbeeffekt dar. Werbung über<br />
Aushänge, Flyer und Schnupperstunden in der Schule führen meistens nur dazu,<br />
dass mehr Jungen als Mädchen in den Verein kommen. Daher ist besonders beim<br />
Einsatz von Werbung (auch über die Homepage) darauf zu achten, dass diese<br />
optimal und zielgerichtet gestaltet ist. Wenn der Verein den Frauenanteil erhöhen<br />
möchte, sollten möglichst mehr Abbildungen von Mädchen und Frauen verwendet<br />
werden. Das Werben von Mitgliedern durch Mitgliedern spielt insbesondere, wenn<br />
man Frauen anwerben möchte die wichtigste Rolle. Das Mitbringen von weiblichen<br />
Mitgliedern sollte man am besten durch besondere Anreize noch weiter<br />
verstärken, z. B. mit einem kleinen Präsent. Einige Vereine mit einem höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil machten deutlich, dass Mädchen mehr Mädchen zum<br />
Training brachten, als Jungen Jungen werben.<br />
Außerdem machen einige Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil<br />
öffentlichkeitswirksam durch besondere Aktion wie Selbstverteidigungskurse auf<br />
sich aufmerksam. Diese nehmen zwar einen geringen Anteil im Trainingsbetrieb<br />
ein, aber durch die Werbung, dass in den Vereinen etwas Besonderes für<br />
Mädchen und Frauen angeboten wird, wird das Image des Vereins positiv im<br />
Hinblick auf Mädchen und Frauen geprägt. Um die Effizienz von Werbung zu<br />
ermitteln, ist zu empfehlen, dass die neuen Mitglieder befragt werden, wodurch sie<br />
auf den Verein aufmerksam geworden sind.<br />
Des Weiteren hat in der Vereinsphilosophie der Vereine mit einem höheren<br />
weiblichen Mitgliederanteil die Pflege der Gemeinschaft einen hohen Stellenwert.<br />
Dies zeichnet sich im Training, aber auch durch vielfältige sportliche und<br />
außersportliche Aktionen aus. Diese Vielfalt spricht anscheinend auch<br />
verschiedene Menschen und damit auch Mädchen und Frauen an. Vereine bei<br />
denen Wettkampfsport eine sehr wichtige Stelle im Verein einnimmt, haben<br />
119
hingegen einen geringeren weiblichen Mitgliederanteil. Am Beispiel des Vereins<br />
42 wurde dargestellt wie unterschiedlich aber die Atmosphäre betreffend<br />
Wettkampfjudo für Frauen ist. Stimmt die Atmosphäre und werden auch die<br />
Frauen gleichberechtigt leistungsbezogen trainiert, dann wächst auch der Anteil<br />
der weiblichen Mitglieder. Im Verein 42 und in der dortigen Öffentlichkeit scheint<br />
sich ein Wandel verzogen zu haben, denn der weibliche Mitgliederanteil hat sich<br />
von 26 % auf 33 % (Stand Januar 2009) erhöht.<br />
Zuletzt hat die Untersuchung ergeben, dass die Gruppengröße bei Vereinen mit<br />
einem höheren Anteil an weiblichen Mitgliedern größer ist. Es ist zu empfehlen,<br />
dass Gruppen möglichst im Durchschnitt mehr als 25 Teilnehmer umfassen.<br />
Dadurch stehen, was gerade am Anfang der Judolaufbahn wichtig ist, den<br />
Mädchen und Frauen auch entsprechende Partner zur Verfügung. Wenn die<br />
Mädchen und Frauen sich integriert fühlen, spielt das Geschlecht dann immer<br />
weniger eine Rolle.<br />
Das Motto „Judo für jeden“ kann nur erfüllt werden, wenn der Verein sich so<br />
ausrichtet, dass er insbesondere auf die Integration der weiblichen Mitglieder<br />
achtet.<br />
120
Anhang<br />
Anhang 1: Vereine mit höherem weiblichen Mitgliederanteil (I) .......................X<br />
Anhang 2: Vereine mit höherem weiblichen Mitgliederanteil (II) .....................XI<br />
Anhang 3: Vereine mit höherem weiblichen Mitgliederanteil (III) ...................XII<br />
Anhang 4: Fragebogen ..................................................................................XIII<br />
IX
Anhang 1: Vereine mit höherem weiblichen Mitgliederanteil (I)<br />
Vereine aus Kreisen bzw. BezirkenAnteil Gesamtanzahl Gesamtanzahl Gesamtanzahl Vereinsdes<br />
NWJVs mit einem höheren weiblicher weiblicher männlicher aktiver verhältnis<br />
weiblichen Mitgliederanteil (> 37%)Mitglieder Mitglieder Mitglieder Judokas im Kreis<br />
Bezirk Arnsberg<br />
Kreis Dortmund<br />
Pol. SV Dortmund 1922 45,0% 36 44 80<br />
1. JG Dortmund e.V 43,7% 55 71 126<br />
SC 1885 Huckarde- Rahm e.V. 50,9% 28 27 55<br />
1. JJJC Dortmund 37,0% 78 133 211 4 von 14<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,4% 464 970 1434 21,43%<br />
Kreis <strong>Bochum</strong>/ Ennepe<br />
Turnverein Gerthe 1911 e.V. 44,7% 34 42 76<br />
DSC Wanne-Eickel-Judo e.V. 47,8% 98 107 205<br />
Judoka Wattenscheid 39,1% 52 81 133<br />
TSG 1881 Sprockhövel 46,0% 23 27 50<br />
Budoka Höntrop e.V. 39,1% 68 106 174<br />
SV „Rot-Weiß“ 04 <strong>Bochum</strong>-Stiepel 41,8% 28 39 67 6 von 24<br />
Gesamtzahlen im Kreis 33,2% 921 1853 2774 25,00%<br />
Märkischer Kreis<br />
TuS Neuenrade 1862 1905 e.V. 43,9% 25 32 57<br />
Turnverein Attendorn e.V. 40,5% 30 44 74<br />
TuS Stöcken- Dahlerbeck e.V. 50,0% 10 10 20<br />
TSV Hagen 1860 e.V. 47,1% 132 148 280<br />
SSV Union Hagen 40,0% 4 6 10<br />
Budo Club Asahi Hagen 75,0% 3 1 4<br />
TUS Volmetal 1887 e.V. 48,0% 12 13 25 7 von 25<br />
Gesamtzahlen im Kreis 35,6% 579 1046 1625 28,00%<br />
Kreis Siegerland<br />
JV Siegerland 41,9% 49 68 117 1 von 6<br />
Gesamtzahlen im Kreis 27,7% 175 456 631 16,67%<br />
Kreis Ostwestfalen<br />
DJK SG Lippstadt- Benninghausen 52,4% 22 20 42<br />
TuS Jahn 1919 Berge 40,0% 18 27 45<br />
Börde Union e.V. 42,6% 20 27 47<br />
TuS Züschen 1931 54,3% 50 42 92<br />
SuS Schwarz- Weia Hallenberg 40,0% 10 15 25<br />
TuS Eintr. 1900 Heinrichstal 72,7% 16 6 22 6 von 25<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,3% 532 1114 1646 24%<br />
Kreis Unna-Hamm<br />
Tura Bergkamen 47,9% 23 25 48<br />
VfL 1854 Kamen 40,8% 20 29 49 2 von 22<br />
Gesamtzahlen im Kreis 29,8% 552 1302 1854 9,09%<br />
Bezirk Detmold<br />
Kreis Bielefeld<br />
VfB Fichte Bielefeld 37,2% 16 27 43<br />
TuS von 1908 Senne 1 37,5% 15 25 40<br />
Bielefeld TG von 1848 e.V. 37,7% 20 33 53 3 von 10<br />
Gesamtzahlen im Kreis 28,1% 237 606 843 30,00%<br />
Kreis Herford<br />
Tus Görn- Weia Dankersen Minden 55,0% 11 9 20 1 von 16<br />
Gesamtzahlen im Kreis 27,0% 301 815 1116 6,25%<br />
Kreis Gütersloh<br />
Turnverein Isselhorst e.V. 46,2% 43 50 93 1 von 9<br />
Gesamtzahlen im Kreis 27,6% 265 694 959 11,11%<br />
Kreis Paderborn<br />
SC Görn- Weis Espeln 1960 e.V. 46,7% 7 8 15<br />
ESV Warburg e.V. 38,4% 28 45 73<br />
Sportclub Görn- Weia Paderborn 55,6% 10 8 18<br />
Tus Westfalia Eiche 46,1% 47 55 102 4 von 18<br />
Gesamtzahlen im Kreis 31,7% 479 1034 1513 22,22%<br />
X
Anhang 2: Vereine mit höherem weiblichen Mitgliederanteil (II)<br />
Vereine aus Kreisen bzw. BezirkenAnteil Gesamtanzahl Gesamtanzahl Gesamtanzahl Vereinsdes<br />
NWJVs mit einem höheren weiblicher weiblicher männlicher aktiver verhältnis<br />
weiblichen Mitgliederanteil (> 37%)Mitglieder Mitglieder Mitglieder Judokas im Kreis<br />
Bezirk Düsseldorf<br />
Kreis Düsseldorf<br />
Turngemeinde Neuss von 1848 41,7% 70 98 168<br />
Garather Sportverein 1966 e.V. 44,6% 54 67 121<br />
TuS Neuss-Reuschenberg 1945 41,1% 23 33 56<br />
Allgem. Rather TV 77 90 Düsseldorf 40,0% 4 6 10<br />
TSV Norf e.V. 45,8% 27 32 59<br />
SC Bushido Düsseldorf 45,5% 20 24 44<br />
TuS Erkrath 1930 41,5% 17 24 41<br />
TV Rommerskirchen 1924 e.V. 41,6% 69 97 166<br />
Judolöwen 01 e.V. 48,5% 33 35 68 9 von 46<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,3% 1446 3034 4480 19,57%<br />
Kreis Essen<br />
JC DJK Essen- Frintrop 48,1% 39 42 81<br />
1. Essener Judo-Club e.V. 41,7% 45 63 108<br />
SG Essen- Schnebeck e.V. 40,9% 36 52 88<br />
Judoclub Altenessen e.V. 45,3% 39 47 86<br />
SC Buschhausen 1912 e.V. 45,2% 19 23 42<br />
Kettwiger TV 1870 e.V. 44,3% 27 34 61 6 von 22<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,7% 647 1332 1979 27,27%<br />
Kreis Duisburg<br />
Dümptener Turnverein 1885 e.V. 44,1% 15 19 34<br />
TV Germania 02 Duisburg e.V. 40,0% 8 12 20<br />
TVE Mülheim Ruhr e.V. 43,2% 16 21 37<br />
Judo-Sportfreunde Hamborn 07 41,9% 18 25 43 4 von 14<br />
Gesamtzahlen im Kreis 30,2% 330 761 1091 28,57%<br />
Kreis Krefeld<br />
SG Judoteam Mönchengladbach 44,1% 45 57 102<br />
Budo- Club Kamp-Lintfort e.V. 40,8% 64 93 157<br />
M. Gladbach Turnverein 1848 40,7% 11 16 27<br />
Allg. SV Einigkeit Schüteln 50,7% 38 37 75<br />
Sportgemeinschaft Dülken e.V. 43,8% 32 41 73 5 von 23<br />
Gesamtzahlen im Kreis 31,1% 725 1609 2334 21,74%<br />
Kreis Wuppertal<br />
Judoclub Wuppertal e.V. 41,3% 33 47 80<br />
Lüttringhauser Turnverein e.V 43,3% 39 51 90<br />
TV Einigkeit Dornap 1900 43,2% 41 54 95<br />
Sportclub Kodoka Wuppertal 41,7% 10 14 24<br />
TSV 1899 Wuppertal e.V. 60,0% 12 8 20<br />
Nevigser TV 1862 Velbert 40,0% 18 27 45<br />
SV Frisch Auf 60,0% 24 16 40<br />
SC 1885 Huckarde- Rahm e.V. 65,5% 19 10 29 8 von 36<br />
Gesamtzahlen im Kreis 30,0% 809 1886 2695 22,22%<br />
Kreis Kleve<br />
1. Budokan Hünxe e.V. 43,6% 17 22 39<br />
KG Bushido Niederrhein e.V. 40,9% 9 13 22<br />
Turnverein Jahn Vrasselt e.V. 41,1% 39 56 95<br />
Kevelaerer SV 1890 1920e.V. 48,3% 29 31 60<br />
Sportverein 19 Straelen e.V. 67,9% 19 9 28<br />
Budo-Kwai Emmerich e.V. 50,7% 70 68 138<br />
SV 1946 Arminia Kapellen- Hamb 46,2% 18 21 39 7 von 23<br />
Gesamtzahlen im Kreis 36,1% 627 1109 1736 30,43%<br />
XI
Anhang 3: Vereine mit höherem weiblichen Mitgliederanteil (III)<br />
Vereine aus Kreisen bzw. BezirkenAnteil Gesamtanzahl Gesamtanzahl Gesamtanzahl Vereinsdes<br />
NWJVs mit einem höheren weiblicher weiblicher männlicher aktiver verhältnis<br />
weiblichen Mitgliederanteil (> 37%)Mitglieder Mitglieder Mitglieder Judokas im Kreis<br />
Bezirk Köln<br />
Kreis Köln<br />
JC Köln Süd Bushido e.V 37,7% 80 132 212<br />
Judo-Club Ford-Köln e.V. 39,3% 81 125 206<br />
Freizeit-Club Schwadorf 1973 47,4% 18 20 38<br />
JC Achilles Köln- Süd 1934 56,7% 17 13 30<br />
JC Jygoro- Kano Berrenrath 50,0% 26 26 52<br />
JJJC Yamanashi e.V. 45,1% 60 73 133<br />
Judo-Verein Köln-Niehl e.V 38,1% 16 26 42<br />
Turn- und Spielverein Rondorf 40,6% 13 19 32 8 von 52<br />
Gesamtzahlen im Kreis 30,7% 1435 3233 4668 15,38%<br />
Kreis Bonn<br />
Budo- Zentrum Meckenheim e.V. 46,8% 22 25 47<br />
SSF Bonn 05 e.V. 45,8% 49 58 107<br />
TSV Bonn 1897 07 37,8% 37 61 98<br />
Turn- Sport- Tennis- Verein Merl 39,6% 19 29 48 4 von 31<br />
Gesamtzahlen im Kreis 27,0% 971 2621 3592 12,90%<br />
Kreis Bergisch Land<br />
Budokan Yanagi e.V. 45,1% 23 28 51<br />
Judoclub Reichshof 02 e.V 40,0% 22 33 55<br />
FC Germania Dattenfeld 37,1% 26 44 70 3 von 29<br />
Gesamtzahlen im Kreis 26,3% 478 1339 1817 10,34%<br />
Kreis Aachen<br />
Kaller Sportclub 1922 e.V. 52,0% 13 12 25<br />
Jülicher Judo-Club e.V. 37,7% 90 149 239<br />
JJC Lammersdorf e.V 37,2% 48 81 129<br />
Turnverein Germania Mannheim 42,4% 25 34 59<br />
Judo Sport Erkelenz e.V. 37,8% 34 56 90<br />
Judoclub Asahi Stolberg e.V. 52,7% 29 26 55<br />
Turnverein Kalterherberg e.V. 40,3% 27 40 67<br />
Judo-Club Haaren e.V. 38,8% 107 169 276 8 von 34<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,0% 1090 2312 3402 23,53%<br />
Bezirk Münster<br />
Kreis Warendorf Münster<br />
FSV und Frauensport Münster 100,0% 12 0 12<br />
SG Sendenhorst 1910 41,4% 24 34 58 2 von 24<br />
Gesamtzahlen im Kreis 26,5% 448 1242 1690 8,33%<br />
Kreis Recklinghausen<br />
SV Horst- Emscher 38,8% 31 49 80<br />
SSV Marl- Hamm 1968 e.V. 47,1% 8 9 17<br />
Erler Sportgemeinschaft 52,8% 19 17 36<br />
1. JC TV Einigkeit Waltrop 38,8% 33 52 85<br />
Judo- und Budo- Club 70 Marl 41,2% 35 50 85<br />
Pol. SV Gelsenkirchen 39,4% 37 57 94<br />
<strong>Judoverein</strong> Hohe Mark 81 e.V. 43,1% 47 62 109<br />
DJK Germania Gladbeck e.V. 54,0% 27 23 50 8 von 25<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,4% 931 1939 2870 32,00%<br />
Kreis Steinfurt<br />
TV Mesum 1950 e.V. 43,0% 65 86 151 1 von 17<br />
Gesamtzahlen im Kreis 25,4% 384 1125 1509 5,88%<br />
Kreis Coesfeld<br />
DJK Sportfreunde Dülmen 37,7% 80 132 212<br />
Sportclub Budokan Bocholt 43,9% 25 32 57<br />
Judo-Club Velen-Reken 45,9% 119 140 259 3 von 18<br />
Gesamtzahlen im Kreis 32,1% 522 1102 1624 16,67%<br />
Summe aller Vereine mit einem höheren weiblichen Mitgliederanteil von 37% 2008 = 111 von 564<br />
XII
Anhang 4: Fragebogen (eigene Ausarbeitung unter Berücksichtigung von Emrich,<br />
Pitsch, 2001; Anhang S. 1 ff. sowie Heinemann, 1994, S. 435 ff.)<br />
1) Wann wurde Ihr <strong>Judoverein</strong> bzw. Ihre Judoabteilung gegründet? _______<br />
2) Wie viele Abteilungen (mit eigener Judoabteilungs) gibt es in Ihrem Verein?<br />
__ Abteilungen<br />
__ <strong>Judoverein</strong><br />
3) Wie viele Einwohner hat die Gemeinde/ Stadt, in der Ihr <strong>Judoverein</strong>/-<br />
abteilung ansässig ist? (Bitte auch bei Orteilen bzw. eingemeindeten Vororten die<br />
Einwohnerzahl der ganzen Stadt angeben!)<br />
__ unter 20.000 Einwohner __ bis 50.000 Einwohner __ bis 100.000 Einwohner<br />
__ bis 250.000 Einwohner __ bis 500.000 Einwohner __ über 500.000 Einwohner<br />
4) Wie viele Sportvereine befinden sich in Ihrem Ort? (Falls nötig bitte schätzen.)<br />
__ 1-5 __ 6-10 __ 11-20 __ 21-50 __ über 50<br />
5) Wie viele <strong>Judoverein</strong>e/-abteilungen befinden sich in Ihrem Ort?<br />
__ 0 Vereine __ 1-2 Vereine __ 3-5 Vereine __ 6-10 Vereine __ mehr als 10<br />
6) Wie ist die Altersverteilung der aktiven Judokas in Ihrem Verein?<br />
(nur „Aktive Mitglieder Judo“ der Stärkemeldung 2008 eintragen)<br />
männlich<br />
_____<br />
weiblich<br />
Kinder bis 6 Jahre _____ _____<br />
Kinder 7 - 14 Jahre _____ _____<br />
Jugendliche 15 - 18 Jahre _____ _____<br />
Erwachsene 19 - 26 Jahre _____ _____<br />
Erwachsene 27 - 40 Jahre _____ _____<br />
Erwachsene 41 - 60 Jahre _____ _____<br />
Senioren über 60 Jahre _____ _____<br />
XIII
7) Wie viele Mitglieder sind im letzten Jahr (2007) (gegebenenfalls geschätzt)<br />
18) in Ihren <strong>Judoverein</strong>/-abteilung eingetreten?<br />
___(männlich)/____(weiblich)<br />
19) aus Ihrem <strong>Judoverein</strong>/-abteilung ausgetreten?<br />
____(männlich)/____(weiblich)<br />
8) Kreuzen Sie bitte an, bei welchen Personengruppen die Zahl der<br />
Mitglieder in Ihrem Verein in den letzten drei Jahren deutlich zugenommen<br />
oder abgenommen hat.<br />
viele<br />
viele<br />
Anmeldungen Abmeldungen<br />
(m. / w.)<br />
(m. / w.)<br />
Kinder bis 6 Jahre ___/___ ___/___<br />
Kinder 7 - 10 Jahre ___/___ ___/___<br />
Kinder 11 – 14 Jahre ___/___ ___/___<br />
Jugendliche 15 - 18 Jahre ___/___ ___/___<br />
Erwachsene 19 - 26 Jahre ___/___ ___/___<br />
Erwachsene 27 - 40 Jahre ___/___ ___/___<br />
Erwachsene 41 - 60 Jahre ___/___ ___/___<br />
Senioren über 60 Jahre ___/___ ___/___<br />
9) Ist Ihr <strong>Judoverein</strong>/-abteilung in der Lage, noch weitere Mitglieder<br />
aufzunehmen?<br />
__ nein __ ja __ mit Warteliste<br />
Falls ja: ____ (Anzahl der möglichen weiteren zusätzlich aufnehmbaren Judokas)<br />
10) Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent Ihrer Judokas (m./ w.) in Ihrem Verein<br />
regelmäßig, d. h. mindestens einmal pro Woche, Judo betreiben.<br />
(Die Frage zielt auch auf folgendes: Sind Mädchen oder Jungen regelmäßiger beim Training?)<br />
Minderjährige:<br />
_/_ 90%<br />
Erwachsene:<br />
_/_ 90%<br />
XIV
11) Schätzen Sie bitte, wie viel Prozent Ihrer Judokas (m. / w.) in Ihrem<br />
Verein regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen, d. h. an mindestens 70<br />
Prozent der angebotenen Wettkämpfe mitmachen. (Achtung: Auch wenn nur 10 %<br />
der Judokas Mädchen wären, muss über 90% angekreuzt werden, wenn diese Mädchen alle<br />
Kämpfen gehen.)<br />
Minderjährige:<br />
_/_ 90%<br />
Erwachsene:<br />
_/_ 90%<br />
12) Haben bei Ihnen Eltern von minderjährigen Vereinsmitgliedern ein<br />
Stimmrecht bei Versammlungen?<br />
___ nein ___ nein, aber ___ (z. B. günstige Familienmitgliedschaft) ___ ja<br />
13) Wie viel Prozent Ihrer Judokas bzw. deren Eltern (m. / w.)besuchen im<br />
Schnitt die Vereinsversammlungen bzw. Abteilungsversammlungen?<br />
(Achtung: Bei gleich vielen Männer wie Frauen auf der Versammlung, darf nur die gleiche<br />
Prozentstufe angekreuzt werden, wenn der Verein insgesamt aus gleich vielen männlichen wie<br />
weiblichen Mitgliedern bestünde.)<br />
Judokas:<br />
_/_90%<br />
Eltern:<br />
_/_ 90%<br />
14) Werden in der Versammlung geschlechterspezifische Interessen<br />
angesprochen?<br />
___ nein ___ ja und zwar: ________________<br />
15) Wie werden bei Ihnen neue Mitglieder gewonnen? (Bitte gewichten.)<br />
__Mitglieder werben Mitglieder __Judo AG __besondere Schulprojekte/-aktionen<br />
__Tag der offenen Tür des Vereins __Aushänge/ Werbeflyer in Geschäften<br />
__Aktionen auf Stadtteilfesten o. ä. __Homepage __Presseberichte _______ (sonstiges)<br />
XV
16) Gibt es bei Ihnen spezielle Anfängergruppen?<br />
___ nein ___ ja und zwar: ________________<br />
17) Mit welchen Themen sind Sie in der Zeitung präsent? (Bitte gewichten)<br />
___Wettkampferfolge ___Gürtelprüfungen ___Vereinsaktivitäten<br />
___Werbung<br />
___Vorstellung von besonderen Mitgliedern<br />
________________________sonstiges<br />
18) Werden Vereinsartikel geschlechterneutral abgedruckt? (Überschriften,<br />
Fotos u. ä.)<br />
___nein ___ja ___ keine Angabe<br />
19) Machen Sie spezielle Werbung für Mädchen und Frauen?<br />
___ nein ___ ja und zwar: ________________<br />
20) Haben Sie Programme/ Aktionen/ Projekte zur Mädchen-/<br />
Frauenförderung?<br />
___ nein ___ ja und zwar: ________________<br />
21) Wer wirb mehr neue Mitglieder – Mädchen/Frauen oder Jungen/Männer?<br />
___Jungen/Männer ___Mädchen/Frauen ___beide gleich ___keine Angabe<br />
22) Gibt es ein spezielles Alter mit dem ein Judoka (m. / w.) Bekannte für den<br />
Verein wirbt?<br />
__/__bis 6 Jahre __/__7-10 Jahre __/__11-14 Jahre __/__15-18 Jahre<br />
__/__über 18 Jahre<br />
XVI
23) Was ist bei Ihnen das wichtigste Trainings- und Vereinsziel?<br />
(Mehrfachantworten möglich (max. 2) – bitte mit Nummerierung nach Gewichtung)<br />
__Bewegung __Wettkampf __Gemeinschaft __Gürtelprüfung<br />
__hohe Mitgliederstärke<br />
__Judomannschaften<br />
__Wettkampf auf hohem Niveau __sonstiges: ___________________<br />
24) Wie ist das Betreuungsverhältnis Trainer/-Trainerhelfer zu<br />
Judoka/Teilnehmer beim Training?<br />
_bis 1 zu 5 _bis 1 zu 7 _bis 1 zu10 _bis 1 zu 14 _bis 1 zu 19 __> 1 zu 19<br />
25) Gesamtgruppengröße in der Halle:<br />
__ 1-10 __ 11-15 __ 16-20 __ 21-25 __ 26-30 __31-35 __ 36-40 __ über 40<br />
26) Training in Untergruppen: __ja __nein<br />
27) Anzahl Untergruppen: ____<br />
28) Trennwände: __ja __nein<br />
29) Gibt es neben den Haupt-Judo-Trainingstagen spezielle, wöchentliche<br />
Angebote?<br />
__ Gürtelprüfungstraining __ gesondertes Wettkampftraining<br />
__ Fitnesstraining __Krafttraining __Lauftraining<br />
__besonderes Konzept: ____________________________________________<br />
XVII
30) Bietet Ihr <strong>Judoverein</strong>/-abteilung Sportangebote für bestimmt Zielgruppen<br />
an?<br />
__ für Mutter/Vater/Eltern und Kind<br />
__ reine Frauen-/Mädchenangebote<br />
__ Judo spielend lernen (DJB Programm) __ reine Männer-/Jungenangebote<br />
__ für Erwachsene Quereinsteiger<br />
__ spezielle Angebote für Übergewichtige<br />
__ Prävention/ Gesundheitssport<br />
__ Behinderte<br />
__ Rehabilitation<br />
__ nein, kein derartiges Angebot<br />
__ besondere _______________________<br />
31) Gibt es in Ihrem <strong>Judoverein</strong>/-abteilung zeitlich begrenzte Kursangebote<br />
gegen gesonderte Bezahlung (Anfängerkurse, Selbstverteidigung usw.)?<br />
___ nein ___ ja und zwar: ________________<br />
32) Bestehen in Ihrem <strong>Judoverein</strong>/-abteilung zusätzliche unregelmäßige<br />
Sportangebote? (Bitte die Anzahl pro Jahr eintragen)<br />
Gürtelprüfungstraining (unregelmäßig) ____<br />
Vereinsmeisterschaft<br />
____<br />
Wettkämpfe<br />
____<br />
Judosafari<br />
____<br />
Judosportabzeichen<br />
____<br />
Lehrgänge<br />
____<br />
Laufen, Walken, Volkslauf<br />
____<br />
Schwimmen, Klettern<br />
____<br />
Fußballturnier<br />
____<br />
Sportfeste<br />
____<br />
Allgemeines Sportabzeichen ____<br />
Sonstige Angebote: _____________ ____<br />
Keine entsprechenden Angebote ____<br />
XVIII
33) Welche der folgenden außersportlichen Angebote gibt es in Ihrem Verein<br />
regelmäßig: (Bitte jeweils die entsprechende Anzahl der Angebote notieren)<br />
Feiern zu besonderen Anlässen (Fasching, Weihnachten; Mannschaftsfeier u. ä.)<br />
Gesellige Angebote (Treffs, Disco, Tanz, Grillfeiern u. ä.)<br />
Tagesausflüge (Freizeitpark, Zoobesuch)<br />
Sommerfest, Tagesausflug, Safari<br />
Hallenübernachtung, Freizeiten, Reisen, Urlaub u. ä.<br />
Spieltreffs, Spielfest<br />
Hobbyaktivitäten (Musizieren, Basteln, Theater u. ä.)<br />
Sonstige Angebote, und zwar: _________________________________________<br />
Keine entsprechenden Angebote<br />
____<br />
____<br />
____<br />
____<br />
____<br />
____<br />
____<br />
____<br />
____<br />
34) In welchem Bereich liegt Mitgliedsbeitragshöhe in Ihrem <strong>Judoverein</strong>/-<br />
abteilung?(für die 1.Person einer Familie)<br />
___unter € 10 ___zwischen € 10-15 ___zwischen € 15-20 ___über € 20<br />
Aufnahmegebühr: __-fache des Monatsbeitrags __ keine Aufnahmegebühr<br />
35) Wie oft können Interessierte bei Ihnen Probetraining machen? ________<br />
36) Wie viele Turniere/ Wettkämpfe werden von Ihnen im Jahr ausgerichtet?<br />
______________________<br />
37) Wie ist das Niveau der Judokas bei Einzelwettkämpfen?<br />
______________________<br />
38) Falls Sie Judomannschaften habe, in was für Ligen kämpfen diese?<br />
______________________<br />
XIX
39) Gibt es in Ihrem Verein Wettkämpfer, die vom Verein oder von<br />
Sponsoren Prämien fürs Wettkämpfen erhalten?<br />
Einzelwettkämpfe: ___ nein ___ ja -><br />
Anzahl: Männer ___ / Frauen ___<br />
Antrittsprämie: __ (M)/__(F)<br />
Siegprämie: __ (M)/__(F)<br />
Mannschaftswettkämpfe: ___ nein ___ ja -><br />
Anzahl: Männer ___ / Frauen ___<br />
Antrittsprämie __ (M)/__(F)<br />
Siegprämie: __ (M)/__(F)<br />
40) Gibt es bei Ihnen die gleiche Prämienhöhe bei gleicher Wettkampfebene<br />
bei Männern und Frauen?<br />
___ ja<br />
___ nein, die Männer erhalten mehr<br />
___ nein, die Frauen erhalten mehr ___ keine Angaben möglich<br />
41) Wie viele der folgenden Einrichtungen und Anlagen werden von Ihrem<br />
Verein genutzt?<br />
Art der Anlage vereinseigen: ja/nein (Tragen Sie bitte die jeweilige Anzahl ein!)<br />
Turnhalle/ Sporthalle __/__<br />
Dojo __/__ Kraftraum __/__<br />
Vereinsheim/ Vereinsgaststätte __/__ Weitere Anlagenart:___________ __/__<br />
42) Bewerten Sie bitte die Qualität der Sportstätten nach Verfügbarkeit,<br />
Zustand, Größe und Freizeitsporteignung, indem Sie unter 1 für „sehr gut“,<br />
unter 2 für „gut, unter 3 für „befriedigend“ oder unter 4 für „schlecht“<br />
ankreuzen.<br />
XX
aulicher Ausstattung/ Verfüg-<br />
Zustand Größe barkeit<br />
Art der Anlage 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4<br />
Turnhalle/ Sporthalle __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __<br />
Dojo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __<br />
Kraftraum __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __<br />
Vereinsheim/ -gaststätte __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __<br />
Weiteres: ____________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __<br />
43) Nehmen Jungen/Männer oder Mädchen/Frauen auch eine längere<br />
Anreise in Kauf?<br />
__ ja Jungen/ Männer __ ja Mädchen/ Frauen __ nein __ keine Angabe<br />
44) Im Folgenden möchte ich Sie um einige Angaben zu der Zahl und Art der<br />
ehrenamtlichen Mitarbeiter in Ihrem <strong>Judoverein</strong>/-abteilung bitten (unter<br />
Ehrenamtlichen werden hier auch Mitarbeiter verstanden, die ihren Aufwand im Rahmen der<br />
Übungsleiter-Pauschale mit bis zu € 2100,- jährlich vom Verein entschädigt bekommen).<br />
Tragen Sie in der folgenden Tabelle bitte ein wie viele Personen in den<br />
aufgeführten Bereichen bzw. Positionen in Ihrem Verein tätig sind, und wie<br />
viele Stunden im Monat durchschnittlich eine Person in diesem Bereich/<br />
diesem Amt/ dieser Funktion tätig ist. (ggf. schätzen)<br />
Anzahl der ehrenamtlich tätigen Personen (m. / w. )insgesamt: ___ / ___<br />
(Kennzeichnen Sie bitte mit einem Strich, wenn ein Amt bzw. Aufgabenbereich in Ihrem Verein<br />
nicht existiert! Hat eine Person mehrere Ämter, tragen Sie diese bitte auch mehrfach ein!)<br />
Ehrenamtliche Mitarbeiter… Anzahl der Mitarbeiter geschätzte durchschnittmännlich<br />
weiblich liche Arbeitsstunden<br />
einer Person pro<br />
Monat<br />
Vorstandsvorsitzender ______ ______ ______<br />
Stellvertretender Vorsitzender ______ ______ ______<br />
Geschäftsführer (unentgeltlich) ______ ______ ______<br />
Schriftführer ______ ______ ______<br />
Kassenwart/Schatzmeister ______ ______ ______<br />
Pressewart ______ ______ ______<br />
XXI
Weitere Vorstandsmitglieder ______ ______ ______<br />
Hauptvorstand(falls Judoabteilung) ______ ______ ______<br />
Jugendleiter ______ ______ ______<br />
Jugendvorstand ______ ______ ______<br />
Jugendsprecher (Minderjährige) ______ ______ ______<br />
Kampfrichter/Listenführer ______ ______ ______<br />
Kyu-Prüfer ______ ______ ______<br />
Unentgeltlich tätige Trainer und ÜL<br />
(inkl. Entschädigungen bis € 2100) ______ ______ ______<br />
Sportassistenten: ______ ______ ______<br />
Mitglieder in Ausschüsse, Gremien u. ä. ______ ______ ______<br />
45) Sind die Mitglieder zur regelmäßigen, unentgeltlichen Mithilfe<br />
verpflichtet?<br />
___ nein ___ ja, durch _________________ (Vereinssatzung, Beschluss o. ä.)<br />
46) Als nächstes möchte ich Sie um einige Angaben zu der Zahl und Art der<br />
bezahlten Mitarbeiter in Ihrem Verein bitten. Wie viele Personen sind in den<br />
folgenden Bereichen als Angestellte (Voll- oder Teilzeit), Honorarkraft oder<br />
Aushilfskraft in Ihrem Verein tätig?<br />
(Hat ein Mitarbeiter mehre Tätigkeiten, tragen Sie ihn bitte auch mehrfach ein!)<br />
Tätigkeitsbereich angestellt als Anzahl Männer/Frauen<br />
Geschäftsführer ______________________ ____/____<br />
Bereich Verwaltung/Organisation ______________________ ____/____<br />
Mitarbeiter im Bereich: ______________________ ____/____<br />
Training-/Betreuung-/Übungs-<br />
Betrieb von Personen und<br />
Mannschaften ______________________ ____/____<br />
Sonstige bezahlte Mitarbeiter ______________________ ____/____<br />
47) Bitte beurteilen Sie, inwieweit folgende Aussagen auf Ihren Verein<br />
zutreffen:<br />
XXII
Unser Verein … trifft trifft<br />
voll zu nicht zu<br />
4 3 2 1<br />
• besitz ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl seiner Mitglieder ___ ___ ___ ___<br />
• ist bestrebt, mit möglichst vielen Judokas am regelmäßigen<br />
Wettkampfbetrieb teilzunehmen ___ ___ ___ ___<br />
• ist bestrebt, mit möglichst vielen Mannschaften<br />
am regelmäßigem Wettkampfbetrieb teilzunehmen ___ ___ ___ ___<br />
• kann den Wettkampfsport kaum noch finanzieren ___ ___ ___ ___<br />
• sieht Judo besonders als Wettkampfsportart ___ ___ ___ ___<br />
• strebt keine steigenden Mitgliederzahlen an ___ ___ ___ ___<br />
• hat sich in den letzten Jahren kaum verändert ___ ___ ___ ___<br />
• wird künftig vermehrt neue Formen von<br />
Bewegung und Spiel anbieten bzw. tut dies heute ___ ___ ___ ___<br />
• legt viel Wert auf Geselligkeit und Gemeinschaft ___ ___ ___ ___<br />
• sollte schon aus Prinzip auf den Einsatz<br />
bezahlter Mitarbeiter verzichten ___ ___ ___ ___<br />
• betrachtet die Sportprogramme kommerzieller<br />
Anbieter als Herausforderung ___ ___ ___ ___<br />
• hat immer mehr Mitglieder, die nur Sport konsumieren wollen ___ ___ ___ ___<br />
• will bleiben, wie er heute ist ___ ___ ___ ___<br />
• ähnelt immer mehr einem Dienstleistungsbetrieb in Sachen Sport ___ ___ ___ ___<br />
• ist stolz auf seine Erfolge im Leistungssport ___ ___ ___ ___<br />
• versucht mit zusätzlichen Freizeitangeboten neue Mitglieder<br />
zu gewinnen ___ ___ ___ ___<br />
• lebt in erster Linie von der Mitarbeitsbereitschaft seiner Mitglieder ___ ___ ___ ___<br />
• misst der ehrenamtlichen Mitarbeit als Möglichkeit,<br />
persönliche Anerkennung zu finden, große Bedeutung bei ___ ___ ___ ___<br />
• legt viel Wert auf Pflege von Tradition ___ ___ ___ ___<br />
• hat sich immer mehr für alle Bevölkerungsgruppen geöffnet ___ ___ ___ ___<br />
• versteht sich vor allem als Freizeit- und Breitensportverein ___ ___ ___ ___<br />
• kann nur mit hauptamtlichen Mitarbeitern zeitgemäß sein ___ ___ ___ ___<br />
• schätz am Ehrenamt insbesondere die Möglichkeit,<br />
demokratische Spielregeln einzuüben ___ ___ ___ ___<br />
• betrachtet die Zukunft als Herausforderung ___ ___ ___ ___<br />
XXIII
48) Beurteilen Sie bitte, wie wichtig die Lösung folgender Aufgaben für Ihren<br />
Verein in nächster Zeit ist.<br />
Wie wichtig ist uns vor allem<br />
sehr wichtig völlig unwichtig<br />
4 3 2 1<br />
• den Mitgliederstand zu halten __ __ __ __<br />
• die Fluktuation zu verringern __ __ __ __<br />
• neue Mitglieder zu gewinnen __ __ __ __<br />
• mehr Mädchen und Frauen als<br />
• Mitglieder zu gewinnen __ __ __ __<br />
• die Zusammenarbeit der ehrenamtlichen<br />
Mitarbeiter zu verbessern __ __ __ __<br />
• Mitglieder für ehrenamtliche<br />
Aufgaben zu gewinnen __ __ __ __<br />
• mehr gesellige Veranstaltungen anzubieten __ __ __ __<br />
• Kooperation mit anderen Vereinen zu verbessern __ __ __ __<br />
• die Qualifikation der ehrenamtlichen<br />
Mitarbeiter zu verbessern __ __ __ __<br />
• hauptamtliche Mitarbeiter einzustellen __ __ __ __<br />
• die räumlichen und gerätemäßigen<br />
Ausstattungen zu verbessern __ __ __ __<br />
• allen finanziellen Anforderungen gerecht zu werden __ __ __ __<br />
• Schulden zu tilgen __ __ __ __<br />
• höhere Einnahmen zu erzielen __ __ __ __<br />
• höhere Mitgliedsbeiträge durchzusetzen __ __ __ __<br />
• mehr Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit zu erzielen __ __ __ __<br />
• unsere Attraktivität zu erhöhen __ __ __ __<br />
• das bestehende Sportangebot auszuweiten __ __ __ __<br />
• neue Sportangebote aufzunehmen __ __ __ __<br />
• die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen __ __ __ __<br />
• Leistungssportler an den Verein zu binden __ __ __ __<br />
• den Klassenerhalt zu sichern __ __ __ __<br />
• Ärger mit Wohnanliegern zu vermeiden __ __ __ __<br />
XXIV
49) Mit welchem Geschlecht ist Ihrer Meinung der Umgang einfacher?<br />
Beim Training: __Jungen/Männer __Mädchen/Frauen __kein Unterschied<br />
Beim Wettkampf: __Jungen/Männer __Mädchen/Frauen __kein Unterschied<br />
50) Wo sehen Sie Unterschiede im Bezug zum Verhalten als Trainer<br />
zwischen den weiblichen und dem männlichen Judokas? Auf was muss man<br />
als Trainer besonders achten?<br />
_________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________<br />
51) Wie stehen Sie zu der neu geschaffenen Möglichkeit, dass auf Turnieren<br />
und Liga-Kämpfen der U11 auch Mädchen gegen Jungen kämpfen dürfen?<br />
Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt?<br />
_________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________<br />
52) Was verstehen Sie unter einem mädchen- und frauenfreundlichen<br />
<strong>Judoverein</strong>?<br />
_________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________<br />
53) Würden Sie Ihren <strong>Judoverein</strong>/-abteilung als frauenfreundlich<br />
bezeichnen?<br />
___ nein ___ ja<br />
Begründung: ______________________________________________________<br />
_________________________________________________________________<br />
XXV
54) Wer sind die drei engagiertesten Mitarbeiter in Ihrem <strong>Judoverein</strong>/-<br />
abteilung im Bereich der Jugendförderung?<br />
(Mit diesen Personen würde ich gerne ein Interview führen. Bitte nennen sie mir auch jeweils<br />
Kontaktdaten, wie Telefon oder e-Mail-Adresse)<br />
• ____________________<br />
• ____________________<br />
• ____________________<br />
55) Zum Schluss möchte ich Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person<br />
bitten:<br />
• Welches Amt bzw. welche Funktion üben Sie in Ihrem Verein aus?<br />
(Falls Sie mehrere Funktionen haben, geben Sie bitte die wichtigste an!)<br />
__________________________________<br />
• Wie lange üben Sie dieses Amt bereits aus?<br />
__________________________________<br />
• Wie lange sind Sie schon Mitglied dieses Vereins?<br />
Seit ___ Jahren<br />
• Geschlecht:<br />
___ männlich ___ weiblich<br />
• Alter _____ Jahre<br />
56) An dieser Stelle können Sie Kritik und Anregungen zum Fragebogen<br />
anbringen, auf Ihre Ansicht noch zentrale Probleme Ihres Vereins oder des<br />
Vereinssport allgemein hinweisen.<br />
_________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________<br />
XXVI
Literaturverzeichnis<br />
Anders, Georg. Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.). (1996). Frauen im<br />
Leistungssport. Köln: Sportverlag Strauß.<br />
Anders, Georg, Braun-Lauf, Elisabeth. Bundesinstitut für Sportwissenschaft<br />
(Hrsg.). (2001). Grenzen für Mädchen und Frauen im Sport. Köln:<br />
Sportverlag Strauß.<br />
Brockhaus (Hrsg.). (1996). Die Enzyplopädie. Deutsches Wörterbuch (20.<br />
überarbeitete Aufl.). Mannheim: Brockhaus.<br />
Burrmann, Ulrike. Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.).(2007). Zum<br />
Sportverständnis von Jugendlichen. Was erfassen schriftliche<br />
Jugendsporterhebungen. Köln: Sportverlag Strauß.<br />
Cachay,Klaus & Digel, Helmut, Thiel, Ansgar. (2006) Hauptberuflichkeit im<br />
Sportverein. Voraussetzungen und Hindernisse. Schorndorf: Hofmann.<br />
Combrink, Claudia. (2004). Relevanz und Irrelevanz von Geschlecht in<br />
ehrenamtlichen Führungsgremien von <strong>Sportjugend</strong>verbänden (Band 13).<br />
Münster: LIT.<br />
Emrich, Eike, Pitsch, Werner. (2001). Die Sportvereine. Ein Versuch auf<br />
empirischer Grundlage. Schorndorf: Hofmann.<br />
Gerdes, Lutz. (2001). Dialogik im Partnerkontaktsport. Hamburg: Dissertation.<br />
Gösche, Axel, Andree, Angela, Fischer, Rolf. (2002). 50 Jahre Nordrhein-<br />
Westfälischer Judo-Verband e.V. Duisburg: Basis-Druck.<br />
Heinemann, Klaus. (1994). Der Sportverein. Ergebnisse einer repräsentativen<br />
Untersuchung. Schorndorf: Hofmann.<br />
XXVII
Heinemann, Klaus. (1998). Einführung in Methoden und Techniken<br />
empirischer Forschung im Sport (Band 1). Grundlagen für Studium,<br />
Ausbildung und Beruf. Schorndorf: Hofmann.<br />
Heinemann, Klaus. (2004). Sportorganisationen. Verstehen und gestalten.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
Heinemann, Klaus. (2007). Einführung in die Soziologie des Sports (Band 1).<br />
Grundlagen für Studium, Ausbildung und Beruf (5 überarbeitete Aufl.).<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
Heinemann, Klaus & Horch, H.D. (1991). Elemente einer Finanzsoziologie<br />
freiwilliger Vereinigungen. Stuttgart.<br />
Heinemann, Klaus & Schubert, Manfred. (1992). Ehrenamtlichkeit und<br />
Hauptamtlichkeit in Sportvereinen. Schorndorf: Hofmann.<br />
Heinemann, Klaus & Schubert, Manfred. (1994). Der Sportverein, Schorndorf:<br />
Hofmann.<br />
Horch, H.D (1987). Personalwirtschaftliche Aspekte ehrenamtlicher Mitarbeit. In<br />
K.Heinemann (Hrsg.). Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Sportvereins.<br />
Schorndorf.<br />
Hochschild, A.R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure.<br />
American Journal of Sociology 85.<br />
Israel, J. (1972). Der Begriff der Entfremdung. Reinbek.<br />
LandesSportBund NRW (Hrsg.). (2007). Potenziale nutzen. Anregungen zur<br />
Vereinsentwicklung aus Geschlechterperspektive. Duisburg:<br />
LandesSportBund NRW.<br />
XXVIII
LandesSportBund NRW (Hrsg.).NW Judo-Verband e.V. & Ringerverband NRW<br />
e.V. (2008) Ringen und Kämpfen Zweikampfsport. Aachen: Meyer & Meyer.<br />
Osterloh, M. (1991). Unternehmensethik und Unternehmenskultur. Steinmann, H.<br />
& Löhr, A. (Hrsg.). Unternehmensethik. (2. Aufl.) Stuttgart.<br />
Pfister, Gertrud. (2002) Frauen und Sport in der DDR. Köln: Sportverlag Strauß.<br />
Pflaum, R. (1954). Die Vereine als Produkt und Gegengewicht sozialer<br />
Differenzierung. In G. Wurzbacher & R. Pflaum (Hrsg.). Das Dorf im<br />
Spannungsfeld industrieller Entwicklung. Stuttgart.<br />
Rossi, P.H. (1966). Voluntary associations in an industrial city. In W.A. Glaser &<br />
D.L. Sills (Ed.). The government of associations. Toronto/New York.<br />
Scheffel, Heidi. (1996). Mädchensport und Koedukation. Aspekte einer<br />
feministischen Sportpraxis. Butzbach-Griedel: Afra.<br />
Schluchter, W. (1972). Aspekte bürokratischer Herrschaft. München.<br />
Sills D.L. (1968). Voluntary associations – sociological aspects. In International<br />
Encyclopedia of the Social Sciences. Bd. 16.New York.<br />
Teipel, Dieter, Heinemann, Dirk, Reinhild Kemper. Bundesinstitut für<br />
Sportwissenschaft (Hrsg.). (2001). Ärgerkontrolle im Judo (Band 17). Köln:<br />
Sportverlag Strauß.<br />
Weber, M. (1911). Geschäftsbericht. Deutsche Gesellschaft für Soziologie (Hrsg.).<br />
Verhandlungen des ersten deutschen Soziologentags vom 19. bis 22.<br />
Oktober 1910 in Frankfurt a.M. Tübingen.<br />
Weber, M. (1956). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen.<br />
Winkler, J. (1988). Das Ehrenamt. Schorndorf.<br />
XXIX
Eidesstattliche Erklärung<br />
Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt, außer den im<br />
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie in den Anmerkungen genannten Hilfsmitteln<br />
keine weiteren benutzt und alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem<br />
Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, unter Angabe der Quellen als Entlehnung<br />
kenntlich gemacht habe.<br />
Unterschrift