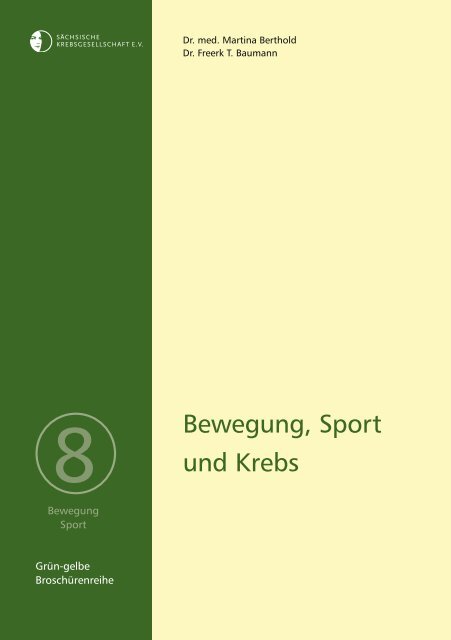Bewegung, Sport und Krebs
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. med. Martina Berthold<br />
Dr. Freerk T. Baumann<br />
8<br />
<strong>Bewegung</strong>, <strong>Sport</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Krebs</strong><br />
<strong>Bewegung</strong><br />
<strong>Sport</strong><br />
Grün-gelbe<br />
Broschürenreihe<br />
1
Autoren<br />
Dr. med. Martina Berthold<br />
Ärztin <strong>und</strong> Medizinjournalistin<br />
Wissenschaftliches Lektorat: Dr. Freerk T. Baumann<br />
Deutsche <strong>Sport</strong>hochschule Köln<br />
Institut für Rehabilitation <strong>und</strong> Behindertensport<br />
Mit fre<strong>und</strong>licher Unterstützung der DRV-BUND <strong>und</strong> des FREISTAATES Sachsen<br />
2
5<br />
6<br />
6<br />
6<br />
INHALT<br />
Vorwort<br />
1. Was bewirkt <strong>Sport</strong>?<br />
1.1. Körperliche Effekte<br />
1.2. Psychische <strong>und</strong> soziale Effekte<br />
7<br />
7<br />
8<br />
2. <strong>Sport</strong> zur <strong>Krebs</strong>prävention<br />
2.1. <strong>Sport</strong> hilft, gefährliches Übergewicht zu reduzieren<br />
2.2. <strong>Sport</strong> kann direkt die Entstehung einiger Tumorarten hemmen<br />
9<br />
9<br />
12<br />
12<br />
13<br />
15<br />
18<br />
19<br />
20<br />
3. <strong>Sport</strong> bei <strong>Krebs</strong>, <strong>Sport</strong> nach <strong>Krebs</strong><br />
3.1. <strong>Sport</strong> tut gut – das gilt auch für Tumorpatienten<br />
3.2. <strong>Bewegung</strong>stherapie versus <strong>Sport</strong><br />
3.3. <strong>Bewegung</strong>stherapie begleitend zur <strong>Krebs</strong>therapie<br />
3.4. <strong>Sport</strong> – was <strong>Krebs</strong>patienten gr<strong>und</strong>sätzlich beachten sollten<br />
3.5. <strong>Sport</strong> während der <strong>Krebs</strong>therapie<br />
3.6. Kontraindikationen: Wann sollten <strong>Krebs</strong>patienten gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
kein <strong>Sport</strong> treiben?<br />
3.7. Rehabilitationssport für Tumorpatienten: Wohin wende ich mich?<br />
Wer bezahlt ihn?<br />
Adressen <strong>und</strong> Ansprechpartner<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 3
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
<strong>Sport</strong> <strong>und</strong> <strong>Krebs</strong> – das sind zwei Begriffe, die eigentlich<br />
nicht zusammenzupassen scheinen.<br />
Doch der Schein trügt: Denn zum einen kann <strong>Sport</strong> Tumorerkrankungen<br />
entgegenwirken <strong>und</strong> so eine wirksame<br />
Präventionsmaßnahme darstellen, zum anderen kann<br />
<strong>Sport</strong> auch eine wichtige Stütze bei Therapie <strong>und</strong> Nachsorge<br />
sein. Das gilt nicht nur für Ausnahmesportler wie<br />
Radprofi Lance Armstrong, die Fußballer Ebbe Sand oder<br />
Heiko Herrlich, den Handballprofi Christian Berge oder die<br />
russisch-schwedische Leichtathletin Ludmilla Engquist, die<br />
drei Monate nach einer Brustkrebsoperation nach siegreichem<br />
Hürdenlauf ins Publikum rief „Ich lebe noch!“<br />
Anliegen dieser Broschüre ist, den Nutzen von <strong>Sport</strong> herauszustellen<br />
– <strong>und</strong> zwar für ges<strong>und</strong>e Menschen wie auch<br />
für Menschen mit <strong>Krebs</strong>. Denn auch für sie kann <strong>Sport</strong><br />
gewinnbringend sein – er verbessert Kondition <strong>und</strong> Körpergefühl,<br />
wirkt positiv auf die psychische Verfassung <strong>und</strong><br />
fördert in vielen Fällen soziale Kontakte, die besonders<br />
für erkrankte Menschen wichtig sind, denn häufig führt<br />
„<strong>Krebs</strong>“ auch zur sozialen Isolation.<br />
Natürlich gelten für Tumorpatienten aber krankheits- <strong>und</strong><br />
therapiebedingte Einschränkungen. Betroffenen möchten<br />
wir mit diesem Heft einen konkreten, praktischen Ratgeber<br />
an die Hand geben, der sowohl die Möglichkeiten als<br />
auch die Grenzen von körperlicher Aktivität aufzeigt.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sollten <strong>Krebs</strong>patienten vorab mit ihrem Arzt<br />
sprechen, wenn sie <strong>Sport</strong> treiben möchten. Auch sollte<br />
jeder sein eigenes Maß finden <strong>und</strong> sich nicht überfordern –<br />
für viele Patienten ist es eine anerkennenswerte, sportliche<br />
Leistung, regelmäßig zehn Minuten spazieren zu gehen<br />
oder Gymnastik zu machen. Sie werden sehen, die <strong>Bewegung</strong><br />
tut Ihnen gut!<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 5
1. Was bewirkt <strong>Sport</strong>?<br />
Der Nutzen von <strong>Sport</strong> bzw. ausreichend körperlicher Aktivität<br />
(das können auch Alltagsaktivitäten sein!) ist vielfach<br />
belegt. Daher wird allgemein ein aktiver Lebensstil empfohlen.<br />
Dafür ist gar nicht unbedingt ein engmaschiges<br />
Trainingsprogramm erforderlich, oft reicht es schon, den<br />
Alltag körperlich aktiver zu gestalten, also mal mit dem<br />
Fahrrad zur Arbeit fahren anstatt mit dem Auto oder die<br />
Treppen nehmen anstelle des Lifts. Bereits das trägt dazu<br />
bei, Übergewicht zu vermeiden, ein positives Körpergefühl<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> verschiedene Krankheiten – auch <strong>Krebs</strong>!<br />
– vorzubeugen.<br />
<strong>Sport</strong> bereichert die Freizeit <strong>und</strong>, wenn man in der Gruppe<br />
trainiert, auch das Sozialleben. Er hat verschiedene Effekte<br />
auf Körper <strong>und</strong> Psyche, die „gut tun“.<br />
1.1. Körperliche Effekte<br />
<strong>Sport</strong> fördert gr<strong>und</strong>sätzlich die Ausdauer, Kraft, Koordination,<br />
Beweglichkeit <strong>und</strong> Schnelligkeit. Je nach <strong>Sport</strong>art<br />
liegt der Schwerpunkt auf einem oder mehreren dieser Bereiche.<br />
Gewichtheben beansprucht <strong>und</strong> trainiert die Kraft,<br />
Joggen / „Dauerlauf“ die Ausdauer <strong>und</strong> Tanz beispielsweise<br />
die Koordination <strong>und</strong> Beweglichkeit.<br />
Egal, welche <strong>Sport</strong>art sie treiben – die regelmäßige körperliche<br />
<strong>Bewegung</strong> hat verschiedene ges<strong>und</strong>heitsfördernde<br />
Effekte: <strong>Sport</strong> wirkt blutdrucksenkend <strong>und</strong> kreislaufstabilisierend,<br />
senkt auch das „schlechte“ Cholesterin<br />
(LDL-Cholesterin), fördert den Muskelaufbau <strong>und</strong> hemmt<br />
den Knochenabbau <strong>und</strong> heizt die Fettverbrennung an.<br />
Menschen, die regelmäßig <strong>Sport</strong> treiben, fühlen sich daher<br />
„fit“, sind in der Regel weniger übergewichtig <strong>und</strong> werden<br />
statistisch gesehen nicht so häufig krank.<br />
1.2. Psychische <strong>und</strong> soziale Effekte<br />
Neben diesen körperlichen Effekten, wirkt <strong>Sport</strong> auch positiv<br />
auf die Psyche. Er hilft, Stress abzubauen <strong>und</strong> schafft<br />
kleine Erfolgserlebnisse. Es konnte zudem gezeigt werden,<br />
6
dass <strong>Sport</strong> stimmungsaufhellend wirkt <strong>und</strong> bei leichten bis<br />
mittelschweren Depressionen sogar die medikamentöse<br />
Therapie mit sogenannten Anti-Depressiva ersetzen kann.<br />
Hinzu kommen soziale Effekte: Gruppensportarten, wie<br />
Fußball, Volleyball oder <strong>Sport</strong> in Gruppen (z. B. Lauftreffs,<br />
Ruderverein, Yogakurs) fördern soziale Kontakte <strong>und</strong><br />
schützen vor Isolation.<br />
fAzit: <strong>Bewegung</strong> tut jedem Menschen gut!<br />
2. <strong>Sport</strong> zur <strong>Krebs</strong>prävention<br />
Es ist allgemein bekannt, dass <strong>Sport</strong> Herz-Kreislauf- <strong>und</strong><br />
Gefäßerkrankungen sowie auch dem Diabetes (Zuckerkrankheit)<br />
vorbeugt. Dass <strong>Sport</strong> aber auch das Risiko, an<br />
<strong>Krebs</strong> zu erkranken, reduzieren kann, wissen die meisten<br />
Menschen gar nicht.<br />
Dabei wirkt <strong>Sport</strong> sogar „doppelt“ gegen <strong>Krebs</strong>: Zum<br />
einen indirekt, da durch die sportliche Betätigung das<br />
Übergewicht <strong>und</strong> damit auch das <strong>Krebs</strong>risiko reduziert<br />
wird. Zum anderen hat <strong>Sport</strong> auch direkte Auswirkungen<br />
auf die <strong>Krebs</strong>entstehung, wie neueste Studien belegen.<br />
2.1. <strong>Sport</strong> hilft, gefährliches Übergewicht zu<br />
reduzieren<br />
Übergewicht ist ein „gewichtiger Risikofaktor“ für <strong>Krebs</strong>.<br />
Das zeigte bereits 2005 eine große Untersuchung an<br />
145.000 Menschen. Übergewicht, insbesondere Übergewicht<br />
in krankhaftem Ausmaß („Adipositas“ = Body Mass<br />
Index > 30), geht deutlich mit dem Auftreten verschiedener<br />
Tumorerkrankungen einher. So haben adipöse<br />
Männer im Vergleich zu normalgewichtigen ein bis zu 2,5<br />
fach erhöhtes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Auch<br />
das Risiko, Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreas-Karzinom)<br />
zu bekommen, war bei diesen stark übergewichtigen<br />
Männern deutlich erhöht.<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 7
Bei Frauen wirkt sich Übergewicht ebenso negativ aus,<br />
auch wenn bei ihnen die „überflüssigen Pf<strong>und</strong>e“ andere<br />
<strong>Krebs</strong>arten zu begünstigen scheinen. Adipöse Frauen<br />
erkranken signifikant häufiger an Nierenkrebs, Non-Hodgkin-Lymphomen<br />
<strong>und</strong> Brustkrebs. Gravierend erhöht<br />
ist außerdem das Risiko für Gebärmutterkörperkrebs.<br />
Studienleiter Dr. Kilian Rapp von der Universität Ulm geht<br />
davon aus, dass allein 26 % aller Gebärmutterkörper-Karzinome<br />
auf Fettleibigkeit zurückzuführen sind.<br />
<strong>Sport</strong> wirkt nicht nur der Fettleibigkeit entgegen, die mit<br />
einer deutlichen Erhöhung des <strong>Krebs</strong>risikos in Zusammenhang<br />
gebracht wird, er beugt auch dem Diabetes-Typ-2<br />
(auch „Altersdiabetes“ oder „Wohlstandsdiabetes“ genannt)<br />
vor. Der wiederum ist mit einem höheren Auftreten<br />
(Inzidenz) von Darm- <strong>und</strong> Bauchspeicheldrüsenkrebs<br />
assoziiert, wie seit Jahren bekannt ist.<br />
2.2. <strong>Sport</strong> kann direkt die Entstehung einiger<br />
tumorarten hemmen<br />
<strong>Sport</strong> senkt nicht nur indirekt via Gewichtsreduktion <strong>und</strong><br />
Diabetes-Prophylaxe das <strong>Krebs</strong>risiko, er hat auch auf die<br />
Entstehung verschiedener Tumorarten einen direkten,<br />
hemmenden Einfluss. <strong>Sport</strong> hat verschiedene physiochemische<br />
Effekte, welche die Entstehung von verschiedenen<br />
<strong>Krebs</strong>arten unterschiedlich beeinflussen, z. B.:<br />
• Brustkrebs <strong>und</strong> Endometrium-Karzinom:<br />
Körperliche Aktivität senkt die Hormonspiegel, insbesondere<br />
bei Frauen vor dem Klimakterium. So sinkt<br />
auch der Insulinspiegel sowie der IGF 1 (= „insulinähnlicher<br />
Wachstumsfaktor 1“), außerdem verbessert sich<br />
die Immunantwort – all das könnte zu einem „Tumorschutz“<br />
beitragen.<br />
• Darmkrebs:<br />
Ein Darmkrebs-hemmender Effekt wird der durch<br />
den <strong>Sport</strong> beschleunigten Magen-Darm-Passage der<br />
Nahrung zugeschrieben. Die Darmschleimhaut ist<br />
bei aktiven Menschen nicht so lange potenziell<br />
karzinogenen (krebserregenden) Stoffen ausgesetzt<br />
wie bei inaktiven Menschen mit langsamer Verdauung.<br />
8
Außerdem hat <strong>Sport</strong> eine Reihe von Wirkungen auf<br />
Entzündungs- <strong>und</strong> Immunfaktoren, was das Darmkrebsrisiko<br />
verringern könnte.<br />
So senkt körperliche Aktivität auch den Prostaglandin-<br />
Spiegel. Hohe Prostaglandin-Spiegel sind mit einer<br />
erhöhten Darmkrebsinzidenz vergesellschaftet.<br />
Führt man sich die indirekten <strong>und</strong> direkten Effekte von<br />
<strong>Sport</strong> vor Augen, ist es nicht verw<strong>und</strong>erlich, dass die<br />
amerikanische <strong>Krebs</strong>gesellschaft ges<strong>und</strong>en Erwachsenen<br />
fünfmal pro Woche eine sportliche Aktivität von ca. 30<br />
Minuten empfiehlt.<br />
3. <strong>Sport</strong> bei <strong>Krebs</strong>, <strong>Sport</strong> nach <strong>Krebs</strong><br />
3.1. <strong>Sport</strong> tut gut – das gilt auch für Tumorpatienten<br />
Früher wurde <strong>Krebs</strong>patienten häufig zur körperlichen<br />
Schonung geraten, doch diese Sichtweise ist seit einigen<br />
Jahren komplett überholt. Die heutige Studienlage dokumentiert<br />
ganz klar positive Effekte körperlicher Aktivität<br />
– sowohl während als auch nach einer <strong>Krebs</strong>erkrankung.<br />
<strong>Sport</strong> ist also nicht nur etwas für Ges<strong>und</strong>e, sondern<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich auch für kranke, sogar krebskranke Menschen.<br />
Allerdings sollten Tumorpatienten ein paar „Regeln“<br />
beherzigen, um sich nicht zu überfordern oder gar<br />
zu gefährden (siehe Punkte 3.4, 3.5, 3.6!).<br />
Zahlreiche Studien belegen, dass <strong>Sport</strong> für das Allgemeinbefinden<br />
zuträglich ist <strong>und</strong> positiv auf Körper <strong>und</strong> Psyche<br />
wirkt. Bahnbrechend für den Stellenwert von <strong>Sport</strong> in der<br />
<strong>Krebs</strong>nachsorge war jedoch die Erkenntnis, dass er sogar<br />
die Rezidivrate (Rückfallhäufigkeit) einiger Tumorarten<br />
senken kann.<br />
• <strong>Sport</strong> verbessert die körperliche Konstitution von<br />
<strong>Krebs</strong>patienten<br />
Die <strong>Krebs</strong>therapie zieht oft einen deutlichen Abfall der<br />
körperlichen Leistungsfähigkeit nach sich.<br />
Diesem Leistungsabfall kann <strong>Sport</strong> jedoch entge-<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 9
genwirken. Durch regelmäßige körperliche Aktivität<br />
nehmen Muskelmasse <strong>und</strong> -kraft zu, außerdem kommt<br />
es zu einer Erhöhung des Blutvolumens (es kann also<br />
mehr Sauerstoff transportiert werden), zu einer verbesserten<br />
Durchblutung der Muskulatur sowie zu einer<br />
Erhöhung der Pumpreserve des Herzens. Auch zeigte<br />
sich, dass Ausdauertraining zu einer schnelleren Wiederherstellung<br />
der Blutbildung (Hämotopoese) nach<br />
einer intensiven Chemotherapie führen kann.<br />
Der aktive Patient fühlt sich also trotz der Strapazen<br />
der <strong>Krebs</strong>therapie körperlich „fitter“ <strong>und</strong> regeneriert<br />
schneller.<br />
• <strong>Sport</strong> wirkt positiv auf die psychische Konstitution von<br />
<strong>Krebs</strong>patienten<br />
Ein regelmäßiges körperliches Training steigert nicht<br />
nur die körperliche Konstitution, es wirkt sich auch<br />
positiv auf die Psyche aus: Der Patient hat Erfolgserlebnisse,<br />
auch wenn nicht jeder ein Lance Armstrong ist!<br />
Außerdem gilt als belegt, dass <strong>Sport</strong> Ängste <strong>und</strong><br />
Depressionen mindern kann – nicht umsonst hat die<br />
<strong>Sport</strong>therapie einen großen Stellenwert in der Behandlung<br />
seelischer Erkrankungen.<br />
Da <strong>Krebs</strong>patienten während der Therapie häufig in<br />
Gruppen unter physiotherapeutischer Anleitung trainieren,<br />
kommt auch ein psychosozialer Effekt hinzu:<br />
Der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen<br />
macht Mut <strong>und</strong> die Gruppe gibt Halt.<br />
Letztendlich führt <strong>Sport</strong> auch zu einer besseren Akzeptanz<br />
des eigenen Körpers, der sich oft unter der<br />
<strong>Krebs</strong>therapie verändert hat, <strong>und</strong> kann so das Selbstwertgefühl<br />
stärken – mit positiven Auswirkungen auf<br />
das psychische Wohlbefinden.<br />
• <strong>Sport</strong> wirkt dem Fatigue-Syndrom entgegen<br />
Ein gravierendes Problem bei Tumorpatienten ist das<br />
sogenannte Fatigue-Syndrom. Fatigue bezeichnet<br />
den Zustand chronischer körperlicher wie psychischer<br />
10
Ermüdung. Die Betroffen leiden unter einem Erschöpfungszustand,<br />
der mit einer bleiernen Müdigkeit <strong>und</strong><br />
Energielosigkeit einhergeht. Vielen Patienten fällt es<br />
schwer, einfache Alltagstätigkeiten zu verrichten. Bislang<br />
ist nicht eindeutig geklärt, ob diese Erschöpfung<br />
eine Nebenwirkung der <strong>Krebs</strong>therapie ist oder durch<br />
die Tumorerkrankung selbst hervorgerufen wird.<br />
<strong>Sport</strong> lindert durch die beschriebenen Effekte auf Körper<br />
<strong>und</strong> Psyche das Fatigue-Syndrom, was sowohl ganz<br />
allgemein als auch für spezielle Tumorarten gezeigt<br />
wurde.<br />
• <strong>Sport</strong> kann einen positiven Einfluss auf Überleben <strong>und</strong><br />
Rezidivrate (Rückfallhäufigkeit) haben<br />
Für besonderes Aufsehen sorgte 2005 eine Studie, die<br />
zeigte, dass <strong>Sport</strong> bei Brustkrebspatientinnen auch das<br />
Rückfallrisiko senken <strong>und</strong> das Leben verlängern kann:<br />
Die Forschungsgruppe um Holmes untersuchte 2.987<br />
Frauen mit der Diagnose Brustkrebs im Stadium I-III<br />
<strong>und</strong> zeigte, dass die Patientinnen deutlich von einem<br />
Walking-Training (3 – 5 St<strong>und</strong>en pro Woche) profitieren.<br />
Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine Studie zu<br />
Darmkrebs, auch hier hatte <strong>Sport</strong> einen vor Rückfällen<br />
schützenden Effekt <strong>und</strong> beeinflusste das Überleben der<br />
Patienten positiv.<br />
Eigentlich sind diese Ergebnisse gar nicht so überraschend:<br />
Wenn man bedenkt, dass <strong>Sport</strong> das Auftreten<br />
von <strong>Krebs</strong> bei Ges<strong>und</strong>en vorbeugen kann (siehe Kapitel 2)<br />
<strong>und</strong> die Entstehung von Tumoren hemmt, liegt es<br />
nahe, dass er ebenso die Tumorentstehung <strong>und</strong> somit<br />
das Rückfallrisiko bei Betroffenen reduzieren kann.<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 11
3.2. <strong>Bewegung</strong>stherapie versus <strong>Sport</strong><br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sollte man <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> bewegungstherapeutische<br />
Maßnahmen unterscheiden.<br />
<strong>Bewegung</strong>stherapie ist ein Sammelbegriff für alle Formen<br />
der <strong>Bewegung</strong>, die bei der Behandlung einer Krankheit<br />
eingesetzt werden können. Der behandelnde Arzt<br />
verschreibt diese Therapie, ein <strong>Sport</strong>therapeut führt sie<br />
durch <strong>und</strong> beide kontrollieren regelmäßig den Erfolg der<br />
Behandlung.<br />
Physiotherapie als therapiebegleitende oder rehabilitative<br />
Maßnahme zielt darauf ab, unerwünschten Begleit- <strong>und</strong><br />
Folgeerscheinungen einer Erkrankung oder ihrer Therapie<br />
entgegenzuwirken. Sie orientiert sich bei der Behandlung<br />
an den Beschwerden <strong>und</strong> den Funktions- bzw. Aktivitätseinschränkungen<br />
des Patienten <strong>und</strong> trainiert gezielt<br />
dagegen. So kann beispielsweise Beckenbodengymnastik<br />
die Inkontinenz als eine häufige Folge nach der Prostata-<br />
Entfernung bei Prostatakrebspatienten beseitigen oder<br />
zumindest lindern.<br />
<strong>Sport</strong>therapie gehört auch zur <strong>Bewegung</strong>stherapie. Diese<br />
noch junge Fachrichtung erobert sich allmählich ihren<br />
Platz in der Rehabilitation. <strong>Sport</strong>liche Aktivitäten tragen<br />
dazu bei, körperliche, seelische <strong>und</strong> auch soziale Probleme<br />
zu beheben. Hierfür gibt es speziell ausgebildete <strong>Sport</strong>therapeuten<br />
in ambulanten <strong>und</strong> stationären Reha-Einrichtungen.<br />
Die <strong>Sport</strong>therapie findet zumeist in Gruppen statt.<br />
3.3. Physiotherapie begleitend zur <strong>Krebs</strong>therapie<br />
Die Physiotherapie kann als supportive (unterstützende)<br />
Therapie begleitend zur <strong>Krebs</strong>therapie zum Einsatz<br />
kommen <strong>und</strong> typischen Begleit- <strong>und</strong> Folgebeschwerden<br />
entgegenwirken. Sie wird nur mit einem Therapeuten<br />
durchgeführt <strong>und</strong> niemals allein!<br />
Nach Chemotherapie kommt es mitunter zur Immobilität,<br />
Gelenkbeschwerden <strong>und</strong> Neuropathien (=Nervenbeschwerden,<br />
die typischerweise zu Taubheitsgefühl in<br />
Armen oder Beinen führen). Die Physiotherapie hat für diese<br />
Beschwerden eine ganze Reihe an Behandlungsmethoden<br />
12
(manuelle Techniken wie Lymphdrainagen <strong>und</strong> Massagen,<br />
Kräftigungsübungen, Atemgymnastik, Entspannungsübungen,<br />
Gleichgewichts-<strong>und</strong> Koordinationsschulungen),<br />
die je nach Tumorart <strong>und</strong> Konstitution des Patienten zur<br />
Anwendung kommen.<br />
Nach Strahlentherapie kann es zu Fibrosierung (Vernarbung<br />
<strong>und</strong> Schrumpfung) des bestrahlten Gewebes<br />
kommen, der mit manuellen Techniken (Lymphdrainagen,<br />
Massagen) sowie Atemtherapie (insbesondere bei Lungenfibrose)<br />
entgegengewirkt werden kann.<br />
Die Beschwerden nach einer Operation sind so vielfältig,<br />
dass die physiotherapeutischen Maßnahmen individuell<br />
<strong>und</strong> je nach OP abgestimmt werden. Nach thoraxchirurgischen<br />
Eingriffen bei Lungenkrebs steht beispielsweise<br />
die Kräftigung der Atemhilfsmuskulatur im Vordergr<strong>und</strong>,<br />
bei Bauchoperationen hingegen die Regeneration der<br />
Bauch- <strong>und</strong> Rückenmuskulatur.<br />
Bei einer krebsbegleitenden Physiotherapie wird das<br />
Training individuell auf die Beschwerden abgestimmt, der<br />
behandelnde Therapeut kennt Ihre Krankengeschichte <strong>und</strong><br />
arbeitet ein spezielles Programm für Sie aus.<br />
3.4. <strong>Sport</strong> – was <strong>Krebs</strong>patienten gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
beachten sollten<br />
Jeder Patient ist anders <strong>und</strong> bringt auch andere körperliche<br />
Voraussetzungen sowie krankheits- <strong>und</strong> therapiebedingt<br />
andere Einschränkungen mit. So ist es beispielsweise<br />
ein großer Unterschied, ob ein ehemaliger Leistungssportler<br />
während oder nach der <strong>Krebs</strong>therapie weitertrainiert,<br />
oder ob ein bekennender „<strong>Bewegung</strong>smuffel“ sich erstmalig<br />
in seinem Leben aufrafft. Auch spielt der Schweregrad<br />
der Erkrankung eine große Rolle.<br />
Wenn möglich, sollte der Patient mindestens dreimal pro<br />
Woche jeweils ca. 20 bis 45 Minuten trainieren, so lautet<br />
die allgemeine Empfehlung. Hierfür bietet sich ein- bis<br />
zweimal pro Woche Ausdauersport <strong>und</strong> einmal pro Woche<br />
„Gymnastik“ in Form von Krafttraining, Dehnübungen<br />
oder Koordination an. Sorgen Sie darüber hinaus für ausreichend<br />
<strong>Bewegung</strong> im Alltag.<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 13
Die <strong>Sport</strong>art kann jeder Patient nach persönlicher Vorliebe –<br />
<strong>Sport</strong> soll ja auch Spaß machen – <strong>und</strong> nicht nur „Pflichtprogramm“<br />
sein! – <strong>und</strong> Konstitution wählen: Generell sind<br />
<strong>Sport</strong>arten wie z. B. Radfahren, Walken, sanftes Joggen<br />
oder Gymnastik, besonders geeignet. Auch Ballsportarten<br />
sind gr<strong>und</strong>sätzlich möglich, allerdings sind sie bei einer<br />
Thrombozytenzahl unter 50 untersagt – siehe Kapitel 3.6..<br />
Bevor Sie sich eine <strong>Sport</strong>art auswählen <strong>und</strong> loslegen,<br />
sollten Sie auf jeden Fall darüber mit Ihrem behandelnden<br />
Onkologen <strong>und</strong> einem erfahrenen Therapeuten sprechen.<br />
Beide kennen Ihre Krankengeschichte <strong>und</strong> können Sie<br />
beraten, welche <strong>Sport</strong>arten bei Ihrer Erkrankung <strong>und</strong> in<br />
Ihrem Stadium der Therapie empfehlenswert sind <strong>und</strong><br />
welche hingegen Schaden anrichten könnten. Wer beispielsweise<br />
während einer Strahlentherapie ein leichtes<br />
Krafttraining im Fitnessstudio absolviert, handelt sich<br />
u. U. Mikrorisse <strong>und</strong> ein erhöhtes Ödemrisiko (=Wasser im<br />
Bindegewebe) ein. Nach Abschluss der Therapie kann ein<br />
solches Training aber durchaus sinnvoll sein, aber nicht<br />
währenddessen.<br />
Auch ist bei älteren Patienten oder bei Patienten mit<br />
einem bestimmten kardiovaskulären Risikoprofil vor intensivem<br />
Ausdauertraining eine kardiologische Untersuchung<br />
empfehlenswert – Ihr Arzt wird Sie bei Bedarf untersuchen<br />
oder zu einem Herzspezialisten (Kardiologen) überweisen.<br />
Fazit: Nicht jeder <strong>Sport</strong> ist zu jedem Zeitpunkt gut, daher<br />
sollten Sie mit Ihrem Arzt über geplante sportliche Aktivitäten<br />
reden. In einigen Fällen sollten vorab Herz-Kreislauf-<br />
Schwächen ausgeschlossen werden.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt: Es ist nie zu spät anzufangen!<br />
Aber:<br />
• Reden Sie erst mit Ihrem behandelnden Arzt über<br />
<strong>Sport</strong>art <strong>und</strong> Trainingszeiten, er kann einschätzen,<br />
was Sie sich zumuten können.<br />
• Beginnen Sie langsam <strong>und</strong> steigern Sie das Training<br />
Schritt für Schritt. <strong>Sport</strong>liche Kondition baut sich<br />
nicht von heute auf morgen auf!<br />
• Hören Sie immer auf Ihren Körper – achten Sie auf<br />
seine Signale, überfordern Sie sich nicht!<br />
• Seien Sie vorsichtig bei <strong>Sport</strong> <strong>und</strong> Training, damit<br />
Sie sich nicht zuviel zumuten oder sich sogar verletzen.<br />
14
3.5. <strong>Sport</strong> während der <strong>Krebs</strong>therapie<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich kann auch während einer Tumortherapie<br />
(Chemotherapie, Strahlentherapie) <strong>Sport</strong> getrieben<br />
werden, allerdings sollten sich die Patienten an den Tagen<br />
schonen, an denen Sie Chemo- oder Strahlentherapie<br />
verabreicht bekommen, die den Herzmuskel <strong>und</strong> die Nieren<br />
belasten. An therapiefreien Tagen kann aber generell<br />
trainiert werden.<br />
Patienten, die eine Immuntherapie bekommen, entwickeln<br />
oft grippeähnliche Beschwerden. Das sportliche Training<br />
muss solange ausgesetzt werden, bis diese Beschwerden<br />
vollkommen abgeklungen sind.<br />
Auch sollte die <strong>Sport</strong>art so gewählt werden, dass Heilungsprozesse<br />
nicht gefährdet werden. So sind beispielsweise<br />
nach einer Strahlentherapie Wassersportarten erst<br />
möglich, wenn die Hautreizungen abgeklungen sind.<br />
Für einige Tumorarten gibt es konkrete Trainingsempfehlungen.<br />
Brustkrebs<br />
Empfehlenswert:<br />
• Wassertherapie<br />
• Ausdauersportarten wie Radfahren oder Wandern (mit<br />
leichtem Gepäck), Skilanglauf, Nordic Walking<br />
Tanzen, Aerobic, Tai-Chi, Qigong oder Yoga<br />
Gut sind in der Regel alle fließenden, sanften sowie<br />
rhythmischen <strong>Bewegung</strong>en mit dem Arm auf der<br />
operierten Seite. Das Öffnen <strong>und</strong> Schließen der Hände<br />
über dem Kopf regt die Muskelpumpe an <strong>und</strong> kann<br />
damit z. B. ein Lymphödem lindern.<br />
Nicht empfehlenswert:<br />
• <strong>Sport</strong>arten mit intensivem Körperkontakt<br />
• Ruckartige, reißende <strong>Bewegung</strong>en<br />
Prostatakrebs<br />
Empfehlenswert:<br />
• Gymnastische Kräftigungsübungen (vor allem für den<br />
Beckenboden)<br />
• Moderates Krafttraining an Geräten<br />
• Wandern, Nordic Walking, Skilanglauf<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 15
• Ballspiele wie Volleyball, Fußball oder Hockey sowie<br />
Tennis (Überlastung vermeiden)<br />
Nicht empfehlenswert:<br />
• Schwimmen solange noch ein Problem mit Inkontinenz<br />
besteht<br />
• Radfahren in den ersten Monaten nach der Entfernung<br />
der Prostata<br />
Magen- <strong>und</strong> Darmkrebs<br />
Empfehlenswert:<br />
• Radfahren, Nordic Walking, Wandern, Schwimmen<br />
• Kräftigung der Bauch- <strong>und</strong> Rückenmuskulatur<br />
• Ohne Stoma können Sie nahezu uneingeschränkt <strong>Sport</strong><br />
treiben. Mit einem Stoma sollten Sie gymnastische<br />
Übungen vermeiden, bei denen Sie auf dem Bauch<br />
liegen.<br />
• Wichtig: Steigern Sie die Belastungen nur sehr langsam,<br />
essen <strong>und</strong> trinken Sie ausreichend.<br />
Nicht empfehlenswert:<br />
• Ruckartige, reißende <strong>Bewegung</strong>en, schnelle <strong>und</strong> starke<br />
Schläge<br />
• <strong>Sport</strong>arten mit intensivem Körperkontakt<br />
• Heben von schweren Gewichten <strong>und</strong> Lasten<br />
Lungenkrebs<br />
Empfehlenswert:<br />
• Das Erlernen neuer Atemtechniken kann die Lungenfunktion<br />
<strong>und</strong> die Atemmuskulatur „trainieren“.<br />
• Kräftigungs- <strong>und</strong> Beweglichkeitstraining für Rücken<br />
<strong>und</strong> Rumpf, Dehngymnastik<br />
• Radfahren, Wandern, Nordic Walking auf zunächst<br />
kurzen Strecken<br />
16
• Schwimmen<br />
• Vorsichtige <strong>Bewegung</strong>sspiele mit (weichen) Bällen<br />
Nicht empfehlenswert:<br />
• <strong>Sport</strong>arten mit intensivem Körperkontakt<br />
Kehlkopfkrebs<br />
Empfehlenswert:<br />
• Gymnastische Übungen, Dehnübungen, Atemgymnastik<br />
• Kräftigungs- <strong>und</strong> Beweglichkeitstraining für Rücken<strong>und</strong><br />
Bauchmuskulatur<br />
• Schwimmen, Wassergymnastik (hier gibt es spezielle<br />
„Schwimmprothesen“)<br />
• Ausdauersportarten wie Ballspiele, Badminton, Tennis<br />
Nicht empfehlenswert:<br />
• Allgemeine Pressübungen, Heben von schweren Lasten<br />
• <strong>Sport</strong> in kalter <strong>und</strong> staubiger Luft<br />
• Beugeübungen nach vorn<br />
Leukämie <strong>und</strong> Lymphomerkrankungen<br />
Empfehlenswert:<br />
• Radfahren (Training auf dem Standfahrrad), Wandern<br />
<strong>und</strong> Nordic-Walking<br />
• Gymnastik <strong>und</strong> Kräftigungsübungen an Geräten<br />
Nicht empfehlenswert:<br />
• <strong>Sport</strong>arten, bei denen das geschwächte Immunsystem<br />
durch krankheitserregende Keime gefährdet werden<br />
könnte: Schwimmen <strong>und</strong> Saunabesuche, <strong>Sport</strong> in<br />
größeren Menschenansammlungen, <strong>Sport</strong>arten mit<br />
Körperkontakt (ggf. können Sie einen M<strong>und</strong>schutz<br />
tragen)<br />
• Ballsportarten nur in abgeschwächter Form z. B. mit<br />
weichen Bällen<br />
• Stoßende <strong>und</strong> reißende <strong>Bewegung</strong>en<br />
Gebärmutterkrebs <strong>und</strong> Leberkrebs<br />
• Siehe Empfehlungen für Magen-Darmkrebspatienten<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 17
Für alle anderen <strong>Krebs</strong>arten gilt: Beginnen Sie erst mit<br />
den Übungen, wenn die Operationsnarben vollständig<br />
abgeheilt sind. Fragen Sie auf jeden Fall im Vorfeld Ihren<br />
Arzt, ob Sie mit dem <strong>Sport</strong> beginnen können. Auch für<br />
krebskranke Kinder gilt, dass <strong>Bewegung</strong>, Spiel <strong>und</strong> <strong>Sport</strong><br />
das gesamte Befinden <strong>und</strong> die Lebensqualität des kleinen<br />
Patienten verbessern können. Eltern <strong>und</strong> Geschwister<br />
sollten in die Therapie mit einbezogen werden. Informieren<br />
Sie sich in der Rehabilitationsklinik, welche Übungen<br />
zu Hause fortgeführt werden können.<br />
Generell gilt: Das Training sollte nicht überfordern, es<br />
sollte keine Schmerzen <strong>und</strong> keinen Muskelkater verursachen!<br />
• Bei Schmerzen: Sofort aufhören!<br />
• Bei Muskelkater: Trainingsdauer <strong>und</strong>/oder -intensität<br />
verringern.<br />
3.6. Kontraindikationen: Wann sollten <strong>Krebs</strong>patienten<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich keinen <strong>Sport</strong> treiben?<br />
„No sports!“ – dieses von Winston Churchill geprägte<br />
Motto ist unbedingt zu befolgen, wenn Sie eine dieser<br />
Beschwerden haben:<br />
• Thrombopenie (=„Thombos“ unter 20.000 Gpt/l):<br />
Bei einer geringen Zahl an Thrombozyten (Blutplättchen)<br />
ist die Blutungsgefahr stark erhöht <strong>und</strong> daher<br />
kein Training möglich. Warten Sie, bis die Werte ansteigen<br />
<strong>und</strong> Ihnen Ihr Arzt „grünes Licht“ gibt.<br />
• Anämie (=Blutarmut: Hämoglobin (=Hb)-Wert unter<br />
8,0 g/dl bzw. 5 mmol/l)<br />
Patienten mit ausgeprägter Anämie fühlen sich so<br />
schwach, dass <strong>Sport</strong> ohnehin jenseits der Belastungsgrenze<br />
liegt. Der wäre dann auch gefährlich <strong>und</strong><br />
könnte zu Herzrhythmusstörungen <strong>und</strong> Herzschwäche<br />
führen. Die Anämie ist aber medikamentös zu beheben.<br />
Bei normalen Hb-Werten kann das Training wieder<br />
aufgenommen werden.<br />
• Akute Blutungen<br />
• Übelkeit / Erbrechen<br />
• Schmerzen<br />
• Kreislaufbeschwerden / Schwindel<br />
• Starke Infekte / Fieber über 38º C<br />
• Bewusstheitseinschränkungen / Verwirrtheitszustände<br />
18
Zudem gelten Einschränkungen bei Leukopenie:<br />
• Der Mangel an weißen Blutkörperchen (Leukopenie)<br />
ist nach schweren Chemotherapien häufig. Es dauert<br />
dann eine Weile, bis sich das Knochenmark von den<br />
Zellgiften erholt <strong>und</strong> neue Blutkörperchen heranreifen.<br />
Bestimmte Medikamente können diesen Prozess beschleunigen.<br />
Per se ist die Leukopenie keine Kontraindikation<br />
für <strong>Sport</strong>. Da aber die Immunabwehr durch den<br />
Mangel an weißen Blutkörperchen geschwächt ist, sind<br />
Gruppensport <strong>und</strong> Wassersportarten wegen möglicher<br />
Infektionsgefahr untersagt.<br />
Außerdem ist zu beachten:<br />
• Kein <strong>Sport</strong> an Tagen, an denen Chemo- oder Strahlentherapien<br />
verabreicht werden!<br />
• Brustkrebspatientinnen, die mit sogenannten monoklonalen<br />
Antikörpern gegen „HER-2/neu“ (Trastuzumab)<br />
behandelt werden, sollten vorerst ganz von<br />
<strong>Sport</strong> absehen, da die Therapie insbesondere in Kombination<br />
mit einer Chemotherapie evtl. die Gefahr der<br />
Herzschwäche bergen könnte. Das wird nun in Studien<br />
überprüft. Solange sich <strong>Sport</strong> bei diesen Patientinnen<br />
nicht als unbedenklich erwiesen hat, sollte davon abgesehen<br />
werden.<br />
3.7. <strong>Sport</strong> für Tumorpatienten:<br />
Wohin wende ich mich? Wer bezahlt es?<br />
<strong>Sport</strong> allein zu treiben, macht den meisten Menschen<br />
weniger Spaß als in der Gruppe – allein verliert man<br />
schnell die Motivation. Es ist daher zu empfehlen, einer<br />
<strong>Krebs</strong>sportgruppe beizutreten. Dort „sportelt“ man<br />
in der Gruppe unter speziell ausgebildeter Aufsicht. Je<br />
nach Gruppe liegt der Schwerpunkt auf einer anderen<br />
<strong>Sport</strong>art (so gibt es Wandergruppen, Radfahrgruppen<br />
etc.). Insgesamt sind im B<strong>und</strong>esgebiet über 800 vom<br />
Landessportb<strong>und</strong> zertifizierte <strong>Krebs</strong>sportgruppen aktiv.<br />
Welche Gruppen es in Ihrer Nähe gibt, können Sie beim<br />
Landessportb<strong>und</strong> Ihres B<strong>und</strong>eslandes sowie auch bei den<br />
Landeskrebsgesellschaften erfragen (wichtige Adressen:<br />
siehe Anhang der Broschüre!).<br />
Dieses <strong>Sport</strong>angebot ist für Betroffene kostenlos. Jeder<br />
<strong>Krebs</strong>patient hat ein Anrecht auf Rehabilitationssport.<br />
So stehen jedem Kassenpatienten 50 Übungsst<strong>und</strong>en (je<br />
mind. 45 Minuten) in einer zertifizierten <strong>Sport</strong>gruppe zu.<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 19
Ihr Arzt füllt dafür ein Formular aus (Muster 56 – zu bestellen<br />
bei der KV), das Sie bei dem Leiter der <strong>Sport</strong>gruppe<br />
abgeben – <strong>und</strong> schon kann´s losgehen!<br />
Wenn die 50 St<strong>und</strong>en „abgearbeitet“ sind, sollte man<br />
nach Möglichkeit nicht aufhören. Die Gebühren, die man<br />
dann selbst tragen muss, sind eine gute Investition in die<br />
eigene Ges<strong>und</strong>heit. Und wenn es doch mal „eng“ aussieht:<br />
Mit Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Gleichgesinnten / Mitpatienten<br />
eine R<strong>und</strong>e durch den Park zu walken oder eine Radtour<br />
zu unternehmen, kostet nichts, macht aber trotzdem<br />
Spaß!<br />
Adressen <strong>und</strong> Ansprechpartner<br />
Im Folgenden haben wir Ihnen eine Liste mit den wichtigsten<br />
Adressen <strong>und</strong> Ansprechpartnern zusammengestellt,<br />
die für Sie hilfreich sind, wenn Sie sich über<br />
Möglichkeiten, Regelungen <strong>und</strong> Beschränkungen der<br />
<strong>Sport</strong>ausübung informieren wollen.<br />
Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e. V.<br />
Schlobigplatz 23<br />
08056 Zwickau<br />
Telefon: 03 75 - 28 14 03<br />
E-Mail: info@skg-ev.de<br />
www.saechsische-krebsgesellschaft-ev.de<br />
Deutsche <strong>Krebs</strong>gesellschaft e. V.<br />
TiergartenTower<br />
Straße des 17. Juni 106 – 108<br />
10623 Berlin<br />
Telefon: 030 - 3 22 93 29 00<br />
www.krebsgesellschaft.de<br />
Deutscher Behindertensportverband e. V.<br />
Friedrich-Alfred-Straße 10<br />
47055 Duisburg<br />
Telefon: 02 03 - 7 17 41 70<br />
E-Mail: dbs@dbs-npc.de<br />
www.dbs-npc.de<br />
20
Sächsischer Behinderten- <strong>und</strong> Versehrtensportverband<br />
e. V.<br />
Am <strong>Sport</strong>forum 10/H2<br />
04105 Leipzig<br />
Telefon: 03 41 - 2 11 38 65<br />
E-Mail: sbv@behindertensport-sachsen.de<br />
www.behindertensport-sachsen.de<br />
Behinderten- <strong>und</strong> Rehabilitations-<strong>Sport</strong>verband<br />
Sachsen-Anhalt e.V.<br />
Ludwig-Wucherer-Straße 86<br />
06108 Halle/Saale<br />
Telefon: 03 45 - 5 17 08 24<br />
E-Mail: info@bssa.de<br />
Landessportb<strong>und</strong> Thüringen e. V.<br />
Werner-Seelenbinder-Straße 1<br />
99096 Erfurt<br />
Telefon: 03 61 - 3 40 54 53<br />
E-Mail: h.hoepfner@lsb-thüringen.de<br />
www.thueringen-sport.de<br />
Thüringer Behinderten- <strong>und</strong> Rehabilitations-<br />
<strong>Sport</strong>verband e. V.<br />
Schützenstraße 4<br />
99096 Erfurt<br />
Telefon: 03 61 - 3 46 05 39<br />
E-Mail: tbrsv@t-online.de<br />
www.behinderten-rehasport.de<br />
Deutscher Olympischer <strong>Sport</strong>b<strong>und</strong><br />
Otto-Fleck-Schneise 12<br />
60528 Frankfurt am Main<br />
Telefon: 069 - 6 70 00<br />
E-Mail: office@dosb.de<br />
www.dosb.de<br />
Landessportb<strong>und</strong> Sachsen e. V.<br />
Goyastraße 2d<br />
04105 Leipzig<br />
Telefon: 03 41 - 21 63 10<br />
E-Mail: lsb@sport-fuer-sachsen.de<br />
www.sport-fuer-sachsen.de<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 21
Deutsche <strong>Sport</strong>hochschule Köln<br />
Am <strong>Sport</strong>park Müngersdorf 6<br />
50933 Köln<br />
Telefon: 02 21 - 49 82 - 0<br />
www.dshs-koeln.de<br />
Verein für Kinder krebskranker Eltern e. V.<br />
Dr. Lida Schneider<br />
Güntherstraße 4a<br />
60528 Frankfurt<br />
Telefon: 0 69 - 67 72 45 04<br />
E-Mail: hkke@hilfe-fuer-kinder-krebskranker.de<br />
www.hilfe-fuer-kinder-krebskranker.de<br />
Deutsche Rentenversicherung<br />
Mitteldeutschland<br />
(ehemals LVA Thüringen, LVA Sachsen-Anhalt <strong>und</strong><br />
LVA Sachsen)<br />
Standort Leipzig<br />
Georg-Schumann-Straße 146<br />
04159 Leipzig<br />
Telefon: 03 41 - 5 50 - 55<br />
Standort Erfurt<br />
Kranichfelder Straße 3<br />
99097 Erfurt<br />
Telefon: 03 61 - 4 82 - 0<br />
Standort Halle<br />
Paracelsusstraße 21<br />
06114 Halle<br />
Telefon: 03 45 - 2 13 - 0<br />
22
Unabhängige Patientenberatung Deutschland –<br />
UPD gemeinnützige GmbH<br />
B<strong>und</strong>esgeschäftsstelle<br />
Littenstraße 10<br />
10179 Berlin<br />
Telefon: 0 30 - 20 08 92 33<br />
E-Mail: info@upd-online.de<br />
www.unabhaengige-patientenberatung.de<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit (BMG)<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit<br />
11055 Berlin<br />
Telefon: 0 30 - 1 84 41 - 0 (b<strong>und</strong>esweiter Ortstarif)<br />
E-Mail: info@bmg.b<strong>und</strong>.de<br />
www.bmg.b<strong>und</strong>.de<br />
Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V. (DFaG)<br />
Maria-Hilf-Straße 15<br />
50677 Köln<br />
Telefon: 02 21 - 9 31 15 96<br />
E-Mail: info@deutsche-fatigue-gesellschaft.de<br />
www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de<br />
2008 Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V. 23
Herausgeber <strong>und</strong> Verleger<br />
Sächsische <strong>Krebs</strong>gesellschaft e.V.<br />
Schlobigplatz 23<br />
08056 Zwickau<br />
Telefon: 03 75 - 281403<br />
Fax: 0375 - 2814 04<br />
E-Mail: info@skg-ev.de<br />
Internet: www.skg-ev.de<br />
Steuer-Nr.: 227/141/02471<br />
ISSN 1869-5728<br />
gedruckt 11/2012