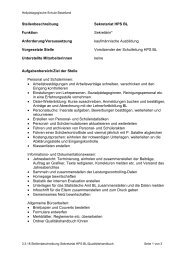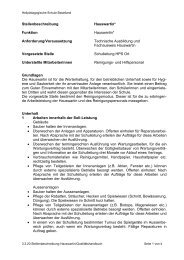Konzept Einzelintegration HPS BL
Konzept Einzelintegration HPS BL
Konzept Einzelintegration HPS BL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Heilpädagogische Schule Baselland<br />
<strong>Konzept</strong> <strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong><br />
für Kindergarten (inkl. 1. Kindergartenjahr),<br />
und Primarschule<br />
für die Schuljahre 05/06 - 07/08<br />
Heilpädagogische Schule Baselland<br />
Kanonengasse 33 - 4410 Liestal - Tel. 061 921 68 13 - Fax 061 921 68 12 - e-mail: is.hps-bl@hps-bl.ch
Inhalt<br />
Gesetzliche Grundlagen...........................................................................................................3<br />
<strong>Einzelintegration</strong> - <strong>Konzept</strong> für Kindergarten und Primarschule...............................................5<br />
1 Einleitung........................................................................................................................5<br />
2 Grundsätze und pädagogisches Modell .........................................................................5<br />
2.1 Grundsätze..............................................................................................................5<br />
2.2 Ziele der integrativen Schulung ...............................................................................6<br />
2.3 Integrative Schulung – das pädagogische Modell ..................................................6<br />
3 <strong>Einzelintegration</strong> in der Regelschule ..............................................................................7<br />
3.1 Zielgruppe...............................................................................................................7<br />
3.2 Das Modell der <strong>Einzelintegration</strong>............................................................................7<br />
3.3 Leitung, Verantwortung und Aufgaben ...................................................................7<br />
3.3.1 Auftraggeber.........................................................................................................7<br />
3.3.2 Schulleitungen der Regel- und Sonderschule ......................................................7<br />
3.3.3 Das Pädagogische Team .....................................................................................8<br />
3.3.4 Aufgaben der Erziehungsberechtigten .................................................................9<br />
3.3.5 Fachlehrpersonen (Textiles Gestalten, Musik, Religion) ......................................9<br />
3.3.6 VIS – Verantwortliche Person für Integrative Schulung von Kindern mit einer<br />
Behinderung .........................................................................................................9<br />
3.3.7 Dienststellen der BKSD ........................................................................................9<br />
3.4 Rahmenbedingungen ...........................................................................................10<br />
3.4.1 Organisatorische Rahmenbedingungen .............................................................10<br />
3.4.2 Zeugnis und Lernbericht.....................................................................................10<br />
3.4.3 Unterstützung der Lehrpersonen........................................................................10<br />
3.4.4 Therapien ...........................................................................................................11<br />
3.4.5 Sicherstellung der <strong>Einzelintegration</strong> ...................................................................11<br />
3.5 Dauer, Verlauf und Weiterführung der integrativen Schulung ..............................11<br />
3.6 Qualitätssicherung und Evaluation .......................................................................12<br />
4 Finanzielle Rahmenbedingungen.................................................................................13<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 2
Gesetzliche Grundlagen<br />
Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998<br />
Art. 18<br />
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.<br />
2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des<br />
Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen,<br />
weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen<br />
oder psychischen Behinderung. ...<br />
4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten<br />
vor.<br />
Art. 41<br />
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater<br />
Initiative dafür ein, dass:<br />
a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat;<br />
b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; ...<br />
f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren<br />
Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können;<br />
g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial<br />
verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen<br />
Integration unterstützt werden.<br />
Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002<br />
Art. 20<br />
2 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder<br />
Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder<br />
und Jugendlicher in die Regelschule.<br />
Bildungsgesetz des Kantons Basel-Landschaft vom 6. Juni 2002<br />
§ 4<br />
3 Schüler und Schülerinnen mit einer Behinderung haben Anspruch auf eine ihnen gemässe<br />
Sonderschulung oder Ausbildung.<br />
§ 47<br />
Die Sonderschulung vermittelt eine der Behinderung angepasste Bildung, fördert die<br />
Persönlichkeitsentwicklung, eine möglichst selbständige Lebensführung und die soziale<br />
Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung.<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 3
Verordnung für die Sonderschulung vom 13. Mai 2003<br />
§ 4 Prüfung integrativer Schulungsmöglichkeiten<br />
1 Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung haben Anspruch darauf, dass vor einem<br />
Entscheid über den Eintritt in eine spezielle Schule der Sonderschulung oder in eine<br />
stationäre Einrichtung der Sonderschulung geprüft wird, ob sie mit Stützmassnahmen eine<br />
öffentliche Volksschule besuchen können.<br />
2 Besuchen sie eine Schule oder stationäre Einrichtung der Sonderschulung, haben sie<br />
Anspruch darauf, dass die Möglichkeit ihrer Eingliederung in eine öffentliche Volksschule<br />
regelmässig überprüft wird.<br />
Verordnung für die Schulleitungen vom 13. Mai 2003<br />
IV. Aufgaben, § 20 Pflichtenheft<br />
l. sie sorgt zusammen mit den zuständigen Fachstellen für die Integration von<br />
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen<br />
Verordnung über Beurteilung, Beförderung, Zeugnis und Übertritt<br />
vom 9. November 2004<br />
F. Spezielle Förderung und Sonderschulung<br />
§ 55 Spezielle Förderung<br />
1<br />
Jährlich führt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer der Kleinklasse mindestens ein<br />
Gespräch mit den Erziehungsberechtigten durch und erstellt darüber eine Aktennotiz.<br />
2 Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse und des Werkjahres sowie der integrativen<br />
Schulungsform werden gemäss den Anforderungen des Stufenlehrplans und den<br />
Bestimmungen der jeweiligen Regelschule beurteilt.<br />
3 Für Schülerinnen und Schüler, welche die Anforderungen der Primarschule oder der<br />
Sekundarschule Niveau A nicht oder nur zum Teil erfüllen, erfolgt die Beurteilung im Sinne<br />
der Lerndiagnostik nach der individuellen Bezugsnorm und den Ausführungsbestimmungen<br />
des Reglementes gemäss § 14. Die Leistungsbeurteilung erfolgt mit einem jährlichen<br />
Bericht. Der Vermerk im Zeugnis lautet „Leistungsbeurteilung und Beförderungsentscheid<br />
gemäss § 55 Absatz 3“<br />
.......<br />
§ 56 Sonderschulung<br />
1<br />
Für Schülerinnen und Schüler der Sonderschulung, welche mit Stützmassnahmen<br />
Regelklassen besuchen, können die Bestimmungen gemäss § 55 Absätze 1 bis 3<br />
angewendet werden.<br />
2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Sonderschulung.<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 4
<strong>Einzelintegration</strong> - <strong>Konzept</strong> für Kindergarten und Primarschule<br />
Für die Schuljahre 05/06 – 07/08<br />
1 Einleitung<br />
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf wenn immer möglich integrativ zu<br />
schulen, ist heute ein allgemein anerkanntes Postulat. Die Forderung nach integrativer<br />
Schulung wird von betroffenen Eltern und von Behindertenorganisationen erhoben und von<br />
Gesetzgebung und IV unterstützt.<br />
Während im Kanton Baselland schon seit Mitte der 80iger-Jahre sinnesbehinderte Kinder<br />
integrativ geschult werden, konnte die integrative Schulung von Kindern mit einer geistigen<br />
Behinderung bisher nur vereinzelt realisiert werden (Finanzierung durch die IV seit 1998).<br />
Gesamtschweizerisch liegen heute bereits mehrjährige Erfahrungen mit verschiedenen<br />
Integrationsformen vor, auf den Schulstufen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe 1.<br />
Der Kanton Baselland (BKSD, Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe)<br />
fördert gezielt den Ausbau der integrativen Schulung. Neben der Form von<br />
<strong>Einzelintegration</strong>en werden seit August 2004 auch Integrationsklassen realisiert (vgl.<br />
„Projektbeschrieb für Integrationsklassen“).<br />
Das vorliegende <strong>Konzept</strong> stützt sich auf Erfahrungen mit <strong>Einzelintegration</strong>en und anderen<br />
Integrationsmodellen im Kanton Basel-Land und in anderen Kantonen. Es definiert die<br />
Grundlagen für die integrative Schulung einzelner Kinder mit einer geistigen Behinderung in<br />
einer Regelklasse des Kindergartens und der Primar- oder Sekundarschule. Abläufe,<br />
Strukturen, Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten werden definiert im Hinblick auf eine<br />
optimale Förderung und Integration aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse.<br />
Projektgrundlagen sind das kantonale Bildungsgesetz und seine Verordnungen und für die<br />
Dauer des Projektes die Bestimmungen der eidgenössischen Invalidenversicherung IV über<br />
die Sonderschulung.<br />
Das Projekt stützt sich auf die bestehende Leistungsvereinbarung zwischen der Bildungs-,<br />
Kultur- und Sportdirektion Kanton Basel-Landschaft und insieme, Verein zur Förderung<br />
geistig Behinderter Baselland, für die Leistungen der Heilpädagogischen Schule Baselland.<br />
Im Hinblick auf den Rückzug der IV aus der Sonderschulung mit dem Inkrafttreten des neuen<br />
Finanzausgleiches NFA (voraussichtlich 2008) werden die gesetzlichen Grundlagen und die<br />
Projektbedingungen auf diesen Zeitpunkt hin überprüft und aktualisiert.<br />
2 Grundsätze und pädagogisches Modell<br />
2.1 Grundsätze<br />
• Anerkennung des grundsätzlichen Anspruchs behinderter Kinder und Jugendlicher<br />
(vertreten durch die Erziehungsberechtigen) auf integrative Schulung, das heisst, leben<br />
und lernen gemeinsam mit nicht behinderten Kindern und Jugendlichen, soweit dies aus<br />
Sicht des Kindes/Jugendlichen und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden<br />
Ressourcen (veränderbaren!) sinnvoll scheint.<br />
• Allen Formen von integrativer Schulung liegt die Überzeugung zugrunde, dass Erziehung<br />
und Bildung in unterschiedlich zusammengesetzten Gruppen für alle beteiligten<br />
Schülerinnen und Schüler entwicklungsfördernd ist.<br />
• Anspruch auf individuelle Abklärung. Sonderschulmassnahmen stützen sich auf die<br />
diagnostizierten Förderbedürfnisse des Kindes und berücksichtigen dessen Umfeld.<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 5
2.2 Ziele der integrativen Schulung<br />
Integrative Schulung verfolgt gleichzeitig mehrere Ziele:<br />
• die soziale Integration der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen in den<br />
Klassenverband und Partizipation an allen Klassenaktivitäten<br />
• die inhaltlich-fachliche Integration im Sinne eines Lernens am „gemeinsamen<br />
Gegenstand“<br />
• die optimale Förderung aller Kinder (mit und ohne Behinderung) entsprechend ihren<br />
individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen.<br />
• gemeinsames Nutzen der vorhandenen Ressourcen der Regel- und der Sonderschule.<br />
2.3 Integrative Schulung – das pädagogische Modell<br />
Integrative Schulung meint die gemeinsame Schulung von behinderten und nicht<br />
behinderten Kindern und Jugendlichen in einer Klasse der Regelschule. Die Schülerinnen<br />
und Schüler mit einer geistigen Behinderung sind ganz oder teilweise von den Lernzielen der<br />
Regelschule befreit und werden aufgrund ihrer besonderen Bedürfnisse im Rahmen<br />
individueller Ziele gefördert.<br />
Die integrativ geschulten Kinder gehören zur Klasse, das heisst, sie gelten im Schulalltag als<br />
Schülerinnen und Schüler der Regelschule und nehmen im Rahmen des geltenden<br />
Stundenplans am Unterricht teil. Während einer festgelegten Anzahl von Lektionen werden<br />
sie von einer heilpädagogisch ausgebildeten zusätzlichen Lehrperson gefördert und<br />
begleitet.<br />
Die Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung leben und lernen gemeinsam und<br />
arbeiten an den gleichen Themen. Dabei verfolgen sie entsprechend ihren Möglichkeiten<br />
unterschiedliche Lernziele und werden mit verschiedenen Methoden und Medien<br />
unterrichtet. Besondere Anlässe (Ausflüge, Lager, Elternanlässe usw.) finden für alle Kinder<br />
der Klasse grundsätzlich gemeinsam statt. Es gelten der Lehrplan und das Angebot der<br />
Regelschule.<br />
Der Einsatz individualisierender und differenzierender Unterrichtsformen (Differenzierung der<br />
Ziele, Methoden und Medien) ist Voraussetzung für die optimale Förderung aller Kinder in<br />
der Klasse.<br />
Die Regellehrpersonen und die heilpädagogische Lehrperson bilden das pädagogische<br />
Team. Sie tragen gemeinsam die Verantwortung für das Gelingen der integrativen Schulung.<br />
Die Schulung der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen erfolgt „so normal wie<br />
möglich". Das heisst: der Unterricht, der Schulalltag, aber auch die flankierenden<br />
Massnahmen und Rahmenbedingungen (Beurteilung, Stundenplan, Elternkontakte usw.)<br />
sollen möglichst gleichartig wie bei den andern Schülern und Schülerinnen gestaltet sein.<br />
Soziale Integration und Normalisierung sind gleichzeitig Mittel und Ziel des<br />
Integrationsprozesses. Die Annäherung an das Ziel braucht Zeit, mit Hindernissen und<br />
Umwegen ist zu rechnen.<br />
Voraussetzung für integrativen Unterricht:<br />
• Inhaltliches Interesse der Beteiligten<br />
• Individualisierende/differenzierende Methodik/Didaktik des Unterrichts (Differenzierung<br />
der Ziele, Methoden und Medien)<br />
• Zusammenarbeit zwischen den Regellehrpersonen und den heilpädagogischen<br />
Lehrpersonen (festes Gefäss für Absprachen, Austausch, Vor- und Nachbereitung)<br />
• Fachliche Begleitung des pädagogischen Teams in Fragen, die sich im Zusammenhang<br />
mit der integrativen Schulung ergeben<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 6
3 <strong>Einzelintegration</strong> in der Regelschule<br />
3.1 Zielgruppe<br />
Dieses <strong>Konzept</strong> beschreibt die Bedingungen für die integrative Schulung einer einzelnen<br />
Schülerin oder eines einzelnen Schülers mit einer geistigen Behinderung (im Sinne der IV) in<br />
einer Klasse der Regelschule. Im Folgenden wird die Bezeichnung „ Kind oder Jugendlicher<br />
mit einer Behinderung“ verwendet.<br />
3.2 Das Modell der <strong>Einzelintegration</strong><br />
Ein einzelintegriertes Kind wird in einer Regelklasse unterrichtet und wird während 6<br />
Lektionen wöchentlich (in begründeten Fällen auch bis 8 Lektionen) von einer<br />
heilpädagogischen Lehrperson zusätzlich unterstützt und begleitet. Während des grösseren<br />
Teils des Unterrichts muss es ohne direkte Unterstützung der heilpädagogischen Lehrperson<br />
am Unterricht teilnehmen und in angemessener Weise davon profitieren können.<br />
Voraussetzungen<br />
Damit eine integrative Schulung nach dem Modell der <strong>Einzelintegration</strong> möglich ist, müssen<br />
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:<br />
• Abklärung durch den SPD<br />
• Empfehlung der integrativen Schulung durch den SPD an die Schulleitung der<br />
Regelschule<br />
• Die Eltern informieren die Schulleitung der Regelschule (Informationspflicht)<br />
• „Runder Tisch“ mit den an der Integration beteiligten Fachpersonen (Lehrperson<br />
Regelschule, Schulleitung Regelschule, Verantwortliche Person für integrative Schulung<br />
der <strong>HPS</strong>-<strong>BL</strong> (VIS), evtl. therapeutische Fachperson, Früherzieherin, Vorschulheilpädagogin,<br />
evtl. Vertretungen des Schulpsychologischen Dienstes und/oder des Amts für<br />
Volksschulen) zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und zur Vereinbarung des<br />
weiteren Vorgehens<br />
• Antrag der Eltern auf Sonderschulung in Form von Stützmassnahmen an die Fachstelle<br />
für Sonderschulung (mit Begründung des SPD)<br />
• Anmeldung in die Heilpädagogische Schule Baselland (Sekretariat <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong>)<br />
• Die Kooperation zwischen Regelschule und der zuständigen Sonderschule wird in einer<br />
Kooperationsvereinbarung geregelt.<br />
• Die Unterstützung wird von einer heilpädagogischen Fachperson der <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong><br />
übernommen.<br />
• Alle Beteiligten haben Kenntnis vom Integrationskonzept<br />
3.3 Leitung, Verantwortung und Aufgaben<br />
3.3.1 Auftraggeber<br />
Auftraggeber für die Durchführung der Stützmassnahmen ist der Kanton, vertreten durch die<br />
Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe.<br />
3.3.2 Schulleitungen der Regel- und Sonderschule<br />
Verantwortung<br />
Voraussetzung für die integrative Schulung der Kinder mit einer Behinderung ist die<br />
Kooperation zwischen einer Regelschule und der zuständigen Heilpädagogischen Schule<br />
(Standort Münchenstein, Liestal-Frenkendorf oder Sissach). Die Schulleitungen der beiden<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 7
Schulen teilen die Verantwortung für die integrative Schulung. Sie vertreten das Angebot<br />
nach aussen und sorgen für die Einhaltung der festgelegten Rahmenbedingungen.<br />
Kooperationsvereinbarung<br />
Die Kooperation wird in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Schulleitung der<br />
Regelschule und der VIS beschrieben. Die Kooperationsvereinbarung regelt die für das<br />
jeweilige Angebot vereinbarten Rahmenbedingungen, die personellen Zuständigkeiten,<br />
sowie finanzielle und allfällige besondere Abmachungen. Für jeden einzeln integrierten<br />
Schüler oder jede einzeln integrierte Schülerin wird eine separate Vereinbarung<br />
geschlossen.<br />
Aufgaben der Schulleitung der Regelschule<br />
• Fachaufsicht über die ihr unterstellte Lehrperson (Unterrichtsbesuch, Standortgespräch)<br />
• Sie wertet in der Regel jährlich die Zusammenarbeit zwischen Sonderschule und<br />
Regelschule aus und sie überprüft die Wirkung der Integration<br />
Aufgaben der zuständigen Schulleitung der Heilpädagogischen Schule<br />
Baselland<br />
• Fachaufsicht über die ihr unterstellte heilpädagogische Lehrperson (Unterrichtsbesuch,<br />
Standortgespräch)<br />
• Organisation der Stellvertretung bei krankheitsbedingter Abwesenheit der heilpädagogischen<br />
Lehrperson<br />
• Anlaufstelle für direkt Beteiligte<br />
• Wahrnehmen der verbindlichen Termine (3.6)<br />
• Auswertung der Unterstützung im Einzelfall und Wirkungsüberprüfung im Controlling der<br />
Leistung „integrative Schulung“<br />
3.3.3 Das Pädagogische Team<br />
Das Pädagogische Team setzt sich zusammen aus der Klassenlehrperson der Regelschule<br />
und einer heilpädagogischen Lehrperson der Heilpädagogischen Schule Baselland<br />
Aufgaben der heilpädagogischen Lehrperson<br />
• Förderplanung für die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler mit Behinderung in<br />
Zusammenarbeit mit den Regellehrpersonen<br />
• Förderung und Begleitung der Schülerin oder des Schülers mit Behinderung in Einzel-,<br />
Gruppen- und Klassensituationen<br />
• Periodische Überprüfung und Anpassung der Förderziele<br />
• Beteiligung am Klassenunterricht durch Team-Teaching, Rollenwechsel (assistierende<br />
und leitende Funktion), Arbeit mit verschieden zusammengesetzten Kleingruppen<br />
• Absprachen, Austausch, Vor-/Nachbereitung mit der Regellehrperson<br />
• Information und Beratung der Regellehrperson und von Fachlehrpersonen im Hinblick<br />
auf die Schülerin oder den Schüler mit einer Behinderung (Lernziele, besondere<br />
Methoden, Behinderung etc.)<br />
• Bereitstellen von geeigneten Arbeitsmaterialien und Lehrmitteln für die Schülerin oder<br />
den Schüler mit einer Behinderung<br />
• Teilnahme an Elternabenden und anderen Anlässen der Klasse<br />
• Kontakt mit den Eltern der Schülerin oder des Schülers mit Behinderung in allen<br />
Belangen der spezifischen Förderung und Mitwirkung am regulären Beurteilungsgespräch<br />
für das integrativ geschulte Kind.<br />
Aufgaben der Regellehrperson bezogen auf die integrativ geschulten Kinder<br />
• Ermöglichen der Teilnahme am Unterricht und der Umsetzung der Förderziele durch<br />
Differenzierung der Lehrmittel, Methoden und Medien im Unterricht<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 8
• Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Lehrperson im Unterricht (Team-Teaching,<br />
Rollenwechsel)<br />
• Absprachen, Austausch, Vor-/Nachbereitung mit der heilpädagogischen Lehrperson<br />
• Die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gelten im Schulalltag als reguläre<br />
Schülerinnen und Schüler der Klasse und die Regellehrperson hat ihnen gegenüber alle<br />
üblichen Funktionen und Aufgaben wahrzunehmen.<br />
Gemeinsame Verantwortung<br />
Die Lehrpersonen des pädagogischen Teams sind gemeinsam verantwortlich für die Qualität<br />
der integrativen Schulung im Hinblick auf alle Kinder der Klasse. Sie planen und organisieren<br />
den Unterricht in eigener Kompetenz. Grundlagen sind dabei der Lehrplan der Regelschule<br />
und die individuellen Förderziele des integrativ geschulten Kindes oder Jugendlichen.<br />
Die Verantwortung für die Erreichung der Ziele der Regelschule und für die Klasse als<br />
Ganzes liegt bei der Regellehrperson. Die heilpädagogische Lehrperson beachtet die in der<br />
Klasse geltenden Regelungen und Abmachungen.<br />
3.3.4 Aufgaben der Erziehungsberechtigten<br />
Die Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten sind im Bildungsgesetz vom 6. Juni<br />
2002, § 66 bis § 69, umschrieben.<br />
3.3.5 Fachlehrpersonen (Textiles Gestalten, Musik, Religion)<br />
Die Heilpädagogische Lehrperson ist dafür besorgt, dass die Fachlehrpersonen, bei welchen<br />
das integriert geschulte Kind mit einer Behinderung den Fachunterricht besucht, die<br />
benötigten Informationen zur integrativen Schulung und zu spezifischen Fragen der<br />
Behinderung erhalten.<br />
3.3.6 VIS – Verantwortliche Person für Integrative Schulung von Kindern mit einer<br />
Behinderung<br />
Um die Koordination und Information im Gesamtsystem zu sichern und eine Anlaufstelle bei<br />
auftauchenden Fragen und Problemen zu bieten, ist ein Mitglied der Schulleitung <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> als<br />
verantwortliche Person (VIS) zuständig<br />
Aufgaben der VIS<br />
Die VIS ist verantwortlich für<br />
• <strong>Konzept</strong>uelle Arbeiten inkl. Formulierung der Kooperationsvereinbarung<br />
• Koordination der Zusammenarbeit der Beteiligten<br />
• Koordination der Informationen die das Gesamtsystem betreffen<br />
• Koordination der Berichterstattung<br />
• Fachliche Begleitung der pädagogischen Teams<br />
• Angebot für Weiterbildung und Erfahrungsaustausch der Heilpädagogen und<br />
Heilpädagoginnen<br />
• Evaluation und Weiterentwicklung des Projektes<br />
3.3.7 Dienststellen der BKSD<br />
Schulpsychologischer Dienst<br />
Die Fachperson des Schulpsychologischen Dienstes, welche den speziellen Förderbedarf<br />
des integrativ geschulten Kindes abgeklärt und die entsprechenden Empfehlungen<br />
abgegeben hat, ist zusätzliche Ansprechstelle für Eltern, Lehrpersonen und weitere Beteiligte<br />
in Fragen, welche die Entwicklung des Kindes betreffen.<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 9
Amt für Volksschulen<br />
Das Amt für Volksschulen unterstützt die Schulleitung der Regelschule bei der Auswertung<br />
der Zusammenarbeit mit der Sonderschule sowie der Wirkung der Integration.<br />
Es kann beigezogen werden für Fragen der Kooperation von Regelschule und Sonderschule.<br />
Es genehmigt die Kooperationsvereinbarung und stellt Antrag an die Fachstelle für<br />
Sonderschulung.<br />
Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe<br />
Bewilligt die Stützmassnahmen und hat die Aufsicht darüber.<br />
Stellt Antrag ans BSV.<br />
3.4 Rahmenbedingungen<br />
3.4.1 Organisatorische Rahmenbedingungen<br />
Die nach dem Modell der <strong>Einzelintegration</strong> geschulten Kinder oder Jugendlichen mit einer<br />
Behinderung besuchen den Unterricht in einer Regelklasse an ihrem Wohnort. Sie werden,<br />
je nach Behinderungsgrad und Schulstufe 6 – 8 Lektionen pro Woche heilpädagogisch<br />
unterstützt und begleitet. Sie sind Schülerinnen und Schüler der Regelschule.<br />
Die normale Infrastruktur wird von der Regelschule zur Verfügung gestellt.<br />
Behinderungsspezifische Hilfsmittel stellt die Heilpädagogische Schule zur Verfügung.<br />
Wenn eine Lehrperson ausfällt, wird von der jeweils zuständigen Schulleitung die<br />
Stellvertretung organisiert.<br />
3.4.2 Zeugnis und Lernbericht<br />
Die Kinder mit Behinderungen sind von den Lernzielen der Regelschule ganz oder teilweise<br />
befreit. Die heilpädagogische Lehrperson formuliert in Zusammenarbeit mit der<br />
Regellehrperson die individuellen Förderziele für das integrativ geschulte Kind. Die<br />
Förderziele werden periodisch überprüft und neu festgelegt.<br />
Zeugnisse, Beurteilungsgespräche und Lernberichte werden möglichst analog zum regulären<br />
Vorgehen ausgeführt (Verordnung BBZ 2004). Das Zeugnis bestätigt den Schulbesuch und<br />
enthält einen Hinweis darauf, dass das betreffende Kind ganz oder teilweise von den<br />
Lernzielen der Regelschule befreit ist. Ein Lernbericht ergänzt das Zeugnis.<br />
3.4.3 Unterstützung der Lehrpersonen<br />
Es wird erwartet dass die Klassenlehrperson der Regelschule und die Heilpädagogische<br />
Lehrperson für ihren Mehraufwand für Koordination, Planung und Evaluation im<br />
Zusammenhang mit der integrativen Schulung Entlastungsstunden im Umfang von je einer<br />
Lektion pro Woche (dies entspricht ca. 1,5 Arbeitsstunden) erhalten. Das pädagogische<br />
Team installiert eine im Stundenplan ausgewiesene Teamsitzung.<br />
Wenn die Stelle der Klassenlehrperson im Job-Sharing besetzt ist, regeln die Beteiligten die<br />
anteilmässige Verteilung mit der Schulleitung vor Beginn des Schuljahres. Eine geeignete<br />
Kompensationsform muss mit der Schulleitung abgesprochen werden.<br />
Die Heilpädagogische Lehrperson hat die Möglichkeit sich in einer geleiteten<br />
Erfahrungsgruppe mit anderen integrativ arbeitenden Heilpädagogen und Heilpädagoginnen<br />
auszutauschen.<br />
Das pädagogische Team kann bei Bedarf bei der VIS fachliche Beratung anfordern. Diese<br />
Beratung kann Fragen der integrativen Schulung und Fragen der Zusammenarbeit im Team<br />
betreffen.<br />
Dem Pädagogischen Teams steht es offen, für temporäre Supervision das Angebot der<br />
Fachstelle Erwachsenenbildung in Anspruch zu nehmen. Die Supervision müsste durch die<br />
einzelnen Lehrpersonen über ihre Schulleitungen beantragt werden.<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 10
Alle Lehrpersonen haben das Recht und die Pflicht, ihr Wissen bezüglich integrativer<br />
Schulung zu erweitern. Die Teilnahme an entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen,<br />
Tagungen, Hospitationen usw. muss von den Lehrpersonen mit der zuständigen Schulleitung<br />
abgesprochen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Schulleitungen<br />
integrationsspezifische Weiterbildungsvorhaben unterstützen und ermöglichen.<br />
3.4.4 Therapien<br />
Für das Organisieren der notwendigen medizinischen Therapien ist die zuständige<br />
Heilpädagogische Schule verantwortlich. Logopädie wird von der Regelschule organisiert<br />
und von der Heilpädagogischen Schule finanziert.<br />
3.4.5 Sicherstellung der <strong>Einzelintegration</strong><br />
Bei nachgewiesenem Bedarf kann die Heilpädagogische Schule für bestimmte Aufgaben zur<br />
Unterstützung des integrierten Kindes oder Jugendlichen für eine festgelegte Anzahl<br />
Lektionen zusätzlich eine Schulhilfe einsetzen.<br />
3.5 Dauer, Verlauf und Weiterführung der integrativen Schulung<br />
Grundsätzlich ist die integrative Schulung auf die gesamte Kindergarten und/oder<br />
Primarschulzeit angelegt (5 Jahre). Im Rahmen der normalen Förderplanung und sowie der<br />
verbindlich festgelegten Standortbestimmungen (siehe 3.6) wird die Qualität der integrativen<br />
Schulung laufend überprüft im Hinblick auf das einzelne integrativ geschulte Kind.<br />
Standortbestimmungen finden mindestens halbjährlich statt (vgl.3.6, Gefässe zur<br />
Qualitätssicherung).<br />
Beim Vorliegen von entsprechenden Gründen und unter Einbezug aller Beteiligten kann die<br />
integrative Schulung eines einzelintegrierten Kindes auch während des Schuljahres<br />
abgebrochen werden. Die Heilpädagogische Schule <strong>BL</strong> verpflichtet sich, das Kind in eine<br />
ihrer Schulen aufzunehmen oder ist behilflich bei der Suche einer anderen Anschlusslösung.<br />
Über Weiterführung oder allfällige Veränderungen und Anpassungen der integrativen<br />
Schulung entscheiden die beiden Schulleitungen gemeinsam auf der Grundlage einer<br />
gemeinsamen Standortbestimmung (strategische Sitzung) mit dem pädagogischen Team<br />
jeweils im März des laufenden Schuljahres. Bei drohendem Abbruch wird ein Runder Tisch<br />
einberufen mit den Schulleitungen von Regelschule und <strong>HPS</strong>, SPD, AVS und der VIS. Bei<br />
Uneinigkeit entscheidet die Schulleitung der Regelschule. Die Eltern werden über den<br />
Entscheid mündlich informiert (2 bis 3 Teilnehmende am Runden Tisch), im Anschluss auch<br />
schriftlich, unter Aufführung einer Rechtsmittelbelehrung.<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 11
3.6 Qualitätssicherung und Evaluation<br />
Durch regelmässige Kontakte zwischen den am Projekt Beteiligten soll die Qualität der integrativen<br />
Schulung laufend überprüft werden. Es werden verbindliche Gefässe zur<br />
Qualitätssicherung festgelegt. Das vorliegende <strong>Konzept</strong> wird laufend evaluiert und wenn<br />
notwendig überarbeitet.<br />
Spätester<br />
Zeitpunkt<br />
Mai/Juni<br />
Anlass Ziel Teilnehmende verantwortlich<br />
Vorbereitungssitzung<br />
Bei Beginn einer neuen<br />
Integration, bei<br />
Stufenwechsel und bei<br />
neu zusammengesetzten<br />
Teams<br />
Vorbereitung des Schulstarts<br />
Grundverständnis von<br />
Integration<br />
Struktur des Projektes<br />
vorstellen offene Fragen<br />
klären (Information der<br />
anderen Eltern;<br />
Zuständigkeiten etc.)<br />
Pädagogisches Team,<br />
Erziehungsberechtigte,<br />
Schulleitung der<br />
zuständigen <strong>HPS</strong>,<br />
Schulleitung der<br />
Regelschule<br />
Schulleitung der<br />
zuständigen <strong>HPS</strong><br />
und/oder<br />
Schulleitung der<br />
RS<br />
November<br />
Standortbestimmung<br />
Erste Erfahrungen austauschen,<br />
offene Fragen<br />
klären, allfällige Probleme<br />
früh erkennen<br />
Pädagogisches Team,<br />
Schulleitung der<br />
zuständigen <strong>HPS</strong>,<br />
Schulleitung der<br />
Regelschule<br />
Schulleitung der<br />
zuständigen <strong>HPS</strong><br />
und/oder<br />
Schulleitung der<br />
RS<br />
Februar /<br />
März<br />
Standortbestimmung<br />
strategische Sitzung<br />
Austausch über Stand des<br />
Projektes und Planung der<br />
Weiterführung<br />
Pädagogisches Team,<br />
Schulleitung der<br />
zuständigen <strong>HPS</strong>,<br />
Schulleitung der<br />
Regelschule,<br />
SPD,<br />
AVS<br />
Schulleitung der<br />
zuständigen <strong>HPS</strong><br />
und/oder<br />
Schulleitung der<br />
RS<br />
Bei<br />
drohendem<br />
Abbruch<br />
Krisensitzung<br />
Die Gründe, welche die<br />
Integration gefährden klären.<br />
Verschiedene Möglichkeiten<br />
aufzeigen.<br />
Nächste Schritte planen.<br />
VIS,<br />
Erziehungsberechtigte,<br />
VertreterInnen von<br />
Sonderschule und<br />
Regelschule,<br />
SPD,<br />
AVS<br />
VIS<br />
Die aufgeführten Gespräche sind verbindlich für alle genannten Teilnehmenden. Wenn<br />
notwendig sollen weitere Beteiligte beigezogen werden und/oder weitere Besprechungen<br />
organisiert werden.<br />
Selbstverständlich finden zusätzlich im regulären Rahmen Gespräche statt zwischen<br />
unterschiedlichen Beteiligten (z.B. Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen, Lehrpersonen<br />
und Fachstellen).<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 12
4 Finanzielle Rahmenbedingungen<br />
• Das Pensum der Regelklassenlehrpersonen wird vom Schulträger gemäss den<br />
Regelungen des Bildungsgesetzes und des Finanzausgleichs finanziert.<br />
• Die Stützmassnahmen der <strong>HPS</strong> werden durch den Kanton finanziert unter<br />
Berücksichtigung der Beträge der IV.<br />
• Bis zum Entscheid des Rechtsdienstes des Regierungsrates über die Finanzierung der<br />
Entlastungsstunde für die Regellehrperson wird die Lektion gemäss gebundenem<br />
Finanzausgleich von den Gemeinden finanziert.<br />
• Behinderungsspezifisches methodisch-didaktisches Material wird von der Heilpädagogischen<br />
Schule <strong>BL</strong> finanziert.<br />
• Für das Regelschulmaterial ist die Regelschule zuständig.<br />
Liestal, im Februar 2006<br />
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 13
<strong>Einzelintegration</strong> <strong>HPS</strong> <strong>BL</strong> – <strong>Konzept</strong> KIGA/PS – 2005-2008 – Februar 2006 14