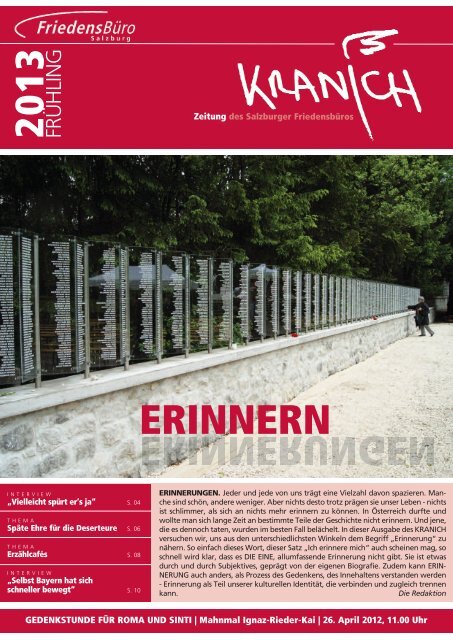Kranich 3-06_14 - Friedensbüro Salzburg
Kranich 3-06_14 - Friedensbüro Salzburg
Kranich 3-06_14 - Friedensbüro Salzburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2013<br />
FRÜHLING<br />
Zeitung<br />
ERINNERN<br />
I N T E R V I E W<br />
„Vielleicht spürt er’s ja“ S. 04<br />
T H E M A<br />
Späte Ehre für die Deserteure S. <strong>06</strong><br />
T H E M A<br />
Erzählcafés S. 08<br />
I N T E R V I E W<br />
„Selbst Bayern hat sich<br />
schneller bewegt“ S. 10<br />
ERINNERUNGEN. Jeder und jede von uns trägt eine Vielzahl davon spazieren. Manche<br />
sind schön, andere weniger. Aber nichts desto trotz prägen sie unser Leben - nichts<br />
ist schlimmer, als sich an nichts mehr erinnern zu können. In Österreich durfte und<br />
wollte man sich lange Zeit an bestimmte Teile der Geschichte nicht erinnern. Und jene,<br />
die es dennoch taten, wurden im besten Fall belächelt. In dieser Ausgabe des KRANICH<br />
versuchen wir, uns aus den unterschiedlichsten Winkeln dem Begriff „Erinnerung“ zu<br />
nähern. So einfach dieses Wort, dieser Satz „Ich erinnere mich“ auch scheinen mag, so<br />
schnell wird klar, dass es DIE EINE, allumfassende Erinnerung nicht gibt. Sie ist etwas<br />
durch und durch Subjektives, geprägt von der eigenen Biografie. Zudem kann ERIN-<br />
NERUNG auch anders, als Prozess des Gedenkens, des Innehaltens verstanden werden<br />
- Erinnerung als Teil unserer kulturellen Identität, die verbinden und zugleich trennen<br />
kann.<br />
Die Redaktion<br />
GEDENKSTUNDE FÜR ROMA UND SINTI | Mahnmal Ignaz-Rieder-Kai | 26. April 2012, 11.00 Uhr
INTERVIEW<br />
Christine Czuma, Obfrau des<br />
Friedensbüros <strong>Salzburg</strong><br />
I N H A L T<br />
02 Kommentar<br />
KONTAKTBOX<br />
IMPRESSUM<br />
03 Kurz&Bündig<br />
04 „Vielleicht spürt er’s ja“<br />
<strong>06</strong> Späte Ehre für die Deserteure<br />
08 Erzählcafés<br />
10 „Selbst Bayern hat sich<br />
schneller bewegt“<br />
12 Biografische Erinnerungen<br />
als Quellen der Erkenntnis<br />
13 „Ich wollte nicht mehr<br />
Teil dieses Krieges sein“<br />
<strong>14</strong> Veranstaltungen<br />
So können Sie uns erreichen:<br />
Friedensbüro <strong>Salzburg</strong><br />
Franz-Josef-Str. 3, 5020 <strong>Salzburg</strong><br />
tel/fax: <strong>06</strong>62/87 39 31<br />
e-mail: office@friedensbuero.at<br />
www.friedensbuero.at<br />
Bankverbindung: <strong>Salzburg</strong>er Sparkasse,<br />
BLZ 20404, Konto-Nr. 17434<br />
Öffnungszeiten:<br />
Mo&Mi: 9–11 Uhr • Di&Do: 15–18 Uhr<br />
DER KRANICH<br />
Nr. 01/2013<br />
An der Erstellung dieser Ausgabe<br />
haben mitgewirkt: Ingo Bieringer, Christine<br />
Czuma, Hans Peter Graß, Daniela Köck, Eva<br />
Navran, Kathrin Quatember, Desirée Summerer<br />
Layout: Kathrin Quatember<br />
Grafisches Grundkonzept: Eric Pratter<br />
Titelbild: Kathrin Quatember<br />
Gedächtnis ist ein<br />
dynamisches Konzept<br />
An einem sonnigen Herbsttag Anfang November gehe ich über den Kommunalfriedhof.<br />
Die Allerheiligenblumen leuchten noch frisch farbig. Auch die<br />
Kranzschleifen von Parteien und Institutionen auf Gedenkkränzen leuchten<br />
noch kräftig rot-weiß-rot und blau; etwa zehn Kränze, auf Metallständern<br />
befestigt, stehen vor dem Kriegerdenkmal. Auf der untersten Stufe des Denkmals<br />
lehnt noch ein Kranz, auf dessen weißer Schleife steht: „Wir gedenken<br />
der Deserteure und Widerstandskämpfer, ermordet von der SS“. Einige Tage<br />
später sehe ich den Kranz am selben Ort, unversehrt. – Ich erinnere mich: Im<br />
Jahr 1997 wurde die Niederlegung eines Kranzes an derselben Stelle mit derselben<br />
Aufschrift verboten; es wurde trotzdem versucht; einer der Beteiligten,<br />
W. Kastner, erhielt eine Geldstrafe von 2000 Schilling<br />
Gedächtnis – die Entscheidung, was öffentlich erinnert wird und aus welcher<br />
Perspektive – hängt von den jeweiligen sozialen und politischen Bedingungen<br />
ab; davon, zu welchen Ereignissen der Vergangenheit ein Bezug in der<br />
Gegenwart hergestellt werden kann (oder soll, darf, muss).<br />
Was eine Gesellschaft in ihr kollektives Gedächtnis aufnimmt, wird Teil des<br />
Selbstbildes, mit dem sich diese Gesellschaft, also die Bevölkerung identifiziert.<br />
Denkmäler für im Krieg getötete Soldaten gibt es viele; man nennt die Männer<br />
Helden, sie gehören „zu uns“. Diejenigen, die diesen (oder jeden?) Krieg<br />
ablehnten, waren lange Zeit „die anderen“, die Nicht-Helden. – Erst nach langen<br />
Debatten scheint es nun sicher, dass in Wien ein Mahnmal für Deserteure<br />
errichtet wird.<br />
In <strong>Salzburg</strong> werden in diesem Jahr einige deutliche Zeichen gesetzt, die die<br />
Chance haben, das kollektive Gedächtnis zu erweitern:<br />
Neue Stolpersteine für viele Opfergruppen, erstmals auch für einen Deserteur,<br />
werden verlegt.<br />
Nach der sehr vorsichtigen Zeichensetzung – eine Tafel an der St. Michaels-<br />
Kirche nennt das Ereignis – finden in Erinnerung an die <strong>Salzburg</strong>er Bücherverbrennung<br />
vor 75 Jahren mehrere Veranstaltungen in diesem April statt.<br />
„Freies Wort“ ist der Name der Initiativgruppe; der Name nennt die leitende<br />
Perspektive dieses Gedenkens: Es geht um den Bezug zur Gegenwart. Der<br />
damaligen Vernichtung von Literatur und Kunst zu gedenken und dieses Feuerwerk<br />
mit Entsetzen abzulehnen hat Konsequenzen für die Gegenwart. Aufmerksam<br />
sein und mutig werden, freies Wort/freies Denken, insbesondere in<br />
Kunst und Literatur, zu schützen und zu verteidigen.<br />
Erst die Erinnerung, die öffentlich zugelassen wird, kann das Vergangene zur<br />
eigenen Geschichte werden lassen, sodass Bezug zur Gegenwart möglich<br />
wird; darin besteht die Notwendigkeit von Gedenkkultur.<br />
Christine Czuma<br />
02 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
KURZ & BÜNDIG<br />
Kurz&Bündig<br />
Wer bezahlt?<br />
Die Nachrichten über Falschangaben in der<br />
Lebensmittelindustrie, ausgebeutete LeiharbeiterInnen,<br />
giftige Weg-werf-Kleidungsmittel,<br />
usw. häufen sich. Die breiten Medien<br />
berichten schockiert von den „Skandalen“,<br />
KonsumentInnen geben sich betrogen und<br />
man ist verunsichert, welcher Umgang nun<br />
bspw. mit den falsch etikettierten Waren<br />
ethisch korrekt wäre – Wegwerfen? Weitergabe<br />
an „sozial Schwächere“? Dabei bleibt<br />
es weitgehend bei der Diskussion um dieses<br />
Dilemma. Die Hintergründe, die mit der Massenproduktion<br />
einhergehen, was bspw.<br />
Masttierhaltung, Ausbeutung von Arbeitskräften<br />
und die schlechte Qualität der verwendeten<br />
Materialien betrifft, sind wohl<br />
bekannt. Wir wissen, dass für unsere<br />
Schnäppchen andere bitter zahlen müssen.<br />
Doch die Scheuklappen sitzen noch bequem<br />
und so begnügen wir uns mit oberflächlichen<br />
Verbesserungs-Versprechen der Konzerne<br />
und sind froh, dass wir nicht dazu angehalten<br />
werden, jetzt endlich über das eigene „Börsal“<br />
hinauszudenken.<br />
DS<br />
mit der Familie und so. Es gibt einen Schalter,<br />
und den lege ich um, wenn es nötig<br />
wird.“ Er könne deshalb auch so gut zielen,<br />
weil er so gerne Computerspiele spiele. God<br />
save the prince!<br />
IB<br />
Rollenspiele<br />
Rollenspiele sind ein wesentlicher Bestandteil<br />
von Seminaren zur Politischen Bildung. Sie<br />
sind persönliche Türöffner, ermöglichen Perspektivenwechsel,<br />
fördern die Fähigkeit, sich<br />
in andere hineinzudenken, sind meist lustbetont<br />
und lockern eingefahrene Muster auf.<br />
Bei der Positionierung der einzelnen Parteien<br />
im Vorfeld der Volksbefragung am 20.1.<br />
dürfte es sich um das Ergebnis eines geglükkten<br />
Rollentausch-Seminars gehandelt haben<br />
– mit unterschiedlichen herausfordernden<br />
Aufgabenstellungen:<br />
Den SPÖ-Funktionären, seit den Arbeiteraufständen<br />
in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts<br />
auf die Ablehnung eines Berufsheeres<br />
getrimmt, wurde auferlegt, die geliebte<br />
Wehrpflicht mit Schmutz zu bewerfen und<br />
auf Professionalität und Effizienz zu setzen.<br />
Dass dies die schwerste Aufgabe gewesen<br />
ist, zeigt das Ergebnis der Befragung. Die<br />
breite Lust an der Verkleidung war endenwollend.<br />
Geglaubt haben das die SchauspielerInnen<br />
nicht einmal selber.<br />
Nicht einfacher, aber offensichtlich wirkungs-<br />
Das Zitat<br />
voller, die Aufgabe für die ÖVP: Zu Schüssels<br />
Zeiten noch voll auf Profi-Armee, NATO-Beitritt<br />
und Abschaffung der Neutralität eingeschworen,<br />
war es trotzdem kein großes Verbiegen,<br />
patriotisch auf die Wehrpflicht zu setzen.<br />
Wer Vizekanzler und Innenministerin<br />
jedoch bei der auferlegen Heiligsprechung<br />
der Zivildiener beobachtet hat, kam nicht<br />
umhin, Ihnen aus Mitleid das Ende dieses<br />
Selbstverleugnungsprozesses zu wünschen.<br />
Gelohnt hat sich die unmenschliche Aufgabe<br />
dann wenigstens doch.<br />
Die antimilitaristischen und pazifistischen<br />
Grünen hatten es auch nicht leicht. Sie mussten<br />
radikale sicherheitspolitische Visionen<br />
hintanhalten und durch die Unterstützung<br />
eines Berufsheer-Modells verhindern, dass wir<br />
„in ein paar Jahren eine Abschaffungsdiskussion<br />
haben“. (Zitat Peter Pilz).<br />
Am Schlimmsten dürfte es aber für die FPÖ-<br />
Funktionäre gewesen sein. Gewohnt, sich auf<br />
jede Gelegenheit zu polarisieren, zu vereinfachen<br />
und zu nivellieren zu stürzen, hatten sie<br />
offensichtlich die Aufgabe, diesmal den<br />
Populismus den anderen Parteien zu überlassen.<br />
Trotz der unterhaltsamen und entspannenden<br />
Wirkung von Rollenspielen dürften alle<br />
AkteurInnen – aber auch das Publikum – froh<br />
darüber sein, dass das Schauspiel ein Ende<br />
gefunden hat und sich alle wieder in ihren<br />
gewohnten Rollen niederlassen und wiederfinden<br />
können.<br />
HPG<br />
Der kleine Prinz<br />
Er ist ein Liebling auf der Insel, smart und ein<br />
wenig frech, blaublütig und wagemutig. Prinz<br />
Harry (28) ist mittlerweile ein bisschen groß<br />
und Hubschrauber-Co-Pilot bei der britischen<br />
Armee und war auch endlich im Krieg. Während<br />
sein Bruder zu Hause zielstrebig auf<br />
Juniorkönig macht, verteidigte Harry in<br />
Afghanistan das Königsreich gegen die Taliban.<br />
Nun ist er in den Palast zurückgekehrt<br />
und gibt Interviews. Wie die SN berichteten<br />
(23.1.), dürfte er das Kämpfen dort ziemlich<br />
cool gefunden haben. Sein Motto ist prägnant:<br />
„Leben zu nehmen um Leben zu retten.<br />
Darum dreht es sich bei uns“. “Wenn da<br />
Leute sind, die unseren Jungs etwas Böses<br />
wollen, dann ziehen wir sie aus dem Verkehr“.<br />
Hilfreich ist ihm dabei, dass es eigentlich<br />
drei Harrys gibt, „einen in der Armee, ein<br />
soziales Ich in meinem Privatleben und dann<br />
FOTO: „LOTSE“<br />
„Die Menschen sind mittlerweile schon<br />
so angefressen auf das politische<br />
System, dass sie jede Vogelscheuche<br />
wählen würden, nur um es denen da<br />
oben zu zeigen.“<br />
Andreas Mölzer, Chefideologe der<br />
FPÖ, im SN-Interview vom <strong>14</strong>. März<br />
2013 auf die Frage, ob Frank Stronach<br />
eine Systemalternative präsentiert.<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 03
INTERVIEW<br />
„Vielleicht spürt er’s ja“<br />
Brigitte Höfert, Tochter des Deserteurs Karl Rupitsch, über ihren Vater und i<br />
hre Motivation, ihn in die Gegenwart zu holen.<br />
Das Gespräch führte Kathrin Quatember.<br />
im Himmel oben“. Irgendwie hab ich offenbar<br />
davon gewusst. In der Familie wurde ab<br />
und zu darüber gesprochen. Da hörte ich<br />
immer wieder Begriffe wie „KZ“ und „Deserteur“.<br />
Später, wenn jemand nach meinem<br />
Vater gefragt hat, hab ich nur gesagt, er sei<br />
vom Krieg nicht zurückgekommen. Nachdem<br />
ich mich schon einige Jahre intensiv mit seinem<br />
Leben und der Zeit des Nationalsozialismus<br />
befasse, fällt es mir heute leicht zu<br />
sagen, dass er in Mauthausen ermordet<br />
wurde.<br />
Brigitte Höfert mit ihrem Vater Karl Rupitsch vor dem „Mitterbichl“, dem Geburtshaus von Brigitte<br />
Höfert und Brigitte Höfert heute.<br />
<strong>Kranich</strong>: Unsere LeserInnen sind neugierig<br />
und möchten gerne mehr zu Ihrer<br />
Biografie erfahren.<br />
Brigitte Höfert: Ich wurde 1941 in Goldegg<br />
geboren. Ich war ein uneheliches Kind und<br />
bin im Alter von fünf Wochen zu Zieheltern<br />
nach Bischofshofen gekommen. Ich habe das<br />
immer als sehr großzügig empfunden und<br />
ich bin zwar bescheiden, aber gut aufgewachsen.<br />
Mein leiblicher Vater Karl Rupitsch<br />
hatte schon zwei Kinder, war verwitwet und<br />
war von Beginn eigentlich gegen das NS-<br />
Regime eingestellt. Er ist im November 1943<br />
– ob wegen Mithilfe bei einer Schwarzschlachtung<br />
oder bei einem Wilddiebstahl –<br />
nach St. Johann gekommen, wo ihn zwei<br />
Männer aus St. Johann, die im Widerstand<br />
waren, befreit haben. Ab diesem Zeitpunkt<br />
ist er untergetaucht. Er hatte einige Männer<br />
als Anhänger. Gemeinsam mit ihnen hat er<br />
auf Almen und Bauernhöfen übernachtet<br />
und sich mit Wilddiebstählen über Wasser<br />
gehalten. Von der örtlichen Bevölkerung wurden<br />
sie eigentlich gut unterstützt. Wenn wieder<br />
mal eine Razzia angesagt war, konnte die<br />
Gruppe zudem auf die Unterstützung der<br />
örtlichen Gendarmerie zählen. Am 2. Juli<br />
1944 fand dann der so genannte „Sturm in<br />
Goldegg/Weng“ statt, wo 1000 Mann von<br />
der SS und 60 Gestapo-Männer das Gebiet<br />
durchkämmten und meinen Vater gefangen<br />
nahmen. An dem Tag sind auch einige Mitläufer<br />
an Ort und Stelle erschossen worden.<br />
Nach den Gestapo-Verhören in <strong>Salzburg</strong><br />
wurde mein Vater zwischenzeitlich in drei<br />
verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert<br />
und schließlich am 28. Oktober 1944 mit seinem<br />
besten Freund und den zwei Männern<br />
aus St. Johann laut Quelle auf Befehl des<br />
Reichsführers SS gehängt. Bei meinem Schuleintritt<br />
bin ich draufgekommen, dass ich<br />
mich anders schreib als meine Zieheltern,<br />
hatte aber vermutlich schon früher vom Tod<br />
meines Vaters erfahren. Auf die Frage während<br />
einer Zugfahrt „Wo ist denn dein<br />
Papa?“ muss ich geantwortet haben „Der ist<br />
FOTO: BRIGITTE HÖFERT<br />
<strong>Kranich</strong>: Wie lange recherchieren Sie<br />
schon und was war der Grund dafür,<br />
sich mit der Geschichte Ihres Vaters<br />
intensiv auseinanderzusetzen?<br />
Brigitte Höfert: Es gibt ein Buch des Historikers<br />
Michael Mooslechner, der zu St. Johann<br />
recherchiert hat, hauptsächlich zu diesem so<br />
genannten „Russenlager“. Bei den Dokumenten<br />
auf der Gemeinde fiel ihm auf, dass<br />
auch verschiedenes aus Goldegg erwähnt<br />
wurde. Daraufhin hat er mit einem Studienkollegen<br />
auch zum „Sturm in Goldegg“<br />
recherchiert. Das Buch erschien 1986 und<br />
meine ältere Schwester väterlicherseits bat<br />
mich damals, das Buch nicht zu lesen, weil<br />
dort die ganzen Gräueltaten zu den Verhören<br />
angeführt waren. Ich hab’s trotzdem<br />
gelesen.<br />
Im Jahr 2005 haben die Trachtenmusikkapellen<br />
Goldegg und Taxenbach das Auftragswerk<br />
„Symphonie der Hoffnung“ über die<br />
Tragödie in Goldegg am Böndlsee aufgeführt.<br />
Bei der ersten Aufführung in der Stadt<br />
<strong>Salzburg</strong> stand Herr Mooslechner vor mir an<br />
der Kassa. Da hab ich ihn gleich angesprochen.<br />
Er war erstaunt, dass Karl Rupitsch<br />
Kinder hatte. Zwischen uns ist eine lockere<br />
Verbindung entstanden und 2008 hat der<br />
ORF eine Filmserie über den Zweiten Weltkrieg<br />
vorbereitet mit einem Teil über die<br />
Deserteure mit dem Titel „Die Ungehorsamen“.<br />
Da bekam ich einen Anruf von Herrn<br />
Mooslechner, dass der ORF-Redakteur Peter<br />
Liska nach <strong>Salzburg</strong> kommt. Er kannte das<br />
Schicksal von meinem Vater schon recht gut.<br />
Wir trafen uns in <strong>Salzburg</strong> und ich erklärte<br />
mich bereit, den Film zu unterstützen. Da bin<br />
ich dann sozusagen „infiziert“ worden.<br />
04 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
INTERVIEW<br />
<strong>Kranich</strong>: Wie ist die Stimmung in Goldegg,<br />
was Ihren Vater betrifft? Wie<br />
nehmen Sie das wahr?<br />
Brigitte Höfert: Meine Erfahrungen in Goldegg<br />
sind nicht so schlecht. Beim schon<br />
erwähnten Film „Die Ungehorsamen“ hat<br />
ein Brüderpaar mitgewirkt, die zwei Brüder<br />
durch die Hand von Gestapo-Beamten verloren<br />
haben. Es hat mich gefreut, dass die<br />
beiden nicht meinem Vater die Schuld<br />
gegeben haben, dass ihre Brüder so<br />
unschuldig durch die Gestapo, die auf der<br />
Suche nach meinem Vater war, zu Tode<br />
gekommen sind. Es gibt unter den Alten<br />
sicher noch Ressentiments. Beim Annafest<br />
in Goldegg/Weng hab ich immer wieder<br />
vom Stammtisch gehört, wie die Geschichte<br />
aufgewärmt wurde und mein Vater und<br />
seine Anhänger diffamiert wurden. Als die<br />
Doku im ORF lief, habe ich einen Bekannten<br />
angestiftet, der immer zu den Stammtischen<br />
geht, er soll sich umhören, ob darüber<br />
gesprochen wird und er erzählte mir,<br />
dass einige der älteren Männer meinten,<br />
mein Vater hätte sich erschießen sollen. Der<br />
Hintergrund ist, dass mein Vater gesagt<br />
haben soll, lieber würde er sich erschießen,<br />
bevor er sich schnappen lässt. Das hat er<br />
dann offenbar doch nicht über’s Herz<br />
gebracht.<br />
<strong>Kranich</strong>: Wenn Sie solche Dinge hören,<br />
wie geht’s Ihnen damit?<br />
Brigitte Höfert: Ich denke mir, die Leute, die<br />
noch negativ darüber sprechen, waren<br />
wahrscheinlich selbst im Krieg und sagen<br />
sich „Wir haben auch unseren Kopf hingehalten<br />
und der oder die haben sich dem<br />
entzogen“. Der Goldegger Bürgermeister<br />
hat auf mehrmaliges Drängen wegen eines<br />
Denkmals geäußert, für ihn seien das keine<br />
Helden gewesen. Das Kapitel über meinen<br />
Vater wurde beinahe wortwörtlich – und<br />
ohne Kommentar oder Quellennachweise –<br />
im NS-Jargon vom Gendarmerieprotokoll<br />
übernommen. Der ORF hat den Altbürgermeister<br />
und jetzigen Bürgermeister von Goldegg<br />
zu dieser Chronik interviewt. Sie meinten,<br />
man würde das bei einer Neuauflage<br />
der Chronik berichtigen, das sei in der ganzen<br />
Arbeit untergegangen. Im Interview<br />
wies der jetzige Bürgermeister zudem darauf<br />
hin, dass es in Goldegg ein Friedensmahnmal<br />
geben sollte. Leider ist bis jetzt in<br />
diese Richtung noch nichts geschehen.<br />
<strong>Kranich</strong>: Am 7. Oktober 2009 beschloss<br />
der Justizausschuss des Nationalrats<br />
einen Gesetzesentwurf, der die pauschale<br />
Aufhebung aller Urteile der NS-<br />
Militärgerichtsbarkeit durch die Republik<br />
Österreich vorsieht. Inwieweit<br />
betrifft das die Rehabilitierung Ihres<br />
Vaters?<br />
Brigitte Höfert: In den Medien las ich, dass<br />
Angehörige in direkter Linie beim Landesgericht<br />
Wien um Rehabilitation ansuchen<br />
können. Und das hab ich dann auch<br />
gemacht – mit allen Unterlagen, die mir zur<br />
Verfügung standen als Beilage. Der Kontakt<br />
zwischen mir, dem Gericht und dem Justizministerium<br />
lief mehrmals hin und her. Leider<br />
war das Todesurteil nicht auffindbar.<br />
Nach einigen Monaten der Korrespondenz<br />
erhielt ich ein Schreiben vom Oberlandesgericht,<br />
dass die Goldegger Gruppe ex lege<br />
rehabilitiert sein. Auch mein Vater, allerdings<br />
nur nach § 4, nicht aber nach § 1,<br />
weil kein Todesurteil vorliege. Man weiß,<br />
dass gegen Ende des Krieges viele Unterlagen<br />
vernichtet wurden und jetzt sollte mein<br />
Vater – obwohl es dieses Gesetz gab –<br />
nicht vollständig rehabilitiert werden. Das<br />
hat mich sehr gewurmt. Mit Bestärkung<br />
und Mitwirkung durch Herrn Mooslechner<br />
schrieb ich einen Brief an Nationalratspräsidentin<br />
Barbara Prammer. Herr Mooslechner<br />
erwähnte zudem in einem Gespräch mit<br />
dem NRAbg. Johann Maier die Causa, der<br />
dies wiederum im Parlament vorbrachte.<br />
Justizministerin Karl meinte, was ich denn<br />
noch wolle, mein Vater sei doch ex lege<br />
rehabilitiert. Ich hatte schon einen Schlussstrich<br />
gezogen. Im Oktober 2012 erhielt ich<br />
dann von Frau Prammer einen Brief, dass<br />
die Justizministerin einen Ausschuss<br />
gegründet hatte. Dieser Ausschuss hätte<br />
einen Erlass herausgegeben, wonach auch<br />
jene Opfer, deren Todesurteil nicht auffindbar<br />
ist, als rehabilitiert gelten. Im Erlass auf<br />
Seite sechs – am liebsten würd ich’s ja einrahmen<br />
– steht geschrieben: „Aufgrund<br />
eines konkreten Falles wurde dieses Gesetz<br />
ergänzt“. Das war ein riesen Erfolgserlebnis.<br />
<strong>Kranich</strong>: Wie sehen Sie ihren Vater<br />
heute? Sie haben ihn ja so gut wie<br />
nicht gekannt. Haben Sie das Gefühl,<br />
im durch das, was Sie erreicht haben,<br />
näher zu kommen?<br />
Brigitte Höfert: Definitiv. Ich hatte von Kindheit<br />
an ein gutes Vaterbild. Meine Zieheltern<br />
erzählten, dass mein Vater sich darum<br />
gekümmert hat, dass ich einen Platz bei<br />
ihnen bekomme. Er kam auch des Öfteren.<br />
Ich habe einige Fotos, wo ich mit ihm zu<br />
sehen bin. Er hat in der Familie auch mitgearbeitet.<br />
Als mein Vater schon in Mauthausen<br />
war, schrieb er meinen Zieheltern und<br />
bat um ein Foto von mir. Das kam allerdings<br />
wieder zurück, weil er zu diesem Zeitpunkt<br />
schon nicht mehr lebte.<br />
Im Mai 2012 fand in Mühlbach im Pausgut,<br />
wo er früher Bauer war, eine Baumpflanzung<br />
statt, wo unter anderem mein Bruder<br />
väterlicherseits und Herr Mooslechner dabei<br />
waren.<br />
<strong>Kranich</strong>: Wie ist Ihre Perspektive für die<br />
Zukunft? Wie geht’s weiter?<br />
Brigitte Höfert: Das Denkmal ist ein sehr<br />
aufwändiges Projekt. Ich brauche das Einverständnis<br />
der Gemeinde Goldegg. Ich<br />
werde nicht mehr ewig leben und möchte<br />
die Gemeinde verpflichten, dass das Denkmal<br />
unter Schutz der Gemeinde gestellt<br />
wird, auch, wenn ich nicht mehr da bin. Der<br />
nächste Punkt ist die Suche nach Sponsoren<br />
und möglichen Förderungen, was alleine<br />
schwer zu schaffen ist.<br />
Was mir eine große Freude macht, ist die<br />
Begegnung. Vor einiger Zeit organisierte das<br />
Bewohnerservice in der Caritas-Schule St.<br />
Ursula eine Begegnung zwischen der<br />
„alten“ Generation und den Schülerinnen.<br />
Dort hab ich dann auch von meinem Vater<br />
erzählt. Sie merken, überall, wo ich meinen<br />
Vater durch ein Gespräch oder visuell in die<br />
Gegenwart bringen kann, bin ich zufrieden.<br />
Vielleicht spürt er’s ja.<br />
Komplettfassung des Interviews unter<br />
www.friedensbuero.at<br />
Kontaktaufnahme mit Brigitte Höfert<br />
über das Friedensbüro unter<br />
quatember@friedensbuero.at<br />
oder <strong>06</strong>62 873931<br />
BUCHTIPP<br />
Sönke Neitzel,<br />
Harald<br />
Welzer: Soldaten:<br />
Protokolle<br />
vom Kämpfen,<br />
Töten und<br />
Sterben. S.<br />
Fischer 2011.<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 05
THEMA<br />
Späte Ehre für die Deserteure<br />
Ein Denkmal am Ballhausplatz.<br />
Von Magnus Koch.<br />
„Dass der Ballhausplatz Standort des künftigen Standortes geworden ist, war nicht von vornherein abzusehen. Zunächst wurden auch eine Reihe<br />
anderer Orte, meist Stätten historischer Verfolgung der Deserteure oder Wehrkraftzersetzer in Wien in den Blick genommen.“ berichtet Magnus<br />
Koch, wissenschaftlicher Berater der Stadt Wien.<br />
FOTO: XAVAX<br />
Am 12. Oktober vergangenen Jahres verkündeten<br />
der Wiener Kulturstadtrat<br />
Andreas Mailath-Pokorny und Grünen-<br />
Klubchef David Ellensohn die Entscheidung:<br />
Das Denkmal für die Verfolgten<br />
der NS-Militärjustiz wird am Ballhausplatz<br />
entstehen – nur einen Steinwurf entfernt<br />
von den Eingängen zu Bundeskanzleramt<br />
und Präsidentschaftskanzlei. Knapp zwei<br />
Jahre nach der rot-grünen Regierungsübereinkunft<br />
in der Hauptstadt bedeutet<br />
diese Entscheidung das bundesweit erste<br />
Denkmal für die Deserteure der Wehrmacht<br />
in Österreich – sieht man einmal<br />
von einigen wenigen Denkzeichen an verschiedenen<br />
Orten ab, die die Deserteure<br />
zwar zum Teil meinen, das Wort allerdings<br />
auf Texttafeln oder in den Widmungstexten<br />
nicht auftaucht. (1)<br />
Die Wiener Entscheidung – übrigens zeitgleich<br />
mit einem Denkmalbeschluss in der<br />
Stadt Bregenz – bedeutet einen Meilenstein<br />
in der geschichtspolitischen Entwikklung<br />
der Zweiten Republik. Dies gilt insbesondere,<br />
wenn man auf die Gedenkpraxis<br />
der ersten Nachkriegsjahrzehnte<br />
zurückschaut. Anschließend an den<br />
Totenkult um die „Gefallenen“ des<br />
Ersten Weltkrieges wurden auf österreichischen<br />
Friedhöfen unzählige Denkmäler<br />
für die „Pflichterfüller“ errichtet. Einmal<br />
abgesehen von einem schmalen Zeitkorridor<br />
unmittelbar nach 1945 galten diejenigen<br />
Österreicher, die als Wehrmachtsoldaten<br />
mithalfen, einen verbrecherischen<br />
Angriffskrieg zu führen, pauschal als tapfer<br />
und anständig. Der Kameradschaftsbund<br />
und sein großes gesellschaftliches<br />
Umfeld war ein WählerInnenpotenzial,<br />
das die Nachkriegsregierungen aller Couleur<br />
hofierten. Dies bedeutete auf der<br />
Kehrseite, dass die Verfolgten einer<br />
bedingungslos im Sinne der NS-Führung<br />
arbeitenden Wehrmachtjustiz ausgegrenzt<br />
wurden. Richard Wadani, Wehrmachtsdeserteur<br />
und Ehrenobmann des<br />
Personenkomitees Gerechtigkeit für die<br />
Opfer der NS-Militärjustiz erinnert sich bis<br />
heute an diese Zeit – für ihn die Erfahrung<br />
doppelt verfolgt worden zu sein:<br />
während des Krieges als Deserteur und<br />
nach dem Krieg als „Kameradenmörder“<br />
und Verräter.<br />
Nachdem im Zuge von Waldheim-Affäre<br />
und später wohl insbesondere der beiden<br />
Wehrmachtsausstellungen in Österreich<br />
ein Wandel in der Bewertung von Kriegserfahrungen,<br />
ein eine Diskussion von Verantwortung<br />
und Schuld im Kontext Soldatischen<br />
Handelns während des Zweiten<br />
Weltkrieges einsetzte, erwachte auch ein<br />
neues Interesse an den Deserteuren der<br />
Wehrmacht. Ausgehend oft von regionalen<br />
Geschichtsinitiativen fragten ForscherInnen<br />
nach Widerstand und Verfolgung<br />
<strong>06</strong> KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
THEMA<br />
in den Reihen der Wehrmacht – und sie<br />
fanden, etwa in Vorarlberg oder Tirol<br />
Soldaten und Zivilisten, die sich dem<br />
Zwangssystem verweigerten, die sich in<br />
den Bergen versteckten, oder zu den Partisanen<br />
überliefen, unterstützt durch Teile<br />
der lokalen Bevölkerung. (2)<br />
Im Windschatten einer sich international<br />
konstituierenden politics of regret dauerte<br />
es bis in die 1990er Jahre, bevor das<br />
Thema auf die bundespolitische Agenda<br />
kam. Die Initiative dafür ging von einer<br />
Gruppe Studierender an der Universität<br />
Wien aus, HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen,<br />
JuristInnen, die sich<br />
schließlich im Auftrag des Nationalrates<br />
der österreichischen Verfolgten der NS-<br />
Militärjustiz annahmen. Es entstand die<br />
erste übergreifende Studie, die auf einer<br />
breiten Quellenbasis nicht nur die Verfolgungsgeschichte<br />
während des Krieges<br />
sondern auch die Nachkriegsgeschichte<br />
einer nicht erfolgten Rehabilitierung<br />
nachzeichnete. (3) Dieses wissenschaftliche<br />
Fundament trägt bis heute. Es war<br />
die zentrale Grundlage für die im Jahre<br />
2009 erfolgte Rehabilitierung der Opfer<br />
der Wehrmachtgerichte. (4) Angehörige<br />
der Forschungsgruppe von 1999 bildeten<br />
gleichzeitig den Kern eines Teams, das<br />
eine 2007 in Berlin eröffnete und zwei<br />
Jahre später für Österreich adaptierte<br />
Version der Wanderausstellung „Was<br />
damals Recht war. Soldaten und Zivilisten<br />
vor Gerichten der Wehrmacht“ nach<br />
Wien holten. (5)<br />
Bereits im Jahre 2002, also im Umfeld<br />
der Veröffentlichung der grundlegenden<br />
Studie über die Wehrmachtgerichtsbarkeit<br />
in Österreich, gründeten AktivistInnen<br />
das Personenkomitee Gerechtigkeit<br />
für die Opfer der NS-Militärjustiz.<br />
Gemeinsam mit den GRÜNEN, grundlegend<br />
unterstützt durch die neu gewonnenen<br />
wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />
setzt sich das Personenkomitee seither<br />
auch für ein zentrales Denkmal ein, das<br />
die Leistungen und die Leiden der über<br />
30.000 nach kriegsgerichtlichen Urteilen<br />
hingerichteten Soldaten und Zivilisten<br />
würdigt – in der öffentlichen Diskussion<br />
in der Regel bekannt als „Deserteursdenkmal“.<br />
Dies scheint allein von daher<br />
berechtigt, da wegen Fahnenflucht rund<br />
dreiviertel aller Todesurteile ergingen.<br />
Äußerst geringe Überlebensaussichten<br />
hatten allerdings auch diejenigen Soldaten,<br />
die wegen kleinerer Delikte (etwa<br />
Diebstahl oder Ungehorsam) in die Mühlen<br />
eines gnadenlosen Strafvollzugs<br />
gerieten.<br />
Dass der Ballhausplatz Standort des künftigen<br />
Standortes geworden ist, war nicht<br />
von vornherein abzusehen. Zunächst wurden<br />
auch eine Reihe anderer Orte, meist<br />
Stätten historischer Verfolgung der<br />
Deserteure oder Wehrkraftzersetzer in<br />
Wien in den Blick genommen. (6) In der<br />
Kommission, die seit Dezember 2011 in<br />
der Wiener Magistratsabteilung 7 (Kultur)<br />
tagte, setzte sich zunächst – aufgrund<br />
der Fürsprache von Grünen und Personenkomitee<br />
– der Standort Heldenplatz<br />
durch; dieser schien allerdings allein aus<br />
pragmatischen Gründen nicht durchsetzbar:<br />
zu viele verschiedene Kompetenzen,<br />
zu viele Anrainer, zu viele noch schwebende<br />
Projektplanungen von Seiten der<br />
Burghaupmannschaft und anderen<br />
Akteuren. Der Ballhausplatz bot sich<br />
schließlich als in jeder Hinsicht glücklicher<br />
Kompromiss an: Der künftige Standort´,<br />
unmittelbar angrenzend an den Heldenplatz<br />
steht in Sichtbeziehung zum so<br />
genannten Hitler-Balkon, von dem aus<br />
der deutsche „Führer“ und Reichskanzler<br />
die Selbstaufgabe österreichischer Staatlichkeit<br />
verkündete. Ungehorsame Handlungen<br />
und Entziehungen der von Wehrmachtgerichten<br />
Verurteilten sind zumindest<br />
auf symbolischer Ebene als Akte der<br />
Auflehnung gegen das NS-Regime zu<br />
sehen, das im Namen „Großdeutschlands“<br />
die Welt mit einem mörderischen<br />
Krieg überzog, der rund 50 Millionen<br />
Menschen das Leben kostete. Die Wehrmachtjustiz<br />
konnte jede widersetzliche<br />
Handlung als „Wehrkraftzersetzung“<br />
ahnden, insbesondere Desertion war aus<br />
Sicht des NS-Regimes ein überaus politisches<br />
Verbrechen. Das Ensemble aus Heldenplatz<br />
und Ballhausplatz, in seiner langen<br />
Geschichte, die mit Krieg, Heldentum<br />
und Opfergedenken verknüpft, eignet<br />
sich also exzellent als Standort des neuen<br />
Denkmals für Deserteure, »Wehrkraftzersetzer«<br />
und »Kriegsverräter«. Gleichzeitig<br />
befindet es sich nahe genug am zentralen<br />
Denkzeichen der Republik für die Österreichischen<br />
Freiheitskämpfer, dem Weiheraum<br />
– denn in ihre Reihen gehören die<br />
Verfolgten der Wehrmachtgerichte.<br />
Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass dies<br />
im Jahre 1965, als der Stein dort eingeweiht<br />
wurde, im öffentlichen Bewusstsein<br />
noch längst nicht verankert war.<br />
Gegenwärtig läuft nun der zweite Schritt<br />
des Verfahrens rund um das Denkmal<br />
am Ballhausplatz: ein internationaler<br />
KünstlerInnenwettbewerb. Ende des Jahres<br />
soll das Denkmal dann eingeweiht<br />
werden. Welche Gestalt es haben wird,<br />
und vor allem, wie sich die weiteren<br />
Auseinandersetzungen um das Thema<br />
gestalten werden, bleibt abzuwarten.<br />
Das Personenkomitee erarbeitet unterdessen<br />
ein Konzept zur Nachnutzung<br />
des Denkmals. Schließlich soll es nicht<br />
End-, sondern Ausgangspunkt dafür<br />
sein, die Erinnerung an die Deserteure<br />
und andere Verfolgte der NS-Militärjustiz<br />
wach zu halten.<br />
Dr. Magnus Koch, Ausstellungsmacher<br />
und freier Historiker, zur Zeit berät er<br />
die Stadt Wien in inhaltlich-wissenschaftlichen<br />
Belangen des am Ballhausplatz<br />
geplanten Deserteursdenkmals.<br />
Nachweise<br />
1) Vgl. die Zusammenstellung auf www.deserteure.at,<br />
wo ebenfalls Denkmalinitiativen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland vorgestellt werden.<br />
2) Vgl. Meinrad Pichler, Widerstand und Widersetzlichkeit<br />
in der Wehrmacht. In: Johnan-August-Malingesellschaft<br />
(Hg.): Von Herren und Menschen. Verfolgung<br />
und Widerstand in Vorarlberg 1939-1945, Bregenz<br />
1985, S. <strong>14</strong>3-152.<br />
3) Vgl. Walter Manoschek, Hg., Opfer der NS-Militärjustiz.<br />
Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik<br />
in Österreich, Wien 2003.<br />
4) Vgl. das am 21. Oktober 2009 mit den Stimmen von<br />
SPÖ, ÖVP und Grünen im Nationalrat verabschiedete<br />
Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz. Dagegen hatten<br />
FPÖ und BZÖ gestimmt, vgl. Bundesgesetzblatt I Nr.<br />
110/2009. Die Republik hat damit anerkannt, dass alle<br />
Deserteure im Sinne der Moskauer Deklaration über die<br />
Wiedererrichtung eines unabhängigen und demokratischen<br />
Österreich zur Schwächung des nationalsozialistischen<br />
Unrechtsregimes, zu seiner Überwindung und<br />
somit zur Befreiung Österreichs beigetragen haben. Das<br />
Gesetz von 2009 nimmt seinerseits Bezug auf das Aufhebungs-<br />
und Einstellungsgesetz vom Juli 1945 (Staatsgesetzblatt<br />
Nr. 48) nach dem alle Urteile, die nach der<br />
sogenannten Kriegssonderstrafrechtsverordnung vom<br />
17. August 1938 ergangen sind, als nicht erfolgt gelten,<br />
zur juristischen Dimension der Debatte vgl. Reinhard<br />
Moos, Das Anerkennungsgesetz 2005 und die Vergangenheitsbewältigung<br />
der NS-Militärjustiz in Österreich,<br />
in: Journal für Rechtspolitik 3 (20<strong>06</strong>), S. 182-196.<br />
5) Vgl. das Begleitbuch zur Ausstellung: auch die<br />
Begleitpublikation Thomas Geldmacher/Magnus<br />
Koch/Hannes Metzler/Peter Pirker, Hg., »Da machen wir<br />
nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten<br />
vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010. Seither ist<br />
die Ausstellung zudem in Klagenfurt und Dornbirn<br />
gezeigt worden, vgl. wiederum die homepage des Personenkomitees<br />
www.deserteure.at.<br />
6) Vgl. die preisgekrönte, jüngst im Mandelbaumverlag<br />
erschienene Studie des Wiener Politikwissenschaftlers<br />
Mathias Lichtenwagner, Leerstellen. Zur Topografie der<br />
Wehrmachtsjustiz in Wien vor und nach 1945, Wien<br />
2012.<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 07
THEMA<br />
Erzählcafés<br />
Biografische Gespräche als Beitrag zu Erinnerungskultur<br />
und politischer Bildung.<br />
Von Hans Peter Graß.<br />
Hans Peter Graß, Geschäftsführer des<br />
Friedensbüros <strong>Salzburg</strong><br />
FOTO: EDIN SMAJILBASIC<br />
„Wie alle Methoden zur biografischen Arbeit forcierten auch diese Erzählcafes eine sehr subjektbezogene und exemplarische Sicht auf politische<br />
Ereignisse, die allerdings durch die größere Anzahl an Gesprächen objektivierbarer und gleich einem Puzzle leichter einzuordnen waren.“<br />
beschreibt Hans Peter Graß die methodische Herangehensweise an das gemeinsame Gespräch.<br />
Wenn wir an biografische Interviews denken,<br />
fallen uns in der Regel Gespräche mit Menschen<br />
ein, die als Zeitzeugen aus einem reichen<br />
Erfahrungsschatz mit weit zurückliegendem<br />
historischem Hintergrund berichten können.<br />
In unserem Projekt WhyWar.at haben wir die<br />
Form eines Erzählcafes gewählt, um jungen<br />
Erwachsenen mit biografischen Bezügen zu<br />
den Kriegen in Ex-Jugoslawien einen Rahmen<br />
zu geben, über ihre Geschichte zu sprechen<br />
und ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben.<br />
Wir haben dabei Gespräche geführt mit<br />
Männer und Frauen zwischen 20 und 30 Jahren,<br />
die aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina,<br />
Serbien und dem Kosovo stammen, orthodox,<br />
katholisch, muslimisch oder ohne<br />
Bekenntnis sind, entweder in <strong>Salzburg</strong> als<br />
Gastabeiterkind geboren wurden, als Flüchtlingskind<br />
in den 90er-Jahren oder in den letzen<br />
Jahren als Bildungs- oder ArbeitsmigrantInnen<br />
nach <strong>Salzburg</strong> gekommen sind.<br />
Die Erzählcafes<br />
grund, bereits durch die Wahl des Ortes<br />
Grundaussagen über die eigene Geschichte<br />
zu machen. Die biografischen Interviews wurden<br />
halböffentlich geführt. Eingeladen waren<br />
FreundInnen und Familienangehörige, sowie<br />
dem Friedensbüro <strong>Salzburg</strong> nahestehende<br />
Personen. Mit dieser eingeschränkten Auswahl<br />
wurde eine gewisse Intimität und emotionale<br />
Sicherheit gewährleistet, die insbesondere<br />
für das Ansprechen heikler persönlicher<br />
oder politischer Themen von großes Bedeutung<br />
war. Die Interviews wurden mit Zustimmung<br />
der Befragten mit einer Videokamera<br />
dokumentiert. Das gesammelte Material<br />
kann für die pädagogische Arbeit verwendet<br />
werden und ermöglicht eine künftige systematische<br />
Aufarbeitung. Den etwa 45minütigen<br />
Gesprächen folgte jeweils eine Diskussion<br />
mit den ZuhörerInnen. In der Regel<br />
waren jedoch die anschließenden Gespräche<br />
bei Buffet und Musik von größerer informativer<br />
Bedeutung.<br />
Moderation<br />
Die Gespräche wurden moderiert, in einem<br />
Vorgespräch die Leitlinien der Gesprächsinhalte<br />
vorbesprochen und gleichzeitig sichergestellt,<br />
welche Themen von den Befragen<br />
Die acht Erzählcafes fanden in unterschiedlichen<br />
Räumen statt, die sich die Befragten<br />
selber aussuchen konnten - mit dem Hintervon<br />
besonderer Bedeutung waren, jedoch<br />
auch, welche – aus welchen Gründen auch<br />
immer - ausgespart werden sollten. Diese<br />
Erstgespräche dienten der Moderation zur<br />
inhaltlichen Klärung persönlicher aber auch<br />
politische Fragen und gab gleichzeitig den<br />
Befragten Planungs-Sicherheit. Anderseits<br />
war es jedoch auch wichtig, Inhalte und<br />
Erzählstränge im Vorgespräche nicht zu<br />
detailliert vorzugeben, um das freie Interview<br />
nicht zu behindern. Ein Gesprächsleitfaden<br />
ermöglichte, die einzelnen Gespräche vergleichbar<br />
und auswertbar zu machen. Trotzdem<br />
wurde versucht, das Interview sehr assoziativ<br />
zu gestalten, offene Fragen zu stellen<br />
und nicht durch rhetorische, geschlossene<br />
Interventionen den Erzählfluss zu behindern.<br />
Methoden<br />
Die Gespräch wurden immer wieder auf<br />
konkrete Ereignisse, benennbare Personen<br />
aber auch auf sinnliche (Klänge, Gerüche,<br />
Bilder) und emotionale Eindrücke hinbezogen.<br />
Unterstrichen wurde das zusätzlich<br />
durch die Bitte an die Befragten, zu den<br />
Begriffen „Krieg“ bzw. „Frieden“ persönliche<br />
Symbole, Accessoires, Bilder, Texte oder<br />
Musik mitzunehmen und ins Gespräch ein-<br />
08 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
THEMA<br />
zubauen. Wie alle Methoden zur biografischen<br />
Arbeit forcierten auch diese Erzählcafes<br />
eine sehr subjektbezogene und exemplarische<br />
Sicht auf politische Ereignisse, die<br />
allerdings durch die größere Anzahl an<br />
Gesprächen objektivierbarer und gleich<br />
einem Puzzle leichter einzuordnen waren.<br />
Inhalte<br />
Inhaltlich wurden den Gesprächen zwei<br />
unterschiedliche Stränge untergelegt: Einen<br />
Biografischen, den von der Kindheit ausgehend<br />
über Kriegserfahrungen, Flucht bzw.<br />
Migration, Integration bzw. Inklusion zur<br />
persönlichen Perspektive führtn. Ein zweiter<br />
inhaltlicher Strang thematisierte Fragenblökke<br />
von Identität/Loyalität/Heimat,<br />
Opfer/Täter/Heldentum, Gewalt/Widerstand/Krieg<br />
sowie Erinnerungskultur/<br />
Geschichtsschreibung und Versöhnung<br />
Chancen<br />
Diese Form des sehr persönlichen Erzählens<br />
birgt große Chancen sowohl für die Erzählenden<br />
als auch für die ZuhörerInnen. Von<br />
Seiten der Befragten war die Erfahrung der<br />
öffentlichen und wertschätzenden Wahrnehmung<br />
der eigenen Geschichte von prioritärer<br />
Bedeutung. Auch das Bewusstmachen<br />
und die Auseinandersetzung mit der<br />
eigenen aber auch der kollektiven<br />
Geschichtsschreibung waren Akte, die nicht<br />
selbstverständlich waren und für viele erst<br />
durch diesen Anstoß in dieser Form verwirklicht<br />
wurde.<br />
Für die RezipientInnen galt die Möglichkeit,<br />
die Geschichte der Jugoslawien-Kriege<br />
durch biografische Zugänge kennenzulernen<br />
als wichtiger Beitrag zur politischen Bildung.<br />
Die Identifikation und die Konfrontation mit<br />
der präsentierten Erzählung gaben auch<br />
Impulse für die Auseinandersetzung mit<br />
eigenen biografischen Hintergründen.<br />
Gefahren<br />
Biografisches Erzählen birgt natürlich auch<br />
Gefahren und Risiken in sich. Insbesondere<br />
in derart sensiblen Feldern, wie es Kriegsund<br />
Migrationserfahrungen darstellen, ist es<br />
notwendig, durch kritische und gleichzeitig<br />
sensible Fragestellung Erhärtungen von Klischees<br />
und Stereotypen vorzubeugen. Um<br />
zu vermeiden, die befragten Personen durch<br />
die permanente Identifizierung mit ihrer<br />
Kriegsgeschichte zu stigmatisieren und zu<br />
missbrauchen, war es von großer Bedeutung,<br />
Handlungs- und Partizipationsfähgkeit,<br />
Autonomie, sowie persönliche Perspektiven<br />
der ErzählerInnen in den Vordergrund<br />
zu stellen.<br />
Besonderes Augenmerk wurde darauf<br />
gelegt, zu verhindern, dass durch die Erzählungen<br />
traumatisierende Erlebnisse von<br />
ErzählerInnen aber auch von ZuhörerInnen<br />
wiederbelebt würden. Dies wurde beim Vorbereitungsgespräch<br />
thematisiert. Gleichzeitig<br />
wurde durch die Praxis, Menschen aus<br />
dem persönlichen Umwelt einzuladen, versucht,<br />
dieses Risiko zu minimieren.<br />
Dipl. Päd. Hans Peter Graß ist Geschäftsführer<br />
des Friedensbüros <strong>Salzburg</strong>, ausgebildeter<br />
Sonderschul- und Religionslehrer, dipl.<br />
Erwachsenenbildner, Leitung des Projektes<br />
"WhyWar.at., Workshops und Seminare zu<br />
den Themenschwerpunkten: Krieg und Frieden,<br />
Vorurteile, Feindbilder, Rassismus,<br />
Interkulturalität;<br />
FOTO: BEZAHLTE ANZEIGE<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 09
INTERVIEW<br />
„Selbst Bayern hat sich schneller bewegt“<br />
Der Historiker Gert Kerschbaumer über das Projekt „Stolpersteine“, Erinnerungspolitik<br />
und den Umgang Österreichs mit der NS-Vergangenheit.<br />
Das Gespräch führte Daniela Köck.<br />
Was macht ihrer Meinung nach die<br />
Besonderheit der Stolpersteine als<br />
Gedenk- und Erinnerungskultur aus?<br />
Abgesehen davon, dass die Stolpersteine ein<br />
Kunstprojekt sind, die von Gunter Demnig<br />
initiiert worden sind, findet die Verlegung in<br />
einer besonderen Form statt. Es gibt einen<br />
bestimmten Termin, an dem Vertreter der<br />
unterschiedlichen Opfergruppen teilnehmen,<br />
der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde,<br />
Marko Feingold, ist regelmäßig<br />
dabei und hin und wieder ist auch die Presse<br />
dabei anwesend. Ich kann mich an die<br />
erste Verlegung der Stolpersteine in <strong>Salzburg</strong><br />
erinnern, diese hat natürlich besonderes<br />
Aufsehen erregt. Was schlussendlich<br />
nach der Verlegung übrig bleibt, ist dann<br />
bloß ein Stein, der nicht von allen als Kunstprodukt<br />
angesehen wird, aber das ist bei<br />
moderner Kunst ebenso. Das ist das eine,<br />
das andere ist, dass wir schon genug Mahnmäler<br />
haben, deren Nachteil ist es, dass sie<br />
zentrale Erinnerungsorte sind, die zwar<br />
unterschiedliche Opfergruppen nennen, wie<br />
etwa das Antifa- Mahnmal am Bahnhof, das<br />
zum ersten Mal Homosexuelle nennt, dennoch<br />
bleiben die Opfer dort namenlos.<br />
Diese Mahnmäler sind alle anonym und mit<br />
diesem Projekt der Stolpersteine bekommen<br />
die Opfer ihren Namen wieder zurück und<br />
werden auch in Beziehung gesetzt zur<br />
ihrem letzten Wohnsitz, ihrem Lebensmittelpunkt<br />
und werden dadurch für uns lebensnäher.<br />
Das scheint für mich der wichtigste<br />
Punkt an diesem Projekt der Stolpersteine zu<br />
sein, dass man den Namen der ermordeten<br />
Menschen, die keinen Grabstein, kein Grab<br />
erhalten haben, damit wieder ins Leben und<br />
in die Erinnerung zurück ruft. Gunter Demnig<br />
geht in seinem Projekt Stolpersteine von<br />
dem Prinzip aus, dass der einzelne Mensch<br />
erst vergessen ist, wenn sein Name vergessen<br />
ist und mit den Stolpersteinen soll den<br />
Opfern der Nationalsozialisten ihr Name<br />
wieder zurückgegeben werden. Ein weiteres<br />
Ziel, das die Verlegung der Stolpersteine<br />
bewirken sollte, nach Gunter Deming, wäre<br />
eine Familienzusammenführung. Dies<br />
bezieht sich in erster Linie auf die jüdischen<br />
Opfer, wie zum Beispiel auf die Familie<br />
Löwy, die in der Linzergasse 5 wohnhaft<br />
war. Alle drei Familienmitglieder, Herbert,<br />
Ida und Ernst Löwy, wurden in Lublin-Majdanek<br />
ermordet. Heute liegen dort in<br />
Gedenken an sie drei Stolpersteine. Das<br />
wäre ein weiterer Sinn dieses Projektes, der<br />
aber sehr schwer zu realisieren ist, vor allem<br />
für andere Opfergruppen.<br />
Sie recherchieren ehrenamtlich für das<br />
Personenkomitee Stolpersteine die Biografien<br />
der ermordeten Menschen. Wie<br />
gehen Sie dabei vor?<br />
Das ist sehr unterschiedlich und es hängt<br />
von der jeweiligen Opfergruppe ab. Ich<br />
habe mich schon früher mit den jüdischen<br />
Opfern beschäftigt und sehr intensiv recherchiert,<br />
vor allem mit der Hilfe der Kultusgemeinde<br />
in Wien, die noch viele Unterlagen<br />
hat. In <strong>Salzburg</strong> ist im Gegensatz dazu sehr<br />
vieles geraubt worden. Die Biografienarbeit<br />
kann man allgemein umschreiben als ein<br />
working process. Im Laufe der Zeit kommen<br />
immer mehr neue Informationen hinzu, so<br />
dass einige der Biografien völlig neu<br />
geschrieben werden müssen oder es melden<br />
sich Nachkommen, wie z.B. aus den USA<br />
und einmal haben sich bei mir auch Nachkommen<br />
aus Kolumbien gemeldet.<br />
Ein weiteres Beispiel für diesen working pro-<br />
cess, ist der Stolperstein, den wir am 18.<br />
April für ein einjähriges Mädchen verlegen.<br />
Von Leah haben wir bis jetzt den richtigen<br />
Namen und das Geburtsdatum nicht<br />
gekannt haben. Es hat sich dann, aber eine<br />
Nachfahrin gemeldet und nach gefragt<br />
warum neben der Großmutter und der<br />
Mutter, Berta und Paula Eisenberg, kein<br />
Stolperstein für das einjährige Mädchen<br />
Leah in der Rainerstrasse 17 liegt. Leah war<br />
erst ein Jahr alt als sie zusammen mit ihrer<br />
Großmutter und Mutter deportiert und<br />
ermordet worden ist.<br />
Das Friedensbüro <strong>Salzburg</strong> übernimmt<br />
bei der Stolpersteinverlegung am 18.<br />
und 19. April die Patenschaft für den<br />
Stolperstein eines Deserteurs, Georg<br />
Prodinger. Wie sind sie auf seine Biografie<br />
gestoßen?<br />
Georg Prodinger steht nicht dem zweibändigen<br />
Band Widerstand und Verfolgung in<br />
<strong>Salzburg</strong> 1934 – 1945. In diesem stehen<br />
viele Opfer der Militärjustiz, wie ich aber<br />
feststellen musste, im Zuge meiner Recherche,<br />
steht Georg Prodinger nicht darin. Wie<br />
bin ich eigentlich auf Prodinger gekommen?<br />
Ich habe zuerst nachgeschaut wer in Glanegg<br />
(heutigen Bundesheer Schießplatz in<br />
Glanegg (Grödig) wurden zur Zeit der Nationalsozialisten<br />
Hinrichtungen durchgeführt.<br />
Heute befindet sich an dieser Stelle das<br />
Mahnmal NS-Opfer Schießplatz Glanegg)<br />
erschossen worden ist, aber nicht nur in<br />
Glanegg. Auf Prodinger bin ich jedoch<br />
durch Zufall gestoßen. Ich habe mir die Polizeimeldekartei<br />
angesehen und da habe ich<br />
plötzlich eine Karte in meiner Hand gehabt<br />
mit seinem Namen darauf. Es wurde darauf<br />
vermerkt, dass er in München- Stadelheim<br />
„verstorben“ sei und das kam mir sehr verdächtig<br />
vor. Die Nationalsozialisten haben in<br />
ihren Akten natürlich nicht hingerichtet<br />
geschrieben und daraufhin habe ich begonnen<br />
nachzuforschen. So bin ich auf die Biografie<br />
des 19 jährigen Georg Prodinger<br />
gestoßen. Wenn ich keinen Zugang zur Polizeimeldekartei<br />
gehabt hätte und diese nicht<br />
im Stadtarchiv gelandet wäre, wüssten wir<br />
vermutlich nichts über Georg Prodinger.<br />
10 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
INTERVIEW<br />
Grundsätzlich benötigt man, aber irgendwelche<br />
Quellen und Spuren, die man zurükkverfolgen<br />
kann. Die Suche wird dadurch<br />
erschwert, dass die Polizei weitgehend die<br />
Quellen vernichtet hat und die Polizeiakte<br />
weitgehen nicht mehr vorhanden sind. Ich<br />
hab bis jetzt leider auch vergeblich nach den<br />
Justizakten gesucht und so bleibt einem<br />
eigentlich Glück und Glück darüber, dass<br />
wir die Polizeimeldekartei haben. Bei den<br />
jüdischen Opfern ist es häufig umgekehrt.<br />
Man findet zum Beispiel in der Shoa- Datenbank<br />
den Namen eines Opfers und daneben<br />
den Vermerk <strong>Salzburg</strong> und dem gehe ich<br />
dann nach.<br />
Bei welcher Opfergruppe gestaltet sich<br />
die Recherche für Sie am schwierigsten?<br />
Bleiben wir gleich bei Georg Prodinger. Er<br />
war ein junger Mann, 19 Jahre alt oder der<br />
kleinen Leah, dem einjährigen Mädchen.<br />
Diese jungen Menschen haben noch fast<br />
keine Spuren im Leben zurück gelassen und<br />
das erschwert die Recherche.<br />
Darüber hinaus sind es vor allem jene Opfergruppen,<br />
die über das Jahr 1945 hinaus diskriminiert<br />
wurden und nicht als Opfer anerkannt<br />
wurden. Nicht als opferwürdig galten<br />
und damit gibt es über sie auch keine<br />
Opferfürsorgeakte. Wir können zum Beispiel<br />
ganz umfassende Biografien z.B. über die<br />
aktiven Gegner des NS- Regime schreiben,<br />
weil wir in diesem Bereich zum Größtenteils<br />
über die Opferfürsorgeakte verfügen.<br />
Dadurch werden die Biografien plastischer<br />
und nachvollziehbarer für Außenstehende.<br />
Bei vielen ist es, aber nicht so. Da haben wir<br />
nur ihre Lebenseckdaten, wie z.B. über die<br />
Zwangsarbeiter.<br />
Ein Schüler hat einmal auf die Frage, ob<br />
Stolpersteine nicht gefährlich seien,<br />
weil man dabei ja hinfallen könne,<br />
geantwortet, dass man nicht fällt, sondern<br />
nur mit dem Kopf und mit dem<br />
Herzen stolpert. Ist das nicht eigentlich<br />
der Anspruch, den man an Erinnerungsorte<br />
und Denkmäler haben sollte?<br />
Es ist ein Glücksfall, wenn jemand so seine<br />
Meinung kundgetan hat. Ich habe jedoch<br />
den Eindruck, dass die meisten Menschen<br />
mehrheitlich darüber eilen, insbesondere die<br />
Einheimischen.<br />
Der Nachtteil von Mahnmälern, wie etwa<br />
dem Antifa- Mahnmal am Bahnhof, ist es,<br />
dass sie auch nicht von allen Opfergruppen<br />
angenommen werden. Wir haben uns von<br />
Anfang darauf geeinigt, dass wir uns nicht<br />
auf eine oder zwei Opfergruppen beschränken,<br />
sondern unser Respekt gilt allen Opfern<br />
und daher ist es auch wichtig, dass viele<br />
Vertreter der Opfergruppen bei den Verlegungen<br />
der Stolpersteine anwesend sind. Es<br />
ist zwar nicht immer gelungen, aber einmal<br />
bei der Verlegung von zwei Stolpersteinen<br />
für zwei Mönche im Stiftshof St. Peter.<br />
Aktuell ist Debatte der Mahnmäler auch in<br />
Bezug um ein Denkmal für Deserteure. Ich<br />
bin jedoch mittlerweile der Meinung, dass<br />
es besser wäre die neuen Medien wie das<br />
Internet dafür zu nützten, um die Biografien<br />
der einzelnen Deserteure in das Netz zu stellen<br />
als ein separates Mahnmal aufzustellen,<br />
das den Deserteuren gewidmet ist. Diese<br />
wäre wieder namenlos. Neben der Verlegung<br />
von Stolpersteinen könnte ich mir<br />
noch etwas Zusätzliches vorstellen, nämlich<br />
ähnlich wie für e Roma und Sinti, wo wir<br />
auch nicht für alle Stolpersteine verlegt<br />
haben, sondern Namenverzeichnisse und<br />
zwar für alle jene, die in Strafeinheiten<br />
gekommen sind, den Gefallenen, die<br />
Zwangsrekrutierten aus den Gefängnissen,<br />
Deserteure, jene, die verurteilt worden sind<br />
wegen unerlaubter Entfernung oder auch<br />
jene, die sich selbstverstümmelt haben.<br />
Wichtig wäre es gewesen den Opfern ihren<br />
Namen wieder zurück zugeben.<br />
Welche Erfahrungen haben sie mit dem<br />
Projekt der Stolpersteine gemacht?<br />
Wir haben grundsätzlich nur positive Erfahrungen<br />
mit dem Kunstprojekt der Stolpersteine<br />
gemacht. Es kommt schon einmal<br />
vor, dass die Steine verletzt werden, dann<br />
werden sie ausgetauscht und im Frühjahr<br />
werden sie geputzt, damit sie wieder sauber<br />
sind.<br />
Warum glauben Sie hat es in Österreich<br />
so lange gebraucht die nationalsozialistische<br />
Vergangenheit aufzuarbeiten?<br />
Das sind die Geheimnisse der Geschichte.<br />
Wir sind ein katholisches, gegenreformatorisches,<br />
gegenaufklärerisches Land und das<br />
wirft eben einen lange Schatten. Auch<br />
wenn die Kirche heute selbst dahinter steht.<br />
Wir habe eine große Redekultur, aber es<br />
fehlt uns eigentlich diese jüdische und auch<br />
teils protestantische Kultur des Buches.<br />
Auch wenn das auf den ersten Blick wenig<br />
zu tun hat mit Aufarbeitung, hängt es meines<br />
Erachtens aber schließlich und endlich<br />
zusammen. Selbst Bayern, das mehrheitlich<br />
katholisch geprägt ist, hat sich schneller<br />
bewegt.<br />
Dr. Gert Kerschbaumer, geb. 1945 in Spital<br />
am Semmering, Kulturpublizist, <strong>Salzburg</strong>,<br />
Publikationen über Kultur unter NS-Herrschaft,<br />
Kunstraub, Literatur, speziell über<br />
Stefan Zweig; derzeit Arbeit an Biografien<br />
über Verfolgte und Holocaustopfer.<br />
STOLPERSTEIN FÜR GEORG PRODINGER<br />
Georg PRODINGER, geboren am 24. Juni 1924 in Leopoldskron, war katholisch, ledig<br />
und wie sein Vater Hilfsarbeiter. Er wohnte bei seinen Eltern im <strong>Salzburg</strong>er Stadtteil<br />
Riedenburg. Über das Leben des jungen Mannes ist wenig bekannt. Er wurde als 19-<br />
jähriger im Lauf des Kriegsjahres 1943 zur Deutschen Wehrmacht in <strong>Salzburg</strong> (Wehrkreis<br />
XVIII) einberufen und war Angehöriger des Ersatz-Bataillons Nr. I des Gebirgsjäger-Ersatz-Regiments<br />
137, das der Division Nr. 418 unterstand. Aus der Kriegssterbefallanzeige<br />
geht hervor, dass Georg PRODINGER am 18. November 1943 vom Kriegsgericht<br />
der Division Nr. 418 wegen Fahnenflucht zum Tode und Verlust der Wehrwürdigkeit<br />
verurteilt und am 25. Jänner 1944 im Zuchthaus München-Stadelheim geköpft<br />
wurde. Motive für seine Desertion sind mangels Kriegsgerichtsakten unbekannt. Seine<br />
Eltern, die als Hinterbliebene keine Opferfürsorge beanspruchen konnten, starben nach<br />
der Befreiung <strong>Salzburg</strong>s. Bemerkenswert ist noch, dass der in München geköpfte<br />
Georg PRODINGER und die auf dem Militärschießplatz in Glanegg bei <strong>Salzburg</strong><br />
erschossenen Deserteure Karl REITMAIER und Walter BRAUNWIESER in der 1991 publizierten<br />
Dokumentation Widerstand und Verfolgung in <strong>Salzburg</strong> 1934 – Recherche:<br />
Gert Kerschbaumer<br />
Das Friedensbüro übernimmt die Patenschaft über den Stolperstein für Georg Prodinger.<br />
Wenn Sie diese Patenschaft finanziell unterstützen möchten, bitten wir um die<br />
Überweisung des Unterstützungsbetrags unter dem Kennwort „Stolperstein“ auf folgendes<br />
Konto bei der Sparkasse <strong>Salzburg</strong>:<br />
Kontonummer: 17434 | BLZ: 20404 | IBAN: AT102040400000017434 | BIC: SBGSAT2SXXX<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 11
THEMA<br />
Johannes Hofinger, Historiker und Mitarbeiter<br />
des Projekts „MenschenLeben“<br />
Biografische Erinnerungen<br />
als Quellen der Erkenntnis<br />
Zur Arbeit mit Oral History Interviews<br />
Von Johannes Hofinger.<br />
bu<br />
Die Sammlung und wissenschaftliche Nutzbarmachung<br />
von Erfahrungen und Erlebnissen<br />
der Menschen mit und in der Zeit des<br />
Nationalsozialismus, seiner Vorgeschichte<br />
und den Nachwirkungen verhalfen in den<br />
1980er Jahren hierzulande der Methode der<br />
Oral History, damals als „mündliche<br />
Geschichte“ bezeichnet, zum Durchbruch.<br />
Die historiografische Rekonstruktion der NS-<br />
Jahre erfolgt seither nicht mehr ausschließlich<br />
anhand erhaltener Aktenbestände, sondern<br />
vermehrt unter Einbeziehung von<br />
Erkenntnissen, die in der Befragung und<br />
inhaltlichen Auseinandersetzung mit Zeitzeuginnen<br />
und Zeitzeugen gewonnen werden.<br />
Wissenschafterinnen und Wissenschafter<br />
stellen das Individuum und damit die Auswirkungen<br />
staatlicher Politik auf den Einzelnen<br />
gleichberechtigt neben das klassische<br />
„Aktenwissen“ und geben so einen subjektiv-plastischen<br />
Eindruck jener Zeit wieder.<br />
Die biografische Arbeit in Form von Interviews<br />
erlebte in den vergangenen dreißig<br />
Jahren einen wahren Boom, sodass publikumsorientierte<br />
Formate wie Fernsehdokumentationen,<br />
Ausstellungen und Buchpro-<br />
jekte kaum mehr ohne diese Ebene der<br />
Ego-Dokumente bzw. Ego-Aussagen auskommen.<br />
Dabei gewinnt die faktische und<br />
thematische Relevanz dieser Erzählungen<br />
durch die penible Kontextualisierung und<br />
Gegenüberstellung mit anderen Quellenbeständen<br />
ihre spezifische Aussagekraft.<br />
Gleichzeitig ermöglicht dieses Verweben<br />
von Erkenntnissen über die „große<br />
Geschichte“ mit den Lebenswelten der<br />
betroffenen Individuen die anschauliche<br />
Darstellung historischer Prozesse. Der Kritik,<br />
die Oral History vertraue zu stark auf soft<br />
facts, die sich im Erinnerungsprozess im<br />
Laufe der Jahrzehnte verändern, die überschrieben,<br />
unterdrückt oder vergessen werden,<br />
begegnen Befürworterinnen und<br />
Befürworter der Methode mit dem Hinweis<br />
auf die Subjektivität und Selektivität sämtlicher<br />
historischer Quellen. Die objektive<br />
„Wahrheit“ der Geschichte ist niemals<br />
rekonstruier- und darstellbar, lediglich eine<br />
Annäherung unter Einbeziehung möglichst<br />
vielfältiger Perspektiven, wozu notwendigerweise<br />
die in Interviews geäußerten subjektiven<br />
Erfahrungen gehören, ist möglich.<br />
FOTO: WWW.MENSCHENLEBEN.AT | JOHANNES HOFINGER<br />
Unter dem Titel MenschenLeben sammelt<br />
das Technische Museum Wien mit Österreichischer<br />
Mediathek seit 2009 biografische<br />
Erzählungen von Österreicherinnen und<br />
Österreichern bzw. in Österreich lebenden<br />
Menschen, um Erlebnisse und Erinnerungen<br />
der Interviewten an das 20. und 21. Jahrhundert<br />
für kommende Generationen zu<br />
erhalten und zugänglich zu machen. Die<br />
bislang knapp 800 lebensgeschichtlichen<br />
Interviews aus dem von Univ.-Prof. Dr. Gerhard<br />
Jagschitz geleiteten Projekt stehen Wissenschafterinnen<br />
und Wissenschaftern<br />
sowie der interessierten Öffentlichkeit ohne<br />
Einschränkungen in den Benutzerräumen<br />
der Österreichischen Mediathek zur Verfügung<br />
und werden sukzessive über die Plattform<br />
www.oesterreich-am-wort.at für einen<br />
dezentralen und globalen Zugriff bereitgestellt.<br />
Das Aufwachsen in der Zwischenkriegszeit,<br />
die individuellen und gesamtgesellschaftlichen<br />
Herausforderungen nach<br />
den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs,<br />
die sich eröffnenden Möglichkeiten durch<br />
den zunehmenden Wohlstand und die<br />
finanzielle Unabhängigkeit sowie die beinahe<br />
uneingeschränkte Mobilität infolge des<br />
Wegfalls der Grenzen im vereinten Europa<br />
sind nur einige Eckpfeiler der österreichischen<br />
und europäischen Geschichte, denen<br />
anhand dieser individuellen Erzählungen<br />
nachgespürt werden kann und die uns<br />
somit einen Schritt näher zu Erkenntnissen<br />
über kollektive Erscheinungen und Verhaltensweisen<br />
bringen können.<br />
Mag. Johannes Hofinger, geb. 1978 in<br />
Grieskirchen, Zeithistoriker, Projektmitarbeiter<br />
des Technischen Museums Wien im Oral<br />
History Projekt MenschenLeben, Forschungsschwerpunkte:<br />
Jüdische Geschichte,<br />
Geschichte und Audiovision.<br />
INFOS ZUM PROJEKT UNTER<br />
www.menschenleben.at<br />
12 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
THEMA<br />
„Ich wollte nicht mehr Teil dieses Krieges sein“<br />
Kriegsdienstverweigerung heute.<br />
Text stammt von Connection e.V. unter Mitarbeit von Daniela Köck<br />
André Shepherd ging im Jahre 2004 zur US-<br />
Armee und war nach seiner Ausbildung<br />
sechs Monate als Mechaniker für den Apache-<br />
Hubschrauber im Irak eingesetzt. Nachdem<br />
er zurück zu seiner Einheit nach Ansbach-Katterbach<br />
(Bayern) gekommen war,<br />
setzte er sich intensiv damit auseinander, wie<br />
das US-Militär im Irak gegen die Zivilbevölkerung<br />
vorgeht. Als er im April 2007 erneut in<br />
den Irak gehen sollte, desertierte er und<br />
beantragte schließlich im November 2008<br />
Asyl in Deutschland. Seit dem Einmarsch im<br />
Irak sind mehr als 25.000 Soldat/Innen desertiert.<br />
Über 150 Verweigerer/Innen haben sich<br />
öffentlich gegen die Kriege im Irak und<br />
Afghanistan ausgesprochen, wie auch André<br />
Shepherd. „Wir haben Nationen zerstört,<br />
führende Persönlichkeiten getötet, Häuser<br />
geplündert, gefoltert, entführt, gelogen und<br />
nicht nur die Bürger und führenden Politiker<br />
der feindlichen Staaten, sondern auch die<br />
unserer Verbündeten manipuliert“- so André<br />
Shepherd. Sein Asylverfahren wird nun vor<br />
dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg<br />
verhandelt.<br />
Zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt<br />
haben Menschen aus unterschiedlichsten<br />
Gründen entschieden trotz Repressionen und<br />
Verfolgung ihren Kriegsdienst zu verweigern.<br />
Im Folgenden werden einige Fälle dargestellt.<br />
„I refuse because I want to<br />
make a difference”<br />
Israel ist ein Staat mit rund 7,2 Millionen<br />
Einwohnern und unterhält eine Armee mit<br />
rund 170.000 Soldaten und fast eine halbe<br />
Million Reservisten. Israel gehört zu den<br />
wenigen Staaten mit einer Wehrpflicht für<br />
Männer und Frauen. Nur ausgesprochen<br />
religiöse Juden können sich freistellen lassen.<br />
Direkt nach der Schule gehen junge<br />
Männer 36 Monate in die Armee, Frauen<br />
müssen knapp zwei Jahre dienen und der<br />
Gang in eine Kampfeinheit steht ihnen<br />
nicht unmittelbar offen. Jedes Jahr veröffentlichen<br />
einige Shministim (Schulabsolventen<br />
der Gymnasien) einen Brief an das<br />
Verteidigungsministerium, in diesem legen<br />
die Gymnasiasten/Innen dar, warum sie<br />
nicht in der Armee dienen wollen.<br />
Or Ben David hat 12 Wochen im Militärarrest<br />
verbracht, weil sie sich als Protest<br />
gegen die Besatzungspolitik des israelischen<br />
Militärs geweigert hat den Kriegsdienst zu<br />
leisten. „Die Gründe für meine Verweigerung?<br />
Zunächst einmal beschützt uns die<br />
israelische Armee nicht wirklich. Sie ist vielmehr<br />
eine Besatzungsarmee. Und dann ist<br />
die Armee ein patriarchaler Ort. Dort herrschen<br />
Männer, Mädchen werden vergewaltigt<br />
oder zumindest sexuell belästigt. Als<br />
Feministin will ich kein Teil eines so patriarchalen<br />
und gewalttätigen Systems sein.“<br />
Finnland: 180 Tage Arrest<br />
Jesse Kamila, ein 24-jähriger Kriegsdienstverweigerer<br />
aus Joensuu wurde am 12.<br />
Februar 2013 von einem Bezirksgericht<br />
wegen Zivildienstverweigerung zu 180<br />
Tagen Hausarrest verurteilt. Seit November<br />
2011 können Totalverweigerer in Finnland<br />
mit Hausarrest bestraft werden. Der Gefangene<br />
muss eine elektronische Fußfessel tragen<br />
und darf während der Strafe nur zum<br />
Studium oder zur Arbeit das Haus verlassen.<br />
Seit der Einführung des Hausarrests<br />
wurde diese Maßnahme häufig bei Totalverweigerern<br />
angewendet, auch wenn einige<br />
von ihnen weiter im Gefängnis inhaftiert<br />
wurden. Jesse Kamila hat den Zivildienst<br />
verweigert, weil er ihn als Strafe für die<br />
Verweigerung von Gewalt sieht. Der Zivildienst<br />
dauert 347 Tage, während der kürzeste<br />
Militärdienst 165 Tage dauert. Die<br />
UN-Menschenrechtskommission hatte in<br />
der Resolution 1998/77 erklärt, dass ein<br />
alternativer Dienst für Kriegsdienstverweigerer<br />
mit den Gründen der Kriegsdienstverweigerung<br />
vereinbar sein, einen zivilen oder<br />
waffenlosen Charakter besitzen und im<br />
öffentlichen Interesse liegen soll sowie keinen<br />
Strafcharakter, z.B. durch seine Dauer,<br />
haben darf.<br />
„Ich habe mein Leben Gott<br />
geweiht“ – Karen Smbatyan<br />
In Armenien dauert der Militärdienst zwei<br />
Jahre. Vor einigen Jahren wurde auf Druck<br />
des Europarates ein alternativer Dienst für<br />
Kriegsdienstverweigerung eingeführt. Dieser<br />
umfasst jedoch 42 Monate und steht unter<br />
der rigiden Aufsicht des Militärs. Die ersten<br />
Absolventen verließen diesen so genannten<br />
Zivildienst nach wenigen Tagen wieder und<br />
kritisierten ihn als „unwürdig“ und „nicht<br />
zivil“. Die meisten armenischen Kriegsdienstverweigerer<br />
sind Mitglied der Religionsgemeinschaft<br />
der Zeugen Jehovas, so wie Karen<br />
Smbatyan: „Jesaja sagt in Kapitel 2,4, alle<br />
Menschen sollen Schwerter und Waffen<br />
niederlegen und sie zu Pflugscharen machen.<br />
Gott fordert alle Nationen auf, keine Kriege<br />
zu führen. Ich folge dem und will nicht an<br />
Waffen ausgebildet werden.“ Da der Zivildienst<br />
der Kontrolle des Militärs untersteht,<br />
verweigern sie auch diesen. Sie werden meist<br />
mit Haft zwischen zwei und drei Jahren<br />
bestraft. Karen Smbatyan wurde wegen seiner<br />
Kriegsdienstverweigerung zu einem Jahr<br />
und 10 Monaten Haft verurteilt.<br />
Mag. Daniela Köck, Historikerin, tätig in der<br />
Museumsvermittlung, seit September 2012<br />
Praktikantin im Friedensbüro, Mitarbeit u.a.<br />
am Schwerpunktprojekt zum Thema Desertion.<br />
Quellen:<br />
▪ Broschüre Connection e.V. „US- Deserteur Andre Shepherd<br />
braucht Asyl“<br />
▪ http://december18th.org/2009/12/09/or-bendavid-<br />
2010/<br />
▪ Film "...aber hat nicht gedient" Junge Menschen verweigern<br />
den Krieg<br />
▪ www.connection-ev.de<br />
DVDTIPP<br />
Timo Vogt:<br />
...aber hat nicht<br />
gedient. DVD -<br />
Audioslideshow,<br />
45 min, mit 48<br />
Seiten Booklet,<br />
Trotzdem Verlag.<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 13
VERANSTALTUNGEN<br />
GEDENKSTUNDE<br />
FÜR SINTI UND ROMA<br />
ROMA UND SINTI IN SALZBURG<br />
EINE SPURENSUCHE<br />
Freitag, 26. April 2013, 11.00 Uhr Am Mahnmal, Ignaz Rieder Kai 21, 5020 <strong>Salzburg</strong><br />
(beim Spielplatz, 500 m salzachaufwärts ab Volksgarten)<br />
Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden am ehemaligen Trabrennplatz Sinti<br />
und Roma zusammengesperrt und von dort in das „Zigeunerlager“ Maxglan gebracht.<br />
Auf Grund des Auschwitz-Erlasses wurde das Lager Maxglan Ende März / Anfang April<br />
1943 aufgelassen. Der Großteil der Sinti und Roma wurde nach Auschwitz deportiert, eine<br />
kleinere Gruppe kam nach Lackenbach. Nur wenige überlebten. Heuer sind es 20 Jahre<br />
seit der Anerkennung der Roma als österreichische Volksgruppe. Bis heute halten sich alte<br />
antiziganistische Vorurteile und Projektionen. Auch heute werden Menschen in Europa<br />
verachtet, diskriminiert, abgeschoben, verfolgt, angegriffen und ermordet.<br />
Begrüßung: Prof. Rudolf Sarközi, Wien, Vorsitzender des Volksgruppenbeirats der österreichischen<br />
Roma<br />
Prolog: Tülin Pektas und Andreas Plank, Schauspielschule Schauspielhaus <strong>Salzburg</strong>;<br />
Johanna von Bibra, Studentin Mozarteum<br />
Ansprachen:<br />
Frau Rosa Gitta Martl und Frau Nicole Sevik – Verein Ketani für Sinti und Roma, Linz<br />
Bürgermeister Dr. Heinz Schaden<br />
Landtagsabgeordnete Gudrun Mosler -Törnström<br />
Kranzniederlegung<br />
Mit Unterstützung von Stadt und Land <strong>Salzburg</strong>.<br />
Kritischer Stadtrundgang<br />
Start: Schwarzgrabenweg/Maxglan (ehemaliges<br />
„Zigeunerlager“), 09:15 Uhr<br />
Ende: Mahnmal für die Roma & Sinti, Ignaz-Rieder-<br />
Kai, 11:00 Uhr<br />
Bis heute halten sich die Jahrhunderte alten antiziganistischen<br />
Vorurteile und Mythen und auch in der<br />
Gegenwart werden Sinti und Roma in Europa diffamiert,<br />
diskriminiert, verjagt und massiv angegriffen,<br />
wenn nicht sogar ermordet. Ausgehend vom Schikksal<br />
und individueller Lebensgeschichten jener Sinti<br />
und Roma, die im sog. „Zigeunerlager Maxglan" bis<br />
1943 von den Nationalsozialisten inhaftiert waren<br />
und von dort ins Vernichtungslager Auschwitz und<br />
andere Lager deportiert wurden, gehen wir auf eine<br />
Spurensuche: wie gestaltete und gestaltet sich das<br />
Leben der Sinti und Roma konkret in und um <strong>Salzburg</strong>?<br />
Woher kommen die weiterhin so starken<br />
antiziganistischen Tendenzen und Ausgrenzungsmechanismen?<br />
Eine Kooperation von: ÖH <strong>Salzburg</strong> und<br />
Friedensbüro <strong>Salzburg</strong><br />
BEZAHLTE ANZEIGE<br />
<strong>14</strong> KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg
VERANSTALTUNGEN<br />
STOLPERSTEINVERLEGUNG<br />
19. APRIL 2013, 8.30 UHR, LEOPOLDSKRONSTRASSE 35<br />
Georg PRODINGER, geboren am 24. Juni 1924 in Leopoldskron, wurde als 19-jähriger im Lauf des<br />
Kriegsjahres 1943 zur Deutschen Wehrmacht in <strong>Salzburg</strong> (Wehrkreis XVIII) einberufen und war Angehöriger<br />
des Ersatz-Bataillons Nr. I des Gebirgsjäger-Ersatz-Regiments 137, das der Division Nr. 418 unterstand.<br />
Aus der Kriegssterbefallanzeige geht hervor, dass Georg PRODINGER am 18. November 1943<br />
vom Kriegsgericht der Division Nr. 418 wegen Fahnenflucht zum Tode und Verlust der Wehrwürdigkeit<br />
verurteilt und am 25. Jänner 1944 im Zuchthaus München-Stadelheim geköpft wurde.<br />
Das Friedensbüro übernimmt im Rahmen des Schwerpunktprojekts „Desertion - Gesichter und<br />
Geschichte(n)“ die Patenschaft für den Stolperstein.<br />
Das Schwerpunktprojekt „Desertion - Gesichter<br />
und Geschichte(n)“ wird unterstützt von:<br />
INITIATIVE FREIES WORT<br />
<strong>Kranich</strong>-Abo:<br />
4 Ausgaben um 12 Euro<br />
Mitgliedschaft im Friedensbüro:<br />
Mitglied: 25 Euro<br />
Fördermitglied: 50 Euro<br />
StudentIn, Zivi, Wehrdiener: 15 Euro<br />
Mit Ihrem Abo unterstützen<br />
Sie die Arbeit des <strong>Salzburg</strong>er<br />
Friedensbüros.<br />
75 JAHRE SALZBURGER BÜCHERVERBRENNUNG<br />
30. APRIL 2013<br />
GRAFIK: HERIBERT DANKL<br />
2013 jährt sich zum 75. Mal die „<strong>Salzburg</strong>er Bücherverbrennung<br />
1938“. Die <strong>Salzburg</strong>er „Initiative Freies<br />
Wort“ will <strong>Salzburg</strong> zu einem Ort machen, an dem<br />
kontinuierlich daran erinnert wird, dass Emanzipation,<br />
Fortschritt und Utopie sich nur in Freiheit entwickeln<br />
können. Im Frühjahr 2013 setzen in <strong>Salzburg</strong> viele<br />
engagierte Personen und Institutionen mit<br />
zahlreichen Veranstaltungen, Projekten<br />
und Aktionen ein mutiges Zeichen weit<br />
über das notwendige Erinnern hinaus.<br />
Ab dem 5. April findet eine Reihe von Veranstaltungen<br />
statt. Am 30. April 2013 steht der gesamte Tag im<br />
Zeichen des Erinnerns in vielfältiger Form.<br />
Das gesamte Programm finden Sie unter<br />
http://www.literaturhaus-salzburg.at/<strong>Salzburg</strong>er-<br />
B%C3%BCcherverbrennung-<br />
19382013_96_129_208.html<br />
Unter Beteiligung von: ABZ - Haus der Möglichkeiten,<br />
BAKIP <strong>Salzburg</strong>, erinnern.at, Personenkommittee<br />
Stolpersteine, Grazer AutorInnenversammlung, <strong>Salzburg</strong>er<br />
AutorInnengruppe, IGNM <strong>Salzburg</strong>, Katholische<br />
Aktion, Institut für Medienbildung, Stadt und<br />
Land <strong>Salzburg</strong>, Literaturhaus <strong>Salzburg</strong>, ÖJRK <strong>Salzburg</strong>,<br />
Plattform Menschenrechte, prolit, Radiofabrik,<br />
Stadtarchiv, UB <strong>Salzburg</strong>, Universität <strong>Salzburg</strong>, Zentrum<br />
für Jüdische Kulturgeschichte, Stefan Zweig<br />
Centre, Friedensbüro <strong>Salzburg</strong> u.v.a.<br />
Wir danken für die Unterstützung:<br />
Das Friedensbüro wird unterstützt<br />
von Stadt <strong>Salzburg</strong> und Land <strong>Salzburg</strong><br />
Das Friedensbüro ist Mitglied folgender Plattformen:<br />
WIR DANKEN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG.<br />
OFFENLEGUNG<br />
lt. Mediengesetz §§25 +43, BGBl. Nr. 3<strong>14</strong>/1981<br />
Der ist die Zeitung des Friedensbüros<br />
<strong>Salzburg</strong> und berichtet mindestens vierteljährlich<br />
über friedenspädagogische und friedenspolitische<br />
Themen, Inhalte der Friedensforschung sowie<br />
Aktivitäten des Vereins »Friedensbüro <strong>Salzburg</strong>«.<br />
KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 15
Österreichische Post AG Infomail Entgelt bezahlt.<br />
Impressum:<br />
<strong>Kranich</strong> 1/13, Friedensbüro <strong>Salzburg</strong>,<br />
Franz-Josef-Straße 3, 5020 <strong>Salzburg</strong>.<br />
www.friedensbuero.at<br />
INFOS UNTER<br />
blog.radiofabrik.at/kiznewz<br />
Ein Projekt von: Radiofabrik und Friedensbüro