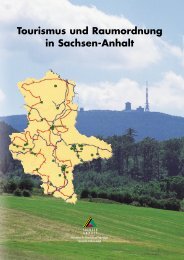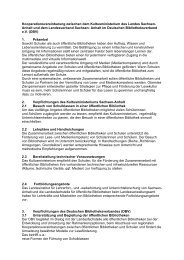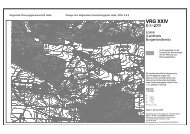Jahresbericht 2001
Jahresbericht 2001
Jahresbericht 2001
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong> 1<br />
<strong>Jahresbericht</strong><br />
<strong>2001</strong><br />
der Gewerbeaufsicht<br />
Sachsen-Anhalt
2<br />
Schriftleitung<br />
Dr.-Ing. Jost Melchior, LAS Dessau<br />
Fachredaktion/Autorinnen und Autoren<br />
Dipl. agr.-Ing. Leonore Brachmann, GAA Dessau<br />
Dipl.-Phys. Jens Döhler, GAA Stendal<br />
Dipl.-Ing. Wolf-Albrecht Fritsch, GAA Magdeburg<br />
Dipl.-Ing. Dietmar Glöckner, LAS Dessau<br />
Dr. rer. nat. Gerhard Greune, LAS Dessau<br />
Dipl.-Ing. Martin Hartmann, GAA Dessau<br />
Dr.-Ing. Guntram Herz, LAS Dessau<br />
Dipl.-Ing. Peter Hofmann, GAA Naumburg<br />
Dipl.-Ing. Dieter Kilz, GAA Halle<br />
Dipl.-Ing. Bernd Köhler, LAS Dessau<br />
Dipl.-Phys. Klaus Machlitt, GAA Halle<br />
Dr. rer. nat. Claus-Peter Maschmeier, LAS Dessau<br />
Dr.-Ing. Jost Melchior, LAS Dessau<br />
Dr. med. Jürgen Otto, LAS Dessau<br />
Dipl.-Ing. Jörg Przygodda, LAS Dessau<br />
Dr.-Ing. Bernhard Räbel, GAA Halle<br />
Dipl.-Ing. Holger Scheil, LAS Dessau<br />
Dr. rer. nat. Bernhard Schicht, LAS Dessau<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz Schuster, LAS Dessau<br />
Dipl.-Chem. Gerhard Soffner, LAS Dessau<br />
Dipl.-Ing. Andrea-Leonore Wendenburg, LAS Dessau<br />
Dipl.-Pharm. Petra Willmann, GAA Stendal<br />
Dipl.-Phys. Otfried Zerfass, LAS Dessau<br />
Zusammenfassung und Redaktion<br />
Dipl.-Chem. Klaus-Detlev Günther, LAS Dessau<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong>
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong> 3<br />
VORWORT<br />
Gesundheit gewinnt auch als<br />
Ziel der Unternehmenspolitik<br />
immer mehr an Bedeutung.<br />
Flankiert wird diese Entwicklung<br />
durch die verstärkt präventive<br />
Ausrichtung des Handelns<br />
der Arbeitsschutzverwaltung<br />
des Landes Sachsen-Anhalt.<br />
Die moderne Arbeitsschutzpolitik<br />
des Landes Sachsen-<br />
Anhalt zielt auf die Entwicklung einer Kultur der Risikoverhütung<br />
in Unternehmen durch die bewusste, eigenverantwortliche<br />
Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsprozessen<br />
und Produkten. Dabei stellen Kompetenzentwicklung<br />
und Partizipation der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar.<br />
Eine derartige Schwerpunktsetzung von Arbeitsschutzpolitik<br />
bedeutet, dass neben der notwendigen Kontrolle<br />
und Überwachung der Einhaltung von Arbeitsschutzgesetzen<br />
auch eine strategische Ausrichtung der<br />
Arbeitsschutzverwaltung in Richtung Beratung der Unternehmen<br />
erfolgt. Damit kann sich der Arbeits- und<br />
Gesundheitsschutz im Land Sachsen-Anhalt zu einem<br />
wichtigen Standortfaktor entwickeln.<br />
Gestützt werden diese Entwicklungen auf die Beschlüsse<br />
der 78. Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom<br />
Oktober <strong>2001</strong>, die einstimmig ein Handlungskonzept<br />
“Gesundheit bei der Arbeit” beschloss. Der Handlungsauftrag<br />
an die staatlichen Arbeitsschutzbehörden lautet:<br />
stärkeres Zusammenwirken zwischen Arbeitsschutz,<br />
Verbraucherschutz, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik<br />
sowie der Wirtschaftsförderung<br />
eine Verbreitung der Wissensbasis bei Unternehmen,<br />
Beschäftigten und Dienstleistern durch zielgruppenspezifische<br />
und handlungsrelevante Beratung und<br />
Qualifizierung sowie eine Modernisierung der Ausbildung<br />
im gesundheitlichen Arbeitnehmerschutz<br />
• die Verbesserung des betrieblichen Managements im<br />
Arbeits- und Gesundheitsschutz durch Förderung von<br />
Leitbildern für “Gesunde Organisationen”, die Berücksichtigung<br />
neuer Belastungsformen sowie die Entwicklung<br />
kleinbetriebstauglicher Handlungshilfen.<br />
Ein Beispiel für diese angestrebte Einheit von Beratung<br />
und Vollzug ist die im Jahr <strong>2001</strong> realisierte Aktion “Marktüberwachung”.<br />
Die Gewerbeaufsicht von Sachsen-Anhalt<br />
hat auf der Grundlage eines methodischen Konzeptes<br />
ihren Wirkungskreis als Marktüberwachungsbehörde<br />
erweitert und durch die Wahrnehmung sowohl der<br />
Kontrollfunktion als auch der beratenden Tätigkeit bereits<br />
in einem Stadium der Geräteherstellung Einfluss genommen,<br />
das vor dem eigentlichen Inverkehrbringen<br />
liegt und – soweit erforderlich – Korrekturen ermöglicht.<br />
42 im Land Sachsen-Anhalt ansässige Hersteller von<br />
Maschinen wurden aufgesucht. Der Beratungsbedarf<br />
dieser Klein- und Mittelbetriebe war groß. Defizite waren<br />
z. B. auf dem Gebiet der Erstellung und Dokumentation<br />
einer Gefahrenanalyse vorhanden. Es wurde festgestellt,<br />
dass die Hersteller für 31 begutachtete Maschinen<br />
die gesetzlich geforderte Dokumentation nicht vorweisen<br />
konnten. Mit der dargestellten gleichzeitigen Beratung<br />
als unmittelbarem Bestandteil der Überwachung<br />
der Hersteller leistet die Arbeitsschutzverwaltung des<br />
Landes einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung<br />
der Arbeitsmittel herstellenden Betriebe. Durch sichere<br />
Produkte werden auch das Leben und die Gesundheit<br />
der Benutzerinnen und Benutzer und Bürgerinnen und<br />
Bürger des Landes befördert und es wird ein Beitrag zum<br />
Verbraucherschutz geleistet.<br />
Dieser <strong>Jahresbericht</strong> ist mir Anlass, allen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit zu danken,<br />
verbunden mit den Wünschen nach innovativen<br />
Ideen sowie kreativer Gestaltung und Begleitung der<br />
sich neu herausbildenden Strukturen im Wandel der<br />
Arbeitswelt und in unserer modernen Verwaltung.<br />
Gerry Kley<br />
Minister für Gesundheit und Soziales<br />
des Landes Sachsen-Anhalt
4<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis ........................................................ 6<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Das Thema:<br />
Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller<br />
Sicherheit von Maschinen, Geräten und anderen<br />
technischen Produkten – wesentliche Grundlage für<br />
den Schutz von Beschäftigten und Verbrauchern .......... 8<br />
Ausgangspunkt ................................................................. 8<br />
Sichere technische Produkte ........................................... 8<br />
Sichere Produkte und freier Warenverkehr .................... 10<br />
Marktüberwachung ......................................................... 11<br />
Kontrolle und Beratung zur Sicherheit von Maschinen<br />
und technischen Geräten bei Herstellern im<br />
Land Sachsen-Anhalt ..................................................... 12<br />
Vorbereitung ....................................................................... 12<br />
Aktivitäten auf dem Gebiet der Sicherheit von<br />
Maschinen .......................................................................... 12<br />
Grundlagen ..................................................................... 12<br />
Arbeitsaufgabe ................................................................ 13<br />
Vorgehensweise .............................................................. 13<br />
Kontrolle und Beratung ................................................... 13<br />
Zur Gefahrenanalyse .................................................... 14<br />
Zu Schutzmaßnahmen ................................................. 15<br />
Zur Herstellererklärung ................................................. 16<br />
Beratung der Hersteller bzw. Inverkehrbringer von<br />
Geräten und Schutzsystemen zur Verwendung in<br />
explosionsgefährdeten Bereichen sowie von Druckgeräten<br />
im Sinne der Druckgeräterichtlinie .................. 16<br />
Aktuelle Verpflichtungen durch europäische<br />
Regelungen ........................................................................ 16<br />
Beratung der Hersteller von Geräten zum Einsatz in<br />
explosionsfähiger Atmosphäre .......................................... 17<br />
Beratung von Druckgeräteherstellern ................................ 17<br />
Zusammenfassung und Ausblick................................... 18<br />
Zur Situation im Arbeitsschutz – Anforderungen, Ergebnisse, Tendenzen –<br />
Arbeitsschutz in Sachsen-Anhalt ................................... 20<br />
Neue Strategieansätze für Sicherheit und<br />
Gesundheitsschutz in Deutschland ................................... 20<br />
Handlungsauftrag an die Staatlichen<br />
Arbeitsschutzbehörden ................................................... 21<br />
Psychische Fehlbelastungen und Stress .......................... 21<br />
Handlungskonzept für die Gewerbeaufsicht .................. 21<br />
Beratung und Aufsicht im Arbeitsschutz ........................... 22<br />
Unfallgeschehen im Land ............................................... 23<br />
Gefährdungsbeurteilung – Kernstück betrieblichen<br />
Arbeitsschutzes oder Papierkrieg? ............................... 24<br />
Gefährdung nicht ernst genommen .................................. 24<br />
Qualität der Gefährdungsbeurteilung ................................ 25<br />
Positive Ausstrahlung von guten Beispielen ..................... 26<br />
Medizinproduktesicherheit ............................................ 28<br />
Tödliche Vorkommnisse mit Betten ................................... 28<br />
Vielschichtige Defizite zur Anlagen- und<br />
Betriebssicherheit .......................................................... 29<br />
Explosionsschutz ............................................................... 29<br />
Getränkeschankanlagen .................................................... 29<br />
Reparatur eines Wärmetauschers ..................................... 29<br />
Strahlenschutz ................................................................ 30<br />
Gefahrstoffe .................................................................... 31<br />
Biologische Arbeitsstoffe ............................................... 32<br />
Sprengstoffrecht ............................................................. 33<br />
Sprengung von vier Schornsteinen ................................... 33<br />
Sozialer Arbeitsschutz .................................................... 34<br />
Arbeitszeitgesetz ................................................................ 34<br />
Arbeitsschutz in Zeitarbeitsfirmen ...................................... 35<br />
Mutterschutz ....................................................................... 35<br />
Gewerblicher Personen- und Güterverkehr .................. 36<br />
Medizinischer Arbeitsschutz .......................................... 37
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong> 5<br />
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land<br />
Inspektionen nach § 16 Störfall-VO zum Arbeitsschutz<br />
und zur technischen Sicherheit<br />
Erste Ergebnisse ............................................................ 40<br />
Anlass, Vorbereitung und Umfang der Inspektionen ........ 40<br />
Ergebnisse der Inspektionen ............................................. 41<br />
Anlagenidentität .............................................................. 41<br />
Sicherheitstechnisch bedeutsame Anlagenteile ............ 41<br />
Wiederkehrende Prüfungen ........................................... 41<br />
Technische Dichtheit ....................................................... 42<br />
Rohrleitungen und Armaturen ........................................ 42<br />
Explosions- und Brandschutz ........................................ 43<br />
Mess-, Steuer- und Regel-Einrichtungen,<br />
Prozessleitsysteme ......................................................... 43<br />
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen ................... 43<br />
Sicherheitscheck an Imbissständen .............................. 44<br />
Erhöhung des Schutzniveaus einer<br />
Sommerrodelbahn für Tausende Fahrgäste .................. 46<br />
Gabelstapler beim Umschlag und innerbetrieblichen<br />
Transport ........................................................................ 48<br />
Aufgabenstellung, Durchführung, Auswertung ................. 48<br />
Betriebsorganisatorische Voraussetzungen ...................... 48<br />
Sicherheitstechnische Voraussetzungen ........................... 49<br />
Transport- und Verkehrswege ............................................ 50<br />
Sachkundigenprüfungen, Gefahrstoffe ............................. 51<br />
Schlussfolgerungen ........................................................... 51<br />
Anhang<br />
Tabellen<br />
Tabelle 1 Personal der Arbeitsschutzbehörden ......... 74<br />
Tabelle 2 Betriebe und Beschäftigte<br />
im Zuständigkeitsbereich ............................ 74<br />
Tabelle 3.1 Dienstgeschäfte in Betrieben ...................... 76<br />
Tabelle 3.2 Dienstgeschäfte bei sonstigen<br />
Arbeitsstellen und Anlagen außerhalb<br />
des Betriebes .............................................. 75<br />
Tabelle 3.3 Sonstige Dienstgeschäfte<br />
im Außendienst............................................ 75<br />
Tabelle 4 Tätigkeiten und Beanstandungen<br />
im Außendienst............................................ 80<br />
Tabelle 5 Tätigkeiten und Vorgänge im Innendienst ... 81<br />
Arbeitssicherheit beim Einsatz der Autogentechnik .... 52<br />
Aus Schaden lernen ........................................................... 52<br />
Allgemeines ........................................................................ 53<br />
Technische Mängel an den Einzelflaschenanlagen .......... 53<br />
Mangelart “organisatorische Voraussetzungen” ............... 53<br />
Mit Sicherheit eine neue Anlage .................................... 56<br />
Thermische Metallbehandlung unter Freisetzung<br />
von Kanzerogenen .......................................................... 59<br />
Einleitung und Zielstellung ................................................. 59<br />
Durchführung ..................................................................... 59<br />
Darstellung der Ergebnisse ............................................... 59<br />
Betriebsbezogene Auswertung der Einhaltung von<br />
Arbeitgeberpflichten beim Umgang mit<br />
krebserzeugenden Gefahrstoffen ................................... 59<br />
Auswertung der Gefährdungssituation in Abhängigkeit<br />
vom angewendeten Bearbeitungsverfahren .................. 62<br />
Arbeitsmedizinische Vorsorge ........................................ 65<br />
Behördliches Handeln .................................................... 65<br />
Zusammenfassung ............................................................. 65<br />
Schutz der arbeitenden Jugend ..................................... 66<br />
Kontrolle der Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes<br />
in ausbildenden Betrieben des Gastgewerbes ................. 66<br />
Bildschirmarbeitsplätze überprüft ................................. 68<br />
Wirksamkeit der Arbeitsschutzaufsicht ......................... 70<br />
Tabelle 6 Überprüfungen nach dem<br />
Gerätesicherheitsgesetz ............................. 82<br />
Tabelle 7 Dienstgeschäfte und Tätigkeiten des<br />
gewerbeärztlichen Dienstes ........................ 83<br />
Tabelle 8 Begutachtete Berufskrankheiten................. 84<br />
Verzeichnisse<br />
Verzeichnis 1 Bezeichnungen und Anschriften der<br />
Dienststellen............................................. 86<br />
Verzeichnis 2 Veröffentlichungen ................................... 87<br />
Informationsmaterialien der Gewerbeaufsicht ............... 88
6<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
Verzeichnis der im <strong>Jahresbericht</strong> verwendeten Abkürzungen – alphabetisch geordnet<br />
ADR ....................... Internationales Übereinkommen über die Beförderung<br />
gefährlicher Güter auf der Straße<br />
AN ......................... ArbeitnehmerInnen<br />
ArbSchG ............... Arbeitsschutzgesetz<br />
ArbZG ................... Arbeitszeitgesetz<br />
ASMK .................... Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Bundesländer<br />
ASR ....................... Arbeitsstättenrichtlinie<br />
BAG ....................... Bundesamt für Güterverkehr<br />
BAuA ..................... Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin<br />
BaustellV ............... Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
auf Baustellen<br />
BErzGG ................. Bundeserziehungsgeldgesetz<br />
BG ......................... Berufsgenossenschaft<br />
BGBl. ..................... Bundesgesetzblatt<br />
BGV ....................... Berufsgenossenschaftliche Vorschriften<br />
BIA ........................ Berufsgenossenschaftliches Institut für<br />
Arbeitssicherheit<br />
BImSchG .............. Bundesimmissionsschutzgesetz<br />
BioStoffV ............... Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitstoffen<br />
(BioStoffV vom 27. Januar 1999, BGBl I<br />
Nr. 4, S. 50)<br />
BK ......................... Berufskrankheit<br />
BKV ....................... Berufskrankheitenverordnung<br />
BMA ...................... Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung<br />
CE ......................... Europäische Kennzeichnung, Konformitätszeichen<br />
DGRL .................... Druckgeräterichtlinie<br />
DruckbehV ............ Druckbehälterverordnung<br />
EG ......................... Europäische Gemeinschaft<br />
ElexV ..................... Verordnung über elektrische Anlagen in<br />
explosionsgefährdeten Räumen<br />
EU ......................... Europäische Union<br />
EuGH .................... Europäischer Gerichtshof<br />
EWR ...................... Europäischer Wirtschaftsraum<br />
GAA ....................... Staatliches Gewerbeaufsichtsamt/ Staatliche<br />
Gewerbeaufsichtsämter<br />
GAV ....................... Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
GefStoffV ............... Gefahrstoffverordnung<br />
GenTG .................. Gentechnikgesetz<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
GGVS .................... Gefahrgutverordnung Straße<br />
GK ......................... Größenklasse bei Betriebsgrößen<br />
GK 1: 1.000 und mehr Beschäftigte<br />
GK 2: 200 bis 999 Beschäftigte<br />
GK 3: 20 bis 199 Beschäftigte<br />
GK 4: 1 bis 19 Beschäftigte<br />
GK 5: ohne Beschäftigte<br />
GSG ...................... Gerätesicherheitsgesetz<br />
GSGV .................... Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz<br />
HVBG .................... Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften<br />
JArbSchG ............. Jugendarbeitsschutzgesetz<br />
KindArbSchV ........ Kinderarbeitsschutzverordnung<br />
KMU ...................... Kleine und mittlelgroße Unternehmen<br />
LAS ....................... Landesamt für Arbeitsschutz Sachsen-Anhalt<br />
LASI ...................... Länderausschuss für Arbeitsschutz und<br />
Sicherheitstechnik<br />
LSA ....................... Land Sachsen-Anhalt<br />
MKS ...................... Maul- und Klauenseuche<br />
MPG ...................... Medizinproduktegesetz<br />
MS ......................... Ministerium für Gesundheit und Soziales des<br />
LSA<br />
MSR ...................... Mess-, Steuer- und Regeltechnik<br />
OWiG .................... Ordnungswidrigkeitengesetz<br />
PSA ....................... Persönliche Schutzausrüstung<br />
RL .......................... Richtlinie<br />
RP MD ................... Regierungspräsidium Magdeburg<br />
RID ........................ Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung<br />
gefährlicher Güter<br />
SchankV ................ Getränkeschankanlagenverordnung<br />
SiGe- ..................... Sicherheits- und Gesundheitsschutz-...<br />
SprengG ............... Sprengstoffgesetz<br />
StAU ...................... Staatliche Ämter für Umweltschutz LSA<br />
VbF ........................ Verordnung über brennbare Flüssigkeiten<br />
VDE ....................... Verein Deutscher Elektroingenieure<br />
VwVfG ................... Verwaltungsverfahrengesetz
Das Thema: Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller 7<br />
Das Thema:<br />
Gewerbeaufsicht kontrolliert<br />
Maschinen sowie Geräte<br />
und berät deren Hersteller
8 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Sicherheit von Maschinen, Geräten und anderen technischen Produkten –<br />
wesentliche Grundlage für den Schutz von Beschäftigten und Verbrauchern<br />
Ausgangspunkt<br />
Bei der Arbeit im Betrieb und auf der<br />
Baustelle, im Büro und im Haushalt wie<br />
auch im Freizeitbereich bei Hobby,<br />
Sport und Spiel ereignen sich immer<br />
wieder Unfälle. Viele Verletzungen und<br />
leider auch Todesfälle resultieren aus<br />
der Unterschätzung von Gefahren sowie<br />
unbedachten Verhaltensweisen.<br />
Hier können nur wiederholtes Belehren,<br />
Aufzeigen der Gefahren, Training<br />
in Verbindung mit der Organisation sicherer<br />
Abläufe und sicherheitsorientierte<br />
Gestaltung entsprechender Bereiche<br />
zu Verbesserungen führen.<br />
Grundvoraussetzung eines Erfolges all<br />
dieser Maßnahmen ist jedoch, dass<br />
zunächst die für die Arbeit, Freizeitaktivitäten<br />
und sonstigen Tätigkeiten<br />
zur Verfügung gestellten bzw. benutzten<br />
Maschinen, Geräte und anderen<br />
technischen Produkte sicher sind.<br />
Sichere technische<br />
Produkte<br />
Was zeichnet eine sichere Maschine,<br />
ein sicheres Gerät oder anderes Produkt<br />
aus?<br />
Bei der vorschriftsmäßigen Benutzung<br />
eines Produktes dürfen Leben und<br />
Gesundheit weder der Benutzerinnen<br />
und Benutzer noch unbeteiligter Dritter<br />
durch dieses gefährdet werden. Diese<br />
Forderung richtet sich in jedem Falle<br />
zunächst als komplexe Aufgabe an den<br />
Hersteller eines technischen Produkts.<br />
Er muss im Konstruktions- und Produktionsprozess<br />
also neben der Realisierung<br />
wirtschaftlicher und funktionstechnischer<br />
Gesichtspunkte auch darauf<br />
achten, dass ein sicheres Produkt entsteht.<br />
Unter der Voraussetzung, dass<br />
der Konstrukteur sicherheitsgerecht<br />
konstruiert hat, wird dann sicherheitsgerecht<br />
produziert, wenn bei der Fertigung,<br />
Montage und Erprobung die Ausführungsangaben<br />
des Konstrukteurs<br />
konsequent zur Umsetzung kommen.<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz Schuster, Dr.-Ing. Guntram Herz, Dipl.-Ing. Bernd Köhler<br />
Abb. 1.1 An diesem Ausleger einer CE-gekennzeichneten Bogendruckmaschine ereignete<br />
sich im Jahr <strong>2001</strong> in einer Druckerei in Sachsen-Anhalt ein Arbeitsunfall, bei dem ein<br />
Beschäftigter tödliche Verletzungen erlitt.<br />
Der Ausleger der Bogendruckmaschine<br />
enthält ein aus Metall bestehendes<br />
Greifersystem für den Transport<br />
der bedruckten Bogen zum Auslagebereich.<br />
Im Bereich der Bogenauslage<br />
ist der Zugang zum Bogengreifersystem<br />
von oben und allseitig<br />
durch feststehende oder verriegelte<br />
trennende Schutzeinrichtungen verhindert.<br />
Diese Schutzeinrichtungen<br />
reichen aber nur bis auf die Unterkante<br />
des Bogengreifersystems herunter,<br />
was u. a. damit begründet wird,<br />
dass während des Betriebs der Maschine<br />
dem Ausleger Probebogen<br />
entnommen werden müssen. Benutzerinformationen<br />
warnen vor den<br />
noch vorhandenen Gefahren.<br />
Die tödlichen Verletzungen erlitt der<br />
Beschäftigte durch Quetschung zwischen<br />
dem Bogengreifersystem und<br />
feststehenden Teilen des Auslegers,<br />
weil<br />
er die Maschine in einer Weise<br />
verwendet hat, die sich zwar aus<br />
dem leicht vorhersehbaren<br />
menschlichen Verhalten ergeben<br />
kann, jedoch vom Hersteller nicht<br />
vorgesehen ist und<br />
die Maschine nicht so konstruiert<br />
wurde, dass eine solche vernünftigerweise<br />
vorhersehbare Fehlanwendung<br />
verhindert ist, obwohl eine<br />
stets einzuhaltende grundlegende<br />
Sicherheitsanforderung dies verlangt.<br />
Aus dem letztgenannten Grund initiierte<br />
die Gewerbeaufsicht des Landes<br />
Sachsen-Anhalt die konstruktive Weiterentwicklung<br />
des Auslegers unter<br />
sicherheitstechnischem Aspekt.<br />
Zwischenzeitlich ist von dem für den<br />
Hersteller der Bogendruckmaschine<br />
zuständigen Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt<br />
eines anderen Bundeslandes<br />
mitgeteilt worden, dass es nun<br />
erklärtes Ziel des Herstellers ist, eine<br />
geeignete konstruktive Lösung für das<br />
Problem zu finden und zu realisieren.<br />
Als Sofortmaßnahme rüstet der Hersteller<br />
die Bogendruckmaschinen mit<br />
weiteren Benutzerinformationen (Schildern<br />
mit entsprechenden Warnhinweisen)<br />
aus.
Das Thema: Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller 9<br />
Im Konstruktionsprozess ist das Ziel,<br />
ein sicheres Produkt herzustellen bzw.<br />
zu entwickeln, in nachstehender Rangfolge<br />
zu verwirklichen:<br />
1.Das Produkt soll so gestaltet werden,<br />
dass es eigensicher ist (unmittelbare<br />
Sicherheitstechnik).<br />
2.Ist eine Lösung der unmittelbaren<br />
Sicherheitstechnik nicht oder nicht<br />
vollständig möglich, sollen besondere<br />
sicherheitstechnische Mittel, so<br />
genannte Schutzeinrichtungen, Verwendung<br />
finden (mittelbare Sicherheitstechnik).<br />
3.Führen die Maßnahmen der unmittelbaren<br />
oder mittelbaren Sicherheitstechnik<br />
nicht oder nicht vollständig<br />
zum Ziel, muss angegeben werden,<br />
unter welchen Bedingungen eine sichere<br />
Verwendung möglich ist (hinweisende<br />
Sicherheitstechnik).<br />
Im Zusammenhang mit der hinweisenden<br />
Sicherheitstechnik hat der Hersteller<br />
vor allem Folgendes zu beachten: Können<br />
bestimmte Gefahren durch die Art<br />
des Transports, der Lagerung, der Aufstellung,<br />
der Anbringung oder der Inbetriebnahme<br />
eines technischen Produktes<br />
verhütet werden, so muss darauf<br />
Abb. 1.2 Explosionsgefährdeter Bereich mit bestimmungsgemäß für dieses Gefahrenpotenzial<br />
in Verkehr gebrachten Geräten<br />
Die hier verwendeten Geräte mit potenziellen<br />
Zündquellen müssen bestimmungsgemäß<br />
dem Einsatz in<br />
staubexplosionsgefährdeten Bereichen<br />
entsprechen. Sie müssen so gestaltet<br />
bzw. mit Schutzeinrichtungen<br />
versehen sein, dass im normalen Betrieb<br />
– aber auch bei Störungen –<br />
explosionsfähige Atmosphären (Gemische<br />
brennbarer Gase, Dämpfe oder<br />
Stäube mit Luft) nicht gezündet wer-<br />
den können. Die Eignung der Geräte<br />
für den spezifischen Einsatzfall kann<br />
allerdings nur dann unterstellt werden,<br />
wenn zusätzliche Angaben des Herstellers<br />
– u. a. zur Zuverlässigkeit des<br />
Zündquellenausschlusses (Kategorie)<br />
sowie zur maximalen Oberflächentemperatur<br />
(Temperaturklasse) – den<br />
betrieblichen Anforderungen entsprechen.<br />
ausreichend hingewiesen werden. Müssen<br />
zur Verhütung von Gefahren bestimmte<br />
Regeln bei der Verwendung,<br />
Ergänzung und Instandhaltung eines<br />
technischen Produkts beachtet werden,<br />
so ist eine leicht verständliche Gebrauchsoder<br />
Betriebsanleitung mitzuliefern.<br />
Es gehört zu den Pflichten des Staates, z.<br />
B. durch Erlass entsprechender Gesetze,<br />
seine Bürger vor Produkten zu schützen,<br />
aus deren Benutzung unvertretbare<br />
Gefahren für Leben und Gesundheit resultieren.<br />
Der Staat ist außerdem für die<br />
Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen<br />
zuständig, d. h., staatliche Institutionen<br />
– wie z. B. die Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
– werden zur Aufsicht<br />
über die Einhaltung von Bestimmungen<br />
zum Inverkehrbringen von Produkten verpflichtet.<br />
Die Notwendigkeit von gesetzlichen<br />
Festlegungen zur Maschinen- und<br />
Gerätesicherheit entsprechend des Standes<br />
der Technik sowie der behördlichen<br />
Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen<br />
wird leider immer wieder durch<br />
entsprechende Ereignisse, wie Unfälle<br />
durch Maschinen, belegt (Abb. 1.1).<br />
Im Falle explosionsgefährdeter Bereiche<br />
ist das Gefahrenpotenzial abhängig<br />
von der Wahrscheinlichkeit und<br />
Dauer des Auftretens explosionsfähiger<br />
Atmosphäre sowie besonderen physikalisch-chemischen<br />
Eigenschaften des<br />
die Explosionsgefahr verursachenden<br />
brennbaren Stoffes. Die hier verwendeten<br />
Geräte müssen sehr differenzierten<br />
spezifischen Forderungen gerecht<br />
werden (Abb. 1.2).
10 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Sichere Produkte und freier<br />
Warenverkehr<br />
Mit der Schaffung des Europäischen<br />
Binnenmarktes verpflichteten sich die<br />
einzelnen Mitgliedsstaaten zum Abbau<br />
von Handelshemmnissen, die einem<br />
freien Warenverkehr entgegenstehen.<br />
Freier Warenverkehr bedeutet nicht,<br />
dass der europäische Binnenmarkt frei<br />
ist für Produkte aller Art, unabhängig<br />
von ihrem Gefahrenpotenzial. Mit dem<br />
“new approach” (neuen Konzept) hat<br />
die EU jedoch vereinbart, dass alle<br />
Produkte, die in einem Mitgliedsstaat<br />
legal hergestellt oder eingeführt (in<br />
Verkehr gebracht) werden, uneingeschränkt<br />
im Europäischen Wirtschaftsraum<br />
vertrieben werden dürfen.<br />
Im Rahmen dieses Konzeptes hat<br />
man sich zum Schutz der Bürgerinnen<br />
und Bürger vor unsicheren Produkten<br />
einerseits und der Ermöglichung eines<br />
freien Warenverkehrs andererseits<br />
verpflichtet, dass Produkte mit entsprechendem<br />
Gefahrenpotenzial grundlegenden<br />
Sicherheitsanforderungen<br />
an Konstruktion und Produktion zu entsprechen<br />
haben, wobei die Mitgliedsstaaten<br />
die hierzu erlassenen europäischen<br />
Richtlinien in nationales Recht<br />
(“1:1 - Umsetzung”) übernehmen müssen.<br />
Zu den Aufgaben der Mitgliedsstaaten<br />
des Europäischen Wirtschaftsraumes<br />
(EWR) gehört auch die staatliche<br />
Kontrolle der Einhaltung der<br />
europäisch einheitlichen (harmonisierten)<br />
Festlegungen zur Sicherheit<br />
von Maschinen, Geräten und anderen<br />
technischen Produkten im Sinne einer<br />
Marktüberwachung (Abb. 1.3).<br />
Über die in Abb. 1.3 hinaus aufgeführten<br />
Richtlinien gelten weitere europäische<br />
Richtlinien auch für solche technischen<br />
Arbeitsmittel wie Aufzüge, Gasverbrauchseinrichtungen<br />
sowie die in<br />
der deutschen Umsetzung – dem Gerätesicherheitsgesetz<br />
(GSG) – den technischen<br />
Arbeitsmitteln gleichgestellten<br />
Produkten, wie Persönliche Schutzausrüstungen,<br />
Spielzeug und Sportboote.<br />
Auch die grundlegenden Sicherheitsanforderungen<br />
an Medizinprodukte<br />
wurden für den europäischen Wirtschaftsraum<br />
verbindlich in einer euro-<br />
Abb. 1.3 Europäisches und nationales Recht bei der Herstellung technischer Arbeitsmittel<br />
päischen Richtlinie geregelt und in nationales<br />
Recht (in Deutschland: Medizinproduktegesetz<br />
– MPG) umgesetzt.<br />
Während die in europäischen Richtlinien<br />
geregelten Anforderungen an Beschaffenheit<br />
und Inverkehrbringen von<br />
technischen Arbeitsmitteln und anderen<br />
Produkten als verbindliche Vorschriften<br />
anzuwenden sind, gilt das<br />
nicht für die Vielzahl der diese Richtlinien<br />
untersetzenden europäischen Normen,<br />
deren Titel im Amtsblatt der Europäischen<br />
Gemeinschaften als harmonisierte<br />
Normen veröffentlicht werden.<br />
Unabhängig von der Anwendung bzw.<br />
Nichtanwendung harmonisierter Nor-<br />
men obliegt es dem Inverkehrbringer,<br />
im Allgemeinen in einer Konformitätserklärung,<br />
die Übereinstimmung mit<br />
den europäischen Richtlinien zu erklären,<br />
unter deren Geltungsbereich das<br />
Produkt fällt und dieses zum formalen<br />
Ausdruck der Konformität mit dem CE-<br />
Zeichen zu versehen. Den Pflichten<br />
des Inverkehrbringers unterliegt der im<br />
EG-Wirtschaftsraum angesiedelte Hersteller<br />
ebenso wie der Einführer eines<br />
Produktes, welches ein nicht in diesem<br />
Wirtschaftsraum beheimateter Hersteller<br />
auf den europäischen Markt bringen<br />
möchte.
Das Thema: Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller 11<br />
Marktüberwachung<br />
Wie bereits dargestellt, war es mit der<br />
Einführung eines einheitlichen gemeinsamen<br />
Binnenmarktes im Europäischen<br />
Wirtschaftsraum erforderlich, die<br />
Abschaffung bestehender Handelshemmnisse<br />
durch die weitgehende<br />
Harmonisierung unterschiedlicher nationaler<br />
Sicherheitsanforderungen bei<br />
technischen Erzeugnissen und Produkten<br />
zu garantieren.<br />
In dem Maße, wie erkannt wurde, dass<br />
eine in diesem Rahmen orientierte Marktwirtschaft<br />
die Gewähr zur Einhaltung<br />
aller harmonisierten Sicherheitsanforderungen<br />
nicht ausschließlich über die<br />
Regulierung des sich zunehmend verschärfenden<br />
Wettbewerbs gibt, gewann<br />
die Forderung nach einer angemessenen<br />
und qualifizierten Marktüberwachung<br />
durch die Staaten des EWR selbst<br />
zunehmend an Bedeutung. Somit sieht<br />
der “Aktionsplan für den Binnenmarkt”<br />
der Europäischen Kommission neben<br />
dem Abbau spezifischer Handelsschranken<br />
auch die Verschärfung der Produktkontrollen<br />
vor. Dabei wird gefordert, dass<br />
die Bestimmungen und sicherheitstechnisch<br />
einschlägigen Regelungen<br />
der Europäischen Richtlinien zu spezifischen<br />
Erzeugnissen (Maschinen, elektrische<br />
Erzeugnisse u. a. sog. harmonisierte<br />
Produkte) gemeinschaftsweit und<br />
einheitlich eingehalten werden.<br />
Die EG-Richtlinien nach Artikel 95 des<br />
EG-Vertrages zu technischen Arbeitsmitteln<br />
und den technischen Arbeitsmitteln<br />
gleichgestellten Erzeugnissen<br />
wurden in der Bundesrepublik im Geltungsbereich<br />
des Gerätesicherheitsgesetzes<br />
durch Verordnungen auf<br />
Grundlage von § 4 GSG umgesetzt. Für<br />
die Umsetzung dieser Binnenmarktrichtlinien<br />
sind das Bundesarbeitsministerium<br />
und für die Kontrolle der Einhaltung<br />
in der Regel die Gewerbeauf-<br />
sichts-/Arbeitsschutzverwaltungen der<br />
Länder zuständig. Diese Behörden verfügen<br />
– so auch in Sachsen-Anhalt –<br />
über die erforderliche fachliche Kompetenz<br />
sowie die für die Marktüberwachung<br />
geforderte Unabhängigkeit<br />
und Befugnisse. Das EG-Recht schließt<br />
systematische Marktkontrollen aus.<br />
Eine Prüfpflicht durch die örtliche Marktüberwachungsbehörde<br />
besteht nur bei<br />
Gefahrenhinweisen, die von anderen<br />
Behörden oder aus sonstigen Quellen<br />
herrühren können. Liegen derartige Informationen<br />
nicht vor, hat sich die Marktüberwachung<br />
auf Stichproben zu beschränken.<br />
Die Bundesländer sind dabei, verbesserte<br />
Kommunikationsstrukturen und<br />
Informationsbeziehungen untereinander<br />
sowie zu anderen die Marktüberwachung<br />
tangierenden Einrichtungen<br />
aufzubauen und verständigen sich auf<br />
eine schwerpunktorientierte Arbeitsteilung<br />
(insbesondere auch beim Aufbau<br />
und der Nutzung eigener Geräteuntersuchungsstellen<br />
der Länder). Diese<br />
Aktivitäten basieren auf einem Beschluss<br />
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz<br />
der Bundesländer aus<br />
dem Jahr 1999, der vom Länderausschuss<br />
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik<br />
(LASI) durch das “Konzept<br />
einer länderübergreifenden Zusammenarbeit<br />
der Marktaufsichtsbehörden<br />
der BRD” umgesetzt wurde.<br />
Damit wird eine Erhöhung der Effizienz<br />
der Marktüberwachung im Sinne von<br />
Stichproben-Kontrollen von beliebigen<br />
auf dem deutschen Markt angebotenen<br />
Produkten, die den erwähnten EG-<br />
Richtlinien unterliegen, bei einerseits<br />
steigendem Aufgabenvolumen und<br />
andererseits unumgänglicher Personal-<br />
und Kostenreduzierung angestrebt.<br />
Mit einer effektiven Marktüberwachung<br />
werden nicht nur – wie eingangs dar-<br />
gestellt – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
und sonstige Benutzerinnen<br />
und Benutzer von technischen<br />
Arbeitsmitteln und anderen Produkten<br />
vor Gefahren geschützt, sondern es<br />
entsteht ein positiver marktregulierender<br />
Nebeneffekt auch dadurch, dass<br />
sicherheits-orientierte Hersteller ggf. vor<br />
unlauteren Wettbewerbern, die vom<br />
Unterlaufen der europäisch harmonisierten<br />
Mindestanforderungen an die<br />
Geräte- bzw. Produktsicherheit profitieren<br />
wollen, geschützt werden. Auch<br />
das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich<br />
und übernimmt Aufgaben im Rahmen<br />
der Arbeitsteilung und Kooperation<br />
der Bundesländer bei der Marktüberwachung.<br />
Marktüberwachung ist dann am wirksamsten,<br />
wenn sie an den Quellen der<br />
Warenströme ansetzt. Diese Quellen<br />
sind die im entsprechenden Aufsichtsbereich<br />
angesiedelten Hersteller und<br />
Einführer technischer Arbeitsmittel, die<br />
von hier aus den europäischen Markt<br />
beliefern.<br />
Die Gewerbeaufsicht von Sachsen-<br />
Anhalt hat es sich zur Aufgabe gemacht,<br />
neben der Wahrnehmung der<br />
allgemeinen Pflichten der Marktüberwachungsbehörde<br />
insbesondere auch<br />
auf die im Land angesiedelten Inverkehrbringer<br />
technischer Arbeitsmittel<br />
zuzugehen. Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt<br />
(GAA) – diesen Unternehmen<br />
ohnehin bekannt als die für den<br />
Arbeitsschutz und die Betriebssicherheit<br />
zuständige Behörde – erweitert<br />
hier seinen Wirkungskreis als Marktüberwachungsbehörde,<br />
die bemüht ist,<br />
durch Wahrnehmung von Kontrollfunktionen<br />
und beratender Tätigkeit bereits<br />
in einem Stadium der Geräteherstellung<br />
Einfluss zu nehmen, das vor dem<br />
eigentlichen Inverkehrbringen liegt und<br />
– soweit erforderlich – Korrekturen ermöglicht.
12 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Kontrolle und Beratung zur Sicherheit von Maschinen und technischen Geräten<br />
bei Herstellern im Land Sachsen-Anhalt<br />
Die zur Marktüberwachung im Rahmen<br />
des GSG verpflichtete staatliche<br />
Gewerbeaufsichtsverwaltung führte auf<br />
der Basis eines vom Landesamt für<br />
Arbeitsschutz des Landes Sachsen-<br />
Anhalt (LAS) erarbeiteten Konzeptes<br />
von April bis Oktober des Jahres <strong>2001</strong><br />
eine landesweite Sonderaktion bei in<br />
Sachsen-Anhalt ansässigen Herstellern<br />
zur Erfüllung der sicherheitstechnischen<br />
Anforderungen und sonstigen<br />
Voraussetzungen des GSG durch. Die-<br />
Vorbereitung<br />
Durch das LAS wurden in Vorbereitung<br />
der Beratungsgespräche und Überprüfungen<br />
den fachspezifischen Kontrollkräften<br />
in den GAA folgende Arbeitsunterlagen<br />
als Module (eingestellt in<br />
das Intranet) zur Verfügung gestellt:<br />
Modul 1 Prüfung bei Maschinen im<br />
Sinne der 9. GSGV<br />
Modul 2 Verhütung mechanischer<br />
Gefahren im Rahmen der<br />
Konstruktion von Maschinen<br />
Modul 3 Sicherheitsanforderungen<br />
an die elektrische Ausrüstung<br />
von Maschinen<br />
Modul 4 Richtlinien für die Konstruktion<br />
lärmarmer Maschinen<br />
Modul 5 Ergonomische Grundsätze<br />
für die Konstruktion sicherer<br />
Maschinen<br />
Modul 6 Geräte und Schutzsysteme<br />
zur bestimmungsgemäßen<br />
Verwendung in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen<br />
Modul 7 Druckgeräte nach der<br />
Druckgeräterichtlinie<br />
(Richtlinie 97/23/EG<br />
DGRL)<br />
Darüber hinaus wurde durch das LAS<br />
eine Schulung der Leitungskräfte und<br />
Spezialisten in den GAA durchgeführt.<br />
Da in Bezug auf die Verordnungen zum<br />
Gerätesicherheitsgesetz Hersteller von<br />
Maschinen den Hauptanteil innerhalb<br />
der Wirtschaftsstruktur des Landes<br />
Aktivitäten auf dem Gebiet der Sicherheit von Maschinen<br />
Grundlagen<br />
Die zentrale Rechtsvorschrift für das<br />
Herstellen von sicheren Maschinen ist<br />
in der Regel die Neunte Verordnung<br />
zum Gerätesicherheitsgesetz (9. GSGV).<br />
Sie nennt die Voraussetzungen für das<br />
Inverkehrbringen dieser technischen<br />
Arbeitsmittel. Danach müssen in erster<br />
Linie die grundlegenden Sicherheitsanforderungen<br />
des Anhangs I der EG-<br />
Maschinenrichtlinie eingehalten sein.<br />
Die meisten grundlegenden Sicherheitsanforderungen<br />
decken Gefahren<br />
se Sonderaktion bezog sich auf Hersteller<br />
von Maschinen (9. GSGV, ggf.<br />
in Verbindung mit elektrischen Sicherheitsanforderungen<br />
entsprechend der<br />
1. GSGV) sowie Geräten und Schutzsystemen<br />
für explosionsgefährdete<br />
Bereiche (11. GSGV) und Druckgeräte<br />
(EG-Druckgeräterichtlinie).<br />
Der wesentliche Vorteil dieses Strategiekonzeptes<br />
bestand darin, dass sich<br />
die Überwachung auf die ansässigen<br />
Hersteller und damit auf die Quellen<br />
ab und sind, sofern sie zutreffen, bei<br />
der Konstruktion und Produktion von<br />
Maschinen zu berücksichtigen. Im Abschnitt<br />
”Vorbemerkungen“ des Anhangs<br />
I der EG-Maschinenrichtlinie ist<br />
festgelegt, dass<br />
eine vollständige Gefahrenanalyse<br />
vorgenommen werden muss und die<br />
zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen<br />
zu ermitteln sind,<br />
die Grundsätze für die Integration<br />
der Sicherheit wie auch die Verpflich-<br />
der Erzeugnisse konzentrierte.<br />
Mit der gleichzeitigen Beratung als<br />
unmittelbaren Bestandteil der Überwachung<br />
der Hersteller zur Erfüllung ihrer<br />
Pflichten leistet die Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
einen sehr wichtigen Beitrag<br />
zur Vertrauensbildung und Existenzsicherung<br />
der Arbeitsmittel herstellenden<br />
Betriebe im Rahmen der<br />
wirtschaftlichen Konsolidierung des<br />
Landes.<br />
darstellen, konzentrierte sich die Unterweisung<br />
auf Form und Inhalt der<br />
Herstellerberatung (Verhütung mechanischer<br />
Gefahren, elektrischer Gefahren,<br />
Gefahren durch Lärm und ggf.<br />
durch Vernachlässigung ergonomischer<br />
Grundsätze bei der Maschinenkonstruktion)<br />
und auf die Überprüfung<br />
von Maschinen, die von den Herstellern<br />
in Verkehr gebracht werden, auf<br />
Einhaltung der<br />
Sicherheitsanforderungen, die mechanische<br />
sowie elektrische Gefahren<br />
abdecken, und<br />
Anforderungen an die Risikobeurteilung,<br />
Betriebsanleitung, Kennzeichnung<br />
und sonstigen Voraussetzungen<br />
für das Inverkehrbringen.<br />
tungen zur Kennzeichnung sowie zur<br />
Bereitstellung einer Betriebsanleitung<br />
für alle Maschinen gelten und<br />
größtmögliche Annäherung an die<br />
mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen<br />
gesetzten Ziele bei<br />
der Maschinenherstellung anzustreben<br />
ist, wenn diese Ziele aufgrund<br />
des Standes der Technik nicht erreicht<br />
werden können.
Das Thema: Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller 13<br />
Realisiert werden die grundlegenden<br />
Sicherheitsanforderungen, die Gefahren<br />
behandeln, indem der Konstrukteur<br />
alle notwendigen Schutzmaßnahmen<br />
durchführt. Einer der Grundsätze<br />
für die Integration der Sicherheit<br />
besteht darin, dass dabei eine bestimmte<br />
Methode angewendet wird. Diese<br />
Methode beinhaltet nachstehende<br />
Stufen und Reihenfolge:<br />
1. Beseitigen oder maximales Vermindern<br />
der Gefahren durch Maßnahmen<br />
zur eigensicheren Konstruktion<br />
(z. B. Anwendung der Mindestabstände<br />
zur Vermeidung des Quetschens<br />
von Körperteilen),<br />
2.Einsetzen trennender und/oder nicht<br />
trennender Schutzeinrichtungen<br />
(technische Schutzmaßnahmen) sowie<br />
ggf. Ausführen ergänzender<br />
Schutzmaßnahmen (z. B. Vorsehen<br />
von NOT-AUS-Einrichtungen) zur<br />
Verminderung von übrig gebliebenen<br />
Gefahren,<br />
3.Informieren und Warnen der Benutzerinnen<br />
und Benutzer in Bezug auf<br />
die noch vorhandenen Gefahren<br />
(Benutzerinformationen).<br />
Alle verbleibenden Risiken müssen bei<br />
einer sicheren Maschine vertretbar sein.<br />
Konkretisiert werden die grundlegenden<br />
Sicherheitsanforderungen des Anhangs<br />
I der EG-Maschinenrichtlinie mittels<br />
harmonisierter europäischer Normen.<br />
Die Nutzung der harmonisierten<br />
Normen ist für die Hersteller generell<br />
nicht obligatorisch, sondern freiwillig.<br />
Gültige harmonisierte Normen können<br />
jedoch die Konformitätsvermutung auslösen.<br />
Das heißt, dass bei Maschinen,<br />
deren Herstellung nach solchen Normen<br />
erfolgte, von der Einhaltung derjenigen<br />
grundlegenden Sicherheitsanforderungen<br />
ausgegangen wird, denen<br />
diese Normen entsprechen.<br />
Arbeitsaufgabe<br />
Mit Blick auf die 9. GSGV galt es im<br />
Rahmen der Sonderaktion, ca. 50 Kleinund<br />
Mittelbetriebe des Maschinenbaus<br />
auszuwählen und<br />
Stichproben-Kontrollen bei Maschinen,<br />
die von den Herstellern in den<br />
Verkehr gebracht werden, durchzuführen<br />
sowie<br />
die Maschinenhersteller in puncto<br />
Erfüllung ihrer einschlägigen Pflichten<br />
zu beraten.<br />
Die Stichproben-Kontrollen bei Maschinen<br />
waren durchzuführen hinsichtlich<br />
der Einhaltung<br />
der Sicherheitsanforderungen zu mechanischen<br />
wie auch elektrischen<br />
Gefahren und<br />
der Anforderungen an die Betriebsanleitung,<br />
der Anforderungen an die<br />
Kennzeichnung sowie der sonstigen<br />
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen.<br />
Besondere Berücksichtigung sollten im<br />
Zusammenhang mit den Kontrollen auf<br />
die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen<br />
jene Anforderungen finden,<br />
welche mechanische Gefahren behandeln.<br />
Der Grund dafür liegt im Unfallgeschehen.<br />
Die meisten der in Sachsen-Anhalt<br />
eingetretenen tödlichen Arbeitsunfälle,<br />
deren primäre Ursachen<br />
Konstruktions- oder Produktionsmängel<br />
an Maschinen gewesen sind, standen<br />
nämlich im Zusammenhang mit mechanischen<br />
Gefahren (Beispiel siehe<br />
Abb. 1.1 auf S. 8).<br />
Vorgehensweise<br />
Zu den sonstigen Voraussetzungen für<br />
das Inverkehrbringen von Maschinen<br />
gehört vor allem, dass der Hersteller<br />
technische Unterlagen erstellt hat, welche<br />
es ermöglichen, die Übereinstimmung<br />
der Maschine mit den grundlegenden<br />
Sicherheitsanforderungen zu<br />
beurteilen. Teile der technischen Unterlagen<br />
sind<br />
eine Liste der grundlegenden Anforderungen<br />
der EG-Maschinenrichtlinie,<br />
die bei der Konstruktion der<br />
Maschine Beachtung fanden, sowie<br />
eine Beschreibung der Lösungen,<br />
die zur Verhütung der von der Maschine<br />
ausgehenden Gefahren gewählt<br />
wurden.<br />
Ferner gehört zu den sonstigen Voraussetzungen<br />
für das Inverkehrbringen<br />
von Maschinen, dass der selbstständig<br />
funktionsfähigen Maschine eine<br />
schriftliche EG-Konformitätserklärung<br />
und der Teilmaschine eine schriftliche<br />
Herstellererklärung beigefügt ist.<br />
Zunächst wurden die Hersteller gebeten,<br />
der Gewerbeaufsicht pro ausgewählter<br />
Maschine die Dokumentation<br />
über die Gefahrenanalyse (Liste der<br />
beachteten Sicherheitsanforderungen,<br />
Beschreibung der Lösungen), ein Exemplar<br />
der Betriebsanleitung sowie ein<br />
Exemplar der EG-Konformitätserklärung/Herstellererklärung<br />
leihweise zu<br />
überlassen. Vor Aufnahme der Betriebsbesichtigungen<br />
erfolgte die Prüfung<br />
dieser Unterlagen. Im Verlauf der<br />
Betriebsbesichtigungen fanden dann<br />
weitere Prüfungen und umfangreiche<br />
Beratungsgespräche statt.<br />
Kontrolle und Beratung<br />
Ausgewählte technische Arbeitsmittel<br />
sind in der EG-Maschinenrichtlinie als<br />
Maschinen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial<br />
eingestuft. Weil lediglich bei<br />
drei derartigen Maschinen Stichproben-Kontrollen<br />
durchgeführt wurden<br />
und jeweils EG-Baumusterprüfungen<br />
durch zugelassene Stellen stattgefunden<br />
haben, enthält der vorliegende<br />
Bericht hierzu keine Darstellung.<br />
Unter Berücksichtigung der vorgenannten<br />
Einschränkung können der<br />
Tabelle 1.1 Informationen über die<br />
Anzahl der<br />
aufgesuchten Hersteller von Maschinen,<br />
Maschinen, bei denen Stichproben-<br />
Kontrollen durchgeführt wurden,<br />
festgestellten Abweichungen von den<br />
Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie<br />
und<br />
Revisionsschreiben oder analogen<br />
behördlichen Maßnahmen<br />
entnommen werden. Die Stichproben-<br />
Kontrollen wurden bei 69 Maschinen<br />
unterschiedlicher Arten, die sich im<br />
Wesentlichen in folgende Gruppen einordnen<br />
lassen, realisiert:
14 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Bau- und Baustoffmaschinen,<br />
kraftbetätigte Tore,<br />
Krane,<br />
land- und forstwirtschaftliche Maschinen,<br />
Nahrungsmittelmaschinen,<br />
Stetigförderer und<br />
Werkzeugmaschinen.<br />
Weiterführend soll vor allem über die<br />
Kontrolle und Beratung in Bezug auf<br />
Sicherheitsanforderungen berichtet<br />
werden. Deshalb stehen Fragen der<br />
Gefahrenanalyse, der vom Konstrukteur<br />
durchzuführenden Schutzmaßnahmen<br />
sowie der Herstellererklärung<br />
im Vordergrund der folgenden 3 Unterabschnitte.<br />
Zur Gefahrenanalyse<br />
Die Ergebnisse der Stichproben-Kontrollen<br />
bei den Maschinen hinsichtlich<br />
der Gefahrenanalyse sind in der Tabelle<br />
1.2 zusammengefasst. Geprüft wurde<br />
die Einhaltung der Anforderung zur<br />
Vornahme einer Gefahrenanalyse. Geprüft<br />
wurde aber auch die Einhaltung<br />
von Anforderungen an die Dokumentation<br />
über die Gefahrenanalyse.<br />
Zu 31 Maschinen konnten die Hersteller<br />
keine Dokumentation über die Gefahrenanalyse<br />
vorlegen. Bei weiteren<br />
9% der 69 kontrollierten Maschinen<br />
waren die Dokumentationen über die<br />
Gefahrenanalyse offensichtlich unvollständig.<br />
Diese Dokumentationen berücksichtigten<br />
ausschließlich spezielle<br />
Gefahren, z. B. bei fahrbaren Maschinen<br />
lediglich die Gefahren aufgrund<br />
ihrer Beweglichkeit.<br />
Während der Betriebsbesichtigungen<br />
stellte sich heraus, dass man 25 Maschinen<br />
tatsächlich keiner Gefahrenanalyse<br />
unterzogen hatte. Es bestätigte<br />
sich, dass bei den vorgenannten 9%<br />
der kontrollierten Maschinen die Gefahrenanalysen<br />
ausschließlich zur Ermittlung<br />
spezieller Gefahren vorgenommen<br />
wurden. Die Hersteller von 6 Maschinen,<br />
die über keine einschlägige Dokumentation<br />
verfügten, konnten glaubhaft<br />
darlegen, dass sie die Gefahrenanalysen<br />
zumindest “gedanklich”<br />
Tabelle 1.1 Behördliche Überwachung im Jahr <strong>2001</strong> zur Einhaltung der 9. GSGV bei Herstellern<br />
von Maschinen<br />
Aufgesuchte Hersteller von Maschinen<br />
Anzahl<br />
42<br />
Maschinen, bei denen Stichproben-Kontrollen durchgeführt wurden<br />
Festgestellte Abweichungen von den Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie in puncto<br />
69<br />
Gefahrenanalyse 31<br />
Schutzmaßnahmen 44<br />
Kennzeichnung 4<br />
EG-Konformitätserklärung und Herstellererklärung 35<br />
Revisionsschreiben oder analoge behördliche Maßnahmen 34<br />
Tabelle 1.2 Ergebnisse der Stichproben-Kontrollen bei den 69 Maschinen hinsichtlich der Gefahrenanalyse<br />
Dokumentation<br />
über die Gefahrenanalyse<br />
Anzahl der<br />
Maschinen<br />
nicht vorhanden 31 (45%)<br />
berücksichtigt allgemeine und<br />
ggf. spezielle Gefahren 32 (46%)<br />
berücksichtigte ausschließlich<br />
spezielle Gefahren 6 (9%)<br />
durchgeführt haben. Von der Anforderung,<br />
eine vollständige Gefahrenanalyse<br />
vorzunehmen, ist also bei 31 Maschinen<br />
abgewichen worden (siehe<br />
Tabelle 1.1).<br />
Jeder zuzuordnende Hersteller wurde<br />
auf die Notwendigkeit wie auch seine<br />
Pflicht aufmerksam gemacht, eine vollständige<br />
Gefahrenanalyse durchzuführen<br />
und die Maschine dann unter Berücksichtigung<br />
dieser Analyse zu konstruieren<br />
und zu produzieren. Darüber<br />
hinaus hat die Gewerbeaufsicht allen<br />
aufgesuchten Herstellern, verbunden<br />
mit einschlägigen Erläuterungen, empfohlen,<br />
die Gefahrenanalyse (Identifizierung<br />
der Gefährdungen) als Teil der<br />
Risikobeurteilung (siehe Abb. 1.4), wie<br />
sie in der harmonisierten Norm DIN EN<br />
1050 behandelt ist, vorzunehmen. Die<br />
Durchführung einer vollständigen<br />
Gefahrenanalyse ist notwendig, um<br />
sämtliche zutreffende Sicherheitsanforderungen<br />
ermitteln zu können. Wenn<br />
die Gefahrenanalyse nicht oder nicht<br />
vollständig vorgenommen wird, nimmt<br />
die Möglichkeit stark zu, dass bei der<br />
Gefahrenanalyse<br />
Anzahl der<br />
Maschinen<br />
nicht vorgenommen 25 (36%)<br />
zur Ermittlung allgemeiner und ggf.<br />
spezieller Gefahren vorgenommen 38 (55%)<br />
ausschließlich zur Ermittlung<br />
spezieller Gefahren vorgenommen 6 (9%)<br />
Abb. 1.4 Iterativer Prozess zum Erreichen<br />
der Sicherheit (nach DIN EN 1050:<br />
1997-01. Sicherheit von Maschinen;<br />
Leitsätze zur Risikobeurteilung.<br />
Berlin: Beuth Verlag)<br />
Konstruktion der Maschine Anforderungen<br />
unberücksichtigt bleiben und deshalb<br />
keine sichere Maschine entsteht.
Das Thema: Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller 15<br />
Zu Schutzmaßnahmen<br />
Aufteilen lassen sich die im Verlauf der<br />
Prüfungen von technischen Unterlagen<br />
wie auch der Maschinen festgestellten<br />
44 Abweichungen von den<br />
grundlegenden Sicherheitsanforderungen,<br />
deren Einhaltung Schutzmaßnahmen<br />
erfordern (siehe Tabelle 1.1),<br />
in<br />
10 nicht erfüllte Anforderungen an<br />
Einsatz, Auswahl sowie Gestaltung<br />
von Schutzeinrichtungen und<br />
34 mangelhafte Betriebsanleitungen.<br />
Die 10 Abweichungen von den Anforderungen<br />
an Einsatz, Auswahl sowie Gestaltung<br />
von Schutzeinrichtungen wurden<br />
bei insgesamt 9 Maschinen erkannt.<br />
Stets handelte es sich um nicht eingehaltene<br />
Anforderungen zu solchen Gefahren,<br />
die sich an Maschinen bewegende<br />
Teile verursachen (Beispiel siehe<br />
Abb. 1.5). Gemäß der EG-Maschinenrichtlinie<br />
müssen bewegliche Teile der<br />
Maschine so konstruiert und produziert<br />
sein, dass Gefahren vermieden werden<br />
oder, falls weiterhin Gefahren bestehen,<br />
mit Schutzeinrichtungen in der<br />
Weise versehen sein, dass jedes Risiko<br />
durch Erreichen der Gefahrstelle, das<br />
zu Unfällen führen kann, ausgeschlossen<br />
wird. Die betreffenden Hersteller<br />
wurden aufgefordert, diese grundlegende<br />
Anforderung und die Anforderungen<br />
der EG-Maschinenrichtlinie an die Auswahl<br />
von Schutzeinrichtungen gegen<br />
Gefahren durch bewegliche Teile und<br />
an die Schutzeinrichtungen selbst strikt<br />
einzuhalten. Außerdem wurde im LAS<br />
eine Informationsbroschüre zum Thema<br />
“Maschinensicherheit: Vermeiden<br />
mechanischer Gefährdungen mittels<br />
Konstruktion” zusammengestellt. Sie ist<br />
besonders für Konstrukteure, welche in<br />
Klein- oder Mittelbetrieben des Maschinenbaus<br />
tätig sind, als Orientierungshilfe<br />
vorgesehen. Das zugehörige Inhaltsverzeichnis<br />
zeigt die Abb. 1.6.<br />
Viele der 34 beanstandeten Betriebsanleitungen<br />
wiesen mehrere Sicherheitsmängel<br />
auf. Oft fehlten die notwendigen<br />
Daten über den von der Maschine<br />
erzeugten Lärm und/oder<br />
Angaben über verbotene Anwendungen<br />
der Maschine.<br />
Aufgabe der Betriebsanleitung ist es,<br />
Benutzerin und Benutzer über die bestimmungsgemäße<br />
Verwendung der<br />
Maschine in Kenntnis zu setzen und auf<br />
verbotene Anwendungen der Maschine<br />
hinzuweisen, die erfahrungsgemäß<br />
vorkommen können.<br />
Abb. 1.5 Konstruktionsmangel an einer Landmaschine: Feststehende trennende Schutzeinrichtung<br />
(Antriebswelle) kann auch ohne Werkzeug geöffnet werden.<br />
Aufgabe der Betriebsanleitung ist es<br />
weiterhin, Benutzerin und Benutzer<br />
über die nach Ausführung sowohl der<br />
Maßnahmen zur eigensicheren Konstruktion<br />
als auch der anderen Schutzmaßnahmen<br />
noch vorhandener Gefahren<br />
und den Umgang damit zu informieren.<br />
Beispielsweise kann aus den Angaben<br />
zum Lärm der Maschine die Lärmbelastung<br />
an den Arbeitsplätzen in den<br />
lauten Arbeitsbereichen abgeschätzt<br />
werden. Denn für die hohen Lärmbelastungen<br />
in den Lärmbereichen der<br />
Betriebe sind vorwiegend Maschinen<br />
verantwortlich. Technische und organisatorische<br />
Maßnahmen zur Lärmminderung<br />
sind so gezielt einsetzbar.<br />
Dadurch erreicht man einen effektiven<br />
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten.<br />
Fehler in der Darbietung einer Maschine<br />
und somit auch Fehler bei der<br />
Instruktion des Benutzers im Rahmen<br />
der Betriebsanleitung können die gleichen<br />
produkthaftungsrechtlichen Konsequenzen<br />
wie z. B. Produktionsfehler<br />
haben. Darauf wurden alle Hersteller<br />
von Maschinen mit mangelhaften<br />
Betriebsanleitungen nachdrücklich hingewiesen.<br />
Information zum Arbeitsschutz und zur technischen Sicherheit<br />
Maschinensicherheit<br />
Vermeiden mechanischer Gefährdungen<br />
mittels Konstruktion<br />
Inhalt<br />
Vorbemerkung<br />
1 Grundlagen der Konstruktion sicherheitsgerechter<br />
Maschinen im Überblick<br />
2 Mechanische Gefährdungen<br />
3 Ausgewählte Sicherheitsanforderungen sowie Schutzmaßnahmen<br />
in Übereinstimmung mit harmonisierten<br />
europäischen Normen zu mechanischen Gefährdungen<br />
3.1 Eigensichere Konstruktion<br />
3.2 Technische Schutzmaßnahmen<br />
3.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen<br />
4. Hinweis auf harmonisierte europäische Normen<br />
Anlage 1 Grundlegende Sicherheitsanforderungen aus dem<br />
Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie (Richtlinie<br />
98/37/EG) zu mechanischen Gefährdungen<br />
Anlage 2 Ausführungsformen von Schutzeinrichtungen<br />
Abb. 1.6 Inhaltsverzeichnis der vom LAS<br />
herausgegebenen Broschüre
16 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Zur Herstellererklärung<br />
Die 35 festgestellten Abweichungen<br />
von den Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie<br />
in puncto EG-Konformitätserklärung<br />
und Herstellererklärung<br />
(siehe Tabelle 1.1) setzen sich aus<br />
32 mangelhaften und 3 nicht existierenden<br />
Erklärungen zusammen. Herstellererklärungen<br />
wurden auch deshalb<br />
gelegentlich beanstandet, weil das<br />
aufzunehmende Inbetriebnahmeverbot<br />
für die Teilmaschinen nicht anforderungsgerecht<br />
ausgeführt war.<br />
Beratung der Hersteller bzw. Inverkehrbringer von Geräten und Schutzsystemen zur<br />
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen sowie von Druckgeräten im Sinne der<br />
Druckgeräterichtlinie<br />
Aktuelle Verpflichtungen durch<br />
europäische Regelungen<br />
Auch die grundlegenden sicherheitstechnischen<br />
Mindestanforderungen an<br />
Geräte und Schutzsysteme, die zur<br />
Verwendung in explosionsfähiger Atmosphäre<br />
bestimmt sind, wurden europäisch<br />
harmonisiert. Grundlage für<br />
das Inverkehrbringen ist die Richtlinie<br />
94/9/EG aus dem Jahre 1994, die 1996<br />
durch die 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz<br />
(11. GSGV – Explosionsschutzverordnung)<br />
in deutsches<br />
Recht umgesetzt wurde. Da auch bisher<br />
in Deutschland bereits hohe Anforderungen<br />
an die Beschaffenheit derartiger<br />
Geräte und Einrichtungen gestellt<br />
wurden und bei hohem Gefahrenpotenzial<br />
in Bereichen der Zone 0, 1, 10<br />
seit Jahrzehnten im Wesentlichen nur<br />
von Prüfstellen bauartzugelassene bzw.<br />
baumustergeprüfte Geräte und Schutzsysteme<br />
zum Einsatz kommen durften,<br />
resultieren weder aus den in der Richtlinie<br />
formulierten technischen Anforderungen<br />
noch aus den vorgeschriebenen<br />
Prüfverfahren für die Produkte und<br />
deren Herstellung grundsätzlich neue<br />
Aufgaben. Dennoch gibt es zahlreiche<br />
Neuerungen, auf die sich Hersteller<br />
und Inverkehrbringer dieser Produkte<br />
einzustellen haben. Seitens des EU-<br />
Parlaments und Rates wurde allerdings<br />
auch eine lange Übergangszeit eingeräumt,<br />
die erst am 30. Juni 2003 endet.<br />
Teilmaschinen sind Maschinen, deren<br />
Einbau in andere Maschinen beabsichtigt<br />
ist und die nicht selbstständig funktionsfähig<br />
sind (u. a. Verbrennungsmotoren).<br />
Da der Hersteller einer Teilmaschine<br />
nicht alle erforderlichen<br />
Schutzmaßnahmen unmittelbar durchführen<br />
kann, hat er in seine Erklärung<br />
ein Inbetriebnahmeverbot zu integrieren.<br />
Es soll mitgeteilt werden, dass die<br />
Inbetriebnahme der Teilmaschine erst<br />
Ähnlich verhält es sich mit den Anforderungen<br />
an Druckbehälter, druckbeaufschlagte<br />
Rohrleitungen sowie industrielle<br />
Anlagen zur Dampf- und Heißwassererzeugung.<br />
An die Stelle der<br />
bisher geltenden Beschaffenheitsanforderungen,<br />
die für diese überwachungsbedürftigen<br />
Anlagen gemeinsam<br />
mit den entsprechenden Betriebsvorschriften<br />
in der Druckbehälterverordnung<br />
bzw. Dampfkesselverordnung<br />
geregelt sind, treten – ausnahmslos<br />
anzuwenden ab 30. Mai 2002 – die<br />
Anforderungen der EG-Druckgeräterichtlinie<br />
(RL 97/23/EG), die allerdings<br />
erst nach diesem Termin als 14. Verordnung<br />
zum Gerätesicherheitsgesetz<br />
nachträglich in nationales Recht (im<br />
Zusammenhang mit der künftigen Betriebssicherheitsverordnung)<br />
umgesetzt<br />
wird.<br />
Sowohl bei Geräten und Schutzsystemen<br />
im Sinne der 11. GSGV als auch bei<br />
Druckgeräten (Druckbehältern, Dampferzeugern<br />
usw.) mit besonders hohem<br />
Gefahrenpotenzial bzw. hohen und sehr<br />
hohen Anforderungen an die Sicherheit<br />
unterliegt der Inverkehrbringer der Pflicht<br />
zur Einbeziehung einer unabhängigen<br />
Prüfstelle (einer gem. der entsprechenden<br />
EG-Richtlinie benannten Stelle), beginnend<br />
von Baumusterprüfungen bis<br />
hin zur Prüfung der Produkte bzw. der<br />
Zertifizierung entsprechender Qualitäts-<br />
dann erfolgen darf, wenn die komplettierte<br />
Maschine als sicher angesehen<br />
wird. Den Herstellern von Teilmaschinen<br />
wurde empfohlen, für das Inbetriebnahmeverbot<br />
stets folgenden Wortlaut<br />
zu verwenden: “Die Inbetriebnahme ist<br />
solange untersagt, bis festgestellt wurde,<br />
dass die Maschine, in die diese<br />
Maschine eingebaut werden soll, den<br />
Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie<br />
entspricht.”<br />
sicherungssysteme. Die von der für den<br />
Vollzug des GSG zuständigen Behörde<br />
auszuübende Marktaufsicht wird sich bei<br />
diesen Produkten im Wesentlichen darauf<br />
beschränken können zu prüfen, dass<br />
das Produkt entsprechend eines der in<br />
der Richtlinie vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahrens<br />
in Verkehr<br />
gebracht wurde, ggf. eine Baumusterprüfbescheinigung<br />
vorliegt und die<br />
benannte Stelle entsprechend der europäisch<br />
harmonisierten Regelungen in<br />
die Prüfung des Entwurfs- und Herstellungsprozesses<br />
einbezogen wurde.<br />
Für Produkte nach 11. und 14. GSGV,<br />
die in Eigenverantwortung des Herstellers<br />
bzw. Importeurs ohne Beteiligung<br />
einer benannten Stelle in Verkehr gebracht<br />
werden können, sind die nach § 5<br />
GSG vorgeschriebenen Stichproben<br />
auch im Hinblick auf die Erfüllung technischer<br />
Mindestanforderungen zu prüfen.<br />
Im Rahmen der Sonderaktion verfolgte<br />
die Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalts<br />
– insbesondere in Anbetracht der noch<br />
nicht abgelaufenen Übergangsfristen<br />
– zunächst lediglich das Ziel festzustellen,<br />
inwieweit sich Hersteller von<br />
Geräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen und Druckgeräten<br />
bereits auf die neuen Vorschriften<br />
eingestellt haben, um im Bedarfsfalle<br />
beratend tätig zu werden.
Das Thema: Gewerbeaufsicht kontrolliert Maschinen sowie Geräte und berät deren Hersteller 17<br />
Beratung der Hersteller von<br />
Geräten zum Einsatz in<br />
explosionsfähiger Atmosphäre<br />
Die Anzahl der Hersteller herkömmlicher<br />
“Ex-Geräte” ist in Sachsen-Anhalt<br />
im Vergleich zu Herstellern, deren Produkte<br />
der 9. GSGV unterliegen, gering.<br />
Da die EU-Richtlinie – und damit die 11.<br />
GSGV – im Gegensatz zu den bisherigen<br />
gesetzlichen Regelungen die “Ex”-<br />
Kennzeichnung nicht nur für elektrische<br />
Geräte für den Einsatz in Zone 0, 1 oder<br />
10 vorschreibt, sondern zukünftig alle<br />
elektrischen und nichtelektrischen Geräte<br />
mit potenzieller Zündquelle, die in<br />
den Zonen 0, 1, 2, 20, 21 oder 22 eingesetzt<br />
werden sollen, dieser Richtlinie<br />
unterliegen, als “Ex-Geräte” in Verkehr<br />
zu bringen sind und auch an der Kennzeichnung<br />
“CE” und “Ex” sowie Angabe<br />
der Gruppe und Kategorie als solche<br />
zu erkennen sein müssen (siehe Abb.<br />
1.7) – ist davon auszugehen, dass es<br />
noch einige Hersteller gibt, deren Produkte<br />
auch unter Beachtung der 11.<br />
GSGV in Verkehr zu bringen sind, die<br />
dies aber bisher noch nicht erkannt<br />
haben. Hier wird die Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
– neben anderen Institutionen<br />
– noch bis zum Ende der Übergangszeit<br />
(30. Juni 2003), aber auch darüber<br />
hinaus beratend tätig sein müssen.<br />
Die Aktion zeigte, dass bei Herstellern,<br />
die schon seit langem regelmäßig elektrische<br />
Ex-Geräte mit hohen Anforderungen<br />
an die Sicherheit in Verkehr<br />
bringen, die Umstellung relativ reibungslos<br />
stattfindet. Der Übergangszeitraum<br />
ist so bemessen, dass nur<br />
wenige bestehende Baumusterprüfbescheinigungen<br />
(Grundlage: § 8 Verordnung<br />
über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten<br />
Räumen [ElexV]-<br />
Fassung vor Dezember 1996) in EG-<br />
Abb. 1.7 Typenschild einer in Sachsen-Anhalt<br />
hergestellten richtlinienkonformen<br />
Ex-Leuchte<br />
Baumusterprüfbescheinigungen gewandelt<br />
werden müssen, sondern im<br />
Zuge der Innovation von Produkten<br />
seit Bekanntmachung der EG-Richtlinie<br />
für Neuentwicklungen bereits EG-<br />
Baumusterprüfbescheinigungen in Auftrag<br />
gegeben und die übrigen Forderungen<br />
der EG-Richtlinie schrittweise<br />
umgesetzt wurden.<br />
Hersteller, die seltener mit Aufträgen<br />
konfrontiert sind, welche Forderungen<br />
nach Ex-Tauglichkeit ihrer Produkte (z.<br />
B. Elektromotoren) beinhalten, warten<br />
zunächst ab, ob ein Inverkehrbringen<br />
noch nach bestehenden Baumusterbescheinigungen<br />
gemäß ElexV erfolgen<br />
kann und werden sich erst bei<br />
Bedarf mit der neuen Rechtslage näher<br />
befassen.<br />
Beratung von<br />
Druckgeräteherstellern<br />
Die Probleme beim Übergang von der<br />
Erfüllung der bisher bereits ebenfalls<br />
auf hohem sicherheitstechnischem Niveau<br />
stehenden nationalen Bestimmungen<br />
zur Beschaffenheit von Druckbehältern,<br />
Rohrleitungsanlagen, Dampfund<br />
Heißwassererzeugern (gesetzliche<br />
T yp des Druckgerätes<br />
- Behälter<br />
- Dampfkessel<br />
- Rohrleitung<br />
Fluidgruppe und<br />
-zustand<br />
- Gruppe 1, Gas/Flüssigkeit<br />
- Gruppe 2, Gas/Flüssigkeit<br />
Konformitätsbewertungsdiagramm<br />
Kategorie<br />
I, II, III, IV<br />
Module für das<br />
Konformitätsbewertungsverfahren<br />
Grundlagen: Druckbehälterverordnung,<br />
Dampfkesselverordnung) zur Umsetzung<br />
der europäisch harmonisierten<br />
Anforderungen an Druckgeräte sind<br />
für die in Sachsen-Anhalt angesiedelten<br />
Hersteller weniger technischer, sondern<br />
mehr organisatorischer und formaler<br />
Natur. Dies beginnt mit einer<br />
völlig neuen Einstufung, auf deren<br />
Grundlage differenzierte sicherheitstechnische<br />
Anforderungen sowie Verfahren<br />
des Nachweises der Erfüllung<br />
dieser Anforderungen (Konformitätsbewertungsverfahren)<br />
abzuleiten sind<br />
(Abb. 1.8). Die bisherigen vier Gruppen<br />
nach Dampfkesselverordnung sowie<br />
die sieben Druckbehältergruppen<br />
(klassifiziert nach zweiparametrischer<br />
Abhängigkeit – Druck, Temperatur)<br />
werden ersetzt durch eine Neueinstufung<br />
aller Druckgeräte in vier Kategorien<br />
(dreiparametrische Abhängigkeit –<br />
Druck, Temperatur, Stoffeigenschaften).<br />
Der Hersteller hat – entsprechend der<br />
Kategorie des Druckgerätes – Wahlmöglichkeiten<br />
bei den Entwurfs-, Bauund<br />
Abnahmeprüfungen in Verbindung<br />
mit Verfahren der Qualitätssicherung.<br />
An Stelle des amtlich anerkannten Sach-<br />
Druck und Volumen<br />
Druck-Inhalts-Produkt<br />
Abb. 1.8 Klassifizierung von Druckgeräten, Ableitung von Modulen für das Konformitätsbewertungsverfahren
18 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
verständigen ist – je nach Kategorie und<br />
Modul – eine benannte Stelle einzubeziehen.<br />
Auf bisher nach Dampfkesselverordnung<br />
(DampfkV) oder Druckbehälterverordnung<br />
(DruckbehV) erteilte<br />
Zulassungen (z. B. Bauartzulassungen,<br />
Verfahrensprüfungen für Schweißverfahren<br />
usw.) kann zukünftig nicht<br />
mehr zurückgegriffen werden.<br />
Eine besondere Problematik im Bereich<br />
der Druckgeräte besteht darin,<br />
dass bisher Beschaffenheits- und<br />
Betriebsvorschriften in einheitlichen<br />
Vorschriften national geregelt waren.<br />
Nach Trennung in europäisch harmonisierte<br />
Beschaffenheitsanforderungen<br />
und national unterschiedlich geregelte<br />
Betriebsvorschriften (z. B. Zyklus wiederkehrender<br />
Prüfungen) muss der<br />
Hersteller sich auch hier von Gewohntem<br />
trennen.<br />
Formale Probleme bereitet auch die<br />
Unterscheidung zwischen nach Druckgeräterichtlinie<br />
(DGRL) in Verkehr zu<br />
bringenden einzelnen Druckgeräten<br />
Die im Jahre <strong>2001</strong> von der Gewerbeaufsicht<br />
bei im Land Sachsen-Anhalt<br />
ansässigen Herstellern von Maschinen,<br />
in einigen Fällen auch von drucktechnischen<br />
Ausrüstungen und solchen zum<br />
Explosionsschutz, durchgeführte Kontrolle<br />
kann als beachtlicher Erfolg zur<br />
Gewährleistung sowohl sicherer technischer<br />
Arbeitsmittel als auch formeller<br />
Erfordernisse von reglementierten<br />
Dokumentationen, die Voraussetzung<br />
beim Inverkehrbringen von derartigen<br />
Erzeugnissen auf dem europäischen<br />
Binnenmarkt sind, gewertet werden.<br />
Insbesondere für die kleineren Unternehmen<br />
war der Beratungsbedarf<br />
durch die Kontrollgruppen der Gewerbeaufsicht<br />
eminent. Die wesentlichen<br />
Defizite lagen weniger in Mängeln der<br />
sicherheitsgerechten Gestaltung und<br />
Produktion als vielmehr bei unzuläng-<br />
und Baugruppen, die vom Hersteller<br />
als zusammenhängende funktionelle<br />
Einheiten, bestehend aus mehreren<br />
Druckgeräten, in Verkehr gebracht<br />
werden.<br />
Die Beratungen bei Druckgeräteherstellern<br />
machten deutlich, dass diese<br />
allgemein über die neuen Vorschriften<br />
informiert waren und über Konzepte<br />
zur Umsetzung der DGRL verfügten.<br />
Es war auch abzusehen, dass in der<br />
Regel die Institution (in Sachsen-Anhalt<br />
der TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt),<br />
welcher der nach bisherigem<br />
Recht prüfende amtlich anerkannte<br />
Sachverständige angehört, zunächst<br />
auch als benannte Stelle im Sinne der<br />
DGRL herangezogen wird. Abzusehen<br />
war, dass neben der Überwindung<br />
einzelner Detailprobleme – insbesondere<br />
der Zusammenführung von<br />
Baugruppen, deren Bestandteile altem<br />
bzw. neuem Recht unterliegen – es<br />
teilweise zu Verzögerungen bei der<br />
Realisierung und Zertifizierung der<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
lichen bzw. fehlenden Gefahrenanalysen<br />
und Betriebsanleitungen sowie<br />
in der Erstellung und Dokumentation<br />
notwendiger technischer Unterlagen.<br />
Auch der Nachweis der Konformität<br />
von Maschinen mit den Schutzzielen<br />
und -anforderungen der europäischen<br />
Richtlinien und Normen wies häufig<br />
Unzulänglichkeiten auf.<br />
Die Unternehmen wurden über ihre<br />
Pflichten unterrichtet und durch Revisionsschreiben<br />
zur Mängelbehebung<br />
innerhalb einer bestimmten Frist veranlasst.<br />
Nachkontrollen waren somit<br />
häufig erforderlich.<br />
Auf Grund der besonderen Bedeutung<br />
für die Sicherheit von Maschinen und<br />
die Existenzsicherung der Unternehmen<br />
wird diese Aktion auch im Jahr<br />
2002 fortgesetzt. Dann wird im Land<br />
Qualitätssicherungssysteme geben<br />
wird.<br />
Als hemmend für den Prozess der fristgemäßen<br />
Durchsetzung der europäisch<br />
harmonisierten Vorschriften im<br />
Druckbehälter- und Dampfkesselbereich<br />
erweist sich neben der Tatsache,<br />
dass die nationale Umsetzung der<br />
DGRL nicht rechtzeitig erfolgte, vor allem,<br />
dass mit der DampfkV und DruckbehV<br />
die bisherigen Betriebsvorschriften<br />
weiter gelten, die nicht den Bedingungen,<br />
die sich aus der DGRL ergeben,<br />
entsprechen. Die Hersteller verzeichnen<br />
aus diesem Grund auf dem<br />
Inlandmarkt gewissermaßen bis zum<br />
letzten Tag die Nachfrage nach Druckgeräten<br />
entsprechend der noch geltenden<br />
nationalen Vorschriften. Bei einem<br />
Hersteller führte das beispielsweise<br />
dazu, dass er bis Mai 2002 dasselbe<br />
Druckgerät für den Inlandsbedarf entsprechend<br />
DruckbehV und für den Export<br />
entsprechend DGRL in Verkehr<br />
bringt.<br />
Sachsen-Anhalt von der staatlichen<br />
Gewerbeaufsicht ein Großteil der Hersteller<br />
von Maschinen und darüber hinaus<br />
auch der Hersteller von<br />
elektrischen Betriebsmitteln (1. GSGV),<br />
wie Leuchten, Schaltschränke, E-<br />
Motore,<br />
Aufzugsanlagen (12. GSGV),<br />
In-vitro-Diagnostika (2. MPG-Änderungsgesetz),<br />
wie Produkte zur medizinischen<br />
Untersuchung an Proben<br />
von Menschen, einschließlich<br />
Blut- und Gewebeproben<br />
hinsichtlich ihrer Erzeugnisse in Bezug<br />
auf die Erfüllung europäisch harmonisierter<br />
grundlegender Sicherheitsanforderungen<br />
sowie formaler Anforderungen<br />
an das Inverkehrbringen kontrolliert<br />
sein.
Zur Situation im Arbeitsschutz 19<br />
Zur Situation<br />
im Arbeitsschutz<br />
– Anforderungen, Ergebnisse, Tendenzen –<br />
Dr.-Ing. Jost Melchior, LAS
20 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Arbeitsschutz in Sachsen-Anhalt<br />
Dr.-Ing. Jost Melchior, LAS<br />
Neue Strategieansätze für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Deutschland<br />
Das Jahr <strong>2001</strong> war geprägt durch eine<br />
sehr grundsätzlich geführte Diskussion<br />
über eine neue strategische Ausrichtung<br />
von Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
in Deutschland.<br />
In einer von den Ländern der EU beschlossenen<br />
sozialpolitischen Agenda<br />
wird das Ziel verfolgt, die EU bis zum<br />
Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten<br />
und dynamischsten wissensbasierten<br />
Wirtschaftsraum der Welt zu machen.<br />
Es soll dauerhaft das Wirtschaftswachstum<br />
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen<br />
und größerem sozialen<br />
Zusammenhalt erreicht werden.<br />
In Deutschland, wie auch den anderen<br />
Ländern der EU, vollzieht sich durch<br />
die Globalisierung der Märkte und den<br />
Übergang zur Informationsgesellschaft<br />
ein grundlegender Strukturwandel in<br />
Wirtschaft und Gesellschaft.<br />
Durch das damit verbundene hohe<br />
Innovationstempo sehen sich Unternehmen<br />
und Beschäftigte höherem Anpassungsdruck<br />
und immer kürzeren<br />
Anpassungszeiten ausgesetzt.<br />
Gesundheit bei der Arbeit<br />
Die 78. Arbeits- und Sozialministerkonferenz<br />
hat im Oktober <strong>2001</strong> einstimmig<br />
ein Handlungskonzept “Gesundheit<br />
bei der Arbeit – Notwendigkeiten,<br />
Ziele, Strategien” zur Neuorientierung<br />
des Arbeitsschutzes in Deutschland beschlossen.<br />
Damit wird eine umfassende Analyse<br />
der Entwicklungstrends für die Zukunft<br />
der Arbeit,<br />
der heutigen Situation des Arbeitsschutzes<br />
in Deutschland,<br />
der Ziele einer zukünftigen Politik zur<br />
Gewährleistung von Sicherheit und<br />
Gesundheit bei der Arbeit sowie<br />
• der zukünftigen Strategien und Kriterien<br />
für Sicherheit und Gesundheit bei<br />
der Arbeit in Unternehmen und für die<br />
staatlichen Arbeitsschutzbehörden<br />
vorgenommen sowie<br />
ein Handlungsauftrag für die staatlichen<br />
Arbeitsschutzbehörden formuliert.<br />
Tradierte, an Großbetrieben und einer<br />
“reinen” Industriegesellschaft orientierte<br />
Strukturen und Strategien, die das<br />
klassische Verständnis von Arbeitsschutz<br />
geprägt haben, werden einer<br />
sich gravierend verändernden Arbeitswelt<br />
immer weniger gerecht.<br />
Beschäftigte sind immer häufiger schädigenden<br />
psychomentalen und psychosozialen<br />
Belastungen ausgesetzt, die<br />
vorwiegend aus Arbeitsorganisation<br />
und Arbeitsinhalten resultieren. Zunehmende<br />
Arbeitsverdichtung, überlange<br />
Arbeitszeiten, hohe Verantwortung,<br />
Fehlbelastungen an der Schnittstelle<br />
Mensch-Technik und für die Sicherheit<br />
am Arbeitsplatz hochrelevante Anforderungen<br />
an Wahrnehmung, Informationsverarbeitung<br />
und Zuverlässigkeit<br />
sowie neuartige Konflikte am Arbeitsplatz<br />
führen zu “neuen” Belastungsfaktoren<br />
und zu Mehrfachbelastungen, oft<br />
auch in Kombination mit “klassischen”<br />
Belastungsformen.<br />
Die Folgen für die Sozialsysteme und für<br />
die Leistungsfähigkeit der Betriebe sind<br />
gravierend. Eine Studie des Bundesverbandes<br />
der Betriebskrankenkassen<br />
zu den Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen<br />
2.1) weist aus, dass jährlich in<br />
Deutschland für die Folgen körperlicher<br />
Arbeitsbelastungen Folgekosten von 28<br />
Mrd. Euro und für psychische Belastungen<br />
von 24 Mrd. Euro anfallen. Dabei<br />
wurden sowohl die direkten Kosten – für<br />
Krankheitsbehandlungen – als auch die<br />
indirekten Kosten – durch Produktivitätsverlust<br />
– berücksichtigt. Durch gezielte<br />
Präventionsmaßnahmen ist ein erheblicher<br />
Anteil dieser Kosten vermeidbar.<br />
Diesen Problemen kann mit traditionellen<br />
Instrumenten des Arbeitsschutzes<br />
allein nicht begegnet werden, auch wenn<br />
die klassischen Belastungsfaktoren und<br />
Arbeitsschutzprobleme fortbestehen.<br />
Zur Schließung der vorhandenen Wissens-<br />
und Methodenlücken hinsichtlich<br />
neuer Belastungen im Arbeitsleben besteht<br />
ein erheblicher Bedarf an arbeitsmedizinisch,<br />
arbeitspsychologisch und<br />
arbeitssoziologisch ausgerichteten Forschungsprogrammen.<br />
Ziel einer neuen Arbeitsschutzpolitik<br />
muss nicht nur sein, Arbeitgeber und<br />
Beschäftigte dabei zu unterstützen, gesundheitliche<br />
Belastungen im Arbeitsprozess<br />
zu erkennen, zu vermeiden<br />
bzw. zu verringern; sie muss auch die<br />
gesundheitsförderlichen Potenziale der<br />
Erwerbsarbeit zur Wirkung bringen.<br />
Alle arbeitsbedingten – körperlichen,<br />
psychischen und sozialen – Belastungen<br />
müssen in eine gesamtheitliche<br />
Arbeitsgestaltung einbezogen werden.<br />
Arbeitsschutz muss sehr viel mehr den<br />
gesamten Menschen im Umfeld von<br />
Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen<br />
und sozialen Beziehungen<br />
berücksichtigen. Dabei muss mit<br />
geeigneten Konzepten und Methoden<br />
endlich auch konsequent auf die kleinen<br />
und mittleren Unternehmen eingegangen<br />
werden, in der die überwiegende<br />
Zahl der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter beschäftigt ist.<br />
2.1) Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen in Deutschland<br />
1998, BKK Bundesverband
Zur Situation im Arbeitsschutz 21<br />
Der wachsenden Bedeutung psychischer<br />
Belastungsformen in der modernen<br />
Arbeitswelt müssen sich alle Handelnden<br />
im Arbeitsschutz stellen. Im<br />
Rahmen der Initiative für eine “Neue<br />
Qualität der Arbeit” hat das BMA eine<br />
Schwerpunktaktion “Psychische Fehlbelastungen<br />
und Stress” gestartet.<br />
Dabei werden den verschiedenen Akteuren<br />
jeweils eigenständige Aufgaben<br />
zugewiesen, die sich zu einem Maßnahmebündel<br />
ergänzen.<br />
Danach liegt beim Bund die aufwändige<br />
Entwicklung, Bewertung und Bereitstellung<br />
benötigter Methoden/Instrumente/Verfahren<br />
zum Erfassen psychischer<br />
Belastungen und Beanspruchungen<br />
sowie zu deren Bewältigung.<br />
Für die Länder ist eine Arbeitsgruppe<br />
des LASI im Auftrag der 77. ASMK tätig,<br />
um Handlungsgrundlagen und Handlungsfelder<br />
der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltungen<br />
auf dem Gebiet<br />
arbeitsbedingter psychischer Belastungen<br />
zu konzipieren.<br />
Handlungskonzept für die<br />
Gewerbeaufsicht<br />
Ergänzend dazu werden für die Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
des Landes<br />
Sachsen-Anhalt die folgenden Maßnahmen<br />
zur Unterstützung/Flankierung der<br />
geplanten Schwerpunktaktion vorgesehen:<br />
1.Obligatorische Fortbildung des<br />
Aufsichtspersonals der Gewerbeaufsicht<br />
zur Erfassung, Bekämpfung<br />
und Prävention psychischer<br />
Fehlbelastungen<br />
Handlungsauftrag an die Staatlichen Arbeitsschutzbehörden<br />
Die Weiterentwicklung moderner Arbeitsschutzstrategien zur<br />
Verbesserung der Gesundheit bei der Arbeit muss sich dabei<br />
bevorzugt auf folgende Handlungsfelder konzentrieren:<br />
ein stärkeres Zusammenwirken zwischen Arbeitsschutz, Verbraucherschutz,<br />
Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik sowie<br />
Wirtschaftsförderung,<br />
eine Verbreiterung der Wissensbasis bei Unternehmern, Beschäftigten<br />
und Dienstleistern durch zielgruppenspezifische<br />
Psychische Fehlbelastungen und Stress<br />
Mit dieser Maßnahme wird eine Überwindung<br />
der z. Z. vergleichsweise einseitigen<br />
Technikorientierung der Aufsicht<br />
durch die Fixierung eines zusätzlichen<br />
Schwerpunktes der Überwachungstätigkeit<br />
und der Beratung angestrebt<br />
– bei gleichzeitiger qualifikatorischer<br />
Ertüchtigung des Aufsichtspersonals<br />
zur Wahrnehmung dieser<br />
neuen Aufgabe.<br />
2.Herausbildung spezieller Fachkompetenz<br />
zur Erfassung, Bekämpfung<br />
und Prävention psychischer<br />
Fehlbelastungen bei ausgewählten<br />
Personen der Verwaltung<br />
Diesem Ziel soll die Erweiterung der<br />
Aufgabenstellung des Arbeitskreises<br />
“Ergonomie” um dieses Thema, die<br />
Stärkung des Arbeitskreises durch Berufung<br />
geeigneter weiterer Personen<br />
und die externe Fortbildung dieser Personen<br />
zur Wahrnehmung der Spezialaufgabe,<br />
dienen.<br />
3.Erarbeitung von Informationsmaterialien<br />
zur Erfassung, Bekämpfung<br />
und Prävention psychischer<br />
Fehlbelastungen für die Öffentlichkeit<br />
Die zu erarbeitenden Informationsmaterialien<br />
sollen eine breite Öffentlichkeit,<br />
insbesondere jedoch Arbeitgeber<br />
und Beschäftigte, für das Anliegen<br />
sensibilisieren und in allgemeinverständlicher,<br />
fassbarer Form darstellen,<br />
wie Fehlbelastungen erkannt und<br />
durch Änderungen der Verhältnisse<br />
und des Verhaltens beseitigt oder vermieden<br />
werden können.<br />
und handlungsrelevante Beratung und Qualifizierung sowie<br />
eine Modernisierung der Ausbildung im gesundheitlichen<br />
Arbeitnehmerschutz,<br />
die Verbesserung des betrieblichen Managements im Arbeitsund<br />
Gesundheitsschutz durch Förderung von Leitbildern für<br />
“Gesunde Organisationen”, die Berücksichtigung neuer<br />
Belastungsformen sowie die Entwicklung kleinbetriebstauglicher<br />
Handlungshilfen (z. B. Branchenlösungen).<br />
4.Information der Arbeitgeber über<br />
nutzbare professionelle Dienstleistungsangebote<br />
zur Analyse und<br />
Gestaltung der Arbeit und ihrer<br />
Bedingungen unter dem Aspekt der<br />
Optimierung psychischer Belastungen<br />
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen<br />
verfügen regelhaft nicht<br />
über hinreichende interne Kompetenzen<br />
für eine den Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
der Beschäftigten<br />
sichernde Arbeitsorganisation und Betriebsgestaltung.<br />
Sie sollen mit Informationen<br />
auf Dienstleistungsanbieter/<br />
-angebote hingewiesen werden, die<br />
sie unter dem Aspekt des verfolgten<br />
Anliegens in Anspruch nehmen können.<br />
5.Untersuchungen und/oder Beratungen<br />
zu ausgewählten Problemfällen<br />
der Erfassung, Bekämpfung<br />
oder Prävention psychischer Fehlbelastungen<br />
auf der Grundlage<br />
zentral entwickelter und empfohlenerMethoden/Instrumente/Verfahren<br />
Die Maßnahme geht davon aus, dass<br />
Methoden/Instrumente/Verfahren in<br />
absehbarer Zeit als Beitrag des Bundes<br />
zentral entwickelt und zur Verfügung<br />
gestellt werden. Sie können und<br />
sollen dann von der Gewerbeaufsicht<br />
bei bedeutsamen Einzel- oder Spezialfällen<br />
im Land für Untersuchungen und/<br />
oder Beratungen genutzt werden, die<br />
die Indikation, den Abbau oder die Verhütung<br />
psychischer Fehlbelastungen<br />
zum Ziel haben.
22 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Besondere Probleme der Sicherheit und<br />
des Gesundheitsschutzes von Beschäftigten,<br />
die mit den herkömmlichen Betriebsrevisionen<br />
nicht hinreichend erkannt<br />
oder verändert werden können,<br />
werden im Rahmen der Programmarbeit<br />
der Arbeitsschutzverwaltung in landesweiten<br />
Sonderaktionen oder regionalen<br />
Schwerpunktkontrollen vertieft<br />
bearbeitet. Deren Ergebnisse werden<br />
im Einzelnen in den verschiedenen Kapiteln<br />
dieses <strong>Jahresbericht</strong>es dargestellt.<br />
Wichtigstes Instrument zur Überwachung<br />
und Beratung bezüglich der Einhaltung<br />
der Arbeitsschutzbestimmungen<br />
ist für die Gewerbeaufsicht nach<br />
wie vor die Durchführung von Revisionen<br />
in den Betrieben. Eine Übersicht<br />
der Ergebnisse im Jahr <strong>2001</strong> zeigt Abb.<br />
2.1 für die wichtigsten Branchen.<br />
Im letzten Jahr wurden von den Gewerbeaufsichtsbeamtinnen<br />
und Gewerbeaufsichtsbeamten<br />
17.906 Betriebe –<br />
im Rahmen von Nachkontrollen auch<br />
mehrmals – aufgesucht. Dabei wurden<br />
22.805 Revisionen in den Betrieben<br />
und 12.237 Dienstgeschäfte außerhalb<br />
von Betrieben vorgenommen. Durchschnittlich<br />
bei 28,2% der Kontrollen<br />
wurden Verstöße gegen Vorschriften<br />
im Arbeitsschutz registriert. Branchen<br />
mit überdurchschnittlich hohen Mängelquoten<br />
sind das Gaststätten- und<br />
Beherbergungsgewerbe, Schulen, Forschung<br />
und Entwicklung, die Leichtindustrie<br />
sowie die Holzverarbeitung.<br />
Die Überwachungsstrategie in Abhängigkeit<br />
von der Zahl der Betriebe in den<br />
einzelnen Branchen und Größenklassen<br />
sowie vom vorhandenen Gefährdungspotenzial<br />
bzw. den Rechtsverstößen<br />
wird jährlich in Form von Zielvereinbarungen<br />
zwischen dem LAS und<br />
den GAA festgelegt. Infolge zurückgehenden<br />
Personalbestandes in der<br />
Gewerbeaufsichtsverwaltung nimmt die<br />
Revisionsdichte in den letzten Jahren<br />
kontinuierlich ab.<br />
Schwerpunkte der Aufsicht und Beratung<br />
im Arbeitsschutz waren Baustellen<br />
sowie Betriebe der Branchen Metall<br />
und Elektro, Gesundheits- und Veteri-<br />
Beratung und Aufsicht im Arbeitsschutz<br />
närwesen, Handel, Land-, Forst- und<br />
Nahrungsgüterwirtschaft sowie Dienstleistung.<br />
Im Zentrum der Überwachungs- und<br />
Beratungstätigkeit der Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
steht die Funktion des<br />
innerbetrieblichen Arbeitsschutzsystems.<br />
Nach wie vor kann die Qualität<br />
der Gefährdungsbeurteilungen und die<br />
sachgerechte Berücksichtigung von<br />
Maßnahmen des Arbeitschutzes bei<br />
Führungsentscheidungen, insbeson-<br />
Branchen Branchen<br />
Kontrollen<br />
Rechtsvorschriften<br />
dere in kleineren und mittleren Unternehmen<br />
(KMU), nicht befriedigen (siehe<br />
auch den Beitrag S. 24). Weitgehend<br />
unberücksichtigt bleiben in den<br />
Gefährdungsbeurteilungen und bei den<br />
Maßnahmen des Arbeitschutzes in den<br />
Betrieben psychische und physische<br />
Fehlbelastungen. Das oben beschriebene<br />
Bündel von Maßnahmen zur Beeinflussung<br />
psychischer Fehlbelastungen<br />
ist darauf ausgerichtet, diese Defizite<br />
zu vermindern.<br />
Mängel Kontrollen mit Mängeln<br />
Abb. 2.1 Übersicht über gefundene Mängel nach den wichtigsten Branchen <strong>2001</strong><br />
Anteil der<br />
Kontrollen<br />
mit Mängeln<br />
Metall gesamt 16.872 7.511 27,8%<br />
4.695<br />
Bau gesamt 6.598 2.367 22,4%<br />
1.481<br />
Holz 1.531 988 34,9%<br />
535<br />
Land/ Forst gesamt 7.689 3.726 28,9%<br />
2.223<br />
Chemie gesamt 2.550 904 20,5%<br />
523<br />
Transport/ Lagerei 3.210 1.462 28,9%<br />
929<br />
Spezielle 2.460 693 19,4%<br />
Dienstleistungen 478<br />
Sonstige 4.257 1.711 25,4%<br />
Dienstleistungen 1.082<br />
Gesundheit/ 8.768 3.844 28,2%<br />
Veterinärwesen 2.471<br />
Handel 7.608 3.322 27,9%<br />
2.125<br />
Schulen/ Sport/ 2.053 1.753 42,4%<br />
Forschung/Entwicklung 870<br />
Verwaltungen 1.601 723 26,0%<br />
417<br />
Gaststätten/ 4.838 4.125 48,9%<br />
Beherbergungen 2.368<br />
Leichtindustrie 810 568 42,2%<br />
342<br />
Baustellen 19.742 9.236 30,9%<br />
6.093<br />
Straßenfahrzeuge 7.928 1.544 16,7%<br />
1.321<br />
0 2.000 4.000<br />
Anzahl<br />
6.000 8.000 10.000
Zur Situation im Arbeitsschutz 23<br />
angezeigte Arbeitsunfälle bei betrieblicher<br />
Tätigkeit<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
53.048<br />
46<br />
49.223<br />
Abb. 2.2 Entwicklung der Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt im Zeitraum 1996-<strong>2001</strong> (Datenbank der<br />
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die Zahlen für <strong>2001</strong> sind vorläufig<br />
[Stand 5. Juli 2002] bzw. lagen noch nicht vor)<br />
Daneben konzentriert sich die Überwachung<br />
vor allem auf die Gestaltung<br />
der Arbeitsstätten, die Einhaltung der<br />
Vorschriften beim Umgang mit Arbeitsmitteln<br />
sowie Gefahrstoffen. Obwohl<br />
sich die Situation in letzten Jahren kontinuierlich<br />
verbessert hat, ist in diesen<br />
Bereichen eine deutlich über dem<br />
Durchschnitt liegende Mängelquote<br />
festzustellen.<br />
Unfallgeschehen im Land<br />
Auch wenn die „weichen“ Belastungsfaktoren<br />
in der Arbeitswelt an Bedeutung<br />
gewinnen, muss der Vermeidung<br />
von Arbeitsunfällen weiter eine hohe<br />
Priorität eingeräumt werden.<br />
Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in<br />
den Betrieben des Landes, die ausschließlich<br />
im Zuständigkeitsbereich<br />
der Gewerbeaufsichtsverwaltung liegen,<br />
ist im letzten Jahr leicht – von 16<br />
auf 20 – angestiegen. Der Anteil der<br />
tödlichen Arbeitsunfälle auf Baustellen<br />
ist auf 25% gesunken. Mitte der 90er<br />
Jahre lag der Schwerpunkt noch mit<br />
2/3 der tödlichen Arbeitsunfälle auf Baustellen.<br />
Ursache dafür ist neben der<br />
verbesserten Unfallverhütung und Planung<br />
von Baumaßnahmen nach Inkraft-<br />
51.950<br />
45.922<br />
29 28 28<br />
treten der Baustellenverordnung das<br />
verringerte Bauvolumen, insbesondere<br />
im Hochbau. Besorgniserregend ist der<br />
steigende Anteil tödlicher Arbeitsunfälle<br />
in der Landwirtschaft und beim innerbetrieblichen<br />
Transport.<br />
Für die meldepflichtigen Arbeitsunfälle<br />
liegen ausgewertete Unfalldaten bis<br />
zum Jahr 2000 vor. Die Zahl meldepflichtiger<br />
Arbeitsunfälle in Sachsen-<br />
Unfälle gesamt<br />
7.000<br />
6.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
41.985<br />
1996 1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong><br />
23<br />
24<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
tödliche Arbeitsunfälle bei betrieblicher<br />
Tätigkeit<br />
Unfälle gesamt<br />
Anhalt sank von 1999 auf 2000 von<br />
45.922 auf 41.985 (Abb. 2.2). Auch hier<br />
ist der Rückgang vorwiegend auf die<br />
Verminderung von Arbeitsunfällen im<br />
Bauwesen zurückzuführen. Der Anteil<br />
der Bauunfälle am Unfallgeschehen ist<br />
von 35% Mitte der 90er Jahre auf 22,6%<br />
im Jahr 2000 gesunken. Branchen mit<br />
einer besonders hohen Unfallquote<br />
sind – noch vor der Bauwirtschaft – die<br />
Land- und Forstwirtschaft, die Holzverarbeitung<br />
und die Transport- und Lagerwirtschaft.<br />
Problematisch ist die Altersstruktur der<br />
von einem Arbeitsunfall betroffenen<br />
Personen (Abb. 2.3). Auffällig ist der<br />
hohe Anteil verletzter Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer der Altersgruppe<br />
zwischen 18 und 24 Jahren.<br />
Sie zeigt, dass sich die Anstrengungen<br />
der Betriebe besonders auf diese<br />
Personengruppe konzentrieren müssen.<br />
Das betrifft sowohl eine verbesserte<br />
Unterweisung bei der Übertragung<br />
von Tätigkeiten als auch die Einflussnahme<br />
auf das Risikoverhalten dieser<br />
Beschäftigtengruppe.<br />
Daneben zeigt sich, dass insbesondere<br />
die Altersgruppe älterer Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer (über 55 Jahre)<br />
einer besonderen Aufmerksamkeit<br />
bedarf. Das zeigt sich auch bei der Auswertung<br />
der tödlichen Arbeitsunfälle.<br />
Unfälle je 1.000 Beschäftigte<br />
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64<br />
Alter<br />
Abb. 2.3 Altersstruktur der von einem Arbeitsunfall betroffenen Personen in Sachsen-Anhalt 2000<br />
(Quellen: Statistisches Landesamt LSA, HVBG)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Unfälle je 1.000 Beschäftigte
24 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Gefährdungsbeurteilung –<br />
Kernstück betrieblichen Arbeitsschutzes oder Papierkrieg?<br />
Der 60-jährige Fahrer eines Gabelstaplers<br />
transportierte in Gitterboxpaletten<br />
gelagerte Kartoffeln aus einem Freibereich<br />
in einen Hallenkomplex mit<br />
Kartoffelsortier- und Abpackanlage.<br />
Seine Fahrt wurde unterbrochen, als<br />
das Fahrzeug im Eingangsbereich der<br />
Halle eine auf dem Fahrweg befindliche<br />
Hilfskraft erfasste und überfuhr.<br />
Die Frau verstarb an den Folgen des<br />
Unfalles.<br />
Erstes Resümee von Verantwortlichen<br />
und externen Arbeitssicherheitsberatern<br />
des Unternehmens:<br />
“Der muss doch geschlafen haben!”,<br />
“Musste die dort rumstehen?”, “Wie<br />
soll man so was verhindern!”...<br />
Auf unsere Frage nach der Gefährdungsbeurteilung<br />
für innerbetriebliche<br />
Transport-, Umschlag- und Lagervorgänge<br />
sowie die im Ergebnis fixierten<br />
Maßnahmen im Sinne von §§ 5 und 6<br />
Arbeitsschutzgesetz legte man ein<br />
Formblatt der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft<br />
Berlin zur Tätigkeitsbeurteilung<br />
“Bedienen von Fahrzeugen<br />
und Landmaschinen” vor, in<br />
welchem durch Ankreuzen zum Beispiel<br />
eine Gefährdung beim Auf- und<br />
Absteigen durch Abrutschen/Fehltreten<br />
festgestellt und folgerichtig deshalb<br />
die vorgegebene Maßnahme:<br />
“Nicht auf- oder abspringen, Aufstiege<br />
trittsicher halten” angekreuzt wurde<br />
usw.<br />
Die Rekonstruktion des Unfallgeschehens<br />
durch das GAA Dessau ergab:<br />
Es lagen keine sicherheitstechnischen<br />
Mängel am Fahrzeug vor.<br />
Die später Verunfallte hatte unmittelbar<br />
vor Eintritt des Unfalles einen<br />
Aufenthaltsraum verlassen, dessen<br />
Tür hinter einem Pfeiler, von der<br />
Dipl. agr.-Ing. Leonore Brachmann, GAA Dessau<br />
Gefährdung nicht ernst genommen<br />
Halleneinfahrt nicht sichtbar, im Eingangsbereich<br />
der Halle lag, um den<br />
gemeinsamen Weg für den Geh- und<br />
Fahrverkehr in Richtung ihres Arbeitsplatzes<br />
zu queren.<br />
Mit dem Rücken zur Halleneinfahrt<br />
war es ihr auf Grund der Maschinengeräusche<br />
aus dem Halleninneren<br />
kaum möglich, den leise laufenden<br />
Gabelstapler akustisch wahrzunehmen.<br />
Auch ein optischer Warnhinweis<br />
durch die Scheinwerfer des<br />
Staplers erreichte sie nicht, da diese<br />
keinen bemerkbaren Lichtkegel verursachten.<br />
Der Fahrer des Gabelstaplers kam<br />
aus dem Außenbereich, wo unsere<br />
Messung eine durchschnittliche Beleuchtungsstärke<br />
von etwa 19.400<br />
lux ergab. Er durchfuhr die Halleneinfahrt<br />
bei 5.000 lux und gelangte<br />
auf den mit 164 lux ausgeleuchteten<br />
Fahrweg der Halle.<br />
Das heißt, allein in den acht Sekunden<br />
Fahrzeit vom Halleneingang bis<br />
zur Unfallstelle mussten sich seine<br />
Augen auf extrem differierende Lichtverhältnisse<br />
einstellen. Nur auf diesem<br />
kurzen Stück war ein Beleuchtungsstärkeunterschied<br />
von 31 : 1<br />
auszugleichen – bereits bei einem<br />
Verhältnis von mehr als 5 : 1 ist die<br />
Dunkeladaption des menschlichen<br />
Auges, insbesondere bei älteren Menschen,<br />
stark eingeschränkt.<br />
Weiterhin ergaben die Untersuchungen,<br />
dass auf Grund der bestehenden<br />
Lichtverhältnisse etwa 1,50 m<br />
vor der Halleneinfahrt die Frontscheibe<br />
des Staplers vor dem dunkleren<br />
Hallenhintergrund wie ein Spiegel<br />
wirkte, der Fahrer also das hinter<br />
ihm liegende Hofgelände und sich<br />
selbst deutlicher sah als das Halleninnere.<br />
Negativ auf die Gesamtsituation wirkte<br />
sich außerdem aus, dass die Hubarme<br />
des Staplers einen toten Winkel<br />
bildeten.<br />
Der Fahrer konnte die auf seinem Fahrweg<br />
befindliche Frau nicht sehen, sie<br />
ihn nur bei außerordentlich erhöhter<br />
Aufmerksamkeit wahrnehmen!<br />
Die Kolleginnen der Verunfallten und<br />
der Fahrer des Gabelstaplers bestätigten<br />
aus ihrer Erfahrung diese Feststellungen.<br />
Es muss also davon ausgegangen werden,<br />
dass eine sorgfältige und verantwortungsbewusste<br />
Wahrnehmung<br />
vorhandener Gefahrensituationen zu<br />
Maßnahmen hätte führen müssen,<br />
welche ohne großen materiellen und<br />
organisatorischen Aufwand den Unfall<br />
hätten verhindern können.<br />
Im Einvernehmen zwischen Verantwortlichen<br />
und Sicherheitsfachkraft begnügte<br />
man sich im Unternehmen aber<br />
damit, dem Gesetz ohne jeglichen betrieblichen<br />
Bezug mit dem Ankreuzen<br />
von Formblättern zu entsprechen.<br />
Da Transport, Umschlag und Lagerung<br />
nicht Bestandteil der berufsgenossenschaftlichen<br />
Vorlage sind,<br />
hielt man es auch nicht für erforderlich,<br />
über die mit der gemeinsamen Nutzung<br />
des Weges für den Geh- und<br />
Fahrverkehr verbundenen Gefahren<br />
nachzudenken...
Zur Situation im Arbeitsschutz 25<br />
Eben diese Situation stellte sich bei<br />
fast allen anderen Arbeitsunfällen mit<br />
tödlichem Ausgang dar – auch solchen,<br />
die in den vergangenen Jahren<br />
auf Grund gleich gearteter Ursachen in<br />
ihrem Verlauf immer wiederkehrten.<br />
Ähnliches zeichnete sich gleichermaßen<br />
im Ergebnis von Schwerpunktkontrollen<br />
der Gewerbeaufsichtsämter,<br />
insbesondere einer des GAA Dessau<br />
zur Umsetzung der §§ 5 und 6 des<br />
Arbeitsschutzgesetzes in Betrieben der<br />
Baubranche, der Landwirtschaft und<br />
des Ernährungsgewerbes mit zehn bis<br />
19 Beschäftigten ab.<br />
Dagegen entsprach in der Mehrzahl<br />
der in diesem Rahmen revidierten Betriebe<br />
der Baubranche die Qualität der<br />
Gefährdungsbeurteilungen in weiten<br />
Bereichen den Anforderungen.<br />
Zwar musste bemängelt werden, dass<br />
43% der Dokumente keine speziellen<br />
Regelungen für den Baustellenbereich<br />
aufwiesen und die Realisierung von<br />
Arbeitsschutzmaßnahmen nicht immer<br />
an Termine gebunden war, grundsätzlich<br />
konnten wir jedoch einschätzen,<br />
dass unsere Aktivitäten aus den Sonderaktionen<br />
“Sicherheit am Bau” der<br />
vergangenen Jahre Früchte trugen.<br />
Vor allem in den aufgesuchten Betrieben<br />
der Landwirtschaft und des Ernährungsgewerbes<br />
musste aber Handlungsbedarf<br />
erkannt werden.<br />
Nur 38% von ihnen hatten sich der<br />
Thematik gestellt und konnten eine<br />
Gefährdungsbeurteilung vorlegen –<br />
immer basierend auf Formblättern, selten<br />
die hierin vorgesehenen Möglichkeiten<br />
zur betrieblichen Umsetzung<br />
nutzend.<br />
Es war erkennbar, dass bis auf sehr<br />
wenige Ausnahmen im Regelfall tatsächlich<br />
nur eine außerordentlich allgemein<br />
gehaltene Beurteilung von Gefährdungen<br />
vorlag.<br />
Die Notwendigkeit, konkrete Maßnahmen<br />
zur sichereren Gestaltung betrieblicher<br />
Vorgänge einzuleiten, wurde<br />
selbst bei wenig komplizierten Problemstellungen<br />
negiert:<br />
Qualität der Gefährdungsbeurteilung<br />
In einem Formblatt war angekreuzt:<br />
Sicherheitsschuhe tragen.<br />
Nicht erkennbar war, welcher Art diese<br />
sein sollen.<br />
Unsere Besichtigung der Produktionsstätten<br />
zeigte, dass keiner der<br />
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
Sicherheitsschuhe trug. In einem<br />
Bereich, in dem Sicherheitsschuhe<br />
der Klasse S 2 zu empfehlen<br />
wären, wurde ein Arbeitnehmer mit<br />
Turnschuhen angetroffen.<br />
Auf Anfrage erfuhren wir, dass das<br />
Unternehmen jedem Arbeitnehmer<br />
jährlich Geldmittel zum Erwerb persönlicher<br />
Schutzausrüstungen zur<br />
Verfügung stellt.<br />
Es war nicht festgelegt, welche Erwerbungen<br />
erforderlich sind. Es wurde<br />
keinerlei Kontrolle ausgeübt – weder<br />
über die Verwendung der Gelder<br />
noch über die Nutzung der Schutzausrüstung.<br />
Für das Bedienen von Landmaschinen<br />
war angekreuzt: Gehörschutz.<br />
Die Überprüfung vorhandener Technik<br />
zeigte, dass im Unternehmen nur<br />
moderne Fahrzeuge mit Fahrerkabinen<br />
zum Einsatz kommen, wodurch<br />
sich ein Tragen von Gehörschutz<br />
für den Fahrer erübrigt.<br />
Die Frage nach dem “Warum” der<br />
Forderung hatte ein Schulterzucken<br />
zur Folge. Der befragte Bediener<br />
sagte aus, dass er keinen Gehörschutz<br />
braucht und auch nicht zur<br />
Verfügung gestellt bekam.<br />
Nachfragen ergaben aber, dass bei<br />
bestimmten, regelmäßig durchzuführenden<br />
Arbeiten im Umfeld der Maschine<br />
durchaus sowohl Gehörschutz<br />
als auch eine Staubschutzmaske<br />
zu empfehlen wären.<br />
Per Kreuz waren wiederkehrende<br />
Prüfungen an technischen Anlagen<br />
vorgesehen.<br />
Eine Aufstellung der prüfpflichtigen<br />
Anlagen lag in den meisten Fällen<br />
nicht vor.<br />
Im Rahmen der Betriebsbesichtigungen<br />
stellten wir dann fest, dass<br />
zum Beispiel eine Krananlage seit<br />
1989 und die elektrischen Anlagen /<br />
Betriebsmittel ebenfalls seit 12 Jahren<br />
nicht revidiert worden waren.<br />
Notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen<br />
zum Schutz der Beschäftigten<br />
bei Tätigkeiten, die regelmäßig<br />
schwere und tödliche Unfälle hervorriefen,<br />
waren kaum eingeleitet worden.<br />
Beispielhaft und mit besonderem<br />
Nachdruck sei hier der Umgang<br />
mit Großballen in der Landwirtschaft<br />
zu nennen.<br />
Völlig unberücksichtigt blieben in der<br />
Regel der Einsatz von Saisonarbeitskräften,<br />
Praktikantinnen und Praktikanten<br />
des Arbeitsamtes und der<br />
Einsatz anderer Betriebsfremder.<br />
Wir mussten weiterhin bemängeln, dass<br />
– neben den bereits genannten Problemen<br />
– Verantwortlichkeiten nicht fixiert,<br />
Termine für die Durchführung von Maßnahmen<br />
nicht benannt und Überprüfungen<br />
zur Umsetzung von Festlegungen<br />
nicht vorgesehen waren sowie dass<br />
Verantwortungsträger und Beschäftigte<br />
trotz nachgewiesener Unterweisung<br />
Aussagen der Gefährdungsbeurteilung<br />
offensichtlich nicht kannten.<br />
(Beharrlichkeit in der Befragung zeigte<br />
zwar zum Teil praktisches Arbeitsschutzwissen<br />
auf, man konnte sich aber<br />
nicht des Eindruckes erwehren, dass<br />
dieses aus einer lange vergangenen<br />
Zeit stammte.)<br />
Als Mangel wurde auch erkannt, dass<br />
die Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung<br />
sich im Regelfall lediglich<br />
auf das Deckblatt, das heißt die Listung<br />
der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
des Betriebes ausgeübten Tätigkeiten<br />
und ihre Einordnung in Gefahrengruppen<br />
beschränkte – Grundlage<br />
für die Feststellung der Einsatzzeiten<br />
der Sicherheitsfachkräfte.<br />
Unsere Mängelfeststellungen führten zu<br />
Diskussionen, welche zeigten, dass an<br />
der Erarbeitung der Unterlagen betriebliche<br />
Verantwortungsträger kaum beteiligt<br />
waren.
26 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Die Einbeziehung von Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmern zog man in<br />
keinem Fall in Erwägung.<br />
Die Frage an einen externen Verfasser<br />
nach dem durchschnittlich benötigten<br />
Zeitaufwand für die Erstellung der<br />
Gefährdungsbeurteilung für einen<br />
Landwirtschaftsbetrieb der in der<br />
Schwerpunktaktion zu betrachtenden<br />
Größenklasse wurde mit 15 bis 20 Minuten<br />
angegeben.<br />
Damit stellten sich die unmittelbaren<br />
Ursachen für die unbefriedigende Situation<br />
dar.<br />
Unsere Argumente für eine qualitätsgerechte<br />
Gefährdungsbeurteilung rie-<br />
Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung<br />
und die Vielfalt sich in diesem<br />
Prozess stetig ändernder Einflussfaktoren<br />
auf die Arbeitsumwelt bedingte<br />
aber eine flexibel anwendbare<br />
Arbeitsschutzgesetzgebung, welche<br />
ein hohes Maß an Eigeninitiative von<br />
den Unternehmen abfordert.<br />
Kernstück der Wahrnehmung betrieblicher<br />
Eigenverantwortung muss unter<br />
diesen Bedingungen eine gewissenhafte<br />
und kompetente Beurteilung der<br />
mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen<br />
und die Einleitung konkreter<br />
Arbeitsschutzmaßnahmen sein.<br />
Verschiedene sehr große Unternehmen<br />
zum Beispiel des Ernährungsgewerbes<br />
erkannten dies schon vor<br />
Jahren.<br />
Hier wird Arbeitsschutz als wirtschaftlicher<br />
Faktor anerkannt und die Gefährdungsbeurteilung<br />
als zentrales Objekt<br />
betrieblicher Prävention betrachtet.<br />
fen grundsätzlich Abwehrhaltungen<br />
hervor: Man müsse produzieren und<br />
habe keine Zeit, noch mehr Papierkrieg<br />
zu führen. Die wirtschaftliche Situation<br />
sei schwierig und die Technik<br />
so modern, dass weitere Arbeitsschutzmaßnahmen<br />
ja eigentlich nicht nötig<br />
wären...<br />
Die Entwicklung des Arbeitsunfallgeschehens<br />
widerlegt diese Rechtfertigungen:<br />
In Sachsen-Anhalt verunfallten<br />
im Jahr <strong>2001</strong> sechs Arbeitnehmer<br />
bei Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft<br />
tödlich.<br />
Die Unfallbilanz ist im Verhältnis zu den<br />
Beschäftigtenzahlen nicht wirklich positiv<br />
zu bewerten. Die Unfallursachen<br />
Positive Ausstrahlung von guten Beispielen<br />
liegen schwerpunktmäßig schon lange<br />
nicht mehr im technischen Bereich.<br />
Viele Unternehmer gehen heute noch<br />
immer davon aus, dass sie ihren Pflichten<br />
im Bereich des Arbeitsschutzes<br />
ausreichend entsprechen, wenn sie den<br />
Vorgaben von Verordnungen und technischen<br />
Regeln Folge leisten: “Nur<br />
wenn da steht, dass ich an der Kreuzung<br />
bei Rot halten muss, bleibe ich<br />
auch stehen.”<br />
Verwaltungs-, ordnungs- oder gar strafrechtlichen<br />
Maßnahmen wegen nicht<br />
ausreichender Organisation des betrieblichen<br />
Arbeitsschutzes wird mit Unverständnis<br />
begegnet.<br />
Im Ergebnis einer von den Unternehmensführungen<br />
geförderten Zusammenarbeit<br />
zwischen Verantwortlichen<br />
und Beschäftigten entstanden im Rahmen<br />
des betrieblichen Arbeitsschutzmanagementsystems<br />
Dokumente, die<br />
in komprimierter Form Maßnahmen des<br />
Arbeitsschutzes bei Durchführung bestimmter<br />
Arbeitsvorgänge wiedergeben<br />
(Abb 2.4 und 2.5). Abb. 2.4 Beispielhafter durch einen Betrieb erstellter innerbetrieblicher Hinweis auf Gefahren – 1
Zur Situation im Arbeitsschutz 27<br />
Abb. 2.5 Beispielhafter durch einen Betrieb erstellter innerbetrieblicher Hinweis auf Gefahren – 2<br />
In keinem Fall entstand übrigens viel<br />
Papier!<br />
Die Anzahl der Arbeitsunfälle sank aber<br />
in jedem Fall spürbar: Eines der Unternehmen<br />
arbeitet seit über vier Jahren<br />
unfallfrei – das heißt, kein Beschäftigter<br />
musste auf Grund eines Arbeitsunfalles<br />
die nächste Schicht versäumen.<br />
Der Krankenstand liegt unter 2%.<br />
Sicherlich besitzen insbesondere Kleinbetriebe<br />
nicht das Know-how der überregional<br />
agierenden Großen. Jährliche<br />
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte<br />
von lediglich zehn bis 15 Stunden und<br />
nicht ausreichend geschulte Verantwortungsträger<br />
zeigen, dass den Problemen<br />
des Arbeitsschutzes nicht ausreichend<br />
Aufmerksamkeit gewidmet wird.<br />
Sicherlich wäre es auch unrealistisch,<br />
würde man bei kleinen Firmen ein gleiches<br />
Engagement erwarten, wie es die<br />
Großen der Branche zeigen.<br />
Wirtschaftliche Zwänge, welche die Leistungsanforderungen<br />
an Verantwortliche<br />
und Beschäftigte zu Ungunsten des<br />
Arbeitsschutzes beeinflussen, und die<br />
technische Modernisierung führen aber<br />
häufig zu einer nicht gerechtfertigten<br />
Bagatellisierung des Arbeitsschutzes,<br />
fehlende Fachkenntnisse zu einer Überforderung.<br />
Eine gezielte Einflussnahme der Arbeitsschutzbehörden<br />
ist also dringend<br />
geboten!
28 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Im Jahr <strong>2001</strong> führten die GAA ihre Kontrolltätigkeit<br />
bei Herstellern, Händlern<br />
und Betreibern von Medizinprodukten<br />
weiter. Bei 9% aller Kontrollen nach dem<br />
Medizinproduktegesetz (MPG) wurde<br />
festgestellt, dass gegen Vorschriften<br />
dieses Gesetzes verstoßen wurde. Die<br />
nicht ausreichende Beachtung der<br />
Medizinprodukte-Betreiberverordnung<br />
(MPBetreibV) gab sogar in 33,6% der<br />
kontrollierten Gesundheitseinrichtungen<br />
Anlass zur Beanstandung. Abb. 2.6<br />
zeigt die Art der vorgefundenen Mängel.<br />
Messtechnische<br />
Kontrollen<br />
5%<br />
Einweisung<br />
6%<br />
Medizinproduktebuch<br />
9%<br />
Reinigung,<br />
Desinfektion,<br />
Sterilisation<br />
4%<br />
Sicherheitstechnische<br />
Kontrollen<br />
19%<br />
Andere<br />
8%<br />
Bestandsverzeichnis<br />
49%<br />
Abb. 2.6 Mängelverteilung bei Kontrollen der<br />
Medizinprodukte-Betreiberverordnung<br />
Darüber hinaus widmete die Gewerbeaufsicht<br />
Sachsen-Anhalts ihre Aufmerksamkeit<br />
dem speziellen Thema Betten:<br />
Krankenhaus-Betten, Krankenhaus-<br />
Kinderbetten und Pflegebetten.<br />
Tödliche Vorkommnisse mit<br />
Betten<br />
Krankenhaus-Kinderbetten<br />
Im Januar <strong>2001</strong> hat sich in Eberswalde<br />
(Brandenburg) ein tödlicher Unfall eines<br />
Kleinkindes in einem Krankenhaus-<br />
Kinderbett ereignet. Ein eineinhalb Jahre<br />
altes Kind war offenbar beim Versuch,<br />
aus seinem Bettchen zu klettern, mit<br />
den Füßen voran durch die Gitterstäbe<br />
geschlüpft und dann mit dem Kopf<br />
steckengeblieben. Dabei strangulierte<br />
es sich wahrscheinlich selbst.<br />
Medizinproduktesicherheit<br />
Dipl.-Phys. Otfried Zerfass, LAS Dessau<br />
In diesem Zusammenhang gab es auch<br />
in Sachsen-Anhalt Besorgnisse und<br />
daraus folgende Anfragen von Kinderärzten<br />
und der Krankenhausgesellschaft<br />
Sachsen-Anhalt e. V. an das<br />
LAS. Die eingeleitete Recherche ergab,<br />
dass überhaupt keine gültige<br />
Norm, sondern nur ein Norm-Entwurf<br />
für Krankenhaus-Kinderbetten existierte.<br />
Der Entwurf der DIN 32623 “Krankenhaus-Kinderbetten<br />
aus Metallen<br />
und Kunststoffen” vom Januar 2000<br />
wies zudem bedenkliche Unterschiede<br />
zu den für den Wohnbereich geltenden<br />
Normen – hauptsächlich bei den<br />
zulässigen Gitterabständen – auf. Das<br />
LAS bat den zuständigen Normenausschuss<br />
des DIN um Auskunft. Im Juli<br />
<strong>2001</strong> legte der Normenausschuss einen<br />
geänderten Entwurf vor, der die<br />
entsprechenden Forderungen berücksichtigt<br />
und der als endgültige Norm<br />
erscheinen soll.<br />
Krankenhaus- und Pflegebetten<br />
für Erwachsene<br />
Von 1998 bis Ende März <strong>2001</strong> ereigneten<br />
sich in Deutschland 14 Brände mit<br />
Todesfolge im Zusammenhang mit<br />
elektrisch verstellbaren Krankenhausund<br />
Pflegebetten und 26 Einklemmungen<br />
bzw. Strangulationen. Pflegebetten<br />
werden sowohl in Pflegeheimen<br />
als auch im Wohnbereich eingesetzt.<br />
Zunächst wurden die Antriebsmotore<br />
als Brandursache vermutet. Im Jahr<br />
<strong>2001</strong> ermittelte das Bundeskriminalamt<br />
als Hauptursache der Brände die<br />
mangelhafte Qualität der Netzzuleitungen<br />
vieler im Verkehr befindlicher<br />
elektrisch betriebener Pflegebetten.<br />
Weitere konstruktive Mängel waren<br />
vielfach nicht ausreichende Zugentlastung<br />
bzw. nicht ausreichender<br />
Knickschutz an der Netzanschlussleitung,<br />
unsichere Verlegung der Netzanschlussleitung<br />
und anderer elektrischer<br />
Verbindungsleitungen und fehlender<br />
oder nicht ausreichender Feuch-<br />
tigkeitsschutz. Eine weitere Ursache<br />
von Unfällen waren die nicht normgerechten<br />
Maße der Seitengitter, wodurch<br />
Patienten eingeklemmt werden<br />
können.<br />
Die zwei in Sachsen-Anhalt ansässigen<br />
Hersteller von Pflegebetten wurden aufgefordert,<br />
gegenüber dem zuständigen<br />
GAA zu belegen, dass die von ihnen in<br />
Verkehr gebrachten Kranken- und<br />
Pflegebetten die gesetzlichen Anforderungen<br />
erfüllen. Soweit erforderlich wurden<br />
notwendige Nachrüstungen bzw.<br />
Änderungen vorgenommen.<br />
Im Mai <strong>2001</strong> wurden die Betreiber, Kammern,<br />
Verbände, Innungen und Krankenkassen<br />
über die notwendigen Maßnahmen<br />
bei bereits im Gebrauch befindlichen<br />
Krankenhaus- und Pflegebetten<br />
informiert. Die Betreiber wurden<br />
aufgefordert, die Betten anhand der<br />
vorgegebenen Checklisten zu überprüfen<br />
oder überprüfen zu lassen und<br />
sie ggf. fachgerecht umrüsten, nachrüsten<br />
oder reparieren zu lassen.<br />
Die GAA werden in Sachsen-Anhalt<br />
ihre stichprobenartigen Kontrollen bei<br />
Betreibern von Pflegebetten im Jahr<br />
2002 fortführen.
Zur Situation im Arbeitsschutz 29<br />
Vielschichtige Defizite zur Anlagen- und Betriebssicherheit<br />
Explosionsschutz<br />
Die in den Jahren 1999 und 2000 festgestellten<br />
Sicherheitsdefizite bei Anlagen<br />
und in Betriebsstätten mit explosionsfähiger<br />
Atmosphäre lenkten die Aufsicht<br />
auch im Jahre <strong>2001</strong> auf die Explosionsschutzproblematik.<br />
Die Instrumentarien<br />
der Sonderaktionen in den zurückliegenden<br />
Jahren wurden in den Methodenkatalog<br />
der Regelrevisionen überführt<br />
und in entsprechenden Betriebsstätten<br />
angewandt. Bei diesen Prüfungen wurden<br />
die nicht befriedigenden Ergebnisse<br />
der Explosionsschutzkontrollen der<br />
letzten zwei Jahre erneut bestätigt. Ursächlich<br />
waren die unzureichenden bzw.<br />
nicht vorhandenen Kenntnisse auf dem<br />
Gebiet des Explosionsschutzes mit den<br />
damit verbundenen Folgen, dass keine<br />
Unterlagen und Festlegungen zum primären<br />
Ex-Schutz und keine Konzepte<br />
zur Verringerung des Zündrisikos vorhanden<br />
sind.<br />
Getränkeschankanlagen<br />
In einer Schwerpunktaktion wurden in<br />
95 gastronomischen Einrichtungen insgesamt<br />
137 Getränkeschankanlagen<br />
überprüft. 84% dieser Anlagen waren<br />
mängelbehaftet.<br />
Mit einer Mängelquote von 86% dominierten<br />
deutlich die nicht durchgeführten<br />
wiederkehrenden Prüfungen. Auch<br />
wenn es in der SchankV festgeschrieben<br />
ist, veranlassen die Betreiber die<br />
wiederkehrende Prüfung nicht von<br />
selbst. Es bedarf immer der Anregung<br />
durch den Sachkundigen oder der Aufforderung<br />
der zuständigen Behörde.<br />
Von den insgesamt 95 kontrollierten<br />
gastronomischen Einrichtungen mussten<br />
24 aufgrund der örtlichen Gegebenheiten<br />
mit einer technischen Lüftung<br />
bzw. mit einem Gaswarngerät ausgestattet<br />
sein. Die Überprüfung ergab, dass<br />
nur in 7 Einrichtungen dies realisiert<br />
war. Ursachen für die Vielzahl und z. T.<br />
die Schwere der Mängel ist einerseits<br />
Dipl.-Ing. Peter Hofmann, GAA Naumburg<br />
das geringe Eigeninteresse der Betreiber<br />
an einer sicheren Getränkeschankanlage<br />
(die wirtschaftlichen Aspekte werden<br />
in den Vordergrund gerückt) und<br />
andererseits das Verhalten der Sachkundigen<br />
im Interessenkonflikt als<br />
“Dienstleister – Sachkundiger”, dem<br />
Auftraggeber keine negativen Prüfergebnisse<br />
zu übermitteln. Dem Ge-<br />
Abb. 2.7 Ansicht des Unfallortes<br />
schäftspartner Maßnahmen zur Schankanlagensicherheit<br />
abzuverlangen, birgt<br />
die Gefahr, Aufträge für die kontinuierlichen<br />
Reinigungen der Getränke- und<br />
Grundstoffleitungen zu verlieren.<br />
Reparatur eines Wärmetauschers<br />
Eine Auswertung erfolgte auch im Zusammenhang<br />
mit dem Unfall in einem<br />
chemischen Großbetrieb bei Reparaturarbeiten<br />
an einem Wärmetauscher, bei<br />
dem ein Mitarbeiter eines Servicebetriebes<br />
schwer verletzt wurde.<br />
Beim mittels Planabdrehgerät spanabhebenden<br />
Abtrennen der eingeschweißten<br />
Membrandichtung kam es zum plötzlichen<br />
Abreißen dieser Dichtung (Metallplatte<br />
∅ 1470 mm, 18 mm dick).<br />
Das am Wärmetauscher befestigte<br />
Planabdrehgerät, das davor angeordnete<br />
Arbeitsgerüst und der darauf befindliche<br />
Mitarbeiter wurden durch die<br />
Wucht der herausfliegenden Membrandichtung<br />
weggeschleudert (Abb. 2.7).<br />
Ursache für das Ereignis war ein innerer<br />
Überdruck im Wärmetauscher von<br />
ca. 5,5 bar, hervorgerufen durch anstehenden<br />
Netzstickstoff (Inertisierung).<br />
Die Anlage wurde jedoch drucklos vom<br />
Anlagenbetreiber zur Reparatur bereitgestellt.<br />
Das Ausbreiten des Netzstickstoffes<br />
bis in den Mantelraum des<br />
Wärmetauschers war aufgrund einer<br />
undichten Reglerarmatur und geschlossenerZwischenentspannungsarmatur<br />
möglich.<br />
Die vom GAA veranlasste Erarbeitung<br />
einer Arbeitsanweisung zur Reparaturvorbereitung<br />
und Reparaturtechnologie<br />
für Wärmeaustauscher mit eingeschweißter<br />
Dichtmembran und die Präzisierung<br />
weiterer betroffener organisatorischer<br />
Regelungen sollen solche Ereignisse<br />
zukünftig verhindern.
30 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Im zurückliegenden Jahr hat es einige<br />
gravierende Änderungen rechtlicher<br />
Vorschriften zum Strahlenschutz gegeben.<br />
Am 26. Juli <strong>2001</strong> wurde die Verordnung<br />
für die Umsetzung von EURA-<br />
TOM-Richtlinien zum Strahlenschutz im<br />
Bundesgesetzblatt Nr. 38 Teil I S. 1714<br />
verkündet. Am 1. August <strong>2001</strong> ist die<br />
Verordnung in Kraft getreten. Sie dient<br />
der Umsetzung der sog. EURATOM-<br />
Grundnorm zum Strahlenschutz und<br />
der Patientenrichtlinie. Ihr Artikel 1 beinhaltet<br />
die neue Strahlenschutzverordnung.<br />
Die weitreichenden Änderungen<br />
haben den Verordnungsgeber bewogen,<br />
die Verordnung neu zu strukturieren.<br />
Die wichtigsten Änderungen sollen kurz<br />
aufgezeigt werden:<br />
Der Empfehlung der Internationalen<br />
Strahlenschutz-Kommission folgend,<br />
hat die Europäische Union die Grenzwerte<br />
für die Jahresdosis beruflich<br />
strahlen-exponierter Personen von<br />
bisher 50 mSv auf praktisch 20 mSv<br />
(max. 100 mSv in 5 Jahren) und für<br />
Einzelpersonen der Bevölkerung von<br />
bisher 5 mSv auf 1 mSv abgesenkt.<br />
Diese Werte übernimmt die Strahlenschutzverordnung.<br />
Der Schutz vor erheblich erhöhter<br />
Exposition durch natürliche Strahlenquellen<br />
bei Arbeiten, das sind im<br />
Sinne der Verordnung Handlungen,<br />
die nicht mit dem Ziel erfolgen, die<br />
Radioaktivität zu nutzen, ist erstmals<br />
umfassend – für Arbeitnehmerinnen,<br />
Arbeitnehmer und Bevölkerung<br />
– geregelt.<br />
Die Novelle schreibt einen verstärkten<br />
Strahlenschutz bei der medizinischen<br />
Anwendung ionisierender<br />
Strahlen vor.<br />
Strahlenschutz<br />
Dr. rer. nat. Gerhard Greune, LAS Dessau<br />
Die Verordnung enthält ein neues<br />
Konzept für die Freigabe radioaktiver<br />
Stoffe aus der Überwachung.<br />
Der Erwerb der Fachkunde, bisher<br />
weitgehend durch nachgeordnete<br />
Richtlinien festgelegt, wird nunmehr,<br />
ihre Bedeutung für den Strahlenschutz<br />
unterstreichend, in einem eigenen Paragrafen<br />
geregelt. Nur noch die Details<br />
sind den Richtlinien zugewiesen.<br />
Die Fachkunde ist künftig in regelmäßigen<br />
Abständen (mindestens alle fünf<br />
Jahre) zu aktualisieren.<br />
Es werden neue Messgrößen für die<br />
Bewertung der Exposition eingeführt.<br />
Komplettiert werden die Vorschriften<br />
durch einen umfangreichen Katalog<br />
von Übergangsvorschriften.<br />
Die neue Gliederung und die weitreichenden<br />
Änderungen der Strahlenschutzverordnung<br />
machen es auch für<br />
denjenigen, der mit der alten Verordnung<br />
in allen Belangen vertraut war,<br />
nicht einfach, die jeweils zu beachtenden<br />
Vorschriften herauszuarbeiten. Um<br />
dies zu erleichtern, wurden für wichtige<br />
Tätigkeitsfelder Checklisten mit einer<br />
Übersicht über die neuen Forderungen,<br />
weitere Änderungen und grundlegende<br />
Vorschriften sowie die zugehörigen<br />
Paragrafen erarbeitet.<br />
Solche Checklisten liegen vor für:<br />
Radionuklidlabore<br />
Radiometrie<br />
Gammaradiografie<br />
Nuklearmedizinische Einrichtungen<br />
Strahlenschutz an Schulen<br />
Strahlenschutz bei natürlichen Strahlenquellen<br />
Sie erlauben den Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern der Gewerbeaufsichts-<br />
verwaltung und den Anwendern eine<br />
schnelle Orientierung über die nunmehr<br />
zu beachtenden Anforderungen.<br />
In der gleichen Ausgabe des Bundesgesetzblattes<br />
wurde vom Bundesumweltministerium<br />
das vollständige Inkrafttreten<br />
des Gesetzes zur Änderung atomrechtlicher<br />
Vorschriften für die Umsetzung<br />
von EURATOM-Richtlinien zum<br />
Strahlenschutz vom 3. Mai 2000 zum<br />
1. August <strong>2001</strong> bekannt gemacht. Zeitgleich<br />
mit der Strahlenschutzverordnung<br />
wurde so die geänderte Definition<br />
für radioaktive Stoffe wirksam. Nur solche<br />
radioaktiven Stoffe fallen unter die<br />
gesetzlichen Regelungen, deren Aktivität<br />
aus Gründen des Strahlenschutzes<br />
nicht außer Acht gelassen werden kann.<br />
Neue Vorschriften gelten auch für die<br />
durch das Verkehrsrecht geregelte<br />
Beförderung radioaktiver Stoffe. Zum<br />
1. Juli <strong>2001</strong> ist das neue Europäische<br />
Übereinkommen über die Internationale<br />
Beförderung gefährlicher Güter<br />
(ADR) in Kraft getreten. Mit der Verordnung<br />
zur Änderung gefahrgutrechtlicher<br />
Vorschriften (GefÄndV <strong>2001</strong>) vom<br />
11. Dezember <strong>2001</strong> (BGBl. I S. 3529)<br />
wurden dessen Vorschriften rückwirkend<br />
zum 1. Juli <strong>2001</strong> auch für die den<br />
nationalen Vorschriften unterliegende<br />
Beförderung wirksam.<br />
Das neue ADR enthält nuklidspezifische<br />
Werte der Aktivitätskonzentration und<br />
Grenzwerte der Aktivität, bei deren Überschreitung<br />
die Bestimmungen des ADR<br />
einzuhalten sind. Die Werte des ADR<br />
sind identisch mit den Freigrenzen der<br />
spezifischen Aktivität und Aktivität nach<br />
Strahlenschutzverordnung. Die bisherige<br />
Blatteinteilung für die Klasse 7 ist<br />
entfallen. Für die Zuordnung der radioaktiven<br />
Stoffe stehen 25 UN-Nummern<br />
zur Verfügung. Erforderlich ist die<br />
Erstellung eines Strahlenschutzprogramms<br />
unter Berücksichtigung der zu<br />
erwartenden Strahlenexposition.
Zur Situation im Arbeitsschutz 31<br />
Wie in den Vorjahren lag der Schwerpunkt<br />
der Arbeit der GAV – insbesondere<br />
beim Schutz vor Gefahrstoffeinwirkungen<br />
zur Vermeidung von beruflich<br />
bedingten Erkrankungen in kleinen<br />
und mittleren Unternehmen – in der<br />
unmittelbaren Überwachung der exponierten<br />
Arbeitsplätze und in der Beratung<br />
zur Vermittlung von Kenntnissen<br />
über Gefahren sowie Möglichkeiten und<br />
Pflichten, diese Gefahren gänzlich zu<br />
vermeiden oder zumindest auf ein Minimum<br />
zu beschränken.<br />
Die Überwachung erfolgte in speziellen<br />
Einzelfällen, beispielsweise ausgelöst<br />
durch gesetzlich vorgeschriebene<br />
Anzeigen, Beschwerden von Beschäftigten<br />
als auch nach den in der Jahresplanung<br />
<strong>2001</strong> festgelegten Schwerpunktthemen.<br />
Die Ergebnisse einer<br />
landesweiten Sonderaktion zu Gefährdungen<br />
durch kanzerogene Stoffe<br />
(Chrom- und Nickelverbindungen) bei<br />
der thermischen Bearbeitung von Edelstählen<br />
sind auf S. 59 ff. dargestellt.<br />
Des Weiteren überprüfte das GAA Halberstadt<br />
in 46 Betrieben die Einhaltung<br />
der erforderlichen Maßnahmen bei der<br />
thermischen Metallbearbeitung unbeschichteter<br />
unlegierter/niedriglegierter<br />
Stähle. Auch wenn keine akute Gefährdung<br />
der Beschäftigten durch gas- bzw.<br />
partikelförmige Schadstoffe festgestellt<br />
werden konnte, wurden grundlegende<br />
Anforderungen, insbesondere hinsichtlich<br />
Rangfolge der Schutzmaßnahmen,<br />
Vernachlässigung der Unterweisungspflicht<br />
und die Bestellung der Betriebsärzte<br />
unzureichend berücksichtigt. Besonders<br />
hervorzuheben sind weiterhin<br />
fehlende Angaben zu Schweißrauchen<br />
im Gefahrstoffverzeichnis und fehlende<br />
Betriebsanweisungen für etwa 50% der<br />
untersuchten Schweißarbeitsplätze.<br />
Eine Gefährdung der Beschäftigten ergab<br />
sich aus der Tatsache, dass wiederkehrende<br />
Prüfungen der lufttech-<br />
Gefahrstoffe<br />
Dipl.-Pharm. Petra Willman, GAA Stendal<br />
nischen Anlagen in ca. der Hälfte der<br />
überprüften Unternehmen nicht durchgeführt<br />
worden waren.<br />
Das GAA Naumburg widmete den stofflichen<br />
Gefahren bei Lackierung und<br />
Farbgebung in der Metallbranche besondere<br />
Aufmerksamkeit, um Aufgabenschwerpunkte<br />
für zukünftige Revisionen<br />
abzuleiten. Formale Anforderungen,<br />
wie das Vorhalten von Sicherheitsdatenblättern,Gefahrstoffverzeichnissen,<br />
Betriebsanweisungen, sind nicht<br />
im erforderlichen Umfangberücksichtigt<br />
worden. Auch bei der Unterweisungspflicht<br />
wurden erhebliche Mängel ermittelt.<br />
Dem Substitutionsgebot konnte aus<br />
technologischen und qualitätsbedingten<br />
Gründen nur selten nachgekommen<br />
werden. Giftige Anstrichstoffe werden<br />
kaum noch verwendet, aber auf den<br />
Einsatz “wenig” lösemittelhaltiger Produkte<br />
kann dennoch aus verschiedenen<br />
Erfordernissen (z.B. Korrosionsschutz)<br />
nicht verzichtet werden.<br />
In der Landesmessstelle für Gefahrstoffe<br />
erfolgten 509 Untersuchungen zur Bestimmung<br />
der Konzentration gefährlicher<br />
Stoffe in der Luft an Arbeitsplätzen<br />
sowie zum Nachweis gefährlicher Stoffe<br />
in Materialproben zur Unterstützung<br />
der Revisionstätigkeit der GAA. Davon<br />
resultieren 22% aus der Revisionstätigkeit,<br />
9% aus Sonder- und Schwerpunktaktionen,<br />
1% aus dem Amtshilfeersuchen,<br />
4% auf Veranlassung durch<br />
den Unternehmer, 1% ohne Angaben,<br />
aber 58% aus Beschwerden von Beschäftigten.<br />
Ein wesentlicher Anteil betraf dabei Beschwerden<br />
beim Umgang mit Glasfaserstäuben.<br />
Beim Schneiden von<br />
Glasfasergewebe oder Stapelglasfasermatten<br />
bei Laminierarbeiten in der Fahrzeugtechnik<br />
wird Glasfaserstaub in der<br />
Arbeitsplatzumgebung freigesetzt. Untersuchungen<br />
zeigten, dass der Anteil<br />
lungengängiger Fasern in der Luft an<br />
den betreffenden Arbeitsplätzen sehr<br />
gering und kein besonderer Atemschutz<br />
notwendig ist, aber der Anteil an “groben”<br />
Fasern hoch ist, so dass an den<br />
exponierten Arbeitsplätzen infolge mechanischer<br />
Verletzung der Haut durch<br />
die Faserbruchstücke in Verbindung mit<br />
lösemittelhaltiger Luft erhebliche Hautreizungen<br />
auftreten. Die Zuschneidearbeiten<br />
sollten zur Staubvermeidung<br />
zweckmäßigerweise unter einer mit einem<br />
Sichtfenster ausgestatteten Absaugglocke<br />
durchgeführt werden.<br />
Bei der Verwendung von glasfaserhaltigen<br />
Spachtelmassen, z. B. beim<br />
Modellbau zur Herstellung von Windkrafträdern,<br />
werden bei intensiven<br />
Schleifarbeiten mit Vibrations- und Rotationsschleifern<br />
Stäube freigesetzt, die<br />
hohe Konzentrationen lungengängiger<br />
Glasfasern enthalten. Bei diesen Arbeiten<br />
muss deshalb ausreichender Schutz<br />
vor Faserstäuben gewährleistet sein.<br />
Bereits Ende 2000 ereignete sich im<br />
Zusammenhang mit Schwefelwasserstoff<br />
ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein Beschäftigter<br />
einer Baufirma für abwassertechnische<br />
Anlagen stieg in einen noch<br />
nicht übergebenen Revisionsschacht<br />
ein, in dem sich Faulgase angesammelt<br />
hatten. Wieder einmal war dem Problem<br />
“Schwefelwasserstoff” als Hauptbestandteil<br />
von Faulgasen nicht mit der<br />
nötigen Vorsicht begegnet worden. Um<br />
die Gefährlichkeit des Schwefelwasserstoffs<br />
einer größeren Beschäftigtenzahl<br />
zur Kenntnis zu bringen, erfolgte im<br />
Berichtszeitraum eine Unfallauswertung<br />
im Mitteilungsblatt der Unfallkasse Sachsen<br />
Anhalt. Des Weiteren nahm das<br />
zuständige GAA Dessau diesen tödlichen<br />
Unfall zum Anlass unter Einbeziehung<br />
von “Güteschutzkanal e. V.”,<br />
über das Verhalten und die Schutzmaßnahmen<br />
beim Umgang mit Schwefelwasserstoff<br />
zu unterrichten.
32 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Biologische Arbeitsstoffe sind im Wesentlichen<br />
Mikroorganismen, mikroskopisch<br />
kleine, zumeist einzellige Organismen<br />
wie Viren, Bakterien, Parasiten<br />
und niedere Pilze. Tätigkeiten mit biologischen<br />
Arbeitsstoffen erstrecken sich<br />
auf eine Vielzahl von Branchen und die<br />
unterschiedlichsten Berufsgruppen, angefangen<br />
vom Archivar bis zum Zerspaner.<br />
Der Schutz der Beschäftigten<br />
vor biologischen Arbeitsstoffen, die Infektionskrankheiten,<br />
sensibilisierende<br />
oder toxische Wirkungen hervorrufen<br />
können, wird in der Biostoffverordnung<br />
(BioStoffV) geregelt, die eine europäische<br />
Richtlinie (90/679/EWG, neu 2000/<br />
54/EG) in nationales Recht umsetzt.<br />
Normadressat ist der Arbeitgeber, der<br />
entsprechend der durchzuführenden<br />
Gefährdungsbeurteilung die erforderlichen<br />
Schutzmaßnahmen festlegt und<br />
umsetzen muss. Für den Vollzug der<br />
BioStoffV sind in Sachsen-Anhalt die<br />
GAA sowie für die Ermächtigung von<br />
Ärzten zur Durchführung der arbeitsmedizinischen<br />
Vorsorge das LAS zuständig.<br />
Auffällig im Vollzug ist der erhöhte<br />
Anteil fehlender oder nicht vollständiger<br />
Gefährdungsbeurteilungen nach<br />
BioStoffV für nicht gezielte Tätigkeiten,<br />
vor allem im Gesundheitswesen. Dieser<br />
Mangel wirkt sich hier nicht auf den<br />
Schutz der Beschäftigten aus, da in<br />
diesem Bereich traditionell seuchenhygienische<br />
Maßnahmen angewandt<br />
werden, die Arbeitsschutzmaßnahmen<br />
beinhalten bzw. auch auf den Schutz<br />
der Beschäftigten wirken, und nach<br />
BioStoffV in der Regel keine anderen<br />
Maßnahmen erforderlich sind.<br />
Einen breiten Raum beanspruchten im<br />
Berichtszeitraum die in der Öffentlichkeit<br />
stark diskutierten Themen BSE, MKS<br />
und Milzbrand. Während aufgrund seiner<br />
geringen Pathogenität für den Menschen<br />
gegen den Erreger der Maul- und<br />
Biologische Arbeitsstoffe<br />
Dr. rer. nat. Bernhard Schicht, LAS Dessau<br />
Klauenseuche (MKS) primär tierseuchenhygienische<br />
Maßnahmen ergriffen werden<br />
müssen, stellen die Erreger von BSE<br />
und Milzbrand auch für den Menschen<br />
ein gesundheitliches Risiko dar.<br />
BSE, eine degenerative Erkrankung des<br />
Zentralnervensystems des Rindes, ist<br />
durch ein strukturveränderndes Eiweiß<br />
(Prionprotein) vermutlich über die Nahrungskette<br />
auch auf den Menschen<br />
übertragbar und löst hier eine ebenfalls<br />
tödliche Variante der Creutzfeldt-<br />
Jakob-Krankheit aus. Für Beschäftigte<br />
stellt der Kontakt mit s. g. Risikomaterialien<br />
(Gehirn, Augen, Mandeln,<br />
Rückenmark) und ihre mögliche Aufnahme<br />
eine Gefahr dar, der bis zur<br />
Aufklärung des Übertragungsweges<br />
und Sanierung der Herden präventiv<br />
zu begegnen ist. Entsprechend hat die<br />
Gewerbeaufsicht mit Bekanntwerden<br />
der auch für Deutschland bestehenden<br />
Risiken betroffene Betriebe und<br />
die Gewerbeaufsichtsbeamtinnen und<br />
Gewerbeaufsichtsbeamten über mögliche<br />
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen<br />
informiert und beraten. Zur<br />
Erfassung der Betriebe und Einrichtungen<br />
wurde auch ein Daten- und Informationsabgleich<br />
mit Überwachungsbehörden<br />
des Veterinär- und Gesundheitswesens<br />
vorgenommen.<br />
In Sachsen-Anhalt waren im Wesentlichen<br />
3 Schlachthöfe, eine Tierkörperbeseitigungsanlage<br />
und eine staatliche<br />
Untersuchungseinrichtung betroffen.<br />
Die flächendeckende Untersuchung<br />
der Schlachttiere (ab 24 Monate) sowie<br />
vorsorglich getöteter und gestorbener<br />
Rinder hat im Jahresverlauf die Erwartung<br />
bestätigt, dass die Durchseuchung<br />
deutscher Rinderbestände mit dem<br />
BSE-Erreger gering ist und somit auch<br />
das Risiko für die Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer (Ende <strong>2001</strong> bei über<br />
2 Mio. untersuchten Tierkörpern in der<br />
Bundesrepublik 135 Fälle, davon 4 im<br />
Land Sachsen-Anhalt).<br />
Zu den biologischen Arbeitsstoffen werden<br />
gemäß BioStoffV auch gentechnisch<br />
veränderte Mikroorganismen gerechnet.<br />
Der Umgang mit diesen wird<br />
im Gentechnikgesetz (GenTG) umfassend<br />
geregelt, so dass die BioStoffV nur<br />
Anwendung findet, wenn in dieser höhere<br />
Anforderungen an den Schutz der<br />
Beschäftigten gestellt werden. In der<br />
Regel trifft dies nicht auf die baulichen,<br />
technischen und persönlichen Sicherheitsmaßnahmen<br />
zu, da das Schutzniveau<br />
der Schutzstufen 1 bis 4 nach<br />
BioStoffV vergleichbar ist mit dem der<br />
Sicherheitsstufen 1 bis 4 nach dem<br />
GenTG.<br />
Im Rahmen der Anmelde- und Genehmigungsverfahren<br />
für gentechnische<br />
Anlagen und Arbeiten wird die Gewerbeaufsicht<br />
in die Entscheidungsfindung<br />
durch die zuständige Behörde (Regierungspräsidium<br />
Magdeburg, RP MD)<br />
einbezogen. Darüber hinaus überwachen<br />
bezüglich des Schutzes der Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer die<br />
örtlich zuständigen GAA die Durchführung<br />
des GenTG. In der Regel sind<br />
durch die Überwachungsbehörden<br />
technisch-organisatorische Überwachungsmaßnahmen<br />
durchzuführen,<br />
wobei das örtlich zuständige GAA und<br />
das RP MD diese Maßnahmen koordinieren.<br />
Bei den Begehungen und Aufzeichnungskontrollen<br />
wurden keine<br />
Abweichungen von den geplanten Arbeiten<br />
und keine schwerwiegenden<br />
Verstöße gegen andere durch die Gewerbeaufsicht<br />
zu überwachende gesetzliche<br />
Bestimmungen festgestellt.<br />
Im Aufsichtsbereich der GAA waren<br />
Ende <strong>2001</strong> von 32 Betreibern insgesamt<br />
115 gentechnische Anlagen zu<br />
Forschungszwecken angemeldet (101<br />
Sicherheitsstufe 1) und genehmigt<br />
(14 Sicherheitsstufe 2). Dies entspricht<br />
gegenüber dem Jahr 2000 einer Zunahme<br />
um 21 Prozent.
Zur Situation im Arbeitsschutz 33<br />
Aus Anlass des Explosionsunglückes<br />
in Enschede wurden im Jahr <strong>2001</strong> in<br />
Sachsen-Anhalt ergänzende Lagerkontrollen<br />
durchgeführt.<br />
Diese Kontrollen richteten sich insbesondere<br />
darauf, ob die gelagerten Produkte<br />
der zugehörigen Lagergruppe<br />
zugeordnet waren und dieses durch<br />
eine entsprechende Bescheinigung der<br />
Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung nachgewiesen werden<br />
konnte. Besonderes Augenmerk war<br />
auf sogenannte „Blitzbomben“, die der<br />
Lagergruppe 1.1 zuzuordnen sind, und<br />
auf ggf. stattfindende Zusammenlagerung<br />
von Produkten der Lagergruppe<br />
1.1 mit denen der Lagergruppe<br />
1.3 gerichtet. Im Ergebnis der Kontrollen<br />
waren Maßnahmen nach § 32<br />
SprengG nicht erforderlich.<br />
Der Fall in Enschede macht deutlich,<br />
wie wichtig es ist, dass Rechtsvorschriften<br />
immer wieder überprüft werden<br />
müssen. Reicht es aus, dass z. B.<br />
nur pyrotechnische Gegenstände der<br />
Klassen I bis III zulassungspflichtig sind<br />
und die der Klasse IV nicht? Warum<br />
soll aus Sicherheitsgründen für pyrotechnische<br />
Gegenstände der Klasse<br />
IV die Zulassungspflicht nicht auch eingeführt<br />
werden?<br />
Auch die Entwicklung im Bereich des<br />
Handels hat sich im Hinblick auf die<br />
Aufbewahrung kleiner Mengen von<br />
pyrotechnischen Gegenständen, bezogen<br />
auf den Lagerort und dessen<br />
Umgebung/Umfeld, in den letzten Jahren<br />
geändert. Ausgehend von den<br />
daraus resultierenden Fragen fand zu<br />
diesem Thema eine intensive Diskussion<br />
zwischen dem MS und den<br />
Vollzugsbehörden des Landes statt.<br />
Das Ergebnis findet seinen Niederschlag<br />
in einer Änderung der Nr. 4 des<br />
Anhangs zu § 2 zur 2. SprengV (incl.<br />
einer neuen Anlage 6a), die zum Jah-<br />
Sprengstoffrecht<br />
Dipl.-Chem. Gerhard Soffner, LAS Dessau<br />
resende vom BMA als Empfehlung für<br />
die Erteilung von Ausnahmen gegeben<br />
wurde und die in die für 2002 geplante<br />
Gesetzesänderung Eingang finden soll.<br />
Sprengung von vier<br />
Schornsteinen<br />
Das an der Elbe 1938 erbaute und 1994<br />
stillgelegte Kraftwerk Vockerode hatte<br />
insgesamt vier baugleiche Schornsteine<br />
von 140 m Höhe mit einem Achsabstand<br />
von 60 m. Die Gesamtanlage<br />
stand seit 1996 unter Denkmalschutz.<br />
Anfang des Jahres <strong>2001</strong> wurde die Entscheidung<br />
für eine Sprengung der<br />
Schornsteine getroffen.<br />
Für die Überwachung des sprengstoffrechtlichen<br />
Teils des Vorhabens war<br />
das GAA Dessau zuständig. Die dabei<br />
zu beachtenden Randbedingungen waren<br />
sehr kompliziert, da aufgrund der<br />
räumlichen Enge des Aufprallbereiches<br />
eine Verkürzung der Falllänge von<br />
140 m auf maximal 80 m notwendig<br />
war. Deshalb entschied man sich für<br />
eine Zweifachsprengung, eine sogenannte<br />
Sprengfaltung, bei der die<br />
Seitenabweichung nicht mehr als 2°<br />
links oder rechts der Fallachse der<br />
Schornsteine betragen durfte.<br />
Außerdem war zu beachten, dass in<br />
einer Entfernung von 110 m vom Standort<br />
des ersten Schornsteines ein Feuerwehrgebäude,<br />
zwei Weichwassertanks,<br />
ein Blockheizwerk und die dazugehörigen<br />
Tankanlagen sowie in ca. 240 m<br />
vom Kraftwerksgelände zahlreiche<br />
Wohngebäude stehen. Diese Betriebsanlagen<br />
und Wohngebäude durften<br />
nicht beschädigt werden. Ferner galt<br />
es, die Auswirkungen der Sprengung<br />
zu beurteilen, da im Moment des Aufpralls<br />
der Betonmassen mit einer erheblichen<br />
Erschütterungs- und Staubbelastung<br />
zu rechnen war. Entsprechende<br />
Befürchtungen der Anwohne-<br />
rinnen und Anwohner galt es zu entkräften.<br />
Deshalb forderte das GAA zusätzliche<br />
Maßnahmen zum Erschütterungsschutz<br />
für die angrenzenden<br />
Betriebsanlagen und Wohngebäude<br />
sowie zur Staubbindung.<br />
Das GAA stellte an das sprengausführende<br />
Unternehmen zusätzliche Forderungen<br />
zur Erarbeitung einer Sicherheitskonzeption,<br />
legte einen Sprengbereich<br />
mit einem Sicherheitsradius von<br />
300 m fest und stimmte die notwendigen<br />
Absperr- und Sicherungsmaßnahmen<br />
ab.<br />
Die Sprengung erforderte pro Schornstein<br />
52 kg Sprengstoff, mit dem jeweils<br />
204 Bohrlöcher besetzt wurden. Einen<br />
Tag vor dem Sprengtermin überprüfte<br />
das GAA alle Schutzmaßnahmen und<br />
überzeugte sich vom Zustand der geladenen<br />
Schornsteine. Die Zündung der<br />
Sprengstoffe erfolgte auf der Grundlage<br />
einer Kombination aus elektrischer<br />
und nichtelektrischer Zündung. Innerhalb<br />
von zehn Sekunden fielen am 22.<br />
September <strong>2001</strong> die vier Schornsteine<br />
durch die Sprengung zielgenau um<br />
(Abb. 2.8). Keine der angrenzenden<br />
Betriebsanlagen bzw. Wohngebäude<br />
wurden durch die Sprengung beschädigt.<br />
Abb. 2.8 Sprengung der Schornsteine des<br />
ehemaligen Kraftwerkes Vockerode
34 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Die rechtlichen Bestimmungen im sozialen<br />
Arbeitsschutz dienen sowohl<br />
dem Arbeitszeitschutz der abhängig<br />
Beschäftigten als auch dem Schutz<br />
besonderer Personengruppen, wie Kinder<br />
und Jugendliche, Schwangere,<br />
LKW- und Omnibus-Fahrer sowie Heimarbeiter.<br />
Arbeitszeitgesetz (ArbZG)<br />
Auch bei den Unternehmen in Sachsen-Anhalt<br />
ist eine Zunahme flexibler<br />
Arbeitszeiten zu verzeichnen.<br />
Der klassische Acht-Stunden-Tag von<br />
Montag bis Freitag wird immer mehr zur<br />
Ausnahme. In einer repräsentativen<br />
Arbeitszeitstudie geben 70% von 2.500<br />
befragten Unternehmen an, dass ihre<br />
wöchentliche Betriebszeit in der Regel<br />
die vertragliche oder tariflich vereinbarte<br />
Wochenarbeitszeit überschreite. 1990<br />
waren es erst 57 Prozent. Zugenommen<br />
haben auch die Anzahl der Überstunden,<br />
die Samstagsarbeit und unregelmäßige<br />
Arbeitseinsätze. Bei den Überstunden<br />
hat sich das Gewicht vom produzierenden<br />
Gewerbe zum Dienstleistungsbereich<br />
verlagert. In 45 Prozent<br />
aller Betriebe wird Samstagsarbeit<br />
geleistet und in 18 Prozent aller Unternehmen<br />
findet regelmäßig Sonntagsarbeit<br />
statt. (Quelle: dpa-Mitteilung,<br />
Volksstimme MD vom 26.01.2002)<br />
In vielen Unternehmen schwankte die<br />
Auftragssituation im Verlauf eines Jahres<br />
stark. Somit wurden die Arbeitszeiten<br />
der Beschäftigten dem jeweiligen<br />
Auftragsvolumen angepasst. Dies führte<br />
wiederum auch zu unregelmäßigen,<br />
z. T. für die Beschäftigten nicht mehr<br />
planbaren und überschaubaren Arbeitszeitregelungen<br />
und Schichtsystemen.<br />
Außerdem kam es zu Mehrarbeit ohne<br />
Ausgleich und Ausdehnung der Betriebszeiten<br />
auf Sonn- und Feiertage.<br />
Sozialer Arbeitsschutz<br />
Dipl.-Ing. Dietmar Glöckner, LAS Dessau<br />
In diesem Bereich des Arbeitsschutzes<br />
fanden im Berichtsjahr 14.510 Besichtigungen<br />
und Überprüfungen statt.<br />
Dass Beratung und Aufklärung nicht<br />
immer und allein zum Erfolg führen,<br />
zeigen die 2.367 Revisionsschreiben<br />
und 1.632 Bußgeldverfahren. Letztere<br />
Dabei bewegten Unternehmen sich<br />
auch außerhalb des gesetzlich zulässigen<br />
Rahmens des Arbeitszeitrechts,<br />
was ein behördliches Eingreifen erforderte.<br />
Hinzu kamen Anzeigen und<br />
Beschwerden wegen Verstößen gegen<br />
die Vorschriften des ArbZG durch Arbeitgeber<br />
bzw. durch sie beauftragte<br />
Personen.<br />
Es bestand landesweit sowohl ein hoher<br />
Bedarf an vorübergehender als auch<br />
ein Bedürfnis an dauerhafter Sonn- und<br />
Feiertagsarbeit. Durch zeitlich befristet<br />
erteilte Ausnahmegenehmigungen zur<br />
Sicherung vorhandener und Schaffung<br />
neuer Dauerarbeitsplätze wurde gem.<br />
§ 15 Abs. 2 ArbZG “im dringenden öffentlichen<br />
Interesse” in 14 Fällen die Beschäftigung<br />
von Arbeitnehmern an Sonn- und<br />
gesetzlichen Feiertagen bewilligt.<br />
Um dem Wettbewerb mit der internationalen<br />
Konkurrenz standhalten zu können,<br />
erhielten 6 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt<br />
Ausnahmegenehmigungen<br />
für Sonn- und Feiertagsarbeit gemäß §<br />
13 Abs. 5 ArbZG.<br />
Bedeutend häufiger wurde Sonn- und<br />
Feiertagsbeschäftigung an bis zu fünf<br />
Sonn- und Feiertagen zur Verhütung<br />
eines “unverhältnismäßigen Schadens”<br />
gem. § 13 Abs. 3 Nr. 2b ArbZG bewilligt.<br />
In wenigen Einzelfällen wurde die tägliche<br />
Arbeitszeit von ArbeitnehmerInnen<br />
auf über 10 Stunden verlängert. Damit<br />
wurden zu 97% im Fahrpersonalrecht<br />
durchgeführt.<br />
Die Schlussfolgerung, dass es in den<br />
übrigen Rechtsgebieten weniger problematisch<br />
aussieht, trifft allerdings nicht<br />
zu, wenn man die festgestellten Beanstandungen<br />
betrachtet.<br />
konnten unter Beachtung des Schutzzieles<br />
des ArbZG und durch den Gesundheitsschutz<br />
der ArbeitnehmerInnen<br />
flankierende Auflagen für ArbeitnehmerInnen<br />
zusätzliche Freischichten,<br />
insbesondere am Wochenende und für<br />
ArbeitnehmerInnen, welche ständig auf<br />
Montage sind, bessere arbeitszeitliche<br />
Rahmenbedingungen für ihre auswärtige<br />
Beschäftigung geschaffen werden.<br />
Problematisch stellt sich nach wie vor<br />
die Arbeitszeitsituation insbesondere<br />
der Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern<br />
im Land Sachsen-Anhalt dar.<br />
Hiervon besonders betroffen sind u. a.<br />
Ärztinnen und Ärzte in größeren, insbesondere<br />
landeseigenen und kommunalen<br />
Krankenhäusern, wo bestimmte Spezialisten<br />
fehlen und die sich im Einsatz<br />
befindlichen Ärztinnen und Ärzte überlastet<br />
sind. Problematisch wird diese<br />
Situation durch den bundesweiten Mangel<br />
an Fachärztinnen und Fachärzten.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen,<br />
dass die Prüfung der Auswirkungen<br />
des SIMAP-Urteils des EuGH<br />
vom 3. Oktober 2000 auf die nationalen<br />
Arbeitszeitregelungen der Mitgliedstaaten<br />
durch die Europäische Kommission<br />
noch nicht abgeschlossen ist. In<br />
seiner Entscheidung hatte der EuGH<br />
in einem Vorabentscheidungsverfahren<br />
festgestellt, dass der Bereitschaftsdienst,<br />
wie ihn die Ärzte-Teams in Valencia<br />
zu leisten hatten, Arbeitszeit im<br />
Sinne der Richtlinie 93/104/EG sei.
Zur Situation im Arbeitsschutz 35<br />
Nach den Informationen aus dem BMA<br />
bestehe für Deutschland kein Handlungsbedarf,<br />
da mit dem Arbeitszeitgesetz die<br />
europäische Arbeitszeitrichtlinie vollständig<br />
umgesetzt worden sei.<br />
Weitere Schwierigkeiten mit der Einhaltung<br />
des Arbeitszeitgesetzes gab es<br />
u. a. in der Nahrungsmittelwirtschaft,<br />
insbesondere der Fleisch- und Schlachtindustrie.<br />
Hier konnte nur mit Geldbußen<br />
in nicht unbedeutender Höhe auf<br />
Arbeitsschutz in<br />
Zeitarbeitsfirmen<br />
Im Jahr <strong>2001</strong> wurden durch Mitarbeiterinnen<br />
und Mitabeiter des GAA Halle in<br />
insgesamt 31 Unternehmen mit Erlaubnis<br />
zur Arbeitnehmerüberlassung die<br />
vertraglichen Regelungen zwischen<br />
Verleiher und Entleiher zum Arbeitsschutz<br />
überprüft. Diese vertragliche<br />
Regelung ist deshalb von so großer Bedeutung,<br />
weil damit bezogen auf den<br />
Arbeitsschutz die Verantwortung zwischen<br />
Verleiher und Entleiher eindeutig<br />
beschrieben und abgegrenzt wird.<br />
Bei der Prüfung der Verträge wurden<br />
insbesondere folgende Mängel festgestellt:<br />
Der Entleiher wird nicht hinreichend<br />
verpflichtet, den Verleiher über Gefährdungen<br />
an den Arbeitsplätzen im<br />
Mutterschutz<br />
Der gesetzliche Mutterschutz hat die<br />
Aufgabe, die im Arbeitsverhältnis stehende<br />
Mutter und das werdende Kind<br />
vor Gefahren, Überforderung und Gesundheitsschädigung<br />
am Arbeitsplatz,<br />
vor finanziellen Einbußen und vor dem<br />
Verlust des Arbeitsplatzes während der<br />
Schwangerschaft und einige Zeit nach<br />
der Entbindung zu schützen.<br />
Im Zusammenhang mit der Beschäftigung<br />
werdender Mütter wurden im<br />
Berichtszeitraum bei 2.126 Betriebsbesichtigungen<br />
344 Mängel festgestellt.<br />
die arbeitszeitrechtlichen Arbeitsbedingungen<br />
der Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer und die Manipulation der<br />
Arbeitszeitnachweise Einfluss genommen<br />
werden.<br />
Bemerkenswert ist der Widerspruch,<br />
dass in Regionen mit sehr hoher Arbeitslosigkeit<br />
nicht genügend qualifiziertes<br />
und geeignetes Fachpersonal<br />
in erforderlichem Umfang zur Verfügung<br />
steht, um die Arbeitsplätze zu<br />
erforderlichen Umfang zu informieren.<br />
Die Verpflichtung des Entleihers, den<br />
Verleiher über die Umsetzung der<br />
Beschäftigten auf andere Arbeitsplätze<br />
zu informieren, fehlt häufig.<br />
Zu bemängeln ist auch, dass die<br />
Verpflichtung zur Mitteilung über beabsichtigte<br />
Abweichungen von den<br />
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes,<br />
z.B. Sonn- und Feiertagsarbeit,<br />
in den Verträgen fehlt.<br />
Weiterhin wurde bei den Kontrollen festgestellt,<br />
dass bei kurzfristiger Anforderung<br />
die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter<br />
bereits ohne Vorliegen eines<br />
unterschriebenen Überlassungsvertrages<br />
mit darin enthaltenen Vereinbarungen<br />
zum Arbeitsschutz eingesetzt<br />
werden. Der Verleiher erhält folglich<br />
nicht rechtzeitig Kenntnis über die bei<br />
Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt<br />
war dabei die umfassende Beratung<br />
der Arbeitgeber zur Einhaltung der<br />
Beschäftigungsverbote für Schwangere.<br />
Chemische Gefahrstoffe, biologische<br />
Arbeitsstoffe und physikalische<br />
Schadfaktoren stellten im Arbeitsprozess<br />
mitunter Gefährdungspotenziale<br />
dar, die für werdende Mütter in<br />
keiner Weise akzeptabel waren. In diesen<br />
Fällen wurden die Verantwortlichen<br />
ausführlich über notwendige Maßnahmen<br />
und ihre Pflichten informiert. Eine<br />
entsprechende Umsetzung der Schwangeren<br />
bzw. die Aussprache eines Be-<br />
besetzen, damit die Anlagen wirtschaftlich<br />
betrieben werden können.<br />
Mitarbeiter des GAA Halberstadt stellten<br />
bei einer Schwerpunktkontrolle von<br />
öffentlichen Tankstellen fest, dass bei<br />
26 kontrollierten Einrichtungen nicht<br />
gegen das ArbZG verstoßen wurde. In<br />
anderen Aufsichtsbezirken gab es in<br />
dieser Branche Probleme mit der Gewährung<br />
der “echten” Pausen und den<br />
Ersatzruhetagen bei Sonn- und Feiertagsbeschäftigung.<br />
diesen Tätigkeiten möglicherweise vorhandenen<br />
Gefährdungen und Belastungen.<br />
Bei einer Vielzahl von Zeitarbeitsfirmen<br />
werden darüber hinaus die den Arbeitsschutz<br />
betreffenden Bestandteile<br />
der Verträge nicht hinreichend überwacht.<br />
Durch unzulängliche Verträge sind einerseits<br />
die Belange der Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer hinsichtlich<br />
des erforderlichen Arbeitsschutzes und<br />
andererseits die Rechtssicherheit in der<br />
Verleihfirma, insbesondere für die Niederlassungsleiter<br />
und Personaldisponenten,<br />
nicht umfassend gewährleistet.<br />
Die Rechtsposition letzterer wird noch<br />
unsicherer, wenn die entsprechenden<br />
Arbeitsanweisungen durch den Verleiher<br />
nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden<br />
können.<br />
schäftigungsverbotes durch den Arbeitgeber<br />
wurden herbeigeführt.<br />
Weiterhin wurden im Berichtszeitraum<br />
insgesamt im LSA 176 Anträge auf<br />
Kündigungszulassung gestellt, wovon<br />
159 Anträge von der Gewerbeaufsicht<br />
abschließend bearbeitet wurden. Eine<br />
Vielzahl der Anträge wurde hauptsächlich<br />
mit Betriebsstilllegung und Fehlverhalten<br />
der Arbeitnehmerin begründet.<br />
In 101 Fällen wurde dem Antrag<br />
auf Kündigungszulassung gemäß § 9<br />
Abs. 3 MuSchG bzw. § 18 Abs. 1<br />
BErzGG zugestimmt.
36 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Der Schwerpunkt der Verstöße gegen<br />
Vorschriften liegt im gewerblichen Personen-,<br />
Güter- und Gefahrgutverkehr<br />
nach wie vor bei den Sozialvorschriften<br />
im Straßenverkehr. Dabei sind im gewerblichen<br />
Personen- und Gefahrgutverkehr<br />
deutlich weniger Verstöße gegen<br />
die Sozialvorschriften im Straßenverkehr<br />
zu verzeichnen als im sonstigen<br />
gewerblichen Güterverkehr.<br />
Gemäß den Feststellungen der Gewerbeaufsicht<br />
bei Betriebskontrollen in<br />
Sachsen-Anhalt im Jahr <strong>2001</strong><br />
waren bei jedem zweiten kontrollierten<br />
Fahrer Verstöße gegen die Sozialvorschriften<br />
im Straßenverkehr festzustellen,<br />
war etwa ein Drittel der kontrollierten<br />
Fahrtage (Arbeitstage) zu beanstanden<br />
und<br />
gab es bei 75% der kontrollierten Unternehmen<br />
Beanstandungen zu den<br />
Sozialvorschriften im Straßenverkehr.<br />
Die Sozialvorschriften im Straßenverkehr<br />
sollen dazu dienen, den sozialen<br />
Arbeitsschutz des Fahrpersonals zu<br />
gewährleisten und zu verbessern, die<br />
Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen<br />
und die Wettbewerbsbedingungen<br />
im gewerblichen Güter- und Personenverkehr<br />
in Europa zu harmonisieren.<br />
Durch mehrere Unfälle in Tunneln mit<br />
Beteiligung von Lastkraftwagen, zuletzt<br />
im Oktober <strong>2001</strong> das Unglück im<br />
Gotthardtunnel mit 11 Toten, ist die Situation<br />
im gewerblichen Personen-, Güter-<br />
und Gefahrgutverkehr wieder verstärkt<br />
in die Diskussion geraten. Von<br />
verschiedenen Seiten wurde im Zusammenhang<br />
damit darauf verwiesen, dass<br />
seit längerer Zeit Vorschläge bei der EU<br />
zur Verbesserung der Situation vorliegen<br />
würden. Ziel müsse sein<br />
Gewerblicher Personen- und Güterverkehr<br />
Dipl.-Ing. Holger Scheil, LAS Dessau<br />
erstens die Höchstarbeitszeit des<br />
Fahrpersonals auf ein akzeptables<br />
Maß zu beschränken und<br />
zweitens eine angemessene Qualifikation<br />
des Fahrpersonals zu gewährleisten.<br />
Von Seiten der EU ist inzwischen vorgesehen,<br />
durch eine Arbeitszeitrichtlinie<br />
die Höchstarbeitszeit des Fahrpersonals<br />
auf 60 Stunden wöchentlich zu begrenzen,<br />
wobei über einen Monatszeitraum<br />
durchschnittlich 48 Stunden je Woche<br />
nicht überschritten werden dürfen. Für<br />
selbst fahrende Unternehmer sollen diese<br />
Vorschriften aber erst ab dem Jahr<br />
2009 gelten.<br />
In der Diskussion befindet sich auch<br />
das so genannte digitale Kontrollgerät.<br />
Einige Mitgliedstaaten der EU, unter ihnen<br />
die Bundesrepublik Deutschland,<br />
haben u. a. noch Bedenken, ob die<br />
neue Generation der Kontrollgeräte ausreichend<br />
gegen Missbrauch geschützt<br />
ist. Die technischen Details zum digitalen<br />
Kontrollgerät regelt der technische<br />
Anhang I B zur Verordnung (EG) Nr.<br />
1360/2002 vom 13. Juni 2002 (7. Anpassung<br />
der VO (EWG) Nr. 3821/85).<br />
Dann müssten ab Ende August 2004<br />
die Fahrzeuge, die erstmals zugelassen<br />
sind, mit dem neuen Kontrollgerät<br />
ausgerüstet werden.<br />
Im Jahr <strong>2001</strong> kontrollierten die GAA im<br />
Fachgebiet Sozialvorschriften im Straßenverkehr<br />
70.742 Fahrtage (Arbeitstage)<br />
des Fahrpersonals. Bei Betriebskontrollen<br />
wurden 53.138 Fahrtage überprüft,<br />
dabei lag die Beanstandungsquote<br />
bezogen auf die kontrollierten Fahrerinnen<br />
und Fahrer bei 48%, bei Straßenkontrollen<br />
(im Rahmen der Zusammenarbeit<br />
mit Polizei und BAG) wurden<br />
17.604 Fahrtage überprüft, dabei lag<br />
die Beanstandungsquote bezogen auf<br />
die kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer<br />
bei 31%.<br />
Vom LAS wird gemeinsam mit der Zentralen<br />
Beratungsstelle für Verkehrssicherheit<br />
der Polizei eine Broschüre<br />
“Sozialvorschriften im Straßenverkehr”<br />
herausgegeben, die im Jahr <strong>2001</strong><br />
grundlegend überarbeitet wurde. Sie<br />
enthält allgemeinverständlich alle Vorschriften,<br />
die für das Fahrpersonal verbindlich<br />
sind.<br />
Im Fachgebiet Beförderung gefährlicher<br />
Güter wurden 413 Straßenfahrzeuge mit<br />
Gefahrgut kontrolliert, von denen 112<br />
zu beanstanden waren. Dies entspricht<br />
einer Beanstandungsquote von 27%.<br />
Mängel waren vor allem bezüglich der<br />
Begleitpapiere, Kennzeichnung, Ausrüstung<br />
und Ladungssicherheit zu verzeichnen.<br />
Es mussten 3 Bußgelder und 16<br />
Verwarnungsgelder verhängt werden.<br />
Kontrolliert wurden 240 Eisenbahnwagen<br />
mit Gefahrgut, von denen 30 beanstandet<br />
werden mussten. Dies entspricht<br />
einer Beanstandungsquote von 12%.<br />
Am 20. Juni <strong>2001</strong> fand, organisiert und<br />
durchgeführt vom LAS und den GAA,<br />
der 8. Gefahrgut-Treff des Landes Sachsen-Anhalt<br />
in der Landgaststätte Schlaitz<br />
statt. Thema für die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer aus der Wirtschaft, Verbänden<br />
und Behörden war die ADR/<br />
RID-Strukturreform.<br />
Auf den Magdeburger Gefahrguttagen<br />
am 18. und 19. Oktober <strong>2001</strong> wurde vor<br />
dem Hintergrund der Terroranschläge<br />
in den USA am 11. September <strong>2001</strong><br />
darauf hingewiesen, dass auch die bisherige<br />
Praxis im Umgang mit Transporten<br />
gefährlicher Güter auf den Prüfstand<br />
gestellt werden muss. Angesichts der<br />
Gefahren, die von solchen Gütern ausgehen<br />
können, wenn sie von Terroristen<br />
gezielt missbraucht werden, müssen<br />
die Sicherheitsvorkehrungen mit Augenmaß<br />
verstärkt werden und sind die<br />
internationalen und nationalen Vorschriften<br />
strikt anzuwenden.
Zur Situation im Arbeitsschutz 37<br />
Die wichtigste Aufgabe des gewerbeärztlichen<br />
Dienstes bestand auch im<br />
Jahre <strong>2001</strong> darin, bei Betriebsrevisionen<br />
mitzuwirken. In 334 Fällen nahmen<br />
die Gewerbeärztinnen und -ärzte<br />
an Revisionen durch die Gewerbeaufsichtsämter<br />
teil, und zwar vorzugsweise<br />
im Rahmen von Regelrevisionen<br />
(62%). In 38% erfolgten die Revisionen<br />
aus besonderem Anlass, wobei<br />
Arbeitsplatzbesichtigungen im Rahmen<br />
von Berufskrankheitenverfahren<br />
und Überprüfungen der betriebsärztlichen<br />
Betreuung die Schwerpunkte<br />
bildeten. Wie im Vorjahr wurden bei<br />
65% aller Revisionen Mängel festgestellt,<br />
an deren Spitze wiederum Defi-<br />
Medizinischer Arbeitsschutz<br />
Dr. med. Jürgen Otto, LAS Dessau<br />
schutz (12%) kennzeichnen zwei weitere<br />
Schwerpunkte. Auf Grund der vorgefundenen<br />
Mängel wurden in 180<br />
Fällen (83%) behördliche Maßnahmen<br />
vorgeschlagen. Dabei handelte es sich<br />
hauptsächlich um Revisionsschreiben,<br />
erstmalig mussten aber auch Anordnungen<br />
und Bußgeldverfahren vorgeschlagen<br />
werden.<br />
Als Folge der seit vielen Jahren bestehenden<br />
engen Zusammenarbeit werden<br />
Aufgaben des medizinischen Arbeitsschutzes<br />
immer häufiger auch von<br />
technischen Aufsichtsbeamtinnen und<br />
Aufsichtsbeamten mit wahrgenommen.<br />
So wurden beispielsweise im Rahmen<br />
aktion kontrollierte das GAA Halberstadt<br />
die Erfüllung von Arbeitgeberpflichten<br />
bei der thermischen Metallbearbeitung<br />
unlegierter und niedriglegierter<br />
Stähle in 46 Unternehmen,<br />
von denen 24% keinen Betriebsarzt<br />
bestellt und 44% die vorgeschriebenen<br />
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen<br />
nicht veranlasst hatten.<br />
Eine wichtige Informationsquelle für<br />
das Erkennen von arbeitsbedingten<br />
Gesundheitsgefahren stellt unverändert<br />
die gewerbeärztliche Mitwirkung<br />
im Berufskrankheitenverfahren dar. Im<br />
Vergleich zu den vorangegangenen<br />
Jahren sind dabei keine bedeutsa-<br />
Tabelle 2.1 Ausgewählte Berufskrankheiten 1992–<strong>2001</strong><br />
BK 2301 Lärmschwerhörigkeit<br />
BK 4201 Exogen allergische Alveolitis<br />
BK 4301 Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder<br />
das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können<br />
BK 4302 Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das<br />
Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können<br />
BK 5101 Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren<br />
oder sein können<br />
Jahr Abgeschlossene<br />
Fälle<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
<strong>2001</strong><br />
Arithm.<br />
Mittel<br />
374<br />
1.142<br />
2.285<br />
3.316<br />
3.036<br />
2.409<br />
1.812<br />
2.116<br />
2.193<br />
1.926<br />
2.061<br />
zite bei der Bestellung von Betriebsärztinnen<br />
bzw. -ärzten standen (24%).<br />
Daneben stellten fehlende oder unvollständigeGefährdungsbeurteilungen<br />
(20%) ein zunehmendes Problem<br />
dar. Mängel bei der Durchführung<br />
arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen<br />
(15%) und Defizite im Haut-<br />
Insgesamt Anteil an den<br />
abgeschlossenen<br />
Fällen<br />
212<br />
485<br />
492<br />
655<br />
975<br />
747<br />
596<br />
589<br />
538<br />
558<br />
585<br />
56,7%<br />
42,5%<br />
21,5%<br />
19,8%<br />
32,1%<br />
31,0%<br />
32,9%<br />
27,8%<br />
24,5%<br />
29,0%<br />
28,4%<br />
Berufskrankheiten<br />
davon davon davon<br />
BK 2301 Anteil BK 4201<br />
BK 4301<br />
BK 4302<br />
Anteil BK 5101 Anteil<br />
99<br />
155<br />
164<br />
287<br />
468<br />
333<br />
261<br />
239<br />
229<br />
248<br />
248<br />
46,7%<br />
31,9%<br />
33,3%<br />
43,8%<br />
48,0%<br />
44,6%<br />
43,8%<br />
40,6%<br />
42,6%<br />
44,4%<br />
42,4%<br />
der Schwerpunktaktion “Arbeitsschutz<br />
bei Lackierung und Farbgebung in der<br />
Metallbranche” des GAA Naumburg<br />
nicht durchgeführte arbeitsmedizinische<br />
Vorsorgeuntersuchungen und<br />
fehlende Hautschutzpläne als dominierende<br />
Mängel festgestellt. Ebenfalls<br />
im Rahmen einer Schwerpunkt-<br />
30<br />
65<br />
61<br />
63<br />
52<br />
28<br />
24<br />
27<br />
23<br />
26<br />
40<br />
14,1%<br />
13,4%<br />
12,4%<br />
9,6%<br />
5,3%<br />
3,7%<br />
4,0%<br />
4,6%<br />
4,3%<br />
4,7%<br />
6,8%<br />
4<br />
95<br />
75<br />
71<br />
170<br />
133<br />
89<br />
117<br />
110<br />
90<br />
99<br />
20,7%<br />
19,6%<br />
15,2%<br />
10,8%<br />
17,4%<br />
17,8%<br />
14,9%<br />
19,9%<br />
20,8%<br />
16,1%<br />
17,0%<br />
men Veränderungen eingetreten. Sowohl<br />
die Anzahl der abgeschlossenen<br />
Fälle als auch die der berufsbedingten<br />
Erkrankungen entsprechen weitgehend<br />
dem 10-Jahres-Durchschnitt.<br />
Das Gleiche gilt für die Häufigkeitsverteilung<br />
der wichtigsten Berufskrankheiten<br />
(vgl. Tabelle 2.1).
38 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Tab. 2.2 Berufsbedingte Erkrankungen 2000/<strong>2001</strong> in den wichtigsten Branchen<br />
Branche Anzahl % Hauptsächliche berufsbedingte Erkrankungen (Fallzahlen)<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Metall 300 25,4 Lärmschwerhörigkeit (182) Erkrankungen durch Asbest (36) Hauterkrankungen (23)<br />
Bau 158 13,4 Lärmschwerhörigkeit (109) Hauterkrankungen (14) Skeletterkrankungen (16)<br />
Chemie 103 8,7 Erkrankungen durch Asbest (55) Lärmschwerhörigkeit (19) Hauterkrankungen (13)<br />
Gesundheits-/<br />
Veterinärwesen 100 8,5 Hauterkrankungen (65) Infektionserkrankungen (29)<br />
Land/Forst 83 7,0 Lärmschwerhörigkeit (28) Allergische Atemwegserkrank.(27) von Tieren auf Menschen<br />
übertragbare Erkrankungen (11)<br />
Sonstige<br />
Dienstleistungen 53 4,5 Hauterkrankungen (28) Lärmschwerhörigkeit (11) Erkrankungen d. Asbest (10)<br />
Aus der gewerbeärztlichen Mitwirkung<br />
im Berufskrankheitengeschehen lassen<br />
sich wesentliche Erkenntnisse für<br />
das Handeln der Gewerbeaufsicht gewinnen.<br />
Voraussetzung dafür ist allerdings<br />
der Einsatz einer speziellen Software,<br />
wie wir sie seit einigen Jahren<br />
nutzen. Folgende Auswertungen seien<br />
beispielhaft aufgeführt:<br />
In jedem Quartal ermitteln wir die<br />
Bearbeitungszeit aller Vorgänge. Der<br />
entsprechende Durchschnittswert<br />
für das Jahr <strong>2001</strong> beträgt 35 Tage.<br />
Damit haben wir die vom Bundesversicherungsamt<br />
als zulässig angesehene<br />
gewerbeärztliche Äußerungsfrist<br />
von 6 Wochen eingehalten<br />
und zur sozialgesetzlich geforderten<br />
zügigen Durchführung des<br />
Verwaltungsverfahrens beigetragen.<br />
Halbjährlich erhalten alle Gewerbeaufsichtsämter<br />
eine bis auf das betroffene<br />
Unternehmen aufgeschlüsselte<br />
Übersicht der neu aufgetretenen<br />
berufsbedingten Erkrankungen<br />
und können somit unmittelbar über<br />
erforderliche Betriebsüberprüfungen<br />
entscheiden.<br />
Jährlich erfolgt eine epidemiologische<br />
Analyse der berufsbedingten<br />
Erkrankungen unter den Gesichtspunkten<br />
Größenklasse der Unternehmen,<br />
Branche, Tätigkeiten, Schadfaktoren,<br />
Expositionszeiten, Art der<br />
Erkrankung und Geschlechtsverteilung.<br />
Die Schlussfolgerungen<br />
hieraus werden im Rahmen des neuen<br />
Steuerungsmodells bei der Planung<br />
gewerbeaufsichtlicher Revisionen<br />
genutzt.<br />
In den beiden vergangenen Jahren<br />
traten 67,4% aller berufsbedingten Erkrankungen<br />
unseres Landes in nur 6<br />
Branchen auf. Diese Branchen sind in<br />
der Tabelle 2.2 nach der Häufigkeit<br />
berufsbedingter Erkrankungen geordnet.<br />
Spalte 2 enthält die absoluten<br />
Zahlen der berufsbedingten Erkrankungen<br />
in der jeweiligen Branche,<br />
Spalte 3 gibt den prozentualen Anteil<br />
an den berufsbedingten Erkrankungen<br />
des Landes an. Die Spalten 4 bis<br />
6 verdeutlichen die branchentypischen<br />
Schwerpunkte berufsbedingter Erkrankungen;<br />
ihr Anteil an den berufsbedingten<br />
Erkrankungen der Branche<br />
beträgt zusammen jeweils >80%.<br />
19% aller berufsbedingten Erkrankungen<br />
betrafen Frauen, deren Anteil an<br />
den Beschäftigten ca. 47% ausmacht.<br />
Männer verrichteten also insgesamt<br />
häufiger als Frauen gesundheitsgefährdende<br />
Tätigkeiten. Dabei standen<br />
die Gefährdung durch Lärm und (länger<br />
zurückliegend) durch Asbest im<br />
Vordergrund. 98% aller Lärmschwerhörigkeiten<br />
und 94% aller durch Asbest<br />
verursachten Erkrankungen traten<br />
deshalb auch bei Männern auf.<br />
Dagegen entfielen 68% der berufsbedingten<br />
Hauterkrankungen und 77%<br />
der berufsbedingten Infektionskrankheiten<br />
auf Frauen, was auf den hohen<br />
Frauenanteil im Friseurhandwerk und<br />
im Gesundheitswesen zurückzuführen<br />
ist.
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 39<br />
Arbeitsschutz-<br />
schwerpunkte<br />
im Land
40<br />
Von Betrieben, in denen mit großen Mengen<br />
gefährlicher Stoffe umgegangen<br />
wird, geht eine besondere Gefährdung<br />
sowohl für die Umgebung als auch für<br />
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
aus. Betriebsbereiche fallen in den<br />
Anwendungsbereich der Störfallverordnung,<br />
wenn die vorhandenen Mengen<br />
an gefährlichen Stoffen die im Anhang 1<br />
der Störfallverordnung aufgeführten Mengenschwellen<br />
überschreiten. Dies sind<br />
häufig Betriebe der chemischen und<br />
petrochemischen Industrie. Der Betreiber<br />
ist verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen,<br />
die Störfälle verhindern bzw. die damit<br />
möglicherweise verbundenen Auswirkungen<br />
begrenzen.<br />
Nach § 16 der Störfallverordnung haben<br />
die zuständigen Behörden ein Überwachungssystem<br />
einzurichten, auf dessen<br />
Grundlage durch regelmäßige und<br />
systematische Prüfungen zu kontrollieren<br />
ist, ob der Betreiber seinen Pflichten<br />
nach der Störfallverordnung nachkommt.<br />
Den zuständigen Behörden hat der<br />
Betreiber im Rahmen einer Vor-Ort-Inspektion<br />
nachzuweisen, dass<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Inspektionen nach § 16 Störfall-VO<br />
zum zum Arbeitssc Arbeitsschutz Arbeitssc Arbeitssc hutz und und zur zur tec technisc tec hnisc hnischen hnisc hen Sic Sicherheit Sic herheit<br />
Er Erste Er ste Er Ergebnisse<br />
Er ebnisse<br />
Dipl.-Ing. Martin Hartmann, GAA Dessau, und Dipl.-Ing. Jörg Przygodda, LAS Dessau<br />
er die erforderlichen spezifischen Maßnahmen<br />
zur Störfallverhinderung ergriffen<br />
hat,<br />
eine Begrenzung der Störfallauswirkungen<br />
innerhalb und außerhalb des<br />
Betriebsbereiches gewährleistet ist und<br />
die Anlagendokumentation die Gegebenheiten<br />
im Betriebsbereich wiedergibt.<br />
Anlass, Vorbereitung und Umfang der Inspektionen<br />
In Sachsen-Anhalt erfolgt der Vollzug<br />
der Störfallverordnung durch die für den<br />
Immissionsschutz (Staatliche Ämter für<br />
Umweltschutz [StAU], später den Regierungspräsidien<br />
zugeordnet) und Arbeitsschutz<br />
(GAA) zuständigen Ämter<br />
jeweils in ihrer originären Zuständigkeit.<br />
Für die Einrichtung des geforderten<br />
Überwachungssystems war eine Abstimmung<br />
dieser Behörden zur Gewährleistung<br />
einer effizienten Zusammenarbeit<br />
erforderlich. Dazu verfügten das Ministerium<br />
für Raumordnung, Landwirtschaft<br />
und Umwelt sowie das Ministerium für<br />
Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales<br />
entsprechende aufeinander abgestimmte<br />
Erlasse.<br />
Auf dieser Grundlage stimmten sich die<br />
StAU und GAA kooperativ über die<br />
Verfahrensweise der Vorbereitung und<br />
Durchführung der Inspektionen sowie<br />
über die spezifisch-fachlichen Inspektionsinhalte<br />
ab. Während die StAU<br />
schwerpunktmäßig eine Prüfung der Or-<br />
Festlegung und Abgrenzung der zu<br />
überprüfenden Anlagen<br />
Ermittlung von<br />
Gefährdungsschwerpunkten<br />
Überprüfung der Technik<br />
(technische Sicherheit)<br />
Bewertung des<br />
Sicherheitsmanagements<br />
ganisation und des Sicherheitsmanagementsystems<br />
des Betriebsbereiches vornahmen,<br />
wurde von den GAA hauptsächlich<br />
die technische Sicherheit der<br />
Anlagen und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen,<br />
die sich insbesondere aus<br />
den Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz<br />
(überwachungsbedürftige<br />
Anlagen), den Verordnungen zum Sprengstoffgesetz<br />
sowie der Arbeitsstättenverordnung,Arbeitsmittelbenutzungsverordnung,<br />
Gefahrstoffverordnung und PSA-<br />
Benutzerverordnung ergeben, kontrolliert.<br />
Als Arbeitshilfe wurde der im LAS erarbeitete<br />
Leitfaden für Anlagen- und Arbeitssicherheit<br />
mit dem neu erstellten Modul E7<br />
„Inspektion in störfallrelevanten Betriebsbereichen“<br />
empfohlen (vgl. Abb. 3.1).<br />
Im Ergebnis der Inspektionen wurden<br />
von den GAA Teilberichte angefertigt<br />
und den StAU zugesandt, die dort in<br />
den von den StAU für jeden Betriebsbereich<br />
zu erstellenden Gesamtbericht<br />
aufgenommen werden.<br />
<strong>2001</strong> wurden in 19 Betriebsbereichen<br />
(davon 17 im Aufsichtsbereich des GAA<br />
Dessau) Erstinspektionen durchgeführt.<br />
Festlegung von<br />
Prüfungsschwerpunkten<br />
Überprüfung der Betriebsorganisation<br />
(organisatorische Sicherheit)<br />
Erstellung eines Prüfberichtes<br />
Abb. 3.1 Ablaufplan einer Inspektion nach Modul E7 des Leitfadens Anlagen- und Arbeitssicherheit
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 41<br />
Für die Vor-Ort-Inspektion der technischen<br />
Systeme wurde ein Zeitaufwand –<br />
je nach Anlagengröße und -typ – von 8<br />
bis 16 Stunden geplant. Mit den Unternehmen<br />
wurden die Termine der Inspektionen<br />
abgestimmt. Der Anlagenbetreiber<br />
wurde schriftlich gebeten, entsprechende<br />
Unterlagen (Prüfakten, Nachweise,<br />
Gefährdungsbeurteilungen, Apparate-<br />
Anlagenidentität<br />
Es wurden die in den Antragsunterlagen<br />
enthaltenen Aufstellungspläne, Verfahrensfließbilder<br />
und Apparatelisten überprüft,<br />
ob der tatsächliche Anlagenbestand<br />
in den wesentlichen Bestandteilen<br />
mit diesen Unterlagen übereinstimmt.<br />
Nur bei einigen Anlagen gab es Abweichungen<br />
zwischen den Verfahrensfließbildern<br />
und dem Anlagenbestand.<br />
Oft stellte sich jedoch bei der Kontrolle<br />
heraus, dass die Verfahrensfließbilder<br />
fehlerhaft waren. Die aktuellen Verfahrensfließbilder<br />
wiesen häufig Mängel auf<br />
und entsprachen durch das Fehlen von<br />
Grundinformationen nicht annähernd der<br />
DIN 28004 “Fließbilder verfahrenstechnischer<br />
Anlagen”. In den Anlagendokumentationen<br />
gab es teilweise keine Übereinstimmung<br />
zwischen den Verfahrensfließbildern<br />
und den isometrischen Rohrleitungsdarstellungen.<br />
Abb. 3.2 Ausflussarmatur an einem Behälter mit heißem Medium<br />
verzeichnisse,Explosionsschutzkonzepte usw.) während der Inspektion zur Einsichtnahme<br />
bereitzuhalten.<br />
Verfahrensbeschreibung, Verfahrensfließbilder<br />
und RI-Fließbilder wurden vor<br />
der Inspektion eingesehen.<br />
An Hand dieser Dokumentationen wur-<br />
Ergebnisse der Inspektionen<br />
Sicherheitstechnisch<br />
bedeutsame Anlagenteile<br />
Bei den Anlagen, für die eine Sicherheitsanalyse<br />
erstellt wurde, lag eine Liste<br />
vor, in der die sicherheitstechnisch<br />
bedeutsamen Anlagenteile beschrieben<br />
sind. Betreiber von Anlagen ohne<br />
Sicherheitsanalyse oder Sicherheitsbericht<br />
besaßen diese Auflistung nicht.<br />
Es wurde auf den sich in Arbeit befindlichen<br />
Sicherheitsbericht verwiesen, welcher<br />
bis Februar 2002 zu erstellen ist.<br />
Wiederkehrende Prüfungen<br />
Für die vom Anlagenbetreiber durchzuführenden<br />
wiederkehrenden Prüfungen<br />
wurden die Prüfprotokolle eingesehen.<br />
Kontrolliert wurde insbesondere die Prüfung<br />
ausgewählter Rohrleitungen,<br />
ausgewählter Druckbehälter,<br />
Abb. 3.3 Ausflussarmatur an einer Gasleitung<br />
de der Inspektionsumfang auf bestimmte<br />
Ausrüstungen und Anlagenteile festgelegt.<br />
Nach der Einsichtnahme in die Dokumentation<br />
und den damit verbundenen<br />
Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern<br />
des Unternehmens wurde eine<br />
Anlagenbesichtigung durchgeführt.<br />
der Dampfkesselanlage,<br />
von Lagern für brennbare Flüssigkeiten,<br />
der ortsveränderlichen elektrischen<br />
Geräte,<br />
der ortsfesten elektrischen Anlage,<br />
der Blitzschutzanlage und<br />
der sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer-<br />
und Regeleinrichtungen (MSR-Einrichtungen).<br />
An diesen Einrichtungen konnten von<br />
den Sachverständigen der Technischen<br />
Überwachung bzw. Sachkundigen laut<br />
vorgelegter Prüfprotokolle keine wesentlichen<br />
Defizite festgestellt werden. Geringfügige,<br />
in den Protokollen vermerkte<br />
Mängel wurden vom Anlagenbetreiber<br />
sofort beseitigt. Als Nachweis hierfür<br />
lagen Mängelbeseitigungsprotokolle vor.
42<br />
Technische Dichtheit<br />
Die technische Dichtheit der Anlagen<br />
musste visuell während der Anlagenbesichtigung<br />
eingeschätzt werden. Alle<br />
stichprobenweise überprüften, unter die<br />
Druckbehälterverordnung fallenden Rohrleitungen<br />
und Behälter wiesen, entsprechend<br />
der Prüfprotokolle der Sachverständigen,<br />
keine Mängel auf.<br />
Bei der Anlagenbesichtigung wurden<br />
jedoch vereinzelt folgende Defizite festgestellt:<br />
Undichtheiten vorrangig an den zu<br />
den Ausrüstungen gehörenden Armaturen.<br />
Viele Ausflussarmaturen von<br />
gefahrstoffführenden Ausrüstungen<br />
und Rohrleitungen wurden nicht durch<br />
einen Blindverschluss gesichert. Hier<br />
besteht die ernsthafte Gefahr einer<br />
Verletzung durch austretende Medien<br />
durch Undichtheit oder unbeabsichtigtes<br />
Öffnen dieser Armaturen.<br />
(s. Abb. 3.2 und 3.3)<br />
An einigen unter Betriebsdruck stehenden<br />
Rohrleitungen wurden Schlauch-<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
leitungen angeschlossen, welche nicht<br />
durch eine Schlauchschelle gesichert<br />
wurden (Abb. 3.4).<br />
Am Ende eines Füllschlauches für<br />
Natronlauge fehlte die Absperrarmatur,<br />
so dass der Inhalt nach dem Absperren<br />
der Armatur an der Rohrleitung<br />
unkontrolliert leer laufen kann<br />
(Abb. 3.5).<br />
Fehlender Spritzschutz an Flanschverbindungen<br />
mit Flachdichtung.<br />
Abb. 3.4 Kondensatabfluss an einem Doppelmantel-Behälter Abb. 3.5 Schlauchleitung zum Abfüllen von Natronlauge<br />
Rohrleitungen und<br />
Armaturen<br />
Für die meisten Anlagen liegt ein konkreter<br />
Prüfplan für das gesamte Rohrleitungssystem<br />
vor. In einigen wenigen<br />
Unternehmen wurden erst ca. 70% der<br />
gefahrstoffführenden Rohrleitungen ent-<br />
sprechend § 30a DruckbehV geprüft. Im<br />
Allgemeinen befinden sich die Rohrleitungssysteme<br />
und Armaturen in einem<br />
guten Zustand, wobei jedoch vereinzelt<br />
erhebliche Mängel festgestellt wurden:<br />
Durch Undichtheiten verkrustete Ar-<br />
Abb. 3.6 Verkrustete Armatur Abb. 3.7 Lose Rohrbefestigung<br />
maturen-Funktionsweise ist in Frage<br />
zu stellen (Abb. 3.6)<br />
Lose Rohrbefestigungen (Abb. 3.7)<br />
Durchgerostete Rohrleitung (Einzelfall)
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 43<br />
Explosions- und<br />
Brandschutz<br />
Ein Explosionsschutzkonzept bzw. ein<br />
Explosionsschutzdokument lag in den<br />
meisten Unternehmen vor. Die Qualität<br />
dieser Dokumente war jedoch sehr unterschiedlich.<br />
Die explosionstechnischen Kenngrößen<br />
der relevanten Stoffe lagen in allen Unternehmen<br />
vor. Pläne mit den eingestuften<br />
explosionsgefährdeten Bereichen<br />
konnten ebenfalls für alle Anlagen<br />
vorgelegt werden. Diese entsprachen<br />
aber nicht immer den hierzu erlassenen<br />
Rechtsvorschriften und Regeln.<br />
Defizite:<br />
Eine Abgasleitung für Wasserstoff<br />
wurde direkt auf eine Lampe gerichtet,<br />
welche nur für die Verwendung im<br />
explosionsgefährdeten Bereich Zone<br />
2 geeignet ist. Da die Wasserstoffableitung<br />
(100%-iger H 2 ) kontinuierlich<br />
erfolgt, ist hier der Bereich in die Zone<br />
0 einzustufen.<br />
In einem Rührbehälter wurde die<br />
Inertisierung manuell ohne Überwachung<br />
der Sauerstoffkonzentration<br />
durchgeführt (kein sicherer primärer<br />
Explosionsschutz).<br />
Keine Temperaturüberwachung an<br />
Wellendurchführungen von Rührmaschinen<br />
im Ex-Bereich (Zündquelle)<br />
Von den Anlagenbetreibern wurde sofort<br />
veranlasst, dass die während der Inspektion<br />
erkannten Mängel umgehend<br />
beseitigt wurden. Behördliche Anordnungen<br />
machten sich aus diesem Grund<br />
nicht erforderlich.<br />
Kein Nachweis der erforderlichen<br />
Druckentlastungsfläche der Berstscheibe<br />
eines Behälters<br />
Keine explosionstechnische Entkopplung<br />
zu anderen Anlagenteilen<br />
Mess-, Steuer- und Regel-<br />
Einrichtungen (MSR),<br />
Prozessleitsysteme<br />
Ein Schwerpunkt der Inspektion war die<br />
Prüfung der sicherheitsbedeutsamen<br />
MSR-Einrichtungen und der Prozessleitsysteme.<br />
Bei der Prüfung wurden u. a.<br />
folgende Schwerpunkte berücksichtigt:<br />
Klassifizierung der MSR-Einrichtung (in<br />
Betriebs-, Überwachungs-, Schutz- und<br />
Schadensbegrenzungseinrichtungen)<br />
Einstufung der MSR-Schutzeinrichtungen<br />
in Anforderungsklassen/Risikobereiche<br />
Kennzeichnung von MSR-Schutzeinrichtungen<br />
vor Ort, in Messwarten und<br />
in Fließbildern<br />
Zuverlässigkeit der Energieversorgung<br />
der MSR-Einrichtungen<br />
Regelmäßige Funktionsprüfung ➠<br />
Prüfprotokolle)<br />
Die meisten Anlagen werden über<br />
speicherprogrammierbare Steuerungssysteme<br />
gefahren. Hierfür lagen generell<br />
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen<br />
Im Allgemeinen befanden sich die überprüften<br />
Anlagen in einem guten und<br />
sicheren Zustand. Durch eine gute Organisation<br />
des Sicherheitsmanagements<br />
in den Unternehmen entsprechen<br />
die Anlagen dem Stand der Sicherheitstechnik.<br />
Klassifizierungen der MSR-Einrichtungen<br />
vor. Konkrete Dokumente zur Einstufung<br />
der Schutzeinrichtungen in Anforderungsklassen<br />
entsprechend der VDI/VDE<br />
2180 konnten jedoch in vielen Fällen<br />
nicht vorgelegt werden.<br />
Die Kennzeichnung der Schutzeinrichtungen<br />
vor Ort, in der Messwarte und in<br />
den Fließbildern entsprechend der NA-<br />
MUR-Richtlinie NE 31 erfolgte auch nur<br />
bei ca. 50% der überprüften Anlagen.<br />
Durch die vorhandenen speicherprogrammierbaren<br />
Steuerungen werden<br />
Fehlbedienungen durch das Personal<br />
ausgeschlossen.<br />
Die kontrollierten MSR-Einrichtungen<br />
besaßen alle eine vom Stromnetz unabhängige,<br />
batteriegepufferte Stromversorgung,<br />
die es über einen gewissen<br />
Zeitraum ermöglicht, deren Funktion aufrecht<br />
zu erhalten.<br />
Des Weiteren waren die sicherheitsgerichteten<br />
Armaturen so konzipiert,<br />
dass sie bei Ausfall von Energien und<br />
Hilfsmedien in einen sicheren Zustand<br />
fahren.<br />
80% der Unternehmen konnten einen<br />
konkreten Prüfplan sowie die Protokolle<br />
der wiederkehrenden Prüfungen vorlegen.<br />
Gravierende Mängel wurden bei<br />
diesen turnusmäßigen Prüfungen nicht<br />
festgestellt.<br />
Für das für jeden Betriebsbereich entsprechend<br />
der Störfallverordnung zu<br />
erstellende Überwachungsprogramm<br />
wird aus technischer Sicht ein Inspektionsintervall<br />
durch die zuständigen Behörden<br />
von 3 Jahren vorgeschlagen.
44<br />
Bei Imbissverkaufsständen setzen die<br />
Betreiber häufig statt auf Sicherheit auf<br />
Kostenminimierung. Diese Tatsache war<br />
Anlass des Überprüfens stationärer und<br />
mobiler Imbissverkaufsstände durch das<br />
GAA Halle in den Jahren 2000 und <strong>2001</strong>.<br />
Es ging insbesondere um die technische<br />
Sicherheit der sich in den Verkaufsständen<br />
befindlichen Flüssiggas-, Getränkeschank-<br />
und Elektroanlagen.<br />
Von den insgesamt 265 kontrollierten<br />
Anlagen in 144 Imbissverkaufsständen<br />
waren nur 14% mängelfrei. Von den überprüften<br />
Flüssiggasanlagen einschließlich<br />
Verbrauchsgeräten (Back-, Koch-, Brateinrichtungen)<br />
waren von 120 Anlagen<br />
nur 6% ohne Mängel, d.h., nur jede 15.<br />
Anlage entsprach den gesetzlichen Anforderungen.<br />
Von den elektrischen Anlagen<br />
waren von 82 überprüften 36,5%<br />
ohne Mängel (Abb. 3.8).<br />
Von 43 überprüften Getränkeschankanlagen<br />
waren 39,5% nicht regelmäßig<br />
geprüft, sonst wurden keine Mängel festgestellt.<br />
Eine Auflistung der einzelnen Mängelfeststellungen<br />
zeigt, dass bestimmte<br />
Unzulänglichkeiten wie<br />
defekte bzw. nicht vorhandene Sicherheitseinrichtungen<br />
an der Gaszuführung<br />
fehlender bzw. unvollständiger Berührungsschutz<br />
an stromführenden Anlagenteilen<br />
Sicherheitscheck an Imbissständen<br />
Dipl.-Ing. Dieter Kilz, GAA Halle<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
7<br />
113<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
35<br />
47<br />
37<br />
228<br />
Flüssiggasanlagen elektr. Anlagen gesamt<br />
Abb. 3.8 Übersicht über den Anteil mängelbehafteter Anlagen<br />
eine unmittelbare Gefährdungsmöglichkeit<br />
für das Imbisspersonal selbst als<br />
auch den Kunden darstellen. In der Vergangenheit eingetretene Brände<br />
und Havarien an solchen Imbissständen,<br />
über welche auch in der Presse<br />
berichtet wurde, belegen diese Feststellung<br />
von der praktischen Auswirkung her.<br />
Die Abb. 3.9 bis 3.12 zeigen eine kleine<br />
Auswahl von Mängeln.<br />
In insgesamt 19 Fällen mussten Anlagen<br />
ohne Mängel<br />
mit Mängeln<br />
Abb. 3.9 Liegende Gasflasche, keine Schlauchbruchsicherung in unmittelbarer Nähe der Elektro-<br />
Verteilung, Wagen ohne Entlüftungsöffnung<br />
im Ergebnis der Überprüfung sofort<br />
stillgelegt werden.<br />
Weitere Mängelschwerpunkte sind die<br />
nicht realisierten Sachkundigenprüfungen,<br />
welche vor Inbetriebnahme und<br />
in regelmäßigen Abständen durchgeführt<br />
werden müssen. Diese von den<br />
Betreibern der Imbissstände nicht ver-
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 45<br />
Tabelle 3.01Analyse der einzelnen Mängelfeststellungen<br />
Mängel Anzahl<br />
Flüssiggasanlagen<br />
insgesamt 113 Anlagen mit Mängeln<br />
innen kein Flaschenschrank 68<br />
keine Lüftung in Bodennähe<br />
keine vorschriftsmäßige Verlegung<br />
47<br />
von Zuführungsleitungen<br />
unzureichende Standsicherheit<br />
42<br />
der Gasflaschen 44<br />
fehlende Schlauchsicherungen 30<br />
kein Schutz gegen Zugriff Dritter 31<br />
fehlende Zündsicherungen 22<br />
fehlender Schutzbereich 11<br />
defekte Bedien- und Sicherheitsschalter 10<br />
keine Kennzeichnung<br />
fehlende Sachkundeprüfung vor<br />
Inbetriebnahme und für regelmäßige<br />
14<br />
Prüfungen 144<br />
fehlende Betriebsanweisungen 82<br />
Gesamt 545<br />
Elektrische Anlagen<br />
insgesamt 46 Anlagen mit Mängeln<br />
Anschlussmängel der elektrischen<br />
Einspeisung 33<br />
freiliegende stromführende Teile 20<br />
kein Knick- und Scheuerstellenschutz 24<br />
nur 2-poliger Anschluss bei Schutzkontaktsteckdosen<br />
19<br />
nicht ordnungsgemäße Klemmvorrichtung 17<br />
Nichtdurchführung einer Sachkundigenprüfung<br />
vor Inbetriebnahme bzw.<br />
regelmäßige Prüfung 60<br />
Gesamt 173<br />
Abb. 3.11Installationschaos einer elektrotechnischen Anlage mit freiliegenden stromführenden<br />
Anlagenteilen<br />
anlassten Prüfungen trugen in den kontrollierten<br />
Einrichtungen wesentlich dazu<br />
bei, dass die Mängel über längere Zeiträume<br />
bestehen konnten. Man hatte sich<br />
an diese Unzulänglichkeiten “gewöhnt”,<br />
d.h., diese Mängel wurden in vielen Fällen<br />
gar nicht mehr als solche wahrgenommen.<br />
Tabelle 3.01 gibt eine Übersicht<br />
der Mängel bei Flüssiggas- und<br />
elektrischen Anlagen.<br />
Jeder Betreiber eines solchen Imbissstandes<br />
hat jedoch in Bezug auf die<br />
installierten Flüssiggas- und Elektroanlagen<br />
genau wie in jedem anderen gewerblichen<br />
Unternehmen gesetzlich festgelegte<br />
Anforderungen zu beachten.<br />
Dies gilt unabhängig von der Tatsache,<br />
ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
beschäftigt werden oder nicht.<br />
Abb. 3.10 Abluft-/Ablauföffnung unmittelbar über Gully (Explosionsgefahr bei Gasansammlung)<br />
Abb. 3.12 Stark beschädigtes und notdürftig<br />
“geflicktes” Elektrokabel<br />
Als Ursache für den vorgefundenen unbefriedigenden<br />
Zustand sind die Unkenntnis<br />
der Betreiber über die gesetzlichen<br />
Anforderungen sowie das Fehlen<br />
von Betriebsanweisungen bzw. Bedienanleitungen<br />
für das bestimmungsgemäße<br />
Betreiben dieser Anlagen anzuführen.<br />
Die hohe Zahl von 723 festgestellten<br />
Mängeln bei der durchgeführten Kontrolle<br />
zeigt eindeutig, dass die Überprüfung<br />
notwendig war. Die im Ergebnis<br />
eingeleiteten Maßnahmen zur Abstellung<br />
der Mängel haben die Betriebssicherheit<br />
der Imbissstände erhöht,<br />
wodurch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts<br />
von Unfällen und Bränden minimiert<br />
werden konnte.<br />
Die Ausstrahlung auf andere nicht überprüfte<br />
Einrichtungen über den sogenannten<br />
“Buschfunk” ist ein feststellbarer<br />
positiver Nebeneffekt, der gegen<br />
Ende der Überprüfungsaktion immer<br />
deutlicher wurde. Zusätzlich wurden die<br />
Mängel in weiteren Filialverkaufsständen<br />
von Imbissverkaufsketten, obwohl diese<br />
nicht kontrolliert wurden und sich<br />
zum Teil außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches<br />
befinden, beseitigt.
46<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Erhöhung des Schutzniveaus einer Sommerrodelbahn<br />
für Tausende Fahrgäste<br />
Am 1. August 2000 ereignete sich auf<br />
einer Sommerrodelbahnanlage (siehe<br />
auch Abb. 3.13) im Aufsichtsbereich<br />
des GAA Halle ein tragischer Unfall.<br />
Eine 58-jährige Frau fuhr in der Zieleinfahrt<br />
der Rodelbahn auf einen vor ihr<br />
fahrenden Schlitten – welcher schon<br />
fast zum Stehen gekommen war – mit<br />
einer Geschwindigkeit von ca. 30–40<br />
km/h auf. Durch den Aufprall wurde die<br />
Frau nach vorn geschleudert. Der angelegte<br />
Beckengurt schnürte den Bauchbereich<br />
sehr stark ein. Die dabei erlittenen<br />
inneren Verletzungen führten wenig<br />
später zum Tode.<br />
Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei<br />
baten das GAA um Mithilfe bei der Feststellung<br />
der Unfallursachen. Nachdem<br />
diesem dabei weitere Unfälle mit z. T.<br />
schwerwiegenden Verletzungsfolgen<br />
auf dieser Anlage bekannt wurden, war<br />
dringender Handlungsbedarf gegeben.<br />
Die Errichtung der baulichen Anlagenteile<br />
(Schlittenbahnen, Start- und Zielanlage,<br />
erforderliche Gebäude u. a.)<br />
wurde und wird durch die zuständige<br />
Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage<br />
baurechtlicher Bestimmungen genehmigt<br />
und überwacht. Die Bewertung<br />
der sicherheitstechnisch relevanten<br />
Anforderungen (Bremsverzögerung,<br />
maximale Geschwindigkeit, Kurvenradien,<br />
Steuerteile etc.) erfolgt durch<br />
eine Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme<br />
durch eine benannte Prüfstelle<br />
(hier TÜV) und wird auf der Grundlage<br />
zutreffender nationaler Standards zertifiziert<br />
(freiwillige Veranlassung durch<br />
den Hersteller).<br />
Die auf der Bahnanlage eingesetzten<br />
Rodelschlitten selbst wurden als Freizeitgeräte<br />
im Sinne des Gerätesicherheitsgesetzes<br />
– GSG – (§ 2 Abs. 2 Ziff. 4)<br />
betrachtet. Für die Überwachung ist<br />
danach die am Sitz des Inverkehrbringers<br />
dieser Geräte bestimmte Behörde<br />
zuständig.<br />
Dipl.-Ing. Dieter Kilz, GAA Halle<br />
In Abstimmung mit der für den Hersteller<br />
örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde<br />
und wegen des großen Eigeninteresses<br />
des Herstellers selbst, die Untersuchungen<br />
am Ereignisort zu unterstützen,<br />
wurden die Untersuchungen durch das<br />
Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Halle<br />
weitergeführt.<br />
Im Ergebnis lassen sich Unfallursachen<br />
und begünstigende Faktoren zusammenfassend<br />
so darstellen:<br />
1.Die Möglichkeit des Auffahrens der<br />
einzelnen Rodelschlitten ist wegen<br />
der individuellen Steuerung der Geschwindigkeit<br />
der Schlitten durch die<br />
Fahrgäste grundsätzlich gegeben.<br />
Eine zwangsweise Abstandshaltung<br />
ist wegen des „sportlichen“ Charakters<br />
der Anlage absichtlich nicht gewollt<br />
und auch nicht vorgesehen.<br />
Somit konzentrierten sich die durchzuführenden<br />
Untersuchungen auf die<br />
Minderung bzw. Vermeidung der durch<br />
das Auffahren möglichen Gesundheitsschäden.<br />
Abb. 3.13 ”alte“ Schlittenausführung (zum Zeitpunkt des Unfalles)<br />
2.Die Verletzungsgefahr bei Auffahrunfällen<br />
ist im auffahrenden Schlitten<br />
anders zu bewerten als im vorausfahrenden<br />
Schlitten, auf den aufgefahren<br />
wird.<br />
2.1 Beim auffahrenden Schlitten wird<br />
(bzw. werden bei Zweierbenutzung)<br />
der Fahrgast in Fahrtrichtung nach<br />
vorn geschleudert. Nur die aufgestemmten<br />
Füße und vor allem der<br />
vorhandene und angelegte Beckengurt<br />
halten diese nicht vermeidbare<br />
Bewegung auf.<br />
Dabei kann es (wie beim beschriebenen<br />
Unfallgeschehen) zu tiefen Einschnürungen<br />
im Bauchbereich mit entsprechender<br />
Verletzungsgefahr kommen<br />
(vergl. Abb. 3.13 – altes Modell).<br />
2.2 Für den hinten sitzenden Fahrgast<br />
des Schlittens, auf welchen aufgefahren<br />
wird, besteht die Gefahr einer<br />
Überdehnung und Prellung der Wirbelsäule.<br />
Der Rücken kann wegen fehlender<br />
Rückenlehne nicht abgestützt und die
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 47<br />
Abb. 3.14 Testversuche auf Prüfstrecke<br />
Wirbelsäule kann oberhalb der Sitzmuldenkante<br />
nach hinten überdehnt<br />
werden. Dies wurde bei früher eingetretenen<br />
Auffahrunfällen durch notwendig<br />
gewordene ärztliche Behandlungen<br />
bestätigt.<br />
3. Alle weiteren Einflussfaktoren, wie Wirksamkeit<br />
der Bremsen, die Gewährleistung<br />
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit<br />
von 40 km/h, der Abstand der<br />
Rodelschlitten beim Start, die Sichtverhältnisse<br />
auf der Bahnanlage u. a.<br />
wurden ebenfalls bewertet.<br />
Sie sind jedoch feststehende Anlagenparameter,<br />
deren Einhaltung durch<br />
die Abnahmeprüfung überwacht wird.<br />
Somit konzentrierte sich die Einflussnahme<br />
vorwiegend auf die unter Punkt 2<br />
aufgeführten Risikofaktoren. Da eine vergleichbare<br />
Gefahrensituation wie bei<br />
Auffahrunfällen im Straßenverkehr besteht,<br />
wurde versucht, die dort gefundenen<br />
Lösungen zu übertragen. Eine auf<br />
Empfehlung des GAA eingerichtete aufwändige<br />
Teststrecke bei einer benannten<br />
Prüfstelle für das Kraftfahrzeugwesen<br />
(Abb. 3.14) führte im Ergebnis zu den<br />
jetzt realisierten technischen Veränderungen<br />
(Abb. 3.15 und 3.16).<br />
Der Beckengurt wurde durch einen 3-<br />
Punkt-Gurt ersetzt. Damit zwangsläufig<br />
verbunden war die Anbringung einer<br />
Rückenlehne bis Kopfhöhe. Weiterhin<br />
wurde die Fußabstützung durch Anbringen<br />
von Aluminiumrasten wesentlich<br />
verbessert.<br />
Die Produktion der neuen Schlittenmodelle<br />
wurde durch den Hersteller unverzüglich<br />
veranlasst und diese in neu<br />
zu errichtenden Anlagen eingesetzt.<br />
Über die Möglichkeit der Nachrüstung<br />
Abb. 3.16 Neu konstruierter Schlitten<br />
Abb. 3.15 Neuer Rodelschlitten auf Bahnanlage<br />
bestehender Anlagen wurden alle<br />
Betreiber durch ausführliche und überzeugende<br />
Informationsschreiben des<br />
Herstellers unterrichtet. Eine Nach- bzw.<br />
Umrüstung ist je nach Auftragsvolumen<br />
relativ kurzfristig möglich. Der Hersteller<br />
lobt, wie sich in diesem Fall durch die<br />
Zusammenarbeit mit dem GAA, der benannten<br />
Stelle, dem Betreiber und dem<br />
Hersteller selbst bemerkenswerte Ergebnisse<br />
für die Erhöhung des Schutzniveaus<br />
erzielen ließen.
48<br />
Aufgabenstellung<br />
Flurförderzeuge, insbesondere Gabelstapler,<br />
erleichtern Transport- und Umschlagarbeiten<br />
erheblich. Sie sind daher<br />
weit verbreitet im Einsatz.<br />
Von Gabelstaplern können aber auch<br />
beträchtliche Gefahren ausgehen, wenn<br />
sicherheitstechnische Voraussetzungen<br />
und/oder betriebsorganisatorische Vorschriften<br />
nicht gegeben sind bzw. missachtet<br />
werden. Mängel im Umgang mit<br />
Gabelstaplern beim innerbetrieblichen<br />
Transport waren in der Vergangenheit<br />
häufig Ursache für schwere Unfälle.<br />
Entsprechend der vorgefundenen Situation<br />
sollte durch Kontrolle und Beratung<br />
auf den betreffenden Betrieb Einfluss<br />
genommen werden, mit dem Ziel,<br />
Gefahren für Fahrer und Dritte beim<br />
Einsatz von Gabelstaplern im innerbetrieblichen<br />
Transport zu minimieren.<br />
Durchführung<br />
Zur Überprüfung der Durchsetzung der<br />
Unternehmerpflichten hinsichtlich der<br />
betriebstechnischen Voraussetzungen,<br />
der technischen Sicherheit und der Organisation<br />
des innerbetrieblichen Einsatzes<br />
von Gabelstaplern wurden in 38<br />
Betrieben in den Aufsichtsbereichen der<br />
GAA Magdeburg und Stendal Stichprobenkontrollen<br />
durchgeführt.<br />
Um einen Überblick über die Gesamtsituation<br />
zu bekommen, wurde die<br />
Schwerpunktkontrolle über Betriebe<br />
verschiedenster Branchen gefächert.<br />
Betroffen waren insbesondere die Branchen<br />
Bau, Metall, Holz, Energie und<br />
Handel.<br />
Mittels einheitlich gestalteter Checklisten<br />
erfolgten Überprüfungen an insgesamt<br />
176 Gabelstaplern.<br />
Gabelstapler beim Umschlag und<br />
innerbetrieblichen Transport<br />
Dipl.-Phys. Jens Döhler, GAA Stendal<br />
Auswertung<br />
Die in die Schwerpunktkontrolle einbezogenen<br />
38 Betriebe gehören 13 verschiedenen<br />
Wirtschaftsklassen aus 7<br />
Branchen an (Abb. 3.17).<br />
Von den überprüften 176 Staplern waren<br />
81 mit Elektroenergie, 22 mit Flüssiggas<br />
und 85 mit Dieselkraftstoff angetrieben.<br />
Handel<br />
8<br />
Abb. 3.17 Überprüfte Betriebe nach Branchen<br />
Bei der Auswertung der festgestellten<br />
Mängel und Unzulänglichkeiten gab es<br />
hinsichtlich der technischen Bedingungen<br />
keine wesentlichen branchenbezogenen<br />
Unterschiede. Bei den<br />
personenbezogenen Voraussetzungen<br />
sowie bei der Organisation des innerbetrieblichen<br />
Transports waren insbesondere<br />
im Bereich Handel überdurchschnittlich<br />
viele Mängel zu verzeichnen.<br />
Die 176 in die Aktion einbezogenen<br />
Stapler gehören verschiedensten Typen<br />
an und wurden von insgesamt 24<br />
verschiedenen Herstellern in den Baujahren<br />
von 1987 bis <strong>2001</strong> gefertigt.<br />
96 (55%) der überprüften Stapler sind<br />
nach 1995 hergestellt bzw. in Verkehr<br />
gebracht worden. Das CE-Zeichen war<br />
bei allen angebracht, die notwendige<br />
Konformitätserklärung jedoch nur bei<br />
88 (92%) vorhanden. Die Betriebsanleitungen<br />
lagen vor.<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Dienstleistungen<br />
4<br />
Metall<br />
2<br />
Betriebsorganisatorische<br />
Voraussetzungen<br />
Die Gefährdungsbeurteilung entsprechend<br />
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes<br />
stellt eine gute Voraussetzung für den<br />
präventiven Arbeitsschutz dar. Die spezifischen<br />
Gefährdungen und besonderen<br />
Maßnahmen beim Transport mit Gabelstaplern<br />
müssen sich auch in der<br />
Energie<br />
2<br />
Bau<br />
Leichtindustrie<br />
5<br />
14<br />
Holz<br />
3<br />
Dokumentation niederschlagen. Gefährdungsbeurteilungen<br />
fehlten jedoch in 8<br />
und Betriebsanweisungen in 11 der aufgesuchten<br />
Betriebe (Abb. 3.18).<br />
Die größten Defizite ergaben sich hinsichtlich<br />
der betrieblichen Organisation<br />
des arbeitsschutzgerechten Transportes.<br />
Bei 21% der aufgesuchten Betriebe<br />
fehlte die Gefährdungsbeurteilung, bei<br />
29% die notwendige Betriebsanweisung<br />
und in 9% der überprüften Betriebe waren<br />
die Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer<br />
nicht regelmäßig unterwiesen<br />
worden.<br />
Mängel waren aber auch hinsichtlich der<br />
Beauftragung zum Führen der Stapler sowie<br />
bei der Gestaltung der innerbetrieblichen<br />
Transportwege zu verzeichnen.
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 49<br />
Nach § 7 der BGV D 27 “Flurförderzeuge”<br />
darf der Unternehmer nur solche<br />
Personen mit dem Steuern von Flurförderzeugen<br />
beauftragen, die mindestens<br />
18 Jahre alt, für die Tätigkeit geeignet<br />
und ausgebildet sind sowie ihre<br />
Befähigung nachgewiesen haben. Der<br />
Auftrag ist vom Unternehmer schriftlich<br />
zu erteilen. Das Ergebnis der diesbezüglichen<br />
Befragungen zeigt Tabelle<br />
3.2.<br />
Defizite waren vor allem in Handelsbetrieben<br />
zu verzeichnen. Aufgrund diskontinuierlicher<br />
Entlade- und Lagerungsvorgänge<br />
sowie der Personalsituation<br />
werden oft die gerade verfügbaren Personen<br />
eingesetzt, ohne darauf zu achten,<br />
ob die Voraussetzungen nach Ausbildung<br />
und Befähigung für das Führen<br />
von Gabelstaplern gegeben sind.<br />
Tabelle 3.2 Persönliche Voraussetzungen des<br />
Fahrers (Gesamt 176 Fahrer)<br />
Erfüllung der persönlichen<br />
Voraussetzungen Anzahl Anteil<br />
mindestens 18 Jahre alt 176 100%<br />
für die Tätigkeit ausgebildet 171 97%<br />
Befähigungsnachweis vorhanden 168 95%<br />
Beauftragung schriftlich<br />
erteilt bekommen 170 97%<br />
Sicherheitstechnische<br />
Voraussetzungen<br />
Fahrerrückhaltesysteme bildeten einen<br />
Schwerpunkt der Kontrolle.<br />
Entsprechend Anhang I der Maschinenrichtlinie<br />
wird vom Hersteller gefordert,<br />
die Maschinen so zu konzipieren und zu<br />
bauen, dass sie unter den vorgesehenen<br />
Betriebsbedingungen ausreichend<br />
stabil sind und benutzt werden können,<br />
ohne dass die Gefahr eines unbeabsichtigten<br />
Umstürzens besteht. Die Maßnahmen<br />
müssen darauf abzielen, Unfallrisiken<br />
selbst in den Fällen auszuschließen,<br />
in denen sich die Unfallrisiken aus<br />
vorhersehbaren ungewöhnlichen Situationen<br />
ergeben.<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
38<br />
30 29<br />
Abb. 3.18 Betriebliche Voraussetzungen (38 Betriebe)<br />
Abb. 3.19 Gabelstapler ohne Fahrerrückhalteeinrichtung<br />
38<br />
Gefährdungsbeurteilungen Betriebsanweisungen Belehrungen<br />
Soll Ist dokumentiert bzw. fristgemäß<br />
Aber auch für Betreiber nicht nach<br />
Maschinenrichtlinie in Verkehr gebrachter<br />
Gabelstapler besteht entsprechend<br />
der Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie die<br />
Pflicht, das Unfallrisiko beim Kippen eines<br />
Staplers mit geeigneten Maßnahmen<br />
zu begrenzen. Abb. 3.19 zeigt einen<br />
Gabelstapler, der z. Z. noch ohne<br />
jegliche Rückhalteeinrichtung im Einsatz<br />
ist.<br />
Auch hinsichtlich weiterer technischer<br />
Ausstattung für die jeweiligen Einsatzbedingungen<br />
mussten Mängel festgestellt<br />
werden (Abb. 3.20).<br />
Der Schutz gegen herabfallende Teile<br />
ist im Wesentlichen gewährleistet. Nicht<br />
zufriedenstellen kann die Ausrüstung<br />
27<br />
22<br />
38<br />
35<br />
34<br />
der überprüften Stapler mit Fahrerrückhaltesystemen.<br />
Von den überprüften<br />
176 Staplern waren nur 45% mit<br />
derartigen Sicherheitssystemen versehen.<br />
Jedoch sicherten die Unternehmen zu,<br />
bis zum Ablauf der sich aus der Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinieergebenden<br />
Übergangsfrist im Dezember 2002<br />
die Stapler entsprechend nachzurüsten.<br />
Bei den 79 mit Fahrerrückhaltesystemen<br />
angetroffenen Staplern waren 2 mit<br />
Sicherungsbügeln, 33 mit einer geschlossenen<br />
Fahrerkabine und 44 mit<br />
Sicherheitsgurt ausgestattet.
50<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
176<br />
79<br />
Fahrerrückhaltesicherung<br />
Abb. 3.20 Technische Anforderungen<br />
notwendig<br />
vorhanden<br />
15 15<br />
Transport- und Verkehrswege<br />
Ursächlich für Unfälle waren in der Vergangenheit<br />
immer wieder Unzulänglichkeiten<br />
in der Organisation des betrieblichen<br />
Ablaufs durch unzureichende<br />
Gestaltung von innerbetrieblichen<br />
Transport- und Verkehrswegen.<br />
Die Arbeitsstättenverordnung legt durch<br />
§ 17 in Verbindung mit der ASR 17/1,2<br />
Vorschriften zur sicheren Gestaltung<br />
von Verkehrswegen fest (Abb. 3.21).<br />
In vielen überprüften Betrieben mussten<br />
allerdings Mängel hinsichtlich der<br />
Beschaffenheit, Abmessung bzw. Abgrenzung<br />
von Verkehrswegen festgestellt<br />
werden.<br />
Tabelle 3.3 macht deutlich, dass im<br />
Rahmen der Stichprobe in zahlreichen<br />
Unternehmen die Organisation des innerbetrieblichen<br />
Transportes unzureichend<br />
ist.<br />
In 9 der 38 aufgesuchten Betriebe sind<br />
die Verkehrswege nicht durchgängig<br />
für die tatsächliche Nutzung, z. B. für<br />
Geh- und Fahrverkehr, ausreichend<br />
breit. Auch sind die Sicherheitszuschläge<br />
entsprechend der Breite der<br />
Ladung nicht immer gegeben.<br />
In Hallen fehlte z. T. die klare Abgrenzung<br />
und Kennzeichnung von Verkehrswegen<br />
und Lagerflächen.<br />
108 106<br />
118<br />
Sichteinschränkungen durch Gassenbildung,<br />
unzweckmäßige Stapelung sowie<br />
auch durch die Art des verwendeten<br />
Lastaufnahmemittels stellen weitere<br />
Gefahren dar.<br />
Hauptmangel beim Abstellen der Stapler<br />
war das Nichtabziehen des Zündschlüssels,<br />
wodurch ein unbefugtes<br />
Benutzen jederzeit möglich wurde.<br />
Die zulässigen Stapelhöhen wurden nur<br />
bei 2 Lagerflächen nicht eingehalten.<br />
Diese betriebsbezogenen Feststellungen<br />
bedeuten jedoch nicht, dass die<br />
Ergebnisse für alle im Betrieb eingesetzten<br />
Stapler bzw. für sämtliche vorhandenen<br />
Verkehrswege gleichermaßen<br />
zutreffen.<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
111<br />
Lastschutzgitter Fahrerschutzdach Schutz vor<br />
Witterungseinflüssen<br />
Abb. 3.21 Beispiel für eine sichere Gestaltung<br />
von Verkehrs- und Lagerflächen<br />
Tabelle 3.3 Verkehrs- und Transportsicherheit (Zahl der kontrollierten Betriebe: 38)<br />
Mängel bei der Organisation der<br />
Verkehrs- und Transportsicherheit Anzahl bemängelter Betriebe Anteil<br />
Kennzeichnung nicht ausreichend 6 16%<br />
Breite der Verkehrswege nicht ausreichend 9 24%<br />
Sichteinschränkung beim Transport 3 8%<br />
Stapelhöhen nicht zulässig 2 5%<br />
Mängel beim Abstellen des Staplers 6 16%<br />
Sachkundigenprüfungen<br />
Im Sinne des § 4 Abs. 4 der Arbeitsmittelbenutzungsverordnung<br />
sind in Verbindung<br />
mit § 37 BGV D 27 “Flurförderzeuge”<br />
jährlich wiederkehrende Sachkundigenprüfungen<br />
durchzuführen.<br />
Grundsätzlich werden diese Prüfungen<br />
in allen kontrollierten Betrieben veranlasst.<br />
In drei Betrieben waren bei insgesamt<br />
fünf Staplern Verstöße gegen die<br />
Prüfpflicht anzumerken (Abb. 2.22).<br />
Prüfbücher zum Nachweis der durchgeführten<br />
Wiederholungsprüfungen werden<br />
in den Unternehmen in der Regel<br />
geführt. Bei der Prüfung festgestellte<br />
Mängel werden dort vom Sachkundigen<br />
auch eingetragen. Nicht immer wird<br />
dieses Buch auch als Beleg für die Ab-
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 51<br />
stellung der Mängel verwendet, in einigen<br />
Fällen konnte nur über die in der<br />
Buchhaltung aufbewahrten Rechnungen<br />
der Nachweis der Mängelbehebung<br />
erbracht werden.<br />
Die Überprüfung der Nachweise über<br />
die Abstellung der Mängel erscheint<br />
besonders wichtig, da eine Vielzahl der<br />
im Prüfbuch niedergelegten Mängel erheblich<br />
und bedeutsam für die Sicherheit<br />
der Stapler waren.<br />
Gefahrstoffe<br />
Bei der Kontrolle des Transportes und<br />
der Verkehrswege in Betriebshallen bot<br />
es sich gleichzeitig an, die Voraussetzungen<br />
für das Betreiben von Dieselgabelstaplern<br />
in geschlossenen Räumen<br />
zu hinterfragen.<br />
Von 85 der insgesamt kontrollierten<br />
Dieselgabelstapler wurden 27 ganz oder<br />
teilweise in geschlossenen Räumen eingesetzt.<br />
Zum Schutz gegen Dieselmotoremissionen<br />
waren davon 23 mit einem<br />
Partikelfilter ausgestattet, bei den übrigen<br />
4 Staplern ist die Nachrüstung<br />
bereits vorgesehen.<br />
Eine Anzeige des Umganges mit Dieselmotoremissionen<br />
nach § 37 Gefahrstoffverordnung<br />
war bei 24 der 27 Stapler<br />
erfolgt.<br />
Die angetroffenen flüssiggasbetriebenen<br />
Stapler wurden sämtlich auf Vorhandensein<br />
des als gefährlich eingestuften<br />
Verdampferdruckreglers Typ “J” der Firma<br />
IMPCO überprüft.<br />
Von den 10 mit Flüssiggas betriebenen<br />
Staplern hatten 5 ursprünglich den bemängelten<br />
Druckregler. Diese waren<br />
bereits umgerüstet. Bei den übrigen<br />
Staplern kamen Druckregler anderer Firmen<br />
zum Einsatz.<br />
95%<br />
90%<br />
85%<br />
97%<br />
mindestens jährlich<br />
geprüft<br />
Abb. 2.22 Wiederkehrende Prüfungen bei 176 Staplern<br />
Schlussfolgerungen<br />
Wie die Schwerpunktkontrolle belegt,<br />
liegen hinsichtlich der Benutzung von<br />
Gabelstaplern für den innerbetrieblichen<br />
Transport zahlreiche Unzulänglichkeiten<br />
vor.<br />
Die festgestellten Mängel können vorrangig<br />
auf eine nicht ausreichende betriebliche<br />
Organisation zurückgeführt werden.<br />
Die Überprüfung zeigte, dass beim innerbetrieblichen<br />
Transport und Verkehr in<br />
Betrieben aller Branchen gleichermaßen<br />
arbeitsschutzrelevante Mängel auftreten<br />
können.<br />
Entsprechend der Stichprobe scheinen<br />
dabei Handelsbetriebe den meisten Nachholbedarf<br />
bei der Schaffung von Voraussetzungen<br />
für einen arbeitsschutzgerechten<br />
innerbetrieblichen Transport<br />
zu haben.<br />
Da die Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie<br />
in der Fassung der RL 95/63 EG noch<br />
nicht in nationales deutsches Recht überführt<br />
wurde, ergab sich bei der Beratung<br />
96%<br />
90%<br />
Prüfnachweis vorhanden Nachweis über<br />
abgestellte Mängel<br />
ein erhöhter Argumentationsaufwand, um<br />
die Betreiber zur freiwilligen Nachrüstung<br />
der “älteren” Stapler mit Fahrerrückhalteeinrichtungen<br />
zu bewegen.<br />
Im Rahmen der Auswertung wurden 26<br />
betriebliche Beratungen durchgeführt.<br />
Durch Revisionsschreiben wurden weitere<br />
Hinweise zur Herstellung der<br />
arbeitsschutzrechtlichen Voraussetzungen<br />
bzw. zur Mängelabstellung gegeben.<br />
Da der innerbetriebliche Transport und<br />
Verkehr nach wie vor als herausragende<br />
Quelle für mögliche Unfälle zu betrachten<br />
ist, sollte dieses Problem verstärkt in Revisionen<br />
Eingang finden. Im Rahmen der<br />
planmäßigen Aufsichtstätigkeit sollte diesbezüglich<br />
der Überprüfung von Gefährdungsbeurteilungen<br />
und Umsetzung der<br />
dokumentierten Maßnahmen sowie der<br />
speziell auf die Tätigkeit abgehobenen<br />
Betriebsanweisung eine besondere Bedeutung<br />
zukommen.
52<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Arbeitssicherheit beim Einsatz der Autogentechnik<br />
Die Anwendung der Autogentechnik in<br />
der Wirtschaft ist ein weit verbreitetes<br />
Verfahren. Neben der Herstellung von<br />
Erzeugnissen kommt diese Technik<br />
auch bei Instandsetzungs-, Montageund<br />
Demontagearbeiten zum Einsatz.<br />
Unmittelbare Auswirkungen von unsachgemäß<br />
vorbereiteten und ausgeführten<br />
autogenen Schweißarbeiten sind unter<br />
anderem auch Arbeitsunfälle und Sachschäden.<br />
So ereignete sich im III. Quartal 2000 im<br />
Zuständigkeitsbereich des GAA Magdeburg<br />
bei der Errichtung einer Kälteanlage<br />
ein schwerer Unfall beim Umgang<br />
mit einer Einzelflaschenanlage. Beim Aufdrehen<br />
der Sauerstoffflasche trat eine<br />
Stichflamme aus dem Federdeckel des<br />
Druckminderers, die zu Verbrennungen<br />
1. und 2. Grades an den Händen, dem<br />
linken Arm und im Gesicht sowie zur<br />
Verletzung der Hornhaut des Auges des<br />
Arbeitnehmers führten. Abbildung 3.23<br />
zeigt die am Unfallort vorgefundene<br />
Einzelflaschenanlage mit der am Federdeckel<br />
des Sauerstoffdruckminderers<br />
vorhandenen elliptischen Aufschmelzung.<br />
Durch Befragungen des Verunfallten und<br />
Begutachtung des Sauerstoffdruckminderers<br />
wurde folgender Ereignishergang<br />
ermittelt:<br />
Durch das ruckartige Öffnen des Ventils<br />
der Sauerstoffflasche (200 bar) ist<br />
die vorgespannte Membrane des Druckminderers<br />
aufgrund des maximal geöffneten<br />
Ventils am Eingang zum Entspannungsraum<br />
(hochgeschraubte Stellschraube)<br />
schlagartig belastet worden.<br />
Diese schlagartige Belastung führte bei<br />
der langjährig im Einsatz befindlichen<br />
ermüdeten Membrane zum Platzen derselben.<br />
Durch die dabei entstehende<br />
Dipl.-Ing. Wolf-Albrecht Fritsch, GAA Magdeburg<br />
Aus Schaden lernen<br />
Aufprall- und Rissenergie in Verbindung<br />
mit reinem Sauerstoff und hohem Druck<br />
kam es zur Entzündung der geborstenen<br />
Membranteilchen. In einer Art Kettenreaktion<br />
verbrannten danach alle im<br />
Inneren des Druckminderers befindlichen<br />
Teile, wie Stellfedern, Ventilverschlüsse,<br />
Abblaseventil. Diese so genannte<br />
“explosive Verbrennung” trat<br />
dann durch Aufschmelzen des Federdeckels<br />
in Form einer Stichflamme aus<br />
dem Druckminderer aus. Abbildung 3.24<br />
zeigt den zerlegten Sauerstoffdruckminderer<br />
mit den noch vorhandenen<br />
Bestandteilen und in Abb. 3.25 ist der<br />
Druckminderer schematisch dargestellt.<br />
Ursächlich für den Unfall war ein Fehlverhalten<br />
des Beschäftigten, der entgegen<br />
bestehender Regelungen in Vorschriften<br />
3.1) das Flaschenventil ruckartig<br />
geöffnet und die Stellschraube des<br />
Abb. 3.23 Einzelflaschenanlage am Unfallort<br />
Druckminderers nicht zur Entlastung der<br />
Feder zurückgeschraubt hat.<br />
Den bisherigen Ausführungen sowie der<br />
mit Veränderungen neu erschienenen<br />
berufsgenossenschaftlichen Vorschrift<br />
für Sicherheit und Gesundheit bei der<br />
Arbeit BGV D 1 “Schweißen, Schneiden<br />
und verwandte Verfahren” Rechnung<br />
tragend, wurde durch das GAA Magdeburg<br />
für das Jahr <strong>2001</strong> eine Schwerpunktaktion<br />
“Arbeitssicherheit beim<br />
Einsatz der Autogentechnik” mit folgendem<br />
Ziel durchgeführt:<br />
“Methodisch durch eine Checkliste vorbereitet,<br />
bestehende Gefährdungen<br />
beim Umgang mit der Autogentechnik<br />
zu erkennen, zu beurteilen und mit den<br />
Unternehmen Maßnahmen zur Beseitigung<br />
bzw. Verringerung festzulegen.”<br />
Die erzielten Ergebnisse sind nachfolgend<br />
aufgezeigt.<br />
3.1) § 15 Abs. 2 ArbSchG i. V. m. § 35 Abs. 1 BGV D 1
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 53<br />
Abb. 3.24 Zerlegter Sauerstoffdruckminderer<br />
Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden<br />
43 Betriebe aufgesucht, die nachfolgenden<br />
Größenklassen zugeordnet<br />
werden können.<br />
Größenklasse 4 30 Betriebe<br />
(AN-Zahl von 1 bis 19)<br />
Größenklasse 3 12 Betriebe<br />
(AN-Zahl von 20 bis 199)<br />
und<br />
Die an den 21 Einzelflaschenanlagen<br />
festgestellten technischen Mängel stellen<br />
sich folgendermaßen dar:<br />
8 mal wurden poröse Sauerstoff- bzw.<br />
Acetylenschläuche angetroffen,<br />
6 Manometer mussten beanstandet<br />
werden,<br />
Die 80 erkannten Mängel bei den organisatorischen<br />
Voraussetzungen in den<br />
43 aufgesuchten Betrieben schlüsseln<br />
sich wie folgt auf:<br />
In 11 Betrieben konnte keine Gefährdungsbeurteilung<br />
für den Arbeitsplatz<br />
“Gasschweißen” vorgelegt werden.<br />
3 Betriebe konnten die gesetzlich geforderte<br />
Gefährdungsbeurteilung<br />
nach § 5 ArbSchG nicht vorlegen.<br />
Hochdruckteil<br />
6<br />
5<br />
Sauerstoffflasche<br />
200 bar<br />
7 8<br />
Größenklasse 2 1 Betrieb<br />
(AN-Zahl von 200 bis 999)<br />
Die Beschäftigtenzahl lag bei 23 Betrieben<br />
unter 10 Arbeitnehmer.<br />
In den 43 Betrieben waren 75 Einzelflaschen-<br />
und 3 Flaschenbatterieanlagen<br />
vorhanden. 60 Einzelflaschen- und 3<br />
Flaschenbatterieanlagen wurden einer<br />
Prüfung unterzogen.<br />
Mangelart “organisatorische Voraussetzungen”<br />
Eine regelmäßige Sachkundigenprüfung<br />
auf Dichtheit und ordnungsgemäßen<br />
Zustand in Abhängigkeit von den<br />
betrieblichen Beanspruchungen der<br />
Einzelflaschen- und Flaschenbatterieanlagen<br />
sowie der Verbrauchseinrichtungen<br />
erfolgte in 16 Fällen nicht.<br />
Die mindestens einmal jährlich durchzuführendenSachkundigenprüfungen<br />
der Einzelflaschensicherungen<br />
auf Sicherheit gegen Gasrücktritt,<br />
Niederdruckteil<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
10 bar<br />
Brenner<br />
Abb. 3.25 Schematische Darstellung eines Druckminderers<br />
Allgemeines<br />
Technische Mängel an den Einzelflaschenanlagen<br />
in 3 Fällen fehlten die Einzelflaschensicherungen,<br />
2 mal waren die Flaschendruckminderer<br />
nicht ordnungsgemäß angebracht<br />
und<br />
9<br />
10<br />
1 Membrane aus Gummi<br />
mit Gewebeeinlagen<br />
2 Federdeckel mit<br />
Entlastungslöchern<br />
3 Stellfeder aus Stahl<br />
4 Stellschraube<br />
5 Entspannungsraum<br />
6 Manometer<br />
7 Ventilverschluss<br />
8 Abblaseventil<br />
9 Manometer<br />
10 Absperrventil<br />
Von den Einzelflaschenanlagen waren<br />
21 mit je einem technischen Mangel<br />
behaftet.<br />
Bei der Kontrolle der organisatorischen<br />
Voraussetzungen für den Einsatz der<br />
Autogentechnik in den 43 Betrieben sind<br />
80 Unzulänglichkeiten festgestellt worden.<br />
je einmal entsprach die Raumlüftung<br />
nicht den Erfordernissen und es fehlte<br />
eine sichere Ablagemöglichkeit für<br />
den Brenner.<br />
In Abb. 3.26 sind die technischen Mängel<br />
an den Einzelflaschenanlagen in<br />
Form eines Säulendiagrammes dargestellt.<br />
Dichtheit und Durchfluss sind in 13<br />
Betrieben nicht durchgeführt worden.<br />
Eine mindestens einmal jährliche Unterweisung<br />
über die sicherheitstechnische<br />
Benutzung der persönlichen<br />
Schutzeinrichtungen der Gasschweißer<br />
erfolgte in 8 Betrieben nicht.<br />
In 7 Betrieben erfolgten keine mindestens<br />
jährlich durchzuführenden<br />
fachspezifischen Unterweisungen.
54<br />
Anzahl<br />
Anzahl<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
20<br />
keine Gefährdungsbeurteilung "Gasschweißen"<br />
60<br />
kontrolliert<br />
12<br />
Gefährdungsbeurteilung fehlt<br />
mit Mängeln<br />
16<br />
regelmäßige SK-Prüfung fehlt<br />
Einzelflaschenanlagen<br />
43 Unternehmen entsprechen 100%<br />
jährliche SK-Prüfung fehlt<br />
13<br />
jährliche Belehrung PSA-Benutzung<br />
fehlt<br />
8<br />
jährliche fachspezifische Belehrung<br />
fehlt<br />
7<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
100 35 38,1 28,6 14,3 9,5 4,8 4,8<br />
Abb. 3.26 Technische Mängel “Einzelflaschenanlagen”<br />
21<br />
8<br />
6<br />
Anteil der Mängel in %<br />
12<br />
PSA-Benutzungsinfo fehlt<br />
Betriebsanweisung "Schweißen in engen Räumen" fehlt<br />
2<br />
Betriebsanweisung "Flaschenbatterieanlagen" fehlt<br />
2<br />
Erlaubnisschein entspricht nicht den Anforderungen<br />
4<br />
Erlaubnisschein<br />
Schweißarbeiten unter 18.<br />
1 1<br />
46,5 27,9 38,1 30,1 18,6 16,3 27,9 4,7 4,7 9,3 2,3 2,3<br />
Abb. 3.27 Mangelart “Organisatorische Voraussetzungen”<br />
poröse Schläuche<br />
defekte Manometer<br />
fehlende Einzelflaschensicherungen<br />
Anteil der Mängel in %<br />
Mängel<br />
21 Mängel entsprechen 100 %<br />
Druckminderer nicht ordnungsgemäß<br />
angebracht<br />
3 2<br />
Lüftung nicht in Ordnung<br />
Brennerablage nicht sicher<br />
1 1
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 55<br />
In 12 Fällen hielt der Arbeitgeber nicht<br />
die für die bereitgestellten persönlichen<br />
Schutzeinrichtungen erforderlichen<br />
Informationen für deren Benutzung<br />
bereit.<br />
In zwei Betrieben fehlten die für Gasschweißarbeiten<br />
in engen Räumen<br />
erforderlichen Betriebsanweisungen.<br />
Bei zwei Betreibern von Flaschenbatterieanlagen,<br />
dessen Verbrauchseinrichtungen<br />
Gasbrenner waren, fehlten<br />
die notwendigen Betriebsanweisungen.<br />
Bei der Kontrolle der ausgestellten<br />
Schweißerlaubnisscheine musste festgestellt<br />
werden, dass in 4 Betrieben<br />
diese nicht den Anforderungen der<br />
neuen BGV D 1 entsprachen.<br />
Je einmal musste bemängelt werden,<br />
dass der Schweißerlaubnisschein für<br />
die auszuführenden Schweißarbeiten<br />
fehlte und Gasschweißarbeiten von<br />
einem Arbeitnehmer durchgeführt wurden,<br />
der das 18. Lebensjahr noch nicht<br />
vollendet hatte.<br />
Abb. 3.26 zeigt die prozentuale Verteilung<br />
der Mängel in Abhängigkeit von<br />
den Mängelarten.<br />
Die Aktion hat gezeigt, dass bei den<br />
organisatorischen Voraussetzungen für<br />
den ordnungsgemäßen Einsatz der<br />
Autogentechnik die größten Defizite zu<br />
verzeichnen waren.<br />
So ist negativ zu vermerken, dass in<br />
25,6% der aufgesuchten Betriebe keine<br />
Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitsplatz<br />
“Gasschweißen” und bei 7% der<br />
Betriebe überhaupt keine Gefährdungsbeurteilung<br />
entsprechend § 5 des<br />
ArbSchG vorgelegt werden konnte (Abb.<br />
3.27).<br />
Weitere Belege für Mängel bei den organisatorischen<br />
Voraussetzungen sind die<br />
hohe Zahl fehlender Sachkundigenprüfungen<br />
und nicht durchgeführter fachspezifischer<br />
Unterweisungen (Abb. 3.27).<br />
Die erkannten technischen Mängel an<br />
35% der kontrollierten Einzelflaschenanlagen<br />
weisen auf ein Gefährdungspotenzial<br />
hin, das Unfälle und Brände,<br />
wie einleitend dargestellt, mit erheblichem<br />
Ausmaß nicht ausschließen lässt.<br />
Vor allem die angetroffenen porösen<br />
Schläuche, defekten Manometer und<br />
falsch angebrachten Flaschendruckminderer<br />
sind ein Indiz dafür (Abb. 3.27).<br />
Die Kontrollergebnisse wurden den 43<br />
Betrieben in Form eines Abschlussgespräches<br />
mitgeteilt. Weiterhin wurden<br />
allen Betrieben, bei denen Defizite<br />
auf den Gebieten der betrieblichen Organisation<br />
des Arbeitsschutzes und der<br />
technischen Sicherheit von Arbeitsmitteln<br />
vorhanden waren, Revisionsschreiben<br />
zugestellt.<br />
Darüber hinaus wurden in 10 Fällen die<br />
Betriebe darauf aufmerksam gemacht,<br />
dass es besser wäre, zum Öffnen der<br />
Flaschenventile einen Ventilschlüssel,<br />
wie in der Abb. 3.28 dargestellt, zu verwenden.<br />
Damit lässt sich ein ruckartiges<br />
Öffnen, das zu Druckmindererbränden<br />
wie bei dem aufgezeigten Unfall<br />
führen kann, ausschließen.<br />
Abb. 3.28 Ventilschlüssel<br />
Aus der Sicht des GAA Magdeburg werden<br />
auf der Grundlage der Ergebnisse<br />
der Schwerpunktaktion und aus den<br />
Erkenntnissen des geschilderten Unfalls<br />
folgende weitergehende Maßnahmen<br />
für erforderlich gehalten:<br />
Die Autogentechnik ist weiterhin im<br />
Rahmen der normalen Revisionstätigkeit<br />
der Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
zu überprüfen.<br />
Die Aktion hat gezeigt, dass bei der<br />
Erarbeitung von Gefährdungsbeurteilungen<br />
gemäß § 5 ArbSchG vor allem<br />
in Klein- und Mittelbetrieben Defizite<br />
bestehen. Die Gefährdungsbeurteilungen<br />
und die daraufhin einzuleitenden<br />
Maßnahmen sind bei den<br />
Kontrollen regelmäßig zu überprüfen.<br />
Werden Mängel erkannt, ist deren Abstellung<br />
nach entsprechender Beratung<br />
zu fordern.<br />
Die hohe Anzahl der fehlenden Sachkundigenprüfungen<br />
und nicht durchgeführten<br />
Unterweisungen ist nicht<br />
zuletzt der Betriebsgröße (23 Betriebe<br />
unter 10 Arbeitnehmern) geschuldet.<br />
In Betrieben dieser Größenordnung ist<br />
es unter den marktwirtschaftlichen<br />
Bedingungen in vielen Fällen aus zeitlichen<br />
und wirtschaftlichen Gründen<br />
nicht möglich, sich mit den vielfältigen<br />
Inhalten der bestehenden Rechtsvorschriften<br />
zu beschäftigen. Auch hier<br />
muss es Aufgabe der Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
sein, diese bestehenden<br />
Lücken durch entsprechende<br />
Beratung und Unterstützung zu schließen,<br />
um damit einen wirksamen Beitrag<br />
zur Unfallverhütung zu leisten.<br />
Die erkannten anlagenbezogenen<br />
Mängel (poröse Schläuche, defekte<br />
Manometer, falsch angebrachte Druckminderer)<br />
sind ein Indiz dafür, dass die<br />
Gasschweißer ihren Kontrollpflichten,<br />
aus welchen Gründen auch immer<br />
(Leichtfertigkeit, Unwissenheit), nicht<br />
ausreichend nachkommen und somit<br />
möglichen Bränden und Unfällen Vorschub<br />
leisten.<br />
Hier muss die Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
durch entsprechende Kontrollen<br />
darauf Einfluss nehmen, dass der<br />
Unternehmer seinen gesetzlich fixierten<br />
Kontroll- und Unterweisungspflichten<br />
nachkommt.
56<br />
Die Radici-Chimica Deutschland GmbH<br />
errichtete am ehemaligen Hydrierwerk-<br />
Standort in 06729 Tröglitz ein Chemiewerk<br />
zur Herstellung von 80.000 t/Jahr<br />
Adipinsäure (Abb. 3.29). Das Investitionsvolumen<br />
beträgt ca. 380 Mill. DM.<br />
Durch das Vorhaben wurden 330 Arbeitsplätze<br />
geschaffen.<br />
Neben der Adipinsäureanlage wurden<br />
außerdem Anlagen zur Herstellung von<br />
Salpetersäure und Cyclohexanol errichtet.<br />
Bei diesen zwei Produkten handelt<br />
es sich um die Vorprodukte zur Adipinsäureherstellung.<br />
Abb. 3.29 Gesamtansicht des Chemiewerkes<br />
Adipinsäure ist ein wichtiges Ausgangsprodukt<br />
für eine vielseitige Verwendung<br />
in der Textil- und Kunststoffindustrie.<br />
Diese Chemieanlage ist eine genehmigungsbedürftige<br />
Anlage im Sinne des<br />
Bundesimmissionsschutzgesetzes und<br />
unterliegt der Störfallverordnung (12.<br />
BImSchV). Die Antragskonferenz dazu<br />
fand im Mai 1998 im Regierungspräsidium<br />
Halle statt.<br />
Die Genehmigung zur Errichtung und<br />
zum Betrieb erfolgte in Form von 12<br />
Teilgenehmigungen, beginnend mit der<br />
1. Teilgenehmigung im November 1998<br />
Mit Sicherheit eine neue Anlage<br />
Dipl.-Ing. Peter Hofmann, GAA Naumburg<br />
und abgeschlossen mit der 12. Teilgenehmigung<br />
(abschließende Betriebsgenehmigung)<br />
im Dezember <strong>2001</strong>. Das<br />
GAA Naumburg hat zu allen 12 Genehmigungen<br />
(7 Teilgenehmigungen zur Errichtung,<br />
5 Teilgenehmigungen zum Betrieb)<br />
Zuarbeit in Form von Stellungnahmen<br />
geleistet. Für VbF-Anlagen wurden<br />
Erlaubnisse in das Genehmigungsverfahren<br />
eingebunden.<br />
Für das GAA Naumburg war es bisher<br />
das größte Einzelvorhaben. Die Ergebnisse<br />
von Baustellenkontrollen durch<br />
das GAA Naumburg zu Beginn der<br />
Realisierungsphase im Juni 1999 und<br />
im Jahre 2000 ergaben z. T. erhebliche<br />
Defizite bezüglich der Gewährleistung<br />
von Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
der Beschäftigten.<br />
Aus diesem Grund hatte sich das GAA<br />
Naumburg die Aufgabe gestellt, in der<br />
Endphase der Realisierung des Vorhabens<br />
im Jahre <strong>2001</strong> durch verstärkte<br />
Kontroll- und Beratungstätigkeit Sicherheit<br />
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten<br />
auf der Baustelle wesentlich<br />
zu verbessern. Die Umsetzung der in<br />
den Teilgenehmigungen gestellten anlagenspezifischen<br />
und arbeitsschutzorganisatorischen<br />
Forderungen sollte<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
durch eine nach Arbeitsschwerpunkten<br />
ausgerichtete Aufsichtstätigkeit auch in<br />
der Phase des Probebetriebes abgesichert<br />
werden.<br />
Bei der Umsetzung dieser Schwerpunktaufgaben<br />
wurden im Zeitraum Januar<br />
bis November <strong>2001</strong> über 100 Besichtigungen<br />
und Besprechungen auf der<br />
Baustelle sowie in den Betriebsstätten<br />
und Anlagenkomplexen durchgeführt.<br />
Die Baustellenkontrollen bezogen sich<br />
schwerpunktmäßig auf die Einhaltung<br />
der Anforderungen<br />
zur Baustellenverordnung (BaustellV),<br />
zur Bereitstellung von Baustellenunterkünften,<br />
an hoch gelegene Arbeitsplätze,<br />
zur Arbeitsmittelbenutzungsverordnung<br />
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln<br />
(insbesondere beim Einsatz<br />
von Autodrehkranen und Hubarbeitsbühnen),<br />
zur Gefahrstoffverordnung beim Umgang<br />
mit Gefahrstoffen und<br />
zu Arbeitszeitregelungen entsprechend<br />
des Arbeitszeitgesetzes.
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 57<br />
Die beim Vollzug der Baustellenverordnung<br />
im Jahre 2000 festgestellten<br />
Defizite, wie unvollständige Aktualisierung<br />
des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes,<br />
unzureichende Darstellung<br />
notwendiger Einrichtungen zur<br />
Erfüllung der Arbeitsschutzbestimmungen<br />
im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan,<br />
insbesondere der Maßnahmen<br />
für die besonders gefährlichen Arbeiten<br />
nach Anhang II der Baustellenverordnung,<br />
wurden bei den Prüfungen<br />
im Rahmen der Schwerpunktkontrolle<br />
nicht mehr festgestellt.<br />
Der vom Bauherrn beauftragte “Dritte”<br />
hatte dem bestellten Koordinator für Sicherheit<br />
und Gesundheitsschutz (Si-Ge-<br />
Koordinator) nach der Auswertung der<br />
vom GAA Naumburg aufgezeigten Defizite<br />
im September 2000 bezüglich der<br />
Überwachung der Maßnahmen des<br />
Arbeitsschutzes und der Realisierung<br />
seiner Aufgaben bei der Ausführung<br />
des Bauvorhabens im Sinne der Baustellenverordnung<br />
alle Vollmachten<br />
übertragen.<br />
So konnte dieser bei gravierenden Verstößen<br />
gegen die festgelegten Maßnahmen<br />
des Arbeitsschutzes Abmahnungen<br />
aussprechen. Mehrere Abmahnungen<br />
Betroffener führten zum Verweis<br />
von der Baustelle bzw. zur Auftragsentbindung<br />
der jeweiligen Firma.<br />
Dieses straffe Regime mit wöchentlicher<br />
Auswertung und die ständige Anwesenheit<br />
des Si-Ge-Koordinators auf<br />
der Baustelle waren ein bedeutender<br />
Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit<br />
und Gesundheitsschutz.<br />
Einmal im Monat führten die am Arbeitsschutz<br />
Beteiligten, wie Fachkräfte für<br />
Arbeitssicherheit der auf der Baustelle<br />
tätigen Firmen, Aufsichtsbeamtinnen<br />
und Aufsichtsbeamte der zutreffenden<br />
Berufsgenossenschaften (hier: Metallund<br />
Bau-BG), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
des GAA Naumburg und der Si-<br />
Ge-Koordinator, eine Baustellenbesichtigung<br />
mit anschließender Auswertung<br />
und Protokollführung durch. Dieses Protokoll<br />
enthielt alle den jeweiligen Firmen<br />
zugeordneten Mängel und wurde allen<br />
Firmen übergeben.<br />
Abb. 3.30 Verlegen von Elektroleitungen in einer Höhe von 6,00 m ohne Schutz gegen Absturz<br />
Beim Nachlassen des Baugeschehens<br />
im September <strong>2001</strong> sollte aus Kostengründen<br />
der bestellte Si-Ge-Koordinator<br />
seine Arbeit beenden. Die Einflussnahme<br />
des GAA Naumburg bewirkte,<br />
dass dieser bis zum Jahresende ganztägig<br />
auf der Baustelle die Aufgaben im<br />
Sinne von § 3 Abs. 3 BaustellV erfüllte.<br />
Die Überprüfung höher gelegener Arbeitsplätze<br />
war Bestandteil jeder Baustellenkontrolle<br />
und betraf eine Vielzahl<br />
der vorhandenen Firmen. Dabei wurden<br />
167 Mängel festgestellt.<br />
Bei 8 Kontrollen führten Beschäftigte<br />
Arbeiten in Höhen bis 10 m ohne Absturzsicherungen<br />
bzw. Auffangeinrichtungen<br />
durch (Abb. 3.30).<br />
Die mündlich ausgesprochenen Anordnungen<br />
mit sofortiger Vollziehung und<br />
Androhung von Zwangsgeld führten zur<br />
Einstellung der Arbeiten und Veranlassung<br />
der erforderlichen Maßnahmen.<br />
Bei einer Firma wurden derartige und<br />
auch noch andere Mängel mehrfach festgestellt.<br />
Dieses Fehlverhalten veranlasste<br />
den zuständigen Mitarbeiter des GAA<br />
Naumburg, ein entsprechendes Schreiben<br />
an die Unternehmensleitung zu senden.<br />
In diesem Schreiben wurde die Organisation<br />
des Unternehmens zur Gewährleistung<br />
des Arbeitsschutzes im Sinne<br />
des § 3 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz in<br />
Frage gestellt. Der Unternehmer wurde<br />
aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen<br />
zu veranlassen.<br />
Daraufhin wurden die Einsatzzeit der<br />
Fachkraft für Arbeitssicherheit dieses Unternehmens<br />
für diese Baustelle spürbar<br />
erhöht und die Verantwortung der Bauleiter<br />
und Poliere aufgewertet. Infolge<br />
dieser Maßnahmen wurden bei den nachfolgenden<br />
Kontrollen keine erheblichen<br />
sicherheitstechnischen Mängel mehr<br />
festgestellt.<br />
Die Überprüfung eines Autodrehkranes<br />
mit hochziehbarem Personenaufnahmemittel<br />
ergab, dass dieser Einsatz nicht<br />
bei der zuständigen BG angemeldet und<br />
der Autodrehkran zudem nicht mit den<br />
dafür erforderlichen Notablass ausgerüstet<br />
war. Diese Feststellung des Mitar-<br />
Abb. 3.31 Kraneinsatz zum Befördern von Personen<br />
mit Personenaufnahmemitteln
58<br />
beiters des GAA Naumburg im Beisein<br />
des Verantwortlichen der Autokran-<br />
Verleihfirma führte zur sofortigen Einstellung<br />
der Arbeiten und zur Bereitstellung<br />
eines anderen Autodrehkranes mit<br />
entsprechender Notablass-Vorrichtung<br />
(Abb. 3.31).<br />
Die wesentlichsten Defizite bei der Benutzung<br />
der Hubarbeitsbühnen waren<br />
fehlende Betriebsanweisungen,<br />
nicht vorhandene Nachweise über<br />
durchgeführte Prüfungen am Einsatzort,<br />
keine Kennzeichnung des Notablasses<br />
in deutscher Sprache,<br />
unkenntliche bzw. verschlissene weitere<br />
Angaben und<br />
nichtbestimmungsgemäßer Einsatz<br />
der Hubarbeitsbühne als Personenund<br />
Lastenaufzug (Transport von Lasten<br />
zu höher gelegenen Arbeitsplätzen,<br />
Verlassen der Hubarbeitsbühne<br />
an der oberen Einsatzstelle) (Abb.<br />
3.32).<br />
Zusammengefasst beinhaltete die Aufsichtstätigkeit<br />
in den errichteten Betriebsstätten<br />
und Anlagenkomplexen insbesondere<br />
die Einhaltung der Vorschriften<br />
der Arbeitsstättenverordnung, der Verordnungen<br />
für überwachungsbedürftige<br />
Anlagen (DruckbehV, VbF, ElexV), der<br />
Gefahrstoffverordnung bei der Realisierung<br />
der im Genehmigungsverfahren angezeigten<br />
anlagenspezifischen und<br />
arbeitsschutzorganisatorischen Nebenbestimmungen<br />
und Hinweise.<br />
Die Aufsichtstätigkeit bewirkte außerdem,<br />
dass typische Mängel, wie Stolperstellen,<br />
Löcher und Spalten in Fußböden, Wänden,<br />
Decken und auf Dächern, fehlende<br />
Abb. 3.33 Lagertanks für brennbare Flüssigkeiten<br />
(Olone), Phenol und Salpetersäure<br />
bzw. unvollstände Absturzsicherungen<br />
auf Behältern, Tanks und Podesten, an<br />
Steigleitern mit seitlicher Ruhebühne, an<br />
Gruben und Klapptreppen der Be- und<br />
Entladestellen von Straßentankfahrzeugen<br />
und Eisenbahnkesselwagen, eingeschränkte<br />
Zugänglichkeit von Armaturen,<br />
unzureichende Durchgangshöhen<br />
und -breiten, nicht trittsichere Treppen<br />
und Steigleitern, unvollständige, fehlende<br />
oder unpassende Gitterroste und zu<br />
steile Treppen, in Abstimmung mit dem<br />
Bauherren und der Errichterfirma beseitigt<br />
wurden.<br />
Stichprobenkontrollen zu Beginn des<br />
Probebetriebes bezüglich der Anlagensicherheit,<br />
der Flucht- und Rettungswege,<br />
der Sicherheitsbeleuchtung, der erforderlichen<br />
Notduschen und des Vorhandenseins<br />
der zutreffenden Betriebsanweisungen<br />
nach § 20 GefStoffV, des<br />
Alarmplanes für das Verhalten bei besonderen<br />
Vorkommnissen, der Not-<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Abb. 3.32 Keine bestimmungsgemäße Verwendung von Arbeitsmitteln<br />
Abb. 3.34 Nach dem Stand der Technik errichtete<br />
Füll- und Entleerstelle für brennbare<br />
Flüssigkeiten<br />
fallinformationen für die Einsatzkräfte (z.<br />
B. der Werkfeuerwehr) ergaben keine<br />
größeren Defizite (Abb. 3.33, 3.34, 3.35).<br />
Im Ergebnis dieser Schwerpunktkontrolle<br />
ist zu verzeichnen, dass die in Auswertung<br />
der durchgeführten Besichtigungen<br />
veranlassten Maßnahmen zu einem bemerkenswerten<br />
Niveau von Arbeitssicherheit<br />
und Qualität auf der Baustelle und<br />
der Anlagensicherheit bei der Errichtung<br />
sowie dem Probebetrieb des gesamten<br />
Vorhabens führten.<br />
Kennzeichnend dafür ist, dass bei der<br />
Realisierung dieses Bauvorhabens seit<br />
Beginn im Juli 1999 bis zum jetzigen<br />
Zeitpunkt insgesamt nur 11 meldepflichtige<br />
Arbeitsunfälle eintraten, obwohl<br />
bisher auf der Baustelle über 6.000 Arbeitnehmer<br />
mit einer Höchstzahl von<br />
über 900 pro Tag tätig waren.<br />
Die Aufnahme des Probebetriebes verlief<br />
ohne nennenswerte Vorkommnisse.<br />
Abb. 3.35 Notdusche am Tanklager für Gefahrstoffe
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 59<br />
Thermische Metallbehandlung unter Freisetzung von<br />
Kanzerogenen<br />
Im Ergebnis der in Sachsen-Anhalt durchgeführten<br />
und über 12 Branchen breit<br />
angelegten Sonderaktion “Ermittlungsund<br />
Überwachungspflicht sowie arbeitsmedizinische<br />
Vorsorge” hatte sich u. a. in<br />
der Metallbranche als Schwerpunkt des<br />
Umgangs mit Gefahrstoffen die thermische<br />
Metallbearbeitung ergeben.<br />
Die meisten Revisionen wurden in der<br />
zweiten Jahreshälfte 2000 und im ersten<br />
Quartal <strong>2001</strong> durchgeführt. Die 109<br />
aufgesuchten Betriebe in den 6 Aufsichtsbereichen<br />
der Arbeitsschutzverwaltung<br />
hatten insgesamt 7.851 Mitarbeiter<br />
(davon 13% Frauen) und waren<br />
aus der Metallbranche gezielt aufgrund<br />
der Verarbeitung hochlegierter Materialien<br />
ausgewählt worden. In diesen Betrieben<br />
wurden jedoch nur 670 Arbeitnehmer<br />
und eine Arbeitnehmerin betrachtet,<br />
da nur sie mit hochlegierten<br />
Stählen und thermischen Verfahren<br />
Umgang hatten. Es wird deutlich, dass<br />
es sich um einen sehr begrenzten Anteil<br />
(9%) von Personen in den untersuchten<br />
Es wurden 1.034 Tätigkeiten (ausgeführte<br />
Arbeitsverfahren) der 671 betrachteten<br />
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
erfasst (siehe Abb. 3.36) Außerdem<br />
wurden 721 Datensätze zur arbeitsmedizinischen<br />
Vorsorge ausgewertet.<br />
Dr. rer. nat. Claus-Peter Maschmeier, LAS<br />
Einleitung und Zielstellung<br />
Von besonderer Bedeutung ist dabei die<br />
Verwendung hochlegierter Stähle, bei<br />
deren Verarbeitung es zur Freisetzung<br />
von kanzerogenen Stoffen kommt. Dies<br />
war der Anlass für die vertiefende Untersuchung<br />
als Beitrag der Gewerbeaufsichtsverwaltung<br />
zur Umsetzung eines<br />
der von der Landesregierung erklärten<br />
Durchführung<br />
Betrieben handelt, der in der Metallbranche<br />
bei thermischen Bearbeitungsverfahren<br />
einem Expositionsrisiko gegenüber<br />
krebserzeugenden Gefahrstoffen<br />
unterliegt.<br />
Zur Durchführung der Sonderaktion<br />
wurde ein Begleitmaterial für die revidierenden<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
der GAA aus der umfangreich vorhandenen<br />
Literatur erstellt, das den<br />
Stand der Technik bezüglich der üblichen<br />
Verfahren, technischer und persönlicher<br />
Schutzmaßnahmen und möglicher<br />
Expositionen beschreibt. Auf diese<br />
Art und Weise wurden die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter in die Lage versetzt,<br />
eine sachkundige Bewertung der<br />
in den Betrieben vorgefundenen Gegebenheiten<br />
vorzunehmen und durch<br />
gezielte Beratung auf die Einhaltung der<br />
Gefahrstoffverordnung und des technischen<br />
Regelwerks hinzuwirken.<br />
Um den vorgefundenen Zustand zu dokumentieren,<br />
wurde ein zweiteiliger Fragebogen<br />
verwendet, der einmal die betriebliche<br />
Situation bezüglich der Einhaltung<br />
gefahrstoffrechtlicher Forderungen<br />
beschreibt und im zweiten Teil<br />
arbeitnehmerbezogen die angewendeten<br />
Bearbeitungsverfahren (Tätigkeiten)<br />
mit ausgewählten Randbedingungen<br />
(Lüftungstechnik, persönliche Schutzmaßnahmen,<br />
Messergebnisse) charakterisiert.<br />
Darstellung der Ergebnisse<br />
Betriebsbezogene Auswertung der Einhaltung von<br />
Arbeitgeberpflichten beim Umgang mit krebserzeugenden<br />
Gefahrstoffen<br />
Bei den in der Sonderaktion speziell<br />
betrachteten Metallbe- und -verarbeitungsverfahren<br />
können durch thermische<br />
Beanspruchung des Materials<br />
krebserzeugende Gefahrstoffe freigesetzt<br />
werden. Dabei handelt es sich<br />
insbesondere um die Metalle Chrom,<br />
Nickel und Cobalt bzw. deren Verbindungen<br />
oder auch um das besonders<br />
beim WIG-Schweißen auftretende Ozon.<br />
Bezüglich der einzuhaltenden Umgangsvorschriften<br />
für krebserzeugende<br />
Gesundheitsziele: “Senkung der Krebssterblichkeit”.<br />
Die Auswertung der gesammelten Daten<br />
soll Schwerpunkte deutlich machen<br />
und zur Ausarbeitung einer zukünftigen<br />
Revisionsstrategie in der Branche dienen.<br />
Stoffe sind aufgrund ihrer Einstufung in<br />
die Kategorien 1 oder 2 die Verbindungen<br />
des Chrom(VI) und des Nickels<br />
relevant.<br />
Beim Umgang mit Gefahrstoffen muss<br />
der Anwender zunächst zu Kenntnissen<br />
über mögliche Gefahren gelangen, die<br />
er im Gefahrstoffverzeichnis niederlegt.<br />
Oftmals ist hier der Ausgangspunkt für<br />
eine Kette von Pflichtverletzungen zu<br />
sehen, die Arbeitgeber auf dem Gebiet
60<br />
Anzahl<br />
1.000<br />
100<br />
10<br />
1<br />
27<br />
des Gefahrstoffrechts begehen. In der<br />
Metallbranche ist dies besonders problematisch,<br />
da gefährliche Stoffe oft erst<br />
bei der Bearbeitung freigesetzt werden<br />
und das damit verbundene Gefährdungspotenzial<br />
nicht erkannt wird. Aus<br />
diesem Grund wurde die Verfügbarkeit<br />
von Informationen für den Arbeitgeber<br />
in einer Frage betrachtet. In diesem Zusammenhang<br />
wurden auch Fragen zu<br />
der Verfahrensauswahl, den Betriebsanweisungen,<br />
den Unterweisungen sowie<br />
zu durchgeführten Anhörungen und<br />
Unterrichtungen gestellt. Weitere Fragen<br />
bezogen sich auf die Anzeigepflicht<br />
beim Umgang mit krebserzeugenden<br />
Gefahrstoffen (§ 37 GefStoffV) und auf<br />
die Einhaltung besonderer Umgangsvorschriften<br />
(§ 36 GefStoffV). Die Ergeb-<br />
11<br />
79<br />
Laserstrahlschneiden<br />
250<br />
4<br />
Lichtbogenhandschweißen<br />
Laserstrahlschweißen<br />
561<br />
2<br />
33<br />
Metall-Inertgasschweißen (MIG)<br />
Metall-Aktivgasschweißen (MAG)<br />
Abb. 3.36 Häufigkeit der Tätigkeiten (verfahrensbezogen)<br />
nisse sind in den Abbildungen 3.37 und<br />
3.38 dargestellt.<br />
Aus den Diagrammen ist Folgendes zu<br />
entnehmen: Produktinformationen waren<br />
in der Regel vorhanden. Mangelhafte<br />
Gefahrstoffverzeichnisse in Kombination<br />
mit der weitgehenden Unkenntnis,<br />
dass auch die Freisetzung entstehender<br />
krebserzeugender Gefahrstoffe<br />
zu berücksichtigen ist, setzten sich in<br />
mangelhaften oder nicht vorhandenen<br />
Betriebsanweisungen fort. Die günstigste<br />
Situation findet man bei den Unterweisungen,<br />
die in zwei Dritteln der Betriebe<br />
ordnungsgemäß durchgeführt wurden.<br />
Die große Anzahl der festgestellten<br />
Mängel unterstreicht, dass es notwendig<br />
war, hier durch die Sonderaktion<br />
20<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Häufigkeit der Tätigkeit (verfahrensbezogen)<br />
Autogen-Brennschneiden<br />
Plasmaschneiden<br />
Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)<br />
15<br />
1<br />
2<br />
Hartlöten<br />
Fülldrahtschweißen<br />
Widerstandsschweißverfahren<br />
22<br />
Lichtbogenspritzen<br />
3<br />
Unterpulverschweißen<br />
2 2<br />
Plasmaschweißen<br />
Elektronenstrahlschweißen<br />
Plasmapulverauftragschweißen<br />
einen Aufsichtsschwerpunkt zu setzen.<br />
Diese Ergebnisse lassen es eher unwahrscheinlich<br />
erscheinen, dass die<br />
Prüfung des Einsatzes emissionsarmer<br />
Schweißverfahren, die Begrenzung der<br />
Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br />
die mit krebserzeugenden<br />
Stoffen Kontakt haben sowie die Abgrenzung<br />
und regelmäßige Reinigung<br />
der Arbeitsbereiche aus dem bewussten<br />
Umsetzen gefahrstoffrechtlicher Regelungen<br />
resultieren. Oftmals erzeugten<br />
hier die geforderte Produktqualität<br />
und Produktivität die erforderliche Motivation.<br />
Die unzureichende Kennzeichnung<br />
der Arbeitsbereiche und Defizite<br />
im Bereich der arbeitsmedizinischen<br />
Vorsorge runden das Bild ab.
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 61<br />
Zahl der Betriebe<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
43<br />
49<br />
Abb. 3.37 Betriebsbezogen ausgewertete Mängel Teil 1<br />
17<br />
Gefahrstoffverzeichnis (§<br />
16 GefStoffV)<br />
Zahl der Betriebe<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
104<br />
55<br />
31<br />
23<br />
Betriebsanweisungen (§<br />
20 GefStoffV)<br />
Abb. 3.38 Betriebsbezogen ausgewertete Mängel Teil 2<br />
5<br />
Produktinformationen<br />
vorhanden<br />
104<br />
5<br />
Prüfung des Einsatzes<br />
emissionsamer<br />
Schweißverfahren<br />
58<br />
50<br />
Unterrichtung und<br />
Anhörung (§ 21 GefStoffV)<br />
1<br />
72<br />
26<br />
11<br />
Unterweisungen (§ 20<br />
GefStoffV)<br />
108<br />
Zahl der Beschäftigten so<br />
gering wie möglich (§ 36<br />
GefStoffV)<br />
0 1<br />
92<br />
15<br />
Abgrenzung/Zugänglichkeit<br />
geregelt (§ 36 GefStffV)<br />
13<br />
nicht zutreffend<br />
keine Mängel<br />
mit Mängel<br />
nicht vorhanden<br />
keine Angaben<br />
58<br />
20<br />
14<br />
4<br />
Vorsorgekartei (§ 34<br />
GefStoffV)<br />
2<br />
37<br />
71<br />
Warn- und<br />
Sicherheitszeichen<br />
vorhanden (§ 36 GefStoffV)<br />
ja<br />
nein<br />
keine Angaben<br />
1<br />
85<br />
19<br />
90<br />
Anzeige (§ 37 GefStoffV)<br />
2<br />
Regelmäßige Reinigung<br />
(§36 GefStoffV)<br />
21
62<br />
Auswertung der<br />
Gefährdungssituation in<br />
Abhängigkeit vom<br />
angewendeten<br />
Bearbeitungsverfahren<br />
Die Verfahren Metall-Inertgasschweißen,<br />
Autogen-Brennschneiden, Hartlöten,<br />
Lichtbogenspritzen, Plasmaschweißen,<br />
Plasmapulverauftragschweißen und<br />
Elektronenstrahlschweißen traten nur in<br />
Einzelfällen auf (Häufigkeiten
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 63<br />
tüchtiger Atemschutz vorhanden, aber<br />
es wurde keine Notwendigkeit gesehen,<br />
diesen zu benutzen. Die Anlagen<br />
waren überwiegend gekapselt bzw. eingehaust<br />
oder es wurde eine lokale<br />
Absaugung mitgeführt. Dieses Verfahren<br />
wurde nur in 8 Betrieben von insgesamt<br />
27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
angewendet.<br />
Das Widerstandsschweißen hatte nur<br />
einen Anteil von 2% an allen Verfahren<br />
(2 Betriebe, 20 Arbeitnehmer). Es wurde<br />
im Mittel in 200 Schichten pro Jahr angewendet<br />
(180 bis 220 Schichten/Jahr),<br />
dauerte aber nur 10 bis maximal 120<br />
Minuten/Schicht (Mittelwert: 48 Minuten/Schicht).<br />
Es war ausschließlich keine<br />
oder keine wirksame Absaugung an<br />
den Arbeitsplätzen vorhanden. Es wurde<br />
aber auch kein Messbedarf gesehen.<br />
Es war aber in einem Drittel der<br />
Fälle als zusätzliche persönliche Schutzausrüstung<br />
eine Atemschutzmaske vorhanden.<br />
Das Unterpulverschweißen war mit ca.<br />
2% auch relativ gering vertreten (3 Be-<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Laserstrahlschneiden<br />
Laserstrahlschweißen<br />
Metall-Aktivgasschweißen (MAG)<br />
Lichtbogenhandschweißen<br />
Abb. 3.40 Anteil der verwendeten Absaugungen (verfahrensbezogen)<br />
triebe, 22 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer).<br />
Es war ein ausschließlich<br />
ortsgebundenes Verfahren, das im Mittel<br />
nur in 70 Schichten/Jahr (10–77<br />
Schichten/Jahr) angewendet wurde. Die<br />
Einsatzdauer betrug im Mittel 270 Minuten/Schicht<br />
(60–300 Minuten/Schicht).<br />
In der Regel war keine Absaugung vorhanden<br />
und es wurde in keinem Fall<br />
eine zusätzliche persönliche Schutzausrüstung<br />
verwendet. In der Mehrzahl der<br />
Fälle lagen Messergebnisse mit Grenzwerteinhaltung<br />
vor. Messbedarf wurde<br />
nicht gesehen.<br />
Das Fülldrahtschweißen hatte nur etwa<br />
einen Anteil von 1,5% an allen Verfahren<br />
(5 Betriebe, 15 Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer). Es wurde etwa im Mittel<br />
in der Hälfte der jährlichen Schichten<br />
angewendet (120 Schichten/Jahr, minimal<br />
10 Schichten/Jahr, maximal 220<br />
Schichten/Jahr). Die Einsatzdauer reichte<br />
von 30 bis 390 Minuten pro Schicht<br />
(Mittelwert 150 Minuten/Schicht). In 80%<br />
der Fälle wurde eine lokale Absaugung<br />
verwendet, die entweder nach dem Ab-<br />
Autogen-Brennschneiden<br />
Metall-Inertgasschweißen (MIG)<br />
Plasmaschneiden<br />
Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)<br />
Hartlöten<br />
Fülldrahtschweißen<br />
Widerstandsschweißverfahren<br />
Lichtbogenspritzen<br />
Unterpulverschweißen<br />
luftprinzip funktionierte oder als BIA-geprüftes<br />
Umluftgerät ausgeführt war. Es<br />
wurde überwiegend ein funktionstüchtiger<br />
belüfteter Schweißerhelm getragen,<br />
dessen Einsatz als notwendig und<br />
zweckmäßig angesehen wurde. Die<br />
Hälfte der Anwendungen erfolgte in engen<br />
Räumen. Messergebnisse lagen<br />
nicht vor.<br />
Das Laserstrahlschweißen (Anteil 1%)<br />
wurde in 3 Betrieben angetroffen und<br />
dort von 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
durchgeführt. Ähnlich wie beim<br />
Laserstrahlschneiden bestand aufgrund<br />
der Anlagenbauform bzw. der lokalen<br />
Absaugung nur eine geringe Expositionsmöglichkeit,<br />
was teilweise vorhandene<br />
Messwerte belegten. Es wurden<br />
Cr-Ni-Stähle mit Gehalten an Chrom von<br />
15 bis 22% und Nickel von 2 bis 14%<br />
verwendet.<br />
Die Abbildungen 3.40, 3.41 und 3.42<br />
geben einen verfahrensbezogenen Überblick<br />
bezüglich der Absaugungen und<br />
zusätzlichen persönlichen Schutzausrüstungen<br />
(Schutz vor Schweißrauchen).<br />
Plasmaschweißen<br />
Elektronenstrahlschweißen<br />
Plasmapulverauftragschweißen<br />
keine lokale Absaugung<br />
keine Angabe zur Art<br />
andere wirksame Absaugung<br />
integrierte Brennerabsaugung<br />
mitgeführte lokale Absaugung<br />
gekapselte oder eingehauste Anlage
64<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Abb. 3.41 Funktionsprinzip der Absaugungen<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Laserstrahlschneiden<br />
Laserstrahlschweißen<br />
Laserstrahlschneiden<br />
Lichtbogenhandschweißen<br />
Laserstrahlschweißen<br />
Metall-Aktivgasschweißen (MAG)<br />
Metall-Aktivgasschweißen (MAG)<br />
Lichtbogenhandschweißen<br />
Metall-Inertgasschweißen (MIG)<br />
Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)<br />
Metall-Inertgasschweißen (MIG)<br />
Plasmaschneiden<br />
Autogen-Brennschneiden<br />
Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)<br />
Autogen-Brennschneiden<br />
Plasmaschneiden<br />
Abb. 3.42 Anteil vorhandener persönlicher Schutzausrüstungen (verfahrensbezogen)<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Hartlöten<br />
Fülldrahtschweißen<br />
Widerstandsschweißverfahren<br />
Hartlöten<br />
Fülldrahtschweißen<br />
Widerstandsschweißverfahren<br />
Lichtbogenspritzen<br />
belüfteter Schweißerhelm<br />
belüftete Maske<br />
Atemschutzmaske mit Filter<br />
übliche PSA<br />
Unterpulverschweißen<br />
Lichtbogenspritzen<br />
Unterpulverschweißen<br />
Plasmaschweißen<br />
Umluft ohne BIA-Prüfung<br />
Umluft mit BIA-Prüfung<br />
Abluft<br />
keine lokale Absaugung<br />
Plasmaschweißen<br />
Elektronenstrahlschweißen<br />
Plasmapulverauftragschweißen<br />
Plasmapulverauftragschweißen<br />
Elektronenstrahlschweißen
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 65<br />
Arbeitsmedizinische Vorsorge<br />
In 100 der 109 untersuchten Betriebe<br />
war ein Betriebsarzt tätig. Geht man<br />
davon aus, dass in den Betrieben, in<br />
denen die Einhaltung der Luftgrenzwerte<br />
nicht nachgewiesen wurde oder in denen<br />
die Gewerbeaufsichtsbeamten<br />
Messbedarf gesehen haben, auch Vorsorgeuntersuchungen<br />
notwendig waren,<br />
sind 64 Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer in 15 Betrieben nicht untersucht<br />
worden, obwohl dies erforderlich<br />
gewesen wäre. In vier dieser Betrie-<br />
Es wurden generelle Defizite bei der<br />
Einhaltung der Grundpflichten der Gefahrstoffverordnung<br />
festgestellt, weshalb<br />
bei Revisionen Augenmerk auf die<br />
Freisetzung von Gefahrstoffen zu legen<br />
ist. Bei den aufgezeigten Mängeln handelt<br />
es sich in der Regel um Ordnungswidrigkeiten,<br />
die abzustellen sind.<br />
Aufgrund des geringen Umfangs des<br />
vorliegenden Datenmaterials kann für<br />
die Verfahren Metall-Inertgasschweißen,<br />
Autogen-Brennschneiden, Hartlöten,<br />
Lichtbogenspritzen, Plasmaschweißen,<br />
Plasmapulverauftragschweißen und<br />
Elektronenstrahlschweißen keine verallgemeinerungsfähige<br />
Aussage zum<br />
Gefährdungspotenzial getroffen werden.<br />
Es handelt sich um wenige Fälle. In<br />
diesen Einzelfällen sind Prüfungen erforderlich.<br />
Bezüglich des Gefährdungspotenzials<br />
der anderen Verfahren ergibt sich ein<br />
differenziertes Bild.<br />
Unproblematisch erscheint die Anwendung<br />
des Laserstrahlschneidens oder<br />
-schweißens, des Plasmaschneidens und<br />
des Unterpulverschweißens. In diese<br />
be war nicht einmal ein Betriebsarzt<br />
tätig. Vorsorgeuntersuchungen, die sich<br />
auf den Umgang mit Chrom(VI) und/<br />
oder Nickel beziehen, wurden in 22 Betrieben<br />
an insgesamt 174 Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmern durchgeführt.<br />
Dabei wurden 25 Untersuchungen von<br />
6 Ärzten durchgeführt, die dafür keine<br />
Ermächtigung hatten.<br />
Behördliches Handeln<br />
Das Ziel des behördlichen Handelns<br />
Zusammenfassung<br />
Gruppe kann auch das Fülldrahtschweißen<br />
eingeordnet werden, da hier<br />
die Anwendung technischer und persönlicher<br />
Schutzmaßnahmen die Regel<br />
ist, insbesondere bei der Anwendung in<br />
engen Räumen. Das Widerstandsschweißen<br />
scheint nur mit einem geringen<br />
Expositionsrisiko verbunden zu sein.<br />
Die drei Hauptverfahren in abnehmender<br />
Reihenfolge ihrer Häufigkeit waren<br />
das Wolfram-Inertgasschweißen, das<br />
Metall-Aktivgasschweißen und das<br />
Lichtbogenhandschweißen.<br />
Beim Lichtbogenhandschweißen treten<br />
relevante Expositionen auf, die, wie auch<br />
literaturbekannt ist, häufig mit Grenzwertüberschreitungen<br />
verbunden sind.<br />
In Kombination mit einem mangelnden<br />
Schutz vor Schweißrauchen ist hier ein<br />
erhebliches Gefährdungspotenzial vorhanden.<br />
Derartige Arbeitsplätze sind<br />
daher bei Revisionen genauer zu untersuchen.<br />
Beim Metall-Aktivgasschweißen waren<br />
häufig weder eine Absaugung noch ein<br />
persönlicher Schutz gegen Schweißrauche<br />
vorhanden. Die Expositionen<br />
bestand darin, die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen<br />
Forderungen in<br />
angemessener Form unter Beachtung<br />
der konkreten betrieblichen Situation<br />
einzufordern. In 55 Betrieben wurde der<br />
Arbeitgeber beraten, 64 Betriebe erhielten<br />
Revisionsschreiben, in denen Forderungen<br />
zur Verbesserung des Arbeitsschutzes<br />
formuliert wurden. Einmal wurde<br />
ein Verwaltungsakt erlassen, und<br />
nur in 22 Betrieben (~ 20%) war kein<br />
behördliches Handeln notwendig.<br />
sind zwar bekanntermaßen geringer als<br />
beim Lichtbogenhandschweißen, stellen<br />
aber doch ein Gefährdungspotenzial<br />
dar, so dass diese Arbeitsplätze mit der<br />
erforderlichen Aufmerksamkeit überprüft<br />
werden müssen.<br />
Das Wolfram-Inertgasschweißen als<br />
wichtigstes dieser drei Verfahren ist auch<br />
das emissionsärmste. Beim Vorhandensein<br />
einer wirksamen Absaugung<br />
ist nur noch ein sehr geringes Gefährdungspotenzial<br />
vorhanden, so dass von<br />
persönlichen Schutzmaßnahmen in der<br />
Regel abgesehen werden kann.<br />
Bei zukünftigen Revisionen kann abgestuft<br />
anhand des vorhandenen Expositionsrisikos<br />
vorgegangen werden. Die<br />
Arbeitgeber sind entsprechend zu beraten.<br />
In diesem Zusammenhang sind<br />
auch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen<br />
differenziert auf ihre Notwendigkeit<br />
hin zu prüfen bzw. ist zu<br />
kontrollieren, ob die erforderlichen Ermächtigungen<br />
vorhanden sind.
66<br />
Entsprechend dem Zweck des<br />
JArbSchG, Kinder vor einer zu frühen<br />
Arbeitsaufnahme und Jugendliche entsprechend<br />
ihrem körperlichen und seelischen<br />
Entwicklungsstand vor Überforderungen<br />
und vor Gefahren am Arbeitsplatz<br />
zu schützen sowie den Jugendlichen<br />
ausreichende Freizeit zur Erholung<br />
und zur Persönlichkeitsentwicklung<br />
zu geben, wurden im Berichtsjahr <strong>2001</strong><br />
1309 Überprüfungen durchgeführt, bei<br />
denen 686 Mängel festgestellt wurden.<br />
Der Anteil der Kontrollen mit Mängeln<br />
betrug 20,4%, d.h., bei jeder 5. Kontrolle<br />
wurden Mängel im Jugendarbeitsschutz<br />
festgestellt. Auch bei Beschäftigung von<br />
Jugendlichen unter 18 Jahren stehen<br />
im LSA arbeitzeitrechtliche Verstöße, wie<br />
Nichteinhaltung der täglichen/wöchentlichen<br />
Arbeitszeit bzw. der<br />
Schichtarbeit,<br />
Verkürzung der Nachtruhe/Freizeit,<br />
Nichteinhaltung der Feiertagsruhe<br />
im Vordergrund.<br />
Weitere Mängel, die wiederholt auftraten<br />
waren:<br />
Schutz der arbeitenden Jugend<br />
Dipl.-Ing. Dietmar Glöckner, LAS Dessau<br />
fehlende Aufsicht bei der Arbeit durch<br />
Fachkundige,<br />
keine Unterweisung bei gefährlichen<br />
Arbeiten und<br />
die Gefährdungsbeurteilung wurde<br />
nicht erstellt.<br />
Darüber hinaus hatten 19 Jugendliche<br />
(1,4%) keine Erstuntersuchung nach §<br />
32 Abs. 1 JArbSchG und 37 Jugendliche<br />
(2,8%) hatten sich nicht der erforderlichen<br />
1. Nachuntersuchung gem. §<br />
33 Abs. 1 JArbSchG unterzogen.<br />
Bei der Überwachung der Einhaltung<br />
der Bestimmungen der Kinderarbeitsschutzverordnung<br />
(KindArbSchV) wurden<br />
im vergangenen Jahr landesweit 32<br />
Fälle von verbotener Kinderarbeit ermittelt,<br />
welche im Einzelnen in den nachfolgenden<br />
Branchen auftraten:<br />
Metallverarbeitung 6 Fälle<br />
Bauhauptgewerbe 4 Fälle<br />
Baunebengewerbe,<br />
Groß- und Einzelhandel,<br />
sonstige Dienstleistungen,<br />
Werbemittel-Zustellung 12 Fälle<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Glas- und Gebäudereinigung,<br />
Gesundheitswesen,<br />
Hotel- und Gastgewerbe 6 Fälle<br />
Landwirtschaft,<br />
Gärtnerei,<br />
Bäckerei,<br />
Herstellung von Möbeln 4 Fälle<br />
In den festgestellten Fällen handelte es<br />
sich um eine Beschäftigung von Schülerinnen<br />
und Schülern im Alter unter 15<br />
Jahren in den Ferien.<br />
In allen Fällen wurde die Beschäftigung<br />
durch behördliches Handeln der Gewerbeaufsicht<br />
sofort eingestellt und Arbeitgeber<br />
und Eltern wurden über die Vorschriften<br />
zur Kinderarbeit unterrichtet.<br />
Im Jahr <strong>2001</strong> ging die Gesamtzahl der<br />
ärztlichen Untersuchungen nach dem<br />
JArbSchG – dem Trend der Bevölkerungsentwicklung<br />
folgend – um 14,2%<br />
von 29.602 im Vorjahr auf 25.393 zurück.<br />
Für diese gesundheitliche Betreuung<br />
der Jugendlichen wurden von der zuständigen<br />
Stelle im LSA, dem GAA Halle,<br />
Untersuchungskosten in Höhe von<br />
rund 1,2 Mio. DM an Gesundheitsämter<br />
und niedergelassene Ärzte erstattet.<br />
Kontrolle der Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes in ausbildenden<br />
Betrieben des Gastgewerbes<br />
Genießt man am Wochenende oder<br />
nach einem anstrengenden Arbeitstag<br />
das gemütliche Ambiente eines Restaurants,<br />
macht man sich sicher keine Gedanken<br />
darüber, dass sich noch nicht<br />
alle Ausbildungsbetriebe im Gastgewerbe<br />
ihrer Verantwortung für die Berufsausbildung<br />
junger Menschen voll<br />
bewusst sind. So zeigen die Ergebnisse<br />
von Betriebsrevisionen in Hotels und<br />
Gaststätten in den letzten Jahren, dass<br />
die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes<br />
weit häufiger verletzt werden,<br />
als in anderen Branchen. Daneben haben<br />
sich eine Vielzahl von Eltern und<br />
Auszubildenden mit Anzeigen und Beschwerden<br />
hilfesuchend an die Arbeitsschutzverwaltung<br />
gewandt.<br />
Um die schon schwierige Ausbildungssituation<br />
dieser Jugendlichen, die Attraktivität<br />
der beruflichen Ausbildung und<br />
damit gleichzeitig das Image der Branche<br />
zu verbessern, wurde von der<br />
Arbeitsschutzverwaltung eine landesweite<br />
Beratungs- und Kontrollaktion zum<br />
Jugendarbeitsschutz im Gastgewerbe<br />
durchgeführt. An vorderster Stelle sollte<br />
neben der Kontrolle die Beratung über<br />
die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes<br />
für Arbeitgeber, Ausbildungsverantwortliche<br />
und Jugendliche<br />
stehen. Ziel war es auch, die z. Z.<br />
nicht befriedigende Ausbildungsbereitschaft<br />
der Betriebe im Land Sachsen-<br />
Anhalt durch diese Sonderaktion keinesfalls<br />
zu verschlechtern.
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 67<br />
Durch entsprechende Informationen<br />
wurden die Industrie- und Handelskammern<br />
Halle-Dessau und Magdeburg, der<br />
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband<br />
Sachsen-Anhalt und die Gewerkschaft<br />
Nahrung, Genuss, Gaststätten<br />
sowie Berufsschulen des Gastgewerbes<br />
über Ziele und Inhalt der Sonderaktion<br />
unterrichtet und um Mitarbeit gebeten.<br />
Für die Jugendlichen und die Arbeitgeber<br />
wurden entsprechend zugeschnittene<br />
Merkblätter zum Jugendarbeitsschutz<br />
herausgegeben. Von der IHK<br />
erhielten die Gewerbeaufsichtsämter<br />
eine Aufstellung der ausbildenden Betriebe<br />
in ihrem Aufsichtsbezirk. Je Gewerbeaufsichtsamt<br />
sollten mindestens<br />
20 Ausbildungsbetriebe der Wirtschaftsklassen<br />
55.1 Hotels, Gasthöfe, Pensionen<br />
und Hotels garni<br />
55.3 Restaurants, Cafés, Eisdielen<br />
und Imbisshallen<br />
55.40.1 Schankwirtschaften<br />
55.40.3 Diskotheken und Tanzlokale<br />
55.52.0 Caterer<br />
überprüft werden. Ein besonderes Augenmerk<br />
sollte auf die Einhaltung arbeitszeitrechtlicher<br />
Vorschriften sowie<br />
die Beschäftigung am Wochenende und<br />
Tabelle 3.4 Hauptverstöße nach dem JArbSchG(Auszug)<br />
Jugendarbeitsschutzgesetz Gesamt<br />
Verstöße<br />
an Feiertagen gerichtet werden.<br />
Von März bis Oktober <strong>2001</strong> wurden<br />
insgesamt 216 Betriebsstätten mittels<br />
Checklisten überprüft, in welchen Auszubildende<br />
für die Berufe<br />
Fachkraft im Gastgewerbe<br />
Restaurantfachfrau/-fachmann<br />
Fachfrau/-mann für Systemgastronomie<br />
Köchin/Koch<br />
Hotelfachfrau/-mann<br />
Hotelkauffrau/-mann<br />
oder als Hilfskräfte bzw. Aushilfskräfte<br />
beschäftigt waren. Zum Teil wurden auch<br />
Nachkontrollen durchgeführt. In 41%<br />
der überprüften Betriebe wurden insgesamt<br />
450 Gesetzesverstöße im Jugendarbeitsschutz<br />
festgestellt (Tabelle 3.4).<br />
62% der rechtlichen Defizite traten in<br />
den kleineren Betrieben und 38% in den<br />
mittleren Betrieben auf.<br />
Die Arbeitgeber bzw. die von ihnen beauftragten<br />
Ausbildungsverantwortlichen<br />
sowohl in Hotels, Gaststätten und Pensionen<br />
als auch in Restaurants, Cafés<br />
und Eisdielen richteten gleichermaßen<br />
nicht immer ihr Augenmerk ausreichend<br />
Anteil der Anteil der Betriebs-<br />
Betriebsstätten mit stätten mit Mängeln,<br />
Verstoß gegen §§ mit Verstoß gegen §§<br />
1. §18 Abs. 2 Sonderregelungen Feiertagsruhe 64 29,6% 51,0%<br />
2. §47 Gesetz/Aufsichtsbehörde 34 15,7% 27,6%<br />
3. § 8 Abs. 1 tägliche/wöchentliche Arbeitszeit 31 14,4% 25,2%<br />
4. §15 5-Tage-Woche 28 13,0% 22,8%<br />
5. §17 Abs. 2 Freistellung – Sonntag 27 12,5% 22,0%<br />
6. §18 Abs. 1; 24./31. Dezember – Feiertage 27 12,5% 22,0%<br />
7. §13 Mindestfreizeit 20 9.3% 16,3%<br />
8. §14 Abs. 2 Sonderregelung Nachtruhe 19 8,8% 15,4%<br />
9. §12 Schichtzeit 18 8,3% 14,6%<br />
10. §14 Abs. 1 Nachtruhe 18 8,3% 14,6%<br />
11. §18 Abs. 3 Ersatz - Freistellung 18 8,3% 14,6%<br />
auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen<br />
zum Schutze der arbeitenden<br />
Jugend.<br />
In den Diskotheken und Tanzlokalen<br />
wurden keine Jugendlichen ausgebildet<br />
und insgesamt nur ein Jugendlicher<br />
als Beschäftigter vorgefunden.<br />
Eine Aufstellung der Hauptverstöße gegen<br />
das JArbSchG im Gastgewerbe in<br />
Sachsen-Anhalt im Jahr <strong>2001</strong> (Tabelle<br />
3.4) zeigt, dass ca. 30% der Betriebe die<br />
Sonderregelungen “Beschäftigungsverbot<br />
am 25. Dezember, 1. Januar,<br />
erster Osterfeiertag und am 1. Mai” zur<br />
Feiertagsruhe nicht einhalten. In 14,4%<br />
der Betriebe gab es Probleme mit der<br />
Dauer der täglichen und wöchentlichen<br />
Arbeitszeit der Auszubildenden und Beschäftigung<br />
nach 22.00/23.00 Uhr.<br />
12,5% der Betriebe hatten auch Jugendliche<br />
am 24. Dezember bzw. 31. Dezember<br />
nach 14.00 Uhr beschäftigt.<br />
Probleme gab es auch mit der Einhaltung<br />
der 5-Tage-Woche. In je neun Fällen<br />
hatten sich Jugendliche nicht der Erstuntersuchung<br />
(§ 32 Abs. 1 JArbSchG)<br />
bzw. der Ersten Nachuntersuchung (§<br />
33 Abs. 1 JArbSchG) unterzogen. In<br />
einem Fall wurde verbotene Kinderarbeit<br />
im Alter unter 15 Jahren festgestellt.<br />
Betriebe mit 1 - 19<br />
Beschäftigten<br />
Kontrollierte Betriebe<br />
Keine Mängel<br />
festgestellt<br />
Mängel festgestellt<br />
41,1%<br />
Betriebe mit Mängeln je Größenklasse<br />
Betriebe m it 1 - 19<br />
Beschäftigten<br />
Mängel je Größenklasse<br />
62%<br />
66%<br />
Betriebe mit 20 - 199<br />
Beschäftigten<br />
38%<br />
Betriebe m it 20 - 199<br />
Beschäftigten<br />
33%
68<br />
Diesem Schwerpunkt widmeten sich im<br />
Jahr 2000/<strong>2001</strong> drei Kontrollen der Gewerbeaufsicht,<br />
wobei Bildschirmarbeitsplätze<br />
in Büros, in Messwarten der<br />
chemischen Industrie und in Krankenhäusern<br />
untersucht wurden.<br />
Die Vermutung, dass die Bildschirmarbeitsverordnung<br />
im Bewusstsein von<br />
Arbeitgebern und Beschäftigten einen<br />
geringeren Stellenwert als andere Regelwerke<br />
des Arbeitsschutzes einnimmt,<br />
bestätigte sich im Verlauf der Kontrollen.<br />
Insbesondere wurden Defizite in<br />
der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze<br />
und im Wissen zu möglichen<br />
Gesundheitsbeeinträchtigungen<br />
und zu den sich aus der Bildschirmarbeitsverordnung<br />
ergebenden Pflichten<br />
für den Arbeitgeber sowohl bei den<br />
Verantwortlichen wie auch bei den Beschäftigten<br />
festgestellt. Teilweise war<br />
Bildschirmarbeitsplätze überprüft<br />
Dipl.-Ing. Andrea-Leonore Wendenburg<br />
Durch den Einzug der Informationstechnik<br />
in fast alle Berufsgruppen nimmt<br />
die Zahl der Bildschirmarbeitsplätze<br />
ständig zu – ob als klassischer Büroarbeitsplatz<br />
oder z. B. in Überwachungseinrichtungen<br />
der Industrie.<br />
Am 20. Dezember 1996 ist die Bildschirmarbeitsverordnung<br />
3.2) in Kraft getreten.<br />
Mit einer ganzheitlichen Betrachtung<br />
soll durch die Bildschirmarbeitsverordnung<br />
den arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren<br />
am Bildschirmarbeitsplatz<br />
entgegengewirkt werden und<br />
eine kontinuierliche Leistungsfähigkeit<br />
der Beschäftigten gesichert werden.<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Doch wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus?<br />
die Bildschirmarbeitsverordnung nicht<br />
einmal bekannt. Hieraus ergibt sich ein<br />
großer Informations- und Beratungsbedarf<br />
in den Unternehmen.<br />
Die gesundheitlichen Gefährdungen<br />
durch Bildschirmarbeitsplätze werden<br />
in den Unternehmen sehr oft unterschätzt.<br />
Die Belastungs- und Beanspruchungssituation<br />
ist bei den Unternehmern<br />
und auch den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern nicht ausreichend bekannt.<br />
Dabei treten immer wieder Kopfschmerzen,<br />
vorzeitige Erschöpfung und<br />
Konzentrationsmangel sowie Probleme<br />
der Augen und des Stütz- und Bewegungsapparates<br />
auf, was wiederum zu<br />
Leistungsminderung und Arbeitsausfällen<br />
führt. Eine Aufgabe der Arbeitsschutzverwaltung<br />
wird es daher künftig<br />
sein, dieses Thema deutlicher in die<br />
Öffentlichkeit zu tragen, um Arbeitge-<br />
Kernpunkte der Bildschirmarbeitsverordnung<br />
sind die<br />
• Beurteilung der Arbeitsbedingungen,<br />
sichere und gesundheitsgerechte<br />
Gestaltung des Arbeitsplatzes<br />
(Hard- und Software),<br />
Untersuchung der Augen und des<br />
Sehvermögens und<br />
Organisation des Arbeitsablaufes.<br />
ber und Beschäftigte zu sensibilisieren,<br />
einen wirksamen Beitrag für einen<br />
belastungsarmen Bildschirmarbeitsplatz<br />
zu leisten.<br />
Der Arbeitgeber hat eine umfassende<br />
Verantwortung für die Sicherheit und<br />
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten<br />
in seinem Betrieb. Ein Schwerpunkt<br />
für Bildschirmarbeitsplätze stellt die Beurteilung<br />
der Arbeitsbedingungen im<br />
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung<br />
nach dem Arbeitsschutzgesetz dar, um<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen<br />
am Arbeitsplatz und zur erforderlichen<br />
Unterweisung der Beschäftigten<br />
ableiten zu können. Hier ist eine<br />
ganzheitliche Betrachtung durch Einbezug<br />
aller relevanten Faktoren am Arbeitsplatz,<br />
wie z. B. Hardware, Möbel,<br />
Software, Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation,<br />
Qualifikation und Beteili-<br />
3.2) BildscharbV [Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz<br />
bei der Arbeit an Bildschirmgeräten vom<br />
4. Dezember 1996 (BGBI I S. 1843), zuletzt geändert<br />
durch Artikel 396 des Gesetzes vom 29. Oktober <strong>2001</strong><br />
(BGBI. I S. 2785, 2865)]
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 69<br />
gung der Beschäftigten sowie die arbeitsmedizinische<br />
Vorsorge, notwendig.<br />
Da die Arbeitsmittel (Bildschirm, Tastatur,<br />
Stuhl, Arbeitstisch u.a.m.) meist einen<br />
hohen technischen Standard aufweisen<br />
und der Norm entsprechen, ergeben<br />
sich günstige ergonomische Voraussetzungen.<br />
Diese Voraussetzungen<br />
werden jedoch nicht optimal genutzt,<br />
da in der Kombination der einzelnen<br />
Arbeitsmittel Mängel auftreten und auch<br />
der Nutzer nicht die ergonomisch günstigeren<br />
Einstellungen kennt bzw. nutzt.<br />
Hier sollte ein enges Zusammenarbeiten<br />
der Sicherheitsfachkraft, des Betriebsarztes<br />
und der einzelnen Mitarbeiter<br />
erfolgen. Die Arbeitsschutzverwaltung<br />
übernimmt die Informations-<br />
und Beratungsfunktion zu allen<br />
anstehenden Fragen und Problemen.<br />
Die Einbeziehung der Beschäftigten in<br />
die Arbeitsplatzgestaltung ist ein sehr<br />
wichtiger Aspekt. Durch die frühzeitige<br />
Beteiligung erhöht sich die Akzeptanz<br />
zur Neu- bzw. Umgestaltung des Arbeitsplatzes,<br />
es können Informationen<br />
gegeben werden, die Mitarbeiterzufriedenheit<br />
erhöht sich und unnötige Investitionen<br />
können vermieden werden. Die<br />
Beachtung der individuellen Vorstellungen<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
im Einklang mit ergonomisch günstiger<br />
Gestaltung ist maßgebend für einen<br />
gesunden Bildschirmarbeitsplatz.<br />
Ein hohes Potenzial für den Abbau von<br />
Belastungen liegt im Verhalten der Beschäftigten,<br />
sofern die arbeitsorganisatorischen<br />
Bedingungen es zulassen.<br />
Die Organisation des täglichen Arbeitsablaufes<br />
sollte Tätigkeitswechsel beinhalten,<br />
um die Arbeit am Bildschirm zu<br />
unterbrechen. Tätigkeitswechsel bringen<br />
eine Entspannung der Augen und<br />
Bewegung in den Arbeitsalltag. Der aus<br />
der vorwiegend sitzenden Tätigkeit resultierende<br />
Bewegungsmangel belastet<br />
den ganzen Organismus. Mehr Dynamik<br />
und Bewegung bei der Arbeit<br />
können alle am Bildschirm Tätigen<br />
durch eigene Aktivität in den Arbeitsablauf<br />
integrieren. Besteht die Möglichkeit<br />
des Tätigkeitswechsels nicht, so<br />
sind dem Beschäftigten am Bildschirmarbeitsplatz<br />
mehrere Kurzpausen zu ermöglichen,<br />
um Ermüdungserscheinungen<br />
vorzubeugen. Die Gewährung<br />
von arbeitsbedingten (bezahlten) Kurzpausen<br />
stellt jedoch für einige Unternehmen<br />
ein Problem dar, wenn keine<br />
Betriebsvereinbarung oder tarifliche<br />
Vereinbarung zu diesem Sachverhalt<br />
existieren. Die sogenannte “Mischarbeit”<br />
(wechselnde Tätigkeiten) ist nach<br />
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen<br />
die sinnvollere Alternative. Ihr<br />
sollte der Vorzug vor der Gewährung<br />
von Kurzpausen gegeben werden.<br />
Ebenso sollte die vom Arbeitgeber anzubietende<br />
Untersuchung der Augen<br />
und des Sehvermögens vor Aufnahme<br />
der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen<br />
durch eine fachkundige Person<br />
von den Beschäftigten künftig verstärkt<br />
in Anspruch genommen werden.<br />
Hinweise für die Durchführung dieser<br />
Untersuchung bietet der berufsgenossenschaftliche<br />
Grundsatz “Bildschirmarbeitsplätze”<br />
(G37).
70<br />
Die Revisionstätigkeit der Staatlichen<br />
Gewerbeaufsichtsämter, aber auch die<br />
innerbetriebliche Aufsicht durch den Arbeitgeber<br />
bzw. ihn beratende Fachkräfte<br />
ist bisher überwiegend eine mängelund<br />
expertenorientierte Aufsicht. Einzelne<br />
Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften<br />
aller Art werden von dafür ausgebildeten<br />
Fachleuten gesucht, aufgelistet,<br />
z. T. sanktioniert und ihre Abstellung<br />
wird kontrolliert. Dieses System<br />
stößt an seine Grenzen, weil die in der<br />
Arbeitsschutzorganisation des Betriebes<br />
liegenden Ursachen für immer wieder<br />
auftretende Mängel im Arbeitsschutz so<br />
weitgehend fortbestehen. Hinzu kommt,<br />
dass der moderne Arbeitsschutz nicht<br />
nur Unfallverhütung und Verhütung arbeitsbedingter<br />
Erkrankungen und Berufskrankheiten<br />
umfasst, sondern auch<br />
die Berücksichtigung aller körperlichen,<br />
psychischen und sozialen Belastungen<br />
im Arbeitsleben verlangt. Fehlbelastungen<br />
dieser Art sind durch die klassische<br />
behördliche Revision kaum aufzudecken.<br />
Sollen nachhaltige Verbesserungen erreicht<br />
werden, muss das Gesamtsystem<br />
der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation<br />
geprüft und ertüchtigt werden.<br />
Das aber erfordert von den Gewerbeaufsichtsbeamten<br />
mehr Systemkontrolle,<br />
verbunden mit sachkundiger Beratung<br />
des Unternehmers und nicht nur<br />
Feststellung einzelner Mängel. Um hier<br />
Erfahrungen zu sammeln, wurde durch<br />
das GAA Halle im Jahre <strong>2001</strong> eine<br />
Schwerpunktaktion in der Metall- und<br />
Elektrobranche durchgeführt.<br />
Kontrolliert wurden 106 längere Zeit nicht<br />
aufgesuchte Betriebe mit 11 bis 20 Beschäftigten.<br />
Wirksamkeit der Arbeitsschutzaufsicht<br />
Dipl.-Phys. Klaus Machlitt, Dr.-Ing. Bernhard Räbel, GAA Halle<br />
Die Kontrollstrategie war so angelegt,<br />
dass die Ergebnisse einer üblichen<br />
mängelorientierten Regelrevision einschließlich<br />
der Kontrolle betrieblicher<br />
Dokumente als Indikator für die Funktionsfähigkeit<br />
der innerbetrieblichen<br />
Arbeitsschutzorganisation verwendet<br />
werden konnten. Die Erkenntnisse wurden<br />
anschließend mit dem Unternehmer/Geschäftsführer<br />
in einem persönlichen<br />
Gespräch ausgewertet. Soweit wie<br />
möglich sollte dabei auf ein ordnungsrechtliches<br />
Vorgehen verzichtet werden<br />
und dafür qualifizierte Beratung, Hilfe<br />
und Motivation im Mittelpunkt stehen.<br />
Langfristig soll ein auf die Bedürfnisse<br />
des Kleinbetriebes abgestimmtes Arbeitsschutzmanagementsystem,<br />
das<br />
selbstkontrollierend und selbstregulierend<br />
funktioniert, implementiert werden.<br />
Die innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation<br />
wurde nach folgenden 11 Kriterien<br />
bewertet:<br />
Bewertungsindex<br />
2<br />
23%<br />
Bewertungsindex<br />
-2<br />
2%<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Bewertungsindex<br />
-1<br />
11%<br />
Abb. 3.43 Gesamteinschätzung der Arbeitsschutzorganisation<br />
1. Arbeitsschutz als ein Unternehmensziel<br />
2. Vorbehaltsaufgaben des Arbeitgebers<br />
im Arbeitsschutz<br />
3. Pflichtenübertragung im Arbeitsschutz<br />
4. Organisatorische Festlegungen und<br />
Weisungen<br />
5. Mittelbereitstellung für den Arbeitsschutz<br />
6. Mitwirkung der Beschäftigten/des<br />
Betriebsrates<br />
7. Beurteilung der Arbeitsbedingungen/Gefährdungsbeurteilung<br />
8. Erfassung und Auswertung von Unfällen<br />
9. Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit<br />
Bewertungsindex<br />
1<br />
35%<br />
Bewertungsindex<br />
0<br />
29%
Arbeitsschutzschwerpunkte im Land 71<br />
10. Bestellung eines Betriebsarztes<br />
11. Unterweisung der Beschäftigten<br />
Die Gesamteinschätzung der Arbeitsschutzorganisation<br />
erfolgte in einer fünfstufigen<br />
Skalierung (Bewertungsindex)<br />
von -2 „Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
hat keine ausreichende Bedeutung im<br />
Unternehmen, Arbeitsschutzorganisation<br />
fehlt oder ist stark mangelhaft“ bis<br />
+2 „Arbeits- und Gesundheitsschutz ist<br />
aktiver Bestandteil der Unternehmensstrategie“.<br />
Die Gesamteinschätzung der Arbeitsschutzorganisation<br />
als Analyse des Ist-<br />
Zustandes zeigt Abb. 3.43. Überraschend<br />
war, dass in etwa einem Viertel<br />
der Betriebe (23%) der Arbeits- und<br />
Gesundheitsschutz aktiver Bestandteil<br />
der Unternehmerstrategie ist (Bewertungsindex<br />
2), und in immerhin noch<br />
35% aller Unternehmen der Arbeits- und<br />
Gesundheitsschutz in der Unternehmensführung<br />
verankert ist (Bewertungsindex<br />
1) und nur bei bestimmten<br />
Kriterien Nachholbedarf bestand. In<br />
insgesamt 13% aller geprüften Betriebe<br />
war der Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
nicht organisiert und sehr mangelhaft<br />
(Bewertungsindex -1 und -2).<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
8<br />
16<br />
25<br />
12<br />
Verteilung der Betriebe nach Mängelgruppen<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
Ø 1 Mangel<br />
pro<br />
Betrieb<br />
Ø 3 Mängel<br />
pro<br />
Betrieb<br />
2 1 0 -1 -2<br />
Bewertungsindex der Arbeitsschutzorganisation<br />
Den Zusammenhang zwischen der bei<br />
der Revision festgestellten durchschnittlichen<br />
Anzahl der Mängel und dem<br />
Bewertungsindex der Arbeitsschutzorganisation<br />
zeigt Abb. 3.44.<br />
Ø 3 Mängel<br />
pro<br />
Betrieb<br />
Ø 6 Mängel<br />
pro<br />
Betrieb<br />
0 Mängel 1 Mangel 2 Mängel >=3 Mängel<br />
Ø 12 Mängel<br />
pro<br />
Betrieb<br />
Abb. 3.44 Verteilung der Betriebe nach Mängelhäufigkeit in Abhängigkeit vom Bewertungsindex<br />
27<br />
4<br />
2 1 0 -1 -2<br />
Bewertungsindex der Arbeitsschutzorganisation<br />
zertifizierte Unternehmen nicht zertifizierte Unternehmen<br />
Abb. 3.45 Bewertungsindex der Arbeitsschutzorganisation im Vergleich von zertifizierten und<br />
nicht zertifizierten Betrieben<br />
11<br />
1<br />
2<br />
Man erkennt, dass der Zusammenhang<br />
zwischen Qualität der Arbeitsschutzorganisation<br />
und festgestellter Mängelquote<br />
tatsächlich besteht und insoweit<br />
die Mängelquote bei Nachkontrollen als<br />
Gradmesser für die Verbesserung des<br />
innerbetrieblichen Arbeitsschutzsystems<br />
verwendet werden kann.<br />
Von den 106 Unternehmen besaßen 33<br />
ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem<br />
(ISO 900X) und/oder waren<br />
arbeitsschutzbezogen SCC (Sicherheits<br />
Certificat Contraktoren) zertifiziert. Abb.<br />
3.45 zeigt im Vergleich zwischen zertifizierten<br />
und nicht zertifizierten Unternehmen,<br />
dass im Unternehmen eingeführte<br />
Managementsysteme sich nachweisbar<br />
positiv auf den Arbeitsschutz in der Praxis<br />
auswirken. Beide Betriebe mit der<br />
schlechtesten Bewertung (-2) hatten kein<br />
Managementsystem, aber 66% aller<br />
Unternehmen mit der besten Bewertung<br />
(2) waren zertifiziert.<br />
Folgende allgemeine Erkenntnisse sind<br />
ableitbar:<br />
Eine gute Arbeitsorganisation im Unternehmen<br />
senkt die Mängelquote im<br />
Arbeitsschutz.
72<br />
Entscheidend für das Funktionieren<br />
der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation<br />
in Kleinbetrieben ist die<br />
Haltung des Unternehmers, die Firmenphilosophie<br />
in der Frage des<br />
Arbeitsschutzes.<br />
Der Unternehmer verlässt sich häufig<br />
darauf, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit<br />
den Arbeitsschutz<br />
insgesamt kontrolliert und vordenkt.<br />
Das ist nach dem Arbeitsschutzgesetz<br />
so nicht vorgesehen. Die Möglichkeit<br />
der Verantwortungsübertragung<br />
auf nachgeordnete Leiter wird<br />
dagegen zu wenig genutzt.<br />
Kontrollen im Arbeitsschutz sind häufig<br />
nicht kontinuierlich oder regelmäßig<br />
wiederkehrend geplant, sondern<br />
bedürfen immer eines Anlasses. Hier<br />
muss bei der Verbesserung angesetzt<br />
werden. U. a. ist die Einbeziehung<br />
der Beschäftigten ein sicheres<br />
Mittel, Mängel und Mängelursachen<br />
festzustellen und eine lau-<br />
fende Selbstkontrolle zu erreichen.<br />
Hilfsmittel, wie Vorlagen und Formblätter<br />
zur Organisation des Arbeitsschutzes,<br />
wurden häufig nachgefragt.<br />
Sie liegen jetzt mit dem LASI-Leitfaden<br />
LV 22 als Handlungshilfe vor.<br />
Haupthemmnisse, die immer wieder<br />
zur Sprache kamen, sind aus der Sicht<br />
der Unternehmer u. a. folgende:<br />
Zu wenig Zeit für den Arbeitsschutz<br />
und zu viele Gesetze und Vorschriften,<br />
Schlechte Auftragslage und harter<br />
Konkurrenz- und Termindruck gehen<br />
z. T. zu Lasten des Arbeitsschutzes,<br />
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
sind nachlässig im Arbeitsschutz, was<br />
durch die Unternehmer nicht ständig<br />
kompensiert werden kann.<br />
Ein Erfolg der Schwerpunktaktion ist,<br />
dass in 26% aller Betriebe die Unternehmer<br />
nach dem ausführlichen Ge-<br />
<strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
spräch von sich aus bereit waren, die<br />
Arbeitsschutzorganisation durchgreifend<br />
zu verbessern. Z.T. wurden konkrete<br />
Vereinbarungen getroffen.<br />
Über die Nachhaltigkeit der Schwerpunktaktion<br />
kann erst später befunden<br />
werden, ein Maßstab dafür ist die Senkung<br />
der Mängelquote. Das ist nur im<br />
zeitlichen Längsschnitt und mit Detailkontrollen<br />
dauerhaft nachzuweisen.<br />
Wenn sich dabei Erfolge abzeichnen,<br />
sollten diese Ergebnisse mit Fachverbänden<br />
und Innungen ausgewertet werden,<br />
um Breitenwirkung zu erzielen. Zu<br />
beobachten wird sein, ob sich positive<br />
wirtschaftliche Aspekte beweisen lassen,<br />
was für die Argumentation gegenüber<br />
den Unternehmern zunehmend<br />
wichtiger wird.<br />
Die Schwerpunktaktion wird im Jahre<br />
2002 fortgeführt, 2003 sind Nachkontrollen<br />
durchzuführen und die sich<br />
ergebenden Erkenntnisse auszuwerten.
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 73<br />
Anhang
74 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Alle Tabellen Stand 31. Dezember <strong>2001</strong><br />
Tabellen<br />
Tabelle 1 Personal der Arbeitsschutzbehörden<br />
laut Stellenplan<br />
Zentralinstanz Mittelinstanz Ortsinstanz Sonstige<br />
Dienststellen<br />
Summe<br />
1 2 3 4 5<br />
1 Ausgebildete Gewerbeaufsichtsbeamte<br />
Höherer Dienst 9 14 58 – 81<br />
Gehobener Dienst 4 7 130 – 141<br />
Mittlerer Dienst 1 – 37 38<br />
Summe 1 14 21 225 – 260<br />
2 Gewerbeaufsichtsbeamte in Ausbildung<br />
Höherer Dienst – – – – –<br />
Gehobener Dienst – – 6 – 6<br />
Mittlerer Dienst – – – – –<br />
Summe 2 – – 6 – 6<br />
3 Gewerbeärzte – 4 6 – 10<br />
4 Entgeltprüfer – – – – –<br />
5 Sonstiges Fachpersonal<br />
Höherer Dienst 4 12 – – 16<br />
Gehobener Dienst 3 24 3 – 30<br />
Mittlerer Dienst 1 29 2 – 32<br />
Summe 5 8 65 5 – 78<br />
6 Verwaltungspersonal – 20 54 – 74<br />
insgesamt *) 22 110 296 – 428<br />
*) Von den insgesamt 428 Beschäftigten der Gewerbeaufsichtsverwaltung waren 51Personen im Bereich der Arbeitsförderung tätig.<br />
Tabelle 2 Betriebe und Beschäftigte im Zuständigkeitsbereich<br />
Tabelle 3.1Dienstgeschäfte in Betrieben<br />
befindet sich auf Seite 76 ff.<br />
Betriebe Beschäftigte<br />
Jugendliche Erwachsene Summe<br />
männlich weiblich Summe männlich weiblich Summe<br />
Größenklasse 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1: 1.000 und mehr Beschäftigte 21 2.320 1.796 4.116 15.643 14.165 29.808 33.924<br />
2: 200 bis 999 Beschäftigte 454 1.904 1.170 3.074 80.264 82.227 162.491 165.565<br />
3: 20 bis 199 Beschäftigte 8.184 5.162 2.334 7.496 228.822 159.886 388.708 396.204<br />
4: 1 bis 19 Beschäftigte 73.932 3.529 2.602 6.131 161.902 162.859 324.761 330.892<br />
Summe 1 - 4 82.591 12.915 7.902 20.617 486.631 419.137 905.768 926.585<br />
5: ohne Beschäftigte 23.733<br />
insgesamt 106.324 12.915 7.902 20.817 486.631 419.137 905.768 926.585
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 75<br />
Tabelle 3.2Dienstgeschäfte bei sonstigen Arbeitsstellen und Anlagen außerhalb des Betriebes<br />
Position Art der Arbeitsstelle bzw. Anlage Dienstgeschäfte<br />
1 Baustellen ........................................................................................................................................................................ 7.730<br />
2 überwachungsbedürftige Anlagen .......................................................................................................................................... 91<br />
3 Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ................................................................................................................. 1<br />
4 Lager explosionsgefährlicher Stoffe ......................................................................................................................................... 2<br />
5 Märkte und Volksfeste (fliegende Bauten, ambulanter Handel) .............................................................................................. 102<br />
6 Ausstellungsstände ............................................................................................................................................................... 81<br />
7 Straßenfahrzeuge ............................................................................................................................................................. 3.715<br />
8 Wasserfahrzeuge .................................................................................................................................................................... 3<br />
9 Heimarbeitsstätten .................................................................................................................................................................. 5<br />
10 private Haushalte (ohne Beschäftigte) .................................................................................................................................... 23<br />
11 übrige ................................................................................................................................................................................. 484<br />
insgesamt ..................................................................................................................................................................... 12.237<br />
Tabelle 3.3Sonstige Dienstgeschäfte im Außendienst *)<br />
*) sofern sie nicht in Betrieben nach Tabelle 3.1 oder bei sonstigen Arbeitsstellen und Anlagen nach Tabelle 3.2 durchgeführt wurden<br />
Position Position Art Art der der der Dienstgeschäfte Dienstgeschäfte<br />
Anzahl Anzahl<br />
Anzahl<br />
1 Besprechungen bei<br />
1.1 Verwaltungsbehörden ................................................................................................................................................ 191<br />
1.2 Gerichten, Staatsanwaltschaften, Polizei ...................................................................................................................... 15<br />
1.3 sachverständigen Stellen ............................................................................................................................................. 28<br />
1.4 Sozialpartnern ............................................................................................................................................................... 5<br />
1.5 Antragstellern .............................................................................................................................................................. 88<br />
1.6 Beschwerdeführern ....................................................................................................................................................... 3<br />
1.7 Privatpersonen (ohne 1.5 und 1.6) .............................................................................................................................. 11<br />
1.8 übrigen ....................................................................................................................................................................... 34<br />
2 Vorträge, Vorlesungen vor<br />
2.1 Sozialpartnern ............................................................................................................................................................... 7<br />
2.2 Betriebsärzten, Fachkräften für Arbeitssicherheit .......................................................................................................... 15<br />
2.3 Sicherheitsbeauftragten ................................................................................................................................................. 9<br />
2.4 Behörden .................................................................................................................................................................... 17<br />
2.5 Schülern, Studenten, Auszubildenden .......................................................................................................................... 10<br />
2.6 übrigen ....................................................................................................................................................................... 25<br />
3 Sonstiges<br />
3.1 Anhörung nach OWiG, VwVfG .................................................................................................................................... 121<br />
3.2 Erörterungen nach BImSchG ......................................................................................................................................... 7<br />
3.3 Ausschusssitzungen ................................................................................................................................................... 30<br />
3.4 Prüfungen ................................................................................................................................................................... 81<br />
3.5 übrige ......................................................................................................................................................................... 90<br />
insgesamt ....................................................................................................................................................................... 787
76 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Tabelle 3.1Dienstgeschäfte in Betrieben<br />
GK 1: 1.000 und mehr Beschäftigte<br />
GK 2: 200 bis 999 Beschäftigte<br />
GK 3: 20 bis 199 Beschäftigte<br />
GK 4: 1 bis 19 Beschäftigte<br />
GK 5: ohne Beschäftigte<br />
Betriebe Beschäftigte in den Betrieben<br />
GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Summe GK1 GK 2 GK 3 GK 4 Summe<br />
Schl. Wirtschaftsgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
01 Landwirtschaft, Gewerbliche Jagd<br />
02 Forstwirtschaft<br />
05 Fischerei und Fischzucht<br />
10 Kohlebergbau, Torfgewinnung<br />
11 Gewinnung von Erdöl und Erdgas,<br />
Erbringung damit verbundener<br />
Dienstleistungen<br />
12 Bergbau auf Uran- und Thoriumerze<br />
13 Erzbergbau<br />
14 Gewinnung von Steinen und<br />
Erden, sonstiger Bergbau<br />
15 Ernährungsgewerbe<br />
16 Tabakverarbeitung<br />
17 Textilgewerbe<br />
18 Bekleidungsgewerbe<br />
19 Ledergewerbe<br />
20 Holzgewerbe (ohne Herstellung<br />
von Möbeln)<br />
21 Papiergewerbe<br />
22 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe,<br />
Vervielfältigung von bespielten<br />
Ton-, Bild- und Datenträgern<br />
23 Kokerei, Mineralölverarbeitung,<br />
Herstellung und Verarbeitung von<br />
Spalt- und Brutstoffen<br />
24 Chemische Industrie<br />
25 Herstellung von Gummi- und<br />
Kunststoffwaren<br />
26 Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung<br />
von Steinen und Erden<br />
27 Metallerzeugung und -bearbeitung<br />
28 Herstellung von Metallerzeugnissen<br />
29 Maschinenbau<br />
30 Herstellung von Büromaschinen,<br />
Datenverarbeitungsgeräten und<br />
-einrichtungen<br />
31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung,<br />
-verteilung u.ä.<br />
32 Rundfunk-, Fernseh- und<br />
Nachrichtentechnik<br />
33 Medizin-, Mess-, Steuer- und<br />
Regelungstechnik, Optik<br />
34 Herstellung von Kraftwagen und<br />
Kraftwagenteilen<br />
35 Sonstiger Fahrzeugbau<br />
36 Herstellung von Möbeln,<br />
Schmuck, Musikinstrumenten,<br />
Sportgeräten, Spielwaren und<br />
sonstigen Erzeugnissen<br />
37 Recycling<br />
40 Energieversorgung<br />
41 Wasserversorgung<br />
45 Baugewerbe<br />
– 2 293 2.948 598 3.841 – 511 10.751 12.762 24.024<br />
– – 39 125 24 188 – – 1.363 590 1.953<br />
– – – 22 8 30 – – – 77 77<br />
– – – – – – – – – – –<br />
– – 3 7 1 11 – – 280 69 349<br />
– – – – – – – – – – –<br />
– – – – – – – – – – –<br />
– – 10 190 42 242 – – 403 851 1.254<br />
– 24 190 2.783 221 3.218 – 6.714 11.595 10.658 28.967<br />
– – – – – – – – – – –<br />
– – 6 74 28 108 – – 327 351 642<br />
– – 9 139 96 244 – – 379 330 709<br />
– – 6 69 31 106 – – 289 159 448<br />
– 1 63 902 74 1.040 – 230 2.239 4.395 6.864<br />
– 1 12 16 – 21 – 614 420 69 1.103<br />
2 – 49 375 88 514 4.197 – 2.455 1.873 8.525<br />
– 1 7 13 – 21 – 614 420 69 1.103<br />
1 23 106 221 30 381 1.033 10.160 6.714 1.778 19.485<br />
– 5 96 189 25 315 – 1.746 4.273 1.385 7.404<br />
– 8 119 479 61 667 – 2.264 6.500 2.650 11.414<br />
1 12 34 51 7 105 1.570 4.946 2.319 354 9.189<br />
– 11 402 1.542 431 2.386 – 3.317 19.273 9.465 32.055<br />
– 9 157 355 58 579 – 2.538 9.092 2.449 14.079<br />
– – 1 16 5 22 – – 23 87 110<br />
– 1 75 220 38 334 – 503 3.629 1.378 5.510<br />
– – 11 44 16 71 – – 599 245 844<br />
– 1 41 501 63 606 – 437 1.491 2.780 4.708<br />
– 2 21 31 4 58 – 1.125 976 183 2.284<br />
1 5 23 50 5 84 1.014 1.931 1.469 294 4.708<br />
– 3 31 142 52 228 – 654 1.614 519 2.787<br />
– 1 40 210 50 301 – 305 1.468 1.155 2.928<br />
– 8 74 96 120 298 – 3.304 4.610 574 8.488<br />
– 1 38 80 90 209 – 310 2.037 366 2.713<br />
– 30 1.367 8.734 1.531 11.662 – 11.748 59.647 53.646 125.041
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 77<br />
aufgesuchte Betriebe Dienstgeschäfte in den Betrieben<br />
GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Summe GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Summe<br />
darunter<br />
in der Nacht an Sonn- u.<br />
Feiertagen<br />
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25<br />
– 1 128 736 62 927 – 1 128 861 66 1.111 – –<br />
– – 14 17 1 32 – – 18 18 1 37 – –<br />
– – – 7 1 8 – – – 7 1 8 – –<br />
– – – – – – – – – – – – – –<br />
– – 2 3 – 5 – – 3 5 – 8 – –<br />
– – – – – – – – – – – – – –<br />
– – – – – – – – – – – – – –<br />
– – 2 39 3 44 – – 2 47 4 53 – –<br />
– 17 99 605 22 743 – 46 189 642 23 900 1 2<br />
– – – – – – – – – – – – – –<br />
– – 3 17 2 22 – – 5 22 2 29 – –<br />
– – 5 8 5 18 – – 6 8 5 19 – –<br />
– – 4 19 – 23 – – 6 23 – 29 – 1<br />
– – 29 269 11 309 – – 57 314 11 382 – –<br />
– 1 8 5 1 15 – 1 16 5 1 23 – –<br />
1 – 19 85 8 113 1 – 43 94 10 148 – –<br />
– 1 3 4 – 8 – 13 5 4 – 22 – –<br />
1 17 62 65 10 155 11 108 157 101 20 397 – –<br />
– 4 49 78 6 137 – 16 69 94 6 185 – –<br />
– 7 50 85 8 150 – 24 98 92 8 222 – –<br />
1 10 23 15 2 51 16 40 43 24 2 125 – –<br />
– 8 255 520 47 830 – 33 516 690 53 1.292 – 1<br />
– 8 105 136 7 256 – 27 230 181 10 448 – 3<br />
– – – 4 – 4 – – – 5 – 5 – –<br />
– 1 37 42 4 84 – 3 61 53 4 121 – –<br />
– – 6 9 1 16 – – 12 9 2 23 – 1<br />
– 1 20 164 10 195 – 1 30 196 12 239 – 1<br />
– 1 12 10 – 23 – 3 32 15 – 43 – –<br />
1 4 17 17 – 39 18 14 41 23 – 96 – –<br />
– 3 18 44 7 72 – 9 27 54 8 98 – –<br />
– 1 21 66 3 91 – 3 32 87 3 125 – 1<br />
– 7 30 16 13 66 – 12 47 18 17 94 – –<br />
– – 12 10 6 28 – – 15 13 6 34 – –<br />
– 22 435 1.748 171 2.376 – 52 604 2.051 181 2.888 – 3
78 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Tabelle 3.1 Dienstgeschäfte in Betrieben (Fortsetzung)<br />
Betriebe Beschäftigte in den Betrieben<br />
GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Summe GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 Summe<br />
Schl. Wirtschaftsgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
50 Kraftfahrzeughandel; Instandhaltung<br />
und Reparatur von<br />
Kraftfahrzeugen; Tankstellen<br />
51 Handelvermittlung und<br />
Großhandel (ohne Handel mit<br />
Kraftfahrzeugen)<br />
52 Einzelhandel (ohne Handel mit<br />
Kraftfahrzeugen und ohne<br />
Tankstellen); Reparatur von<br />
Gebrauchsgütern<br />
55 Gastgewerbe<br />
60 Landverkehr; Transport in<br />
Rohrfernleitungen<br />
61 Schifffahrt<br />
62 Luftfahrt<br />
63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den<br />
Verkehr; Verkehrsvermittlung<br />
64 Nachrichtenübermittlung<br />
65 Kreditgewerbe<br />
66 Versicherungsgewerbe<br />
67 Mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe<br />
verbundene<br />
Tätigkeiten<br />
70 Grundstücks- und Wohnungswesen<br />
71 Vermietung beweglicher Sachen<br />
ohne Bedienungspersonal<br />
72 Datenverarbeitung und<br />
Datenbanken<br />
73 Forschung und Entwicklung<br />
74 Erbringung von Dienstleistungen<br />
überwiegend für Unternehmen<br />
75 Öffentliche Verwaltung,<br />
Verteidigung, Sozialversicherung<br />
80 Erziehung und Unterricht<br />
85 Gesundheits-, Veterinär- und<br />
Sozialwesen<br />
90 Abwasser- und Abfallbeseitigung<br />
und sonstige Entsorgung<br />
91 Interessenvertretungen und<br />
kirchliche und sonstige religiöse<br />
Vereinigungen (ohne<br />
Sozialwesen und Sport)<br />
92 Kultur, Sport und Unterhaltung<br />
93 Erbringung von sonstigen<br />
Dienstleistungen<br />
95 Private Haushalte<br />
– ABM Bauwesen<br />
insgesamt<br />
GK 1: 1.000 und mehr Beschäftigte<br />
GK 2: 200 bis 999 Beschäftigte<br />
GK 3: 20 bis 199 Beschäftigte<br />
GK 4: 1 bis 19 Beschäftigte<br />
GK 5: ohne Beschäftigte<br />
– 1 267 2.833 623 3.724 – 259 9.422 14.579 24.260<br />
– 12 222 1.861 830 2.925 – 3.445 9.725 9.594 22.764<br />
1 12 475 14.544 5.637 20.669 1.723 3.373 21.054 47.040 73.190<br />
– – 167 7.585 3.682 11.434 – – 6.486 22.735 29.221<br />
4 13 224 2.501 900 3.642 5.040 6.208 11.109 10.844 33.201<br />
– – 1 55 9 65 – – 149 161 310<br />
– – 1 9 7 17 – – 20 56 76<br />
– 1 102 974 232 1.309 – 200 4.917 4.458 9.575<br />
2 18 101 376 124 621 3.359 6.048 6.649 1.915 17.971<br />
– 2 112 823 367 1.304 – 528 6.785 4.111 11.424<br />
– 1 15 139 268 423 – 202 862 688 1.752<br />
– – – 308 581 889 – – – 578 578<br />
– 2 73 911 1.008 1.994 – 775 3.507 3.560 7.842<br />
– – 8 290 196 494 – – 281 881 1.162<br />
– 2 26 189 110 327 – 576 1.359 963 2.898<br />
– 2 26 39 11 78 – 711 1.870 230 2.811<br />
– 20 530 3.605 1.570 5.725 – 6.645 28.156 17.011 51.812<br />
1 96 709 1.309 534 2.649 1.037 34.430 44.370 7.926 87.763<br />
3 35 946 3.268 334 4.586 6.506 12.478 37.770 26.047 82.801<br />
3 70 552 6.610 763 7.998 5.698 27.754 29.499 26.248 89.199<br />
– 1 128 500 148 777 – 396 6.068 2.528 8.992<br />
– 1 30 416 126 573 – 241 1.353 1.959 3.553<br />
– 3 65 1.253 486 1.807 – 1.206 3.535 4.998 9.739<br />
– 2 54 2.876 1.326 4.258 – 502 2.354 10.224 13.080<br />
– – – 16 55 71 – – – 28 28<br />
2 11 27 18 2 60 2.747 5.974 2.045 158 10.924<br />
21 454 8.184 73.932 23.733 106.324 33.924 165.565 396.204 330.892 926.585
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 79<br />
aufgesuchte Betriebe Dienstgeschäfte in den Betrieben<br />
GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Summe GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 Summe<br />
darunter<br />
in der Nacht an Sonn- u.<br />
Feiertagen<br />
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25<br />
– 1 112 850 97 1.060 – 1 149 997 107 1.254 – 18<br />
– 7 61 251 29 348 – 16 93 291 32 432 – 1<br />
1 7 169 1.631 259 2.067 2 17 253 1.799 270 2.341 1 8<br />
– – 74 1.166 273 1.513 – – 117 1.388 308 1.813 5 –<br />
3 12 103 431 53 602 5 52 168 539 56 820 – –<br />
– – 1 6 – 7 – – 4 6 – 10 – –<br />
– – – 4 1 5 – – – 4 1 5 – –<br />
– 1 72 134 11 185 – 1 72 156 12 241 – –<br />
1 6 28 43 18 96 1 12 32 45 18 108 – –<br />
– 2 30 49 4 85 – 2 42 52 5 101 – –<br />
– – 3 10 4 17 – – 4 10 4 18 – –<br />
– – – 19 6 25 – – – 19 6 25 – –<br />
– 2 27 124 42 195 – 2 36 146 45 229 – 1<br />
– – 3 39 5 47 – – 3 42 6 51 – –<br />
– 1 10 37 19 67 – 1 12 42 19 74 – –<br />
– 2 11 11 3 27 – 18 18 16 3 55 – –<br />
– 10 181 531 100 822 – 16 236 608 109 969 2<br />
– 47 206 152 23 428 – 110 299 162 38 609 – –<br />
3 14 178 426 23 644 42 22 227 466 28 785 – –<br />
3 58 200 1.367 101 1.729 48 219 327 1.540 112 2.246 – 1<br />
– 1 72 171 26 270 – 4 145 261 41 451 – 1<br />
– – 5 46 14 65 – – 5 46 14 65 – –<br />
– 3 22 183 28 236 – 10 40 208 31 289 – –<br />
– 1 22 382 103 508 – 3 29 442 109 583 – –<br />
– – – 1 4 5 – – – 1 4 5 – –<br />
– 10 5 2 – 17 – 14 6 2 – 22 – –<br />
15 299 3.030 12.905 1.657 17.906 144 926 4.857 15.044 1.834 22.805 7 45
80 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Tabelle 4 Tätigkeiten und Beanstandungen im Außendienst<br />
Besichtigungen,<br />
Überprüfungen<br />
Tätigkeiten<br />
Tätigkeiten<br />
1 Allgemeines – 857 12 97 – – –<br />
2 Technischer Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsschutz<br />
2.1 Arbeitsstätten, Ergonomie 21.530 1.677 44 88 230 90 15.176<br />
2.2 überwachungsbedürftige Anlagen 3.868 310 23 17 16 1 2.356<br />
2.3 Medizinprodukte 1.157 95 9 – 7 – 515<br />
2.4 Technische Arbeitsmittel und Einrichtungen 13.218 501 19 15 192 1 8.526<br />
2.5 Gefahrstoffe 5.978 476 41 45 28 107 3.837<br />
2.6 Explosionsgefährliche Stoffe 322 76 24 62 – – 97<br />
2.7 Strahlenschutz 561 72 11 3 – 7 126<br />
2.8 Arbeitssicherheitsorganisation 14.998 1.262 62 96 221 1 9.935<br />
2.8 Gentechnik 643 98 10 1 4 – 617<br />
2.10 Beförderung gefährlicher Güter 712 25 9 2 1 – 204<br />
Summe Position 2 62.987 4.592 252 329 699 207 41.389<br />
3 Sozialer Arbeitsschutz<br />
3.1 Arbeitszeitschutz<br />
3.1.1 Sonn- und Feiertagsarbeit 1.126 98 10 – – – 46<br />
3.1.2 Sozialvorschriften im Straßenverkehr 4.359 165 24 75 4 – 2.526<br />
3.1.3 Sonstiger Arbeitszeitschutz 5.704 238 18 7 7 – 774<br />
3.2 Jugendarbeitsschutz 1.182 114 10 7 3 – 689<br />
3.3 Mutterschutz 2.126 167 7 51 – – 344<br />
3.4 Heimarbeitsschutz 13 – – – – – 9<br />
Summe Position 3 14.510 782 69 140 14 – 4.388<br />
4 Arbeitsschutz in der Seeschifffahrt – – – – – – –<br />
Besprechungen<br />
Insgesamt 77.497 6.231 333 566 713 207 45.777<br />
Vorträge, Vorlesungen<br />
Sonstiges<br />
Untersuchungen von<br />
Unfällen, Berufskrankheiten<br />
und Schadensfällen<br />
Position Sachgebiet 1 2 3 4 5 6 7<br />
Messungen<br />
Beanstandungen
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 81<br />
Tabelle 5 Tätigkeiten und Vorgänge im Innendienst<br />
Ordnungswidrigkeiten<br />
Sonstiges<br />
Abgabe an Dritte<br />
Strafanzeigen<br />
Abgabe an die Staatsanwaltschaft<br />
Rücknahme des Bußgeldbescheides,<br />
Ermäßigung des Bußgeldes<br />
Bußgeldbescheide<br />
Verwarnungen mit Verwarnungsgeld<br />
Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld<br />
Anhörungen und Vernehmungen<br />
Anwendung von Zwangsmitteln<br />
ablehnende Widerspruchsbescheide<br />
stattgebende Widerspruchsbescheide<br />
Anordnungen<br />
Besichtigungsschreiben<br />
abgelehnte Genehmigungen, Erlaubnisse,<br />
Zulassungen und Ausnahmen<br />
erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen<br />
und Ausnahmen<br />
Stellungnahmen, Gutachten<br />
Bearbeitung gesetzlich vorgeschriebener<br />
Anzeigen<br />
Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden<br />
Besprechungen<br />
Position Sachgebiet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
1 Allgemeines 120 143 – 454 – – – – – – – – – – – – – – 56 2.638<br />
2 Technischer Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsschutz<br />
2.1 Arbeitsstätten, Ergonomie 484 322 153 4.143 112 4 5.818 279 2 – 2 26 1 – 5 – – – 1 7.304<br />
2.2 Überwachungsbedürftige Anlagen 164 65 816 398 110 3 1.427 14 1 – 3 98 2 12 9 – – – 4 1.472<br />
2.3 Medizinprodukte 35 82 63 30 – – 323 1 – – – 26 – 4 15 – 3 – – 704<br />
2.4 Techn. Arbeitsmittel und Einrichtungen 65 40 43 565 7 – 3.400 69 1 – 1 18 – – 2 – – – 1 3.922<br />
2.5 Gefahrstoffe 256 149 853 941 179 1 1.979 28 9 – – 47 1 10 23 1 1 1 2 2.025<br />
2.6 Explosionsgefährliche Stoffe 100 69 148 46 146 1 74 1 – – – 5 – – 3 – – 1 4 439<br />
2.7 Strahlenschutz 177 63 1.343 121 190 1 121 4 – 2 – 11 1 – – – – – – 351<br />
2.8 Arbeitssicherheitsorganisation 196 138 614 1.110 19 1 4.344 98 1 – 1 70 1 9 10 2 – – 5 4.933<br />
2.9 Gentechnik 15 16 17 32 1 – 320 – – – – – – – – – – – – 197<br />
2.10 Beförderung gefährlicher Güter 15 7 – 3 1 – 47 – – – – 4 – 1 6 – – – – 42<br />
Summe Position 2 1.507 951 4.050 7.389 765 11 17.853 494 14 2 7 305 6 36 73 3 4 2 17 21.389<br />
3 Sozialer Arbeitsschutz<br />
3.1 Arbeitszeitschutz<br />
3.1.1 Sonn- und Feiertagsarbeit 62 138 27 79 454 4 251 – – – – 24 3 – 7 – 1 – 1 441<br />
3.1.2 Sozialvorschriften im Straßenverkehr 31 222 117 18 – – 234 1 2 – – 2.004 168 418 1.582 14 30 – 350 2.758<br />
3.1.3 Sonstiger Arbeitszeitschutz 53 97 22 96 38 – 1.026 8 1 – 1 36 1 7 17 – 1 – 1 1.301<br />
3.2 Jugendarbeitsschutz 15 78 171 102 39 1 320 – – 4 1 74 10 13 24 – 4 – 1 433<br />
3.3 Mutterschutz 139 278 4.289 41 126 30 533 – – 7 – 25 2 2 2 2 – – – 1.097<br />
3.4 Heimarbeitsschutz 2 – – – – – 3 – – – – – – – – – – – 19 27<br />
Summe Position 3 302 833 4.626 336 657 35 2.367 9 3 11 2 2.163 184 440 1.632 16 36 – 372 5.057<br />
4 Arbeitsschutz in der Seefahrt<br />
Insgesamt 1.929 1.927 8.676 8.179 1.422 46 20.220 503 17 13 9 2.468 190 476 1.705 19 40 2 445 29.084<br />
Zahl der Vorgänge 1.480 1.724 8.561 5.095 1.365 46 9.184 398 8 2 7 2.419 190 476 1.692 20 39 2 439 16.620
82 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Tabelle 6 Überprüfungen nach dem Gerätesicherheitsgesetz *)<br />
an/von anderen<br />
EU/EWR-<br />
Staaten ***)<br />
Anzahl und Art der Mängel **) Mitteilungen<br />
an/von anderen<br />
Arbeitsschutzbehörden<br />
***)<br />
Mitteilungen<br />
Überprüfte technische<br />
Arbeitsmittel<br />
mit sicherheitstechnischen<br />
Mängeln<br />
Überprüfte<br />
technische<br />
Arbeitsmittel<br />
(Herkunft)<br />
insgesamt (Summe von 3 und 4 bzw. 6 bis 8)<br />
Überprüfte<br />
technische<br />
Arbeitsmittel<br />
(vorwiegend<br />
verwendet in)<br />
Anzahl der<br />
Überprüfungen<br />
nach dem<br />
Gerätesicherheitsgesetz<br />
von anderen EU/EWR-Staaten<br />
an andere EU/EWR-Staaten<br />
von Behörden in Deutschland<br />
an Behörden in Deutschland<br />
gerichtliche Verfahren<br />
Anordnungen und Ersatzmaßnahmen<br />
Revisionsschreiben<br />
insgesamt (Summe von 13 bis 16)<br />
Mängel bei Gebrauchsanweisungen,<br />
Hinweisen, usw.<br />
unbrauchbare Geräte (Neukonstruktion<br />
erforderlich)<br />
durch konstruktive Maßnahmen<br />
abstellbare Mängel<br />
durch Nachrüstung abstellbare<br />
Mängel<br />
davon Erzeugnisse aus<br />
Drittländern<br />
davon Erzeugnisse aus EU/EWR-<br />
Staaten<br />
davon inländische Erzeugnisse<br />
insgesamt (Summe von 10 bis 12)<br />
Erzeugnisse aus Drittländern<br />
Erzeugnisse aus EU/EWR-<br />
Staaten<br />
inländische Erzeugnisse<br />
Haushalt, Freizeit, Schule,<br />
Kindergarten<br />
Gewerbe, Landwirtschaft,<br />
Verwaltung<br />
darunter auf Messen und<br />
Ausstellungen<br />
insgesamt<br />
Überprüfung bei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24<br />
Herstellern 102 – 232 6 238 222 14 2 115 112 3 – 22 8 – 315 345 50 1 – 3 5 – –<br />
Importeuren 1 – 1 – 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – –<br />
Händlern 122 2 153 405 558 444 11 103 104 14 1 89 87 7 2 90 186 18 – – 1 3 – 1<br />
Verwendern 59 – 144 1 145 127 16 2 36 29 7 – 22 7 1 16 46 15 2 – 8 1 1 –<br />
Sonstigen – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –<br />
insgesamt 283 2 530 412 942 794 41 107 255 155 11 89 131 22 3 421 577 83 3 – 12 9 1 1<br />
*) Mit Ausnahme von Vollzugsmaßnahmen nach Verordnungen zu überwachungsbedürftigen Anlagen<br />
**) Bei Geräten mit mehreren Mängeln ist jeder Mangel in der entsprechenden Spalte zu zählen<br />
***) Mitteilungen über Geräte mit sicherheitstechnischen Mängeln, wenn der Betriebssitz des Herstellers oder Importeurs im Aufsichtsbezirk<br />
eines anderen Gewerbeaufsichtsamtes liegt
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 83<br />
Tabelle 7 Dienstgeschäfte und Tätigkeiten des gewerbeärztlichen Dienstes<br />
Zuständigkeitsbereich Zuständigkeitsbereich<br />
Summe<br />
Summe<br />
Gewerbeaufsicht Bergaufsicht Sonstiger,<br />
unbest.<br />
Position 1 2 3 4<br />
1 Außendienst<br />
1.1 Dienstgeschäfte 428 – – 428<br />
1.2 Tätigkeiten<br />
1.2.1 Betriebsbesichtigungen, Überprüfungen 322 – – 322<br />
1.2.2 Besprechungen 47 – – 47<br />
1.2.3 Vorträge, Vorlesungen 25 – – 25<br />
1.2.4 Sonstige Tätigkeiten 34 – – 34<br />
1.2.5 Ärztliche Untersuchungen – – – –<br />
1.2.6 Messungen – – – –<br />
1.2.7 Beanstandungen – – – –<br />
2 Innendienst<br />
2.1 Gutachten, Stellungnahmen, Beratungen 2.491 2.491<br />
2.1.1 Gutachten über Berufskrankheiten und andere berufsbedingte<br />
Erkrankungen 2.110 – – 2.110<br />
2.1.2 Stellungnahmen zum betrieblichen Arbeitssicherheitsgesetz – – – –<br />
2.1.3 Sonstige Gutachten und Stellungnahmen 79 – – 79<br />
2.1.4 Beratungen in arbeitsmedizinischen Fragen 302 – – 302<br />
2.2 Ermächtigungen von Ärzten 65 – – 65<br />
2.3 Ärztliche Untersuchungen<br />
2.3.1 Untersuchungsanlass<br />
2.3.1.1 Vorgeschriebene Vorsorgeuntersuchungen – – – –<br />
2.3.1.2 Berufskrankheiten- Untersuchungen – – – –<br />
2.3.1.3 Sonstige Untersuchungen – – – –<br />
2.3.2 Untersuchungsinhalt<br />
2.3.2.1 Körperliche Untersuchungen – – – –<br />
2.3.2.2 Röntgenuntersuchungen – – – –<br />
2.3.2.3 Elektrokardiogramme – – – –<br />
2.3.2.4 Lungenfunktionsuntersuchungen – – – –<br />
2.3.2.5 Blutuntersuchungen – – – –<br />
2.3.2.6 Urinuntersuchungen – – – –<br />
2.3.2.7 Hautteste – – – –<br />
2.3.2.8 Sonstige medizinisch-technische Untersuchungen – – – –<br />
2.4 Analysen<br />
2.4.1 Biologisches Material – – – –<br />
2.4.2 Arbeitsstoffe – – – –<br />
2.4.3 Raumluftproben – – – –<br />
2.4.4 Sonstige Analysen – – – –<br />
2.5 Sonstige Tätigkeiten 773 – – 773
84 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Tabelle 8 Begutachtete Berufskrankheiten<br />
begutachtet: im Berichtsjahr abschließend begutachtete Berufskrankheiten<br />
berufsbedingt: Zusammenhang zwischen Erkrankung und beruflichen Einflüssen festgestellt<br />
Zuständigkeitsbereich Summe<br />
Arbeitsschutzbehörden<br />
Bergaufsicht sonstiger,<br />
unbestimmt<br />
begutacht. berufsbed. begutacht. berufsbed. begutacht. berufsbed. begutacht. berufsbed.<br />
Nr. Berufskrankheiten 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten<br />
11<br />
1101<br />
1102<br />
1103<br />
1104<br />
1105<br />
1106<br />
1107<br />
1108<br />
1109<br />
1110<br />
12<br />
1201<br />
1202<br />
13<br />
1301<br />
1302<br />
1303<br />
1304<br />
1305<br />
1306<br />
1307<br />
1308<br />
1309<br />
1310<br />
1311<br />
1312<br />
1313<br />
1314<br />
1315<br />
13 16<br />
1317<br />
Metalle oder Metalloide<br />
Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorganischen Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen<br />
Erstickungsgase<br />
Erkrankungen durch Kohlenmonoxid<br />
Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff<br />
Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe<br />
Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege<br />
durch aromatische Amine<br />
Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe<br />
Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol<br />
Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols<br />
oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge<br />
Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff<br />
Erkrankungen durch Methylalkohol (Methanol)<br />
Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen<br />
Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen<br />
Erkrankungen durch Salpetersäureester<br />
Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide<br />
Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide<br />
Erkrankungen der Zähne durch Säuren<br />
Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon<br />
Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol<br />
Erkrankungen durch Isocyanate, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen<br />
haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der<br />
Krankheit ursächlich waren oder sein können<br />
Erkrankung der Leber durch Dimethylformamid<br />
Polyneuropathie oder Enzyphalopathie durch organische Lösemittel oder deren<br />
Gemische<br />
2 Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten<br />
21<br />
2101<br />
2102<br />
2103<br />
2104<br />
2105<br />
2106<br />
2107<br />
2108<br />
2109<br />
2110<br />
2111<br />
22<br />
2201<br />
Mechanische Einwirkungen<br />
Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnenoder<br />
Muskelansätze, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für<br />
die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit<br />
ursächlich waren oder sein können<br />
Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die<br />
Kniegelenke überdurchschnittlich belastenden Tätigkeiten<br />
Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig<br />
wirkenden Werkzeugen oder Maschinen<br />
Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur Unterlassung aller<br />
Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das<br />
Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können<br />
Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen Druck<br />
Drucklähmungen der Nerven<br />
Abrissbrüche der Wirbelfortsätze<br />
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben<br />
oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer<br />
Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für<br />
die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit<br />
ursächlich waren oder sein können<br />
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch langjähriges Tragen<br />
schwerer Lasten auf der Schulter, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen<br />
haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der<br />
Krankheit ursächlich waren oder sein können<br />
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige,<br />
vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zur<br />
Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die<br />
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein<br />
können<br />
Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende Tätigkeit<br />
8 – 8 –<br />
15 – 15 –<br />
3 2 3 2<br />
1 – 1 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
2 – 2 –<br />
3 – 3 –<br />
1 – 1 –<br />
1 1 1 1<br />
– – – –<br />
10 1 10 1<br />
26 2 26 2<br />
25 1 25 1<br />
1 – 1 –<br />
1 – 1 –<br />
– – – –<br />
3 – 3 –<br />
1 – 1 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
5 – 5 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
3 2 3 2<br />
1 – 1 –<br />
7 – 7 –<br />
21 – 21 –<br />
34 4 34 4<br />
25 8 25 8<br />
2 1 2 1<br />
12 3 12 3<br />
15 – 15 –<br />
– – – –<br />
248 2 248 2<br />
42 1 42 1<br />
90 3 90 3<br />
1 1 1 1<br />
Druckluft<br />
Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft – – – –
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 85<br />
23<br />
2301<br />
24<br />
2401<br />
2402<br />
Zuständigkeitsbereich Summe<br />
Arbeitsschutzbehörden<br />
Bergaufsicht sonstiger,<br />
unbestimmt<br />
begutacht. berufsbed. begutacht. berufsbed. begutacht. berufsbed. begutacht. berufsbed.<br />
Nr. Berufskrankheiten 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
3 Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten<br />
3101<br />
3102<br />
3103<br />
3104<br />
Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der<br />
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit<br />
der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war<br />
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten<br />
Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder<br />
Strongyloides stercoralis<br />
Tropenkrankheiten, Fleckfieber<br />
4 Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und des Bauchfells<br />
41<br />
4101<br />
4102<br />
4103<br />
4104<br />
4105<br />
4106<br />
4107<br />
4108<br />
4109<br />
4110<br />
4111<br />
42<br />
4201<br />
4202<br />
4203<br />
43<br />
4301<br />
4302<br />
Erkrankungen durch anorganische Stäube<br />
Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)<br />
Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-<br />
Tuberkulose)<br />
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte<br />
Erkrankung der Pleura<br />
Lungenkrebs<br />
in Verbindung mit Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose),<br />
in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter Erkrankung der Pleura oder<br />
bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Asbestfaserstaub-Dosis am<br />
Arbeitsplatz von mindestens 25 Faserjahren (25 x 106 [(Fasern/m 3 ) x Jahre])<br />
Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des<br />
Pericards<br />
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine<br />
Verbindungen<br />
Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder<br />
Verarbeitung von Hartmetallen<br />
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl<br />
(Thomasphosphat)<br />
Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine<br />
Verbindungen<br />
Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase<br />
Chronische obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten unter Tage im<br />
Steinkohlebergbau bei Einwirkung einer Dosis von in Regel 100 Faserjahre<br />
Erkrankungen durch organische Stäube<br />
Exogen-allergische Alveolitis<br />
Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Rohbaumwoll-,<br />
Rohflachs- oder Rohhanfstaub (Byssinose)<br />
Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichenoder<br />
Buchenholz<br />
Obstruktive Atemswegerkrankungen<br />
Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen<br />
(einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben,<br />
die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit<br />
ursächlich waren oder sein können<br />
Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive<br />
Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die<br />
für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit<br />
ursächlich waren oder sein können<br />
5 Hauterkrankungen<br />
5101<br />
5102<br />
Lärm<br />
Lärmschwerhörigkeit 406 248 406 248<br />
Strahlen<br />
Grauer Star durch Wärmestrahlung<br />
Erkrankungen durch ionisierende Strahlen<br />
Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller<br />
Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das<br />
Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können<br />
Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß,<br />
Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche Stoffe<br />
6 Krankheiten sonstiger Ursache<br />
– – – –<br />
18 1 18 1<br />
33 14 33 14<br />
28 18 28 18<br />
– – – –<br />
1 1 1 1<br />
44 13 44 13<br />
2 1 2 1<br />
144 54 144 54<br />
189 43 189 43<br />
16 10 16 10<br />
– – – –<br />
2 – 2 –<br />
– – – –<br />
1 – 1 –<br />
3 – 3 –<br />
2 – 2 –<br />
17 3 17 3<br />
– – – –<br />
3 1 3 1<br />
81 23 81 23<br />
70 – 70 –<br />
204 90 204 90<br />
2 – 2 –<br />
SE BKVO § 9 Abs. 2 SGB VII 54 7 54 7<br />
insgesamt 1.926 558 1.926 558<br />
Feststellungen zum Tod durch BK: NEIN 18<br />
JA 35
86 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Turmschanzenstr. 25 , 39114 Magdeburg<br />
Postanschrift: Postfach 39 11 55, 39135 Magdeburg<br />
Telefon: (03 91) 5 67 - ... Durchwahl, (03 91) 5 67 - 01 Zentrale<br />
Telefax: (03 91) 5 67 46 21<br />
Abt. 7: Arbeitsrecht und Arbeitsschutz<br />
Leiter: Bethge, Jürgen<br />
Referat 71: Allgemeine Angelegenheiten der Abt. 7, Innenrevision der Abt.<br />
Leiter: Steinberg, Kerstin, Dr.-Ing.<br />
Stellvertr.: Roettgen, Karl<br />
Referat 72: Geräte- und anlagenbezogener Arbeitsschutz, Koordination von<br />
Länderangelegenheiten<br />
Leiter: Karsten, Hartmut, Dipl.-Phys.<br />
Stellvertr.: Mewes, Ronald, Dipl.-Ing.<br />
Referat 73: Stoffbezogener Arbeitsschutz, Medizinprodukte und Arbeitsstätten<br />
Leiter: Groh, Gerd, Dr. agr.<br />
Stellvertr.: Renning, Joachim, Dr. rer. nat.<br />
Referat 74: Betriebliche Gesundheitsförderung, Medizinischer und sozialer Arbeitsschutz<br />
Leiterin: Brüning, Karen<br />
Stellvertr.: Grote, Wolfgang<br />
Referat 75: Recht der Arbeit und Arbeitszeitrecht<br />
Leiter: Kiefer, Herbert<br />
Stellvertr.: Ahlers, Karin<br />
Die Referate sind zuständig für das Land Sachsen-Anhalt.<br />
Landesamt für Arbeitsschutz<br />
Kühnauer Str. 70, 06846 Dessau<br />
Postanschrift: Postfach 1802, 06815 Dessau<br />
Telefon: (03 40) 65 01 - ... Durchwahl, (03 40) 65 01 - 0 Zentrale<br />
Telefax: (03 40) 65 01 - 2 94<br />
Direktor: Melchior, Jost, Dr.-Ing.<br />
Stellvertr.: Laux, Günter, Dipl.-Ing.<br />
Abt. 1 Zentrale Aufgaben<br />
Abt. 2 Arbeitsschutz<br />
Abt. 3 Technische Sicherheit<br />
Abt. 4 Gefahrstoffe/Physikalische Schadfaktoren<br />
Abt. 5 Arbeitsförderung<br />
Abt. 6 Medizinischer Arbeitsschutz<br />
Das Landesamt für Arbeitsschutz ist zuständig für das Land Sachsen-Anhalt<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Dessau<br />
Johann-Meier-Str. 12, 06844 Dessau<br />
Postanschrift: Postfach 1423, 06813 Dessau<br />
Telefon: (03 40) 79 10 - ... Durchwahl, (03 40) 79 10 - 4 03 Zentrale<br />
Telefax: (03 40) 79 10 - 4 04<br />
Leiter: Gilke, Klaus, Dipl.-Ing.<br />
Stellvertr.: Herrmann, Bernd, Dipl.-Phys.<br />
Das GAA Dessau ist zuständig für die kreisfreie Stadt Dessau sowie für die Landkreise Anhalt-<br />
Zerbst, Bernburg, Bitterfeld, Köthen und Wittenberg.<br />
Verzeichnisse<br />
Verzeichnis 1 Bezeichnungen und Anschriften der Dienststellen<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Halberstadt<br />
Klusstraße 18, 38820 Halberstadt<br />
Postanschrift: Postfach 1141, 38801 Halberstadt<br />
Telefon: (0 39 41) 5 86 - ... Durchwahl, (0 39 41) 5 86 - 3 Zentrale<br />
Telefax: (0 39 41) 5 86 - 4 54<br />
Leiter: Heuck, Uwe, Dr. rer. nat.<br />
Stellvertr.: Schimrosczyk, Christine, Dipl.-Phys.<br />
Das GAA Halberstadt ist zuständig für die Landkreise<br />
Aschersleben-Staßfurt, Halberstadt, Quedlinburg und Wernigerode.<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Halle<br />
Dessauer Str. 104, 06118 Halle/Saale<br />
Postanschrift: Postfach 110434, 06018 Halle/Saale<br />
Telefon: (03 45) 52 43 - ... Durchwahl, (03 45) 52 43 - 0 Zentrale<br />
Telefax: (03 45) 52 43 - 2 14<br />
Leiter: Räbel, Bernhard, Dr.-Ing.<br />
Stellvertr.: Machlitt, Klaus, Dipl.-Phys.<br />
Das GAA Halle ist zuständig für die kreisfreie Stadt Halle sowie für die Landkreise Mansfelder<br />
Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis und Sangerhausen.<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Magdeburg<br />
Saalestr. 32, 39126 Magdeburg<br />
Postanschrift: Postfach 39 80, 39014 Magdeburg<br />
Telefon: (03 91) 25 64 - ... Durchwahl, (03 91) 25 64 - 2 00<br />
Telefax: (03 91) 25 64 - 2 02<br />
Leiter: Orschmann, Hans-Jürgen, Dipl.-Phys.<br />
Stellvertr.: Probst, Dietrich, Dipl.-Ing. (FH)<br />
Das GAA Magdeburg ist zuständig für die kreisfreie Stadt<br />
Magdeburg sowie für die Landkreise Bördekreis, Ohrekreis und Schönebeck.<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Naumburg<br />
Jenaer Str. 29, 06618 Naumburg<br />
Postanschrift: Jenaer Str. 29, 06618 Naumburg<br />
Telefon: (0 34 45) 71 42 - ... Durchwahl, (0 34 45) 71 42 - 0 Zentrale<br />
Telefax: (0 34 45) 71 42 - 2 20<br />
Leiter: Zorn, Klaus-Gert, Dipl.-Phys. (amt.)<br />
Stellvertr.: Hofmann, Peter, Dipl.-Ing.<br />
Das GAA Naumburg ist zuständig für die Landkreise<br />
Burgenlandkreis und Weißenfels.<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Stendal<br />
Stadtseeallee1, 39576 Stendal<br />
Postanschrift: Postfach 552, 39563 Stendal<br />
Telefon: (0 39 31) 49 4 - ... Durchwahl; (0 39 31) 49 4 - 0 Zentrale<br />
Telefax: (0 39 31) 21 20 18<br />
Leiter: Wilcke, Gerhard, Dipl.-Phys.<br />
Stellvertr.: Döhler, Jens, Dipl.-Phys.<br />
Das GAA Stendal ist zuständig für die Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Stendal und<br />
Jerichower Land.
Anhang – Tabellen und Verzeichnisse 87<br />
Verzeichnis 2 Veröffentlichungen<br />
Autoren Titel Fundstelle<br />
REINHOLD RÜHL, Bau-BG Frankfurt a.M.<br />
EVA LECHTENBERG-AUFFARTH, BAuA Dortmund<br />
GEORG HAMM, LAS Dessau<br />
THOMAS SMOLA, BIA<br />
GEORG HAMM, LAS Dessau<br />
EVA KESSLER, 3M Deutschland<br />
EVA LECHTENBERG-AUFFARTH, BAuA Dortmund<br />
REINHOLD RÜHL, Bau-BG Frankfurt a.M.<br />
URSULA VATER, ZfA Hessen<br />
EVA LECHTENBERG-AUFFARTH, BAuA Dortmund<br />
GEORG HAMM, LAS Dessau<br />
REINHOLD RÜHL, Bau-BG Frankfurt a.M.<br />
THOMAS SMOLA, BIA<br />
URSULA VATER, ZfA Hessen<br />
OWEN GRÄFE, LAS Dessau<br />
GEORG HAMM, LAS Dessau<br />
CLAUS-PETER MASCHMEIER, LAS Dessau<br />
The development of process-specific risk<br />
assessment and control in germany<br />
Gefahrenermittlung und Ersatzstoffprüfung mit<br />
dem Spaltenmodell der neuen TRGS 440<br />
Ermitteln von Gefahrstoffen und Methoden zur<br />
Ersatzstoffprüfung mit der neuen TRGS 440<br />
Ermittlungs- und Überwachungspflicht sowie<br />
arbeitsmedizinische Vorsorge – Gefährdungsprofile/Revisionsmatrix<br />
Ann. occup.Hyg. 46(2002)1, 119-125<br />
Eingereicht 12. Februar <strong>2001</strong><br />
in "Gefahrstoffe <strong>2001</strong>" Universum Verlagsanstalt<br />
Wiesbaden<br />
Sicherheitsingenieur 32(<strong>2001</strong>)11, 18-23<br />
CD-ROM 05/<strong>2001</strong> LAS Dessau<br />
BERNHARD RÄBEL, GAA Halle Arbeitsschutz<br />
Sichere Werkzeuge, Maschinen und Anlagen<br />
Mitteldeutsche Wirtschaft <strong>2001</strong>, Heft 5<br />
BERNHARD RÄBEL, GAA Halle Unternehmer und Betriebsarzt – Partner für Gesundheit<br />
im Betrieb...<br />
Mitteldeutsche Wirtschaft <strong>2001</strong>, Heft 5<br />
BERNHARD RÄBEL, GAA Halle Arbetarsskydd, Arbetsmiljöinspektion und moderne<br />
Konzepte – die staatliche Arbeitsschutzaufsicht<br />
in Schweden<br />
VDGAB-Nachrichten <strong>2001</strong>, Heft 2<br />
MANFRED IFLAND, GAA Halle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz – wichti- Tagungsband 11. Schweißtechnische Fachtagung<br />
ge Aspekte beim Schweißen/Schneiden von<br />
hochlegierten Stählen<br />
in Halle 07. 11. <strong>2001</strong>, Vortrag 11<br />
SIEGFRIED WENDT, GAA Halle Besuch nach Anmeldung Der Gefahrgutbeauftragte <strong>2001</strong>, Heft 7<br />
DIETMAR GLÖCKNER, LAS Dessau Information des Landesamtes für Arbeitsschutzes<br />
zu den ärztlichen Untersuchungen nach dem<br />
Jugendarbeitsschutzgesetz<br />
Ärzteblatt Sachsen-Anhalt 12(2002)12, 14<br />
GUNTRAM HERZ, LAS Dessau Konstruktive Maschinensicherheit Sicherheitsingenieur 32(<strong>2001</strong>)3, 12-17<br />
GUNTRAM HERZ, LAS Dessau Maschinensicherheit: Vermeiden mechanischer<br />
Gefährdungen mittels Konstruktion<br />
Informationsheft des LAS Dessau <strong>2001</strong><br />
HARTMUT KARSTEN, MS Magdeburg Arbeitsschutzrecht – Übersicht, Stand, Entwick- Tagungsband 4. Tag des Arbeitsschutzes, TÜV<br />
lungen<br />
Akademie München <strong>2001</strong><br />
HARTMUT KARSTEN, MS Magdeburg Fachliche Eignung eines SiGe-Koordinators – Was Tagungsband Sicherheits- und Gesundheitsschutz-<br />
heißt das?<br />
koordination, TÜV Akademie München <strong>2001</strong><br />
HARTMUT KARSTEN, MS Magdeburg<br />
Wirksame Marktaufsicht Jahrbuch Arbeit und Gesundheit <strong>2001</strong>,<br />
WILHELM THIELE, Amt f. Arbeitsschutz Hamburg<br />
Universum-Verlag Wiesbaden, S. 108<br />
HARTMUT KARSTEN, MS Magdeburg<br />
Möglichkeiten des technischen Arbeitsschutzes Kongressvortrag A + A <strong>2001</strong> 16.05.01<br />
DIETMAR SCHNEIDER, BAuA Berlin<br />
und der arbeitsmedizinischen Prävention bei<br />
Staubbelastungen<br />
Düsseldorf<br />
DIETMAR SCHNEIDER, BAuA Berlin<br />
Probleme der epidemiogischen Ermittlung von IVSS-Kolloquium Toulouse 11.-13.06.01 Stäube,<br />
HARTMUT KARSTEN, MS Magdeburg<br />
Dosis-Wirkungs-Beziehungen für Partikel-Effekte Rauche und Nebel am Arbeitsplatz: Risiken und<br />
in den Atemwegen<br />
Prävention, Tagungsband S. 129
88 <strong>Jahresbericht</strong> der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt <strong>2001</strong><br />
Informationsmaterialien der Gewerbeaufsicht<br />
Sozialvorschriften<br />
im<br />
Straßenverkehr<br />
Bestell-Nr.<br />
11/<strong>2001</strong>-84<br />
Arbeiten in der<br />
Nähe<br />
von Freileitungen<br />
und Kabeln<br />
Bestell-Nr.<br />
11/1998-58<br />
ArbeitsmedizinischeEignungsundVorsorgeuntersuchung<br />
Bestell-Nr.<br />
4/1998-52<br />
Handbuch<br />
Die Umsetzung der<br />
EG-Maschinenrichtlinie<br />
in deutsches<br />
Recht<br />
Bestell.-Nr. 2/<br />
2000-45 (Schutzgebühr<br />
EUR 6,00)<br />
Arbeitssicherheit auf<br />
Baustellen –<br />
Wichtige Informationen für<br />
den Bauherrn<br />
Bestell.Nr. 10/1998-54<br />
Qualitätssicherung<br />
für die zahnärztlicheRöntgendiagnostik<br />
Bestell.-Nr. 3/<br />
1995-23<br />
Handbuch<br />
Sicherheitstechnische<br />
MSR- und<br />
Prozessleittechnik<br />
für verfahrenstechnische<br />
Anlagen<br />
Bestell.-Nr. 2/2000-<br />
44 (Schutzgebühr<br />
EUR 6,00)<br />
Anwenderschulung<br />
in Krankenhäusern<br />
Bestell-Nr.<br />
7/1998-53<br />
Arbeitssicherheit Erdbauarbeiten<br />
auf Baustellen – Bestell-Nr.<br />
Informationen zur 11/1998-51<br />
Baustellenverordnung<br />
für Baubetriebe<br />
Bestell-Nr. 4/1999-63<br />
Ärztliche Untersuchungen<br />
nach dem<br />
Jugendarbeitsschutzgesetz<br />
Bestell-Nr.3/2002-<br />
87<br />
Jugendarbeitsschutzgesetz<br />
Bestell-Nr. 3/<strong>2001</strong>-<br />
78<br />
Handbuch<br />
Anwendung der<br />
Druckgeräterichtlinie<br />
Bestell.-Nr. 5/<br />
2000-73<br />
Bericht<br />
Bewertung der Arbeitsund<br />
Anlagensicherheit von<br />
Altanlagen in Sachsen-<br />
Anhalt 1995 – 1998*)<br />
Bestell-Nr. 3/1999-62<br />
Strahlenbelastung<br />
in der interventionellenRadiologie*)<br />
Bestell-Nr. 5/1997-<br />
41<br />
Absturzgefahren<br />
auf Baustellen*)<br />
Bestell-Nr. 11/<br />
1994-9<br />
Beschäftigung<br />
werdender Mütter<br />
im Krankenhäusern<br />
und vergleichbaren<br />
Einrichtungen<br />
Bestell-Nr. 4/2000-<br />
68<br />
Handbuch<br />
Sicherheitstechnische<br />
Maßnahmen<br />
bei gasexplosionsgefährdeten<br />
Anlagen<br />
Bestell-Nr. 2/1999-<br />
60 (Schutzgebühr<br />
EUR 6,00)<br />
Bericht<br />
Überprüfung der Erfüllung<br />
der Betreiberpflichten<br />
beim Betrieb von Geräten<br />
bzw. Anlagen in<br />
explosionsfähiger Atmosphäre*)<br />
Bestell-Nr. 04/<strong>2001</strong>-80<br />
Werkstätten in der<br />
Landwirtschaft *)<br />
Bestell.-Nr. 9/<br />
1997-47<br />
Abbruch- und<br />
Demontagearbeiten*)<br />
Bestell-Nr.<br />
11/1994-10<br />
Mutterschutz in der<br />
ambulanten Altenund<br />
Krankenpflege<br />
Bestell.-Nr. 4/<br />
<strong>2001</strong>-75<br />
Handbuch<br />
SicherheitstechnischeMaßnahmen<br />
bei staubexplosionsgefährdeten<br />
Anlagen<br />
Bestell-Nr. 2/1999-<br />
61 (Schutzgebühr<br />
EUR 6,00)<br />
Bericht<br />
Kontrolle der Arbeitgeberpflichten<br />
zur Minderung<br />
des Lärms*)<br />
Bestell-Nr. 04/<strong>2001</strong>-81<br />
Medizinprodukte-<br />
Betreiberverordnung<br />
Bestell-Nr.<br />
7/1999-65<br />
Sicherheit in Heim<br />
und Freizeit<br />
Bestell-Nr.<br />
9/1997-49<br />
Silvesterfeuerwerk<br />
- Pyrotechnische<br />
Gegenstände<br />
Bestell-Nr.<br />
12/2000-77<br />
Information<br />
Maschinensicherheit:<br />
Vermeiden<br />
mechanischer<br />
Gefährdungen<br />
mittels Konstruktion<br />
Bestell-Nr. 12/<br />
<strong>2001</strong>-86 (Schutzgebühr<br />
EUR 6,00)<br />
Wiederkehrende<br />
Kontrollen<br />
Bestell-Nr.<br />
7/1999-66<br />
Sicheres Verlegen<br />
von Bitumenschweißbahnen<br />
Bestell-Nr.<br />
10/2000-76<br />
Druckbehälter in<br />
technischen Anlagen<br />
Bestell.-Nr. 5/<br />
1997-34<br />
Ferienjobs<br />
Bestell-Nr.<br />
6/2000-74<br />
Getränkeschankanlagen<br />
Bestell-Nr. 7/1997-<br />
39<br />
Persönliche<br />
Schutzausrüstungen<br />
Staatl.Vorschriften*)<br />
Bestell.-Nr. 3/<br />
1998-43<br />
Arbeitsschutzgesetz<br />
Bestell-Nr.<br />
1/1998-50<br />
Die Broschüren werden in der Regel kostenlos abgegeben.<br />
Bei einer Lieferung von mehr als 10 Exemplaren pro Broschüre<br />
wird ein Betrag von EUR 0,20 pro Exemplar zuzüglich<br />
Versandkosten erhoben. Stand Mai 2002<br />
*) Nur noch begrenzt vorrätig, im Bedarfsfall bitte nachfragen:<br />
Landesamt für Arbeitsschutz Sachsen-Anhalt, Dezernat 13,<br />
Herr Günther,<br />
Kühnauer Str. 70, 06846 Dessau,<br />
Postfach 1802, 06815 Dessau<br />
É 0340-6501-168, Fax 0340-6501-294,<br />
Email: klaus-detlev.guenther@las.ms.lsa-net.de