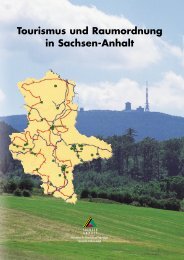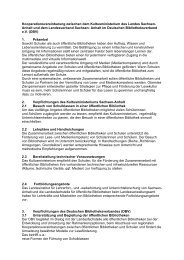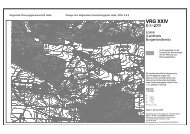Gemeinschaftsinitiativen
Gemeinschaftsinitiativen
Gemeinschaftsinitiativen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
Strukturwandel in Sachsen-Anhalt<br />
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT<br />
Europäischer Fonds<br />
für Regionale Entwicklung<br />
RESIDER II<br />
RECHAR II<br />
KONVER II<br />
KMU<br />
Ministerium für Wirtschaft und Technologie
INHALT<br />
INTERVIEW IM GESPRÄCH MIT DER WIRTSCHAFTSMINISTERIN SACHSEN-ANHALTS KATRIN BUDDE 3<br />
RESIDER II EIN NEUER WIND WEHT DURCH DEN OSTHARZ 6<br />
NEUBAU DER MEHRZWECKHALLE „HARZLANDHALLE“ IN ILSENBURG 8<br />
SANIERUNG DES BAROCKEN ANBAUS DES WENDHUSENTURMS IN THALE 10<br />
SPORTPLÄTZE IN BLANKENBURG UND KÖNIGSHÜTTE 12<br />
RECHAR II AUFWÄRTS STATT ABWÄRTS 14<br />
DER HANDWERKERHOF IN VÖLPKE 16<br />
BAU EINER ZUFAHRTSSTRASSE VON DER B 91 ZUM GEWERBEGEBIET DEUBEN 18<br />
MASTERPLAN FÜR DIE REGION RUND UM DEN TAGEBAU GOLPA-NORD 20<br />
KONVER II KULTIVIERUNG EINES SCHWEREN ERBES 22<br />
ENTWICKLUNGSGEBIET HEIDE-SÜD IN DER SAALESTADT HALLE 24<br />
ALTLASTENSANIERUNG KASERNENGELÄNDE SCHÖNBURGER STRASSE IN NAUMBURG 26<br />
KMU EINTRITTSKARTE IN DEN EUROPÄISCHEN WETTBEWERB 28<br />
ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM IN DER BURGER KNÄCKE AG 30
INTERVIEW IM GESPRÄCH MIT WIRTSCHAFTSMINISTERIN KATRIN BUDDE<br />
Die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
in der Förderperiode 1994 -1999<br />
„Die Strukturfondsförderung der EU<br />
ist somit eine wichtige und notwendige<br />
Ergänzung der Wirtschaftsförderung<br />
aus Bundes- und Landesmitteln.“<br />
Warum gibt es überhaupt eine europäische<br />
Struktur- und Regionalpolitik? Was steckt<br />
dahinter?<br />
In einem gemeinsamen Wirtschaftsraum<br />
muss es Solidarität geben zwischen reichen<br />
und weniger gut entwickelten Regionen,<br />
denn es ist kein Vorankommen möglich,<br />
wenn reiche und arme Regionen weit auseinander<br />
klaffen. Das wäre nicht nur sozial<br />
unverträglich, sondern auch ökonomisch<br />
nicht zu vertreten.<br />
Wenn strukturschwache Regionen aufholen,<br />
schafft das neue Märkte und wirtschaftliche<br />
Stabilität im EU-Binnenmarkt. Somit besteht<br />
kein Widerspruch zur Globalisierung der<br />
Weltwirtschaft, denn für die Wirtschaft unseres<br />
Landes müssen wir alle Möglichkeiten<br />
ausschöpfen, um auf den weltweiten<br />
Wachstumsmärkten mitbestimmen zu können.<br />
In der öffentlichen Debatte hört man noch<br />
oft die Auffassung: „Die größten Nettozahler<br />
sind die Deutschen“. Was hat<br />
Deutschland von der Strukturpolitik?<br />
Es ist viel zu wenig bekannt, dass die Bundesrepublik<br />
Deutschland als Empfängerland<br />
in den Jahren 1994 bis 1999 bei der Förderung<br />
aus den Strukturfonds auf Platz zwei<br />
Katrin Budde<br />
von allen Mitgliedsstaaten lag, nach Spanien<br />
und vor Italien. Die neuen Bundesländer<br />
befanden sich in der gleichen<br />
Förderstufe wie ärmere südliche Regionen.<br />
Als Region, deren Bruttoinlandsprodukt<br />
weniger als 75 Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts<br />
erreicht, zählt Sachsen-<br />
Anhalt zu den sogenannten Ziel 1-Regionen.<br />
Das sind die Regionen mit der höchsten<br />
Förderung. Die Strukturfondsförderung der<br />
EU ist somit eine wichtige und notwendige<br />
Ergänzung der Wirtschaftsförderung aus<br />
Bundes- und Landesmitteln.<br />
Trotz dieser Argumente gibt es in Sachsen-<br />
Anhalt immer noch eine gewisse „Europa-<br />
Skepsis“. Was hat nun konkret Sachsen-<br />
Anhalt von Europa, was von den Strukturfonds?<br />
Sachsen-Anhalt erhielt in der vergangenen<br />
Förderperiode mehr als fünf Milliarden DM<br />
aus den Strukturfonds. Mit Hilfe dieser Gelder<br />
ist unsere Wirtschaft ein ganzes Stück<br />
vorangekommen. Besonders kleine und<br />
mittlere Unternehmen profitieren von der<br />
Förderung aus EU-Strukturfondsmitteln.<br />
Europa trägt dazu bei, die Wohlstandsschere<br />
zwischen Ost und West abzubauen.<br />
Um nur einige Schwerpunkte zu nennen:<br />
3
4<br />
INTERVIEW IM GESPRÄCH MIT WIRTSCHAFTSMINISTERIN KATRIN BUDDE<br />
Wenn strukturschwache<br />
Regionen aufholen,<br />
schafft das<br />
neue Märkte<br />
und wirtschaftliche<br />
Stabilität<br />
im EU-Binnenmarkt.<br />
Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung<br />
(EFRE) stellt Mittel für die Errichtung<br />
von Gründer- und Gewerbezentren<br />
zur Verfügung. Jungen, zukunftsfähigen<br />
Unternehmen wird hier die Infrastruktur<br />
zur Verfügung gestellt, um erfolgreich<br />
wachsen zu können. In der gegenwärtigen<br />
Förderperiode stehen 1,8 Milliarden DM für<br />
die Förderung der gewerblichen Wirtschaft<br />
zur Verfügung. In die Forschung und Entwicklung<br />
fließen allein in diesem Jahr mehr<br />
als 40 Millionen DM aus dem EFRE.<br />
Des Weiteren wurden mit Hilfe der europäischen<br />
Strukturpolitik wichtige Infrastrukturprojekte<br />
finanziert, so beispielsweise die<br />
Bundesstraße B 6 n. Auch haben die Fördermittel<br />
erheblichen Anteil an der Qualifizierung<br />
von Arbeitnehmern und Arbeitslosen<br />
für neue Aufgaben. Nicht zu vergessen<br />
natürlich: die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> …<br />
Europäische <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> – Was<br />
versteht man darunter, was haben speziell<br />
die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> gebracht?<br />
Welche <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> gab es in<br />
Sachsen-Anhalt?<br />
Die Mittel der Strukturfonds wurden durch<br />
13 Europäische <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
ergänzt. Europagelder und Mittel der Landesregierung<br />
flossen in gemeinsam vorbereitete<br />
Projekte ein. Hinsichtlich ihrer Wirkung<br />
waren die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
somit sehr effektiv, denn direkt vor Ort<br />
können die Probleme am besten eingeschätzt<br />
werden. Bei der Vorbereitung und<br />
Realisierung der Projekte haben wir deshalb<br />
eng mit den regionalen und lokalen Behörden<br />
sowie mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern<br />
zusammengearbeitet.<br />
Sie sprachen von 13 <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong>.<br />
Welche davon waren in Sachsen-Anhalt<br />
wirksam?<br />
In Sachsen-Anhalt kamen acht <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
zum Einsatz:<br />
KMU – Förderung kleiner und mittlerer<br />
Unternehmen; KONVER II – Förderung der<br />
Rüstungs- und Standortkonversion militärischer<br />
Liegenschaften; LEADER II – Förderung<br />
der ländlichen Entwicklung; RECHAR<br />
II – Förderung der Umstellung von Kohlerevieren;<br />
RESIDER II – Förderung der Umstellung<br />
von Stahlregionen; URBAN II –<br />
Förderung der Entwicklung stark benach-<br />
teiligter Stadtviertel; ADAPT – Förderung<br />
der Anpassung an den industriellen Wandel;<br />
BESCHÄFTIGUNG – Förderung der<br />
wirtschaftlichen, beruflichen und sozialen<br />
Eingliederung von Frauen und Jugendlichen.<br />
Der Großteil der <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
wurde beendet. Wie geht’s weiter?<br />
Die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> haben sich als<br />
zusätzliches Förderinstrument der europäischen<br />
Strukturpolitik besonders dort<br />
bewährt, wo die klassischen Förderinstrumentarien<br />
nicht greifen. Das hat die Landesregierung<br />
frühzeitig erkannt. In die Operationellen<br />
Programme der Strukturfonds für<br />
die Jahre 2000 bis 2006 haben wir deshalb<br />
Förderschwerpunkte der bisherigen <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
integriert. Das war<br />
auch deshalb möglich, weil es in der laufenden<br />
Förderperiode den Ländern selbst überlassen<br />
bleibt, spezielle Schwerpunktthemen,<br />
so beispielsweise Bergbauregionen und<br />
Konversionsstandorte, selbstständig zu fördern.<br />
Um nur ein Beispiel zu nennen – die Gemeinschaftsinitiative<br />
RECHAR. Diese gibt es<br />
nicht mehr in dieser Form, die Strukturprobleme<br />
in ehemaligen Bergbauregionen jedoch<br />
immer noch.<br />
Die Landesregierung knüpft deshalb mit<br />
der „Richtlinie über die Gewährung von<br />
Zuwendungen im Rahmen der Bergbausanierung<br />
im Land Sachsen-Anhalt“ nahtlos<br />
an RECHAR an.<br />
Weitere Förderrichtlinien gibt es bei der<br />
Altlastensanierung, so bei den Konversionsstandorten<br />
und in der Förderung von wasserwirtschaftlichen<br />
Vorhaben, die ehemals<br />
über RECHAR gefördert wurden.<br />
Was ist sonst noch neu in der jetzigen<br />
Förderperiode?<br />
Neu ist der integrative Ansatz der Europäischen<br />
Kommission. So konnten in der<br />
vorangegangenen Förderperiode komplexe<br />
Projektverbünde nur schwer gefördert werden.<br />
Im jetzigen Förderzeitraum bis 2006<br />
wird eine enge Verzahnung der Strukturfonds<br />
ermöglicht. Es handelt sich dabei –<br />
neben dem EFRE – um den Europäischen<br />
Sozialfonds (ESF) und den Europäischen<br />
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die<br />
Landwirtschaft (EAGFL).
Der integrierte Einsatz dieser Fonds erlaubt<br />
es uns, noch mehr als bisher nachhaltig<br />
Wachstum und Beschäftigung zu fördern,<br />
denn die Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
steht für die Landesregierung an vorderer<br />
Stelle. Darüber hinaus wacht die Europäische<br />
Kommission streng darüber, dass<br />
die Nachhaltigkeit der Förderung auch auf<br />
die Belange von Umwelt- und Naturschutz<br />
und auf die Chancengleichheit von Frauen<br />
und Männern ausgerichtet ist. Das liegt<br />
auch in unserem Interesse.<br />
Besonders deutlich wird der integrierte Ansatz<br />
in den fünf Landesinitiativen, die wir<br />
innerhalb der Landesregierung ressortübergreifend<br />
ausgerichtet haben:<br />
PAKTE FÜR ARBEIT – Förderung lokaler<br />
Beschäftigungsinitiativen; URBAN 21 –<br />
nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen;<br />
REGIO – gezielte Unterstützung von regionalen<br />
Projekten; LOCALE – Projektförderung<br />
im ländlichen Raum; LIST – Landesinnovationsstrategie<br />
für Forschung und<br />
Entwicklung.<br />
Für diese Landesinitiativen steht etwa ein<br />
Fünftel der Strukturfondsmittel zur Verfügung,<br />
die dann – wie bei den <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />
– durch Landesmittel kofinanziert<br />
werden.<br />
Wer bestimmt über die Mittelvergabe?<br />
Welche Instanz koordiniert und steuert den<br />
Einsatz der Fondsmittel?<br />
Dem Wirtschaftsministerium kommt die<br />
Aufgabe der Koordinierung des Strukturfondseinsatzes<br />
zu. Als Ministerin bin ich<br />
deshalb gegenüber der Europäischen Kommission<br />
für die Verwendung der Mittel<br />
rechenschaftspflichtig.<br />
Da die Strukturfonds jedoch die Arbeit aller<br />
Ministerien tangieren, haben wir einen interministeriellen<br />
Arbeitskreis eingerichtet,<br />
um unsere Aktivitäten aufeinander abzustimmen.<br />
Hieran beteiligen sich auch jeweils<br />
die Fondsverwalter aus dem Wirtschaftsministerium<br />
für den EFRE, aus dem Sozialministerium<br />
für den ESF und aus dem Landwirtschaftsministerium<br />
für den EAGFL.<br />
Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig,<br />
ständig mit den Kammern, Wirtschaftsverbänden<br />
und Gewerkschaften, vor allem<br />
auch mit den Menschen vor Ort, über den<br />
effektiven Einsatz der Strukturfonds zu<br />
sprechen.<br />
Wie kann die EU den Bürgern näher gebracht<br />
werden? Wie beurteilen Sie in diesem<br />
Zusammenhang Veranstaltungen wie<br />
den „Europäischen Erfahrungsaustausch<br />
zur Gemeinschaftsinitiative RECHAR II“, an<br />
dem der Generaldirektor der Europäischen<br />
Kommission, Guy Crauser, teilnahm?<br />
Das europäische Haus entsteht nicht von<br />
selbst. Wir müssen einen Stein auf den<br />
anderen setzen, damit es wächst. Als unverzichtbares<br />
Fundament brauchen wir dazu<br />
die Akzeptanz bei den Menschen. Nicht<br />
jede kritische Stimme ist dabei als Ablehnung<br />
gegenüber der Europaidee zu verstehen.<br />
Die Menschen machen sich eben Gedanken<br />
über ihre eigene Zukunft. Oft sind<br />
es auch existenzielle Sorgen. Wenn wir klar<br />
verständlich machen, dass die EU Lösungswege<br />
aufzeigt, wird auch die Europa-<br />
Akzeptanz steigen. Dazu gehören auch<br />
Informationsveranstaltungen wie der Erfahrungsaustausch<br />
zu RECHAR II. Das Wirtschaftsministerium<br />
hatte im vergangenen<br />
Jahr europaweit zu dieser Veranstaltung<br />
eingeladen. Ziel war es, Bilanz über die<br />
Umstrukturierung der Bergbauregionen zu<br />
ziehen und gleichzeitig Perspektiven aufzuzeigen.<br />
Wirtschaftsförderer, Bergbausanierer<br />
und Umweltexperten aus RECHAR-Regionen<br />
sowie Vertreter mittel- und osteuropäischer<br />
Bergbauregionen diskutierten über<br />
ihre Erfahrungen. Dabei wurde deutlich:<br />
Viele der Probleme in den ehemaligen Bergbauregionen<br />
in Europa ähneln sich. Der Erfahrungsaustausch<br />
ermöglichte den Teilnehmern,<br />
ihr Know-how im Strukturwandel<br />
auszutauschen und voneinander zu lernen.<br />
Sachsen-Anhalt kann auf wertvolle<br />
Erfahrungen verweisen?<br />
In der Tat ist das so. Sachsen-Anhalt hat in<br />
den vergangenen Jahren nicht nur von den<br />
Strukturfonds profitiert, indem die Wirtschaft<br />
den Strukturwandel gemeistert hat.<br />
Auch können wir auf viele wichtige Erfahrungen<br />
bei der Verwendung der europäischen<br />
Gelder verweisen. Den Erfahrungsschatz<br />
Sachsen-Anhalts im Zusammenhang<br />
mit der deutschen Vereinigung, mit dem<br />
Einsatz der Strukturfonds, besonders mit<br />
Blick auf die Osterweiterung der EU zu aktivieren,<br />
darin liegt unsere spezielle Verantwortung.<br />
Dieser wollen wir in der gegenwärtigen<br />
Förderperiode auch gerecht werden.<br />
5
RESIDER II<br />
FÖRDERPERIODE 1994 – 1999<br />
B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />
PROJEKTE: 7<br />
FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 17.276.702,48 DM<br />
ZUSCHUSS: 12.664.915,08 DM<br />
DAVON AUS EU-MITTELN: 10.289.931,44 DM<br />
DAVON AUS LANDES-MITTELN: 2.374.983,64 DM
Ein neuer Wind<br />
weht durch den Ostharz<br />
In der DDR hatte die Eisen- und Stahlindustrie in zwei Landkreisen des heutigen Landes Sachsen-Anhalt überragende<br />
Bedeutung: in den zur Harzregion gehörenden Landkreisen Wernigerode und Quedlinburg.<br />
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands ging der Abbau alter Strukturen schneller vonstatten als der beschäftigungswirksame<br />
Aufbau einer neuen Wirtschaft. Im Landkreis Quedlinburg verloren in den Jahren 1990 bis 1994<br />
rund 6 000 Personen ihren Arbeitsplatz in der Eisen- und Stahlindustrie, im Landkreis Wernigerode waren es 3 200<br />
Menschen. Andere, von dieser Branche abhängige Wirtschaftszweige wurden mit in den Strudel gerissen – Schätzungen<br />
zufolge wurden in den Landkreisen etwa 5 250 Arbeitsplätze in diesen angrenzenden Bereichen abgebaut.<br />
Wo aber liegen heute die Perspektiven der traditionellen Eisen- und Stahlindustrie? Die Landkreise Wernigerode<br />
und Quedlinburg sind landschaftlich reizvoll im Vor- und Hochharz gelegen. Der Harz – das nördlichste<br />
Mittelgebirge Deutschlands – ist ein beliebter Anlaufpunkt für Urlauber. Mehrere Landkreise aus Niedersachsen,<br />
Thüringen und Sachsen-Anhalt schlossen sich nach der politischen Wende in dem Pilotprojekt „Harz“ zusammen,<br />
um die regional verantwortlichen Träger bei der Erstellung einer Gesamtentwicklungskonzeption für den Harz zu<br />
unterstützen. Heute nimmt der Fremdenverkehrsverband Harzer Verkehrsverband e.V. Marketingaufgaben für die<br />
gesamte Harzregion wahr. Der Fremdenverkehr kann den Strukturwandel in der Region weit voran bringen.<br />
Deshalb war es von großer Dringlichkeit, die Standards der touristischen Angebote im Ostharz an jene des<br />
Westharzes anzugleichen und auf veränderte Nachfragestrukturen auszurichten.<br />
Die Gemeinschaftsinitiative RESIDER II – als zusätzliches Förderinstrument der europäischen Strukturpolitik –<br />
konzentrierte sich daher in Sachsen-Anhalt auf die nachhaltige Verbesserung der touristischen Infrastruktur in<br />
den Landkreisen Wernigerode und Quedlinburg.<br />
7
8<br />
RESIDER II NEUBAU DER MEHRZWECKHALLE „HARZLANDHALLE“ IN ILSENBURG<br />
Die Attraktivität der Region nimmt zu<br />
Für die kleine, von der Stahlindustrie geprägte Stadt Ilsenburg ein gigantisches Projekt – der<br />
Bau der Harzlandhalle Ilsenburg. Mit Glasflächen zur Eingangsfront und einem lichtdurchlässigen<br />
freischwebenden Dach präsentiert sie sich nach außen hin. Innen bietet eine geräumige<br />
Teleskopbühne, die sich je nach Bedarf vergrößern lässt, Platz für etwa 2 000 Menschen. Zwölf<br />
KONTAKT: ILSENBURGER FREIZEIT-BAU GMBH<br />
AUF DER SEE 40<br />
38871 ILSENBURG<br />
TEL. 03 94 52. 81 81<br />
FAX 03 94 52. 81 82<br />
Erkennbares im Herbst 1999. Der Hallenbereich der Harzlandhalle.<br />
Über Jahrhunderte prägte die Eisen- und<br />
Stahlindustrie die Stadt Ilsenburg und<br />
ihre angrenzenden Regionen. Nach dem<br />
Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft<br />
mussten sich die hiesigen Erzeugnisse<br />
mit einem Mal gegen die Konkurrenz<br />
auf dem Weltmarkt behaupten.<br />
Vergebens. Die Hütten wurden entweder<br />
geschlossen oder drastisch reduziert. Allein<br />
in der Eisen- und Stahlindustrie Ilsenburgs<br />
gingen mehr als 1 800 Arbeitsplätze<br />
verloren.<br />
Für die Kleinstadt Ilsenburg mit ihren<br />
rund 6 500 Bewohnern hatte der enorme<br />
Arbeitsplatzabbau gravierende Auswirkungen.<br />
Mit dem Niedergang der Eisenund<br />
Stahlindustrie gerieten auch die Umsätze<br />
in allen anderen Wirtschaftsbereichen<br />
der Region in einen Abwärtsstrudel.<br />
Viele Einwohner verließen ihre Heimat.<br />
Dabei weist die kleine Stadt an der Ilse<br />
eine Vielzahl von Vorzügen auf. Die wun-<br />
derschöne Landschaft liegt in unmittelbarer<br />
Nähe zum Nationalpark „Hochharz“<br />
mit seinem Touristenmagneten, dem<br />
Brocken. Ilsenburg erfüllt nahezu alle<br />
Voraussetzungen für das Prädikat<br />
„Luftkurort“ und eignet sich somit sehr<br />
gut für den Ausbau des Gesundheitstourismus.<br />
Auch die Wandermöglichkeiten<br />
bieten hierfür hervorragende Voraussetzungen<br />
– mehr als 200 Kilometer Wanderweg<br />
sind ausgeschildert.<br />
Aufbauend auf diesen Standortbedingungen<br />
wird seit Anfang der 90er Jahre die<br />
touristische Infrastruktur Ilsenburgs weiterentwickelt.<br />
Erste Erfolge waren bald zu<br />
verzeichnen: Hotels und Pensionen wurden<br />
modernisiert und auf einen zeitgemäßen<br />
Standard gebracht.<br />
Was fehlte, war die Möglichkeit, größere<br />
kulturelle Veranstaltungen oder Sportereignisse<br />
auszutragen. Viele Veranstaltungen<br />
mussten deshalb nach Wernigerode<br />
ausgelagert werden.<br />
Der Bau der Harzlandhalle war ein ehrgeiziges<br />
Projekt für die Kleinstadt Ilsenburg,<br />
handelt es sich hierbei doch um die größte<br />
Mehrzweckhalle zwischen Börde und
Millionen Mark hat das ehrgeizige Projekt gekostet – den Löwenanteil von rund 8,5 Millionen<br />
Mark stellten die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung<br />
und das Land Sachsen-Anhalts aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RESIDER II zur Verfügung.<br />
Neuer regionaler Anziehungspunkt: Die Harzlandhalle nach der Fertigstellung.<br />
Harz. Unter ihrem Dach finden heute<br />
überregional bedeutsame Veranstaltungen<br />
statt, wobei das Spektrum von kulturellen<br />
Höhepunkten und sportlichen Events über<br />
Messen, Tagungen und Ausstellungen bis<br />
hin zum Schul- und Vereinssport reicht.<br />
Insgesamt finden etwa 2 000 Personen in<br />
der Mehrzweckhalle mit ihren rund 3 400<br />
Quadratmetern Platz. Der Hallenbereich<br />
lässt sich mittels mobilen Trennsystemen<br />
in drei Teile gliedern, was insbesondere<br />
für den Schul- und Vereinssport von Bedeutung<br />
ist. Eine geräumige Teleskopbühne,<br />
die sich je nach Bedarf vergrößern<br />
lässt, wird ergänzt durch eine Bühne auf<br />
der rückwärtigen Seite der Halle. Auch<br />
das Aufstellen von Podestbühnen ist realisierbar.<br />
Die Errichtung der Harzlandhalle bereichert<br />
das Freizeit-, Kultur- und Tourismusangebot<br />
der Stadt Ilsenburg wesentlich;<br />
die Attraktivität der ganzen Region ist erheblich<br />
gestiegen. Überdies erhöht sich<br />
die Anzahl der Arbeitsplätze durch den<br />
Bau der Harzlandhalle. Einerseits sind im<br />
Bereich ihrer Bewirtschaftung und Vermarktung<br />
direkt Arbeitsplätze entstanden,<br />
andererseits wird die Attraktivität und<br />
Wirtschaftskraft der Anlage den touristi-<br />
schen Standort Ilsenburg nachhaltig sichern,<br />
den Beherbergungsbetrieben in der<br />
Region zusätzliche Gäste bringen und bei<br />
Zuliefer- oder Dienstleistungsunternehmen<br />
Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen. Nicht<br />
zuletzt verbessern sich die sozialen Strukturen<br />
– die kulturelle und sportliche Betätigung<br />
der Ilsenburger nimmt zu, Vereine<br />
und Gruppen können ihre Angebote<br />
ausbauen, neue Gemeinschaften finden in<br />
der Harzlandhalle eine Heimat.<br />
Kinder-Sportveranstaltung im Sommer 2000.<br />
ILSENBURG<br />
9
10<br />
RESIDER II SANIERUNG DES BAROCKEN ANBAUS DES WENDHUSENTURMS IN THALE<br />
Ein touristisches Kleinod mehr<br />
An den nördlichen Harzrand, wo die Bode aus ihrem beeindruckenden Felsental in die Norddeutsche<br />
Tiefebene austritt, schmiegt sich die kleine Stadt Thale. Abseits vom heutigen Stadtgebiet,<br />
in der Nähe des noch immer sprudelnden Weiberborns, erfolgte um 825 die Gründung<br />
des geschichtsträchtigen Klosters Wendhusen. Um 1193 /1194 wurde auf diesem Gelände ein<br />
fünfgeschossiger Wohnturm, der Wendhusenturm, errichtet.<br />
KONTAKT: STADT THALE<br />
RATHAUSSTRASSE 1<br />
06502 THALE<br />
TEL. 0 39 47. 47 00<br />
FAX 03947.2410<br />
Der Wendhusenturm mit<br />
barockem Fachwerkanbau.<br />
Die Geschichte des Wendhusenklosters ist<br />
von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Um<br />
825 als Kloster gegründet, wurde es im<br />
späten 12. Jahrhundert im Verwüstungskrieg<br />
von Herzog Heinrich dem Löwen<br />
gegen Kaiser Friedrich I. überfallen und<br />
ausgeplündert. Im Zuge der Wiederherstellungsarbeiten<br />
wurde auch der Wendhusenturm<br />
errichtet. Lange galt er als Refektorium<br />
des Klosters oder als Westteil der<br />
Klosterkirche. Inzwischen sind Fachleute<br />
der Überzeugung, dass er zu einer karolingischen<br />
Burganlage gehörte. Damit wäre er<br />
der vermutlich älteste Profanbau in den<br />
neuen Bundesländern.<br />
Das anarchistische 14. Jahrhundert bewirkte<br />
den erneuten Niedergang des nunmehrigen<br />
Stifts. Nach Aufhebung des<br />
Stifts im Jahre 1540 verwandelte Graf<br />
Ulrich XI. von Regenstein das Kloster in<br />
ein Rittergut.<br />
Im Zuge der Enteignungen 1945/46 wurde<br />
das geschichtsträchtige Kloster- bzw. Rittergut<br />
schließlich zum Volkseigentum<br />
erklärt. Durch die darauffolgende unangemessene<br />
Nutzung – bis 1990 war hier<br />
zweckentfremdet eine LPG untergebracht –<br />
wurde das Gut verändert und verschlissen.<br />
Seit 1993 bemüht sich die Stadt Thale um<br />
die Wiederherstellung des Wendhusenkomplexes<br />
zu einem kulturell-touristischen<br />
Zentrum, das einen neuen gesellschaftlichen<br />
Mittelpunkt der Stadt bilden und<br />
dem geschichtsträchtigen Ort einen Abglanz<br />
seiner einstigen Bedeutung zurückbringen<br />
soll.<br />
Der Wendhusenturm wurde in fünfjähriger<br />
Bauzeit saniert. Er kann jedoch ausschließlich<br />
durch seinen barocken Anbau betreten<br />
werden. Auch dieser war stark sanierungsbedürftig<br />
und aus bautechnischen<br />
Gründen nicht mehr begehbar. An der Sanierung<br />
dieses Anbaus beteiligten sich die<br />
Europäische Union und das Land Sachsen-<br />
Das rustikale Café ist Schmuckstück im<br />
sanierten Herrenhaus.
Zusammen mit der nahegelegenen Andreaskirche kennzeichnet er noch immer den alten Ortskern<br />
Thales. Für die Sanierung des barocken Anbaus des Wendhusenturms stellten die Europäische<br />
Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Land Sachsen-<br />
Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RESIDER II insgesamt mehr als 1,1 Millionen Mark<br />
zur Verfügung.<br />
Neuer Blick hinter die Klostermauern: Der sanierte Wendhusenturm.<br />
Anhalt mit Fördermitteln aus der Gemeinschaftsinitiative<br />
RESIDER II.<br />
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist<br />
der Wendhusenturm wieder zugänglich<br />
für Besucher aus aller Welt. Die Stadt<br />
Thale hat den Touristen ein historisches<br />
Kleinod mehr anzubieten und trägt damit<br />
dem immer stärker werdenden Kulturtourismus<br />
in der Region Rechnung.<br />
Auch andere Projekte der Gemeinschaftsinitiative<br />
RESIDER II trugen dazu bei, die<br />
Stadt Thale als Ausflugs- und Ferienziel<br />
noch attraktiver zu gestalten.<br />
Fast 800.000 DM wurden zum Beispiel aus<br />
RESIDER II-Mitteln für den Neubau der<br />
Hubertusbrücke zur Verfügung gestellt.<br />
Um in das Bodetal mit seiner einzigartigen<br />
Flora und Fauna zu gelangen, ist diese<br />
Brücke für Fußgänger und Radfahrer unverzichtbar.<br />
Ihr desolater Zustand machte<br />
jedoch einen Brückenneubau unumgänglich.<br />
Die Dimensionierung der neuen<br />
Hubertusbrücke erfolgte so, dass im Bedarfsfall<br />
auch der Zugang für Ver- und<br />
Entsorgungsfahrzeuge gewährleistet ist.<br />
Nach Abschluss der Bauarbeiten steht die<br />
Brücke seit Sommer 1997 den Wanderern<br />
wieder als Zugang in das seit 1937 unter<br />
Naturschutz stehende Bodetal zur Verfügung.<br />
Vom schroffen, einst kaum begehbaren<br />
Bodetal aus gelangt man seit 1970 mit<br />
einer Personenschwebebahn in wenigen<br />
Minuten zum Hexentanzplatz mit seinem<br />
Heimattiergarten, der fast 200 heimische<br />
Tierarten beherbergt. Die Felsen des<br />
Hexentanzplatzes überragen Bodetal und<br />
Harzvorland um 239 m. Den Besuchern<br />
ermöglicht dies einen unvergleichlichen<br />
Blick auf das flachwellige Harzvorland.<br />
Nahe dem Hexentanzplatz befindet sich<br />
auch das Harzer Bergtheater Thale.<br />
Deutschlands älteste und traditionsreichste<br />
Naturbühne wurde 1903 – damals unter<br />
dem Namen „Grüne Bühne“ – eröffnet.<br />
Die Trinkwasserversorgung des Hexentanzplatzes<br />
wurde als infrastrukturelle<br />
Voraussetzung für seine weitere touristische<br />
Erschließung ebenfalls aus Mitteln<br />
der Gemeinschaftsinitiative RESIDER II<br />
gefördert.<br />
THALE<br />
11
12<br />
RESIDER II SPORTPLÄTZE IN BLANKENBURG UND KÖNIGSHÜTTE<br />
Neue Sportplätze runden Tourismusangebot ab<br />
Ein Tourismuszentrum kann sich durch eine Vielzahl von Erlebnismöglichkeiten auszeichnen:<br />
idyllische Landschaft, interessante Historie, außergewöhnliche Architektur, gut ausgestattete<br />
Hotels und Pensionen oder ein modernes Kur- und Kulturangebot. Vielfältige Sport- und<br />
Freizeitmöglichkeiten runden das touristische Potential in jedem Falle ab. Um die Entwicklung<br />
KONTAKT: STADT BLANKENBURG<br />
POSTFACH 1234<br />
38883 BLANKENBURG<br />
TEL. 0 39 44 . 90 31 40<br />
FAX03944.903139 GEMEINDE KÖNIGSHÜTTE<br />
C/O VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT „BODFELD/HARZ“<br />
POSTFACH 1125<br />
38872 ELBINGERODE<br />
TEL. 03 94 54.45261<br />
FAX039454.42210 Tiefbaumaßnahmen während<br />
der Bauphase am Sportplatz<br />
Königshütte.<br />
Der Harz – eine der schönsten und abwechslungsreichsten<br />
deutschen Landschaften<br />
– bildet eine außergewöhnliche<br />
Naturkulisse, die viele Touristen in die<br />
Harzlandkreise zieht. Zwischen der „bunten<br />
Stadt“ Wernigerode und der Stadt des<br />
UNESCO-Weltkulturerbes Quedlinburg<br />
liegt die Blütenstadt Blankenburg.<br />
Mittelalterliche Baukunst, eindrucksvolle<br />
Schloss- und Gartenarchitektur und die<br />
Heilkräfte der Natur machen Blankenburg<br />
zu einem beliebtem Urlaubsort.<br />
Um Urlaubsgästen, aber auch Geschäftsreisenden<br />
und einheimischen Sportlern<br />
attraktive Sportmöglichkeiten anbieten zu<br />
können, entschied sich die Stadt Blankenburg<br />
zur Errichtung eines modernen<br />
Sportforums auf dem Gelände der ehemaligen<br />
Gießerei „Harzer Werke“. Nach der<br />
Sanierung der brachliegenden Flächen<br />
wurde dort bereits Mitte der 90er Jahre<br />
ein Sportkomplex mit Sporthotel und<br />
Gaststätte, einem Stadion mit sechs Rundbahnen<br />
aus einem Kunststoffbelag, mit<br />
Tennisplätzen und Volleyballfeldern, Kraftraum<br />
und Turnhalle gebaut. Sämtliche Geräte<br />
zur Durchführung aller technischen<br />
und Laufdisziplinen der Leichtathletik finden<br />
die Sportler hier vor.<br />
Um das Angebot von „Allwetter“ – Aussensportflächen<br />
für Urlaubergruppen des<br />
Sporthotels, des Jugendgästehauses und<br />
von Kurgästen zu verbessern, wurde das<br />
Sportforum Ende der 90er Jahre um einen<br />
modernen Kunstrasensportplatz erweitert.<br />
Dieser wurde mit Flutlichtanlage, einem<br />
Groß- und einem Kleinspielfeld sowie<br />
einer Tribüne für etwa 400 bis 500 Zuschauer<br />
ebenfalls auf einer Fläche des<br />
früheren Gießereigeländes, das sowohl an<br />
die Stadionfläche als auch an die Tennisplätze<br />
angrenzt, erbaut.<br />
Mit einem „Promifußballspiel“ weihten<br />
u. a. die Bundesliga-Handballer des SC<br />
Magdeburg im Juni 1998 das neue Großspielfeld<br />
ein. Der sehr strapazierfähige<br />
Kunstbelag des Platzes kann mit allen<br />
Schuhen bespielt werden und benötigt<br />
wenig Pflege. Etwa 1,5 Millionen Mark hat<br />
der neue Kunstrasensportplatz gekostet –<br />
rund 80 % davon stellten die Europäische<br />
Union aus dem Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung und das Land<br />
Sachsen-Anhalt aus Mitteln der<br />
Gemeinschaftsinitiative RESIDER II zur<br />
Verfügung. Diese Investition hat sich nach<br />
Einschätzung aller Beteiligten gelohnt –<br />
wurde durch sie doch das Freizeitangebot
des Fremdenverkehrs im Landkreis Wernigerode – einst Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie<br />
– zu unterstützen, förderten die Europäische Union sowie das Land Sachsen-Anhalt den Bau<br />
von Sportanlagen in den Harzgemeinden Blankenburg und Königshütte aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative<br />
RESIDER II.<br />
Der Sportplatz macht das Tourismusangebot der Harzstadt Blankenburg noch attraktiver.<br />
der Stadt Blankenburg sinnvoll abgerundet<br />
und die Stadt für Touristen und<br />
Einheimische noch attraktiver gemacht.<br />
Für die in Blankenburg regelmäßig stattfindenden<br />
Trainingslager, die vom<br />
Städtischen Kurbetrieb und den ortsansässigen<br />
Vereinen organisiert werden und<br />
an denen Sportler aus dem europäischen<br />
Ausland teilnehmen, kann der Sportplatz<br />
nun optimal genutzt werden.<br />
Wie die Stadt Blankenburg war auch die<br />
Gemeinde Königshütte in der früheren<br />
DDR Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie.<br />
Die fast 700-jährige Tradition des<br />
Harzer Eisengusses wird in begrenztem<br />
Umfang heute noch durch einen Gießereiund<br />
Ofenbaubetrieb fortgesetzt. Der drastische<br />
Abbau von Arbeitsplätzen in diesem<br />
Bereich konnte jedoch nicht durch die<br />
heimische Wirtschaft kompensiert werden.<br />
Aufgrund ihrer bevorzugten Lage in der<br />
Natur- und Kulturlandschaft des Harzes<br />
sieht auch die Gemeinde Königshütte ihre<br />
Perspektiven in der Entwicklung des<br />
Fremdenverkehrs und investierte in die<br />
Bereiche Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten.<br />
Auf brachliegenden Flächen des<br />
ehemaligen „VEB Gießerei- und Ofenbau-<br />
kombinates“ Königshütte errichtete die<br />
Gemeinde einen Großfeldsportplatz mit<br />
Rasenfläche, Toren, Ballfangzaun sowie<br />
Spieler- und Betreuerkabinen. Auch PKW-<br />
Stellplätze und Lärmschutzdämme waren<br />
in der etwa 900.000 DM teuren Investition,<br />
von denen etwa 80 % die Europäische<br />
Union und das Land trugen, enthalten.<br />
Mit dem neuen Sportplatz hat die Gemeinde<br />
das Freizeitangebot für ihre Touristen<br />
erweitert und die Stadt für Aktivurlauber<br />
noch attraktiver gemacht. Dies macht insbesondere<br />
vor dem Hintergrund Sinn, dass<br />
in Königshütte durch die reizvollen Seen,<br />
die als Hochwasserschutz- und Überleitungsbecken<br />
im Zusammenhang mit dem<br />
Bau der Rappbodetalsperre angelegt wurden,<br />
bereits Wassersportmöglichkeiten<br />
bestehen und die Harzgemeinde für den<br />
Aktiv- und Gesundheitsurlaub prädestiniert<br />
ist.<br />
Fügt sich dem sportlichen Ambiente an:<br />
Der neue Sportplatz von Blankenburg.<br />
BLANKENBURG<br />
KÖNIGSHÜTTE<br />
13
RECHAR II<br />
FÖRDERPERIODE 1994 – 1999<br />
B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />
PROJEKTE: 46<br />
FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 81.361.286,42 DM<br />
ZUSCHUSS: 50.160.741,01 DM<br />
DAVON AUS EU-MITTELN: 40.869.080,76 DM<br />
DAVON AUS LANDES-MITTELN: 9.291.660,25 DM
Aufwärts statt abwärts<br />
Viele europäische Bergbauregionen kämpfen mit dem Wegbrechen einer über Generationen durch den Bergbau<br />
geprägten Wirtschaftsstruktur. Die Auslöser dieser Entwicklungen sind vielgestaltig: Erschöpfung der<br />
Rohstoffvorkommen, Konkurrenz durch billigere Importprodukte oder auch die Substitution von Kohle durch<br />
emissionsärmere Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas.<br />
Unterschiedlich ist der zeitliche Rahmen dieses Veränderungsprozesses. Während insbesondere Bergbauregionen in<br />
Westeuropa sich sukzessive auf den Wandel einstellen konnten, kam es in ostdeutschen Bergbaugebieten nach der<br />
Wiedervereinigung Deutschlands zu einem branchenübergreifenden, dramatischen Arbeitsplatzabbau.<br />
Auf diese besondere Problemlage reagierte die Europäische Union mit der Auflegung der Gemeinschaftsinitiative<br />
RECHAR II, die als zusätzliches Förderinstrument der europäischen Strukturpolitik besonders in den Bereichen<br />
eingesetzt wurde, in denen die klassischen Förderinstrumentarien nicht greifen konnten.<br />
Vordringliche Ziele waren die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner sowie die Erhöhung<br />
der Attraktivität der Standortbedingungen für Investitionen der gewerblichen Wirtschaft, um die ökonomische<br />
Umstellung in den ehemaligen Braunkohlentagebaugebieten zu beschleunigen. Ein wesentlicher Aspekt der<br />
Gemeinschaftsinitiative RECHAR II war die überregionale Zusammenarbeit. Schließlich standen die vom Bergbau<br />
geprägten Gemeinden in Sachsen-Anhalt vor ähnlichen Problemen. Es galt zu verhindern, dass sie mit gleichartigen<br />
Investitionen gegenseitig in Konkurrenz traten. Das Verständnis der Nachbargemeinden untereinander wurde<br />
während der Förderperiode verbessert, ein starker Solidarisierungs- und Identifikationseffekt erzielt sowie ein<br />
echtes Interesse geweckt, die Gemeinden als Gemeinschaft, als Region, zu vermarkten.<br />
15
16<br />
RECHAR II DER HANDWERKERHOF IN VÖLPKE<br />
Historischer Hof – Domizil für Handwerksbetriebe<br />
In der Chronik des Ortes Völpke wird die Hofstelle „Nessauischer Hof“ im Jahr 1570 zum ersten Mal<br />
erwähnt. Nach mehr als 200 Jahren bäuerlicher Bewirtschaftung brannte der Hof – und mit ihm mehr<br />
als die Hälfte des Dorfes – vollständig ab. An seiner Stelle wurden die heute noch vorhandenen<br />
Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie eine Stallung errichtet, die im Laufe der Jahre lediglich durch<br />
kleinere Um- und Ausbauten verändert wurden. Heute sind die Räumlichkeiten des letzten erhalte-<br />
KONTAKT: GEMEINDE VÖLPKE<br />
C/O VWG OST-LAPPWALD<br />
HARBKER WEG 7<br />
39365 SOMMERSDORF<br />
TEL. 03 94 02.224<br />
FAX 039402.224<br />
Hofcharakter vor der Sanierung.<br />
Der Bördelandkreis, in dessen Nordwesten<br />
die Gemeinde Völpke liegt, verdankt seinen<br />
Namen der „Magdeburger Börde“.<br />
Aufgrund deren landwirtschaftlich ausgezeichnet<br />
nutzbarer Lößböden war die<br />
Landwirtschaft über Jahrhunderte hinweg<br />
der Haupterwerbszweig der Bevölkerung.<br />
Unter dem Bördeboden liegt jedoch auch<br />
ein beträchtliches Braunkohlevorkommen.<br />
Es erstreckt sich vom Staßfurter Raum aus<br />
über Oschersleben bis in den Raum Völpke<br />
/ Harbke. Obwohl bereits seit Beginn<br />
des 19. Jahrhunderts untertage Braunkohle<br />
abgebaut wurde, erfolgte der industrielle<br />
Aufschwung der Region erst nach Freigabe<br />
des Privilegs zum Kohleabbau, das bis<br />
1847 beim König lag.<br />
Im Jahr 1898 wurde das erste Brikettwerk<br />
gegründet; um 1900 die erste Wachsfabrik<br />
errichtet. Ein wesentlicher Meilenstein in<br />
der industriellen Entwicklung der Region<br />
war der Eisenbahnanschluss, der den<br />
Transport der geförderten Kohle in fernere<br />
Gebiete ermöglichte. Die Wirtschaft in der<br />
Region florierte; auch das Handwerk blühte<br />
auf. Eng verbunden mit dem industriellen<br />
Aufschwung kam es zu einem enormen<br />
Anstieg der Bevölkerungsanzahl.<br />
Nach der Wiedervereinigung der beiden<br />
deutschen Staaten blieb von der Braunkohleindustrie<br />
fast nichts erhalten. Der<br />
letzte Braunkohlentagebau in der Region –<br />
der Tagebau Wulfersdorf - ist seit 1989<br />
geschlossen. Im Jahr 1991 wurde der<br />
Kraftwerksbetrieb in Harbke eingestellt;<br />
ein Jahr später schloss die Brikettfabrik<br />
ihre Tore. Ein dramatischer Arbeitsplatzabbau<br />
war die Folge.<br />
Die Völpker Montanwachs GmbH wurde<br />
1992 privatisiert und konnte nur einen<br />
geringen Teil der Arbeitnehmer weiterbeschäftigen<br />
– etwa 230 Menschen verloren<br />
ihre Arbeit.<br />
Diesen Arbeitsplatzverlusten und den daraus<br />
resultierenden sozialen Konsequenzen<br />
versucht die Gemeinde Völpke, durch<br />
Neuansiedlungen von Unternehmen auf<br />
neuen Gewerbe- und Industriegebieten<br />
entgegenzuwirken. Darüber hinaus ist es<br />
ihr Anliegen, die bisher ortsansässigen<br />
Unternehmen und die damit verbundenen<br />
Arbeitsplätze zu erhalten. Problematisch<br />
ist hierbei, dass aufgrund der Eigentumsverhältnisse<br />
einige Grundstücke in Völpke<br />
dem Alteigentümer rückübertragen werden.<br />
Die Existenz der auf diesen Grund-
nen Vierseitenhofes der Gemeinde Völpke preiswertes Domizil für mehrere Unternehmen. Etwa 50<br />
Arbeitnehmer finden Beschäftigung in den alten, schonend sanierten Gemäuern. Fast 900.000 DM<br />
kostete der Umbau der Büro- und Wirtschaftsgebäude – etwa 80 % davon gewährten die Europäische<br />
Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Land Sachsen-Anhalt als<br />
Zuschuss aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RECHAR II.<br />
Idyllischer Anblick der Rückseite des Handwerkerhofes Völpke vom Park aus.<br />
stücken angesiedelten Handwerksbetriebe<br />
steht auf dem Spiel – stellt sich für sie<br />
doch die Frage nach dem Finden und nach<br />
der Finanzierung der Herrichtung alternativer<br />
Räumlichkeiten.<br />
Um ortsansässigen Handwerksbetrieben<br />
mit diesem Verlagerungsdruck finanzierbare<br />
Werkstätten anbieten zu können, erwarb<br />
die Gemeinde Völpke im Herbst 1995<br />
die ursprüngliche landwirtschaftliche Hofstelle<br />
„Nessauischer Hof“. Der Hof wurde<br />
in den letzten Jahrhunderten durchgängig<br />
genutzt und ist so gut erhalten, dass eine<br />
vollständige Grundsanierung nicht notwendig<br />
war. Für die Dachsanierung wurden<br />
bereits 1995 Mittel im Rahmen des<br />
Dorferneuerungsprogrammes bewilligt.<br />
Die Gemeinde Völpke baute den letzten in<br />
Völpke erhaltenen Vierseitenhof für fast<br />
900.000 DM zu einem Handwerkerhof um.<br />
An dieser Investition beteiligten sich die<br />
Europäische Union und das Land Sachsen-<br />
Anhalt mit Fördermitteln der Gemeinschaftsinitiative<br />
RECHAR II. Bei der schonenden<br />
Sanierung wurde viel Wert darauf<br />
gelegt, dass die orts- und regionstypische<br />
Bauweise des Hofes erhalten blieb. Inzwischen<br />
sind die Instandsetzungs- und<br />
Modernisierungsarbeiten abgeschlossen.<br />
Auch die Außenanlagen wurden ausgebessert.<br />
Lediglich die Gestaltung der farbigen<br />
Außenfassade muss – finanziert aus Mitteln<br />
des Gemeindehaushaltes – noch erfolgen.<br />
VÖLPKE<br />
Handwerkerhof Völpke mit alter Fassade, Eingang Malerbetrieb.<br />
Die Neugestaltung findet nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen<br />
2001 statt.<br />
17
18<br />
RECHAR II BAU EINER ZUFAHRTSSTRASSE VON DER B 91 ZUM GEWERBEGEBIET DEUBEN<br />
Eine neue Straße zu den „Wolkenmachern“<br />
Eindrucksvoll ragen die qualmenden Schornsteine des Deubener Braunkohlenwerkes, der Mitteldeutschen<br />
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), in den Himmel. Zu Füßen der „Wolkenmacher“<br />
windet sich seit Oktober 1998 die neue Erschließungsstraße, die das Gewerbegebiet Deuben direkt<br />
an die Bundesstraße 91 anbindet und dieses damit für potentielle Investoren wesentlich aufwertet.<br />
KONTAKT: GEMEINDE DEUBEN<br />
C/O VWG MAIBACH-NÖDLITZTAL<br />
SCHULSTRASSE 9<br />
06727 THEISSEN<br />
TEL. 0 34 41. 68 60 - 0<br />
FAX 03441.6860-40<br />
Einbau des Krötentunnels.<br />
Das Zeitz-Weißenfelser Braunkohlenrevier<br />
gehört zu den ältesten Revieren Mitteldeutschlands.<br />
Die Anfänge der Kohlegewinnung<br />
lassen sich hier bis in die Mitte<br />
des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Seit<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts nahm der<br />
Braunkohlenbergbau durch die aufkommende<br />
Industrialisierung und den stetigen<br />
Anstieg des Bedarfes an Brennstoffen seinen<br />
eigentlichen Aufschwung.<br />
Die wirtschaftliche Lage des Zeitz-Weißenfelser<br />
Reviers war zu diesen Zeiten durch<br />
hohe Selbstkosten der Tiefbaugruben und<br />
kleine, wenig leistungsfähige Tagebaue<br />
geprägt. Um zu überleben, war es unumgänglich,<br />
einen zentralen Veredlungsstandort<br />
zu projektieren und effiziente Großtagebaue<br />
für die Förderung von Braunkohle<br />
zu erschließen. Die Großraumförderung<br />
und zentralisierte Verarbeitung der Braunkohle<br />
erfolgte seit 1927 in Deuben.<br />
Zahlreiche Neuaufschlüsse, die Verkippung<br />
von Restlöchern und Aufhaldung veränderten<br />
und prägten das Landschaftsbild<br />
der Region entscheidend.<br />
Der Bergbau war über Jahrzehnte hinweg<br />
der größte Arbeitgeber der Region – mehr<br />
als die Hälfte der Bevölkerung der Gemein-<br />
de Deuben und der umliegenden Ortschaften<br />
waren in dieser Branche beschäftigt.<br />
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands<br />
vollzogen sich im Revier einschneidende<br />
wirtschaftliche Veränderungen. Eine Vielzahl<br />
der Produktionsstätten des ehemaligen<br />
Braunkohlenwerkes wurden stillgelegt<br />
und abgerissen. Für einen großen Teil der<br />
Belegschaft bedeutete dies den Verlust des<br />
Arbeitsplatzes. Mit dem starken Anstieg<br />
der Arbeitslosigkeit ging ein Rückgang in<br />
der Bevölkerungszahl der Gemeinde Deuben<br />
einher – insbesondere junge Leute<br />
versuchten in anderen Landesteilen einen<br />
Neuanfang.<br />
Im Januar des Jahres 1994 übernahm die<br />
MIBRAG Teile des ehemaligen Braunkohlenwerkes<br />
– eine Neuorientierung für die<br />
Abzweig Siedlungsstraße.
Etwa 1,9 Millionen Mark hat der Bau der 541 Meter langen Straße gekostet – das Gros von mehr<br />
als 1,3 Millionen Mark stellten die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale<br />
Entwicklung und das Land Sachsen-Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RECHAR II zur<br />
Verfügung.<br />
Verbreiterte B 91 aus Richtung Naundorf kommend.<br />
Gemeinde Deuben war dadurch in Sicht.<br />
Das Kraftwerk, die Brikett- und die Staubfabrik<br />
sind erhalten geblieben und wurden<br />
mit hohem finanziellen Aufwand saniert.<br />
Die MIBRAG ist mit diesen Betriebsbereichen<br />
auf einem Teil der Gewerbefläche<br />
tätig. Das an die MIBRAG angrenzende<br />
ehemalige Schwelereigelände steht zur<br />
Ansiedlung weiterer Unternehmen zur<br />
Verfügung. Die unzureichende verkehrstechnische<br />
Erschließung der Gewerbefläche<br />
führte in der Vergangenheit dazu,<br />
dass potentielle Investoren von einer Ansiedlung<br />
Abstand nahmen.<br />
Der Bau einer Zufahrtsstraße von der Bundesstraße<br />
91 bis zum Gewerbegebiet Deuben<br />
war also die entscheidende Voraussetzung<br />
zur dauerhaften Sicherung und<br />
Erweiterung des Industrie- und Gewerbestandortes<br />
Deuben und damit zur Belebung<br />
der Wirtschaft in der Kommune.<br />
Aufgrund fehlender Steuereinnahmen war<br />
die finanzielle Situation der Gemeinde<br />
Deuben angespannt – eine Finanzierung<br />
des Straßenneubaus allein aus Gemeindemitteln<br />
war nicht realisierbar. In dieser<br />
Lage stellte die Aussicht auf Fördermittel<br />
der Europäischen Union und des Landes<br />
Sachsen-Anhalt über die Gemeinschafts-<br />
initiative RECHAR II eine Hoffnung für<br />
die Gemeinde Deuben dar.<br />
Diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht.<br />
Der aufwendigste und teuerste Bauabschnitt<br />
der insgesamt 541 Meter langen<br />
Straße war der Knotenpunkt zur Bundesstraße<br />
91. Diese musste verbreitert werden,<br />
um Links- und Rechtsabbiegespuren<br />
zu schaffen. Erschwerend kam hinzu, dass<br />
zwischen der Erschließungsstraße und den<br />
angrenzenden Flächen ein beträchtlicher<br />
Höhenunterschied überwunden werden<br />
musste. Im Bauvorhaben waren auch Ausgleichsmaßnahmen<br />
inbegriffen - so wurden<br />
heimische Laubbäume gepflanzt und<br />
sogar an einen Krötentunnel gedacht.<br />
Mit der neuen Straße erfüllte sich ein lang<br />
gehegter Wunsch der Deubener. Einerseits<br />
wurde das Gewerbegebiet mit Fertigstellung<br />
der Zufahrt wesentlich attraktiver.<br />
Elf Unternehmen sind hier inzwischen auf<br />
einer Fläche von 37 Hektar tätig und beschäftigen<br />
insgesamt über 300 Mitarbeiter.<br />
Andererseits wird seit dem Bau der neuen<br />
Erschließungsstraße die Hauptstraße<br />
Deubens – bisher einzige Zufahrtsmöglichkeit<br />
zum Gewerbegebiet – vom Schwerlastverkehr<br />
entlastet.<br />
DEUBEN<br />
19
20<br />
RECHAR II MASTERPLAN FÜR DIE REGION RUND UM DEN TAGEBAU GOLPA-NORD<br />
Die Eisenstadt FERROPOLIS<br />
Als künstlerisch anspruchsvoll gestaltete Landmarke ist FERROPOLIS weit über das Land sichtbar. Die fünf<br />
gigantischen Tagebaugroßgeräte setzen dem Bergbau ein originelles Denkmal. Gleichzeitig steht<br />
FERROPOLIS inmitten einer vom Bergbau geprägten Landschaft, in der die verheerenden Folgen rücksichtsloser<br />
Ausbeutung der Natur unübersehbar sind. Die Baggerstadt ist der überregional und international<br />
wirksame touristische Anziehungspunkt der Region. Maßgeblich für ihren dauerhaften Erfolg ist jedoch<br />
KONTAKT: FERROPOLIS GMBH<br />
KARL-LIEBKNECHT-STRASSE 12<br />
06773 GRÄFENHAINICHEN<br />
TEL. 03 49 53.35121<br />
FAX 034953.35120<br />
Gigantische Schaufelräder<br />
prägen das Bild von der<br />
Eisenstadt FERROPOLIS.<br />
Zwischen Bitterfeld, Wittenberg und Torgau<br />
liegt ein als „Hochfläche von Gräfenhainichen-Schmiedeberg“<br />
bekanntes Endmoränengebiet.<br />
Unter dessen pleistozäner<br />
Bedeckung lagerten braunkohleführende<br />
Schichten, die im Tagebaubetrieb in mehreren<br />
Baufeldern um die Ortslage Gräfenhainichen<br />
gewonnen wurden. Der Tagebau<br />
Golpa-Nord liegt nordwestlich von Gräfenhainichen.<br />
Im Jahre 1958 begannen hier<br />
die Aufschlussarbeiten, seit 1964 wurde<br />
Braunkohle im Tagebau gefördert. Zwei<br />
Jahre später wurde Golpa-Nord zum Leistungstagebau<br />
erweitert und schließlich bis<br />
1991 ausgekohlt.<br />
Im Zuge der seit 1989 geführten Debatte<br />
zum Umgang mit dieser Industriefolgelandschaft<br />
entstand – ausgehend vom Bauhaus<br />
Dessau – die Idee des „Industriellen<br />
Gartenreichs“. Der Tagebau Golpa-Nord<br />
sollte nicht vollständig verschwinden bzw.<br />
ausschließlich zu einer Seenlandschaft renaturiert<br />
werden. Vielmehr sah ein Konzept<br />
eines Bauhaus-Studenten die Vision<br />
einer „Stadt aus Eisen“ vor. Aufbauend<br />
auf dieser Vision wurden fünf Tagebaugroßgeräte<br />
nicht verschrottet, sondern<br />
nach einer Idee des englischen Bühnendesigners<br />
Jonathan Park um eine Arena<br />
gruppiert, die insgesamt 25 000 Besuchern<br />
Platz bietet. Jonathan Park war es auch,<br />
der anstelle der üblichen Herstellerbezeichnungen<br />
Namen für die Tagebaugeräte<br />
kreierte: MOSQUITO, MEDUSA, GEMINI,<br />
MAD MAX und BIG WHEEL bilden das<br />
deutschlandweit einzigartige Ambiente der<br />
Ende 1995 symbolisch eröffneten Stadt<br />
FERROPOLIS.<br />
Die unterschiedlichsten Events wurden inzwischen<br />
in der Baggerstadt ausgetragen<br />
und begeistert aufgenommen. FERROPOLIS<br />
ist jedoch nicht nur als Veranstaltungsstätte<br />
unter kulturellen Aspekten zu sehen,<br />
sondern auch als Wirtschaftsplattform in<br />
einer strukturschwachen Region.<br />
Weil für die Entwicklung und den Erfolg<br />
des Standortes FERROPOLIS die Gestaltung<br />
des gesamten Gebietes rund um den<br />
Tagebau Golpa-Nord maßgeblich ist, beschlossen<br />
die Anrainerkommunen gemeinsam<br />
mit den Gesellschaftern der 1997 gegründeten<br />
FERROPOLIS GmbH, einen<br />
Masterplan für die Region zu erstellen.<br />
Bei diesem über die Gemeinschaftsinitiative<br />
RECHAR II geförderten Vorhaben ging<br />
es keinesfalls nur um die weitere Gestaltung<br />
und Vermarktung des Veranstaltungs-
auch die Entwicklung des gesamten Areals rund um den Tagebau Golpa-Nord. Um wirtschaftliche Perspektiven<br />
für dieses Gebiet aufzuzeigen, beschlossen die Anrainerkommunen gemeinsam mit den Gesellschaftern<br />
der FERROPOLIS GmbH, einen Masterplan für die Region zu erstellen. Etwa 200.000 DM kostete<br />
dieses Projekt – 80 % davon stellten die EU aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und<br />
das Land Sachsen-Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RECHAR II zur Verfügung.<br />
Die Arena mit Platz für 25 000 Besucher füllt sich bei Konzertveranstaltungen.<br />
ortes FERROPOLIS, sondern vielmehr um<br />
das Aufzeigen von wirtschaftlichen Perspektiven<br />
für das gesamte etwa 155 Quadratkilometer<br />
umfassende Gebiet mit den<br />
Landschaftsräumen „Dübener Heide“ und<br />
„Muldeaue“.<br />
Ziel des Masterplanes war es, unter Berücksichtigung<br />
sowohl ökologischer als<br />
auch ökonomischer Aspekte, ein Leitbild<br />
für die Entwicklung der Region aus verkehrstechnischer,<br />
touristischer, wirtschaftlicher<br />
und kultureller Sicht zu entwickeln.<br />
Am Wichtigsten war zunächst, die verschiedenen<br />
Gemeinden an einen Tisch zu<br />
bringen und zu verhindern, dass sie mit<br />
gleichartigen Investitionen gegenseitig in<br />
Konkurrenz treten. Ein erster bedeutsamer<br />
Erfolg des Masterplan-Projektes war vor<br />
diesem Hintergrund, dass ein starker<br />
Solidarisierungs- und Identifikationseffekt<br />
der vom Bergbau geprägten Gemeinden<br />
eintrat. Einerseits wurde das Verständnis<br />
der Nachbargemeinden untereinander verbessert,<br />
andererseits ein echtes Interesse<br />
geweckt, die Gemeinden als Gemeinschaft,<br />
als Region, zu vermarkten.<br />
Erste Denkansätze im Rahmen des Masterplans<br />
gehen in die Richtung „Naturpark<br />
des 21. Jahrhunderts“. Ein Brückenschlag<br />
zwischen dem Kerngebiet Dübener Heide,<br />
den Bergbaufolgelandschaften und dem<br />
Wörlitzer Gartenreich gehören dazu.<br />
Einig sind sich die beteiligten Gemeinden<br />
auch in diesem Punkt: der Masterplan mit<br />
seinen vielen pfiffigen Ideen wird nicht<br />
nur ein Stück Papier bleiben, sondern von<br />
den darin fixierten Vorhaben werden einige<br />
kurz-, andere mittelfristig umgesetzt<br />
werden.<br />
FERROPOLIS<br />
Fünf ehemalige Tagebau-Kolosse gruppieren sich um die Arena.<br />
21
KONVER II<br />
FÖRDERPERIODE 1995 – 1999<br />
B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />
PROJEKTE: 25<br />
FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 52.452.103,76 DM<br />
ZUSCHUSS: 41.489.599,76 DM<br />
DAVON AUS EU-MITTELN: 33.709.139,09 DM<br />
DAVON AUS LANDES-MITTELN: 7.780.460,67 DM
Kultivierung<br />
eines schweren Erbes<br />
Zwischen 1990 und 1994 kehrten die Westgruppen der sowjetischen Streitkräfte aus den neuen Ländern in ihre Heimat<br />
zurück – ein Viertel von ihnen war in Sachsen-Anhalt stationiert.<br />
Die Wirtschaftsstruktur vieler Orte war einseitig darauf ausgerichtet, das Militär zu versorgen – sowohl mit kommunalen<br />
Dienstleistungen, wie Wasser und Strom, als auch mit sonstiger regionaler Infrastruktur. Nach dem Truppenabzug entstand<br />
in diesen Gebieten eine erhebliche Nachfragelücke. Dies hatte zur Folge, dass immer mehr Menschen im Umkreis<br />
ehemaliger Militärstandorte ihre Arbeit verloren. Allein in Sachsen-Anhalt wurden Anfang der neunziger Jahre etwa<br />
122 000 Arbeitsplätze im Militär- und Rüstungsbereich abgebaut.<br />
Schwer lastete das Erbe der militärisch genutzten Flächen auch auf den Kommunen. Riesige, bis dato für Zivilpersonen<br />
unzugängliche Areale der Sowjetarmee – in Sachsen-Anhalt waren das 72 981 Hektar – fielen an den Bund. Hinzu kamen<br />
Kasernen und Truppenübungsplätze der NVA sowie von DDR-Behörden genutztes Terrain. Kontaminierte Böden, große<br />
Mengen zurückgelassener Munition und zahlreiche verfallene Gebäude zählten zu den Relikten der DDR-Mitgliedschaft<br />
im Warschauer Pakt. Kostenträchtige Sanierungen waren auf diesen Arealen notwendig, um sie einer zivilen Nutzung<br />
zuführen zu können. In den ohnehin strukturschwachen Konversionsgebieten der Neuen Bundesländer überforderte dies<br />
die kommunalen Haushalte bei weitem.<br />
Als zusätzliches Förderinstrument der europäischen Strukturpolitik hatte die Europäische Union die Gemeinschaftsinitiative<br />
KONVER II eingesetzt. Die aus diesem Programm geflossenen Gelder wurden konzentriert verwendet, um die<br />
Renaturierung und Erschließung der Militärliegenschaften zu fördern. Insbesondere wurden neue gewerbliche<br />
Tätigkeiten aktiviert, um dadurch die Voraussetzungen für das Entstehen zukunftsfähiger Arbeitsplätze zu schaffen.<br />
23
24<br />
KONVER II ENTWICKLUNGSGEBIET HEIDE-SÜD IN DER SAALESTADT HALLE<br />
Ein Ort mit Zukunft<br />
„w i p: quality network“ – der Name steht für den Wissenschafts- und Innovationspark Halle, steht<br />
für die Idee des Nebeneinanders und Miteinanders verschiedener Forschungseinrichtungen und junger,<br />
zukunftsfähiger Unternehmen. „w i p“ steht für Know-how, Kreativität und Innovation in einem<br />
ganz besonderen Netzwerk – auf einem einzigartigen Standort, dem ehemaligen Militärgelände<br />
Heide-Süd.<br />
KONTAKT: STADT HALLE<br />
MARKTPLATZ 1<br />
06108 HALLE<br />
TEL. 03 45 . 2 11 - 47 51<br />
FAX 0345.211-4869<br />
Wie alle Wirtschaftsregionen der ehemaligen<br />
DDR war auch die Stadt Halle im Zuge<br />
des Übergangs von der Planwirtschaft zur<br />
sozialen Marktwirtschaft von erheblichen<br />
Produktionseinbrüchen ihrer Industrie<br />
betroffen. Zahlreiche Menschen verloren<br />
ihren Arbeitsplatz.<br />
Zusätzlich steht Halle nach dem Abzug der<br />
sowjetischen Streitkräfte vor dem Problem,<br />
enorme militärische Altlasten entsorgen zu<br />
müssen. So gilt das Areal Heide-Süd mit<br />
einer Fläche von etwa 220 Hektar als das<br />
größte innerstädtische Konversionsgebiet<br />
in den neuen Bundesländern.<br />
Die Geschichte des Areals begründet seine<br />
Probleme. Von 1935 an nutzte die Deutsche<br />
Wehrmacht das Gelände für eine Heeresund<br />
Luftwaffennachrichtenschule. Nach<br />
Ende des Zweiten Weltkrieges zogen zunächst<br />
amerikanische, 1946 dann sowjetische<br />
Truppen in die Wehrmachtsgebäude<br />
ein.<br />
Nach Abzug der sowjetischen Truppen<br />
wurde die Hinterlassenschaft der drei Militärstreitkräfte<br />
erstmals in ihrem ganzen<br />
Umfang deutlich. Die Liegenschaft Heide-<br />
Süd bot ein verheerendes Bild: viele Bereiche<br />
waren mit Schutt und Abfällen übersät,<br />
tausende von Altreifen im Gelände<br />
verteilt. Überall fanden sich Behälter mit<br />
Öl und Chemikalien. Der Flugplatz, der<br />
vor und während des Zweiten Weltkrieges<br />
auf dem Gelände betrieben wurde, trug<br />
wesentlich zur Kontamination bei. Munitionsfunde<br />
– insgesamt etwa 20 Tonnen –<br />
erforderten einen schnellen Einsatz des<br />
Kampfmittelräumdienstes.<br />
Auch die bisher militärisch genutzten Gebäude<br />
bereiteten große Probleme. Für die<br />
historische Aufarbeitung war es erforderlich,<br />
alle Bauwerke fotografisch festzuhalten.<br />
Die zum Teil stark beschädigten<br />
Gebäude mussten auf Anordnung des Gewerbeaufsichtsamtes<br />
eingebaut und unter<br />
Vakuum bei Vollschutz der Arbeitskräfte<br />
abgebrochen werden, um das Freiwerden<br />
von Asbestfasern in die Außenluft zu vermeiden.<br />
Wegeverbindung im Bau: Granitkleinsteinpflaster<br />
vom ehemaligen Kasernengelände<br />
in Wiederverwendung.
Für die Erschließung und die Renaturierung von rund 31 Hektar Fläche auf diesem Areal haben die<br />
Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Land Sachsen-<br />
Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative KONVER II rund 27 Millionen Mark zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Das Gelände Heide-Süd.<br />
Trotz aller Probleme: Die Stadt Halle liegt<br />
inmitten einer Wirtschaftsregion der<br />
neuen Länder mit besonders guten<br />
Entwicklungsaussichten. Aufgewertet wird<br />
die Lage durch eine gute Verkehrsinfrastruktur,<br />
deren Standard mit dem Ausbau<br />
der A 14 weiter gestiegen ist. Hallesche<br />
Strategie war es – aufbauend auf den<br />
grundsätzlich guten Standortbedingungen<br />
– individuelle, exzellente Rahmenbedingungen<br />
für ansiedlungswillige Unternehmen<br />
zu schaffen.<br />
Der Lösungsansatz der Stadt Halle lehnte<br />
sich an Science-Parks englischer und amerikanischer<br />
Universitäten an. Deren Idee:<br />
Weltkonzerne bevorzugen Standorte, die<br />
über ein – in jeder Hinsicht – intaktes und<br />
komplettes Umfeld verfügen. Ein derartiges<br />
Angebot wollte auch Halle „schneidern“:<br />
einen Wissenschaftspark, dessen<br />
herausragendes Format eine Symbiose aus<br />
einmaligem Ambiente, der baulichen Situation,<br />
günstigen Preisen, Forschungsinfrastruktur<br />
und qualifiziertem Personal<br />
ist.<br />
Die Kommune entwickelte das gemeinsame<br />
Dach, unter dem Synergien zwischen<br />
Wissenschaft, Forschung und Produktion<br />
entstehen können.<br />
Auf dem Konversionsgelände Heide-Süd<br />
entwickelt sich seit mehreren Jahren der<br />
„w i p“. Eine hervorragende überregionale<br />
infrastrukturelle Anbindung sowie eine<br />
Infrastruktur auf höchstem technischen<br />
Niveau innerhalb des Parks kennzeichnen<br />
den Standort.<br />
Bereits heute gibt es im „w i p“ einen leistungsfähigen,<br />
synergetisch zusammenarbeitenden<br />
Kreis von Start-up-Unternehmen,<br />
Partnern der Global Player sowie<br />
universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.<br />
Der Wissenschafts- und Innovationspark<br />
ist jedoch noch offen für weitere Interessenten.<br />
Besonders junge Unternehmen finden<br />
hier sehr gute Start- und Entfaltungsmöglichkeiten.<br />
Die über die Gemeinschaftsinitiative<br />
KONVER II geförderte Renaturierung war<br />
neben der Erschließung des ehemaligen<br />
Militärgeländes Heide-Süd ein unverzichtbarer<br />
Bestandteil des Konversionskonzeptes<br />
der Stadt Halle. Die Renaturierungsmaßnahmen<br />
fügen sich nahtlos in den Plan<br />
ein, den Standort Heide-Süd für Menschen<br />
ebenso attraktiv zu machen wie für Unternehmen<br />
und leisten einen erheblichen Beitrag<br />
zur Akzeptanz des Standortes.<br />
HALLE<br />
25
26<br />
KONVER II ALTLASTENSANIERUNG KASERNENGELÄNDE SCHÖNBURGER STRASSE<br />
Kasernengelände ziviler Nutzung zugeführt<br />
Großflächige, ehemals vom Militär genutzte Areale mit kontaminierten Böden und verfallenen Gebäuden<br />
schmälern den positiven Eindruck, den der Burgenlandkreis mit seinen Flußniederungen,<br />
Weinbergen und Sandsteinfelsen, mit seinen kulturgeschichtlich bedeutsamen Sehenswürdigkeiten<br />
hinterläßt.<br />
KONTAKT: BURGENLANDKREIS<br />
SCHÖNBURGER STRASSE 41<br />
06618 NAUMBURG<br />
TEL. 0 34 45 . 73 21 03<br />
FAX 03445.731199<br />
Attraktiv: Das Kasernengelände nach der Altlasten-Sanierung und Beräumung.<br />
Der Burgenlandkreis bildet die südliche<br />
Spitze des Landes Sachsen-Anhalt. Durch<br />
die reizvolle Verbindung zwischen dem<br />
landschaftlich schönen Saale-Unstrut-Tal<br />
und zahlreichen kulturhistorischen<br />
Sehenswürdigkeiten ist die Region aus<br />
touristischer Sicht attraktiv.<br />
Vor allem aber gehört der Burgenlandkreis<br />
zum infrastrukturell gut erschlossenen<br />
mitteldeutschen Wirtschaftsraum Halle-<br />
Leipzig-Dessau, einer Region mit hervorragenden<br />
Entwicklungschancen.<br />
Indes – wie in zahlreichen anderen Landkreisen<br />
der neuen Länder gibt es auch im<br />
Burgenlandkreis großflächige Konversionsstandorte.<br />
Zu diesen gehört das ehemals<br />
durch die Westgruppen der sowjetischen<br />
Streitkräfte genutzte Kasernengelände<br />
„Schönburger Straße“ in Naumburg<br />
(Saale). Insgesamt umfasst dieses Areal<br />
37.675 Quadratmeter, auf dem sich fünf<br />
Kasernenblöcke, zwei Garagenkomplexe<br />
sowie ein ehemals als Reithalle genutztes<br />
Gebäude befinden. Große Mengen an<br />
Schutt und Abfall, kontaminierte Böden,<br />
verfallene Kasernengebäude – eine kostenaufwendige<br />
Beräumung und Altlastensanierung<br />
war notwendig, um dieses Areal<br />
wieder einer zivilen Nutzung zuführen zu<br />
können.<br />
Zwei der fünf Kasernenblöcke wurden<br />
durch den Burgenlandkreis bereits komplett,<br />
ein dritter Kasernenblock, das sogenannte<br />
„Haus 3“, teilweise saniert. Mit<br />
Hilfe von Fördermitteln der Gemeinschaftsinitiative<br />
KONVER II gelang es, den<br />
Ausbau dieses „Hauses 3“ fertig zu stellen<br />
sowie die Außenanlagen und die Verkehrsfläche<br />
des Kasernengeländes herzurichten.<br />
Im Einzelnen umfasste das Vorhaben die<br />
Sanierung und den Ausbau des ersten<br />
Obergeschosses und des Dachgeschosses<br />
sowie die Verlängerung der vorhandenen<br />
Erschließungsstraße innerhalb des Kasernengeländes.<br />
Darüber hinaus wurde das<br />
Grundstück vor dem „Haus 3“ rekultiviert.<br />
Das Gelände wurde begradigt, eine<br />
Deckschicht aufgebracht, Rasen gesät und<br />
ein Parkplatz mit 50 PKW-Stellplätzen<br />
errichtet. Nach den Sanierungsarbeiten
Mit Mitteln der Gemeinschaftsinitiative KONVER II unterstützten die Europäische Union sowie<br />
das Land Sachsen-Anhalt den Burgenlandkreis dabei, die ehemaligen Militärliegenschaften von<br />
Altlasten zu befreien und sie zu renaturieren, um Gewerbeflächen zu schaffen und damit neue<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten zu lancieren.<br />
Der Altbestand vor der Sanierung.<br />
wird das ehemalige Kasernengebäude<br />
„Haus 3“ als Verwaltungssitz für die<br />
Kreisverwaltung des Burgenlandkreises<br />
genutzt.<br />
Um eine Nutzung des Gesamtareals zu<br />
gewährleisten, erfolgten im Rahmen eines<br />
zweiten KONVER-Vorhabens eine aufwendige<br />
Altlastensanierung, der Abriss sowie<br />
die Beräumung von nicht mehr nutzbarer<br />
Gebäudesubstanz auf dem gesamten<br />
Kasernengelände „Schönburger Straße“.<br />
So wurden z. B. eine alte Einfriedungsmauer<br />
und 52 Heiztrassenfundamente<br />
abgerissen, die Fundamentlöcher verfüllt<br />
und eine 44 Meter lange Heizrohrleitung<br />
einschließlich Stahlkonstruktion abgebrochen.<br />
Zwei weitere Kasernenblöcke, die ehemalige<br />
Reithalle, fünf Garagen eines Garagenkomplexes<br />
sowie zwei Pförtnerhäuschen<br />
wurden abgerissen, das Gelände beräumt,<br />
die Fundamente verfüllt und die Geländeoberflächen<br />
hergerichtet.<br />
Insgesamt kosteten die im Rahmen der<br />
beiden KONVER-Vorhaben realisierten<br />
Abriss-, Beräumungs- und Sanierungsarbeiten<br />
ca. 3,4 Millionen DM. Etwa 2,5<br />
Millionen DM gewährten die Europäische<br />
Union aus dem Europäischen Fonds für<br />
regionale Entwicklung und das Land<br />
Sachsen-Anhalt als Zuschuss aus Mitteln<br />
der Gemeinschaftsinitiative KONVER II.<br />
Haus 3 nach der Sanierung.<br />
NAUMBURG<br />
27
KMU<br />
FÖRDERPERIODE 1994 – 1999<br />
B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />
PROJEKTE: 1737<br />
FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 106.726.986 DM<br />
ZUSCHUSS: 75.710.244 DM<br />
DAVON AUS EU-MITTELN: 56.782.683 DM<br />
DAVON AUS LANDES-MITTELN: 18.927.561 DM
Eintrittskarte in den<br />
Europäischen Wettbewerb<br />
Die im Jahr 1990 in den neu gegründeten Ländern vorhandene, stark planwirtschaftlich geprägte Wirtschaftsstruktur<br />
war vorwiegend im osteuropäischen Wirtschaftsverband eingebunden und bestand weitgehend aus<br />
Großbetrieben oder Kombinaten. Ein leistungsstarker Mittelstand existierte praktisch nicht.<br />
Nach den Erfahrungen in den alten Ländern wird etwa die Hälfte des Bruttosozialproduktes in mittelständischen<br />
Unternehmen erzeugt. Sie bieten 66 % aller Arbeitsplätze und 80 % aller Ausbildungsplätze. Dies begründet den<br />
hohen Stellenwert der kleinen und mittleren Unternehmen. Daher lag eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen<br />
Aufgaben im Wiederaufbau eines leistungsstarken Mittelstandes und dessen Anpassung an die nationale und internationale<br />
Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Zur Unterstützung des Mittelstandes initiierte die Europäische Kommission die Gemeinschaftsinitiative kleine und<br />
mittlere Unternehmen. Diese wurde über das Operationelle Programm KMU mit EU- und Landesmitteln umgesetzt.<br />
Dieser Mitteleinsatz soll die Anpassung der Wettbewerbsverhältnisse an den europäischen Binnenmarkt ermöglichen,<br />
um damit die Grundlagen für eine sich langfristig selbsttragende und ökologisch verträgliche Wirtschaftsentwicklung<br />
zu schaffen. Dies ist die grundlegende Voraussetzung des Erhaltes von vorhandenen sowie der langfristigen<br />
Schaffung von Arbeitsplätzen.<br />
29
30<br />
KMU ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM IN DER BURGER KNÄCKE AG<br />
Ein knackiges Stück Heimat<br />
Die Burger Knäcke AG, eine Fabrik mit Tradition. „Die erste Knäckebrot - Fabrik Deutschlands“ – so<br />
wirbt das Firmenlogo. Gegenwärtig werden in der Burger Knäcke AG mit 120 Mitarbeitern überaus<br />
erfolgreich Dauerbackwaren entwickelt, hergestellt und vertrieben.<br />
KONTAKT: BURGER KNÄCKE AG<br />
NIEGRIPPER CHAUSSEE 7<br />
39288 BURG<br />
TEL. 0 39 21. 9 23 - 0<br />
FAX 03921.923-160<br />
Burger Knäcke – eine Fabrik<br />
mit langer Tradition.<br />
25 km östlich der Landeshauptstadt<br />
Sachsen-Anhalts Magdeburg liegt die<br />
Kreisstadt des Jerichower Landes Burg.<br />
Hierher wurde 1931 der Firmenstandort<br />
der durch Dr. Wilhelm Kraft 1927 in<br />
Berlin-Lichtenfelde gegründeten „Ersten<br />
Deutschen Knäckebrotwerke“ verlegt. Er<br />
wusste, dass die Magdeburger Börde nicht<br />
nur eine der größten Kornkammern<br />
Deutschlands war, sondern hier auch der<br />
beste Roggen angebaut wurde. Es boten<br />
sich also ideale Voraussetzungen für den<br />
Aufbau des Unternehmens.<br />
Nach der Enteignung 1945 wurde aus dem<br />
Unternehmen der „VEB Erste Deutsche<br />
Knäckebrotwerke Burg“. Während der 40jährigen<br />
Planwirtschaft steigerte sich die<br />
Produktionskapazität kontinuierlich auf<br />
bis zu 40 Mio. Packungen im Jahr. Die<br />
durch den Gründer Dr. Kraft initiierte<br />
Unternehmensstrategie, nämlich eine gesunde<br />
Alternative zum herkömmlichen<br />
Brot anzubieten, hatte auch in der sozialistischen<br />
Planwirtschaft ihren Erfolg.<br />
1990 – das Jahr der Wiedervereinigung<br />
Deutschlands. Mit der politischen Wende<br />
kam der wirtschaftliche Einbruch. Die vorhandenen<br />
Absatzmärkte brachen weg, und<br />
die starke Konkurrenz hatte 45 Jahre Vorlauf<br />
im Konsolidierungsprozess eines national<br />
und international wettbewerbsfähigen<br />
Standards.<br />
Zunächst kam es 1990 sogar zum Stillstand<br />
der Produktion. Die Belegschaft musste<br />
von 750 auf 112 Mitarbeiter reduziert werden.<br />
Die bereits von hoher Arbeitslosigkeit<br />
bedrohte Region schien einen ihrer traditionsreichsten<br />
Arbeitgeber zu verlieren.<br />
Jetzt hieß es kämpfen, die Ärmel hochkrempeln<br />
und nach Alternativen und Möglichkeiten<br />
suchen, um das Unternehmen<br />
aus der Talsohle zu führen. Schließlich<br />
waren alle Betroffenen von den Produkten<br />
überzeugt, und die früheren Verkaufszahlen<br />
untermauerten diese Einstellung.<br />
Deshalb setzte ein neues Marketingkonzept<br />
auf alt bewährte Traditionen. Qualitativ<br />
höherwertige und optisch ansprechendere<br />
Verpackungen wurden entwickelt. Mit<br />
dem Motto „Ein knackiges Stück Heimat“<br />
wurde der Werbefeldzug angetreten – und<br />
das mit Erfolg.<br />
Schnell wurde dem Unternehmen bewusst:<br />
Wer sich langfristig auf dem nationalen sowie<br />
internationalen Markt behaupten will<br />
und den immer stärker wehenden Markt-
Doch beschäftigt man sich etwas genauer mit der Firmengeschichte, so war es nach der politischen<br />
Wiedervereinigung Deutschlands 1990 ein steiniger Weg für das Unternehmen bis zur Erreichung<br />
des heutigen Standes.<br />
Die Burger Knäcke AG – erste deutsche Knäckebrotfabrik.<br />
wind für sich zu nutzen weiß, kommt an<br />
dem Thema Qualitätsmanagementsystem<br />
nicht mehr vorbei.<br />
Einerseits war das Unternehmen von der<br />
Notwendigkeit der Durchführung eines<br />
Qualitätsmanagementsystems überzeugt,<br />
andererseits stellte sich die Frage nach<br />
der Finanzierung. Zudem wurden im Unternehmen<br />
mit Hilfe des Landes Sachsen-<br />
Anhalt im Vorfeld bereits nötige Investitionen<br />
in Millionenhöhe realisiert.<br />
Naheliegend war daher, durch monetäre<br />
Zuwendungen, auch dieses Vorhaben zu<br />
verwirklichen. Das Unternehmen führte<br />
Ende 1999 mit einem Gesamtausgabevolumen<br />
von DM 24.630,00 die Zertifizierung<br />
nach DIN ISO 9 001 erfolgreich durch.<br />
Dies war möglich durch die finanzielle Unterstützung<br />
der Europäischen Union und<br />
des Landes Sachsen-Anhalt, die dieses Projekt<br />
gemeinschaftlich mit 75 % der entstandenen<br />
Kosten bezuschussten.<br />
Mit Hilfe des Qualitätsmanagementsystems<br />
wurden Verfahrensabläufe optimiert, interne<br />
Prozesse und Strukturen durch die Beseitigung<br />
von Organisationsmängeln<br />
effektiver und kostengünstiger gestaltet.<br />
Dadurch konnten die Qualität der Produk-<br />
te, der Dienstleistungsservice und die Kundenbindung<br />
enorm verbessert werden.<br />
Das Bemühen wurde belohnt. Derzeit liegt<br />
der Marktanteil in den neuen Bundesländern<br />
bei 60 %.<br />
Auch das Ausland ist auf den Geschmack<br />
des Burger Knäckebrotes und Zwiebackes<br />
gekommen. Schon heute wird z. B. nach<br />
Frankreich, England, Italien, Tschechien<br />
sowie über „den großen Teich“ nach Amerika<br />
exportiert.<br />
Weit über die Ländergrenzen hinaus bekannt.<br />
BURG<br />
31
IMPRESSUM<br />
Herausgeber: Ministerium für Wirtschaft und Technologie<br />
des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Wilhelm-Höpfner-Ring 4<br />
39116 Magdeburg<br />
Tel. 03 91 . 5 67 - 01<br />
Fax 03 91 . 81 50 72<br />
E-Mail: poststelle@mw.lsa-net.de<br />
Internet: www.mw.sachsen-anhalt.de<br />
Verantw. Redakteurin: Kathrin Kuhn,<br />
Geschäftsstelle RECHAR im Hause Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt<br />
Texte: Kathrin Kuhn, Marion Stephan,<br />
mit freundlicher Unterstützung durch die jeweiligen Projektträger und<br />
durch die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle RECHAR<br />
Doris Gruß und Christina Wamsler<br />
Fotos: Thale: Foto Voigt GmbH<br />
Königshütte: CIKA Projektierungs GmbH<br />
FERROPOLIS: Bildjournalist Frank Drechsler<br />
Halle: Landschaftsarchitekturbüro Därr (Luftbild), Fotografenmeister W. Ziegler<br />
Alle weiteren Fotos wurden freundlicherweise von den jeweiligen Projektträgern<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Gestaltung und Satz: Hoffmann und Partner Werbeagentur GmbH, Magdeburg<br />
Druck: Grafisches Centrum Cuno, Calbe<br />
Juni 2001<br />
Diese Broschüre wurde durch die Gemeinschaftsinitiative RESIDER II kofinanziert.<br />
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT<br />
Europäischer Fonds<br />
für Regionale Entwicklung