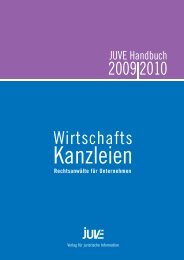NJW 8/2013, S. 497 ff. - Kiermeier Haselier Grosse
NJW 8/2013, S. 497 ff. - Kiermeier Haselier Grosse
NJW 8/2013, S. 497 ff. - Kiermeier Haselier Grosse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Neue Juristische Wochenschrift<br />
In Verbindung mit dem Deutschen Anwaltverein<br />
und der Bundesrechtsanwaltskammer herausgegeben von Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Rechtsanwalt in<br />
Kiel – Prof. Dr. Rainer Hamm, Rechtsanwalt in Frankfurt a. M. – Dr. Dr. h. c. Georg Maier-Reimer,<br />
Rechtsanwalt in Köln – Prof. Dr. Hans-Jürgen Rabe, Rechtsanwalt in Berlin – Ingeborg Rakete-<br />
Dombek, Rechtsanwältin und Notarin in Berlin – Dr. Michael Streck, Rechtsanwalt in Köln.<br />
Schriftleitung: Rechtsanwalt Tobias Freudenberg, Beethovenstraße 7b, 60325 Frankfurt a. M.<br />
8 <strong>2013</strong><br />
Seite <strong>497</strong>–560<br />
66. Jahrgang<br />
21. Februar <strong>2013</strong><br />
Rechtsanwalt Volker Schmidt*<br />
Aktuelle Probleme des § 648 a BGB<br />
Mit Wirkung zum 1. 1. 2009 sind die Neuregelungen des<br />
§ 648 a I, V und VI BGB zur Bauhandwerkersicherung eingeführt<br />
worden. In den vergangenen Jahren gab es mehrfach<br />
Anlass für den BGH und für die Obergerichte, sich mit diesen<br />
Neuregelungen und den praktischen Auswirkungen zu befassen.<br />
Dabei hat die Rechtsprechung zahlreiche strittige Fragen<br />
für die häufigsten Anwendungsfälle geklärt. Es hat sich<br />
gezeigt, dass § 648 a BGB zu einem wirksamen Druckmittel<br />
der Auftragnehmer geworden ist und für diese eine Option<br />
darstellt, Bauverträge kurzfristig und rechtssicher zu beenden.<br />
Dieser Beitrag befasst sich mit häufig auftretenden,<br />
aktuellen Rechtsfragen rund um § 648 a BGB.<br />
I. Einleitung<br />
Mit den Änderungen des § 648 a BGB hat der Gesetzgeber<br />
den Sicherungsanspruch des Unternehmers grundlegend neu<br />
gestaltet. Nach der Altfassung von § 648 a BGB bestand kein<br />
klagbarer Anspruch auf eine Sicherheit. Der Unternehmer<br />
hatte im Falle der Nichterfüllung des Sicherungsverlangens<br />
lediglich die Wahl, die Leistung zu verweigern und zu kündigen<br />
(§ 648 a V BGB a. F.) oder schlicht weiterzubauen und<br />
auf die Sicherheit zu verzichten. Der Gesetzgeber hat mit der<br />
Neufassung des § 648 a V 1 BGB dem Unternehmer nun<br />
mehrere Alternativen zur Verfügung gestellt: Der Unternehmer<br />
kann nach Ablauf der Frist zur Sicherheitsleistung weitere<br />
Bauleistungen verweigern oder den Vertrag kündigen.<br />
Der Unternehmer kann aber auch weiterarbeiten und seinen<br />
Anspruch auf Sicherheitsleistung mit gerichtlicher Hilfe<br />
durchsetzen 1 . Mit der Scha<strong>ff</strong>ung eines eigenen, durchsetzbaren<br />
Anspruchs auf Sicherheitsleistung hat der Gesetzgeber<br />
die Bedeutung des § 648 a BGB für die Praxis erheblich aufgewertet.<br />
Nach der Neufassung des Gesetzes muss nun jeder<br />
Besteller, der nicht unter die Ausnahmen des § 648 a VI BGB<br />
fällt, damit rechnen, dass er eine Sicherheit leisten muss.<br />
Rechtlich ist es ohne Weiteres möglich, dass der Unternehmer<br />
den Besteller unmittelbar nach Abschluss des Bauvertrags<br />
au<strong>ff</strong>ordert, eine Sicherheit in Höhe des gesamten Auftragswerts,<br />
zuzüglich 10 %, zu leisten. Auf Grund der gewachsenen<br />
Bedeutung des § 648 a BGB geht dieser Beitrag auf die<br />
zentralen Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Sicherheitsleistung<br />
ein.<br />
II. Personeller Anwendungsbereich<br />
1. Anspruchsteller<br />
Eine Sicherheit gem. § 648 a BGB kann nur der Unternehmer<br />
eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon<br />
fordern. Für den Bauunternehmer, der mit Hoch-, Tief- oder<br />
Ausbauleistungen beauftragt ist, bereitet der personelle Anwendungsbereich<br />
von § 648 a BGB regelmäßig keine Probleme.<br />
Strittig ist der personelle Anwendungsbereich aber bereits<br />
dann, wenn die Leistung des Unternehmers nicht unmittelbar<br />
zu einer Werterhöhung des Bauwerks führt 2 . Nach der Gesetzesbegründung<br />
soll unter die Anspruchsberechtigten auch<br />
der Architekt oder Statiker fallen, wenn er die für die Errichtung<br />
eines Bauwerks notwendige geistige Leistung schuldet 3 .<br />
Der Wortlaut des § 648 a BGB enthält zudem keine Beschränkung<br />
auf eine mögliche Werterhöhung für das Bauwerk.<br />
Von daher ist kein Grund ersichtlich, warum Architekten,<br />
planende und überwachende Bauingenieure, Statiker<br />
oder andere Sonderfachleute von dem berechtigten Kreis der<br />
Anspruchsteller ausgenommen bleiben sollten 4 .<br />
Strittig ist zudem, ob ein Auftragnehmer, der reine Vorbereitungsarbeiten<br />
für ein Bauwerk auszuführen hat, Unternehmer<br />
eines Bauwerks i. S. von § 648 a BGB ist. Der BGH hat<br />
bereits für § 648 a I BGB a. F. entschieden, dass der Unternehmer,<br />
der lediglich Rodungsarbeiten zur Baufeldfreimachung<br />
ausführt, kein Unternehmer einer Außenanlage ist 5 .<br />
Deswegen ist auch für Gerüstbauleistungen umstritten, ob<br />
der Gerüstbauunternehmer zum Kreis der geschützten Bauwerksunternehmer<br />
i. S. von § 648 a BGB gehört, wenn er mit<br />
selbstständigen Gerüstbauleistungen beauftragt ist. Nach einer<br />
Au<strong>ff</strong>assung sind Gerüstbauleistungen eine unverzichtbare<br />
Voraussetzung dafür, dass die unmittelbar dem Bauwerk<br />
dienenden Leistungen erbracht werden können, so dass eine<br />
* Der Autor ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in der Dresdner<br />
Kanzlei <strong>Kiermeier</strong>, <strong>Haselier</strong>, <strong>Grosse</strong>.<br />
1 BT-Dr 16/511, S. 17; Joussen, IBR 2010, 3; Schmitz, in: Kni<strong>ff</strong>ka, BauvertragsR,<br />
2012, § 648 a Rdnrn. 30 <strong>ff</strong>. m. w. Nachw.; ders., BauR 2009,<br />
714 (718 f.).<br />
2 Vgl. zum Streitstand Joussen, in: Ingenstau/Korbion, VOB, 18. Aufl.<br />
(<strong>2013</strong>), Anh. 1 Rdnr. 146.<br />
3 BT-Dr 12/1836, S. 8.<br />
4 OLG Düsseldorf, NZBau 2005, 164 = BauR 2005, 416, bespr. v.<br />
Weise/Hänsel, <strong>NJW</strong>-Spezial 2005, 168; Scholtissek, NZBau 2009, 91<br />
(93).<br />
5 BGH, <strong>NJW</strong>-RR 2005, 750 = NZBau 2005, 281 = BauR 2005, 1019.
498 <strong>NJW</strong> 8/<strong>2013</strong><br />
Aufsätze<br />
Schmidt, Aktuelle Probleme des § 648 a BGB<br />
Sicherheit verlangt werden kann 6 . Ähnlich wie bei den Rodungsarbeiten<br />
handelt es sich aber auch bei selbstständigen<br />
Gerüstbauleistungen um reine Vorbereitungsmaßnahmen, so<br />
dass ausgehend vom Beschluss des BGH zu den Rodungsarbeiten<br />
auch Gerüstbauleistungen nicht unter § 648 a BGB<br />
fallen 7 . Der Wortlaut des § 648 a BGB und auch die Gesetzesbegründung<br />
8 enthalten jedoch keine Hinweise darauf,<br />
dass der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Unternehmer<br />
beschränkt ist, die für eine Werterhöhung des Bauwerks sorgen.<br />
Es ist auch keine Beschränkung auf Unternehmer ersichtlich,<br />
deren Leistungen dem Bauwerk unmittelbar zu Gute<br />
kommen.<br />
Der Ausschluss von Vorbereitungsarbeiten und von selbstständigen<br />
Gerüstbauleistungen aus dem Anwendungsbereich<br />
von § 648 a BGB ist daher mit dem Wortlaut des Gesetzes<br />
sowie Sinn und Zweck der Norm nicht in Einklang zu bringen<br />
und deswegen nicht überzeugend. Das belegt auch ein<br />
Vergleich mit den Planungs- und Bauüberwachungsleistungen.<br />
Auch diese Leistungen führen nicht zu einer unmittelbaren<br />
Werterhöhung des Bauwerks und trotzdem sind sie<br />
von § 648 a BGB umfasst. Lediglich Bausto<strong>ff</strong>lieferanten, die<br />
ihre Leistungen auf Grund eines Kaufvertrags zu erbringen<br />
haben, sollen nach der Gesetzesbegründung nicht unter<br />
§ 648 a BGB fallen 9 .<br />
2. Anspruchsgegner<br />
Anspruchsverpflichteter ist gem. § 648 a BGB der Besteller,<br />
also der Vertragspartner des Unternehmers. § 648 a VI BGB<br />
enthält für die Anspruchsverpflichteten zwei wichtige Ausnahmen.<br />
Gemäß § 648 a VI 1 Nr. 1 BGB findet § 648 a BGB keine<br />
Anwendung, wenn der Besteller eine juristische Person des<br />
ö<strong>ff</strong>entlichen Rechts ist oder es sich um ein ö<strong>ff</strong>entlich-rechtliches<br />
Sondervermögen handelt, über deren Vermögen ein<br />
Insolvenzverfahren unzulässig ist. Häufig wird darüber gestritten,<br />
ob kirchliche Organisationen und deren Untergliederungen,<br />
also beispielsweise eine Pfarrei, zur Stellung einer<br />
Bauhandwerkersicherung verpflichtet sind. In dem Zusammenhang<br />
wird von den Unternehmen ein Beschluss des OLG<br />
Celle aus dem Jahr 2011 10 herangezogen. Diese Entscheidung<br />
befasste sich mit der Frage, ob ein Bistum ö<strong>ff</strong>entlicher Auftraggeber<br />
i. S. von § 98 Nr. 2 GWB ist und damit – unter den<br />
weiteren Voraussetzungen – zur Anwendung des Kartellvergaberechts<br />
verpflichtet ist. Diese Au<strong>ff</strong>assung berücksichtigt<br />
aber nicht, dass es bei § 648 a VI 1 Nr. 1 BGB nicht darauf<br />
ankommt, ob die betre<strong>ff</strong>ende Körperschaft ein ö<strong>ff</strong>entlicher<br />
Auftraggeber ist oder nicht. Zur Stellung einer Bauhandwerkersicherung<br />
ist der Besteller nicht verpflichtet, wenn es sich<br />
um eine juristische Person des ö<strong>ff</strong>entlichen Rechts handelt,<br />
über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist.<br />
Die Untergliederungen der Kirchen sind gem. Art. 140 GG<br />
i. V. mit Art. 137 V 1 WRV Körperschaften des ö<strong>ff</strong>entlichen<br />
Rechts. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen einer<br />
Untergliederung der Kirche als Körperschaft des ö<strong>ff</strong>entlichen<br />
Rechts ist unzulässig. Denn gem. Art. 140 GG i. V. mit<br />
Art. 137 III WRV ordnen die Religionsgesellschaften ihre<br />
Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken der<br />
für alle geltenden Gesetze. Die Zulässigkeit einer Insolvenz<br />
über Untergliederungen der Kirche hätte aber zur Folge, dass<br />
die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnisse der betre<strong>ff</strong>enden<br />
Untergliederung eingeschränkt bzw. sogar ausgeschlossen<br />
wird, weil diese Rechte auf den Insolvenzverwalter übergehen<br />
würden. Ein solcher Eingri<strong>ff</strong> in die grundgesetzlich garantierte<br />
Selbstverwaltung der Kirchen ist damit unzulässig 11 . Damit<br />
liegen beide Voraussetzungen für den Anwendungsausschluss<br />
des§ 648 a VI 1 Nr. 1 BGB vor.<br />
Auch die zweite Ausnahme gem. § 648 a VI 1 Nr. 2 BGB<br />
bereitet in der Praxis hin und wieder Probleme. Demnach<br />
findet § 648 a I–V BGB keine Anwendung, wenn der Besteller<br />
eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung<br />
oder Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder<br />
ohne Einliegerwohnung ausführen lässt. So ist beispielsweise<br />
bereits zweifelhaft, warum der Gesetzgeber diesbezüglich Privatpersonen,<br />
die eine Eigentumswohnung errichten lassen,<br />
schlechter gestellt hat als Privatpersonen, welche die Errichtung<br />
eines Einfamilienhauses beauftragt haben 12 . Als Ausnahmevorschrift<br />
und auf Grund der abschließenden Formulierung<br />
greift die Ausnahmevorschrift des § 648 a VI 1 Nr. 2<br />
BGB bei der Errichtung einer Eigentumswohnung nicht 13 .<br />
III. Sachlicher Anwendungsbereich<br />
1. Gekündigte Bauverträge<br />
Die Kündigung eines Bauvertrags steht dem Anspruch des<br />
Unternehmers auf eine Sicherheit gem. § 648 a BGB nicht<br />
entgegen. Zwar hat das LG Hamburg unlängst so entschieden<br />
14 ; andere Gerichte, wie etwa das LG Nürnberg-Fürth 15 ,<br />
das OLG Brandenburg 16 und das LG Stuttgart 17 , haben<br />
jeweils mit guten Gründen gegenteilig judiziert. Denn schon<br />
der BGH hat zur Vorgängervorschrift mit Urteil vom 22. 1.<br />
2004 18 darauf hingewiesen, dass der Unternehmer auch noch<br />
nach einer Kündigung das Recht hat, eine Sicherheit zu verlangen.<br />
Der BGH hat dies seinerzeit zwar an die Voraussetzung<br />
geknüpft, dass der Besteller noch Erfüllung fordert.<br />
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die genannte<br />
BGH-Entscheidung noch zu der Vorgängervorschrift ergangen<br />
ist, die dem Unternehmer – anders als die Neufassung –<br />
lediglich ein Leistungsverweigerungsrecht eingeräumt hat.<br />
Ein Leistungsverweigerungsrecht läuft in der Tat leer, wenn<br />
der Unternehmer gar keine Leistungen mehr zu erbringen hat.<br />
Außerdem enthielt die Altfassung von § 648 a BGB die Voraussetzung,<br />
dass die Sicherheit für vom Unternehmer zu<br />
erbringende Vorleistungen zu stellen sei. Auch diese Einschränkung<br />
ist mit der am 1. 1. 2009 in Kraft getretenen<br />
Fassung von§ 648 a BGB entfallen.<br />
Die Änderung im Wortlaut der Vorschrift macht – wie übrigens<br />
auch die Gesetzesbegründung 19 – deutlich, dass es unter<br />
der Neufassung von § 648 a BGB für das Sicherheitsverlangen<br />
des Unternehmers nicht mehr darauf ankommen kann,<br />
ob und inwieweit der Unternehmer noch vorzuleisten verpflichtet<br />
ist. Das LG Stuttgart hat daher in seinem Urteil vom<br />
6 OLG Köln, BauR 2000, 1874 = BeckRS 1999, 31052077.<br />
7 OLG Hamburg, BauR 1994, 123 = BeckRS 1993, 30859565; LG<br />
Baden-Baden, Beschl. v. 21. 2. 2011 – 2 O 246/10, BeckRS 2011,<br />
19499; Joussen, in: Ingenstau/Korbion (o. Fußn. 2), Anh. 1 Rdnr. 7;<br />
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 14. Aufl. (<strong>2013</strong>), Rdnr. 320.<br />
8 BT-Dr 12/1836, S. 8.<br />
9 BT-Dr 12/1836, S. 8.<br />
10 OLG Celle, Beschl. v. 25. 8. 2011 – 13 Verg 5/11, BeckRS 2011,<br />
21496.<br />
11 BVerfG, <strong>NJW</strong> 1984, 2041; Hirte, in: Uhlenbruck, InsO, 13. Aufl.<br />
(2010), § 12 Rdnr. 14.<br />
12 Zum Streitstand vgl. Schmitz, in: Kni<strong>ff</strong>ka (o. Fußn. 1), § 648 a<br />
Rdnr. 24.<br />
13 Werner/Pastor (o. Fußn. 7), Rdnr. 325 m. w. Nachw.; Joussen, in: Ingenstau/Korbion<br />
(o. Fußn. 2), Anh. 1 Rdnrn. 227 <strong>ff</strong>. m. w. Nachw.<br />
14 LG Hamburg, <strong>NJW</strong>-RR 2011, 312.<br />
15 LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 12. 4. 2010 – 17 O 11183/09, IBRRS<br />
74629.<br />
16 OLG Brandenburg, BauR 2010, 1969 = BeckRS 2010, 16070.<br />
17 LG Stuttgart, IBR 2011, 85 = BeckRS 2010, 30075.<br />
18 BGH, <strong>NJW</strong>-RR 2004, 740 = NZBau 2004, 264 = BauR 2004, 834.<br />
19 BT-Dr 16/511, S. 17.
Schmidt, Aktuelle Probleme des § 648 a BGB<br />
Aufsätze<br />
<strong>NJW</strong> 8/<strong>2013</strong> 499<br />
3. 12. 2010 20 zutre<strong>ff</strong>end ausgeführt, dass die Grundaussage<br />
des Urteils des BGH vom 22. 1. 2004 21 , wonach der Besteller<br />
auch nach der Kündigung noch eine Sicherheit leisten muss,<br />
auch und gerade unter der Neufassung von § 648 a BGB<br />
weiter gilt. Denn gerade nach einer Kündigung besteht zumindest<br />
insoweit ein Sicherungsbedürfnis des Unternehmers,<br />
als er bis zur Kündigung Bauleistungen erbracht hat, für die<br />
der Besteller weder Zahlungen geleistet noch eine Sicherheit<br />
gestellt hat. Auch nach einer Kündigung soll der Unternehmer<br />
gem. § 648 a BGB davor geschützt werden, dass der<br />
Besteller insolvent wird. Dieses Risiko vermindert sich durch<br />
eine Kündigung nicht. Zutre<strong>ff</strong>end hebt das OLG Celle 22<br />
deswegen hervor, dass nach der Neufassung des § 648 a BGB<br />
nicht nur die zukünftige Vorleistungspflicht des Unternehmers,<br />
sondern auch gerade der bereits verdiente Werklohnanspruch<br />
des Unternehmers gesichert werden soll. Dem Unternehmer<br />
soll die Möglichkeit gegeben werden, sich eine<br />
schnelle Sicherheit zu bescha<strong>ff</strong>en, um in dem daran anschließenden<br />
Werklohnprozess die Berechtigung des geltend gemachten<br />
Anspruchs unter Berücksichtigung etwaiger Gegenforderungen<br />
des Bestellers klären zu können, ohne das Insolvenzrisiko<br />
des Bestellers während des Werklohnprozesses tragen<br />
zu müssen. Folglich kann eine Kündigung – von wem<br />
auch immer sie ausgesprochen wird – keinen Einfluss auf den<br />
Anspruch gem. § 648 a I 1 BGB haben, mit welchem dem<br />
Insolvenzrisiko des Bestellers begegnet werden soll 23 .<br />
Der Gesetzesbegründung und auch dem Gesetzeswortlaut<br />
sind keine Hinweise dafür zu entnehmen, dass der Anspruch<br />
auf eine Sicherheitsleistung nicht mehr bestehen soll, wenn<br />
der Bauvertrag gekündigt ist. Der Anspruch auf Sicherheitsleistung<br />
betri<strong>ff</strong>t natürlich nur solche Leistungen, die der Unternehmer<br />
bis zur Kündigung bereits ausgeführt hat. Der<br />
Unternehmer hat keinen Anspruch auf eine Sicherheit für<br />
solche Bauleistungen, die bis zur Kündigung noch nicht ausgeführt<br />
worden sind und nach einer wirksamen Kündigung<br />
auch nicht mehr ausgeführt werden müssen. Mit Blick auf<br />
Sinn und Zweck der Neufassung von § 648 a BGB besteht<br />
hierfür kein anzuerkennendes Sicherungsbedürfnis des Unternehmers.<br />
2. Abnahme<br />
Mit der Neufassung von § 648 a BGB hat der Gesetzgeber<br />
klargestellt, dass der Anspruch des Unternehmers auf die<br />
Sicherheit nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass der Besteller<br />
das Werk abgenommen hat. Nach der Rechtsprechung<br />
des BGH galt dies zwar auch für § 648 a BGB a. F. 24 . Jedoch<br />
sah sich der Gesetzgeber veranlasst, dies zum 1. 1. 2009 klarzustellen<br />
25 .<br />
3. Mängel<br />
Auch das Verhältnis eines Anspruchs auf Sicherheitsleistung<br />
gem. § 648 a BGB zu mangelbedingten Zahlungsansprüchen<br />
des Bestellers wurde mit der Neufassung des § 648 a I BGB<br />
klargestellt. Nach dessen Satz 4 bleiben Ansprüche, mit denen<br />
der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf<br />
Vergütung aufrechnen kann, bei der Berechnung der Vergütung<br />
unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder<br />
rechtskräftig festgestellt. Der Gesetzgeber hat dabei in Kauf<br />
genommen, dass der Besteller auch dann eine Sicherheit leisten<br />
muss, wenn der Unternehmer mangelhaft gearbeitet hat.<br />
§ 648 a BGB hindert den Besteller zwar nicht daran, mit<br />
seinen Gegenforderungen gegen den Vergütungsanspruch des<br />
Unternehmers aufzurechnen. Auf den Sicherheitsanspruch<br />
des Unternehmers hat das aber keinen Einfluss 26 . Allein das<br />
Bestehen von Mängeln – und damit gegebenenfalls eines Leistungsverweigerungsrechts<br />
des Bestellers – ändert nichts an<br />
dem durchsetzbaren Anspruch des Unternehmers auf Sicherheitsleistung;<br />
Mängel verringern auch nicht die Höhe der<br />
Sicherheit 27 .<br />
IV. Au<strong>ff</strong>orderungsschreiben und Fristsetzung–<br />
Rechtsfolgen<br />
nach Ausbleiben der geforderten Sicherheit<br />
Nachdem eine angemessene Frist zur Übergabe der Sicherheit<br />
abgelaufen ist, hat der Unternehmer das Recht, den Bauvertrag<br />
gem. § 648 a V 1 BGB zu kündigen oder weitere Leistungen<br />
zu verweigern.<br />
1. Inhalt des Au<strong>ff</strong>orderungsschreibens<br />
Die formalen Anforderungen an die Au<strong>ff</strong>orderung zur Sicherheitsleistung<br />
sind durch die Neufassung des § 648 a BGB entschärft<br />
worden. Nach der Altfassung des Gesetzes musste der<br />
Unternehmer noch eine doppelte Frist setzen und er musste<br />
darauf achten, dass die Frist- und Nachfristsetzung nicht in<br />
dem gleichen Schreiben erfolgten 28 . Zudem musste der Unternehmer<br />
dem Besteller mit der Nachfrist ausdrücklich androhen,<br />
dass er den Vertrag kündige, wenn der Besteller die<br />
geforderte Sicherheit nicht leiste.<br />
Nach der Neufassung des Gesetzes genügt eine einmalige<br />
Fristsetzung 29 . Die Au<strong>ff</strong>orderung muss noch nicht einmal<br />
schriftlich erfolgen. Dies ist lediglich zu Beweiszwecken zu<br />
empfehlen. Da der Besteller nach § 648 a BGB nicht verpflichtet<br />
ist, eine bestimmte Sicherheit zu übergeben, darf der<br />
Unternehmer die Art der Sicherheit nicht vorgeben. Der Unternehmer<br />
sollte also beispielsweise nicht die Übergabe einer<br />
Bankbürgschaft fordern, sondern etwa eine zulässige Sicherheit.<br />
Der Besteller hat dann insoweit die Wahl. Fordert der<br />
Unternehmer eine bestimmte oder eine überhöhte Sicherheit,<br />
ist das Sicherungsverlangen aber nur dann unwirksam, wenn<br />
die Forderung des Unternehmers völlig überzogen und unverhältnismäßig<br />
ist 30 . Überschreitet die Au<strong>ff</strong>orderung des Unternehmers<br />
die Grenze zur Unverhältnismäßigkeit nicht, ist der<br />
Besteller verpflichtet, eine zulässige Sicherheit in der gesetzlich<br />
geforderten Höhe zu übergeben.<br />
2. Angemessene Frist zur Sicherheitsleistung<br />
Ein Leistungsverweigerungsrecht des Unternehmers oder ein<br />
Kündigungsrecht entsteht erst, wenn der Unternehmer dem<br />
Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der<br />
Sicherheit gesetzt hat. Der Gesetzgeber hat den Begri<strong>ff</strong> der<br />
Angemessenheit in diesem Zusammenhang nicht näher definiert.<br />
Der Gesetzbegründung ist zu entnehmen, dass bewusst<br />
davon abgesehen wurde, diesen Begri<strong>ff</strong> näher zu bestimmen<br />
31 . Eine Frist zur Leistung der Sicherheit ist jedenfalls<br />
dann angemessen, wenn es dem Besteller in dieser Frist ermöglicht<br />
wird, die Sicherheit ohne schuldhaftes Zögern zu<br />
erlangen. Dabei ist darauf abzustellen, was von einem Besteller<br />
verlangt werden kann, der sich in normalen finanziellen<br />
20 LG Stuttgart, Teilurt. v. 3. 12. 2010 – 8 O 248/10, BeckRS 2010,<br />
30075.<br />
21 BGH, <strong>NJW</strong>-RR 2004, 740.<br />
22 OLG Celle, BauR 2012, 1808 = BeckRS 2012, 17930.<br />
23 So auch LG Paderborn, Urt. v. 9. 6. 2011 – 3 O 521/10, BeckRS 2011,<br />
23329 und LG Stralsund, Urt. v. 14. 9. 2011 – 1 S 41/11, BeckRS 2012,<br />
09167.<br />
24 BGHZ 157, 335 = <strong>NJW</strong> 2004, 1525 = NZBau 2004, 259.<br />
25 BT-Dr 16/511, S. 17.<br />
26 BT-Dr 16/511, S. 17.<br />
27 BGHZ 146, 24 = <strong>NJW</strong> 2001, 822 = NZBau 2001, 129.<br />
28 BGH, <strong>NJW</strong>-RR 2011, 235 = NZBau 2011, 93.<br />
29 Schmitz, BauR 2009, 714 (719).<br />
30 Joussen, in: Ingenstau/Korbion (o. Fußn. 2), Rdnr. 150 m. w. Nachw.<br />
31 BT-Dr 12/1836, S. 8.
500 <strong>NJW</strong> 8/<strong>2013</strong><br />
Aufsätze<br />
Schmidt, Aktuelle Probleme des § 648 a BGB<br />
Verhältnissen befindet 32 . Eine Frist von einer Woche kann<br />
bei professionellen Auftraggebern auch bei einem Großauftrag<br />
ausreichend sein 33 . Mittlerweile sollte es sich bei diesen<br />
Bauherren herumgesprochen haben, welche Rechte dem Unternehmer<br />
gem. § 648 a BGB zustehen. Eine Frist von deutlich<br />
über zehn Tagen wird man dem Bauherrn daher nur in<br />
seltenen Ausnahmefällen gewähren können 34 . Auf Grund der<br />
notwendigen Zeit für die Bescha<strong>ff</strong>ung der Sicherheit soll deswegen<br />
in der Regel eine Frist von sieben bis zehn Tagen<br />
notwendig sein 35 . Um die Rechtsfolge einer ausgebliebenen<br />
Sicherheitsleistung herbeizuführen, ist aus Sicht des Unternehmers<br />
darauf zu achten, in jedem Fall eine nach Tagen<br />
oder nach einem konkreten Datum bestimmte Frist zu setzen,<br />
so dass kein Zweifel darüber besteht, ab welchem Zeitpunkt<br />
ein Leistungsverweigerungsrecht bzw. ein Kündigungsrecht<br />
gegeben ist 36 . Setzt der Unternehmer dem Besteller eine zu<br />
kurze Frist, dann ist die Fristsetzung aber nicht wirkungslos,<br />
sondern es wird eine angemessene Frist in Gang gesetzt 37 .<br />
Trotzdem ist es aus Sicht des Unternehmers nicht empfehlenswert,<br />
eine zu kurze Frist zu setzen. Denn dadurch geht der<br />
Unternehmer das Risiko ein, dass die Ausübung eines Leistungsverweigerungsrechts<br />
oder die Kündigung noch vor Ablauf<br />
einer angemessenen Frist erfolgt, mit der Konsequenz,<br />
dass die Kündigung bzw. die Leistungsverweigerung zu Unrecht<br />
erfolgte und der Besteller seinerseits daraus folgende<br />
Ansprüche geltend macht.<br />
Nach der Neufassung des Gesetzes muss der Unternehmer in<br />
seinem Au<strong>ff</strong>orderungsschreiben auch nicht auf die Rechtsfolgen<br />
im Falle einer nicht fristgemäßen Sicherheitsleistung hinweisen.<br />
Weder muss der Unternehmer ein Leistungsverweigerungsrecht<br />
noch eine Vertragskündigung androhen. Denn der<br />
Verweis des § 648 a V 1 auf § 643 S. 1 BGB ist mit der ab<br />
dem 1. 1. 2009 geltenden Neufassung des § 648 a V BGB<br />
entfallen. Auch eine doppelte Fristsetzung, also die Setzung<br />
einer Nachfrist, ist nach dem Wortlaut der aktuellen Fassung<br />
des Gesetzes entbehrlich.<br />
3. Wettlauf der Fristen<br />
Der Anspruch des Unternehmers auf eine Sicherheitsleistung<br />
gem. § 648 a BGB entsteht bereits mit Abschluss des Bauvertrags<br />
38 . In der Praxis üben die Auftragnehmer dieses Recht<br />
aber häufig erst aus, wenn es während der Bauausführung zu<br />
Streitigkeiten mit dem Besteller kommt. In dieser Situation<br />
droht den Bauvertragsparteien der Wettlauf der Fristen. Verweigert<br />
der Unternehmer weitere Leistungen zu Recht, weil<br />
er dem Besteller fruchtlos eine angemessene Frist zur Übergabe<br />
einer Sicherheit gesetzt hatte, kann der Besteller von<br />
dem Unternehmer keine weiteren Leistungen beanspruchen<br />
39 . Ist eine angemessene Frist zur Übergabe einer Sicherheit<br />
abgelaufen, dann geht eine Au<strong>ff</strong>orderung des Bestellers,<br />
Mängel zu beseitigen bzw. die Bauleistungen zügig fortzusetzen<br />
(§§ 4 VII, 5 IV VOB/B), ins Leere, da der Unternehmer<br />
seine Leistungen zu Recht verweigert. Umgekehrt gilt dies<br />
jedoch genauso. Setzt der Besteller dem Unternehmer eine<br />
Frist zur Mangelbeseitigung bzw. zur zügigen Fortsetzung<br />
der Arbeiten und läuft diese Frist – gegebenenfalls verbunden<br />
mit einer Kündigungsandrohung (§ 4 VII i. V. mit § 8 III<br />
VOB/B) – ab, bevor die von dem Unternehmer gesetzte angemessene<br />
Frist zur Übergabe einer Sicherheit gem. § 648 a<br />
BGB abgelaufen ist, dann entsteht das Kündigungsrecht des<br />
Bestellers zu einem Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer seine<br />
Leistungen noch nicht verweigern durfte. In diesem Fall kündigt<br />
der Besteller zu Recht 40 . Kommt es zu gegenseitigen<br />
Fristsetzungen der Bauvertragsparteien, ist es im Falle gegenseitiger<br />
Kündigungen daher entscheidend, welche angemessene<br />
Frist zuerst abgelaufen ist. Hier spricht man vom so genannten<br />
Wettlauf der Fristen 41 .<br />
V. Unabdingbarkeit<br />
Vereinbarungen, die eine Sicherheit nach § 648 a BGB insgesamt<br />
ausschließen, sind gem. § 648 a VII BGB unwirksam.<br />
Das gilt auch für Parteiabreden, welche die gesetzlichen Regelungen<br />
in § 648 a I–V BGB lediglich in der einen oder<br />
anderen Hinsicht verändern 42 . Das gilt selbstverständlich<br />
nicht nur für Vereinbarungen im Wege von Allgemeinen Geschäftsbedingungen,<br />
sondern auch für Individualvereinbarungen<br />
43 . Seitens der Auftraggeber wird aber häufig der Versuch<br />
unternommen, durch die Vertragsgestaltung den Unternehmer<br />
davon abzuhalten, seine Rechte gem. § 648 a BGB<br />
geltend zu machen. So ist beispielsweise die Klausel „Verlangt<br />
der Unternehmer eine Sicherheit gem. § 648 a BGB, so<br />
richtet sich die Fälligkeit der Abschlagszahlungen nach<br />
§ 632 a BGB“ gebräuchlich. Diese Klausel verstößt weder<br />
gegen § 648 a VII BGB noch als Allgemeine Geschäftsbedingung<br />
gegen § 307 BGB. Der Unternehmer hat mit der Regelung<br />
über die Bauhandwerkersicherung gem. § 648 a BGB<br />
erhebliches Druckpotenzial. Er hat die Möglichkeit, von seinem<br />
Auftraggeber unmittelbar nach Vertragsschluss eine Sicherheit<br />
in Höhe der gesamten Vergütung, zuzüglich 10 %<br />
für Nebenforderungen zu verlangen. Dieses Recht des Unternehmers<br />
ist nicht – auch nicht im Wege einer Individualvereinbarung<br />
– abdingbar. Gemäß § 632 a BGB kommt es für<br />
den Anspruch des Unternehmers auf Abschlagszahlungen<br />
darauf an, inwieweit der Auftraggeber durch die Leistung des<br />
Unternehmers einen Wertzuwachs erlangt hat. Vereinbaren<br />
die Vertragsparteien die Geltung der VOB/B, dann kommt es<br />
gem. § 16 I 1 Nr. 1 VOB/B nicht auf den Wertzuwachs beim<br />
Auftraggeber an, sondern auf die Höhe des Wertes der jeweils<br />
nachgewiesenen, vertragsgemäßen Leistungen. Die zitierte<br />
Vertragsklausel führt dazu, dass der Unternehmer Abschlagszahlungen<br />
lediglich auf Grundlage von § 632 a BGB<br />
verlangen kann, wenn er eine Sicherheit gem. § 648 a BGB<br />
fordert. Hierdurch wird zwar Druck auf den Unternehmer<br />
ausgeübt, von § 648 a BGB keinen Gebrauch zu machen 44 .<br />
Dieser Druck ändert aber nichts daran, dass die Klausel<br />
lediglich dazu führt, die Rechtslage des dispositiven Gesetzesrechts<br />
herzustellen 45 . Im Übrigen sind Vereinbarungen im<br />
Zusammenhang mit § 648 a BGB nur wirksam, wenn sie<br />
dem Unternehmer auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen<br />
zusätzliche Sicherheiten verscha<strong>ff</strong>en. In einem solchen<br />
Fall gibt es keinen Konflikt mit § 648 a VII BGB 46 .<br />
Abgesehen davon führt jede Einschränkung des Anspruchs<br />
32 BGH, <strong>NJW</strong> 2005, 1939 = BauR 2005, 1009.<br />
33 OLG Dresden, BauR 2006, 1318 = BeckRS 2011, 16551.<br />
34 Vgl. OLG Naumburg, BauR 2003, 556 = BeckRS 2001, 30199648.<br />
35 BT-Dr 12/1836, S. 9.<br />
36 OLG Naumburg, Urt. v. 8. 6. 2005 – 12 U 90/03, IBRRS 54411; BGH,<br />
Beschl. v. 30. 3. 2006 – VII ZR 192/05, BeckRS 2006, 17412.<br />
37 Busche, in: MünchKomm-BGB, 6. Aufl. (2012), § 648 BGB Rdnr. 14;<br />
Voit, in: Bamberger/Roth, BeckOK-BGB, Stand: 1. 11. 2012, § 648 a<br />
Rdnr. 23.<br />
38 Begri<strong>ff</strong> nach Schmitz, in: Kni<strong>ff</strong>ka (o. Fußn. 1), § 648 a BGB Rdnr. 111.<br />
39 BGH, <strong>NJW</strong>-RR 2008, 31 = NZBau 2008, 55, bespr. v. Weise/Hänsel,<br />
<strong>NJW</strong>-Spezial 2007, 573; OLG Düsseldorf, NZBau 2006, 717, bespr. v.<br />
Weise/Hänsel, <strong>NJW</strong>-Spezial 2007, 23.<br />
40 BGH, <strong>NJW</strong>-RR 2006, 240 = NZBau 2006, 112 = BauR 2006, 375.<br />
41 Schmitz, in: Kni<strong>ff</strong>ka (o. Fußn. 1),§ 648 a BGB Rdnrn. 111 f.<br />
42 BGHZ 167, 345 = <strong>NJW</strong> 2006, 2475 Rdnrn. 13, 15.<br />
43 Palandt/Sprau, BGB, 72. Aufl. (<strong>2013</strong>), § 648 a Rdnr. 4; BGHZ 167,<br />
345 = <strong>NJW</strong> 2006, 2475 Rdnr. 13; BGH, <strong>NJW</strong> 2001, 822 (823).<br />
44 Markus/Kaiser/Kapellmann, AGB-Hdb. Bauvertragsklauseln, 3. Aufl.<br />
(2011), Rdnr. 790.<br />
45 LG München I, Urt. v. 8. 2. 2005 – 11 O 15194/04, BeckRS 2011,<br />
11990; vgl. auch OLG Nürnberg, Urt. v. 22. 1. 1998 – 2 U 2639/97,<br />
BeckRS 1998, 30859963.
Schmidt, Aktuelle Probleme des § 648 a BGB<br />
Aufsätze<br />
<strong>NJW</strong> 8/<strong>2013</strong> 501<br />
des Unternehmers auf eine Bauhandwerkersicherung unmittelbar<br />
zur Unwirksamkeit.<br />
VI. Art und Höhe der Sicherheit<br />
Der Unternehmer kann eine Sicherheit für die auch in Zusatzverträgen<br />
vereinbarte und noch nicht gezahlte Vergütung einschließlich<br />
dazugehöriger Nebenforderungen verlangen. In<br />
einem ersten Schritt ist die Berechnung der Höhe der Sicherheit<br />
deswegen relativ einfach. Durch den Besteller geleistete<br />
Zahlungen sind von dem vollen vertraglichen Vergütungsanspruch<br />
abzuziehen. In Höhe der Di<strong>ff</strong>erenz kann der Unternehmer<br />
Sicherheitsleistung beanspruchen 47 . Nach dem Gesetzeswortlaut<br />
sind auch Zusatzaufträge, also Nachtragsleistungen,<br />
bei der Höhe der Sicherheit zu berücksichtigen. Für den<br />
Unternehmer besteht in der Praxis das Problem, dass er für<br />
die Höhe seines Vergütungsanspruchs darlegungs- und beweisbelastet<br />
ist 48 . Bei der Höhe der Sicherheit können deswegen<br />
in der Regel nur dem Grunde und der Höhe nach unstreitige<br />
Nachträge berücksichtigt werden, also solche Zusatzaufträge,<br />
für die bereits eine Preisvereinbarung i. S. von<br />
§ 2 V 2 bzw. § 2 VI Nr. 2 S. 2 VOB/B vorliegt. Anderenfalls<br />
besteht die Gefahr, dass der Unternehmer mit seinem Sicherheitsverlangen<br />
eine unzutre<strong>ff</strong>ende Höhe angibt 49 . Nach der<br />
Gesetzesbegründung sollen in die Höhe der Sicherheit auch<br />
solche Ansprüche des Unternehmers gegen den Besteller einbezogen<br />
werden, welche an die Stelle des Vergütungsanspruchs<br />
treten 50 . Deswegen sind auch Schadensersatzansprüche<br />
des Unternehmers gegenüber dem Besteller im Wege des<br />
§ 648 a BGB sicherbar.<br />
Die Art der Sicherheit kann der Unternehmer dem Besteller<br />
nicht vorgeben. Insofern hat der Besteller ein Wahlrecht zwischen<br />
den in § 232 I BGB genannten Arten einer Sicherheitsleistung.<br />
Zusätzlich gewährt § 648 a II BGB dem Besteller die<br />
Möglichkeit, die Sicherheit im Wege einer Garantie oder<br />
eines sonstigen Zahlungsversprechens eines befugten Kreditinstituts<br />
oder Kreditversicherers zu leisten.<br />
Aus Sicht des Unternehmers ist zu berücksichtigen, dass die<br />
üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu maximal 2 %<br />
pro Jahr dem Besteller erstattet werden müssen (§ 648 a III<br />
BGB).<br />
VII. Prozessuales<br />
Nach der Neufassung des § 648 a BGB hat der Unternehmer<br />
gegen den Besteller einen durchsetzbaren Anspruch auf die<br />
Sicherheit. Diesen Anspruch kann der Unternehmer auch<br />
klageweise durchsetzen 51 oder mit einer Klage auf Zahlung<br />
von Werklohn verbinden. Aus anwaltlicher Sicht ist eine<br />
solche Vorgehensweise sogar zu empfehlen und in der Beratungspraxis<br />
zu berücksichtigen 52 . Das Gericht kann in diesem<br />
Fall über den Anspruch auf Sicherheitsleistung durch<br />
Teilurteil gem. § 301 ZPO entscheiden 53 . Das ist regelmäßig<br />
dann der Fall, wenn der geltend gemachte Werklohnanspruch,<br />
für den auch die Sicherheit verlangt wird, der<br />
Höhe nach unstreitig ist und der Besteller die Werklohnklage<br />
mit streitigen Gegenforderungen, also beispielsweise Ersatzvornahmekosten,<br />
abwehren möchte. Da die streitigen Gegenforderungen<br />
bei der Berechnung der Sicherheitshöhe gem.<br />
§ 648 a BGB nicht zu berücksichtigen sind, ist der Anspruch<br />
auf Sicherheitsleistung in der Regel ohne Beweisaufnahme<br />
zur Endentscheidung reif, so dass ein Teilurteil ergehen<br />
kann 54 .<br />
Im Falle einer kombinierten Klage auf Leistung der Sicherheit<br />
und auf Zahlung des Werklohns müssen die Werte der beiden<br />
eigenständigen Streitgegenstände addiert werden 55 . Der Wert<br />
der Klage auf Sicherheitsleistung entspricht dabei dem vollen<br />
Wert der zu sichernden Forderung 56 . Auch zur Vollstreckung<br />
eines Urteils auf Sicherheitsleistung gibt es erste Rechtsprechung.<br />
Demnach handelt es sich bei der Sicherheitsleistung<br />
um eine vertretbare Handlung i. S. von § 887 ZPO 57 . Dabei<br />
ist auch bei der Vollstreckung zu berücksichtigen, dass dem<br />
Besteller die Wahl zwischen den unterschiedlichen Sicherheiten<br />
zusteht. Deswegen kann der Unternehmer auch im Wege<br />
der Zwangsvollstreckung nicht eine beliebige Sicherheit bewirken.<br />
Das Wahlrecht des Bestellers geht jedoch dann auf<br />
den Unternehmer über, wenn der Besteller sein Wahlrecht<br />
nicht oder nicht wirksam ausgeübt hat, § 264 BGB. Kommt<br />
der Besteller der in dem Urteil ausgesprochenen Verpflichtung<br />
zur Sicherheitsleistung nicht nach oder wählt er eine<br />
ungenügende Sicherheit 58 , dann kann der Unternehmer zwischen<br />
den zur Verfügung stehenden Sicherheiten wählen und<br />
etwa im Wege des § 887 ZPO die Hinterlegung von Geld<br />
erwirken. Die hierfür notwendigen Kosten, also den notwendigen<br />
Geldbetrag, kann der Unternehmer gem. § 887 II ZPO<br />
fordern und dementsprechend die Vollstreckung betreiben 59 .<br />
VIII. Zusammenfassung<br />
Der Gesetzgeber hat mit den am 1. 1. 2009 in Kraft getretenen<br />
Änderungen des § 648 a BGB ein wirksames Sicherungsmittel<br />
für die Unternehmer gescha<strong>ff</strong>en. Die Besteller haben<br />
nahezu keine e<strong>ff</strong>izienten Verteidigungsmöglichkeiten gegen<br />
den Anspruch des Unternehmers auf Sicherheitsleistung.<br />
Streitige Gegenforderungen der Besteller bleiben unberücksichtigt.<br />
Sofern die Höhe der o<strong>ff</strong>enen Vergütungsansprüche<br />
unstreitig ist und der Besteller sich auch nicht auf § 648 a VI<br />
BGB berufen kann, muss der Besteller eine Sicherheit leisten.<br />
Anderenfalls riskiert er, dass der Unternehmer seine Leistung<br />
verweigert, berechtigterweise kündigt oder sogar auf Stellung<br />
der Sicherheit klagt. Vor allem im Rahmen baubegleitender<br />
Rechtsberatung muss § 648 a BGB aus Sicht des Unternehmers<br />
und aus Sicht des Bestellers stets im Auge behalten<br />
werden. Ein Sicherheitsverlangen des Unternehmers, auf das<br />
der Besteller nicht vorbereitet ist, kann die weitreichenden,<br />
geschilderten Rechtsfolgen auslösen. Demgegenüber kann<br />
der Unternehmer über § 648 a BGB zumindest die Folgen<br />
einer Insolvenz des Bestellers während der Bauphase abmildern.<br />
&<br />
46<br />
BGH, <strong>NJW</strong> 2001, 822; BGHZ 167, 345 = <strong>NJW</strong> 2006, 2475; BGH, <strong>NJW</strong><br />
2010, 2272 (2273).<br />
47 OLG Karlsruhe, <strong>NJW</strong> 1997, 263 = BauR 1996, 556.<br />
48 Werner/Pastor (o. Fußn. 7), Rdnr. 329.<br />
49 Vgl. zur Forderung einer überhöhten Sicherheit Nr. IV 1.<br />
50 BT-Dr 16/511, S. 17.<br />
51 Schmitz, in: Kni<strong>ff</strong>ka (o. Fußn. 1),§ 648 a Rdnrn. 30 <strong>ff</strong>. m. w. Nachw.<br />
52 Joussen, IBR 2010, 3.<br />
53 Dingler/Gasch, IBR 2012, 1113.<br />
54 OLG Frankfurt a. M., Urt. v.19. 6. 2012 – 4 U 1/12, BeckRS 2012,<br />
23195.<br />
55 OLG Düsseldorf, NZBau 2005, 697; BauR 2009, 1009 = BeckRS<br />
2009, 04558; Beschl. v. 5. 6. 2012 – 23 W 30/12, IBRRS 86936; a. A.<br />
OLG Brandenburg, Beschl. v. 22. 2. 2012 – 4 W 34/11, BeckRS 2012,<br />
11578.<br />
56 OLG Stuttgart, Beschl. v. 13. 2. 2012 – 10 W 5/12, BeckRS 2012,<br />
20209.<br />
57 Vgl. im Einzelnen LG Darmstadt, Urt. v. 15. 2. 2012 – 12 O 12/11,<br />
IBRRS 584819; Schmitz, in: Kni<strong>ff</strong>ka (o. Fußn. 1),§ 648 a Rdnr. 35.<br />
58 LG Darmstadt, Urt. v. 15. 2. 2012 – 12 O 12/11, IBRRS 584819.<br />
59 Weyer, IBR 2008, 702; OLG Hamm, Beschl. v. 28. 1. 2011 – 19 W 2/<br />
11, IBRRS 78848, unter Bezugnahme u. a. auf LG Hamm, Urt. v. 11. 1.<br />
2011 – 21 O 83/10, IBRRS 78845.