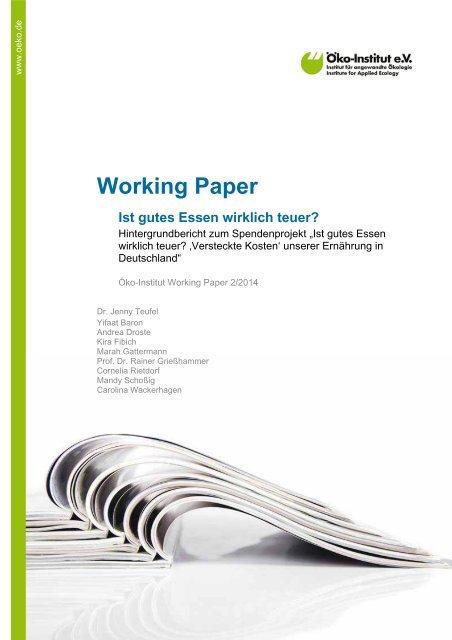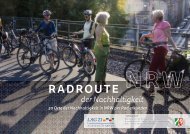2014-637-de
2014-637-de
2014-637-de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.oeko.<strong>de</strong><br />
Working Paper<br />
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Hintergrundbericht zum Spen<strong>de</strong>nprojekt „Ist gutes Essen<br />
wirklich teuer? ‚Versteckte Kosten‘ unserer Ernährung in<br />
Deutschland“<br />
Öko-Institut Working Paper 2/<strong>2014</strong><br />
Dr. Jenny Teufel<br />
Yifaat Baron<br />
Andrea Droste<br />
Kira Fibich<br />
Marah Gattermann<br />
Prof. Dr. Rainer Grießhammer<br />
Cornelia Rietdorf<br />
Mandy Schoßig<br />
Carolina Wackerhagen
Öko-Institut e.V. / Oeko-Institut e.V.<br />
Geschäftsstelle Freiburg / Freiburg Head Office<br />
Postfach / P.O. Box 17 71<br />
79017 Freiburg. Deutschland / Germany<br />
Tel.: +49 761 45295-0<br />
Fax: +49 761 45295-288<br />
Büro Darmstadt / Darmstadt Office<br />
Rheinstraße 95<br />
64295 Darmstadt. Deutschland / Germany<br />
Tel.: +49 6151 8191-0<br />
Fax: +49 6151 8191-133<br />
Büro Berlin / Berlin Office<br />
Schicklerstraße 5-7<br />
10179 Berlin. Deutschland / Germany<br />
Tel.: +49 30 405085-0<br />
Fax: +49 30 405085-388<br />
info@oeko.<strong>de</strong><br />
www.oeko.<strong>de</strong><br />
2
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Working Paper<br />
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Hintergrundbericht zum Spen<strong>de</strong>nprojekt „Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
‚Versteckte Kosten‘ unserer Ernährung in Deutschland“<br />
Dr. Jenny Teufel<br />
Yifaat Baron<br />
Andrea Droste<br />
Kira Fibich<br />
Marah Gattermann<br />
Prof. Dr. Rainer Grießhammer<br />
Cornelia Rietdorf<br />
Mandy Schoßig<br />
Carolina Wackerhagen<br />
Working Paper 2/<strong>2014</strong> Öko-Institut e.V. / Oeko-Institut e.V.<br />
Juli <strong>2014</strong><br />
Download: www.oeko.<strong>de</strong>/workingpaper/spen<strong>de</strong>nprojekt2012<br />
Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung,<br />
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Lizenz. Öko-Institut e.V. <strong>2014</strong><br />
This work is licensed un<strong>de</strong>r Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. Oeko-<br />
Institut e.V. <strong>2014</strong><br />
Die Working Paper Series <strong>de</strong>s Öko-Instituts ist eine Sammlung wissenschaftlicher Beiträge aus <strong>de</strong>r<br />
Forschungsarbeit <strong>de</strong>s Öko-Instituts e.V. Sie präsentieren und diskutieren innovative Ansätze und<br />
Positionen <strong>de</strong>r aktuellen Nachhaltigkeitsforschung. Die Serie ist offen für Arbeiten von Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftlern aus an<strong>de</strong>ren Forschungseinrichtungen. Die einzelnen<br />
Working Paper entstehen in einem sorgfältigen wissenschaftlichen Prozess ohne externes Peer<br />
Review.<br />
Oeko-Institut’s Working Paper Series is a collection of research articles written within the scope of<br />
the institute’s research activities. The articles present and discuss innovative approaches and<br />
positions of current sustainability research. The series is open to work from researchers of other<br />
institutions. The Working Papers are produced in a scrupulous scientific process without external<br />
peer reviews.<br />
3
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Zusammenfassung<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>s von privaten Spen<strong>de</strong>rn finanzierten Projektes „Ist gutes Essen wirklich teuer?“<br />
„Versteckte Kosten“ unserer Ernährung in Deutschland wur<strong>de</strong>n zum einen die realen Kosten<br />
verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile, und zum an<strong>de</strong>ren die Thematik „versteckte“ o<strong>de</strong>r „externe“ Kosten<br />
unserer Ernährung untersucht. Die Studie hat gezeigt, dass durch eine Umstellung <strong>de</strong>s „durchschnittlichen<br />
Ernährungsstiles in Deutschland“ auf einen fleischreduzierten Ernährungsstil, <strong>de</strong>r aus<br />
gesundheitlichen Grün<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird, die<br />
Mehrkosten, die durch <strong>de</strong>n Einkauf von Bio- und fair gehan<strong>de</strong>lten Produkten entstehen, weitgehend<br />
kompensiert wer<strong>de</strong>n können.<br />
Trotz großer Unsicherheiten, die es bei <strong>de</strong>r Zuordnung von vorliegen<strong>de</strong>n Daten gibt, hat sich auch<br />
gezeigt, dass die Kosten, die in Folge von ernährungsbedingten Krankheiten und aufgrund <strong>de</strong>r<br />
Anwendung von nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken entstehen, diese Mehrkosten<br />
<strong>de</strong>utlich übersteigen.<br />
Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen somit die For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Sachverständigenrats für<br />
Umweltfragen sowie zahlreicher Umweltverbän<strong>de</strong> und Interessenvertreter nach einer nachhaltigen<br />
Lebensmittelproduktion und einer grundlegen<strong>de</strong>n Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r politischen Rahmenbedingungen<br />
für die Agrarproduktion. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass <strong>de</strong>r erfor<strong>de</strong>rliche gesellschaftliche<br />
Wan<strong>de</strong>l hin zu einem maßvollen und nachhaltigen Fleischkonsum in Deutschland<br />
geleitet und unterstützt wer<strong>de</strong>n muss. Hierzu gehört die Einbindung aller Akteure, von <strong>de</strong>r Agrarproduktion<br />
über die Lebensmittelindustrie und <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l bis hin zu <strong>de</strong>n Krankenkassen und<br />
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung, um nur einige weitere Akteure beispielhaft zu nennen.<br />
Wie dieser Wan<strong>de</strong>l zielführend unterstützt wer<strong>de</strong>n kann, sollte sorgfältig analysiert und ausgearbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Dass eine saisonale und ausgewogene Ernährung auch sehr schmackhaft sein kann, zeigen eine<br />
Reihe von Köchen und Köchinnen, die uns ihre Rezepte dankenswerterweise kostenlos zur<br />
Verfügung gestellt haben und die mit Hilfe <strong>de</strong>s „Politischen Kochbuchs“ einfach nachzukochen<br />
sind. 1<br />
1<br />
Das Kochbuch wur<strong>de</strong> im Rahmen <strong>de</strong>s Spen<strong>de</strong>nprojektes erstellt und wur<strong>de</strong> an die Spen<strong>de</strong>r verschickt. Bei Interesse<br />
mel<strong>de</strong>n Sie sich bitte bei Andrea Droste (a.droste@oeko.<strong>de</strong>), Tel. 0761-45295-249).<br />
5
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Zusammenfassung 5<br />
Abbildungsverzeichnis 8<br />
Tabellenverzeichnis 8<br />
1. Einleitung 9<br />
2. Methodik 10<br />
2.1. Kosten und Treibhausgasemissionspotenzial unterschiedlicher<br />
Ernährungsweisen 10<br />
2.2. Erfassung externer Kosten 13<br />
2.3. Ermittlung <strong>de</strong>r konkreten Ursachen externer Kosten an zwei<br />
Fallbeispielen 13<br />
3. Ergebnisse 14<br />
3.1. Treibhausgaspotenzial verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile 14<br />
3.2. Kosten verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile 16<br />
3.3. Externe Kosten <strong>de</strong>r fleischbetonten durchschnittlichen Ernährung 18<br />
3.3.1. Kosten durch die Behandlung von Adipositas und weiterer ernährungsbedingter<br />
Krankheiten 18<br />
3.3.2. Externe Kosten <strong>de</strong>r Agrarproduktion 20<br />
3.3.3. Ursachen externer Kosten <strong>de</strong>r Produktion von Lebensmitteln am Beispiel <strong>de</strong>s Angebots<br />
an frischen Tomaten im <strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>l 21<br />
4. Fazit 27<br />
Literaturverzeichnis 28<br />
7
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 3-1:<br />
Abbildung 3-2:<br />
Durchschnittliche jährliche CO 2 e-Emissionen pro Person (in kg)<br />
verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile 15<br />
Vergleich <strong>de</strong>r Kosten verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsweisen auf Basis von<br />
Bio-Produkten und konventionellen Produkten in Euro/Jahr und Person 17<br />
Abbildung 3-3: Tomatenanbau in Glas-Gewächshäusern in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n 22<br />
Abbildung 3-4:<br />
Abbildung 3-5:<br />
Tomatenanbau auf Substrat mit computergestützter Zulieferung von<br />
Wasser und Nährstoffen 22<br />
In <strong>de</strong>n meisten nie<strong>de</strong>rländischen Betrieben wer<strong>de</strong>n die Tomaten<br />
automatisch gesammelt und in die Packbetriebe transportiert, wo sie<br />
gewaschen und verpackt wer<strong>de</strong>n 22<br />
Abbildung 3-6: Tomatengewächshäuser in El Ejido, Provinz Almería (Mar <strong>de</strong>l Plástico) 23<br />
Abbildung 3-7: Tomatenanbau in Folientunneln in Süd<strong>de</strong>utschland 24<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 2-1: Für die untersuchten Ernährungsstile verwen<strong>de</strong>te Abkürzungen 11<br />
8
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
1. Einleitung<br />
Fair gehan<strong>de</strong>lte und/o<strong>de</strong>r Bio-Lebensmittel haben ihren Preis. Sie sind in <strong>de</strong>r Regel <strong>de</strong>utlich teurer<br />
als konventionell erzeugte Lebensmittel. Im Rahmen <strong>de</strong>s Projektes „Ist gutes Essen wirklich<br />
teuer?“ wur<strong>de</strong> untersucht, inwieweit eine Umstellung <strong>de</strong>s Ernährungsstils von <strong>de</strong>r statistischen<br />
Durchschnittsernährung auf eine Ernährung nach <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft<br />
für Ernährung (DGE) die Mehrkosten, die durch <strong>de</strong>n Rückgriff auf fair und biologisch erzeugte<br />
Lebensmittel entstehen, auffängt und welchen Beitrag zum Klimaschutz diese Umstellung leistet.<br />
Dieser Ansatz wur<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>m Hintergrund gewählt, dass ein maßvoller Fleischkonsum national<br />
und global einen Beitrag zum Erhalt von wertvollen Kulturlandschaften im Hinblick auf Natur- und<br />
Biodiversitätsschutz, sowie durch die Nutzung von Flächen, die nicht für <strong>de</strong>n Ackerbau geeignet<br />
sind, einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit leisten kann. Aus verschie<strong>de</strong>nen Grün<strong>de</strong>n<br />
ist eine artgerechte und flächenangepasste Tierhaltung aus unserer Sicht nicht komplett<br />
abzulehnen (s. Infokasten zum Thema „Fleischkonsum“).<br />
Durch die tatkräftige Unterstützung einiger bekannter Köche und Köchinnen, die uns kostenlos<br />
einige ihrer leckeren Rezepte zur Verfügung stellten, konnten wir die Ergebnisse unserer Studie<br />
mit praktischen Tipps für eine saisonale, leckere und fleischreduzierte Ernährung unterlegen.<br />
Im Vergleich zu Lebensmitteln, die im Rahmen einer konventionellen Landwirtschaft produziert<br />
wer<strong>de</strong>n, ist <strong>de</strong>r Anbau von Lebensmitteln, die mit biologischen Anbauverfahren hergestellt wer<strong>de</strong>n,<br />
mit geringeren Umweltbelastungen für Bo<strong>de</strong>n, Grund- und Oberflächengewässer und Ökosysteme<br />
verbun<strong>de</strong>n. Der Anbau und Import von Lebens- und Genussmitteln, beispielsweise Kaffee, Kakao<br />
o<strong>de</strong>r Bananen, die in wenig entwickelten Län<strong>de</strong>rn erzeugt wer<strong>de</strong>n, sind vielfach mit negativen<br />
sozialen Auswirkungen verbun<strong>de</strong>n. Hier kann <strong>de</strong>r Rückgriff auf Lebensmittel aus fairem Han<strong>de</strong>l die<br />
nachteiligen sozialen Auswirkungen in <strong>de</strong>n Produktionslän<strong>de</strong>rn minimieren. Neben <strong>de</strong>n „direkten<br />
Kosten“, die mit <strong>de</strong>m Kauf von Lebensmitteln verbun<strong>de</strong>n sind, entstehen also eine Reihe weiterer<br />
Kosten, sogenannte „indirekte o<strong>de</strong>r externe Kosten“, die die Gesellschaft <strong>de</strong>s Konsumlan<strong>de</strong>s o<strong>de</strong>r<br />
auch die Gesellschaft <strong>de</strong>s Erzeugerlan<strong>de</strong>s trägt. Diese externen Kosten sind im eigentlichen Preis<br />
von Lebensmitteln nicht enthalten. Hierzu gehören Kosten, die in Folge <strong>de</strong>r Umweltauswirkungen<br />
o<strong>de</strong>r in Folge von negativen sozialen Auswirkungen entstehen. Typische Beispiele sind:<br />
Kosten <strong>de</strong>r Erschließung neuer Trinkwasserreserven, wenn bislang genutzte Reserven aufgrund<br />
<strong>de</strong>r Belastung mit Nitraten o<strong>de</strong>r Pestizidrückstän<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r konventionellen Landwirtschaft<br />
nicht mehr genutzt wer<strong>de</strong>n können.<br />
Monitoring von Pestizi<strong>de</strong>n, Düngemitteln und an<strong>de</strong>ren Schadstoffen in Gewässern, Bö<strong>de</strong>n und<br />
Lebensmitteln<br />
Entsorgungskosten (Entsorgung von mit Schadstoffen o<strong>de</strong>r Krankheitserregern kontaminierten<br />
Lebensmitteln, s. beispielsweise BSE-belastete Rin<strong>de</strong>r)<br />
Akute Schä<strong>de</strong>n von Pestizi<strong>de</strong>n bei landwirtschaftlichen Mitarbeitern o<strong>de</strong>r/und Anwohnern<br />
Sinken<strong>de</strong> Erträge aufgrund sinken<strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nfruchtbarkeit durch Bo<strong>de</strong>nerosion und <strong>de</strong>n Verlust<br />
an organischer Substanz im Bo<strong>de</strong>n.<br />
Der massive Einsatz von Antibiotika in <strong>de</strong>r konventionellen Tierhaltung geht einher mit <strong>de</strong>r<br />
Gefahr, Antibiotikaresistenzen hervorzurufen. Ein zunehmen<strong>de</strong>s Problem im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
Behandlung von Krankheiten, die durch Bakterien erzeugt wer<strong>de</strong>n. Der Bedarf <strong>de</strong>r Entwicklung<br />
neuer Antibiotika ist vorhan<strong>de</strong>n und verursacht Kosten.<br />
9
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Deckung von bestimmten Lebensunterhaltungskosten - beispielsweise durch <strong>de</strong>n Staat - wenn<br />
diese aufgrund geringer Löhne in <strong>de</strong>n Erzeugerlän<strong>de</strong>rn nicht durch <strong>de</strong>n Einzelnen getragen<br />
wer<strong>de</strong>n können.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Studie wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>shalb versucht, über Literaturrecherchen die „externen Kosten“<br />
nicht nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken und ungesun<strong>de</strong>r Ernährungsweisen in Deutschland<br />
zu erfassen. Sind diese niedriger als die „realen“ Mehrkosten, die durch <strong>de</strong>n Kauf von fair<br />
gehan<strong>de</strong>lten und/o<strong>de</strong>r Bio-Lebensmitteln entstehen? Aufgrund methodischer Probleme und<br />
schlechter Datenlage kann dies nur eine grobe Abschätzung sein. Für zwei Lebens- bzw. Genussmittel<br />
– Tomate und Kakao – wur<strong>de</strong> versucht, die Ursachen für externe Kosten, die mit <strong>de</strong>ren<br />
Erzeugung verbun<strong>de</strong>n sind, mit Hilfe <strong>de</strong>r sozio-ökonomischen Analyse genauer zu ermitteln. Die<br />
bei<strong>de</strong>n Beispiele wur<strong>de</strong>n im Rahmen einer Vorsondierung <strong>de</strong>r Datenlage aus einer größeren<br />
Auswahl an Lebensmitteln gewählt. Die Ergebnisse <strong>de</strong>r Tomaten-Analyse wer<strong>de</strong>n weiter unten<br />
ausführlich dargestellt.<br />
2. Methodik<br />
2.1. Kosten und Treibhausgasemissionspotenzial unterschiedlicher Ernährungsweisen<br />
In <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Studie wur<strong>de</strong> das Treibhausgaspotenzial und die Kosten einer durchschnittlichen<br />
Ernährung (Ernährung in Anlehnung an die Angaben <strong>de</strong>s Statistischen Bun<strong>de</strong>samtes 2012),<br />
die sich durch einen hohen Fleisch- und Wurstkonsum auszeichnet, mit <strong>de</strong>nen einer Ernährung,<br />
die auf <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) beruht, verglichen.<br />
Die DGE gibt für eine gesun<strong>de</strong> Ernährung folgen<strong>de</strong> Empfehlungen: weniger Fleisch, mehr Obst<br />
und Gemüse, sowie mehr Vollwertprodukte und weniger Genussmittel (AID 2012). Ergänzend<br />
wur<strong>de</strong> das Treibhausgaspotenzial eines vegetarischen und eines veganen Ernährungsstils<br />
ermittelt und verglichen.<br />
In <strong>de</strong>n bisher durchgeführten Untersuchungen zu Lebensmittelkostenvergleichen wur<strong>de</strong>n – bis auf<br />
wenige Ausnahmen (s. z.B. Mertens et al. 2007) - eher pauschale bzw. aggregierte Annahmen zu<br />
<strong>de</strong>n eingesetzten Lebensmitteln gemacht, bzw. es wur<strong>de</strong>n vergleichen<strong>de</strong> Marktpreiserhebungen 2<br />
durchgeführt (Institut für angewandte Verbraucherforschung 2001, Öko-Institut 2000) 3 . Zur<br />
Ermittlung <strong>de</strong>r Kosten verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile ist es aber sinnvoller, mit realen Mahlzeiten<br />
zu rechnen. Hierfür wur<strong>de</strong>n für die Ernährungsstile „Durchschnittliche Ernährung“ und „Ernährung<br />
nach DGE-Empfehlungen“ sieben verschie<strong>de</strong>ne Ernährungstagespläne erstellt. Auch für die Erfassung<br />
<strong>de</strong>r Treibhausgasemissionen eines „ovo-lacto-vegetarischen Ernährungsstiles“ und eines<br />
„veganen Ernährungsstiles“ wur<strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong> Ernährungstagespläne erstellt. Alle Ernährungstagespläne<br />
umfassen Mengen sowie Kalorienangaben für je drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten.<br />
Insgesamt enthalten die sieben verschie<strong>de</strong>nen Tagespläne bei je<strong>de</strong>m Ernährungsstil<br />
einen repräsentativen Mix 4 aus unterschiedlichen Fleisch-, Milch- und Getrei<strong>de</strong>produkten sowie<br />
Gemüse und Obst. Nach Angaben <strong>de</strong>s Statistischen Bun<strong>de</strong>samtes (2012) wur<strong>de</strong>n im Jahr 2010<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Vergleichen<strong>de</strong> Marktpreiserhebungen erfassen beispielsweise die Preise für Bio-Lebensmittel und konventionell<br />
produzierte Lebensmittel (z.B. Preis für 1 kg Hackfleisch halb und halb). Diese Marktpreiserhebungen berücksichtigen<br />
daher nicht, wie sich die Verän<strong>de</strong>rung einer Ernährungsgewohnheit auf die Kosten auswirken.<br />
Körber & Kretschmer (2001) geben einen kurzen Überblick über Studien, die um die Jahrtausendwen<strong>de</strong> zu diesem<br />
Aspekt durchgeführt wur<strong>de</strong>n.<br />
Das heißt, dass die bei<strong>de</strong>n auf Fleischprodukten basieren<strong>de</strong>n Ernährungsstile sowohl Fleischprodukte von Rind,<br />
Schwein und Geflügel enthalten, <strong>de</strong>r Geflügelanteil aber entsprechend <strong>de</strong>n statistischen Angaben geringer ist<br />
(Bun<strong>de</strong>samts für Statistik 2012).<br />
10
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
durchschnittlich 89,5 kg Fleisch- und Fleischerzeugnisse pro Person verzehrt. Diese Angabe<br />
enthält aber auch Verluste entlang <strong>de</strong>r Produktionskette. Die für die Ernährungstagepläne <strong>de</strong>r<br />
„durchschnittlichen Ernährung“ angenommenen Mengenangaben zum Fleischkonsum lehnen sich<br />
<strong>de</strong>shalb nur an diese statistischen Mengenangaben an und basieren im Wesentlichen auf Annahmen,<br />
die auf Portionsgrößen von fleischbetonten Gerichten in <strong>de</strong>r Gemeinschaftsverpflegung<br />
beruhen. In Anlehnung an die Portionsgrößen <strong>de</strong>r Gemeinschaftsverpflegung wur<strong>de</strong> für die „Durchschnittliche<br />
Ernährung“ ein Fleisch- und Wurstkonsum von 79,8 kg pro Jahr und Person angenommen.<br />
Basierend auf <strong>de</strong>n so erstellten Ernährungstagesplänen reduziert sich <strong>de</strong>r Fleisch- und<br />
Wurstkonsum bei einer Umstellung von einer „Durchschnittlichen Ernährung (im Folgen<strong>de</strong>n mit<br />
ESS 1 abgekürzt)“ zu einer „Ernährung nach DGE-Empfehlungen (im Folgen<strong>de</strong>n mit ESS 2<br />
abgekürzt)“ um rund 69 % auf 24,4 kg 5 pro Person und Jahr. Der Konsum an Milchprodukten<br />
erhöht sich jedoch zur Deckung <strong>de</strong>s Eiweißbedarfes um rund 30 %. Die Ernährungstagespläne<br />
<strong>de</strong>s „ovo-lacto-vegetarischen Ernährungsstiles (im Folgen<strong>de</strong>n mit ESS 3 abgekürzt)“ enthalten<br />
keine Fleisch- und Wurstprodukte. Statt<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong>n diese durch Sojaprodukte, Hülsenfrüchte,<br />
Milchprodukte und Eier ersetzt. Entsprechend erfolgtei bei <strong>de</strong>r Erstellung <strong>de</strong>r Ernährungstagespläne<br />
<strong>de</strong>s „veganen Ernährungsstils (im Folgen<strong>de</strong>n mit ESS 4 abgekürzt)“ eine Umstellung <strong>de</strong>r<br />
tierischen Produkte komplett auf Sojaprodukte und Hülsenfrüchte. In <strong>de</strong>n Ernährungstagesplänen<br />
waren mit Ausnahme von Kaffee und Tee keine Genussmittel wie Alkohol, Softdrinks, Knabbergebäck<br />
(wie beispielsweise Chips, etc.) o<strong>de</strong>r Riegel enthalten, da <strong>de</strong>r Verzehr dieser Produkte<br />
nicht mit einem bestimmten Ernährungsstil einhergeht 6 . In Form von Zwischenmahlzeiten o<strong>de</strong>r<br />
Desserts enthielten die Ernährungstagespläne aber auch süße Speisen wie beispielsweise Schokola<strong>de</strong>,<br />
Schokokekse, Kuchen o<strong>de</strong>r Kompott. Fruchtsäfte waren zum Teil im Frühstück o<strong>de</strong>r als<br />
Zwischenmahlzeit enthalten.<br />
Tabelle 2-1:<br />
Für die untersuchten Ernährungsstile verwen<strong>de</strong>te Abkürzungen<br />
Ernährungsstil<br />
Abkürzung<br />
Durchschnittliche Ernährung ESS 1<br />
Ernährung nach DGE-Empfehlungen ESS 2<br />
Durchschnittliche Ernährung auf <strong>de</strong>r Basis von Bio-Lebensmitteln und fair<br />
gehan<strong>de</strong>lten Lebensmitteln<br />
Ernährung nach DGE-Empfehlungen auf <strong>de</strong>r Basis von Bio-Lebensmitteln und fair<br />
gehan<strong>de</strong>lten Lebensmitteln<br />
Bio- ESS 1<br />
Bio- ESS 2<br />
ovo-lacto-vegetarisch ESS 3<br />
vegan ESS 4<br />
Quelle: Öko-Institut e.V. 2013<br />
Basierend auf <strong>de</strong>n sieben verschie<strong>de</strong>nen Ernährungstagesplänen pro Ernährungsstil wur<strong>de</strong> anhand<br />
eines durchschnittlichen Kalorienbedarfs pro Jahr von rund 740.000 kcal 7 die verzehrte<br />
Lebensmittelmenge pro Produktkategorie (Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel, Fleischprodukte<br />
wie Wurst o<strong>de</strong>r Schinken, Milchprodukte, wie Trinkmilch, Sahne, Joghurt, Quark o<strong>de</strong>r Käse,<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Die DGE empfiehlt einen Fleischkonsum von 15 bis 30 kg/Jahr.<br />
Wir haben in diesem Punkt die Empfehlungen <strong>de</strong>r DGE für alle Ernährungsstile umgesetzt, da <strong>de</strong>r statisch erfasste<br />
hohe durchschnittliche Konsum an Zucker und Fett mit ganz verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsstilen einhergehen kann. Ziel<br />
<strong>de</strong>r Studie war es nicht, die Treibhausgasemissionen und Kosten eines aufgrund <strong>de</strong>s hohen Zucker- und Fettkonsums<br />
ungesun<strong>de</strong>n Ernährungsstiles zu erfassen.<br />
Für die Berechnungen <strong>de</strong>s Treibhausgaspotenzials sowie <strong>de</strong>r Kosten wur<strong>de</strong> ein durchschnittlicher Kalorienbedarf von<br />
2000 kcal pro Tag und Person zugrun<strong>de</strong> gelegt.<br />
11
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Gemüse, Obst, verschie<strong>de</strong>ne Getrei<strong>de</strong>produkte etc.) und das damit verbun<strong>de</strong>ne Treibhausgasemissionspotenzial<br />
8 berechnet.<br />
Zur Erfassung <strong>de</strong>r Kosten verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile wur<strong>de</strong>n die Ernährungstagespläne<br />
monatlich <strong>de</strong>m regionalen saisonalen Angebot an Gemüse und Obst angepasst. Das heißt beispielsweise,<br />
dass im Mai Spargel als Gemüsebeilage gewählt wur<strong>de</strong>, im September hingegen<br />
frische Bohnen. Bewusst wur<strong>de</strong>n keine Kosten für asaisonale Produkte, wie beispielsweise Erdbeeren<br />
im Dezember, erfasst. Ziel war es, bei<strong>de</strong> Ernährungsstile <strong>de</strong>r Saison anzupassen, um Verzerrungen,<br />
die durch <strong>de</strong>n Kauf von asaisonalen Produkten entstehen, zu vermei<strong>de</strong>n. Ebenso<br />
wur<strong>de</strong>n keine „Luxusprodukte“ o<strong>de</strong>r „Spezialitäten aus an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn“ in die Kostenerhebung<br />
aufgenommen. Das heißt beispielsweise, dass bei Wurst ein Mix aus Preisen für Salami und<br />
Lyoner und nicht für Morta<strong>de</strong>lla, Parmaschinken o<strong>de</strong>r Bündnerfleisch erfasst wur<strong>de</strong>. Der Kauf von<br />
solchen “Spezialitäten“ o<strong>de</strong>r „Beson<strong>de</strong>rheiten“ kann unabhängig vom Ernährungsstil die Ausgaben<br />
für Lebensmittel drastisch erhöhen.<br />
Die Kosten wur<strong>de</strong>n für die im Folgen<strong>de</strong>n aufgezählten Ernährungsstile erhoben:<br />
eine durchschnittliche <strong>de</strong>utsche Ernährung in Anlehnung an die Daten <strong>de</strong>s Statistischen<br />
Bun<strong>de</strong>samtes (ESS 1),<br />
eine Ernährung nach <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE (mit<br />
rund 70 % weniger Fleisch, jedoch 30 % mehr Milchprodukten als in <strong>de</strong>r Durchschnittsernährung)<br />
(ESS 2),<br />
eine durchschnittliche <strong>de</strong>utsche Ernährung (s. ESS 1), aber zu 100 % auf Bio-Lebensmitteln und<br />
fair gehan<strong>de</strong>lten Lebensmitteln basierend (Bio-ESS 1),<br />
eine Ernährung nach <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r DGE (s. ESS 2), aber zu 100 % auf Bio-Lebensmitteln<br />
und fair gehan<strong>de</strong>lten Lebensmitteln basierend (Bio-ESS 2).<br />
Die Ermittlung <strong>de</strong>r Kosten <strong>de</strong>r vier verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsstile fand im Rahmen einer Vor-Ort-<br />
Erhebung in <strong>de</strong>n Filialen verschie<strong>de</strong>ner Supermarktketten, in einer Filiale eines Discounters, in <strong>de</strong>r<br />
Filiale einer Biosupermarktkette sowie in einem Genossenschaftsla<strong>de</strong>n in Freiburg im Breisgau<br />
statt. Hierbei ist zu beachten, dass die Lebensmittelpreise im süd<strong>de</strong>utschen Raum <strong>de</strong>utlich höher<br />
liegen als in an<strong>de</strong>ren Regionen Deutschlands. Vor <strong>de</strong>m Hintergrund, dass im Rahmen <strong>de</strong>r Studie<br />
jedoch keine absoluten Kosten, son<strong>de</strong>rn die Relation <strong>de</strong>r Kosten zwischen <strong>de</strong>n ausgewählten<br />
Ernährungstypen erfasst wer<strong>de</strong>n sollten, ist diese – aus Kapazitätsgrün<strong>de</strong>n getroffene – Einschränkung<br />
im Studien<strong>de</strong>sign vertretbar. Die La<strong>de</strong>nbegehungen fan<strong>de</strong>n über einen Zeitraum von<br />
5 Monaten (von Mai bis September 2013) jeweils monatlich statt. Grundlage <strong>de</strong>r Erhebung waren<br />
die für die verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsstile erstellten Ernährungstagespläne. Die Preise wur<strong>de</strong>n für<br />
vergleichbare Produkte aus konventioneller landwirtschaftlicher Produktion und aus biologischem<br />
Anbau erhoben. Beispielsweise wur<strong>de</strong>n für Bergkäse die Preise von angebotenen Produkten erhoben,<br />
die hinsichtlich Reifegrad, Fettgehalt und Herkunft zumin<strong>de</strong>st annähernd vergleichbar waren.<br />
Gewisse Ungenauigkeiten ließen sich hierbei nicht vermei<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong> Bergkäse sowohl mit<br />
45 % als auch mit 48 % Fett i. Tr. in eine Gruppe aufgenommen. Bei Tomaten wur<strong>de</strong> beispielsweise<br />
nicht <strong>de</strong>r Durchschnittspreis für alle im La<strong>de</strong>n erhältlichen Tomaten ermittelt, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r<br />
Preis für eine bestimmte Tomatensorte (z.B. normale run<strong>de</strong> Tomaten für Tomatensalat o<strong>de</strong>r<br />
Fleischtomaten für Tomatensoße), um Preisverzerrungen zwischen verschie<strong>de</strong>nen Anbietern zu<br />
vermei<strong>de</strong>n. So wer<strong>de</strong>n in verschie<strong>de</strong>nen Supermarktketten, sowie auf Märkten und in Genossen-<br />
8<br />
Für die Berechnung <strong>de</strong>r Treibhausgasemissionspotenziale <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsstile wur<strong>de</strong> auf Emissionsfaktoren<br />
<strong>de</strong>r Datenbanken Ecoinvent und GEMIS zurückgegriffen. Für Lebensmittel, die in diesen Datenbanken nicht<br />
verfügbar waren, wur<strong>de</strong> auf Emissionsfaktoren zurückgegriffen, die im Rahmen einzelner recherchierter Studien<br />
ermittelt wur<strong>de</strong>n.<br />
12
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
schaftslä<strong>de</strong>n auch spezielle Tomatensorten (wie beispielswiese Berner Rose, Ochsenauge etc.)<br />
angeboten, die jedoch auch einen höheren Preis haben. Diese hochpreisigen Tomaten wer<strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>r Regel nicht in Discountern angeboten. Im Discounter wur<strong>de</strong>n nur die Preise <strong>de</strong>rjenigen<br />
Lebensmittel erfasst, die in vergleichbarer Qualität auch aus biologischem Anbau angeboten<br />
wur<strong>de</strong>n. Hiermit sollte vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, dass niedrigere Discounter-Preise von konventionell<br />
produzierten Lebensmitteln zu einer Verzerrung <strong>de</strong>r Kostenerhebung führen. Aus diesem Grund<br />
wur<strong>de</strong>n auch in <strong>de</strong>r Regel keine Preise von Eigenmarkenprodukten erhoben, da hier häufig kein<br />
vergleichbares Pendant in Bio-Qualität zu fin<strong>de</strong>n war. Bei Lebensmitteln wie Kaffee, Bananen,<br />
Kakao bzw. Schokola<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n die Preise von Produkten erfasst, die nicht nur aus biologischem<br />
Anbau stammen, son<strong>de</strong>rn auch fair gehan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>n. Gab es verschie<strong>de</strong>ne vergleichbare Produkte<br />
eines bestimmten Lebensmittels in einem La<strong>de</strong>n (wie beispielsweise Erdbeermarmela<strong>de</strong>n<br />
mit vergleichbarem Fruchtanteil von verschie<strong>de</strong>nen Anbietern), wur<strong>de</strong>n möglichst alle Produkte<br />
dieses Lebensmittels erfasst. Die so erhobenen Preise wur<strong>de</strong>n pro kg hochgerechnet. Bei Produkten<br />
wie Kohlrabi o<strong>de</strong>r Salat, die zu Stückpreisen angeboten wur<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> das Gewicht/Stück<br />
ermittelt. Auch hier besteht eine gewisse Ungenauigkeit in <strong>de</strong>r Kostenerhebung, da für die<br />
Gewichtsbestimmung keine Durchschnittswerte pro Anbieter erhoben wer<strong>de</strong>n konnten. Für je<strong>de</strong>s<br />
in <strong>de</strong>n Ernährungstagesplänen enthaltene Lebensmittel wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Median <strong>de</strong>r Preise für das Produkt<br />
aus konventioneller bzw. aus biologischer Landwirtschaft (bzw. aus fairem Han<strong>de</strong>l) pro Monat<br />
ermittelt. Durch die Wahl <strong>de</strong>s Medians als Mittelwert sollten Ausreißer in <strong>de</strong>r Datenerhebung<br />
nivelliert wer<strong>de</strong>n.<br />
2.2. Erfassung externer Kosten<br />
Die Erfassung externer Kosten als Folge eines ungesun<strong>de</strong>n Ernährungsstiles sowie als Folge <strong>de</strong>r<br />
Anwendung nicht nachhaltiger Anbaumetho<strong>de</strong>n erfolgte im Rahmen einer umfassen<strong>de</strong>n Literaturrecherche<br />
und <strong>de</strong>ren Auswertung.<br />
Ziel war es, zum einen konkrete Fakten zu Gesundheitskosten zu ermitteln, die durch ernährungsbedingte<br />
Krankheiten hervorgerufen wer<strong>de</strong>n. Zum an<strong>de</strong>ren sollte die internationale und nationale<br />
Fachdiskussion zum Thema „externe Kosten <strong>de</strong>r Agrarproduktion“ ausgeleuchtet wer<strong>de</strong>n. Die<br />
Recherche wur<strong>de</strong> über <strong>de</strong>sk research unter Zuhilfenahme von umfangreichen Datenbanken, Zeitschriftenkatalogen,<br />
Verlagsprogrammen und Ergebnissen <strong>de</strong>r Ressortforschung durchgeführt.<br />
Konkret erfolgte die Recherche über wissenschaftliche Datenbanken, Zeitschriften und über die<br />
Internetsuchmaschinen Google Scholar und Scirus. Insgesamt wur<strong>de</strong>n nur wenige Studien zum<br />
Thema „externe Kosten <strong>de</strong>r Lebensmittelproduktion bzw. <strong>de</strong>r Landwirtschaft“ gefun<strong>de</strong>n.<br />
2.3. Ermittlung <strong>de</strong>r konkreten Ursachen externer Kosten an zwei Fallbeispielen<br />
Um die komplexen Zusammenhänge zwischen <strong>de</strong>m Angebot bzw. Konsum von Lebensmitteln in<br />
Deutschland und <strong>de</strong>n sozialen Auswirkungen und Umweltauswirkungen besser zu verstehen,<br />
wur<strong>de</strong>n anhand zweier Beispiele 9 „frische Tomaten im <strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>l“ und „Kakao“ die Ursachen<br />
externer Kosten tiefer analysiert. Im Rahmen dieser ausführlichen Zusammenfassung <strong>de</strong>r<br />
Studie wird jedoch nur auf die Ergebnisse <strong>de</strong>s Tomatenbeispiels eingegangen. Das Hauptziel<br />
dieses Arbeitspaketes war es, die wesentlichen Kostenfaktoren zu i<strong>de</strong>ntifizieren, die nicht im Preis<br />
dieser Produkte enthalten sind. Dabei wur<strong>de</strong> versucht, sowohl soziale Auswirkungen als auch<br />
Umweltauswirkungen zu erfassen.<br />
9<br />
Die Auswahl dieser bei<strong>de</strong>n Fallbeispiele erfolgte im Rahmen einer Voruntersuchung, in <strong>de</strong>r die Verfügbarkeit von<br />
Daten zur Produktion von verschie<strong>de</strong>nen Lebensmitteln für <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Markt (u.a. Milch, Rindfleisch, Orangen,<br />
Kaffee) geprüft wur<strong>de</strong>.<br />
13
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Hierzu wur<strong>de</strong>n im Rahmen einer umfangreichen Literatur- und Internetrecherche sowie im Rahmen<br />
von Interviews eine Reihe von Daten zum Anbau und Transport <strong>de</strong>r ausgewählten Fallbeispiele<br />
zusammengetragen und ausgewertet. Diese Daten umfassten u.a.:<br />
Anbaugebiete und Produktionsmengen<br />
Generelle Informationen zu <strong>de</strong>n angewandten Anbaupraktiken, sowie Erträge pro Fläche<br />
Detaillierte Informationen zur Anwendung von Pestizi<strong>de</strong>n und Düngemitteln im Rahmen verschie<strong>de</strong>ner<br />
Anbaumetho<strong>de</strong>n<br />
Wasserverbrauch, Herkunft <strong>de</strong>s zur Bewässerung eingesetzten Wassers<br />
Einsatz weiterer Hilfsmittel und Ressourcen (z.B. Energie für Maschineneinsatz, Folien, etc.)<br />
Flächenverbrauch<br />
Treibhausgasemissionspotenzial verschie<strong>de</strong>ner Anbaumetho<strong>de</strong>n<br />
Lohnniveau im Verhältnis zu <strong>de</strong>n örtlichen Lebenshaltungskosten<br />
Illegale Arbeitsverhältnisse, Kin<strong>de</strong>rarbeit<br />
Informationen über staatliche Unterstützungen (Subventionen, kostenlose Verteilung von Hilfsmitteln,<br />
etc.)<br />
3. Ergebnisse<br />
3.1. Treibhausgaspotenzial verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile<br />
Die Agrarproduktion hat einen nicht unerheblichen Anteil am globalen Ausstoß von klimarelevanten<br />
Gasen. Verschie<strong>de</strong>ne Studien zeigen, dass rund ein Fünftel <strong>de</strong>s gesamten Treibhausgasausstoßes<br />
in Deutschland durch unsere Ernährung verursacht wird (u.a. Eberle et al. 2005,<br />
Quack et al. 2007, Taylor 2000, Kramer et al. 1994). Über die Hälfte <strong>de</strong>r ernährungsbedingten<br />
Emissionen stammen dabei aus <strong>de</strong>r Landwirtschaft (vgl. z.B. Kramer et al. 1994, Koerber et al.<br />
2009; Teufel et al. 2010), d.h. <strong>de</strong>r Produktion <strong>de</strong>r landwirtschaftlichen Rohstoffe, wobei hier vor<br />
allem die Produktion von tierischen Lebensmitteln zu Buche schlägt. Eine Reduktion <strong>de</strong>s Konsums<br />
an Fleisch- und Milchprodukten trägt folglich dazu bei, die ernährungsbedingten Treibgausgasemissionen<br />
zu senken.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Studie wur<strong>de</strong>, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, das Treibhausgasemissionspotenzial<br />
von vier verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsstilen: die „Durchschnittliche Ernährung (ESS 1)“, die „Ernährung<br />
nach DGE-Empfehlungen (ESS 2)“, die „ovo-lacto-vegetarische Ernährung (ESS 3)“ und die<br />
„vegane Ernährung (ESS 4)“ erfasst. Zugrun<strong>de</strong> gelegt wur<strong>de</strong> hier, dass die Produkte aus<br />
konventioneller Produktion stammen. Die Auswertung verschie<strong>de</strong>ner Studien zeigt, dass sich<br />
durch <strong>de</strong>n Rückgriff auf Produkte aus biologischem Anbau ein Reduktionspotenzial von ca. 5-10 %<br />
erzielen lässt (vgl. z.B. Teufel et al. 2010). Es zeigt sich, dass die „Durchschnittliche Ernährung<br />
(ESS 1)“ mit einem Treibhausgasemissionspotenzial von ca. 1,80 g CO 2 e/kcal behaftet ist 10 . Bei<br />
einer „Ernährung nach DGE-Empfehlungen (ESS 2)“ reduziert sich das Treibhausgasemissionspotenzial<br />
um rund 11 % auf 1,58 g CO 2 e/kcal. Dieses vergleichsweise geringe Reduktionspotenzial<br />
beruht auf <strong>de</strong>r Tatsache, dass bei diesem Ernährungsstil zur Deckung <strong>de</strong>s Eiweißbedarfes <strong>de</strong>r<br />
Anteil an Milchprodukten im Vergleich zur „Durchschnittlichen Ernährung (ESS 1)“ erhöht wur<strong>de</strong>.<br />
10<br />
Für alle Berechnungen, d.h. sowohl für die Berechnungen <strong>de</strong>r Treibhausgasemissionen wie für die Berechnung <strong>de</strong>r<br />
Kosten wur<strong>de</strong> ein durchschnittlicher Kalorienbedarf von 2000 kcal zugrun<strong>de</strong> gelegt.<br />
14
CO2e-Emissionen [kg CO2e/Person und Jahr]<br />
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Auf Basis eines täglichen Kalorienverbrauchs von 2000 kcal/Tag an 365 Tagen ergeben sich die in<br />
Abbildung 3-1 dargestellten jährlichen CO 2 e-Emissionen von 1.314 kg CO 2 e/Jahr bei <strong>de</strong>r „Durchschnittlichen<br />
Ernährung (ESS 1)“ und 1.153 kg CO 2 e/Jahr bei <strong>de</strong>r „Ernährung nach DGE-Empfehlungen<br />
(ESS 2). Die Treibhausgasemissionen <strong>de</strong>r „ovo-lacto-vegetarische Ernährung (ESS 3)“<br />
liegen bei 978,2 kg CO 2 e/Jahr (minus 26 % gegenüber ESS 1), die <strong>de</strong>r „veganen Ernährung<br />
(ESS 4)“ bei 824,9 kg CO 2 e/Jahr (minus 37 % gegenüber ESS 1).<br />
Abbildung 3-1:<br />
1400<br />
Durchschnittliche jährliche CO 2 e-Emissionen pro Person (in kg) verschie<strong>de</strong>ner<br />
Ernährungsstile<br />
1314<br />
1200<br />
1153<br />
1000<br />
978<br />
800<br />
825<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Durchschnittliche<br />
Ernährung<br />
DGE-Empfehlung Vegetarische Ernährung Vegane Ernährung<br />
Quelle: Öko-Institut e.V. 2013<br />
Durch eine Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Ernährungsstils mittels einer Reduktion <strong>de</strong>s Fleischkonsums, <strong>de</strong>r<br />
auch aus gesundheitlichen Grün<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r DGE empfohlen wird, kann folglich aktiv „Klimaschutz“<br />
betrieben wer<strong>de</strong>n. Durch <strong>de</strong>n kompletten Verzicht auf Fleischprodukte können zwar<br />
weitere Reduktionspotenziale ausgeschöpft wer<strong>de</strong>n, letztendlich erfor<strong>de</strong>rt eine <strong>de</strong>rartige Umstellung<br />
aber eine stärkere Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>m Thema „ausgewogene Ernährung“. Dies trifft<br />
vor allem für eine vegane Ernährungsweise zu. Mit Blick auf <strong>de</strong>n Erhalt von alten Kulturlandschaften,<br />
beispielsweise artenreiche Magerwiesen und -wei<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Streuwiesen, die noch in<br />
alten Hutelandschaften zu fin<strong>de</strong>n sind, ist ein maßvoller Fleischkonsum auch aus Naturschutzgrün<strong>de</strong>n<br />
empfehlenswert. Aus globaler Sicht leistet eine eher extensiv ausgerichtete Viehzucht auch<br />
einen wichtigen Beitrag zur Versorgung <strong>de</strong>r Weltbevölkerung mit Nahrung. Laut Angaben <strong>de</strong>r<br />
Welternährungsorganisation <strong>de</strong>r Vereinten Nationen (FAO) wer<strong>de</strong>n 69 % <strong>de</strong>r weltweit für die Landwirtschaft<br />
zur Verfügung stehen<strong>de</strong>n Flächen als extensives Wei<strong>de</strong>land genutzt und können auch in<br />
Zukunft aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht nicht sinnvoll in Ackerland überführt wer<strong>de</strong>n.<br />
15
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
3.2. Kosten verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsstile<br />
Ein Ernährungsstil, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r DGE basiert, schnei<strong>de</strong>t – wie oben gezeigt - im<br />
Hinblick auf <strong>de</strong>n Umweltindikator Treibhausgasemissionen besser ab als ein Ernährungsstil, <strong>de</strong>r<br />
einen hohen Anteil an Fleischprodukten aufweist. Der in Deutschland wie auch in an<strong>de</strong>ren Industrie-<br />
und mittlerweile auch in Schwellenlän<strong>de</strong>rn hohe Fleischkonsum birgt jedoch noch eine Reihe<br />
weiterer Umweltrisiken sowie auch soziale Risiken, die hier nur beispielhaft und nicht vollständig<br />
genannt wer<strong>de</strong>n sollen.<br />
Eine intensive Tierhaltung geht einher mit einer <strong>de</strong>utlich erhöhten Stickstoffbelastung von Oberflächengewässern<br />
und Grundwasser. Dieser Stickstoffüberschuss wird noch durch <strong>de</strong>n Import von<br />
Futtermitteln auf Getrei<strong>de</strong>basis verschärft, auf <strong>de</strong>m das hohe Produktionsniveau für Fleisch- und<br />
Milchprodukte in Deutschland basiert. Diese Importe wie<strong>de</strong>rum sind auch unter <strong>de</strong>m Aspekt <strong>de</strong>r<br />
globalen Ernährungssicherheit kritisch zu betrachten.<br />
Wie eingangs erwähnt, sollte geprüft wer<strong>de</strong>n, ob eine Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Ernährungsstils von ESS 1<br />
auf ESS 2 die Kosten auffängt, die eine Umstellung <strong>de</strong>r Ernährung auf fair gehan<strong>de</strong>lte und/o<strong>de</strong>r<br />
Bio-Lebensmittel mit sich bringt. Hierfür wur<strong>de</strong>n die Kosten für die im Folgen<strong>de</strong>n aufgezählten<br />
Ernährungsstile erhoben:<br />
eine durchschnittliche <strong>de</strong>utsche Ernährung in Anlehnung an die Daten <strong>de</strong>s Statistischen Bun<strong>de</strong>samtes<br />
(ESS 1),<br />
eine Ernährung nach <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE (mit<br />
rund 70 % weniger Fleisch, jedoch 30 % mehr Milchprodukten als in <strong>de</strong>r Durchschnittsernährung)<br />
(ESS 2),<br />
eine durchschnittliche <strong>de</strong>utsche Ernährung (s. ESS 1), aber zu 100 % auf Bio-Lebensmitteln und<br />
fair gehan<strong>de</strong>lten Lebensmitteln basierend (Bio-ESS 1),<br />
eine Ernährung nach <strong>de</strong>n Empfehlungen <strong>de</strong>r DGE (s. ESS 2), aber zu 100 % auf Bio-Lebensmitteln<br />
und fair gehan<strong>de</strong>lten Lebensmitteln basierend (Bio-ESS 2).<br />
Abbildung 3-2 zeigt die Ergebnisse dieser Preisrecherchen.<br />
16
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Abbildung 3-2:<br />
Vergleich <strong>de</strong>r Kosten verschie<strong>de</strong>ner Ernährungsweisen auf Basis von Bio-<br />
Produkten und konventionellen Produkten in Euro/Jahr und Person<br />
4000<br />
3.625<br />
Kosten Ernährungsweisen [in Euro / Person u. Jahr]<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
2.396<br />
87%<br />
2.839 2.758<br />
103%<br />
100%<br />
131%<br />
0<br />
DGE-Empfehlung<br />
Konventionell<br />
DGE-Empfehlung<br />
Bio<br />
Durchschnittliche<br />
Ernährung konventionell<br />
Durchschnittliche<br />
Ernährung Bio<br />
Quelle: Öko-Institut e.V. 2013<br />
Die „Durchschnittliche Ernährung“ auf <strong>de</strong>r Basis von Bioprodukten ist um 31 % teurer als die<br />
„Durchschnittliche Ernährung“ auf <strong>de</strong>r Basis von konventionellen Produkten. Wenn Verbraucher<br />
sich aber gesün<strong>de</strong>r (Empfehlung nach DGE) UND umweltbewusster (Bio-Lebensmittel) ernähren<br />
wollen, haben sie nur 3 % höhere Kosten als bei einer „Durchschnittlichen Ernährung“,<br />
die auf konventionell erzeugten Produkten basiert (vergleiche Abbildung 3-2). Die<br />
Mehrkosten liegen bei rund 80 Euro/Person und Jahr. An dieser Stelle soll aber betont wer<strong>de</strong>n,<br />
dass diese Mehrkosten von 3 % nicht in Stein und Bein gemeißelt sind. Wird statt einmal pro<br />
Woche 2-3 Mal pro Woche nach Spargel gegriffen o<strong>de</strong>r möchte ich mir beispielsweise Parmaschinken<br />
o<strong>de</strong>r Morta<strong>de</strong>lla in Bio-Qualität anstatt Salami, Lyoner o<strong>de</strong>r Leberwurst leisten, können<br />
die Mehrkosten schnell auf 10 % o<strong>de</strong>r mehr klettern. Ebenfalls haben die erhobenen Gesamtkosten<br />
<strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsstile nur einen indikativen Wert. Leiste ich mir beispielsweise<br />
3-4 Mal pro Woche Spargel zur Spargelzeit anstatt nur einmal pro Woche, erhöhen sich die<br />
Gesamtkosten schnell.<br />
Am billigsten (minus 13 %) und auch gesün<strong>de</strong>r lebt man mit einer Ernährung nach DGE-<br />
Empfehlungen auf <strong>de</strong>r Basis konventioneller Lebensmittel. Auch die Treibhausgasemissionen sind<br />
geringer (siehe oben). Trotz<strong>de</strong>m ist <strong>de</strong>r konventionelle Anbau von pflanzlichen Produkten mit <strong>de</strong>m<br />
Einsatz von Pestizi<strong>de</strong>n, Mineraldünger und an<strong>de</strong>ren synthetischen Wuchshilfsmitteln verbun<strong>de</strong>n.<br />
Im Vergleich zu konventionellen Anbaumetho<strong>de</strong>n zeichnet sich <strong>de</strong>r biologische Anbau auch durch<br />
<strong>de</strong>n Einsatz von bo<strong>de</strong>nschonen<strong>de</strong>n Anbaumetho<strong>de</strong>n wie Gründüngung und Fruchtwechsel aus.<br />
17
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Die Preiserhebung zeigt auch <strong>de</strong>utlich, dass konventionell produziertes Fleisch im Vergleich zu<br />
Fleisch, das nach Richtlinien <strong>de</strong>s biologischen Landbaus erzeugt wur<strong>de</strong>, extrem billig ist (vergleiche<br />
die Kosten für ESS 1 und Bio-ESS 1). Die Grün<strong>de</strong> hierfür sind vielfältig und konnten im<br />
Rahmen dieser Studie nicht <strong>de</strong>tailliert untersucht wer<strong>de</strong>n. Grün<strong>de</strong> sind beispielsweise eine<br />
niedrigere Tierdichte/Fläche und ein höherer Arbeitsaufwand bei einer Tierproduktion nach <strong>de</strong>n<br />
Richtlinien <strong>de</strong>s organischen Landbaus. Der höhere Arbeitsaufwand ergibt sich auch teilweise durch<br />
Haltungsformen, die <strong>de</strong>m Tierwohl dienen. Neben <strong>de</strong>m Arbeitsaufwand spielen aber auch Marktfaktoren<br />
eine Rolle. Bestimmte Teile <strong>de</strong>s Tieres lassen sich heutzutage nicht mehr gut vermarkten.<br />
Schlicht und ergreifend gibt es heutzutage beispielsweise keinen Markt für Bio-Schweinefüße, was<br />
<strong>de</strong>n Preis für die vermarktbaren Teile <strong>de</strong>s Tieres in die Höhe treibt. Ein weiterer Aspekt im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r Preisgestaltung sind vermutlich auch die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in <strong>de</strong>n Schlachthöfen.<br />
Dieser Aspekt müsste aber in einer eigenen Studie näher untersucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Eine Umstellung von einer „Durchschnittliche Ernährung“ auf eine „Ernährung nach DGE-Empfehlungen“<br />
kann also die Mehrkosten, die durch <strong>de</strong>n Kauf von fair gehan<strong>de</strong>lten und/o<strong>de</strong>r biologisch<br />
produzierten Lebensmitteln entstehen, fast abfangen. Hierbei ist noch nicht berücksichtigt, dass<br />
nicht nachhaltige Anbau- und Tierhaltungsmetho<strong>de</strong>n Kosten erzeugen können, die nicht im<br />
Lebensmittelpreis enthalten sind und von <strong>de</strong>r Gesellschaft in <strong>de</strong>n Produktionslän<strong>de</strong>rn getragen<br />
wer<strong>de</strong>n müssen, ebenso wenig wie die Tatsache, dass ein ungesun<strong>de</strong>r Ernährungsstil Krankheiten<br />
und damit vermeidbare Gesundheitskosten verursachen kann.<br />
3.3. Externe Kosten <strong>de</strong>r fleischbetonten durchschnittlichen Ernährung<br />
Durch Auswertung einer Literaturrecherche wur<strong>de</strong> untersucht, in welchem Rahmen diese externen<br />
Kosten liegen. Ebenso wur<strong>de</strong>n statistische Daten und wissenschaftliche Literatur recherchiert, die<br />
Informationen über Kosten zu ernährungsbedingten Krankheiten enthalten. Diese Form <strong>de</strong>r Erhebung<br />
von externen Kosten kann nur eine grobe Abschätzung sein, in welcher Größenordnung<br />
diese Kosten liegen. So gibt es vielfach Probleme bei <strong>de</strong>r Zuordnung <strong>de</strong>r Kosten: welche Nitratbelastung<br />
stammt aus <strong>de</strong>r Tierhaltung? Welche aus <strong>de</strong>r Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln<br />
o<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Produktion von Pflanzen für die Bioenergie-Gewinnung. Die Nutzungsform<br />
eines Standortes verän<strong>de</strong>rt sich im zeitlichen Verlauf. Detaillierte Ergebnisse hierzu, die lokal<br />
erfasst wer<strong>de</strong>n, lassen sich aufgrund unterschiedlicher geologischer und hydrologischer Gegebenheiten<br />
nicht auf an<strong>de</strong>re Standorte übertragen. Trotz<strong>de</strong>m erscheint eine Abschätzung <strong>de</strong>r Höhe<br />
dieser Kosten sinnvoll, um einen Anhaltspunkt zu bekommen, inwieweit gegebenenfalls die Entwicklung<br />
politischer Maßnahmen gerechtfertigt ist.<br />
3.3.1. Kosten durch die Behandlung von Adipositas und weiterer ernährungsbedingter<br />
Krankheiten<br />
Der durchschnittliche Ernährungsstil in Deutschland – wie auch in vielen an<strong>de</strong>ren Industrienationen<br />
- ist ungesund: zu viel Fleisch, zu viele gesättigte Fettsäuren, zu viel Zucker. Übergewicht<br />
und ernährungsbedingte Krankheiten sind die Folge. In Deutschland schaffen es die meisten<br />
Erwachsenen nicht, das Körpergewicht bis ins höhere Alter im Normalbereich zu halten: 67 % <strong>de</strong>r<br />
Männer und 53 % <strong>de</strong>r Frauen haben Übergewicht, wobei 23 % <strong>de</strong>r Männer und 24 % <strong>de</strong>r Frauen<br />
sogar adipös, also stark übergewichtig, sind. Damit bringen sieben von zehn Männern und fünf von<br />
zehn Frauen zu viel Gewicht auf die Waage. Während die Übergewichtshäufigkeit in <strong>de</strong>n letzten<br />
Jahren stagniert, ist die Anzahl <strong>de</strong>r Adipositas-Erkrankungen weiter gestiegen. Beson<strong>de</strong>rs auffällig<br />
ist ein starker Anstieg in <strong>de</strong>n jüngeren Altersgruppen sowie bei Personen mit einem niedrigen<br />
sozioökonomischen Status (Mensink et al. 2013). Die Behandlung von Adipositas selbst verursacht<br />
Kosten (z.B. durch Diätbehandlungen o<strong>de</strong>r in Form <strong>de</strong>r Durchführung operativer Eingriffe, wie die<br />
18
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Anlage eines Magenban<strong>de</strong>s), ebenso wie die Behandlung von Krankheiten, die als Folge einer<br />
ungesun<strong>de</strong>n Ernährung auftreten können (z.B. Typ 2-Diabetes mellitus o<strong>de</strong>r Herz-Kreislauf.-Krankheiten).<br />
Weitere indirekte Kosten entstehen z.B. durch Arbeitsunfähigkeit als Folge von ernährungsbedingten<br />
Krankheiten.<br />
Laut Sassi (2010) hat die Behandlung von Adipositas in <strong>de</strong>n meisten Län<strong>de</strong>rn einen Anteil von 1 –<br />
3 % <strong>de</strong>r Kosten <strong>de</strong>s Gesundheitssystems (Ausnahme USA, hier sind es ca. 5 – 10 %). Insgesamt<br />
kosten übergewichtige Personen das Gesundheitswesen rund 25 % mehr als Normalgewichtige.<br />
Da die Zeitspanne zwischen <strong>de</strong>m Erreichen <strong>de</strong>s Übergewichts und <strong>de</strong>r Behandlung von damit einhergehen<strong>de</strong>n<br />
Erkrankungen relativ groß ist, könnte sich die Summe <strong>de</strong>r Gesundheitskosten bis<br />
2015 global betrachtet noch um 70 % und bis 2025 um das 2,4-fache erhöhen, da die Zunahme<br />
übergewichtiger Personen in <strong>de</strong>n letzten Jahren massiv angestiegen ist (Sassi 2010). Die Ausgaben<br />
für Magen-Operationen (Magenband, Magenballon o<strong>de</strong>r Magenverkleinerung) bei stark übergewichtigen<br />
PatientenInnen sind in Deutschland in <strong>de</strong>n letzten 5 Jahren um 64 % gestiegen und<br />
lagen im Jahr 2012 mit 669 Eingriffen bei 4,6 Mio. Euro (DAK 2013). Insgesamt entstan<strong>de</strong>n im<br />
Jahr 2008 durch Adipositas und sonstige Überernährung in Deutschland Gesundheitskosten von<br />
863 Mio. Euro. Das entspricht einem Wert von 10 Euro Krankheitskosten pro Jahr und Einwohner<br />
(Statistisches Bun<strong>de</strong>samt 2013).<br />
Auf Grund <strong>de</strong>r Diagnose von Diabetes mellitus wur<strong>de</strong>n im Jahr 2007 <strong>de</strong>utschlandweit mehr als<br />
7 Mio. Bun<strong>de</strong>sbürger behan<strong>de</strong>lt, etwa 90 % dieser Erkrankten sind <strong>de</strong>m Typ-2-Diabetes zuzuordnen.<br />
Übergewicht gilt als eine <strong>de</strong>r Hauptursachen für diesen Erkrankungstyp. Es wer<strong>de</strong>n zunehmend<br />
Kin<strong>de</strong>r und Jugendliche mit Diabetes-Typ-2 diagnostiziert, die in <strong>de</strong>r Regel stark übergewichtig<br />
sind. Insgesamt dürfte die Dunkelziffer erheblich sein, sodass heute min<strong>de</strong>stens 10 % <strong>de</strong>r<br />
in Deutschland leben<strong>de</strong>n Menschen an einem Diabetes mellitus lei<strong>de</strong>n (DDS 2013). Laut Angaben<br />
<strong>de</strong>s Statistischen Bun<strong>de</strong>samtes (2013) entstan<strong>de</strong>n im Jahr 2008 durch Diabetes mellitus in<br />
Deutschland Gesundheitskosten von rund 6,3 Mrd. Euro. Das entspricht einem Wert von 80 Euro<br />
Krankheitskosten pro Jahr und Einwohner.<br />
Übergewicht gilt – neben Bluthochdruck, erhöhtem Cholesterinspiegel, Rauchen und Arteriosklerose<br />
- auch als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten (BMBF 2013). Laut Angaben <strong>de</strong>s<br />
Statistischen Bun<strong>de</strong>samtes (2013) entstan<strong>de</strong>n in Deutschland im Jahr 2008 durch Krankheiten <strong>de</strong>s<br />
Kreislaufsystems Gesundheitskosten von knapp 37 Mrd. Euro. Das entspricht einem Wert von 450<br />
Euro Krankheitskosten pro Jahr und Einwohner (Statistisches Bun<strong>de</strong>samt 2013). Nicht alle Herz-<br />
Kreislauf-Krankheiten sind jedoch Folgen einer ungesun<strong>de</strong>n Ernährung. Wie hoch <strong>de</strong>r Anteil an<br />
ernährungsbedingten Herz-Kreislauf-Krankheiten ist, lässt sich nicht beziffern.<br />
Die oben aufgeführten Kosten für das Gesundheitssystem haben – wie ausgeführt – mehrere<br />
Ursachen. Eine Aufschlüsselung auf einzelne Ursachen ist bislang und vermutlich auch in <strong>de</strong>r<br />
Zukunft nicht möglich. Wenn man aber vorsichtig davon ausgehen wür<strong>de</strong>, dass 50 % <strong>de</strong>r Kosten<br />
von Adipositas und von Diabetes und 20 % <strong>de</strong>r Herz-Kreislauf-Krankheiten auf falsche Ernährung<br />
zurückzuführen wären, wären dies immer noch rund 11 Mrd. Euro bzw. rund 138 Euro pro Bun<strong>de</strong>sbürger<br />
pro Jahr.<br />
Dass diese Kostenschätzung nicht überschätzt ist, zeigen auch an<strong>de</strong>re Zahlen. So beziffert Prof.<br />
Dr. Günter Neubauer, Direktor <strong>de</strong>s Instituts für Gesundheitsökonomie in München, die Behandlungskosten<br />
für die Folgeerkrankungen von Adipositas in Deutschland auf insgesamt 17 Mrd.<br />
Euro). 11 Das Schweizerische Bun<strong>de</strong>samt für Gesundheit schätzt die Kosten für das Gesundheitswesen,<br />
die durch Adipositas und Übergewicht in 2006 in <strong>de</strong>r Schweiz entstan<strong>de</strong>n sind, auf<br />
11 - http://www.hausarbeiten.<strong>de</strong>/faecher/vorschau/190707.html, abgerufen am 07.07.<strong>2014</strong><br />
19
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
5,8 Mrd. Schweizer Franken 12 . Das entspricht bei <strong>de</strong>m Umrechnungskurs von 2006 einer Summe<br />
von 3,7 Mrd. Euro o<strong>de</strong>r 493 Euro/Einwohner in 2006. Diese Schätzung liegt <strong>de</strong>utlich über unserer<br />
Annahme von rund 140 Euro/Bun<strong>de</strong>sbürger. Die Statistiken zeigen außer<strong>de</strong>m einen zunehmen<strong>de</strong>n<br />
Trend hinsichtlich <strong>de</strong>s Anteils übergewichtiger Personen in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik.<br />
3.3.2. Externe Kosten <strong>de</strong>r Agrarproduktion<br />
Bei <strong>de</strong>r Betrachtung unerwünschter Folgen <strong>de</strong>r Landwirtschaft auf die Umwelt und <strong>de</strong>n Menschen<br />
muss man zwischen verschie<strong>de</strong>nen Umweltschä<strong>de</strong>n im Hinblick auf die verschie<strong>de</strong>nen Schutzgüter<br />
Wasser, Bo<strong>de</strong>n, Luft (inklusive Klima) und Artenvielfalt unterschei<strong>de</strong>n sowie Folgen für die<br />
menschliche Gesundheit. Hierzu gehören <strong>de</strong>r Verlust <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nfruchtbarkeit durch Erosion, die<br />
Belastung von Grundwasser und Oberflächengewässern mit Phosphor- und Stickstoffverbindungen<br />
sowie Pestizi<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna, <strong>de</strong>r Ausstoß von<br />
Treibhausgasen durch unsachgemäße Düngung, Nutzung von anmoorigen und moorigen Flächen<br />
und hohe Viehbestän<strong>de</strong>, sowie gesundheitliche Folgen für <strong>de</strong>n Menschen durch <strong>de</strong>n Pestizi<strong>de</strong>insatz<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n hohen Antibiotikaeinsatz 13 in <strong>de</strong>r Tierzucht. Viele Probleme sind seit Jahrzehnten<br />
bekannt, zum Teil wur<strong>de</strong>n, v.a. die Gewässerbelastung betreffend, Maßnahmen getroffen – dazu<br />
gehört das Atrazinverbot (1991), die Novellierung <strong>de</strong>s Pflanzenschutzgesetzes (1996) und <strong>de</strong>r<br />
Düngeverordnung (1996, verschärft 2007) – doch haben all diese Maßnahmen bisher nur partiell<br />
Wirkung gezeigt. Von <strong>de</strong>n Nährstoffeinträgen in die Oberflächengewässer Deutschlands stammten<br />
für <strong>de</strong>n Zeitraum 2003 bis 2005 über 70 % aller Stickstoff- und über 50 % aller Phosphoreinträge<br />
aus <strong>de</strong>r Landwirtschaft (Umweltbun<strong>de</strong>samt 2010). Ein Viertel aller Grundwasservorkommen in<br />
Deutschland weist zu hohe Nitratwerte auf (BMU/UBA 2010). Bei Überschreitung <strong>de</strong>s Grenzwertes<br />
von 50 Milligramm Nitrat pro Liter kann das Grundwasser nicht mehr ohne weiteres als Trinkwasser<br />
genutzt wer<strong>de</strong>n. Das heißt die Brunnen müssen – wenn überhaupt möglich – in tiefere<br />
Schichten verlagert o<strong>de</strong>r aufgegeben wer<strong>de</strong>n (UBA/VZBV <strong>2014</strong>).<br />
Bislang gibt es für Deutschland keine Studien, die die Kosten, die durch nicht nachhaltige landwirtschaftliche<br />
Bewirtschaftung entstehen, monetarisieren 14 . Für Großbritannien haben Pretty et al.<br />
2000 (zitiert nach Scha<strong>de</strong>r et al. 2013) für <strong>de</strong>n Zeitraum von 1990 bis 1996 jährliche Gesamtkosten<br />
von insgesamt minimal 2,5 Mrd. Euro und maximal 8,6 Mrd. Euro beziffert (in Euro umgerechnet<br />
und für 2012 inflationsbereinigt). Bei einem Erwartungswert von gerun<strong>de</strong>t 5,2 Mrd. Euro, von <strong>de</strong>m<br />
die Autoren ausgehen, entspricht dies etwa 298 Euro pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche<br />
o<strong>de</strong>r auf die Einwohner Großbritanniens umgerechnet rund 82 Euro/Einwohner und Jahr. Wür<strong>de</strong><br />
man diese Kosten auf die landwirtschaftliche Fläche Deutschlands umrechnen, entstün<strong>de</strong>n rund<br />
2,4 bis 8,3 Mrd. Euro externe Kosten, bzw. rund 30 bis 100 Euro pro Einwohner und Jahr. Zu <strong>de</strong>n<br />
be<strong>de</strong>utendsten Kostenpunkten im Hinblick auf die Umweltfolgen zählen die Treibhausgasemissionen,<br />
die Trinkwasserbelastung durch Pestizi<strong>de</strong>, Arten- und Habitatverluste und <strong>de</strong>r<br />
Verlust an organischer Substanz im Bo<strong>de</strong>n (Pretty et al. 2000 zitiert nach Scha<strong>de</strong>r et al. 2013).<br />
Die Ergebnisse für Großbritannien lassen sich mit Sicherheit nicht 1:1 auf Deutschland übertragen.<br />
12<br />
13<br />
14<br />
http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/05218/05232/in<strong>de</strong>x.html?lang=<strong>de</strong>, abgerufen am<br />
07.07.<strong>2014</strong><br />
„Insgesamt sind im Jahr 2012 rund 1.619 Tonnen Antibiotika von pharmazeutischen Unternehmen und Großhändlern<br />
an Tierärzte in Deutschland abgegeben wor<strong>de</strong>n. Dies be<strong>de</strong>utet ein Minus gegenüber <strong>de</strong>r Vorjahresgesamtmenge von<br />
ca. 87 t. Die Menge an Fluorchinolonen, <strong>de</strong>ren Verwendung in <strong>de</strong>r Tiermedizin wegen ihrer Rolle als sogenannte<br />
Reserveantibiotika für die Humanmedizin kritisch gesehen wird, ist gegenüber <strong>de</strong>r Vorjahresmeldung um 2 t<br />
angestiegen. Von <strong>de</strong>n abgegebenen 1.619 t Wirkstoffen entfallen 1.611 t auf Präparate, die für min<strong>de</strong>stens eine<br />
Tierart zugelassen sind, die Lebensmittel liefert. Nur 8 t entfallen auf Präparate, die ausschließlich für nicht<br />
Lebensmittel liefern<strong>de</strong> Tiere (also Sport- und Freizeittiere) zugelassen sind“ (BVL 2013).<br />
Das Umweltbun<strong>de</strong>samt (2012) hat eine Metho<strong>de</strong>nkonvention zur Schätzung von Umweltkosten herausgegeben.<br />
Diese Metho<strong>de</strong>nkonvention adressiert aber keine landwirtschaftlichen Umweltkosten.<br />
20
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Die Studie zeigt außer<strong>de</strong>m, dass sich die externen Kosten, die durch nicht nachhaltige landwirtschaftliche<br />
Bewirtschaftung entstehen, aufgrund von Zuordnungsschwierigkeiten und Wissenslücken<br />
nur grob abschätzen lassen. Dennoch kann man die Ergebnisse von Pretty et al. (2000)<br />
zumin<strong>de</strong>st zur Einschätzung <strong>de</strong>r Größenordnung heranziehen, in <strong>de</strong>r sich diese externen Kosten<br />
bewegen. Es zeigt sich, dass diese Größenordnung in <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Mehrkosten liegt, die<br />
entstehen, wenn eine Umstellung <strong>de</strong>s Ernährungsstils von <strong>de</strong>r „durchschnittlichen Ernährung“ auf<br />
<strong>de</strong>r Basis von konventionellen Produkten auf eine „Ernährung nach DGE-Empfehlungen“ auf <strong>de</strong>r<br />
Basis von Bio-Produkten vorgenommen wird.<br />
3.3.3. Ursachen externer Kosten <strong>de</strong>r Produktion von Lebensmitteln am Beispiel <strong>de</strong>s<br />
Angebots an frischen Tomaten im <strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>l<br />
Die Be<strong>de</strong>utung von externen Kosten, aber auch die Schwierigkeit <strong>de</strong>r Quantifizierung und Zuordnung<br />
lässt sich gut am Angebot von frischen Tomaten auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Markt zeigen. Tomaten<br />
sind das Gemüse, das in Deutschland am meisten konsumiert wird. Im Schnitt hat <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche<br />
Bun<strong>de</strong>sbürger 2012/13 20,6 kg Tomaten verzehrt, davon 6,7 kg als frische Tomaten und 13,9 kg in<br />
Form von verarbeiteten Tomaten 15 . Tomaten wer<strong>de</strong>n in Deutschland das ganze Jahr über frisch im<br />
Han<strong>de</strong>l sowohl aus konventioneller als auch aus biologischer Produktion angeboten. Nur etwa 8 %<br />
davon stammen aus <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Markt. Fast die Hälfte <strong>de</strong>s Tomatenangebotes an frischen<br />
Tomaten auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Markt stammt aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n (48 %), weitere 22 % kommen<br />
aus Spanien (kleinere Mengen kommen aus an<strong>de</strong>ren EU-Län<strong>de</strong>rn sowie aus Marokko 16 ). Die<br />
Anbauregionen weisen klimatische und soziale Unterschie<strong>de</strong> auf. Ebenfalls unterschei<strong>de</strong>n sich die<br />
Anbaupraktiken in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Län<strong>de</strong>rn. Das heißt, dass mit <strong>de</strong>m Tomatenanbau län<strong>de</strong>rspezifisch<br />
unterschiedliche Umweltauswirkungen und soziale Auswirkungen verbun<strong>de</strong>n sind, und<br />
es entsprechend unterschiedliche Erzeugungskosten wie externalisierte Kosten gibt. Im Rahmen<br />
einer sozio-ökonomischen Analyse wur<strong>de</strong> versucht, die Unterschie<strong>de</strong> zwischen konventionell<br />
angebauten Tomaten aus Spanien und <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n sowie Tomaten aus kontrolliert biologischem<br />
Landbau aus Deutschland herauszuarbeiten.<br />
In <strong>de</strong>r Regel wer<strong>de</strong>n Tomaten, die als Frischware auf <strong>de</strong>n Markt kommen, im kommerziellen Stil in<br />
Gewächshäusern aus Glas o<strong>de</strong>r unter Folie angebaut, da die heutigen Anfor<strong>de</strong>rungen an eine<br />
kontinuierliche Marktbelieferung im Freilandanbau nicht zu erfüllen sind (pers. Mitteilung Jochum<br />
2007, zitiert aus Theurl 2008). Die Vorteile liegen in <strong>de</strong>r einfacheren Kultivierung wie Bewässerung,<br />
Unkrautkontrolle, Schädlingsbekämpfung und Ernte, geringeren Ernteverlusten, Möglichkeit<br />
<strong>de</strong>s Anbaus und Arbeitens unter allen Wetterbedingungen, sowie in gleichmäßig hohen Erträgen<br />
und - am wichtigsten - in <strong>de</strong>r Verfrühung <strong>de</strong>r Erntesaison und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen höheren<br />
Wirtschaftlichkeit (vgl. Campiglia et al. 2007).<br />
In <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n Tomaten in <strong>de</strong>r Regel in Glas-Gewächshäusern auf Mineralwolle angebaut<br />
(vgl. Abbildung 3-3 und Abbildung 3-4). Die verbrauchte Mineralwolle wird im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
Herstellung von Baumaterial für <strong>de</strong>n Straßenbau recycelt o<strong>de</strong>r über die Verarbeitung zu Steinklinker<br />
wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Steinwollherstellungsprozess eingespeist. Da <strong>de</strong>r Einsatz von Mineralwolle im<br />
Bio-Anbau untersagt ist, fin<strong>de</strong>t hier <strong>de</strong>r Anbau auf natürlichem Substrat statt. Für die Kontrolle <strong>de</strong>r<br />
Feuchtigkeit und <strong>de</strong>r Nährstoffversorgung wer<strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rne computergestützte Monitoringsysteme<br />
eingesetzt, die einen gezielten und optimierten Einsatz von Nährstoffen und Wasser ermöglichen<br />
und somit <strong>de</strong>n Nährstoff- und Pestizi<strong>de</strong>intrag in die Umwelt reduzieren (vgl. Abbildung 3-4). Die<br />
meisten nie<strong>de</strong>rländischen Gewächshäuser sind an gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen<br />
15<br />
16<br />
Quelle: http://www.ble.<strong>de</strong>/DE/08_Service/03_Pressemitteilungen/2013/130709_Tomate.html, abgerufen im Juli 2013.<br />
Die Herkunft <strong>de</strong>r Tomaten, die zur Herstellung von weiterverarbeiteten Tomatenprodukten verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ckt<br />
sich wahrscheinlich nicht unbedingt mit <strong>de</strong>r Herkunft <strong>de</strong>s Angebotes an frischen Tomaten in Deutschland.<br />
21
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
angeschlossen, die <strong>de</strong>n Strombedarf <strong>de</strong>r Betriebe sowie 90 % <strong>de</strong>s Wärmebedarfs <strong>de</strong>r Gewächshäuser<br />
bereitstellen. Der übrige Strom wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist.<br />
Abbildung 3-3:<br />
Tomatenanbau in Glas-Gewächshäusern in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n<br />
Quelle: Öko-Institut e.V. 2013<br />
Abbildung 3-4:<br />
Tomatenanbau auf Substrat mit computergestützter Zulieferung von<br />
Wasser und Nährstoffen<br />
Quelle: Öko-Institut e.V. 2013<br />
Der Transport <strong>de</strong>r Tomaten von <strong>de</strong>n Gewächshäusern zu <strong>de</strong>n Packstationen sowie das Waschen<br />
und Verpacken <strong>de</strong>r Ernte erfolgt in <strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>rländischen Betrieben in <strong>de</strong>r Regel hoch automatisiert<br />
(vgl. Abbildung 3-5). Die Betriebsgrößen in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n liegen im konventionellen Anbau<br />
zwischen 2 und 10 ha, im Bio-Anbau zwischen 2 und 5 ha.<br />
Abbildung 3-5:<br />
In <strong>de</strong>n meisten nie<strong>de</strong>rländischen Betrieben wer<strong>de</strong>n die Tomaten automatisch<br />
gesammelt und in die Packbetriebe transportiert, wo sie gewaschen<br />
und verpackt wer<strong>de</strong>n<br />
Quelle: Öko-Institut e.V. 2013<br />
22
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
In Spanien erfolgt <strong>de</strong>r Tomatenanbau für das Angebot von Frischware hingegen in verschie<strong>de</strong>nen<br />
Gewächshauskonstruktionen aus Plastikfolien (mit Flach- o<strong>de</strong>r Schrägdach). Zum Teil wer<strong>de</strong>n auf<br />
diese Weise riesige Landflächen mit Plastikfolie überdacht und sind daher auch unter <strong>de</strong>m Begriff<br />
„mar <strong>de</strong> plastico“ bekannt (vgl. Abbildung 3-6).<br />
Abbildung 3-6:<br />
Tomatengewächshäuser in El Ejido, Provinz Almería (Mar <strong>de</strong>l Plástico)<br />
Quelle: http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/El_Ejido, abgerufen im Juli <strong>2014</strong><br />
Zur Reduktion <strong>de</strong>r Sonneneinstrahlung wer<strong>de</strong>n die Folien im Frühjahr/ Sommer mit Kalk getüncht.<br />
Düngung erfolgt im konventionellen Anbau sowohl in Form <strong>de</strong>r Einbringung von Wirtschaftsdünger<br />
(bei Anlage <strong>de</strong>r Gewächshauskonstruktionen als auch periodisch) als auch durch Mineraldüngergaben<br />
(Theurl 2008). Nach Thompson et al. (2007) zitiert aus Theurl (2008) wer<strong>de</strong>n die<br />
Düngergaben nicht mit Hilfe bestimmter Mess- und Kontrolltechniken optimiert. Ein Teil <strong>de</strong>s Anbaus<br />
(rund 20 %) fin<strong>de</strong>t auf künstlichem Substrat statt (Theurl 2008). In Bezug auf die Erhebung<br />
von „externen Kosten“ ist von Be<strong>de</strong>utung, dass in <strong>de</strong>n spanischen Anbauregionen „Wasser“ eine<br />
knappe Ressource darstellt. Rund 70 % <strong>de</strong>s Wasserbedarfs in Spanien wird durch die Landwirtschaft<br />
beansprucht – mit steigen<strong>de</strong>r Ten<strong>de</strong>nz (MIMAM 2003). Die Befriedigung dieses Wasserbedarfs<br />
wird zum Teil technisch durch Investitionen in verschie<strong>de</strong>ne Infrastrukturmaßnahmen und<br />
durch <strong>de</strong>n Einsatz von Energie gelöst (Transport von Nord nach Süd mit Hilfe von Kanälen und<br />
Staudämmen, Entsalzung von Meerwasser und Einsatz von behan<strong>de</strong>ltem Abwasser), führt aber<br />
zum Teil auch zu einer Übernutzung <strong>de</strong>r Grundwasserressourcen mit irreversiblen Folgeschä<strong>de</strong>n<br />
für die natürliche Vegetation.<br />
Für die Beschreibung <strong>de</strong>s Tomatenanbaus in Deutschland konnte nicht auf bereits publizierte<br />
Studien o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re offizielle Quellen zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n. Exemplarisch wur<strong>de</strong> daher die<br />
Situation in drei Bio-Betrieben in <strong>de</strong>r Umgebung von Freiburg analysiert (Vorortbesichtigungen und<br />
Interviews von Gemüseproduzenten). In Deutschland fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Anbau von Tomaten sowohl im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r Bio-Produktion als auch im Rahmen <strong>de</strong>r konventionellen Produktion in Folientunneln<br />
(vgl. Abbildung 3-7) o<strong>de</strong>r in Glas-Gewächshäusern statt. Generell scheint sich <strong>de</strong>r technologische<br />
Stand <strong>de</strong>s Gewächshausanbaus in Deutschland stark vom technologischen Stand in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n<br />
zu unterschei<strong>de</strong>n. Mo<strong>de</strong>rne, hocheffiziente Gewächshäuser, die die Abwärme von Kraft-<br />
Wärme-Kopplungsanlagen nutzen und computergesteuerte Systeme zur Optimierung von Bewässerung<br />
und Nährstoffversorgung einsetzen, sind in Deutschland offensichtlich nicht Standard.<br />
Dieser technologische Unterschied ist vermutlich einer <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>, warum in Deutschland im<br />
Vergleich zu <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n nur saisonal produziert wird. In Deutschland fin<strong>de</strong>t zumin<strong>de</strong>st im<br />
Bio-Anbau nach unseren Rechercheergebnissen eine Beheizung <strong>de</strong>r Gewächshäuser in <strong>de</strong>r Regel<br />
nur während eines begrenzten Zeitraums für die Anzucht <strong>de</strong>r Pflanzen bzw. zur Überbrückung von<br />
Kälteeinfällen statt. Eine Beheizung zur Produktion in kälteren Perio<strong>de</strong>n wäre in Deutschland in<br />
<strong>de</strong>n standardmäßig betriebenen Gewächshäusern zu teuer.<br />
23
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Abbildung 3-7:<br />
Tomatenanbau in Folientunneln in Süd<strong>de</strong>utschland<br />
Quelle: Baron 2013<br />
Da <strong>de</strong>r Einsatz von Mineralwolle im Bio-Anbau untersagt ist, fin<strong>de</strong>t hier <strong>de</strong>r Anbau auf natürlichem<br />
Substrat statt. Im Bio-Anbau wer<strong>de</strong>n entwe<strong>de</strong>r im Jahresverlauf zeitlich versetzt o<strong>de</strong>r auch parallel<br />
im gleichen Gewächshaus verschie<strong>de</strong>ne Kulturen angebaut, um <strong>de</strong>n Schädlingsdruck zu reduzieren.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Erfassung <strong>de</strong>r externen Kosten von verschie<strong>de</strong>nen Angebotsformen frischer<br />
Tomaten im <strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>l wur<strong>de</strong>n Daten zu Erträgen, Flächenbedarf, zum Pestizid- und<br />
Düngemitteleinsatz, zum Einsatz von Nützlingen, zu Bewässerung, zu Subventionsmaßnahmen<br />
und zu Lohn- und Lebensunterhaltungskosten im Rahmen <strong>de</strong>s Tomatenanbaus in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n,<br />
in Spanien, in Deutschland und in Marokko recherchiert, verglichen und ausgewertet. Zusammenfassend<br />
kann vorweg festgehalten wer<strong>de</strong>n, dass sich aus öffentlich zugänglichen Daten<br />
nicht ableiten lässt, inwieweit sich <strong>de</strong>r Verbraucherpreis von Tomaten verschie<strong>de</strong>ner Herkunft und<br />
Anbauform erhöht, wenn bestimmte externe Kosten eingerechnet wer<strong>de</strong>n. Dies ist zum Teil darin<br />
begrün<strong>de</strong>t, dass offiziell zugängliche Daten zum großen Teil veraltet sind. Außer<strong>de</strong>m hat sich<br />
durch die Vorortbesuche in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und in Deutschland gezeigt, dass eine große<br />
Varianz in <strong>de</strong>n Anbaumetho<strong>de</strong>n besteht. Das heißt, um <strong>de</strong>n Anteil <strong>de</strong>r Kosten zu ermitteln, <strong>de</strong>r bislang<br />
nicht im Verbraucherpreis enthalten ist, bedarf es eines viel größeren Stichprobenumfangs als<br />
es im Rahmen dieser Studie geleistet wer<strong>de</strong>n konnte. Dennoch kann gezeigt wer<strong>de</strong>n, dass verschie<strong>de</strong>ne<br />
externe Kosten durch <strong>de</strong>n Anbau entstehen, die nicht im Erzeugerpreis enthalten sind.<br />
Pestizi<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r konventionellen Landwirtschaft eingesetzt, um Ernteverluste zu vermei<strong>de</strong>n<br />
o<strong>de</strong>r Ernteverlusten vorzubeugen. Der Einsatz ist mit einer Reihe von negativen Umweltauswirkungen<br />
sowie negativen gesundheitlichen Auswirkungen für landwirtschaftliche Arbeitskräfte,<br />
Anwohner und Verbraucher verbun<strong>de</strong>n. Kosten, die durch diese Schä<strong>de</strong>n entstehen, wie<br />
zum Beispiel die Erschließung neuer Trinkwasserquellen o<strong>de</strong>r die Behandlung von Krankheiten,<br />
sind nicht im Produktionspreis enthalten, son<strong>de</strong>rn wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Gesellschaft getragen. Im biologischen<br />
Anbau ist <strong>de</strong>r Einsatz von synthetischen Pestizi<strong>de</strong>n weitgehend untersagt. Zur Bekämpfung<br />
von Schädlingen wer<strong>de</strong>n hier Nützlinge eingesetzt. Innerhalb <strong>de</strong>r EU ist <strong>de</strong>r Einsatz auch für<br />
<strong>de</strong>n konventionellen Anbau reguliert. Beispielsweise sind 56 Substanzen im Tomatenanbau verboten,<br />
für weitere Substanzen wur<strong>de</strong>n Grenzwerte formuliert 17 . Diese Regulierungen gelten aber<br />
beispielsweise nicht für <strong>de</strong>n Anbau in Marokko. Aktuelle konkrete Zahlen zum Pestizi<strong>de</strong>insatz im<br />
Tomatenanbau in Spanien und <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n sind öffentlich nicht verfügbar. Verschie<strong>de</strong>ne<br />
Studien (u.a. Theurl et al. 2008, Blom 2007) zeigen auf, dass sich <strong>de</strong>r Pestizi<strong>de</strong>insatz im Toma-<br />
17<br />
http://www.infoagro.com/noticias/2012/marruecos__tomates_con_56_sustancias_activas_prohibidas.asp; abgerufen<br />
im Juli 2013<br />
24
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
tenanbau in Spanien seit 2000 <strong>de</strong>utlich reduziert hat und <strong>de</strong>r Anbau heutzutage überwiegend nach<br />
<strong>de</strong>n Grundsätzen <strong>de</strong>s integrierten Pflanzenschutzes stattfin<strong>de</strong>t. Auch hier greift man mittlerweile<br />
zum Teil auf <strong>de</strong>n Einsatz von Nützlingen zurück. In <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n erfolgt <strong>de</strong>r Pestizi<strong>de</strong>insatz<br />
durch die Nutzung von computergestützten Monitoringsystemen heutzutage sehr gezielt und<br />
betrug nach van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong>n (2004) bereits Anfang <strong>de</strong>s 21. Jahrhun<strong>de</strong>rts pro ha und Jahr nur rund<br />
ein Drittel <strong>de</strong>r Menge, die in Spanien eingesetzt wur<strong>de</strong>. Das heißt, dass zumin<strong>de</strong>st in Spanien und<br />
<strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n letzten 12 Jahren intensive Verän<strong>de</strong>rungen im Rahmen <strong>de</strong>s konventionellen<br />
Anbaus von Tomaten stattgefun<strong>de</strong>n haben, um Schä<strong>de</strong>n und damit verbun<strong>de</strong>ne externe<br />
Folgekosten durch <strong>de</strong>n Pestizi<strong>de</strong>insatz zu reduzieren.<br />
In Spanien spielt im Hinblick auf mögliche Umweltschä<strong>de</strong>n und externe Kosten im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
Tomatenanbaus vor allem auch die Frage <strong>de</strong>r Bewässerung eine wichtige Rolle. In <strong>de</strong>n Hauptanbaugebieten<br />
müssen die Tomatenkulturen regelmäßig bewässert wer<strong>de</strong>n. Durch <strong>de</strong>n wachsen<strong>de</strong>n<br />
Wasserbedarf <strong>de</strong>r spanischen Landwirtschaft steht Spanien mittlerweile vor massiven Wasserversorgungsproblemen<br />
und Nutzungskonflikten. Teilweise wird in Spanien das Wasser aus <strong>de</strong>m<br />
wasserreicheren Nor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s transportiert. Hierfür war <strong>de</strong>r Ausbau einer entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Infrastruktur in Form von Staudämmen und Kanälen notwendig. Weitere Infrastrukturmaßnahmen<br />
zur Verbesserung <strong>de</strong>r Wasserversorgungssituation erfolgten bzw. erfolgen in<br />
Spanien im Rahmen <strong>de</strong>r Einrichtung von verbesserten Abwasserbehandlungsanlagen, mit <strong>de</strong>nen<br />
das behan<strong>de</strong>lte Abwasser eine Qualität erreicht, die zulässt, dass es für Bewässerungszwecke<br />
eingesetzt wer<strong>de</strong>n kann, sowie in <strong>de</strong>r Errichtung von Entsalzungsanlagen. Darüber hinaus sind<br />
hier mancherorts auch bereits Folgen <strong>de</strong>r Übernutzung von Grundwasserreserven sichtbar, die<br />
von <strong>de</strong>r Versalzung landwirtschaftlich genutzter Flächen bis zur Gefährdung von für <strong>de</strong>n Naturschutz<br />
wertvollen Gebieten reichen, (Can<strong>de</strong>la et al. 2008). Konkrete Zahlen im Hinblick auf externe<br />
Kosten, die a) durch die Wasserbereitstellung für Bewässerung von Tomatenkulturen (o<strong>de</strong>r<br />
Gemüsekulturen) und b) durch Folgekosten <strong>de</strong>r Übernutzung von Grundwasserressourcen in<br />
Spanien in <strong>de</strong>n letzten Jahren entstan<strong>de</strong>n sind, sind nicht öffentlich verfügbar. Offensichtlich ist<br />
jedoch, dass diese Kosten nicht in <strong>de</strong>n Erzeugungskosten eingepreist sind, und entwe<strong>de</strong>r über EU-<br />
Gel<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n spanischen Staatshaushalt finanziert wer<strong>de</strong>n.<br />
Weitere externe Kosten entstehen im Rahmen <strong>de</strong>r Tomatenproduktion vor allem auch durch <strong>de</strong>n<br />
Verlust an organischem Material und Kohlenstoff im Bo<strong>de</strong>n in Folge von Bo<strong>de</strong>nerosion und Bo<strong>de</strong>nverdichtung.<br />
Auch <strong>de</strong>r nicht optimierte Einsatz von Düngemitteln birgt die Gefahr einer Nitratbelastung<br />
von Grund- und Oberflächengewässern. Zu guter Letzt stellt die Praktik <strong>de</strong>s Anbaus unter<br />
riesigen „Plastikmeeren“, die we<strong>de</strong>r von Wei<strong>de</strong>n noch Hecken, Wäldchen o<strong>de</strong>r Ackerrandstreifen<br />
unterbrochen, sind einen großen Biodiversitätsverlust dar.<br />
Auch hinsichtlich <strong>de</strong>r Lohnkosten gibt es Unterschie<strong>de</strong> im Tomatenanbau in Spanien und<br />
Deutschland bzw. <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n. Vergleicht man in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n, Deutschland und<br />
Spanien die Brutto-Löhne, die in <strong>de</strong>r Landwirtschaft gezahlt wer<strong>de</strong>n, mit <strong>de</strong>n jeweiligen Lebensunterhaltungskosten,<br />
so stellt sich heraus, dass ordnungsgemäß angestellte Beschäftigte in <strong>de</strong>r<br />
Landwirtschaft in allen drei Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Lebensunterhalt einer Person <strong>de</strong>cken können. In<br />
Deutschland und in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n können sich diese Beschäftigten jedoch einen höheren<br />
Lebensstandard leisten als in Spanien. Nicht in diese Betrachtung miteinbezogen wer<strong>de</strong>n konnte<br />
die Tatsache <strong>de</strong>r illegalen Beschäftigungsverhältnisse in <strong>de</strong>r Landwirtschaft.<br />
25
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Diese Problematik wird für <strong>de</strong>n Gemüse- und Erdbeeranbau in Südspanien, Griechenland,<br />
Marokko und Süditalien vielfach von verschie<strong>de</strong>nen NGOs und <strong>de</strong>r Presse adressiert 18 .<br />
Tomatenanbau in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n fin<strong>de</strong>t in Form eines hocheffizienten Gewächshausanbaus<br />
statt. Aus Interviewaussagen einzelner Betreiber nie<strong>de</strong>rländischer Gemüseanbaubetriebe lässt<br />
sich schließen, dass es im Zeitraum von ca. 2000 bis 2009 finanzielle Unterstützungen für die<br />
Mo<strong>de</strong>rnisierung und Ausweitung <strong>de</strong>s Gewächshausanbaus in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n gab. Eine vergleichbare<br />
Form <strong>de</strong>r Unterstützung hat es in Deutschland offensichtlich nicht gegeben. Auch diese<br />
Form von finanziellen Unterstützungsmaßnahmen sind im Grun<strong>de</strong> genommen externe Kosten, die<br />
nicht <strong>de</strong>r Verbraucher bezahlt, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>njenigen getragen wer<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong>n Topf eingezahlt<br />
haben, aus <strong>de</strong>m die Unterstützungsmaßnahmen finanziert wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>m konkreten Fall<br />
konnte nicht festgestellt wer<strong>de</strong>n, aus welcher Quelle die Unterstützungsmaßnahmen finanziert<br />
wer<strong>de</strong>n (z.B. EU-Gel<strong>de</strong>r, nie<strong>de</strong>rländischer Staatshaushalt etc.). Letztendlich kann jedoch festgehalten<br />
wer<strong>de</strong>n, dass durch die finanzielle Unterstützung <strong>de</strong>r technologischen Entwicklung und <strong>de</strong>r<br />
Installierung von hochmo<strong>de</strong>rnen und hocheffizienten Gewächshausanlagen Produktionseinheiten<br />
etabliert wer<strong>de</strong>n konnten, die ganzjährig zu geringen Erzeugerpreisen Tomaten mit hohen Ertragsraten<br />
pro Fläche und Jahr produzieren.<br />
Die Studie hat gezeigt, dass im Preis von Tomaten im <strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>l eine Reihe von Kosten<br />
offensichtlich nicht enthalten ist. Es konnte gezeigt wer<strong>de</strong>n, dass diese Kosten in Spanien vor<br />
allem durch die Einrichtung von Bewässerungsinfrastrukturmaßnahmen und durch geringere Lohnkosten<br />
entstehen. Es ist zu vermuten, dass es hier weitere externe Kosten gibt, die durch Biodiversitätsverluste<br />
entstehen bzw. entstan<strong>de</strong>n sind. Hierzu konnten aber keine flächenbezogenen Daten<br />
recherchiert wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n sind es die Entwicklungs- und Investitionskosten, die<br />
nicht im Preis von Tomaten aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n enthalten sind.<br />
An dieser Stelle soll angemerkt wer<strong>de</strong>n, dass Forschungs- und Entwicklungskosten, die nicht im<br />
Preis von Produkten enthalten sind, sowohl in <strong>de</strong>n herkömmlichen als auch in <strong>de</strong>n biologischen<br />
Landbau fließen, und dass auch in Deutschland in die Agrarforschung investiert wird. In Deutschland<br />
wur<strong>de</strong> jedoch zumin<strong>de</strong>st bis zur Einrichtung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>sprogramms für Ökologischen Landbau,<br />
heute Bun<strong>de</strong>sprogramm für ökologischen Landbau und an<strong>de</strong>re Formen <strong>de</strong>s nachhaltigen<br />
Landbaus, lange Jahre bemängelt, dass sehr viel weniger Geld in Forschungsfragen <strong>de</strong>s biologischen<br />
Landbaus als in Forschungsfragen im Rahmen <strong>de</strong>s konventionellen Landbaus fließen.<br />
18<br />
Wenger, S., (2013), Nur wenn geschossen wird, schauen alle auf die Pflückerinnen, Die Wochenzeitung (WOZ)<br />
Nr. 18, 03.05.2013,<br />
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.forumcivique.org/sites/<strong>de</strong>fault/files/WOZ1813SE0910.pdf;<br />
Derichsweiler, C. (2013) Das «Plastic-Meer» von Almería - Eine Welt unter Folie, Neue Zürcher Zeitung 15.05.2013,<br />
http://www.nzz.ch/aktuell/international/uebersicht/eine-welt-unter-folie-1.18081276#<br />
26
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
4. Fazit<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Studie konnte gezeigt wer<strong>de</strong>n, dass die konventionelle Lebensmittelproduktion<br />
eine Reihe von Kosten zur Folge hat, die nicht im tatsächlichen La<strong>de</strong>npreis enthalten sind. Der<br />
Verbraucher zahlt sie indirekt o<strong>de</strong>r die Kosten wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Gesellschaft <strong>de</strong>s Erzeugerlan<strong>de</strong>s<br />
getragen. Ebenso entstehen Gesundheitskosten durch ungesun<strong>de</strong> Ernährungsweisen, wie unter<br />
an<strong>de</strong>rem ein zu hoher Fleischkonsum. Diese Kosten sind nicht niedrig. Konservativ geschätzt entstehen<br />
in Deutschland ca. 138 Euro pro Person und Jahr für Gesundheitskosten zur Behandlung<br />
von ernährungsbedingten Krankheiten, sowie ca. 30 bis 100 Euro pro Person und Jahr für externe<br />
Kosten als Folge von nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktionsmetho<strong>de</strong>n.<br />
Aus gesundheitlichen Grün<strong>de</strong>n und unter Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet ist ein<strong>de</strong>utig zu<br />
empfehlen, sich nach <strong>de</strong>n Richtlinien <strong>de</strong>r DGE zu ernähren und auf fair gehan<strong>de</strong>lte und/o<strong>de</strong>r<br />
Produkte aus biologischem Anbau zurückzugreifen. Dies muss nicht teuer sein. Beim Rückgriff auf<br />
saisonale und regionale Produkte entstehen Mehrkosten im Vergleich zur durchschnittlichen<br />
Ernährung mit konventionell produzierten Lebensmitteln in einer Größenordnung von weniger als<br />
10 %. Achte ich auf <strong>de</strong>n Geldbeutel und verzichte auf Produkte, wie bestimmte Spezialitäten, die in<br />
Bio-Qualität doch <strong>de</strong>utlich mehr kosten als konventionelle Vergleichsprodukte, können die Mehrkosten<br />
noch bis auf weniger als 5 % gesenkt wer<strong>de</strong>n. Das entspricht bei einem Kalorienverbrauch<br />
von 2.000 kcal pro Tag ca. 80 Euro pro Person und Jahr.<br />
Aus agrarpolitischer Sicht unterstützen die Ergebnisse dieser Studie die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Sachverständigenrats<br />
für Umweltfragen (SRU), von Umweltverbän<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft für<br />
bäuerliche Landwirtschaft e.V.: In <strong>de</strong>n nächsten Jahren soll eine <strong>de</strong>utlich höhere Umschichtung für<br />
Leistungen im Umwelt- und Tierschutz von Bauern von <strong>de</strong>n allgemeinen Direktzahlungen <strong>de</strong>r EU<br />
erfolgen, wie bislang im kürzlich verabschie<strong>de</strong>ten Gesetzentwurf zur Umsetzung <strong>de</strong>r EU-Agrarreform<br />
vorgesehen. Der bereits verabschie<strong>de</strong>te Gesetzentwurf sieht <strong>de</strong>rzeit nur eine Umschichtung<br />
von 4,5 % vor. Die EU-Agrarreform gibt jedoch einen Spielraum von bis zu 15 %. Auch <strong>de</strong>r<br />
erlaubte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beim Anbau von Hülsenfrüchtlern wie Futtererbsen,<br />
Soja etc. auf ökologischen Vorrangflächen kann nicht befürwortet wer<strong>de</strong>n. Wichtig sind weiterhin<br />
verbesserte Regelungen zum Erhalt von Dauergrünland.<br />
Aus klimapolitischer Sicht ist eine Reduktion <strong>de</strong>s Konsums von Fleisch von Wie<strong>de</strong>rkäuern und vor<br />
allem <strong>de</strong>s Anbaus von Futtermitteln auf Ackerflächen einzuleiten und umzusetzen. Dies gilt auch<br />
für die Sicherung <strong>de</strong>r Welternährung. Empfehlungen zum Fleischkonsum sind jedoch gesellschaftlich<br />
stark umstritten und brisant, möglicherweise, weil viele damit die For<strong>de</strong>rung nach einem<br />
kompletten Verzicht auf Fleisch verbin<strong>de</strong>n. Es gibt jedoch eine Reihe von genannten Grün<strong>de</strong>n, die<br />
keineswegs für einen generellen Verzicht auf Fleisch plädieren (s. Kasten zum Thema „Fleischkonsum“).<br />
Eine Reduktion <strong>de</strong>s Fleischkonsums, verbun<strong>de</strong>n mit einem Umstieg auf hochwertiges<br />
Fleisch aus nachhaltiger, tier- und naturverträglicher Erzeugung sollte erklärtes politisches Ziel im<br />
Rahmen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Nachhaltigkeitsstrategie sein. Wie dieses Ziel erreicht wer<strong>de</strong>n kann, sollte<br />
Inhalt einer sorgfältigen inter- und transdisziplinär angelegten Studie sein.<br />
Weiterhin bleibt wichtig, in die Weiterentwicklung und Optimierung von umweltverträglichen Landbewirtschaftungsformen<br />
zu investieren, ebenso wie in die Analyse von Hemmnissen bei <strong>de</strong>r Vermarktung<br />
nachhaltig produzierter Lebensmittel. Derzeit gibt es hierfür das von <strong>de</strong>n Grünen ins<br />
Leben gerufene „Bun<strong>de</strong>sprogramm Ökologischer Landbau und an<strong>de</strong>re Formen nachhaltiger Landwirtschaft“.<br />
Dieses Programm sollte unbedingt aufrechterhalten und gegebenenfalls sogar ausgebaut<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
27
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Literaturverzeichnis<br />
AID 2012<br />
Benning et al. 2011<br />
Biesalski & Grimm 2011<br />
Blom 2007<br />
BMBF 2013<br />
BMELV 2013<br />
aid. Die aid-Ernährungspyrami<strong>de</strong> Richtig essen lehren und lernen. 5. Auflage.<br />
2012. ISBN/EAN 978-3-8308-1008-7<br />
Benning, R; <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>, C. / BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland<br />
e.V. Subventionen für die industrielle Fleischerzeugung in Deutschland<br />
- BUND-Recherche zur staatlichen För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Schweine- und Geflügelproduktion<br />
in <strong>de</strong>n Jahren 2008 und 2009. Berlin 2011.<br />
Biesalski, H. K.; Grimm, P. Taschenatlas <strong>de</strong>r Ernährung. 5.Auflage. Thieme<br />
Verlag. Stuttgart. 2011<br />
Blom, J. v. d. Control <strong>de</strong> plagas en hortícolas protegidas: Almería, el año <strong>de</strong><br />
la transición. Horticultura XXV[200], 36-42. 2-6-2007.<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Herz-Kreislauf-<br />
Forschung. http://www.gesundheitsforschung-bmbf.<strong>de</strong>/<strong>de</strong>/133.php. Seite<br />
abgerufen am 09.10.2013.<br />
Bun<strong>de</strong>sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
(BMELV). Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur GAP.<br />
http://www.bmelv.<strong>de</strong>/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Agrarpolitik<br />
/GAP-FAQs.html, Seite abgerufen am 11.10.2013.<br />
BMU/UBA 2010 Wasserwirtschaft in Deutschland – Teil 2. Bun<strong>de</strong>sumweltministerium /<br />
Umweltbun<strong>de</strong>samt, 2010.<br />
http://www.umweltbun<strong>de</strong>samt.<strong>de</strong>/sites/<strong>de</strong>fault/files/medien/378/publikationen<br />
/wawi_teil_02_<strong>2014</strong>.pdf<br />
Bonakdar 2008<br />
BVL 2013<br />
Campiglia et al. 2007<br />
Can<strong>de</strong>la et al. 2008<br />
DAG 2013<br />
Bonakdar, M.; Tagesschau. Ziele und Empfänger <strong>de</strong>r EU-Agrarsubventionen.<br />
http://www.tagesschau.<strong>de</strong>/wirtschaft/faqsubventionen100.html,<br />
Seite abgerufen am 14.10.2013.<br />
Zweite Datenerhebung zur Antibiotikaabgabe in <strong>de</strong>r Tiermedizin. Presseund<br />
Hintergrundinformationen. Bun<strong>de</strong>samt für Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit, 2013.<br />
http://www.bvl.bund.<strong>de</strong>/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Pres<br />
se_und_Hintergrundinformationen/05_Tierarzneimittel/2013/2013_11_11_pi<br />
_Abgabemengen.html<br />
Campiglia, E.; Colla, G.; Mancinelli, R.; Rouphael, Y.; Marucci, A.; Energy<br />
Balance of Chorticulturae 747, 2007, 185-191.<br />
Can<strong>de</strong>la L.; Domingo F.; Berbel J.; Alarcón J.J.; An overview of t e main<br />
water conflicts in Spain : proposals for problem solving. In: El Moujabber M.<br />
(ed.); Shatanawi M. (ed.); Trisorio-Liuzzi G. (ed.); Ouessar M. (ed.);<br />
Laureano P. (ed.); Rodríguez R. (ed.); Water culture and water conflict in the<br />
Mediterranean area. Bari: CIHEAM, 2008. p. 197-203 (Options Méditerranéennes:<br />
Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 83)<br />
Deutsche Adipositas-Gesellschaft e.V. (DAG). Kosten <strong>de</strong>r Adipositas in<br />
Deutschland. http://www.adipositas-gesellschaft.<strong>de</strong>/in<strong>de</strong>x.php?id=8.<br />
Seite abgerufen am 09.10.2013.<br />
28
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
DAK-Gesundheit 2013<br />
DDS 2013<br />
Drewes et al. 2013<br />
Eberle et al. 2005<br />
XXL-Patienten – Kostenexplosion bei Magen-Operationen für Übergewichtige.<br />
Statistik <strong>de</strong>r DAK-Gesundheit – Ausgaben seit 2008 fast verdoppelt.<br />
http://www.dak.<strong>de</strong>/dak/download/Pressemitteilung_XXL-Patienten-<br />
1319654.pdf. Abgerufen am 22.04.<strong>2014</strong>.<br />
Deutsche Diabetes-Stiftung (DDS). Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes<br />
2011.<br />
http://diabetesstiftung.<strong>de</strong>/fileadmin/dds_user/dokumente/Gesundheitsbericht<br />
_2011.pdf. Seite abgerufen am 09.10.2013.<br />
Drewes, D.; Jungert, A. 2,6 Millionen für Südzucker.<br />
http://www.morgenweb.<strong>de</strong>/nachrichten/wirtschaft/2-6-millionen-fursudzucker-1.563931,<br />
Seite abgerufen am 11.10.2013.<br />
Eberle, U.; Fritsche, U.; Hünecke, K.; Teufel, J.; Wiegmann, K.; Ernährungswen<strong>de</strong><br />
– Strategien für sozial-ökologische Transformationen im gesellschaftlichen<br />
Handlungsfeld Umwelt-Ernährung-Gesundheit. Öko-Institut e.V. in<br />
Kooperation mit Institut für sozial-ökologische Forschung GmbH (ISOE);<br />
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW); KATALYSE Institut;<br />
2005<br />
Europäische Kommission 2013 Europäische Kommission. Wieviel kostet die GAP <strong>de</strong>n Steuerzahler?<br />
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_<strong>de</strong>.htm<br />
Seite abgerufen am 26.11.2013.<br />
Gizinski et al. 2013<br />
Gizinski, M.; Mondial, S. Team Recherche macht Agrarsubventionen einsehbar.<br />
http://www.ndr.<strong>de</strong>/fernsehen/agrarsubventionen105.html,<br />
Seite abgerufen am 11.10.2013.<br />
Institut für angewandte Verbraucherforschung 2001 Institut für angewandte Verbraucherforschung e.V.<br />
Verbraucherverhalten beim Lebensmittelkauf. Köln. 2001.<br />
Koerber & Kretschmer 2001<br />
Koerber et al. 2009<br />
Koerber, K. von; Kretschmer, J.; Die Preise von Bio-Lebensmitteln als Hür<strong>de</strong><br />
bei <strong>de</strong>r Agrar- und Konsumwen<strong>de</strong>. Aid Ernährung im Fokus, 11/01, 278-282.<br />
Koerber, K. v.; Kretschmer, J.; Prinz, S.; Dasch, E. Globale Nahrungssicherung<br />
für eine wachsen<strong>de</strong> Weltbevölkerung – Flächenbedarf und Klimarelevanz<br />
sich wan<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>r Ernährungsgewohnheiten. J. Verbr. Lebensm. 4,<br />
174-189. 2009.<br />
Kramer et al. 1994 Kramer, P.; Männle, T.; Schaffner, J. Landwirtschaft und Ernährung –<br />
Verän<strong>de</strong>rungsten<strong>de</strong>nzen im Ernährungssystem und klimatische Relevanz.<br />
Band 1, Teilband 2. Bonn, Economica Verlag, 189 Seiten. 1994.<br />
LWK 2013<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong>de</strong>rsachsen (LWK). Direktzahlungen: Agrarreform<br />
<strong>2014</strong> – 2020.<br />
http://www.lwknie<strong>de</strong>rsachsen.<strong>de</strong>/in<strong>de</strong>x.cfm/portal/6/nav/360/article/17887.html,<br />
Seite abgerufen<br />
am 27.11.2013.<br />
Mensink et al. 2013 Mensink, G.B.M.; Schlenklewitz, A.; Haftenberger, M.; Lampert, T.; Ziese, T.<br />
et al. Übergewicht und Adipositas in Deutschland – Ergebnisse <strong>de</strong>r Studie<br />
zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1); Bun<strong>de</strong>sgesundheitsblatt<br />
2013, Springer Verlag Hei<strong>de</strong>lberg, 2013. Abgerufen am<br />
22.04.2013:<br />
http://edoc.rki.<strong>de</strong>/oa/articles/rec5I0tIFMfd2/PDF/23JuqX9byg62Q.pdf<br />
29
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Mertens et al. 2008<br />
MIMAM 2003<br />
Mostova 2012<br />
Na Presseportal 2013<br />
Öko-Institut e.V. 2000<br />
Pretty et al. 2000<br />
Quack et al. 2007<br />
Sassi 2010<br />
Scha<strong>de</strong>r et al. 2013<br />
Mertens, E.; Schnei<strong>de</strong>r, K.; Claupein, E.; Spiller, A.; Hoffmann, I.; Lebensmittelkosten<br />
bei verschie<strong>de</strong>nen Ernährungsweisen. Vergleich einer üblichen<br />
Lebensmittelauswahl mit einer Lebensmittelauswahl entsprechend Empfehlungen<br />
zur Prävention ernährungsbedingter Krankheiten. Ernährungs Umschau,<br />
3, 139-148.<br />
MIMAM (Ministerio <strong>de</strong>l Medio ambiente). Water in Spain (White Paper on<br />
Water in Spain). I.S.B.N. 84-8320-219-0, 607 pp. 2003<br />
Mostova, I. Adipositas – eine Krankheit mit kostspieligen Folgen: Konzepte<br />
und Probleme <strong>de</strong>r gängigen Therapieansätze. Projektarbeit Universität Köln.<br />
http://www.hausarbeiten.<strong>de</strong>/faecher/vorschau/190707.html<br />
Na Presseportal. EU-Agrarbudget - Merkel schwächt ländliche Entwicklung<br />
in Deutschland.<br />
http://www.presseportal.<strong>de</strong>/pm/58356/2488339/eu-agrarbudget-merkelschwaecht-laendliche-entwicklung-in-<strong>de</strong>utschland,<br />
Seite abgerufen am<br />
11.10.2013.<br />
Globalisierung in <strong>de</strong>r Speisekammer: Auf <strong>de</strong>r Suche nach einer nachhaltigen<br />
Ernährung, Band 1: Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung im Bedürfnisfeld<br />
Ernährung. Freiburg 2000<br />
Pretty ,J.N.; Brett, C.; Gee,D.; Hine, R.E.; Mason, C.F.; Morison, J.I.L.;<br />
Raven, H.; Rayment, M.D.; van <strong>de</strong>r Bijl, G.: An assessment of the total<br />
external costs of UK agriculture. Agricultural Systems 65: 2, pp. 113-136.<br />
Quack et al. 2007. Stoffstromanalyse relevanter Produktgruppen. Energieund<br />
Stoffströme <strong>de</strong>r privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2005.<br />
Teilprojekt „EcoTopTen – Innovationen für einen nachhaltigen Konsum<br />
(Hauptphase)". 2007.<br />
Sassi, F.; OECD (Hrsg.). Obesity and the economics of prevention. ISBN:<br />
978-92-64-06367-9, 2010.<br />
Scha<strong>de</strong>r, C.; Petrasek, R.; Lin<strong>de</strong>nthal, T.; Weisshaidinger, R.; Müller, W.;<br />
Müller, A.; Niggli, U.; Stolze, M.: Volkswirtschaftlicher Nutzen <strong>de</strong>r Bio-<br />
Landwirtschaft für Österreich Beitrag <strong>de</strong>r biologischen Landwirtschaft zur<br />
Reduktion <strong>de</strong>r externen Kosten <strong>de</strong>r Landwirtschaft Österreichs. FiBL<br />
Schweiz. 26. November 2013, Frick, Wien.<br />
Statistisches Bun<strong>de</strong>samt 2012 Statistisches Jahrbuch,<br />
https://www.<strong>de</strong>statis.<strong>de</strong>/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Statistische<br />
sJahrbuch2012.pdf?__blob=publicationFile, Seite abgerufen am 09.10.2013.<br />
Statistisches Bun<strong>de</strong>samt 2013 Statistisches Bun<strong>de</strong>samt. Krankheitskosten: Deutschland, Jahre, Krankheitsdiagnosen<br />
(ICD10) https://wwwgenesis.<strong>de</strong>statis.<strong>de</strong>/genesis/online;jsessionid=5B322C42432FAC061681E07<br />
40CC58A12.tomcat_GO_1_1?operation=previous&levelin<strong>de</strong>x=2&levelid=13<br />
98173376446&step=2. Abgerufen am 22.04.<strong>2014</strong>.<br />
Taylor 2000<br />
Taylor, C.; Ökologische Bewertung von Ernährungsweisen anhand ausgewählter<br />
Indikatoren, Dissertation am Fachbereich Agrarwissenschaften,<br />
Ökotrophologie und Umweltmanagement <strong>de</strong>r Justus-Liebig-Universität<br />
Gießen 2000.<br />
30
Ist gutes Essen wirklich teuer?<br />
Teufel et al. 2011<br />
Theurl 2008<br />
UBA/VZBV <strong>2014</strong><br />
Umweltbun<strong>de</strong>samt 2010<br />
Teufel, J.; Brommer, E.; Gattermann, M.; Stratmann, B.; Grobscreening zur<br />
Typisierung von Produktgruppen im Lebensmittelbereich in Orientierung am<br />
zu erwarten<strong>de</strong>n CO2e-Fußabdruck. LANUV-Fachbericht Nr. 29. Studie für<br />
das Lan<strong>de</strong>samt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, 2011. zum<br />
download abrufbar unter<br />
http://www.lanuv.nrw.<strong>de</strong>/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe29/fabe29start<br />
.htm<br />
CO2-Bilanz <strong>de</strong>r Tomatenproduktion: Analyse acht verschie<strong>de</strong>ner Produktionssysteme<br />
in Österreich, Spanien und Italien. Social Ecology Working<br />
Paper 110, Wien, Dezember 2008<br />
Für umweltfreundlichere Lebensmittel - Handlungsempfehlungen <strong>de</strong>s<br />
Verbraucherzentrale Bun<strong>de</strong>sverbands und <strong>de</strong>s Umweltbun<strong>de</strong>samts<br />
http://www.umweltbun<strong>de</strong>samt.<strong>de</strong>/sites/<strong>de</strong>fault/files/medien/378/dokumente/fu<br />
er_umweltfreundlichere_lebensmittel_handlungsempfehlungen_uba_vzbv.p<br />
df<br />
Wasserwirtschaft in Deutschland, Teil 1 – Grundlagen. Umweltbun<strong>de</strong>samt,<br />
2010.<br />
http://www.umweltbun<strong>de</strong>samt.<strong>de</strong>/sites/<strong>de</strong>fault/files/medien/419/publikationen<br />
/wasserwirtschaft-grundlagen.pdf<br />
Umweltbun<strong>de</strong>samt 2012 Ökonomische Bewertung von Umweltschä<strong>de</strong>n – Metho<strong>de</strong>nkonvention 2.0<br />
zur Schätzung von Umweltkosten.<br />
van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong>n (2004) van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong>n, N. J. A., Janse, J., Kaarsemaker, R. C., Maaswinkel, R. H.<br />
M. 2004. Duurzaamheid van vruchtgroenten in Spanje; proeve van monitoring.<br />
Den Haag, LEI.<br />
31