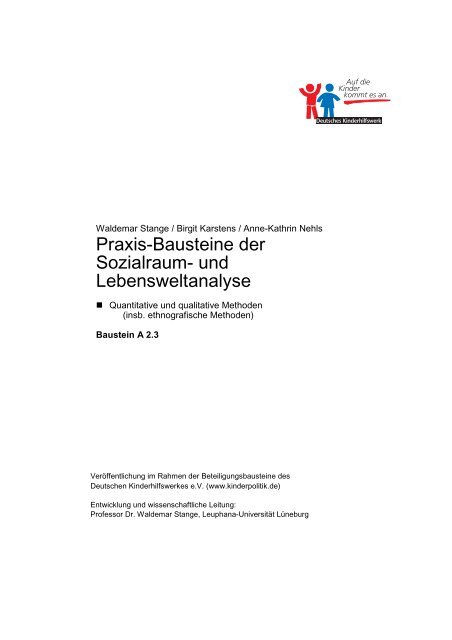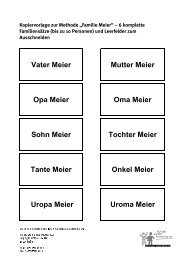Praxis-Bausteine der Sozialraum- und Lebensweltanalyse
Praxis-Bausteine der Sozialraum- und Lebensweltanalyse
Praxis-Bausteine der Sozialraum- und Lebensweltanalyse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Waldemar Stange / Birgit Karstens / Anne-Kathrin Nehls<br />
<strong>Praxis</strong>-<strong>Bausteine</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Lebensweltanalyse</strong><br />
� Quantitative <strong>und</strong> qualitative Methoden<br />
(insb. ethnografische Methoden)<br />
Baustein A 2.3<br />
Veröffentlichung im Rahmen <strong>der</strong> Beteiligungsbausteine des<br />
Deutschen Kin<strong>der</strong>hilfswerkes e.V. (www.kin<strong>der</strong>politik.de)<br />
Entwicklung <strong>und</strong> wissenschaftliche Leitung:<br />
Professor Dr. Waldemar Stange, Leuphana-Universität Lüneburg
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Überblick ...........................................................................................................3<br />
2. <strong>Praxis</strong>-Baustein 1: Sozialstrukturanalyse..........................................................3<br />
2.1 Zielsetzung <strong>und</strong> Notwendigkeit einer Sozialstrukturanalyse ......................3<br />
2.2 Aufbau <strong>und</strong> Methode <strong>der</strong> Datenermittlung..................................................6<br />
2.3 Exemplarische Darstellung möglicher Indikatoren für eine<br />
Sozialstrukturanalyse .................................................................................6<br />
2.4 Möglichkeiten für ein vereinfachtes Vorgehen............................................9<br />
3. <strong>Praxis</strong>-Baustein 2: Quantitative Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendbefragungen..................11<br />
3.1 Der Fragebogen........................................................................................11<br />
3.2 Möglichkeiten für ein vereinfachtes Vorgehen..........................................13<br />
4. <strong>Praxis</strong>baustein 3: Qualitative Verfahren <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Lebensweltanalyse</strong> .........................................................................................14<br />
4.1 Definition <strong>und</strong> Begrifflichkeiten .................................................................14<br />
4.2 Ethnografie <strong>und</strong> Jugendarbeit ..................................................................15<br />
4.3 Qualitative Methoden – ein exemplarischer Überblick .............................17<br />
4.3.1 Strukturierte <strong>Sozialraum</strong>begehung ..................................................17<br />
4.3.2 Teilnehmende Beobachtung............................................................18<br />
4.3.3 Befragung an Kommunikations- <strong>und</strong> Dialogwänden .......................20<br />
4.3.4 Nadelmethode .................................................................................21<br />
4.3.5 Cliquen-Kataster / Jugendkulturen-Kataster (mit ergänzendem<br />
Gruppeninterview) ...........................................................................22<br />
4.3.6 Fremdbild-Erk<strong>und</strong>ung ......................................................................24<br />
4.3.7 Leitfadeninterview mit Schlüsselpersonen ......................................25<br />
4.3.8 Gruppeninterview.............................................................................26<br />
4.3.9 Subjektive Landkarte .......................................................................28<br />
4.3.10 Weitere Methoden ........................................................................30<br />
4.3.11 Zur strategischen Einbindung <strong>der</strong> qualitativen, insb. <strong>der</strong><br />
ethnografischen Methoden ..............................................................30<br />
5. Die Auswertung von qualitativ gewonnenem Wissen.....................................31<br />
6. Möglichkeiten für ein vereinfachtes Vorgehen................................................34<br />
7. Zusammenfassung..........................................................................................35<br />
8. Literatur ...........................................................................................................37<br />
2
1. Überblick<br />
<strong>Praxis</strong>-<strong>Bausteine</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong><br />
1. Sozialstrukturanalyse<br />
In diesem <strong>Praxis</strong>-Baustein wird begründet, warum das Ermitteln sozialstruktureller<br />
Informationen für die Jugendhilfeplanung einer Gemeinde bzw. eines Stadtteils eine<br />
bedeutsame Gr<strong>und</strong>lage darstellt <strong>und</strong> notwendig ist. Der Stellenwert <strong>und</strong> die Ziele einer<br />
solchen Sozialstrukturanalyse werden aufgezeigt <strong>und</strong> die möglichen Quellen <strong>der</strong><br />
Datengewinnung genannt. Die Indikatoren für eine <strong>Sozialraum</strong>beschreibung werden<br />
durch <strong>Praxis</strong>-Tipps näher beleuchtet. Und schließlich werden Hinweise auf<br />
Vereinfachungen bei <strong>der</strong> Ermittlung benötigter Daten sowie für eine unaufwändigere<br />
Form <strong>der</strong> Sozialstrukturanalyse gegeben.<br />
2. Quantitative Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendbefragung (Fragbögen)<br />
Der Fragebogen wird als effektives Instrument zur quantitativen Erfassung sozialer<br />
Daten besprochen. Der Leser findet kurze Hinweise, was es beim sorgfältigen<br />
Entwickeln einsatzfähiger Fragebögen zu beachten gilt. Auch Möglichkeiten für eine<br />
„abgespeckte“, einfachere Variante <strong>der</strong> Datengewinnung werden aufgezeigt.<br />
3. Qualitative Methoden<br />
Nach einer Klärung des Begriffs qualitativ werden die Gr<strong>und</strong>züge von qualitativen<br />
Untersuchungen im Unterschied zu den quantitativen beschrieben. Ebenso wird auf Beson<strong>der</strong>heiten<br />
– vor allem die Vorzüge <strong>und</strong> Nachteile dieser methodischen Herangehensweise<br />
– eingegangen. Die Entstehung <strong>der</strong> ethnografischen Methoden <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendarbeit wird geschil<strong>der</strong>t <strong>und</strong> die Parallele zur qualitativen <strong>Sozialraum</strong>analyse<br />
gezogen. Schließlich werden dem Leser exemplarisch bewährte methodische Elemente<br />
zur qualitativen Untersuchung von Sozialräumen bzw. Lebenswelten ausführlich näher<br />
gebracht. Es werden auch praxisrelevante Vorschläge für ein vereinfachtes, schnelleres<br />
Vorgehen unterbreitet <strong>und</strong> abschließend noch einmal die Chancen <strong>und</strong> Vorteile von<br />
<strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>n aufgelistet.<br />
2. <strong>Praxis</strong>-Baustein 1: Sozialstrukturanalyse 1<br />
2.1 Zielsetzung <strong>und</strong> Notwendigkeit einer Sozialstrukturanalyse<br />
Wenn man die Lebensbedingungen in einem <strong>Sozialraum</strong> erfassen <strong>und</strong> beschreiben will –<br />
sei es in <strong>der</strong> „großen“ Jugendhilfeplanung o<strong>der</strong> nur bei sozialräumlichen Konzeptentwicklungen<br />
im Stadtteil –, so ist es immer <strong>der</strong> erste Schritt (noch bevor man mit eigenen<br />
Befragungen beginnt), die Lebensverhältnisse im <strong>Sozialraum</strong> über die Sammlung aller<br />
relevanten statistischen Daten zu beschreiben <strong>und</strong> zu analysieren. Das ist in manchen<br />
Fällen <strong>und</strong> für einige Bereiche einfach. So verfügt jede Gemeinde im Allgemeinen über<br />
einen Gr<strong>und</strong>bestand wichtiger Daten des Ortes zur Demografie, zur wirtschaftlichen<br />
Entwicklung, zur Schulsituation usw. In an<strong>der</strong>en Fällen ist dies schwieriger, wenn z. B.<br />
lediglich Daten für die Kreisebene o<strong>der</strong> das gesamtstädtische Gebiet vorhanden sind<br />
1 Auf <strong>der</strong> Basis von Karstens / Nehls 2005.<br />
3
(z. B. über die Jugendhilfefälle). Gut aufgestellte Jugendämter verfügen allerdings über<br />
ausgezeichnete statistische <strong>Sozialraum</strong>beschreibungen für jeden <strong>Sozialraum</strong> <strong>und</strong> schreiben<br />
diese auch regelmäßig fort.<br />
Überlegungen dieser Art werden durch den Begriff <strong>der</strong> Sozialstrukturanalyse erfasst. Die<br />
Sozialstrukturanalyse soll den Stand <strong>und</strong> die Entwicklung von sozialstrukturellen Verhältnissen<br />
des Stadtteils o<strong>der</strong> des Gemeindegebietes ermitteln, um u. A. benachteiligte<br />
<strong>und</strong> somit problemanfällige soziale Lebenslagen differenziert erfassen zu können. Sie<br />
zeigt die objektiven Rahmenbedingungen individueller Lebensgestaltung auf. Durch sie<br />
ist es möglich, die demografische <strong>und</strong> wirtschaftliche Entwicklung <strong>und</strong> ihre sozialen<br />
Auswirkungen in die Analyse einzubeziehen (z. B. Mobilität, Wohnraumnot, Verkehr).<br />
Sie gibt den Planern auch Auskunft über soziale <strong>und</strong> infrastrukturelle Verän<strong>der</strong>ungen<br />
einer Region (im Vergleich). Durch sie erhält man Einblicke <strong>und</strong> Einschätzungen über<br />
verän<strong>der</strong>te Lebenslagen von Kin<strong>der</strong>n, Jugendlichen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Familien. Nach § 80 Abs.<br />
2 SGB VIII sollen Einrichtungen <strong>und</strong> Dienste so geplant werden, dass junge Menschen<br />
<strong>und</strong> Familien in gefährdeten Lebens- <strong>und</strong> Wohnbereichen beson<strong>der</strong>s geför<strong>der</strong>t werden.<br />
Die kleinräumige Datenerhebung durch eine Sozialstrukturanalyse, bei <strong>der</strong> nicht ausschließlich<br />
jugendspezifische Daten erfasst werden, gibt Hinweise auf unversorgte<br />
Gebiete bzw. Zielgruppen<br />
Dieses sozialräumlich erhobene Datenpaket ist nicht nur wichtig, um daraus Folgerungen<br />
für die weitere Entwicklung <strong>der</strong> Jugendhilfe auf <strong>der</strong> gesamtplanerischen Ebene <strong>der</strong><br />
kreisfreien Stadt o<strong>der</strong> des Landkreises abzuleiten (z. B. in Bezug auf den Einsatz<br />
finanzieller Mittel, Personalkapazitäten <strong>und</strong> sonstiger Ressourcen in den einzelnen<br />
Sozialräumen aufgr<strong>und</strong> eines Vergleichs). Es kann auch entscheidende Planungsdaten<br />
unterhalb dieser Ebene, also für den <strong>Sozialraum</strong>, enthalten – für die jeweils Zuständigen<br />
im Stadtteil (Bezirksrat, <strong>Sozialraum</strong>konferenz, Bezirkssozialarbeit usw.) wie auch für die<br />
Einrichtungen, Organisationen, Vereine im Stadtteil, die mit eigenen Mitteln <strong>und</strong> Kompetenzen<br />
unabhängig von <strong>der</strong> Stadt- o<strong>der</strong> Kreisebene aktiv sind.<br />
Eine <strong>Sozialraum</strong>beschreibung auf dem Hintergr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Sozialstrukturanalyse sollte den<br />
Handlungsprinzipien Lebensweltorientierung, Lebenslagenorientierung <strong>und</strong> Alltagsorien-tierung<br />
<strong>der</strong> Jugendhilfe folgen <strong>und</strong> dazu dienen, die Einzelgemeinde o<strong>der</strong> den<br />
Stadtteil – eben den <strong>Sozialraum</strong> – zu charakterisieren <strong>und</strong> einen transparenten Überblick<br />
über die Lebensräume <strong>und</strong> die Lebensverhältnisse im Planungsgebiet zu vermitteln.<br />
„Jugendhilfe, die ihre Adressaten in ihrer jeweils konkreten Lebenswelt erreichen will,<br />
muss zunächst möglichst differenzierte Informationen zur Beschreibung <strong>und</strong> Analyse <strong>der</strong><br />
konkreten Lebensverhältnisse <strong>und</strong> Lebenslagen zusammentragen <strong>und</strong> interpretieren“<br />
(Lukas / Strack 1996, S. 31).<br />
Die <strong>der</strong>zeit üblichen <strong>Sozialraum</strong>beschreibungen konzentrieren sich im Allgemeinen<br />
zunächst einmal auf rein statistische Daten <strong>und</strong> Fallzahlen zu den Leistungen <strong>der</strong> Jugendhilfe,<br />
wie sie in <strong>der</strong> Jugendhilfeplanung erhoben werden.<br />
Die Sozialstrukturanalyse stellt den ersten Schritt für eine bedarfs- <strong>und</strong> problemorientierte<br />
Jugendhilfeplanung (aber auch für einfache Stadtteilplanungen) dar. Hierbei<br />
ist keine flächendeckende, son<strong>der</strong>n eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur <strong>der</strong> Jugendhilfe<br />
zu entwickeln (Dezentralisierung / Regionalisierung; Zimmermann 2002, S. 25).<br />
Eine Sozialstrukturanalyse muss regelmäßig fortgeschrieben werden. Durch eine neue<br />
4
<strong>und</strong> damit aktuellere Datenlage lassen sich zeitliche Verän<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Entwicklungen<br />
erfassen bzw. aktuelle Trends aufzeigen <strong>und</strong> mit den eingesetzten Maßnahmen in Beziehung<br />
bringen (Erfolgskontrolle). „Durch die Fortschreibung <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>analyse<br />
können darüber hinaus kleinräumig Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Bevölkerung nachgezeichnet<br />
werden, z. B. sozialer Auf- <strong>und</strong> Abstieg, ‚Jugendlichkeit’ des Viertels, Lebensformen<br />
<strong>und</strong> Familienstatus o<strong>der</strong> die Zu- <strong>und</strong> Abwan<strong>der</strong>ung von deutschen <strong>und</strong> nichtdeutschen<br />
Bewohnern“ (Riege / Schubert 2005, S. 241). Dieses ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen<br />
von Verän<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> ein rechtzeitiges Reagieren.<br />
Allerdings sind mit solchen Daten die subjektiven Lebenswelten von Kin<strong>der</strong>n, Jugendlichen,<br />
jungen Erwachsenen <strong>und</strong> Familien nicht zu erfassen. Die Antworten auf diesen<br />
Aspekt wird eine Sozialstrukturanalyse alleine nicht liefern können. Man benötigt also<br />
nicht nur Aussagen über die statistisch erfassten objektiven Lebensbedingungen, Defizitlagen<br />
<strong>und</strong> die von diesen Zahlen her erschlossenen Bedarfsstrukturen von Kin<strong>der</strong>n,<br />
Jugendlichen, jungen Erwachsenen <strong>und</strong> Familien. Um aus relevanten Merkmalen <strong>der</strong><br />
Zielgruppen mögliche Handlungsstrategien überzeugend ableiten zu können <strong>und</strong><br />
konkrete Sozialisationsbedürfnisse zu beschreiben, sollten <strong>Sozialraum</strong>beschreibungen<br />
nicht nur auf statistischen Sozialstrukturanalysen beruhen, son<strong>der</strong>n durch qualitative<br />
Lebensweltuntersuchungen ergänzt werden. An<strong>der</strong>s ausgedrückt: Für ein „Gesamtbild“<br />
<strong>der</strong> vielfältigen räumlichen, sozialen <strong>und</strong> institutionellen Bezüge sind neben den sozialstatistischen<br />
Daten, die erste Hinweise liefern, qualitative Untersuchungsmethoden (wie<br />
Teilnehmende Beobachtung, Begehungen, Steifzüge, Interviews u. Ä.), die weiter unten<br />
beschrieben werden (vgl. dazu Abschnitt 4), unerlässlich.<br />
Zusammenfassend lässt sich die Zielsetzung <strong>der</strong> Sozialstrukturanalyse (sowohl für die<br />
Jugendhilfeplanung wie auch für einfachere Projekte aus dem Stadtteil heraus), wie in<br />
<strong>der</strong> nachfolgenden Grafik versucht, darstellen:<br />
5
Diskussionsgr<strong>und</strong>lage<br />
(Politik, freie Träger,<br />
Öffentlichkeit,<br />
Verwaltung)<br />
Handlungsbedarfe<br />
verdeutlichen<br />
Datengr<strong>und</strong>lage<br />
Sozialstrukturanalyse<br />
Verän<strong>der</strong>ungen<br />
aufzeigen<br />
Grafik 1: Zielsetzung von Sozialstrukturanalysen<br />
(Quelle: Landkreis Rosenheim 2003, S. 11)<br />
Es muss betont werden, dass nicht <strong>der</strong> jeweils einzelne Indikator Gr<strong>und</strong>lage für die Entwicklung<br />
von Maßnahmen vor Ort sein kann. Nur die Zusammenschau aller Indikatoren<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong>en Bewertung auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Gemeinden kann zu gesicherten Erkenntnissen<br />
<strong>und</strong> zur Entwicklung von (Jugendhilfe-)Maßnahmen führen.<br />
2.2 Aufbau <strong>und</strong> Methode <strong>der</strong> Datenermittlung<br />
Die Verfügbarkeit von Daten zur Sozialstruktur für einzelne Gemeinden o<strong>der</strong> Stadtteile<br />
(also Sozialräume) ist sehr unterschiedlich. Einerseits können Daten durch das (Kreis-)<br />
Jugendamt abgerufen werden (z. B. Jugendhilfedaten), an<strong>der</strong>erseits auch vom Landesamt<br />
für Statistik 2 , <strong>der</strong> Agentur für Arbeit (allgemeine Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit),<br />
den Sozialämtern in Stadt <strong>und</strong> Landkreis, <strong>der</strong> Polizei (Kriminalitätsstatistik) o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Gemeindeverwaltung (z. B. Hilfen zum Lebensunterhalt, Einkommensstrukturdaten).<br />
3<br />
Wie kann man nun anhand <strong>der</strong> in Statistiken verfügbaren Daten <strong>und</strong> Informationen versuchen,<br />
die Sozialstruktur eines untersuchten Gebietes darzustellen?<br />
2.3 Exemplarische Darstellung möglicher Indikatoren für eine<br />
Sozialstrukturanalyse<br />
Gestaltung von<br />
Jugendhilfestrukturen<br />
(Prävention)<br />
Soziale Brennpunkte<br />
identifizieren<br />
Zunächst sollte man einen Katalog kleinräumiger, regelmäßig verfügbarer Daten zur<br />
Beschreibung <strong>der</strong> sozialen Lage im <strong>Sozialraum</strong> erstellen.<br />
2 Z. B. Informationen von den Statistischen Landesämtern, vgl. z. B. die Daten-CD „Statistik Datenbank,<br />
Ausgabe 2004“ vom Nie<strong>der</strong>sächsischen Landesamt für Statistik.<br />
3 Übersichten zu geeigneten Datenquellen geben Jordan / Schone 1999, S.111 ff. <strong>und</strong> S. 350 ff.<br />
6
Diese Auswahl <strong>der</strong> Strukturdaten sollte sich orientieren an <strong>der</strong> gängigen kommunalen<br />
Sozialberichterstattung für den Landkreis o<strong>der</strong> das gesamtstädtische Gebiet. Die Auswahl<br />
kann dann – je nach Zielsetzung <strong>und</strong> Fragestellung – um weitere eigene Kriterien<br />
ergänzt werden, soweit sie als Indikatoren für die soziale Lebensrealität von Kin<strong>der</strong>n,<br />
Jugendlichen <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Familien im <strong>Sozialraum</strong> gelten können. Hierbei ist es wichtig,<br />
die vorhandenen Datenquellen auf ihre Aussagefähigkeit <strong>und</strong> ihre Fehlerhaftigkeit hin zu<br />
überprüfen.<br />
Die sozialstrukturellen Merkmale einer Region können nicht für sich betrachtet werden,<br />
son<strong>der</strong>n müssen mit den Merkmalen an<strong>der</strong>er Räume verglichen werden. Da es keine<br />
allseits wirklich anerkannten Kriterien für „gute“ o<strong>der</strong> „schlechte“ Lebensräume gibt,<br />
greift man hier auf die Mittelwerte <strong>der</strong> Kreise, des Landes o<strong>der</strong> des B<strong>und</strong>es zurück. Die<br />
jeweils erkennbaren Abweichungen können als spezifische Merkmale des untersuchten<br />
Raumes interpretiert <strong>und</strong> als „besser“ o<strong>der</strong> „schlechter“ bewertet werden.<br />
Aussagekräftig sind natürlich vor allem die Mittelwerte von Sozialräumen mit gleicher<br />
Größe, aber vielleicht an<strong>der</strong>en politischen, historischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Traditionen<br />
<strong>und</strong> Zielen. Informationen zu eventuell unterschiedlichen Sozialstrukturen klären viele<br />
jugendhilferelevante Fragestellungen zielgenauer auf <strong>und</strong> ermöglichen erst die guten gemeinwesen-<br />
bzw. sozialräumlich orientierten Konzepte <strong>der</strong> Jugendhilfe (vgl. ISS 1997,<br />
S. 5). „Hier kann die <strong>Sozialraum</strong>analyse wichtige Hinweise auf regionale Disparitäten<br />
<strong>und</strong> entsprechend notwendige dezentrale Standortplanungen, regionale Schwerpunkte<br />
<strong>der</strong> Ressourcenverteilung <strong>und</strong> spezifische Ausgestaltungen von sozialpädagogischen<br />
Angeboten geben“ (ebd.). Letztlich geht es also bei diesem Vergleich um Hinweise auf<br />
Unterversorgungen <strong>und</strong> Benachteiligungen, die dann bei zentralen Mittelzuweisungen<br />
o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Versorgung mit sozialen Diensten in <strong>der</strong> Jugendhilfeplanung zu berücksichtigen<br />
wären.<br />
Ein Beispiel für eine Systematik im Rahmen <strong>der</strong> Sozialstrukturanalyse 4 :<br />
Räumliche Beschaffenheit des kommunalen Umfeldes<br />
Daten zur räumlichen Situation, durch die das räumliche Umfeld charakterisiert werden<br />
kann, in dem Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche aufwachsen:<br />
• äußere Begrenzung <strong>und</strong> Angrenzung<br />
• Gebietsgröße<br />
• tatsächliche Flächennutzung<br />
• Charakter <strong>der</strong> Wohnbebauung<br />
• Verkehrssituation<br />
Bevölkerungsaufbau <strong>und</strong> -entwicklung<br />
Daten zur Bevölkerungsstruktur, die nach Altersgruppen <strong>und</strong> Nationalität unterglie<strong>der</strong>t<br />
sind <strong>und</strong> die Zusammensetzung <strong>der</strong> Bevölkerung des <strong>Sozialraum</strong>s wi<strong>der</strong>spiegeln:<br />
• Altersstruktur <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
• Bevölkerung nach Geschlecht<br />
• Bevölkerungsdichte<br />
4 Siehe Karstens / Nehls 2005, S. 79 f. Weitere Beispiele in Jordan / Schone 1999, 115 ff. <strong>und</strong> 351 ff.<br />
7
• Staatsangehörigkeit <strong>der</strong> Einwohner<br />
• Zahl <strong>der</strong> Lebendgeborenen (Geburtenrate)<br />
• Daten über Zu- <strong>und</strong> Abwan<strong>der</strong>ungen<br />
• Bevölkerungsprognose<br />
Weitere Daten zur sozialen Lage, die Aussagen über die sozioökonomische Situation <strong>der</strong><br />
Bewohner <strong>und</strong> insbeson<strong>der</strong>e über die Lebenschancen von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen im<br />
<strong>Sozialraum</strong> ermöglichen, sind z. B.:<br />
Beschäftigung <strong>und</strong> Einkommen<br />
• Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen<br />
• Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte<br />
• Ein- <strong>und</strong> Auspendler<br />
• Arbeitslosigkeit<br />
• Einkommen <strong>und</strong> Steuereinnahmen<br />
• Haushaltsstrukturdaten<br />
• Sozialhilfe<br />
• Wohngeld<br />
Wohnsituation<br />
• Wohnungsbestand<br />
• Wohnfläche<br />
• Wohnberechtigungsscheine<br />
• Obdachlose <strong>und</strong> Asylbewerber<br />
Familien-Situation<br />
• Familienstand<br />
• Eheschließungen<br />
• Nichtehelich Geborene<br />
• Familiäre Krisen / Ehescheidungen<br />
Situation von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
• Bildungsbeteiligung<br />
• Ausbildungsbeteiligung<br />
• Hilfen zur Erziehung<br />
• Strafverdächtige Min<strong>der</strong>jährige<br />
• Min<strong>der</strong>jährige Opfer von Straftaten<br />
• Jugendgerichtshilfefälle<br />
Kulturelle Situation<br />
• Religiöse Bindung<br />
• Politische Partizipation<br />
Infrastruktur (<strong>und</strong> dafür eingesetzte Haushaltsmittel)<br />
• Spielplätze<br />
• Sportplätze<br />
• Schulen<br />
8
• Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />
• Medizinische Versorgung<br />
• Beratungseinrichtungen<br />
• Kirchen<br />
• Politische Parteien <strong>und</strong> Wählergemeinschaften<br />
• Vereine <strong>und</strong> Verbände<br />
Diese Daten können in einem längeren schriftlichen Bericht zusammengefasst <strong>und</strong><br />
grafisch aufbereitet werden. Das Ergebnis dieser Sozialstrukturanalyse ist – verb<strong>und</strong>en<br />
mit den erhältlichen Jugendhilfedaten – also eine im Wesentlichen statistische <strong>Sozialraum</strong>beschreibung,<br />
über die gut aufgestellte Jugendämter für jeden ihrer Sozialräume<br />
bereits verfügen. Die Darstellung in <strong>der</strong> Form eines Sozialatlasses kommt im Rahmen<br />
einzelner <strong>Sozialraum</strong>analysen nicht so sehr in Frage, da diese Form eher für die parallele<br />
Darstellung mehrerer Sozialräume geeignet ist (z. B. für ein ganzes Stadtgebiet) – es sei<br />
denn, <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong> lässt sich aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Datenlage wie<strong>der</strong>um deutlich unterteilen.<br />
An dieser Stelle ist nochmals daran zu erinnern, dass die kleinräumig verfügbaren statistischen<br />
Daten nicht alle Problemlagen <strong>und</strong> Problemgruppen identifizieren können. Ein<br />
Beispiel hierfür ist die Aussiedlerproblematik 5 . Aussiedler besitzen einen deutschen Pass<br />
<strong>und</strong> sind daher aus <strong>der</strong> Bevölkerungsstatistik kaum „herauszufiltern“. Diese Gruppe von<br />
Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen wird jedoch häufig als eine Gruppe identifiziert, die beson<strong>der</strong>en<br />
Benachteiligungen <strong>und</strong> Problemen bei <strong>der</strong> Integration ausgesetzt ist. Informationen<br />
darüber, wie groß diese Gruppe ist <strong>und</strong> welche Problemlagen für sie charakteristisch<br />
sind, können oft nur mit dem Einsatz qualitativer Methoden erfasst werden.<br />
2.4 Möglichkeiten für ein vereinfachtes Vorgehen<br />
Eine Sozialstrukturanalyse muss nicht immer aufwändig <strong>und</strong> kompliziert sein. Es gibt<br />
auch ganz schlichte, kurze <strong>und</strong> unaufwändige Formen. So sind vielfach die erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Daten bereits vorhanden. Beispiele:<br />
• Eine Gemeinde hat in ihrer Orts-Darstellung (meistens eine repräsentative<br />
Broschüre) bereits alle Daten dokumentiert.<br />
• Es gibt einen Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendbericht <strong>der</strong> Gemeinde.<br />
• Eine Jugendorganisation, ein Verein, eine Kirchengemeinde usw. hat <strong>der</strong>artige<br />
Daten bereits einmal zusammengestellt.<br />
• Ein freier Jugendhilfeträger erhebt regelmäßig solche Daten <strong>und</strong> dokumentiert<br />
sie.<br />
• Der Sozialausschuss des Gemein<strong>der</strong>ates verfügt über solche Daten.<br />
• Es gibt ein schulisches Projekt zur Sozialstrukturanalyse.<br />
• Das Stadtteil-Jugendzentrum hat im Zuge seiner Konzeptionsentwicklung <strong>und</strong><br />
im Rahmen einer Fortbildung schon eine <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> Lebensweltuntersuchung<br />
einschließlich <strong>der</strong> Erhebung <strong>der</strong> Sozialstrukturdaten durchgeführt.<br />
• Im Rahmen <strong>der</strong> Ferienpassaktion werden gemeinsam mit beson<strong>der</strong>s „fitten“<br />
Jugendlichen Elemente <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>analyse erprobt.<br />
5 Diese Problematik gilt im Übrigen zunehmend auch für an<strong>der</strong>e Gruppen mit Migrationshintergr<strong>und</strong>, die<br />
aufgr<strong>und</strong> des geän<strong>der</strong>ten Einbürgerungsrechts zunehmend einen deutschen Pass besitzen, ohne damit jedoch<br />
ihre beson<strong>der</strong>en Problemlagen zwischen zwei Kulturkreisen abgelegt zu haben.<br />
9
• Das Kreis-Jugendamt hat Ortsprofile (<strong>Sozialraum</strong>beschreibungen) erstellt <strong>und</strong><br />
schreibt sie regelmäßig fort.<br />
In allen diesen Fällen wird die Arbeit natürlich erheblich erleichtert. Eine schnelle <strong>und</strong><br />
unaufwändige Sozialstrukturanalyse ist also möglich – auch dann, wenn ergänzend<br />
einige <strong>der</strong> Daten selbst recherchiert o<strong>der</strong> erneuert werden müssen.<br />
Eine zweite Möglichkeit <strong>der</strong> einfachen <strong>und</strong> relativ unaufwändigen Sozialstrukturanalyse<br />
besteht darin, in einem Team, das sich zu diesem Zwecke (<strong>Sozialraum</strong>analyse) zusammenfindet,<br />
leicht zugängliche relevante Daten zu sammeln. Hilfreich sind hier<br />
Checklisten, die den Vorteil haben, bereits eine sinnvolle Struktur vorzugeben. Auf DIN-<br />
A4-Blättern o<strong>der</strong> auf Metaplan-Postern werden die Angaben gesammelt <strong>und</strong> ggf.<br />
Arbeitsaufträge vergeben.<br />
Eine beson<strong>der</strong>s häufige Verwendungssituation für einfache Sozialstrukturanalysen ist es,<br />
wenn ausgewählte Daten gesammelt werden, die nur für eine einzelne soziale Einrichtung<br />
(Schule, Jugendzentrum, Kin<strong>der</strong>tagestätten, Sportverein) im Stadtteil relevant sind.<br />
Konkrete Beispiele für solche einfachen <strong>und</strong> relativ unaufwändigen Sozialstrukturanalysen<br />
in Form einer Checkliste (Sammlung <strong>und</strong> Auswertung statistischer Daten <strong>und</strong><br />
Materialien: Sozialstatistik, soziale Infrastruktur / Bestand – aber auch Hintergr<strong>und</strong>informationen<br />
zum Stadtteil, zu Stadtplanung, Baugeschichte, Sozialgeschichte, zur aktuellen<br />
politischen Situation, zu Problemen etc.) gibt R. Thiersch (2000, S. 11 ff. <strong>und</strong> S. 13 ff.).<br />
Sie zeigt dabei anhand des Kin<strong>der</strong>tagesstätten-Bereichs auch, wie sinnvoll es ist, Checklisten<br />
mit rein einrichtungsbezogenen Daten zu erheben (Thiersch 2000, S. 14 <strong>und</strong> 11<br />
ff.).<br />
Konkret sollte das ganze Team <strong>der</strong> Einrichtung mitarbeiten. Auf Metaplan-Karten o<strong>der</strong><br />
Wandzeitungen wird das gemeinsame Wissen zusammengetragen <strong>und</strong> ggf. bis zu den<br />
nächsten Teamsitzungen ergänzt. Selbstverständlich fließen alle in <strong>der</strong> Einrichtung ohnehin<br />
vorhandenen statistischen Daten in die Analyse ein.<br />
Solche Checklisten lassen sich im Übrigen auch selbst herstellen <strong>und</strong> an die eigene<br />
Situation anpassen.<br />
Eine ganz einfache <strong>und</strong> schnelle Möglichkeit <strong>der</strong> Datengewinnung besteht darin, Experteninterviews<br />
zu führen: Klug ausgewählte, kompetente Interviewpartner produzieren in<br />
kürzester Zeit für die Befrager eine komplette Sozialstrukturanalyse. Im Schneeballsystem<br />
kann man sich „vorwärts hangeln“ zu neuen Experten <strong>und</strong> erhält in kürzester Zeit<br />
ein recht vollständiges Bild.<br />
Eine sehr gute Möglichkeit für einfache <strong>und</strong> unaufwändige Sozialstrukturanalysen ist es,<br />
diese als Auftrag an schulische Projektgruppen in geeigneten Fächern zu vergeben. Aber<br />
auch an Gruppen <strong>der</strong> Jugendverbände, die sich mehr in die Kommunalpolitik einmischen<br />
wollen (z. B. bestimmte Pfadfin<strong>der</strong>gruppen) wäre hier zu denken. Wenn ein Jugendzentrum<br />
über eine längere Zeit eine <strong>Sozialraum</strong>analyse erstellen will, um die eigene<br />
Konzeptionsentwicklung voranzutreiben, kann man dies gut mit partizipativen <strong>Sozialraum</strong>methoden<br />
<strong>und</strong> pädagogischen Aktionen über einen längeren Zeitraum verbinden<br />
(Jugendliche als Forscher). Gewiss sollte man zunächst mit den qualitativen Methoden<br />
beginnen, die den Jugendlichen mehr Spaß machen (Foto-Streifzüge, Videoproduktion<br />
über den Stadtteil, Jugendliche interviewen Jugendliche, Cliquen-Kataster usw.). Aber<br />
10
verpackt in eine Reportage (Interviews von Politik <strong>und</strong> Verwaltung mit Datenerhebung)<br />
o<strong>der</strong> im Rahmen einer öffentlichen Präsentation mit vielen visuellen Elementen („Unser<br />
Stadtteil“) könnten Sozialstrukturdaten plötzlich einen ganz an<strong>der</strong>en Stellenwert gewinnen.<br />
Einfache <strong>und</strong> unaufwändige Sozialstrukturanalysen sollten diesen Charakter auch behalten.<br />
Sonst werden sie gar nicht erst durchgeführt. Dennoch ist auch bei dieser Variante<br />
von zentraler Bedeutung, dass die Daten aufbereitet, geordnet, strukturiert dokumentiert<br />
sowie mit Schussfolgerungen <strong>und</strong> Handlungsempfehlungen versehen werden.<br />
Dies bleibt vom Aufwand her überschaubar, wenn auch dies im Team erfolgt <strong>und</strong> ggf.<br />
Einzelaufträge vergeben werden. Eine sehr geeignete Unterstützungsmaßnahme ist es<br />
immer, wenn solche Analysen im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen einer Einrichtung<br />
o<strong>der</strong> Organisation realisiert werden. Der Vorteil liegt darin, dass <strong>der</strong> Bildungsprozess<br />
an die eigene <strong>Praxis</strong> <strong>und</strong> den eigenen <strong>Sozialraum</strong> angeb<strong>und</strong>en wird <strong>und</strong><br />
zeitneutral ist.<br />
3. <strong>Praxis</strong>-Baustein 2: Quantitative Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendbefragungen 6<br />
3.1 Der Fragebogen<br />
Wie bereits beschrieben haben die Träger <strong>der</strong> öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 80 Abs.<br />
1 KJHG „im Rahmen ihrer Planungsverantwortung … den Bedarf unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Wünsche, Bedürfnisse <strong>und</strong> Interessen <strong>der</strong> jungen Menschen … für einen<br />
mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln ...“. <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>n versuchen<br />
deshalb häufig, die Erk<strong>und</strong>ung von Interessen <strong>und</strong> Wünschen durch Betroffenenbeteiligung<br />
in <strong>der</strong> Form von Fragebögen anzugehen, unter an<strong>der</strong>em auch deshalb, weil<br />
dieser Ansatz – an<strong>der</strong>s als die qualitativen Methoden (die eher auf Probleme aufmerksam<br />
machen, Erklärungen <strong>und</strong> Hypothesen ermöglichen) die Quantifizierung <strong>der</strong> Erhebungsdaten<br />
ermöglicht. Und diese ist für die Ermittlung des genauen Bedarfs <strong>und</strong> <strong>der</strong> damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Planung von Angeboten natürlich sehr wichtig.<br />
Terhart erfasst mit quantitativ-empirischer Forschung Projekte, „die ihre Fragestellung<br />
zu einem System von Hypothesen ausarbeiten, diesen Hypothesen dann Variablen (verän<strong>der</strong>liche<br />
Größen) zuordnen <strong>und</strong> schließlich Instrumente <strong>der</strong> Datenerhebung ein-setzen,<br />
die die jeweilige Ausprägung eines Merkmals möglichst quantitativ (numerisch) abbilden.<br />
Das so gewonnene Zahlenmaterial kann dann statistisch ausgewertet werden<br />
(Verteilung, Zusammenhänge etc.); diese Auswertung erfolgt zum Zwecke <strong>der</strong> Überprüfung<br />
<strong>der</strong> vorab definierten Hypothesen, die schließlich wi<strong>der</strong>legt o<strong>der</strong> (vorläufig)<br />
bestätigt werden“ (Terhart 1997, S. 28).<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> quantitativen Forschung werden also Menge <strong>und</strong> Häufigkeit auf <strong>der</strong><br />
Basis von messbaren Kriterien festgestellt. Dazu wird in <strong>der</strong> Regel als klassisches<br />
Verfahren <strong>der</strong> Befragung <strong>der</strong> Fragebogen genutzt. Die Befragten beantworten schriftlich<br />
ausformulierte Fragen zu verschiedenen Themen.<br />
6 Unter Mitarbeit von Yvonne Witte. Auf <strong>der</strong> Basis von Karstens / Nehls 2005, S. 198 ff. <strong>und</strong> Witte 2005, S.<br />
65 ff.<br />
11
Der Vorteil <strong>der</strong> schriftlichen Befragungen im Rahmen von <strong>Sozialraum</strong>analysen mittels<br />
Fragebogen liegt darin, mit relativ wenig Personal <strong>und</strong> vergleichsweise geringen Kosten<br />
eine hohe Anzahl von Probanden gleichzeitig befragen zu können. Auch zeigt die<br />
Erfahrung, dass bei öffentlichen Präsentationen von Untersuchungsergebnissen den<br />
Zahlen <strong>und</strong> Fakten <strong>der</strong> quantitativen Ergebnisse – auch wenn das in dieser Ausschließlichkeit<br />
gerade bei Lebensweltuntersuchungen fragwürdig sein mag – mehr Überzeugungskraft<br />
zugeschrieben wird. Das kann für die Weiterarbeit durchaus von Nutzen sein.<br />
Bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>und</strong> Konstruktion des Fragebogens als einer „stark strukturierten<br />
Befragung“ muss viel Zeit eingeplant <strong>und</strong> Sorgfalt aufgewendet werden.<br />
Die Entwicklung eines Fragebogens setzt systematische Planung voraus. So ist z. B. die<br />
Anordnung <strong>der</strong> Fragen <strong>und</strong> Fragentypen ein wichtiges Merkmal in <strong>der</strong> Struktur des<br />
Fragebogens. Bei stark strukturierenden Befragungen arbeitet man zum größten Teil mit<br />
geschlossenen Fragen. Dabei muss <strong>der</strong> Proband nur die vorgefertigten Antwortkategorien<br />
ankreuzen („Multiple Choice“). Der Vorteil <strong>der</strong> geschlossenen Frage ist die Vergleichbarkeit<br />
<strong>der</strong> Antworten. Demgegenüber hat <strong>der</strong> Befragte bei offenen Fragen einen<br />
großen Spielraum bei <strong>der</strong> Beantwortung. Dadurch erhält man mehr <strong>und</strong> differenziertere<br />
Antworten, die aber schwer vergleichbar sind. Die beiden Fragetypen kann man auch als<br />
„Hybridfrage“ in einer Frage verbinden (Kirchhoff / Kuhnt / Lipp / Schlawin 2003, S. 20<br />
ff.).<br />
Der Aufbau <strong>und</strong> die Länge des Fragebogens hängen vom Untersuchungsgegenstand <strong>und</strong><br />
vom Forschungsziel ab. Dabei sollte die schriftliche Befragung in <strong>der</strong> Regel nicht länger<br />
als 45 Minuten dauern <strong>und</strong> möglichst nicht mehr als 35 – 55 Fragen enthalten. Der<br />
Fragebogen muss natürlich so gestaltet werden, dass ihn alle Probanden verstehen. Als<br />
Regel gilt, „das Beson<strong>der</strong>e folgt dem Allgemeinen, das Unvertraute dem Vertrauten, das<br />
Komplizierte dem Einfachen“ (Steinert / Thiele 2000, S. 219).<br />
Die Einzelheiten <strong>der</strong> Standard-Vorgehensweise bei quantitativen Forschungen können<br />
hier nicht vorgestellt werden. Dazu wird auf die entsprechenden Lehrbücher verwiesen<br />
(vgl. dazu z. B. Steinert / Thiele, 2000, S. 215 f., Diekmann 2005, Kromrey 2003, Mayer<br />
2002, Moser 1997, Schnell 2005).<br />
Wichtig für unseren Zusammenhang ist es nur festzuhalten, dass eine saubere Konstruktion<br />
des Fragebogens, eine kluge <strong>und</strong> för<strong>der</strong>liche Organisation <strong>der</strong> Verteilung <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Rückläufe (Mayer 2002, S. 97) <strong>und</strong> die Auswertung einen erheblichen Aufwand bedeuten,<br />
<strong>der</strong> mit einer „Nebenbei-Beschäftigung“ von im <strong>Sozialraum</strong> Tätigen nicht zu<br />
bewältigen ist. Deshalb werden unter 3.2 einige Vereinfachungsvorschläge gemacht.<br />
Bei <strong>der</strong> Auswertung standardisierter Fragebögen kann nicht auf ein relevantes Statistikprogramm<br />
verzichtet werden. In den eher einfach strukturierten Untersuchungszusammenhängen<br />
von <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>n sind einige Programme (z. B.<br />
SPSS) für den Praktiker im Allgemeinen zu komplex <strong>und</strong> auch nicht erfor<strong>der</strong>lich. Excel<br />
bietet zwar eine Reihe statistischer Auswertungsmöglichkeiten, ist dennoch in <strong>der</strong> Regel<br />
nicht ausreichend <strong>und</strong> eigentlich nicht optimal für <strong>Sozialraum</strong>untersuchungen. Man<br />
benötigt im Rahmen praxisbezogener <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>n Programme,<br />
die Analyseverfahren zwar komplett, aber dennoch vereinfacht durchführen (Mayer<br />
12
2002, S. 136). Die Software Grafstat ist hier ein guter Kompromiss. Es ist ein<br />
Programm, das für sozialwissenschaftliche Studien von Schülern geschrieben wurde. 7<br />
Diese Software ermöglicht es auch dem jugendlichen Forscher, angeleitet technisch<br />
saubere Fragen zu entwickeln <strong>und</strong> ein ausfüllfertiges Druckformular o<strong>der</strong> ein HTML-<br />
Formular des Fragebogens zu erstellen. Mit Grafstat kann man seine gesammelten Daten<br />
auf sehr einfache Weise erfassen, gestalten, auswerten, dokumentieren <strong>und</strong> präsentieren.<br />
3.2 Möglichkeiten für ein vereinfachtes Vorgehen<br />
Auch quantitative Befragungen mit Fragebögen lassen sich in weniger aufwändigen<br />
Formen realisieren. Folgende Vereinfachungen kommen infrage:<br />
• kurze Fragebögen: thematische Einschränkung (wenn nur ausgewählte Daten<br />
gesammelt werden, die nur für eine einzelne soziale Einrichtung, z. B. eine<br />
Schule, ein Jugendzentrum, eine Kin<strong>der</strong>tagestätte, einen Sportverein im Stadtteil)<br />
erhoben werden<br />
• Befragungen nur einer kleineren Anzahl von Repräsentanten aus <strong>der</strong> Zielgruppe<br />
(Fallzahlen klein halten, um weniger Organisationsaufwand bei <strong>der</strong> direkten<br />
Arbeit mit den Zielgruppen zu haben)<br />
• Poster-Fragebögen einsetzen (Fragebögen auf Metaplan-Postern – z. B. in <strong>der</strong><br />
Turnhalle, Kleben von Punkten, Ergebnis liegt sofort vor)<br />
• fertige Fragebögen übernehmen <strong>und</strong> nicht neu entwickeln<br />
• die Aufgaben nicht von wenigen Personen erledigen lassen, son<strong>der</strong>n auf ein<br />
größeres Team <strong>der</strong> Einrichtung verteilen <strong>und</strong> somit die einzelnen Aufgaben<br />
durch viele verschiedene Personen erledigen lassen<br />
• externe Aufträge (ggf. Projektmittel beantragen)<br />
Es gibt auch eine Reihe von Alternativen zur Durchführung von Befragungen durch die<br />
Mitarbeiter:<br />
• Delegation an Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche<br />
• Delegation an eine Jugendorganisation, einen Verein, eine Kirchengemeinde<br />
• Das Stadtteil-Jugendzentrum führt im Zuge seiner Konzeptionsentwicklung <strong>und</strong><br />
im Rahmen einer Fortbildung möglicherweise schon eine <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong><br />
Lebensweltuntersuchung durch <strong>und</strong> kann nun auch die Fragebogenerhebung<br />
übernehmen.<br />
• im Rahmen <strong>der</strong> Ferienpass-Aktion unter pädagogischer Anleitung eine Fragebogenaktion<br />
entwickeln<br />
• Jugendliche führen selber eine Befragung zu Programmwünschen für das<br />
Jugendzentrum durch.<br />
• Ein Jugendzentrum erstellt über eine längere Zeit eine partizipative <strong>Sozialraum</strong>analyse<br />
mit partizipativen <strong>Sozialraum</strong>methoden <strong>und</strong> pädagogischen Aktionen<br />
(Jugendliche als Forscher). Ein Teil davon ist eine Fragebogenaktion.<br />
• Ein Ortsjugendring führt regelmäßig eine Fragebogenaktion durch, von <strong>der</strong> alle<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> die Stadtteilgremien profitieren. So verfährt z. B. <strong>der</strong> Orts-<br />
7 Das Programm ist für einen Beitrag von 4,- Euro bei <strong>der</strong> B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung erhältlich<br />
bzw. steht als Download bereit.<br />
13
jugendring Ahrensburg. Diese Befragung wird sowohl konzeptionell als auch<br />
von <strong>der</strong> Durchführung <strong>und</strong> Auswertung her komplett von Jugendlichen<br />
realisiert. Es geht inhaltlich um Freizeitfragen, Politik, Schule <strong>und</strong> den Kin<strong>der</strong>-<br />
<strong>und</strong> Jugendbeirat. Die Befragung wird ansprechend aufbereitet in einer<br />
Broschüre <strong>und</strong> hat große öffentliche Resonanz. Da es sich um eine regelmäßige<br />
Wie<strong>der</strong>holung handelt, durch die vorhandenes Know-how gezielt genutzt wird,<br />
liegt hier sicher ein Vereinfachungseffekt vor. Für die durchführenden<br />
Jugendlichen ist es wohl eher nicht eine einfache <strong>und</strong> unaufwändige Methode,<br />
für Politik <strong>und</strong> Jugendpflege in Ahrensburg jedoch ist diese Art <strong>der</strong> Delegation<br />
eine einfache <strong>und</strong> komfortable Möglichkeit, an Befragungsergebnisse zu<br />
gelangen.<br />
Selbstverständlich müssen auch diese Daten aufbereitet, geordnet, strukturiert dokumentiert<br />
<strong>und</strong> mit Schussfolgerungen versehen werden.<br />
4. <strong>Praxis</strong>baustein 3: Qualitative Verfahren <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Lebensweltanalyse</strong> 8<br />
4.1 Definition <strong>und</strong> Begrifflichkeiten<br />
Terhart betont, dass <strong>der</strong> Begriff qualitativ nichts mit Qualität im bewertenden Sinne zu<br />
tun hat, son<strong>der</strong>n damit, dass sich „qualitativ-empirische Forschung am Ziel einer<br />
möglichst gegenstandsnahen Erfassung <strong>der</strong> ganzheitlichen kontextgeb<strong>und</strong>enen Eigenschaften<br />
sozialer Fel<strong>der</strong>“ orientiere (Terhart 1997, S.27 f.). Es geht nicht um die Erfassung<br />
statistischen Datenmaterials, son<strong>der</strong>n um die ganzheitliche Untersuchung <strong>der</strong><br />
sozialen Fel<strong>der</strong> sowie <strong>der</strong> in ihnen enthaltenen Beziehungen <strong>und</strong> Subjektivitäten. Bei<br />
qualitativen Untersuchungen kommt es darauf an, auf Menschen zuzugehen <strong>und</strong> sie<br />
direkt zu ihren subjektiven Empfindungen <strong>und</strong> Sichtweisen, zu ihrem Lebensgefühl, zur<br />
Lebensqualität <strong>und</strong> ihren subjektiven Möglichkeiten in ihrem <strong>Sozialraum</strong> zu befragen.<br />
Wichtig bei qualitativen Untersuchungen ist es, einen möglichst unvoreingenommenen,<br />
unmittelbaren Zugang zum Feld zu haben <strong>und</strong> die Meinungen <strong>und</strong> Ansichten <strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Lebenswelt lebenden Menschen möglichst umfassend einzubeziehen.<br />
Die qualitative Art <strong>der</strong> Bedürfnis- <strong>und</strong> Bedarfsermittlung kann als Gr<strong>und</strong>lage für die<br />
Erstellung von Konzepten in <strong>der</strong> Jugendhilfe sehr sinnvoll <strong>und</strong> nutzbringend eingesetzt<br />
werden (Terhart 1997, S. 27 f.).<br />
Die qualitative Datenerhebung verwendet keine standardisierten Methoden i. e. S. Das<br />
ist dann bei <strong>der</strong> späteren Daten-Auswertung im Rahmen geeigneter EDV-Programme –<br />
wie MAX-QDA (qualitative Datenanalyse) – teilweise an<strong>der</strong>s.<br />
Probleme <strong>und</strong> Schwierigkeiten des qualitativen Forschens<br />
Der Vorteil qualitativen Forschens besteht darin, dass die angewandten Methoden nicht<br />
so abstrakt sind <strong>und</strong> gut von den Forschern in den Alltag eingebaut werden können. Im<br />
Gegensatz dazu stellen sich die Vor- <strong>und</strong> Nachbereitungen <strong>der</strong> durchgeführten qualitati-<br />
8 Auf <strong>der</strong> Basis von Karstens / Nehls 2005, S. 198 ff.<br />
14
ven Methoden als sehr arbeitsintensiv dar. Auch die Dauer <strong>der</strong> Durchführung ist zum<br />
Teil schlecht einschätzbar <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ertrag hinsichtlich <strong>der</strong> Ergebnisse oft ungewiss. Weitere<br />
typische Probleme qualitativen Forschens, die auftreten können (Friebertshäuser /<br />
Prengel 1997, S. 71) sind:<br />
Missing data: Wichtige Fragen können in einem offenen Interview vergessen werden, da<br />
es z. B. keinen ausführlichen Leitfaden gibt <strong>und</strong> das Gespräch sehr frei verläuft. Um<br />
dieser Problematik entgegenzutreten, kann es sinnvoll sein, eine Checkliste anzufertigen,<br />
die man am Ende des Gesprächs durchgeht.<br />
Quasi-Quantifizierung: Aufgr<strong>und</strong> des Gebrauches bestimmter Wörter werden die Ergebnisse<br />
„verdeckt quantifiziert“. Die Worte „typischerweise“, „selten“, „häufig“ <strong>und</strong> Komparative<br />
wie „Typ A“ o<strong>der</strong> „Typ B“ sind zum Teil unvermeidbar. Die Verwendung<br />
solcher Begriffe <strong>und</strong> jede „verdeckte Quantifizierung“ muss immer in Bezug auf ihren<br />
Erkenntnisgewinn hinterfragt werden.<br />
Die größte Schwierigkeit liegt im Komparativ. Hier sind quantitative Aussagen meistens<br />
nicht ganz auszuschließen. Entwe<strong>der</strong> man verzichtet auf <strong>der</strong>artige Komparative o<strong>der</strong><br />
man geht doch quantitativ vor <strong>und</strong> zählt bzw. rechnet nach.<br />
Untersuchungsgr<strong>und</strong>lage: „Die Zahl <strong>und</strong> Art <strong>der</strong> in die Untersuchung einzubeziehenden<br />
Subjekte wird oft willkürlich bestimmt. Auch die Rekrutierung <strong>der</strong> Einbezogenen beruht<br />
oft nicht auf einem rationalen, das meint begründeten Auswahlprozess.“ Es sollten<br />
jedoch alle Kontraste, die analysiert werden sollen, in einer ausreichenden Zahl von<br />
Fällen vertreten sein. Ist die Fragestellung zu unübersichtlich, so kommt man schnell auf<br />
Fallzahlen, die nicht mehr bewältigt werden können. Aufgr<strong>und</strong> dessen sollte man sich im<br />
Vorfeld auf wenige zentrale Kontraste, vielleicht sogar nur auf ein Problem beschränken<br />
(Friebertshäuser / Prengel 1997, S. 76 ff.).<br />
4.2 Ethnografie <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />
Die qualitativen Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> sind in <strong>der</strong> letzten<br />
Zeit sehr intensiv im Zusammenhang mit den sogenannten „ethnografischen Methoden<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit“ diskutiert worden. Was ist damit gemeint? (zum Folgenden:<br />
Appel / Stötzel 1999, S. 1 ff.).<br />
Bronislav Malinowski, ein britischer Forscher, gehörte zu den Begrün<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Ethnografie.<br />
Er erforschte als Ethnologe zu Beginn des letzten Jahrhun<strong>der</strong>ts Völker auf<br />
Südseeinseln <strong>und</strong> teilte dabei als einer <strong>der</strong> Ersten das Leben <strong>der</strong> Menschen, die er erforschte.<br />
Er kultivierte z. B. die qualitative Forschungsmethode <strong>der</strong> Teilnehmenden<br />
Beobachtung. Ein wesentliches Element bei dieser Methode ist es, dass <strong>der</strong> Forscher sich<br />
über einen bestimmten Zeitraum in dem zu untersuchenden Feld aufhält <strong>und</strong> das Leben<br />
dort verfolgt (Fremdheitserfahrung). Es geht darum, die an<strong>der</strong>en Kultur- <strong>und</strong> Zivilisationsmuster<br />
zu erkennen <strong>und</strong> zu erlernen. Aufgegriffen wurden solche Feldforschungsansätze<br />
von <strong>der</strong> Chicago-Soziologie Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts. Methodisch waren<br />
<strong>der</strong>en Feldforschungen auf die sog. Erste-Hand-Erk<strong>und</strong>ungen <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
„sozialen Welten“ <strong>der</strong> Großstadt ausgerichtet. Im Zentrum dieser Forschungsweise steht<br />
die erwähnte Fremdheitserfahrung. Das sind Erfahrungen, dass bei Begegnungen mit<br />
Fremden die selbstverständlich gehandhabten Verhaltensmuster <strong>und</strong> -erwartungen, das<br />
„Denken <strong>und</strong> Handeln wie üblich“ sich als teilweise vollständig untauglich erweist. Will<br />
15
man in den fremden Lebenszusammenhängen selbst handlungsfähig werden, steht man<br />
als Frem<strong>der</strong> vor <strong>der</strong> schwierigen Aufgabe, die Kultur- <strong>und</strong> Zivilisationsmuster des<br />
Personenkreises, an den man sich annähert, zu erkennen <strong>und</strong> zu erlernen. Man muss also<br />
in Erfahrung bringen, wie man sich angemessen bzw. richtig verhalten kann.<br />
Die Ethnografie als wissenschaftliche Methode vollzieht diesen Annäherungs- <strong>und</strong><br />
Verstehensprozess. Ziel ist es, ein zusammenhängendes Bild von den Regeln des<br />
Zusammenlebens, des Verhaltens <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kommunikation in <strong>der</strong> fremden Lebenswelt zu<br />
bekommen. Dieses Bild kann nur durch die persönliche Erk<strong>und</strong>ung in <strong>der</strong> fremden<br />
Lebenswelt erworben werden (Appel / Stötzel 1999, S. 1 ff.).<br />
Berührungspunkte zwischen Jugendarbeit <strong>und</strong> Ethnografie<br />
Die Methodik <strong>der</strong> Jugendarbeits-Ethnografie – etwa die teilnehmende Beobachtung – ist<br />
angelehnt an das beschriebene neugierige Erforschen frem<strong>der</strong> Zivilisationen. Die oft<br />
ungewohnten <strong>und</strong> fremdartig erscheinenden Gewohnheiten jugendlicher Peer-Groups<br />
kann man so besser kennenlernen <strong>und</strong> besser verstehen.<br />
Es gehörte ohnehin schon immer zum Handwerkszeug, sich über die Lebenswelt <strong>der</strong><br />
Jugendlichen – ihre sozialen, familiären <strong>und</strong> biografischen Hintergründe – genauer zu<br />
informieren. Es geht dabei wie auch bei <strong>der</strong> eigentlichen ethnografischen Jugendarbeit<br />
i. e. S. um die wechselseitige Vermittlung <strong>der</strong> unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven<br />
<strong>und</strong> z. T. um eine regelrechte Übersetzungsarbeit – z. B. dann, wenn die unterschiedliche<br />
Sprache von jugendlicher Subkultur einerseits <strong>und</strong> Bürokratie an<strong>der</strong>erseits<br />
ein direktes Gespräch verunmöglichen würde. Auch bei den Aktivitäten zur Planung von<br />
Angeboten <strong>und</strong> Maßnahmen, <strong>der</strong> Entwicklung <strong>und</strong> Fortschreibung von Konzeptionen<br />
sowie <strong>der</strong> Reflexion <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong> werden immer wie<strong>der</strong> Aussagen über Bedürfnisse <strong>und</strong><br />
Bedarfe <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen aus ihrer Lebenswelt benötigt, um Äußerungen <strong>der</strong><br />
Nutzer richtig zu deuten. Dabei gibt es vielfältige Ansätze, die Lebenswelten <strong>der</strong><br />
Jugendlichen auf methodisch angeleitete Weise zu erk<strong>und</strong>en <strong>und</strong> zu verstehen (Appel /<br />
Stötzel 1999, S. 2 ff.). Dabei wurden für die Jugendarbeit eine Reihe hochwirksamer <strong>und</strong><br />
aktivieren<strong>der</strong> Methoden adaptiert.<br />
Ethnografische Methoden in <strong>der</strong> Jugendarbeit sind z. B. (Appel / Stötzel 1999, S. 4 ff.,<br />
Hervorh. d. A.):<br />
• „Stadtteilbegehung <strong>und</strong> fotografische Stadtteilerk<strong>und</strong>ung (Zugänglichkeit <strong>der</strong><br />
Einrichtungen, Zustand <strong>der</strong> Spielplätze / Nutzungsweise, informelle <strong>und</strong><br />
formelle Treffpunkte, jugendkulturelle Szenen): Diese Erk<strong>und</strong>ungen werden<br />
dokumentiert, aus möglichst verschiedenen Perspektiven kommentiert <strong>und</strong><br />
aufbereitet …<br />
• Subjektive Landkarten: Hier geht es um die biografische Relevanz von Raumnutzung<br />
<strong>und</strong> -aneignung, d. h. Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche werden aufgefor<strong>der</strong>t, die<br />
täglich relevanten Orte, die Wege, die soziale Bedeutsamkeiten aufzu-zeichnen<br />
…<br />
• Nadeluntersuchung: Jugendliche werden befragt, die Ergebnisse werden mit<br />
Nadeln in einer Landkarte dokumentiert <strong>und</strong> systematisiert (als Bedarfsbeschreibung,<br />
als Interessenserk<strong>und</strong>ung, als Beschreibung eines Konfliktpotenzials<br />
etc.) …<br />
16
• Offene Befragungen von Jugendlichen <strong>und</strong> Stadtteilakteuren, zu Geschichten<br />
von Institutionen, zu aktuellen Ereignissen (Aktivität <strong>und</strong> Interessen), zu Konfliktlagen<br />
etc.“.<br />
Kritische Punkte <strong>und</strong> Anmerkungen<br />
Bei <strong>der</strong> Verbindung dieser zwei Bereiche ist zu bemerken, dass bei <strong>der</strong> Verwendung<br />
ethnografischer Methoden in <strong>der</strong> Jugendarbeit <strong>der</strong> Fokus auf „Nützlichkeit <strong>und</strong> Integrierbarkeit“<br />
<strong>der</strong> Arbeitsgänge (Exploration / Erk<strong>und</strong>ung, Evaluation) mehr gefor<strong>der</strong>t ist als<br />
die Wissenschaftlichkeit.<br />
So einfach wie man denkt ist diese Vorgehensweise lei<strong>der</strong> nicht. Durch das gehäufte<br />
Auftreten von Unbekanntem werden oftmals „unangenehme Gefühle“ hervorgerufen.<br />
Eine „weitgehend vorurteilsfreie, erschließende Haltung aus <strong>der</strong> Perspektive möglichst<br />
aller Beteiligten setzt Denk- <strong>und</strong> Handlungsfreiräume voraus, die in <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong> wegen<br />
des starken Problem- <strong>und</strong> Handlungsdrucks selten vorhanden <strong>und</strong> nicht immer herzustellen<br />
sind“.<br />
„Diese forschende Haltung, <strong>der</strong> es zunächst nicht so sehr ums Machen geht, son<strong>der</strong>n um<br />
das Verstehen von Sinn <strong>und</strong> Bedeutungen muss prinzipiell ergebnisoffen angelegt sein.<br />
Diese Offenheit jedoch kann im Wi<strong>der</strong>spruch stehen zu pädagogischen Orien-<br />
tierungen <strong>und</strong> zu offenen o<strong>der</strong> latenten Auftragslagen“ (Appel / Stötzel 1999, S. 6).<br />
Beson<strong>der</strong>s zu erwähnen ist, „dass ethnographische Verfahren in <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong> nicht einfach<br />
mitlaufen können. Sie sind anspruchsvoll <strong>und</strong> sollten ausgewählten Erk<strong>und</strong>ungs-, Reflexions-<br />
<strong>und</strong> Evaluationsprojekten vorbehalten sein“ (Appel / Stötzel 1999, S. 6).<br />
4.3 Qualitative Methoden – ein exemplarischer Überblick<br />
4.3.1 Strukturierte <strong>Sozialraum</strong>begehung 9<br />
Kurzbeschreibung<br />
Diese Methode ist keine direkte Beteiligungsmethode von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen,<br />
son<strong>der</strong>n stellt eher eine Beobachtungsmethode dar, die dazu dient, den sozialräumlichen<br />
Blick des Stadtteils o<strong>der</strong> Dorfes mit seinen Qualitäten zu erweitern <strong>und</strong> erste Kontakte<br />
mit den Bürgern zu ermöglichen. Das Ziel <strong>der</strong> strukturierten <strong>Sozialraum</strong>begehung ist es,<br />
den Stadtteil / das Dorf aus <strong>der</strong> alltagsweltlichen Sicht von Heranwachsenden, aber auch<br />
von Erwachsenen zu begreifen.<br />
Zielgruppen<br />
Erwachsene, Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche (in verschiedenen Altersgruppen, Mädchen <strong>und</strong><br />
Jungen, die allein, zu zweit o<strong>der</strong> in einer Clique / Gruppe ihren Nahraum nutzen. Die<br />
optimale Gruppengröße beträgt zwei bis drei Personen).<br />
Zeitaufwand / Dauer<br />
9 Quelle: Stange 2004; Deinet 1999, S. 74 f., S 82 ff.<br />
17
Die Dauer einer <strong>Sozialraum</strong>begehung mit einem Erwachsenen o<strong>der</strong> mit einer Gruppe<br />
von Kin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Jugendlichen beträgt ca. 60 – 90 Minuten. Es sollten aber immer<br />
mehrere Begehungen mit verschiedenen Zielgruppen absolviert werden („Gegen-Check“<br />
<strong>der</strong> Sichtweisen). Man kann strukturierte <strong>Sozialraum</strong>begehungen auch in regelmäßigen<br />
Abständen – z. B. alle vier Wochen – durchführen, um durch unterschiedliche Beobachtungen<br />
in den einzelnen R<strong>und</strong>gängen <strong>und</strong> zu unterschiedlichen Tageszeiten etc. die<br />
Chance einer differenzierten Wahrnehmung zu ermöglichen.<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
Eine Begehung sollte, wenn möglich, an trockenen <strong>und</strong> sonnigen Tagen durchgeführt<br />
werden. Daher sind die Sommermonate am besten geeignet.<br />
Material / Hilfsmittel<br />
Tonbandgerät / Diktiergerät, Polaroid- <strong>und</strong> / o<strong>der</strong> Digitalkamera, Klemmbrett, DIN-A4-<br />
Blätter, Beobachtungs- <strong>und</strong> Protokollbögen, Stifte<br />
Vorteile<br />
Sinnliche Wahrnehmung eines <strong>Sozialraum</strong>s, Interpretation <strong>der</strong> unmittelbaren Eindrücke<br />
räumlicher <strong>und</strong> sozialer Strukturen (durch Begegnen, Wahrnehmen, Hören, Sprechen)<br />
Durchführung<br />
Zwei bis drei Forscher verabreden sich mit einem Bürger (Erwachsene, Kin<strong>der</strong>, Jugendliche)<br />
des Stadtteils o<strong>der</strong> Dorfes. Diese kleine Gruppe zieht in einer vorher festgelegten<br />
Zeitspanne durch den Ort <strong>und</strong> dokumentiert den R<strong>und</strong>gang mithilfe einer Digitalkamera,<br />
einem Diktiergerät, Klemmbrett-Notizen o<strong>der</strong> standardisierten Beobach-tungs- <strong>und</strong><br />
Protokollbögen. Dabei ist es wichtig, dem Bürger zuzuhören, aber auch aktiv<br />
nachzufragen <strong>und</strong> alle Antworten <strong>und</strong> Erlebnisse zu dokumentieren.<br />
Eine Begehung mit Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen kann auch mit einer Videokamera begleitet<br />
<strong>und</strong> festgehalten werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass <strong>der</strong> Einsatz eines<br />
solchen Mediums viel mehr Aufmerksamkeit erfor<strong>der</strong>t <strong>und</strong> teilweise ablenkt.<br />
Während <strong>der</strong> Begehung können interessante Gespräche z. B. über Gruppen <strong>und</strong> Cliquen<br />
im Stadtteil entstehen. Darüber hinaus erhalten die Pädagogen bei dieser Methode auch<br />
Informationen über Lieblingsorte, informelle Treffpunkte o<strong>der</strong> Oberflächengestaltungen<br />
von Plätzen, die z. B. für die Gruppe <strong>der</strong> Inline-Skater von Bedeutung sind u.Ä.<br />
4.3.2 Teilnehmende Beobachtung 10<br />
Kurzbeschreibung<br />
Bei <strong>der</strong> Teilnehmenden (topografischen) Beobachtung begibt man sich direkt in das zu<br />
erforschende Feld, nimmt sozusagen am Leben <strong>der</strong> dort agierenden Gruppen teil. Man<br />
nimmt Kontakt mit <strong>der</strong> zu beobachtenden Gruppe auf, begibt sich in eine Face-to-Face-<br />
10 Quellen: Stange 2004; Moser 1997, S. 39 – 42; Jordan / Schone 1998, S. 562 – 564; Marin / Wawrinowski<br />
1991, S. 191; Weskamp 1996, S. 22 – 25; Spiegel 1997, S. 186 f.<br />
18
Interaktion mit den Teilnehmenden <strong>und</strong> beobachtet dabei.<br />
Zielgruppen<br />
Kin<strong>der</strong>, Jugendliche, Erwachsene, formelle <strong>und</strong> informelle Gruppen (Cliquen)<br />
Zeitaufwand / Dauer:<br />
Ca. 30 Minuten bis 2 St<strong>und</strong>en. Die Zeitspanne ergibt sich aus <strong>der</strong> Zielsetzung <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Art <strong>der</strong> Gruppe (z. B. <strong>der</strong>en Alter).<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
trockenes, windstilles Wetter<br />
Material / Hilfsmittel<br />
Beobachtungsbögen, Klemmbretter, Stifte, Fotokameras, Stadtpläne; bei Kin<strong>der</strong>n:<br />
Sofortbildkameras o<strong>der</strong> Digitalkameras mit Bildschirm, Doku-Mappe (zum Sammeln<br />
sämtlicher Feldmaterialien, Fotos, Protokoll, Beobachtungsbogen), ggf. Videokameras,<br />
Tonband<br />
Vorteile<br />
Da die Teilnehmende (topografische) Beobachtung in <strong>der</strong> natürlichen Umgebung <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen stattfindet, bietet sie authentische <strong>und</strong> natürliche Informationen<br />
(keine Laborsituation). Die Teilnehmende Beobachtung erlaubt durchaus auch Kommunikation<br />
<strong>und</strong> Kontakt mit <strong>der</strong> Zielgruppe <strong>und</strong> beschränkt sich nicht nur auf das reine<br />
Beobachten.<br />
Nachteile<br />
Da man gleichzeitig Beobachter <strong>und</strong> Teilnehmer ist <strong>und</strong> nebenbei auch alles Beobachtete<br />
<strong>und</strong> Erlebte dokumentieren muss, kann man schnell die Übersicht verlieren. Die Gruppe<br />
stellt möglicherweise die Beobachter in den Mittelpunkt. Denn die Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
kennen sie nicht <strong>und</strong> sind neugierig <strong>und</strong> interessiert. Trotzdem muss man versuchen,<br />
so wenig wie möglich herausgehobene Aufmerksamkeit zu erregen. Das gelingt<br />
meistens auch, weil das Interesse <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> sich wie<strong>der</strong> verlagert.<br />
Durchführung<br />
Topografische Beobachtung mit festem Standort: Schulhof, Schulklasse, Kita, Spielplatz<br />
/ Bauspielplatz, Sport, Plätze, Rathaus, Disco, Café, Kneipe, insb. Cliquen-Orte usw.:<br />
Jugendtreffpunkte, Bushäuschen, Geschäfte usw.<br />
Beispiel feste Gruppe (Schulklasse, Gruppe im Jugendzentrum u. Ä.): Die Untersuchenden<br />
begeben sich in die Gruppe <strong>und</strong> verbringen eine bestimmte Zeit innerhalb <strong>der</strong><br />
Gruppe. Sie beobachten (füllen Bögen aus), fragen die Gruppe im Ausnahmefall auch<br />
einmal unbefangen etwas. Sie begleiten sie ggf. auch zu ihren informellen Treffs.<br />
Während des gesamten Prozesses müssen die Untersuchenden aufmerksam, aber möglichst<br />
unauffällig agieren, ohne zu beeinflussen. Es können nach Beobachtungsphasen<br />
auch Interviews mit <strong>der</strong> Gruppe geführt werden. Neben dem Beobachtungsbogen sollten<br />
weitere Notizzettel bereitgehalten werden. Denn <strong>der</strong> Beobachtungsbogen hält nur eine<br />
selektive Auswahl von Kategorien bereit. So kann man dort beson<strong>der</strong>e Auffälligkeiten<br />
19
<strong>und</strong> Vorgänge nicht erfassen. Wenn eine teilnehmende Beobachtung öfter stattfinden<br />
soll, ist zu empfehlen, nach jedem Einsatz sofort die Auswertung zu machen, denn dann<br />
sind die Erinnerungen an das Gesehene noch frisch. Wichtig ist auch die korrekte Zuordnung<br />
von Fotos zu den entsprechenden Ereignissen o<strong>der</strong> Orten. Es empfiehlt sich, die<br />
Fotos (bei Sofortbildkameras) <strong>und</strong> die entsprechenden Notizen zu nummerieren. Bei<br />
einer normalen Kamera kann <strong>der</strong> Notiz die Nummer des Fotos beigefügt werden.<br />
4.3.3 Befragung an Kommunikations- <strong>und</strong> Dialogwänden 11<br />
Kurzbeschreibung<br />
Diese Methode wird mit flanierenden Kin<strong>der</strong>n, Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen im<br />
öffentlichen Raum durchgeführt Die vorbeikommenden Kin<strong>der</strong>, Jugendlichen <strong>und</strong><br />
Erwachsenen werden dazu angehalten, anhand vorher ausgesuchter Fragen ihre Meinung<br />
zur Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendfre<strong>und</strong>lichkeit in ihrer Gemeinde zu äußern. An die dafür<br />
aufgestellten Kommunikationswände werden die auf Karten geschriebenen Antworten<br />
angepinnt <strong>und</strong> nach Bedarf diskutiert. Die getroffenen Aussagen können aufgr<strong>und</strong> unterschiedlich<br />
definierter Kartenfarben einzelnen Zielgruppen zugeordnet <strong>und</strong> so leichter<br />
ausgewertet werden.<br />
Zielgruppen<br />
Kin<strong>der</strong>, Jugendliche, Erwachsene<br />
Zeitaufwand / Dauer<br />
ca. vier bis fünf St<strong>und</strong>en<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
trockenes, windstilles Wetter<br />
Material / Hilfsmittel<br />
Stellwände, auf Streifen vorbereitete Fragen, Metaplan-Karten (für jede Zielgruppe<br />
unterschiedliche Farben), Edding-Stifte, Ghettoblaster / CDs, Süßigkeiten (als „Dankeschön“),<br />
Luftballons (zum Schmücken)<br />
Vorteile<br />
direkte Kommunikation mit den im <strong>Sozialraum</strong> lebenden Personen<br />
Nachteile<br />
Unsicherheit <strong>und</strong> Offenheit: auf das freiwillige „Mitmachen“ <strong>der</strong> Zielgruppen angewiesen<br />
sein (Leerlauf)<br />
Durchführung<br />
Vier bis fünf Stellwände werden gut sichtbar im Ort aufgestellt. Die vorbereiteten <strong>und</strong><br />
auf Streifen ausgedruckten Fragen werden an die Tafeln gepinnt. Die Forscher sind nun<br />
11 Quelle: Stange 2004<br />
20
angehalten, vorbeikommende Kin<strong>der</strong>, Jugendliche <strong>und</strong> Erwachsene zu motivieren, die<br />
Fragen zu beantworten. Damit eine spätere Unterscheidung <strong>der</strong> aufgeschriebenen Antworten<br />
möglich ist, erhalten die Zielgruppen unterschiedliche Kartenfarben. Während<br />
dieser Befragung entsteht ein kommunikativer Prozess, <strong>der</strong> zu einer Erweiterung <strong>der</strong><br />
Antwortmöglichkeiten seitens <strong>der</strong> Passanten führt. Wichtig ist es, dass nicht zu viele<br />
(max. 3 – 4) Fragen ausgewählt werden.<br />
4.3.4 Nadelmethode 12<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Nadelmethode stellt ein Verfahren dar, das je<strong>der</strong>zeit schnell <strong>und</strong> einfach in <strong>der</strong><br />
Jugendarbeit angewandt werden kann <strong>und</strong> das immer zu einem Ergebnis führt. Bei dieser<br />
aktivierenden Methode geht es darum, dass Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche bunte Nadeln in<br />
große Stadtteilkarten stecken <strong>und</strong> auf diese Weise bestimmte Orte (wie z. B. die eigene<br />
Wohngegend, Treff- <strong>und</strong> Streifräume, Angsträume o<strong>der</strong> Lieblingsplätze) bezeichnen.<br />
Dabei sind weitere inhaltliche Fragestellungen, beispielsweise zu Freizeitaktivitäten,<br />
möglich. Die bunten Nadeln erlauben aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> verschiedenen Farben eine<br />
bestimmte Zuordnung (Codierung), sodass am Ende z. B. die bevorzugten Orte von<br />
Mädchen sofort erkennbar werden.<br />
Zielgruppen<br />
Kin<strong>der</strong>, Jugendliche, Erwachsene<br />
Zeitaufwand:<br />
ca. 2 – 4 St<strong>und</strong>en (je nach dem Ort <strong>der</strong> Durchführung)<br />
Materialien / Hilfsmittel<br />
hochkopierte Stadtteilpläne (je günstiger <strong>der</strong> Maßstab, desto präziser <strong>und</strong> besser erkennbar<br />
sind die Elemente <strong>der</strong> Siedlung), verschiedenfarbige Stecknadeln <strong>und</strong> / o<strong>der</strong><br />
Klebepunkte, Stellwände, Stifte, Schreibunterlagen, Papier, Digitalkamera<br />
Kombinierbar mit folgenden Methoden:<br />
Gruppeninterview / Gruppendiskussion, Schneller <strong>Sozialraum</strong>-Check<br />
Vorteile<br />
Diese Methode ist aktivierend, animierend, partizipativ, niedrigschwellig, führt zu<br />
Kommunikation <strong>und</strong> Diskussion, ermöglicht leicht den Kontakt zu Unbekannten (bei<br />
Anwendung außerhalb einer Einrichtung), schnelle repräsentative Ergebnisse, geringer<br />
Durchführungs- <strong>und</strong> Vorbereitungsaufwand, Durchführung in einer Einrichtung o<strong>der</strong> im<br />
Freien.<br />
Die erlangten Informationen ergeben auch einen schnellen Überblick über den Einzugsbereich<br />
einer Einrichtung <strong>und</strong> tragen zur Verbesserung des pädagogischen Konzeptes<br />
dieser Einrichtung (bzw. des Stadtteils) bei.<br />
12 Quellen: Stange 2004; Deinet / Krisch 2002, S. 100 f.<br />
21
Durchführung<br />
Die Jugendarbeiter händigen den Teilnehmern die Nadeln in den jeweiligen Farben aus<br />
<strong>und</strong> bitten sie, diese an die entsprechenden Orten zu stecken. Dabei können die<br />
Pädagogen bei Bedarf unterstützend tätig sein, wenn die gewünschten Orte auf <strong>der</strong> Karte<br />
von den Kin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Jugendlichen nicht sofort auffindbar sind. Die Jugendarbeiter<br />
sollten an den Tafeln stehen bleiben, u. A. auch damit die Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen die<br />
Nadeln nicht ständig umstecken. In kleinen Gruppen o<strong>der</strong> um Zwischenergebnisse zu<br />
fixieren, können die Nadeln durch bunte Klebepunkte ersetzt werden. Bei großen<br />
Gruppen sind die Nadeln aber platzsparend. Für die spätere Auswertung kann die<br />
Digitalfotografie die Ergebnisse auf den bepunkteten o<strong>der</strong> genadelten Karten sichern.<br />
Bei dieser Methode bieten sich weitere Befragungen o<strong>der</strong> Gespräche über die Qualität<br />
<strong>der</strong> festgelegten Orte an (ergänzende Interview-Elemente). Es können zusätzliche<br />
Fragen, die mit den Orten in Verbindung gebracht werden, gestellt werden, beispielsweise<br />
zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten. Diese könnte man auch durch weitere<br />
Nadelsetzungen in entsprechende Fel<strong>der</strong> auf zusätzlichen Stellwänden abfragen.<br />
4.3.5 Cliquen-Kataster / Jugendkulturen-Kataster (mit ergänzendem<br />
Gruppeninterview) 13<br />
Kurzbeschreibung<br />
Kin<strong>der</strong>, Jugendliche o<strong>der</strong> Erwachsene werden gebeten, Cliquen, Gruppen <strong>und</strong> subkulturelle<br />
Szenen im Stadtteil bzw. Dorf zu beschreiben, wobei dies nicht nur zu einem<br />
Überblick <strong>und</strong> zu einem Einblick in verschiedene Cliquenzusammenhänge verhilft,<br />
son<strong>der</strong>n auch – über den Diskussionsprozess beim Ausfüllen des Rasters – wesentliche<br />
Einblicke in alltagsweltliche Deutungen <strong>und</strong> das Selbstverständnis <strong>der</strong> Befragten erlaubt.<br />
Zielgruppen<br />
Diese Methode ist für ältere Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> vor allem Jugendliche geeignet, da in diesem<br />
Alter die Zugehörigkeit zu Gleichaltrigengruppen, zu Szenen <strong>und</strong> ganz konkreten Cliquen<br />
eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung in ihrer Entwicklung hat.<br />
Zur Erstellung eines Jugendkulturenrasters (Cliquen-Katasters) sollten Gruppen von<br />
Jugendlichen angesprochen werden, die sich schon kennen, etwa Schulklassen o<strong>der</strong> die<br />
Stammbesucher einer Jugendeinrichtung, Jugendgruppen etc. Die teilnehmende Jugendgruppe<br />
sollte sich aus mindestens fünf bis maximal 20 Personen zusammensetzen. Die<br />
Methode ist aber auch im öffentlichen Raum für Spontanbefragungen mit Dialogwänden<br />
einsetzbar.<br />
Gruppengröße<br />
5 – 20 Personen<br />
Zeitaufwand<br />
ca. 30 – 120 Minuten<br />
13 Quellen: Stange 2004; Deinet / Krisch 2002, S. 113 f.<br />
22
Äußere Voraussetzungen<br />
Die Gesamtgruppe muss die Möglichkeit haben, die Einzelposter <strong>und</strong> -karten für die<br />
Cliquen <strong>und</strong> Gruppen gemeinsam vergleichend anzuschauen (Stellwände, Wandzeitungen<br />
etc.). Außerdem ist es erfor<strong>der</strong>lich, dass Kleingruppen von zwei bis drei Jugendlichen<br />
gebildet werden, die sich entwe<strong>der</strong> innerhalb eines großen Raumes o<strong>der</strong> auch in<br />
parallele Kleingruppenräume zurückziehen können.<br />
Material / Hilfsmittel<br />
Stellwände, vorher angefertigtes Raster, Edding-Stifte, Metaplan-Karten<br />
Kombinierbar mit folgenden Methoden<br />
Gruppeninterview, Gruppendiskussion, Schneller <strong>Sozialraum</strong>-Check<br />
Vorteile<br />
Gute Einstiegsmethode, einfache Anwendung im Jugendhaus, erlaubt einen wesentlichen<br />
Einblick in alltagsweltliche Deutungen, Sozialpädagogen erhalten einen schnellen Überblick<br />
über die im <strong>Sozialraum</strong> vorhandenen Jugendkulturen, weitere Methoden können<br />
ergänzt werden.<br />
Durchführung<br />
Beispiel-Raster:<br />
Name Äußeres Verhalten Musik Weltbild /<br />
Politik<br />
Skater weite Hose,<br />
Kapuzenpullis,<br />
Kappe,<br />
Skaterschuhe<br />
„Tanz-<br />
schüler“<br />
konservativ<br />
(dunkle Jeans,<br />
Hemd, Pulli,<br />
Halb- / Tanz-<br />
schuhe)<br />
„cool“, lässig,<br />
provokant,<br />
tolerant<br />
höflich,<br />
vernünftig,<br />
eher<br />
konservativ<br />
Hip-Hop politisch neutral,<br />
z.T. eher links<br />
Charts,<br />
gemischt<br />
keine beson<strong>der</strong>e<br />
Weltanschauung<br />
<strong>und</strong> Politik<br />
Treffpunkte<br />
Schulhof<br />
Tanzschulen<br />
(<strong>der</strong>en Veran-<br />
staltungen)<br />
In ein vorgefertigtes Raster mit verschiedenen Kategorien werden unterschiedliche<br />
Merkmale von Jugendgruppen durch die teilnehmenden Jugendlichen auf Metaplan-<br />
Karten eingetragen <strong>und</strong> diese angepinnt. Kategorien sind – wie im Beispiel-Raster<br />
ersichtlich – z. B.: Äußeres, Verhalten, Musik, Weltbild / Politik, Treffpunkte. Hierbei<br />
geht es zunächst einmal um eher objektive Inhalte, wie z. B. „Skater treffen sich auf dem<br />
Marktplatz“ o<strong>der</strong> „Popper fahren Moped“. Das Ausfüllen des Rasters muss ja relativ<br />
knapp gehalten werden. Die Methode dient nicht dazu, unterschiedliche Kulturen in ein<br />
Raster zu drängen <strong>und</strong> sie damit besser unter Kontrolle zu haben. Sie dient vielmehr<br />
dazu, ihre Vielfalt zu erfassen, Informationen über die Gruppen zu erhalten, die man<br />
eventuell vorher nicht kannte <strong>und</strong> auf diesen Ergebnissen aufzubauen (Bedürfnisse<br />
ermitteln, spätere Kontaktaufnahme).<br />
Die Methode sollte mit ergänzenden Gruppeninterview-Elementen verb<strong>und</strong>en werden<br />
(Begründungen, Erläuterungen, Bedeutungen).<br />
Um ein relativ komplettes Bild von Szenen <strong>und</strong> Cliquen in einem <strong>Sozialraum</strong> zu erhalten,<br />
ist es notwendig, diese Methode mit unterschiedlichen Gruppen durchzuführen,<br />
23
um verschiedene Blickwinkel einzubeziehen, etwa mehrere Klassen verschiedener<br />
Schulen, eine Jugendgruppe, Besucher einer Jugendeinrichtung etc. Wichtig ist es auch,<br />
darauf zu achten, dass hier nur belegbare Beschreibungen <strong>und</strong> nicht vorschnell Klischees<br />
multipliziert werden.<br />
4.3.6 Fremdbild-Erk<strong>und</strong>ung 14<br />
Kurzbeschreibung<br />
Bei dieser Methode werden Anwohner, Passanten (Erwachsene, Jugendliche, Kin<strong>der</strong>)<br />
mittels standardisiertem Kurz-Interview (Straßeninterview) zur Außenwahrnehmung <strong>und</strong><br />
zum Image <strong>der</strong> Jugendarbeit befragt. Das Image von Jugendeinrichtungen hat in <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit eines <strong>Sozialraum</strong>s großen Einfluss auf den Zugang von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
Jugendlichen zu den Angeboten <strong>der</strong> Jugendarbeit. Die Einschätzung <strong>der</strong> Bewohner eines<br />
<strong>Sozialraum</strong>s spiegelt oft auch die Einstellung <strong>der</strong> Jugendlichen im Stadtteil bzw. Dorf<br />
wi<strong>der</strong> <strong>und</strong> hat daher nicht nur Einfluss auf die Jugendeinrichtung, son<strong>der</strong>n auch auf<br />
weitergehende Beteiligungsprojekte.<br />
Zielgruppe<br />
erwachsene Passanten, unbekannte Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Zeitaufwand / Dauer<br />
je nach Erkenntnisinteresse ca. 60 – 150 Minuten (pro Interview 10 – 15 Minuten)<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
Es gibt keine beson<strong>der</strong>en Voraussetzungen.<br />
Material / Hilfsmittel<br />
Tonband / Diktiergerät, ggf. Videokamera, Klemmbrett / DIN-A4-Zettel / Kugelschreiber,<br />
Interviewleitfaden<br />
Vorteile<br />
starker Bezug zur Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />
Nachteil<br />
geringer Bezug auf an<strong>der</strong>e Orte bzw. Räume <strong>und</strong> Institutionen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
im <strong>Sozialraum</strong><br />
Durchführung<br />
Die Interviewten sollten als Befragungsorte belebte Plätze auswählen. Dies können die<br />
nächste Geschäftsstraße, die Busstation, <strong>der</strong> Park o<strong>der</strong> ein belebter Fußweg sein. Bei<br />
dieser Interviewsituation ist es sinnvoll, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu<br />
befragen, etwa ältere Menschen, Mütter mit Kin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Jugendliche. Während <strong>der</strong><br />
Befragung ist es sinnvoll, das Gespräch mit einem Diktiergerät aufzuzeichnen <strong>und</strong> / o<strong>der</strong><br />
die wesentlichen Aussagen in einem Befragungsprotokoll zu notieren. Auch eine Doku-<br />
14 Quellen: Stange 2004; Deinet 1999, S. 81 f.<br />
24
mentation mit Videokamera <strong>und</strong> separatem Mikrofon ist möglich.<br />
4.3.7 Leitfadeninterview mit Schlüsselpersonen 15<br />
Kurzbeschreibung<br />
Schlüsselpersonen sind Bürger eines Dorfes, Stadtteils o<strong>der</strong> Bezirkes, die spezielle<br />
Informationen darüber haben <strong>und</strong> weitergeben können. Es wird dabei unterschieden<br />
zwischen Fachleuten bzw. Experten (z. B. Bürgermeister <strong>und</strong> Jugendpfleger) <strong>und</strong> den<br />
<strong>Sozialraum</strong>-Schlüsselpersonen (z. B. Senioren mit langjährigen Kenntnissen über den<br />
<strong>Sozialraum</strong>). Es handelt sich dabei also entwe<strong>der</strong> um Personen, die einflussreiche Funktionen<br />
haben o<strong>der</strong> aber um Personen wie den Hausmeister einer Schule, die Kioskverkäuferin,<br />
Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche einer ortsk<strong>und</strong>igen Clique o<strong>der</strong> die alte Dame, die<br />
immer am Fenster sitzt <strong>und</strong> das Geschehen auf einem öffentlichem Platz verfolgt. Sie<br />
alle können Schlüsselpersonen sein <strong>und</strong> stellen somit wichtige Informanten dar, die die<br />
Erstellung einer <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> im Stadtteil erleichtern, unterstützen<br />
<strong>und</strong> vorantreiben, indem sie über ihre Erfahrungen <strong>und</strong> Erlebnisse im Stadtteil<br />
berichten. In diesen Erzählungen <strong>und</strong> Aussagen können entscheidende Hinweise zur<br />
Entwicklung <strong>und</strong> gegenwärtigen Situation des <strong>Sozialraum</strong>s stecken.<br />
Zielgruppen<br />
Erwachsene, aber teilweise auch ältere Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche (allerdings nur dann,<br />
wenn sie die Funktionen von <strong>Sozialraum</strong>-Schlüsselpersonen o<strong>der</strong> Fachleuten erfüllen,<br />
also über vielfältiges, herausgehobenes <strong>Sozialraum</strong>-Expertenwissen verfügen.)<br />
Zeitaufwand<br />
ca. 30 – 120 Minuten<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
gemütliche, vertrauenerweckende <strong>und</strong> beruhigend wirkende Atmosphäre<br />
Material / Hilfsmittel<br />
evtl. Tonbandgerät o<strong>der</strong> Diktiergerät, Kugelschreiber, Klemmbrett plus DIN-A4-Zettel,<br />
vorbereiteter Interviewleitfaden, kleine Geschenke für die Zielgruppe<br />
Vorteile<br />
Informationen aus <strong>der</strong> Sicht von selber im <strong>Sozialraum</strong> lebenden Personen, komprimierte<br />
Informationsaufnahme aufgr<strong>und</strong> des Expertenstatus <strong>der</strong> Befragten (verdichtete <strong>Sozialraum</strong>kenntnisse<br />
erfassen), Verstehen <strong>der</strong> inneren Struktur des <strong>Sozialraum</strong>s, erste Kontaktaufnahme<br />
mit Einwohnern<br />
Nachteile<br />
Es gibt Raum für Abschweifungen, hoher Auswertungsaufwand bei reinen Tonbandmitschnitten<br />
<strong>und</strong> einer ggf. großen Anzahl von Interviews.<br />
15 Quellen: Stange 2004; Deinet 1999, S. 78<br />
25
Durchführung<br />
Leitfadeninterviews: Da Schlüsselpersonen in <strong>der</strong> Regel über eine Fülle von Informationen<br />
verfügen, welche sie oft in Form unstrukturierter Erzählungen vermitteln, besteht<br />
die Gefahr, dass Gespräche mit ihnen unsystematisch verlaufen <strong>und</strong> wichtige<br />
Informationen nicht erfasst werden. Um dies zu verhin<strong>der</strong>n, ist das Erstellen eines<br />
Interviewleitfadens zur Strukturierung des Gespräches (Interviews) sinnvoll.<br />
Beispiel für eine einfache Strukturierung eines Gesprächs / Interviews:<br />
Geschichtliche Betrachtung (z. B. „Wie war es früher?“), Infrastrukturbereich (z. B.<br />
„Wie ist es jetzt bezogen auf Verkehr, Kultur, Freizeit, Wohnen, Einkaufen?“), ortsrelevante<br />
Schwerpunktthemen (z. B. Kin<strong>der</strong>, Jugendliche, alte Leute, Migranten,<br />
Einkaufsmöglich-keiten?), Zukunftsvisionen (Wie wird es hier in einigen Jahren wohl<br />
aussehen?), Wünsche<br />
Am Anfang des Interviews ist darauf zu achten, dass <strong>der</strong> Interviewte ein wenig Zeit<br />
braucht, um sich an die „Interviewsituation“ zu gewöhnen. Darum ist es empfehlenswert,<br />
am Anfang weniger wichtige Fragen zu stellen, um dem Interviewten den Einstieg<br />
zu erleichtern. Die wichtigen Fragen können dann im weiteren Verlauf des Interviews<br />
gestellt werden.<br />
Bei beson<strong>der</strong>s auskunftsfreudigen Interviewten ist es günstig, diesen vorab (verbal) eine<br />
kurze Übersicht zu geben über die Themen <strong>und</strong> Kategorien, die im Interview auf jeden<br />
Fall angesprochen werden. Der Befragte weiß dann, dass bestimmte Themen, die auch<br />
ihm „unter den Nägeln brennen“, auf jeden Fall noch drankommen <strong>und</strong> braucht das<br />
Gespräch nicht von sich aus darauf zu bringen. Diese Maßnahme kann zu einem<br />
übersichtlichen Interview beitragen.<br />
Der Interviewer muss sich auf sein Gegenüber einlassen <strong>und</strong> den Redefluss nur wenn<br />
nötig unterbrechen (ggf. je nach Stimmungslage nachfragen o<strong>der</strong> neue Fragen stellen).<br />
Die Antworten werden mitgeschrieben (A4-Bögen o<strong>der</strong> Metaplan-Karten), auch per<br />
Tonband o<strong>der</strong> Diktiergerät aufgezeichnet <strong>und</strong> anschließend ggf. vollständig transkribiert<br />
– o<strong>der</strong> selektiv nach bestimmten Kategorien abgehört <strong>und</strong> paraphrasiert (Kurzaussagen)<br />
<strong>und</strong> dabei schriftlich fixiert (z. B. auf Metaplan-Karten).<br />
Ein Son<strong>der</strong>fall <strong>der</strong> Methode sind Cliquenbefragungen am Gruppenort <strong>und</strong> im öffentlichen<br />
Raum (Leitfadeninterview).<br />
4.3.8 Gruppeninterview 16<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Gruppeninterview ist ein strukturiertes Gruppengespräch, bei dem die Leitfragen<br />
anhand eines Interviewleitfadens vorgegeben sind. Ähnlich wie beim Leitfadeninterview<br />
werden Schlüsselpersonen 17 o<strong>der</strong> auch „normale“ Personen aus dem <strong>Sozialraum</strong> eingeladen<br />
<strong>und</strong> in Form eines Gruppengespräches über ihren persönlichen Erfahrungs- <strong>und</strong><br />
Erlebensbereich im Stadtteil o<strong>der</strong> Dorf befragt.<br />
16 Quellen: Stange 2004; Deinet 1999, S. 78<br />
17 Schlüsselpersonen: siehe Leitfadeninterviews mit Schlüsselpersonen.<br />
26
Hierbei fragt <strong>der</strong> Interviewer – wie in einem Einzelinterview – relativ gezielt <strong>und</strong> lässt<br />
den Prozess nicht so offen wie z. B. bei echten Gruppendiskussionen (die mit mehr<br />
Jugendlichen als im Interview mit dem Ziel <strong>der</strong> Erfassung biografisch <strong>und</strong> lebensweltlich<br />
geprägter Einstellungen, Bewertungen etc. <strong>und</strong> weniger zur Faktenerfassung durchgeführt<br />
werden).<br />
Das Gruppeninterview ist sehr ökonomisch, weil in kurzer Zeit sehr viele Informationen<br />
(insb. über Sachverhalte, Fakten, Meinungen <strong>und</strong> Ereignisse) erhältlich sind, die<br />
außerdem auch genauer sind, da sie bereits durch die Gruppe abgestimmt sind. Trotz<br />
dieser korrektiven <strong>und</strong> optimierenden Funktion <strong>der</strong> Gruppe spielt <strong>der</strong> Gruppenprozess<br />
selber keine so große Rolle wie bei einer Gruppendiskussion, wo er für das Ergebnis mit<br />
entscheidend ist. Gruppeninterviews können viele Einzelinterviews ersetzen.<br />
Zielgruppen<br />
Ältere Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Erwachsene, Jugendliche, geschlossene Gruppen (Cliquen), Fokus-<br />
Gruppen (nach bestimmten, alle relevanten Teilgruppen erfassenden Schlüsseln zusammengesetzte<br />
Gruppen in pädagogischen Einrichtungen (Jugendzentrum, Schule usw.)<br />
Gruppengröße<br />
2 bis maximal5 Personen<br />
Zeitaufwand / Dauer<br />
30 – 90 Minuten<br />
Kombinierbar mit folgenden Methoden<br />
Begehung<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
gemütliche <strong>und</strong> beruhigend wirkende Atmosphäre<br />
Material / Hilfsmittel<br />
Tonbandgerät o<strong>der</strong> Diktiergerät, Kugelschreiber, Klemmbrett plus DIN-A4-Zettel,<br />
Metaplan-Karten, vorbereiteter Interviewleitfaden, kleine Geschenke für die Zielgruppen<br />
Vorteile<br />
gezieltes Erheben erwünschter Informationen möglich, ökonomisch, in kurzer Zeit sind<br />
viele Informationen zu erhalten, Gruppenprodukt, reduzierte Kartenmenge, höhere<br />
Qualität <strong>der</strong> Aussagen, Hemmschwelle <strong>der</strong> Befragten fällt eher (Verhalten in einer<br />
Gruppe „Gleichgesinnter“)<br />
Nachteil<br />
Bei einer zu großen Gruppe kommen nicht alle zu Wort, dominierende Leitfiguren<br />
können das Bild verzerren.<br />
Durchführung<br />
Am Anfang des Interviews ist darauf zu achten, dass die Interviewten ein wenig Zeit<br />
brauchen, um sich an die „Interviewsituation“ zu gewöhnen. Darum ist es empfehlens-<br />
27
wert, am Anfang weniger wichtige Fragen zu stellen („Anwärmer“), um den Interviewten<br />
den Einstieg zu erleichtern. Die signifikanteren Fragen können dann im weiteren<br />
Verlauf des Interviews gestellt werden.<br />
Der Interviewer muss sich auf die Interviewten einlassen <strong>und</strong> den Redefluss nur wenn<br />
nötig unterbrechen (ggf. je nach Stimmungslage nachfragen o<strong>der</strong> neue Fragen stellen).<br />
Die erhaltenen Antworten werden mitgeschrieben (z. B. auf A4-Blättern o<strong>der</strong> Metaplan-<br />
Karten), per Tonband o<strong>der</strong> Diktiergerät aufgezeichnet <strong>und</strong> anschließend ggf. vollständig<br />
transkribiert – o<strong>der</strong> selektiv nach bestimmten Kategorien abgehört, paraphrasiert <strong>und</strong><br />
schriftlich fixiert (z. B. auf Metaplankarten).<br />
4.3.9 Subjektive Landkarte 18<br />
Kurzbeschreibung<br />
Mithilfe selbstgemalter bzw. gezeichneter „subjektiver“ Karten werden die Lebensräume<br />
von Kin<strong>der</strong>n, Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen in einem Stadtteil o<strong>der</strong> Dorf sichtbar<br />
gemacht. Die individuellen Bedingungen des Wohnumfeldes, <strong>der</strong> Spielorte usw. werden<br />
bei dieser Methode in ihren lebensweltlichen Bedeutungen erkennbar. Weiterhin können<br />
vorhandene Barrieren, Angsträume <strong>und</strong> vieles mehr sichtbar werden, da die Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
Jugendlichen die Möglichkeit haben, vielfältige Deutungen <strong>der</strong> sozialräumlichen<br />
Zusammenhänge darzustellen.<br />
Zielgruppen<br />
Diese Methode ist für Kin<strong>der</strong>, weniger für Jugendliche, aber durchaus für Erwachsene<br />
geeignet (z. B. retrospektiv: für Großeltern beim Vergleich von Spielräumen früher <strong>und</strong><br />
heute). Sie muss auf den entsprechenden Entwicklungsstand abgestimmt werden.<br />
Jüngere Kin<strong>der</strong> malen oft typische Kin<strong>der</strong>zeichnungen o<strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>. Ältere Kin<strong>der</strong> –<br />
insbeson<strong>der</strong>e Mädchen – fertigen oft schon sehr detaillierte Zeichnungen ihrer Lebenswelt<br />
an. Die Methode sollte nur mit einer kleinen Gruppe (z. B. einer Jungschar-Gruppe)<br />
in einem geschützten Raum durchgeführt werden. Sie erfor<strong>der</strong>t eine 1:1-Interview-<br />
Situation.<br />
Zeitaufwand<br />
ca. 2 St<strong>und</strong>en, dabei ausreichend Zeit für eine spätere Besprechung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>, evtl.<br />
Än<strong>der</strong>ungen sind einzuplanen<br />
Äußere Voraussetzungen<br />
geschlossener Raum, genügend Platz, gute Licht- <strong>und</strong> Luftverhältnisse<br />
Material <strong>und</strong> Hilfsmittel<br />
große DIN-A2-Papierbögen, ggf. festeres Papier (Karton), ausreichend Filz- <strong>und</strong><br />
Buntstifte, Pastell-Kreide<br />
Vorteile<br />
18 Quellen: Deinet / Krisch 2002, S. 141 f.; Stange 2004<br />
28
Die Methode hat eine aktivierende, animierende <strong>und</strong> partizipative Wirkungsweise für<br />
Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Erwachsene, ist niedrigschwellig, erleichtert den Kontakt zu den<br />
unbekannten Intervieweren. Die aktuelle Visualisierung <strong>der</strong> Bedeutung verschiedener<br />
Orte führt zu einer intensiven Kommunikation über den Stadtteil / das Dorf, die<br />
Verbindung von Zeichnen <strong>und</strong> Reden erleichtert Mitteilungen.<br />
Nachteil<br />
Die Abhängigkeit von visuellen Ausdrucksfähigkeiten <strong>der</strong> Ausführenden kann manchmal<br />
die Aussagekraft einschränken.<br />
Durchführung<br />
Die Teilnehmer sollten zu Beginn beson<strong>der</strong>s motiviert <strong>und</strong> animiert werden. Die Gruppe<br />
<strong>der</strong> einzeln <strong>und</strong> simultan befragten Kin<strong>der</strong> muss ohne große Ablenkung genügend Zeit<br />
für die Anfertigung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> zur Verfügung haben.<br />
Die Interviewer müssen den Kin<strong>der</strong>n (Erwachsenen) vermitteln, dass es nicht nur um<br />
eine grobe geografische Karte des jeweiligen <strong>Sozialraum</strong>s geht, son<strong>der</strong>n primär um die<br />
persönlich <strong>und</strong> subjektiv gefärbte Darstellung <strong>der</strong> eigenen Lebenswelt.<br />
1. Schritt: Einstieg, Zeichnung, Nachfragen<br />
Erklärung <strong>der</strong> Methode, Zeichnung des eigenen Wohnhauses, <strong>der</strong> Wohnung o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Straße, Malen <strong>der</strong> unmittelbaren Wohnumgebung, die den Kin<strong>der</strong>n (Erwachsenen)<br />
wichtig ist. Maßstäbe – also die tatsächlichen Entfernungen – spielen keine Rolle. Orte<br />
<strong>und</strong> Räume sollen in <strong>der</strong> subjektiven Bedeutung für jeden Einzelnen gemalt werden.<br />
Nach einer unbeeinflussten Zeichen- <strong>und</strong> Erzählphase können durch Nachfragen <strong>und</strong><br />
aktives Zuhören ergänzende Informationen zutage geför<strong>der</strong>t werden (Interviewsituation)<br />
<strong>und</strong> zu interessanten subjektiven Landkarten führen. Wichtig ist die ganze Zeit über das<br />
Anfertigen schriftlicher Notizen (Protokoll) durch den jeweiligen Interviewer.<br />
2. Schritt:<br />
Die Bil<strong>der</strong> werden in Kleingruppen präsentiert, aufgehängt, miteinan<strong>der</strong> verglichen <strong>und</strong><br />
durch Nachfragen konkretisiert. Je<strong>der</strong> Teilnehmer stellt sein Bild <strong>und</strong> die Bedeutung<br />
desselben vor, wobei die an<strong>der</strong>en Fragen stellen dürfen. Weitere Details (Orte <strong>und</strong><br />
Räume, auf die man im Gespräch gekommen ist) werden nachträglich eingetragen. Diese<br />
können mit an<strong>der</strong>en Farben gekennzeichnet werden.<br />
3. Schritt:<br />
Ggf. Bewertung von gemalten Orten in den subjektiven Landkarten anhand von Klebepunkten<br />
(beson<strong>der</strong>s bedeutsame Orte). Der Einsatz unterschiedlicher Farben kann<br />
positive <strong>und</strong> negative Orte kennzeichnen.<br />
4. Schritt:<br />
Auswertung <strong>und</strong> Interpretation <strong>der</strong> Karten durch das Forscherteam. Die während des<br />
Zeichnens <strong>und</strong> des Gesprächs angefertigten Notizen (auf DIN-A4-Bögen o<strong>der</strong> Metaplan-<br />
Karten), die ja Ergebnischarakter wie im klassischen Interview haben, werden systematisch<br />
ausgewertet (paraphrasiert auf Metaplankarten geschrieben <strong>und</strong> geordnet).<br />
Die Schritte 2 <strong>und</strong> 3 können auch übergangen werden. Dann ist <strong>der</strong> Ergebnischarakter<br />
entscheidend <strong>und</strong> nicht so sehr die Funktion als pädagogische Aktion.<br />
29
4.3.10 Weitere Methoden<br />
Nicht beschrieben wurden folgende Methoden, die in vielen <strong>Praxis</strong>situationen ebenfalls<br />
eine hervorragende Rolle spielen können:<br />
Bewegungsstadtplan: Der <strong>Sozialraum</strong> wird mit Farbe als Stadtteilkarte auf dem Schulhof<br />
visualisiert <strong>und</strong> die Jugendlichen werden dann in diesem begehbaren Modell befragt<br />
(Magistrat <strong>der</strong> Stadt Witzenhausen / Landesjugendamt Hessen 2000).<br />
Spielplatz-Test: Kin<strong>der</strong> prüfen anhand von Checklisten Spielplätze ihrer Umgebung.<br />
Stadtteilforscher-Aktionen mit Kin<strong>der</strong>n: nicht als Zeige- <strong>und</strong> Begehungsform, son<strong>der</strong>n<br />
als systematische Untersuchung des Stadtteils durch Kin<strong>der</strong><br />
Foto-Stadtplan: Wichtige Orte aus dem <strong>Sozialraum</strong> sind auf Fotos vergrößert auf Mo<strong>der</strong>ationstafeln<br />
visualisiert <strong>und</strong> bilden den Stadtteil nach. Interviews <strong>und</strong> Bepunktungs-<br />
Aktionen an <strong>der</strong> jeweiligen Station, Bewertung von Orten z. B. durch ein Polaritätsprofil<br />
usw.<br />
Weitere Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>, die in <strong>der</strong> jüngsten Zeit an<br />
<strong>der</strong> Universität Lüneburg völlig neu entwickelt, erfolgreich evaluiert <strong>und</strong> in die <strong>Praxis</strong><br />
implementiert wurden:<br />
Bewegungsinterview: Großgruppenmethode, einem Spiel aus dem Kin<strong>der</strong>-TV („1, 2 o<strong>der</strong><br />
3“) nachgebildet. Nachdem eine Leitfrage gestellt wurde, hüpfen die Kin<strong>der</strong> auf<br />
verschiedenen Antwort-Fel<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Turnhalle hin <strong>und</strong> her. Wenn sie sich für ein<br />
Antwortfeld entschieden haben, werden sie jeweils noch kurz zu ihrer Entscheidung<br />
befragt.<br />
Schneller <strong>Sozialraum</strong>-Check: ebenfalls eine Großgruppenmethode, bei <strong>der</strong><br />
Interviewfragen auf Metaplanwänden visualisiert sind. Die Teilnehmenden beantworten<br />
die Fragen auf Karten (quasi im Selbstinterview bzw. Karteninterview).<br />
<strong>Sozialraum</strong>werkstatt: nach dem Muster einer eintägigen Zukunftswerkstatt mit einer<br />
Fokusgruppe von jugendlichen <strong>und</strong> erwachsenen Experten. Alle Informationen werden<br />
in einer einzigen Veranstaltung erhoben.<br />
Objektive Landkarte (Punktmethode): Auf vergrößerten Stadtteilplänen werden Punkte<br />
geklebt als Antwort auf sozialräumliche Fragen (Treffpunkte, gefährliche Orte,<br />
Bewegungsdiagramme usw.).<br />
Aktivieren<strong>der</strong> Poster-Fragebogen: auf Metaplan-Tafeln vergrößerte Fragebögen. Nach<br />
einer Bepunktung liegt das Ergebnis sofort vor.<br />
Diese fünf Methoden werden im nächsten Beitrag des vorliegenden Bandes (Baustein<br />
A. 12 „Innovativ <strong>und</strong> effektiv: Neue qualitative Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Lebensweltanalyse</strong>“) genauer beschrieben.<br />
4.3.11 Zur strategischen Einbindung <strong>der</strong> qualitativen, insb. <strong>der</strong> ethnografischen<br />
Methoden<br />
Die beschriebenen qualitativen Methoden werden je nach Zielsetzung <strong>und</strong> Rahmenbedingungen<br />
ganz unterschiedlich eingesetzt. Auf die strategische Einbindung solcher<br />
Methoden in eine umfassende <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> kann hier nicht weiter<br />
30
eingegangen werden. Erste Hinweise sind im ersten Gr<strong>und</strong>lagenartikel in diesem Band<br />
(dort Abschnitt 3.4) enthalten. Skizziert seien an dieser Stelle lediglich zwei Beispiele:<br />
Beispiel 1<br />
Man kann z. B. die Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> – insbeson<strong>der</strong>e<br />
die qualitativen – beson<strong>der</strong>s gut im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen zur Konzeptionsentwicklung<br />
erproben:<br />
Im Rahmen einer größeren <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> für eine Konzeptionsentwicklung<br />
<strong>der</strong> Einrichtung stellt das Team eines Jugendhauses einen Befragungsplan mit<br />
einer Auswahl <strong>der</strong> Methoden <strong>und</strong> Zielgruppen (erwachsene Schlüsselpersonen <strong>und</strong><br />
Jugendliche in <strong>und</strong> außerhalb <strong>der</strong> Einrichtung) zusammen.<br />
Die Befragungen werden im Rahmen mehrerer Fortbildungsveranstaltungen (Inhouse)<br />
durchgeführt <strong>und</strong> ausgewertet: z. B. vier Begehungen mit Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen,<br />
Nadelmethode im Jugendzentrum (Besucher- <strong>und</strong> Nutzeranalyse), Fremdbild-<br />
Erk<strong>und</strong>ung durch Straßeninterviews von Jugendlichen mit Jugendlichen, Cliquenbefragungen<br />
am Gruppenort (Leitfadeninterview), Objektive Landkarte / Punktmethode im<br />
Jugendzentrum <strong>und</strong> auf dem Marktplatz auf Dialogwänden, Gruppeninterviews von<br />
Jugendlichen im Jugendzentrum <strong>und</strong> in Schulen.<br />
Die Auswertung (siehe Abschnitt 5) erfolgt durch Transkription, Paraphrasierung usw. –<br />
ggf. ökonomisch per Metaplan. Die Ergebnisse werden mit denen <strong>der</strong> Fragebogenaktion<br />
verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> interpretiert, bewertet <strong>und</strong> mit Schlussfolgerungen (Handlungsempfehlungen)<br />
für die Konzeptionsentwicklung versehen. Sie werden dann in einer längeren<br />
Dokumentation fixiert, mit einer Zusammenfassung versehen <strong>und</strong> gedruckt. Eine komprimierte<br />
Powerpoint-Präsentation mit einem Extrakt <strong>der</strong> wichtigsten Ergebnisse wird<br />
hergestellt. Beides wird öffentlich präsentiert.<br />
Beispiel 2:<br />
Man kann die beschriebenen qualitativen Methoden auch einsetzen im Rahmen des<br />
PRA-Ansatzes (Participatory Rapid Appraisal – Schnelle Partizipatorische Datenerhebung),<br />
einer Methode aus <strong>der</strong> Entwicklungshilfe, die an <strong>der</strong> Universität Lüneburg<br />
erfolgreich für Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ersten Welt adaptiert wurde (siehe dazu Stange 2008). Dabei<br />
untersucht z. B. ein studentisches Forscherteam in einem einwöchigen intensiven Feldaufenthalt<br />
einen <strong>Sozialraum</strong> mit dem gesamten Arsenal an ethnografischen Methoden,<br />
wertet die Daten gleich vor Ort gemeinsam aus <strong>und</strong> präsentiert die Ergebnisse – einschließlich<br />
erster Empfehlungen – den Einwohnern <strong>und</strong> Einwohnerinnen in einer<br />
öffentlichen Veranstaltung am Ende <strong>der</strong> Woche (auf Metaplan-Postern <strong>und</strong> als Powerpoint-Präsentation,<br />
ggf. auch schon mit <strong>der</strong> fertigen schriftlichen Dokumentation).<br />
Für die Untersuchung als Feldaufenthalt z. B. in einem fremden Stadtteil o<strong>der</strong> Dorf wird<br />
ein größeres Team von z. B. 10 – 20 Personen (Fortbildungskurs, Studenten o. Ä.)<br />
benötigt, das ca. eine Woche in diesem Stadtteil o<strong>der</strong> Ort lebt.<br />
5. Die Auswertung von qualitativ gewonnenem Wissen<br />
Qualitative Daten lassen sich auswerten, indem komplette Abschriften <strong>der</strong> Interviews<br />
angefertigt werden. Anschließend werden diese Abschriften mit einem qualitativen<br />
31
Auswertungsprogramm (z. B. MaxQDA) Satz für Satz kodiert <strong>und</strong> auf dem Hintergr<strong>und</strong><br />
eines dabei entstehenden Code-Baumes strukturiert.<br />
Die Ergebnisse dieser üblichen Art von Transkription, Paraphrasierung, Kategorienbildung<br />
usw. werden – wie im obigen ersten Beispiel beschrieben – interpretiert, bewertet<br />
<strong>und</strong> mit Schlussfolgerungen (Handlungsempfehlungen) versehen.<br />
Die aufwändige klassische Methode <strong>der</strong> Auswertung mit kompletten Abschriften ist im<br />
Rahmen eines Feldaufenthaltes nach <strong>der</strong> erwähnten Methode PRA (Participatory Rapid<br />
Appraisal – Schnelle partizipatorische Datenerhebung, unserem zweiten Beispiel)<br />
weniger praktikabel. Gut geeignet, erprobt, schnell <strong>und</strong> unaufwändig ist aber die folgende<br />
Methode, eine innovative Metaplan-Methode (Visualisierung): Beim Auswertungsverfahren<br />
wird auf die Transkription verzichtet. Die Tonbän<strong>der</strong> bzw. Mitschriften<br />
werden selektiv ausgewertet, indem ohne Umwege die wesentlichen Aussagen gleich<br />
paraphrasiert auf Metaplan-Karten geschrieben <strong>und</strong> zügig nach den Mo<strong>der</strong>ationsvorschriften<br />
geordnet sowie geclustert werden (am besten jeweils zu zweit).<br />
Die Teams werten ihre Ergebnisse <strong>der</strong> verschiedenen Methoden parallel aus, sodass man<br />
schnell ein Gesamtergebnis hat. Dabei gilt dieses Verfahren nicht nur für Interviews,<br />
son<strong>der</strong>n sinngemäß auch für alle an<strong>der</strong>en unter 4. genannten Methoden <strong>und</strong> wird häufig<br />
auch im Rahmen von Konzepten wie im ersten Beispiel angewendet.<br />
<strong>Praxis</strong>tipps zur Auswertung<br />
Zur Auswertungsvariante „Übertragung auf Metaplan-Karten“ 19 : (nachträgliche<br />
schnelle Paraphrasierung – ohne vollständige Abschriften) plus Strukturierung /<br />
Clusterung<br />
1. Für jeden Methodenkontakt zunächst separat auswerten:<br />
• Material sichten (abhören, ansehen u. Ä.)<br />
• Dabei beson<strong>der</strong>s auffällige Stellen merken <strong>und</strong> kennzeichnen.<br />
• Die Textmenge reduzieren! In eigenen Worten den Kern verkürzt<br />
zusammenfassen („paraphrasieren“). Statt ganzer Sätze aus den Notizen <strong>und</strong><br />
aus <strong>der</strong> Erinnerung heraus Kurzaussagen (aber nicht nur ein einzelnes<br />
Stichwort) auf Metaplan-Karten nach den bekannten Metaplanregeln<br />
formulieren. Diese Kurzaussagen müssen aber für sich allein verständlich sein.<br />
Also z. B. auf die Frage „Wie ist das soziale Klima in Amelinghausen?“ nicht<br />
einfach auf die Karte schreiben „gut“, son<strong>der</strong>n: „Soziales Klima in<br />
Amelinghausen gut“. Denn die ursprüngliche Frage ist ja beim späteren<br />
Zusammenstecken mit an<strong>der</strong>en Karten nicht mehr vorhanden <strong>und</strong> <strong>der</strong> Sinn bei<br />
<strong>der</strong> zu knappen Formulierung für Dritte nicht mehr erkennbar.<br />
Unter folgenden Gesichtspunkten auswerten, z. B.:<br />
• Was ist den Befragten wichtig bzw. beson<strong>der</strong>s wichtig (zentrale Aussagen)?<br />
• markante Auffälligkeiten<br />
19 Die Variante EDV-gestützte Verfahren, z. B. über das Programm MaxQDA, wird – obwohl durchaus<br />
hocheffektiv – hier ausgespart, weil es für schnelle sozialarbeiterische Aktionen im Feld, die sofort ein<br />
präsentables Ergebnis sämtlicher Arbeitsgruppen erzeugen müssen, nicht so praktikabel <strong>und</strong> bei aller<br />
gr<strong>und</strong>sätzlichen Effizienz <strong>und</strong> Genauigkeit doch nicht so schnell <strong>und</strong> vor Allem nicht so motivierend ist.<br />
32
• Parallelitäten<br />
• Häufigkeiten, Wie<strong>der</strong>holungen<br />
• Einzelaussagen in ihrer Bedeutung zur Gesamtaussage bewerten<br />
• Dabei an die Relevanz für die anliegenden Themen <strong>und</strong> die vorab festgelegte<br />
Fragerichtung (Hypothesen) denken! Also nur wesentliche Erkenntnisse<br />
weiterverarbeiten!<br />
Offenes Ordnungs- <strong>und</strong> Strukturierungsverfahren:<br />
• Die Karten auf Metaplan-Tafeln schrittweise ordnen („clustern“): Karten<br />
anstecken nach <strong>der</strong> Maßgabe „Was gehört inhaltlich zusammen?“ Nach <strong>und</strong><br />
nach entstehen Schwerpunkte (Kartenhäufchen) <strong>und</strong> eine Struktur, die vorab<br />
noch nicht unbedingt deutlich war. Also keine Ordnungskategorien vorab<br />
festlegen. Die entstehen im Prozess von allein (in <strong>der</strong> Metaplansprache heißt<br />
dies ja „Induktives Systematisieren“).<br />
• Drst zum Schluss diese „Cluster“ mit einem dicken Stift umrahmen <strong>und</strong> mit<br />
zusammenfassenden Oberbegriffen (Kategorien) versehen (auf mittleren<br />
weißen Kreisen). Bei großen Aussagenmengen können mehrere solcher Cluster<br />
auch zu „Hauptclustern“ verb<strong>und</strong>en werden, sog. Themen. Genügend Platz<br />
einplanen auf je<strong>der</strong> Tafel. Je nach Aussagenmenge genügend Tafeln<br />
bereithalten.<br />
• Zusammenfassende Einschätzung / Bewertung, z. B. in einer markanten<br />
zusammenfassenden Aussage (ggf. auch als These)<br />
2. Bei Unklarheiten ggf. noch einmal die Bän<strong>der</strong> abhören <strong>und</strong> Karten ergänzen, ersetzen,<br />
abän<strong>der</strong>n (also durch Bän<strong>der</strong> gestützte Verarbeitung).<br />
3. Bei Fragebögen, Karten / Plänen u. Ä. ggf. zusammenfassen (z. B. Auszählen von<br />
Ergebnissen, Übertragen in eine gemeinsame Karte usw.) <strong>und</strong> zusätzlich Kurzaussagen<br />
auf Metaplan-Karten zu den Ergebnissen.<br />
4.Zusammenführen <strong>der</strong> verschiedenen Einzelauswertungen paralleler Methodenkontakte<br />
(z. B. von mehreren Interviews mit <strong>der</strong>selben Zielgruppe) sinngemäß, wie unter<br />
Punkt 1 beschrieben. Genau dies wäre durch reine schriftliche Ausformulierung mit<br />
vollständigen Sätzen (außer durch ein EDV-gestütztes Verfahren) ohne das Metaplan-<br />
Verfahren nur sehr schwer möglich <strong>und</strong> aufwändig. Schon allein deshalb wird hier die<br />
letzte Variante empfohlen. Im Übrigen ist die Visualisierung durch gemeinsame<br />
Bearbeitung von Mo<strong>der</strong>ationstafeln eine große Erleichterung für Kommunikationsprozesse<br />
im Team <strong>und</strong> erhöht die Beurteiler-Übereinstimmung spektakulär.<br />
5. Die Einzelauswertungen verschiedener Methodenkontakte (z. B. Interview <strong>und</strong><br />
Begehung <strong>und</strong> Spielplatz-Test) mit <strong>der</strong>selben Zielgruppe sollten immer zunächst einmal<br />
getrennt dokumentiert werden. Sie können aber, wenn dies praktikabel ist – <strong>und</strong> wenn es<br />
um dieselben Inhalte ging – unter Umständen in größeren inhaltlichen Clustern<br />
zusammengefasst werden. Dazu werden die Cluster <strong>der</strong> einzelnen Methodenkontakte<br />
zusammengesteckt (neu geordnet) auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Oberbegriffe. Eventuell sind nun<br />
neue Oberbegriffe zu bilden bzw. werden Cluster zu „Hauptclustern“ zusammengeführt,<br />
zu sogenannten „Themen“. Diese Zusammenstellung soll aber möglichst lange noch den<br />
Vergleich zwischen den verschiedenen Methodenzugängen zum selben Thema erlauben<br />
(Gegenübergestellung). Mit dem Mixen von Einzelkarten also zunächst einmal vor-<br />
33
sichtig <strong>und</strong> sparsam sein. Es sei denn, man hat von vornherein darauf geachtet, für die<br />
einzelnen Methodenzugänge unterschiedliche Kartenfarben zu verwenden. Erst jetzt<br />
werden die Karten endgültig geklebt.<br />
6. Die Auswertungen verschiedener Zielgruppen (z. B. von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Erwachsenen)<br />
werden nicht gemischt zusammengeführt, son<strong>der</strong>n nur verglichen.<br />
6. Möglichkeiten für ein vereinfachtes Vorgehen<br />
• Die vielfältigen Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>analyse werden über einen längeren<br />
Zeitraum verteilt <strong>und</strong> „häppchenweise“ während <strong>der</strong> regulären Arbeitszeit abgearbeitet.<br />
• Es werden nur wenige Methoden in <strong>der</strong> jeweiligen Kategorie erprobt.<br />
• Es erfolgt eine Konzentration allein auf die Methode „Gruppeninterview“ o<strong>der</strong><br />
„Gruppendiskussion“ (mit Fokusgruppen) <strong>und</strong> nur wenige Einsätze.<br />
• Beim Auswertungsverfahren wird auf die Transkription verzichtet: Die Tonbän<strong>der</strong><br />
bzw. Mitschriften werden (wie unter 5. beschrieben) selektiv ausgewertet,<br />
indem ohne Umwege die wesentlichen Aussagen gleich endgültig<br />
paraphrasiert auf Metaplan-Karten geschrieben werden <strong>und</strong> zügig nach den<br />
Metaplan-Vorschriften geordnet <strong>und</strong> geclustert werden (am besten zu zweit).<br />
Das ist erfahrungsgemäß eine enorme Vereinfachung <strong>und</strong> Effizienzsteigerung.<br />
• Es gibt keine große anspruchsvolle (Gesamt-) Dokumentation, ggf. aber durchaus<br />
Präsentationen, wenn auch in kleinerem Rahmen. Die Dokumentation <strong>und</strong><br />
Präsentation erfolgt direkt mit den Auswertungstafeln z. B. innerhalb <strong>der</strong><br />
<strong>Sozialraum</strong>-Fortbildungsveranstaltung.<br />
Weitere strategische Möglichkeiten:<br />
• Die gesamte Aktion wird delegiert an eine externe Einrichtung (Planungsbüro,<br />
Hochschule).<br />
• Die gesamte Aktion wird als Ferienpassaktion zusammen mit engagierten<br />
Jugendlichen als Forscher durchgeführt (einschließlich Interview-Training) im<br />
Rahmen <strong>der</strong> normalen Arbeitszeit.<br />
• Es wird die Methode <strong>der</strong> „<strong>Sozialraum</strong>werkstatt“ gewählt nach dem Muster einer<br />
eintägigen Zukunftswerkstatt mit jeweils einer parallelen Fokusgruppe von<br />
jugendlichen <strong>und</strong> erwachsenen Experten (alle Informationen in jeweils einer<br />
einzigen Veranstaltung erhoben).<br />
• Es wird allein die Methode „<strong>Sozialraum</strong>-Check“ (Delphi-Methode auf Metaplan-Tafeln)<br />
realisiert.<br />
• Es werden Einzelprojekte <strong>und</strong> Einzelmethoden herausgelöst (wie Kin<strong>der</strong>stadtplan,<br />
<strong>Sozialraum</strong>-Video, Nadelmethode) <strong>und</strong> als einzelnes partizipatives Projekt<br />
gestaltet, insb. für kleinere Verwendungszwecke (als Aktion im Rahmen des<br />
Standardangebotes o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ferienpassaktion, aber auch als Beitrag zur Programmplanung).<br />
• Es wird allein die Methode „Poster-Fragebogen“ realisiert (Fragebögen<br />
vergrößert auf Metaplan-Tafeln, Bepunktung, Ergebnis liegt sofort vor).<br />
34
7. Zusammenfassung<br />
Die drei großen <strong>Bausteine</strong> einer umfassenden <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> sind:<br />
1. Sozialstrukturanalyse – Erfassung aller relevanten sozialstatistischen Daten<br />
für den <strong>Sozialraum</strong><br />
Das Vorliegen verlässlicher, aktueller Informationen (die geeignet sind, einen<br />
<strong>Sozialraum</strong> statistisch zu beschreiben <strong>und</strong> auf Problembereiche hinzuweisen) ist die<br />
Gr<strong>und</strong>lage für effektives Handeln vor Ort. Der Begriff Sozialstrukturanalyse steht für<br />
das gezielte Ermitteln dieser Daten, bezogen auf den konkreten Stadtteil o<strong>der</strong> die<br />
Gemeinde. Sind die tatsächlichen Rahmenbedingungen erfasst, können Aussagen über<br />
die sozialräum-lichen Lebensverhältnisse abgeleitet <strong>und</strong> Vergleiche mit an<strong>der</strong>en<br />
Gemeinden / Stadtteilen angestellt werden, vor allem mit solchen gleicher Größe. Da es<br />
keine fachlich abgesicherten, absolut gültigen Vergleichsskalen gibt, muss man beim<br />
Vergleich auf die Mittelwerte des Kreises, des Landes o<strong>der</strong> des B<strong>und</strong>es zurückgreifen,<br />
um z. B. Hinweise auf Benachteiligungen bestimmter sozialer Gruppen o<strong>der</strong> die<br />
Unterversorgung mit bestimmten Angeboten zu erhalten.<br />
Das Ergebnis <strong>der</strong> Sozialstrukturanalyse ist die <strong>Sozialraum</strong>beschreibung. Eine Sozialstrukturanalyse<br />
sollte regelmäßig fortgeschrieben werden. Die wie<strong>der</strong>holte Erhebung zu<br />
einem späteren Zeitpunkt lässt auch Verän<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Entwicklungen erkennen.<br />
Gerade die sich wandelnden Lebensumstände von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Familien, auch<br />
soziale Abstiege, können mit diesem regelmäßig angewandten Instrument erfasst<br />
werden. Öffentliche <strong>und</strong> freie Träger erhalten wertvolle Fingerzeige, worauf sich ihre<br />
Aktivitäten <strong>und</strong> Ressourcen sinnvollerweise konzentrieren können.<br />
Als Quelle für sozial-relevante Daten kommen z. B. infrage: Jugendämter, Sozialämter,<br />
Gemeindeverwaltungen, Polizei, die Agentur für Arbeit sowie das Landesamt für<br />
Statistik.<br />
2. Die quantitative Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendbefragung – Fragebögen für Kin<strong>der</strong>,<br />
Jugendliche <strong>und</strong> Erwachsene<br />
Das wohl am häufigsten eingesetzte Instrument <strong>der</strong> Datenerhebung sind Fragebögen,<br />
weil mit ihnen gut auswertbares Zahlenmaterial ermittelt werden kann, das systematische<br />
Vergleiche zulässt. Ein Fragebogen kann als „stark strukturierte Befragung“<br />
betrachtet werden. Die Entwicklung eines Fragebogens erfor<strong>der</strong>t eine oft unterschätzte<br />
Vorbereitungszeit <strong>und</strong> setzt sorgfältige, systematische Planung voraus. Ist die Fragenreihe<br />
erst einmal erstellt <strong>und</strong> stimmig, kann aber mit wenig Aufwand eine große Anzahl<br />
Auskunftswilliger erreicht werden. Für die Auswertung standardisierter Fragebögen<br />
empfiehlt es sich, auf ein geeignetes EDV-gestütztes Statistikprogramm zurückzugreifen.<br />
Beim Erstellen eines Fragebogens ist vieles zu beachten, z. B.:<br />
• die Anordnung <strong>der</strong> Fragen <strong>und</strong> Fragentypen<br />
• Aufbau <strong>und</strong> Länge abhängig von Gegenstand <strong>und</strong> Zielen<br />
• i. d. R. max. 45 Minuten, max. 55 Fragen<br />
• Verständlichkeit für die Befragten<br />
35
• Regel: „Das Beson<strong>der</strong>e folgt dem Allgemeinen, das Komplizierte dem<br />
Einfachen.“<br />
3. Die qualitativen Untersuchungsmethoden<br />
Sie dienen dem Versuch, subjektive Lebenswelten <strong>der</strong> Bewohner eines <strong>Sozialraum</strong>s<br />
nachvollziehbar zu machen. Es geht also nicht um die Erfassung statistischen Datenmaterials,<br />
son<strong>der</strong>n um die ganzheitliche Betrachtung <strong>der</strong> sozialen Fel<strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
Lebenswelten <strong>und</strong> <strong>der</strong> in ihnen enthaltenen Beziehungen <strong>und</strong> Subjektivitäten.<br />
Zu beachten:<br />
• arbeitsintensive Vor- <strong>und</strong> Nachbereitungen<br />
• Dauer <strong>und</strong> Ertrag <strong>der</strong> Durchführung sind schlechter einschätzbar als z. B. bei<br />
Fragebögen.<br />
• Gefahr von „Missing data“: Checklisten benutzen, da sonst Gefahr des Auslassens<br />
wichtiger Punkte besteht<br />
• Gefahr <strong>der</strong> Quasi-Quantifizierung durch nicht aussagefähige bzw. ungenaue<br />
Komparative <strong>und</strong> Typisierungen<br />
• Untersuchungsbasis: je komplexer das Thema, desto größer die Anzahl <strong>der</strong><br />
Befragten. Problem: Unübersichtlichkeit, Fallzahlen nicht zu bewältigen (dann<br />
lieber Beschränkung auf Teil-Thema)<br />
Die Ergebnisse einer qualitativen Bedürfnis- <strong>und</strong> Bedarfsermittlung sind beson<strong>der</strong>s<br />
wertvoll als Gr<strong>und</strong>lage für die Erstellung von Konzeptentwicklungen in <strong>der</strong> Jugendhilfe.<br />
Die qualitativen Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> werden oft in<br />
Zusammenhang mit den Ethnografischen Methoden <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />
gebracht. Die Methodik <strong>der</strong> Ethnografie – etwa die Teilnehmende Beobachtung – ist<br />
angelehnt an das neugierige Erforschen frem<strong>der</strong> Zivilisationen.<br />
Um die oft ungewohnten <strong>und</strong> fremdartig erscheinenden Gewohnheiten jugendlicher<br />
Peer-Groups kennenzulernen <strong>und</strong> besser zu verstehen, ist dieser Ansatz für die Jugendarbeit<br />
adaptiert worden. Ethnografische Methoden, die dabei zum Einsatz kommen, sind:<br />
• Strukturierte <strong>Sozialraum</strong>begehung<br />
• Teilnehmende Beobachtung<br />
• Befragung an Kommunikations- <strong>und</strong> Dialogwänden<br />
• Subjektive Landkarten<br />
• Nadeluntersuchung<br />
• Offene Befragungen<br />
• Fremdbild-Erk<strong>und</strong>ung<br />
• Gruppeninterview<br />
• Cliquen-Kataster / Jugendkulturen-Kataster<br />
• Leitfadeninterviews mit Schlüsselpersonen<br />
36
8. Literatur<br />
Appel, Michael / Stötzel, Angelika (1999): Ethnographische Methoden in <strong>der</strong> Jugendarbeit.<br />
Unveröff. Papier. Hannover<br />
Baacke, Dieter (1980): „Der sozialräumliche Ansatz zur Beschreibung <strong>und</strong> Erklärung<br />
des Verhaltens Jugendlicher“. In: deutsche jugend. Heft 11/1980<br />
Baacke, Dieter (1993): Die 6- bis 12-Jährigen. Einführung in Probleme des Kindesalters.<br />
5. Auflage. Weinheim <strong>und</strong> Basel<br />
Behnken, Imbke / Lutz, Manuela / Zinnecker, Jürgen (1997): „Narrative Landkarten“.<br />
In: Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch<br />
Qualitative Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim<br />
Blinkert, Baldo (1993): Aktionsräume von Kin<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Stadt. Eine Untersuchung im<br />
Auftrag <strong>der</strong> Stadt Freiburg. Pfaffenweiler<br />
Bohn, Irina / Kreft, Dieter / Segel, Gerhard (1997): Kommunale Gewaltprävention. Eine<br />
Handreichung für die <strong>Praxis</strong>. Das Aktionsprogramm gegen Aggression <strong>und</strong> Gewalt.<br />
Münster<br />
Böhnisch, Lothar (1994): Gespaltene Normalität. Lebensbewältigung <strong>und</strong> Sozialpädagogik<br />
an den Grenzen <strong>der</strong> Wohlfahrtsgesellschaft. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Böhnisch, Lothar / Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore (2002): „Räume,<br />
Zeiten, Beziehungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ort <strong>der</strong> Jugendarbeit“. In: deutsche Jugend. 50.<br />
Jahrgang, Heft 2/2002<br />
Böhnisch, Lothar / Funk, Heide (1989): Jugend im Abseits? Zur Lebenslage Jugendlicher<br />
im ländlichen Raum. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Böhnisch, Lothar / Münchmeier, Richard (1990): Pädagogik des Jugendraums. Zur<br />
Begründung <strong>und</strong> <strong>Praxis</strong> einer sozialräumlichen Jugendpädagogik. Weinheim <strong>und</strong><br />
München<br />
Braun, Karl-Heinz (1994): „Schule <strong>und</strong> Sozialarbeit in <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierungskrise“. In:<br />
Neue <strong>Praxis</strong>, 2/1994<br />
BMJFFG – B<strong>und</strong>esministerium für Jugend, Familie, Frauen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Hrsg.<br />
(1990): Achter Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendbericht. Bericht über Bestrebungen <strong>und</strong><br />
Leistungen <strong>der</strong> Jugendhilfe. Bonn<br />
Deinet, Ulrich (1996): „Sozialräumliche Konzeptentwicklung“. In: Deinet, Ulrich /<br />
Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (1996): Konzepte entwickeln. Reihe <strong>Praxis</strong>hilfen für<br />
die Jugendarbeit. Weinheim<br />
Deinet, Ulrich (1998): Das sozialräumliche Muster in <strong>der</strong> Offenen Jugendarbeit. In:<br />
Deinet, Ullrich / Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch Offene Jugendarbeit,<br />
Münster<br />
Deinet, Ulrich (1998): „Aneignung <strong>und</strong> Sozialer Raum. Prämissen einer jugendorientierten<br />
Offenen Jugendarbeit“. In: Kiesel, Doron / Scherr, Albert / Thole, Werner.<br />
Hrsg. (1998): Standortbestimmung Jugendarbeit. Theoretische Orientierungen <strong>und</strong><br />
empirische Bef<strong>und</strong>e. Schwalbach<br />
Deinet, Ulrich (1999): Sozialräumliche Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung zur<br />
Konzeptentwicklung in <strong>der</strong> Offenen Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit. Opladen<br />
Deinet, Ulrich (2002): „,Aneignung’ <strong>und</strong> ,Lebenswelt’ – <strong>der</strong> sozialräumliche Blick <strong>der</strong><br />
Jugendarbeit“. In: Merten, Roland. Hrsg. (2002): <strong>Sozialraum</strong>orientierung. Zwischen<br />
fachlicher Innovation <strong>und</strong> rechtlicher Machbarkeit. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
37
Deinet, Ulrich / Krisch, Richard (2002): Der sozialräumliche Blick <strong>der</strong> Jugendarbeit.<br />
Methoden <strong>und</strong> <strong>Bausteine</strong> zur Konzeptentwicklung <strong>und</strong> Qualifizierung. Opladen<br />
Deinet, Ulrich. / Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (1996): Konzepte entwickeln.<br />
Anregungen <strong>und</strong> Arbeitshilfen zur Klärung <strong>und</strong> Legitimation. Reihe <strong>Praxis</strong>hilfen für<br />
die Jugendarbeit. Weinheim<br />
Deinet, Ulrich / Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (1998): Handbuch Offene Jugendarbeit.<br />
Münster<br />
Deinet, Ulrich / Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (2000): Jugendarbeit auf dem Land.<br />
Opladen<br />
Deutscher Verein für öffentliche <strong>und</strong> private Fürsorge. Hrsg. (1997): Fachlexikon <strong>der</strong><br />
sozialen Arbeit. 4. Auflage. Frankfurt am Main<br />
Diekmann, Andreas ( 2005): Empirische Sozialforschung. Gr<strong>und</strong>lagen, Methoden,<br />
Anwendungen. 13. Auflage. Reinbek bei Hamburg<br />
Dinger, Gerhard / Franke, Björn (2004): Der Aufmischer. einmischen – mitmischen –<br />
aufmischen. Tübingen<br />
Dubiel, Marion / Haimerl, Matthias (1997): Gemeinde für Kin<strong>der</strong> – Gemeinde für alle.<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>fre<strong>und</strong>lichkeitsprüfung – dargestellt am Beispiel <strong>der</strong><br />
Gemeinde Schaffl<strong>und</strong>. Unveröff. Diplomarbeit. Lüneburg<br />
Eichholz, Reinald (2001): „Verstetigung einer Beteiligungskultur? – Politische <strong>und</strong><br />
rechtliche Rahmenbedingungen“. In: BMFSFJ – B<strong>und</strong>esministerium für Familie,<br />
Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend. Hrsg. (2002): Partizipation von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
Jugendlichen als gesellschaftliche Utopie? Ideale – Erfahrungen – Perspektiven.<br />
Dokumentation des B<strong>und</strong>eskongresses am 12. / 13. 11. 2001. Berlin<br />
Feldmann, Ursula u. A. (1996): Handbuch <strong>der</strong> örtlichen Sozialplanung. Schriften des<br />
Deutschen Vereins für öffentliche <strong>und</strong> private Fürsorge. Schrift 265. Frankfurt am<br />
Main“.<br />
Flade, Antje / Kustor, Beatrice. Hrsg. (1996): Raus aus dem Haus: Mädchen erobern die<br />
Stadt. Frankfurt am Main <strong>und</strong> New York<br />
Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Hamburg<br />
Friebertshäuser, Barbara (1997): „Feldforschung <strong>und</strong> teilnehmende Beobachtung“. In:<br />
Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch Qualitative<br />
Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung. Hrsg. (2003): Mitmischen!? Ein Gutachten von Jugendlichen<br />
zu Freizeitangeboten in Dresden. Dresden<br />
Fuhs, Burkhard (1997): „Fotografie <strong>und</strong> qualitative Forschung. In: Friebertshäuser,<br />
Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden<br />
in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Girtler, Roland (1998): Methoden <strong>der</strong> qualitativen Sozialforschung – Anleitung zur<br />
Feldarbeit. 2. Auflage. Wien<br />
Girtler, Roland (2001): Methoden <strong>der</strong> Feldforschung. 4. völlig neu bearb. Auflage. Köln<br />
Gläss, Holger / Herrmann, Franz (1997): Strategien <strong>der</strong> Jugendhilfeplanung. Theoretische<br />
<strong>und</strong> methodische Gr<strong>und</strong>lagen für die <strong>Praxis</strong>. 2. Auflage. Weinheim <strong>und</strong><br />
München<br />
Graf, Pedro (1996): Konzeptentwicklung. 2. Auflage. Alling<br />
Heinze, Thomas (1987): Qualitative Sozialforschung – Erfahrungen, Probleme <strong>und</strong><br />
Perspektiven. Opladen<br />
Heinzel, Frie<strong>der</strong>ike (1997): „Qualitative Interviews mit Kin<strong>der</strong>n“. In: Friebertshäuser,<br />
38
Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden<br />
in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim<br />
Herrenknecht, Albert (2000): „Jugend im regionalen Dorf“. In: Deinet, Ulrich / Sturzenhecker,<br />
Benedikt. Hrsg. (2000): Jugendarbeit auf dem Land. Opladen<br />
Hörstmann, Jürgen u. A. (2000): „Jugendpflegeleasing / Professionelle Unterstützung<br />
auf Zeit“. In: Deinet, Ulrich / Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (2000): Jugendarbeit<br />
auf dem Land. Opladen<br />
Holzmann, Steffi (2005): Neue Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>.<br />
Entwicklung eines Handbuchs zur Durchführung von Großgruppenmethoden.<br />
Unveröff. Diplomarbeit. Lüneburg<br />
ISS – Institut für Sozialarbeit <strong>und</strong> Sozialpädagogik e.V. (1997): Kommunale Sozialberichterstattung<br />
– <strong>Sozialraum</strong>analyse für den Landkreis Lüneburg unter beson<strong>der</strong>er<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> Jugendhilfeperspektive. Frankfurt am Main<br />
Jordan, Erwin (1996): „Jugendhilfe“. In: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid. Hrsg. (1996):<br />
Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, <strong>Praxis</strong>fel<strong>der</strong>, Begriffe <strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong><br />
Sozialarbeit <strong>und</strong> Sozialpädagogik. 4. vollständig überarb., erw. Auflage. Weinheim<br />
<strong>und</strong> Basel<br />
Jordan, Erwin (1998): „<strong>Sozialraum</strong> <strong>und</strong> Jugendhilfeplanung“. In: Jordan, Erwin /<br />
Schone, Reinhold. Hrsg. (1998): Handbuch Jugendhilfeplanung. Gr<strong>und</strong>lagen.<br />
<strong>Bausteine</strong>. Materialien. Münster<br />
Jordan, Erwin / Schone, Reinhold (1992): Jugendhilfeplanung – aber wie? Eine Arbeitshilfe<br />
für die <strong>Praxis</strong>. Münster<br />
Jordan, Erwin / Schone, Reinhold. Hrsg. (1998): Handbuch Jugendhilfeplanung.<br />
Münster<br />
Jordan, Erwin / Stork, Remy (1998): „Beteiligung in <strong>der</strong> Jugendhilfeplanung“. In:<br />
Jordan, Erwin / Schone, Reinhold. Hrsg. (1998): Handbuch Jugendhilfeplanung.<br />
Gr<strong>und</strong>lagen, <strong>Bausteine</strong>, Materialien. Münster<br />
Jordan, Erwin / Schone, Reinhold. Hrsg. (2000): Handbuch Jugendhilfeplanung. Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
<strong>Bausteine</strong>, Materialien. 2. Auflage. Münster<br />
Karstens, Birgit / Nehls, Anne-Kathrin (2005): Innovative Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>-<br />
<strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong> in <strong>der</strong> Jugendhilfeplanung – dargestellt an <strong>der</strong> Samtgemeinde<br />
Amelinghausen. Unveröff. Diplomarbeit. Lüneburg<br />
Kirchhoff, Sabine / Kuhnt, Sonja / Lipp, Peter / Schlawin, Siegfried (2003): Fragebogen<br />
– Datenbasis, Konstruktion <strong>und</strong> Auswertung. 3. Auflage. Opladen<br />
KJR Rems-Murr (1997): Freizeitverhalten <strong>und</strong> Beteiligungsmöglichkeiten Jugendlicher<br />
in Verein. Jugendzentrum, Schule, Gemeinde <strong>und</strong> Ehrenamt. Backnang<br />
Kleedorfer, Jutta (1999): „Partizipation – gibt’s das schon?“. In: Verein Jugendzentren.<br />
Hrsg. (1999): Sozialpädagogik <strong>und</strong> Jugendarbeit im Wandel – auf dem Weg zu einer<br />
lebensweltorientierten Jugendför<strong>der</strong>ung. Wissenschaftliche Reihe, Band I. Wien<br />
Klika, Dorle (1997): „Methodische Zugänge zur historischen Kindheitsforschung“. In:<br />
Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch Qualitative<br />
Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim<br />
Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid (1996): „Jugendhilfeplanung“. In: Kreft, Dieter / Mielenz,<br />
Ingrid. Hrsg. (1996): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, <strong>Praxis</strong>fel<strong>der</strong>, Begriffe<br />
<strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong> Sozialarbeit <strong>und</strong> Sozialpädagogik. 4. vollständig überarb. erw.<br />
Auflage. Weinheim <strong>und</strong> Basel<br />
Krisch, Richard (1999): Fremdbil<strong>der</strong>k<strong>und</strong>ung; Strukturierte Stadtteilbegehung. In:<br />
39
Deinet, Ulrich: Sozialräumliche Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung zur<br />
Konzeptentwicklung in <strong>der</strong> Offenen Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit. Opladen<br />
Krisch, Richard (2001): „Zur Anwendung von Methoden sozialräumlich orientierter<br />
<strong>Lebensweltanalyse</strong>n in <strong>der</strong> Jugendarbeit“. In: Lindner, Werner. Hrsg. (2001): Ethnographische<br />
Methoden in <strong>der</strong> Jugendarbeit. Opladen<br />
Kromrey, Helmut (2003): Empirische Sozialforschung. Modelle <strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong><br />
standardisierten Datenerhebung <strong>und</strong> Datenauswertung. 11. überarb. Auflage.<br />
Stuttgart<br />
Kühn, Christian (1998): „Räume planen, bauen <strong>und</strong> gestalten“. In: Deinet, Ulrich /<br />
Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (1998): Handbuch Offene Jugendarbeit. Münster<br />
Landkreis Rosenheim, Hrsg. (2003): Sozialstrukturanalyse für den Landkreis Rosenheim<br />
unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung jugendhilferelevanter Fragestellungen.<br />
Rosenheim<br />
Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landesjugendamt <strong>und</strong> Westfälische Schulen.<br />
Hrsg. (1997): JUNEX – junge Experten planen ein Jugendcafé: ein Partizipationsmodell.<br />
Münster<br />
Lessing, Helmut (1984): „Jugendarbeit als Wi(e)<strong>der</strong>aneignung von Arbeit, Umwelt <strong>und</strong><br />
Kultur“. In: deutsche jugend, 10/1984<br />
Lindner, Werner (1998): „Von <strong>der</strong> ,Unwirtlichkeit’ zur ,Unwirklichkeit’ <strong>der</strong> Stadt. Die<br />
pädagogische Vermittlung zwischen jugendlicher Stadt- <strong>und</strong> Medienerfahrung“. In:<br />
Neue <strong>Praxis</strong> 2/1998<br />
Lindner, Werner (1999): „Jugendliche <strong>und</strong> Jugendarbeit im Kontext <strong>der</strong> gegenwärtigen<br />
Sicherheitsdebatte“. In: deutsche jugend, 4/1999<br />
Lindner, Werner (2000): Grenzen <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>orientierung in <strong>der</strong> Jugendarbeit.<br />
Unveröff. Manuskript. Hannover<br />
Lindner, Werner. Hrsg. (2001): Ethnographische Methoden in <strong>der</strong> Jugendarbeit.<br />
Opladen<br />
Lofland, John (1979): „Feld-Notizen“. In: Gerdes, Klaus. Hrsg. (1979): Explorative<br />
Sozialforschung. Stuttgart<br />
Lukas, Helmut / Strack, Gerhold. Hrsg. (1996): Methodische Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Jugendhilfeplanung.<br />
Freiburg im Breisgau<br />
Lutz, Manuela / Behnken, Imbke / Zinneker, Jürgen (1997): „Narrative Landkarten“. In:<br />
Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch Qualitative<br />
Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Magistrat <strong>der</strong> Stadt Witzenhausen / Landesjugendamt Hessen / Ewig, Jörn u. A. Hrsg.<br />
(2000): „ … toll, dass wir gefragt werden …“. Die Bewegungslandkarte. Eine<br />
Methode zur Kin<strong>der</strong>beteiligung. Witzenhausen<br />
Mannheim-Runkel, Monika / Taplik, Ursula. Hrsg. (1998): Konzeptentwicklung in <strong>der</strong><br />
Jugendarbeit. Frankfurt am Main<br />
Martin, Ernst / Wawrinowski, Uwe (1991): Beobachtungslehre. Weinheim <strong>und</strong> Basel<br />
Marotzki, Winfried (1998): „Ethnographische Verfahren in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaftlichen<br />
Biographieforschung“. In: Jüttemann, Gerd / Thomae, Hans. Hrsg. (1998):<br />
Biographische Methoden in den Humanwissenschaften. Weinheim<br />
Mayer, Horst O. (2002): Interview <strong>und</strong> schriftliche Befragung. München<br />
Moser, Heinz (1997): Instrumentenkoffer für den <strong>Praxis</strong>forscher. Freiburg im Breisgau<br />
Moser, Heinz (2003): Instrumentenkoffer für die <strong>Praxis</strong>forschung. Zürich<br />
Müller, Burkhard (1989): Auf’m Land ist mehr los. Jugendpflege in Kleinstädten <strong>und</strong><br />
40
ländlichen Gemeinden. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Müller, Burkhard (1998): Referat während <strong>der</strong> Fachtagung Jugendarbeit auf dem Land.<br />
4. bis 5. Mai 1998 im Jugendhof Vlotho. Unveröff. Manuskript. Vlotho<br />
Müller, Wolfgang C. (1996a): „Gemeinwesenarbeit (GWA)“. In: Kreft, Dieter / Mielenz,<br />
Ingrid. Hrsg. (1996): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, <strong>Praxis</strong>fel<strong>der</strong>, Begriffe<br />
<strong>und</strong> Methoden <strong>der</strong> Sozialarbeit <strong>und</strong> Sozialpädagogik. 4. vollständig überarb., erw.<br />
Auflage. Weinheim <strong>und</strong> Basel<br />
Mün<strong>der</strong>, Johannes u. A. (2003): Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe. 4. Auflage. Weinheim, Berlin <strong>und</strong> Basel<br />
Mün<strong>der</strong>, Johannes / Becker, Susanne (1998): „Rechtliche Aspekte von Jugendhilfeplanung<br />
<strong>und</strong> Jugendhilfeplänen“. In: Jordan, Erwin / Schone, Reinhold. Hrsg..(1998):<br />
Handbuch Jugendhilfeplanung. Gr<strong>und</strong>lagen. <strong>Bausteine</strong>. Materialien. Münster<br />
Oetke, Dirk (2001): Strategien ethnographischer <strong>Sozialraum</strong>analyse unter beson<strong>der</strong>er<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> Partizipation von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen. Unveröff.<br />
Diplomarbeit. Lüneburg<br />
Ortmann, Norbert (1996): „Methoden zur Erk<strong>und</strong>ung von Lebenswelten“. In: Deinet,<br />
Ulrich / Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (1996): Konzepte entwickeln. Weinheim <strong>und</strong><br />
München<br />
Ortmann, Norbert (1999): „Die Stadtteilerk<strong>und</strong>ung mit Schlüsselpersonen; Nadelmethode,<br />
Jugendkulturenkataster, Leitfaden-Interview mit Schlüsselpersonen“. In:<br />
Deinet, Ulrich (1999): Sozialräumliche Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung<br />
zur Konzeptentwicklung in <strong>der</strong> Offenen Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit. Opladen<br />
Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans (2001): Handbuch Sozialarbeit / Sozialpädagogik. 2.<br />
überarb. Auflage. Neuwied <strong>und</strong> Kriftel<br />
Prengel, Annedore (1997): „Zur Bedeutung von <strong>Praxis</strong>forschung in Erziehung <strong>und</strong><br />
Erziehungswissenschaft“. In: Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg.<br />
(1997): Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft.<br />
Weinheim<br />
Projektgruppe Wanja (2000): Handbuch zum Wirksamkeitsdialog in <strong>der</strong> Offenen Kin<strong>der</strong>-<br />
<strong>und</strong> Jugendarbeit. Qualität sichern, entwickeln <strong>und</strong> verhandeln. Münster<br />
Reutlinger, Christian (o. J.): „Stadt“. In: Handbuch Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendhilfe. Weinheim<br />
<strong>und</strong> München<br />
Scherr, Albert (1998): „Konzeptionsentwicklung als Mitarbeiterqualifizierung <strong>und</strong><br />
Qualitätssicherung in <strong>der</strong> offenen Jugendarbeit“. In: Mannheim-Runkel, Monika /<br />
Taplik, Ursula. Hrsg. (1998): Konzeptentwicklung in <strong>der</strong> Jugendarbeit. Frankfurt am<br />
Main<br />
Schipmann, Werner (2002): „<strong>Sozialraum</strong>orientierung“ in <strong>der</strong> Jugendhilfe. Kritische<br />
Anmerkungen zu einem (un-)zeitgemäßen Ansatz. In: Merten, Roland. Hrsg. (2002):<br />
<strong>Sozialraum</strong>orientierung. Zwischen fachlicher Innovation <strong>und</strong> rechtlicher<br />
Machbarkeit. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Schnell, Rainer (2005): Methoden <strong>der</strong> empirischen Sozialforschung. 7. völlig überarb.<br />
<strong>und</strong> erw. Auflage. München<br />
Schone, Reinhold (1998): „Organisation von Planungsprozessen“. In: Jordan, Erwin /<br />
Schone, Reinhold. Hrsg. (1998): Handbuch Jugendhilfeplanung. Gr<strong>und</strong>lagen,<br />
<strong>Bausteine</strong>, Materialien. Münster<br />
Schröer, Wolfgang / Struck, Norbert / Wolff, Mechthild (2002): Handbuch Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendhilfe. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
41
Schulze, Theodor (1997): „Interpretation von autobiographischen Texten“. In:<br />
Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore. Hrsg. (1997): Handbuch Qualitative<br />
Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. Weinheim<br />
Schumann, Michael (1994): „Sozialräumliche <strong>und</strong> biographische Perspektiven in <strong>der</strong><br />
Jugendarbeit“. In: Neue <strong>Praxis</strong>, 6/1994<br />
Schumann, Michael (1998): „Dimensionen des sozialräumlichen Untersuchungsansatzes“.<br />
In: Mannheim-Runkel, Monika / Taplik, Ursula. Hrsg. (1998),<br />
Konzeptentwicklung in <strong>der</strong> Jugendarbeit. Frankfurt am Main<br />
Sengling, Dieter (1996): „Sozialökologie“. In Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid. Hrsg.<br />
(1996): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, <strong>Praxis</strong>fel<strong>der</strong>, Begriffe <strong>und</strong> Methoden<br />
<strong>der</strong> Sozialarbeit <strong>und</strong> Sozialpädagogik. 4. vollständig überarb., erw. Auflage.<br />
Weinheim <strong>und</strong> Basel<br />
Stange, Waldemar (1998): Planen mit Phantasie. Zukunftswerkstatt <strong>und</strong> Planungszirkel<br />
für Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugendliche. 3. Auflage. Berlin <strong>und</strong> Kiel<br />
Stange, Waldemar (2002a): Konzeption (didaktisches Konzept). Bewegungsinterview für<br />
Kin<strong>der</strong>. Unveröff. Papier. Lüneburg<br />
Stange, Waldemar (2002b): Konzeption (didaktisches Konzept). <strong>Sozialraum</strong>werkstatt für<br />
Erwachsene. Unveröff. Papier. Lüneburg<br />
Stange, Waldemar (2002c): Konzeption (didaktisches Konzept). <strong>Sozialraum</strong>werkstatt für<br />
Jugendliche. Unveröff. Papier. Lüneburg<br />
Stange, Waldemar (2004): Methoden <strong>der</strong> <strong>Sozialraum</strong>analyse. Unveröff. Papier.<br />
Lüneburg<br />
Stange, Waldemar / Karstens, Birgit (2006): „<strong>Sozialraum</strong>- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltanalyse</strong>“. In:<br />
Stange, Waldemar u.A. (2006)¨Ausbildung von Prozessmo<strong>der</strong>atoren für die<br />
Beteiligung von Kin<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Jugendlichen – Handbuch 2. Partizipationsprojekte<br />
starten: Ideenfindung <strong>und</strong> Situationsanalyse. Hrsgg. von <strong>der</strong> Bertelsmann Stiftung.<br />
Gütersloh<br />
Steinert, Erika / Thiele Gisela (2000): Sozialarbeitsforschung für Studium <strong>und</strong> <strong>Praxis</strong>.<br />
Frankfurt am Main<br />
Stimmer, Franz. Hrsg. (2000): Lexikon <strong>der</strong> Sozialpädagogik <strong>und</strong> <strong>der</strong> Sozialarbeit. 4.<br />
völlig überarb., erw. Auflage. München <strong>und</strong> Wien<br />
Sturzenhecker, Benedikt (1999): „Cliquenportrait“. In: Deinet, Ulrich (1999): Sozialräumliche<br />
Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung zur Konzeptentwicklung in<br />
<strong>der</strong> Offenen Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit. Opladen<br />
Sturzenhecker, Benedikt (2000): „Prävention ist keine Jugendarbeit. Thesen zu Risiken<br />
<strong>und</strong> Nebenwirkungen <strong>der</strong> Präventionsorientierung“. In: Sozialmagazin 1/2000<br />
Sturzenhecker, Benedikt (2002): Was folgt aus <strong>der</strong> PISA-Studie für die Jugendhilfe?<br />
unveröff. Manuskript. Münster<br />
Terhart, Ewald (1997): Entwicklung <strong>und</strong> Situation des qualitativen Forschungsansatzes<br />
in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft. In: Friebertshäuser, Barbara / Prengel, Annedore:<br />
Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in <strong>der</strong> Erziehungswissenschaft.<br />
Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Thiersch, Hans (1998): „Lebensweltorientierte soziale Arbeit <strong>und</strong> Forschung“. In:<br />
Rauschenbach, Thomas / Thole, Werner. Hrsg. (1998): Sozialpädagogische<br />
Forschung. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Thiersch, Renate (2000).: „Wie, was, wo, wann <strong>und</strong> mit wem? – <strong>Sozialraum</strong>analyse<br />
konkret“. In: TPS 5/2000<br />
42
van <strong>der</strong> Loo, Hans / van Reijen, Willem (1992): Mo<strong>der</strong>nisierung Projekt <strong>und</strong> Paradox.<br />
München<br />
Verein Jugendzentren. Hrsg. (1999): Sozialpädagogik <strong>und</strong> Jugendarbeit im Wandel – auf<br />
dem Weg zu einer lebensweltorientierten Jugendför<strong>der</strong>ung. Wissenschaftliche Reihe,<br />
Band I. Wien<br />
von Spiegel, Hiltrud (1997): Offene Arbeit mit Kin<strong>der</strong>n – (k)ein Kin<strong>der</strong>spiel. Münster<br />
Weskamp, Peter (1996): „<strong>Sozialraum</strong>analytische <strong>Praxis</strong> als Basis für die Konzeptentwicklung<br />
in <strong>der</strong> offenen Jugendarbeit“. In: Deinet, Ullrich / Sturzenhecker, Benedikt<br />
Hrsg. (1996): Konzepte entwickeln. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Winter, Reinhard (2000): „Professionalität <strong>und</strong> Landjugendarbeit in Mo<strong>der</strong>nisierungsbrüchen“.<br />
In: Deinet, Ulrich / Sturzenhecker, Benedikt. Hrsg. (2000): Jugendarbeit<br />
auf dem Land. Opladen<br />
Witte, Yvonne (2005): Jugendkonferenzen im Landkreis Stade, dargestellt am Beispiel<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Harsefeld. Eine qualitative Studie. Unveröff. Diplomarbeit. Lüneburg<br />
Wuggenig, Ulf (1991): „Die Photobefragung als projektives Verfahren“. In: Kreutz,<br />
Henrik. Hrsg. (1991): Pragmatische Analyse von Texten, Bil<strong>der</strong>n <strong>und</strong> Ereignissen.<br />
Opladen<br />
Zeiher, Helga (1983): „Die vielen Räume <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. Zum Wandel räumlicher Lebensbedingungen<br />
seit 1945“. In: Preuss-Lausitz, Ulf u. A. (1983): Kriegskin<strong>der</strong>,<br />
Konsumkin<strong>der</strong>, Krisenkin<strong>der</strong>. Berlin<br />
Zeiher, Hartmut J. / Zeiher, Helga (1994): Orte <strong>und</strong> Zeiten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. Soziales Leben im<br />
Alltag von Großstadtkin<strong>der</strong>n. Weinheim <strong>und</strong> München<br />
Zimmermann, Gerd (2002): Jugendhilfeplanung. Veranstaltungsskripte. Lüneburg<br />
Technische Quellen <strong>und</strong> Hilfsmittel<br />
VERBI Software. Consult. Sozialforschung GmbH (2001): MAXQDA 2001. MAX<br />
Qualitative Datenanalyse. Berlin<br />
Nie<strong>der</strong>sächsisches Landesamt für Statistik. Hrsg. (2004): CD-ROM Statistik-Datenbank.<br />
Ausgabe 2004. Hannover<br />
Wilhelms-Universität Münster / B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung. Hrsg. (2004):<br />
Forschen mit GrafStat. Erw. Neuauflage. Bonn<br />
Landkreis Stade (2000 / 2002): Jugendhilfe- <strong>und</strong> Sozialplanung. CD. Stade<br />
43