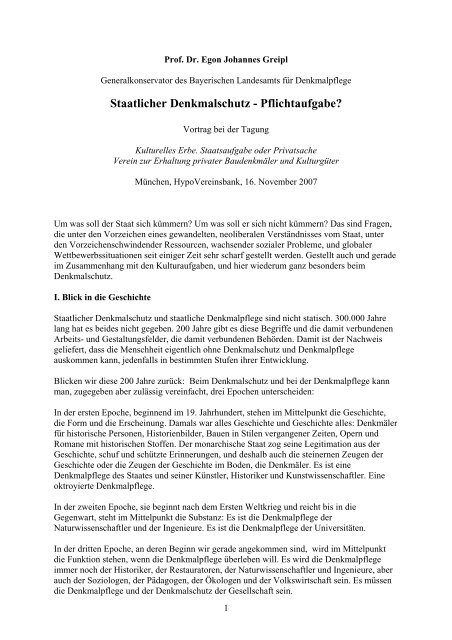ein Vortrag von Prof. Dr. Egon Johannes Greipl - Altstadtfreunde ...
ein Vortrag von Prof. Dr. Egon Johannes Greipl - Altstadtfreunde ...
ein Vortrag von Prof. Dr. Egon Johannes Greipl - Altstadtfreunde ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Egon</strong> <strong>Johannes</strong> <strong>Greipl</strong><br />
Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege<br />
Staatlicher Denkmalschutz - Pflichtaufgabe?<br />
<strong>Vortrag</strong> bei der Tagung<br />
Kulturelles Erbe. Staatsaufgabe oder Privatsache<br />
Ver<strong>ein</strong> zur Erhaltung privater Baudenkmäler und Kulturgüter<br />
München, HypoVer<strong>ein</strong>sbank, 16. November 2007<br />
Um was soll der Staat sich kümmern? Um was soll er sich nicht kümmern? Das sind Fragen,<br />
die unter den Vorzeichen <strong>ein</strong>es gewandelten, neoliberalen Verständnisses vom Staat, unter<br />
den Vorzeichenschwindender Ressourcen, wachsender sozialer Probleme, und globaler<br />
Wettbewerbssituationen seit <strong>ein</strong>iger Zeit sehr scharf gestellt werden. Gestellt auch und gerade<br />
im Zusammenhang mit den Kulturaufgaben, und hier wiederum ganz besonders beim<br />
Denkmalschutz.<br />
I. Blick in die Geschichte<br />
Staatlicher Denkmalschutz und staatliche Denkmalpflege sind nicht statisch. 300.000 Jahre<br />
lang hat es beides nicht gegeben. 200 Jahre gibt es diese Begriffe und die damit verbundenen<br />
Arbeits- und Gestaltungsfelder, die damit verbundenen Behörden. Damit ist der Nachweis<br />
geliefert, dass die Menschheit eigentlich ohne Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />
auskommen kann, jedenfalls in bestimmten Stufen ihrer Entwicklung.<br />
Blicken wir diese 200 Jahre zurück: Beim Denkmalschutz und bei der Denkmalpflege kann<br />
man, zugegeben aber zulässig ver<strong>ein</strong>facht, drei Epochen unterscheiden:<br />
In der ersten Epoche, beginnend im 19. Jahrhundert, stehen im Mittelpunkt die Geschichte,<br />
die Form und die Ersch<strong>ein</strong>ung. Damals war alles Geschichte und Geschichte alles: Denkmäler<br />
für historische Personen, Historienbilder, Bauen in Stilen vergangener Zeiten, Opern und<br />
Romane mit historischen Stoffen. Der monarchische Staat zog s<strong>ein</strong>e Legitimation aus der<br />
Geschichte, schuf und schützte Erinnerungen, und deshalb auch die st<strong>ein</strong>ernen Zeugen der<br />
Geschichte oder die Zeugen der Geschichte im Boden, die Denkmäler. Es ist <strong>ein</strong>e<br />
Denkmalpflege des Staates und s<strong>ein</strong>er Künstler, Historiker und Kunstwissenschaftler. Eine<br />
oktroyierte Denkmalpflege.<br />
In der zweiten Epoche, sie beginnt nach dem Ersten Weltkrieg und reicht bis in die<br />
Gegenwart, steht im Mittelpunkt die Substanz: Es ist die Denkmalpflege der<br />
Naturwissenschaftler und der Ingenieure. Es ist die Denkmalpflege der Universitäten.<br />
In der dritten Epoche, an deren Beginn wir gerade angekommen sind, wird im Mittelpunkt<br />
die Funktion stehen, wenn die Denkmalpflege überleben will. Es wird die Denkmalpflege<br />
immer noch der Historiker, der Restauratoren, der Naturwissenschaftler und Ingenieure, aber<br />
auch der Soziologen, der Pädagogen, der Ökologen und der Volkswirtschaft s<strong>ein</strong>. Es müssen<br />
die Denkmalpflege und der Denkmalschutz der Gesellschaft s<strong>ein</strong>.<br />
1
II. Die Wende <strong>von</strong> 1990<br />
Denkmalschützer und Denkmalpfleger beschäftigen sich nach herkömmlicher Vorstellung<br />
ausschließlich mit der Vergangenheit. Im Interesse langfristig erfolgreicher<br />
denkmalpflegerischer Arbeit ist es heute aber mehr als je nötig, gleichzeitig zurück und nach<br />
vorne zu blicken. Denkmalschutz und Denkmalpflege müssen den Januskopf tragen.<br />
Die ideellen und institutionellen Anfänge und Grundlagen <strong>von</strong> Denkmalschutz und<br />
Denkmalpflege reichen in Bayern ins 19. und ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Die<br />
Verabschiedung des Denkmalschutzgesetzes im Jahr 1973 hat sie konkretisiert und gefestigt.<br />
Pate stand der Umbruch, der sich in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren vor dem<br />
Hintergrund <strong>ein</strong>es gesellschaftlichen Wertewandels vollzog. Man war über die<br />
Bedenkenlosigkeit erschrocken, mit der vielerorts immer schneller verschwand, was der<br />
Zweite Weltkrieg an baulichen und künstlerischen Zeugnissen vorangegangener Generationen<br />
übrig gelassen hatte.<br />
Die Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 1973 bis gegen 1990 lassen sich als<br />
Aufwuchsphase bezeichnen, in der die Denkmalpflege in Bayern <strong>ein</strong>en enormen<br />
Personalzuwachs verbuchte und über <strong>ein</strong>en stattlichen Etat (1990: 90 Mio. DM) verfügte.<br />
Archäologische Großgrabungen, spektakuläre Großrestaurierungen, prestigeträchtige<br />
Auslandsprojekte und <strong>ein</strong> umfassendes Publikationswesen schlugen sich in <strong>ein</strong>er verstärkten<br />
Medienberichterstattung nieder und führten dazu, dass die Arbeit der staatlichen<br />
Denkmalpflege <strong>ein</strong>e breite öffentliche Aufmerksamkeit fand. Die Akzeptanz wuchs. Oder war<br />
es <strong>ein</strong> Sch<strong>ein</strong>akzeptanz, <strong>ein</strong>e Mode?<br />
Seit 1990 änderten sich die Zeiten gewaltig. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege<br />
erlebte in den 1990er Jahren <strong>ein</strong>en Stellenabbau <strong>von</strong> zunächst 8 %, nach 2004 mussten erneut<br />
10 % des Personals <strong>ein</strong>gespart werden. Von acht Dienstellen haben wir zwei geschlossen,<br />
zwei weitere folgen. Die den Gebietsreferenten zur Verfügung stehenden Fördermittel gingen<br />
s<strong>ein</strong> 1990 um nominal 90 % zurück. Die operativen Mittel der Bodendenkmalpflege sind<br />
praktisch bei Null angelangt. Die Haushaltszahlen stehen in <strong>ein</strong>em auffallenden Gegensatz<br />
zum ständigen öffentlichen Bekenntnis zum Wert des baulichen und archäologischen Erbes<br />
und der Wichtigkeit s<strong>ein</strong>er Pflege. Aber schon 1926 hat der Wiener Staatswissenschaftler<br />
Rudolf Goldscheid den Staatshaushalt als den Körper des Staates definiert, ohne dessen<br />
Kenntnis man den tatsächlichen Geist des Staates nicht zutreffend beurteilen könne. Das<br />
Budget sei gleichsam das aller verbrämenden Ideologie entkleidete Gerippe des Staates. 1<br />
Die zunächst in ihren fatalen Auswirkungen vollkommen unterschätzte Gesetzesnovelle <strong>von</strong><br />
1994, der Wegfall der sog. Dissensregelung, bedeutete <strong>ein</strong>en irreparablen Verlust für die<br />
denkmalpflegerischen Handlungsmöglichkeiten.<br />
1 Rudolf Goldscheid, Staat, öffentlicher Haushalt und Gesellschaft. Wesen und Aufgabe der<br />
Finanzwissenschaft vom Standpunkt der Soziologie, in: Handwörterbuch der<br />
Finanzwissenschaft, Bd. 1, Tübingen 1926, S. 253-315. Zitat S. 256. Den Hinweis verdanke<br />
ich Dirk Götschmann, „Nervus rerum. Die Staats<strong>ein</strong>nahmen des Königreichs Bayern und<br />
ihre Verwendung, in: G. Hetzer, B. Uhl (Hg.), Festschrift Hermann Rumschöttel zum 65.<br />
Geburtstag, Archivalische Zeitschrift 88 (2006), Bd. 1, 229-270.<br />
2
Die gegenwärtige Revision der Denkmalliste führt die negativen Folgen der skizzierten<br />
Entwicklung schlagartig vor Augen. Ein Beispiel: Landkreis Altötting: die Denkmalliste <strong>von</strong><br />
1980 führt 1441 Einzelbaudenkmäler auf; die Revision führt zur Streichung <strong>von</strong> 248 (17,2%),<br />
da<strong>von</strong> 135 wegen Totalverlust durch Abbruch. Landkreis Dingolfing Landau 1990: 1750<br />
Baudenkmäler, da<strong>von</strong> 217 noch vor der jetzt beginnenden Revision gestrichen. Landkreis<br />
Rottal – Inn: Von 2108 Baudenkmälern sind 241 gestrichen. Landkreis Nürnberger Land: <strong>von</strong><br />
2104 Baudenkmälern haben wir 196 verloren. Landkreis Mühldorf: 1579 Baudenkmäler. Die<br />
Revision muss 162 streichen.<br />
Die Verluste betreffen hauptsächlich die baulichen Zeugen der Lebens- Wohn und<br />
Arbeitswelten der Mittel und Unterschichten. Die laufende Überprüfung der 970 Ensembles<br />
in Bayern ergibt, dass wegen Substanzerosion für <strong>ein</strong> Viertel die Streichung und für <strong>ein</strong><br />
<strong>Dr</strong>ittel die reduzierenden Flächenkorrektur fällig ist. Nach 35 Jahren Denkmalschutzgesetz<br />
sind <strong>von</strong> den Hauslandschaften nur mehr Fragmente da, sind nicht wenige Ortskerne ruiniert<br />
und Kulturlandschaften in großem Umfang zerstört. Vielerorts hat sich <strong>ein</strong>e ästhetische<br />
Umweltverschmutzung ohnegleichen breit gemacht. Waren die ökonomischen Zwänge<br />
unausweichlich? Waren Denkmalschutz und Denkmalpflege nicht verankerte Werte, sondern<br />
<strong>ein</strong>e Mode – Ersch<strong>ein</strong>ung? Gerieten sie eben gegen Ende des Jahrtausends außer Mode?<br />
III. Denkmalschutz und Denkmalpflege: Antworten für die Zukunft<br />
Die Frage ist nicht die, ob die Denkmäler in der Verfassung stehen. Da stehen sie nämlich<br />
schon seit 1949. Die Frage ist, wen es schert! Die Frage ist: Welche Rolle können und werden<br />
die Denkmäler in der Zukunft spielen? All<strong>ein</strong> an der Antwort auf diese Frage hängt die<br />
Zukunft <strong>von</strong> staatlichem Denkmalschutz und staatlicher Denkmalpflege. Mit welchen<br />
Entwicklungen ist in Bayern also konkret zu rechnen, und wie kann und wie soll sich die<br />
Denkmalpflege auf diese <strong>ein</strong>stellen?<br />
Nach dem heutigen Kenntnisstand werden die Bevölkerungszahlen insgesamt abnehmen,<br />
wobei der Anteil der älteren, nicht mehr im Erwerbsleben stehenden Personen an der<br />
Gesamtbevölkerung steigt. Im Zuge dieser Entwicklung ist damit zu rechnen, dass sich die<br />
Bevölkerung auf Ballungsräume konzentriert, was zur Revitalisierung der Stadt bei<br />
gleichzeitiger Verödung strukturell schlecht erschlossener Landgem<strong>ein</strong>den führen wird.<br />
Aufgrund <strong>von</strong> Globalisierung und Migration wird der Anteil <strong>von</strong> Bewohnern mit <strong>ein</strong>em<br />
anderen ethnischen und mentalen Hintergrund wachsen. Überlieferte Traditionsstränge<br />
werden abreißen, traditionelle religiöse, mentale und kulturelle Milieus zunehmend erodieren,<br />
ersetzt oder überlagert. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass der Staat und die Kommunen aus<br />
politischen (Deregulierung), personellen (Personallabbau) oder finanziellen<br />
(Steueraufkommen, Verschuldung) Gründen die Möglichkeiten <strong>ein</strong>er Steuerung nicht mehr<br />
im gewohnten Umfang wahrnehmen wollen oder wahrnehmen können.<br />
Es gilt, Handlungsspielräume zur Gestaltung dieser Zukunft auszuloten, und die Ressourcen<br />
zu benennen, die zur Bewältigung des Wandels überhaupt vorhanden sind. Wandel unter dem<br />
Vorzeichen knapper Ressourcen, das ist es, was den gegenwärtigem Wandel vom Wandel der<br />
60er und 70 er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unterscheidet, als die Probleme finanziell<br />
abgefedert werden konnten.<br />
Die Denkmalpflege ist diesen Umbrüchen nicht hilflos ausgesetzt. Im Gegenteil: bietet <strong>ein</strong><br />
Potential zu deren Bewältigung, weil sie vorhandene Ressourcen in Wert setzt! So leisten<br />
archäologisches und bauliches Erbe <strong>ein</strong>en großen Beitrag zur dringend notwendigen Stärkung<br />
der Regionen. Historische Bauwerke, vor allem aber historische und <strong>ein</strong>igermaßen unverletzte<br />
3
Ortsbilder und Kulturlandschaften, die den ländlichen Raum noch auszeichnen, können im<br />
Wettbewerb mit den Ballungsräumen <strong>ein</strong>e wichtige Rolle spielen. Denkmäler, hier<br />
insbesondere auch die mit der Kulturlandschaft eng verknüpften, im Gelände sichtbaren<br />
Denkmäler aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit, können für <strong>ein</strong>e sinnerfüllte und<br />
sinnstiftende Freizeitgestaltung <strong>ein</strong>e große Bedeutung entfalten. Diese Bedeutung nimmt in<br />
<strong>ein</strong>er alternden Gesellschaft, deren Mitglieder <strong>ein</strong>en vergleichsweise hohen Anteil an Freizeit<br />
besitzen, zu. In diesem Rahmen ist auch die ehrenamtliche Tätigkeit zu sehen, die an<br />
Bedeutung gewinnen muss.<br />
Der ethnische Wandel in Bayern wird sich beschleunigen. Schon heute besteht die<br />
Bevölkerung vieler Städte und Gem<strong>ein</strong>den zu <strong>ein</strong>em nicht geringen Teil aus Bürgern, die<br />
aufgrund ihres persönlichen, familiären, sozialen, ethnischen, geistigen, religiösen und<br />
mentalen Hintergrunds nur durch <strong>ein</strong>e gezielte Vermittlung <strong>ein</strong>e Beziehung zu den baulichen<br />
und archäologischen Denkmälern ihres Gastlandes bzw. ihrer neuen Heimat entwickeln<br />
können. Es wird darauf ankommen, diesen Mitbürgern den Wert der baulichen und<br />
archäologischen Zeugnisse nahe zubringen und sie als Mitstreiter für die Bewahrung des<br />
kulturellen Erbes zu gewinnen. Hier liegt <strong>ein</strong>e wichtige integrative Aufgabe der<br />
Denkmalpflege!<br />
Die künftige Entwicklung wird in erheblichem Maße kirchliche Baudenkmäler betreffen, für<br />
welche <strong>ein</strong>e seelsorgerliche Notwendigkeit nicht mehr besteht. Dies ist <strong>ein</strong>e Folge des<br />
allgem<strong>ein</strong>en Trends der Entkirchlichung der Gesellschaft. Bereits jetzt stellen die Kirchen<br />
Überlegungen an, inwieweit Kirchenschließungen erforderlich s<strong>ein</strong> werden, und welche<br />
Möglichkeiten sich eröffnen, funktionslose kirchliche Bausubstanz zu nutzen. Hier ist zu<br />
berücksichtigen, dass Kirchen für die Identität und damit die Qualität <strong>ein</strong>er Ortschaft<br />
prägende Bedeutung haben. Die Entwicklung des Kirchensteueraufkommens und der<br />
Gottesdienstbesucherzahlen könnte die Kirchen dazu veranlassen, dem Staat und den<br />
Kommunen die Kirchen als Identität tragende, aber gottesdienstlich nicht mehr benötigte<br />
Bauten anzubieten.<br />
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden Verfall, Entwertung und<br />
Beseitigung vorhandener Bausubstanz (Rückbau) unvermeidbar s<strong>ein</strong>. Der Rückbau wird eher<br />
die jüngere Bausubstanz betreffen. Es sollte sich die Einsicht durchsetzen, dass die Nutzung<br />
vorhandener Bausubstanz Priorität vor der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete<br />
erlangen muss. In diesem Rahmen erhalten die historischen Ortskerne und damit die<br />
Denkmalsubstanz, soweit sie noch vorhanden ist, <strong>ein</strong>en neuen Stellenwert. Der Verzicht auf<br />
Flächenverbrauch wiederum bedeutet neue Chancen für den Erhalt der Bodendenkmäler und<br />
der noch <strong>ein</strong>igermaßen intakten Ortsbilder. Städte und Orte brauchen, wenn entstehen und<br />
wenn sie wachsen und wenn sie nicht willkürliche und anarchische Agglomeration s<strong>ein</strong><br />
wollen, <strong>ein</strong>e gute Planung durch Fachleute: Architekten, Landschaftsplaner, Geographen<br />
Sozialwissenschaftler als Geburtshelfer. Wenn es dann um das Schrumpfen geht, bis zum<br />
verschwinden, ist fachliche Hilfe wiederum angezeigt; Amputation unter ärztlicher Kontrolle,<br />
im Extremfall Sterbebegleitung durch Fachleute.<br />
Ein ganzheitlicher, interdisziplinärer, ressortübergreifender Ansatz, der die verstärkte<br />
Zusammenarbeit mit den kommunalen Partnern wesentlich intensiviert, Potentiale entdeckt,<br />
Handlungsspielräume auslotet, Wettbewerb durch Kooperation ersetzt und dabei stets den<br />
Schwerpunkt auf Qualität statt auf Quantität legt, muss das Ziel <strong>ein</strong>er auch in Zukunft<br />
erfolgreichen Denkmalpflege s<strong>ein</strong>. Es gilt, die Bereiche zu erhalten oder zu gestalten, in den<br />
Regionalität, Nachhaltigkeit und Geschichtlichkeit als Merkmale guten Städtebaus präsent<br />
sind.<br />
4
IV. Denkmalschutz. Eingriffsverwaltung oder Leistungsverwaltung?<br />
Die klassische Verwaltungswissenschaft unterscheidet zwischen Eingriffsverwaltung und<br />
Leistungsverwaltung. Der Denkmalschutz beruht in der heutigen Form auf dem Prinzip der<br />
Eingriffsverwaltung. Er erreicht s<strong>ein</strong> Ziel, nämlich den Erhalt möglichst vieler Denkmäler in<br />
möglichst großer Unversehrtheit durch Gebote und Verbote. Pflichten, Einschränkungen und<br />
Auflagen greifen in die Freiheitsrechte des <strong>ein</strong>zelnen <strong>ein</strong>.<br />
Bei der Eingriffsverwaltung wird vom <strong>ein</strong>zelnen Betroffenen in der Regel als Einschränkung<br />
und Belastung empfunden, was der Allgem<strong>ein</strong>heit zum Schutz oder zum Vorteil dienen soll<br />
und <strong>von</strong> ihr auch theoretisch so wahrgenommen wird. Auch fachliche Beratung wird nicht<br />
unbedingt der Leistungsverwaltung zugeordnet, sondern als ungebetener Rat, als<br />
Einmischung und Bevormundung, nicht selten als Eingriff empfunden: Beratung als<br />
Instrument der Eingriffsverwaltung eben. Der Versuch des Jahres 2006, die obligatorische<br />
Zuziehung des Landesamts für Denkmalpflege zu <strong>ein</strong>er fakultativen Zuziehung nach dem<br />
Willen der Entscheidung der Kommunen oder Kreise zu machen, zeigte genau diese<br />
Bewertung. Als Ziel der gescheiterten Gesetzesnovelle war ja formuliert, die<br />
Handlungsfreiheit der Kommunen zu stärken.<br />
Das Problem beginnt dann, wenn auch die Allgem<strong>ein</strong>heit insgesamt die Eingriffsverwaltung<br />
in <strong>ein</strong>em bestimmten Bereich ausschließlich als Einschränkung und Belastung empfindet. Der<br />
gesellschaftliche und / oder politische Konsens über die Schutzwürdigkeit bestimmter Werte<br />
ist dann zerbrochen.<br />
Politische Systeme, die durch Abbau <strong>von</strong> Zuständigkeiten und durch Deregulierung ihre<br />
Selbstaushöhlung betreiben und ihr Ansehen untergraben, werden trotzdem gelegentlich<br />
instrumentalisiert, zu Gunsten <strong>von</strong> Gruppeninteressen regulierend tätig zu werden. Wohin das<br />
treiben kann, zeigt <strong>ein</strong> ernst gem<strong>ein</strong>ter Versuch des Der Deutsche Fußballbunds. Der DFB hat<br />
kürzlich an Städte, in denen Länderspiele stattfinden sollen, <strong>ein</strong> Papier übersandt, in denen<br />
sich diese Städte verpflichten sollten zur Erfüllung aller zumutbaren Anweisungen und<br />
Wünsche des DFB, zur Bereitstellung <strong>von</strong> Werbeflächen für den DFB und s<strong>ein</strong>e Lizenzpartner<br />
an prominenten Stellen in den Innenstädten, zum Verbot <strong>von</strong> nicht vom DFB genehmigten<br />
länderspielbezogenen Marken- Werbe- oder Dekorationsmaterialien in der gesamten Stadt<br />
und zur Bereitstellung <strong>ein</strong>er Personengruppe, die nicht autorisierte Werbung zu verhindern<br />
hat und Vollstreckungsmaßnahmen durchführen soll (Süddeutsche Zeitung 22.03.07, 41).<br />
Die Frage ist schon, ob wir, nur um global konkurrenzfähig zu bleiben, Regeln aufgeben<br />
dürfen, die in Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden entwickelt, erkämpft, verf<strong>ein</strong>ert wurden.<br />
Sind denn Solidarsysteme k<strong>ein</strong>e Errungenschaft? Sind denn Stadtplanung und<br />
Landschaftsschutz, Denkmalpflege und Denkmalschutz k<strong>ein</strong>e Errungenschaft? Heißt es denn<br />
nicht, zur <strong>Dr</strong>itten Welt zu werden, wenn man auf solche Regeln verzichtet? Die Ergebnisse<br />
der Deregulierung im Baurecht lassen sich in jedem Gewerbegebiet betrachten, jenen Orgien<br />
<strong>von</strong> Ressourenverschwendung dem fehlen jeglicher Ästhethik und Erkennbarkeit. Die<br />
Ergebnisse lasen sich betrachten, am Niedergang unserer Orts- und Stadtbilder, ja ganzer<br />
Kulturlandschaften.<br />
Neben die Deregulierung als Prinzip, und damit eng zusammenhängend, tritt die<br />
Ökonomisierung als Prinzip:<br />
Wir haben <strong>ein</strong>en neuem Fetisch, den Ökonomismus. Er dominiert die Reformdiskussionen.<br />
Dahinter steht offensichtlich die Vermutung, dass sich Theater, Altenheime oder<br />
Polizeireviere wie Unternehmen führen lasse. Ökonomische Denken ist <strong>ein</strong>e Methode,<br />
5
Komplexität zu reduzieren. Eine Verständigung darüber, welche Anliegen der Gesellschaft<br />
etwas „wert“ sind, an welchen Leitbildern sie sich orientieren will, fehlt in der Debatte. Wie<br />
setzt <strong>ein</strong>e Gesellschaft Prioritäten in Kultur, Bildung oder im Gesundheitswesen und -auch- in<br />
der Wirtschaft? Die Ökonomie hat ihren berechtigten Platz, wenn sie als Mittel, nicht als<br />
Zweck angesehen wird. 2<br />
Der andere Fetisch ist die Deregulierung. Aber: Regeln braucht es überall, wo es Zivilisation<br />
gibt. Regeln schaffen Zivilisation. Denkmalschutz und Denkmalpflege sind Verfahren zum<br />
geregelten Umgang mit dem baulichen Erbe. Sie sind nicht Museum und schon gar nicht die<br />
Käseglocke und dreimal nicht das Disneyland. Sie sind Garanten sichtbarer und leicht<br />
verständlicher Kontinuität in <strong>ein</strong>er unübersichtlichen Welt, optische Orientierung, die<br />
Generationen überdauert.<br />
Aber mit den Regeln all<strong>ein</strong> sind Denkmalpflege und Denkmalschutz nicht zu machen.<br />
Staatliche Denkmalpflege und staatlicher Denkmalschutz müssen zu mehr<br />
Leistungsverwaltung werden oder wieder werden. Wir müssen Überzeuger und Vermittler<br />
s<strong>ein</strong>. Was müssen wir bringen?<br />
Erstens: Das Schutzgut im Boden und über dem Boden muss in s<strong>ein</strong>em jeweils aktuellen<br />
Zustand und in objektiver Beschreibung s<strong>ein</strong>er Werte für Behörden, Planer, Wirtschaft und<br />
jedermann zugänglich erfasst und in den entsprechenden Daten verfügbar s<strong>ein</strong>. Um die<br />
qualifizierte Beschreibung historischer und materieller Werte geht es! Hierzu dienen die<br />
flächendeckende, 2013 abzuschließende Nachqualifizierung und Revision der Bayerischen<br />
Denkmalliste und die objektive Erfassung der Ensemble - Werte. Hierzu bauen wir vor allem<br />
in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Vermessung und Geodaten <strong>ein</strong>e geobasierte<br />
Datenbank auf, die Teil der Integralen Geodatenbank Bayern ist: Das<br />
Fachinformationssystem Denkmal (FIS). Die Denkmaldaten sind also allgem<strong>ein</strong> verfügbar.<br />
Auf diese Weise wird die Kenntnis aktueller Zustände verbreitet und Planungssicherheit<br />
geschaffen. Positive und negative Potentiale lassen sich schnell und im Zusammenhang<br />
erkennen und entsprechende Strategien entwickeln. Die staatliche Denkmalpflege bildet, aus<br />
ihrem fachlichen Überblick heraus, die Werte ab, hilft, aus ihrer Erfahrung und aus ihrem<br />
Überblick heraus, Nutzungs- und Erhaltungsstrategien zu entwickeln. Sie kümmert sich nicht<br />
um Bilder, sondern um Substanz, die vielleicht Bilder erzeugen mag. Sie benennt<br />
Authentizität. Sie setzt sich für die Denkmäler in der Fläche <strong>ein</strong>, nicht für modische<br />
Leuchttürme. In <strong>ein</strong>em Leuchtturm ist nur <strong>ein</strong>er behaust, der Wärter. Die anderen sind auf der<br />
finsteren Wasserwüste verloren und werden nur gelegentlich vom Lichtfinger berührt.<br />
Zweitens: Die Arbeitsweise und der Erfolg der Denkmalschutz und der Denkmalpflege<br />
beteiligten Behörden ist zu untersuchen, zu bewerten und zu optimieren. Hierzu haben wir<br />
2006 <strong>ein</strong>e Umfrage veranstaltet und ausgewertet. Am 1. Oktober hat <strong>ein</strong> Modellversuch mit<br />
15 Kommunalen Partnern begonnen, der uns wichtige Ergebnisse liefern wird, Ansatzpunkte<br />
für Verbesserungen.<br />
<strong>Dr</strong>ittens: Soll Denkmalschutz und Denkmalpflege positiv wahrgenommen, akzeptiert werden,<br />
müssen die <strong>von</strong> der Denkmalpflege angebotenen Leistungen positiv wahrgenommen werden.<br />
Bei finanziellen Vorteilen wie Zuschüssen, Entschädigungen oder Steuervorteilen ist dies<br />
k<strong>ein</strong> großes Problem. Hier muss nur der Einsatz öffentlicher Mittel, dessen be<strong>ein</strong>druckende<br />
Rentabilität bei Ökonomen bekannt und <strong>von</strong> Politikern offenbar verdrängt ist, wieder auf <strong>ein</strong><br />
Niveau kommen, wo er hingehört. Gegenwärtig lesen wir in der Zeitung, die Ziele der<br />
2 Zitat: Unternehmensberater Roland Bickmann, in: DIE WELT vom 30.08.02., S.8.<br />
6
ayerischen Finanzpolitik seien: Schulden zahlen, Rücklagen bilden, die Investitionsquote<br />
erhöhen. Investitionsquote: Unter dieser Überschrift müssen die staatlichen Ausgaben im<br />
Bereich der Denkmalpflege stehen! Investitionen sind es, Anschubfinanzierungen. Sie<br />
verdienen es nicht, ständig als konsumtive Ausgaben diffamiert werden.<br />
Wir sind gespannt auf den Nachtragshaushalt 2008. Da wird das bayerische Landesamt, das in<br />
den Jahren seit 2000, und das waren wahrhaft dürre Jahre, sich geschunden hat, an <strong>ein</strong>er<br />
schwierigen Reform gearbeitet, Personal<strong>ein</strong>sparungen und Dienststellenschließungen<br />
verkraftet, innovative und über Bayern hinaus wirkende Projekte entwickelt hat, da wird<br />
dieses Amt hundert Jahre alt. Wie ich höre, soll es <strong>ein</strong>e Million Euro mehr geben, für das<br />
ganze Jahr, für das ganze Bayernland, für 131 Landkreise und große Städte, für 120.000<br />
Baudenkmäler und 55.000 Bodendenkmäler, für fünf Welterbestätten, für 65.000 private<br />
Denkmaleigentümer! Sollen wir ernsthaft glauben, dass <strong>ein</strong>e Million Euro nach der<br />
beispiellosen Sparorgie seit 1990 <strong>ein</strong> Geburtstagsgeschenk zum Hundertsten ist? Aber wir<br />
haben ja gelesen, dass <strong>ein</strong> Kurswechsel nicht auf der Agenda steht.<br />
Die Fabel vom Philosophen und dem Esel fällt mir <strong>ein</strong>. Der Philosoph hat den Esel trainiert,<br />
mit immer weniger Futter auszukommen. Trotzdem rackerte der Esel sich unermüdlich ab für<br />
s<strong>ein</strong>en Herrn. Schließlich war die Tagesration bei <strong>ein</strong>em Strohhalm angelangt. Ausgerechnet<br />
da fiel der Esel tot um. Esel sind teuer, der Schaden für den Philosophen war gewaltig. In<br />
unserem Fall ist der Esel übrigens erst in zweiter Linie das Landesamt für Denkmalpflege, in<br />
erster Linie sind es unsere Denkmäler und vor allem ihre Eigentümer.<br />
Denkmäler sind reich wertvolle Ressource für die Bewältigung der Zukunft. Nur wissen zu<br />
wenige <strong>von</strong> diesem Potential, gerade in der Sphäre der Politik. Daran müssen wir arbeiten. Zu<br />
viele wissen zu wenig da<strong>von</strong>, was für <strong>ein</strong> Vorteil es ist, wenn Denkmalschutz und<br />
Denkmalpflege nicht in der Ecke sondern zu Seite stehen.<br />
7