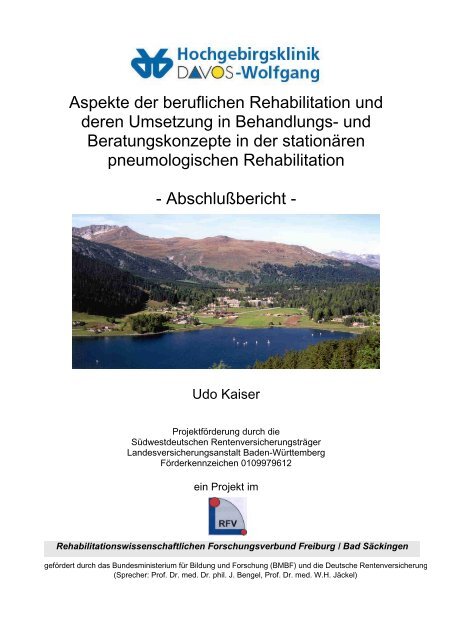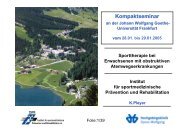Körperliche und Psychische Summenskala des SF12
Körperliche und Psychische Summenskala des SF12
Körperliche und Psychische Summenskala des SF12
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aspekte der beruflichen Rehabilitation <strong>und</strong><br />
deren Umsetzung in Behandlungs- <strong>und</strong><br />
Beratungskonzepte in der stationären<br />
pneumologischen Rehabilitation<br />
- Abschlußbericht -<br />
Udo Kaiser<br />
Projektförderung durch die<br />
Südwestdeutschen Rentenversicherungsträger<br />
Lan<strong>des</strong>versicherungsanstalt Baden-Württemberg<br />
Förderkennzeichen 0109979612<br />
ein Projekt im<br />
Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverb<strong>und</strong> Freiburg / Bad Säckingen<br />
gefördert durch das B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Forschung (BMBF) <strong>und</strong> die Deutsche Rentenversicherung<br />
(Sprecher: Prof. Dr. med. Dr. phil. J. Bengel, Prof. Dr. med. W.H. Jäckel)
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung.....................................................................................................................................<br />
1. Theoretischer Hintergr<strong>und</strong>....................................................................................................<br />
1.1. Die Bedeutung pneumologischer Erkrankungen...............................................................<br />
1.2. Sozioökonomische Aspekte pneumologischer Erkrankungen...........................................<br />
1.3. Die pneumologische Versorgung in Deutschland..............................................................<br />
1.4. Pneumologische Rehabilitation.........................................................................................<br />
1.4.1. Konzepte der Behinderung <strong>und</strong> Rehabilitation......................................................<br />
1.4.2. Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen........................................................................................<br />
1.4.3. Indikationsspezifische Rehabilitationsziele............................................................<br />
1.4.4. Komponenten der pneumologischen Rehabilitation..............................................<br />
1.5. Zielorientierung in der medizinischen Rehabilitation.........................................................<br />
1.6. Berufsbezogene Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation...................................<br />
2. Projektverlauf........................................................................................................................<br />
3. Forschungsmethodik.............................................................................................................<br />
3.1. Zielsetzungen <strong>und</strong> Fragestellung......................................................................................<br />
3.2. Methodik <strong>und</strong> Design.........................................................................................................<br />
3.3. Beschreibung der Erhebungsinstrumente.........................................................................<br />
3.4. Stichprobengewinnung <strong>und</strong> Rücklauf................................................................................<br />
3.5. Auswertungskonzeption....................................................................................................<br />
3.6. Datenschutz/Ethikkommission...........................................................................................<br />
4. Ergebnisse............................................................................................................................<br />
4.1. Ergebnisse der Nachbefragung.........................................................................................<br />
4.1.1. Demographische Stichprobenmerkmale................................................................<br />
4.1.2. Somatische Stichprobenmerkmale........................................................................<br />
4.1.3. Funktionale Stichprobenmerkmale........................................................................<br />
4.1.4. Psychosoziale Stichprobenmerkmale....................................................................<br />
4.1.5. Behandlungsbezogene Stichprobenmerkmale......................................................<br />
4.2. Vorhersage der Frühberentung.........................................................................................<br />
4.2.1. Vorhersage der Frühberentung bezogen auf Messzeitpunkt t1 .............................<br />
4.2.1.1. Zusammensetzung der Gruppen <strong>und</strong> vorbereitendende Schritte...............<br />
4.2.1.2. Darstellung der Ergebnisse bezogen auf Messzeitpunkt t1........................<br />
4.2.2. Vorhersage der Frühberentung bezogen auf Messzeitpunkt t2............................<br />
4.3. Ergebnisse der Befragung zu beruflichen Hilfen...............................................................<br />
4.3.1. Demographische Stichprobenmerkmale................................................................<br />
4.3.2. Somatische Stichprobenmerkmale........................................................................<br />
4.3.3. Funktionale Stichprobenmerkmale........................................................................<br />
4.3.4. Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebensqualität..........................................................<br />
4.3.5. Behandlungsbezogene Stichprobenmerkmale......................................................<br />
4.3.6. Bewertung der Rehabilitationsbehandlung durch den Arzt...................................<br />
4.3.7. Vorhersage der Frühberentung durch den Arzt.....................................................<br />
4.4. Entwicklung eines Assessmentinstrumentes.....................................................................<br />
4.5. Ergebnisse der Expertenbefragung...................................................................................<br />
4.5.1. Pneumologische Fachkliniken...............................................................................<br />
4.5.2. Niedergelassene Pneumologen.............................................................................<br />
5. Zusammenfassung................................................................................................................<br />
5.1. Welche somatischen, funktionalen, psychosozialen <strong>und</strong> behandlungsbezogenen Merkmale<br />
weist der „pneumologische Patient“ auf?..........................................................<br />
5.2. Welche Risikoprofile zur Frühberentung bzw. der Gefährdung hierzu lassen sich ablei-<br />
2<br />
6<br />
8<br />
8<br />
9<br />
9<br />
11<br />
11<br />
12<br />
14<br />
15<br />
17<br />
20<br />
30<br />
35<br />
35<br />
36<br />
36<br />
40<br />
42<br />
43<br />
44<br />
44<br />
45<br />
46<br />
48<br />
53<br />
60<br />
64<br />
64<br />
64<br />
66<br />
74<br />
79<br />
79<br />
80<br />
82<br />
85<br />
87<br />
93<br />
98<br />
102<br />
112<br />
112<br />
117<br />
122<br />
123<br />
128
ten?....................................................................................................................................<br />
5.3. Wie können Risiken zur Früherkennung durch ein Screeninginstrument frühzeitig identifiziert<br />
<strong>und</strong> zielgerichtet in den Rehabilitationsprozess eingebracht werden?.................<br />
5.4. Welche Beratungskonzepte sind notwendig, damit der langfristige Behandlungserfolg<br />
gesichert <strong>und</strong> eine Frühberentung vermieden werden kann (Schnittstelle zur Nachsorge)?..............................................................................................................................<br />
5.5. In welchem Ausmaß finden berufliche Aspekte im Rahmen einer pneumologischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme Berücksichtigung?.................................................................<br />
5.6. Welchen Beitrag können hierbei die an der Gesamtbehandlung beteiligten Versorgungssegmente<br />
leisten?....................................................................................................<br />
6. Diskussion <strong>und</strong> Integration der Ergebnisse...........................................................................<br />
7. Überlegungen <strong>und</strong> Vorbereitungen zur Umsetzung der Ergebnisse.....................................<br />
7.1. Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen der Umsetzung..................................................................<br />
7.2. Umsetzungen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang..................................................<br />
7.3. Weitere Möglichkeiten der Umsetzung..............................................................................<br />
8. Publikationsliste während <strong>des</strong> Förderzeitraums....................................................................<br />
9. Literaturverzeichnis...............................................................................................................<br />
10. Anhang..................................................................................................................................<br />
Tabellen<br />
Screeninginstrument (Langfassung)<br />
Arbeitsergebnisse der Projektgruppe<br />
3<br />
132<br />
133<br />
137<br />
139<br />
142<br />
157<br />
158<br />
162<br />
167<br />
170<br />
172<br />
186
Wenn von „Sinn der Arbeit“ überhaupt noch die Rede sein kann, dann besteht dieser<br />
nun – was wahrhaftig nicht verächtlich gemeint ist – im Empfang der Lohntüte. Da<br />
die Mehrheit unserer in den hochindustrialisierten Ländern lebenden Zeitgenossen<br />
nur noch diesen Sinn kennen, nur diesen noch kennen können, müssen wir von dieser<br />
Mehrzahl sagen, sie führe ein sinnloses Leben. Wobei wir freilich zugestehen<br />
müssen, dass das „sinnlose Arbeiten“ vielleicht – nein: nicht sinnvoller, aber doch<br />
wohl erträglicher ist als das sinnlose Herumvegetieren der Arbeitslosen, denen noch<br />
nicht einmal sinnloses Arbeiten vergönnt ist. Es gibt nichts Herzzerreißenderes als<br />
das Heimweh der Arbeitslosen nach den guten alten Zeiten, in denen sie noch hatten<br />
sinnlos arbeiten dürfen.<br />
Günter Anders<br />
4
Einleitung<br />
Die vorliegende Arbeit bildet den Abschlußbericht <strong>des</strong> Forschungsprojektes „Aspekte<br />
der beruflichen Rehabilitation <strong>und</strong> deren Umsetzung in Behandlungs- <strong>und</strong> Beratungskonzepte<br />
in der stationären pneumologischen Rehabilitation“. Das Projekt wurde<br />
durch die Südwestdeutschen Rentenversicherungsträger unter der Federführung<br />
der LVA Baden-Württemberg gefördert (Förderkennzeichen 0109979612) <strong>und</strong> ist ein<br />
Vorhaben <strong>des</strong> Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverb<strong>und</strong>es Freiburg /<br />
Bad Säckingen (Sprecher: Prof. Dr. Dr. J. Bengel, Prof. Dr. W.H. Jäckel).<br />
Das Projekt wurde im Zeitraum von Oktober 1998 <strong>und</strong> September 2002 an der Deutschen<br />
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (Projektleiter: Dr. U. Kaiser, Projektmitarbeiter<br />
bis September 2001: Dipl.-Psych. S. Lippitsch) durchgeführt.<br />
Die Studie verfolgte fünf Fragestellungen bezüglich der Indikation zu berufsbezogenen<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> deren Umsetzung durch einen interdisziplinären Beratungsansatz<br />
in der medizinischen Rehabilitation.<br />
Die ersten beiden Fragestellungen beschäftigen sich mit der Beschreibung pneumologischer<br />
Patienten auf den relevanten Ebenen der Internationalen Klassifikation der<br />
Funktionsfähigkeit, Behinderung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit (ICF) <strong>und</strong> der Ableitung eines Risikoprofils<br />
zur Frühberentung aus diesen Merkmalen. Zur Beantwortung dieser Fragen<br />
dienen vorliegende Erhebungen aus drei Studien, die fünf Jahre später durch eine<br />
Nachbefragung unter besonderer Berücksichtigung beruflicher Aspekte ergänzt wurden.<br />
Die dritte Fragestellung beinhaltet die Entwicklung eines Screeningverfahrens<br />
zur frühzeitigen Erkennung von Patienten mit einem erhöhten Risiko zur Frühberentung,<br />
welches sich auf die ermittelten Risikofaktoren bezieht. Die vierte Fragestellung<br />
beschäftigt sich mit dem notwendigen Beratungsbedarf im berufsbezogenen Kontext<br />
<strong>und</strong> hieraus abgeleitet, mit der Entwicklung eines interdisziplinären Informations- <strong>und</strong><br />
Beratungsansatzes <strong>und</strong> <strong>des</strong>sen Integration in die stationäre pneumologische Rehabilitation.<br />
Im Kontext der Schnittstelle zur Rehabilitationsnachsorge beinhaltet die<br />
fünfte Fragestellung die Abbildung vorhandener <strong>und</strong> notwendiger beruflicher Hilfen<br />
im Bereich der Rehabilitationsnachsorge bzw. in den unterschiedlichen Versorgungssegmenten<br />
in der Behandlungskette.<br />
Die vorliegenden Studien basieren auf einem korrelativ-naturalistischen Untersuchungskonzept<br />
ohne Kontrollgruppe <strong>und</strong> Randomisierung <strong>und</strong> beziehen sich ausschließlich<br />
auf Patientenangaben. Unter Einbeziehung der Nachbefragung handelt<br />
es sich um ein Längsschnitt<strong>des</strong>ign mit zwei Messzeitpunkten (t1: Klinikaufnahme, t2:<br />
> 5 Jahre nach Klinikentlassung). Bei der Befragung zu beruflichen Hilfen handelt es<br />
sich um eine Querschnittuntersuchung mit einem Messzeitpunkt, bei der Patienten-<br />
<strong>und</strong> Arztangaben einbezogen werden. Die Expertenbefragung zu vorhandenen <strong>und</strong><br />
notwendigen Hilfen in der Behandlungskette wurde mittels einmaliger Fragebogenerhebung<br />
durchgeführt. Die eingesetzten Erhebungsinstrumente beinhalten erprobte<br />
Eigenkonstruktionen <strong>und</strong> standardisierte Verfahren, die sich in der rehabilitationswissenschaftlichen<br />
Forschung bewährt haben.<br />
Im Kontext <strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>themas „Zielorientierung in Diagnostik, Therapie <strong>und</strong> Ergebnismessung“<br />
besteht die primäre Zielsetzung <strong>des</strong> Projektes in der Entwicklung von<br />
Verfahren zur besseren Berücksichtigung berufsbezogener Fragestellungen in der<br />
medizinischen Rehabilitation.<br />
6
Die Durchführung umfangreicher rehabilitationswissenschaftlicher Studien ist insbesondere<br />
im Routinealltag einer Rehabilitationsklinik nur durch Unterstützung vieler<br />
Personen möglich. Da Abschlußberichte auch immer die Möglichkeit bieten, dieses<br />
oft unsichtbare Unterstützungssystem zu würdigen, möchte ich hier die Gelegenheit<br />
nutzen, mich für die erfahrene Unterstützung im Projektverlauf zu bedanken.<br />
Mein erster Dank gilt der Stiftung Deutsche Hochgebirgsklinik Davos 1 (Präsident:<br />
Prof. Dr. W. Schülen, D. Ohnmacht), der Geschäftsführung (F.J. Alemany) <strong>und</strong> der<br />
ärztlichen Direktion (Dr. M. Schmitz, PD Dr. G. Menz) für die Genehmigung zur<br />
Durchführung der Studie <strong>und</strong> die umfangreiche Unterstützung.<br />
Mein besonderer Dank gilt den Patientinnen, Patienten <strong>und</strong> Ärzten, die sich an der<br />
Studie beteiligt haben für deren Einsatz <strong>und</strong> Geduld beim Ausfüllen der umfangreichen<br />
Fragebögen. Dem Projektmitarbeiter Dipl.-Psych. S. Lippitsch <strong>und</strong> den vielen<br />
Hilfskräften danke ich für ihren Beitrag zum Gelingen <strong>des</strong> Projektes. Des weiteren<br />
möchte ich mich bei K.U. Bohrmann <strong>und</strong> L. Sakobielski für die seit Jahren bewährte<br />
<strong>und</strong> engagierte Unterstützung bei der Organisation der unterschiedlichen Befragungen<br />
<strong>und</strong> bei S. Hart <strong>und</strong> Dipl.-Psych. E. Lietz für die Durchsicht <strong>des</strong> Manuskriptes<br />
bedanken. Wesentlicher Dank im Rahmen der Umsetzung <strong>und</strong> Erprobung der Projektergebnisse<br />
gilt der klinikinternen Projektgruppe „Berufliche Orientierung in der<br />
medizinischen Rehabilitation“, die das Projekt über einen langen Zeitraum beratend<br />
begleitet hat (Dr. E. Petri, K. Pleyer, F.D. Südmeyer, P. Bleuel, Dr. C. Bizer).<br />
Weiterhin möchte ich mich bei den Süddeutschen Rentenversicherungsträgern – vertreten<br />
durch die LVA Baden Württemberg – für die Projektförderung bedanken. Für<br />
die administrative Abwicklung <strong>des</strong> Projektes <strong>und</strong> der mir häufig entgegengebrachten<br />
Geduld bedanke ich mich dabei insbesondere bei Herrn Kraft <strong>und</strong> Frau Günter.<br />
Ein ganz besonderer Dank gilt auch dem Forschungsverb<strong>und</strong> Freiburg/Bad Säckingen.<br />
Hierbei ist insbesondere die stets fre<strong>und</strong>schaftliche <strong>und</strong> vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />
mit dem Geschäftsführer <strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>es (J. Herdt) <strong>und</strong> damit auch mit<br />
den Verb<strong>und</strong>sprechern (Prof. Dr. Dr. J. Bengel, Prof. Dr. W.H. Jäckel) zu nennen,<br />
durch die vorhandene Probleme stets konstruktiv <strong>und</strong> im wahrsten Sinne <strong>des</strong> Wortes<br />
grenzüberschreitend geklärt werden konnten. Weiterhin danke ich dem Methodenzentrum<br />
<strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>es (vertreten durch Dipl.-Psych. R. Leonhardt) für die kritische<br />
<strong>und</strong> gleichzeitig konstruktive Stellungnahme zum Entwurf <strong>des</strong> Abschlußberichtes.<br />
Zum Schluss möchte ich mich ganz persönlich bei meinem näheren persönlichen<br />
<strong>und</strong> beruflichen Umfeld für das wohlwollende Ertragen meines chronischen Zeitmangels<br />
- der im Zeitraum der Berichterstellung seinen Höhepunkt erreichte - <strong>und</strong> die<br />
erfahrende Unterstützung bedanken.<br />
Davos Wolfgang im Juni 2003<br />
Dr. U. Kaiser<br />
1 Genannt sind die jeweiligen Personen zum Zeitpunkt der Datenerhebungen (kursiv) <strong>und</strong> zum jetzi-<br />
gen Zeitpunkt<br />
7
1. Theoretischer Hintergr<strong>und</strong><br />
1.1. Die Bedeutung pneumologischer Erkrankungen<br />
Asthma bronchiale ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen, im Kin<strong>des</strong>-<br />
<strong>und</strong> Jugendalter die häufigste Erkrankung. Sie nimmt weltweit jährlich zu. In Mitteleuropa<br />
sind 6-8 % der erwachsenen Bevölkerung an Asthma bronchiale erkrankt. 15-20<br />
% weisen ein hyperreagibles Bronchialsystem auf, bei über 20 % der erwachsenen<br />
Bevölkerung sind allergische Sensibilisierungen gegen Umweltallergene nachweisbar<br />
(Nowak & v. Mutius 2000). Alleine in Deutschland werden jährlich ca. 100.000<br />
Neudiagnosen an Asthma bronchiale gestellt. Trotz verbesserter diagnostischer <strong>und</strong><br />
therapeutischer Möglichkeiten ist der Anstieg von Morbidität <strong>und</strong> Mortalität ungebremst<br />
(ÄZQ 2001, Cegla 1996, GINA 1995, Petro 2000, Menz et al. 2002, Deutsche<br />
Atemwegsliga 1998, Pauwels et al. 2001, Konietzko & Fabel 2000).<br />
Asthma wird als eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege beschrieben,<br />
an der viele Zellen, wie insbesondere Mastzellen, eosinophile Granulozyten, T-<br />
Lymphozyten, neutrophile Granulozyten <strong>und</strong> Epithelzellen beteiligt sind. Bei prädisponierten<br />
Personen führt diese Entzündung zu rekurrierenden Episoden von Giemen,<br />
Kurzatmigkeit, Brustenge <strong>und</strong> Husten, vor allem nachts <strong>und</strong> am frühen Morgen.<br />
Diese Episoden gehen in der Regel mit einer ausgedehnten, aber variablen Verengung<br />
der Atemwege einher, welche häufig spontan oder nach Behandlung reversibel<br />
ist. Charakteristisch für alle Formen <strong>des</strong> Asthma bronchiale sind das Schleimhautödem,<br />
die Ausbildung der bronchialen Überempfindlichkeit, eine meist variable bronchiale<br />
Obstruktion sowie eine vermehrte Schleimbildung (Deutsche Atemwegsliga<br />
1998, Petro 2000, Schultze-Werninghaus & Debelic 1988).<br />
Klinik <strong>und</strong> weitergehende Untersuchungen lassen eine grobe Einteilung <strong>des</strong> Asthma<br />
bronchiale in ein allergisches Asthma <strong>und</strong> ein nichtallergisches, sogenanntes Intrinsic<br />
Asthma zu. Asthma bronchiale ist nicht nur reversible Atemwegsobstruktion,<br />
Schleimhautödem oder -bildung, sondern kann zu irreversiblen Veränderungen an<br />
bronchialen <strong>und</strong> pulmonalen Strukturen führen (Remodeling der Atemwege). Um eine<br />
frühzeitige Behandlung einleiten zu können, ist eine rechtzeitige intensive Diagnostik<br />
(Staging) erforderlich (Menz et al. 2002, Menz 2002, Pauwels et al. 2001,<br />
Deutsche Atemwegsliga 1998, ÄZQ 2002).<br />
Unter COPD verstehen wir eine chronische Lungenerkrankung mit progredienter,<br />
nach Gabe von Bronchodilatatoren <strong>und</strong>/oder Glukokortikoiden nicht vollständig reversible<br />
Atemwegsobstruktion auf dem Boden einer chronischen Bronchitis <strong>und</strong>/oder<br />
eines Lungenemphysems (Worth et al. 2002, Gillissen 2000, Konietzko & Fabel<br />
2000).<br />
Die Häufigkeit wird in Deutschland auf 10-15 % geschätzt. Typische Symptome sind<br />
chronischer Husten mit oder ohne Auswurf sowie Atemnot, die anfangs nur unter Belastung<br />
auftritt. Nicht eingeschlossen in die Definition der COPD ist das Asthma bronchiale<br />
(Worth et al. 2002).<br />
8
1.2. Sozioökonomische Aspekte pneumologischer Erkrankungen<br />
Pneumologische Erkrankungen verursachen mit jährlichen Kosten in Höhe von 37<br />
Milliarden DM die zweithöchsten Kosten aller Krankheitsgruppen in Deutschland, nur<br />
übertroffen von Herz- Kreislauferkrankungen (Konietzko & Fabel 2000, Wettengel &<br />
Volmer 1994).<br />
Die Gesamtkosten errechnen sich aus der Summe von direkten <strong>und</strong> indirekten Kosten.<br />
Zu den direkten Kosten zählen ärztliche Leistungen, Arzneimittel, stationäre Behandlung,<br />
Rehabilitation <strong>und</strong> Krankengeldzahlungen. Zu den indirekten Kosten werden<br />
die krankheitsbedingte Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsunfähigkeit sowie die durch den vorzeitigen<br />
Tod bedingten Produktivitätsverluste gezählt. Tabelle 1 verdeutlicht, dass bei<br />
pneumologischen Erkrankungen die indirekten Kosten der dominierende Faktor sind,<br />
d.h. also der Verlust an menschlichem Arbeitskapital für die Gesellschaft infolge Arbeitsunfähigkeit,<br />
vorzeitiger Invalidisierung <strong>und</strong> frühzeitigem Tod. Trotz dieser immensen<br />
indirekten Kosten sind Aufwendungen für pneumologische Rehabilitationsmaßnahmen<br />
relativ gering (vgl. Tab. 1).<br />
Tabelle 1: Kosten von Lungenerkrankungen (Konietzko & Fabel 2000)<br />
Kostenarten Lungenkrankheiten Asthma Chronische<br />
Insgesamt bronchiale Bronchitis<br />
Vorzeitige To<strong>des</strong>fälle 4,5 0,289 0,506<br />
Vorzeitige Rentenfälle 3,9 0,683 1,56<br />
Arbeitsausfall 13,8 0,737 5,814<br />
Rehabilitation 0,3 0,147 0,071<br />
Krankenhaus 4,9 0,334 0,9<br />
Arzneimittel 5 1,311 1,927<br />
Ambulante Behandlung 4,6 0,703 1,656<br />
Gesamt in Mrd. 37 4,2 12,3<br />
In der zukünftigen Entwicklung ist den vier „großen“ pneumologischen Erkrankungen<br />
noch eine größere Bedeutung zuzumessen. Nach epidemiologischen Schätzungen<br />
werden pneumologische Erkrankungen im Jahr 2020 global nach den kardiovaskulären<br />
Erkrankungen führend sein <strong>und</strong> auf der Rangliste nach oben rutschen. Insgesamt<br />
ist in Deutschland bis zum Jahr 2010 mit einer Zunahme pneumolgischer Erkrankungen<br />
(Asthma, COPD, Pneumonie) um 25 % auszugehen, was sich in einer entsprechenden<br />
Zunahme der krankheitsbedingten Folgekosten niederschlagen wird (Konietzko<br />
& Fabel 2000).<br />
1.3. Die pneumologische Versorgung in Deutschland<br />
Trotz der hohen sozioökonomischen Relevanz ist die pneumologische Versorgung<br />
im Vergleich mit anderen Schwerpunktfächern der inneren Medizin <strong>und</strong> dem europäischen<br />
<strong>und</strong> außereuropäischen Ausland einmalig schlecht (Konietzko & Fabel 1996,<br />
Kaiser & Schmitz 1998a, Sachverständigengutachten 2002a,b, 2003, Kaiser 2003):<br />
Fachärzte in der Pneumologie: Von den zur Zeit r<strong>und</strong> 1.200 aktiven Fachärzten für<br />
Pneumologie sind 617 in der Praxis, 495 im Krankenhaus <strong>und</strong> ca. 20 in Behörden<br />
tätig. Internationale Standards gehen von einem Richtwert von jeweils einem Pneumologen<br />
auf 100.000 Einwohner - getrennt für die stationäre <strong>und</strong> ambulante Versorgung<br />
- aus. Dies bedeutet auf der Basis der Zahlen von 1990 ein Defizit von ca. 400<br />
Pneumologen, das sich in etwa gleichem Umfang auf den ambulanten wie auf den<br />
9
stationären Bereich bezieht. In Anbetracht der Bevölkerungs- <strong>und</strong> Morbiditätsentwicklung<br />
mit einer Zunahme der pneumologischen Erkrankungen um 25 % <strong>und</strong> der<br />
Krankenhaustage um 10 % bis zum Jahre 2010 ist der Gesamtbedarf in der Praxis<br />
<strong>und</strong> Klinik auf 1.600 Fachärzte für Pneumologie anzusetzen (Prognosestudie Stand<br />
<strong>und</strong> Entwicklung der Pneumologie 1992, Konietzko & Fabel 1996).<br />
Pneumologische Betten: Für 1989 weist das statistische B<strong>und</strong>esamt insgesamt 4.069<br />
Betten für Lungen- <strong>und</strong> Bronchialheilk<strong>und</strong>e aus. Im Vergleich zu anderen medizinischen<br />
Fachrichtungen wird der überwiegende Teil (66 %) der pneumologischen Betten<br />
in Fachkrankenhäusern betrieben. Demgegenüber ist die Anzahl von 21 pneumologischen<br />
Fachabteilungen in Allgemeinkrankenhäusern <strong>und</strong> der geringe Anteil<br />
pneumolgischer Betten in Universitätskliniken mit 3,4 % weit niedriger als bei anderen<br />
internistischen Fachgebieten. Unter Einschluss der Thoraxchirurgie stehen insgesamt<br />
4.800 Betten zur Verfügung, was einer Relation von 1 Bett auf 13.000 Einwohner<br />
entspricht. Bei einem jährlichen Gesamtpflegetagevolumen von 8,41 Mio.<br />
wurden 1,49 Mio. Tage innerhalb <strong>und</strong> 6,92 Mio. Tage außerhalb von Lungenfachabteilungen<br />
<strong>und</strong> -fachkrankenhäusern erbracht. Dies bedeutet für die alten B<strong>und</strong>esländer<br />
ein Defizit von 22.300 Krankenhausbetten, für die neuen B<strong>und</strong>esländer ein Defizit<br />
von 3.000 Betten (Konietzko & Fabel 1996).<br />
Rehabilitationskliniken im Erwachsenenbereich: insgesamt existierten bis zum<br />
13.9.1996 57 Rehabilitationskliniken. Die Verteilung zeigt, dass die Kliniken vorwiegend<br />
im Norden (PLZ-Bereich 2 <strong>und</strong> 3) <strong>und</strong> im Süden (Schwarzwald, Bayern, PLZ-<br />
Bereich 7-9) angesiedelt sind (Deutsche Atemwegsliga 1996). Vier Kliniken befinden<br />
sich in Davos/Schweiz, was primär durch die günstigen Klimafaktoren begründet ist.<br />
1993 standen für die pneumologische Rehabilitation 3.630 Betten zur Verfügung (vgl.<br />
auch pneumologische Betten). Die pneumologische Rehabilitation machte damit nur<br />
2,5 % aller erfassten Betten in Rehabilitationskliniken aus (Buschmann-Steinhage<br />
1996). Es ist anzunehmen, dass durch den weiterhin vorgenommenen Bettenabbau<br />
in der stationären Rehabilitation heute weniger Potential vorhanden ist. Über die aktuelle<br />
Anzahl der Kliniken <strong>und</strong> Betten liegen jedoch keine Angaben vor.<br />
Universitäre Repräsentanz der Pneumologie: im internationalen Vergleich - insbesondere<br />
mit der EU <strong>und</strong> den USA - zeigt sich, dass die Repräsentanz der Pneumologie<br />
mangelhaft ist. In den USA ist an allen 173 ‘Medical Schools’ auch eine ‘Division<br />
of Pulmonology’ vorhanden, in der EU ist dies bei 80 % (173 von 209) der Fall (Konietzko<br />
& Fabel 1996). Demgegenüber haben 1995 von 33 Hochschulstandorten nur<br />
8 eine voll etablierte Abteilung für Pneumologie.<br />
Durch die Gegenüberstellung <strong>des</strong> sich aus den epidemiologischen Daten der ‘großen’<br />
Lungenkrankheiten ergebenden Bedarfs für Krankenversorgung, Lehre <strong>und</strong><br />
Forschung wird insgesamt deutlich, dass das vorhandene Potential der Pneumologie<br />
in Deutschland in den unterschiedlichen Bereichen defizitär ist <strong>und</strong> eine flächendeckende<br />
Versorgung nicht besteht.<br />
Für den Teilbereich der Rehabilitation lässt sich zusammenfassend feststellen, dass<br />
wohnortnahe ambulante Rehabilitationszentren, die alle wesentlichen Angebote unter<br />
einem Dach anbieten, bisher fehlen. Gleichfalls kann angenommen werden, dass<br />
die im Rahmen der Disease-Management-Programme (DMP) im Sachverständigengutachten<br />
(2003) angedachte Öffnung der Akutkliniken für Leistungen zur Rehabilitation<br />
durch die vorhandene Versorgungsstruktur im Akutbereich <strong>und</strong> zusätzlich durch<br />
10
weitere Faktoren limitiert ist (DGP 1997, Kaiser & Schmitz 1998a,b, Kaiser 2003,<br />
Pleyer & Schmitz 1997):<br />
Ambulante Versorgungsstruktur Versorgungsstruktur im Akutbereich<br />
• Fehlende ambulante Reha-Zentren<br />
• Fehlende ambulante Schulungsangebote<br />
• Lungensportgruppen sind nicht flächendeckend<br />
vorhanden<br />
• Selbsthilfegruppen sind notwendig, jedoch<br />
kein Ersatz für rehabilitative Versorgung<br />
• Ausrichtung der Physiotherapiepraxen<br />
unzureichend auf pneumologische Erkrankungen<br />
ausgerichtet<br />
• Psychologische Hilfen erschwert durch<br />
Zugänglichkeit, Wartezeiten, Zuzahlung<br />
<strong>und</strong> eingeschränkte Übertragbarkeit gängiger<br />
Therapiekonzepte auf körperlich<br />
chronisch Kranke<br />
• Für die Rehabilitation notwendiges Erfahrungswissen<br />
fehlt<br />
• Ungünstige Voraussetzungen hinsichtlich<br />
der notwendigen Berufsgruppen <strong>und</strong> der<br />
rehabilitativen Infrastruktur (räumlich,<br />
technisch)<br />
• Fehlende „rehabilitative Kultur“ bezüglich<br />
eines umfassenden Krankheits- <strong>und</strong> Behandlungsverständnisses,<br />
der sozialmedizinischen<br />
Ausrichtung <strong>und</strong> einem interdisziplinären<br />
Handeln<br />
• Fehlen eines interdisziplinär ausgerichteten<br />
Reha-Konzeptes <strong>und</strong> der integrativen<br />
Verzahnung der Teilangebote (Addition<br />
vs. Synergie)<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> wird pneumologische Rehabilitation vorwiegend in stationären<br />
Rehabilitationseinrichtungen umfassend durchgeführt werden können. Dies bedeutet<br />
jedoch, dass gerade in diesen Einrichtungen verstärkt berufliche Aspekte einbezogen<br />
werden müssen <strong>und</strong> gleichzeitig die Schnittstelle zur Nachsorge verbessert<br />
werden muss (DGP 1997, Kaiser 1994, Kaiser & Schmitz 1998a,b).<br />
1.4. Pneumologische Rehabilitation<br />
1.4.1. Konzepte der Behinderung <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
Zunehmende Prävalenz, gravierende krankheitsbedingte Folgen für die Betroffenen<br />
<strong>und</strong> insbesondere erhebliche sozioökonomische Folgekosten dieser Erkrankungen<br />
stehen in einem deutlichen Gegensatz zur fachärztlichen Versorgung mit limitierten<br />
Möglichkeiten in Früherkennung, Diagnostik <strong>und</strong> Therapie. Im Vordergr<strong>und</strong> steht hier<br />
meist eine biomedizinische Sichtweise, die sich in Diagnostik <strong>und</strong> Therapie fast ausschließlich<br />
an der Gr<strong>und</strong>erkrankung <strong>und</strong> deren Leitsymptomen orientiert.<br />
Die medizinische Rehabilitation erfordert dagegen eine systematische Erweiterung<br />
der akutmedizinischen Perspektive um Aspekte der Funktionsfähigkeit in Schule, Beruf<br />
<strong>und</strong> Alltagsleben, der psychischen Stabilität <strong>und</strong> der sozialen Integration im Sinne<br />
einer Orientierung am Krankheitsfolgenmodell der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation<br />
(WHO)(ICIDH), beziehungsweise <strong>des</strong>sen Weiterentwicklung (WHO 1980, Matthesius<br />
et al. 1995, Schuntermann 1996, WHO 2001, Schuntermann 2003, B<strong>und</strong>esausschuss<br />
der Ärzte <strong>und</strong> Krankenkassen 2003, VDR 1991, 2000a, BAR 1999a,b, 2001,<br />
Buschmann-Steinhage 1996).<br />
Während die ICIDH die notwendige Berücksichtigung der drei Aspekte Impairment<br />
(Schaden), Disability (Funktionsstörung) <strong>und</strong> Handycap (Beeinträchtigung) in den<br />
Mittelpunkt stellte, wird in den Ansätzen zur Weiterentwicklung der Theorie der Behinderung<br />
im Rahmen der International Classification of Functioning, Disability<br />
and Health (ICF, WHO 2001) ressourcenorientierten Konzepten verstärkt Bedeutung<br />
11
eigemessen. Die ICF unterscheidet zwischen den Modellkomponenten „Körperstrukturen<br />
<strong>und</strong> -funktionen“, „Aktivitäts- oder Leistungskonzept“ <strong>und</strong> dem „Partizipationskonzept“.<br />
Darüber hinaus finden Kontextfaktoren jetzt eine stärkere Berücksichtigung,<br />
da das Ziel der Partizipation der Betroffenen von den individuell zur Verfügung<br />
stehenden persönlichen <strong>und</strong> sozialen Ressourcen abhängig ist. Die ICF versteht sich<br />
als ein rehabilitationsrelevantes Rahmenkonzept, das gleichberechtigt die biologische,<br />
individuelle <strong>und</strong> soziale Perspektive von Ges<strong>und</strong>heit berücksichtigt.<br />
Der Begriff der Rehabilitation impliziert eine ganzheitliche, systemische <strong>und</strong> dynamische<br />
Sicht <strong>des</strong> Krankheitsgeschehens, wobei auf der Ebene <strong>des</strong> Individuums (<strong>und</strong><br />
seines sozialen Umfel<strong>des</strong>) alle vorhandenen Methoden <strong>und</strong> Interventionen bedarfs-<br />
<strong>und</strong> zielgerichtet eingesetzt werden müssen. Hierzu benötigt die Rehabilitationsmedizin<br />
Theorien <strong>und</strong> Modelle, die einerseits die Entstehungsprozesse von Behinderungen,<br />
andererseits die hieraus resultierenden rehabilitativen Interventionen beinhalten.<br />
Abb.1 versucht diese beiden Ansätze in einem Modell zu integrieren.<br />
Abb. 1. Entstehungsprozesse von Behinderungen <strong>und</strong> Ansatzpunkte für Intervention in der<br />
Rehabilitation (modifiziert nach Ger<strong>des</strong> & Weis 2000)<br />
Danach besteht das Ziel der Rehabilitation darin, hinsichtlich <strong>des</strong> Primärprozesses<br />
Schädigungen, Fähigkeitsstörungen <strong>und</strong> Beeinträchtigungen zu minimieren <strong>und</strong> die<br />
Entwicklung von Sek<strong>und</strong>ärprozessen zu verhindern. Rehabilitation zielt also nicht nur<br />
darauf ab, eingeschränkte <strong>und</strong> benachteiligte Personen zu befähigen, sich ihrer Umwelt<br />
anzupassen, sondern auch, in die Umfeldbedingungen einzugreifen, um die soziale<br />
Integration zu erleichtern (VDR 1991, Schuntermann 1996, 2003, Buschmann-<br />
Steinhage 1996, BAR 1999a,b, 2001, WHO 2001, Kaiser 1994, Bengel & Koch 2002,<br />
Bengel & Jäckel 2002).<br />
1.4.2. Gesetzliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Medizinische Leistungen zur Rehabilitation werden nach § 15 SGB VI in stationärer,<br />
teilstationärer oder ambulanter Form erbracht. Die Leistungen umfassen alle insofern<br />
erforderlichen medizinischen Maßnahmen, insbesondere die ärztliche Behandlung,<br />
die Versorgung mit Arznei- <strong>und</strong> Verbandsmitteln, mit Heilmitteln sowie die Ausstattung<br />
mit Hilfsmitteln (VDR 2000a, BAR 1999a,b, 2001).<br />
12
Nach den gesetzlichen Vorschriften sollen stationäre medizinische Rehabilitationsleistungen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich für längstens drei Wochen erbracht werden. Eine längere<br />
Behandlungsdauer ist jedoch möglich, soweit dies erforderlich ist, um das angestrebte<br />
Rehabilitationsziel zu erreichen. Medizinische Leistungen zur Rehabilitation<br />
werden nicht vor Ablauf von vier Jahren nach solchen oder ähnlichen Leistungen zur<br />
Rehabilitation erbracht, deren Kosten aufgr<strong>und</strong> öffentlich-rechtlicher Vorschriften getragen<br />
oder bezuschusst worden sind. Dies gilt nicht, wenn vorzeitige Leistungen aus<br />
ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen dringend erforderlich sind (§ 12 Abs. 2 Satz 2 SGB VI).<br />
Im Rahmen der sozialmedizinischen Zugangsbedingungen müssen aus medizinischer<br />
Sicht bei den Versicherten Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> eine positive Reha-Erfolgsprognose gegeben sein.<br />
Rehabilitationsbedürftigkeit im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung ist<br />
dann gegeben, wenn die Erwerbstätigkeit <strong>des</strong> Versicherten aus medizinischen Gründen<br />
erheblich gefährdet oder gemindert ist. Ob im Einzelfall Rehabilitationsbedürftigkeit<br />
vorliegt, ergibt sich aus der zusammenfassenden Bewertung aller wesentlichen<br />
sozialmedizinischen Faktoren, wie z.B.:<br />
• Funktionseinschränkungen<br />
• Risikokonstellation<br />
• Kombination von Ges<strong>und</strong>heitsstörungen/Multimorbidität<br />
• Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
• Bisherige Therapie<br />
• Erfordernis der Koordination mehrerer Therapieformen<br />
• Hoher Schulungsbedarf<br />
• Probleme bei der Krankheitsverarbeitung<br />
Der Begriff der Rehabilitationsfähigkeit bezieht sich auf die somatische <strong>und</strong> psychische<br />
Verfassung <strong>des</strong> Rehabilitanden für die Teilnahme an einer geeigneten Rehabilitation.<br />
Er muss in der Lage sein, das Angebot aktiver <strong>und</strong> passiver therapeutischer<br />
Leistungen wahrnehmen zu können.<br />
Das Gesetz fordert im § 10 SGB VI eine positive Reha-Erfolgsprognose. Die Stabilisierung<br />
<strong>des</strong> Leistungsvermögens im Erwerbsleben, letztendlich die Verminderung<br />
oder zumin<strong>des</strong>t das Hinausschieben der Berentung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit<br />
müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erreicht werden können: „Rehabilitation<br />
vor Rente“. Dies bedeutet, dass funktionelle Beeinträchtigungen, die einem<br />
rehabilitativen Behandlungsansatz gar nicht zugänglich oder so gravierend sind,<br />
dass das Rehabilitationsziel der Rentenversicherung nicht erreicht werden kann, eine<br />
Rehabilitation zulasten der Rentenversicherung ausschließen.<br />
Demnach ist eine pneumologische Rehabilitation dann indiziert, wenn trotz adäquater<br />
ambulanter ärztlicher Betreuung beeinträchtigende Krankheitsfolgen drohen,<br />
bestehen oder persistieren, die die Möglichkeiten von normalen Aktivitäten <strong>und</strong> der<br />
Partizipation am normalen beruflichen <strong>und</strong> privaten Leben behindern, insbesondere<br />
bei folgenden Konstellationen (DGP 1997, VDR 1991, Kaiser 1994, Kaiser et al.<br />
1995, Petro 2000):<br />
• Persistierende asthmatische Beschwerden <strong>und</strong> Einschränkung der Lungenfunktion<br />
bzw. instabiles Asthma trotz adäquater ambulanter medizinischer Betreuung<br />
13
• Gefährdung der Berufs- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit<br />
• Drohende Pflege- <strong>und</strong> Hilfsbedürftigkeit<br />
• Hoher medizinischer Ressourcenverbrauch wie z.B. wiederholte ambulante oder<br />
stationäre Notfallbehandlung<br />
• Patienten mit schweren medikamentös bedingten Folgekomplikationen, z.B. infolge<br />
einer notwendigen hochdosierten Steroidmedikation (u.a. Osteoporose, Adipositas,<br />
Diabetes, Stigmatisierung)<br />
• Persistierende psychosoziale Krankheitsfolgen trotz adäquater ambulanter medizinischer<br />
Betreuung<br />
• <strong>Psychische</strong> Komorbidität (z.B. Angststörungen; Syndrome <strong>des</strong> depressiven Formenkreises<br />
inkl. Anpassungsstörungen, somatoforme Störungen) mit Indikation<br />
zur begleitenden psychotherapeutischen Behandlung<br />
• Ambulante Schulung beim Patienten nicht ausreichend oder nicht möglich, bzw.<br />
vor Ort in zumutbarer Entfernung nicht vorhanden<br />
• Notwendige ambulante Trainingstherapie bzw. Atemphysiotherapie vor Ort in zumutbarer<br />
Entfernung nicht vorhanden bzw. nicht ausreichend<br />
• Erfolglose ambulante Tabakentwöhnung bei prinzipiell bestehender Motivation<br />
zum Rauchverzicht (intensivierte Entwöhnungsprogramme)<br />
• Notwendigkeit einer besonderen Allergen- <strong>und</strong> Schadstoffarmut<br />
1.4.3. Indikationsspezifische Rehabilitationsziele<br />
Die Zielsetzungen der pneumologischen Rehabilitation orientieren sich an den rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen <strong>und</strong> den Vorgaben der Kostenträger <strong>und</strong> Fachverbände.<br />
Für die von den Rentenversicherungsträgern gewährten Maßnahmen ergibt sich<br />
hierdurch das primäre Ziel, durch geeignete Maßnahmen zur Erhaltung <strong>und</strong> Wiedererlangung<br />
der Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten beizutragen. Für den pneumologischen<br />
Bereich wurden durch die Rentenversicherung (VDR 1991) <strong>und</strong> die Deutsche<br />
Gesellschaft für Pneumologie (DGP) unter Einbeziehung der allgemeinen Rehabilitationsziele<br />
entsprechende krankheitsspezifische Therapieziele <strong>und</strong> Angebote formuliert,<br />
die auf der somatischen, funktionalen, psychosozialen <strong>und</strong> edukativen Ebene<br />
angesiedelt sind (DGP 1997, Worth et. al. 2002, Deutsche Atemwegsliga 1998,<br />
ACVPR 1998, DGP 1995, Fischer 1995, Menz 2000, Kaiser 1994, Kaiser et al. 1995,<br />
1997).<br />
Die übergeordneten Ziele der Rehabilitation sind die Beseitigung oder Kompensation<br />
der somatischen, funktionalen <strong>und</strong> psychosozialen Krankheitsfolgen, die Steigerung<br />
der Lebensqualität <strong>und</strong> damit insgesamt die Reduzierung <strong>des</strong> volkswirtschaftlichen<br />
Schadens aus dem Verlust von Arbeits-, Erwerbsfähigkeit <strong>und</strong> Mortalität dieser Erkrankungen.<br />
Die allgemeinen Ziele der pneumologischen Rehabilitation beinhalten:<br />
• Maximale Besserung der Atemfunktion<br />
• Erlangung maximaler Selbständigkeit <strong>und</strong> Aktivität<br />
• Erlangung maximaler Kompetenz im Umgang mit der Erkrankung<br />
• Wiederaufnahme oder Fortsetzung der früheren beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung<br />
für besser geeignete Arbeit<br />
• Minimierung der Folgen der Krankheit für Familie <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
14
Aufgr<strong>und</strong> der individuellen Problemlagen lassen sich u.a. folgende weitere indikationsspezifische<br />
Ziele nennen:<br />
• Sicherstellung <strong>und</strong> Spezifizierung der (Rehabilitations-)Diagnose als Gr<strong>und</strong>lage<br />
für eine adäquate Therapie, Prognoseeinschätzung <strong>und</strong> Leistungsbeurteilung<br />
• Nach umfassender, vor allem allergologischer <strong>und</strong> lungenfunktioneller Diagnostik<br />
Formulierung langfristiger Therapieziele sowie Erarbeitung <strong>und</strong> Erprobung eines<br />
langzeitigen individuellen Behandlungskonzeptes<br />
• Optimierung der medikamentösen Therapie (Einstellung auf prophylaktische<br />
Basistherapie, Training bedarfsorientierter Therapieintensivierung bei infekt- oder<br />
allergiebedingten Exazerbationen mit klinischer bzw. Peak-Flow-Meter-Kontrolle)<br />
• Expositionskarenz, Eliminierung ungünstiger Trigger, Diagnostik <strong>und</strong> Eliminierung<br />
von Faktoren, die Exazerbationen begünstigen<br />
• Wiederherstellung der bestmöglichen funktionellen Leistungsfähigkeit, einschließlich<br />
der möglichst weitgehenden Besserung der Atemfunktion<br />
• Beurteilung <strong>des</strong> Schweregra<strong>des</strong> der Erkrankung <strong>und</strong> der bereits bestehenden<br />
Fähigkeits- <strong>und</strong> Funktionsstörungen<br />
• Besserung der Leitsymptome (Atemnot, Husten, Auswurf)<br />
• Linderung bzw. Abbau von leistungsschwächenden physischen <strong>und</strong> psychischen<br />
Symptomen<br />
• Besserung der körperlichen Belastbarkeit (private <strong>und</strong> berufliche Leistungsfähigkeit)<br />
• Identifizierung von auslösenden <strong>und</strong> aufrechterhaltenden Bedingungen der Symptomatik<br />
<strong>und</strong> Erlernen von Strategien zu deren Beeinflussung<br />
• Förderung der Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> <strong>des</strong> Krankheitsmanagements (Selbstwahrnehmung,<br />
Selbstkontrolle, eigenverantwortliches Krankheitsmanagement,<br />
Krankheitsakzeptanz, Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen <strong>und</strong><br />
Compliance)<br />
• Verhinderung bzw. Reduktion psychosozialer Krankheitsfolgen wie Angst, Depression<br />
<strong>und</strong> soziale Isolation<br />
• Ermöglichen einer möglichst normalen Partizipation am beruflichen, sozialen <strong>und</strong><br />
privaten Leben<br />
• Ermöglichen von Aktivitäten im Berufsleben sowie im privaten <strong>und</strong> öffentlichen<br />
Bereich in einem möglichst normalen Ausmaß, z.B. das Ermöglichen von sozialen<br />
Aktivitäten wie Sport oder Teilnahme an öffentlichen <strong>und</strong> kulturellen Ereignissen<br />
• Minimierung der Folgen der Erkrankung durch Erlernen sozialer Kompetenzen in<br />
Partnerschaft, Familie <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
• Verhinderung von Hilfs- <strong>und</strong> Pflegebedürftigkeit<br />
• Beratung für die berufliche Tätigkeit im Hinblick auf Allergien <strong>und</strong> Risikofaktoren<br />
• Verbesserung der Möglichkeiten zur Selbsthilfe<br />
• Einleitung tertiärpräventiver Maßnahmen (Rehabilitationsnachsorge)<br />
1.4.4. Komponenten der pneumologischen Rehabilitation<br />
Das Angebotsspektrum einer modernen pneumologischen Rehabilitationsklinik umfasst<br />
neben der umfassenden Diagnostik <strong>und</strong> medikamentösen Behandlung vor allem<br />
Angebote aus den Bereichen der Physikalischen Therapie (Physio-, Sport- <strong>und</strong><br />
Bewegungs-, Inhalations-, Balneo- <strong>und</strong> Hydrotherapie), der Psychosozialen Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> Rehabilitationspsychologie, der Patientenschulung <strong>und</strong> der Ernährung<br />
15
(DGP 1997, Kaiser 1994, Kaiser et al. 1995, Kaiser & Schmitz 1998a,c, Petro 2000,<br />
Worth et al. 2000, Pleyer & Schmitz 1998, Petri 2000).<br />
Die Vorgaben zur Strukturqualität basieren dabei auf evidenzbasierten Leitlinien<br />
(DGP 1995, 1997, ACVPR 1998, GINA 1995, ÄZQ 2001, Worth et al. 2002, Pauwels<br />
et al. 2001, Worth et al. 2000) <strong>und</strong> Vorgaben der Kostenträger (VDR 1991, 1995,<br />
1997, 2000a). Die Überprüfung der Struktur-, Prozess- <strong>und</strong> Ergebnisqualität erfolgt<br />
im Rahmen der Rentenversicherung durch das hierfür entwickelte Qualitätssicherungsprogramm<br />
(VDR 2000b, Kaiser & Schmitz 1994, 1995, Schmitz & Kaiser 2000).<br />
Damit die in enger Abstimmung mit dem ambulant behandelnden Facharzt <strong>und</strong> dem<br />
Rehabilitanden individuell zu definierenden Rehabilitationsziele erreicht werden können,<br />
verfügen Rehabilitationskliniken im Rahmen der Strukturqualität neben den üblichen<br />
Möglichkeiten zur pneumologischen Diagnostik <strong>und</strong> Therapie über umfassende<br />
rehabilitationsspezifische Verfahren:<br />
• umfassende Rehabilitationsdiagnostik<br />
• Optimierung der medikamentösen Therapie<br />
• Expositionskarenz<br />
• allergologische <strong>und</strong> umweltmedizinische Diagnostik, Beratung <strong>und</strong> Therapie<br />
• Patienteninformation, -schulung <strong>und</strong> -verhaltenstraining<br />
• Atemtherapeutische Maßnahmen, Atemmuskulaturtraining <strong>und</strong> -erholung durch<br />
nichtinvasive Beatmungstechniken (Physiotherapie)<br />
• Bewegungs-, Sport- <strong>und</strong> Trainingstherapie<br />
• psychosoziale Diagnostik <strong>und</strong> Beratung, Psychotherapie, Entspannungsverfahren<br />
• Balneologische Maßnahmen/Hydrotherapie<br />
• Ernährungsberatung <strong>und</strong> -schulung<br />
• Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung, einschließlich Sozial-, Berufs- <strong>und</strong> Rehabilitationsberatung<br />
• Diagnostik, Therapie <strong>und</strong> Schulung bei schlafbezogenen Atmungsstörungen<br />
• Sauerstofflangzeittherapie<br />
In Abbildung 2 ist exemplarisch die Angebotsstruktur der Hochgebirgsklinik Davos-<br />
Wolfgang für den Bereich der Rehabilitation <strong>des</strong> Asthma bronchiale dargestellt.<br />
Die Umsetzung dieses, an den Krankheitsfolgen ausgerichteten Konzeptes erfolgt<br />
durch ein Rehabilitationsteam, in dem neben Ärzten, Psychologen <strong>und</strong> Pflegekräften<br />
u.a. Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, Sozialarbeiter <strong>und</strong> Ernährungsberater<br />
interdisziplinär zusammenarbeiten (DGP 1997).<br />
16
Abb. 2 Angebotsstruktur der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang – Bereich Asthma<br />
1.5. Zielorientierung in der medizinischen Rehabilitation<br />
Das Schwerpunktthema <strong>des</strong> Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverb<strong>und</strong>es<br />
Freiburg/Bad Säckingen beinhaltet die Zielorientierung in Diagnostik, Therapie<br />
<strong>und</strong> Ergebnismessung (Bengel & Jäckel 2000). Ger<strong>des</strong>, Bengel & Jäckel (2000) beschreiben<br />
hierzu ein idealtypisches Modell einer wissenschaftlich voll entwickelten<br />
Rehabilitation, welches u.a. folgende Merkmale aufweist:<br />
• Die rehabilitationsrelevanten Problemlagen individueller Patienten können auf<br />
den verschiedenen Dimensionen (somatisch, funktional, psychosozial, edukativ)<br />
detailliert beschrieben <strong>und</strong> Fallgruppen zugeordnet werden, die durch jeweils<br />
ähnliche Problemlagen gekennzeichnet sind<br />
• Bei den Rehabilitationsträgern liegen abgesicherte Erkenntnisse vor, die als Entscheidungshilfen<br />
für die Indikation zur Rehabilitation <strong>und</strong> für die Zuweisung zu<br />
geeigneten Rehabilitationseinrichtungen genutzt werden können<br />
• Für die verschiedenen Fallgruppen können auf den rehabilitationsrelevanten Dimensionen<br />
kurz-, mittel- <strong>und</strong> langfristige Therapieziele bestimmt werden, deren<br />
Erreichung gemessen oder nach transparenten Kriterien beobachtet werden kann<br />
• Es stehen erprobte Vorgehensweisen zur Verfügung, die es ermöglichen, die Patienten<br />
als die primären Handlungsträger im Rehabilitationsprozess in die Be-<br />
17
stimmung reha-relevanter Problemlagen <strong>und</strong> in die Definition von Therapiezielen<br />
einzubeziehen<br />
• Für die verschiedenen Therapieziele sind therapeutische Verfahren bzw. kurz-,<br />
mittel- <strong>und</strong> langfristige Therapieprogramme verfügbar, die mit einer angebbaren<br />
Wahrscheinlichkeit zur Zielerreichung führen<br />
• Die verschiedenen Versorgungsformen (stationär, teilstationär, ambulant) sind<br />
hinsichtlich ihrer differenziellen Indikation evaluiert <strong>und</strong> können zielorientiert eingesetzt<br />
werden<br />
• Es sind Kommunikationsstrukturen <strong>und</strong> inhaltliche Bezugspunkte etabliert, die<br />
eine Integration von Teilprozessen <strong>und</strong> verschiedenen Handlungsträgern ermöglichen<br />
Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die aktuelle Situation der Rehabilitation<br />
zentrale Schwachstellen aufweist, die zusammenfassend als Segmentierung der<br />
Teilprozesse bzw. -aspekte (Mangel an Integration) sowie als Pauschalisierung der<br />
Rehabilitationsangebote (Mangel an Differenzierung) bezeichnet werden können.<br />
Die Segmentierung zeigt sich dabei in der Isolierung von Teilprozessen, die relativ<br />
unverb<strong>und</strong>en nebeneinander ablaufen, der Abspaltung bestimmter Gruppen von Akteuren<br />
oder Absolutsetzung von Teilaspekten. Probleme dieser Art zeigen sich insbesondere<br />
in den Schnittstellen <strong>des</strong> Rehabilitationsprozesses (Zuweisung, stationäre<br />
<strong>und</strong> ambulante Rehabilitation bzw. Nachsorge). Sie können sich jedoch auch innerhalb<br />
von Rehabilitationseinrichtungen zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen<br />
ergeben (Ger<strong>des</strong>, Bengel & Jäckel 2000).<br />
Für den Bereich der pneumologischen Erkrankung sind insbesondere die Schnittstellenprobleme<br />
in der Rehabilitationskette belegt. In der Davoser-Reha-Studie (Kaiser<br />
1994) wurden 414 Patienten zu erwarteten Problemen nach der Entlassung <strong>und</strong><br />
zu notwendigen Angeboten in der Nachsorge befragt (Kaiser & Schmitz 1998a,b).<br />
Erwartete Probleme nach Entlassung Notwendige Angebote in der Nachsorge<br />
• Im Bereich der Arbeit (32,4 %)<br />
• Klima/Luft (23 %)<br />
• Weiterführung der Behandlung (22,3 %)<br />
• Im Bereich der Familie (13,6 %)<br />
• Freizeitgestaltung (11,8 %)<br />
• Allergenkontakt (5,2 %)<br />
• Sonstige (12,5 %)<br />
• Arztvorträge (71,6 %)<br />
• Lungensportgruppen (56,4 %)<br />
• Berufliche Beratung (53,8 %)<br />
• Psychotherapie (41,1 %)<br />
• Beratung in Rentenfragen (39,4 %)<br />
• Gesprächsgruppen mit Ärzten (37 %)<br />
• Psycholog. Gesprächsgruppen (33,7 %)<br />
• Selbsthilfegruppen (24,9 %)<br />
Trotz der geschilderten Probleme <strong>und</strong> der Relevanz vielfältiger Nachsorgemaßnahmen<br />
zeigen die Angaben in der Nachbefragung (6 Monate nach Entlassung), dass<br />
die konkrete Inanspruchnahme dieser Angebote bei einem sehr geringen Teil der<br />
Patienten erfolgt ist. Neben eigener sportlicher Betätigung (25,8 %) beziehen sich die<br />
weiteren Angaben auf Asthmasport (21,3 %), Alternativmedizin (7,9 %), Psychotherapie<br />
(6,4 %), Atemtherapie (4,9 %), Selbsthilfegruppe (4,6 %), Entspannungstherapie<br />
(4,3 %), Schulung (1,8 %) <strong>und</strong> psychologische Beratungsstelle (0,9 %). Eine genauere<br />
Analyse bezüglich <strong>des</strong> Asthmasports ergibt, dass nur 3,2 % der Befragten in<br />
einer eigentlichen Lungensportgruppe aktiv sind <strong>und</strong> 69,4 % in ihrer Reichweite keine<br />
derartigen Angebote vorgef<strong>und</strong>en haben. Ähnliche Tendenzen zeigen sich bezüglich<br />
der ambulanten Patientenschulung. Hier geben 42,8 % mangelnde regionale Ange-<br />
18
ote an, 55,3 % wurden ausschließlich während stationärer Rehabilitationsmaßnahmen<br />
geschult.<br />
Der Aspekt der Segmentierung im Kontext der Schnittstellen in der Behandlungskette<br />
wird durch die Gutachten <strong>des</strong> Sachverständigenrates 2001 <strong>und</strong> 2003 nachhaltig unterstützt.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> eines erheblichen Versorgungsdefizits im Bereich<br />
chronisch obstruktiver Atemwegserkrankungen (vgl. Abschnitt 1.3.) stellt der Sachverständigenrat<br />
2001 fest, dass die Einbeziehung gr<strong>und</strong>legender rehabilitativer Elemente<br />
in die Langzeitversorgung angezeigt ist, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen<br />
besser mit dem übrigen Versorgungsprozess abgestimmt werden müssen <strong>und</strong><br />
die pneumologische Rehabilitation besser in alle Bereiche der Versorgung integriert<br />
werden muss (Sachverständigengutachten 2001,2003).<br />
Steuerung über<br />
Ges<strong>und</strong>heitsökonomie,<br />
Prädiktoren zur<br />
gezielten Indikation,<br />
Leitlinien, QS-Management<br />
Prävention,<br />
Früherkennung<br />
Outcome-<br />
Assessment<br />
Disease-Management<br />
Hausarzt<br />
Facharzt<br />
Akutklinik<br />
REHABILI-<br />
TATION<br />
Rückkoppelung<br />
über Ergebnisse<br />
Ziele:<br />
Erhaltung/Wiederherstellung der<br />
Erwerbsfähigkeit, Verbesserung<br />
von Kosten/Effektivität<br />
Nachsorge,<br />
Vernetzung<br />
Abb. 3: Schnittstellenoptimierung durch Disease-Management (modifiziert<br />
nach Fischer 2001)<br />
Zwischenzeitlich wurde Asthma bronchiale in die Disease-Management-Programme<br />
(DMP) aufgenommen. Ziel der DMP ist die Steuerung der Behandlung definierter<br />
Ges<strong>und</strong>heitsstörungen über sektorspezifische Grenzen hinweg. Es wird angenommen,<br />
dass die systematische, integrierte <strong>und</strong> evidenzbasierte Patientenversorgung<br />
insbesondere bei chronischem Verlauf effektiver <strong>und</strong> effizienter ist als die fragmentierte<br />
Behandlung einzelner Krankheitsepisoden. Sämtliche Maßnahmen der Betreuung<br />
<strong>und</strong> Behandlung, aber auch (Sek<strong>und</strong>är-)Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation sollen<br />
eingeschlossen werden. Dabei sollen Krankenhäuser mit entsprechender Qualifikation<br />
vereinbarte Leistungen auch im Pflege- <strong>und</strong> Rehabilitationsbereich erbringen<br />
dürfen (Sachverständigengutachten 2003).<br />
Inwieweit die primär die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) betreffenden DMP<br />
die pneumologische Versorgungslandschaft nachhaltig verbessern werden, muss abgewartet<br />
werden. Die inhaltliche Ausgestaltung (Strukturen – Prozesse – Qualitätssi-<br />
19
cherung/Evaluation) erfolgt derzeit unter Einbeziehung der Rentenversicherung in<br />
Fachgremien, die jedoch von Akutmedizinern dominiert werden.<br />
Zur Verbesserung der rehabilitativen Gesamtversorgung erscheint es daher dringend<br />
erforderlich, dass sich neben den Fachverbänden auch Rehabilitationseinrichtungen<br />
<strong>und</strong> die Rehabilitationsforschung an diesen Entwicklungen (ambulante Rehabilitation,<br />
Rehabilitation in Akutkrankenhäusern, DMP) beteiligen (Kaiser 2000, 2001, 2003,<br />
Kaiser et al 2001, Kaiser & Lippitsch 2001).<br />
Die Pauschalisierung der Rehabilitationsangebote im Sinne eines Mangels an Differenzierung<br />
beschäftigt sich mit der Ausdifferenzierung von Merkmalen bestimmter<br />
Untergruppen innerhalb einer Gesamtgruppe (z.B. pneumologische Erkrankungen),<br />
die zur Festlegung der Therapieziele <strong>und</strong> zur differentiellen Indikation für die unterschiedlichen<br />
Angebote in der Rehabilitation genutzt werden sollen.<br />
Ger<strong>des</strong>, Bengel & Jäckel (2000) sehen vor diesem Hintergr<strong>und</strong> einen Entwicklungsbedarf<br />
vor allem darin, die Merkmale oder Merkmalkombinationen, nach denen therapeutisch<br />
relevante Untergruppen gebildet werden können, diagnostisch weiter auszudifferenzieren<br />
<strong>und</strong> erfolgversprechende Therapieprogramme für diese Untergruppen<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> zu evaluieren. Sie gehen davon aus, dass auf diese Weise<br />
der Komplexität der Einzelfälle stärker Rechnung getragen wird <strong>und</strong> gleichzeitig eine<br />
wichtige Voraussetzung dafür geschaffen werden kann, dass die Rehabilitationsprozesse<br />
sich auch in bislang allzu pauschal behandelten Bereichen mehr an individuell<br />
relevanten Reha-Zielen orientieren können. Die in Abschnitt 1.4. beschriebenen vielfältigen<br />
Merkmale der Rehabilitationsbedürftigkeit, der Rehabilitationsziele <strong>und</strong> der<br />
Komponenten der pneumologischen Rehabilitation unterstreichen die Relevanz dieses<br />
Ansatzes für diesen Indikationsbereich.<br />
1.6. Berufsbezogene Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation<br />
Das Ziel menschlicher Arbeit ist im ökonomischen Sinne mit der Produktion <strong>und</strong> der<br />
Verteilung von Waren oder Dienstleistungen verb<strong>und</strong>en, wofür der abhängig Arbeitende<br />
entsprechen<strong>des</strong> Geld erhält.<br />
Voraussetzung für ein stabiles Berufsleben sind für Bennett (1972) die realistische<br />
Einschätzung <strong>des</strong> eigenen Könnens <strong>und</strong> der eigenen Grenzen, die Fähigkeit, Fehlschläge<br />
zu verkraften <strong>und</strong> unter Stress zu arbeiten, ein Min<strong>des</strong>tmaß an Kontaktfähigkeit,<br />
Selbständigkeit, Unabhängigkeit <strong>und</strong> die Fähigkeit, klare Entscheidungen zu<br />
treffen <strong>und</strong> diese in die Tat umzusetzen.<br />
Dies lässt sich in Anlehnung an Cumming & Cumming (1962) durch die Einteilung<br />
der Arbeitsfähigkeiten in ‚instrumentelle Fähigkeiten’ <strong>und</strong> ‚sozioemotionale Fähigkeiten’<br />
spezifizieren. Die instrumentellen Arbeitsfähigkeiten beinhalten die notwendigen<br />
manuellen <strong>und</strong> geistigen Aspekte, die sozioemotionalen hingegen die Zusammenarbeit<br />
mit anderen, die Anpassung an die sozialen Normen <strong>und</strong> die Fähigkeit zur<br />
Durchsetzung eigener angemessener Bedürfnisse. Haerlin et al. (1985) liefern eine<br />
Übersicht über diese beiden Bereiche:<br />
20
• Instrumentelle Anteile der Arbeit:<br />
− Elementare Arbeitsfähigkeiten: Ausdauer, Zeiteinteilung, Genauigkeit, Sorgfalt,<br />
Gedächtnisleistung, Körperhaltung, Konzentration <strong>und</strong> Aufmerksamkeit<br />
− Spezielle Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten: sprachlogisches Verständnis, Schreiben,<br />
Umgang mit Zahlenmaterial, numerisches Verständnis, handwerklichestechnisches<br />
Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, formallogisches<br />
Verständnis<br />
• Sozioemotionale Anteile der Arbeit:<br />
− Emotionaler Bereich: Initiative, Antrieb, Motivation, Interesse<br />
− Bereich <strong>des</strong> Selbstbil<strong>des</strong>: Selbstvertrauen, Selbständigkeit, Rollenverhalten,<br />
Verantwortung<br />
− Sozialer, zwischenmenschlicher Bereich: Kontakt zu einzelnen <strong>und</strong> zu Gruppen,<br />
Beziehung zu Vorgesetzen, Kollegen <strong>und</strong> Untergebenen, Integration <strong>und</strong><br />
kooperative Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe, Anpassung <strong>und</strong> Durchsetzung<br />
Wesentliche Risiken zur individuellen Beschäftigungsfähigkeit beinhalten zwei<br />
typische arbeitsgeb<strong>und</strong>ene Risiken. Zum einen betrifft dies das Krankheitsrisiko infolge<br />
eines physischen <strong>und</strong> psychischen Verschleißes. Zum anderen ist mit höherem<br />
Alter das De-Qualifizierungsrisiko zu nennen, welches in dem Maße entsteht, wie<br />
spezifische Qualifikationen durch neue technische oder wirtschaftliche Anforderungen<br />
veralten (Krämer 2002). Beide Risiken entwickeln sich im Verlauf der Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Berufsbiographie <strong>und</strong> können in der Spätphase <strong>des</strong> Erwerbslebens ihren Höhepunkt<br />
erreichen (Naegele 1992, 2001). Treten diese Risiken gleichzeitig auf, prägen<br />
sie ganz entscheidend das höhere Beschäftigungsrisiko älterer Erwerbspersonen mit<br />
(Naegele & Frerichs 2001). Darüber hinaus ist das De-Motivationsrisiko zu nennen,<br />
welches sich aus im Erwerbsleben verlorener Anerkennung <strong>und</strong> erfahrener Entmutigungen<br />
ergibt (Behrens et al. 1999, Behrens 2001).<br />
Nach Krämer (1999) sind der Wandel der physischen/psychischen Leistungsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> Qualifikationsprofils mit dem Phänomen der ‚begrenzten Tätigkeitsdauer’<br />
verknüpft. Einem unabhängig von biologischen Alterungsprozessen im Betriebsalltag<br />
<strong>und</strong> hier an bestimmten Arbeitsplätzen regelmäßig auftretenden Phänomen, das mit<br />
zunehmendem Alter einer längerfristigen Erwerbstätigkeit entgegensteht (Morschhäuser<br />
1999). Insgesamt ist die individuelle Leistungsfähigkeit im Beruf überwiegend<br />
vom Arbeitsplatz, der Arbeitstätigkeit <strong>und</strong> den konkreten Arbeitsbedingungen abhängig<br />
sowie auch das Ergebnis stetiger Förderung. Leistungsminderungen sind demnach<br />
das Ergebnis von langjährigen Belastungen, fehlender ges<strong>und</strong>heitlicher Prävention,<br />
mangelnder Qualifizierung bzw. zu niedrigen Qualifikationsanforderungen im<br />
Erwerbsleben (vgl. Pack et al. 2000).<br />
Ein zusätzliches Risiko zum frühzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben stellt<br />
vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Arbeitsmarktlage seit Jahren ein höheres Alter dar 2 . Der<br />
hohe Anteil Älterer an der Langzeitarbeitslosigkeit ist hier nur ein zu nennen<strong>des</strong> Indiz<br />
(Kistler & Hilpert 2001). Das Problem Älterer am Arbeitsmarkt besteht nicht darin,<br />
dass ihr Risiko, entlassen zu werden, höher ist, sondern darin, das ihre Rückkehr-<br />
2 Vgl. zur Thematik Demographie <strong>und</strong> Erwerbsarbeit: Forschungsprogramm „Demographischer Wandel<br />
<strong>und</strong> die Zukunft der Erwerbsarbeit im Standort Deutschland“, gefördert durch das B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Bildung, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie.<br />
21
chancen auf einen neuen Arbeitsplatz mit zunehmendem Alter rapide absinken. In<br />
den letzten Jahren ist die Arbeitslosenquote der 55-59-Jährigen <strong>und</strong> diejenige der<br />
60-Jährigen <strong>und</strong> Älteren von einem doppelt so hohen Ausgangswert aus stärker angestiegen<br />
als diejenige <strong>des</strong> Durchschnitts bzw. aller anderen Altersgruppen. Dies<br />
bedeutet, dass insbesondere Arbeitnehmer ab 50 Jahre überdurchschnittlich endgültig<br />
im Sinne von Frühberentung oder Arbeitslosigkeit aus dem Erwerbsleben ausscheiden<br />
(Kistler & Hilpert 2001). Zahlen aus 2001 zeigen, dass insgesamt 29,6 %<br />
aller Arbeitslosen die Gruppe der über 50-Jährigen betrifft (Statistisches Jahrbuch<br />
2002, vgl. Abb. 4). Jüngste Studien belegen gleichzeitig, dass Arbeitslose im Vergleich<br />
zu Berufstätigen insgesamt einen ungünstigeren Ges<strong>und</strong>heitszustand haben<br />
<strong>und</strong> weniger ges<strong>und</strong>heitsbewusst leben. Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass Arbeitslosigkeit<br />
ursächliche Auswirkungen auf die Entwicklung schwerwiegender Erkrankungen<br />
hat (Grobe & Schwartz 2003). Vor dem Hintergr<strong>und</strong> einer bereits bestehenden<br />
chronischen Erkrankung kann daher durch Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Belastungen in der Wechselwirkung ein hoher Einfluss auf den weiteren<br />
Krankheitsverlauf <strong>und</strong> eine mögliche Frühberentung angenommen werden.<br />
Abb. 4: Arbeitslose 2001 nachAltergruppen<br />
Unterschiedliche Instrumente der Frühberentung haben in der Vergangenheit häufig<br />
auch dazu gedient, den Arbeitsmarkt zu entlasten. Hierbei haben Unternehmen häufig<br />
im Rahmen der allgemeinen Rationalisierungs- <strong>und</strong> Organisationsentwicklung ihre<br />
Personalprobleme in einer gesellschaftlich anerkannten Art <strong>und</strong> Weise <strong>und</strong> in einer<br />
für die Arbeitnehmer einigermaßen sozialverträglichen Art bereinigt (‚Early Exit’). Daten<br />
aus der Schweiz zeigen, dass in etwa der Hälfte der Fälle vorzeitige Berentungen<br />
auf Wunsch <strong>des</strong> Arbeitsgebers erfolgten (Huth 2002). Weitere Anhaltspunkte ergeben<br />
sich aus der Erwerbsquote <strong>und</strong> der Beschäftigungsquote 3 . Im internationalen<br />
Vergleich liegt diese für Deutschland insgesamt betrachtet im Mittelfeld (vgl. Abb. 5,<br />
3 Erwerbsquote: Anteil der 15-65-Jährigen Erwerbspersonen an der erwerbsfähigen Bevölkerung in %.<br />
Beschäftigungsquote: Nutzungsgrad <strong>des</strong> Faktors Arbeit durch den Anteil der Personen, die in Voll-<br />
<strong>und</strong> Teilzeit Lohn- <strong>und</strong> Gehalt beziehen in %.<br />
22
zitiert nach Eichhorst 2003). Bezogen auf April 2001 entfallen 19,5 % der Erwerbstätigen<br />
auf die Altersgruppe der 50-60-Jährigen <strong>und</strong> 4,6 % auf die Gruppe der<br />
über 60-Jährigen (vgl. Statistisches Jahrbuch 2002).<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
76,3<br />
81,0<br />
Schweden<br />
76,1<br />
84,9<br />
Norwegen<br />
Abbildung 5<br />
75,3<br />
84,2<br />
Dänemark<br />
71,8<br />
Erwerbsquote 1997-2001<br />
Frauen <strong>und</strong> Männer in %<br />
89,6<br />
Schweiz<br />
71,0<br />
75,7<br />
Finnland<br />
70,7<br />
83,9<br />
USA<br />
69,7<br />
81,8<br />
Kanada<br />
68,2<br />
83,8<br />
Großbritannien<br />
67,6<br />
83,5<br />
Neuseeland<br />
64,4<br />
81,9<br />
Australien<br />
64,2<br />
82,9<br />
Niederlande<br />
63,1<br />
78,6<br />
Portugal<br />
62,8<br />
80,0<br />
Deutschland<br />
62,4<br />
80,0<br />
Österreich<br />
61,2<br />
74,3<br />
Frankreich<br />
59,7<br />
85,2<br />
Japan<br />
Frauen Männer<br />
54,8<br />
72,8<br />
Belgien<br />
53,6<br />
77,9<br />
Irland<br />
50,9<br />
79,5<br />
Spanien<br />
Quelle: OECD Employment Outlook 2002.<br />
Weitere Aufschlüsse über die Erwerbsquote ergeben sich aus der Aufteilung nach<br />
Alter, Geschlecht <strong>und</strong> Familienstand. Bezogen auf 2001 ist die Erwerbsquote für<br />
Deutschland 2001 in Abb. 6 dargestellt (Statistisches Jahrbuch 2001).<br />
Abb. 6: Erwerbsquote nach Alter <strong>und</strong> Familienstand 2001<br />
23<br />
45,4<br />
74,0<br />
Italien
Die in Abbildung 7 dargestellte Beschäftigungsquote für Deutschland zeigt im internationalen<br />
Vergleich einen suboptimalen Nutzungsgrad <strong>des</strong> Faktors Arbeit (zitiert<br />
nach Eichhorst 2003). Als wesentliche limitierende Faktoren sind hierbei die hohe<br />
Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> der auch hiermit in Verbindung stehende Trend zur Frühberentung<br />
anzunehmen.<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
73,5<br />
81,9<br />
Norwegen<br />
71,0<br />
74,8<br />
Schweden<br />
Abbildung 7<br />
Beschäftigungsquote 1997-2001<br />
Frauen <strong>und</strong> Männer in %<br />
71,0<br />
80,7<br />
Dänemark<br />
69,2<br />
87,0<br />
Schweiz<br />
67,4<br />
80,2<br />
USA<br />
64,7<br />
78,2<br />
Großbritannien<br />
64,5<br />
Quelle: OECD Employment Outlook 2002.<br />
75,2<br />
Kanada<br />
63,2<br />
78,0<br />
Neuseeland<br />
63,0<br />
68,0<br />
Finnland<br />
61,2<br />
80,5<br />
Niederlande<br />
59,9<br />
75,7<br />
Australien<br />
59,3<br />
76,1<br />
Österreich<br />
59,2<br />
75,2<br />
Portugal<br />
57,0<br />
81,3<br />
Japan<br />
56,9<br />
73,3<br />
Deutschland<br />
53,3<br />
67,4<br />
Frankreich<br />
Frauen Männer<br />
Insgesamt ist jedoch auch ein Wertewandel zu verzeichnen, der zu einem Verlust an<br />
Bedeutung der Arbeit für das individuelle Leben geführt hat. Arbeit ist weiterhin ein<br />
integraler Bestandteil <strong>des</strong> Lebens, er wird jedoch nicht mehr als dominierender Faktor<br />
betrachtet werden können. Es wächst erstmals in Deutschland eine ‚Rentnergeneration’<br />
heran, die ein Arbeitsleben lang in ein Sozialversicherungssystem einbezahlt<br />
hat <strong>und</strong> daher auch bei einem freiwilligen oder erzwungenen vorzeitigen Ausstieg<br />
aus dem Erwerbsleben kaum finanzielle Einbußen hat. Zunehmend wird Art der<br />
entgoltenen Betätigung in der postmodernen Gesellschaft vom Kriterium der Lebensqualität<br />
bestimmt, die möglichst hoch sein sollte. Es geht mehr um die Selbstverwirklichung<br />
in der <strong>und</strong> durch die Arbeit. Die Präferenzen für die individuelle Reduktion<br />
der Lebensarbeitszeit zeigen sich zum einen im wachsenden Wunsch, Vollzeitbeschäftigung<br />
durch Teilzeitstellen abzulösen. Zum anderen steigt die Zahl der<br />
Frühberentungen (Huth 2002).<br />
Zusammenfassend kann angenommen werden, dass von chronischen Erkrankungen<br />
Betroffene gr<strong>und</strong>sätzlich ein erhöhtes Risiko zur Vorzeitigen Berentung aufweisen.<br />
Dieses Gr<strong>und</strong>risiko, aus dem sich die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung<br />
ableitet, darf jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Für diese Gruppe<br />
kommen im kumulativen Sinne folgende Risiken hinzu, die als maßgeblich für eine<br />
vorzeitige Berentung angenommen werden können (Naegele 1992, 2001, Kistler &<br />
Hilpert 2001, Behrens 2001, Krämer 2002, Grobe & Schwartz 2003, Behrens et al.<br />
1999):<br />
24<br />
50,3<br />
72,8<br />
Irland<br />
49,4<br />
68,0<br />
Belgien<br />
39,3<br />
70,3<br />
Spanien<br />
38,5<br />
67,7<br />
Italien
• Zusätzliches Krankheitsrisiko infolge eines physischen <strong>und</strong> psychischen Verschleißes<br />
• De-Qualifizierungsrisiko, welches mit zunehmendem Alter zunimmt<br />
• De-Motivationsrisiko<br />
• Höheres Alter mit erhöhtem Risiko der Reintegration in das Berufsleben aus einer<br />
temporären Arbeitslosigkeit<br />
• Frühberentung als Mittel einer sozialverträglichen Lösung im Rahmen von allgemeinen<br />
Rationalisierungs- <strong>und</strong> Organisationsentwicklungen aus Sicht der Unternehmen<br />
(‚goldener Handschlag’)<br />
• Werteverschiebung in Richtung Lebensqualität <strong>und</strong> Autonomie bei gleichbleibender<br />
finanzieller Absicherung<br />
Die alternde <strong>und</strong> schrumpfende Erwerbsbevölkerung auf der einen Seite <strong>und</strong> der<br />
Trend zu Frühberentungen auf der anderen Seite stellen den Arbeitsmarkt ebenso<br />
wie das Sozialversicherungssystem zunehmend vor Probleme. Vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
leerer Kassen <strong>und</strong> dem demographischen Wandel sind die Forderungen nach einer<br />
Verlängerung der Lebensarbeitszeit <strong>und</strong> dem Stop <strong>des</strong> Trends zur Frühberentung<br />
unüberhörbar.<br />
Diesen Forderungen stehen die prognostizierte weitere Zunahme an chronischen<br />
Erkrankungen <strong>und</strong> die vielfältigen weiteren Risikofaktoren entgegen. Ansätze zur Lösung<br />
der Gesamtproblematik werden nur in einer konzertierten Aktion von allen Beteiligten<br />
gef<strong>und</strong>en werden können. In diesem Bündnis zur ‚Zukunft der Arbeit’ wird<br />
sich die medizinische Rehabilitation in der Schnittstelle zur beruflichen Rehabilitation<br />
diesen immensen Herausforderungen stellen müssen. Hierbei dürfte die verbesserte<br />
Integration berufsbezogener Aspekte in die medizinische Rehabilitation ein wesentlicher<br />
Ansatz sein.<br />
Die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung beruht auf dem Auftrag,<br />
die Integration <strong>des</strong> Versicherten im Erwerbsprozess sicherzustellen oder ihn wieder<br />
in das Berufsleben einzugliedern (Verhorst 1996, Wittwer 1997, BfA 2000). Sie<br />
grenzt sich dabei von der eigentlichen beruflichen Rehabilitation, den berufsfördernden<br />
Leistungen zur Rehabilitation (§§ 16 ff SGB VI) ab. Zu den berufsfördernden<br />
Leistungen zählen beispielsweise folgende Maßnahmen (VDR 1997, BAR 2001, BfA<br />
1999, Schaub 1995, Schliehe & Röckelein 2002, Seyd et al. 1999):<br />
• Innerbetriebliche Umsetzungen<br />
• Arbeitsplatzbeschaffungen, ggf. mit befristeten Lohnkostenzuschüssen<br />
• Behindertengerechte Arbeitsplatzumrüstungen<br />
• Anlernmaßnahmen mit teilweiser Lohnkostenübernahme<br />
• Zuschüsse zum Kauf von Kraftfahrzeugen oder deren geeignete Umrüstung für<br />
Versicherte, die behinderungsbedingt nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel<br />
zu benutzen, um den Arbeitsplatz zu erreichen<br />
• Berufliche Anpassung, Ausbildung <strong>und</strong> Weiterbildung in einem Berufsförderungswerk<br />
oder einem Betrieb<br />
• Maßnahmen in einer Werkstatt für Behinderte<br />
Trotzdem müssen auch in der medizinischen Rehabilitation arbeits- <strong>und</strong> berufsbezogene<br />
Problemstellungen im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung berücksichtigt<br />
werden, da sie sich gr<strong>und</strong>sätzlich bei allen Rehabilitanden, dies jedoch in<br />
25
unterschiedlicher Ausprägung <strong>und</strong> mit differierenden Auswirkungen auf rehabilitative<br />
Strategien, finden lassen.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der sozialmedizinischen Relevanz <strong>und</strong> den in Abschnitt 1.2.<br />
beschriebenen Folgekosten pneumologischer Erkrankungen ist es daher dringend<br />
erforderlich, für die Rehabilitation die therapeutisch-rehabilitative Gr<strong>und</strong>haltung zu<br />
modifizieren <strong>und</strong> um den Leitgedanken eines arbeitsproblemorientierten Bezuges<br />
gezielt zu erweitern (Schliehe & Haaf 1996, Biefang et al. 1996, MDS 1997, BfA<br />
2000, Schliehe & Röckelein 2002, Schuntermann 2003, Neuderth & Vogel 2002,<br />
Schaub 1995, Linha 1995, Linha et al. 1996, Kaiser & Schmitz 1999a, 2000a,b, Kaiser<br />
2002a).<br />
Dies bedeutet konkret, dass das individuelle Risiko oder die Gefährdung für eine vorzeitigen<br />
Berentung durch geeignete somatische, funktionale <strong>und</strong> psychosoziale Faktoren<br />
<strong>und</strong> ihrer Wechselwirkungen abschätzbar sein muss. Hierdurch besteht die<br />
Möglichkeit, für diese Risikogruppe bereits während der Rehabilitationsmaßnahme<br />
alle diagnostischen <strong>und</strong> therapeutischen Maßnahmen auf arbeits- <strong>und</strong> berufsbezogene<br />
Problemstellungen auszurichten.<br />
Hierzu ist es erforderlich, die für die Rehabilitation wesentliche ganzheitliche bio-psycho-soziale<br />
Betrachtung von Krankheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit auf die Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit<br />
zu übertragen. Allgemein lassen sich dabei folgende Bereiche benennen<br />
(BfA 2000):<br />
• Auf der somatischen Ebene krankheitsresultierende Einschränkungen, die eine<br />
geeignete Arbeits- <strong>und</strong> Hilfsmittelausstattung oder Umsetzungen am Arbeitsplatz<br />
erfordern<br />
• Auf der psychischen Ebene Aspekte, die z.B. dem Phänomen der Erwartungs-<br />
<strong>und</strong> Versagensangst, dem Modell der beruflichen Gratifikation als Ungleichgewicht<br />
zwischen beruflicher Verausgabung <strong>und</strong> Belohnung sowie der Integration in<br />
das soziale Netz zugeordnet werden können<br />
• Auf der sozialen Ebene Fragen <strong>des</strong> sozioökonomischen Status mit seinen verschiedenen<br />
Aspekten wie Ausbildung <strong>und</strong> berufliche Position, Einkommen, sozialer<br />
Rückzug<br />
Atemwegserkrankungen <strong>und</strong> damit assoziierte Allergien unterliegen hinsichtlich <strong>des</strong><br />
Verlaufs (Symptome, Krankheitsfolgen) vielerlei Einflüssen, bei denen - neben der<br />
Krankheitsschwere - Personenfaktoren, das soziale Umfeld, die Umwelt <strong>und</strong> auch<br />
Arbeitsbedingungen <strong>und</strong> Arbeitsanforderungen (Fischer 1995, VDR 1995, Bossert<br />
1994, Baur 1996, Flörkemeier 2000, Nowak 2000, Petri & Haber 2000, Radon & Nowak<br />
2000, Schultz et al. 2000, Chan-Yeung 1995, Kaiser & Schmitz 1999a, Kaiser &<br />
Schmitz 2000a,b, Kaiser 2002a, Lauber 1996) eine wesentliche Rolle spielen. Bezüglich<br />
der Arbeitsplatzgestaltung <strong>und</strong> den Arbeitsanforderungen sind daher insbesondere<br />
berufliche Allergene <strong>und</strong> Schadstoffe sowie unspezifische Auslösefaktoren<br />
für die Asthmasymptomatik von Bedeutung. Hierbei sind vor allem Staub, Rauch,<br />
Nebel, Gase, Kälte, Hitze, Nässe <strong>und</strong> das Mikroklima zu nennen. Im Weißbuch ‚Lunge<br />
2000’ wurde der Anteil anerkannter Berufskrankheiten 1997 mit ca. 30 % zu Lasten<br />
pneumologischer Erkrankungen angegeben (Konietzko & Fabel 2000). Daneben<br />
sind für die Symptomatik <strong>und</strong> den Krankheitsverlauf die Arbeitszeitgestaltung wie<br />
Nacht- <strong>und</strong> Wechselschicht, Pausenregelung, berufliche, soziale <strong>und</strong> emotionale<br />
26
Stressoren <strong>und</strong> vor allem im Kontext <strong>des</strong> Anstrengungsasthmas, das Ausmaß körperlicher<br />
Belastungen (Heben, Bücken, Tragen etc.) zu berücksichtigen.<br />
Insgesamt ist unstrittig, dass das hohe Ausmaß an vorzeitiger Aufgabe der Erwerbstätigkeit<br />
nicht allein durch die objektive Krankheitsschwere bedingt ist. Chronische<br />
Atemwegserkrankungen erfordern von den Betroffenen <strong>und</strong> ihrem engeren sozialen<br />
Umfeld eine Vielfalt von Anpassungsleistungen. Es gilt heute als sicher, dass<br />
der Krankheitsverlauf <strong>und</strong> das Risiko der Frühberentung verstärkt durch psychosoziale<br />
Aspekte <strong>und</strong> Prozesse (Angst, Depression oder andere psychische Probleme,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsverhalten, soziale Unterstützung, Coping, Compliance, Krankheitsmanagement)<br />
mitbestimmt wird, die bisher zu wenig Beachtung finden (Kaiser et al.<br />
1997). In diese Betrachtung muss auch der Arbeitsplatz selbst unter Einbeziehung<br />
<strong>des</strong> Auslösespektrums <strong>und</strong> der beruflichen Belastung <strong>und</strong> Beanspruchung verstärkt<br />
einbezogen werden, da er in einem hohen Ausmaß den Krankheitsverlauf mitbestimmt<br />
(Fischer 1995, VDR 1995) <strong>und</strong> in der Folge das Risiko der beruflichen Desintegration<br />
erhöht.<br />
Als wesentlicher Faktor für den Rehabilitationsprozess gilt die Reha-Motivation <strong>und</strong><br />
deren Förderung (Deck et al. 1998a,b) durch den Haus- <strong>und</strong> Facharzt. Studien im<br />
Bereich der pneumologischen Rehabilitation belegen, dass der überwiegende Teil<br />
der Betroffenen (75-80 %) zu Beginn der Rehabilitationsmaßnahme eine passive Erwartungshaltung<br />
aufweist (Kaiser 1994, Kaiser & Schmitz 1994, 1996b 1998a,b,c).<br />
Trotz massiver Probleme in den somatischen, funktionalen <strong>und</strong> psychosozialen Bereichen<br />
der Krankheit findet keine Verknüpfung dieser Belastungen mit der individuellen<br />
Reha-Zieldefinition statt, was die in der Rehabilitation mögliche Erarbeitung von<br />
Lösungs- <strong>und</strong> Bewältigungsstrategien in diesen Bereichen erschwert. Im beruflichen<br />
Bereich zeigen sich Krankheitsfolgen, die sich insbesondere in Leistungseinschränkungen/Arbeitsbelastungen<br />
<strong>und</strong> dem zur Folge in AU-Zeiten, Berufswechsel oder<br />
einer Frühberentung manifestieren. Frühberentungen werden dabei primär mit dem<br />
Krankheitsverlauf, den damit verb<strong>und</strong>enen Belastungen <strong>und</strong> dem Rat <strong>des</strong> Hausarztes<br />
begründet. Bei einem großen Teil der Berenteten ergeben sich durch die Berentung<br />
Folgeprobleme, die primär in der fehlenden Tagesstruktur <strong>und</strong> den fehlenden<br />
sozialen Kontakten zu Arbeitskollegen begründet sind (Kaiser 1994, 2000a, Kaiser &<br />
Schmitz 1998a, 1999a, 2000a,b). Ähnliche Tendenzen bezüglich einer fehlenden<br />
Zieldefinition zeigen sich auch bei den zuweisenden Ärzten, so dass die eigentliche<br />
Formulierung der Rehabilitationsziele auf der Basis der Eingangs- <strong>und</strong> Verlaufsdiagnostik<br />
erst am Beginn der Rehabilitationsmaßnahme stattfinden kann (Kaiser 1994,<br />
Kaiser & Schmitz 1994).<br />
Das Spektrum der rehabilitativen Diagnostik richtet sich dabei auf die Einleitung der<br />
zielgerichteten Therapie <strong>und</strong> die abschließende Beurteilung der Leistungsfähigkeit im<br />
Erwerbsleben. Damit Rehabilitanden mit einem erhöhten berufsbezogenen Risiko<br />
frühzeitig erkannt <strong>und</strong> gezielten Interventionen zugeführt werden können sind für berufsorientierten<br />
Analysen sowohl die Angaben zur Sozial- <strong>und</strong> Berufsanamnese, die<br />
Klärung der sozialen Situation als auch wesentliche Fragen der Motivation, <strong>des</strong><br />
zugr<strong>und</strong>eliegenden individuellen Krankheitsmodells sowie der subjektiven <strong>und</strong> objektiven<br />
Belastbarkeits-/Beanspruchungswechselwirkungen von Bedeutung (BfA 2000,<br />
Kaiser 2000a, Fischer 1995, VDR 1991, 1995, 1997, 2000a, DGP 1997). Zur weiteren<br />
Abklärung können diese Ergebnisse durch psychologische Diagnostikverfahren<br />
oder Verhaltensbeobachtungen der anderen Berufsgruppen in der Rehabilitation<br />
(Krankengymnasten, Sporttherapeuten) ergänzt werden.<br />
27
Die Ergebnisse einer derartigen Diagnostik müssen einerseits dazu genutzt werden,<br />
aus dem Gesamtklientel die Rehabilitanden herauszufiltern, die einer hieraus definierten<br />
Untergruppe „Berufliche Risikopatienten“ zuzuordnen sind, andererseits im<br />
Bereich der Therapie alle Therapieziele <strong>und</strong> Interventionen auf die berufliche Tätigkeit<br />
auszurichten. Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass relevante Berufsgruppen in<br />
der Rehabilitation spezifische berufsbezogene Maßnahmenmodule entwickeln <strong>und</strong><br />
diese in das Gesamtangebot der Rehabilitationskliniken integriert werden. Hierbei<br />
kommen insbesondere berufsorientierte Module in den Bereichen der Psychologie,<br />
der Krankengymnastik, der Sport- <strong>und</strong> Bewegungstherapie, der Ergotherapie <strong>und</strong> der<br />
Patientenschulung in Frage. Wesentliche Inhalte sind dabei im Einzelnen (BfA 2000):<br />
• Validierung der bisherigen Krankheitsbewältigung<br />
• Erwerb <strong>und</strong> Umsetzung von Angst- <strong>und</strong> Stressbewältigungsstrategien<br />
• Realistische Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit<br />
• Erprobung somatischer <strong>und</strong> psychischer Belastbarkeit sowie berufsrelevanter<br />
Kommunikations- <strong>und</strong> Interaktionsfähigkeiten<br />
• Reflexion ges<strong>und</strong>heitlicher, beruflicher <strong>und</strong> privater Ziele <strong>und</strong> deren Verknüpfung<br />
• Behandlungsbegleitende praxisbezogene Tätigkeiten, um die Übertragung von<br />
Lösungsansätzen ins berufliche Umfeld zu erleichtern<br />
Von entscheidender Bedeutung für den weiteren Rehabilitationsprozess <strong>und</strong> entsprechende<br />
Nachsorgemaßnahmen ist der frühzeitige Entlassungsbericht, in dem<br />
neben der plausiblen Darstellung <strong>und</strong> kritischen Würdigung <strong>des</strong> gesamten Rehabilitationsprozesses<br />
Aspekte der beruflichen Integration umfassend berücksichtigt werden.<br />
Gleichzeitig kommt der Rehabilitations- <strong>und</strong> Sozialberatung vor allem in der Einleitung<br />
der Nachsorgemaßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Neben allgemeiner<br />
individueller Beratung <strong>und</strong> Information zu den wesentlichen Bereichen <strong>des</strong><br />
Sozialrechtes beinhaltet die spezielle Beratung insbesondere konkrete Hilfen zur<br />
Umsetzung der sozialmedizinischen Beurteilung. Diese beziehen sich in direkter Zusammenarbeit<br />
mit dem Sozialmediziner auf die Entwicklung von allgemeinen <strong>und</strong><br />
krankheitsbezogenen Fragestellungen, die Erarbeitung der Perspektive zur Nachsorge<br />
<strong>und</strong> die Erschließung von zeitnahen Informations- <strong>und</strong> Beratungsquellen nach<br />
der Entlassung. Nur hierdurch lassen sich die Ressourcen der Patienten in medizinischer,<br />
beruflicher <strong>und</strong> sozialer Hinsicht nachhaltig nutzen. Dies trifft insbesondere für<br />
Rehabilitanden zu, bei denen die Einleitung einer berufsfördernden Maßnahme erforderlich<br />
ist. Die von Fraisse <strong>und</strong> Karoff (1997) berichtete durchschnittliche Wartezeit<br />
zwischen Ende der medizinischen Rehabilitation <strong>und</strong> der Durchführung einer berufsfördernden<br />
Maßnahme von 13,4 Monaten bedarf dringend einer Verkürzung.<br />
Die folgenden Zahlen belegen nochmals die Bedeutung der Schnittstellen „Zugangssteuerung<br />
in die Rehabilitation“ <strong>und</strong> „Einleitung von Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation“.<br />
Trotz der Maxime „Reha vor Rente“ <strong>und</strong> den hohen Folgekosten von<br />
pneumologischen Erkrankungen erhalten über 50 % der Betroffenen vor der Frühberentung<br />
keine Rehabilitationsmaßnahme. Nachfolgende Maßnahmen der beruflichen<br />
Rehabilitation beschränken sich lediglich auf Einzelfälle:<br />
• 1991 erhielten nur etwa die Hälfte (54,1 % Männer; 47,6 % Frauen) in den letzten<br />
5 Jahren vor der Frühberentung eine Rehabilitationsmaßnahme (Fischer 1995)<br />
• 1997 erhielten lediglich 50 % vor der Frühberentung eine Rehabilitationsmaßnahme,<br />
lediglich 3 % erhielten eine Maßnahme zur berufliche Rehabilitation (VDR<br />
2000c,d)<br />
28
• 1999 verdeutlichen die Zahlen eindrücklich diesen negativen Trend: keine medizinische<br />
Rehabilitation vor Frühberentung (55,2 %), keine berufliche Rehabilitation<br />
vor Frühberentung (96,8 %) (VDR 2000c,d)<br />
In einigen Indikationsbereichen wurden Modellprojekte <strong>und</strong> Behandlungsansätze zu<br />
berufsbezogenen Maßnahmen im Rahmen der medizinischen Rehabilitation entwickelt<br />
(Budde & Keck 1999, Heinzen-Lasere 1998, Leidig & Zielke 2000, Beutel et al.<br />
1997, 1998a,b, Bürger 1997, Czikkely & Limbacher 1998, Göbel 1999, Karoff 1999,<br />
Koch et al. 1997, Linha 1995, Linha et al. 1996, Niehaus 1999). Eine von Neuderth &<br />
Vogel (2002) vorgelegte Übersicht beschreibt 16 Projekte, von denen 7 dem psychosomatischen<br />
<strong>und</strong> 9 dem somatischen Indikationsspektrum zugeordnet werden können.<br />
Das Spektrum der berufsbezogenen Interventionen reicht dabei von einer Thematisierung<br />
berufsbezogener Inhalte während der Rehabilitationsbehandlung (z.B. im<br />
Rahmen der Sozialberatung der Klinik) bis hin zu mehrtägigen externen Belastungserprobungen,<br />
wobei die Unterschiede u.a. darin liegen, inwieweit die Kliniken eigene<br />
Potenziale einbringen (Integrationsmodelle) oder sich externer Facheinrichtungen<br />
(z.B. Berufsförderungswerke) im Rahmen von Kooperationsmodellen bedienen<br />
(Neuderth & Vogel 2002, Korsukéwitz 2002).<br />
Zusammenfassend kann für den Bereich der pneumologischen Erkrankungen festgestellt<br />
werden, dass sich in der Versorgungsstruktur auf der einen Seite fehlende<br />
ambulante Strukturen zur Rehabilitation <strong>und</strong> eine deutlich defizitäre fachärztliche<br />
Versorgungsdichte, auf der anderen Seite stationäre Rehabilitationszentren gegenüberstehen,<br />
die durch eine hohe Spezialisierung, umfassende diagnostische <strong>und</strong> therapeutische<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Interdisziplinarität unter einem Dach vereinen (Kaiser<br />
& Schmitz 1998, DGP 1995, 1997, Cegla 1996). Eine Vielfalt von Studien belegt den<br />
Erfolg dieser Maßnahmen. Es besteht daher gerade in diesen Zentren die Möglichkeit,<br />
durch zielgerichteten Einsatz aller Mittel (Diagnostik, Therapie, Beratung, Schulung)<br />
dem mehrdimensionalen Aspekt der Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit frühzeitig,<br />
interdisziplinär <strong>und</strong> umfassend Rechnung zu tragen (Holzinger et al. 1994, Casaburi<br />
1993, Deter 1986, Grootendorst et al. 2000, Lacasse et al. 1996, Pleyer et al. 1999,<br />
2000, Schäfers 1998, Trautner et al. 1993, van den Boom et al. 1998), Büchi et al.<br />
1996, Kaiser 1994, 2002b, Kaiser & Schmitz 1994, 1995, 1996a,b, 1998a,b,c,<br />
1999b,c, 2000c, Petro 2000, Kaiser et al. 1997, 2000a, 2003, Kaiser & Lippitsch<br />
2001).<br />
29
2. Projektverlauf<br />
Mit dem Projekt wurde das Ziel verfolgt, für pneumologische Erkrankungen ein Risikoprofil<br />
zur Frühberentung zu identifizieren <strong>und</strong> in ein Screeningverfahren zur gezielten<br />
Diagnostik <strong>und</strong> Zuweisung in die Therapie-, Beratungs- <strong>und</strong> Schulungsbereiche<br />
umzusetzen. Zur Beantwortung der damit verb<strong>und</strong>enen Fragestellungen sollten<br />
bereits vorliegende Erhebungen durch eine Nachbefragung unter besonderer Berücksichtigung<br />
der beruflichen Rehabilitation ergänzt <strong>und</strong> in der Wechselwirkung auf<br />
das Kriterium der Frühberentung <strong>und</strong> der Gefährdung analysiert werden. Durch eine<br />
Befragung zu beruflichen Hilfen in der pneumologischen Rehabilitation sollte der Bedarf<br />
für Beratungsangebote bei berufsbezogenen Problemen untersucht werden.<br />
In einem mehrstufigen Auswahlverfahren (März 1996 bis Juni 1997) wurde das Projekt<br />
im Juni 1997 im Rahmen <strong>des</strong> Projektantrages <strong>des</strong> Rehabilitationswissenschaftlichen<br />
Forschungsverb<strong>und</strong>es (RFV) Freiburg/Bad Säckingen beim Projektträger<br />
(Deutsches Zentrum für Luft- <strong>und</strong> Raumfahrt e.V.- DLR) eingereicht. Nachdem das<br />
Projekt vom Projektträger in der Tendenz positiv eingestuft wurde, wurden bis Ende<br />
Januar die notwendigen Formanträge für die Bereitstellung der finanziellen Mittel erstellt.<br />
Anfang Februar 1998 wurde das Projekt der Ethischen Kommission der Landschaft<br />
Davos zur Genehmigung vorgelegt, die Ende März 1998 ohne Einschränkung<br />
erfolgte. Anfang April 1998 wurde das Projekt von den Förderern im letzten Begutachtungsschritt<br />
bewilligt, wobei jedoch darauf hingewiesen wurde, dass in der endgültigen<br />
Fassung <strong>des</strong> Projektes die Stellungnahme der Gutachter berücksichtigt werden<br />
muss. Dies betraf insbesondere den durch das Design (vorliegende Erhebungen<br />
<strong>und</strong> Nachbefragung nach über fünf Jahren) bedingten Rücklauf <strong>und</strong> die Repräsentativität<br />
<strong>des</strong> Patientengutes <strong>und</strong> der Klinik. Das Projekt wurde in der ersten Phase als<br />
Machbarkeitsstudie bewilligt, wobei nach neun Monaten zu den aufgeworfenen Fragen<br />
der Gutachter ein Zwischenbericht vorgelegt werden musste.<br />
Im August 1998 wurde mitgeteilt, dass die Projektförderung durch die Südwestdeutschen<br />
Lan<strong>des</strong>versicherungsanstalten erfolgen werde <strong>und</strong> in Absprache mit der LVA<br />
Württemberg die Federführung bei der LVA Baden (Innenverhältnis) liege. Mitte August<br />
1998 wurden auf der Basis <strong>des</strong> Gutachtervotums <strong>und</strong> der hieraus resultierenden<br />
Machbarkeitsstudie durch die Förderer Anpassungen in finanzieller Hinsicht vorgenommen,<br />
die insgesamt zu einer Mittelkürzung von 23,3 % führten.<br />
Entsprechend den zu diesem Zeitpunkt festgelegten Rahmenbedingungen <strong>des</strong> Projektes<br />
(Förderer, Gutachter) konnte Ende August 1998 mit der Schaffung der personellen<br />
<strong>und</strong> räumlichen Voraussetzungen begonnen werden, was den ursprünglich<br />
geplanten Beginn <strong>des</strong> Projektes (April 1998) verzögerte.<br />
Aus unterschiedlichen Gründen gestaltete sich die Personalrekrutierung <strong>des</strong> wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiters schwierig. Diese Gründe lagen insbesondere in der räumlichen<br />
Distanz zu einer deutschen Universität, in der unsicheren Anstellungsdauer<br />
(zuerst 50 %-Anstellung für den Zeitraum der Machbarkeitsstudie, Unsicherheit bezüglich<br />
einer möglichen Weiterbeschäftigung in Abhängigkeit vom Ergebnis der Weiterförderung)<br />
<strong>und</strong> in den hohen Lebenshaltungskosten in Davos in Relation zur Bezahlung<br />
nach deutschen Richtlinien (BAT IIa). Insbesondere durch die bereits genannte<br />
fehlende Nähe zu einer Universität konnten keine Hilfskräfte rekrutiert werden,<br />
so dass hier andere Lösungen gef<strong>und</strong>en werden mussten <strong>und</strong> wurden.<br />
30
Zum 1.10.1998 wurde die Stelle <strong>des</strong> wissenschaftlichen Mitarbeiters besetzt, der<br />
nach Vorliegen der Arbeits- <strong>und</strong> Aufenthaltsbewilligung Mitte Oktober 1998 die Arbeit<br />
aufnehmen konnte. Die Problematik der Hilfskräfte wurde unter Verwendung der<br />
hierfür bereitgestellten Mittel durch zeitlich befristete <strong>und</strong> aufgabenbezogene Werkverträge<br />
(Literaturbeschaffung, Dateneingabe, etc.) gelöst.<br />
Entsprechend den im Projektantrag vorgesehenen Eigenmitteln wurden durch den<br />
Träger der Klinik 2 Räume zur Verfügung gestellt <strong>und</strong> entsprechend ausgestattet.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der deutlichen Kürzungen bei der Mittelvergabe im EDV-Bereich wurde neben<br />
der im Projektantrag genannten Bereitstellung eines EDV-Arbeitsplatzes auch<br />
die Software zur Datenverarbeitung (SPSS-PC) aus Eigenmitteln der Klinik angeschafft,<br />
so dass die Gr<strong>und</strong>voraussetzungen im personellen <strong>und</strong> räumlichen Bereich<br />
Mitte Oktober 1998 gegeben waren.<br />
Für den Zeitraum der Machbarkeitsstudie ergab sich folgen<strong>des</strong> Arbeitsprogramm:<br />
• Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Nachbefragung (Entwicklung <strong>des</strong> Fragebogens<br />
<strong>und</strong> der Begleitschreiben, Erhebung, Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung der Dateneingabe)<br />
• Literaturanalyse- <strong>und</strong> -aufbereitung der für das Projekt relevanten Literatur<br />
• Vorbereitung der Reanalyse der bereits vorliegenden Studien (Überprüfung <strong>und</strong><br />
Aufbereitung der vorliegenden Datensätze, Bildung eines Gesamtdatensatzes unter<br />
Einbeziehung der Nachbefragung)<br />
• kontinuierliche Dateneingabe <strong>und</strong> erste <strong>des</strong>kriptive Auswertung der Nachbefragung<br />
• Analysen zur Beantwortung der Fragestellungen der Gutachter bezüglich Rücklauf<br />
<strong>und</strong> Repräsentativität der vorliegenden Daten (vgl. Zwischenbericht 1999 - Machbarkeitsstudie)<br />
• Prüfung durch das Methodenzentrum <strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>es, ob mit den vorliegenden<br />
Datensätzen aus methodischer Sicht die Fragestellungen zu beantworten sind<br />
• Zwischenbericht nach 9 Monaten zum Projektverlauf <strong>und</strong> den Fragestellungen der<br />
Gutachter<br />
Im Juli 1999 wurde auf der Basis der Fragestellungen der Gutachter zum Verlauf der<br />
Machbarkeitsstudie ausführlich Stellung bezogen. Auf der Basis <strong>des</strong> Zwischenberichtes<br />
wurde die Weiterförderung von den Gutachtern einstimmig unterstützt, so<br />
dass die weiteren Arbeitsschritte im Projekt vorgenommen werden konnten.<br />
Nachdem die Weiterförderung gesichert war, wurde klinikintern eine interdisziplinär<br />
besetzte Projektgruppe berufen, die das Projekt für die gesamte Laufzeit beratend<br />
begleiten sollte. Die Projektgruppe bestand aus dem damaligen Ärztlichen Direktor<br />
(gleichzeitig Mitantragsteller <strong>und</strong> zu dieser Zeit stellv. Sprecher der Sektion Prävention<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation in der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie - DGP), dem<br />
Ltd. Oberarzt (gleichzeitig zuständig für Sozialmedizin), dem Leiter der Abteilung für<br />
Physikalische Therapie (gleichzeitig Vorstandsmitglied der AG Lungensport in<br />
Deutschland), dem Projektleiter (gleichzeitig Leiter der Abteilung für Psychosoziale<br />
Rehabilitation mit den Bereichen Reha-Psychologie, Patientenschulung, Rehabilitations-<br />
<strong>und</strong> Sozialberatung, Freizeit- <strong>und</strong> Kreativtherapie, Rehabilitationsforschung) <strong>und</strong><br />
dem wissenschaftlichen Mitarbeiter <strong>des</strong> Projektes. Neben der beratenden Funktion<br />
beschäftigte sich die Projektgruppe unter Einbeziehung der Fragestellungen <strong>des</strong> Projektes<br />
<strong>und</strong> vorliegender Ergebnisse mit der besseren Berücksichtigung beruflicher<br />
31
Aspekte im pneumologischen Rehabilitationsprozess (Strukturen, Prozesse, stationäre<br />
Rehabilitation, Schnittstellen zur Nachsorge).<br />
Unter Einbeziehung der bis dahin vorliegenden Arbeitsergebnisse der Projektgruppe<br />
wurde Mitte 2000 ein Rehabilitationsberatungs- <strong>und</strong> Informationszentrum in die<br />
Klinik integriert. Aus Eigenmitteln wurde hierzu eine Sozialarbeiterin mit entsprechender<br />
Berufserfahrung eingestellt. Die Aufgaben <strong>des</strong> Zentrums liegen neben der<br />
allgemeinen Rehabilitations- <strong>und</strong> Sozialberatung <strong>und</strong> Information insbesondere in der<br />
individuellen beraterischen Umsetzung der sozialmedizinischen Beurteilung. Diese<br />
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sozialmediziner durch die Entwicklung von allgemeinen<br />
<strong>und</strong> krankheitsbezogenen Fragestellungen, der Erarbeitung der Perspektive<br />
zur Reha-Nachsorge <strong>und</strong> der hieraus resultierenden Erschließung von zeitnahen<br />
Informations- <strong>und</strong> Beratungsquellen nach der Entlassung. Es sei darauf hingewiesen,<br />
dass diese Stelle mittlerweile fest im Stellenplan der Klinik verankert ist.<br />
Im weiteren wissenschaftlichen Projektverlauf konnte die Nachbefragung bis Ende<br />
2000 abgeschlossen <strong>und</strong> auf der Basis von 553 vorliegenden Fragebögen (Rücklauf<br />
von 67,9 %) in wesentlichen Teilen ausgewertet werden.<br />
Die im Anschluss an die Nachbefragung vorgesehene zusätzliche Befragung zu notwendigen<br />
beruflichen Hilfen für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen<br />
konnte bis Anfang 2001 vorbereitet (Erstellung <strong>des</strong> Fragebogens, Organisation der<br />
Durchführung) <strong>und</strong> bis Mitte 2001 durchgeführt <strong>und</strong> abgeschlossen werden. Da der<br />
Folgeantrag für die zweite Förderphase abgelehnt wurde, wurde ein Teil der für diese<br />
Förderphase geplanten Fragestellungen in die Patientenbefragung integriert. Außerdem<br />
wurde zusätzlich durch einen Arztfragebogen im Rahmen der Entlassung der<br />
teilnehmenden Patienten die Meinung der jeweiligen Stationsärzte u.a. zu den vermuteten<br />
beruflichen Aussichten bzw. Entwicklungen der Patienten erhoben. Für die<br />
Patientenbefragung liegen 455 Fragebögen <strong>und</strong> für die Arztbefragung 358 Fragebögen<br />
vor, was für die Patientenbefragung einem Rücklauf von 82,7 % <strong>und</strong> für die<br />
Arztbefragung - in Bezug auf die vorliegenden Patientenfragebögen - von 78,7 %<br />
entspricht.<br />
Neben den umfangreichen organisatorischen Arbeiten im Rahmen der Erhebungen,<br />
Datenorganisation <strong>und</strong> -auswertung wurde im ersten Quartal 2001 gleichzeitig die<br />
geplante Expertenbefragung aus unterschiedlichen Versorgungssegmenten vorbereitet<br />
<strong>und</strong> Ende März 2001 durchgeführt.<br />
Der Rücklauf der Expertenfragebögen war derart unter den Erwartungen, dass aufgr<strong>und</strong><br />
mangelnder Erfolgsaussicht auf eine geplante Erinnerung an die Rückgabe<br />
der Fragebögen verzichtet wurde. Auswertbare Antworten liegen von niedergelassenen<br />
Pneumologen (n=69, 12,8 %) <strong>und</strong> pneumologischen Fach- <strong>und</strong> Rehabilitationskliniken<br />
vor (n=35, 14,5 %). Schriftliche Rückmeldungen in Form von Briefen zeigen,<br />
dass Kostenträger <strong>und</strong> Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation die Behandlung<br />
von berufsbezogene Themen als ihre originäre Aufgabe ansehen. Für Selbsthilfegruppen<br />
ist dieses Thema fremd, d.h. dass das Ausfüllen <strong>des</strong> für diese Gruppen<br />
konzipierten Fragebogens eine Überforderung darstellte. Der geringe Rücklauf der<br />
Bögen der niedergelassenen Pneumologen <strong>und</strong> der pneumologischen Kliniken kann<br />
u.a. dadurch entstanden sein, dass die Befragung durch eine „konkurrierende Klinik“<br />
durchgeführt wurde. Insgesamt muss mit diesem Rücklauf die Expertenbefragung als<br />
gescheitert angesehen werden. Die Ergebnisse der Expertenbefragung stellen somit<br />
32
keine repräsentative Stichprobe dar, liefern jedoch Anhaltspunkte zur Beschreibung<br />
der Gesamtsituation in der Versorgung.<br />
Veränderungen im Vergleich zum Projektantrag <strong>und</strong> der zeitlichen Planung haben<br />
sich in folgenden Bereichen ergeben:<br />
In der Befragung zu notwendigen beruflichen Hilfen für Patienten mit chronischen<br />
Atemwegserkrankungen wurden in Teilbereichen Fragen integriert, die ursprünglich<br />
für ein Folgeprojekt in der zweiten Förderphase vorgesehen waren. Darüber<br />
hinaus wurde als Erweiterung in diesem Erhebungsschritt eine Arztbefragung<br />
durchgeführt.<br />
Eine wesentliche Veränderung ergab sich im Bereich der Expertenbefragung.<br />
Durch den geringen Rücklauf ist die Aussagekraft zwar entsprechend eingeschränkt,<br />
die Erreichung der Vorhabensziele sind hierdurch aus unserer Sicht nicht gefährdet.<br />
Neben einer Beschreibung der wahrgenommenen Aufgaben <strong>und</strong> der damit vorliegenden<br />
Erfahrungen im Rahmen berufsbezogener Aspekte in der pneumologischen<br />
Rehabilitation sollte mit der Expertenbefragung auch eine Sensibilisierung für diesen<br />
wesentlichen Bereich erreicht werden. Im Sinne einer Kompensation oder auch Ausweitung<br />
der Ergebnisse der begrenzten Expertenbefragung wurden auf Initiative <strong>und</strong><br />
unter dem Vorsitz <strong>des</strong> Projektleiters erstmals bei einem Jahreskongress der Deutschen<br />
Gesellschaft für Pneumologie (DGP) in der Sektion für Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
ein Frühseminar (Jena 2002) <strong>und</strong> ein Symposium (Bochum 2002) zu beruflichen<br />
Aspekten in der pneumologischen Rehabilitation für niedergelassene Pneumologen<br />
<strong>und</strong> Kliniker durchgeführt. In das Symposium wurden als Referenten Vertreter<br />
der Rentenversicherung <strong>und</strong> der Forschungsverbünde einbezogen. Für 2003<br />
ist gemeinsam mit der Sektion ein entsprechender Workshop in Davos geplant. Ein<br />
weiterer Workshop wurde gemeinsam mit der Sektion Arbeitsmedizin in der DGP von<br />
der Sektion Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation für den nächsten Kongress in Frankfurt<br />
(2004) beantragt <strong>und</strong> angenommen.<br />
Veränderungen im zeitlichen Verlauf <strong>des</strong> Projektes hatten unterschiedliche Gründe,<br />
betreffen jedoch primär den Abschlussbericht. Als hinderlich hat sich die verzögerte<br />
<strong>und</strong> auch unsichere Anfangsphase <strong>des</strong> Projektes erwiesen. Neben den hieraus<br />
resultierenden Problemen in der Rekrutierung <strong>des</strong> wissenschaftlichen Mitarbeiters<br />
sind hierbei die Halbierung der Mittel für das erste Projektjahr <strong>und</strong> die dadurch beeinflusste<br />
Dauer der Nachbefragung zu nennen. Durch die festgelegten Projektschritte<br />
fiel die Befragung zu beruflichen Hilfen in eine belegungsschwache Zeit, so dass zur<br />
Erreichung der geplanten Stichprobe längere Zeit als geplant verging. Im Rahmen<br />
der kostenneutralen Verlängerung <strong>des</strong> Projektes war es nicht möglich, dass hierbei<br />
der wissenschaftliche Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden konnte, da dieser im Anschluss<br />
an den ursprünglich geplanten Projektzeitraum bereits eine andere Stelle<br />
angenommen hatte <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb unter Anrechnung <strong>des</strong> Jahresurlaubs Anfang September<br />
2001 aus dem Projekt ausschied. Die endgültige Abfassung <strong>des</strong> bis dahin nur<br />
in Ansätzen vorliegenden Abschlussberichtes <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ene weitere Datenanalysen<br />
ruhte damit alleine auf den Schultern <strong>des</strong> Projektleiters.<br />
Im Rahmen von gleichzeitig in der Klinik vorgenommenen strukturellen Veränderungen<br />
mussten von der Projektleitung neben dem bisherigen klinischen Aufgabenfeld<br />
weitere Aufgaben übernommen werden, die die notwendigen Projektabschlussarbeiten<br />
nur außerhalb der normalen Arbeitszeit zuließen. Insofern kann festgestellt<br />
33
werden, dass durch die hierdurch entstandene Verzögerung nicht die Ergebnisse <strong>des</strong><br />
Projektes, sondern lediglich der Zeitpunkt der Beendigung durch die Abgabe <strong>des</strong><br />
Abschlußberichtes betroffen war. Aus Sicht der Projektleitung konnten die Zielsetzungen<br />
<strong>des</strong> Projektes erreicht werden.<br />
34
3. Forschungsmethodik<br />
3.1. Zielsetzungen <strong>und</strong> Fragestellungen<br />
Im Kontext <strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>themas „Zielorientierung in Diagnostik, Therapie <strong>und</strong> Ergebnismessung“<br />
(vgl. Bengel & Jäckel 2000) besteht die primäre Zielsetzung <strong>des</strong> Projektes<br />
in der empirischen Ableitung eines ‘Risikoprofils zur Frühberentung’ (Prädiktion)<br />
<strong>und</strong> der hierauf basierenden Entwicklung eines Assessmentverfahrens zur frühzeitigen<br />
Selektion der Hochrisikopatienten bezüglich einer vorzeitigen beruflichen<br />
Desintegration bzw. Berentung (vgl. Abb. 8). Mit diesem ersten Schritt soll für den<br />
Bereich der pneumologischen Erkrankungen die Bildung einer Untergruppe von Patienten<br />
ermöglicht werden, deren Rehabilitationsziele primär im beruflichen Bereich<br />
liegen <strong>und</strong> dementsprechend mit diesen Problemkonstellationen gezielt in die Bereiche<br />
der Therapie, Beratung <strong>und</strong> Schulung überwiesen werden können (Individualisierung<br />
vs. Pauschalisierung).<br />
Die Ergebnisse sollen durch eine weitere Befragung von Patienten (n=500) <strong>und</strong> Experten<br />
zu notwendigen beruflichen Hilfen in der pneumologischen Rehabilitation ergänzt<br />
werden. Hierdurch sollen insbesondere Bedarf <strong>und</strong> Fragestellungen im Bereich<br />
der Rehabilitations- <strong>und</strong> Sozialberatung abgeklärt werden, um die Schnittstelle zur<br />
Nachsorge zu verbessern <strong>und</strong> damit den Rehabilitationserfolg nachhaltig zu fördern.<br />
Die Ergebnisse dieses zweiten Schrittes sollen Anhaltspunkte zur Implementierung<br />
eines interdisziplinär ausgerichteten Informations- <strong>und</strong> Beratungszentrums liefern.<br />
(Verbesserung der Segmentierung in Richtung Rehabilitationsnachsorge).<br />
Reanalyse, Nachbefragung <strong>und</strong> Methodenentwicklung<br />
unter besonderer Berücksichtigung beruflicher Aspekte<br />
Implementierung eines Beratungs- <strong>und</strong> Informationszentrums<br />
Reanalyse der<br />
Reha-Studien<br />
Bereiche/Quellen:<br />
•somatische<br />
•funktionale<br />
• psychosoziale<br />
•edukative<br />
• behandlungsbezogene<br />
• Aspekte der berufl.<br />
Rehabilitation<br />
• Patientenangaben<br />
• Arztangaben<br />
• objektive Parameter<br />
Abb. 8: Projektübersicht<br />
Ergänzende<br />
Methoden<br />
• Nachbefragung<br />
unter besonderer<br />
Berücksichtigung<br />
der beruflichen<br />
Rehabilitation<br />
• Patientenbefragung<br />
• Expertenbefragung<br />
• Literaturanalyse<br />
35<br />
Implementierung<br />
<strong>des</strong> Zentrums<br />
• interdisziplinär<br />
ausgerichtet<br />
•Einbeziehung<br />
der Funktions- <strong>und</strong><br />
Leistungsdiagnostik<br />
<strong>und</strong> der Therapie-,<br />
Beratungs- <strong>und</strong><br />
Schulungsangebote<br />
• Perspektive zur<br />
Nachsorge<br />
Methodenentwicklung:<br />
Screening beruflicher<br />
Risikoprofile
Die Hauptfragestellungen lassen sich wie folgt benennen:<br />
1. Welche somatischen, funktionalen, psychosozialen <strong>und</strong> behandlungsbezogenen<br />
Merkmale weist der „pneumologische Patient“ auf?<br />
2. Welche Risikoprofile zur Frühberentung bzw. der Gefährdung hierzu lassen sich<br />
ableiten?<br />
3. Wie können diese durch ein Screeninginstrument frühzeitig identifiziert <strong>und</strong> zielgerichtet<br />
in den Rehabilitationsprozess (Diagnostik, Therapie, Beratung, Schulung)<br />
eingebracht werden?<br />
4. Welche Beratungskonzepte sind notwendig, damit der langfristige Behandlungserfolg<br />
gesichert <strong>und</strong> eine Frühberentung vermieden werden kann (Schnittstelle zur<br />
Nachsorge)?<br />
5. Welchen Beitrag können hierbei die an der Gesamtbehandlung beteiligten Versorgungssegmente<br />
(Hausarzt, Kostenträger, Selbsthilfegruppen etc.) leisten?<br />
3.2. Methodik <strong>und</strong> Design<br />
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden vorliegende Erhebungen aus drei Studien<br />
durch eine Nachbefragung unter besonderer Berücksichtigung beruflicher Aspekte<br />
ergänzt (Kaiser 1994). Die vorliegenden Studien basieren auf einem korrelativ-naturalistischen<br />
Untersuchungskonzept ohne Kontrollgruppe <strong>und</strong> Randomisierung,<br />
welches auf dem Modell der Datenboxen von Wittmann (1985, 1995) beruht.<br />
Unter Einbeziehung der Nachbefragung handelt es sich um ein Längsschnitt<strong>des</strong>ign<br />
mit 2 Messzeitpunkten (t1: Klinikaufnahme, t2: > 5 Jahre nach Klinikentlassung). Bei<br />
der Befragung zu beruflichen Hilfen handelt es sich um eine Querschnittuntersuchung<br />
mit einem Messzeitpunkt zum Zeitpunkt der Klinikaufnahme.<br />
In die Nachbefragung wurden alle früher Befragten eingeschlossen, die folgende<br />
Merkmale aufweisen:<br />
• Hauptdiagnose pneumologische Erkrankung<br />
• Alter über 17 Jahre <strong>und</strong><br />
• in den Ursprungsstichproben verwertbare Angaben<br />
3.3. Beschreibung der Erhebungsinstrumente<br />
Bei der Auswahl der Assessmentinstrumente wurden die Empfehlungen der Arbeitsgruppen<br />
‚Generische Methoden’, ‚Routinedaten’ <strong>und</strong> ‚Reha-Ökonomie’ (VDR 1999)<br />
berücksichtigt. Abweichungen ergeben sich durch die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit<br />
mit den Ergebnissen der einbezogenen Vorstudien. Da bezüglich der seit<br />
Jahren eingesetzten Instrumente - einschließlich selbstentwickelter Verfahren - umfassende<br />
methodische Erkenntnisse (Validität, Sensitivität, Konsistenz, etc.) vorliegen,<br />
wird der Vergleichbarkeit eine höhere Priorität eingeräumt (Kaiser 1994). Die<br />
selbstentwickelten Verfahren beinhalten primär indikationsbezogene Symptombereiche<br />
<strong>und</strong> Krankheitsbelastungen. Diese von den Betroffenen einzustufenden Ratings<br />
dienen der Statusmessung, können jedoch auch als direkte oder indirekte Veränderungsmessung<br />
eingesetzt werden. Über eine Aggregation lassen sich Skalen bilden,<br />
die die jeweiligen Bereiche übergeordnet zusammenfassen. Teilbereiche werden<br />
durch qualitative Ansätze ergänzt.<br />
36
Der Fragebogen zur Nachbefragung enthält folgende Bereiche:<br />
• Derzeitige Belastungen <strong>und</strong> Beschwerden: Form der Atemwegserkrankung,<br />
andere Erkrankungen, Komorbidität<br />
• Ges<strong>und</strong>heitszustand/Alltagsschwierigkeiten: Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Lebensqualität,<br />
Zurechtkommen im Alltag, Anforderungen <strong>des</strong> Alltags, Leiden unter der<br />
Erkrankung, erlebte Beeinträchtigungen, Häufigkeit/Erleben der asthmatischen<br />
Symptome, Angst, Depression, körperlich krank, seelisch beeinträchtigt, subjektive<br />
Meinung über die Entwicklung der Erkrankung in den nächsten Jahren<br />
• Behandlungen: Art der Behandlungen in den letzten 6 Monaten, Hilfe von Institutionen/Personen,<br />
Antrag zur stationären Rehabilitation, Gründe für/gegen einen<br />
Antrag, Erfahrungen mit Antrag, Inanspruchnahme von Ärzten/Therapeuten,<br />
Selbsthilfegruppen, Zufriedenheit mit ambulanter Versorgung, Medikamentenkonsum,<br />
Wirksamkeit der Medikamente/Symptomatik, Compliance<br />
• <strong>und</strong> Lebensereignisse:<br />
• Risikofaktoren <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsverhalten, Lebensereignisse (belastend vs.<br />
angenehm)<br />
• Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> soziale Unterstützung: Strategien zur Krankheitsverarbeitung,<br />
hilfreiche Strategien <strong>und</strong> deren Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf,<br />
Ausmaß der Krankheitsbewältigung, Formen, Quellen <strong>und</strong> Ausmaß der<br />
sozialen Unterstützung, Erleben der Hilfe durch andere Personen<br />
• Berufliche Situation: Berufliche Situation, Schwerbehinderung, berufliche Stellung,<br />
Hilfen im beruflichen Alltag, Maßnahmen zur beruflichen Förderung, AU-<br />
Zeiten, Arbeitsfähigkeit, objektive <strong>und</strong> subjektive Arbeitsbedingungen, Belastungen<br />
am Arbeitsplatz, Betriebsgröße, Arbeitszufriedenheit, berufliche Veränderungen<br />
durch die Erkrankung, Erleben der Arbeitssituation, Zukunftssorgen. Zusatz<br />
für Rentenantragsteller <strong>und</strong> Berentete: Rentenantrag <strong>und</strong> Berentung, Berentungsform,<br />
-dauer, Gründe für die Antragstellung bzw. Berentung, Zurechtkommen<br />
mit Berentung<br />
• Lebenszufriedenheit: Bedeutung<br />
unterschiedlicher Bereiche für die Lebenszufriedenheit,<br />
aktuelles Ausmaß der Zufriedenheit in diesen Bereichen<br />
• Angaben zur Person:<br />
• Soziodemographische Daten: Alter, Geschlecht, Nationalität, Familienstand,<br />
Schulabschluss, Berufsausbildung, Konfession, Kinderanzahl, Krankenkasse <strong>und</strong><br />
Rentenversicherungsträger, Nettoeinkommen (selbst <strong>und</strong> Haushalt), Zahl <strong>und</strong> Art<br />
der Personen im Haushalt, Stadtgröße<br />
37
Tab. 2: Instrumente im Fragebogen zur Nachbefragung<br />
Titel <strong>des</strong><br />
Kurzbezeich- Autor / Jahr Erhobene Kriterien<br />
Instruments<br />
nung<br />
Fragebogen zum Ges<strong>und</strong>- SF-12 Bullinger et al. Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Lebensqualität<br />
heitszustand SF-36 (Kurzform)<br />
1998<br />
Asthmasymptomliste ASL Kinsman et al.<br />
1974<br />
Brief-Symptom-Inventory<br />
(Kurzform <strong>des</strong> SCL-90 R)<br />
Kontrollattributionen bezüglich<br />
<strong>des</strong> weiteren Krankheitsverlaufs<br />
BSI Derogatis et al.<br />
1977<br />
EKOA Muthny<br />
1990<br />
<strong>Körperliche</strong> Beschwerden, Symptome,<br />
<strong>und</strong> Empfindungen der asthmatischen<br />
Atemnot<br />
Subskalen Depression <strong>und</strong> Angst<br />
Kontrollattributionen bezüglich <strong>des</strong><br />
weiteren Krankheitsverlaufs<br />
Risikofaktoren SF-36 Bullinger et al.<br />
1998<br />
Teilbereich aus SF-36<br />
Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung<br />
FKV-LIS Muthny 1989 Strategien der Krankheitsverarbeitung<br />
Fragebogenskalen zu Be- SBUS-B1 Weyer et al. Subskala B1: „Arbeits- <strong>und</strong> Berufsbelastung<br />
<strong>und</strong> Unzufriedenheit<br />
im Beruf<br />
1980<br />
lastung“<br />
Subjektive Arbeitsanalyse SAA Martin et al. 1980 Quantitative <strong>und</strong> qualitative Überforde-<br />
(2 Subskalen)<br />
rung durch die Arbeit<br />
Lebenszufriedenheits-inventar<br />
Patientenfragebogen zu berufsbezogenen Hilfen<br />
LZI Muthny 1991 Teilbereiche der Lebensqualität<br />
Ergänzend zu Teilbereichen der Nachbefragung beinhaltet dieser Fragebogen insbesondere<br />
Fragen zu notwendigen Hilfen im Rahmen <strong>des</strong> Rehabilitationsverfahrens<br />
<strong>und</strong> für die poststationäre Phase. Die Patientenbefragung wird durch eine Arztbefragung<br />
ergänzt.<br />
• Erwartungen an den Klinikaufenthalt<br />
• Lebensqualität<br />
• Krankheitsbelastungen<br />
• Behandlungen<br />
• Krankheitsverarbeitung, soziale Unterstützung<br />
• Fragen zur beruflichen Situation: Schwerbehinderung, berufliche Stellung, Inanspruchnahme<br />
von Bf-Maßnahmen, Rentenantrag, Arbeitsfähigkeit<br />
• Fragen für Berufstätige: berufliche Situation, Rentenwunsch, Merkmale beruflicher<br />
Tätigkeit, AU-Zeiten, betriebliche Umstrukturierungen/Rationalisierungen,<br />
Furcht vor Arbeitslosigkeit<br />
• Fragen für Berentete: Art <strong>und</strong> Dauer der Rente<br />
• Beratungswünsche im beruflichen Kontext: Wunsch vorhanden, Beratungsthemen,<br />
Beratungsthemen im Kontext möglicher Einrichtungen, Nutzen der erhaltenen<br />
Beratungen,<br />
• Soziodemographische <strong>und</strong> krankheitsbezogene Angaben: Alter, Geschlecht, Nationalität,<br />
Familienstand, Schulabschluss, Berufsausbildung, Kinderanzahl, Kostenträger,<br />
Nettoeinkommen, Zahl <strong>und</strong> Art der Personen im Haushalt, Art <strong>des</strong> Kli-<br />
38
nikaufenthaltes, Anzahl der Rehabilitationsmaßnahmen in den letzten 5 Jahren,<br />
Hauptdiagnose<br />
Tab. 3: Instrumente im Patientenfragebogen zu berufsbezogenen Hilfen<br />
Titel <strong>des</strong> Instruments Kurzbezeichnung<br />
Autor / Jahr Erhobene Kriterien<br />
Rehamotivation <strong>und</strong> Erwar- FREM-17 Deck et al. Rehamotivation, Erwartungen<br />
tungen an die Rehabilitation<br />
1998 (a,b)<br />
Fragebogen zum Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
SF-36 (Kurzform)<br />
Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung<br />
SF-12 Bullinger et al.<br />
1998<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbezogene Lebensqualität<br />
FKV-LIS Muthny 1989 Strategien der Krankheitsverarbeitung<br />
(Subskalen „Depressive Verarbeitung“ <strong>und</strong><br />
„Bagatellisierung/Wunschdenken“)<br />
Arztfragebogen (im Rahmen der Befragung zu beruflichen Hilfen)<br />
Zur Beschreibung der Stichprobe aus Sicht <strong>des</strong> Arztes in der Klinik wurde im Rahmen<br />
der Befragung zu beruflichen Hilfen vom behandelnden Arzt ein Fragebogen<br />
ausgefüllt. Dieser beinhaltet folgende Beeiche:<br />
• Daten zur Atemwegserkrankung (Diagnose, Krankheitsdauer, -schwere)<br />
• Krankheitsbelastungen<br />
• Behandlungen<br />
• Prognose bezüglich Verlauf Erwerbsfähigkeit<br />
• Empfehlungen für die Nachsorge<br />
• Erreichung der Rehabilitationsziele<br />
Fragebögen der Expertenbefragung<br />
Die Expertenbefragung richtet sich an Ämter, Pneumologen, Einrichtungen der beruflichen<br />
Rehabilitation, Akut- <strong>und</strong> Rehabilitationskliniken mit pneumologischem<br />
Schwerpunkt, Kostenträger <strong>und</strong> Selbsthilfegruppen. Unter Beachtung der originären<br />
Zuständigkeiten bzw. Angebote wurden in die unterschiedlichen Fragebögen folgende<br />
Bereiche einbezogen:<br />
• Information zum Klientel: Anteil an Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen,<br />
Sensibilität bezüglich Arbeit <strong>und</strong> Beruf im Kontext von Atemwegserkrankungen<br />
bei den Patienten<br />
• Maßnahmen <strong>und</strong> Angebote der Einrichtung: Unterstützung bei beruflichen Problemen,<br />
Maßnahmen zur Früherkennung von beruflichen Problemen, Art von berufsbezogenen<br />
Interventionen<br />
• Kontakte zu anderen Einrichtungen/Kooperationspartnern: Kooperationspartner<br />
<strong>und</strong> Kooperationsform, Bewertung der Kooperationen<br />
• Gesamtbewertung: Bedeutung der Einbindung beruflicher Aspekte, Schätzung<br />
<strong>des</strong> Anteils an Risikopatienten, Qualität <strong>und</strong> Wichtigkeit der Berücksichtigung beruflicher<br />
Aspekte in den unterschiedlichen Versorgungssegmenten im Rehabilitationsprozess<br />
39
3.4. Stichprobengewinnung <strong>und</strong> Rücklauf<br />
Die Gesamtsumme der für die Nachbefragung in Frage kommenden früheren Studienteilnehmer<br />
lag bei 1029 ehemaligen Patienten. Die Analyse der vorliegenden<br />
Studien (Bezugsmesszeitpunkt: T1) ergab, dass insgesamt 148 Befragte diese Kriterien<br />
nicht erfüllen <strong>und</strong> daher ausgeschlossen werden mussten (vgl. Abb. 9). Kriterien<br />
für den Ausschluss waren nicht verwertbare Bögen wegen unzureichender Ausfüllung<br />
(n=51), anderer Hauptdiagnosen (n=25) <strong>und</strong> Teilnahme in mehreren Teilstudien<br />
(n=72).<br />
Antworter<br />
(n=553)<br />
Versandte Fragebögen<br />
(n=881)<br />
Ursprüngliche Gesamtstichprobe<br />
(n=1029)<br />
Erreichbare (n=814) Nicht Erreichbare (n=67)<br />
Nicht-Antworter<br />
(n=194)<br />
Abb. 9: Zusammensetzung der Stichprobe<br />
unzureichend<br />
(n=51)<br />
verzogen<br />
(n=55)<br />
Basisstudie: n=414<br />
Schulungsstudie: n=231<br />
Sportstudie: n=384<br />
Ausgeschlossene (n=148)<br />
Doppelte<br />
(n=72)<br />
verstorben<br />
(n=12)<br />
Diagnose<br />
(n=25)<br />
In den ersten Teil der Studie (Nachbefragung) wurden 881 ehemalige Studienteilnehmer<br />
mit der Bitte angeschrieben, an der postalischen Nachbefragung teilzunehmen.<br />
Hierzu erhielten die Teilnehmer eine Information über die Studie, eine Einverständniserklärung,<br />
einen Fragebogen <strong>und</strong> einen frankierten Rückumschlag. Patienten,<br />
die innerhalb eines Monats nicht geantwortet hatten, wurden nochmals unter<br />
Beifügung eines Fragebogens angeschrieben. Zur Erhöhung <strong>des</strong> Rücklaufs wurde<br />
zusätzlich telefonisch mit den Nichtantwortern Kontakt aufgenommen (vgl. Bericht<br />
Machbarkeitsstudie 1999). Von den angeschriebenen Patienten waren 814 erreichbar<br />
(vgl. Abb. 5). Hiervon liegen insgesamt N=553 ausgefüllte Fragebögen vor, was<br />
einem Rücklauf von 67,9 % entspricht.<br />
Im Anschluss an die Nachbefragung <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene Analyse der Daten<br />
wurde die Befragung zu beruflichen Hilfen in der pneumologischen Rehabilitation<br />
an aktuell in die Hochgebirgsklinik eingewiesenen Patienten durchgeführt.<br />
Als Einschlusskriterium für die Aufnahme in die Stichprobe galt der kurz bevorstehende<br />
Aufnahmetermin, Alter ab 18. Lebensjahr <strong>und</strong> die Hauptdiagnose „Atemwegserkrankung“.<br />
Um eine Konf<strong>und</strong>ierung mit dem Klinikeintritt zu vermeiden, erhielten<br />
die eingewiesenen Patienten ca. 4 Wochen vor Klinikeintritt den Fragebogen mit ei-<br />
40
ner entsprechenden Information, einer Einverständniserklärung <strong>und</strong> einem Rückumschlag<br />
zugeschickt. Die Angeschriebenen wurden gebeten, den ausgefüllten Fragebogen<br />
<strong>und</strong> die Einverständniserklärung im verschlossenen Rückumschlag im Aufnahmegespräch<br />
dem behandelnden Arzt zur Weiterleitung auszuhändigen. Mit denjenigen<br />
Patienten, die ihren Bogen nach der Aufnahme nicht abgegeben hatten, wurde<br />
nochmals schriftlich <strong>und</strong> mündlich Kontakt aufgenommen, um sie zur Teilnahme<br />
an der Teilstudie zu motivieren. Von den 550 angeschriebenen Patienten lagen zum<br />
Ende <strong>des</strong> Erhebungszeitraumes 455 ausgefüllte Fragebogen vor, was einem Rücklauf<br />
von 82,7 % entspricht.<br />
Zur Beschreibung der Stichprobe aus Sicht <strong>des</strong> Arztes in der Klinik wurde im Rahmen<br />
der Befragung zu beruflichen Hilfen vom behandelnden Arzt ein Fragebogen<br />
ausgefüllt. Hierzu erhielten die Ärzte von allen Patienten, die an der Befragung zu<br />
beruflichen Hilfen teilgenommen <strong>und</strong> eine Einverständniserklärung unterschrieben<br />
hatten einen Fragebogen, der zum Zeitpunkt der Entlassung ausgefüllt werden sollte.<br />
Zur Steigerung <strong>des</strong> Rücklaufs wurde mit den Ärzten, die den Bogen noch nicht ausgefüllt<br />
hatten, persönlich Kontakt aufgenommen <strong>und</strong> um Abgabe gebeten.<br />
Von den 455 Patienten, von denen ein ausgefüllter Fragebogen <strong>und</strong> eine Einverständniserklärung<br />
vorlagen, liegen 358 Arztfragebögen vor, was (bezogen auf den<br />
Rücklauf der Patientenfragebogen) einem Rücklauf von 78,7 % entspricht.<br />
Im Rahmen der Expertenbefragung wurde der Fragebogen an insgesamt 1499 definierte<br />
Experten aus dem Versorgungssystem versandt (vgl. Tab. 4). Die Adressen<br />
hierfür stammten aus verschiedenen Informationsquellen (z.B. Internet, Broschüren,<br />
CD-Verzeichnisse).<br />
Tabelle 4: angeschriebene Experten<br />
Gruppe Anzahl<br />
A. Ämter 230<br />
B. niedergelassene Pneumologen 539<br />
C. Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 79<br />
D. Pneumologische Fach- <strong>und</strong> Rehabilitationskliniken 226<br />
E. Kostenträger 279<br />
F. Selbsthilfegruppen 146<br />
Gesamt 1499<br />
Der Rücklauf der Expertenfragebögen war derart unter den Erwartungen, so dass<br />
aufgr<strong>und</strong> mangelnder Erfolgsaussicht auf eine geplante Erinnerung an die Rückgabe<br />
der Fragebögen verzichtet wurde. Auswertbare Antworten liegen von niedergelassenen<br />
Pneumologen (n=69, 12,8 %) <strong>und</strong> pneumologischen Fach- <strong>und</strong> Rehabilitationskliniken<br />
vor (n=35, 14,5 %). Die Ergebnisse der Expertenbefragung stellen somit keine<br />
repräsentative Stichprobe dar, liefern jedoch Anhaltspunkte zur Beschreibung der<br />
Gesamtsituation in der Versorgung (vgl. Abschnitt 2).<br />
41
3.5. Auswertungskonzeption<br />
Die Auswertung der Daten orientierte sich an den verschiedenen Arbeitsschritten <strong>des</strong><br />
Gesamtprojektes (vgl. Projektantrag). Die Daten für die Reanalyse lagen jeweils in<br />
einem Datenbanksystem vor. Im ersten Schritt wurden die Daten aus den vorliegenden<br />
Studien in mehreren Schritten zu einem Gesamtdatensatz zusammengefasst<br />
<strong>und</strong> integriert. Mit der Zielsetzung der eindeutigen Vergleichbarkeit <strong>und</strong> Vereinheitlichung<br />
der vorliegenden Datensätze <strong>und</strong> der Nachbefragung (eindeutige Zuordnung<br />
zu den Teilstudien <strong>und</strong> Eindeutigkeit im Gesamtdatensatz) waren bei der Bildung<br />
<strong>des</strong> Gesamtdatensatzes verschiedene Schritte notwendig:<br />
• Umbenennung <strong>und</strong> eindeutige Zuordnung der Variablen: in den unterschiedlichen<br />
Studien waren teilweise Skalen <strong>und</strong> Items der verwendeten Fragebögen mit unterschiedlichen<br />
Variablennamen versehen<br />
• Recodierung <strong>und</strong> Umpolung: Variablen, die in den unterschiedlichen Studien zwar<br />
inhaltlich identisch vorlagen, waren teilweise unterschiedlich gepolt oder/<strong>und</strong> unterschiedlich<br />
gestuft<br />
Nach der Bildung <strong>des</strong> Gesamtdatensatzes aus den vorliegenden Studien erfolgte die<br />
Zusammenführung dieser beiden Datensätze (gebildeter Gesamtdatensatz aus Vorstudien<br />
<strong>und</strong> Datensatz der Nachbefragung). Zuerst wurden die in die Studie integrierten<br />
Instrumente bzw. deren Subskalen einer methodenkritischen Überprüfung<br />
unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgte zur Beantwortung der ersten Fragestellung<br />
die Auswertung der Daten in <strong>des</strong>kriptiver Form (Vergleich t1 vs. t2).<br />
Patientenmerkmale<br />
Patientenmerkmale<br />
Ausgangsstichproben<br />
Ausgangsstichproben<br />
• Somatisch<br />
• Funktional<br />
• Psychosozial<br />
• Behandlungsbezogen<br />
• Demographisch<br />
im Beruf<br />
im Beruf<br />
Ermittlung eines Risikoprofils<br />
zur Frühberentung<br />
?<br />
Patientenmerkmale<br />
Patientenmerkmale<br />
Nachbefragung<br />
Nachbefragung<br />
Antrag<br />
Antrag<br />
auf<br />
auf<br />
Frühberentung<br />
Frühberentung<br />
(mit<br />
(mit<br />
oder<br />
oder<br />
ohne<br />
ohne<br />
Erfolg)<br />
Erfolg)<br />
kein<br />
kein<br />
Antrag<br />
Antrag<br />
auf<br />
auf<br />
Frühberentung<br />
Frühberentung<br />
t 1 : Ersterhebung t 2: Nacherhebung<br />
Abb. 10: Projektübersicht<br />
Deskriptive Analyse<br />
Status - Veränderung<br />
Statistische Methode (Bsp.):<br />
Logistische Regression<br />
(Vorhersage eines dichotomen<br />
Kriteriums durch Variablen<br />
unterschiedlicher Skalierung)<br />
Im nächsten Schritt wurden zur Beantwortung der zweiten Fragestellung auf der Basis<br />
der Patientendaten somatische, funktionale, psychosoziale <strong>und</strong> behandlungsbezogene<br />
Bereiche hinsichtlich der Ermittlung eines ‘Risikoprofils zur Frühberentung’<br />
untersucht (vgl. Abb. 10).<br />
42
Hierzu wurden diese Bereiche jeweils zusammengefasst <strong>und</strong> hinsichtlich möglicher<br />
Zusammenhänge mit dem Kriterium ‘Frühberentung’ durch eine logistische Regressionsanalyse<br />
untersucht. Zur Absicherung der auf den Messzeitpunkt t1 bezogenen<br />
Ergebnisse wurden für die gleiche Modellbildungsgruppe weitere Analysen bezogen<br />
auf den Messzeitpunkt t2 durchgeführt.<br />
Die zur Beantwortung der vierten Fragestellung zu notwendigen Beratungsangeboten<br />
durchgeführte Befragung zu beruflichen Hilfen <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene Arztbefragung<br />
erfolgt im ersten Schritt in <strong>des</strong>kriptiver Form. Weiterhin wurde die vom behandelnden<br />
Arzt auf einer fünfstufigen Skala vorgenommene Einschätzung <strong>des</strong><br />
Frühberentungsrisikos unter Einbeziehung der Patienten- <strong>und</strong> Arztdaten mittels einer<br />
linearen Regressionsanalyse untersucht.<br />
Auf der Basis der in diesen Gesamtanalysen ermittelten Risiken zur Frühberentung<br />
wurde ein Assessmentinstrument entwickelt <strong>und</strong> damit die dritte Fragestellung beantwortet.<br />
Die Auswertung der ergänzenden Expertenbefragung zur Beantwortung<br />
der fünften Fragestellung erfolgt in rein <strong>des</strong>kriptiver Form.<br />
Die Dateneingabe <strong>und</strong> -auswertung erfolgte mit der PC-Version <strong>des</strong> Statistikprogramms<br />
SPSS (Version 10). Daneben kamen die unterschiedlichen Module von MS-<br />
Office 2000 zur Anwendung.<br />
3.6. Datenschutz/Ethikkommission<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Datenschutzes erhielten die Studienteilnehmer ein Informationsschreiben<br />
über die Ziele <strong>und</strong> Rahmenbedingungen der Studie <strong>und</strong> eine Einverständniserklärung,<br />
die von ihnen unterschrieben wurde (vgl. Anhang). Die Dateneingabe<br />
erfolgte anonymisiert, <strong>und</strong> die Originalbogen wurden gesichert <strong>und</strong> für Dritte unzugänglich<br />
aufbewahrt. Das Projekt wurde im Februar 1998 der Ethikkommission der<br />
Landschaft Davos zur Prüfung vorgelegt <strong>und</strong> genehmigt.<br />
43
4. Ergebnisse<br />
Da sich die unterschiedlichen Erhebungen der Studie aus unterschiedlichen Stichproben<br />
rekrutieren, werden die verschiedenen Stichproben getrennt <strong>und</strong> zeitlich geordnet<br />
dargestellt. Zunächst erfolgt eine Darstellung der Stichprobe für die Nachbefragung.<br />
Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der logistischen Regression zur<br />
Ableitung eines Risikoprofils zur Frühberentung dargestellt. Danach wird auf die Ergebnisse<br />
der Befragung zu beruflichen Hilfen eingegangen, gefolgt von der Entwicklung<br />
<strong>des</strong> Screeninginstrumentes <strong>und</strong> den Ergebnissen der Expertenstichprobe. Den<br />
Abschluss bildet eine Zusammenfassung <strong>und</strong> Integration der Ergebnisse.<br />
Zur besseren Lesbarkeit sind die jeweiligen Irrtumswahrscheinlichkeiten in Abbildungen<br />
als Stern gekennzeichnet: *p
Die Einschlusskriterien in die beiden Gruppen sind wie folgt definiert:<br />
• eine zwischen t1 (Ursprungsstichprobe) <strong>und</strong> t2 (Nachbefragung) beantragte oder<br />
ausgesprochene Frühberentung (n=92)<br />
• die Fortsetzung der Berufstätigkeit zu t1 <strong>und</strong> t2 (n=316)<br />
MZP t1<br />
MZP t2<br />
Zusammensetzung der Stichprobe (t1/t2)<br />
Kriterium: Erwerbsstatus<br />
Abbildung 11<br />
t1: im Beruf<br />
t2: im Beruf<br />
433 70 50<br />
Modellbildungsgruppe:<br />
n=408<br />
316 316 + 92 = 408 92<br />
t1: im Beruf<br />
t2: frühberentet/<br />
Antrag Frühberentung<br />
322 144 87<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
aktuell berufstätig Antrag/Frührente Altersrente<br />
Die nach der Beschreibung der wesentlichen Stichprobenmerkmale dargestellte multivariate<br />
Analyse zur Identifizierung eines Risikoprofils zur Frühberentung bezieht<br />
sich auf die diesen Gruppen zugehörigen Patienten (Modellbildungsgruppe, n=408).<br />
4.1.1. Demographische Stichprobenmerkmale<br />
In die Nachbefragung wurden 881 ehemalige Patienten einbezogen, von denen 814<br />
erreichbar waren (vgl. Abb. 9). Hiervon lagen für die Nachbefragung insgesamt 553<br />
ausgefüllte Fragebögen vor, was einem Rücklauf von 67,9 % entspricht. Die Überprüfung<br />
relevanter Merkmale der Stichprobe (Alter, Geschlecht, Diagnosen, Krankheitsdauer)<br />
ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen den Antwortern <strong>und</strong><br />
Nicht-Antwortern. Auf die Repräsentativität wurde im Zwischenbericht 1999 eingegangen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der vorliegenden Ergebnisse kann diese unterstellt werden.<br />
Die Teilnehmer der Studie waren zu 50,2 % Frauen <strong>und</strong> entsprechend zu 49,9 %<br />
Männer. Das Durchschnittsalter betrug zu t1 47,0 ± 14,0 Jahre, zu t2 52,1 ± 14,0 Jahre,<br />
was die Zeit von ca. 5 Jahren zwischen den beiden Messzeitpunkten erkennen<br />
lässt. Bei der Stichprobe handelt es sich fast ausschließlich um deutsche Staatsbürger<br />
(99,2 %). Die Verteilung der Altersgruppen ist aus Abbildung 12 zu entnehmen.<br />
45<br />
553<br />
553
Altersverteilung - Bildungsstand<br />
Altersverteilung:<br />
18-24<br />
25-34<br />
35-44<br />
45-54 Jahre<br />
55-64 Jahre<br />
ab 65 Jahre<br />
Bildungsstand:<br />
Hauptschule ohne Abschluss<br />
Hauptschule mit Abschluss<br />
Realschule/Mittlere Reife<br />
Polytechn. Oberschule<br />
FH-Reife/Abitur<br />
anderer Abschluss<br />
Abbildung 12 (n=553)<br />
1,6<br />
2,7<br />
1,8<br />
3,6<br />
7,4<br />
12,3<br />
12,5<br />
17,2<br />
16,5<br />
21,3<br />
22,6<br />
22,4<br />
25,3<br />
31,6<br />
33,5<br />
32,4<br />
35,2<br />
0 10 20 30 40<br />
t1 in % t2 in %<br />
Die Angaben zum Familienstand zeigen im Vergleich zu t1, dass insbesondere der<br />
Anteil der Verheirateten zu Lasten der Ledigen von 64,3 % auf 68,9 % angewachsen<br />
ist. Das Bildungsniveau ist erwartungsgemäß zu t2 etwas höher als zu t1: der Anteil<br />
sowohl von Teilnehmern mit Hauptschulabschluss als auch Mittlerer Reife ist zugunsten<br />
eines höheren Anteils von Absolventen eines Gymnasiums oder einer<br />
Hochschule zurückgegangen. Die Verteilung für den Messzeitpunkt t2 ist aus Abbildung<br />
12 zu ersehen. Eine Übersicht über weitere soziodemographische <strong>und</strong> sozioökonomische<br />
Merkmale der Stichprobe für den Messzeitpunkt t2 ist aus Tabelle A1<br />
im Anhang zu entnehmen.<br />
4.1.2. Somatische Stichprobenmerkmale<br />
Der Anteil der verschiedenen Hauptdiagnosen fällt zu t1 <strong>und</strong> t2 ähnlich aus, was<br />
durch den chronischen Verlauf dieser Erkrankungen auch zu erwarten war. Am häufigsten<br />
sind die verschiedenen Formen <strong>des</strong> Asthma bronchiale vertreten (ca. 80 %),<br />
gefolgt von der chronisch obstruktiven Bronchitis mit ungefähr 22 % <strong>und</strong> dem Lungenemphysem<br />
mit ca. 10 % (vgl. Abb. 13).<br />
Bei den Nebenerkrankungen stehen dabei mit der Atemwegserkrankung verb<strong>und</strong>ene<br />
Allergien (46,1 %) im Vordergr<strong>und</strong>, gefolgt von Erkrankungen <strong>des</strong> Skeletts oder <strong>des</strong><br />
Muskelapparats mit 28,2 %, <strong>des</strong> Herz-Kreislauf-Systems mit 15,2 % <strong>und</strong> der Haut mit<br />
13,9 %. Etwa die Hälfte der Patienten gibt dabei mehr als eine Nebenerkrankung an.<br />
Lediglich ein Viertel weist keine Zusatzerkrankung auf. Die Krankheitsdauer beträgt<br />
zu t1 durchschnittlich 15,1 Jahre (SD 11,9 Jahre).<br />
46
Diagnosen - Nebenerkrankungen<br />
Primärdiagnose:<br />
Asthma bronchiale<br />
chronische Bronchitis<br />
Lungenemphysem<br />
Nebenerkrankungen (NE):<br />
Allergien<br />
Skelett/Muskel<br />
Herz/Kreislauf<br />
Haut<br />
Nervensystem<br />
Verdauung<br />
Stoffwechsel<br />
Anzahl NE:<br />
keine<br />
eine<br />
zwei<br />
drei<br />
vier<br />
Abbildung 13 (n=553)<br />
2<br />
10,5<br />
10,3<br />
15,2<br />
13,9<br />
7,8<br />
5,2<br />
4,7<br />
8<br />
22,5<br />
20,4<br />
25<br />
28,2<br />
28<br />
37<br />
46,1<br />
80,7<br />
76,5<br />
0 20 40 60 80 100<br />
t1 in % t2 in %<br />
Einen Hinweis auf den Schweregrad der Erkrankung gibt die notwendige Medikation.<br />
Hierzu liegen für die Nachbefragung Angaben vor, die sich am Stufenschema der<br />
Asthmatherapie orientieren (Atemwegsliga 1998). Die in Abbildung 14 dargestellte<br />
Verteilung zeigt, dass 72,4 % eine mittel- bis schwergradige Erkrankung aufweisen.<br />
Medikation - Krankheitsschweregrad<br />
keine Medikamente<br />
kurzwirksame Betamimetika<br />
zusätzlich Kortisonspray<br />
langwirksame Betamimetika,<br />
Kortisonspray, Theophyllin<br />
zusätzlich systemische Kortikoide<br />
Abbbildung 14 (n=553)<br />
2,5<br />
4,5<br />
20,7<br />
32,5<br />
39,9<br />
0 10 20 30 40 50<br />
t2 in %<br />
Einen ersten Überblick über die Krankheitsbelastungen gibt Abbildung 15. Die Befragten<br />
schätzten hierzu das Ausmaß der Belastungsintensität jeweils für die letzten<br />
6 Monate auf einer Skala von 1=gar nicht bis 5=sehr stark ein. Die Ergebnisse zeigen,<br />
dass sich in der Rangreihe zwischen den Messzeitpunkten (> 5 Jahre) kaum<br />
Veränderungen ergeben haben. Die größten Belastungen (MW > 3.00) werden für<br />
die Atemwegserkrankung/-symptomatik, die körperliche Verfassung, die allgemeine<br />
47
Leistungsfähigkeit, das Allgemeinbefinden, den allgemeinen Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
<strong>und</strong> die Einschränkungen in der Lebensqualität insgesamt angegeben.<br />
Abbildung 15 (n=553)<br />
Allgemeine Krankheitsbelastungen<br />
Atemwegserkrankung<br />
körperliche Verfassung<br />
allg. Leistungsfähigkeit<br />
Allgemeinbefinden<br />
allg. Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
berufl. Leistungsfähigkeit<br />
Arbeitsfähigkeit<br />
Konfliktfähigkeit<br />
allg. Alltagsanforderungen<br />
seelische Verfassung<br />
Nebenwirkungen Behandlung<br />
Symptomwahrnehmung<br />
Einschätzung Symptome<br />
Symptomkontrolle<br />
Krankheitsmanagement<br />
Lebensqualität insgesamt<br />
3,68<br />
3,17<br />
3,38<br />
3,03<br />
3,34<br />
2,98<br />
3,2<br />
2,91<br />
3,18<br />
2,91<br />
2,95<br />
2,65<br />
2,92<br />
2,77<br />
2,91<br />
2,76<br />
2,9<br />
2,66<br />
2,75<br />
2,56<br />
2,62<br />
2,47<br />
2,47<br />
2,4<br />
2,95<br />
2,49<br />
3,16<br />
2,82<br />
1 2 3 4 5<br />
MW t1 MW t2<br />
Die in der Nachbefragung für die Bereiche angegebenen Belastungen fallen in allen<br />
Bereichen geringer aus. Die deutlichsten <strong>und</strong> hochsignifikanten Verbesserungen ergeben<br />
sich dabei insbesondere in den Bereichen, die zu t1 die höchste Belastungsintensität<br />
aufweisen.<br />
Ausschließlich für die Nachbefragung liegen Angaben zu krankheitsbedingten Belastungen<br />
vor, die sich vorwiegend um das Krankheitsmanagement ansiedeln lassen.<br />
Obwohl alle Befragten bei min<strong>des</strong>tens einem stationären Klinikaufenthalt diesbezüglich<br />
geschult wurden, ergeben sich überwiegend mittlere Belastungen (MW 2,4-2,95)<br />
in der Fähigkeit, Atemwegssymptome frühzeitig wahrzunehmen, diese sicher zu bewerten<br />
<strong>und</strong> zu kontrollieren <strong>und</strong> frühzeitig <strong>und</strong> gezielt geeignete Maßnahmen zur<br />
Verbesserung der Symptomatik einzuleiten.<br />
4.1.3. Funktionale Stichprobenmerkmale<br />
Zur Beschreibung der funktionalen Stichprobenmerkmale wird – entsprechend dem<br />
Schwerpunktthema dieses Projektes - neben Einschränkungen in der Bewältigung<br />
von Alltagsanforderungen vorwiegend auf Aspekte <strong>des</strong> Berufslebens eingegangen.<br />
Hierbei stehen neben der allgemeinen Beschreibung der beruflichen Situation <strong>und</strong><br />
diesbezüglichen krankheitsbedingten Einschränkungen insbesondere unterschiedliche<br />
Aspekte der Arbeitsanforderungen <strong>und</strong> -belastungen im Vordergr<strong>und</strong>. Daneben<br />
werden für Frühberentete/Antragsteller Gründe hierzu <strong>und</strong> das Erleben der vorzeitigen<br />
Berentung beschrieben.<br />
Zur Abbildung der Bewältigung der Alltagsanforderungen wurden den Befragten<br />
beschriebene Bereiche in Itemform (1=fällt mir schwer – 5=fällt mir leicht) zur Bewertung<br />
vorgegeben.<br />
48<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
**<br />
*<br />
***
Die in Abbildung 16 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die primären Einschränkungen<br />
in den Bereichen Haushalt <strong>und</strong> körperliche Aktivität liegen. Die sich bereits<br />
bei den somatischen Bereichen abzeichnende stabile Verbesserung zwischen den<br />
Messzeitpunkten zeigt sich auch hier. Diese betreffen insbesondere die Aktivitäten<br />
im Haushalt (t=4,49, df=168, p
Berufsstatus - berufliche Einschränkungen<br />
Beruflicher Status:<br />
Angestellter<br />
Beamtet<br />
in Ausbildung<br />
(Fach-)Arbeiter<br />
Hausfrau/-mann<br />
arbeitslos<br />
selbständig<br />
sonstiges<br />
Einschränkungen/Folgen:<br />
AU-Ausfall<br />
Schwerbehinderung<br />
Abbildung 17 (n=408)<br />
2,9<br />
1,7<br />
0,7<br />
9,5<br />
7,8<br />
16,7<br />
15<br />
27,1<br />
44,1<br />
40,2<br />
77,1<br />
86,2<br />
0 20 40 60 80 100<br />
t1 in % t2 in %<br />
Die Angaben zu beruflichen Einschränkungen bzw. Kontextfaktoren ergeben, dass<br />
zu t1 77,1 % der Patienten in den letzten 6 Monaten vor der Befragung zumin<strong>des</strong>t<br />
einmal arbeitsunfähig erkrankt waren <strong>und</strong> 27,1 % eine anerkannte Schwerbehinderung<br />
aufweisen. Die Arbeitsunfähigkeit erstreckte sich durchschnittlich über 2 bis 3<br />
Wochen (Median). 24,6 % der Patienten waren bis zu 2 Wochen arbeitsunfähig, 28,2<br />
% über 2 bis 4 Wochen, 14,2 % über 4 bis 8 Wochen <strong>und</strong> schließlich 10,0 % waren<br />
über 8 Wochen arbeitsunfähig. Über die Änderungen der Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
können keine genauen Aussagen getroffen werden, da der Bezugszeitraum beim<br />
zweiten Messzeitpunkt nicht 6 sondern 12 Monate beträgt. Der Anteil der Patienten,<br />
die in den letzten 12 Monaten zu t2 min<strong>des</strong>tens einmal arbeitsunfähig waren, beträgt<br />
86,2 %. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit liegt zu t2 bei 35,4 Tagen.<br />
Bei Halbierung dieser Dauer ergibt sich ein Wert von 17,7 Tagen, der vergleichbar ist<br />
mit dem Median von 2-3 Wochen innerhalb von 6 Monaten zu t1. Im Vergleich zu t1<br />
hat zu t2 der Anteil der Patienten mit einer anerkannten Schwerbehinderung um 13,1<br />
% zugenommen (vgl. Abb. 17).<br />
Zur weiteren Beschreibung der Arbeitsanforderungen <strong>und</strong> -belastungen wurden<br />
zu t2 unterschiedliche Bereiche abgefragt. Zu Beginn wurden den noch im Erwerbsleben<br />
stehenden Patienten Fragen zu krankheitsbedingten beruflichen Veränderungen<br />
mit der Bitte um Einschätzung vorgegeben (1=gar nicht – 5=sehr stark). Die in<br />
Abbildung 18 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass Veränderungen in vielen Bereichen<br />
angegeben werden. An negativen Folgen bilden sich dabei insbesondere die<br />
stärkere Arbeitsbelastung (54,3 %), die eingeschränkte berufliche Perspektive (30,2<br />
%), der verstärkte Konkurrenzdruck (27,8 %) <strong>und</strong> die notwendige Reduktion der Arbeitszeit<br />
(27,2 %) ab.<br />
50
Krankheitsbedingte berufliche Veränderungen<br />
stärkere Arbeitsbelastung<br />
Kollegen rücksichtsvoller<br />
Weiterkommen eingeschränkt<br />
verstärkte Konkurrenz<br />
arbeite weniger<br />
Verhältnis zu Kollegen besser<br />
Arbeitsplatz gefährdet<br />
andere Tätigkeit<br />
geringerer Verdienst<br />
berufliche Rückstufung<br />
mehr Pausen<br />
Verhältnis zu Kollegen schlechter<br />
Versetzung Arbeitsplatz<br />
umgeschult<br />
Abbildung 18 (n=316)<br />
30,2<br />
27,8<br />
27,2<br />
21,8<br />
19,1<br />
17<br />
16,5<br />
14<br />
13,6<br />
11<br />
8,6<br />
6,2<br />
45,8<br />
54,3<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
t2 in %<br />
In einer weiteren Teilfragestellung wurden Formen der Arbeits- <strong>und</strong> Berufsbelastung<br />
durch die Subskala „Arbeits- <strong>und</strong> Berufsbelastung“ <strong>des</strong> SBUS von Weyer et al.<br />
(1980) erfragt. Hierzu wurden die 16 Items von den Patienten in den Polen<br />
1=zutreffend bis 0=nicht zutreffend beantwortet.<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Berufsbelastung (SBUS-B1)<br />
nach der Arbeit erschöpft<br />
abgehetzt bei der Arbeit<br />
vom Beruf mitgenommen<br />
meist sehr angespannt<br />
sollte mich mehr schonen<br />
oft gestört<br />
Arbeit unter Zeitdruck<br />
ständig unter Druck<br />
brauche mehr Pausen<br />
mute mir zuviel zu<br />
Enttäuschungen erlebt<br />
seelische Belastungen<br />
häufig schwer lösbare Probleme<br />
werde mit Arbeit nicht fertig<br />
Anforderungen nicht gewachsen<br />
nicht voll ausgelastet<br />
Abbildung 19 (n=118)<br />
75,6<br />
82,2<br />
73,7<br />
71,3<br />
72,6<br />
77,1<br />
69,7<br />
70,1<br />
53,8<br />
63,3<br />
46,6<br />
52,2<br />
45,7<br />
46,7<br />
42,2<br />
46,3<br />
41,5<br />
49,7<br />
40,5<br />
47,4<br />
34,5<br />
39,7<br />
33,1<br />
42<br />
31,9<br />
33,4<br />
31,6<br />
38,7<br />
21,8<br />
28<br />
11,8<br />
8,5<br />
0 20 40 60 80 100<br />
t1 in % t2 in %<br />
Abbildung 19 gibt die Ergebnisse für die beiden Messzeitpunkte wider. Es zeigt sich,<br />
dass sich über die Hälfte der Befragten insbesondere erschöpft, abgehetzt, mitgenommen,<br />
angespannt fühlen <strong>und</strong> insgesamt das Gefühl haben, sich mehr schonen<br />
zu müssen. Da der SBUS zu t1 nur in der Basisstudie bei einer Subgruppe (n=118)<br />
eingesetzt wurde, ergibt sich im Vergleich zu t2 eine deutlich reduzierte Stichprobengröße,<br />
so dass die Darstellung alleine dem Überblick dient, gleichzeitig jedoch die<br />
beruflichen Belastungen sehr deutlich macht. Bereinigt um fehlende Werte ergeben<br />
sich im Vergleich zu t2 in keinem Bereich signifikante Unterschiede.<br />
51
Ergänzend hierzu wurden zu t2 Subskalen <strong>des</strong> SAA (Martin et al. 1980) <strong>und</strong> berufliche<br />
Belastungen aus dem Ges<strong>und</strong>heits-Survey (Bellach et al. 1998) erhoben<br />
(n=316). Die Ergebnisse <strong>des</strong> SAA (Martin et al. 1980) zur quantitativen <strong>und</strong> qualitativen<br />
Überforderung bestätigen dabei berufliche Belastungen. Die auf einer 5-stufigen<br />
Skala (1=nie – 5=immer) zu bewertenden Bereiche zeigen auf der Skalenebene im<br />
Mittel eine quantitative Überforderung von 2,82 (SD .94) <strong>und</strong> eine qualitative Überforderung<br />
von 2,22 (SD .88).<br />
Die Ergebnisse zu beruflichen Belastungen aus dem Ges<strong>und</strong>heits-Survey (Bellach et<br />
al. 1998) beschreiben berufliche Belastungen (MW > 2,50) insbesondere in den Bereichen<br />
„Konzentration“, „Lärm“, „hohe Verantwortung für Menschen“, „schnelle Entscheidungen“,<br />
„widersprüchliche Anweisungen“ <strong>und</strong> „einseitige Belastung“. Daneben<br />
spielen Arbeitsbedingungen eine Rolle, die im Kontext der Erkrankung <strong>und</strong> damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Allergien als schädlich angenommen werden müssen: Gase, Schadstoffpartikel,<br />
Allergene, Hitze-Kälte-Nässe, schwere Arbeit (vgl. Tab. A2 im Anhang).<br />
Die weitere berufliche Perspektive wurde zu t2 durch die Erfassung von krankheitsbezogenen<br />
beruflichen Sorgen abgebildet. Als Gr<strong>und</strong>lage dienten hierzu diejenigen<br />
316 Patienten, die zu t1 <strong>und</strong> t2 berufstätig waren. Bei den jeweils vorgegebenen<br />
einzustufenden Bereichen (1=nie – 4=immer) geben insgesamt zwei Drittel der Berufstätigen<br />
krankheitsbedingte Sorgen <strong>und</strong> Befürchtungen an. Am häufigsten (55,8<br />
%) wird von den Patienten die Befürchtung genannt, wegen <strong>des</strong> Ges<strong>und</strong>heitszustands<br />
vorzeitig berentet zu werden. Insgesamt haben ungefähr zwei Drittel der Patienten<br />
zumin<strong>des</strong>t gelegentlich Sorgen, aufgr<strong>und</strong> ihres Ges<strong>und</strong>heitszustands Einbußen<br />
im Berufsleben hinnehmen zu müssen (vgl. Abb. 20).<br />
Sorgen um weitere berufliche Perspektive<br />
Abbildung 20 (n=316)<br />
vorzeitige Berentung<br />
schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten<br />
geringerer Verdienst<br />
schlechterer Arbeitsplatz<br />
Arbeitslosigkeit<br />
35,6<br />
34,5<br />
42<br />
40,6<br />
55,8<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
t2 in %<br />
Zur Abbildung möglicher Gründe zur Frühberentung <strong>und</strong> deren Erleben wurden<br />
diejenigen Patienten, die jemals einen Antrag hierzu gestellt haben <strong>und</strong> diejenigen,<br />
die frühberentet sind (vgl. Abb. 11) einbezogen. Auf jeweils 5-stufigen-Skalen (1=gar<br />
nicht – 5=sehr stark) wurden hierzu Bereiche zur Einschätzung vorgegeben.<br />
52
Wie Abbildung 21 zeigt, liegen die Gründe zur Antragstellung vorwiegend in der verminderten<br />
Leistungsfähigkeit (86,9 %), dem körperlichen Befinden (79,3 %), der<br />
Angst vor Verschlimmerung der Erkrankung (55,3 %) <strong>und</strong> dem Rat <strong>des</strong> behandelnden<br />
Hausarztes (50,5 %). Bei etwa einem Viertel der Befragten spielen daneben die<br />
Familie <strong>und</strong> der Arbeitgeber sowie der Wunsch, mehr vom Leben haben zu wollen,<br />
eine Rolle (vgl. Tab. A3 im Anhang).<br />
Begründung der Frühberentung/Antragstellung<br />
Begründung:<br />
verminderte Leistungsfähigkeit<br />
körperliches Befinden<br />
Verschlimmerung Krankheit<br />
Hausarzt<br />
Partner/Familie<br />
mehr vom Leben haben<br />
Arbeitgeber<br />
Alter<br />
kein geeigneter Arbeitsplatz<br />
Probleme Arbeit zu finden<br />
geringere finanzielle Einbuße<br />
Kollegen<br />
Erleben:<br />
freie Einteilung <strong>des</strong> Tages<br />
fühle mich entlastet<br />
anderen Dingen widmen<br />
wünsche, wieder arbeiten<br />
Kollegenkontakt fehlt<br />
vermisse gewohnten Tagesablauf<br />
fühle mich nutzlos<br />
fehlende Tagesstruktur<br />
Abbildung 21 (n=144)<br />
Erleben der Berentung<br />
29,6<br />
26,2<br />
24<br />
15,1<br />
14,6<br />
12,6<br />
7,2<br />
6,1<br />
9,4<br />
8,5<br />
7,8<br />
3<br />
1,2<br />
55,3<br />
50,5<br />
71,5<br />
66,3<br />
64,3<br />
86,9<br />
79,3<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Gründe (%) Erleben (%)<br />
Der überwiegende Teil erlebt die vorzeitige Berentung positiv. Dies betrifft die freie<br />
Einteilung <strong>des</strong> Tages (71,5 %), das Gefühl der Entlastung (66,3 %) <strong>und</strong> die Möglichkeit,<br />
sich auch wieder anderen Dingen widmen zu können (64,3 %). Für einen relativ<br />
geringen Teil ist die Berentung eher belastend. Dies betrifft vorwiegend den Wunsch,<br />
wieder arbeiten zu können (9,5 %), den fehlenden Kontakt zu Kollegen (8,5 %) <strong>und</strong><br />
das Vermissen <strong>des</strong> gewohnten Tagesablaufes (7,8 %).<br />
4.1.4. Psychosoziale Stichprobenmerkmale<br />
Die bisherige Darstellung der somatischen <strong>und</strong> funktionalen Stichprobenmerkmale<br />
beinhaltet in Teilbereichen bereits psychosoziale Belastungen, die in Verbindung mit<br />
der Erkrankung <strong>und</strong> deren Verlauf von Bedeutung sind. In diesem Teilabschnitt soll<br />
insbesondere auf die Ausprägung von psychischer Komorbidität (Angst <strong>und</strong> Depression),<br />
die Wahrnehmung <strong>und</strong> das Erleben asthmatischer Symptome, Strategien zur<br />
Krankheitsbewältigung <strong>und</strong> unterschiedliche Aspekte der Lebensqualität eingegangen<br />
werden. Die Darstellungen beziehen sich überwiegend auf die Skalen der eingesetzten<br />
Instrumente. Die Ausprägung der einzelnen Items wird im Tabellenanhang<br />
dargestellt.<br />
Zur Erfassung der persönlichkeitsbezogenen Angst <strong>und</strong> Depression wurden die<br />
Subskalen „Angst“ <strong>und</strong> „Depression“ <strong>des</strong> Brief-Symptom-Inventory (BSI) von Derogatis<br />
et al. (1973) eingesetzt, welche in einer Selbsteinschätzung symptomatischen<br />
Distress misst (1=überhaupt nicht – 5=sehr stark). Die Reliabilitäten sind sowohl bei<br />
53
der Skala Depression (t1: .85, t2: .91) als auch bei der Skala Angst (t1: .82, t2: .85)<br />
zufriedenstellend hoch.<br />
Die Skalenmittelwerte der Erhebung zu t1 fallen relativ gering aus, belegen jedoch die<br />
Bedeutung der Angst <strong>und</strong> der Depression für einen nicht zu unterschätzenden Teil<br />
der Befragten (vgl. Abb. 22). Zu t2 zeigen sich in beiden Skalen Anstiege, die für die<br />
Skala Depression signifikant sind (t=3,15, df=252, p
Die Subskalen weisen zu t1 eine hinreichende Reliabilität zwischen .85 – .92 auf. Zu<br />
t2 sind dies zwischen .91 – .93. Lediglich Subskala „Hyperventilationssymptome“<br />
weist zu beiden Zeitpunkten geringere Werte auf (t1 .66, t2 .73). Die Mittelwerte der<br />
ASL-Subskalen zu t1 <strong>und</strong> t2 sind in Abbildung 23 dargestellt, für die Einzelitems wird<br />
auf Tabelle A5 im Anhang verwiesen.<br />
obstrukt. Atembeschwerden<br />
Abbildung 23 (n=286)<br />
Asthma-Symptom-Liste<br />
Müdigkeit<br />
nervöse Ängstlichkeit<br />
ärgerliche Gereiztheit<br />
Hyperventilation<br />
1,93<br />
2,19<br />
2,26<br />
2,16<br />
2,1<br />
2,34<br />
3<br />
2,84<br />
2,97<br />
3,45<br />
1 2 3 4 5<br />
MW t1 MW t2<br />
Die höchsten Werte zeigen sich mit 3,00 bzw. 3,45 für beide Messzeitpunkte in der<br />
Skala „obstruktive Atembeschwerden“ <strong>und</strong> mit 2,84 bzw. 2,97 in der Skala „Müdigkeit“,<br />
die physiologisch eng mit der Skala „Hyperventilation“ verknüpft ist. Auffallend<br />
sind für beide Messzeitpunkte die relativ geringen Werte in der Skala „nervöse<br />
Ängstlichkeit“. Zahlreiche Studien belegen die Bedeutung dieser krankheitsbezogenen<br />
Angst für das Krankheitsmanagement (Deter 1985, Kaiser 1994, Kaiser et al.<br />
1997). Eine gute Krankheitsprognose weisen Patienten mit mittleren Werten in der<br />
Gr<strong>und</strong>angst (vgl. BSI, Abb. 22) <strong>und</strong> hohen Werten in der asthmaspezifischen Angst<br />
auf. Sie achten ängstlich <strong>und</strong> nervös auf ihre Symptome <strong>und</strong> bewerten bereits geringfügige<br />
Obstruktionen als Hinweis (Signalfunktion der Angst) auf eine asthmatische<br />
Krise. Insgesamt jedoch sind sie gegenüber beängstigenden Ereignissen im<br />
Leben eher ausgeglichen <strong>und</strong> ruhig.<br />
Im Vergleich der Skalenveränderungen (t1/t2) zeigt sich ein signifikanter Anstieg der<br />
Skala „Atembeschwerden“ (t=7,07, df=224, p
Zur Abbildung der vielfältigen <strong>und</strong> unterschiedlichen Strategien der Krankheitsverarbeitung<br />
im Krankheitsprozess wurde der Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung<br />
(FKV) von Muthny (1989) in der Kurzform verwendet. Hierbei sollten die<br />
Patienten die vorgegebenen 35 Strategien auf einer fünfpoligen Skala (1=gar nicht –<br />
5=sehr stark zutreffend) angeben. Als Bezugszeitraum wurden dabei jeweils die letzten<br />
6 Monate vor der Befragung vorgegeben.<br />
Auf der Basis der Items stehen Compliance bezogene Strategien, die Vertrauenssetzung<br />
in den Arzt <strong>und</strong> der eigene Kampfgeist zu beiden Messzeitpunkten in der Rangreihe<br />
an oberster Stelle (vgl. Abb. 24). Es fällt auf, dass zu t1 <strong>und</strong> t2 - lediglich mit geringen<br />
Verschiebungen - die gleichen Bewältigungsstrategien im Vordergr<strong>und</strong> stehen.<br />
Die weiteren Ergebnisse der Einzelbereiche sind aus Tabelle A6 im Anhang ersichtlich.<br />
Da die in der Rangreihe führenden Strategien „Compliance“ <strong>und</strong> „Vertrauenssetzung<br />
in den Arzt“ keiner Skala zugeordnet werden können (vgl. Muthny 1989),<br />
sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Unterschiede zwischen t1 <strong>und</strong> t2<br />
statistisch nicht bedeutsam sind.<br />
Strategien zur Krankheitsverarbeitung (FKV)<br />
Rangplätze 1-10<br />
Compliance<br />
Vertrauen in den Arzt<br />
Kampfgeist entwickeln<br />
Selbstermutigung<br />
aktive Problemlösung<br />
Anderen Gutes tun<br />
intensiver leben<br />
Informationssuche<br />
Erfolge/Selbstbestätigung<br />
Ablenkung<br />
Abbildung 24 (n=553)<br />
4,1<br />
3,85<br />
3,75<br />
3,52<br />
3,39<br />
3,36<br />
3,28<br />
3,27<br />
3,22<br />
3,21<br />
4,08<br />
3,77<br />
3,56<br />
3,43<br />
3,24<br />
3,26<br />
3,26<br />
2,93<br />
3,2<br />
3,07<br />
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5<br />
MW t1 MW t2<br />
Die nachfolgende Darstellung basiert auf den festgelegten Skalen <strong>des</strong> FKV-Manuals.<br />
Die Überprüfung der Reliabilität zu t1 weist Werte zwischen .61 <strong>und</strong> .76 auf. Zu t2 waren<br />
diese mit Werten zwischen .64 <strong>und</strong> .76 vergleichbar.<br />
Die Ergebnisse der FKV-Subskalen sind in der Rangfolge <strong>und</strong> ihren Ausprägungen<br />
für die beiden Messzeitpunkte (t1 <strong>und</strong> t2) in Abbildung 25 ersichtlich. Zu beiden Messzeitpunkten<br />
stehen auf der Basis der Skalenmittelwerte aktive, problemorientierte<br />
Strategien (t1 3,31/t2 3,19) sowie Strategien im Bereich der Ablenkung <strong>und</strong> Selbstermutigung<br />
(t1 3,07/t2 3,06) im Vordergr<strong>und</strong>. Neben diesen, in verschiedenen Studien<br />
für die Krankheitsbewältigung <strong>und</strong> den Krankheitsverlauf als adaptiv beschriebenen<br />
Skalen, sind die Mittelwerte der als maladaptiv geltenden Skalen der Bagatellisierung<br />
(t1 2,26/ t2 2,15) <strong>und</strong> der depressiven Verarbeitung (t1 2,04/ t2 1,96) zu beiden Messzeitpunkten<br />
geringer ausgeprägt.<br />
56
Statistisch signifikante Unterschiede ergeben sich im Vergleich der Messzeitpunkte<br />
in den Subskalen „aktives Coping“ t=3,28, df=463, p
Die Mittelwerte wurden darüber hinaus mit den Normdaten für deutsche Personen<br />
mit chronischen Lungenerkrankungen aus dem Handbuch <strong>des</strong> SF-36 verglichen. Sowohl<br />
bei der psychischen als auch bei der körperlichen <strong>Summenskala</strong> reihen sich die<br />
Mittelwerte der vorliegenden Stichproben zu t1 <strong>und</strong> t2 unterhalb <strong>des</strong> 50. <strong>und</strong> oberhalb<br />
<strong>des</strong> 25. Perzentils ein. Die Abweichung gegenüber dem im Manual angegebenen<br />
Mittelwert beträgt bei der körperlichen <strong>Summenskala</strong> ca. 25 % einer Standardabweichung,<br />
die Abweichung der psychischen <strong>Summenskala</strong> liegt bei ca. 41 % einer Standardabweichung.<br />
Auch unter Beachtung der unterschiedlichen Verteilung von Geschlecht<br />
<strong>und</strong> Alter (Normstichprobe vs. untersuchte Stichprobe) kann angenommen<br />
werden, dass die vorliegende Stichprobe im Vergleich zur Normstichprobe stärkere<br />
körperliche <strong>und</strong> psychische Beeinträchtigung aufweist.<br />
Zur weiteren Beschreibung von Teilbereichen der Lebensqualität wurde zu beiden<br />
Messzeitpunkten das Lebenszufriedenheitsinventar (LZI) von Muthny (1990) eingesetzt.<br />
Hierbei werden wesentliche Lebensbereiche von den Patienten hinsichtlich ihrer<br />
Zufriedenheit auf einer fünfstufigen Skala (1=sehr zufrieden – 5=sehr unzufrieden)<br />
bewertet.<br />
Die in Abbildung 27 für t1 <strong>und</strong> t2 dargestellte Rangfolge <strong>und</strong> Verteilung der Mittelwerte<br />
zeigt (vgl. Tab. A7 im Anhang), dass zu beiden Messzeitpunkten die höchste Zufriedenheit<br />
in den familiären Lebensbereichen (Kinder, Familie, Partnerschaft) angegeben<br />
wurde, gefolgt von Auffassungen über die eigene Person (Charakter, geistige<br />
Verfassung, Fähigkeiten) sowie den Sozialkontakten. Die höchste Unzufriedenheit<br />
ergibt sich bei beiden Messzeitpunkten in den Bereichen der Ges<strong>und</strong>heit, der körperlichen<br />
Verfassung <strong>und</strong> dem bisherigen Behandlungserfolg.<br />
Aspekte der Lebensqualität (LZI)<br />
Verhältnis eigene Kinder<br />
Familienleben<br />
Ehe/Partnerschaft<br />
Charakter<br />
Sozialkontakte<br />
geistige Verfassung<br />
finanzielle Lage<br />
Fähigkeiten<br />
Freizeitgestaltung<br />
Stimmung<br />
berufliche Situation<br />
Aussehen<br />
Sexualleben<br />
bisheriger Behandlungserfolg<br />
körperliche Verfassung<br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
Lebenszufriedenheit insgesamt<br />
Abbildung 27 (n=553)<br />
1,9<br />
2<br />
2,01<br />
2,07<br />
2,1<br />
2,15<br />
2,3<br />
2,3<br />
2,45<br />
2,47<br />
2,5<br />
2,53<br />
2,56<br />
2,63<br />
3,03<br />
3,29<br />
2,22<br />
1,96<br />
2,77<br />
2,06<br />
2,11<br />
2,23<br />
2,08<br />
2,42<br />
2,32<br />
2,45<br />
2,51<br />
2,47<br />
2,57<br />
2,66<br />
2,47<br />
2,95<br />
2,94<br />
2,21<br />
5 4 3 2 1 2 3 4 5<br />
MW t1 MW t2<br />
Statistisch signifikante Veränderungen zwischen t1 <strong>und</strong> t2 ergeben sich für wenige<br />
Lebensbereiche. Zufriedener sind die Befragten zu t2 mit ihrer Ges<strong>und</strong>heit (t=5,64,<br />
df=472, p
Zur abschließenden Beschreibung der psychosozialen Stichprobenmerkmale werden<br />
nachfolgend Überzeugungen bezüglich <strong>des</strong> weiteren Krankheitsverlaufes <strong>und</strong> möglicher<br />
Einflüsse hierauf beschrieben.<br />
Die Erwartungen über den weiteren Verlauf der Erkrankung sind insgesamt eher negativ.<br />
Ein Drittel (33,1 %) der Befragten geht in der Entwicklung von einer Verschlechterung<br />
aus <strong>und</strong> die Hälfte (51,3 %) glaubt, dass es wie bisher bleiben wird.<br />
Lediglich 15,5 % der Stichprobe glaubt, dass sich die Erkrankung im Verlauf verbessern<br />
wird (MW 2,84, SD .86).<br />
Zur Abbildung von Einflussgrößen auf den Krankheitsverlauf wurde der Fragebogen<br />
zu erkrankungsbezogenen Kontrollattributionen (EKOA) von Muthny (1990) eingesetzt.<br />
In diesem, im Kontext der Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebensqualität relevanten<br />
Inventar, werden den Befragten unterschiedliche Faktoren für den weiteren<br />
Krankheitsverlauf vorgegeben, die von ihnen entsprechend ihrer Auffassung auf einer<br />
fünfstufigen Skala (1=gar nicht – 5=sehr stark) zu bewerten sind. Da dieses Instrument<br />
zu t1 nur in einer Teilstudie eingesetzt wurde, beschränkt sich die folgende<br />
Ergebnisdarstellung auf den zweiten Messzeitpunkt.<br />
Faktoren für den weiteren Krankheitsverlauf<br />
eigenes Verhalten<br />
eigene Lebenseinstellung<br />
Fortschritte Medizin<br />
Umweltfaktoren<br />
Konfliktmanagement<br />
familiäre Unterstützung<br />
Stress/Hetze <strong>des</strong> Lebens<br />
Umgang mit Krankheit<br />
Engagement Ärzte<br />
berufliche Sorgen/Belastungen<br />
Können der Ärzte<br />
familiäre Sorgen<br />
körperliche Veranlagung<br />
psychische Fakoren<br />
Selbstansprüche<br />
Naturheilverfahren<br />
Schicksal<br />
Zufall<br />
Gestirne/Erdstrahlen<br />
Abbildung 28 (n=553)<br />
6,3<br />
4,2<br />
22,8<br />
14,3<br />
63<br />
60,9<br />
60,1<br />
59,6<br />
57,8<br />
57,3<br />
54,6<br />
51,2<br />
45,7<br />
41,5<br />
40<br />
33,5<br />
75,8<br />
74,9<br />
70,3<br />
0 20 40 60 80 100<br />
t2 in %<br />
Wesentliche Faktoren für den weiteren Verlauf sind dabei vor allem das eigene Verhalten<br />
(75,8 %), die eigene Lebenseinstellung (74,9 %) <strong>und</strong> erhoffte Fortschritte in<br />
der Medizin (70,3 %) (vgl. Abb. 28 <strong>und</strong> Tab. A8 im Anhang). Neben der Rolle der mit<br />
den Atemwegserkrankungen verb<strong>und</strong>enen Allergien <strong>und</strong> der Bedeutung psychischer<br />
Faktoren im Rahmen der Atemwegssymptomatik werden daneben vorwiegend Umweltfaktoren<br />
(63 %) <strong>und</strong> unterschiedliche Belastungen genannt. Demgegenüber haben<br />
irrationale Überzeugungen (Schicksal, Zufall, Gestirne/Erdstrahlen) für nur wenige<br />
Befragte eine Bedeutung.<br />
59
4.1.5. Behandlungsbezogene Stichprobenmerkmale<br />
Die meisten Patienten waren bereits zu t1 mehrfach in der Hochgebirgsklinik<br />
(MW=3,14 ±2,9). Bei lediglich 36,3 % handelte es sich um den ersten Aufenthalt. Die<br />
Kostenübernahme <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes verteilt sich in etwa gleich auf die Rentenversicherung<br />
(BfA 36 %, LVA 8,5 %) <strong>und</strong> die gesetzliche (GKV 31,1 %) <strong>und</strong> private<br />
(PKV 22,8 %) Krankenversicherung.<br />
Zum Zeitpunkt der Erstbefragung gaben 80,2 % der Patienten an, schon einmal an<br />
einer Rehabilitationsmaßnahme teilgenommen zu haben. In dem zwischen t1 <strong>und</strong> t2<br />
vergangenen Zeitraum von etwas mehr als 5 Jahren haben insgesamt 40,4 % der<br />
Befragten einen Wiederholungsantrag gestellt.<br />
Diejenigen Befragten, die keinen Antrag gestellt haben, begründen dies zu 30,2 %<br />
mit dem günstigen Krankheitsverlauf, fehlender Unterstützung durch ihren behandelnden<br />
Arzt (14,8 %) <strong>und</strong> aus einem Antrag entstehenden Problemen mit dem Arbeitgeber<br />
bzw. den Kollegen (14,1 %). Ein fehlender Erfolg der letzten Rehabilitationsmaßnahme<br />
wird nur von 5,6 % als Begründung angeführt (vgl. Abb. 29).<br />
Gründe für fehlende Antragstellung zur<br />
Rehabilitation<br />
vom Krankheitsverlauf nicht notwendig<br />
fehlende Unterstützung Arzt<br />
Probleme am Arbeitsplatz<br />
Zuzahlung/Urlaub schreckt ab<br />
Abbildung 29 (n=553)<br />
fehlender Erfolg<br />
5,6<br />
11,4<br />
14,8<br />
14,1<br />
30,2<br />
0 5 10 15 20 25 30 35<br />
Angaben in % (t2)<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der beschriebenen Versorgungssituation pneumologischer Erkrankungen<br />
(vgl. Abschnitt 1.3) <strong>und</strong> den bisher dargestellten somatischen, funktionalen<br />
<strong>und</strong> psychosozialen Stichprobenmerkmalen, stellt sich die Frage, welche Beratungs-<br />
<strong>und</strong> Hilfsangebote aus Sicht der Betroffenen notwendig sind, um die Folgen<br />
der chronischen Erkrankung zu mindern.<br />
Hierbei stehen aus Sicht der Befragten zu t2 neben Arztvorträgen zu krankheitsbezogenen<br />
Themen (71,4 %), insbesondere auch Hilfs- <strong>und</strong> Beratungsangebote zu Bereichen<br />
<strong>des</strong> Projektes im Vordergr<strong>und</strong> (Beratung zur Umschulung <strong>und</strong> bei Arbeitsplatzproblemen<br />
mit 61 %, Beratung im Rahmen von Rentenfragen mit 52,2 %). Daneben<br />
werden psychologisch/psychotherapeutische Angebote (45,9 %), Gesprächsgruppen<br />
mit Ärzten (37,7 %) oder Psychologen (32,8 %) <strong>und</strong> Lungensportgruppen (37,1 %)<br />
60
genannt. Selbsthilfegruppen spielen im Kontext von Beratungs- <strong>und</strong> Hilfsangeboten<br />
eine geringere Rolle (20,8 %) (vgl. Abb. 30).<br />
Notwendige Beratungs- <strong>und</strong> Hilfsangebote<br />
Arztvorträge<br />
Umschulung, Arbeitsplatz<br />
Rentenfragen<br />
Psychologe/Psychotherapeut<br />
Gruppen mit Arzt<br />
Sportgruppen<br />
Gruppen mit Psychologen<br />
Selbsthilfegruppen<br />
Abbildung 30 (n=553)<br />
20,8<br />
32,8<br />
37,7<br />
37,1<br />
45,9<br />
52,2<br />
61<br />
71,4<br />
0 20 40 60 80<br />
Die Bedeutung von notwendigen Beratungs- <strong>und</strong> Hilfsangeboten im beruflichen Bereich<br />
zieht die Frage nach sich, wer diese Hilfen aus Sicht der Betroffenen leisten<br />
könnte. Hierzu wurden mögliche Personen bzw. Beteiligte in der Versorgungskette<br />
mit der Bitte vorgegeben, mögliche Hilfen <strong>und</strong> das Ausmaß der erhaltenen Hilfe auf<br />
einer fünfstufigen Skala (1=gar nicht – 5=sehr gut) zu bewerten.<br />
Abbildung 31 (n=408)<br />
Hilfen im beruflichen Umfeld<br />
Arzt<br />
Familie/Partner<br />
Betriebsarzt<br />
Rehaberater Krankenkasse<br />
Vertrauensperson Schwerbehinderung<br />
Mitbetroffene<br />
Psychotherapeut/Psychologe<br />
Selbsthilfegruppe<br />
Sachbearbeiter Krankenkasse<br />
Sachbearbeiter Rentenversicherung<br />
Vorgesetzte<br />
Berater Arbeitsamt<br />
Kollegen<br />
44,1<br />
17,4<br />
42,9<br />
13,6<br />
40,4<br />
16,9<br />
32,2<br />
23<br />
31,8<br />
17<br />
31,2<br />
4,1<br />
28,8<br />
23,7<br />
27,3<br />
16,2<br />
26,2<br />
15,6<br />
22,3<br />
8,3<br />
14,9<br />
15,6<br />
73,2<br />
71<br />
72,1<br />
69,2<br />
0 20 40 60 80 100<br />
könnte helfen in % hat geholfen %<br />
Die in Abbildung 31 dargestellten Sichtweisen <strong>und</strong> Erfahrungen der Befragten zeigen<br />
eindrücklich, dass Hilfen im beruflichen Bereich vorwiegend vom Arzt (73,2 %) <strong>und</strong><br />
der Familie/Partnerschaft (72,1 %) erwartet <strong>und</strong> von diesen auch vorwiegend geleistet<br />
werden (71 % bzw. 69,2 %). Daneben werden von etwa 40 % der Befragten der<br />
61
Betriebsarzt (44,1 %), der Rehaberater der Krankenkasse (42,9 %) <strong>und</strong> die betriebliche<br />
Vertrauensperson für Schwerbehinderte (40,4 %) genannt. Die im konkreten Fall<br />
erhaltene Hilfe wird jedoch als gering eingeschätzt. Alle anderen, insbesondere auch<br />
dafür zuständige Bereiche, spielen bei beiden Aspekten eine deutlich geringe Rolle.<br />
Die nachfolgende Beschreibung der in Anspruch genommenen Angebote in der<br />
pneumologischen Versorgung verdeutlich die große Diskrepanz zwischen Notwendigkeit,<br />
insbesondere auch unter rehabilitativen Aspekten <strong>und</strong> der realen Wirklichkeit<br />
(vgl. Abb. 32).<br />
ambulante med. Behandlung:<br />
Allgemeinmediziner<br />
Lungenfacharzt<br />
Internist<br />
Orthopäde<br />
Gynäkologe<br />
Dermatologe<br />
Urologe<br />
Neurologe/Psychiater<br />
Psychotherapeut<br />
Mitglied in Gruppen:<br />
Selbsthilfegruppe<br />
Lungensportgruppe<br />
Osteoporosegruppe<br />
Atemtherapiegruppe<br />
Sonstige in letzten 5 Jahren:<br />
Naturheiler<br />
psychosoz. Beratungsstelle<br />
ambulante Schulungsgruppe<br />
Psychotherapeut<br />
psychosomatische Klinik<br />
Abbildung 32 (n=553)<br />
Versorgungsstruktur<br />
7,3<br />
5,2<br />
6,9<br />
2,3<br />
1,9<br />
1,7<br />
8,8<br />
8,8<br />
4,2<br />
3,3<br />
13,4<br />
35,1<br />
28,7<br />
25,9<br />
30,7<br />
42,9<br />
53,1<br />
62,7<br />
0 20 40 60 80<br />
Angaben in %<br />
Die ärztliche Versorgung der Patienten erfolgt – bezogen auf die letzten 6 Monate<br />
vor der Befragung zu t2 - primär durch Allgemeinmediziner (63,7 %), Lungenfachärzte<br />
(53,1 %) <strong>und</strong> Internisten (42,1 %). Daneben werden von den Befragten (MfN)<br />
im Rahmen der beschriebenen Multimorbidität <strong>und</strong> der individuellen Ges<strong>und</strong>heitssituation<br />
vorwiegend Behandlungen bei Orthopäden (35,1 %), Gynäkologen (28,7 %)<br />
<strong>und</strong> Dermatologen (25,9 %) angegeben. Zu beiden Messzeitpunkten werden nur etwa<br />
die Hälfte der Befragten von Lungenfachärzten behandelt (t1 52,3 %, t2 53,1 %).<br />
Die Inanspruchnahme von insbesondere in der Nachsorge <strong>und</strong> der ambulanten Rehabilitation<br />
bedeutsamen Angeboten findet bei der untersuchten Stichprobe mehr<br />
oder minder nicht statt. Dies betrifft den Lungensport (2,3 %), die Atemtherapie (2,3<br />
%) <strong>und</strong> neben psychosozialen Angeboten insbesondere auch die ambulante Schulung<br />
(8,8 %). Dagegen fällt – bezogen auf die letzten 5 Jahre – ein deutlich hoher<br />
Anteil (30,7 %) an Behandlungen durch Naturheiler auf. Mögliche Gründe für diese<br />
Situation können im Bedarf oder auch der Motivation der Befragten liegen. Aufgr<strong>und</strong><br />
der vielfach beschriebenen pneumologischen Unterversorgung in Deutschland<br />
(Sachverständigengutachten 2001, 2003, Kaiser 1998a) ist jedoch hierfür die fehlende<br />
flächendeckende Versorgung mit Angeboten dieser Art der wesentliche Gr<strong>und</strong>.<br />
Trotz dieser Situation sind insgesamt 59,8 % der Befragten mit der regionalen pneumologischen<br />
Versorgung zufrieden. Abstriche machen 24,8 % <strong>und</strong> unzufrieden sind<br />
insgesamt 15,3 %.<br />
62
Wesentliches Kriterium zur Bewertung von medizinischen Maßnahmen <strong>und</strong> damit<br />
auch der Rehabilitation ist die Entwicklung der mit der Krankheit <strong>und</strong> ihren Folgen<br />
verb<strong>und</strong>enen Kosten. Die Entwicklung der kostenrelevanten Variablen, jeweils bezogen<br />
auf die letzten 6 Monate vor Klinikaufnahme (t1) bzw. 6 Monate vor Nachbefragung<br />
(t2) für einen Zeitraum von über 5 Jahren ist in Abbildung 33 dargestellt.<br />
• Die Anzahl der notwendigen Arztbesuche hat sich zwischen t1 <strong>und</strong> t2 von insgesamt<br />
4277 auf 3269 signifikant reduziert (n=471, t1: MW 9,08 ± 12,2, t2: MW 6,94<br />
± 8,96, t=3,54, df=470, p 5 Jahre nach Entlassung<br />
Arztbesuche<br />
Krankenhaus<br />
Krankenhaustage<br />
Notarzt<br />
Notaufnahmen Klinik<br />
Intensivstation<br />
Bezugszeitraum jeweils 6 Monate<br />
Abbildung 33 (n=553)<br />
10<br />
8<br />
4,277<br />
6<br />
4<br />
in Tausend<br />
1,525<br />
0,152<br />
0,214<br />
0,104<br />
0,055<br />
2<br />
0,129<br />
0,124<br />
0,06<br />
0,061<br />
1,213<br />
3,269<br />
0 2 4 6 8 10<br />
in Tausend<br />
***<br />
**<br />
vor Aufnahme > 5 Jahre nach Entlassung<br />
Der Vergleich der notwendigen Notfallmaßnahmen zu t1 <strong>und</strong> t2 zeichnet ein ähnliches<br />
Bild:<br />
• Zu t1 mussten 23,1 % der Stichprobe den Notarzt in Anspruch nehmen, zu t2 traf<br />
dies auf nur noch 14,7 % der Patienten zu (n=376, t1: MW .57 ± 1,3 t2: MW .33 ±<br />
1,2, t=3,04, df=375, p
Insgesamt unterstreichen sie die Relevanz <strong>und</strong> die Effizienz von Rehabilitationsbehandlungen.<br />
Die Entwicklung der kostenrelevanten Variablen über einen Zeitraum<br />
von über 5 Jahren nach Entlassung aus der Klinik belegt zudem deren ökonomischen<br />
Nutzen.<br />
4.2. Vorhersage der Frühberentung<br />
In diesem Teil der Berichterstattung soll versucht werden, die zweite Fragestellung<br />
<strong>des</strong> Projektes zu beantworten. Diese beschäftigt sich mit der Frage, ob <strong>und</strong> welche<br />
Risikoprofile zur Frühberentung bzw. der Gefährdung hierzu sich aus den vorliegenden<br />
Daten ableiten lassen.<br />
Wie im Abschnitt zur Forschungsmethodik beschrieben (vgl. 3.4.), setzt sich die Ausgangsstichprobe<br />
aus 3 verschiedenen Studien zusammen, die unterschiedliche Fragestellungen<br />
hatten. Dementsprechend wurden in Teilbereichen unterschiedliche<br />
Instrumente eingesetzt. Bei der Auswahl der Instrumente für die Nachbefragung<br />
wurde einerseits versucht, die Empfehlungen der Arbeitsgruppe ‚Generische Methoden’,<br />
‚Routinedaten’ <strong>und</strong> ‚Reha-Ökonomie’ (VDR 1999) zu berücksichtigen, andererseits<br />
jedoch auch die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten.<br />
Dies hat unter Einbeziehung der Gruppenbildungen (vgl. Abb. 34) zur Folge, dass in<br />
Teilbereichen keine vergleichbaren Daten vorliegen, so dass diese aufgr<strong>und</strong> der hierdurch<br />
reduzierten Fallzahlen in der logistischen Regression (bezogen auf den<br />
Messzeitpunkt t1) keine Verwendung finden können.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurde im zweiten Schritt versucht, unter Einbeziehung der gleichen<br />
Gruppenbildung (vgl. Abb. 34) Prädiktoren zur Vorhersage der Frühberentung<br />
auf der Basis der Nachbefragung abzuleiten. Hierzu wurden die vorliegenden Daten<br />
einer univariaten Analyse unterzogen (vgl. Tab A9 im Anhang). Die sich als signifikant<br />
unterschiedlich erwiesenen Variablen wurden anschließend in diesem zweiten<br />
Schritt für die logistische Regression verwendet.<br />
4.2.1. Vorhersage der Frühberentung bezogen auf Messzeitpunkt t1<br />
4.2.1.1. Zusammensetzung der Gruppen <strong>und</strong> vorbereitende Schritte<br />
Hierzu liegen für t1 <strong>und</strong> t2 von jeweils 553 Patienten Datensätze vor (Gesamtstichprobe)<br />
von denen 408 zur Modellbildung verwendet werden konnten. Bezogen auf<br />
das Kriterium „Erwerbsstatus“ sind zu<br />
• t1 433 Befragte berufstätig, 70 frühberentet oder ein entsprechender Antrag wurde<br />
gestellt <strong>und</strong> 50 altersbedingt berentet <strong>und</strong> zu<br />
• t2 sind 322 berufstätig, 144 frühberentet oder ein entsprechender Antrag wurde<br />
gestellt <strong>und</strong> 87 sind altersbedingt berentet (vgl. Abb. 34).<br />
64
Die Einschlusskriterien in die beiden Gruppen sind wie folgt definiert:<br />
• eine zwischen t1 (Ursprungsstichprobe) <strong>und</strong> t2 (Nachbefragung) beantragte oder<br />
ausgesprochene Frühberentung (n=92)<br />
• die Fortsetzung der Berufstätigkeit zu t1 <strong>und</strong> t2 (n=316)<br />
MZP t1<br />
MZP t2<br />
Zusammensetzung der Stichprobe (t1/t2)<br />
Kriterium: Erwerbsstatus<br />
Abbildung 34<br />
t1: im Beruf<br />
t2: im Beruf<br />
433 70 50<br />
Modellbildungsgruppe:<br />
n=408<br />
316 316 + 92 = 408 92<br />
t1: im Beruf<br />
t2: frühberentet/<br />
Antrag Frühberentung<br />
322 144 87<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
aktuell berufstätig Antrag/Frührente Altersrente<br />
Als statistisches Verfahren zur Vorhersage <strong>des</strong> Berentungsrisikos wurde eine<br />
schrittweise logistische Regression nach bedingter Likelihood gewählt. Sie ist in der<br />
Lage, je nach Voreinstellungen durch Ein- oder Ausschließen verschiedener Variablen<br />
eine Modellgleichung zu berechnen, die eine Vorhersage der späteren Gruppenzugehörigkeit<br />
darstellt.<br />
Zur Verbesserung der inhaltlichen Auswertbarkeit wurden verschiedene Indizes gebildet.<br />
Da in den Primärstudien kein allgemeingültiges Maß für die objektive Krankheitsschwere<br />
definiert wurde, wurde auf der Basis der Patientenangaben eine Indexvariable<br />
gebildet, in die die Häufigkeit der Atemnot unter verschiedenen Auslösesituationen,<br />
das Ausmaß der körperlichen Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> die Schwere der Atemnotanfälle<br />
eingingen.<br />
Die Variable „Schwerbehinderung“ ist dichotom. Bei Vorliegen erhält die Variable den<br />
Wert 1, sonst 0. Dieses Merkmal wurde ebenfalls in der logistischen Regression – als<br />
kategoriale Variable – eingesetzt. Als eine weitere kategoriale Variable wurde eine<br />
vereinfachte Form <strong>des</strong> Familienstatus aufgenommen. Dabei wurden die verschiedenen<br />
Formen einer bestehenden Partnerschaft in der Ausprägung „in Bindung“ <strong>und</strong><br />
alle anderen als „nicht in Bindung“ zusammengefasst <strong>und</strong> als Input-Variable verwendet.<br />
Durch diese Reduktion sollte die häufig inhaltlich kaum befriedigende Interpretation<br />
<strong>des</strong> Einflusses einer mehrstufigen kategorialen Einflussvariable vermieden werden.<br />
Als Ausgangsvariablen wurden in der logistischen Regression das Alter, das Geschlecht,<br />
das Vorliegen einer Schwerbehinderung, der Familienstand (vereinfacht),<br />
65<br />
553<br />
553
die Schulbildung (vereinfacht), die Skalen <strong>des</strong> FKV (Bagatellisierung, Depressive<br />
Verarbeitung, problemorientierte Verarbeitung, Ablenkung, Religiosität), das LZI, verschiedene<br />
Behandlungsmerkmale (Arztbesuche, Besuche bei Spezialisten), die subjektive<br />
Einschätzung der Arbeitsfähigkeit, die AU-Zeiten im letzten Jahr zu t1, ein subjektiver<br />
Krankheitsschwereindex <strong>und</strong> die Dauer der Erkrankung zu t1 verwendet.<br />
Die verbleibenden 408 Patienten wurden nach ihrem Erwerbsstatus zu t2 in die oben<br />
beschriebenen Gruppen eingeteilt. Die Antragsteller waren mit 22,5 % (n=92) ausreichend<br />
stark vertreten, um eine Analyse durchführen zu können. Bei nur wenigen Befragten<br />
in dieser Gruppe war der Ausgang <strong>des</strong> Antrags auf Frühberentung unklar (84<br />
ehemalige Patienten waren zu t2 tatsächlich frühberentet <strong>und</strong> nur 8 hatten einen abgelehnten<br />
oder bislang nicht bewilligten Antrag gestellt). Die Gruppe der Nicht-Antragsteller<br />
setzte sich aus n=316 Patienten (77,5 %) zusammen.<br />
Für die statistischen Analysen wurde die Gesamtstichprobe von 408 Patienten<br />
nochmals zufällig im Verhältnis 60:40 in eine Modellbildungsgruppe (n=245) <strong>und</strong> eine<br />
Kreuzvalidierungsgruppe (n=163) unterteilt. Die zufällige Aufteilung der Stichprobe in<br />
zwei Teile erlaubt die Überprüfung <strong>des</strong> mit dem ersten Teil der Stichprobe ermittelten<br />
Modells an ihrem zweiten Teil. Die Effekte einer Stichprobenselektion sind damit<br />
besser vermeidbar <strong>und</strong> die Ergebnisse besser generalisierbar. Das Modell (Modellbildungsgruppe,<br />
60 %) wurde so an einer zweiten Substichprobe validiert (Kreuzvalidierungsgruppe,<br />
40 %).<br />
4.2.1.2. Darstellung der Ergebnisse bezogen auf Messzeitpunkt t1<br />
Zunächst erfolgt die Darstellung der Ergebnisse aus der Modellbildung. In Tabelle 5a<br />
sind diejenigen Variablen mit ihrer jeweiligen Einflussrichtung aufgeführt, die durch<br />
die logistische Regression als bedeutsam ermittelt wurden:<br />
Tabelle 5a: Ergebnisvariablen in der Modellbildungsgruppe<br />
Schritt Variable B* SE(B)* Wald* Sig.* Exp(B)*<br />
1 Alter 0.188 0.034 31.140
Die Modellgüteparameter sind in Tabelle 5b dargestellt.<br />
Tabelle 5b: Modellgüteparameter in der Modellbildungsgruppe<br />
-2LL Cox & Snell R 2 Nagelkerkes R 2<br />
Chi 2<br />
148.634 0.368 0.561 112.307<br />
Die in Tabelle 5a dargestellten Variablen sind von der logistischen Regression als<br />
Prädiktionen zur Vorhersage der Frühberentung ermittelt worden:<br />
• Ein höheres Alter<br />
• Das Vorliegen einer Schwerbehinderung<br />
• Höhere Zufriedenheit mit der Freizeit<br />
• Niedrigere Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit<br />
• Niedrigere Zufriedenheit mit der eigenen Stimmung<br />
• Mehr Besuche bei einem Hausarzt/Allgemeinmediziner<br />
• Weniger/keine Besuche bei einem Pneumologen (Facharzt)<br />
Als Modellgüteparameter wird häufig der OR (odds ratio) angegeben. Dieser gibt das<br />
Verhältnis zweier Risiken an. In diesem Fall sind dies die Risiken, zum einen unter<br />
der Bedingung der Einordnung in die Gruppe der später Frühberenteten auch frühberentet<br />
zu werden <strong>und</strong> zum anderen, bei Einordnung in die Gruppe der später nicht<br />
Frühberenteten später dennoch frühberentet zu werden. Je weiter das Verhältnis<br />
(der Quotient) dieser beiden Risiken von 1 entfernt ist, <strong>des</strong>to besser kann das Modell<br />
die beiden Gruppen trennen. Die 1 würde in diesem Fall bedeuten, dass die Merkmalsausprägungen<br />
der Patienten zu t1 keinerlei Einfluss auf die Entwicklung eines<br />
Interesses an der Frühberentung haben. Die Analyse ergab ein OR von 17.50 (95 %<br />
CI: 8.23 – 37.21). Auch die untere Grenze <strong>des</strong> 95 %-Vertrauensintervalls für die<br />
Grenzen <strong>des</strong> OR liegt deutlich oberhalb der 1. Das Modell kann damit zunächst auf<br />
der Basis der statistischen Kennwerte als brauchbar eingestuft werden.<br />
Das ermittelte Modell wurde in der zweiten Substichprobe einer Überprüfung unterzogen<br />
<strong>und</strong> hier zeigte sich ein OR von 17.35 (95 % CI: 6.61 – 45.54). Das Modell<br />
scheint demnach auch auf andere Stichproben übertragbar zu sein.<br />
Weitere Güteparameter einer logistischen Regression sind die Angaben zur Treffergenauigkeit<br />
der Vorhersage. Hier wurden jeweils für die Modellbildungsgruppe sowie<br />
für die Kreuzvalidierungsgruppe die folgenden Parameter berechnet (vgl. Tab. 5b).<br />
Tabelle 5b: Klassifikationskriterien in den Substichproben <strong>und</strong> bei Zufallsauswahl<br />
Parameter Modellbildung Kreuzvalidierung Zufall<br />
(50:50)<br />
Zufall<br />
(Basisrate)<br />
prädiktiver Wert 68,8 % 71,4 % 22,9 % 22,9 %<br />
Spezifität 92,1 % 93,7 % 50,0 % 76,9 %<br />
Sensitivität 60,0 % 54,1 % 50,0 % 22,9 %<br />
Trefferquote 84,9 % 84,7 % 50,0 % 64,4 %<br />
67
Aus Tabelle 5b wird ersichtlich, dass sich die Ergebnisse der Modellbildungsgruppe<br />
<strong>und</strong> der Kreuzvalidierungsgruppe nicht stark unterscheiden. Wäre ein Stichprobeneffekt<br />
<strong>und</strong> damit ein Indiz gegen die Modellgültigkeit vorhanden, müssten die Ergebnisse<br />
in der Kreuzvalidierungsgruppe deutlich geringer ausfallen, da dort dieselbe<br />
Modellgleichung Verwendung findet wie in der Modellbildungsgruppe, diese jedoch<br />
an Personen getestet wird, die nicht zur Modellbildung verwendet worden sind. Hier<br />
scheint jedoch die Gleichung mit den gef<strong>und</strong>enen Variablen auf die Kreuzvalidierungsgruppe<br />
übertragbar zu sein.<br />
Die verschiedenen Gütekriterien der Klassifikation sollen im folgenden kurz beschrieben<br />
werden. Der prädiktive Wert einer Klassifikation gibt an, wie hoch der Prozentsatz<br />
richtiger Einordnungen der aufgr<strong>und</strong> der Modellgleichung als frühberentet vorausgesagten<br />
Patienten ist. In diesem Fall liegt dieser Wert sowohl in der Modellbildungsgruppe<br />
als auch in der Kreuzvalidierungsgruppe um 70 %. Also lediglich ca. 30<br />
% der als frühberentet Vorhergesagten haben zu t2 keinen Antrag auf Frühberentung<br />
gestellt.<br />
Die Spezifität gibt an, welcher Prozentsatz derjenigen Patienten, die zu t2 keinen Antrag<br />
auf Frühberentung gestellt haben, auch als solche vorausgesagt werden. Hier<br />
liegt der Anteil korrekter Einordnungen jeweils bei über 92 %. In dieser Gruppe kann<br />
die höchste Trefferquote verzeichnet werden.<br />
Ein weiterer Parameter ist die Sensitivität. Sie gibt an, welcher Anteil der späteren<br />
Antragsteller/Frühberenteten auch als solche durch die Modellgleichung vorausgesagt<br />
wurden. Hier liegt der Anteil bei durchschnittlich knapp 60 %. Trotz dieser eher<br />
geringen Sensitivität kann die Modellgleichung als brauchbar angesehen werden, da<br />
beim Vergleich mit auf Zufallsvoraussage basierenden Modellen (sowohl bei 50:50<br />
als auch auf der Gr<strong>und</strong>lage der Basisrate) sich eine stets höhere Güte der verschiedenen<br />
Parameter <strong>des</strong> hier gef<strong>und</strong>enen Modells zeigt.<br />
In der letzten Zeile in Tabelle 5b ist die Gesamttrefferquote aufgeführt. Sie gibt an,<br />
wie hoch der Prozentsatz aller richtig vorhergesagten Fälle an allen Fällen ist (ein<br />
anhand der Anzahl auftretender Fälle gewichteter Mittelwert aus der Sensitivität <strong>und</strong><br />
Spezifität). Mit durchschnittlich ca. 85 % gibt die Gesamttrefferquote Zeugnis über<br />
die Verwendbarkeit der Modellgleichung.<br />
Obwohl für die Gesamtstichprobe der gr<strong>und</strong>sätzliche Einfluss <strong>des</strong> Alters für das Risiko<br />
zur Frühberentung belegt wurde, wurden zusätzliche altersstratifizierte Substichproben<br />
weiteren Analysen unterzogen. Unter Bezugnahme auf die in Abschnitt<br />
1.6. dargestellten Verteilungen der Beschäftigungs- <strong>und</strong> Erwerbsquoten wurden –<br />
trotz künstlich erzeugter Einengung der Streubreite - hierdurch weitere Anhaltspunkte<br />
für die Risikoabschätzung zur Frühberentung bei diesen Gruppen erwartet.<br />
Die in Altersgruppen stratifizierten Substichproben konnten wegen z.T. relativ geringer<br />
Gruppengrößen leider nur teilweise ausgewertet werden, eine Überprüfung der<br />
Modelle mittels Kreuzvalidierung war aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong>sen ebenfalls nicht möglich. Die<br />
im folgenden berichteten Ergebnisse lassen sich demnach lediglich als Hinweise interpretieren.<br />
Die Gesamtstichprobe wurde in drei Altersgruppen unterteilt: bis 44 Jahre, 45 bis 54<br />
Jahre <strong>und</strong> 55 bis 64 Jahre. Für jede dieser Gruppen wurde eine getrennte logistische<br />
68
Regression mit den gleichen Ausgangsbedingungen wie in der Gesamtstichprobe<br />
durchgeführt. In der jüngsten Gruppe (bis 44 Jahre) wurden n=195 Patienten zusammengefasst,<br />
die mittlere (45 bis 54 Jahre) bestand aus n=139 <strong>und</strong> die älteste (ab<br />
55 Jahre) aus n=74 Patienten. In den verschiedenen Gruppen trat das vorherzusagende<br />
Ereignis (Frühberentung oder Antrag) unterschiedlich häufig auf: In der jüngsten<br />
Gruppe waren es 4,1 % (n=8), in der zweiten Gruppe 32,4 % (n=45) <strong>und</strong> in der<br />
ältesten Gruppe 52,7 % (n=39). Diese Verteilung hebt die Bedeutung <strong>des</strong> Alters für<br />
die statistische Vorhersage der Frühberentung hervor.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der geringen Anzahl der Antragsteller/Frühberenteten in der Gruppe bis 44<br />
Jahre <strong>und</strong> der hieraus resultierenden Wahrscheinlichkeit methodischer Artefakte<br />
werden Ergebnisse für diese Gruppe nicht dargestellt.<br />
In der mittleren Altersgruppe (45-54 Jahre) ergeben sich folgende Risikofaktoren zur<br />
Frühberentung (vgl. Tab. 6a, Trefferquote 84,9 %, Sensitivität 75,6 %):<br />
• Vorliegen einer Schwerbehinderung<br />
• Höheres Alter<br />
• Höhere Unzufriedenheit mit dem eigenen Charakter<br />
• Höhere AU-Zeiten<br />
Tabelle 6a: Ergebnisvariablen in der Subgruppe 45 bis 54 Jahre<br />
Schritt Variable B* SE(B)* Wald* Sig.* Exp(B)*<br />
1 Schwerbehinderung 2.419 0.505 22.968
Tabelle 7a: Ergebnisvariablen in der Subgruppe ab 55 Jahre<br />
Schritt Variable B* SE(B)* Wald* Sig.* Exp(B)*<br />
1 Unzufriedenheit mit der Freizeit -2.182 0.606 12.973
Frühberentung nach Altersgruppen<br />
Einfluss Arztbesuche <strong>und</strong> GdB<br />
Arztbesuche gering/kein GdB<br />
Arztbesuche hoch/kein GdB<br />
Arztbesuche gering/GdB<br />
Arztbesuche hoch/GdB<br />
Abbildung 35 (n=408)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5,3<br />
8,5<br />
14,3<br />
12,5<br />
25<br />
40,9<br />
46,7<br />
52,5<br />
44,4<br />
61<br />
67,9<br />
0 20 40 60 80<br />
bis 34 Jahre 35-44 Jahre<br />
45-54 Jahre 55-64 Jahre<br />
Nachfolgend wird versucht, die relevanten Einflussgrößen auf die Frühberentung<br />
durch grobe Vereinfachung (Dichotomisierung) in ein praxistaugliches Modell zu integrieren.<br />
In der Originalgleichung wird für jede Variable ein Gewicht berechnet, mit<br />
dem die Ausprägung der Variable multipliziert werden muss, um zu einem Vorhersagewert<br />
zu kommen. Die Höhe dieses Vorhersagewerts gibt an, ob die betreffende<br />
Person laut der Regressionsgleichung in die Gruppe der später Frühberenteten fallen<br />
wird oder nicht. Je näher dabei der individuelle Wert dem Schwellenwert liegt (häufig<br />
0.5), <strong>des</strong>to unsicherer ist die Entscheidung. Eine Vereinfachung kann dadurch bewerkstelligt<br />
werden, dass für jede als bedeutsam identifizierte Variable eine Dichotomisierung<br />
vorgenommen wird <strong>und</strong> die Ausprägungen der einzelnen Personen mit<br />
dem so definierten Schwellenwert verglichen werden. Liegt die Eigenschaft der Person,<br />
je nach Richtung <strong>des</strong> Einflusses, über bzw. unter dem Median, wird der Person<br />
ein „Risikopunkt“ zugewiesen. Je mehr Risikopunkte die Person hat, umso größer ist<br />
die Wahrscheinlichkeit, dass sie später einen Antrag zur Frühberentung stellen wird.<br />
Hier werden die gef<strong>und</strong>enen Variablen dichotomisiert <strong>und</strong> in einer „Risikoskala“, bestehend<br />
aus der Anzahl der Risikopunkte, zusammengefasst. Die Häufigkeitsverteilung<br />
dieser Skala ist in Abbildung 36 dargestellt.<br />
71
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
Häufigkeitsverteilung der Risikopunkte<br />
8,1<br />
20,3<br />
30,6<br />
20,6<br />
13,6<br />
5<br />
0<br />
1,7<br />
4,9<br />
0,2<br />
0 1 2 3 4 5 6 7<br />
Abbildung 36 (n=408)<br />
in %<br />
Die zugr<strong>und</strong>eliegenden Variablen sind nur mäßig miteinander interkorreliert: 14 der<br />
21 Korrelationen erreichen das Signifikanzniveau nicht. Bis auf eine Korrelation (zwischen<br />
der Zufriedenheit mit der Freizeit <strong>und</strong> der Stimmung (r=-.36) liegen alle beobachteten<br />
Zusammenhangsmaße unter .26 <strong>und</strong> damit die aufgeklärte Varianz unter 7<br />
%. Bei einer hohen Interkorrelation der Variablen müsste eine überproportionale Betonung<br />
der Häufigkeitsverteilung am oberen Extrem der Skala zu verzeichnen sein.<br />
Die Häufigkeitsverteilung ist etwas flacher als bei einer Normalverteilung (Kurtosis= -<br />
.354 ± .241, Schiefe= .094 ± .121), weist jedoch keine Extremwertkumulation auf. Die<br />
Verteilungsform spricht damit nicht gegen die Verwendung der Risikopunkte-Skala<br />
zur Identifizierung starker Risikofälle. Wie sich sowohl die Vorhersage als auch das<br />
tatsächliche Antragsverhalten zur Frühberentung auf die verschiedenen Kategorien<br />
der Risikopunkte verteilt, zeigt Abbildung 37.<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0<br />
Abbildung 37<br />
(n=408)<br />
Häufigkeitsverteilung Risikopunkte<br />
Antragstellung/Frühberentung<br />
Anteil Risikopunkte in %<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3,4<br />
1,2<br />
6,8<br />
15,4<br />
16,8<br />
0-01 2 3 4 5 6-7<br />
15,6<br />
33,3<br />
32,1<br />
63,9<br />
52,6<br />
52,7<br />
Modellbildung (V) Kreuzvalidierung (T) Insgesamt (T)<br />
72<br />
100<br />
70<br />
66,7<br />
V=Vorhersage<br />
T=Tätsächlich
Die tatsächliche Antragstellung zur Frühberentung weicht von der Vorhersage in den<br />
hohen Punkte-Kategorien etwas nach unten ab. Dieser Effekt kommt dadurch zustande,<br />
dass in dem Modell diejenigen Variablen, die zur Bildung der Risikopunkte<br />
verwendet wurden, gleichzeitig zur Bildung <strong>des</strong> Modells herangezogen wurden. Zum<br />
Vergleich <strong>und</strong> einer besseren Einschätzung der Tauglichkeit werden in Abb. 37 daher<br />
zusätzlich die Verteilungen der tatsächlichen Antragsteller/Frühberenteten in den<br />
Kategorien der Risikopunkte dargestellt.<br />
Über die Tauglichkeit <strong>des</strong> Konzepts der Risikopunkte soll die Abbildung 38 weiteren<br />
Aufschluss geben. Dort werden die Verteilungen der tatsächlichen Antragsteller/Frühberenteten<br />
in Abhängigkeit der Risikopunkte in der Gesamtstichprobe dargestellt.<br />
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es keine eindeutige Grenze zwischen dem<br />
Eintreten bzw. Ausbleiben einer späteren Frühberentung gibt. Die Verteilungen ähneln<br />
vielmehr denjenigen bei Hypothesentestungen. Tatsächlich lässt sich die Fragestellung<br />
hier in eine Art Hypothesentestung umformulieren. Unter diesem Gesichtspunkt<br />
interessiert, wo auf der Skala der Schnittpunkt gesetzt werden muss, um eine<br />
möglichst effiziente Trennung zwischen Antragstellern/Frühberenteten <strong>und</strong> weiterhin<br />
Berufstätigen zu erhalten. Tatsächlich ist der Mittelwertunterschied hinsichtlich der<br />
Risikopunkte zwischen den beiden Gruppen hoch signifikant (t=10.461,<br />
p(df=406)
Die statistische Entscheidung zugunsten einer späteren Antragstellung bzw. Frühberentung<br />
wird in diesem Fall durch das Risiko einer Falschentscheidung gedämpft.<br />
Eine Falschentscheidung wäre hier gegeben, wenn trotz einer hohen Anzahl an Risikopunkten<br />
(≥ 6) ein Patient keinen entsprechenden Antrag stellen würde. Das Risiko<br />
liegt hier bei 33,3 %. Das gegenteilige Risiko, einen Patienten wegen einer niedrigen<br />
Anzahl an Risikopunkten (≤ 5) fälschlicherweise als nicht frühberentungsgefährdet<br />
anzusehen, beträgt 19 %. Das per Konvention als akzeptabel angesehene Risiko bei<br />
Hypothesentestungen liegt bei 5 %. Die Entscheidung, ausschließlich aufgr<strong>und</strong> der<br />
Risikopunkte eine Antragstellung zur Frühberentung vorherzusagen, ist demnach mit<br />
einem relativ hohen Risiko verb<strong>und</strong>en. Dis impliziert die Notwendigkeit einer weiteren<br />
Absicherung <strong>des</strong> Risikos durch ergänzende diagnostische Verfahren.<br />
4.2.2. Vorhersage der Frühberentung bezogen auf Messzeitpunkt t2<br />
Hierzu wurden die vorliegenden Daten der Nachbefragung zuerst einer univariaten<br />
Analyse unterzogen. Die sich als signifikant unterschiedlich erwiesenen Variablen<br />
wurden anschließend für die schrittweise logistische Regression nach bedingter Likelihood<br />
verwendet (vgl. Tab. A9 im Anhang). Hierbei wurden die für t1 definierten<br />
Gruppen verwendet (vgl. Abb. 34, 4.2.1.1.).<br />
Von der relevanten Stichprobe von N=408 wurde wieder zufällig eine Substichprobe<br />
von ca. 60 % (in diesem Fall 56,4 %) gebildet, bei der das Vorhersagemodell ermittelt<br />
wurde. In den untersuchten Variablen ergaben sich keinerlei signifikante Unterschiede<br />
zwischen den beiden zufällig gebildeten Gruppen (Geschlechterverteilung,<br />
Alter, Antrag auf Frühberentung). In einem zweiten Schritt soll das gef<strong>und</strong>ene Regressionsmodell<br />
in der nicht zur Modellbildung verwendeten Substichprobe eingesetzt<br />
werden, um dort den Frühberentungsantrag vorherzusagen. Der Begriff der ‚Vorhersage’<br />
trifft verständlicherweise nicht exakt zu, weil sowohl die Prädiktoren als auch<br />
das Kriterium zum gleichen Zeitpunkt erhoben wurden. Dennoch wurden aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>des</strong> für die Nachbefragung konsistenten Datensatzes durch diese Analyse aufschlussreiche<br />
Informationen über Zusammenhänge <strong>und</strong> Einflüsse auf das Risiko zur<br />
Frühberentung erwartet.<br />
Für die Modellbildung wurde eine Substichprobe von n=230 verwendet. Als Ausgangsvariablen<br />
in der logistischen Regression wurden unter Bezug auf die Ergebnisse<br />
der univariaten Analyse folgende Variablen einbezogen (vgl. Tab. A9 im Anhang):<br />
• Alter<br />
• Geschlecht<br />
• Schwerbehinderung<br />
• Skalen <strong>SF12</strong><br />
• Items zu subjektiven Krankheitsbelastungen<br />
• Subskalen der Asthma-Symptomliste<br />
• Ausmaß der Krankheitsbewältigung<br />
• Subskalen ‚Angst’ <strong>und</strong> Depression’ BSI<br />
• Subskalen <strong>des</strong> Freiburger Fragebogens zur Krankheitsverarbeitung + Item<br />
Vertrauenssetzung in die Ärzte<br />
• Dauer der Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten<br />
74
• Berufliche Belastungen<br />
• berufliche Veränderungen durch die chronische Erkrankung<br />
• Gesamtskala SBUS<br />
• Subskalen <strong>des</strong> SAA: ‚quantitative Überforderung’, ‚qualitative Überforderung’<br />
• Items zu berufsbezogenen Sorgen <strong>und</strong><br />
• Bereiche der Lebenszufriedenheit (LZI)<br />
In Tabelle 8a sind die für die Modellbildungsgruppe durch die logistische Regression<br />
ermittelten relevanten Variablen zur Vorhersage der Antragstellung/Frühberentung<br />
mit ihrer jeweiligen Einflussrichtung aufgeführt.<br />
Tabelle 8a: Ergebnisvariablen in der Modellbildungsgruppe<br />
Schritt Variable B* SE(B)* Wald* Sig.* Exp(B)*<br />
1 Alter .22 .03 50.25
• Geringere Symptome der Müdigkeit (ASL) im Kontext der Atemwegssymptomatik<br />
• Stärkeres Empfinden der Einschränkung <strong>des</strong> beruflichen Weiterkommens<br />
• Stärkere Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit<br />
• Geringere Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit<br />
• Längere Dauer der Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten<br />
• Besseres Abfinden mit der chronischen Erkrankung<br />
• Stärkere berufliche Veränderungen durch die Erkrankung<br />
Die Analyse ergab ein OR von 20,34 (95% CI: 8,89 – 46,53). Auch die untere Grenze<br />
<strong>des</strong> 95 %-Vetrauensintervalls für die Grenzen <strong>des</strong> OR liegt deutlich oberhalb von 1.<br />
Das Modell kann damit zunächst auf der Basis der statistischen Kennwerte als<br />
brauchbar eingestuft werden.<br />
Das ermittelte Modell wurde in der zweiten Substichprobe (Kreuzvalidierung) einer<br />
Überprüfung unterzogen. Hierbei ergab sich ein OR von 23,22 (95% CI: 8,97 –<br />
60,12), was dafür spricht, dass das Modell auch in dem Stichprobenteil verwendbar<br />
zu sein scheint, in dem diese Regressionsanalyse nicht durchgeführt wurde.<br />
Die Treffergenauigkeit der Vorhersage für die Modellbildungsgruppe <strong>und</strong> die Kreuzvalidierungsgruppe<br />
sind in Abbildung 8c dargestellt.<br />
Tabelle 8c: Klassifikationskriterien in den Substichproben<br />
Parameter Modellbildung Kreuzvalidierung<br />
prädiktiver Wert 75,6 % 71,0 %<br />
Spezifität 94,3 % 93,7 %<br />
Sensitivität 55,4 % 61,1 %<br />
Trefferquote 84,8 % 87,1 %<br />
Der prädiktive Wert (Anteil richtiger Einordnungen der aufgr<strong>und</strong> der Modellgleichung<br />
als frühberentet vorausgesagten Patienten) liegt sowohl in der Modellbildungsgruppe<br />
als auch in der Kreuzvalidierungsgruppe bei über 70 %. Die Spezifität (Prozentsatz<br />
derjenigen Teilnehmer, die keinen Antrag auf Frühberentung gestellt haben <strong>und</strong> auch<br />
als solche vorausgesagt werden) liegt jeweils bei über 93 %. Die Sensitivität (Anteil<br />
der Interessenten an einer Frühberentung, die auch als solche durch die Modellgleichung<br />
eingeordnet werden) liegt bei durchschnittlich ungefähr 60 %. Die Gesamttrefferquote<br />
(Prozentsatz aller richtig vorhergesagten Fälle) beträgt durchschnittlich<br />
ca. 85 % <strong>und</strong> belegt damit die Verwendbarkeit der Modellgleichung.<br />
Aus Tabelle 8c wird ersichtlich, dass sich die Ergebnisse der Modellbildungsgruppe<br />
<strong>und</strong> der Kreuzvalidierungsgruppe nur unwesentlich unterscheiden <strong>und</strong> damit ein<br />
Stichprobeneffekt offensichtlich nicht eingetreten ist. Damit scheint die Gleichung der<br />
Modellbildungsgruppe mit den gef<strong>und</strong>enen Variablen auf die Kreuzvalidierungsgruppe<br />
übertragbar zu sein.<br />
Wie bereits für den Messzeitpunkt t1, wurde trotz der genannten methodischen Vorbehalte<br />
(vgl. Abschnitt 4.2.1.2.) wiederum eine altersstratifizierte Analyse durchgeführt.<br />
Hierzu wurde die Gesamtstichprobe in die gleichen drei Altersgruppen unterteilt:<br />
Bis 44 Jahre, 45 bis 54 Jahre <strong>und</strong> 55 bis 64 Jahre. Für jede dieser Gruppen<br />
wurde wiederum eine getrennte logistische Regression mit den gleichen Ausgangs-<br />
76
edingungen wie in der Gesamtstichprobe durchgeführt, allerdings ohne Kreuzvalidierung.<br />
In der jüngsten Gruppe (bis 44 Jahre) wurden n=146 Personen zusammengefasst,<br />
die mittlere (45 bis 54 Jahre) bestand aus n=111 <strong>und</strong> die älteste (ab 55 Jahre)<br />
aus n=151 Patienten. In den verschiedenen Gruppen trat die Antragstellung/Frühberentung<br />
unterschiedlich häufig auf: In der jüngsten Gruppe war nur eine<br />
Person, in der zweiten Gruppe waren es 16,2 % (n=18) <strong>und</strong> in der ältesten Gruppe<br />
48,3 % (n=73). Die Bedeutung <strong>des</strong> Alters ist auch in dieser kurzen Zusammenfassung<br />
wieder recht deutlich.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der geringen Anzahl der Antragsteller/Frühberenteten in der Gruppe bis 44<br />
Jahre <strong>und</strong> hieraus resultierender methodischer Artefakte werden auch hier die Ergebnisse<br />
für diese Gruppe nicht dargestellt.<br />
Für die Altersgruppe von 45-54 Jahren ergeben sich bei einer Gesamttrefferquote<br />
<strong>des</strong> Modells von 95,5 % <strong>und</strong> einer Sensitivität von 72,7 % folgenden Risikofaktoren<br />
zur Frühberentung (vgl. Tab. 9a):<br />
• Stärkere Beeinträchtigung der allgemeinen Leistungsfähigkeit<br />
• Stärkere Belastungen durch ein hohes Arbeitstempo<br />
• Geringerer Verdienst durch die Erkrankung<br />
• Geringere Belastung durch die Erkrankung<br />
• Geringere Belastung durch die Arbeit<br />
• Geringere nächtliche Atemnot<br />
• Geringere soziale Unterstützung<br />
• Geringere Gefährdung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes<br />
Tabelle 9a: Ergebnisvariablen in der Subgruppe 45 bis 54 Jahre<br />
Schritt Variable B* SE(B)* Wald* Sig.* Exp(B)*<br />
1<br />
Beeinträchtigung der allgemeinen<br />
Leistungsfähigkeit in den letzten 6<br />
Monaten (v10_5b)<br />
3.13 .83 14.36
In der Altersgruppe ab 55 Jahre ergeben sich bei einer Trefferquote von 84,1 %<br />
<strong>und</strong> einer Sensitivität von 80,8 % folgende Risikofaktoren zur Frühberentung (vgl.<br />
Tab. 10a):<br />
• Alter<br />
• Stärkere krankheitsbedingte berufliche Belastungen<br />
• Geringere berufliche Belastung durch Störungen/Unterbrechungen bei der Arbeit<br />
• Höhere quantitative Überforderung<br />
• Höhere Belastungen durch Kontrollen durch Vorgesetzte<br />
• Höhere Zufriedenheit mit den Sozialkontakten<br />
• Höhere Zufriedenheit mit den eigenen Fähigkeiten<br />
• Stärkere Belastungen durch die Nebenwirkungen der Behandlung<br />
• Geringere Belastungen durch maschinenbestimmtes Arbeitstempo<br />
• Stärkere Belastungen durch schlechtes Verhältnis zu Kollegen am Arbeitsplatz<br />
• Geringere Müdigkeit (ASL) im Rahmen der Atemwegssymptomatik<br />
• Höhere Einschränkung <strong>des</strong> beruflichen Weiterkommens<br />
• Geringere Sorgen, weniger zu verdienen<br />
Tabelle 10a: Ergebnisvariablen in der Subgruppe ab 55 Jahre<br />
Schritt Variable B* SE(B)* Wald* Sig.* Exp(B)*<br />
1 Alter .53 .13 17.04
Tabelle 10b: Modellgüteparameter in der Substichprobe ab 55 Jahre<br />
-2LL Cox & Snell R 2 Nagelkerkes R 2<br />
Chi 2<br />
100.75 .51 .68 108.42<br />
Die Ergebnisse für die altersstratifizierten Substichproben ergeben wiederum kein<br />
homogenes Bild bezüglich der Risikofaktoren <strong>und</strong> weichen in Teilbereichen von der<br />
Gesamtstichprobe deutlich ab. Trotz der methodisch bedingten eingeschränkten<br />
Aussagekraft der Ergebnisse (Stichprobengröße, Einschränkung der Streuung, fehlende<br />
Kreuzvalidierung) liefern auch die Ergebnisse für den zweiten Messzeitpunkt<br />
wertvolle Hinweise für mögliche unterschiedliche Risikokonstellationen in den unterschiedlichen<br />
Altersgruppen.<br />
4.3. Ergebnisse der Befragung zu beruflichen Hilfen<br />
Die Ergebnisdarstellung zu diesem Erhebungsteil erfolgt unter Einbeziehung von Angaben<br />
der Patienten <strong>und</strong> der behandelnden Stationsärzte während <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes.<br />
Neben einer Beschreibung der wesentlichen Charakteristika der Stichprobe<br />
liegt der Schwerpunkt der Darstellung in den Bereichen zu notwendigen beruflichen<br />
Hilfen im Rehabilitationsprozess. Von den 550 ca. vier Wochen vor der Klinikaufnahme<br />
angeschriebenen Patienten nahmen 455 durch Abgabe eines ausgefüllten<br />
Fragebogens an der Studie teil (Rücklaufquote 82,7 %). Für diese liegen 358 Arztbogen<br />
vor, was einem Rücklauf von 78,7 % entspricht.<br />
4.3.1. Demographische Stichprobenmerkmale<br />
Der Frauenanteil der Stichprobe beträgt 52,3 %, das Durchschnittsalter liegt insgesamt<br />
bei 48,7 Jahren (±13,0). Die in Abbildung 39 dargestellte Altersverteilung zeigt,<br />
dass die am häufigsten vertretenen Altersgruppen von Patienten im Alter zwischen<br />
55 bis 64 (28 %) bzw. 45 bis 54 Jahren (24 %) gebildet werden. Bei der Stichprobe<br />
handelt es sich fast ausschließlich um deutsche Staatsbürger (98 %).<br />
Die Angaben zum Familienstand zeigen, dass der überwiegende Teil der Befragten<br />
verheiratet ist (71,2 %). Insgesamt 77,7 % geben an, in einer Partnerschaft zu leben.<br />
Im eigenen Haushalt leben durchschnittlich 2,68 Personen (±1,84), davon 2,20 über<br />
18 Jahre (±.91). Das Bildungsniveau ist relativ hoch. R<strong>und</strong> ein Drittel der Befragten<br />
hat als höchsten Bildungsabschluss die Fachhochschulreife bzw. das Abitur (vgl.<br />
Abb. 39).<br />
79
Altersklassen:<br />
18-24 Jahre<br />
25 bis 34 Jahre<br />
35-44 Jahre<br />
45-54 Jahre<br />
55-64 Jahre<br />
ab 65 Jahre<br />
Familienstand:<br />
verheiratet<br />
ledig<br />
geschieden<br />
fester Fre<strong>und</strong><br />
verwitwet<br />
verlobt<br />
getrennt lebend<br />
Bildungsgrad:<br />
Hauptschule o.A.<br />
Hauptschule m.A.<br />
Realschule<br />
Polytechn. Oberschule<br />
FH-Reife<br />
Abitur<br />
andere<br />
Soziodemographische Merkmale<br />
Abbildung 39 (n=455)<br />
4,4<br />
6<br />
5,8<br />
3,5<br />
1,1<br />
0,7<br />
1,8<br />
0,9<br />
9,8<br />
13,6 20,224 28<br />
11,8<br />
11<br />
23,8<br />
4.3.2. Somatische Stichprobenmerkmale<br />
1,8<br />
33,6<br />
27,1<br />
71,2<br />
0 20 40 60 80<br />
Auf der Basis der Arztangaben leiden 91,2 % an einem Asthma bronchiale in unterschiedlicher<br />
Form (vgl. Abb. 40). Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei das Mixed-Asthma<br />
(42,1 %), die bronchiale Hyperreagibilität (BHR) mit 35 % <strong>und</strong> das Intrinsic-Asthma<br />
32,9 %). Neben der pneumologischen Erkrankung weisen 68,4 % weitere Erkrankungen<br />
auf. Hierbei stehen neben Endokrinopathien (23,7 %), Herz-Kreislauferkrankungen<br />
(22,8 %), mit der Atemwegserkrankung verb<strong>und</strong>ene Allergien (15,8 %) <strong>und</strong><br />
mit jeweils 13,5 % Erkrankungen <strong>des</strong> Skeletts <strong>und</strong> der Haut im Vordergr<strong>und</strong>. Bezogen<br />
auf den Zeitpunkt der Erstdiagnose weisen die Patienten eine durchschnittliche<br />
Erkrankungsdauer von 16,3 Jahren (± 12,6) auf.<br />
in %<br />
Diagnosen - Nebenerkrankungen<br />
Diagnosen:<br />
Mixed Asthma<br />
BHR<br />
Intrinsic Asthma<br />
Extrinsic Asthma<br />
Anstrengungsasthma<br />
Chronisch obstruktive Bronchitis<br />
Lungenemphysem<br />
Nebenerkrankungen:<br />
Endokrinopathien<br />
Herz/Kreislauf<br />
Allergien<br />
Skelett, Muskeln<br />
Haut<br />
Nervensystem<br />
Verdauung<br />
Abbildung 40 (n=358)<br />
Arztbefragung<br />
5,1<br />
3,1<br />
7<br />
11<br />
17,9<br />
15,8<br />
13,5<br />
13,5<br />
10,5<br />
23,7<br />
22,8<br />
35<br />
32,9<br />
42,1<br />
68,4<br />
0 20 40 60 80<br />
80<br />
in % (Mfn)<br />
Krankheitsdauer:<br />
MW: 16,3 Jahre<br />
SD: 12,6 Jahre
Einen Hinweis auf den Schweregrad der Erkrankung gibt die notwendige Medikation 1<br />
<strong>und</strong> der Schweregrad der Asthmaanfälle 2 . Die in Abbildung 41 dargestellte Verteilung<br />
zeigt, dass die meisten Betroffenen vorwiegend unter mittelschweren (56,6 %) <strong>und</strong><br />
schweren Asthmaanfällen (23,9 %) leiden. Dementsprechend weisen über die Hälfte<br />
der Befragten ein mittelschweres (62,0 %) bis schweres Asthma (18,8 %) auf.<br />
Schweregrad Asthmaanfälle:<br />
Abbildung 41 (n=358)<br />
Schweregrad der Erkrankung<br />
Arztbefragung<br />
leicht<br />
mittel<br />
schwer<br />
Schweregrad Erkrankung:<br />
keine Medikamente<br />
intermittieren<strong>des</strong> Ashtma<br />
leichtes Asthma<br />
mittelschweres Asthma<br />
schweres Asthma<br />
4,9<br />
12,2<br />
19,6<br />
21<br />
20,7<br />
23,9<br />
41,3<br />
56,6<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Aufnahme in %<br />
Einen ersten Überblick über die mit der Erkrankung verb<strong>und</strong>enen Belastungen gibt<br />
Abbildung 42. Der behandelnde Arzt <strong>und</strong> die Patienten schätzten hierzu das Ausmaß<br />
der Belastungsintensität auf einer Skala von 1=sehr gering bis 5=sehr hoch ein.<br />
Aus dem Erleben der Patienten stehen dabei die körperliche Leistungsfähigkeit (44,8<br />
%), die Krankheitssymptomatik (42,6 %), die allgemeine Leistungsfähigkeit (41,2 %),<br />
die körperliche Verfassung (38,1 %) <strong>und</strong> berufliche Einschränkungen in den Bereichen<br />
der Leistungsfähigkeit (35,3 %) <strong>und</strong> der Arbeitsfähigkeit (33,8 %) im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Insbesondere in Bereichen, die notwendige Fähigkeiten der Patienten für einen<br />
adäquaten Umgang mit der Erkrankung beschreiben, geben die Betroffenen geringe<br />
Probleme an (Wissen über Erkrankung <strong>und</strong> Behandlung, Symptomwahrnehmung,<br />
-kontrolle <strong>und</strong> -bewertung, aktives Krankheitsmanagement).<br />
1 Schweregradeinteilung nach der Richtlinie der Deutschen Atemwegsliga (1998):<br />
Intermittieren<strong>des</strong> Asthma: Symptome tagsüber: ≤ 2 x pro Woche, nachts ≤ x pro Woche, keine dauernde<br />
Medikation. Leichtes Asthma: Symptome tagsüber: ≤ 1 x pro Tag, nachts > x pro Monat (Kortisonspray<br />
niedrige Dosis oder Langzeitmedikament (Nedocromil, DNCG), ggf. bronchialerweitern<strong>des</strong><br />
Spray. Mittelschweres Asthma: Symptome tagsüber: ≥ 1 x pro Tag, nachts ≥ 1 x pro Woche ((Kortisonspray<br />
mittlere, langwirksame Beta2-Agonisten, Theophyllin, ggf. Leukotrienantaqonisten). Schweres<br />
Asthma: Symptome tagsüber ständig, nachts häufig (Kortisonspray hohe Dosis, Langwirksame<br />
Beta2-Agonisten, Theophyllin, systemische Kortikoide)<br />
2 Schweregrad der Asthmaanfälle: leicht = Anfälle von Atemnot, die spontan vorübergehen, mittelschwer<br />
= Anfälle von Atemnot, die durch inhalative Maßnahmen vorübergehen, schwere = Anfälle, die<br />
durch weitergehende Maßnahmen oder durch ärztliche Behandlung vorübergehen<br />
81
Allgemeine Krankheitsbelastungen<br />
Arzt- <strong>und</strong> Patientenangaben Aufnahme<br />
körperliche Leistungsfähigkeit<br />
Atemwegserkrankung<br />
allg. Leistungsfähigkeit<br />
körperliche Verfassung<br />
berufl. Leistungsfähigkeit<br />
Arbeitsfähigkeit<br />
allg. Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
Konfliktfähigkeit<br />
Allgemeinbefinden<br />
seelische Verfassung<br />
Nebenwirkungen Behandlung<br />
Bewertung der Symptome<br />
Stimmung<br />
allg. Alltagsanforderungen<br />
Krankheitsmanagement<br />
Selbstwertgefühl<br />
Symptomkontrolle<br />
Krankheitsbewältigung<br />
Symptomwahrnehmung<br />
Wissen Erkrankung<br />
Compliance<br />
Prognose Erkrankung<br />
Lebensqualität insgesamt<br />
Abbildung 42 (n=455, 358 )<br />
31,8<br />
30,4<br />
27,7<br />
26,8<br />
30<br />
32,7<br />
24,6<br />
29,7<br />
25,9<br />
34,9<br />
23,5<br />
26,9<br />
26,8<br />
44,8<br />
42,6<br />
41,2<br />
38,1<br />
35,3<br />
33,8<br />
32,8<br />
31,3<br />
30,7<br />
22,9<br />
22,7<br />
21,1<br />
19,9<br />
19,8<br />
17,3<br />
15,2<br />
13,3<br />
13,3<br />
11,9<br />
10<br />
21,4<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
Häufigkeit in % (Arzt) Häufigkeit in % (Patient)<br />
Die Einschätzung der behandelnden Klinikärzte zeigt ein umgekehrtes Bild (vgl. Abb.<br />
42). Die Probleme in den beschriebenen Fähigkeiten werden von den Ärzten deutlich<br />
höher eingeschätzt, dies gilt auch für das Ausmaß der Probleme in der Krankheitsbewältigung.<br />
Demgegenüber schätzen die Ärzte die Probleme im körperlichen Bereich<br />
der Erkrankung deutlich geringer ein. Bis auf die berufliche Leistungsfähigkeit<br />
ergeben sich für alle im Vergleich vorliegenden Bereiche signifikante Unterschiede in<br />
der Einschätzung der Belastungsintensität.<br />
4.3.3. Funktionale Stichprobenmerkmale<br />
Die Angaben zur Berufsausbildung zeigen, dass nur ein geringer Teil der Stichprobe<br />
keine abgeschlossene Ausbildung hat (6,5 %). Insgesamt 42,8 % verfügen über eine<br />
abgeschlossene Lehre <strong>und</strong> 15,3 % haben eine Fachschule besucht. Mit einem Anteil<br />
von 23 % verfügt fasst ein Viertel über einen Hochschulabschluss. Dementsprechend<br />
ist das verfügbare Haushaltseinkommen entsprechend hoch (vgl. Abb. 43).<br />
82<br />
***<br />
***<br />
**<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***
höchster Berufsabschluß:<br />
keine Ausbildung<br />
nicht abgeschl. Lehre<br />
abgeschl. Lehre<br />
Fachschule<br />
Universität<br />
anderer<br />
Nettoeinkommen (in DM):<br />
unter 1000<br />
1000 - 1999<br />
2000 - 2999<br />
3000 - 3999<br />
4000 - 4999<br />
5000 - 5999<br />
6000 <strong>und</strong> mehr<br />
Abbildung 43 (n=455)<br />
Berufsausbildung<br />
Nettoeinkommen Haushalt<br />
1<br />
1,2<br />
5,5<br />
8,8<br />
11,5<br />
13<br />
15,3<br />
17,9<br />
15,5<br />
14,7<br />
23<br />
28,7<br />
42,8<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Anteil in % Anteil in %<br />
In Verbindung mit der Berufsausbildung werden im Berufsstatus die weitaus stärksten<br />
Gruppen von Angestellten (40,4 %) <strong>und</strong> Beamten (12,7 %) gebildet (vgl. Abb.<br />
44). Der Anteil der Berenteten beträgt, Alters- <strong>und</strong> Frührentner zusammengefasst,<br />
23.9 %.<br />
In Abbildung 44 ist der Rentenstatus nochmals unterteilt dargestellt. Bei dieser Substichprobe<br />
sind nahezu die Hälfte aus Altersgründen berentet (50,9 %). Noch häufiger<br />
als der vorgezogene Ruhestand mit insgesamt 13,7 % tritt die auf Dauer angelegte<br />
Erwerbsunfähigkeitsrente mit 23,5 % auf. Die anderen Formen der Berentung<br />
wegen Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit fallen dagegen mit insgesamt 9,8 % weniger<br />
stark ins Gewicht. Die Dauer der Berentung liegt durchschnittlich bei 7,6 Jahren (±<br />
6,9).<br />
Berufsstatus:<br />
Angestellter<br />
Beamter<br />
Frührente/Vorruhestand<br />
Altersrente<br />
(Fach-)Arbeiter<br />
Hausfrau<br />
selbständig<br />
in Ausbildung<br />
arbeitslos<br />
sonstiges<br />
Rentenstatus:<br />
Altersrente<br />
Vorgezogene Rente<br />
EU-Dauer<br />
EU-Zeit<br />
BU-Dauer<br />
BU-Zeit<br />
Abbildung 44 (n=455)<br />
Berufs- <strong>und</strong> Rentenstatus<br />
6,8<br />
6,2<br />
4,2<br />
2,6<br />
2,2<br />
1,5<br />
5,9<br />
2,9<br />
1<br />
12,7<br />
12,5<br />
11,4<br />
13,7<br />
25,5<br />
40,4<br />
50,9<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Anteil in % Anteil in %<br />
83
Insgesamt 45,1 % der Befragten besitzen einen Schwerbehindertenausweis. Der<br />
Grad der Behinderung liegt bei durchschnittlich 58,2 % (± 17,9). In den vergangen<br />
fünf Jahren haben nur insgesamt 2,5 % der Befragten an Maßnahmen zur beruflichen<br />
Rehabilitation teilgenommen, die vorwiegend als Umschulung durchgeführt<br />
wurden. Die Teilnehmer an Bf-Maßnahmen weisen ein Durchschnittsalter von 41,5<br />
Jahren (± 10,5) <strong>und</strong> der Frauenanteil beträgt nur 27,3 %. Die subjektive Einschätzung<br />
der Arbeitsfähigkeit dieser Subgruppe liegt bei 70,2 % (± 20,3) gegenüber 61,4<br />
% (± 25,0) in der Gesamtstichprobe. Alle Teilnehmer sind noch berufstätig.<br />
Zum Zeitpunkt der Klinikaufnahme sind 14,5 % der Gesamtstichprobe arbeitsunfähig<br />
krankgeschrieben. Bezogen auf die letzten 12 Monate traf dies bei 87,8 % min<strong>des</strong>tens<br />
einmal zu (MW 33,5 Tage, ± 50,4). Die momentane Arbeitsfähigkeit beträgt<br />
durchschnittlich 61,4 % (± 25).<br />
In der aktuellen beruflichen Tätigkeit arbeiten 75,8 % vollzeitig mit überwiegend<br />
regelmäßigen Arbeitszeiten (68,7 %). Im Durchschnitt wird die aktuelle Tätigkeit seit<br />
15,5 Jahren ausgeübt (± 11,6 Jahre). Im Rahmen ihrer Tätigkeit berichten 14 % der<br />
Befragten von betrieblichen Umstrukturierungen <strong>und</strong> Rationalisierungen. Insgesamt<br />
6,2 % der Patienten haben verstärkt Angst, in der nächsten Zeit arbeitslos zu werden<br />
(MW 1,70, ± .92) <strong>und</strong> 20,5 % haben den Wunsch, in absehbarer Zeit in Rente zu gehen<br />
bzw. aus dem Berufsleben auszuscheiden.<br />
Zur Abbildung von berufs- <strong>und</strong> arbeitsbezogenen Belastungen wurden den Befragten,<br />
die noch im Berufsleben waren, 70 verschiedene Belastungsfaktoren mit der<br />
Bitte um Beantwortung vorgegeben (Vorkommen <strong>des</strong> Faktors, Ausmaß der Belastung<br />
durch den Faktor). Die Zusammenstellung der Belastungsfaktoren basiert auf<br />
den von der Rentenversicherung erfragten Bereichen zur Reha-Antragstellung bzw.<br />
auch zur Frühberentung. Zur Ermittlung der Belastung wurde die Häufigkeit der subjektiven<br />
ges<strong>und</strong>heitlichen Beeinträchtigung aufaddiert <strong>und</strong> so ein Summenscore gebildet.<br />
Der Belastungsindex der einzelnen Faktoren entstand durch den relativen Anteil<br />
der Nennungen als ges<strong>und</strong>heitlich beeinträchtigend an allen Nennungen, bei denen<br />
der jeweilige Faktor am Arbeitsplatz auftrat. Das Belastungspotential ist demnach<br />
ein Prozentsatz der ges<strong>und</strong>heitlichen Belastung bei Vorhandensein <strong>des</strong> Faktors.<br />
In Abbildung 45 ist zunächst die Verteilung der Belastung der Personen in<br />
Gruppen angegeben.<br />
84
Häufigkeit (Gruppen):<br />
keine<br />
1-5<br />
6-10<br />
11-15<br />
16-20<br />
über 20<br />
Vorkommen/Belastung<br />
geschlossene Räume<br />
hohe Konzentration<br />
Tempo<br />
Staub, Dämpfe, schlechte Luft<br />
einseitige Körperhaltung<br />
lange Arbeitszeiten<br />
unregelm. Essen<br />
Zugluft<br />
Hitze, Kälte, Nässe<br />
Allergene<br />
schlechtes Arbeitsklima<br />
Tragen ohne Hilfen<br />
Abbildung 45 (n=304)<br />
Arbeitsbelastungen<br />
Gruppierung - Hauptbelastungen<br />
19,5<br />
34,8<br />
21,2<br />
12,1<br />
6,5<br />
5,9<br />
64<br />
63,7<br />
56,3<br />
42,9<br />
38,5<br />
38,5<br />
38,5<br />
26<br />
26<br />
24,7<br />
22,4<br />
18,4<br />
15,7<br />
31,5<br />
53,6<br />
67,7<br />
53,5<br />
44,7<br />
41,3<br />
43<br />
48,8<br />
47,2<br />
41,5<br />
42,6<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
Häufigkeit in % Belastung in %<br />
Die Anzahl der Belastungen bewegt sich in einer Bandbreite von 0 für gar keine Belastung<br />
bis hin zu 42 der möglichen 70 Belastungsfaktoren. Berufs- <strong>und</strong> arbeitsbezogene<br />
Belastungen geben insgesamt 80,5 % der Berufstätigen an. Der am häufigsten<br />
vorkommende Faktor ist das Arbeiten in geschlossenen Räumen (64,0 %) mit einem<br />
relativen Belastungspotential von 15,7 %, gefolgt von der Notwendigkeit starker Konzentration<br />
(63,7 %) mit einem relativen Belastungspotential von 31,5 %. Wie Abb. 45<br />
zeigt, spielen daneben körperlich beanspruchende Faktoren, Umweltfaktoren <strong>und</strong><br />
psychosoziale Komponenten eine Rolle.<br />
Im Zusammenhang mit den Belastungen sind auch die krankheitsbedingten Fehlzeiten<br />
zu sehen. Die Arbeitsunfähigkeitszeiten <strong>und</strong> die Anzahl beruflicher Belastungen<br />
korrelieren signifikant positiv miteinander (r=.18, p
psychischen Bewältigung der Erkrankung von anderen Personen ziemlich bis sehr<br />
gut unterstützt (MW 3,21 ± 1,35).<br />
Strategien zur Krankheitsverarbeitung<br />
Subskalen - FKV<br />
FKV-Skala Bagatellisierung<br />
Abbildung 46 (n=455)<br />
Herunterspielen<br />
Nicht-wahrhaben-wollen<br />
Wunschdenken/Tagträume<br />
FKV-Skala Depressive Verarbeitung<br />
ungeduldig <strong>und</strong> gereizt<br />
Grübeln<br />
sozialer Rückzug<br />
Schicksal hadern<br />
Selbstmitleid<br />
2,13<br />
2,1<br />
2,04<br />
2,03<br />
1,96<br />
1,83<br />
1,61<br />
2,27<br />
2,46<br />
2,3<br />
1 2 3 4 5<br />
Zur Beschreibung von Aspekten der Lebensqualität wurde auch in dieser Teilbefragung<br />
der SF-12 von Bullinger & Kirchberger (1998) eingesetzt. Ein erster Überblick<br />
über die Einschränkungen (Zusammenfassung der Extremwerte in Richtung Belastung)<br />
zeigt Abbildung 47. Hierbei zeigt sich, dass sich die größten Einschränkungen<br />
im allgemeinen Ges<strong>und</strong>heitszustand (77,4 %), in der Alltagsbewältigung (76,6 – 83,5<br />
%), in den körperlich bedingten Schwierigkeiten bei der Arbeit oder zu Hause (64,6 -<br />
76,1 %) <strong>und</strong> im Befinden (Energielosigkeit, 74,4%) ergeben.<br />
Einschränkungen in der Lebensqualität<br />
Einzelitems SF 12<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand<br />
Alltagsbewältigung:<br />
mittelschwere Tätigkeiten<br />
Treppenabsätze steigen<br />
Schwierigkeiten Arbeit/zu Hause<br />
aufgr<strong>und</strong> körperlicher Ges<strong>und</strong>heit:<br />
weniger geschafft<br />
konnte nur bestimmte Dinge tun<br />
Schwierigkeiten Arbeit/zu Hause<br />
aufgr<strong>und</strong> seelischer Probleme:<br />
weniger geschafft<br />
nicht so sorgfältig wie üblich<br />
Schmerzen<br />
körperliches/emotionales Befinden:<br />
ruhig <strong>und</strong> gelassen<br />
voller Energie<br />
entmutigt <strong>und</strong> traurig<br />
Beeinträchtigung Sozialkontakte<br />
Abbildung 47 (n=455)<br />
45,7<br />
41,6<br />
32,4<br />
27,3<br />
MW<br />
60,2<br />
59,6<br />
64,6<br />
77,4<br />
75,6<br />
83,6<br />
76,1<br />
74,4<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anteil Belastungen in %<br />
In Abbildung 48 sind die Mittelwerte der beiden nach den Manualanweisungen (Bullinger<br />
& Kirchberger 1998) gebildeten Summenskalen dargestellt.<br />
86
<strong>Körperliche</strong> <strong>und</strong> psychische Summenskalen<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Abbildung 48<br />
(n=455)<br />
35,4<br />
SF - 12<br />
SD 10,6 SD 11,4<br />
43,5<br />
körperlich psychisch<br />
Auch unter Beachtung der unterschiedlichen Verteilung von Geschlecht <strong>und</strong> Alter<br />
(Normstichprobe vs. untersuchte Stichprobe) kann angenommen werden, dass die<br />
vorliegende Stichprobe im Vergleich zur Normstichprobe eine stärkere körperliche<br />
<strong>und</strong> psychische Beeinträchtigung aufweist.<br />
4.3.5. Behandlungsbezogene Stichprobenmerkmale<br />
Beim jetzigen Klinikaufenthalt handelt es sich bei 53,2 % um einen Wiederholungsaufenthalt<br />
in der Hochgebirgsklinik. Hauptkostenträger <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes sind<br />
BfA/LVA (49,6 %), gesetzliche (24,1 %) <strong>und</strong> private Krankenkassen (14,4 %). Insgesamt<br />
59,9 % der Befragten haben in den letzten fünf Jahren vor dem jetzigen Klinikaufenthalt<br />
wegen der Atemwegserkrankung eine Maßnahme zur Rehabilitation in<br />
Anspruch genommen (MW 1,4 ± 2,15). Neben der haus-/fachärztlichen Versorgung<br />
entfallen in diesem Zeitraum weitere Vorbehandlungen auf<br />
• Psychosoziale Beratungsstelle (7,1 %)<br />
• Psychosomatische Klinik (2,6 %)<br />
• Ambulante Psychotherapie (12,9 %)<br />
• Ambulante Schulungsgruppe (8,3 %)<br />
• Naturheiler (32,3 %)<br />
Die Erwartungen der Befragten an den bevorstehenden Klinikaufenthalt wurden<br />
durch den Fragebogen zur Rehabilitationsmotivation (FREM 17) von Deck et al.<br />
(1998a,b) erfasst. Auf einer fünfstufigen Skala (1=stimmt genau – 5=trifft auf mich<br />
nicht zu) sind von den Befragten 17 definierte Erwartungen hinsichtlich ihrer subjektiven<br />
Bedeutung zu bewerten. In einem zweiten Schritt sind die gleichen Bereiche<br />
nochmals in ihrer Wichtigkeit in Bezug auf den Grad der Erfüllung auf einer fünfstufigen<br />
Skala (1=sehr wichtig – 5=trifft auf mich nicht zu) zu bewerten.<br />
87
Abbildung 49 (n=455)<br />
Reha-Motivation (FREM)<br />
pearsons corr. alle p
Erwartungen im beruflichen Kontext<br />
nach Berufsstatus<br />
Erhöhung der Arbeitsfähigkeit<br />
Abbildung 50 (n=403)<br />
32,4<br />
42,1<br />
beruflichen Stress abbauen 11,8<br />
22,2<br />
Hilfe bei Arbeits-/Sozialrecht<br />
5,6<br />
32,1<br />
35,3<br />
Bestätigung vermind. Leistungsfähigkeit<br />
26,7<br />
38,2<br />
22,2<br />
Hilfe bei Rentenantrag<br />
0<br />
12,5<br />
9,4<br />
Beratung Umschulung<br />
0<br />
9,7<br />
9,4<br />
76,8<br />
73,1<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Erwartungen in %<br />
im Beruf EU/BU vorgez. Ruhestand<br />
Eine weitere differenzierte Betrachtung der Beratungserwartungen ergibt sich durch<br />
eine Altersgruppierung (vgl. Abb. 51, Abb. 39). Hierbei zeigt sich, dass der Abbau<br />
von beruflichem Stress bis auf die älteste Subgruppe (ab 55 Jahre) bei allen anderen<br />
Betroffenen einen sehr hohen Stellenwert hat (70-73,8 %). Die Verbesserung der<br />
Arbeitsfähigkeit spielt insbesondere in den Altersgruppen zwischen dem 35 <strong>und</strong> 54<br />
Lebensjahr eine herausragende Rolle (76,7-78,6 %). Bei der jüngsten Gruppe (bis 34<br />
Jahre) <strong>und</strong> bei der ältesten wird dies von ca. zwei Dritteln der Befragten erwartet.<br />
Hilfe bei arbeits- <strong>und</strong> sozialrechtlichen Fragen spielen für ca. ein Drittel der Befragten<br />
eine Rolle, wobei diese Erwartung in der ältesten Gruppe mit 24,1 % geringer ausfällt.<br />
Der Wunsch nach Bestätigung der verminderten beruflichen Leistungsfähigkeit<br />
nimmt mit dem Alter zu (22,8-37,3 %). Gleiches gilt für den Wunsch nach Hilfe bei<br />
einer Rentenantragstellung (7,7-15 %). Ein umgekehrter Trend zeigt sich bei den erwarteten<br />
Beratungen zu Umschulungen, die mit zunehmendem Alter abnimmt (16,7-<br />
6,9 %).<br />
89
Erwartungen im beruflichen Kontext<br />
nach Altersgruppen<br />
beruflichen Stress abbauen<br />
Abbildung 51 (n=410)<br />
Erhöhung Arbeitsfähigkeit<br />
Hilfe bei Arbeits-/Sozialrecht<br />
Bestätigung vermind. Leistungsfähigkeit<br />
Beratung Umschulung<br />
Hilfe bei Rentenantrag<br />
70<br />
70<br />
73,8<br />
49,2<br />
67,1<br />
76,7<br />
78,6<br />
62<br />
34,6<br />
33,3<br />
34<br />
24,1<br />
22,8<br />
19,1<br />
27,9<br />
37,3<br />
16,7<br />
12,2<br />
8,7<br />
6,9<br />
7,7<br />
6,7<br />
13,5<br />
15<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Erwartungen in %<br />
bis 34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre<br />
Zur weiteren Abklärung <strong>des</strong> Beratungsbedarfs im beruflichen Kontext wurden die<br />
Teilnehmer auf einer fünfstufigen Skala (1=gar nicht – 5= ja, sehr) gefragt, ob sie<br />
sich eine ausführliche Beratung zu Themen im beruflichen Zusammenhang wünschen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wünschen sich 31,8 % der Berufstätigen <strong>und</strong> 20 % der Frühberenteten<br />
eine ausführliche Beratung zu berufsbezogenen Fragen. Auf der Basis möglicher Beratungsbereiche<br />
zeigt sich ein anderes Bild (vgl. Abb. 52). Lediglich 7,4 % aller Berufstätigen<br />
äußern keinerlei Interesse an einer entsprechenden Beratung. Bei den<br />
relevanten Themen stehen folgende Bereiche im Vordergr<strong>und</strong>: medizinische Rehabilitation<br />
(85,7 %), Krankheit <strong>und</strong> Beruf (77,8 %), Allergien am Arbeitsplatz (72,9 %), im<br />
Beruf bleiben (72,8 %), berufliche Perspektiven (62,2 %), berufliche Rehabilitation<br />
(51,4 %), Umgang mit Vorgesetzten/Krankheit (51,4 %), Umgang mit Kollegen/Krankheit<br />
(48,1 %), Möglichkeiten zur Berentung (44,5 %), Weiter-/Fortbildung<br />
(41,9 %), allgemeiner Umgang mit Vorgesetzten/Kollegen (40,8 %) <strong>und</strong> Umschulungsmöglichkeiten<br />
(23 %).<br />
Über den beruflichen Kontext hinaus wünschen sich 52,7 % der Befragten Beratungen<br />
in Bezug auf Hilfsmöglichkeiten bei Behörden <strong>und</strong> Krankenkassen <strong>und</strong> 46,6 % in<br />
Bezug auf Hilfen in der Rehabilitationsnachsorge (Selbsthilfegruppen, -verbände,<br />
etc.).<br />
90
Beratungswünsche im beruflichen Kontext<br />
Medizinische Rehabilitation<br />
Krankheit <strong>und</strong> Beruf<br />
Allergien <strong>und</strong> Arbeitsplatz<br />
Abbildung 52 (n=346)<br />
im Beruf bleiben<br />
Berufliche Perspektiven<br />
Berufliche Rehabilitation<br />
Umgang mit Vorgesetzten/Krankheit<br />
Umgang mit Kollegen/Krankheit<br />
Möglichkeiten Berentung<br />
Weiter-/Fortbildung<br />
allg. Umgang Kollegen/Vorgesetzten<br />
Umschulungsmöglichkeiten<br />
12,7<br />
12,1<br />
17,6<br />
17,8<br />
17,6<br />
26,3<br />
14,6<br />
23<br />
15,1<br />
7,9<br />
32,4<br />
31,6<br />
29,1<br />
32,8<br />
27<br />
29,6<br />
29,8<br />
33,9<br />
33,6<br />
35,4<br />
40,8<br />
44,9<br />
43,3<br />
41,2<br />
44,5<br />
41,9<br />
40,8<br />
45,4<br />
51,4<br />
51,4<br />
48,1<br />
62,2<br />
72,9<br />
72,8<br />
77,8<br />
85,7<br />
0 20 40 60 80 100<br />
insgesamt ja, kurzer Überblick in % ausführliche Beratung in %<br />
Die Betroffenen (Berufstätige, Vorruhestand, Frührente) wurden ebenfalls nach bereits<br />
erfolgten Beratungen zu diesen Themen befragt <strong>und</strong> wie hilfreich diese Beratungen<br />
gewesen seien. Insgesamt gaben lediglich 11,6 % der befragten Patienten<br />
an, zu einem der Themen im beruflichen Kontext bereits beraten worden zu sein.<br />
Dabei geben die prozentual häufigsten Beratungen Patienten an, die noch nicht berentet<br />
sind (13,9 %)(vgl. Abb. 53).<br />
Erfolgte Beratungen - Institutionen<br />
Gesamtanteil:<br />
nach Berufsstatus:<br />
nicht berentet<br />
EU/BU<br />
vorgezogene Altersrente<br />
welche Institution:<br />
Rentenversicherung<br />
Krankenkasse<br />
Arbeitsamt<br />
Betriebsrat<br />
Versorgungsamt<br />
Gewerkschaft<br />
Sozialamt<br />
Abbildung 53 (n=403)<br />
2<br />
0,2<br />
4,2<br />
3,3<br />
3,1<br />
2,6<br />
1,8<br />
5,6<br />
9,5<br />
11,6<br />
13,9<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Gesamt in % nach Berufsstatus in % Anteil Institutionen in %<br />
In Abbildung 53 sind die beteiligten Einrichtungen mit der relativen Häufigkeit der Beratungen<br />
aufgeführt. Die einzelnen Häufigkeiten addieren sich nicht zu den oben genannten<br />
11,6 %, da Mehrfachnennungen möglich waren. Hierbei zeigt sich, dass die<br />
Beratungen zu Themen im beruflichen Kontext wurden hauptsächlich von Renten-<br />
91
<strong>und</strong> Krankenversicherungen durchgeführt. Andere Einrichtungen spielen kaum eine<br />
Rolle.<br />
Insgesamt wird deutlich, dass sich zwischen dem geäußerten Beratungsbedarf <strong>und</strong><br />
den konkret erfolgten Beratungen eine deutliche Lücke abzeichnet. Aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong><br />
geringen Anteils der beratenen Personen (n=47) können die nachfolgenden institutionsbezogenen<br />
Beratungsinhalte <strong>und</strong> deren Nützlichkeit lediglich als Hinweis<br />
bezeichnet werden.<br />
Im Versorgungsamt beinhalteten die Beratungen in den meisten Fällen Möglichkeiten<br />
der Berentung oder allgemeine Zusammenhänge zwischen der Atemwegserkrankung<br />
<strong>und</strong> dem Beruf (60 %). Die Rentenversicherung legte bei den Beratungen das<br />
Hauptgewicht auf die Berentungsmöglichkeiten (63,2 %) <strong>und</strong> die berufliche Rehabilitation<br />
(36,8 %). Bei den Krankenversicherungen wurden schwerpunktmäßig Themen<br />
<strong>des</strong> Zusammenhangs zwischen Beruf <strong>und</strong> Krankheit (53,3 %) <strong>und</strong> Berentungsmöglichkeiten<br />
(40 %) besprochen. Die Gespräche beim Arbeitsamt hatten am häufigsten<br />
Informationen zu beruflicher Rehabilitation (50 %), Umschulungsmöglichkeiten<br />
(42,9 %) oder Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung (35,7 %) zum Inhalt.<br />
Abbildung 54 (n=47)<br />
Hilfe durch die Beratungen<br />
Möglichkeiten Berentung<br />
Weiter-/Fortbildung<br />
Medizinische Rehabilitation<br />
im Beruf bleiben<br />
Umschulungsmöglichkeiten<br />
Berufliche Perspektiven<br />
Berufliche Rehabilitation<br />
Kollegen/Vorgesetzte allgemein<br />
Allergien im Beruf<br />
Umgang mit Vorgesetzten<br />
Umgang mit Kollegen<br />
Krankheit <strong>und</strong> Beruf<br />
27,3<br />
25<br />
38,1<br />
36,4<br />
50<br />
46,2<br />
46,2<br />
44,4<br />
60<br />
58,6<br />
54,5<br />
78,9<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Nennungen in % (MfN)<br />
In Abb. 54 ist die Nützlichkeit der erhaltenen Beratung nach Inhalten dargestellt<br />
(Mehrfachnennungen möglich) Es fällt auf, dass der größte Nutzen auf Hilfen zur<br />
Frühberentung (78,9 %) entfällt. Danach folgen Beratungen zu Weiter- <strong>und</strong> Fortbildungen<br />
(60 %), zur medizinischen Rehabilitation (58,6 %), zu Hilfen zum Verbleib im<br />
Beruf (54,5 %) <strong>und</strong> zu Umschulungsmöglichkeiten (50 %).<br />
Dagegen wurden allgemeine Beratungen zu Krankheit <strong>und</strong> Beruf (25 %), Umgang<br />
mit Kollegen (27,3 %) <strong>und</strong> Vorgesetzten (36,4 %), Allergien im Beruf (38,1 %) <strong>und</strong><br />
auch Fragen zur weiteren beruflichen Perspektive (46,2 %) <strong>und</strong> zur beruflichen Rehabilitation<br />
(46,2 %) als weniger hilfreich erlebt.<br />
92
4.3.6. Bewertung der Rehabilitationsbehandlung durch den Arzt<br />
Auf der Basis der Arztbefragung soll nachfolgend die Rehabilitationsbehandlung<br />
unter den Aspekten der Prozess- <strong>und</strong> Ergebnisqualität näher beschrieben werden.<br />
Hierzu liegen 358 Fragebögen vor, was bezogen auf den Rücklauf der Patientenbefragung<br />
(n=455) einem Rücklauf von 78,7 % entspricht.<br />
Neben der biomedizinischen Basisdiagnostik <strong>und</strong> der daraus resultierenden Optimierung<br />
der Pharmakotherapie wurden die Betroffenen auf ärztliche Überweisung in die<br />
unterschiedlichen Rehabilitationsangebote überwiesen. Wie in Abbildung 55 dargestellt<br />
stehen dabei, bedingt durch die häufig in Gruppen durchgeführten Behandlungen,<br />
die Angebote der Sporttherapie (90,9 %), der Inhalationstherapie (82,3 %), der<br />
Physiotherapie (79,4 %) <strong>und</strong> der Balneologie (73,7 %) im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Zur weitergehenden Absicherung der Rehabilitationsdiagnose durch biomedizinische<br />
(59,1 %) <strong>und</strong> psychosoziale (4,6 %) Diagnostikverfahren fanden während <strong>des</strong> Rehabilitationsaufenthaltes<br />
gezielte Überweisungen zur Einzelberatung <strong>und</strong> -therapie in<br />
die Bereiche der Rehabilitationspsychologie (14,3 %), der Ernährungsberatung (9,7<br />
%), der Arbeits- <strong>und</strong> Sozialmedizin (8,3 %) <strong>und</strong> der Sozialberatung (7,4 %) statt (vgl.<br />
Abb. 55).<br />
Überweisungen in Reha-Angebote - Nutzen<br />
Sporttherapie<br />
Inhalationstherapie<br />
Physiotherapie<br />
Balneologie<br />
ergänzende med. Diagnostik<br />
psych. Beratung/Therapie<br />
Ernährungsberatung<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Sozialmedizin<br />
Sozialberatung<br />
Psychologische Diagnostik<br />
Abbildung 55 (n=358)<br />
4,6<br />
Arztangaben<br />
9,7<br />
8,3<br />
7,4<br />
14,3<br />
59,1<br />
70<br />
67,6<br />
67,9<br />
66,4<br />
90,9<br />
86,6<br />
82,3<br />
95,2<br />
79,4<br />
93,2<br />
73,7<br />
91,1<br />
73,2<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Überweisungen (%) hoher Nutzen (%)<br />
Aus Sicht <strong>des</strong> behandelnden Arztes wird der Nutzen der Angebote für die Gesamtbehandlung<br />
insgesamt sehr hoch eingeschätzt (vgl. Abb. 55). Neben der Absicherung<br />
der Eingangsdiagnostik durch weiterführende medizinische (98 %) <strong>und</strong> psychosoziale<br />
Diagnostik werden dabei insbesondere die Angebote der Inhalationstherapie<br />
(95,2 %), der Physiotherapie (93,2 %), der Balneologie (91,1 %) <strong>und</strong> der Sporttherapie<br />
(86,5 %) genannt.<br />
Ein erster Effekt der Rehabilitationsmaßnahme lässt sich aus der Veränderung <strong>des</strong><br />
Asthmaschweregra<strong>des</strong> in Verbindung mit der notwendigen Basis- <strong>und</strong> Bedarfsmedikation<br />
erkennen (vgl. Abb. 56).<br />
93<br />
98
Veränderung <strong>des</strong> Asthmaschweregra<strong>des</strong><br />
Arztbefragung<br />
keine Medikamente<br />
intermittieren<strong>des</strong> Asthma<br />
leichtes Asthma<br />
mittelschweres Asthma<br />
schweres Asthma<br />
Abbildung 56 (n=358)<br />
2,2<br />
4,9<br />
8,1<br />
12,2<br />
21<br />
20,7<br />
18,8<br />
29,4<br />
41,3<br />
41,6<br />
0 10 20 30 40 50<br />
Aufnahme in % Entlassung in %<br />
Die Ergebnisse zeigen im Vergleich zwischen Aufnahme <strong>und</strong> Entlassung deutliche<br />
Verschiebungen (p ≤ .001, vgl. Abb. 56). Während die Anzahl von Patienten, die bei<br />
Klinikaufnahme keine Medikamente nehmen mussten bzw. ein intermittieren<strong>des</strong><br />
Asthma hatten, abgenommen hat, zeigt sich eine relativ deutliche Zunahme im Bereich<br />
<strong>des</strong> leichten Asthmas (21 vs. 29,4 %), die Anzahl im Bereich <strong>des</strong> mittelschweren<br />
Asthmas zeigt keine Veränderung (41,3 vs. 41,6 %) <strong>und</strong> die Zahl der Patienten<br />
mit schwerem Asthma hat leicht abgenommen (20,7 vs. 18,8 %).<br />
Die deutliche Zunahme im Bereich <strong>des</strong> leichten Asthmas lässt zwei Erklärungen zu.<br />
Auf der einen Seite dürften im Bereich der schwereren Krankheitsformen Verbesserungen<br />
erreicht worden sein. Andererseits ist davon auszugehen, dass ein nicht unbeträchtlicher<br />
Teil der Patienten zu Beginn <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes in Relation zur<br />
Krankheitsschwere medikamentös untertherapiert war.<br />
Wesentliche Therapieziele der Rehabilitation liegen in der Reduktion von Krankheitsfolgen<br />
<strong>und</strong> in der Förderung der Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> <strong>des</strong> Krankheitsmanagements.<br />
Zur Bewertung der diesbezüglichen Rehabilitationseffekte wurden die<br />
behandelnden Ärzte gebeten, auf einer fünfstufigen Skala (1=sehr gering – 5=sehr<br />
hoch) jeweils für den Zeitpunkt der Aufnahme <strong>und</strong> der Entlassung den Status der<br />
Patienten in diesen Bereichen zu bewerten.<br />
94
Allgemeine Krankheitsbelastungen<br />
Arztangaben Aufnahme - Entlassung<br />
Wissen Erkrankung<br />
Krankheitsmanagement<br />
körperliche Leistungsfähigkeit<br />
allg. Leistungsfähigkeit<br />
seelische Verfassung<br />
Krankheitsbewältigung<br />
körperliche Verfassung<br />
Prognose Erkrankung<br />
berufl. Leistungsfähigkeit<br />
Symptomwahrnehmung<br />
Bewertung der Symptome<br />
Compliance<br />
Lebensqualität insgesamt<br />
Abbildung 57 (n=358)<br />
34,9<br />
32,7<br />
31,8<br />
30,4<br />
30<br />
29,7<br />
27,7<br />
26,9<br />
26,8<br />
25,9<br />
24,6<br />
23,5<br />
26,8<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
Häufigkeit in % (Aufnahme) Häufigkeit in % (Entlassung)<br />
Die in Abb. 57 dargestellten Ergebnisse (vgl. auch Tab. A10 im Anhang) zeigen auf<br />
den ersten Blick eine deutliche Reduktion der Krankheitsbelastungen zwischen Aufnahme<br />
<strong>und</strong> Entlassung (für alle Bereiche: p ≤ .001). Ohne auf die einzelnen Differenzen<br />
einzugehen, muss hier von einer Überschätzung der Veränderungen durch die<br />
behandelnden Ärzte ausgegangen werden. Einerseits liegen hinreichende Belege<br />
vor, dass insbesondere die Bewertung von Krankheitsbelastungen oder Fertigkeiten<br />
in den funktionalen, psychosozialen <strong>und</strong> edukativen Bereichen zwischen Arzt <strong>und</strong><br />
Patient in nur wenigen Teilbereichen übereinstimmen. Belastungen <strong>und</strong> Fertigkeiten<br />
werden von den Betroffenen im Vergleich zum Arzt meist stärker angegeben (vgl.<br />
Abschnitt 4.3.2., Abb. 42, Kaiser 1994). Weiterhin kann davon ausgegangen werden,<br />
dass die Ärzte die Einschätzung für beide Bezugszeitpunkte jeweils bei der Entlassung<br />
vorgenommen haben, was zusätzlich zu einer Überschätzung geführt haben<br />
könnte.<br />
Das Ergebnis der Arztangaben zu den Therapiezielen in den unterschiedlichen Ebenen<br />
der Rehabilitation <strong>und</strong> dem jeweiligen Erreichungsgrad lässt einerseits Rückschlüsse<br />
auf den Erfolg der Rehabilitationsmaßnahme zu, bestätigt aber auch die<br />
Annahme einer möglichen Überschätzung in den in Abbildung 57 genannten Bereichen.<br />
Die meisten Ziele der Rehabilitationsmaßnahme sind aus Sicht <strong>des</strong> Arztes dem edukativen<br />
(93,1 %) <strong>und</strong> dem somatischen (91, 3 %) Bereich zuzuordnen, gefolgt von<br />
funktionalen (79,9 %) <strong>und</strong> psychosozialen Zielen (60 %)(vgl. Abb. 58). Bei über drei<br />
Viertel der Patienten konnten diese Ziel umfassend erreicht werden, dies insbesondere<br />
mit 82,8 % im Bereich der edukativen Ziele.<br />
95<br />
2,1<br />
2,4<br />
2,9<br />
2,9<br />
2,8<br />
2,2<br />
3,8<br />
7<br />
5,2<br />
3,4<br />
2,6<br />
3,3<br />
2,4<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***
Therapieziele:<br />
edukativ<br />
somatisch<br />
funktional<br />
psychosozial<br />
Erreichen der Ziele:<br />
somatisch<br />
nein<br />
unklar<br />
ja<br />
funktional<br />
nein<br />
unklar<br />
ja<br />
psychosozial<br />
nein<br />
unklar<br />
ja<br />
edukativ<br />
nein<br />
unklar<br />
ja<br />
Abbildung 58 (n=358)<br />
Therapieziele - Zielerreichung<br />
1,2<br />
1,7<br />
1,8<br />
Arzteinschätzung<br />
22<br />
23,4<br />
20,7<br />
60<br />
79,9<br />
76,8<br />
74,8<br />
77,4<br />
93,1<br />
91,3<br />
0,7<br />
16,6<br />
82,8<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anteile in %<br />
Im Kontext <strong>des</strong> zentralen Projektthemas wurden die Ärzte abschließend um Bewertung<br />
<strong>des</strong> individuellen Risikos zur Frühberentung, der Prognose bezüglich der Erwerbsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> notwendiger weiterführender Maßnahmen für die Zeit nach der<br />
Entlassung der Patienten gebeten.<br />
Für die Subgruppe der berufstätigen Patienten wurde das Risiko zur Frühberentung<br />
dabei auf einer fünfstufigen Skala (1=nein – 5=ja) <strong>und</strong> die Prognose der Erwerbsfähigkeit<br />
auf einer fünfstufigen Skala (1=viel schlechter – 5=viel besser) eingestuft.<br />
Wie Abbildung 59 zeigt, werden lediglich 45,2 % der Patienten als wenig gefährdet<br />
eingestuft. Bei 19,5 % ist dies unsicher <strong>und</strong> insgesamt 35,2 % weisen ein hohes Risiko<br />
zur Frühberentung auf (MW 2,89, ± 1,26). Ein Unterschied zwischen Frauen <strong>und</strong><br />
Männern von 38,5 % gegenüber 32,3 % ist dabei statistisch nicht bedeutsam. Der<br />
größte Anteil an vermuteten Risikopatienten ist in der Altersgruppe zwischen 45 bis<br />
54 Jahren zu finden (47.0%).<br />
96
Risikopatienten - Entwicklung Erwerbsfähigkeit<br />
Arztbefragung<br />
Anteil Risikopatienten:<br />
nein<br />
Abbildung 59 (n=358)<br />
eher nein<br />
unsicher<br />
eher ja<br />
ja<br />
Entwicklung Erwerbsfähigkeit:<br />
viel schlechter<br />
etwas schlechter<br />
unverändert<br />
etwas besser<br />
viel besser<br />
1,6<br />
9,3<br />
8,9<br />
13,8<br />
12,6<br />
19,5<br />
22,6<br />
31,4<br />
33,1<br />
47,4<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Risikopatienten (%) Entwicklung Erwerbsfähigkeit (%)<br />
Die Prognose zur weiteren Entwicklung der Erwerbsfähigkeit zeigt (vgl. Abb. 59),<br />
dass bei insgesamt 10,9 % eine Verschlechterung angenommen wird <strong>und</strong> beim größten<br />
Teil der Stichprobe davon ausgegangen wird, dass der Status quo gehalten werden<br />
kann (MW 3,39 ± .84).<br />
Zur Stabilisierung der erreichten Erfolge wird für die Rehabilitationsnachsorge von<br />
den behandelnden Ärzten bei min<strong>des</strong>tens 35,2 % eine intensive ambulante Weiterführung<br />
der Rehabilitation als notwendig erachtet. Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation<br />
müssen bei 5,6 % geprüft <strong>und</strong> bei 4,4 % eingeleitet werden. Die Frage<br />
einer vorzeitigen Berentung steht bei insgesamt 7,2 % der Patienten im Raum. Aus<br />
Sicht der Ärzte sollte diesbezüglich bei jeweils 3,6 % eine weitere Abklärung erfolgen<br />
bzw. die notwendigen Schritte zur Berentung eingeleitet werden (vgl. Abb. 60).<br />
Intensivierung med. Reha.:<br />
nein<br />
eventuell<br />
ja<br />
Berufliche Rehabilitation:<br />
nein<br />
eventuell<br />
ja<br />
Abbildung 60 (n=358)<br />
Weiterführende Massnahmen<br />
Arzteinschätzung<br />
7,3<br />
5,6<br />
4,4<br />
35,2<br />
57,5<br />
Berentung:<br />
nein<br />
eventuell<br />
ja<br />
3,6<br />
3,6<br />
92,8<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anteile in %<br />
Intensive med. Reha. Berufliche Rehabilitation Berentung<br />
97<br />
90
4.3.7. Vorhersage der Frühberentung durch den Arzt<br />
Eine wesentliche Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist die Sicherstellung <strong>und</strong><br />
Spezifizierung der Rehabilitationsdiagnose als Gr<strong>und</strong>lage für eine adäquate Therapie,<br />
Prognoseeinschätzung <strong>und</strong> die abschließende sozialmedizinische Leistungsbeurteilung<br />
zur Einleitung weiterer Maßnahmen in der Rehabilitationsnachsorge.<br />
Die Zusammenführung der Patienten- <strong>und</strong> Arztdaten im Rahmen der Befragung zu<br />
beruflichen Hilfen ermöglichte eine Analyse der fünfstufigen Arzteinschätzung in Bezug<br />
auf die Gefährdung zur Frühberentung. Hierbei wurde als Methode eine lineare<br />
schrittweise Regression gerechnet, die als Kriterium die Risikoeinschätzung durch<br />
den Arzt <strong>und</strong> als mögliche Prädiktoren Angaben der Ärzte sowie Angaben der Patienten<br />
berücksichtigte.<br />
Die einbezogenen Arztangaben sind im einzelnen: Dauer der Erkrankung, Schweregrad<br />
der Asthmaanfälle, Schweregrad der Atemwegserkrankung zu Beginn <strong>und</strong> kurz<br />
vor Ende <strong>des</strong> Aufenthaltes, krankheitsbezogene Belastungen bei Aufnahme <strong>und</strong> vor<br />
Entlassung sowie die Differenzbildung, Prognose der Erwerbsfähigkeit, Festsetzung<br />
<strong>und</strong>/oder Erreichung von Zielen der Rehabilitation im somatischen, funktionalen,<br />
psychosozialen <strong>und</strong> im edukativen Bereich.<br />
Die Patientenangaben beinhalten im einzelnen: Erwartungen der Patienten an den<br />
Klinikaufenthalt, die körperliche <strong>und</strong> psychische Skala <strong>des</strong> <strong>SF12</strong>, berufsfördernde<br />
Maßnahmen in den letzten 12 Monaten, Arbeitstätigkeit, Subskalen <strong>des</strong> FKV, soziale<br />
Unterstützung, Grad der Schwerbehinderung, subjektive Einschätzung der derzeitigen<br />
Arbeitsfähigkeit, Rentenwunsch, Länge <strong>des</strong> Arbeitsweges, Dauer der Arbeitsunfähigkeit<br />
in den letzten 12 Monaten, Sorgen um den Arbeitsplatz, Beratungswunsch<br />
in beruflicher Hinsicht, das Alter <strong>und</strong> das Geschlecht.<br />
Um den Stichprobeneffekt zu reduzieren, wurde eine Kreuzvalidierung durchgeführt.<br />
Hierbei wurde die Gesamtstichprobe im Verhältnis 60:40 durch Zufallsauswahl in<br />
zwei Teile unterteilt. Die größere Substichprobe besteht aus n=210 Personen (60,7<br />
%), die kleinere Gruppe aus n=136 (39,3 %). Es traten keine statistisch bedeutsamen<br />
Unterschiede in den untersuchten Variablen zwischen diesen beiden Gruppen auf.<br />
Die so entstandene größere Substichprobe diente der Gewinnung einer Regressionsgleichung,<br />
die in der zweiten Substichprobe überprüft werden sollte. In Tabelle<br />
11a sind die in der ersten Substichprobe als statistisch bedeutsam gef<strong>und</strong>enen Variablen<br />
mit ihren jeweiligen Parametern zusammengefasst.<br />
98
Tabelle 11a: Einflussvariablen der Risikoeinschätzung durch den Arzt<br />
Schritt Variable B* SE(B)* β* T* Sig.*<br />
1 Allg. Leistungsfähigkeit bei Aufnahme -.32 .12 -.22 -2.65
Tabelle 11c: Aufgeklärte Varianz (Regression 1)<br />
R R-Quadrat Korrigiertes R-<br />
Modell Kreuzvalidierung<br />
Ungefähr 60 % der<br />
Fälle (Stichprobe) =<br />
1,00 (ausgewählt)<br />
Kreuzvalidierung<br />
Ungefähr 60 % der<br />
Fälle (Stichprobe)<br />
~= 1,00 (Auswahl<br />
aufgehoben)<br />
Quadrat<br />
Standardfehler<br />
<strong>des</strong> Schätzers<br />
1 ,516 ,266 ,262 1,10<br />
2 ,591 ,349 ,342 1,04<br />
3 ,621 ,386 ,377 1,01<br />
4 ,642 ,413 ,401 ,99<br />
5 ,660 ,436 ,421 ,97<br />
6 ,688 ,473 ,457 ,94<br />
7 ,699 ,489 ,471 ,93<br />
8 ,708 ,501 ,480 ,92<br />
9 ,717 ,514 ,491 ,91<br />
10 ,724 ,525 ,500 ,90<br />
11 ,734 ,590 ,539 ,513 ,89<br />
Die Analyse ergab weiterhin, dass die so gef<strong>und</strong>ene Regressionsgleichung in der<br />
zweiten Substichprobe (Kreuzvalidierung) nur einen geringeren Teil der Varianz aufklären<br />
konnte (34,8 % in Gruppe 2). Daher wurde eine Regressionsgleichung auch in<br />
dieser Substichprobe ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 12a zusammengefasst.<br />
Tabelle 12a: Einflussvariablen der Risikoeinschätzung durch den Arzt<br />
Schritt Variable B* SE(B)* β* T* Sig.*<br />
1 Schweregrad der Asthmaanfälle .84 .15 .38 5.47
heitsprognose, eine schlechtere Zielerreichung auf funktionaler Ebene, ein höherer<br />
Schweregrad der Atemwegserkrankung <strong>und</strong> eine geringere allgemeine Leistungsfähigkeit<br />
mit der Einschätzung <strong>des</strong> Patienten als Risikopatienten zusammen.<br />
Aus den Patientenvariablen wurden eine höhere Patientenerwartung von Kontakten<br />
mit anderen Patienten, eine geringere Erwartung von Erholung während der Rehabilitation<br />
sowie eine höhere Patientenerwartung <strong>des</strong> Abstand Gewinnens durch die<br />
Rehabilitation als statistisch bedeutsam gef<strong>und</strong>en.<br />
Mit den statistisch bedeutsamen Variablen können in dieser Substichprobe 54,7 %<br />
der Varianz der Risikoeinschätzung erklärt werden (korrigiertes R 2 ). Sie erweisen<br />
sich jedoch aufgr<strong>und</strong> der gef<strong>und</strong>enen Merkmale der ersten Gruppe (R 2 27,9 %) als<br />
schwierig interpretierbar. Die Varianzaufklärung zwischen den einzelnen Schritten ist<br />
aus Tabelle 12c zu entnehmen.<br />
Tabelle 12c: Aufgeklärte Varianz (Regression 2)<br />
R R-Quadrat Korrigiertes R-<br />
Modell Kreuzvalidierung<br />
Ungefähr 60 % der<br />
Fälle (Stichprobe) =<br />
,00 (ausgewählt)<br />
Kreuzvalidierung<br />
Ungefähr 60 % der<br />
Fälle (Stichprobe)<br />
~= ,00 (Auswahl<br />
aufgehoben)<br />
Quadrat<br />
Standardfehler<br />
<strong>des</strong> Schätzers<br />
1 ,559 ,312 ,307 1,11<br />
2 ,635 ,403 ,394 1,04<br />
3 ,670 ,449 ,436 1,00<br />
4 ,694 ,481 ,464 ,98<br />
5 ,708 ,502 ,482 ,96<br />
6 ,725 ,525 ,502 ,94<br />
7 ,735 ,541 ,515 ,93<br />
8 ,749 ,561 ,532 ,91<br />
9 ,760 ,528 ,578 ,547 ,90<br />
Variablen, die sich in beiden Gruppen als bedeutsam herausgestellt haben, sind ein<br />
höherer Schweregrad der Krankheit, eine schlechtere Prognose <strong>und</strong> eine geringere<br />
Leistungsfähigkeit. Patientenerwartungen scheinen auch eine Rolle zu spielen, können<br />
aber nicht in allen Details übereinstimmend in beiden Gruppen identifiziert werden.<br />
Diese unterschiedlichen Ergebnisse müssen vor dem Hintergr<strong>und</strong> interpretiert<br />
werden, dass in der kleineren Gruppe weniger Patienten erfasst wurden. Insgesamt<br />
spielen demnach neben dem Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigung der Patienten<br />
auch Patientenerwartungen <strong>und</strong> möglicherweise auch die Art der Krankheitsverarbeitung<br />
bei der Einordnung eines Patienten in die Risikogruppe für den Arzt eine<br />
Rolle.<br />
101
4.4. Entwicklung eines Assessmentinstrumentes<br />
Die folgende Darstellung dient der Beantwortung der dritten Fragestellung <strong>des</strong> Forschungsprojektes.<br />
Diese beinhaltet die Frage, wie die in der Gesamtgruppe der Patienten<br />
mit chronischen Erkrankungen der Lunge- <strong>und</strong> der Atemwege vorhandene<br />
Teilgruppe mit erhöhtem Risiko zur vorzeitigen Berentung frühzeitig durch ein geeignetes<br />
Screeninginstrument identifiziert werden kann.<br />
Als Basis dienen hierzu die in den verschiedenen Teilbefragungen <strong>des</strong> Projektes<br />
festgestellten Prädiktoren (vgl. Tab. 13) <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Erhebungsinstrumente.<br />
Auf der somatischen Ebene kristallisieren sich hierbei neben der Krankheitsdauer<br />
<strong>und</strong> dem Schweregrad der Erkrankung unterschiedliche allgemeine <strong>und</strong> symptombezogene<br />
Parameter als Risikofaktoren heraus.<br />
Auf der funktionalen Ebene sind dies durchweg die bereits vorliegende Schwerbehinderung<br />
<strong>und</strong> die AU-Zeiten. Daneben spielen unterschiedliche Aspekte der allgemeinen<br />
<strong>und</strong> beruflichen Leistungsfähigkeit, Arbeitsbelastungen <strong>und</strong> krankheitsbedingte<br />
berufliche Sorgen <strong>und</strong> Veränderungen eine Rolle.<br />
Auf der psychosozialen Ebene sind insbesondere Einschränkungen in unterschiedlichen<br />
Aspekten der Lebensqualität, das Ausmaß der Krankheitsbewältigung <strong>und</strong> die<br />
gewählten Strategien hierzu sowie das Erleben der Krankheitssymptomatik <strong>und</strong> unterschiedliche<br />
Erwartungen der Patienten an die Rehabilitationsbehandlung zu nennen.<br />
Auf der behandlungsbezogenen Ebene ergeben sich Hinweise dafür, dass neben<br />
der Anzahl der notwendigen Behandlungen bei einem Pneumologen <strong>und</strong> Allgemeinmediziner<br />
die adäquate lungenfachärztliche Behandlung von Bedeutung ist.<br />
Bei der Entwicklung <strong>des</strong> Screeninginstrumentes wurden unter Beachtung <strong>des</strong> Umfanges<br />
<strong>und</strong> der Praktikabilität die relevanten Prädiktoren der unterschiedlichen Ebenen<br />
einbezogen (vgl. Tab. 13). In einer Kurzfassung <strong>des</strong> Instrumentes wurden nur<br />
die Prädiktoren integriert, die für die Gesamtgruppe (ohne Altersstratifizierung) Bedeutung<br />
erlangten. Aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> im Projekt integrierten berufsbezogenen Beratungskonzepts<br />
(Interventionsebene) wurden diese Prädiktoren um wesentliche Aspekte<br />
der Rehabilitationsmotivation <strong>und</strong> <strong>des</strong> Beratungsbedarfs ergänzt. Die Kurzfassung<br />
enthält folgende Bereiche:<br />
• Erwartungen an den Klinikaufenthalt<br />
• Beschwerden <strong>und</strong> Belastungen<br />
• Ambulante <strong>und</strong> stationäre Behandlungen<br />
• Berufliche Situation<br />
• Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit<br />
• Beratungswünsche<br />
• Alter<br />
102
Tabelle 13: Prädiktoren zur Vorhersage der Antragstellung/Frühberentung 1<br />
Basisstudien (t1) Patienten Nachbefragung (t2) – Patienten Befragung berufliche Hilfen - Patient <strong>und</strong> Arzt<br />
Somatisch • Krankheitsdauer<br />
• Höheres Alter<br />
Funktional • Schwerbehinderung<br />
• Arbeitsfähigkeit<br />
• AU-Zeiten<br />
Psychosozial • Zufriedenheit mit der Freizeit<br />
• Zufriedenheit mit der Stimmung<br />
• Zufriedenheit mit eigenem Charakter<br />
• Zufriedenheit mit Partnerschaft<br />
• Religiosität/Sinnsuche<br />
Behandlung • Anzahl Behandlungen beim<br />
Allgemeinmediziner<br />
• In pneumologischer Behandlung<br />
bzw. Anzahl Behandlungen bei<br />
einem Pneumologen<br />
• Höheres Alter<br />
• Belastungen durch Atemwegserkrankung<br />
• Belastungen durch Nebenwirkungen der<br />
Behandlung<br />
• Häufige Atemnot<br />
• Schwerbehinderung<br />
• Berufliche Belastung insgesamt<br />
• Quantitative Überforderung<br />
• Belastung durch Störungen/Unterbrechungen bei der Arbeit<br />
• Belastung durch maschinenbestimmtes Arbeitstempo<br />
• Belastungen durch Verhältnis zu Kollegen<br />
• Stärkere Belastung durch die Arbeit<br />
• Belastungen durch Kontrollen <strong>des</strong> Vorgesetzten<br />
• Geringerer Verdienst als vorher<br />
• Gefährdung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes durch die Erkrankung<br />
• Einschränkung berufliches Weiterkommen<br />
• Sorgen, weniger zu verdienen<br />
• Berufliche Veränderungen durch Krankheit<br />
• Allgemeine Leistungsfähigkeit<br />
• Berufliche Leistungsfähigkeit<br />
• AU-Zeiten<br />
• Müdigkeit (ASL)<br />
• Abfinden mit der chronischen Erkrankung<br />
• Zufriedenheit mit Sozialkontakten<br />
• Zufriedenheit mit eigenen Fähigkeiten<br />
• Soziale Unterstützung<br />
• Coping – Wunschdenken <strong>und</strong> Tagträume<br />
1 Fette Darstellung: Prädiktoren für die Gesamtgruppe (ohne Altersstratifizierung) für Basisstudien <strong>und</strong> Nachbefragung<br />
103<br />
• Schweregrad der Asthmaanfälle<br />
• Krankheitsprognose (Entlassung)<br />
• Krankheitsschweregrad (Entlassung)<br />
• Allgemeine Leistungsfähigkeit (Aufnahme)<br />
• Zielerreichung auf der funktionalen Ebene<br />
• Lebensqualität allgemein (Aufnahme)<br />
• Compliance (Aufnahme)<br />
• Krankheitsbewältigung<br />
• Krankheitsverarbeitung: Wunschdenken <strong>und</strong> Tagträume<br />
• Krankheitsverarbeitung: Grübeln<br />
• Reha-Ziel im somatischen Bereich<br />
• Patientenerwartung ‚Aufbau Selbstvertrauen’<br />
• Patientenerwartung ‚Besprechung arbeits-<br />
sozialrechtlicher Fragen’<br />
• Patientenerwartung ‚Kontakt mit anderen<br />
Patienten’<br />
• Patientenerwartung ‚Abstand gewinnen’
Daneben wurde eine Langfassung <strong>des</strong> Fragebogens entwickelt, in die auch die<br />
Prädiktoren der altersstratifizierten Subgruppen integriert wurden (vgl. Tab. 13 <strong>und</strong><br />
Anhang 10.2.). Vor dem Hintergr<strong>und</strong> <strong>des</strong> umfassenden Rehabilitationsmodells der<br />
ICF (WHO 2001, Schuntermann 2003) <strong>und</strong> der sozialmedizinischen Relevanz von<br />
Erkrankungen der Lunge <strong>und</strong> der Atemwege wurde einer umfassenden Abbildung<br />
<strong>des</strong> beruflichen Bereiches <strong>und</strong> seiner Einflussfaktoren Vorrang gegeben. Dies bedeutet,<br />
dass nicht alleine die Einzelprädiktoren, sondern jeweils die Bereiche in den<br />
Fragebogen aufgenommen wurden.<br />
In das Screeninginstrument wurden erprobte selbstentwickelte Verfahren <strong>und</strong> standardisierte<br />
Fragebogen bzw. Subskalen 2 aus diesen zusammengefasst (vgl. Tab.<br />
14).<br />
Der Fragebogen zu berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden <strong>und</strong> Belastungen<br />
enthält in der Langfassung folgende Bereiche:<br />
• Erwartungen an den Klinikaufenthalt: hierbei wurde der erste Teil <strong>des</strong> FREM-<br />
17 (Deck et al. 1998a,b) eingesetzt. Auf den zweiten Teil, der die Wichtigkeit der<br />
Erfüllung der Erwartungen beinhaltet wurde verzichtet, da sich in der Vorbefragung<br />
durchweg Korrelationen von > .90 zwischen Erwartung <strong>und</strong> Wichtigkeit der<br />
Erfüllung ergaben<br />
• Belastungen <strong>und</strong> Beschwerden: Neben der Krankheitsdiagnose, möglichen<br />
Nebenerkrankungen <strong>und</strong> der Krankheitsdauer werden hier krankheitsbedingte<br />
Belastungen in unterschiedlichen Lebensbereichen, Erleben der asthmatischen<br />
Symptome (ASL von Kinsman et al. 1974), Angst <strong>und</strong> Depression (BSI von Derogatis<br />
et al. 1977), aktuelle körperliche <strong>und</strong> seelische Belastung<br />
• Behandlungen: Behandlungen in den letzten 12 Monaten, Inanspruchnahme von<br />
Ärzten <strong>und</strong> Therapeuten, Zufriedenheit mit medizinischer Versorgung zu Hause,<br />
AU-Zeiten, Rehabilitationsmaßnahme, Medikamentenkonsum zur Beschreibung<br />
<strong>des</strong> Krankheitsschweregrads, aktuelle Symptomatik unter dieser Medikation,<br />
Compliance, Einschätzung der Krankheitsprognose<br />
• <strong>und</strong> Lebensereignisse:<br />
• Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> soziale Unterstützung: Strategien zur Krankheitsverarbeitung<br />
(FKV-LIS von Muthny 1989), Ausmaß der Krankheitsbewältigung,<br />
Quellen <strong>und</strong> Ausmaß der sozialen Unterstützung<br />
• Berufliche Situation: Berufsausbildung, Erwerbstätigkeit <strong>und</strong> berufliche Stellung,<br />
Antrag zur Frühberentung, Teilnahme an Bf-Maßnahmen, Arbeitsfähigkeit,<br />
Schwerbehinderung/GdB, Arbeitsbedingungen, berufliche Veränderungen durch<br />
die Erkrankung, Qualitative <strong>und</strong> Quantitative Überforderung (SAA von Martin et<br />
al. 1980), Sorgen um die berufliche Zukunft, Arbeitszufriedenheit,<br />
• Lebenszufriedenheit: aktuelle Zufriedenheit in unterschiedlichen Bereichen der<br />
Lebensqualität (LZI von Muthny 1991)<br />
2 Durch die Integration von Fragebogen bzw. Subskalen aus Fragebogen (vgl. Tab. 14) anderer Autoren<br />
muss das Recht zur Verwendung dieser Instrumente vor einer Erprobung der Langfassung mit<br />
den Autoren <strong>und</strong> dem Hogrefe-Verlag abgesprochen werden. Bei einer entsprechenden Einigung<br />
erfolgt im Instrument jeweils die Quellenangabe.<br />
104
• Beratungswünsche im beruflichen Bereich<br />
• Angaben zur Person:<br />
• Soziodemographische Daten: Alter, Geschlecht, Nationalität, Familienstand,<br />
Partnerschaft, Kinderzahl, Personen im Haushalt, Schulabschluss, Kostenträger<br />
der Rehabilitationsmaßnahme<br />
Tab. 14: Integrierte Instrumente/Subskalen im Screeninginstrument<br />
Titel <strong>des</strong><br />
Kurzbezeich- Autor / Jahr Erhobene Kriterien<br />
Instruments<br />
nung<br />
Rehamotivation <strong>und</strong> Erwar- FREM-17 Deck et al. Rehamotivation, Erwartungen<br />
tungen an die Rehabilitation<br />
1998 (a,b)<br />
Asthmasymptomliste ASL Kinsman et al.<br />
1974<br />
Brief-Symptom-Inventory<br />
(Kurzform <strong>des</strong> SCL-90 R)<br />
Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung<br />
Subjektive Arbeitsanalyse<br />
(2 Subskalen)<br />
Lebenszufriedenheits-inventar<br />
BSI Derogatis et al.<br />
1977<br />
<strong>Körperliche</strong> Beschwerden, Symptome,<br />
<strong>und</strong> Empfindungen der asthmatischen<br />
Atemnot<br />
Subskalen Depression <strong>und</strong> Angst<br />
FKV-LIS Muthny 1989 Strategien der Krankheitsverarbeitung<br />
SAA Martin et al. 1980 Quantitative <strong>und</strong> qualitative Überforderung<br />
durch die Arbeit<br />
LZI Muthny 1991 Teilbereiche der Lebensqualität<br />
105
Fragebogen zu berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen bei Erkrankungen der<br />
Lunge- <strong>und</strong> der Atemwege<br />
- Kurzfassung -<br />
U. Kaiser<br />
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Liebe Patientin, lieber Patient, Pat.-ID: __________<br />
wie wir Ihnen in einem Informationsschreiben mitgeteilt haben, möchten wir mit diesem Fragebogen<br />
erreichen, dass wir bereits zu Beginn Ihres Klinikaufenthaltes über Ihre berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen sowie Ihre Erwartungen an den Aufenthalt bei uns informiert sind.<br />
Die Fragen beziehen sich auf Ihre Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ihre berufliche Situation <strong>und</strong> wie Sie damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Schwierigkeiten <strong>und</strong> Belastungen bewältigen. Um Ihnen umfassend helfen zu können, benötigen<br />
wir vollständige Angaben. Nehmen Sie sich bitte genügend Zeit, den Fragebogen auszufüllen <strong>und</strong><br />
beantworten Sie die Fragen bitte so offen <strong>und</strong> ehrlich wie möglich.<br />
Wir möchten Ihnen nun noch die Fragentypen erklären, denen Sie im Laufe der Bearbeitung <strong>des</strong> Fragebogens<br />
begegnen werden:<br />
1. Fragen, die Sie einfach mit „ja“ oder „nein“ beantworten sollen (Zutreffen<strong>des</strong> soll jeweils angekreuzt<br />
werden)<br />
2. Fragen, die ganz offen gestellt sind, d.h. nach der Frage haben wir einfach eine oder mehrere<br />
Zeilen Platz gelassen, in die Sie bitte Ihre Antwort stichwortartig hineinschreiben.<br />
3. Bei manchen Fragen bitten wir Sie, einzuschätzen, wie stark etwas für Sie zutrifft, z.B.: wie stark<br />
Ihre Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen behindert haben. Wir fragen dann meist in einer<br />
5-stufigen Skala wie folgt:<br />
Beispiel:<br />
Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten<br />
zu Hause <strong>und</strong> im Beruf behindert? (Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an)<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
überhaupt ein mäßig ziemlich sehr<br />
nicht bisschen<br />
Bei Fragetypen, bei denen mehrere Antwortmöglichkeiten vorgesehen sind, können Sie bei jedem<br />
zutreffenden Kästchen ein Kreuz machen. Bei Bezug auf einen bestimmten Zeitraum ist dieser jeweils<br />
im Text der Frage besonders hervorgehoben.<br />
Bitte überlegen Sie bei den Antworten nicht lange, sondern kreuzen Sie möglichst spontan das Kästchen<br />
an, das nach Ihrem Gefühl am ehesten zutrifft.<br />
Diese Hinweise sind lediglich als Vorinformation gedacht. Bei den Fragen im Fragebogen wird bei<br />
Abweichungen von dem hier erklärten Prinzip im einzelnen deutlich gemacht, wie sie beantwortet<br />
werden sollen.<br />
Wir bitten Sie, jetzt mit der Bearbeitung zu beginnen.<br />
Vielen Dank!<br />
106
Erwartungen an den Klinikaufenthalt<br />
1.) Im folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, mit denen Patienten ihre Erwartungen <strong>und</strong><br />
Wünsche an den Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik beschrieben haben. Sicherlich sind<br />
auch Sie mit bestimmten Erwartungen <strong>und</strong> Wünschen in diese Klinik gekommen.<br />
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Aussagen der Reihe nach durch <strong>und</strong> kreuzen Sie bei jeder<br />
Aussage an, in welchem Maße die genannten Erwartungen <strong>und</strong> Wünsche auf Sie zutreffen.<br />
Falls die Aussagen nicht auf Sie zutreffen, kreuzen Sie bitte in der rechten Spalte an.<br />
Ich erwarte, dass... stimmt<br />
genau<br />
stimmt<br />
überwiegend<br />
stimmt eher<br />
nicht<br />
stimmt<br />
überhaupt<br />
nicht<br />
trifft auf<br />
mich nicht<br />
zu<br />
ich Abstand vom Alltag gewinne � � � � �<br />
ich mich erhole � � � � �<br />
ich mich eine Zeitlang um nichts<br />
kümmern muss<br />
� � � � �<br />
der Kurort ansprechend ist � � � � �<br />
es möglich ist, auch außerhalb<br />
der Rehabilitation etwas zu unternehmen<br />
man mir eine genaue Diagnose<br />
mitteilt<br />
ich meine körperliche Leistungsfähigkeit<br />
erhöhen kann<br />
ich bald wieder wie früher arbeiten<br />
kann<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
ich lerne, gesünder zu leben � � � � �<br />
ich Kontakt zu Patienten mit gleichen<br />
oder ähnlichen Problemen<br />
bekomme<br />
mein Selbstvertrauen gestärkt<br />
wird <strong>und</strong> dass man mir Mut macht<br />
ich beruflichen Stress abbauen<br />
kann<br />
ich lerne, mir mehr Freizeit zu<br />
nehmen <strong>und</strong> sie für mich zu nutzen<br />
man mir bei arbeits- <strong>und</strong> sozialrechtlichen<br />
Fragen hilft<br />
man mir bei einer Rentenantragstellung<br />
hilft<br />
ich meine verminderte Leistungsfähigkeit<br />
hier bestätigt bekomme<br />
man mich über berufliche Umschulungsmöglichkeiten<br />
informiert<br />
<strong>und</strong> berät<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
107
Beschwerden <strong>und</strong> Belastungen<br />
2.) Denken Sie bitte an die letzten 12 Monate: Erinnern Sie sich bitte, wie es Ihnen in diesem Zeitraum<br />
ging, wie Sie sich gefühlt haben oder wo Sie Probleme hatten. Bitte kreuzen Sie für jeden<br />
Sachverhalt an, wie stark Sie unter möglichen Einschränkungen leiden bzw. welche Probleme Sie<br />
in bestimmten Bereichen in den letzten 12 Monaten hatten.<br />
Leiden unter ... bzw.<br />
Beeinträchtigung<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig mittel ziemlich<br />
Einschränkungen in der allg. Leistungsfähigkeit � � � � �<br />
Einschränkungen in der berufl. Leistungsfähigkeit � � � � �<br />
Einschränkungen in der Arbeitsfähigkeit � � � � �<br />
3.) Sie finden nachfolgend eine Liste mit Empfindungen <strong>und</strong> Symptomen, die viele Patienten während<br />
asthmatischer Beschwerden angeben. Geben Sie bitte an, wie häufig dies bei asthmatischen<br />
Problemen auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie alle Punkte, lassen Sie keinen aus.<br />
Nie selten gelegentlich oft immer<br />
Träge � � � � �<br />
Müde � � � � �<br />
abgespannt � � � � �<br />
Lahm � � � � �<br />
Schläfrig � � � � �<br />
Behandlungen in den letzten 12 Monaten<br />
4.) Welche Behandlungen haben Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt wegen Ihrer Atemwegserkrankung<br />
in Anspruch nehmen müssen?<br />
Häufigkeit<br />
Wie häufig haben Sie einen Arzt für Allgemeinmedizin aufgesucht? ca. ___________ mal<br />
Wie häufig haben Sie einen Lungenfacharzt aufgesucht? ca. ___________ mal<br />
Wie häufig waren Sie stationär im Krankenhaus aufgenommen? ca. ___________ mal<br />
Wie viel Tage waren Sie stationär im Krankenhaus aufgenommen? ca. ___________ Tage<br />
Wie häufig mussten Sie den Notarzt anrufen? ca. ___________ mal<br />
Wie häufig mussten Sie als Notfall in eine Klinik eingeliefert werden? ca. ___________ mal<br />
Wie oft mussten Sie auf der Intensivstation beatmet werden? ca. ___________ mal<br />
5.) Bei welchen Ärzten/Therapeuten waren Sie in den letzten 12 Monaten in Behandlung?<br />
Allgemeinmediziner niedergelassener Lungenfacharzt<br />
Internist Neurologe/Psychiater<br />
Urologe Gynäkologe<br />
Hautarzt Orthopäde<br />
Psychotherapeut nicht in Behandlung<br />
Sonstige: ________________________________________________________________<br />
108<br />
sehr<br />
stark
6.) Sind Sie zur Zeit krankgeschrieben? � nein � ja<br />
7.) Waren Sie in den letzten 12 Monaten krankgeschrieben?<br />
� nein, ich war in den letzten 12 Monaten nicht krankgeschrieben<br />
� ja, an insgesamt ...............Tagen<br />
Berufliche Situation<br />
8.) Wie würden Sie Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit beurteilen (ungeachtet, ob Sie einer konkreten<br />
Erwerbstätigkeit nachgehen oder nicht)? Bitte machen Sie auf der folgenden Skala an der<br />
entsprechenden Stelle ein Kreuz (Das Kreuz kann auch zwischen den Linien liegen)!<br />
|----------- | ----------- | -----------|----------- |<br />
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %<br />
9.) Besitzen Sie einen Schwerbehindertenausweis?<br />
� nein<br />
� beantragt<br />
� ja; mit welchem Behinderungsgrad? ................%<br />
10.) Haben Sie infolge der Atemwegserkrankung berufliche Veränderungen erfahren? Geben Sie<br />
bitte an, inwieweit nachfolgende Aussagen auf Sie zutreffen:<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig mittel stark sehr<br />
stark<br />
Ich fühle mich durch die Arbeit stärker belastet � � � � �<br />
Ich habe schon eine berufliche Rückstufung<br />
hinnehmen müssen<br />
� � � � �<br />
Ich habe einen geringeren Verdienst � � � � �<br />
Mein berufliches Weiterkommen ist eingeschränkt � � � � �<br />
Mein Arbeitsplatz ist gefährdet � � � � �<br />
Ich muss mich verstärkt gegen Konkurrenz<br />
behaupten<br />
� � � � �<br />
Ich arbeite weniger als vor der Erkrankung � � � � �<br />
Ich bin schon an einen anderen Arbeitsort versetzt<br />
worden<br />
Ich habe eine andere Tätigkeit als vor der<br />
Erkrankung<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
Ich habe mehr Pausen als vorher � � � � �<br />
Ich habe auf einen anderen Beruf umgeschult � � � � �<br />
Mein Verhältnis zu Kollegen hat sich verschlechtert � � � � �<br />
Sonstiges:<br />
________________________________________<br />
109<br />
� � � � �
11.) Wie häufig machten Sie sich in den letzten 12 Monaten Sorgen, dass Sie wegen Ihres Ges<strong>und</strong>heitszustan<strong>des</strong><br />
...<br />
Nicht bis zum Erreichen <strong>des</strong> Rentenalters berufstätig<br />
sein zu können?<br />
Ihre Erwerbsfähigkeit/Ihr Verbleib im Beruf dauerhaft<br />
gefährdet ist?<br />
Sich überlegen, einen Antrag zur Frühberentung zu<br />
stellen?<br />
nie manchmal oft immer<br />
12.) Insgesamt betrachtet, wie stark fühlen Sie sich durch Ihre Erkrankung im Beruf belastet?<br />
Zutreffen<strong>des</strong> bitte ankreuzen.<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
gar nicht wenig mittel ziemlich sehr stark<br />
Bitte kurz erläutern:<br />
_________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit<br />
13.) Wie gut sind Sie insgesamt seelisch mit der Erkrankung <strong>und</strong> Behandlung fertig geworden?<br />
Zutreffen<strong>des</strong> bitte ankreuzen.<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
gar nicht wenig mittel ziemlich sehr gut<br />
14.) Wir möchten nun noch ein paar Fragen zu Ihrer Lebenszufriedenheit stellen. Sie finden in der<br />
folgenden Tabelle verschiedene Bereiche der Lebensqualität. Bitte kreuzen Sie das momentane<br />
Ausmaß an, das Ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem jeweiligen Bereich<br />
entspricht. Bitte lassen Sie keinen Bereich aus:<br />
sehr<br />
zufrieden<br />
eher<br />
zufrieden<br />
weder<br />
noch<br />
eher<br />
unzufrieden<br />
sehr<br />
unzufrieden<br />
Stimmung � � � � �<br />
Freizeitgestaltung � � � � �<br />
Mit dem Leben insgesamt � � � � �<br />
Beratungswünsche für die anstehende Rehabilitationsmaßnahme:<br />
15.) Würden Sie sich generell für sich selbst eine ausführliche Beratung zu Themen im Zusammenhang<br />
mit Ihrer beruflichen Situation oder Perspektive wünschen?<br />
------------- ------------- -------------- --------------<br />
gar nicht eher nein mittel eher ja ja, sehr<br />
110
16.) Zu welchen Themen würden Sie im Verlauf der Rehabilitationsmaßnahme gerne beraten<br />
werden?<br />
Themenbereich<br />
Allergien <strong>und</strong> die daraus folgenden Einschränkungen<br />
am Arbeitsplatz<br />
Zusammenhänge zwischen meiner Atemwegserkrankung<br />
<strong>und</strong> meiner beruflichen Situation<br />
Umgang mit Kollegen im Zusammenhang mit<br />
meiner Erkrankung<br />
Umgang mit Vorgesetzten im Zusammenhang<br />
mit meiner Erkrankung<br />
Zukunftsperspektiven im Berufsleben mit meiner<br />
Erkrankung<br />
nicht notwendig<br />
ja, kurzer Überblick<br />
ja, ausführliche<br />
Beratung<br />
Wie bleibe ich im Beruf ohne mich zu überfordern<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Beantragung der Berentung<br />
Medizinische Rehabilitation<br />
Berufliche Rehabilitation<br />
Weiter-/Fortbildungen<br />
Umschulungsmöglichkeiten<br />
Umgang mit Kollegen/Vorgesetzten<br />
Wer ist mein Ansprechpartner für...?<br />
Weiterführende Kontaktmöglichkeiten (Ämter,<br />
Kassen, Versicherungen, usw.)<br />
Wie geht es weiter?<br />
Kontaktmöglichkeiten vor Ort (Hilfsverbände,<br />
Selbsthilfegruppen, usw.)<br />
17.) Wir bitten Sie, zum Schluss noch ihr Alter in Lebensjahren anzugeben.<br />
Lebensalter in Jahren: ___<br />
Nachdem Sie nun alle Fragen bearbeitet haben, möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass<br />
die Richtigkeit Ihrer Angaben für Ihre umfassende Behandlung von großer Bedeutung ist. Daher<br />
möchten wir Sie bitten, die Fragen noch einmal durchzugehen <strong>und</strong> sie auf die Vollständigkeit der Bearbeitung<br />
<strong>und</strong> die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen.<br />
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!<br />
Falls Sie Anmerkungen haben, können Sie diese hier gerne aufschreiben:<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
111
4.5. Ergebnisse der Expertenbefragung<br />
4.5.1. Pneumologische Fachkliniken<br />
Für diesen Teil der Expertenbefragung liegen Antworten von 35 pneumologischen<br />
Fachkliniken vor (Rücklauf 14,5 % 3 ). Bei den antwortenden Einrichtungen handelt es<br />
sich primär um Kliniken, bei denen pneumologische Erkrankungen einen Teilbereich<br />
<strong>des</strong> Indikationsspektrums darstellen. Der Anteil an Lungen- <strong>und</strong> Atemwegserkrankungen<br />
beträgt durchschnittlich 56,1 % (± 26,2). Während <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes<br />
werden von durchschnittlich 29,9 % (± 27) der Patienten Fragen zu beruflichen Bereichen<br />
thematisiert.<br />
Insgesamt 60 % der Kliniken geben an, berufliche Aspekte in die Gesamtbehandlung<br />
einzubeziehen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei diagnostische Verfahren (Anamnese,<br />
Lungenfunktions- <strong>und</strong> Allergiediagnostik). Bei diesen Einrichtungen werden berufliche<br />
Aspekte der Patienten primär durch Kontakte zu anderen Einrichtungen berücksichtigt<br />
(vgl. Abb. 61). Hierbei stehen Hinweise über geeignete Einrichtungen oder<br />
Überweisungen in die Einrichtungen (MW 3,12 ± .96) <strong>und</strong> patientenbezogene Kontakte<br />
mit diesen Einrichtungen (MW 3,22 ± 1,04) im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Kontakte zu anderen Einrichtungen<br />
Hinweis/Überweisung:<br />
nie/selten<br />
manchmal<br />
häufig/immer<br />
Kontaktaufnahme:<br />
nie/selten<br />
manchmal<br />
häufig/immer<br />
Kooperationspartner:<br />
Berufsbildungswerke<br />
Rentenversicherung<br />
Krankenkassen<br />
Rehakliniken<br />
Arbeitgeber Patienten<br />
Berufsgenossenschaft<br />
Arbeitsamt<br />
Berufsförderungswerke<br />
Werkstätten für Behinderte<br />
Hauptfürsorgestelle/VA<br />
Abbildung 61 (n=35)<br />
pneumologische Kliniken<br />
100<br />
30,3<br />
36,4<br />
33,3<br />
34,4<br />
18,8<br />
46,9<br />
77,1<br />
62,9<br />
51,4<br />
48,6<br />
42,9<br />
37,1<br />
25,7<br />
20<br />
14,3<br />
11,4<br />
80<br />
60<br />
40<br />
Anteile in %<br />
20<br />
42,9<br />
28,6<br />
20 34,3<br />
25,7<br />
17,1<br />
2,9 14,3<br />
11,4<br />
2,9<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anteile in %<br />
Häufigkeit positive Zusammenarbeit<br />
Wie Abbildung 61 verdeutlicht, stehen in der direkten Zusammenarbeit Berufsbildungswerke<br />
(77,1 %), die Rentenversicherung (62,9 %), Krankenkassen (51,4 %),<br />
Rehabilitationskliniken (48,6 %) <strong>und</strong> Arbeitgeber der Patienten (42,9 %) im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Sehr positiv wird dabei die Zusammenarbeit vorwiegend mit Berufsbildungswerken<br />
(42,9 %), Rehabilitationskliniken (34,3 %), der Rentenversicherung (28,6 %) <strong>und</strong> den<br />
Arbeitgebern der Patienten (25,7 %) bewertet.<br />
3 Auf die durch den Rücklauf bedingte fehlende Repräsentativität <strong>und</strong> die hieraus resultierende eingeschränkte<br />
Aussagekraft der gesamten Expertenbefragung wurde in Abschnitt 2 <strong>und</strong> 3.4. bereits hingewiesen.<br />
112
Einrichtungen, die nach eigenen Angaben beruflich orientierte Maßnahmen<br />
durchführen, wurden gebeten, diese zu spezifizieren. Abbildung 62 zeigt, dass es<br />
sich hierbei überwiegend um Beratungsangebote im beruflichen Kontext handelt.<br />
Insgesamt 4 Einrichtungen geben darüber hinaus interne Belastungserprobungen an.<br />
Abbildung 62 (n=35)<br />
Beruflich orientierte Maßnahmen<br />
Beratung in beruflichen Fragen<br />
Rehafachberatung<br />
Berufsberatung<br />
Belastungserprobung (intern)<br />
Förderungsmaßnahmen<br />
Berufsfindung<br />
Arbeitstherapie<br />
Arbeitsplatzsimulation<br />
Belastungserprobung (extern)<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
5<br />
4<br />
14<br />
14<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anzahl der Einrichtungen (MfN möglich)<br />
Die Dauer der Maßnahmen schwankt zwischen 1 <strong>und</strong> 35 Tagen (MW 19,9, ± 11,7).<br />
Im Durchschnitt nehmen 29,9 % (± 27) der pneumologischen Patienten berufliche<br />
Hilfen in Anspruch. Einschlusskriterien in die Maßnahmen sind vorwiegend das Alter,<br />
die Motivation, die Kooperationsfähigkeit, drohende Arbeitsunfähigkeit <strong>und</strong> die Sinnhaftigkeit<br />
einer Umschulung.<br />
Die beteiligten Berufsgruppen setzen sich meist aus Ärzten (45,7 %), Psychologen<br />
(28,6 %) <strong>und</strong> mit jeweils 25,7 % aus Sozialarbeitern <strong>und</strong> Physiotherapeuten zusammen<br />
(vgl. Abb. 63). Daneben werden im Einzelfall Berater der Rentenversicherung,<br />
Ökotrophologen <strong>und</strong> Pädagogen genannt. Die Koordination der Maßnahmen in Form<br />
von Einleitung, Überprüfung <strong>und</strong> Ergebnisbesprechung erfolgt überwiegend durch<br />
ein Team von Ärzten, Psychologen <strong>und</strong> Sozialarbeitern.<br />
113
Abbildung 63 (n=35)<br />
Beteiligte Berufsgruppen<br />
Ärzte<br />
Psychologen<br />
Sozialarbeiter<br />
Physiotherapeuten<br />
Sozialversicherungsfachleute<br />
Arbeitstherapeuten<br />
Lehrer<br />
Sozialpädagogen<br />
5,7<br />
5,7<br />
11,4<br />
11,4<br />
28,6<br />
25,7<br />
25,7<br />
45,7<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Nennungen in % (MfN möglich)<br />
Die Effektivität der selbst durchgeführten Maßnahmen wurde von den Einrichtungen<br />
auf einer fünfstufigen Skala (1=ineffektiv – 5=sehr effektiv) bewertet. Insgesamt 20 %<br />
bewerten die Angebote dabei als ineffektiv. Jeweils 40 % geben eine mittlere bis sehr<br />
hohe Effektivität an (MW 3,20 ± .79). Die Ineffektivität wird dabei in Einzelaussagen<br />
mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation, fehlender Unterstützung <strong>und</strong> einer<br />
mangelnden Umsetzung der Empfehlungen beschrieben.<br />
Im letzten Teil der Befragung wurden die Einrichtungen gebeten, die Relevanz der<br />
verstärkten Berücksichtigung beruflicher Aspekte im Rehabilitationsprozess unter<br />
Einbeziehung der beteiligten Einrichtungen zu bewerten.<br />
Die Notwendigkeit einer verstärkten Einbindung beruflicher Aspekte in den Rehabilitationsprozess<br />
wird dabei von 82,4 % der Einrichtungen als sehr hoch eingeschätzt<br />
(MW 4,29 ± .91). Dabei geben 59,4 % der Einrichtungen an, dass hierzu geeignete<br />
Untersuchungen zur Früherkennung von beruflichen Problemen insgesamt hilfreich<br />
wären (MW 3,69 ± 1,09). Bezogen auf die eigenen Patienten weisen nach Auffassung<br />
der Befragten 28,2 % (± 20,1) ein erhöhtes Risiko zur vorzeitigen Berentung<br />
auf.<br />
Zur Abbildung der Effektivität beruflicher Ansätze im Rehabilitationsprozess wurden<br />
die Befragten gebeten, auf einer fünfstufigen Skala (1=sehr schlecht – 5=sehr gut)<br />
die diesbezügliche Qualität für die unterschiedlichen Beteiligten anzugeben. Abbildung<br />
64 zeigt, dass nach Auffassung der Befragten die beste Qualität durch stationäre<br />
Rehabilitationseinrichtungen (68 %), Fachärzte (48,1 %), Berufsgenossenschaften<br />
(47,1 %) <strong>und</strong> die Rentenversicherungsträger (43,5 %) gewährleistet wird.<br />
Trotz einer wesentlichen Beteiligung bei beruflichen Fragestellungen wird insbesondere<br />
dem Arbeitsamt (3,8 %) keine hohe Effizienz unterstellt.<br />
114
Versorgungsstruktur pneumologische Rehabilitation<br />
Effektivität beruflicher Maßnahmen aus der Sicht<br />
pneumologischer Kliniken<br />
stationäre Rehaeinrichtungen<br />
Fachärzte<br />
Berufsgenossenschaften<br />
Rentenversicherung<br />
stationäre Akuteinrichtungen<br />
Berufsbildungswerke<br />
Berufsförderungswerke<br />
teilstationäre Einrichtungen<br />
Krankenkassen<br />
ambulante Einrichtungen<br />
Hauptfürsorgestellen/VA<br />
Arbeitsamt<br />
Abbildung 64 (n=35)<br />
53,3<br />
57,7<br />
50<br />
47,6<br />
37<br />
40<br />
35,7<br />
35,7<br />
40<br />
12<br />
14,3<br />
17,4<br />
3,8<br />
12,5<br />
9,5<br />
48,1<br />
47,1<br />
43,5<br />
40<br />
35,7<br />
28,6<br />
26,7<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
24<br />
schlecht (in %) gut (in %)<br />
Neben dieser Bewertung <strong>des</strong> Ist-Zustan<strong>des</strong> wurden die Befragten gebeten, die Wichtigkeit<br />
der unterschiedlichen Institutionen im Rehabilitationsprozess in Bezug auf berufliche<br />
Aspekte i.S.v. Hilfen zur beruflichen (Re-)Integration zu bewerten (1=völlig<br />
unwichtig – 5=sehr wichtig). Die in Abbildung 65 dargestellten Ergebnisse zeigen,<br />
dass allen beteiligten Institutionen eine mehr oder minder starke Bedeutung zugewiesen<br />
wird. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei die Berufsgenossenschaften (83,9 %),<br />
Fachärzte (82,8 %), stationäre Rehabilitationseinrichtungen (81,2 %) <strong>und</strong> die Rentenversicherung<br />
(77,4 %). Bis auf wenige Ausnahmen ergeben sich im Vergleich der<br />
von den Befragten bewerteten Effektivität der bisherigen Angebote <strong>und</strong> der Wichtigkeit<br />
in den Bereichen signifikante Unterschiede.<br />
Versorgungsstruktur pneumologische Rehabilitation<br />
Wichtigkeit in Bezug auf berufliche Aspekte aus der Sicht<br />
pneumologischer Kliniken<br />
Berufsgenossenschaften<br />
Fachärzte<br />
stationäre Rehaeinrichtungen<br />
Rentenversicherung<br />
Krankenkassen<br />
ambulante Einrichtungen<br />
Berufsförderungswerke<br />
Arbeitsamt<br />
Beratungsstellen<br />
Berufsbildungswerke<br />
teilstationäre Einrichtungen<br />
stationäre Akuteinrichtungen<br />
Hauptfürsorgestellen/VA<br />
Abbildung 65 (n=35)<br />
40<br />
33,3<br />
13,8<br />
16,1<br />
25<br />
6,3<br />
6,5<br />
9,4<br />
10<br />
12<br />
13,3<br />
13,3<br />
0<br />
30<br />
43,3<br />
60<br />
68<br />
64,5<br />
58,1<br />
57,1<br />
56,7<br />
53,3<br />
83,9<br />
82,8<br />
81,2<br />
77,4<br />
71,9<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
unwichtig (in %) wichtig (in %)<br />
115<br />
***<br />
***<br />
**<br />
**<br />
***<br />
***<br />
**<br />
***<br />
**<br />
***
Nachfolgend werden die Auffassungen der Kliniken bezüglich der Vernetzung bei<br />
berufsbezogenen Fragestellungen in der Versorgungsstruktur dargestellt. Diese basieren<br />
auf den Kommentaren zu eigenen Erfahrungen (vgl. Abb. 61), der hieraus resultierenden<br />
Bewertung der Qualität (vgl. Abb. 64) <strong>und</strong> der insgesamt zugeschriebenen<br />
Wichtigkeit der Beteiligten bei berufsbezogenen Maßnahmen im Rahmen der<br />
Vernetzung (vgl. Abb. 65). Es sei darauf hingewiesen, dass aufgr<strong>und</strong> der geringen<br />
Stichprobe hier nur tendenzielle Aussagen möglich sind, keinesfalls eine umfassende<br />
Beurteilung. Die Darstellung erfolgt in der Reihenfolge der zugeschriebenen Wichtigkeit<br />
der Versorgungssegmente:<br />
Berufsgenossenschaften: gute Qualität (47,1 %), Wichtigkeit (83,9 % ***)<br />
Berufsgenossenschaften werden insgesamt als kompetent bezeichnet. Problematisch<br />
werden lange Bearbeitungszeiten, häufige Nachfragen <strong>und</strong> der insgesamt geringe<br />
Anteil an Rehabilitationsleistungen gesehen.<br />
Fachärzte: gute Qualität (48,1 %), Wichtigkeit (82,8 % ***)<br />
Den Fachärzten wird eine Bedeutung in der Nachsorge <strong>und</strong> in der ambulanten<br />
Weiterbehandlung beigemessen. Kritisch wird das Versorgungsdefizit mit Fachärzten<br />
genannt, welches in der Folge bei den einzelnen Ärzten zu Zeitmangel führt, der eine<br />
umfassende Behandlung über die somatische Ebene der Krankheit hinaus unter Berücksichtigung<br />
von beruflichen Problemen erschwert. Vereinzelt werden fehlende<br />
Kenntnis <strong>und</strong> Kompetenz im Bereich beruflicher Aspekte bei pneumologischen Erkrankungen<br />
genannt.<br />
Stationäre Rehabilitationskliniken: gute Qualität (68 %), Wichtigkeit (81,2 % **)<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich werden stationären Rehabilitationskliniken durch die vorhandene Leistungsdichte<br />
die größten Möglichkeiten eingeräumt. Diese lassen sich stichwortartig<br />
wie folgt beschreiben: umfassen<strong>des</strong>, interdisziplinär ausgerichtetes Angebot in Diagnostik,<br />
Therapie, Schulung <strong>und</strong> Beratung, alle Möglichkeiten zur Diagnostik der Erkrankung<br />
<strong>und</strong> ihrer Folgen <strong>und</strong> damit zur Früherkennung funktionaler Defizite <strong>und</strong><br />
Risiken zur Frühberentung, ganzheitliches Behandlungskonzept unter einem Dach<br />
mit umfassenden Hilfen zur Krankheitsbewältigung, Schulung <strong>und</strong> Beratung <strong>und</strong> zur<br />
Sensibilisierung für krankheitsbedingte berufliche Fragestellungen. Nach Auffassung<br />
der Kliniken sind zur optimalen Ausschöpfung dieser Möglichkeiten Verbesserungen<br />
in folgenden Bereichen notwendig: Zuweisung in die Rehabilitation mit klarer Fragestellung,<br />
Optimierung der Schnittstelle zur Rehabilitationsnachsorge.<br />
Rentenversicherung: gute Qualität (43,5 %), Wichtigkeit (77,4 % **)<br />
Die Rentenversicherung wird im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Rehabilitationsleistungen<br />
<strong>und</strong> der Verminderung von Kosten durch Frühberentungen als sehr wichtig<br />
erachtet. Problematisch wird die fehlende Nähe zu den Versicherten bzw. Kliniken<br />
<strong>und</strong> in diesem Zusammenhang die oft lange Bearbeitungsdauer von Anträgen gesehen.<br />
Krankenkassen: gute Qualität (24 %), Wichtigkeit (71,9 % ***)<br />
Insgesamt wird die Kooperation mit Krankenkassen als gut beschrieben. Aufgr<strong>und</strong><br />
fehlender Zuständigkeit für den beruflichen Bereich <strong>und</strong> einem medizinischen Unverständnis<br />
werden Krankenkassen jedoch für diesen speziellen Bereich als eher inkompetent<br />
beschrieben.<br />
116
Ambulante Rehabilitation: gute Qualität (12,5 %), Wichtigkeit (64,5 % ***) <strong>und</strong> teilstationäre<br />
Rehabilitation: gute Qualität 26,7 %, Wichtigkeit (53,3 % ***)<br />
Nach Auffassung der Kliniken findet aufgr<strong>und</strong> fehlender Angebote <strong>und</strong> der Komplexität<br />
ambulante <strong>und</strong> teilstationäre Rehabilitation im eigentlichen Sinne kaum statt. Im<br />
beruflichen Kontext wird sie als nicht existent angesehen. Mögliche wichtige Aufgaben<br />
im Rahmen ambulanter Rehabilitationsangebote werden in den Bereichen der<br />
wohnortnahen ambulanten Weiterbetreuung <strong>und</strong> der Rehabilitationsnachsorge gesehen.<br />
Berufsförderungswerke: gute Qualität (28,6 %), Wichtigkeit (60 % **) <strong>und</strong> Berufsbildungswerke:<br />
gute Qualität (35,7 %), Wichtigkeit (56,7 % **)<br />
Positiv wird bei den Berufsförderungs- bzw. -bildungswerken die dort vorhandene<br />
umfassende Kompetenz bezüglich beruflicher Fragen <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Umsetzung in Hilfsangeboten zur beruflichen Wiedereingliederung gesehen. Hemmnisse<br />
in der Umsetzung sind aus Sicht der Kliniken vorwiegend die geringe Anzahl<br />
der Einrichtungen <strong>und</strong> die Wohnortferne.<br />
Arbeitsamt: gute Qualität (3,8 %), Wichtigkeit (58,1 % ***)<br />
Trotz einer guten Datenlage, der Nähe zum Arbeitsmarkt <strong>und</strong> daraus resultierenden<br />
Möglichkeiten der Koordination der (Wieder-)Eingliederung sehen die Kliniken gravierende<br />
Probleme in diesem Bereich. Diese bestehen vorwiegend in einer Überforderung<br />
bei pneumologischen Patienten, einer fehlenden krankheitsbezogenen Kompetenz,<br />
fehlendem Interesse <strong>und</strong> den gesamten Problemen auf dem Arbeitsmarkt.<br />
Stationäre Akuteinrichtungen: gute Qualität (40 %), Wichtigkeit (43,3 %)<br />
Obwohl Rehabilitationsleistungen nicht in das Aufgabenfeld von Akutkliniken fallen,<br />
sehen die Befragten vor dem Hintergr<strong>und</strong> der hervorragenden diagnostischen Ausstattung<br />
dieser Einrichtungen Möglichkeiten im Vorfeld von Rehabilitationsmaßnahmen.<br />
Diese betreffen die umfassende Diagnostik bei pneumologischen Erkrankungen<br />
<strong>und</strong> damit auch die Möglichkeit zur Früherkennung der Rehabilitationsbedürftigkeit.<br />
In enger Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Facharzt <strong>und</strong> dem Patienten<br />
wird hier die Chance gesehen, auch im beruflichen Bereich frühzeitig die entsprechenden<br />
Schritte einzuleiten.<br />
Hauptfürsorgestellen/Versorgungsämter: gute Qualität (9,5 %), Wichtigkeit (30 %)<br />
Da auch Hauptfürsorgestellen <strong>und</strong> Versorgungsämter keine direkten medizinischen<br />
<strong>und</strong> beruflichen Rehabilitationsleistungen anbieten, wird von den Kliniken die Bedeutung<br />
dieser Stellen lediglich in der vorhandenen sozialmedizinischen Kompetenz<br />
gesehen, die es in den Rehabilitationsprozess einzubringen gilt.<br />
4.5.2. Niedergelassene Pneumologen<br />
Für diesen Teil der Expertenbefragung liegen Antworten von 69 niedergelassenen<br />
Pneumologen vor (Rücklauf 12,8 %). Der Anteil an chronischen Lungen- <strong>und</strong> Atemwegserkrankungen<br />
beträgt durchschnittlich 73,2 % (± 13,7). Fragen zum beruflichen<br />
Bereich werden von durchschnittlich 22,9 % (± 15,6) der Patienten thematisiert.<br />
Die gr<strong>und</strong>sätzliche Notwendigkeit einer verstärkten Einbindung beruflicher Aspekte in<br />
den Rehabilitationsprozess wird von 79,7 % der Pneumologen als hoch eingeschätzt<br />
(MW 4,0 ± .86). Dabei geben 58,7 % der Befragten an, dass hierzu geeignete Unter-<br />
117
suchungen zur Früherkennung von beruflichen Problemen insgesamt hilfreich wären<br />
(MW 3,59 ± 1,07). Bezogen auf die eigenen Patienten weisen nach Auffassung der<br />
Befragten 20,4 % (± 13,3) ein erhöhtes Risiko zur vorzeitigen Berentung auf.<br />
Insgesamt 88,4 % der Pneumologen geben an, berufliche Aspekte in die Gesamtbehandlung<br />
einzubeziehen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei diagnostische Verfahren<br />
(pneumologische <strong>und</strong> arbeitsbezogene Anamnese, Lungenfunktions- <strong>und</strong> Allergiediagnostik).<br />
Berufliche Aspekte werden darüber hinaus bei durchschnittlich 7,6 % (± 9,3) primär<br />
durch Kontakte zu anderen Einrichtungen berücksichtigt (vgl. Abb. 66). Hierbei stehen<br />
Hinweise über geeignete Einrichtungen oder Überweisungen in die Einrichtungen<br />
(MW 3,12 ± .90) <strong>und</strong> patientenbezogene Kontakte mit diesen Einrichtungen (MW<br />
2,71 ± 1,03) im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Kontakte zu anderen Einrichtungen<br />
niedergelassene Pneumologen<br />
Hinweis/Überweisung:<br />
nie/selten<br />
manchmal<br />
häufig/immer<br />
Kontaktaufnahme:<br />
nie/selten<br />
manchmal<br />
häufig/immer<br />
Kooperationspartner:<br />
Berufsgenossenschaft<br />
Rehakliniken<br />
Krankenkassen<br />
Arbeitsamt<br />
Rentenversicherung<br />
Arbeitgeber Patienten<br />
Hauptfürsorgestelle/VA<br />
Berufsförderungswerke<br />
Werkstätten für Behinderte<br />
Berufsbildungswerke<br />
Abbildung 66 (n=69)<br />
100<br />
49,3<br />
52,2<br />
94,2<br />
85,5<br />
82,6<br />
68,1<br />
65,2<br />
49,3<br />
44,9<br />
80<br />
60<br />
40<br />
Anteile in %<br />
23,2<br />
27,5<br />
26,1<br />
21,7<br />
20<br />
46,4<br />
40,6<br />
43,5<br />
30,4<br />
23,2<br />
21,1 13<br />
11,6 10,1<br />
10,1 8,7<br />
65,2<br />
68,1<br />
0 20 40 60 80 100<br />
Anteile in %<br />
Häufigkeit positive Zusammenarbeit<br />
Wie Abbildung 66 verdeutlicht, stehen in der direkten Zusammenarbeit Berufsgenossenschaften<br />
(94,2 %), Rehabilitationskliniken (85,5 %) <strong>und</strong> Krankenkassen (82,6 %),<br />
Arbeitsämter (68,1 %) <strong>und</strong> die Rentenversicherung (65,2 %) im Vordergr<strong>und</strong>. Sehr<br />
positiv wird dabei die Zusammenarbeit vorwiegend mit Rehabilitationskliniken (68,1<br />
%) <strong>und</strong> Berufsgenossenschaften (65,2 %) bewertet.<br />
Zur Abbildung der Effektivität beruflicher Ansätze im Rehabilitationsprozess wurden<br />
die Befragten gebeten, auf einer fünfstufigen Skala (1=sehr schlecht – 5=sehr gut)<br />
die diesbezügliche Qualität für die unterschiedlichen Beteiligten anzugeben. Abbildung<br />
67 zeigt, dass nach Auffassung der Befragten, die beste Qualität durch Berufsgenossenschaften<br />
(61,9 %), Fachärzte (59,5 %), stationäre Akuteinrichtungen (47,7<br />
%) <strong>und</strong> stationäre Rehabilitationsbehandlungen (46,4 %) gewährleistet wird. Trotz<br />
einer wesentlichen Beteiligung bei beruflichen Fragestellungen wird dem Arbeitsamt<br />
(21,7 %), der Rentenversicherung (21,4 %), den Berufsbildungswerken (16,8 %) <strong>und</strong><br />
den Berufsförderungswerken (9,7 %) keine hohe Effizienz unterstellt.<br />
118
Versorgungsstruktur pneumologische Rehabilitation<br />
Effektivität beruflicher Maßnahmen aus der Sicht<br />
niedergelassener Pneumologen<br />
Berufsgenossenschaften<br />
Fachärzte<br />
stationäre Akuteinrichtungen<br />
stationäre Rehaeinrichtungen<br />
ambulante Einrichtungen<br />
teilstationäre Einrichtungen<br />
Krankenkassen<br />
Arbeitsamt<br />
Rentenversicherung<br />
Hauptfürsorgestellen/VA<br />
Berufsbildungswerke<br />
Berufsförderungswerke<br />
Abbildung 67 (n=69)<br />
48,6<br />
42,9<br />
50<br />
51,6<br />
29,2<br />
35,4<br />
33,3<br />
21,4<br />
27<br />
30,4<br />
9,5<br />
9,4<br />
9,7<br />
27<br />
31,2<br />
25,4<br />
21,7<br />
21,4<br />
20,4<br />
16,8<br />
47,7<br />
46,4<br />
61,9<br />
59,4<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
schlecht (in %) gut (in %)<br />
Neben dieser Bewertung <strong>des</strong> Ist-Zustan<strong>des</strong> wurden die Befragten gebeten, die Wichtigkeit<br />
der unterschiedlichen Institutionen im Rehabilitationsprozess in Bezug auf berufliche<br />
Aspekte i.S.v. Hilfen zur beruflichen (Re-)Integration zu bewerten (1=völlig<br />
unwichtig – 5=sehr wichtig). Die in Abbildung 68 dargestellten Ergebnisse zeigen,<br />
dass allen beteiligten Institutionen eine mehr oder minder starke Bedeutung zugewiesen<br />
wird. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei die Berufsgenossenschaften (86,6 %),<br />
Fachärzte (85,5 %), stationäre Rehabilitationseinrichtungen (74,2 %) <strong>und</strong> die Rentenversicherung<br />
(64,6 %). Bis auf wenige Ausnahmen ergeben sich im Vergleich der<br />
von den Befragten bewerteten Effektivität der bisherigen Angebote <strong>und</strong> der Wichtigkeit<br />
in den Bereichen signifikante Unterschiede.<br />
Versorgungsstruktur pneumologische Rehabilitation<br />
Wichtigkeit in Bezug auf berufliche Aspekte aus der Sicht<br />
niedergelassener Pneumologen<br />
Berufsgenossenschaften<br />
Fachärzte<br />
stationäre Rehaeinrichtungen<br />
Rentenversicherung<br />
ambulante Einrichtungen<br />
teilstationäre Einrichtungen<br />
Beratungsstellen<br />
Krankenkassen<br />
Arbeitsamt<br />
Berufsförderungswerke<br />
stationäre Akuteinrichtungen<br />
Berufsbildungswerke<br />
Hauptfürsorgestellen/VA<br />
Abbildung 68 (n=69)<br />
52,6<br />
34,9<br />
25,4<br />
10,9<br />
15,4<br />
18,5<br />
23,9<br />
19<br />
14,9<br />
20,3<br />
22<br />
6<br />
2,9<br />
21,1<br />
47,5<br />
41,3<br />
41,1<br />
64,6<br />
64,6<br />
61,9<br />
60,3<br />
59,7<br />
58,2<br />
74,2<br />
86,6<br />
85,5<br />
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100<br />
unwichtig (in %) wichtig (in %)<br />
119<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
**<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***<br />
***
Unter Hinweis auf die durch die Stichprobengröße bedingte eingeschränkte Aussagekraft<br />
werden nachfolgend auch die Auffassungen der niedergelassenen Pneumologen<br />
bezüglich der Vernetzung bei berufsbezogenen Fragestellungen in der Versorgungsstruktur<br />
dargestellt. Die Darstellung erfolgt wieder in der Reihenfolge der zugeschriebenen<br />
Wichtigkeit der Versorgungssegmente (vgl. Abb. 68):<br />
Berufsgenossenschaften: gute Qualität (61,9 %), Wichtigkeit (86,6 % ***)<br />
Berufsgenossenschaften werden insgesamt als kompetent bezeichnet. Begründet<br />
wird dies für Einzelfälle <strong>und</strong> durch das Vorhandensein eigener Kliniken. Problematisch<br />
werden lange Bearbeitungszeiten, häufige Nachfragen <strong>und</strong> der insgesamt geringe<br />
Anteil an Rehabilitationsleistungen gesehen.<br />
Fachärzte: gute Qualität (59,4 %), Wichtigkeit (85,5 % ***)<br />
Insgesamt sehen die niedergelassenen Pneumologen ihre Aufgaben in der kompetenten<br />
ambulanten Behandlung der Patienten, die sich durch präzise Diagnostik <strong>und</strong><br />
Therapie auszeichnet. Gleichzeitig betonen sie aber die für weitergehende Fragestellungen<br />
notwendige Zeit <strong>und</strong> teilweise auch Kenntnis. Vereinzelt werden die fehlende<br />
Versorgungsdichte <strong>und</strong> die fehlende Honorierung genannt.<br />
Stationäre Rehabilitationskliniken: gute Qualität (46,4 %), Wichtigkeit (74,2 % ***)<br />
Die Bewertung der stationären Rehabilitationskliniken durch die niedergelassenen<br />
Pneumologen lässt eine ambivalente Haltung erkennen. Durch die vorhandene Leistungsdichte<br />
werden Rehabilitationskliniken für die umfassende Behandlung <strong>und</strong> die<br />
Einbeziehung beruflicher Fragestellungen für „Spezialfälle“ die größten Möglichkeiten<br />
eingeräumt. Diese lassen sich stichwortartig wie folgt beschreiben: umfassen<strong>des</strong>,<br />
interdisziplinär ausgerichtetes Angebot in Diagnostik, Therapie, Schulung <strong>und</strong> Beratung,<br />
alle Möglichkeiten zur Diagnostik der Erkrankung <strong>und</strong> ihrer Folgen <strong>und</strong> damit<br />
zur Früherkennung funktionaler Defizite <strong>und</strong> Risiken zur Frühberentung, ganzheitliches<br />
Behandlungskonzept unter einem Dach mit umfassenden Hilfen zur Krankheitsbewältigung,<br />
Schulung <strong>und</strong> Beratung <strong>und</strong> zur Sensibilisierung für krankheitsbedingte<br />
berufliche Fragestellungen. Als problematisch wird die Wohnortferne<br />
geeigneter Einrichtungen, die geringe Dauer der Rehabilitationsbehandlung, vielfältige<br />
Hindernisse in der Antragstellung <strong>und</strong> eine fehlende Verzahnung mit den anderen<br />
Angeboten gesehen. Nach Auffassung der Pneumologen sind zur optimalen<br />
Ausschöpfung dieser Möglichkeiten Verbesserungen in folgenden Bereichen notwendig:<br />
bessere Kooperation mit dem niedergelassenen Pneumologen, insbesondere<br />
bezüglich der realistischen Möglichkeiten vor Ort bzw. der Absprache bei gravierenden<br />
Änderungen der medikamentösen Therapie, Optimierung der Schnittstelle<br />
zur Rehabilitationsnachsorge durch individuelle Rückmeldung <strong>und</strong> rasche Erstellung<br />
<strong>des</strong> Entlassungsberichtes.<br />
Rentenversicherung: gute Qualität (21,4 %), Wichtigkeit (64,4 % **)<br />
Die Rentenversicherung wird im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Rehabilitationsleistungen<br />
<strong>und</strong> der Verminderung von Kosten durch Frühberentungen als sehr wichtig<br />
erachtet. Die Kooperation wird teilweise als sehr problematisch beschrieben. Begründet<br />
wird dies vorwiegend durch sehr lange Bearbeitungszeiten von Anträgen zur<br />
Rehabilitation, eine sehr kritische Prüfung der Rehabilitationsbedürftigkeit <strong>und</strong> die<br />
damit lange Dauer bis zur Bewilligung.<br />
120
Ambulante Rehabilitation: gute Qualität (31,2 %), Wichtigkeit (64,6 % ***) <strong>und</strong> teilstationäre<br />
Rehabilitation: gute Qualität (27 %), Wichtigkeit (61,9 % ***)<br />
Die niedergelassenen Pneumologen betonen, dass bisher aufgr<strong>und</strong> fehlender Angebote<br />
ambulante <strong>und</strong> teilstationäre Rehabilitation im eigentlichen Sinne kaum vorhanden<br />
sind. Mögliche wichtige Aufgaben im Rahmen ambulanter Rehabilitationsangebote<br />
werden in den Bereichen der wohnortnahen ambulanten Weiterbetreuung <strong>und</strong><br />
der Rehabilitationsnachsorge gesehen.<br />
Krankenkassen: gute Qualität (24 %), Wichtigkeit (71,9 % ***)<br />
Insgesamt wird die Kooperation mit Krankenkassen als gut beschrieben. Probleme<br />
ergeben sich durch die „Bürokratie“, den Filter über den MDK <strong>und</strong> die für die Beurteilung<br />
von Rehabilitationsanträgen oft zu kurze perspektivische Betrachtungsweise<br />
der Krankenkassen. Aufgr<strong>und</strong> fehlender Zuständigkeit für den beruflichen Bereich<br />
<strong>und</strong> einem medizinischen Unverständnis werden Krankenkassen jedoch für diesen<br />
speziellen Bereich als eher inkompetent beschrieben.<br />
Arbeitsamt: gute Qualität (21,7 %), Wichtigkeit (58,2 % ***)<br />
Im Einzelfall wird die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt als gut beschrieben. Teilweise<br />
wird eine fehlende K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Zielorientierung in der Beratung <strong>und</strong> daraus<br />
resultierende Erfolglosigkeit von Bemühungen kritisiert. Als negativ werden weiterhin<br />
eine Überforderung bei pneumologischen Patienten, fehlende krankheitsbezogene<br />
Kompetenz, fehlen<strong>des</strong> Interesse <strong>und</strong> die Probleme auf dem Arbeitsmarkt genannt.<br />
Berufsförderungswerke: gute Qualität (9,7 %), Wichtigkeit (47,5 % ***) <strong>und</strong> Berufsbildungswerke:<br />
gute Qualität (16,8 %), Wichtigkeit (41,1 % ***)<br />
Die Aufgaben dieser Einrichtungen sind den Befragten relativ unbekannt. Bemängelt<br />
wird die fehlende medizinische Kompetenz. Gr<strong>und</strong>sätzlich werden die Aufgaben in<br />
Hilfen zur beruflichen (Wieder-)Eingliederung <strong>und</strong> dabei insbesondere in Umschulungsmaßnahmen<br />
gesehen.<br />
Stationäre Akuteinrichtungen: gute Qualität (47,7 %), Wichtigkeit (41,3 %)<br />
Akutkliniken sind aus Sicht der Pneumologen für kurzfristige Aufenthalte wichtig. Sie<br />
betonen die hohe Strukturqualität der biomedizinischen Diagnostik <strong>und</strong> Therapie unter<br />
einem Dach. Gleichzeitig kritisieren sie die fehlende Zahl an pneumologischen<br />
Betten in Akutkliniken <strong>und</strong> die teilweise schlechte Kooperation in Bezug auf die medikamentöse<br />
Behandlung. Für die Rehabilitation <strong>und</strong> damit auch für berufliche Aspekte<br />
bei pneumologischen Erkrankungen sind Akutkliniken aus Sicht der Fachärzte<br />
jedoch nicht zuständig <strong>und</strong> auch nicht ausgestattet.<br />
Hauptfürsorgestellen/Versorgungsämter: gute Qualität (20,4 %), Wichtigkeit (21,1 %)<br />
Die Aufgaben von Hauptfürsorgestellen <strong>und</strong> Versorgungsämtern sind den Befragten<br />
nur teilweise bekannt. Kontakte bestehen nur im Einzelfall, dies überwiegend durch<br />
die Weitergabe von Bef<strong>und</strong>en.<br />
121
5. Zusammenfassung<br />
Rehabilitationsforschung hat das übergeordnete Ziel der Weiterentwicklung <strong>und</strong> wissenschaftlichen<br />
Begründung der rehabilitativen Praxis. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der zunehmenden<br />
Prävalenz chronischer Atemwegserkrankungen, den immens hohen gesellschaftlichen<br />
Folgekosten durch diese Erkrankungen, den Defiziten in der pneumologischen<br />
Versorgung <strong>und</strong> insbesondere den veränderten Rahmenbedingungen<br />
im Ges<strong>und</strong>heitswesen, gewinnen diese Bemühungen zunehmend an Bedeutung.<br />
Trotz der hohen Folgekosten, die deutlich mitbestimmt werden durch vorzeitige Erwerbsunfähigkeit<br />
<strong>und</strong> krankheitsbedingten Arbeitsausfall sind dagegen Aufwendungen<br />
für qualitativ hochwertige Rehabilitationsmaßnahmen relativ gering. Der direkte<br />
Übergang in die Frühberentung ist häufig die Folge. Trotz der anhaltend hohen Arbeitslosenzahl<br />
<strong>und</strong> dem Wandel in der Arbeitswelt bildet das Ziel der beruflichen Integration<br />
bzw. Reintegration auch weiterhin das Zentrum der medizinischen Rehabilitation.<br />
Daher ist es dringend erforderlich, die Zugangssteuerung zur <strong>und</strong> während<br />
der medizinischen Rehabilitation unter dem Blickwinkel <strong>des</strong> Erhalts der Erwerbsfähigkeit<br />
bzw. der Reintegration in das Berufsleben zu verbessern. In Abgrenzung zu<br />
berufsfördernden Maßnahmen müssen sich alle Maßnahmen in Diagnostik, Therapie,<br />
Schulung <strong>und</strong> Beratung in der (medizinischen) pneumologischen Rehabilitation<br />
stärker an beruflichen Zielen orientieren, insbesondere bei Risikopatienten. Dies bedeutet<br />
die gezielte Ausrichtung <strong>des</strong> gesamten Leistungspotentials der medizinischpneumologischen<br />
Rehabilitation auf den Erhalt der Erwerbsfähigkeit (Risikopotential<br />
<strong>des</strong> Patienten ⇔ Leistungspotential der Rehabilitationsklinik ⇔ Rehabilitationspotential<br />
<strong>des</strong> Patienten).<br />
Im Kontext <strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>themas „Zielorientierung in Diagnostik, Therapie <strong>und</strong> Ergebnismessung“<br />
(Bengel & Jäckel 2000) besteht die primäre Zielsetzung <strong>des</strong> Projektes<br />
in der empirischen Ableitung eines ‘Risikoprofils zur Frühberentung’ (Prädiktion) <strong>und</strong><br />
der hierauf basierenden Entwicklung eines Assessmentverfahrens zur frühzeitigen<br />
Selektion von Patienten mit einem erhöhten Risiko zur vorzeitigen Berentung. Mit<br />
diesem ersten Schritt soll für den Bereich der pneumologischen Erkrankungen die<br />
Bildung einer Untergruppe von Patienten ermöglicht werden, deren Rehabilitationsziele<br />
primär im beruflichen Bereich liegen <strong>und</strong> dementsprechend mit diesen Problemkonstellationen<br />
gezielt in die Bereiche der Diagnostik, Therapie, Beratung <strong>und</strong><br />
Schulung überwiesen werden können (Individualisierung vs. Pauschalisierung). Hierzu<br />
wurden vorliegende Erhebungen fünf Jahre später durch eine Nachbefragung unter<br />
besonderer Berücksichtigung beruflicher Aspekte ergänzt <strong>und</strong> in der Wechselwirkung<br />
auf das Kriterium der Frühberentung <strong>und</strong> der Gefährdung hierzu analysiert.<br />
Für diese Teilbefragung liegen 553 Fragebögen vor.<br />
Die Nachbefragung wurde durch eine weitere Befragung von in die Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang eingewiesenen Patienten (n=455) <strong>und</strong> ihren behandelnden Ärzten<br />
in der Klinik zu notwendigen beruflichen Hilfen im Rehabilitationsprozess ergänzt.<br />
Hierdurch sollten insbesondere Bedarf <strong>und</strong> Fragestellungen im Bereich der Rehabilitations-<br />
<strong>und</strong> Sozialberatung untersucht <strong>und</strong> Anhaltspunkte zur Implementierung eines<br />
interdisziplinär ausgerichteten Informations- <strong>und</strong> Beratungszentrums gewonnen<br />
werden (Verbesserung der Segmentierung in Richtung Rehabilitationsnachsorge).<br />
Abschließend wurde eine Expertenbefragung durchgeführt, mit der die Rolle der an<br />
der Gesamtbehandlung beteiligten Versorgungssegmente in Bezug auf berufsbezogene<br />
Fragestellungen näher beleuchtet werden sollte.<br />
122
Nachfolgend werden die verschiedenen Erhebungen den Hauptfragestellungen zugeordnet<br />
<strong>und</strong> damit die Fragestellungen zusammenfassend beantwortet.<br />
5.1. Welche somatischen, funktionalen, psychosozialen <strong>und</strong> behandlungsbezogenen<br />
Merkmale weist der „pneumologische Patient“ auf?<br />
In die Nachbefragung wurden 814 ehemalige Patienten einbezogen. Der Rücklauf<br />
der postalischen Befragung liegt bei 67,9 % (n=553).<br />
Bei einer Gleichverteilung der Anteile an Männern <strong>und</strong> Frauen ergibt sich für t1 ein<br />
Durchschnittsalter von 47,0 (± 14) Jahren, für t2 von 52,1 (± 14) Jahren, was die Zeit<br />
von ca. 5 Jahren zwischen den beiden Messzeitpunkten erkennen lässt. Der überwiegende<br />
Teil der Befragten ist verheiratet oder lebt in sonstigen partnerschaftlichen<br />
Beziehungen. Über ein Drittel der Befragten verfügt über die Hochschulreife, so dass<br />
die Stichprobe im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein höheres Bildungsniveau<br />
aufweist.<br />
Die Hauptdiagnosen beinhalten mit 80 % überwiegend unterschiedliche Formen<br />
asthmatischer Erkrankungen. Neben der Erkrankung der Lunge oder der Atemwege<br />
weisen 75 % der Stichprobe weitere Erkrankungen auf, wobei Allergien (46,1 %),<br />
Erkrankungen <strong>des</strong> Skeletts oder <strong>des</strong> Muskelapparats (28,2 %), <strong>des</strong> Herz-Kreislauf-<br />
Systems (15,2 %) <strong>und</strong> der Haut (13,9 %) im Vordergr<strong>und</strong> stehen. Die Krankheitsdauer<br />
beträgt zu t1 durchschnittlich 15,1 Jahre (± 11,9).<br />
Auf der Basis der notwendigen Medikation weisen 72,4 % der Befragten eine mittel-<br />
bis schwergradige Erkrankung auf, in deren Folge sich in wesentlichen Lebensbereichen<br />
Beeinträchtigungen ergeben. Für beide Messzeitpunkte werden dabei die größten<br />
Belastungen (MW > 3,00) in den Bereichen Atemwegserkrankung/-symptomatik,<br />
körperliche Verfassung, allgemeine Leistungsfähigkeit, Allgemeinbefinden, allgemeiner<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustand <strong>und</strong> der Einschränkung in der Lebensqualität insgesamt<br />
angegeben. In der Nachbefragung ergibt sich für alle Bereiche eine deutliche Verbesserung.<br />
Diese betreffen mit einer statistisch hochsignifikanten Differenz insbesondere<br />
diejenigen Bereiche, die zu t1 die höchste Belastungsintensität aufweisen.<br />
Entsprechend dem hohen Bildungsniveau sind in der Ausgangsstichprobe zu t1 44,1<br />
% der Patienten in einem Angestelltenverhältnis, 16,7 % sind beamtet, 9,5 % befinden<br />
sich noch in Ausbildung <strong>und</strong> 7,8 % sind (Fach-)Arbeiter.<br />
Die Angaben zu beruflichen Einschränkungen bzw. Kontextfaktoren ergeben, dass<br />
zu t1 77,1 % der Patienten in den letzten 6 Monaten vor der Befragung zumin<strong>des</strong>t<br />
einmal arbeitsunfähig erkrankt waren <strong>und</strong> 27,1 % eine anerkannte Schwerbehinderung<br />
aufweisen. Die Arbeitsunfähigkeitszeiten erstrecken sich durchschnittlich über 2<br />
bis 3 Wochen (Median). Der Anteil der Patienten, die in den letzten 12 Monaten zu t2<br />
min<strong>des</strong>tens einmal arbeitsunfähig waren, beträgt 86,2 %. Die durchschnittliche Dauer<br />
der Arbeitsunfähigkeit liegt unter Zugr<strong>und</strong>elegung <strong>des</strong> Vergleichszeitraumes von t1 zu<br />
t2 bei 17,7 Tagen. Im Vergleich zu t1 hat zu t2 der Anteil der Patienten mit einer anerkannten<br />
Schwerbehinderung um 13,1 % zugenommen.<br />
Krankheitsbedingte berufliche Veränderungen beziehen sich vorwiegend auf die<br />
stärkere Arbeitsbelastung (54,3 %), die eingeschränkte berufliche Perspektive (30,2<br />
123
%), den verstärkten Konkurrenzdruck (27,8 %) <strong>und</strong> die notwendige Reduktion der<br />
Arbeitszeit (27,2 %).<br />
Die für eine Teilstichprobe vorliegenden Angaben zu beruflichen Belastungen beschreiben<br />
ein breites Belastungsspektrum. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei zu t1 „nach<br />
der Arbeit erschöpft“ (75,6 %), „abgehetzt bei der Arbeit“ (73,7 %), „vom Beruf mitgenommen“<br />
(72,6 %), „meist sehr angespannt“ (69,7 %) <strong>und</strong> „sollte mich mehr schonen“<br />
(53,8 %). Zu t2 ergibt sich weder in der Rangreihe der Belastungen, noch in der<br />
Ausprägung ein signifikanter Unterschied.<br />
Die Ergebnisse der zu t2 eingesetzten Subskalen <strong>des</strong> SAA (Martin et al. 1980) belegen<br />
daneben Anzeichen für eine quantitative (MW 2,82, ± .94) <strong>und</strong> eine qualitative<br />
Überforderung (MW 2,22, ± .88). Weitere Belastungen lassen sich aus den aus dem<br />
Ges<strong>und</strong>heits-Survey (Bellach et al. 1998) entnommenen Arbeitsbelastungen ableiten.<br />
Hierbei stehen (MW > 2,50) „Konzentration“, „Lärm“, „hohe Verantwortung für<br />
Menschen“, „schnelle Entscheidungen“, „widersprüchliche Anweisungen“ <strong>und</strong> „einseitige<br />
Belastung“ im Vordergr<strong>und</strong>. Daneben spielen Arbeitsbedingungen eine Rolle,<br />
die im Kontext der Erkrankung <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Allergien als schädlich angenommen<br />
werden müssen: Gase, Schadstoffpartikel, Allergene, Hitze-Kälte-Nässe,<br />
schwere Arbeit.<br />
Zwei Drittel der zu beiden Messzeitpunkten berufstätigen Befragten geben krankheitsbedingte<br />
Sorgen bezüglich der weiteren beruflichen Perspektive an. Im Vordergr<strong>und</strong><br />
stehen dabei die Sorge, vorzeitig berentet zu werden (55,8 %), schlechtere<br />
Aufstiegsmöglichkeiten (42 %) <strong>und</strong> ein geringerer Verdienst (40,6 %).<br />
Diejenigen Befragten, die zwischen beiden Messzeitpunkten einen Antrag zur Frühberentung<br />
gestellt haben, begründen diesen vorwiegend mit der verminderten Leistungsfähigkeit<br />
(86,9 %), dem körperlichen Befinden (79,3 %), der Angst vor Verschlimmerung<br />
der Erkrankung (55,3 %) <strong>und</strong> dem Rat <strong>des</strong> behandelnden Hausarztes<br />
(50,5 %). Bei etwa einem Viertel der Befragten spielen daneben die Familie <strong>und</strong> der<br />
Arbeitgeber sowie der Wunsch, mehr vom Leben haben zu wollen, eine Rolle.<br />
Die im Bereich der psychosozialen Stichprobenmerkmale mit dem Brief-Symptom-<br />
Inventory (BSI) von Derogatis et al. (1977) erfasste persönlichkeitsbezogene Angst<br />
<strong>und</strong> Depression fällt im Mittel zu t1 mit 1,95 bzw. 1,51 relativ gering aus. Trotzdem<br />
belegen sie die Bedeutung der Angst <strong>und</strong> der Depression für einen nicht zu unterschätzenden<br />
Teil der Befragten. Zu t2 zeigen sich in beiden Skalen Anstiege, die für<br />
die Skala Depression signifikant sind (t=3,15, df=252, p
sind für beide Zeitpunkte die relativ geringen Werte in der Skala „nervöse Ängstlichkeit“.<br />
Zahlreiche Studien belegen die Bedeutung dieser krankheitsbezogenen Angst<br />
für das Krankheitsmanagement (Deter 1985, Kaiser 1994, Kaiser et al. 1997).<br />
Im Vergleich (t1/t2) zeigt sich ein signifikanter Anstieg der Skala „Atembeschwerden“<br />
(t=7,07, df=224, p
Unzufriedenheit ergibt sich bei beiden Messzeitpunkten in den Bereichen der Ges<strong>und</strong>heit,<br />
der körperlichen Verfassung <strong>und</strong> dem bisherigen Behandlungserfolg.<br />
Signifikante Veränderungen zwischen t1 <strong>und</strong> t2 ergeben sich für wenige Lebensbereiche.<br />
Zufriedener sind die Befragten zu t2 mit ihrer Ges<strong>und</strong>heit (t=5,64, df=472,<br />
p
tene Hilfe wird jedoch als gering eingeschätzt. Alle anderen, insbesondere auch dafür<br />
zuständige Bereiche spielen unter beiden Aspekten eine deutlich geringe Rolle.<br />
Die Angaben der Befragten zu in Anspruch genommenen Angeboten im Zeitraum<br />
zwischen beiden Messzeitpunkten verdeutlichen die große Diskrepanz zwischen<br />
Notwendigkeit, insbesondere auch unter rehabilitativen Aspekten, <strong>und</strong> der realen<br />
Wirklichkeit.<br />
Die ärztliche Versorgung der Patienten erfolgt – bezogen auf die letzten 6 Monate<br />
vor der Befragung zu t2 - primär durch Allgemeinmediziner (63,7 %), Lungenfachärzte<br />
(53,1 %) <strong>und</strong> Internisten (42,1 %). Daneben werden von den Befragten (MfN)<br />
im Rahmen der beschriebenen Multimorbidität <strong>und</strong> der individuellen Ges<strong>und</strong>heitssituation<br />
vorwiegend Behandlungen bei Orthopäden (35,1 %), Gynäkologen (28,7 %)<br />
<strong>und</strong> Dermatologen (25,9 %) angegeben. Trotz der Krankheitsschwere werden nur<br />
etwa die Hälfte der Befragten von Lungenfachärzten behandelt (t1 52,3 %, t2 53,1 %).<br />
Die Inanspruchnahme von in der Nachsorge <strong>und</strong> der ambulanten Rehabilitation bedeutsamen<br />
Angeboten findet bei der untersuchten Stichprobe mehr oder minder<br />
nicht statt. Dies betrifft den Lungensport (2,3 %), die physikalische Atemtherapie (2,3<br />
%) <strong>und</strong> neben psychosozialen Angeboten insbesondere auch die ambulante Schulung<br />
(8,8 %). Dagegen fällt – bezogen auf die letzten 5 Jahre – ein deutlich hoher<br />
Anteil (30,7 %) an Behandlungen durch Naturheilern auf. Mögliche Gründe für diese<br />
Situation können im individuellen Bedarf oder auch der Motivation der Befragten liegen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der vielfach beschriebenen pneumologischen Unterversorgung in<br />
Deutschland ist jedoch hierfür die fehlende flächendeckende Versorgung mit Angeboten<br />
dieser Art der wesentliche Gr<strong>und</strong>. Trotz dieser Situation sind insgesamt 59,8 %<br />
der Befragten mit der regionalen pneumologischen Versorgung zufrieden. Abstriche<br />
machen 24,8 % <strong>und</strong> unzufrieden sind insgesamt 15,3 %.<br />
Wesentliches Kriterium zur Bewertung von medizinischen Maßnahmen <strong>und</strong> damit<br />
auch der Rehabilitation ist die Entwicklung der mit der Krankheit <strong>und</strong> ihren Folgen<br />
verb<strong>und</strong>enen Kosten. Die Entwicklung der kostenrelevanten Variablen, jeweils bezogen<br />
auf die letzten 6 Monate vor Klinikaufnahme (t1) bzw. 6 Monate vor Nachbefragung<br />
(t2) für einen Zeitraum von über 5 Jahren zeigt, dass sich die Anzahl der<br />
notwendigen Arztbesuche von insgesamt 4277 auf 3269 signifikant reduziert hat<br />
(n=471, t1: MW 9,08 ± 12,2, t2: MW 6,94 ± 8,96, t=3,54, df=470, p
noch 3,4 % der Patienten zu (n=365, t1: MW .15 ± .88, t2: MW .17 ± .69, t=1,16,<br />
df=364, ns).<br />
Die Ergebnisse belegen eindrücklich eine deutliche Reduktion notwendiger medizinischer<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> damit auch individueller Krankheitsfolgen <strong>und</strong> Belastungen.<br />
Insgesamt unterstreichen sie die Relevanz <strong>und</strong> die Effizienz von Rehabilitationsbehandlungen.<br />
Die Entwicklung der kostenrelevanten Variablen über einen Zeitraum<br />
von über 5 Jahren nach Entlassung aus der Klinik belegt zudem deren ökonomischen<br />
Nutzen.<br />
5.2. Welche Risikoprofile zur Frühberentung bzw. der Gefährdung hierzu lassen<br />
sich ableiten?<br />
Zur Beantwortung dieser Fragestellung liegen für beide Messzeitpunkte von jeweils<br />
553 Patienten Datensätze vor (Gesamtstichprobe) von denen 408 zur Modellbildung<br />
(Frühberentung zwischen den Messzeitpunkten: n=92, zu beiden Zeitpunkten berufstätig:<br />
n=316) verwendet werden konnten.<br />
Durch die logistische Regression (bezogen auf Messzeitpunkt t1) aus der Modellbildung<br />
werden folgende Prädiktoren zur Vorhersage der Frühberentung ermittelt<br />
(OR 17.50, 95 % CI: 8.23 – 37.21):<br />
• Ein höheres Alter<br />
• Das Vorliegen einer Schwerbehinderung<br />
• Höhere Zufriedenheit mit der Freizeit<br />
• Niedrigere Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit<br />
• Niedrigere Zufriedenheit mit der eigenen Stimmung<br />
• Mehr Besuche bei einem Hausarzt/Allgemeinmediziner<br />
• Weniger/keine Besuche bei einem Pneumologen (Facharzt)<br />
Das ermittelte Modell wurde in der zweiten Substichprobe einer Überprüfung unterzogen<br />
<strong>und</strong> hier zeigte sich ein OR von 17.35 (95 % CI: 6.61 – 45.54). Das Modell<br />
scheint demnach auch auf andere Stichproben übertragbar zu sein.<br />
Weitere Hinweise ergeben sich durch die Ergebnisse der nach Altersgruppen stratifizierten<br />
Subgruppen. Aufgr<strong>und</strong> der Stichprobengröße konnte diese Analyse nur<br />
für zwei Altersgruppen (ohne Kreuzvalidierung) durchgeführt werden.<br />
In der mittleren Altersgruppe (45-54 Jahre) ergeben sich folgenden Risikofaktoren<br />
zur Frühberentung (Trefferquote 84,9 %, Sensitivität 75,6 %):<br />
• Vorliegen einer Schwerbehinderung<br />
• Höheres Alter<br />
• Höhere Unzufriedenheit mit dem eigenen Charakter<br />
• Höhere AU-Zeiten zu t1<br />
In der Altersgruppe ab 55 Jahre ergeben sich als wesentliche Einflussgrößen zur<br />
Vorhersage der Frühberentung folgende Faktoren (Trefferquote 79,7 %, Sensitivität<br />
76,9 %):<br />
128
• Höhere Zufriedenheit mit der Freizeit<br />
• Dauer der Erkrankung zu t1<br />
• Höhere Werte in der Subskala <strong>des</strong> FKV „Religiosität/Sinnsuche“<br />
• Mehr Arztbesuche (Hausarzt/Allgemeinmediziner)<br />
• Höhere Unzufriedenheit in der Partnerschaft<br />
Eine homogene Vorhersage, die in allen Substichproben Gültigkeit hätte, lässt sich<br />
nur bedingt für die verschiedenen Altergruppen machen. Die Abhängigkeit der Ergebnisse<br />
von der Struktur der Stichprobe kann in den Untergruppen aufgr<strong>und</strong> der<br />
Stichprobengrößen zwar nicht durch eine Kreuzvalidierung relativiert werden. Dennoch<br />
ergeben sich wertvolle Hinweise für die Verteilung der Risikofaktoren.<br />
Eine weitere Analyse wurde mit den vorliegenden Daten aus dem Messzeitpunkt t2<br />
vorgenommen. Hierzu wurden diese zuerst einer univariaten Analyse unterzogen.<br />
Hierbei kristallisieren sich die nachfolgend genannten Bereiche als bedeutsam heraus,<br />
die unter Beibehaltung der für t1 definierten Gruppen als Ausgangsvariablen für<br />
die weitere logistische Regression verwendet werden:<br />
• Alter<br />
• Geschlecht<br />
• Schwerbehinderung<br />
• Skalen <strong>SF12</strong>: körperliche <strong>und</strong> psychische Beeinträchtigung<br />
• Items zu subjektiven Krankheitsbelastungen<br />
• Subskalen der Asthma-Symptomliste<br />
• Ausmaß der Krankheitsbewältigung<br />
• Subskalen ‚Angst’ <strong>und</strong> Depression’ (BSI )<br />
• Subskalen <strong>des</strong> Freiburger Fragebogens zur Krankheitsverarbeitung + Item Vertrauenssetzung<br />
in die Ärzte<br />
• Dauer der Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten<br />
• Berufliche Belastungen<br />
• berufliche Veränderungen durch die chronische Erkrankung<br />
• Gesamtskala berufliche Belastungen (SBUS)<br />
• Subskalen <strong>des</strong> SAA: ‚quantitative Überforderung’, ‚qualitative Überforderung’<br />
• Items zu berufsbezogenen Sorgen<br />
• Bereiche der Lebenszufriedenheit (LZI)<br />
Von der relevanten Stichprobe (n=408) wurden wieder zufällig im Verhältnis 60:40<br />
Substichgruppen zur Modellbildung (n=230) <strong>und</strong> zur Kreuzvalidierung (n=178) gebildet.<br />
Für die Modellbildungsgruppe ergeben sich dabei folgende Risikofaktoren zur<br />
Frühberentung (OR 20.34, 95 % CI: 8.89 – 46.53):<br />
• Höheres Alter<br />
• Stärkere berufliche Belastung durch die Atemwegserkrankung<br />
• Schwerbehinderung<br />
• Geringere Symptome der Müdigkeit (ASL) im Kontext der Atemwegssymptomatik<br />
• Stärkeres Empfinden der Einschränkung <strong>des</strong> beruflichen Weiterkommens<br />
• Stärkere Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit<br />
• Geringere Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit<br />
• Längere Dauer der Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten<br />
• Besseres Abfinden mit der chronischen Erkrankung<br />
129
• Stärkere berufliche Veränderungen durch die Erkrankung<br />
Das ermittelte Modell wurde in der zweiten Substichprobe (Kreuzvalidierung) einer<br />
Überprüfung unterzogen. Hierbei ergab sich ein OR von 23.22 (95 % CI: 8.97 –<br />
60.12), was dafür spricht, dass das Modell auch in dem Stichprobenteil verwendbar<br />
zu sein scheint, in dem diese Regressionsanalyse nicht durchgeführt wurde.<br />
Weitere Hinweise ergeben sich wiederum durch die Ergebnisse der nach Altersgruppen<br />
stratifizierten Subgruppen. Aufgr<strong>und</strong> der Stichprobengröße konnte diese<br />
Analyse auch hier wiederum nur für zwei Altersgruppen (ohne Kreuzvalidierung)<br />
durchgeführt werden.<br />
Für die Altersgruppe von 45-54 Jahren ergeben sich bei einer Gesamttrefferquote<br />
<strong>des</strong> Modells von 95,5 % <strong>und</strong> einer Sensitivität von 72,7 % folgende Risikofaktoren<br />
zur Frühberentung:<br />
• Stärkere Beeinträchtigung der allgemeinen Leistungsfähigkeit<br />
• Stärkere Belastungen durch ein hohes Arbeitstempo<br />
• Geringerer Verdienst durch die Erkrankung<br />
• Geringere Belastung durch die Arbeit<br />
• Geringere nächtliche Atemnot<br />
• Geringere soziale Unterstützung<br />
• Geringere Gefährdung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes<br />
In der Gruppe ab 55 Jahre ergeben sich bei einer Trefferquote von 84,1 % <strong>und</strong> einer<br />
Sensitivität von 80,8 % folgende Risikofaktoren zur Frühberentung:<br />
• Alter<br />
• Stärkere krankheitsbedingte berufliche Belastungen<br />
• Geringere berufliche Belastung durch Störungen/Unterbrechungen bei der Arbeit<br />
• Höhere quantitative Überforderung<br />
• Höhere Belastungen durch Kontrollen durch Vorgesetzte<br />
• Höhere Zufriedenheit mit den Sozialkontakten<br />
• Höhere Zufriedenheit mit den eigenen Fähigkeiten<br />
• Stärkere Belastungen durch die Nebenwirkungen der Behandlung<br />
• Geringere Belastungen durch maschinenbestimmtes Arbeitstempo<br />
• Stärkere Belastungen durch schlechtes Verhältnis zu Kollegen am Arbeitsplatz<br />
• Geringere Müdigkeit (ASL) im Rahmen der Atemwegssymptomatik<br />
• Höhere Einschränkung <strong>des</strong> beruflichen Weiterkommens<br />
• Geringere Sorgen, weniger zu verdienen<br />
Als Erweiterung der Fragestellung wurde die Urteilsbildung <strong>des</strong> Arztes näher<br />
untersucht, die zur Zuordnung eines Patienten in die Gruppe der Risikopatienten<br />
führt. Die Zusammenführung der Patienten- <strong>und</strong> Arztdaten im Rahmen der Befragung<br />
zu beruflichen Hilfen ermöglicht eine Analyse der fünfstufigen Arzteinschätzung<br />
in Bezug auf die Gefährdung zur Frühberentung. Hierbei wurde als Methode eine<br />
lineare schrittweise Regression gerechnet, die als Kriterium die Risikoeinschätzung<br />
durch den Arzt <strong>und</strong> als mögliche Prädiktoren Angaben der Ärzte <strong>und</strong> Patienten berücksichtigte.<br />
Um den Stichprobeneffekt zu reduzieren, wurde eine Kreuzvalidierung<br />
durchgeführt. Hierbei wurde die Gesamtstichprobe im Verhältnis 60:40 durch Zu-<br />
130
fallsauswahl in zwei Teile unterteilt. Die größere Substichprobe besteht aus N=210<br />
Personen (60,7 %), die kleinere Gruppe aus N=136 (39,3 %).<br />
Mit den statistisch bedeutsamen Variablen können in dieser Substichprobe 51,3 %<br />
der Varianz der Risikoeinschätzung erklärt werden (korrigiertes R 2 ). Als Prädiktoren<br />
wurden primär Variablen <strong>des</strong> Arztbogens ermittelt: Eine geringere Leistungsfähigkeit,<br />
ein höherer Schweregrad der Asthmaanfälle, eine schlechtere Krankheitsprognose<br />
am Ende der Behandlung, Zielsetzung der Rehabilitation im somatischen Bereich,<br />
eine gering eingeschätzte Lebensqualität, eine höhere Compliance <strong>und</strong> ein höherer<br />
Schweregrad der Erkrankung bei Entlassung hängen mit einem höheren Risiko zusammen.<br />
Im späteren Teil der Regressionsanalyse wurden Variablen als bedeutsam<br />
in die Regressionsgleichung aufgenommen, die aus den Patientenangaben bestehen.<br />
Hierbei erwiesen sich eine stärkere Tendenz der Patienten zu Wunschdenken<br />
<strong>und</strong> Grübeln als Strategien zur Krankheitsverarbeitung, eine höhere Erwartung <strong>des</strong><br />
Aufbaus von Selbstvertrauen im Laufe der Rehabilitation <strong>und</strong> eine geringere Erwartung<br />
der Besprechung sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtlicher Fragen als bedeutsame Prädiktoren.<br />
Die Analyse ergab weiterhin, dass die so gef<strong>und</strong>ene Regressionsgleichung in der<br />
zweiten Substichprobe nur einen geringeren Teil der Varianz aufklären konnte (34,8<br />
% in Gruppe 2). Daher wurde eine Regressionsgleichung auch in dieser Substichprobe<br />
ermittelt. In der Kreuzvalidierunggruppe hängen demnach auf der Basis der<br />
Arztvariablen ein höherer Schweregrad der Asthmaanfälle, eine schlechtere Krankheitsprognose,<br />
eine schlechtere Zielerreichung auf funktionaler Ebene, ein höherer<br />
Schweregrad der Atemwegserkrankung <strong>und</strong> eine geringere allgemeine Leistungsfähigkeit<br />
mit der Einschätzung <strong>des</strong> Patienten als Risikopatienten zusammen. Aus den<br />
Patientenvariablen wurden eine höhere Patientenerwartung von Kontakten mit anderen<br />
Patienten, eine geringere Erwartung von Erholung während der Rehabilitation<br />
sowie eine höhere Patientenerwartung <strong>des</strong> Abstand Gewinnens durch die Rehabilitation<br />
als statistisch bedeutsam gef<strong>und</strong>en. Mit den statistisch bedeutsamen Variablen<br />
können in dieser Substichprobe 54,7 % der Varianz der Risikoeinschätzung erklärt<br />
werden (korrigiertes R 2 ), erweisen sich jedoch aufgr<strong>und</strong> der Daten der ersten Gruppe<br />
(R 2 27,9 %) als schwierig interpretierbar.<br />
Variablen, die sich in beiden Gruppen als bedeutsam herausgestellt haben, sind ein<br />
höherer Schweregrad der Krankheit, eine schlechtere Prognose <strong>und</strong> eine geringere<br />
Leistungsfähigkeit. Patientenerwartungen scheinen auch eine Rolle zu spielen, können<br />
aber nicht in allen Details übereinstimmend in beiden Gruppen identifiziert werden.<br />
Diese unterschiedlichen Ergebnisse müssen vor dem Hintergr<strong>und</strong> interpretiert<br />
werden, dass in der kleineren Gruppe weniger Patienten erfasst wurden. Insgesamt<br />
spielen demnach neben dem Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigung der Patienten<br />
auch Patientenerwartungen <strong>und</strong> möglicherweise auch die Art der Krankheitsverarbeitung<br />
bei der Einordnung eines Patienten in die Risikogruppe für den Arzt eine<br />
Rolle.<br />
131
5.3. Wie können Risiken zur Frühberentung durch ein Screeninginstrument<br />
frühzeitig identifiziert <strong>und</strong> zielgerichtet in den Rehabilitationsprozess eingebracht<br />
werden?<br />
Neben der Herausarbeitung von Prädiktoren zur Frühberentung besteht eine wesentliche<br />
Zielsetzung <strong>des</strong> Projekts in der Entwicklung eines auf diesen Prädiktoren basierenden<br />
Sreeninginstrumentes zur frühzeitigen Selektion von Patienten mit einem erhöhten<br />
Risiko zur Frühberentung. Die gesamten Ergebnisse zeigen, dass sich unterschiedliche<br />
Risikofaktoren auf allen Ebenen der Erkrankung <strong>und</strong> Behandlung identifizieren<br />
lassen.<br />
Bei der Entwicklung <strong>des</strong> Screeninginstrumentes wurden unter Beachtung <strong>des</strong> Umfanges<br />
<strong>und</strong> der Praktikabilität die relevanten Prädiktoren der unterschiedlichen Ebenen<br />
einbezogen. In einer Kurzfassung <strong>des</strong> Instrumentes wurden nur die Prädiktoren<br />
integriert, die für die Gesamtgruppe (ohne Altersstratifizierung) Bedeutung erlangten.<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> im Projekt integrierten berufsbezogenen Beratungskonzepts (Interventionsebene)<br />
wurden diese Prädiktoren um wesentliche Aspekte der Rehabilitationsmotivation<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> Beratungsbedarfs ergänzt. Die Kurzfassung enthält folgende Bereiche:<br />
• Erwartungen an den Klinikaufenthalt<br />
• Beschwerden <strong>und</strong> Belastungen<br />
• Ambulante <strong>und</strong> stationäre Behandlungen<br />
• Berufliche Situation<br />
• Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit<br />
• Beratungswünsche<br />
• Alter<br />
Daneben wurde eine Langfassung <strong>des</strong> Fragebogens entwickelt, in die auch die<br />
Prädiktoren der altersstratifizierten Subgruppen integriert wurden. Vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
<strong>des</strong> umfassenden Rehabilitationsmodells der ICF (WHO 2001, Schuntermann<br />
2003) <strong>und</strong> der sozialmedizinischen Relevanz von Erkrankungen der Lunge <strong>und</strong> der<br />
Atemwege wurde einer umfassenden Abbildung <strong>des</strong> beruflichen Bereiches <strong>und</strong> seiner<br />
Einflussfaktoren Vorrang gegeben. Dies bedeutet, dass nicht alleine die Einzelprädiktoren,<br />
sondern jeweils die Bereiche in den Fragebogen aufgenommen wurden.<br />
In das Screeninginstrument wurden erprobte selbstentwickelte Verfahren <strong>und</strong> standardisierte<br />
Fragebögen bzw. Subskalen 1 aus diesen zusammengefasst.<br />
Der Fragebogen zu berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden <strong>und</strong> Belastungen<br />
enthält in der Langfassung folgende Bereiche:<br />
• Erwartungen an den Klinikaufenthalt<br />
1 Durch die Integration von Fragebögen bzw. Subskalen aus Fragebögen anderer Autoren muss das<br />
Recht zur Verwendung dieser Instrumente vor einer Erprobung der Langfassung mit den Autoren <strong>und</strong><br />
dem Hogrefe-Verlag abgesprochen werden. Bei einer entsprechenden Einigung erfolgt im Instrument<br />
jeweils die Quellenangabe.<br />
132
• Belastungen <strong>und</strong> Beschwerden<br />
• Behandlungen<br />
• Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> soziale Unterstützung<br />
• Berufliche Situation<br />
• Lebenszufriedenheit<br />
• Beratungswünsche im beruflichen Bereich<br />
• Soziodemographische Daten<br />
Der Fragebogen kann zu diesem Zeitpunkt lediglich als Entwurf auf der Basis relevanter<br />
Prädiktoren bezeichnet werden. Unter Einbeziehung der Ergebnisse <strong>des</strong> Projekts<br />
muss das Instrument in einem ersten Schritt im Verb<strong>und</strong> <strong>und</strong> in der Fachgesellschaft<br />
diskutiert werden. Eine abschließende Beurteilung wird ohne Erprobungsphase<br />
zudem nicht möglich sein. Gr<strong>und</strong>sätzlich wird die in der Langfassung vorhandene<br />
umfassende Einbeziehung der „Prädiktorenbereiche“ im Gegensatz zur alleinigen<br />
Einbeziehung relevanter Einzelprädiktoren zu prüfen sein. Dies betrifft die komplette<br />
Integration der Asthma-Symptom-Liste (Kinsman et al. 1974), <strong>des</strong> Freiburger<br />
Fragebogens zur Krankheitsverarbeitung (Muthny 1989) <strong>und</strong> insbesondere auch die<br />
Integration der Subskalen „Angst“ <strong>und</strong> „Depression“ <strong>des</strong> BSI (Derogatis et al. 1977),<br />
die keinen Beitrag zur Vorhersage leisten. Für die Integration der kompletten Instrumente<br />
bzw. Subskalen spricht der Einfluss auf die zentralen Ziele der Rehabilitation<br />
in den Bereichen der Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> <strong>des</strong> Krankheitsmanagements. In<br />
diesem Kontext wäre die gesamte Integration der Instrumente sinnvoll. Die Integration<br />
der beiden Subskalen <strong>des</strong> BSI wird unter dem Aspekt der psychischen Komorbidität<br />
als sinnvoll angesehen.<br />
5.4. Welche Beratungskonzepte sind notwendig, damit der langfristige Behandlungserfolg<br />
gesichert <strong>und</strong> eine Frühberentung vermieden werden<br />
kann (Schnittstelle zur Nachsorge)?<br />
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die zur Aufnahme in die Klinik anstehenden<br />
Patienten zu ihren Erwartungen an den Klinikaufenthalt <strong>und</strong> zu notwendigen<br />
beruflichen Hilfen befragt. Zusätzlich wurden für jeden Patienten bei Aufnahme <strong>und</strong><br />
Entlassung durch den behandelnden Stationsarzt Krankheitsbelastungen in ihrer<br />
Ausprägung eingestuft <strong>und</strong> bei Entlassung der Rehabilitationsverlauf <strong>und</strong> die weitere<br />
Prognose durch vorgegebene abgestufte Items bewertet.<br />
Von den 550 ca. vier Wochen vor der Klinikaufnahme angeschriebenen Patienten<br />
nahmen 455 durch Abgabe eines ausgefüllten Fragebogens an der Studie teil (Rücklaufquote<br />
82,7 %). Für diese liegen 358 Arztbogen vor, was einem Rücklauf von 78,7<br />
% entspricht.<br />
Bei der Stichprobe sind die Geschlechter in etwa gleich vertreten (Frauen 52,3 %,<br />
Männer 47,7 %). Das Durchschnittsalter liegt insgesamt bei 48,7 Jahren (±13.0). Der<br />
überwiegende Teil der Befragten ist verheiratet (71,2 %) bzw. lebt in einer Partnerschaft<br />
(77,7 %). Das Bildungsniveau ist relativ hoch. R<strong>und</strong> ein Drittel der Befragten<br />
hat als höchsten Bildungsabschluss die Fachhochschulreife bzw. das Abitur.<br />
Auf der Basis der Arztangaben leiden 91,2 % an Asthma bronchiale in unterschiedlicher<br />
Form. Neben der pneumologischen Erkrankung weisen 68,4 % weitere Erkrankungen<br />
auf, wobei neben Endokrinopathien (23,7 %), Herz- Kreislauferkrankungen<br />
133
(22,8 %), mit der Atemwegserkrankung verb<strong>und</strong>ene Allergien (15,8 %) <strong>und</strong> mit jeweils<br />
13,5 % Erkrankungen <strong>des</strong> Skeletts <strong>und</strong> der Haut im Vordergr<strong>und</strong> stehen. Bezogen<br />
auf den Zeitpunkt der Erstdiagnose weisen die Patienten eine durchschnittliche<br />
Erkrankungsdauer von 16,3 Jahren (± 12,6) auf.<br />
Die meisten Betroffenen leiden unter mittelschweren (56,6 %) <strong>und</strong> schweren Asthmaanfällen<br />
(23,9 %). Basierend auf der notwendigen Medikation weisen über die<br />
Hälfte der Befragten ein mittelschweres (62,0 %) bis schweres Asthma (18,8 %) auf.<br />
Allgemeine krankheitsbezogene Belastungen ergeben sich aus den Patientenangaben<br />
vorwiegend in der Bereichen der körperlichen Leistungsfähigkeit (44,8 %), der<br />
Krankheitssymptomatik (42,6 %), der allgemeinen Leistungsfähigkeit (41,2 %), der<br />
körperlichen Verfassung (38,1 %) <strong>und</strong> in den beruflichen Bereichen durch eine eingeschränkte<br />
Leistungsfähigkeit (35,3 %) <strong>und</strong> Arbeitsfähigkeit (33,8 %). Die Einschätzung<br />
der behandelnden Klinikärzte zeigt ein umgekehrtes Bild. In Verbindung mit der<br />
Arzteinschätzung dieser Belastungen fällt auf, dass die Ärzte im Vergleich zu den<br />
Patienten deutlich höhere Defizite im Bereich notwendiger Fertigkeiten im Krankheitsmanagement<br />
(Wissen, Symptomwahrnehmung <strong>und</strong> -kontrolle, Einleitung geeigneter<br />
Schritte) sehen. Demgegenüber fühlen sich die Patienten im somatischen,<br />
funktionalen <strong>und</strong> psychosozialen Bereich stärker beeinträchtigt, als dies vom Arzt<br />
bewertet wird. Bis auf die berufliche Leistungsfähigkeit ergeben sich für alle im Vergleich<br />
vorliegenden Bereiche signifikante Unterschiede in der Einschätzung der Belastungsintensität,<br />
ein Phänomen, was auch bereits in früheren Studien aufgetreten<br />
ist (vgl. Kaiser 1994).<br />
Im Bereich der funktionalen Stichprobenmerkmale zeigt sich in Verbindung mit<br />
dem hohen Bildungsgrad, dass 42,8 % der Befragten eine abgeschlossene Lehre<br />
haben, 15,3 % eine Fachschule besucht haben <strong>und</strong> mit 23 % fasst ein Viertel über<br />
einen Hochschulabschluss verfügt. Dementsprechend werden im Berufsstatus die<br />
weitaus stärksten Gruppen von Angestellten (40,4 %) <strong>und</strong> Beamten (12,7 %) gebildet.<br />
Der Anteil der Berenteten beträgt 23,9 %. Davon entfallen auf eine Altersrente<br />
11,4 % <strong>und</strong> auf eine Frühberentung 12,5 %.<br />
Insgesamt 45,1 % der Befragten besitzen einen Schwerbehindertenausweis mit einem<br />
durchschnittlichen Grad der Behinderung von 58,2 % (± 17,9). In den vergangen<br />
fünf Jahren haben nur insgesamt 2,5 % der Befragten an Maßnahmen zur beruflichen<br />
Rehabilitation teilgenommen, die vorwiegend als Umschulung durchgeführt<br />
wurden. Zum Zeitpunkt der Klinikaufnahme sind 14,5 % der Befragten arbeitsunfähig<br />
krankgeschrieben. Bezogen auf die letzten 12 Monate traf dies bei 87,8 % min<strong>des</strong>tens<br />
einmal zu (MW 33,5 Tage, ± 50,4). Die momentane Arbeitsfähigkeit beträgt<br />
durchschnittlich 61,4 % (± 25).<br />
In der aktuellen beruflichen Tätigkeit arbeiten 75,8 % vollzeitig mit überwiegend<br />
regelmäßigen Arbeitszeiten (68,7 %). Im Durchschnitt wird die aktuelle Tätigkeit seit<br />
15,5 Jahren ausgeübt (± 11,6 Jahre). Im Rahmen ihrer Tätigkeit berichten 14 % der<br />
Befragten von betrieblichen Umstrukturierungen <strong>und</strong> Rationalisierungen. Insgesamt<br />
6,2 % der Patienten haben verstärkt Angst, in der nächsten Zeit arbeitslos zu werden<br />
(MW 1,70, ± .92) <strong>und</strong> 20,5 % haben den Wunsch, in absehbarer Zeit in Rente zu gehen<br />
bzw. aus dem Berufsleben auszuscheiden.<br />
134
Berufs- <strong>und</strong> arbeitsbezogene Belastungen geben insgesamt 80,5 % der Berufstätigen<br />
an. Der am häufigsten vorkommende Faktor ist das Arbeiten in geschlossenen<br />
Räumen (64,0 %) mit einem relativen Belastungspotential von 15,7 %, gefolgt von<br />
der Notwendigkeit starker Konzentration (63,7 %) mit einem relativen Belastungspotential<br />
von 31,5 %. Insgesamt zeigt sich ein breites Spektrum an Belastungen, bei<br />
dem sowohl körperlich beanspruchende Faktoren <strong>und</strong> Reizungen der Atemwege als<br />
auch psychische Komponenten wie ein schlechtes Arbeitsklima <strong>und</strong> die Sorge um<br />
den Arbeitsplatz im Vordergr<strong>und</strong> stehen.<br />
Im Zusammenhang mit den Belastungen sind auch die krankheitsbedingten Fehlzeiten<br />
zu sehen. Die Arbeitsunfähigkeitszeiten <strong>und</strong> die Anzahl beruflicher Belastungen<br />
korrelieren signifikant positiv miteinander (r=.18, p
lich der Erfüllung weist in fast allen Bereichen hohe <strong>und</strong> signifikante (p < .001) Zusammenhänge<br />
auf.<br />
Von der Gesamtstichprobe werden dabei vorwiegend die Verbesserung der körperlichen<br />
Leistungsfähigkeit (95,5 %) Erholung, (95,1 %), Mitteilung der genauen Diagnose<br />
(91,2 %), Erlernung einer gesünderen Lebensweise (84,1 %) <strong>und</strong> ein ansprechender<br />
Kurort (83,5 %) genannt. Bis auf die im berufsbezogenen Bereich anzusiedelnden<br />
Erwartungen zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit (69,6 %) <strong>und</strong> zum Abbau<br />
von beruflichem Stress (61,2 %), spielen die weiteren Aspekte für die Gesamtstichprobe<br />
eine untergeordnete Rolle: Hilfe bei arbeits- <strong>und</strong> sozialrechtlichen Fragen<br />
(29,7 %), die Bestätigung einer verminderten beruflichen Leistungsfähigkeit (29,4 %),<br />
Hilfe bei der Rentenantragstellung (10,8 %), Information/Beratung zur Umschulung<br />
(8,5 %).<br />
Nimmt man von dieser pauschalen Betrachtung der Erwartungen der Gesamtstichprobe<br />
Abstand, so ergibt sich für die im berufsbezogenen Kontext relevante Stichprobe<br />
der Berufstätigen <strong>und</strong> der Frühberenteten ein vollkommen anderes Bild. Berufstätige<br />
erwarten vorwiegend eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit (76,8 %) <strong>und</strong><br />
den Abbau von beruflichem Stress (73,1 %). Daneben spielen Hilfen bei arbeits- <strong>und</strong><br />
sozialrechtlichen Fragen (32,1 %), die Bestätigung der verminderten beruflichen<br />
Leistungsfähigkeit (26,7 %), Hilfestellungen bei einem Rentenantrag (12,5 %) <strong>und</strong><br />
Beratung bezüglich Umschulungsmaßnahmen (9,7 %) eine Rolle.<br />
Für die Subgruppe der Frühberenteten zeichnet sich wiederum ein vollkommen anderes<br />
Bild. Bei den Erwartungen an den Klinikaufenthalt stehen die Bestätigung der<br />
verminderten beruflichen Leistungsfähigkeit (38,2 %), Hilfe bei arbeits- <strong>und</strong> sozialrechtlichen<br />
Problemen (35,5 %) <strong>und</strong> die Erhöhung der Arbeitsfähigkeit (32,4 %) im<br />
Vordergr<strong>und</strong>. Daneben wird von 11,8 % der Abbau von beruflichem Stress <strong>und</strong> von<br />
jeweils 9,4 % Hilfestellungen bei einem Rentenantrag bzw. Beratung zu Umschulungsmöglichkeiten<br />
genannt.<br />
Eine weitere differenzierte Betrachtung der Beratungserwartungen ergibt sich durch<br />
eine Altersgruppierung. Hierbei zeigt sich, dass der Abbau von beruflichem Stress<br />
bis auf die älteste Subgruppe (ab 55 Jahre) bei allen anderen Betroffenen einen sehr<br />
hohen Stellenwert hat (70-73,8 %). Die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit spielt insbesondere<br />
in den Altersgruppen zwischen dem 35 <strong>und</strong> 54 Lebensjahr eine herausragende<br />
Rolle (76,7-78,6 %). Bei der jüngsten Gruppe (bis 34 Jahre) <strong>und</strong> bei der ältesten<br />
wird dies von ca. zwei Dritteln der Befragten erwartet. Hilfe bei arbeits- <strong>und</strong><br />
sozialrechtlichen Fragen spielen für ca. ein Drittel der Befragten eine Rolle, wobei<br />
diese Erwartung in der ältesten Gruppe mit 24,1 % geringer ausfällt. Der Wunsch<br />
nach Bestätigung der verminderten beruflichen Leistungsfähigkeit nimmt mit dem<br />
Alter zu (22,8-37,3 %). Gleiches gilt für den Wunsch nach Hilfe bei einer Rentenantragstellung<br />
(7,7-15 %). Ein umgekehrter Trend zeigt sich bei den Erwartungen bezüglich<br />
Beratungen zu Umschulungen, die mit zunehmendem Alter abnehmen (16,7-<br />
6,9 %).<br />
Neben dieser Abschätzung eines berufsbezogenen Beratungsbedarfs auf der Basis<br />
der Erwartungen an den Klinikaufenthalt ergeben sich weitere Anhaltspunkte hierfür<br />
durch die direkte Befragung zu diesem Thema. Gr<strong>und</strong>sätzlich wünschen sich 31,8 %<br />
der Berufstätigen <strong>und</strong> 20 % der Frühberenteten eine ausführliche Beratung zu berufsbezogenen<br />
Fragen.<br />
136
Auf der Basis möglicher Beratungsbereiche zeigt sich ein anderes Bild. Lediglich 7,4<br />
% aller Berufstätigen äußern keinerlei Interesse an einer entsprechenden Beratung.<br />
Bei den relevanten Themen stehen folgende Bereiche im Vordergr<strong>und</strong>: medizinische<br />
Rehabilitation (85,7 %), Krankheit <strong>und</strong> Beruf (77,8 %), Allergien am Arbeitsplatz (72,9<br />
%), im Beruf bleiben (72,8 %), berufliche Perspektiven (62,2 %), berufliche Rehabilitation<br />
(51,4 %), Umgang mit Vorgesetzten/Krankheit (51,4 %), Umgang mit Kollegen/Krankheit<br />
(48,1 %), Möglichkeiten zur Berentung (44,5 %), Weiter-/Fortbildung<br />
(41,9 %), allgemeiner Umgang mit Vorgesetzten/Kollegen (40,8 %) <strong>und</strong> Umschulungsmöglichkeiten<br />
(23 %).<br />
Über den beruflichen Kontext hinaus wünschen sich 52,7 % der Befragten Beratungen<br />
in Bezug auf Hilfsmöglichkeiten bei Behörden <strong>und</strong> Krankenkassen <strong>und</strong> 46,6 % in<br />
Bezug auf Hilfen in der Rehabilitationsnachsorge (Selbsthilfegruppen, -verbände,<br />
etc.).<br />
Die Ergebnisse verdeutlichen einerseits einen hohen Beratungsbedarf zu berufsbezogenen<br />
Hilfen, andererseits geben nur 11,6 % der Befragten an, jemals diesbezüglich<br />
beraten worden zu sein. Wenn überhaupt, wurden diese vorwiegend durch die<br />
Renten- <strong>und</strong> Krankenversicherung sowie das Arbeitsamt durchgeführt.<br />
5.5. In welchem Ausmaß finden berufliche Aspekte im Rahmen einer pneumologischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme Berücksichtigung?<br />
Die zentrale Aufgabe der medizinischen Rehabilitation in Bezug auf den Erhalt oder<br />
die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit legt die Frage nahe, wie berufsbezogene<br />
Aspekte hierbei Berücksichtigung finden.<br />
Zur Beantwortung dieser erweiterten Fragestellung wurde auf der Basis der im<br />
Rahmen der Befragung zur beruflichen Hilfen durchgeführten Arztbefragung die Rehabilitationsbehandlung<br />
unter den Aspekten der Prozess- <strong>und</strong> Ergebnisqualität<br />
näher untersucht. Hierzu liegen 358 Fragebögen der behandelnden Stationsärzte<br />
vor, was im Vergleich zu den Patientendaten einem Rücklauf von 78,7 % entspricht.<br />
Neben der biomedizinischen Basisdiagnostik <strong>und</strong> der daraus resultierenden Optimierung<br />
der Pharmakotherapie wurden die Betroffenen durch die behandelnden Ärzte in<br />
die unterschiedlichen Rehabilitationsangebote überwiesen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen<br />
dabei die Angebote der Sporttherapie (90,9 %), der Inhalationstherapie (82,3 %), der<br />
Physiotherapie (79,4 %) <strong>und</strong> der Balneologie (73,7 %).<br />
Neben einer weitergehenden Absicherung der Rehabilitationsdiagnose durch biomedizinische<br />
(59,1 %) <strong>und</strong> psychosoziale (4,6 %) Diagnostikverfahren fanden während<br />
<strong>des</strong> Rehabilitationsaufenthaltes gezielte Überweisungen zu Einzelbehandlungen<br />
bzw. Beratungen in die Bereiche der Rehabilitationspsychologie (14,3 %), der Ernährungsberatung<br />
(9,7 %), der Arbeits- <strong>und</strong> Sozialmedizin (8,3 %) <strong>und</strong> der Sozialberatung<br />
(7,4 %) statt.<br />
Der Nutzen der Angebote für die Gesamtbehandlung wird durch die Ärzte insgesamt<br />
sehr hoch eingeschätzt. Neben der Absicherung der Eingangsdiagnostik durch weiterführende<br />
medizinische (98 %) <strong>und</strong> psychosoziale Diagnostik (66,4 %) werden da-<br />
137
ei insbesondere die Angebote der Inhalationstherapie (95,2 %), der Physiotherapie<br />
(93,2 %), der Balneologie (91,1 %) <strong>und</strong> der Sporttherapie (86,5 %) genannt.<br />
Ein erster Effekt der Rehabilitationsmaßnahme lässt sich aus der Veränderung <strong>des</strong><br />
Asthmaschweregra<strong>des</strong> in Verbindung mit der notwendigen Basis- <strong>und</strong> Bedarfsmedikation<br />
erkennen. Im Vergleich zwischen Aufnahme <strong>und</strong> Entlassung zeigen sich deutliche<br />
Verschiebungen (p ≤ .001). Während die Anzahl von Patienten, die bei Klinikaufnahme<br />
keine Medikamente nehmen mussten bzw. ein intermittieren<strong>des</strong> Asthma<br />
hatten, abgenommen hat, zeigt sich eine relativ deutliche Zunahme im Bereich <strong>des</strong><br />
leichten Asthmas (21 vs. 29,4 %). Die Anzahl im Bereich <strong>des</strong> mittelschweren Asthmas<br />
zeigt keine Veränderung (41,3 vs. 41,6 %), <strong>und</strong> die Zahl der Patienten mit<br />
schwerem Asthma hat leicht abgenommen (20,7 vs. 18,8 %). Die deutliche Zunahme<br />
im Bereich <strong>des</strong> leichten Asthmas lässt zwei Erklärungen zu. Auf der einen Seite dürften<br />
im Bereich der schwereren Krankheitsformen Verbesserungen erreicht worden<br />
sein. Andererseits ist davon auszugehen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Patienten<br />
zu Beginn <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes in Relation zur Krankheitsschwere medikamentös<br />
untertherapiert war.<br />
Wesentliche Therapieziele der Rehabilitation liegen in der Reduktion von Krankheitsfolgen<br />
<strong>und</strong> in der Förderung der Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> <strong>des</strong> Krankheitsmanagements.<br />
Die bei Aufnahme von den behandelnden Ärzten eingestufte Belastungsintensität<br />
in unterschiedlichen Bereichen krankheitsbezogener Belastungen<br />
weicht durchweg hochsignifikant (p ≤ .001) von den Patientenangaben ab. Krankheitsbelastungen<br />
<strong>und</strong> unterschiedliche Kompetenzen im Rahmen <strong>des</strong> Krankheitsmanagements<br />
werden dabei von den Patienten im Vergleich zur Bewertung <strong>des</strong> Arztes<br />
stärker angegeben. Aus Sicht <strong>des</strong> Arztes zeigt sich zwischen Aufnahme <strong>und</strong> Entlassung<br />
in allen Bereichen der krankheitsbezogenen Belastungen eine deutliche <strong>und</strong><br />
hochsignifikante Verbesserung (p ≤ .001). Ohne auf die einzelnen Differenzen einzugehen,<br />
kann hierbei unter Bezugnahme auf frühere Studien (Kaiser 1994) von einer<br />
Überschätzung der Veränderungen durch die behandelnden Ärzte ausgegangen<br />
werden.<br />
Die Rehabilitationsziele lagen bei den Patienten aus Sicht <strong>des</strong> Arztes vorwiegend in<br />
edukativen (93,1 %) <strong>und</strong> somatischen (91, 3 %) Bereichen, gefolgt von funktionalen<br />
(79,9 %) <strong>und</strong> psychosozialen (60 %) Bereichen. Bei über drei Viertel der Patienten<br />
konnten diese Ziele umfassend erreicht werden, dies insbesondere mit 82,8 % im<br />
edukativen Bereich.<br />
Im Kontext <strong>des</strong> zentralen Projektthemas weisen nach Auffassung der Ärzte lediglich<br />
45,2 % der Patienten ein geringes Risiko zur vorzeitigen Berentung auf. Bei 19,5 %<br />
ist das Risiko unsicher <strong>und</strong> insgesamt 35,2 % werden als deutlich gefährdet eingestuft<br />
(MW 2,89, ± 1,26). Hierbei ist der Unterschied zwischen Frauen <strong>und</strong> Männern<br />
von 38,5 % gegenüber 32,3 % statistisch nicht bedeutsam. Der größte Anteil an vermuteten<br />
Risikopatienten ist mit einem Anteil von 47 % in der Altersgruppe zwischen<br />
45 bis 54 Jahren zu finden. Die vom Arzt vorgenommene Prognose bezüglich der<br />
weiteren Entwicklung der Erwerbsfähigkeit ergibt, dass bei insgesamt 10,9 % eine<br />
Verschlechterung angenommen wird <strong>und</strong> beim größten Teil der Stichprobe der Status<br />
quo gehalten werden kann (MW 3,39 ± .84).<br />
Zur Stabilisierung der erreichten Erfolge wird für die Rehabilitationsnachsorge von<br />
den behandelnden Ärzten bei 35,2 % eine intensive ambulante Weiterführung der<br />
138
Rehabilitation als notwendig erachtet. Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation<br />
müssen bei 5,6 % geprüft <strong>und</strong> bei 4,4 % eingeleitet werden. Die Frage einer vorzeitigen<br />
Berentung steht bei insgesamt 7,2 % der Patienten im Raum. Aus Sicht der Ärzte<br />
sollte diesbezüglich bei jeweils 3,6 % eine weitere Abklärung erfolgen bzw. die<br />
notwendigen Schritte zur Berentung eingeleitet werden.<br />
5.6. Welchen Beitrag können hierbei die an der Gesamtbehandlung beteiligten<br />
Versorgungssegmente leisten?<br />
Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden wesentliche Versorgungssegmente<br />
im Rahmen einer Fragebogenerhebung angeschrieben. Aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> geringen<br />
Rücklaufs muss sich die Ergebnisdarstellung auf pneumologische Kliniken <strong>und</strong> niedergelassene<br />
Pneumologen beschränken. Eine Repräsentativität der Erhebung kann<br />
nicht angenommen werden, so dass die Ergebnisse lediglich Hinweise zur Beantwortung<br />
der Fragestellung liefern können.<br />
Bei den antwortenden Kliniken (n=35, Rücklauf 14,5 %) handelt es sich primär um<br />
Einrichtungen, bei denen pneumologische Erkrankungen einen Teilbereich <strong>des</strong> Indikationsspektrums<br />
darstellen. Der Anteil an Lungen- <strong>und</strong> Atemwegserkrankungen beträgt<br />
durchschnittlich 56,1 % (± 26,2). Während <strong>des</strong> Klinikaufenthaltes werden von<br />
durchschnittlich 29,9 % (± 27) der Patienten Fragen zu beruflichen Bereichen thematisiert.<br />
Insgesamt 60 % der Kliniken geben an, berufliche Aspekte in die Gesamtbehandlung<br />
einzubeziehen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei diagnostische Verfahren (Anamnese,<br />
Lungenfunktions- <strong>und</strong> Allergiediagnostik) <strong>und</strong> Beratungsansätze. Bei diesen Einrichtungen<br />
werden berufliche Aspekte der Patienten primär durch Kontakte zu anderen<br />
Einrichtungen berücksichtigt. Hierbei stehen Hinweise über geeignete Einrichtungen<br />
oder Überweisungen in die Einrichtungen (MW 3,12 ± .96) <strong>und</strong> patientenbezogene<br />
Kontakte mit diesen Einrichtungen (MW 3,22 ± 1,04) im Vordergr<strong>und</strong>. Eine direkte<br />
Zusammenarbeit besteht dabei vorwiegend mit Berufsbildungswerken (77,1 %), der<br />
Rentenversicherung (62,9 %), Krankenkassen (51,4 %), Rehabilitationskliniken (48,6<br />
%) <strong>und</strong> den Arbeitgebern der Patienten (42,9 %). Als positiv wird dabei insbesondere<br />
die Zusammenarbeit mit Berufsbildungswerken (42,9 %), Rehabilitationskliniken<br />
(34,3 %), der Rentenversicherung (28,6 %) <strong>und</strong> den Arbeitgebern der Patienten (25,7<br />
%) angegeben.<br />
Kliniken, die beruflich orientierte Maßnahmen durchführen, setzen dies überwiegend<br />
durch Beratungsangebote im beruflichen Kontext um. Insgesamt 4 Einrichtungen<br />
geben darüber hinaus interne Belastungserprobungen an. Die Dauer der Maßnahmen<br />
schwankt zwischen 1 <strong>und</strong> 35 Tagen (MW 19,9, ± 11,7). Einschlusskriterien<br />
in die Maßnahmen sind vorwiegend das Alter, die Motivation, die Kooperationsfähigkeit,<br />
drohende Arbeitsunfähigkeit <strong>und</strong> die Sinnhaftigkeit einer Umschulung.<br />
Die beteiligten Berufsgruppen setzen sich meist aus Ärzten (45,7 %), Psychologen<br />
(28,6 %) <strong>und</strong> mit jeweils 25,7 % aus Sozialarbeitern <strong>und</strong> Physiotherapeuten zusammen.<br />
Daneben werden im Einzelfall Berater der Rentenversicherung, Ökotrophologen<br />
<strong>und</strong> Pädagogen genannt. Die Koordination der Maßnahmen in Form von Einleitung,<br />
Überprüfung <strong>und</strong> Ergebnisbesprechung erfolgt überwiegend durch ein Team<br />
von Ärzten, Psychologen <strong>und</strong> Sozialarbeitern.<br />
139
Die Effektivität der selbst durchgeführten Maßnahmen wird von 20 % der durchführenden<br />
Kliniken als gering <strong>und</strong> von jeweils 40 % als mittel bis hoch (MW 3,20 ± .79)<br />
eingestuft. Die Ineffektivität wird dabei in Einzelaussagen mit der allgemeinen wirtschaftlichen<br />
Situation, fehlender Unterstützung <strong>und</strong> einer mangelnden Umsetzung<br />
der Empfehlungen beschrieben.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird die Notwendigkeit einer verstärkten Einbindung beruflicher Aspekte<br />
in den Rehabilitationsprozess von 82,4 % der Einrichtungen als sehr hoch eingeschätzt<br />
(MW 4,29 ± .91). Dabei wird von 59,4 % der Einrichtungen die Nützlichkeit<br />
von geeigneten Untersuchungen zur Früherkennung von beruflichen Problemen als<br />
hilfreich angesehen (MW 3,69 ± 1,09). Bezogen auf die eigenen Patienten weisen<br />
28,2 % (± 20,1) ein erhöhtes Risiko zur vorzeitigen Berentung auf.<br />
Bezogen auf eigene Erfahrungen wird aus Sicht der Kliniken die höchste Effektivität<br />
bzw. Qualität in der Einbeziehung beruflicher Aspekte durch stationäre Rehabilitationseinrichtungen<br />
(68 %), Fachärzte (48,1 %), Berufsgenossenschaften (47,1 %) <strong>und</strong><br />
die Rentenversicherung (43,5 %) gewährleistet. Trotz einer wesentlichen Beteiligung<br />
bei beruflichen Fragestellungen wird insbesondere dem Arbeitsamt (3,8 %) keine<br />
hohe Effizienz unterstellt.<br />
Insgesamt betrachtet halten die Kliniken zur umfassenden Integration beruflicher Aspekte<br />
ein abgestuftes Zusammenwirken aller im Versorgungssystem beteiligten Einrichtungen<br />
für wichtig. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei Berufsgenossenschaften (83,9<br />
%), Fachärzte (82,8 %), stationäre Rehabilitationseinrichtungen (81,2 %) <strong>und</strong> die<br />
Rentenversicherung (77,4 %). Bis auf wenige Ausnahmen ergeben sich im Vergleich<br />
der von den Befragten bewerteten Effektivität der bisherigen Angebote <strong>und</strong> der Wichtigkeit<br />
in den Bereichen signifikante Unterschiede.<br />
Im Rahmen der Expertenbefragung liegen von 69 niedergelassenen Pneumologen<br />
Antworten vor (Rücklauf 12,8 %). Der Anteil an chronischen Lungen- <strong>und</strong> Atemwegserkrankungen<br />
beträgt durchschnittlich 73,2 % (± 13,7). Fragen zum beruflichen<br />
Bereich werden von durchschnittlich 22,9 % (± 15,6) der Patienten thematisiert.<br />
Die gr<strong>und</strong>sätzliche Notwendigkeit einer verstärkten Einbindung beruflicher Aspekte in<br />
den Rehabilitationsprozess wird von 79,7 % der Pneumologen als hoch eingeschätzt<br />
(MW 4,0 ± .86). Dabei geben 58,7 % an, dass hierzu geeignete Untersuchungen zur<br />
Früherkennung beruflicher Probleme hilfreich wären (MW 3,59 ± 1,07). Bezogen auf<br />
die eigenen Patienten weisen 20,4 % (± 13,3) ein erhöhtes Risiko zur vorzeitigen Berentung<br />
auf.<br />
Insgesamt 88,4 % der Pneumologen geben an, berufliche Aspekte in die Gesamtbehandlung<br />
einzubeziehen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei diagnostische Verfahren<br />
(pneumologische <strong>und</strong> arbeitsbezogene Anamnese, Lungenfunktions- <strong>und</strong> Allergiediagnostik).<br />
Berufliche Aspekte werden darüber hinaus bei durchschnittlich 7,6 % (± 9,3) primär<br />
durch Kontakte zu anderen Einrichtungen berücksichtigt. Hierbei stehen Hinweise<br />
über geeignete Einrichtungen oder Überweisungen in die Einrichtungen (MW 3,12 ±<br />
.90) <strong>und</strong> patientenbezogene Kontakte mit diesen Einrichtungen (MW 2,71 ± 1,03) im<br />
Vordergr<strong>und</strong>. Die direkte Zusammenarbeit erfolgt vorwiegend mit Berufsgenossen-<br />
140
schaften (94,2 %), Rehabilitationskliniken (85,5 %), Krankenkassen (82,6 %), Arbeitsämtern<br />
(68,1 %) <strong>und</strong> der Rentenversicherung (65,2 %). Als sehr positiv wird dabei<br />
die Zusammenarbeit mit Rehabilitationskliniken (68,1 %) <strong>und</strong> Berufsgenossenschaften<br />
(65,2 %) angegeben.<br />
Bezogen auf eigene Erfahrungen wird aus Sicht der Pneumologen die höchste Effektivität<br />
bzw. Qualität in der Einbeziehung beruflicher Aspekte durch Berufsgenossenschaften<br />
(61,9 %), Fachärzte (59,5 %), stationäre Akuteinrichtungen (47,7 %) <strong>und</strong><br />
stationäre Rehabilitationsbehandlungen (46,4 %) gewährleistet. Trotz einer wesentlichen<br />
Beteiligung bei beruflichen Fragestellungen wird dem Arbeitsamt (21,7 %), der<br />
Rentenversicherung (21,4 %), den Berufsbildungswerken (16,8 %) <strong>und</strong> den Berufsförderungswerken<br />
(9,7 %) keine hohe Effizienz unterstellt.<br />
Auch die Pneumologen halten zur umfassenden Integration beruflicher Aspekte ein<br />
abgestuftes Zusammenwirken aller im Versorgungssystem beteiligten Einrichtungen<br />
für wichtig. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei die Berufsgenossenschaften (86,6 %),<br />
Fachärzte (85,5 %), stationäre Rehabilitationseinrichtungen (74,2 %) <strong>und</strong> die Rentenversicherung<br />
(64,6 %). Bis auf wenige Ausnahmen ergeben sich im Vergleich der<br />
von den Befragten bewerteten Effektivität der bisherigen Angebote <strong>und</strong> der Wichtigkeit<br />
in den Bereichen signifikante Unterschiede.<br />
Insgesamt zeigt die Expertenbefragung, dass auf der einen Seite ein hoher Bedarf<br />
für eine Einbeziehung berufsbezogener Fragestellungen vorliegt, auf der anderen<br />
Seite jedoch diese insbesondere auch im Vorfeld von Rehabilitationsmaßnahmen<br />
relevanten Fragestellungen kaum Berücksichtigung finden. Neben fehlenden eigenen<br />
Angeboten spielen hierfür neben der primär akutmedizinischen Ausrichtung der Kliniken<br />
<strong>und</strong> Pneumologen auch Defizite in der Kooperation mit relevanten Einrichtungen<br />
eine Rolle.<br />
141
6. Diskussion <strong>und</strong> Integration der Ergebnisse<br />
Mit dem Gesamtprojekt liegen Merkmale für insgesamt 1.008 Patienten mit Erkrankungen<br />
der Lunge- <strong>und</strong> der Atemwege vor. Hiervon entfallen 553 auf eine Nachbefragung,<br />
die 5 Jahre nach der ersten Befragung durchgeführt wurde <strong>und</strong> 455 auf aktuell<br />
zur Aufnahme in die Klinik anstehenden Patienten. Die Charakteristika der<br />
Stichproben machen deutlich, dass pneumologische Rehabilitationskliniken mit Patienten<br />
konfrontiert werden, die überwiegend mittel- <strong>und</strong> schwergradige chronische<br />
Erkrankungen mit einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von über 15 Jahren, einer<br />
ausgeprägten Multimorbidität <strong>und</strong> vielfältigen Krankheitsbelastungen bzw. -folgen<br />
im somatischen, funktionalen, psychosozialen <strong>und</strong> edukativen Bereich aufweisen.<br />
Die Merkmale der Stichproben verdeutlichen eindrücklich die Evidenz der Rehabilitation<br />
i.S.e. systematischen Erweiterung der akutmedizinischen Behandlung <strong>und</strong> einer<br />
eindeutigen Orientierung am Modell der ICF (WHO 2001). Dies bedeutet im ersten<br />
Schritt eine eindeutige leitlinien- <strong>und</strong> evidenzbasierte biomedizinische Diagnostik <strong>und</strong><br />
medikamentöse Therapie (ICD), die innerhalb <strong>des</strong> interdisziplinär ausgerichteten Rehabilitationskonzeptes<br />
im zweiten Schritt gleichberechtigt – ressourcen- <strong>und</strong> defizitorientiert<br />
– Aspekte der funktionalen Ges<strong>und</strong>heit (Schuntermann 2003) in Diagnostik<br />
<strong>und</strong> Therapie einbezieht <strong>und</strong> zu einem Ganzen integriert.<br />
Für die pneumologische Rehabilitation bedeutet dies hohe Anforderungen an die<br />
Strukturqualität pneumologischer Rehabilitationszentren. Neben der indikationsspezifischen<br />
Ausstattung (räumlich, apparativ) <strong>und</strong> einer fachärztlichen <strong>und</strong> rehabilitationsmedizinischen<br />
ärztlichen Kompetenz umfassen diese strukturellen Voraussetzungen<br />
Angebote in den Bereichen der Physikalischen Therapie (Physio-, Sport- <strong>und</strong><br />
Bewegungs-, Inhalations-, Balneo- <strong>und</strong> Hydrotherapie), der Psychosozialen Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> Rehabilitationspsychologie, der Patientenschulung <strong>und</strong> der Ernährung<br />
(VDR 1991, DGP 1997, Kaiser 1994, Kaiser et al. 1995, Petro 2000, ÄZQ 2002). Insbesondere<br />
im Kontext der allergischen Komponente von Atemwegserkrankungen<br />
<strong>und</strong> der daraus resultierenden Notwendigkeit einer strikten Allergenkarenz kann der<br />
Klinikstandort in günstigen klimatischen Gebieten der Strukturqualität zugeordnet<br />
werden (Menz 2001).<br />
Die Effektivität stationärer pneumologischer Rehabilitationsmaßnahmen ist in Teilbereichen<br />
nachgewiesen. Hierbei sind vor allem Studien zur Physikalischen Therapie,<br />
zur Wirkung der Klimatherapie, zur Trainingstherapie, zur Psychotherapie <strong>und</strong> zur<br />
Patientenschulung zu nennen (DGP 1997, Kaiser 1994, Kaiser & Schmitz 1998c,<br />
2000c, Kaiser et al. 2000a, 1996, Büchi et al. 1996, Holzinger et al. 1994, Grootendorst<br />
2002, Lacasse et al. 1996).<br />
Unabhängig von den zentralen Zielsetzungen <strong>des</strong> Projektes lassen sich diese Effekte<br />
auch durch die mehr als 5 Jahre später durchgeführte Nachbefragung von 553 Patienten<br />
eindrücklich belegen. In allen Zielbereichen der Rehabilitation konnte zumin<strong>des</strong>t<br />
der progrediente Krankheitsverlauf mit massiven Krankheitsfolgen in allen Lebensbereichen<br />
gestoppt <strong>und</strong> in zentralen Bereichen eine deutliche <strong>und</strong> signifikante<br />
Verbesserung erzielt werden. Auch wenn die Aussagekraft durch die Selbstangaben<br />
der Betroffenen eingeschränkt sein mag, betreffen die Verbesserungen auch kostenrelevante<br />
Bereiche. Im Vergleich zur Erstbefragung zeigt sich in der Katamnese eine<br />
deutliche <strong>und</strong> signifikante Reduktion der ambulanten Akutbehandlungen, der Notarzteinsätze<br />
<strong>und</strong> der Notfalleinweisungen in die Klinik.<br />
142
Die Ergebnisse belegen eindrücklich eine deutliche Reduktion notwendiger medizinischer<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> damit auch individueller Krankheitsfolgen <strong>und</strong> Belastungen.<br />
Insgesamt unterstreichen sie die Relevanz, Effektivität <strong>und</strong> die Effizienz der Rehabilitationsbehandlung.<br />
Die Entwicklung der kostenrelevanten Variablen über einen Zeitraum<br />
von über 5 Jahren nach der Rehabilitationsmaßnahme belegt zudem deren<br />
ökonomischen Nutzen.<br />
Auch wenn über diesen langen Zeitraum von über 5 Jahren <strong>und</strong> den vielfältigen Einflussfaktoren<br />
auf den Krankheitsverlauf keine Kausalität zur Rehabilitationsmaßnahme<br />
unterstellt werden kann, ergeben sich aus den Angaben der Betroffenen auf<br />
der einen Seite deutliche Belege für die defizitäre pneumologische Versorgungssituation<br />
<strong>und</strong> auf der anderen Seite gleichzeitig für den daraus resultierenden Stellenwert<br />
der stationären pneumologischen Rehabilitation.<br />
Unabhängig von der ges<strong>und</strong>heitlichen Gesamtsituation haben im Zeitraum zwischen<br />
den Befragungen nur 40,4 % eine weitere Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch<br />
genommen. Trotz der überwiegend mittel- bis schwergradigen Erkrankung befand<br />
sich zu beiden Zeitpunkten nur die Hälfte der Befragten in Behandlung bei einem<br />
Lungenfacharzt. Als notwendige Nachsorgemaßnahmen werden von den Befragten<br />
umfassende Hilfs- <strong>und</strong> Beratungsangebote aus allen Therapiebauseinen der Rehabilitation<br />
genannt. Die Angaben der Befragten zu in Anspruch genommenen Angeboten<br />
im Zeitraum zwischen beiden Messzeitpunkten verdeutlichen die große Diskrepanz<br />
zwischen Notwendigkeit, insbesondere auch unter rehabilitativen Aspekten,<br />
<strong>und</strong> der realen Wirklichkeit. Die Inanspruchnahme von Maßnahmen zur Nachsorge<br />
bzw. zur ambulanten Rehabilitation hat bei der untersuchten Stichprobe nicht stattgef<strong>und</strong>en.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich erfordern chronische Erkrankungen der Lunge <strong>und</strong> der Atemwege - je<br />
nach Schweregrad <strong>und</strong> Verlauf - eine lebenslange medizinische Versorgung, die an<br />
erster Stelle wohnortnah von Haus-/Fachärzten <strong>und</strong> Akutkliniken mit dem Ziel der<br />
Beseitigung oder Kompensation der körperlichen Aspekte der Erkrankung gewährleistet<br />
wird. Zur umfassenden Behandlung ist dabei jedoch eine enge Verzahnung<br />
mit rehabilitativen Angeboten notwendig, die in Zusammenarbeit mit dem Haus-<br />
/Facharzt den Schwerpunkt auf die Beseitigung oder Kompensation der Krankheitsfolgen<br />
legen. Da Rehabilitationszentren mit ambulanten Angeboten bisher fehlen,<br />
müssen diese als wesentliche Komponente in der regionalen Versorgungsstruktur<br />
aufgebaut werden. Hierbei erscheint es notwendig, die Qualitätsansprüche an stationäre<br />
Einrichtungen hinsichtlich der Struktur-, Prozess- <strong>und</strong> Ergebnisqualität sowie<br />
notwendigen Maßnahmen der Qualitätssicherung <strong>und</strong> <strong>des</strong> Qualitätsmanagements<br />
auf diese aufzubauenden ambulanten Zentren zu übertragen (Kaiser & Schmitz<br />
1998a, VDR 2000b, 2001, DGP 1997).<br />
Das eigentliche Kernprojekt beschäftigt sich mit der zentralen Zielsetzung der Rehabilitation<br />
der Rentenversicherung: der Sicherstellung der Integration <strong>des</strong> Versicherten<br />
in den Erwerbsprozess bzw. der Reintegration in das Berufsleben. Im Kontext<br />
<strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>themas „Zielorientierung in Diagnostik, Therapie <strong>und</strong> Ergebnismessung“<br />
(vgl. Bengel & Jäckel 2000) beinhaltet dies eine verbesserte Integration beruflich<br />
orientierter Maßnahmen in Diagnostik, Therapie, Schulung <strong>und</strong> Beratung im Rehabilitationsprozess.<br />
143
Die im Verb<strong>und</strong>thema integrierte Abkehr von der Pauschalisierung in Diagnostik,<br />
Therapie <strong>und</strong> Ergebnismessung hin zu einer individuellen Sichtweise dieser Bereiche<br />
bedeutet für das Projekt im ersten Schritt die Notwendigkeit einer empirischen Ableitung<br />
eines Risikoprofils zur Frühberentung. Hierbei wird versucht, auf der Basis<br />
<strong>des</strong> breiten Spektrums an krankheits- <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Merkmalen der<br />
Gesamtstichprobe eine Subgruppe zu bilden, die eine bestimmte Problem- <strong>und</strong>/oder<br />
Ressourcenkonstellation mit einer erhöhten/geringeren Gefährdung zur Frühberentung<br />
aufweist.<br />
Die Relevanz <strong>des</strong> Themas wird durch folgende Zahlen belegt:<br />
• Im Rahmen der Nachbefragung sind zwischen beiden Messzeitpunkten (5 Jahre<br />
Differenz) 22,5 % der zu t1 Berufstätigen frühberentet worden bzw. haben einen<br />
Antrag hierzu gestellt<br />
• Als Gründe für die Frühberentung geben die Betroffen an:<br />
− verminderte Leistungsfähigkeit (86,9 %)<br />
− körperliches Befinden (79,3 %)<br />
− Angst vor Verschlimmerung der Erkrankung (55,3 %)<br />
− Rat <strong>des</strong> behandelnden Hausarztes (50,5 %)<br />
− Rat der Familie <strong>und</strong> <strong>des</strong> Arbeitgebers (25 %)<br />
− Wunsch, mehr vom Leben haben zu wollen<br />
• Von den zu t2 Berufstätigen äußern 55,8 % die Sorge, frühzeitig berentet zu werden<br />
• Die behandelnden Ärzte stufen im Rahmen der Befragung zu beruflichen Hilfen<br />
insgesamt 35,2 % als Hochrisikopatienten zur vorzeitigen Berentung ein. Bei der<br />
Gruppe der 45-54-Jährigen trifft dies auf fast die Hälfte zu (47 %)<br />
• Bei dieser Teilbefragung an 455 Patienten werden im Rahmen der Erwartungen<br />
an die Rehabilitationsbehandlung von 10,8 % der Befragten Hilfen bei einer Rentenantragstellung<br />
geäußert <strong>und</strong> 29,4 % wollen die verminderte berufliche Leistungsfähigkeit<br />
bestätigt haben<br />
• Im Rahmen der Expertenbefragung stufen pneumologische Fachkliniken 28,2 %<br />
<strong>und</strong> niedergelassene Pneumologen 20,4 % ihrer Patienten als Risikopatienten zur<br />
vorzeitigen Berentung ein<br />
In dieser retrospektiven Langzeitstudie konnte an 408 Patienten ein Modell entwickelt<br />
werden, das eine Vorhersage <strong>des</strong> zukünftigen Risikos zur Frühberentung erlaubt.<br />
Hierzu wurden auf der Basis <strong>des</strong> Kriteriums <strong>des</strong> Erwerbstatus zwei Gruppen<br />
gebildet. Die Einschlusskriterien in diese Gruppen waren eine zwischen den Messzeitpunkten<br />
beantragte oder erfolgte Frühberentung (n=92) oder eine Berufstätigkeit<br />
zu beiden Messzeitpunkten (n=316).<br />
Die Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse (bezogen auf Messzeitpunkt<br />
t1) ergeben bei der Modellbildungsgruppe folgende Risiken zur vorzeitigen Berentung:<br />
ein höheres Alter, eine anerkannte Schwerbehinderung, eine höhere Zufriedenheit<br />
mit der Freizeit, eine geringere subjektive Arbeitsfähigkeit, eine niedrige Zufriedenheit<br />
mit der Stimmung, mehr Besuche bei einem Hausarzt/Allgemeinmediziner<br />
<strong>und</strong> weniger/keine Besuche bei einem Pneumologen (Facharzt). Eine Überprüfung<br />
<strong>des</strong> Modells mittels Kreuzvalidierung weist auf die Übertragbarkeit auf andere Stichproben<br />
hin.<br />
144
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der bestehenden chronischen Erkrankung weisen die Ergebnisse<br />
neben dem zunehmenden Alter insbesondere auf die Bedeutung <strong>des</strong> physischen<br />
<strong>und</strong> psychischen Verschleißes hin, der sich in der anerkannten Schwerbehinderung,<br />
der geringeren Arbeitsfähigkeit <strong>und</strong> der niedrigeren Stimmung äußert. Der<br />
insgesamt bedeutsame Prädiktor <strong>des</strong> Alters lässt verschiedene Interpretationen zu.<br />
Anhaltspunkte für ein De-Qualifizierungsrisiko (Naegele 1992), welches häufig mit<br />
höherem Alter zunimmt, lassen sich nicht erkennen. Ein De-Motivationsrisiko durch<br />
im Erwerbsleben verlorene Anerkennung <strong>und</strong> erfahrene Entmutigungen (Behrens et<br />
al. 1999, Behrens 2001) könnte sich eventuell durch die geringere Stimmung äußern.<br />
Wesentlich erscheint jedoch, dass mit zunehmender Nähe zur normalen Berentung<br />
die Arbeit für das individuelle Leben an Bedeutung verloren hat <strong>und</strong> der Selbstverwirklichung<br />
<strong>und</strong> Lebensqualität der Vorrang vor der Arbeit eingeräumt wurde. Hierdurch<br />
kann eine Interessensverlagerung angenommen werden, die mit den Lebensplänen<br />
vereinbar erscheint. Hierbei sei angemerkt, dass heute erstmals eine Generation<br />
an „Rentnern“ heranwächst, die in ein Sozialversicherungssystem eingebettet<br />
ist <strong>und</strong> mit zunehmendem Alter auch bei einer vorzeitigen Berentung nur geringe finanzielle<br />
Einbussen hat, was eine Interessensverlagerung in Richtung Selbstverwirklichung<br />
<strong>und</strong> Lebensqualität erleichtert. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der deutlichen lungenfachärztlichen<br />
Unterversorgung gewinnt die Anzahl der Arztbesuche an Bedeutung.<br />
Auf der einen Seite sprechen die Ergebnisse für eine verbesserte lungenfachärztliche<br />
Versorgung der Betroffenen, auf der anderen Seite lässt die Vielzahl der Besuche<br />
bei Allgemeinmedizinern/Hausärzten zwei Interpretationen zu. Bereits bei den<br />
allgemein angegebenen Gründen zur Frühberentung wurde deutlich, dass bei über<br />
der Hälfte der Frühberenteten der Hausarzt hierzu geraten hat. Dies mag durch die<br />
Anzahl der Kontakte <strong>und</strong> die häufig auch persönlichere Beziehung mit dem Hausarzt<br />
erklärbar sein. Auf der anderen Seite kann jedoch auch angenommen werden, dass<br />
aufgr<strong>und</strong> der Krankheitsschwere der Stichprobe zumin<strong>des</strong>t eine Mitbehandlung<br />
durch einen Lungenfacharzt indiziert war, die jedoch nicht erfolgt ist <strong>und</strong> damit die<br />
medizinischen Möglichkeiten nicht umfänglich ausgeschöpft wurden. Auch wenn der<br />
hohe Bildungsgrad der Stichprobe statistisch keine Rolle gespielt hat, kann ein hohes<br />
Wissen um die sozialrechtlichen Möglichkeiten angenommen werden, welches durch<br />
gezielte Handlungsplanung <strong>und</strong> adäquate Handlungskompetenz die Entscheidungsfindung<br />
zur Frühberentung <strong>und</strong> deren Umsetzung in die Realität gefördert hat.<br />
Weitere Hinweise ergeben sich durch die Ergebnisse der nach Altersgruppen stratifizierten<br />
Subgruppen. In der mittleren Altersgruppe (45-54 Jahre) kristallisieren<br />
sich eine vorliegende Schwerbehinderung, ein höheres Alter, eine höhere Unzufriedenheit<br />
mit dem eigenen Charakter <strong>und</strong> die Anzahl der AU-Zeiten als Risikofaktoren<br />
heraus.<br />
Die vorliegende Schwerbehinderung <strong>und</strong> die Anzahl der AU-Zeiten belegen eine<br />
Teilhabestörung im beruflichen Bereich, die auf einen physischen <strong>und</strong> psychischen<br />
Verschleiß rückschließen lässt. Der Einfluss <strong>des</strong> Alters in Verbindung mit der geringeren<br />
Zufriedenheit mit dem eigenen Charakter lässt auf eine Unvereinbarkeit mit<br />
dem vorhandenen Lebenskonzept schließen. Insgesamt spricht diese Konstellation<br />
für fehlende Ressourcen <strong>und</strong> Bewältigungsmöglichkeiten, die letztendlich zur Frühberentung<br />
führen. Hiermit kann die mittlere Altersgruppe als Verlierer der Erkrankung<br />
bezeichnet werden, bei der insbesondere der Förderung von Bewältigungsstrategien<br />
<strong>und</strong> Ressourcen eine besondere Beachtung geschenkt werden sollte.<br />
145
Wesentliche Einflussgrößen in der Altersgruppe ab 55 Jahre sind eine höhere Zufriedenheit<br />
mit der Freizeit, die Krankheitsdauer, höhere Werte in der Subskala <strong>des</strong><br />
FKV „Religiosität/Sinnsuche“, mehr Arztbesuche (Hausarzt/Allgemeinmediziner) <strong>und</strong><br />
eine höhere Unzufriedenheit in der Partnerschaft.<br />
Die Ergebnisse für die älteste Gruppe sprechen deutlich für eine in Verbindung mit<br />
der zeitlichen Nähe zur normalen Altersrente <strong>und</strong> der Krankheitsdauer stehenden<br />
klaren Entscheidung, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Die höhere<br />
Zufriedenheit mit der Freizeit spricht für eine Interessensverlagerung in Richtung<br />
Selbstverwirklichung <strong>und</strong> Lebensqualität zu Lasten der Bedeutung der Arbeit für das<br />
individuelle Leben. Die höheren Werte in der Subskala „Religiosität/Sinnsuche“ der<br />
Subskala <strong>des</strong> FKV weisen zusätzlich auf diese mit den weiteren Lebensplänen vereinbare<br />
Neuorientierung hin. Die vermehrten Arztbesuche lassen wiederum mehrere<br />
Interpretationen zu, die insbesondere eine mögliche mangelnde Ausschöpfung der<br />
Behandlung durch einen Lungenfacharzt <strong>und</strong>/oder den Rat <strong>des</strong> Hausarztes zur Berentung<br />
beinhalten. Als verstärkender Faktor für die Entscheidung zur Frühberentung<br />
kann eine mangelnde soziale Unterstützung in der Partnerschaft beigetragen haben,<br />
die durch die höhere Unzufriedenheit in der Partnerschaft zum Ausdruck gebracht<br />
wird. Wie bereits für die Gesamtgruppe dargestellt, können insbesondere für die ältere<br />
Gruppe die für eine Entscheidung zur Frühberentung förderlichen Rahmenbedingungen<br />
eine Rolle gespielt haben (finanzielle Absicherung, bildungsabhängige<br />
Handlungsplanung <strong>und</strong> -kompetenz).<br />
Eine weitere Analyse wurde mit den vorliegenden Daten aus dem Messzeitpunkt t2<br />
vorgenommen. Hierbei wurden die sich in einer univariaten Analyse als relevant erwiesenen<br />
Bereiche unter Beibehaltung der für t1 definierten Gruppen durch eine logistische<br />
Regressionsanalyse untersucht. Für die Gesamtstichprobe (n=408) erweisen<br />
sich dabei ein höheres Alter, eine stärkere berufliche Belastung durch die Atemwegserkrankung,<br />
eine anerkannte Schwerbehinderung, geringere Symptome der<br />
Müdigkeit (ASL) im Kontext der Atemwegssymptomatik, Einschränkungen im beruflichen<br />
Weiterkommen, eine stärkere Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit,<br />
eine geringere Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit, die AU-Zeiten,<br />
ein besseres Abfinden mit der chronischen Erkrankung <strong>und</strong> stärkere berufliche Veränderungen<br />
durch die Erkrankung als Risikofaktoren für eine Frühberentung. Eine<br />
Überprüfung <strong>des</strong> Modells mittels Kreuzvalidierung weist auf die Übertragbarkeit auf<br />
andere Stichproben hin.<br />
Auch wenn sich die Prädiktoren unterscheiden, ähneln die Ergebnisse denen in Bezug<br />
auf Messzeitpunkt t1. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der bestehenden chronischen Erkrankung<br />
mit einer Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit weisen die<br />
Ergebnisse neben dem zunehmenden Alter insbesondere auf die Bedeutung <strong>des</strong><br />
physischen <strong>und</strong> psychischen Verschleißes hin. Dieser äußert sich in der anerkannten<br />
Schwerbehinderung, der höheren Dauer der AU-Zeiten <strong>und</strong> stärkeren beruflichen<br />
Belastungen durch die Atemwegserkrankung. Dem widersprechen auch nicht unbedingt<br />
die geringere Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> die geringere<br />
Müdigkeit im Kontext der Atemwegssymptomatik. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> <strong>des</strong> höheren<br />
Alters scheint die Frühberentung für eine freiwillige oder erzwungene Richtungsentscheidung<br />
in Bezug auf die weitere Lebensgestaltung zu sprechen. Hierfür<br />
sprechen aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> Alters die zunehmende Nähe zur normalen Berentung <strong>und</strong><br />
das Abfinden mit der Chronizität der Erkrankung <strong>und</strong> deren Folgen. Im beruflichen<br />
Kontext kann diese Richtungsentscheidung durch bereits erlebte krankheitsbedingte<br />
146
erufliche Veränderungen <strong>und</strong> das Empfinden einer Einschränkung <strong>des</strong> beruflichen<br />
Weiterkommens beeinflusst worden sein. Letzteres kann auch im Sinne einer beruflichen<br />
De-Motivierung interpretiert werden. Wesentlich erscheint jedoch, das mit zunehmender<br />
Nähe zur normalen Berentung, krankheitsbedingten Belastungen <strong>und</strong><br />
negativen beruflichen Erfahrungen die Arbeit für das individuelle Leben an Bedeutung<br />
verloren (Sinnfindung, Motivation) hat <strong>und</strong> der Selbstverwirklichung <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
im Sinne einer Interessenverlagerung der Vorrang vor der Arbeit eingeräumt<br />
wurde.<br />
Weitere Hinweise ergeben sich wiederum durch die Ergebnisse der nach Altersgruppen<br />
stratifizierten Subgruppen. Für die Altersgruppe von 45-54 Jahren ergeben<br />
sich eine stärkere Beeinträchtigung der allgemeinen Leistungsfähigkeit, stärkere<br />
Belastungen durch ein hohes Arbeitstempo, ein geringerer Verdienst durch die<br />
Erkrankung, geringere Belastungen durch die Arbeit, geringere nächtliche Atemnot,<br />
geringere soziale Unterstützung <strong>und</strong> eine geringere Gefährdung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes<br />
als Risikofaktoren zur Frühberentung.<br />
Wie bereits bei den Ergebnissen in Bezug auf Messzeitpunkt t1, kann diese Altersgruppe<br />
auch hier als die Gruppe der Verlierer bezeichnet werden. Hierfür sprechen<br />
auf der einen Seite die geringere Gefährdung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes, allgemein geringere<br />
Belastungen durch die Arbeit <strong>und</strong> eine relative Stabilität der Krankheitssymptomatik,<br />
die sich in einer geringeren nächtlichen Atemnot äußert. Auf der anderen Seite<br />
scheinen jedoch Wechselwirkungen zwischen der Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> den beruflichen<br />
Anforderungen in Form einer stärkeren Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> einer quantitativen Überforderung <strong>und</strong> Autonomieverlust (Belastungen<br />
durch hohes Arbeitstempo) für die Frühberentung eine Rolle zu spielen. Hinzukommende<br />
negative berufliche Erfahrungen, eine hieraus mögliche Demotivierung (geringerer<br />
Verdienst durch die Erkrankung) <strong>und</strong> eine fehlende soziale Unterstützung,<br />
die im Zusammenwirken mit den anderen Faktoren insgesamt das Risiko zur Frühberentung<br />
erhöhen. Die Ergebnisse für diese Altersgruppe sprechen für eine stärkere<br />
Beachtung der Förderung psychischer (Motivation, Copingstrategien) <strong>und</strong> sozialer<br />
(soziale Unterstützung) Ressourcen sowie einer Beeinflussung von Arbeitsbedingungen,<br />
die mit der Erkrankung vereinbar sind (Umweltfaktoren).<br />
In der Gruppe ab 55 Jahre ergeben sich als wesentliche Risikofaktoren zur Frühberentung<br />
das Alter, stärkere krankheitsbedingte berufliche Belastungen, geringere berufliche<br />
Belastungen durch Störungen/Unterbrechungen bei der Arbeit, höhere quantitative<br />
Überforderung, höhere Belastungen durch Kontrollen durch Vorgesetzte, höhere<br />
Zufriedenheit mit den Sozialkontakten, höhere Zufriedenheit mit den eigenen<br />
Fähigkeiten, stärkere Belastungen durch die Nebenwirkungen der Behandlung, geringere<br />
Belastungen durch maschinenbestimmtes Arbeitstempo, stärkere Belastungen<br />
durch schlechtes Verhältnis zu Kollegen am Arbeitsplatz, geringere Müdigkeit<br />
(ASL) im Rahmen der Atemwegssymptomatik, eine höhere Einschränkung <strong>des</strong> beruflichen<br />
Weiterkommens <strong>und</strong> geringere Sorgen, weniger zu verdienen.<br />
Die Ergebnisse für die älteste Gruppe sprechen wiederum für eine in Verbindung mit<br />
der zeitlichen Nähe zur normalen Altersrente stehenden klaren Entscheidung zum<br />
vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Die höhere Zufriedenheit mit den Sozialkontakten<br />
<strong>und</strong> den eigenen Fähigkeiten sprechen für eine Interessenverlagerung in<br />
Richtung Selbstverwirklichung <strong>und</strong> Lebensqualität zu Lasten der Bedeutung der Arbeit<br />
für das individuelle Leben. Als verstärkender Faktor für die Entscheidung zur<br />
147
Frühberentung kann in Bezug auf die Erkrankung trotz geringerer Belastung durch<br />
die Atemwegssymptomatik (Subskala Müdigkeit der ASL) eine stärkere Belastung<br />
durch die Nebenwirkungen der Behandlung beigetragen haben. Im beruflichen Kontext<br />
lassen sich drei Einflussgrößen auf die Entscheidung zur Frühberentung festmachen.<br />
Diese betreffen auf der einen Seite den physischen <strong>und</strong> psychischen Verschleiß,<br />
der sich in stärkeren krankheitsbedingten beruflichen Belastungen <strong>und</strong> einem<br />
höheren Ausmaß an quantitativer Überforderung festmachen lässt. Auf der anderen<br />
Seite sind sozioemotionale Bereiche der Arbeit betroffen, die sich durch stärkere<br />
Belastungen im Verhältnis zu Kollegen <strong>und</strong> höhere Belastungen durch Kontrollen<br />
durch Vorgesetzte ausdrücken, wobei letztere auch als Einschränkungen in der<br />
Autonomie betrachtet werden können. Der dritte Bereich betrifft im Kontext <strong>des</strong> höheren<br />
Alters die berufliche Perspektive im Sinne eines eingeschränkten Weiterkommens<br />
(De-Motivation) <strong>und</strong> der geringeren Sorge, durch eine vorzeitige Berentung<br />
weniger zu verdienen. Insgesamt erscheint die Entscheidung durch vorzeitigen Berentung<br />
mit den Lebensplänen vereinbar. Der vorzeitige Ausstieg aus dem Erwerbsleben<br />
kann dabei als positives Ergebnis eines Verarbeitungs- <strong>und</strong> Entscheidungsprozesses<br />
als neue Lebensperspektive betrachtet werden. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der<br />
altersbedingten eingeschränkten beruflichen Perspektive <strong>und</strong> der finanziellen Absicherung<br />
fallen krankheitsbedingte berufliche Belastungen durch den Ausstieg aus<br />
dem Erwerbsleben weg. Belastende soziale Probleme mit Kollegen <strong>und</strong> Vorgesetzten<br />
werden durch befriedigende Sozialkontakte im privaten Umfeld ersetzt <strong>und</strong> die<br />
eingeschränkte Autonomie bei der beruflichen Tätigkeit wird durch den Einsatz der<br />
vorhandenen Fähigkeiten in Richtung Selbstbestimmung <strong>und</strong> Lebensqualität verlagert.<br />
Bezogen auf die beiden Messzeitpunkte <strong>und</strong> die Altersstratifizierung zeigt die gesamte<br />
Analyse, dass die zeitliche Nähe zum normalen Berentungsalter über die gesamte<br />
Stichprobe hinweg einen tragenden Faktor der Vorhersage darstellt. Im Kontext<br />
<strong>des</strong> Alters lassen sich daneben unterschiedliche krankheits- <strong>und</strong> berufsbezogene<br />
Belastungen festmachen, die durch physischen <strong>und</strong> psychischen Verschleiß<br />
das Risiko einer vorzeitigen Berentung erhöhen. Dies gilt insbesondere dann, wenn<br />
im außerberuflichen Bereich in Form von Freizeitaktivitäten, Sozialkontakten, Selbstbestimmung<br />
<strong>und</strong> Lebensqualität befriedigende Alternativen vorhanden sind <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong><br />
<strong>des</strong> Alters geringe finanzielle Einbußen durch die Frühberentung zu befürchten<br />
sind. Im beruflichen Bereich erweisen sich neben den Arbeitsbedingungen, Belastungen<br />
<strong>und</strong> Einschränkungen im Bereich der instrumentellen <strong>und</strong> sozioemotionalen Arbeitsfähigkeiten<br />
für eine vorzeitige Berentung als bedeutsam. Daneben scheint die<br />
mit zunehmendem Alter eingeschränkte berufliche Perspektive eine Rolle zu spielen,<br />
was auf eine De-Motivation rückschließen lässt <strong>und</strong> in einem gesellschaftlich akzeptierten<br />
Rückzug in ein befriedigen<strong>des</strong> Privatleben mündet.<br />
Auch wenn die theoriegeleiteten altersstratifizierten Gruppen aufgr<strong>und</strong> der Fallzahlen<br />
nicht durch Kreuzvalidierung überprüft werden konnten, ergeben sich hierdurch wertvolle<br />
Hinweise. Die Gruppe der 45-54-Jährigen kann insgesamt als die Gruppe der<br />
Verlierer bezeichnet werden, die ohne Vorhandensein von befriedigenden Alternativen<br />
aufgr<strong>und</strong> fehlender Ressourcen <strong>und</strong> Bewältigungsstrategien vorzeitig aus dem<br />
Erwerbsleben ausgeschieden ist. Die Ergebnisse für die älteste Gruppe sprechen<br />
insgesamt für eine in Verbindung mit der zeitlichen Nähe zur normalen Altersrente<br />
stehenden klaren <strong>und</strong> in die Lebensplanung integrierte Entscheidung zum vorzeitigen<br />
Ausstieg aus dem Erwerbsleben.<br />
148
Auch wenn der hohe Bildungsgrad der Stichprobe statistisch keine Rolle gespielt hat,<br />
kann ein hohes Wissen um die sozialrechtlichen Möglichkeiten angenommen werden,<br />
welches durch gezielte Handlungsplanung <strong>und</strong> adäquate Handlungskompetenz<br />
die Entscheidungsfindung zur Frühberentung <strong>und</strong> deren Umsetzung in die Realität<br />
gefördert hat.<br />
Die gesamten Ergebnisse sprechen neben der Optimierung der biomedizinischen<br />
Diagnostik <strong>und</strong> Therapie <strong>und</strong> der hieraus angestrebten Verbesserung der Krankheitssymptomatik<br />
<strong>und</strong> der Krankheitsfolgen im beruflichen Bereich für eine stärkere<br />
Beachtung der Förderung psychischer (Motivation, Copingstrategien) <strong>und</strong> sozialer<br />
(soziale Unterstützung) Ressourcen sowie einer Beeinflussung von Arbeitsbedingungen,<br />
die mit der Erkrankung vereinbar sind (Umweltfaktoren). Daneben scheint die<br />
Behandlung bei einem Lungenfacharzt einen Schutzfaktor darzustellen, aus der sich<br />
die Notwendigkeit der Verbesserung der fachärztlichen Behandlung ableiten lässt.<br />
Die Ergebnisse sprechen für die Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen, um Allgemeinmediziner/Hausärzte<br />
besser in den Rehabilitationsprozess zu integrieren. Neben<br />
einer gr<strong>und</strong>sätzlichen Einbeziehung der Rehabilitationsmedizin in die ärztliche<br />
Ausbildung können Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsangebote dazu beitragen, dass vor dem<br />
Rat zur Frühberentung zuerst alle rehabilitativen Möglichkeiten ausgeschöpft werden<br />
(B<strong>und</strong>esausschuss der Ärzte <strong>und</strong> Krankenkassen 2003). Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der<br />
Diskussion <strong>und</strong> die demographisch bedingte (notwendige) Verlängerung der Arbeitszeit<br />
sind daneben Maßnahmen erforderlich, die von der medizinischen Rehabilitation<br />
nicht geleistet werden können. Hierzu zählen Anreize zum längeren Verbleib im Erwerbsleben<br />
(Perspektive, Entwicklungsmöglichkeiten) <strong>und</strong> altersintegrative Gestaltungsansätze<br />
in Bezug auf die Arbeitsgestaltung (vgl. Behrens et al. 1999, Behrens<br />
2001, Krämer 2002).<br />
Die gesamten Ergebnisse lassen überspitzt formuliert den Schluss zu, dass die medizinische<br />
Rehabilitation vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Zunahme chronischer Erkrankungen<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> demographischen Wandels vor immense Probleme gestellt werden<br />
wird, wenn sie berufliche Aspekte nicht eindeutig in den Rehabilitationsprozess integriert.<br />
Insbesondere bei älteren Betroffenen kann sich die paradoxe Situation ergeben,<br />
dass sich mit dem zunehmenden Alter, welches häufig mit finanzieller Absicherung<br />
<strong>und</strong> eingeschränkter beruflicher Perspektive einhergeht, trotz einer Reduktion<br />
der Krankheitsbelastungen <strong>und</strong> -folgen <strong>und</strong> damit einer verbesserten Lebensqualität<br />
im außerberuflichen Bereich das Risiko zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Berufsleben<br />
deutlich erhöht.<br />
Auf der Basis der gef<strong>und</strong>en Prädiktoren wurde in einer Kurzfassung (Prädiktoren für<br />
die Modellbildungsgruppe zu t1 <strong>und</strong> t2) <strong>und</strong> einer Langfassung (Prädiktoren für die<br />
Gesamtgruppe <strong>und</strong> für die altersstratifizierten Gruppen zu t1 <strong>und</strong> t2, Prädiktoren aus<br />
der Befragung zu beruflichen Hilfen) ein ‚Fragebogen zu berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen’ entwickelt, der in der Kurzfassung folgende<br />
Bereiche enthält:<br />
• Erwartungen an den Klinikaufenthalt<br />
• Krankheitsbezogene Beschwerden <strong>und</strong> Belastungen<br />
• Ambulante <strong>und</strong> stationäre Behandlungen<br />
• Berufliche Situation<br />
• Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebenszufriedenheit<br />
• Beratungswünsche<br />
149
• Alter<br />
Das Screeninginstrument bietet die Möglichkeit, Patienten mit einem erhöhten Risiko<br />
zur Frühberentung frühzeitig zu identifizieren <strong>und</strong> gezielt speziellen berufsbezogenen<br />
diagnostischen <strong>und</strong> therapeutischen Maßnahmen zuzuweisen. Eine Absicherung der<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Screenings kann durch die bei Aufnahme in der Rehabilitationseinrichtung<br />
obligatorische Rehabilitationsanamnese <strong>und</strong> die weiteren Angaben in der<br />
Sozial- <strong>und</strong> Berufsanamnese erfolgen. Aufgr<strong>und</strong> der im Normalfall kurzen Dauer der<br />
medizinischen Rehabilitationsmaßnahme von drei Wochen bietet der Fragebogen<br />
auch die Möglichkeit eines Screenings vor Aufnahme, bei dem unter Einbeziehung<br />
<strong>des</strong> Haus-/Facharztes vorläufige individuelle Therapieziele bereits frühzeitig definiert<br />
werden können (Klemperer 2003).<br />
Für dieses Vorgehen sprechen die Ergebnisse der in der Hochgebirgsklinik Davos-<br />
Wolfgang seit 1994 fortlaufend durchgeführten Patientenbefragung (Kaiser &<br />
Schmitz 1994, 1995). Auf der Basis <strong>des</strong> bisherigen Rücklaufs von 13.000 Fragebögen<br />
ergibt sich eindeutig die relativ passive Erwartungshaltung der Patienten zu Beginn<br />
der Rehabilitationsmaßnahme. Die im Rahmen der Davoser-Reha-Studie<br />
durchgeführte Katamnese zeigt dies in abgeschwächter Form auch für den behandelnden<br />
Haus-/Facharzt (Kaiser 1994, Kaiser & Schmitz 1998b). Zusammengefasst<br />
liegen die Vorteile bei diesem Vorgehen in folgenden Bereichen:<br />
• Frühzeitiges Screening der Patienten in Bezug auf arbeitsbezogene Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen<br />
• Frühzeitige Sensibilisierung der Patienten <strong>und</strong> <strong>des</strong> behandelnden Haus-<br />
/Facharztes für die Rehabilitationsmaßnahme <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen individuellen<br />
Zielsetzungen (Reha-Motivation)<br />
• Vorliegen eines individuellen Risikoprofils bereits bei Klinikaufnahme, welches<br />
gezielt durch die Ergebnisse der Rehabilitationsanamnese <strong>und</strong> die Sozial- <strong>und</strong><br />
Berufsanamnese frühzeitige Hinweise gibt, in welchem Umfang <strong>und</strong> in welchen<br />
Bereichen die Rehabilitationsdiagnose im arbeitsbezogenen Kontext genauer abgesichert<br />
werden muss<br />
• Frühzeitige Zuweisung in spezielle berufsbezogene Maßnahmen während der<br />
Rehabilitation<br />
• Verbesserung der Schnittstellen zum behandelnden Haus-/Facharzt durch frühzeitige<br />
Einbeziehung in die Formulierung der individuellen Zielsetzungen der Rehabilitationsmaßnahme<br />
Rechtzeitige <strong>und</strong> zielgerichtete Entscheidungen während <strong>des</strong> Rehabilitationsprozesses<br />
sind eine wesentliche Voraussetzung, um Ressourcen der Betroffenen in medizinischer,<br />
beruflicher <strong>und</strong> sozialer Hinsicht nachhaltig zu nutzen. Im Rahmen möglicher<br />
berufsorientierter Maßnahmen setzt das Projekt im Bereich der Intervention den<br />
Schwerpunkt auf einen Beratungsansatz, mit dem die Schnittstelle zur Rehabilitationsnachsorge<br />
verbessert werden soll (Segmentierung).<br />
Im Rahmen der Nachbefragung äußern die Betroffenen zur Stabilisierung der während<br />
der stationären Rehabilitationsmaßnahme erzielten Erfolge <strong>und</strong> zur Verhinderung<br />
von weiteren Krankheitsfolgen notwendige Hilfen <strong>und</strong> Beratungsangebote in<br />
allen rehabilitativen Bereichen. Hierbei werden insbesondere ambulante Schulungsangebote,<br />
psychosoziale Hilfen <strong>und</strong> Angebote im Bereich <strong>des</strong> Lungensports genannt.<br />
Spezielle Hilfen im berufsbezogenen Kontext betreffen vor allem Beratung zur Um-<br />
150
schulung, bei Arbeitsplatzproblemen <strong>und</strong> zu Fragen der Berentung. Aufgr<strong>und</strong> bisher<br />
fehlender pneumologischer ambulanter Rehabilitationsangebote kann festgestellt<br />
werden, dass bei der untersuchten Stichprobe eine Rehabilitationsnachsorge mit<br />
entsprechenden Hilfen nicht stattgef<strong>und</strong>en hat.<br />
Vor diesem – sich bereits in früheren Studien abzeichnenden – Hintergr<strong>und</strong>, wurde in<br />
dem aktuellen Forschungsprojekt eine spezielle Befragung zu beruflichen Hilfen<br />
durchgeführt. Gr<strong>und</strong>sätzlich wünschen sich 32 % der Berufstätigen <strong>und</strong> 20 % der<br />
Frühberenteten eine Beratung zu beruflichen Fragen. Die Erwartungen der Gesamtstichprobe<br />
beziehen sich dabei vorwiegend auf die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> den Abbau von beruflichem Stress.<br />
Eine differenzierte Betrachtung der Erwartungen nach dem Erwerbsstatus zeigt, dass<br />
Berufstätige im berufsbezogenen Kontext diese vorwiegend auf eine Verbesserung<br />
der Arbeitsfähigkeit, Abbau von beruflichem Stress, Hilfen bei arbeits- <strong>und</strong> sozialrechtlichen<br />
Fragen <strong>und</strong> Hilfen zur Umschulung beziehen. Erwartungen bezüglich einer<br />
Bestätigung der verminderten beruflichen Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> direkter Hilfestellungen<br />
bei einem Rentenantrag zeigen, dass bereits vor Klinikaufnahme bei einem<br />
Viertel der Berufstätigen Überlegungen zur Berentung angestellt werden. Von<br />
den Frühberenteten werden neben einer weiteren Bestätigung der verminderten<br />
beruflichen Leistungsfähigkeit, Hilfe bei arbeits- <strong>und</strong> sozialrechtlichen Problemen,<br />
Abbau von beruflichem Stress <strong>und</strong> Hilfen zum Rentenantrag genannt. Von über einem<br />
Drittel der Frühberenteten wird jedoch auch die Erhöhung der Arbeitsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> von einem weiteren Teil der Befragten Beratungen zu Umschulungsmöglichkeiten<br />
genannt, was für einen Wunsch zur Reintegration in das Berufsleben spricht.<br />
Eine altersdifferenzierte Betrachtung der Beratungserwartungen ergibt, dass der<br />
Abbau von beruflichem Stress bis auf die älteste Subgruppe (ab 55 Jahre) bei allen<br />
anderen Betroffenen einen sehr hohen Stellenwert hat. Die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit<br />
spielt insbesondere in den Altersgruppen zwischen dem 35. <strong>und</strong> 54.<br />
Lebensjahr eine herausragende Rolle. Der Wunsch nach Bestätigung der verminderten<br />
beruflichen Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> Hilfestellung bei einem Rentenantrag<br />
nimmt mit dem Alter zu. Ein umgekehrter Trend zeigt sich bei den erwarteten Beratungen<br />
zu Umschulungen.<br />
Im Überblick beinhalten die von der Stichprobe genannten Beratungsthemen im<br />
Rahmen der pneumologischen Rehabilitationsmaßnahme folgende Bereiche: medizinische<br />
Rehabilitation, Krankheit <strong>und</strong> Beruf, Allergien am Arbeitsplatz, im Beruf bleiben,<br />
berufliche Perspektiven, berufliche Rehabilitation, Umgang mit Vorgesetzten<br />
<strong>und</strong> Kollegen/Krankheit, Möglichkeiten zur Berentung, Weiter-/Fortbildung, allgemeiner<br />
Umgang mit Vorgesetzten/Kollegen, Abbau von beruflichem Stress, arbeits- <strong>und</strong><br />
sozialrechtliche Fragen, Umschulungsmöglichkeiten.<br />
Die Ergebnisse zeigen ein breites Spektrum an Beratungswünschen im berufsbezogenen<br />
Kontext, welches einerseits die Problemlage der Befragten insgesamt widerspiegelt<br />
(Pauschalisierung), andererseits jedoch auch im beruflichen Kontext für eine<br />
differenzierte Betrachtung nach Alter <strong>und</strong> Erwerbsstatus spricht (Individualisierung).<br />
Daneben wird deutlich, dass aufgr<strong>und</strong> fehlender Möglichkeiten in der regionalen Versorgung<br />
eine deutliche Verlagerung dieser Beratungsbedürfnisse auf die Rehabilitationsmaßnahme<br />
stattgef<strong>und</strong>en hat. Gravierend erscheint, dass bisher erfahrene Be-<br />
151
atungen vorwiegend in der Hilfestellung zur Frühberentung als sehr nützlich angesehen<br />
wurden. Insgesamt scheint es dringend erforderlich, zielgruppenspezifische<br />
Beratungsangebote zu etablieren (Strukturqualität), die vorwiegend den Erhalt der<br />
Erwerbsfähigkeit oder die Reintegration in das Berufsleben zum Ziel haben. Hierbei<br />
sollte sich individuell (Prozessqualität, differentielle Indikation) am Rehabilitationsmodell<br />
der ICF (WHO 2001, Schuntermann 2003) orientiert <strong>und</strong> der Schwerpunkt auf<br />
die günstige Beeinflussung von Umweltfaktoren <strong>und</strong> persönlichen Ressourcen der<br />
Rehabilitanden gelegt werden. Beratungsmodelle sollten dabei interdisziplinär ausgerichtet<br />
sein, wobei im beruflichen Kontext insbesondere dem Arzt, dem Sozialmediziner,<br />
der Rehabilitations- <strong>und</strong> Sozialberatung, der Psychologie <strong>und</strong> der Patientenschulung<br />
ein besonderer Stellenwert zukommt.<br />
Theoretisch lässt sich dabei der Gr<strong>und</strong>gedanke der Beratung am Konzept der<br />
Krankheitsbewältigung ausrichten. Das Wissen um Bewältigungsprozesse fördert<br />
einerseits das Verstehen der Betroffenen, andererseits besteht dadurch letztlich aber<br />
auch erst die Chance einer günstigen therapeutischen Einflussnahme auf diese Vorgänge<br />
<strong>und</strong> damit eine Verringerung der Krankheitsfolgen. Ähnlich wie sich Krankheitsverarbeitungsprozesse<br />
zum Teil auf den Ebenen der Kognition, Emotion <strong>und</strong><br />
Handlung ansiedeln lassen, kann auch die Überlegung angestellt werden, wie diesen<br />
Betrachtungsebenen im Rahmen von Beratungsangeboten therapeutische Ziele zugeordnet<br />
werden können. Exemplarisch lassen sich folgende Beispiele nennen:<br />
• Kognition: Informationssuche durch patientenadäquatere Aufklärung <strong>und</strong> Information,<br />
Stärkung von realitätsgerechtem Informationssucheverhalten, Veränderung<br />
von Fehlwahrnehmungen <strong>und</strong> ungünstigen Attributionen, Verstärkung der als wirkungsvoll<br />
eingeschätzten Verarbeitungsmodi, Nutzung/Verstärkung vorhandener<br />
Ressourcen <strong>und</strong> Abbau defizitärer Strategien<br />
• Emotion: Erleichterung <strong>des</strong> emotionalen Ausdrucks, Durchleben <strong>und</strong> Durcharbeiten<br />
von Gefühlen, Abbau von irrationalen Ängsten, Förderung der Rehabilitationsmotivation<br />
• Handlung: Einüben von konkreten Verhaltensweisen in unterschiedlichem Kontext,<br />
Modifikation, Erfahrung der Selbstwirksamkeit, Förderung der aktiven Problemlösung,<br />
Handlungswissen <strong>und</strong> Handlungskompetenz<br />
Aufgr<strong>und</strong> der geringen Dauer von Rehabilitationsmaßnahmen erscheint es dringend<br />
geboten, die Betroffenen möglichst frühzeitig <strong>und</strong> gezielt in entsprechende Beratungsangebote<br />
zu überweisen. Hierbei können im ersten Schritt die Ergebnisse <strong>des</strong><br />
Screeninginstrumentes genutzt werden. Daneben kann zusätzlich während der Rehabilitationsmaßnahme<br />
das von Dern <strong>und</strong> Raß (2002) entwickelte Isnyer Rückkehr<br />
Inventar (IRI) eingesetzt werden, welches sich zur Zeit in der Validierungsphase befindet.<br />
Das von den Autoren entwickelte Inventar basiert auf gef<strong>und</strong>enen Prädiktoren,<br />
mit denen die Rückkehrgeschwindigkeit nach einer Rehabilitationsmaßnahme vorhergesagt<br />
werden kann. Hierbei erwiesen sich die Fähigkeit zur Handlungsplanung,<br />
die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten, der Wunsch zur Rückkehr zur Arbeit <strong>und</strong><br />
die Genesung aus Sicht <strong>des</strong> Arztes für die Gesamtstichprobe als wesentliche Prädiktoren.<br />
Zusätzliche geschlechtsspezifische Prädiktoren beziehen sich bei Frauen<br />
auf die Unterstützung durch den Lebenspartner <strong>und</strong> bei Männern auf die Unterstützung<br />
durch die Gesellschaft, Sorgen um die Situation am Arbeitsplatz <strong>und</strong> die Häufigkeit<br />
von Rehabilitationsmaßnahmen. Da sich mit diesem Inventar (10 Items) nach<br />
Aussage der Autoren notwendige Hilfsangebote im beruflichen Kontext vor der Klinikentlassung<br />
identifizieren lassen, würde hierdurch eine sinnvolle Ergänzung zum<br />
152
Screeningverfahren vor der Klinikaufnahme erreicht. Ein nicht unwesentlicher Teil<br />
der Stichprobe wurde bei Patienten mit Atemwegserkrankungen in der Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang erhoben. Gr<strong>und</strong>sätzlich erscheint daher die Übertragbarkeit<br />
auf diese Indikationsgruppe gewährleistet zu sein, wobei die abschließenden Ergebnisse<br />
der Validierungsstudie abgewartet werden müssen.<br />
Die Ergebnisse einer Teilfragestellung <strong>des</strong> Projektes zur Berücksichtigung beruflicher<br />
Aspekte während einer stationären Rehabilitationsmaßnahme weisen auf<br />
eine mangelnde Zielorientierung in diesem Bereich hin. Hierfür sprechen insbesondere<br />
deutliche Diskrepanzen zwischen den differenzierten Patientenerwartungen<br />
nach Alter <strong>und</strong> Erwerbsstatus, den berufsbezogenen Krankheitsfolgen <strong>und</strong> den ärztlichen<br />
Überweisungen in die unterschiedlichen Rehabilitationsangebote. Hierbei stehen<br />
neben der weiteren biomedizinischen Diagnostik eindeutig Angebote im Bereich<br />
der Physikalischen Therapie (Physiotherapie, Sporttherapie, Inhalationstherapie,<br />
Balneotherapie) im Vordergr<strong>und</strong>. Demgegenüber finden sich Überweisungen in eher<br />
berufsbezogene Ansätze in den Bereichen der Sozialmedizin, der Sozialberatung<br />
<strong>und</strong> der Rehabilitationspsychologie nur in Einzelfällen. Unterstützt wird diese Feststellung<br />
durch die Einschätzung der behandelnden Ärzte zum Zeitpunkt der Klinikentlassung,<br />
nach der über ein Drittel der Betroffenen ein hohes Risiko zur vorzeitigen<br />
Berentung aufweist <strong>und</strong> bei jeweils zehn Prozent der Befragten eine weitere Abklärung<br />
zu berufsfördernden Maßnahmen bzw. zur Berentung notwendig ist.<br />
Die mittels Regressionsanalyse versuchte Herausarbeitung von Prädiktoren zur Zuordnung<br />
der Betroffenen in eine Risikogruppe zur Frühberentung lässt unter Einbeziehung<br />
der vorgenommen Kreuzvalidierung insgesamt keine klare Struktur der Urteilsbildung<br />
durch den Arzt erkennen. Variablen, die sich in beiden Gruppen als bedeutsam<br />
herausgestellt haben, sind ein höherer Schweregrad der Krankheit, eine<br />
schlechtere Prognose <strong>und</strong> eine geringere Leistungsfähigkeit. Patientenerwartungen<br />
scheinen auch eine Rolle zu spielen, können aber nicht in allen Details übereinstimmend<br />
in beiden Gruppen identifiziert werden. Auch wenn bei der Interpretation die<br />
Ausfüllung <strong>des</strong> Fragebogens zu einem Zeitpunkt eine Rolle gespielt haben mag,<br />
scheinen diese Ergebnisse – auch im Kontext <strong>des</strong> Überweisungsverhaltens - insgesamt<br />
darauf hinzudeuten, dass im berufsbezogenen Bereich tatsächlich keine klare<br />
Struktur bzw. kein klares Vorgehen vorhanden ist.<br />
Damit das Potential der pneumologischen Rehabilitation auch in Richtung beruflicher<br />
Fragestellungen voll ausgeschöpft werden kann, erscheint es daher dringend erforderlich,<br />
die eingeschränkte somatische Sichtweise im ärztlichen Bereich durch entsprechende<br />
Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsangebote in Richtung der ICF (WHO 2001) zu<br />
erweitern. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der prognostizierten weiteren Zunahme chronischer<br />
Erkrankungen der Lunge <strong>und</strong> der Atemwege sollten mittelfristig Überlegungen angestellt<br />
werden, wie die Rehabilitationsmedizin verstärkt in der ärztlichen Ausbildung<br />
bzw. durch entsprechende Angebote im Rahmen der Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung Berücksichtigung<br />
finden kann. Daneben wird im Rahmen der Qualitätssicherung in der<br />
medizinischen Rehabilitation (VDR 2000b) eine stärkere Verankerung der Sozialmedizin/berufsbezogener<br />
Angebote in die Bereiche der Struktur-/Prozessqualität <strong>und</strong><br />
der Klinikkonzepte als dringend erforderlich angesehen.<br />
Chronische Erkrankungen der Lunge <strong>und</strong> der Atemwege erfordern in den meisten<br />
Fällen eine lebenslange Behandlung, bei der unter rehabilitativen Gesichtspunkten<br />
nicht die einzelne Krankheitsepisode, sondern der gesamte Krankheitsverlauf <strong>und</strong><br />
153
die damit verb<strong>und</strong>enen Folgen im Vordergr<strong>und</strong> stehen. Die Patientendaten belegen<br />
eindrücklich den Bedarf an verzahnten Akut- <strong>und</strong> Rehabilitationsangeboten im stationären<br />
<strong>und</strong> ambulanten Bereich sowie umfassenden Hilfs- <strong>und</strong> Beratungsangeboten<br />
im Bereich der Rehabilitationsnachsorge. Gleichfalls spiegeln die Patientenangaben<br />
jedoch auch die deutlich defizitäre Versorgungslage in diesen Bereichen wider. Auch<br />
wenn die Ergebnisse der Expertenbefragung aufgr<strong>und</strong> <strong>des</strong> geringen Rücklaufs<br />
nicht als repräsentativ betrachtet werden können, bestätigen sie doch die deutliche<br />
Diskrepanz zwischen Bedarf <strong>und</strong> Realität im Bereich berufsbezogener Fragestellungen.<br />
Obwohl r<strong>und</strong> 80 % der befragten Fachkliniken <strong>und</strong> Pneumologen die verstärkte<br />
Einbeziehung beruflicher Aspekte in den Rehabilitationsprozess als notwendig ansehen<br />
<strong>und</strong> über 20 % der eigenen Patienten ein erhöhtes Risiko zur vorzeitigen Berentung<br />
aufweisen, beschränken sich eigene berufsbezogene Ansätze fast ausschließlich<br />
auf diagnostische <strong>und</strong> allgemeine beraterische Verfahren. In Einzelfällen<br />
besteht eine Zusammenarbeit mit den im Versorgungssystem beteiligten Einrichtungen,<br />
die sich jedoch vorwiegend auf notwendige patientenbezogene Kontakte beschränkt.<br />
Insgesamt betrachtet hält der überwiegende Teil der Befragten zur umfassenden Integration<br />
beruflicher Aspekte ein abgestuftes Zusammenwirken aller im Versorgungssystem<br />
beteiligten Einrichtungen für wichtig. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen dabei Berufsgenossenschaften,<br />
Fachärzte, stationäre Rehabilitationseinrichtungen <strong>und</strong> die<br />
Rentenversicherung. Bis auf wenige Ausnahmen ergeben sich im Vergleich der von<br />
den Befragten bewerteten Effektivität der Angebote im Versorgungssystem <strong>und</strong> deren<br />
Wichtigkeit signifikante Unterschiede. Effektivitätsverluste beziehen sich dabei<br />
vor allem auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten, fehlende krankheitsbezogene<br />
Kompetenz, mangelnde Kooperation, lange Bearbeitungszeiten mit viel „Bürokratie“,<br />
die mangelnde Versorgungsdichte <strong>und</strong> die allgemeine Arbeitsmarktlage.<br />
Zusammenfassend scheint unbestritten, dass berufsbezogenen Maßnahmen im<br />
Rehabilitationsprozess eindeutiger Rechnung getragen werden muss. Die Ergebnisse<br />
<strong>des</strong> Projektes belegen auf der Basis der umfangreichen Patientenmerkmale<br />
auf der einen Seite einen hohen Bedarf für diese Maßnahmen, auf der anderen Seite<br />
wird jedoch auch in Verbindung mit der Expertenbefragung deutlich, dass in der gesamten<br />
Behandlungskette gravierende Defizite in diesem Bereich vorhanden sind.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> bisher fehlender ambulanter rehabilitativer Strukturen besteht<br />
zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere im Bereich der stationären Rehabilitation ein<br />
hoher Entwicklungs- <strong>und</strong> Erprobungsbedarf in Bezug auf eine bessere Integration<br />
berufsbezogener Maßnahmen in die Gesamtbehandlung <strong>und</strong> deren Schnittstellen.<br />
Hierfür sprechen vor allem die vorhandenen umfassenden diagnostischen Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> die interdisziplinäre Ausrichtung dieser Zentren in Bezug auf Therapie,<br />
Schulung <strong>und</strong> Beratung. Es wird jedoch auch zu untersuchen sein, inwieweit bei einer<br />
umfassenden Integration dieses zentralen Themas der medizinischen Rehabilitation<br />
für Risikopatienten eine limitierte Dauer der Maßnahme von drei Wochen ausreicht.<br />
Damit berufsbezogene Ansätze möglichst frühzeitig greifen können, ist jedoch die<br />
Abkehr von der Pauschalisierung hin zu einer Individualisierung in Diagnostik, Therapie,<br />
Schulung <strong>und</strong> Beratung erforderlich. Dies bedeutet im ersten Schritt die frühzeitige<br />
Erkennung von Betroffenen, die ein erhöhtes Risiko zur Frühberentung aufweisen.<br />
Mit dem im Projekt auf der Basis von gewonnenen Prädiktoren entwickelten<br />
154
Screeningverfahren bietet sich die Möglichkeit, bereits vor Klinikaufnahme entsprechende<br />
Anhaltspunkte zur individuellen Risikoausprägung zu gewinnen. Je nach Intention<br />
kann hierzu eine Kurz- oder Langform <strong>des</strong> Fragebogens eingesetzt <strong>und</strong> bei<br />
Bedarf auch der behandelnde Haus-/Facharzt einbezogen werden.<br />
Im Rahmen berufsorientierter Interventionen legt das Projekt den Schwerpunkt auf<br />
einen interdisziplinären Ansatz, bei dem der Sozialmedizin (Beurteilung) <strong>und</strong> der umfassenden<br />
individuellen Beratung zur Verbesserung der Schnittstelle zur Rehabilitationsnachsorge<br />
(Segmentierung) eine besondere Bedeutung zukommt. Der interdisziplinär<br />
ausgerichtete Beratungsansatz orientiert sich hierbei am Konzept der<br />
Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> setzt den Schwerpunkt auf die günstige Beeinflussung<br />
von Umweltfaktoren <strong>und</strong> die persönlichen Ressourcen der Rehabilitanden. Hierzu<br />
wurde ein Prozessmodell entwickelt, mit dem unter Einbeziehung der Sozialmedizin,<br />
einem implementierten Beratungs- <strong>und</strong> Informationszentrum, der Rehabilitationspsychologie,<br />
der Sport- <strong>und</strong> Bewegungstherapie <strong>und</strong> der Physiotherapie (Strukturqualität)<br />
durch klar definierte Abläufe (Prozessqualität) dem individuellen Risiko zur Frühberentung<br />
umfassend Rechnung getragen werden soll.<br />
Insgesamt konnten mit dem Projekt nur erste Anhaltspunkte zur besseren Integration<br />
berufsbezogener Maßnahmen in der pneumologischen Rehabilitation gewonnen<br />
werden. Der Vorteil der Studie besteht darin, dass durch Einbeziehung vorhandener<br />
Daten bei einer Laufzeit von drei Jahren ein Zeitraum von über fünf Jahren einbezogen<br />
werden konnte. Durch die unterschiedlichen Fragestellungen musste hierbei in<br />
Kauf genommen werden, dass aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher Fragestellungen in Teilbereichen<br />
beim ersten Messzeitpunkt unterschiedliche Instrumente eingesetzt wurden,<br />
die aufgr<strong>und</strong> fehlender Vergleichbarkeit dort zu inkonsistenten Datensätzen führten.<br />
Trotzdem kann die Beantwortung der Fragestellungen als zufriedenstellend bezeichnet<br />
werden. Das entwickelte Screeningverfahren <strong>und</strong> die in den Rehabilitationsprozess<br />
integrierten Maßnahmen bedürfen für eine abschließende Bewertung jedoch<br />
einer längeren Erprobungs- <strong>und</strong> Evaluierungsphase.<br />
Daneben ist unstrittig, dass im nächsten Schritt gezielt interdisziplinär ausgerichtete<br />
berufsbezogene Interventionen entwickelt <strong>und</strong> überprüft werden müssen. Hierzu bedarf<br />
es einer Einbeziehung der Fachgesellschaften <strong>und</strong> der verb<strong>und</strong>übergreifenden<br />
Arbeitsgruppen. Neben in die Rehabilitationskliniken integrierte Maßnahmen ist bei<br />
günstigen regionalen Gegebenheiten auch an Kooperationsmodelle mit Berufsförderungswerken<br />
zu denken. Die Expertenbefragung belegt auch hier bisher geringe Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> limitierte Möglichkeiten, so dass auch hier ein Entwicklungs- <strong>und</strong> Erprobungsbedarf<br />
besteht.<br />
Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt wird in der Entwicklung von Aus-, Weiter- <strong>und</strong><br />
Fortbildungskonzepten gesehen, bei denen sich interne Fortbildungen mit externen<br />
Angeboten ergänzen können. Das Potential der medizinischen Rehabilitation wird in<br />
Richtung berufsbezogener Fragestellungen nur dann ausgeschöpft werden können,<br />
wenn die eingeschränkte somatische Sichtweise im ärztlichen <strong>und</strong> nichtärztlichen<br />
Bereich im Sinne der ICF (WHO 2001, Schuntermann 2003) erweitert wird. Diesem<br />
Teilbereich sollte neben der Berücksichtigung berufsbezogener Maßnahmen in Rehabilitations-<br />
bzw. Klinikkonzepten auch im Rahmen der Qualitätssicherung <strong>und</strong> <strong>des</strong><br />
Qualitätsmanagements verstärkt Beachtung geschenkt werden. Gleichzeitig sollten<br />
auch Überlegungen angestrebt werden, wie die Rehabilitationsmedizin verstärkt in<br />
der ärztlichen Ausbildung Berücksichtigung finden kann.<br />
155
Weiterer Forschungsbedarf besteht in der Überprüfung der entwickelten Screeninginstrumente<br />
(Kurz- <strong>und</strong> Langfassung) <strong>und</strong> der sozialmedizinischen Steuerungsinstrumente<br />
im Rehabilitationsprozess. Dies gilt auch für die implementierten Behandlungskomponenten<br />
<strong>und</strong> deren Weiterentwicklung. Insgesamt besteht ein erhöhter<br />
Bedarf an Langzeiterhebungen, die den Nutzen von berufsbezogenen Maßnahmen<br />
auch unter Einbeziehung ökonomischer Kriterien belegen. Hierzu bieten sich multizentrische<br />
Studien an, die unterschiedliche Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit<br />
überprüfen <strong>und</strong> deren Ergebnisse zu einer differenziellen Zuweisung in Rehabilitationszentren<br />
mit entsprechenden berufsbezogenen Schwerpunkten genutzt werden<br />
können.<br />
Die medizinische Rehabilitation wird sich künftig neuen Herausforderungen stellen<br />
müssen. Die Konsequenzen aus veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
<strong>und</strong> die aktuellen Entwicklungen im Ges<strong>und</strong>heitswesen (DRG’s, DMP’s, Qualitätsmanagementprogramme,<br />
etc.) sind heute noch nicht abschätzbar. Unstrittig ist jedoch<br />
die weitere Zunahme von chronischen Erkrankungen <strong>und</strong> gleichzeitig ein demografischer<br />
Wandel mit erheblichen Einflüssen auf die zukünftige Entwicklung der<br />
Erwerbsarbeit. Dies hat gerade in der jüngsten Vergangenheit in der Politik zu einem<br />
Umdenken geführt. Waren bisher Forderungen nach einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit<br />
<strong>und</strong> nach Vorruhestandsmodellen die Regel, sind heute vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
der zunehmend sinkenden Zahl jüngerer Erwerbspersonen umgekehrte Forderungen<br />
unüberhörbar. Dies bedeutet auch, dass die bisher gesellschaftlich mitgetragene<br />
Reduktion eines Überangebotes an Arbeitskräften durch Frühberentung von<br />
älteren Erwerbstätigen kritisch hinterfragt werden wird. Die Gesamtproblematik wird<br />
nur durch eine konzertierte Aktion aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen lösbar<br />
sein. Die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung wird sich diesen Entwicklungen<br />
stellen müssen, was sie u.a. mit dem Förderschwerpunkt Rehabilitationswissenschaften<br />
getan hat. In der Umsetzung der hierbei gewonnenen Erkenntnisse<br />
sollte der Integration beruflich orientierter Maßnahmen in der medizinischen<br />
Rehabilitation verstärkt Beachtung geschenkt werden.<br />
156
7. Überlegungen <strong>und</strong> Vorbereitungen zur Umsetzung der Ergebnisse<br />
Die originären Ergebnisse <strong>des</strong> Projektes schließen die Beschreibung der Patienten<br />
mit chronischen Erkrankungen der Lunge <strong>und</strong> der Atemwege auf den unterschiedlichen<br />
Ebenen der Rehabilitation, die Ableitung eines Risikoprofils zur Frühberentung,<br />
die Entwicklung eines hierauf basierenden Screeninginstrumentes, die Abschätzung<br />
<strong>des</strong> notwendigen Beratungsbedarfs in Bezug auf berufliche Fragestellungen in der<br />
Schnittstelle zur Rehabilitationsnachsorge <strong>und</strong> eine Beschreibung der Relevanz unterschiedlicher<br />
Einrichtungen in der Rehabilitationskette im beruflichen Kontext ein.<br />
Das Projekt ist mit dem Ziel angetreten, die Integration beruflicher Aspekte im Rahmen<br />
der medizinischen Rehabilitation in den Bereichen der Diagnostik, Therapie,<br />
Beratung <strong>und</strong> Schulung zu verbessern. Die Möglichkeiten der Umsetzung der Ergebnisse<br />
müssen aufgr<strong>und</strong> der Komplexität <strong>des</strong> Rehabilitationsprozesses <strong>und</strong> der Vielfalt<br />
der hieran Beteiligten auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden. Neben<br />
gr<strong>und</strong>sätzlichen Überlegungen zur Umsetzung der Ergebnisse in den Bereichen der<br />
Diagnostik <strong>und</strong> Therapie bezieht die nachfolgende Darstellung exemplarisch die bisher<br />
in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang vorgenommenen Schritte, notwendige<br />
Diskussionen in Arbeitsgruppen <strong>und</strong> Fachgesellschaften <strong>und</strong> den Bereich der Fort-<br />
<strong>und</strong> Weiterbildung ein.<br />
Die Möglichkeiten der Umsetzung der Projektergebnisse über die Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang hinaus hängen davon ab, in welchem Ausmaß Vernetzungen <strong>des</strong><br />
Projektes mit in der Rehabilitation relevanten Bereichen vorhanden sind. In Abbildung<br />
69 ist die Vernetzung <strong>des</strong> Projektes bzw. der Forschungsgruppe Rehabilitation<br />
zu ersehen. In den einzelnen Bereichen sind weiterhin die damit erreichbaren Be<br />
rufsgruppen genannt. Auf diese Vernetzung <strong>und</strong> die daraus resultierenden Möglichkeiten<br />
im Rahmen der Umsetzung der Projektergebnisse wird in der weiteren Darstellung<br />
eingegangen.<br />
AG Lungensport:<br />
Aus- Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Berufsgruppen in<br />
der Rehabilitation<br />
PCM Oppenheim:<br />
Geschäftsstelle<br />
ISPR<br />
AG Lungensport<br />
Lehre & Forschung<br />
Diplomarbeiten, Dissertationen,<br />
Habilitationen<br />
AG Berufliche Orientierung<br />
In der med. Rehabilitation<br />
Forschungsverbünde<br />
Projekt<br />
Forschungsgruppe Reha:<br />
U. Kaiser, K. Pleyer<br />
I S P R:<br />
Aus- Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Berufsgruppen in<br />
der Rehabilitation<br />
Rehabilitationsforschung<br />
Abbildung 69: Vernetzung <strong>des</strong> Projektes<br />
Integration beruflicher Aspekte<br />
in der medizinischen Rehabilitation<br />
Berufsgruppen in der Rehabilitation<br />
Umsetzung in der Klinik:<br />
Strukturen – Prozesse – Ergebnisse<br />
Interdisziplinäres Reha-Team<br />
157<br />
RFV Bayern:<br />
AG Patientenschulung<br />
- Atemwege –<br />
Berufsgruppen in der<br />
Rehabilitation<br />
RFV Freiburg/<br />
Bad Säckingen:<br />
Projektstandort<br />
Umsetzung in der Sektion<br />
Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation:<br />
Symposien, Workshops, Seminare<br />
Berufsgruppen in der pneumologischen<br />
Rehabilitation<br />
AG Reha-Forschung
7.1. Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen der Umsetzung<br />
Im Mai 2000 wurde von der B<strong>und</strong>esversicherungsanstalt für Angestellte (BfA 2000)<br />
ein ‚Eckpunktepapier arbeitsbezogener Strategien in der medizinischen Rehabilitation’<br />
veröffentlicht, welches sich in wesentlichen Teilen auf den Förderungsschwerpunkt<br />
Rehabilitationswissenschaften <strong>des</strong> BMBF <strong>und</strong> <strong>des</strong> VDR bezieht. Da die Ergebnisse<br />
<strong>des</strong> Projekts die hierin formulierten Zielsetzungen unterstützen, wird nachfolgend<br />
hierauf Bezug genommen.<br />
Die im Projekt gewonnenen Hinweise für Risiken zur vorzeitigen Berentung <strong>und</strong> das<br />
hieraus entwickelte Sreeninginstrument legt die Frage nahe, wie diese Ergebnisse im<br />
Bereich der Früherkennung der ‚Risikopatienten’ <strong>und</strong> damit in der Diagnostik Berücksichtigung<br />
finden können. Die Diagnostik in der medizinischen Rehabilitation beinhaltet<br />
vorwiegend die Sicherstellung <strong>und</strong> Spezifizierung der Rehabilitationsdiagnose<br />
zur Einleitung der zielgerichteten Therapie <strong>und</strong> die abschließende Beurteilung<br />
der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben.<br />
In Abb. 70 sind die wesentlichen Bereiche der Diagnostik im Bezug zur Arbeit <strong>und</strong><br />
Erwerbsfähigkeit dargestellt. Zu erwähnen ist hier auch der interdisziplinäre Ansatz in<br />
der Diagnostik. Zielorientierung in der Diagnostik bedeutet, dass neben der indikationsspezifischen<br />
Basisdiagnostik für einen Teilbereich der Patienten mit einem erhöhten<br />
Risiko zur Frühberentung spezielle, im Bezug zur Arbeit stehende Verfahren<br />
zur Anwendung kommen müssen, bei denen jedoch noch ein hoher Entwicklungs-<br />
<strong>und</strong> Erprobungsbedarf besteht.<br />
158
Arzt<br />
Sozialanamnese<br />
Beruflicher Werdegang<br />
Krankheitsverlauf<br />
Arbeitsplatzbeschreibung<br />
Belastbarkeit/<br />
Beanspruchung<br />
Auslöser <strong>und</strong> Auswirkung<br />
subjektives Krankheitsmodell<br />
Reha-Motivation<br />
Behandlungsindikation<br />
Psychotherapie/<br />
Klinische Psychologie<br />
Sreeningbogen zur<br />
subj. Einschätzung <strong>des</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitszustands<br />
Empfehlung ergänzender<br />
Assessments<br />
Spezifizierung der Rehabilitationsdiagnose im arbeitsbezogenen Kontext<br />
Indikation für berufsbezogene Bausteine in der medizinischen Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> Basis für Beurteilung der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben<br />
Psychologe<br />
Emotionales Befinden<br />
Selbstwahrnehmung<br />
Persönlichkeitsstruktur<br />
soziales Verhalten<br />
Auslöser <strong>und</strong> Auswirkung<br />
Motivation zur beruflichen<br />
Tätigkeit (Ambivalenz)<br />
Verhaltensbeobachtung<br />
zur Leistungsbeurteilung<br />
Psychophysiologische <strong>und</strong><br />
konzentrative Leistungsfähigkeit<br />
Intellektuelle Befähigung<br />
Persönlichkeitsdiagnostik<br />
Psychologische<br />
Eignungsdiagnostik<br />
Empfehlung ergänzender<br />
Assessments<br />
Sozialarbeiter/<br />
-pädagoge<br />
Klärung der sozialen Situation/<br />
Beziehungsrahmen<br />
Ermittlung indiv. Normen <strong>und</strong><br />
Wertvorstellungen im Bezug zur<br />
Erwerbsfähigkeit<br />
Konfliktklärung in sozialer<br />
Hinsicht (finanzielle Situation,<br />
sozialer Rückzug)<br />
Empfehlung ergänzender<br />
Assessments<br />
Krankengymnast<br />
Sporttherapeut<br />
Ergotherapeut<br />
Ergänzung der Arbeitsanamnese<br />
Ermitteln allgemeiner indiv.<br />
Stärken <strong>und</strong> Beeinträchtigungen<br />
Ermitteln behinderungsgerechter<br />
Arbeitsbedingungen<br />
Verhaltensbeobachtung<br />
zur Leistungsbeurteilung<br />
Empfehlung ergänzender<br />
Assessments<br />
Abbildung 70: Spezifizierung der Rehabilitationsdiagnostik im berufsbezogenen Kontext (modifiziert nach BfA 2000)<br />
159<br />
Sozialmediziner/<br />
Reha-Berater<br />
Ermitteln <strong>des</strong> beruflichen<br />
Werdegangs<br />
Ermittlung der Bezugstätigkeit<br />
Abgleich <strong>des</strong> Belastbarkeits-/Beanspruchungsprofils<br />
Feststellung branchenüblicher<br />
Belastungsmerkmale<br />
Empfehung ergänzender<br />
Assessments
Das im Projekt auf der Basis der Prädiktoren entwickelte Screeninginstrument bietet<br />
die Möglichkeit, diese Subgruppe frühzeitig zu identifizieren <strong>und</strong> gezielt die individuell<br />
notwendige, vertiefende Diagnostik zu veranlassen. Eine Absicherung der Ergebnisse<br />
<strong>des</strong> Screenings kann durch die bei Aufnahme in der Rehabilitationseinrichtung<br />
obligatorische Rehabilitationsanamnese <strong>und</strong> die weiteren Angaben in der Sozial- <strong>und</strong><br />
Berufsanamnese erfolgen. Aufgr<strong>und</strong> der im Normalfall kurzen Dauer der medizinischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme von drei Wochen wäre es hierbei sinnvoll, den Patienten<br />
vor Beginn der Rehabilitationsmaßnahme den Fragebogen mit der Bitte um<br />
Beantwortung <strong>und</strong> Rücksendung zuzusenden. Gleichzeitig muss überlegt werden,<br />
inwiefern der behandelnde Haus-/Facharzt durch dieses Vorgehen auch in die Definition<br />
der individuellen Therapieziele seines Patienten einbezogen werden kann. Für<br />
dieses Vorgehen sprechen die Ergebnisse der in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
seit 1994 fortlaufend durchgeführten Patientenbefragung (Kaiser & Schmitz<br />
1994, 1995). Auf der Basis <strong>des</strong> bisherigen Rücklaufs von 13.000 Fragebögen ergibt<br />
sich eindeutig die relativ passive Erwartungshaltung der Patienten zu Beginn der Rehabilitationsmaßnahme.<br />
Die im Rahmen der Davoser-Reha-Studie durchgeführte<br />
Katamnese zeigt dies in abgeschwächter Form auch für den behandelnden Haus-<br />
/Facharzt (Kaiser 1994, Kaiser & Schmitz 1998b). Zusammengefasst liegen die Vorteile<br />
bei diesem Vorgehen in folgenden Bereichen:<br />
• Frühzeitiges Screening der Patienten in Bezug auf arbeitsbezogene Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen<br />
• Frühzeitige Sensibilisierung der Patienten <strong>und</strong> <strong>des</strong> behandelnden Haus-<br />
/Facharztes für die Rehabilitationsmaßnahme <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen individuellen<br />
Zielsetzungen (Reha-Motivation)<br />
• Vorliegen eines individuellen Risikoprofils bereits bei Klinikaufnahme, welches<br />
gezielt durch die Ergebnisse der Rehabilitationsanamnese <strong>und</strong> die Sozial- <strong>und</strong><br />
Berufsanamnese frühzeitige Hinweise gibt, in welchem Umfang <strong>und</strong> in welchen<br />
Bereichen die Rehabilitationsdiagnose im arbeitsbezogenen Kontext genauer abgesichert<br />
werden muss<br />
• Frühzeitige Zuweisung in spezielle berufsbezogene Maßnahmen während der<br />
Rehabilitation<br />
• Verbesserung der Schnittstellen zum behandelnden Haus-/Facharzt durch frühzeitige<br />
Einbeziehung in die Formulierung der individuellen Zielsetzungen der Rehabilitationsmaßnahme<br />
Der weitere gr<strong>und</strong>sätzliche Bereich, in dem Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert werden<br />
müssen, betrifft die rehabilitationsspezifischen Interventionen. Zielorientierung<br />
im Bereich der Therapie bedeutet im Kontext <strong>des</strong> Projektes, dass die durch das<br />
Screening <strong>und</strong> die Anamnese definierte Subgruppe der Patienten mit einem erhöhten<br />
Risiko zur Frühberentung, mit dem Ziel der Verbesserung <strong>und</strong> Wiederherstellung der<br />
Erwerbsfähigkeit <strong>und</strong> beruflichen Integration in spezielle Bausteine im Bereich arbeitsbezogener<br />
Interventionen überwiesen werden müssen.<br />
Insbesondere in der stationären Rehabilitation besteht die Möglichkeit, die gezielte<br />
Ausrichtung <strong>des</strong> gesamten Leistungspotentials auf den Erhalt der Erwerbsfähigkeit<br />
(Risikopotential <strong>des</strong> Patienten ⇔ Leistungspotential der Rehabilitationsklinik ⇔ Rehabilitationspotential<br />
<strong>des</strong> Patienten) auszurichten. Dabei sollte ein Schwerpunkt auf<br />
die Stärkung der persönlichen psychischen <strong>und</strong> sozialen Ressourcen gelegt werden<br />
<strong>und</strong> Umweltfaktoren im Sinne der ICF ausreichend Berücksichtigung finden (vgl.<br />
Abb. 1, Abschnitt 1.4.1).<br />
160
Arzt<br />
Indikationsbezogene<br />
Therapie<br />
Psychologe<br />
Problemorientierte<br />
Gruppenarbeit:<br />
Stressbewältigung<br />
Konflikttraining<br />
Soziales/berufliches<br />
Kompetenztraining<br />
Entspannungstherapie:<br />
Autogenes Training<br />
Prog. Muskelrelaxation<br />
Konfliktzentrierte<br />
Einzelgespräche<br />
Berufsbezogene Bausteine in der medizinischen Rehabilitation<br />
Sozialarbeiter/<br />
-pädagoge<br />
allgemeine Beratung<br />
<strong>und</strong> Information<br />
Beraterische Umsetzung<br />
der sozialmedizinischen<br />
Beurteilung:<br />
Entwicklung von allg.<br />
<strong>und</strong> krankheitsspezifischen<br />
Fragestellungen<br />
Erarbeitung der Perspektive<br />
zur Reha-Nachsorge<br />
Erschliessen von zeitnahen<br />
Informations- <strong>und</strong> Beratungsquellen<br />
nach Entlassung<br />
Krankengymnast<br />
Sporttherapeut<br />
Abbildung 71: Berufsbezogene Bausteine in der med. Rehabilitation (modifiziert nach BfA 2000)<br />
161<br />
Ergotherapeut<br />
Indiaktionsbezogene Arbeitsplatztraining<br />
Krankengymnastik Hilfsmittelbezogene<br />
Funktionsspezifische Ergotherapie<br />
Krankengymnastik Kreativtherapie<br />
Atemschulung<br />
Projektgruppen<br />
Rückenschulung<br />
Indikationsbezogene<br />
Sporttherapie<br />
Funktionsspezifische<br />
Sporttherapie<br />
Kraft-Ausdauer-Training<br />
<strong>und</strong> Konditionsaufbau<br />
krankheitsspezifisches<br />
ADL-Training (Steigerung<br />
Belastbarkeit, Verhinderung<br />
Symptomatik, Angstabbau)<br />
Schulung<br />
Indikativgruppen<br />
Indikationsspezifische Schulung<br />
Asthma, COPD, Allergien, Haut<br />
Ges<strong>und</strong>heitstraining<br />
Ernährung, Sport <strong>und</strong> Bewegung,<br />
Stress <strong>und</strong> Stressbewältigung,<br />
Alltagsdrogen<br />
Krankheit <strong>und</strong> Beruf<br />
Problemlösegruppe<br />
Konflikte am Arbeitsplatz<br />
Möglichkeiten der Nachsorge<br />
<strong>und</strong> Integration in den Arbeitsprozess
In Abbildung 71 sind mögliche Bausteine berufsbezogener Maßnahmen in der medizinischen<br />
Rehabilitation dargestellt. Wie bereits im Bereich der Diagnostik (vgl. Abb.<br />
70), verdeutlicht die Darstellung auch bei den Interventionen das hohe Ausmaß an<br />
Interdisziplinarität <strong>und</strong> zeigt gleichzeitig das zu nutzende Potential eindrücklich auf.<br />
Unter Bezugnahme auf die von Neuderth & Vogel (2002) vorgelegte Übersicht über<br />
speziell auf den beruflichen Bereich ausgerichtete Maßnahmen in der medizinischen<br />
Rehabilitation, zeigt sich durch die geringe Anzahl ein hoher Entwicklungs- <strong>und</strong> Erprobungsbedarf<br />
in diesem Bereich. Für den Bereich der Erkrankungen der Lunge<br />
<strong>und</strong> der Atemwege wird dies zusätzlich durch die sozialmedizinische Relevanz <strong>und</strong><br />
die daraus resultierenden Folgekosten dieser Erkrankungen (vgl. Abschnitt 1.2.) sowie<br />
die Ergebnisse der Expertenbefragung (vgl. Abschnitt 4.5.) unterstützt. Konkrete<br />
Möglichkeiten hierzu werden später dargestellt.<br />
7.2. Umsetzungen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Mit Beginn <strong>des</strong> Projektes wurde in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang unter Leitung<br />
<strong>des</strong> Projektleiters eine interdisziplinär besetzte Projektgruppe ‚Berufliche Orientierung<br />
in der pneumologischen Rehabilitation’ eingesetzt, die dem Forschungsprojekt<br />
bis Mitte 2000 beratend zur Seite stand (Kaiser et al. 2000b, Kaiser & Lippitsch<br />
2001). Die Aufgaben bestanden in der Qualitätsverbesserung im sozialmedizinischen<br />
Bereich. Hierzu sollte im ersten Schritt der Ist-Zustand der Strukturen <strong>und</strong> Prozesse<br />
im Bereich der Sozialmedizin beschrieben werden <strong>und</strong> hieraus resultierend unter<br />
Einbeziehung der damals vorliegenden Forschungsergebnisse ein Soll-Zustand definiert<br />
werden. In der Problemanalyse kam die Projektgruppe zu folgendem Ergebnis:<br />
� Unzureichende Berücksichtigung der beruflichen Situation der Patienten in der<br />
Aufnahmeprozedur<br />
� Passive Erwartungshaltung der Patienten<br />
� Häufig Selbstzuweisung der Patienten (unzureichende Therapiezieldefinition <strong>und</strong><br />
Therapiesteuerung)<br />
� Zu späte Erkennung von Risikopatienten<br />
� Unzureichende Einbeziehung <strong>des</strong> Patienten (Aufklärung, Beratung)<br />
� Schnittstellenprobleme (Stationsarzt – Sozialmedizin - Beratung, etc.) führen zu<br />
Zeitverlusten<br />
� Die Mehrdimensionalität der Erwerbsfähigkeit wird unzureichend berücksichtigt<br />
� Häufig einseitige somatische Sichtweise der Erwerbsfähigkeit<br />
� Die sozialmedizinische Beurteilung erfolgt zu spät, so dass eine umfassende Beratung<br />
nicht mehr möglich ist<br />
� Der Transfer der Ergebnisse durch den Stationsarzt <strong>und</strong> den Arztbrief (Dauer bis<br />
zur Versendung) verhindern bei den Problempatienten eine reibungslose Weiterberatung<br />
im Rahmen der Nachsorge (Schnittstellenproblem)<br />
Hieraus ergaben sich für die Projektgruppe folgende wegleitende Fragen:<br />
1. Wie können die vorhandenen Strukturen der Klinik durch geeignete Prozesse gezielt<br />
zur Identifikation der Risikopatienten <strong>und</strong> zur umfassenden Therapie, Information<br />
<strong>und</strong> Beratung genutzt werden (Optimierung Strukturen/Prozesse, wie/wer<br />
begutachten, wie/wer beraten)?<br />
162
2. Wie kommt der Stationsarzt möglichst bereits bei der Aufnahme zur Indikation für<br />
eine umfassende sozialmedizinische Beurteilung <strong>und</strong> Beratung (Risikoprofile, Assessmentinstrumente)?<br />
3. Wie kann die Schnittstelle zur Nachsorge verbessert werden (Information <strong>und</strong><br />
Beratung <strong>des</strong> Patienten, Arztbrief, Instrument zur Information <strong>des</strong> Haus-<br />
/Facharztes)?<br />
Da im Rahmen der Strukturqualität gr<strong>und</strong>sätzlich alle notwendigen diagnostischen<br />
<strong>und</strong> therapeutischen Angebote für eine verstärkte Ausrichtung auf berufsbezogene<br />
Aspekte vorhanden waren, bezogen sich strukturelle Veränderungen ausschließlich<br />
auf den Bereich der Sozialmedizin <strong>und</strong> Rehabilitations- <strong>und</strong> Sozialberatung.<br />
Unter Einbeziehung der damals vorliegenden Projektergebnisse wurde Mitte 2000<br />
ein Rehabilitations-Beratungs- <strong>und</strong> Informationszentrum (BIZ) in das Gesamtkonzept<br />
der Klinik integriert. Aus Eigenmitteln wurde hierzu eine Sozialarbeiterin mit entsprechender<br />
Qualifikation <strong>und</strong> Berufserfahrung eingestellt. Die Aufgaben <strong>des</strong> Zentrums<br />
liegen neben der allgemeinen Rehabilitations- <strong>und</strong> Sozialberatung <strong>und</strong> Information<br />
insbesondere in der individuellen beraterischen Umsetzung der sozialmedizinischen<br />
Beurteilung. Die Beratung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sozialmediziner<br />
durch die Entwicklung von allgemeinen <strong>und</strong> krankheitsbezogenen Fragestellungen,<br />
der Erarbeitung der Perspektive zur Reha-Nachsorge <strong>und</strong> der hieraus resultierenden<br />
Erschließung von zeitnahen Informations- <strong>und</strong> Beratungsquellen (einschließlich der<br />
Einleitung nachfolgender berufsorientierter Maßnahmen) nach der Entlassung.<br />
Konkret können die Arbeitsinhalte wie folgt beschrieben werden:<br />
• Beratung <strong>und</strong> Betreuung bei persönlichen <strong>und</strong> beruflichen Problemsituationen,<br />
Konfliktsituationen <strong>und</strong> Entscheidungsschwierigkeiten<br />
• Gemeinsame (mit dem Patienten) Erarbeitung von Handlungsalternativen unter<br />
Beachtung der individuellen Lebenssituation<br />
• Rehabilitationsberatung<br />
− Einleitung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 ff SGB IX<br />
zur Erhaltung <strong>und</strong> Erlangung eines Arbeitsplatzes, zur beruflichen Anpassung<br />
<strong>und</strong> Weiterbildung, zur beruflichen Ausbildung etc.)<br />
− Einleitung von stufenweisen Wiedereingliederungen<br />
• Sozialberatung<br />
− Beratung nach Schwerbehindertenrecht<br />
− Klärung der wirtschaftlichen Sicherung<br />
− Allgemeine Information zu Rentenfragen<br />
− Einleitung häuslicher Pflege<br />
− Sonstige Organisation weitergehender Hilfen<br />
Es sei darauf hingewiesen, dass diese Stelle mittlerweile fest im Stellenplan der Klinik<br />
verankert ist.<br />
163
Struktur- <strong>und</strong> Prozessmerkmale<br />
<strong>des</strong> beruflichen Ansatzes<br />
Diagnostik<br />
Indikation<br />
Intervention<br />
Sozial-<br />
Arbeitsanamnese<br />
Stationsarzt<br />
(Case-Manager)<br />
Reha-<br />
Nachsorge<br />
Sozialmedizin<br />
Beurteilung<br />
BIZ<br />
Beratung<br />
Fallkonferenz<br />
Abb. 72: Struktur <strong>und</strong> Prozessmerkmale <strong>des</strong> beruflichen Ansatzes<br />
Qualifizierung/Sensibilisierung<br />
der Mitarbeiter aller Bereiche<br />
Assessmentverfahren<br />
Frühzeitige Risikoabschätzung<br />
Zielorientierung<br />
Prozesssteuerung<br />
Sozialmedizin/Beurteilung<br />
Diagnostik/Interventionen<br />
Reha-Psychologie<br />
Sporttherapie<br />
Physiotherapie<br />
Schulung<br />
Beratungszentrum<br />
Hilfen zur Reha-Nachsorge<br />
Arztbrief<br />
Die wesentlichen Inhalte <strong>des</strong> berufsbezogenen Ansatzes sind aus Abbildung 72 zu<br />
ersehen. Auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Projektergebnisse <strong>und</strong><br />
dem vorläufigen Abschlussbericht der Projektgruppe, wurden verschiedene Schritte<br />
unternommen, um das Modell in die Klinik zu integrieren (vgl. Anlage).<br />
Im Vordergr<strong>und</strong> standen dabei die Qualifizierung <strong>und</strong> Sensibilisierung der Mitarbeiter<br />
<strong>des</strong> Rehabilitationsteams in Bezug auf berufliche Aspekte im Bereich der medizinischen<br />
Rehabilitation, die Ausrichtung der bestehenden Angebote der Berufsgruppen<br />
auf diese Aspekte in Diagnostik <strong>und</strong> Therapie sowie Verbesserungen in der Prozesssteuerung.<br />
Spezielle Erweiterungen wurden im Bereich der Patientenschulung durch<br />
Seminare zu den Themen „Asthma, Beruf <strong>und</strong> Umwelt“, „Rehabilitation chronischer<br />
Krankheiten“ <strong>und</strong> „Sozialrechtliche Aspekte chronischer Krankheiten“ vorgenommen.<br />
Weiterhin wurden verschiedene Informationsmaterialien zu diesen Themen erstellt.<br />
Im Bereich der Prozesssteuerung wurden alle vorliegenden Instrumente überprüft,<br />
bei Bedarf modifiziert <strong>und</strong> neue Instrumente erarbeitet. Dies betraf insbesondere:<br />
• Den Fragebogen zur Sozial- <strong>und</strong> Arbeitsanamnese, den die Patienten ab diesem<br />
Zeitpunkt bereits vor der Aufnahme zugesandt bekamen<br />
• Den Anamnesebogen Rehabilitation, der komplett überarbeitet wurde<br />
• Die Anmeldung zur sozialmedizinischen Beurteilung<br />
• Die Rückmeldung der (vorläufigen/endgültigen) sozialmedizinischen Beurteilung<br />
an den behandelnden Arzt<br />
• Die Basisdokumentation der psychologischen Diagnostik<br />
• Das Überweisungsverfahren in das BIZ<br />
• Den Bericht BIZ (Kurz-/Langversion) an den Stationsarzt<br />
164
Unter Einbeziehung der bis Mitte 2000 vorliegenden Projektergebnisse wurde eine<br />
vorläufige Definition von Risikopatienten vorgenommen <strong>und</strong> ein Prozess festgelegt,<br />
mit dem die Gesamtbehandlung dieser Subgruppe in Diagnostik <strong>und</strong> Therapie gesteuert<br />
wird. In die vorläufige Definition der Risikopatienten wurden folgende Merkmale<br />
aufgenommen:<br />
• Aktuell arbeitsunfähige Patienten <strong>und</strong> insbesondere Patienten, die 4 Wochen <strong>und</strong><br />
länger in den letzten 12 Monaten arbeitsunfähig waren<br />
• Patienten, bei denen ein Rentenantrag läuft (Reha vor Rente)<br />
• Patienten die aus ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen arbeitslos sind<br />
• Patienten, die am Arbeitsplatz Probleme haben: Belastung, Beanspruchung, soziale<br />
Konflikte, Schadstoffe, etc.<br />
• Patienten, die sozialmedizinische Probleme haben (z.B. Rentenbegehren, Fragen<br />
zur Schwerbehinderung, etc.)<br />
• Patienten, die offensichtlich eine Tätigkeit/einen Beruf ausüben, der mit der<br />
Krankheit (Schwere, Prognose, Allergie, etc.) unvereinbar zu sein scheint<br />
Die Filterung der Risikopatienten aus der Gesamtgruppe der Patienten erfolgt auf der<br />
Basis der Ergebnisse der Rehabilitationsanamnese, der Sozial- <strong>und</strong> Arbeitsanamnese<br />
<strong>und</strong> der Basiseingangsdiagnostik. Die hierdurch bestimmten Risikopatienten<br />
werden durch ein definiertes Prozessmodell den unterschiedlichen berufsbezogenen<br />
Maßnahmen zugewiesen (vgl. Abb. 73). Die Einzelheiten sind aus dem in der Anlage<br />
beigefügten Bericht der Projektgruppe zu entnehmen.<br />
165
Verdacht<br />
ergänztes Basisprogramm<br />
Risikopatienten haben Priorität (Kennzeichnung!)<br />
individuell, zielorientiert<br />
Basisdiagnostik<br />
• Basis-Allergiediagnostik<br />
• Laboranalyse<br />
• Lungenfunktionsdiagnostik<br />
Basisangebote<br />
• Medikamentöse Therapie<br />
• Psychosoziale Rehabilitation<br />
• Physikalische Therapie<br />
• Ernährungsberatung<br />
Zusatzinformationen<br />
• Sozial– <strong>und</strong> Arbeitsanamnese (Patientenangaben)<br />
• Anforderungen (Stationsarztangaben)<br />
Prozesssteuerung:<br />
Stationsarzt<br />
BIZ<br />
spezifische<br />
Beratung<br />
nein<br />
alle Ergebnisse/Berichte<br />
BIZ<br />
ggf. Beratung<br />
Sozialmedizin<br />
abschließende Arbeits-/<br />
Sozialmedizinische<br />
Beurteilung<br />
(Reha-)Anamnese & sonstige Information<br />
Sozialmedizin<br />
vorläufige<br />
sozial–/arbeits-medizinische<br />
Beurteilung<br />
durch Sozialmediziner<br />
(weitere) Maßnahmen?<br />
Stationsarzt:<br />
Risikopatient?*<br />
Fallkonferenz<br />
(STA, CA, BIZ, SozM)<br />
• Urteilsbildung<br />
• Risikoprofil<br />
• Zieldefinition<br />
Stationsarzt<br />
Entlassungsgespräch (Stationsarzt)<br />
• Nachsorgeinformation <strong>und</strong> -formular für/an Patient<br />
• weitergehende Empfehlungen an andere Institutionen<br />
nein<br />
<br />
zum Nicht-Risikopatienten<br />
*Risikokriterien<br />
• Aktuell arbeitsunfähig (insbes. >4 Wochen<br />
im letzten Jahr)<br />
• Rentenantrag läuft<br />
• aus ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen arbeitslos<br />
• Probleme am Arbeitsplatz (Belastung, Beanspruchung,<br />
sozial,...)<br />
• sozialmedizinische Probleme<br />
(Rentenbegehren, Schwerbeh.,...)<br />
• mit Krankheit unvereinbare Tätigkeit<br />
Angebote insbesondere für<br />
Risikopatienten<br />
Risikopatienten haben Priorität<br />
Spezifische Diagnostik<br />
• Erweiterte Lungenfunktionsdiagnostik<br />
• Methacholintest/ Histamintest<br />
• Ergometrie mit Blutgasen oder Laufbandgehstreckentest<br />
• evtl. EIA-Test<br />
• Erweiterte Allergiediagnostik<br />
• Psychosoziale Diagnostik (FPI, BL,<br />
ASL, FKV)<br />
• Sport <strong>und</strong> Bewegung (6-Minuten-<br />
Gehtest, Ergometer)<br />
Spezifische Angebote<br />
• Patientenschulung<br />
• Psychologische Beratung/Therapie<br />
• Sporttherapie/Physiotherapie<br />
Ergebnis/Bericht/Akte<br />
nein<br />
Unterlagen versenden an zuweisenden Arzt/ zur Nachsorgeinstitution<br />
• BfA-Formular an zuständige Stelle<br />
• Arztbrief verschicken<br />
Abbildung 73: Ablaufschema für Risikopatienten<br />
ja<br />
166<br />
ja Bf-Fall?<br />
Risikopatient<br />
Zeitachse<br />
Aufnahmetag<br />
kurz vor<br />
Entlassung
Eine umfassende Evaluation dieses Modells zur Integration berufsbezogener Aspekte<br />
in die Gesamtbehandlung liegt zur Zeit nicht vor <strong>und</strong> war auch nicht Gegenstand<br />
<strong>des</strong> Forschungsprojektes. Weiterhin muss das vorläufige Modell nach Vorliegen<br />
der Endergebnisse <strong>des</strong> Projektes einer gr<strong>und</strong>legenden Überprüfung <strong>und</strong> Modifikation<br />
unterzogen werden, was im Rahmen <strong>des</strong> Qualitätsmanagements in der Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang erfolgen wird. Trotzdem sind gewisse Effekte der Implementierung<br />
dieses vorläufigen Ansatzes aus den Ergebnissen der fortlaufenden Patientenbefragung<br />
mit dem F-QS (Kaiser & Schmitz 1994) zu erkennen (vgl. Abb. 74).<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Abbildung 74<br />
Entwicklung der Patientenzufriedenheit<br />
Beratung in arbeitsbezogenen Fragen<br />
55,7 54,9<br />
15,5 13,9<br />
65,5<br />
5,5 4<br />
1998 1999 1. Halbjahr 2000 2000<br />
7.3. Weitere Überlegungen zur Umsetzung<br />
unzufrieden (%) zufrieden (%)<br />
Die Beschreibung der gr<strong>und</strong>sätzlichen Überlegungen zur Umsetzung der Ergebnisse<br />
hat auf der einen Seite die Möglichkeiten berufsbezogener Ansätze in den Bereichen<br />
der Diagnostik <strong>und</strong> Therapie im Rahmen von Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation<br />
aufgezeigt. Auf der anderen Seite ist jedoch auch deutlich geworden, dass<br />
nur in Teilbereichen klar definierte <strong>und</strong> mit den Fachgesellschaften <strong>und</strong> der Rentenversicherung<br />
abgestimmte Konzepte der beteiligten Berufsgruppen vorliegen.<br />
Insofern besteht bei allen beteiligten Berufsgruppen, den Fachgesellschaften <strong>und</strong> der<br />
Rentenversicherung die Notwendigkeit einer Konkretisierung bzw. ein Entwicklungsbedarf<br />
in Bezug auf berufsbezogene Maßnahmen in Diagnostik, Therapie, Schulung<br />
<strong>und</strong> Beratung. Zur nachhaltigen Verankerung dieser Angebote sind weiterhin entsprechende<br />
Fort-, Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungskonzepte zu entwickeln.<br />
Es ist nachvollziehbar, dass diese vielfältigen Aufgaben von dem Forschungsprojekt<br />
nicht geleistet werden können. Trotzdem werden durch die in Abbildung 65 dargestellte<br />
Vernetzung <strong>des</strong> Projektes bzw. der Forschungsgruppe Rehabilitation in Teilbereichen<br />
Möglichkeiten gesehen, die nachfolgend kurz beschrieben werden.<br />
167<br />
83,7
Verb<strong>und</strong>übergreifende Arbeitsgruppen:<br />
Für die Entwicklung von berufsbezogenen Bausteinen in der medizinischen Rehabilitation<br />
können die im Rahmen der Verb<strong>und</strong>forschung gebildeten verb<strong>und</strong>übergreifenden<br />
Arbeitsgruppen genutzt werden. Hierbei sind insbesondere die im Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Freiburg/Bad Säckingen angesiedelte „AG berufliche Orientierung<br />
in der medizinischen Rehabilitation“ (Sprecher: Dr. U. Kaiser) <strong>und</strong> die im Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Bayern angesiedelte „AG Patientenschulung“ (Sprecher: Dr. H. Vogel)<br />
zu nennen. In diesen Arbeitsgruppen sind alle Berufsgruppen vertreten, was für<br />
die Entwicklung von integrativen Ansätzen förderlich erscheint. Für den Bereich der<br />
Patientenschulung ist hierbei insbesondere an die Entwicklung von berufsbezogenen<br />
Indikationsgruppen zu denken, die das Modell der allgemeinen Ges<strong>und</strong>heitsbildung<br />
der Rentenversicherung (VDR 2002e) <strong>und</strong> die indikationsspezifischen Schulungen<br />
für die Risikogruppe sinnvoll ergänzt. Weiterhin wäre in diesen Gruppen auch an die<br />
Entwicklung von entsprechenden Fortbildungskonzepten zu denken.<br />
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie: Sektion Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
Bemühungen um die Umsetzung von Forschungsergebnissen in der medizinischen<br />
Rehabilitation tangieren immer bestehende Leitlinien, definierte Standards oder vorhandene<br />
Positionspapiere. Bemühungen zur Weiterentwicklung werden daher immer<br />
nur dann erfolgreich sein, wenn frühzeitig die entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften<br />
einbezogen werden.<br />
Hierzu wurde auf Initiative <strong>und</strong> unter dem Vorsitz <strong>des</strong> Projektleiters erstmals bei einem<br />
Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP) in der Sektion<br />
für Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation ein Frühseminar (Jena 2002) <strong>und</strong> ein Symposium<br />
(Bochum 2002) zu beruflichen Aspekten in der pneumologischen Rehabilitation<br />
für niedergelassene Pneumologen <strong>und</strong> Kliniker durchgeführt. In das Symposium<br />
wurden als Referenten Vertreter der Rentenversicherung <strong>und</strong> der Forschungsverbünde<br />
einbezogen. Für 2003 ist gemeinsam mit der Sektion ein entsprechender<br />
Workshop in Davos geplant. Ein weiterer Workshop wird gemeinsam mit der Sektion<br />
Arbeitsmedizin in der DGP beim nächsten Kongress in Frankfurt (2004) durchgeführt.<br />
Weitere Unterstützungsmöglichkeiten bestehen durch die Einbeziehung der in der<br />
Sektion integrierten ‚AG Reha-Forschung’, die 2001 gegründet wurde (vgl. Kaiser et<br />
al. 2001) <strong>und</strong> deren Koordinator der Leiter dieses Projektes ist.<br />
Insgesamt können durch die Einbeziehung der Sektion Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
bei der Weiterentwicklung berufsbezogener Ansätze alle Berufsgruppen in der Rehabilitation<br />
beteiligt werden. Gleichfalls besteht hier auch die Möglichkeit, das Thema<br />
‚Rehabilitation <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit’ bei großen Kongressen zu präsentieren <strong>und</strong><br />
damit die Berufsgruppen in der Akut- <strong>und</strong> Rehabilitationsmedizin für dieses Thema<br />
zu sensibilisieren.<br />
An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Mitantragsteller <strong>des</strong> Forschungsprojektes<br />
in seiner Zeit als Sprecher der Sektion Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
in der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie als Mitglied der Expertenkommission<br />
für das Leitlinien-Clearing-Verfahren „Asthma bronchiale“ in einem hohen<br />
Maße dazu beigetragen hat, dass die Zielsetzungen <strong>des</strong> Projektes für die Gruppe der<br />
168
ereits Erwerbstätigen <strong>und</strong> auch für den Bereich der Berufswahl in ausreichendem<br />
Maße Berücksichtigung gef<strong>und</strong>en haben (ÄZQ 2001).<br />
Institut für sportmedizinische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation (ISPR)<br />
Weitere Unterstützung bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse ist durch das<br />
‚Institut für sportmedizinische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation’ (ISPR) zu erwarten. Das<br />
Anfang 2002 gegründete Institut dient der Operationalisierung der seit Jahren zwischen<br />
der Universität Mainz <strong>und</strong> der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang bestehenden<br />
Kooperation. Die Ziele <strong>des</strong> Instituts liegen in der Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
aller Berufsgruppen in der Rehabilitation. Unterstützt wird das Institut durch einen<br />
Beirat, in dem sowohl Akut- als auch Rehabilitationsmediziner vertreten sind. Beide<br />
Mitglieder der Forschungsgruppe Rehabilitation in der Hochgebirgsklinik Davos-<br />
Wolfgang sind im Vorstand <strong>des</strong> Instituts vertreten (www.ispr.biz).<br />
Im Rahmen der universitären Lehre <strong>und</strong> Forschung werden Seminare, Praktika, Exkursionen<br />
<strong>und</strong> praxisbezogene Diplomarbeiten <strong>und</strong> Dissertationen durchgeführt bzw.<br />
betreut.<br />
Bei der Durchführung von Ausbildungsseminaren im Bereich <strong>des</strong> Lungensports arbeitet<br />
das Institut eng mit der AG Lungensport Deutschland zusammen, mit der es in<br />
Oppenheim eine gemeinsame Geschäftsstelle unterhält (www.lungensport.org).<br />
Die Ausführungen verdeutlichen, dass Unterstützungsleistungen durch das Institut<br />
<strong>und</strong> auch durch die AG Lungensport vorwiegend in Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsangeboten<br />
für alle Berufsgruppen in der Rehabilitation liegen könnten. Weitere Aktivitäten<br />
<strong>des</strong> Instituts sind aus der Abbildung 74 zu entnehmen.<br />
Abbildung 74: Projekte im ISPR<br />
169
8. Publikationsliste während <strong>des</strong> Förderzeitraums<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1998): Die Verzahnung stationärer <strong>und</strong> ambulanter pneumologischer<br />
Rehabilitationsangebote: Bewertung der Ergebnisse <strong>und</strong> Kooperation<br />
aus der Sicht <strong>des</strong> Arztes. In VDR (Hrsg.), Interdisziplinarität <strong>und</strong> Vernetzung.<br />
DRV-Schriften Band 11. VDR, Frankfurt, 67-69.<br />
Kaiser, U., Trachsel., W. & Schmitz, M. (1998). Die Entwicklung von Modellen zur<br />
Patientenschulung von Erwachsenen mit chronischen Atemwegserkrankungen in<br />
der Schweiz im Bereich der stationären <strong>und</strong> ambulanten Versorgung. In VDR<br />
(Hrsg.), Interdisziplinarität <strong>und</strong> Vernetzung. DRV-Schriften Band 11. VDR, Frankfurt,<br />
182-184.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1998). In-Patient Pulmonary Rehabilitation – Methods and<br />
Results. In VDR, (Hrsg.), 6 th European Congress on Research in Rehabilitation.<br />
Improving Practice by Research. DRV-Schriften Band 10. VDR, Frankfurt, 418-<br />
420.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1998). Ambulante Rehabilitationsangebote bei chronischen<br />
Atemwegserkrankungen: Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Konsequenzen aus der Davoser-Reha-Studie<br />
(166-186). In M. Schmidt-Ohlemann, Ch. Zippel, W. Blumenthal<br />
& H.J. Fichtner (Hrsg.), Ambulante wohnortnahe Rehabilitation – Konzepte für<br />
Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft. DVfR-Reihe: Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation,<br />
Band 7. Ulm: Universitätsverlag.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999). Sommercamp für Erwachsene: ein zielgruppenorientierter,<br />
interdisziplinärer Behandlungsansatz. Physikalische Medizin, 8, 147.<br />
Pleyer, K., Schmitz, M., Kaiser, U. & Schäfers, N. (1999). Auswirkungen von sporttherapeutischen<br />
Maßnahmen auf die Leistungsfähigkeit chronisch atemwegserkrankter<br />
junger Erwachsener innerhalb <strong>des</strong> Sommercamps an der Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang. Schweiz. Physikalische Medizin, 8, 152.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999). Gefährdungspotentiale zur beruflichen Ausgrenzung<br />
von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. In VDR, (Hrsg.), Reha-<br />
Bedarf, Effektivität, Ökonomie. DRV-Schriften Band 12. VDR, Frankfurt, 94-95.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999). Zielgruppenspezifische Angebote in der pneumologischen<br />
Rehabilitation: ‚Sommercamp für junge Erwachsene‘ der Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang. In VDR, (Hrsg.), Reha-Bedarf, Effektivität, Ökonomie. DRV-<br />
Schriften Band 12. VDR, Frankfurt, 333-334.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999). Sport- <strong>und</strong> Bewegungstherapie im pneumologischen<br />
Rehabilitationsprozess. In VDR, (Hrsg.), Reha-Bedarf, Effektivität, Ökonomie.<br />
DRV-Schriften Band 12. VDR, Frankfurt, 338-339.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (2000). Effektivität <strong>und</strong> Effizienz einer pneumologischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme aus unterschiedlicher Perspektive. DRV-Schriften<br />
Band 20, VDR, Frankfurt, 356-359.<br />
170
Kaiser, U. (2000). Rehabilitationsforschung (67). In N. Konietzko & H. Fabel (Hrsg.),<br />
Weissbuch Lunge 2000. Defizite, Zukunftsperspektiven, Forschungsansätze: Zur<br />
Lage der Pneumologie in Deutschland. Stuttgart: Thieme.<br />
Kaiser U. & Schmitz, M. (2000). Die Relevanz einer stärkeren Berücksichtigung beruflicher<br />
Aspekte in der pneumologischen Rehabilitation. Pneumologie, 54, 13.<br />
Pleyer, K., Kaiser, U., Schäfers, N. & Schmitz, M. (2000). Auswirkungen von sporttherapeutischen<br />
Maßnahmen auf die Leistungsfähigkeit junger Erwachsener.<br />
Pneumologie, 54, 57.<br />
Schmitz, M. & Kaiser, U. (2000). Qualitätssicherung in der stationären pneumologischen<br />
Rehabilitation (757-726). In W. Petro (Hrsg.). Pneumologische Prävention<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation. Berlin: Springer.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (2000). Berufliche Orientierung in der stationären pneumologischen<br />
Rehabilitation. In Bengel J. & Jäckel, W.H. (Hrsg.). Zielorientierung in<br />
der Rehabilitation – Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverb<strong>und</strong> Freiburg/Bad<br />
Säckingen (141-150). Regensburg: Roderer.<br />
Kaiser, U., Lippitsch, S. & Schmitz, M. (2000). In-Patient Pulmonary Rehabilitation.<br />
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 161, 3, 495.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (2000). Effektivität <strong>und</strong> Effizienz einer pneumologischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme aus unterschiedlicher Perspektive. DRV-Schriften<br />
Band 20, 356-359.<br />
Kaiser, U. & Lippitsch, S. (2001). Rehabilitationsforschung als Instrument zur Qualitätsverbesserung<br />
in der Rehabilitation: die Integration eines interdisziplinären Modells<br />
zur beruflichen Orientierung in der pneumologischen Rehabilitation. DRV,<br />
26, 68-71.<br />
Kaiser U., Mühlig, S, Schwiersch, M. & Wittmann, M. (2001). Positionspapier zur<br />
Gründung einer Arbeitsgruppe Rehabilitationsforschung in der pneumologischen<br />
Rehabilitation. Klinische Verhaltensmedizin <strong>und</strong> Rehabilitation, 54, 168-170.<br />
Kaiser U. (2001). Aspekte der beruflichen Rehabilitation <strong>und</strong> deren Umsetzung in<br />
Behandlungs- <strong>und</strong> Beratungskonzepte in der stationären pneumologischen Rehabilitation.<br />
In DLR-Projektträger <strong>des</strong> BMBF & Deutsche Rentenversicherung<br />
(Hrsg.), Rehabilitationswissenschaftliche Forschungsverbünde, aktualisierte <strong>und</strong><br />
überarbeitete Auflage 1/2002 (86). Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U. (2001). Rehabilitationsverb<strong>und</strong>forschung in Deutschland: die Brücke zwischen<br />
Forschung <strong>und</strong> Praxis. Sonderheft 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft<br />
für Pneumologie. Berlin: BVG<br />
Kaiser U. (2002). Berufliche Orientierung in der pneumologischen Rehabilitation – ein<br />
interdisziplinäres Behandlungsmodell in der Rehabilitation von Patienten mit<br />
chronischen Atemwegserkrankungen. In Neuderth, S. & Vogel, H., B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft<br />
für Rehabilitation (Hrsg.). Berufsbezogene Maßnahmen in der<br />
171
medizinischen Rehabilitation – bisherige Entwicklungen <strong>und</strong> Perspektiven (135-<br />
146). Frankfurt: BAR.<br />
Kaiser, U. (2002). Krankheitsbelastungen, Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
bei chronischen Atemwegserkrankungen. DRV-Schriften, Band 33, 281-286.<br />
Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U., Jung, V. & Kresse, S. (2003). Der Stellenwert der Raucherentwöhnung in<br />
der stationären pneumologischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Band 40, 444-<br />
446. Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U. (2003). Disease-Management-Programm Asthma bronchiale – Königsweg<br />
oder Alibi: Chancen <strong>und</strong> Risiken im Kontext der stationären pneumologischen<br />
Rehabilitation. DRV-Schriften, Band 40, 437-439. Frankfurt: VDR.<br />
172
9. Literaturverzeichnis<br />
Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung (Hrsg.)(2001). Leitlinien-Clearing-Bericht<br />
„Asthma bronchiale“. Schriftenreihe der Ärztlichen Zentralstelle Qualitätssicherung,<br />
Band 9. München: Zuckerschwerdt.<br />
ACVPR (1998). Guidelines for pulmonary rehabilitation programs. Champaign: Human<br />
Kinetics.<br />
Baur, X. (1996). Umwelt <strong>und</strong> Lunge. Deutsches Ärzteblatt, 93, 5, 244-248.<br />
Behrens, J., Morschhäuser, M., Viebrok, H. & Zimmermann, E. (1999). Länger erwerbstätig<br />
– aber wie? Opladen: Westdeutscher.<br />
Behrens, J. (2001). Was uns vorzeitig „alt aussehen“ lässt. Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte.<br />
B 3-4, 14-22.<br />
Bellach, B.-M., Knopf, H. & Thefeld, W. (1998). Der B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitssurvey<br />
1997/98. Ges<strong>und</strong>heitswesen, 60 (Sonderheft 2), 59-68.<br />
Bengel, J, & Jäckel, W.H. (Hrsg.) (2000). Zielorientierung in der Rehabilitation - Rehabilitationswissenschaftlicher<br />
Forschungsverb<strong>und</strong> Freiburg/ Bad Säckingen.<br />
Regensburg: Roderer.<br />
Bengel, J. & Koch; U. (Hrsg.)(2000). Gr<strong>und</strong>lagen der Rehabilitationswissenschaften.<br />
Berlin: Springer.<br />
Bennett, D. (1972). Die Bedeutung der Arbeit für die psychiatrische Rehabilitation. In<br />
A. Finzen & M.v. Cranach (Hrsg.). Sozialpsychiatrische Texte. <strong>Psychische</strong><br />
Krankheit als sozialer Prozess (68-78). Berlin: Springer.<br />
Beutel, M., Bleichner, F. & Kayser, E. (1997). Berufliche Integration psychosomatisch<br />
Kranker, MMW, 46, 680-682.<br />
Beutel, M, Kayser, E. Vorndran, A., Farley, A. & Bleichner, F. (1998a). Die integrierte<br />
berufliche Belastungserprobung in der medizinischen Rehabilitation – Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> Perspektiven am Beispiel der psychosomatischen Rehabilitation. Rehabilitation,<br />
37, 85-92.<br />
Beutel, M., Kayser, E., Vorndran, A., Schlüter, K. & Bleichner, F. (1998b). Berufliche<br />
Integration psychosomatisch Kranker – Ergebnisse einer Verlaufsuntersuchung<br />
mit Teilnehmern der beruflichen Belastungserprobung. Praxis Klinische Verhaltensmedizin<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation, 42, 22-27.<br />
Biefang, S., Potthoff, P., Bellach, B., Ziese, Th. & Buschmann-Steinhage, R. (1996).<br />
Prädiktoren <strong>des</strong> Rehabilitations- <strong>und</strong> Berentungsgeschehens - Ergebnisse einer<br />
Längsschnittstudie. Deutsche Rentenversicherung, 1-2, 84-108.<br />
Bossert, T. (1994). Berufsbedingte Allergien. Allergiker, 58-59.<br />
Budde, H.G. & Keck, M. (1999). Vorfeldmaßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung<br />
in der kardiologischen Anschlussheilbehandlung. Herz-Kreislauf, 31,<br />
9/351.<br />
173
Büchi, S., Wolf, C., Schwarz, F., Villiger, B. & Buddeberg, C. (1996). Sind stationäre<br />
Rehabilitationsbehandlungen bei Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenkrankheit<br />
(COLK) sinnvoll? Psychother. Psychosom. Med. Psychol., 46, 423-<br />
429.<br />
Bürger, W. (1997). Arbeit, Psychosomatik <strong>und</strong> medizinische Rehabilitation. Eine<br />
Längsschnittuntersuchung. Bern: Huber.<br />
Bullinger, M. & Kirchberger, I. (1998). SF-36 Fragebogen zum Ges<strong>und</strong>heitszustand.<br />
Handanweisung. Göttingen: Hogrefe.<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (1999a). Positionspapier der B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft<br />
für Rehabilitation zur Weiterentwicklung der medizinischen,<br />
beruflichen <strong>und</strong> sozialen Rehabilitation. Rehabilitation, 38, 38-43.<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (1999b). Perspektiven <strong>des</strong> Wandels in<br />
der Rehabilitation. Anregungen <strong>und</strong> Empfehlungen aus den Beiträgen auf dem<br />
3. B<strong>und</strong>eskongress für Rehabilitation 1999. Frankfurt: BAR.<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Hrsg.)(2001). Wegweiser – Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> Teilhabe behinderter Menschen. Frankfurt: BAR.<br />
B<strong>und</strong>esausschuss der Ärzte <strong>und</strong> Krankenkassen (2003). Richtlinien <strong>des</strong> B<strong>und</strong>esausschusses<br />
der Ärzte <strong>und</strong> Krankenkassen übe die Verordnung <strong>und</strong> Gewährung<br />
von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, über die Beratung von Leistungen<br />
zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben <strong>und</strong> über<br />
ergänzende Leistungen zur Rehabilitation (Rehabilitations-Richtlinien) nach<br />
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 SGB V. (unveröffentlichter Entwurf).<br />
B<strong>und</strong>esversicherungsanstalt für Angestellte (1999) (Hrsg.). Rehabilitation 1999 –<br />
Fachtagung zur beruflichen Rehabilitation der BfA. Berlin: BfA.<br />
B<strong>und</strong>esversicherungsanstalt für Angestellte (2000) (Hrsg.). Eckpunkte arbeitsbezogener<br />
Strategien in der medizinischen Rehabilitation. Berlin: BfA.<br />
Buschmann-Steinhage, R. (1996). Einrichtungen der Rehabilitation <strong>und</strong> ihre Aufgaben<br />
(73-89). In H. Delbrück & E. Haupt (Hrsg.). Rehabilitationsmedizin. Therapie-<br />
<strong>und</strong> Betreuungskonzepte bei chronischen Krankheiten. München: Urban<br />
<strong>und</strong> Schwarzenberg.<br />
Casaburi, R. (1993). Exercise training in COPD. In R. Casaburi & T.L. Petty (Eds.),<br />
Principles and practice of pulmonary rehabilitation. Philadelphia: Sa<strong>und</strong>ers.<br />
Cegla, U. (1996). Rehabilitation bei Erkrankungen der Atmungsorgane. In H. Delbrück<br />
& E. Haupt (Hrsg.), Rehabilitationsmedizin, Therapie- <strong>und</strong> Betreuungskonzepte<br />
bei chronischen Krankheiten (295-318). München: Urban & Schwarzenberg.<br />
Chan-Yeung, M. (1995). ACCP Consensus Statement: Assessment of Asthma in the<br />
Workplace. Chest, 108, 1084-1117.<br />
Cumming, J. & Cumming, E. (1962). Ich <strong>und</strong> Milieu. Theorie <strong>und</strong> Praxis der Milieutherapie.<br />
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.<br />
174
Czikkely, M. & Limbacher, K. (1998). „Meine beruflichen Schwierigkeiten bewältige<br />
ich, wenn es mir wieder besser geht ...“ – Berufsbezogene Behandlungsansätze<br />
während eines stationären Heilverfahrens. Praxis Klinische Verhaltensmedizin<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation, 42, 4-10.<br />
Deck, R., Zimmermann, M., Kohlmann, T. & Raspe, H. (1998a). Rehabilitationsbezogene<br />
Erwartungen <strong>und</strong> Motivation bei Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen.<br />
Die Rehabilitation, 37, 140-146.<br />
Deck, R., Kohlmann, T. & Raspe, H. (1998b). Erwartungen <strong>und</strong> Motivation bei Patienten<br />
in der medizinischen Rehabilitation. Zeitschrift für Ges<strong>und</strong>heitspsychologie,<br />
6, 101-108.<br />
Dern, W. & Raß, G. (2002). Rehabilitationsbedürftigkeit von Patienten nach der Klinikentlassung.<br />
Evaluation eines Prädiktorensystems <strong>und</strong> Entwicklung eines<br />
Assessmentinstrumentes. Studie im Rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Ulm. Forschungsbericht.<br />
Derogatis, L.R. (1977). The SCL-90 Manual I: Scoring, administration and procedures<br />
for the SCL-90. John Hopkins University School of Medicine, Clinical<br />
Psychometrics Unit.<br />
Deter, H.C. (1986). Psychosomatische Behandlung <strong>des</strong> Asthma bronchiale. Indikation,<br />
Therapie <strong>und</strong> Ergebnisse der krankheitsorientierten Gruppentherapie. Berlin:<br />
Springer.<br />
Deutsche Atemwegsliga (1996). Verzeichnis von Einrichtungen für die stationäre Rehabilitation<br />
im Kin<strong>des</strong>- <strong>und</strong> Erwachsenenalter.<br />
Deutsche Atemwegsliga (Wettengel, R. et al.)(1998). Empfehlungen zur Asthmatherapie<br />
bei Kindern <strong>und</strong> Erwachsenen. Pneumologie, 52, 591-602.<br />
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (1995). Empfehlungen zum strukturierten<br />
Patiententraining bei obstruktiven Atemwegserkrankungen. Pneumologie, 49,<br />
455-460.<br />
Deutsche Gesellschaft für Pneumologie - Sektion Pneumologische Prävention <strong>und</strong><br />
Rehabilitation (1997). Die stationäre pneumologische Rehabilitation für Erwachsene:<br />
Zielsetzung - diagnostische <strong>und</strong> therapeutische Standards - Forschungsbedarf.<br />
Pneumologie, 51, 523-532.<br />
Eichhorst, W. (2003). Benchmarking Deutschland – Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong><br />
Beruf. Projektkurs „Europäische Arbeitsmarkt- <strong>und</strong> Sozialpolitik. Bertelsmann<br />
Stiftung.<br />
Fischer, J. (1995). Krankheiten der Atmungsorgane. In VDR (Hrsg.), Sozialmedizinische<br />
Begutachtung in der gesetzlichen Rentenversicherung (217-256). Stuttgart:<br />
Fischer.<br />
Fischer, J. (2001). Pneumologische Rehabilitation – was ist international akzeptiert?<br />
42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. 21.-24.3.2001,<br />
Jena.<br />
175
Flörkemeier, V. (2000). Berufliche Rehabilitation bei chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankungen.<br />
In W. Petro (Hrsg.). Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
(691-697). Berlin: Springer.<br />
Fraisse, E. & Karoff, M. (1997). Verbesserung <strong>des</strong> Überganges zwischen medizinischer<br />
<strong>und</strong> beruflicher Rehabilitation. Rehabilitation, 36, 233-237.<br />
Ger<strong>des</strong>, N. & Weis, J. (2000). Zur Theorie der Rehabilitation. In J. Bengel & U. Koch<br />
(Hrsg.), Gr<strong>und</strong>lagen der Rehabilitationswissenschaften (41-68). Berlin: Springer.<br />
Ger<strong>des</strong>, N., Bengel, J. & Jäckel, W.H. (2000). Zielorientierung in Diagnostik, Therapie<br />
<strong>und</strong> Ergebnismessung. In J. Bengel & U. Koch (Hrsg.), Gr<strong>und</strong>lagen der Rehabilitationswissenschaften<br />
(3-12). Berlin: Springer.<br />
Gillissen, A. (2000). Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Bremen: Uni-Med.<br />
GINA (1995). Global strategy for Asthma Management and Prevention, NHLB/WHO<br />
Workshop Report (National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood<br />
Institute, Publication No. 95-3659). Bethesda: US Departement of Health and<br />
Human Services.<br />
Göbel, J. (1999). Case-Management zur Erhaltung von Arbeitsverhältnissen Behinderter<br />
– Ein Modellversuch <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>arbeitsamts Bayern. Rehabilitation, 38,<br />
209-219.<br />
Grobe, T. & Schwartz, F.W. (2003). Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. In Robert-Koch-<br />
Institut (Hrsg.). Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung <strong>des</strong> B<strong>und</strong>es, Heft 13. Wiesbaden:<br />
Robert-Koch-Institut.<br />
Grootendorst, D.C., Dahlén, S.-E., van den Bos, J.W., Duiverman, E.J., Veselic-<br />
Charvat, M., Vrijlandt, E.J.L.E., O’Sullivan, S., Kumlin, M., Sterk, P.J. & Roldaan,<br />
A.C. (2000). Benefits of high altitude allergen avoidance in atopic adolescents<br />
with moderate to severe asthma, over an above treatment with high dose<br />
inhaled steroids. Clinical and Experimental Allergy, 31, 400-408.<br />
Haerlin, C., Meier, A., Schwendy, A., Weber & Wörl, H.G. (1985). Das Berufliche<br />
Trainingszentrum Rhein-Neckar als Modell einer spezifischen Einrichtung für<br />
psychisch Behinderte. In Stiftung Rehabilitation (Hrsg.). Modellvorhaben zur<br />
Weiterentwicklung der beruflich-sozialen Rehabilitation psychisch Behinderter.<br />
Heidelberg: Stiftung Rehabilitation.<br />
Heinzen-Lasere, H. (1998). Verzahnung medizinischer <strong>und</strong> beruflicher Rehabilitation.<br />
Praxis Klinische Verhaltensmedizin <strong>und</strong> Rehabilitation, 41, 35-37.<br />
Holzinger, A., Kaspar, P. & Petro, W. (1994). Langzeiteffekte pneumologischer Rehabilitationsverfahren<br />
bei Patienten mit chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen<br />
(COPD). Pneumologie, 48, 662.<br />
Huth, P. (2002). Mehr Lebensqualität dank Altersteilzeit. Neue Züricher Zeitung,<br />
2002-07-18, Nr. 164, 21.<br />
176
Kaiser U. (1994). Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen der Rehabilitation chronischer Atemwegserkrankungen.<br />
Frankfurt: VAS.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1994). Qualitätssicherung in der stationären Rehabilitation.<br />
Erste Erfahrungen mit einem neuentwickelten Instrument. Atemw.-Lungenkrkh.<br />
Jahrgang 20, 2. Suppl.-Heft, 190-202.<br />
Kaiser, U., Lütke Fremann, H. & Schmitz, M. (1995). Atemwegserkrankungen. In F.<br />
Petermann (Hrsg.), Verhaltensmedizin in der Rehabilitation (165-190). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Kaiser, U., & Schmitz, M. (1995). Die Beurteilung einer stationären pneumologischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme auf der Basis von Patientenangaben. Atemw.- u.<br />
Lungenkrankheiten, 21, 8, 400-402.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1996a). Das Davoser Prozessmodell der Patientenschulung<br />
für Erwachsene mit chronischen Atemwegserkrankungen. Hintergründe,<br />
Umsetzung, Evaluation. In VDR (Hrsg.), Evaluation in der Rehabilitation. (206-<br />
208). DRV-Schriften, Band 6. Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1996b). Ein integratives Modell zur internen Qualitätssicherung<br />
(QS) in einer Rehabilitationsklinik am Beispiel der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang.<br />
Entwicklung, Implementierung, Ergebnisse. In VDR (Hrsg.), Evaluation<br />
in der Rehabilitation (80-81). DRV-Schriften, Band 6. Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U., Muthny, F.A. & Schmitz, M. (1997). Psychosoziale Aspekte bei chronischen<br />
Atemwegserkrankungen (COPD). Relevanz <strong>und</strong> Konsequenzen für die<br />
pneumologische Rehabilitation. Pneumologie, 51, 120-128.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1998a). Ambulante Rehabilitationsangebote bei chronischen<br />
Atemwegserkrankungen: Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Konsequenzen aus<br />
der Davoser-Reha-Studie (166-186). In M. Schmidt-Ohlemann, Ch. Zippel, W.<br />
Blumenthal & H.J. Fichtner (Hrsg.), Ambulante wohnortnahe Rehabilitation –<br />
Konzepte für Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft. DVfR-Reihe: Interdisziplinäre Schriften<br />
zur Rehabilitation, Band 7. Ulm: Universitätsverlag.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1998b): Die Verzahnung stationärer <strong>und</strong> ambulanter pneumologischer<br />
Rehabilitationsangebote: Bewertung der Ergebnisse <strong>und</strong> Kooperation<br />
aus der Sicht <strong>des</strong> Arztes. In VDR (Hrsg.), Interdisziplinarität <strong>und</strong> Vernetzung.<br />
DRV-Schriften Band 11. VDR, Frankfurt, 67-69.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1998c). In-Patient Pulmonary Rehabilitation – Methods and<br />
Results. In VDR, (Hrsg.), 6 th European Congress on Research in Rehabilitation.<br />
Improving Practice by Research. DRV-Schriften Band 10. VDR, Frankfurt, 418-<br />
420.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999a). Gefährdungspotentiale zur beruflichen Ausgrenzung<br />
von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen. In VDR, (Hrsg.),<br />
Reha-Bedarf, Effektivität, Ökonomie. DRV-Schriften Band 12. VDR, Frankfurt, 94-<br />
95.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999b). Zielgruppenspezifische Angebote in der pneumologischen<br />
Rehabilitation: ‚Sommercamp für junge Erwachsene‘ der Hochgebirgs-<br />
177
klinik Davos-Wolfgang. In VDR, (Hrsg.), Reha-Bedarf, Effektivität, Ökonomie.<br />
DRV-Schriften Band 12. VDR, Frankfurt, 333-334.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (1999c). Sport- <strong>und</strong> Bewegungstherapie im pneumologischen<br />
Rehabilitationsprozess. In VDR, (Hrsg.), Reha-Bedarf, Effektivität, Ökonomie.<br />
DRV-Schriften Band 12. VDR, Frankfurt, 338-339.<br />
Kaiser, U. (2000). Rehabilitationsforschung (67). In N. Konietzko & H. Fabel (Hrsg.),<br />
Weißbuch Lunge 2000. Defizite, Zukunftsperspektiven, Forschungsansätze: Zur<br />
Lage der Pneumologie in Deutschland. Stuttgart: Thieme.<br />
Kaiser U. & Schmitz, M. (2000a). Die Relevanz einer stärkeren Berücksichtigung beruflicher<br />
Aspekte in der pneumologischen Rehabilitation. Pneumologie, 54, 13.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (2000b). Berufliche Orientierung in der stationären pneumologischen<br />
Rehabilitation. In Bengel J. & Jäckel, W.H. (Hrgs.). Zielorientierung<br />
in der Rehabilitation – Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverb<strong>und</strong><br />
Freiburg/Bad Säckingen (141-150). Regensburg: Roderer.<br />
Kaiser, U. & Schmitz, M. (2000c). Effektivität <strong>und</strong> Effizienz einer pneumologischen<br />
Rehabilitationsmaßnahme aus unterschiedlicher Perspektive. DRV-Schriften<br />
Band 20, VDR, Frankfurt, 356-359.<br />
Kaiser, U., Lippitsch, S. & Schmitz, M. (2000a). In-Patient Pulmonary Rehabilitation.<br />
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 161, 3, 495.<br />
Kaiser, U., Petri, E, Pleyer, K. Bleuel, P., Bizer, C. & Lippitsch, S. (2000b). Berufliche<br />
Orientierung in der pneumologischen Rehabilitation. Abschlußbericht der Projektgruppe.<br />
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang (unveröffentlicht).<br />
Kaiser, U. & Lippitsch, S. (2001). Rehabilitationsforschung als Instrument zur Qualitätsverbesserung<br />
in der Rehabilitation: die Integration eines interdisziplinären<br />
Modells zur beruflichen Orientierung in der pneumologischen Rehabilitation.<br />
DRV, 26, 68-71.<br />
Kaiser U., Mühlig, S, Schwiersch, M. & Wittmann, M. (2001). Positionspapier zur<br />
Gründung einer Arbeitsgruppe Rehabilitationsforschung in der pneumologischen<br />
Rehabilitation. Klinische Verhaltensmedizin <strong>und</strong> Rehabilitation, 54, 168-<br />
170.<br />
Kaiser, U. (2001). Rehabilitationsverb<strong>und</strong>forschung in Deutschland: die Brücke zwischen<br />
Forschung <strong>und</strong> Praxis. Sonderheft 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft<br />
für Pneumologie. Berlin: BVG<br />
Kaiser U. (2002a). Berufliche Orientierung in der pneumologischen Rehabilitation –<br />
ein interdisziplinäres Behandlungsmodell in der Rehabilitation von Patienten mit<br />
chronischen Atemwegserkrankungen. In Neuderth, S. & Vogel, H., B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft<br />
für Rehabilitation (Hrsg.). Berufsbezogene Maßnahmen in<br />
der medizinischen Rehabilitation – bisherige Entwicklungen <strong>und</strong> Perspektiven<br />
(135-146). Frankfurt: BAR.<br />
178
Kaiser, U. (2002b). Krankheitsbelastungen, Krankheitsverarbeitung <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
bei chronischen Atemwegserkrankungen. DRV-Schriften, Band 33, 281-<br />
286. Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U., Jung, V. & Kresse, S. (2003). Der Stellenwert der Raucherentwöhnung in<br />
der stationären pneumologischen Rehabilitation. DRV-Schriften, Band 40, 444-<br />
446. Frankfurt: VDR.<br />
Kaiser, U. (2003). Disease-Management-Programm Asthma bronchiale – Königsweg<br />
oder Alibi: Chancen <strong>und</strong> Risiken im Kontext der stationären pneumologischen<br />
Rehabilitation. DRV-Schriften, Band 40, 437-439. Frankfurt: VDR.<br />
Karoff, M. (1999). Modelle der Integration beruflicher <strong>und</strong> kardiologischer Rehabilitation.<br />
Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation, 11, (3), 97-101.<br />
Kinsman, R., Spector, S., Shucard, D. & Luparello, T. (1974). Observation on pattern<br />
of subjective symptomatology of acute asthma. Psychosom Med, 36, 129-143.<br />
Kistler, E. & Hilpert, M. (2001). Auswirkungen <strong>des</strong> demographischen Wandels auf<br />
Arbeit <strong>und</strong> Arbeitslosigkeit. Aus Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte, B 3-4, 5-13.<br />
Klemperer, D. (2003). Arzt-Patienten-Beziehung. Entscheidung über Therapie muss<br />
gemeinsam getroffen werden. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, 12, A753-A755.<br />
Koch, U., Bürger, W., Schulz, H., Glier, B. & Rodewig, K. (1997). Berufsbezogene<br />
Behandlungsangebote in der psychosomatischen Rehabilitation: Bedarf <strong>und</strong><br />
Konzeption. DRV-Schriften, 9-10/97, 548-574.<br />
Konietzko, N. & Fabel, H. (1996). Lungenkrankheiten in Deutschland. Pneumologie,<br />
Sonderheft II/96, 50, 574-577.<br />
Konietzko, N. & Fabel, H. (2000) (Hrsg.), Weißbuch Lunge 2000. Defizite, Zukunftsperspektiven,<br />
Forschungsansätze: Zur Lage der Pneumologie in Deutschland.<br />
Stuttgart: Thieme.<br />
Korsukéwitz, C. (2002). Kooperationen mit Berufsförderungswerken. In S. Neuderth<br />
& H. Vogel, (2000). Berufsbezogene Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation<br />
– bisherige Entwicklungen <strong>und</strong> aktuelle Perspektiven. Tagungsband <strong>des</strong><br />
RFB Bayern zur Expertentagung am 25./26. Januar 2000 in Würzburg (67-70).<br />
Frankfurt: BAR.<br />
Krämer, K. (2002). Lebensarbeitszeitgestaltung in der Altenpflege – Handlungsleitfaden<br />
für eine alternsgerechte Personalentwicklung. Informationen <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
aus einem Beratungsprojekt: Öffentlichkeits- <strong>und</strong> Marketingstrategie demographischer<br />
Wandel. Broschürenreihe: Demographie <strong>und</strong> Erwerbsarbeit. Stuttgart:<br />
o.V.<br />
Lacasse, Y., Wong, E., Guyatt, G.H., King, D., Cook, D.J. & Goldstein, R.S. (1996).<br />
Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease.<br />
Lancet, 348, 1115-1119.<br />
Lauber, B. (1996). Sozialmedizinische Daten zu chronisch obstruktiven Atem wegserkrankungen<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Atemwegs- <strong>und</strong> Lungen-<br />
179
krankheiten, 22, 1, 63-72.<br />
Leidig, S. & Zielke, M. (2000) (Hrsg.). Arbeitsplatzbezogene Psychosomatik. Praxis<br />
Klinische Verhaltensmedizin <strong>und</strong> Rehabilitation, 13, 50.<br />
Linha, M. (1995). Jugendliche Asthmatiker in der Berufswahl. Eine empirische Untersuchung<br />
bei jugendlichen Patienten der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang.<br />
Nürnberg: Diplomarbeit Universität Nürnberg-Erlangen.<br />
Linha, M., Kaiser, U. & Schmitz, M. (1996). Aspekte der Berufswahl jugendlicher<br />
Asthmatiker. Zentrale Ergebnisse einer Studie bei jugendlichen Patienten der<br />
Hochgebirgsklinik Davos Wolfgang. Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation, 8, 2, 53-58.<br />
Martin, E., Ackermann, U., Udris, I. & Oegerli, K. (1980). Monotonie in der Industrie –<br />
eine ergonomische, psychologische <strong>und</strong> medizinische Studie an Uhrenarbeitern.<br />
Schriften zur Arbeitspsychologie Nr. 29. Huber: Bern.<br />
Matthesius, R.-G., Jochheim, K.-A., Barolin, G.S. & Heinz, Chr. (Hrsg.). (1995).<br />
ICIDH - International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps.<br />
Mosby: Ullstein.<br />
Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (1997). Begutachtungsanleitung<br />
„Arbeitsunfähigkeit“. Essen: DZS.<br />
Menz, G. (2000). Pneumologische Prävention in der Klinik. In W. Petro (Hrsg.),<br />
Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation. Ziele, Methoden, Ergebnisse<br />
(32-38). Berlin: Springer.<br />
Menz, G. (2001). Evidenzbasierte Effekte der Allergen- <strong>und</strong> Schadstoffkarenz im<br />
Hochgebirge. Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang. (unveröffentlicht).<br />
Menz, G., Buhl, R., Gillissen, A. , Kardos, P., Matthys, H., Pfister, R., Russi, E.W.,<br />
Simon, H.U., Vogelmeier, Wettengel, R., Worth, H. & Rabe, K.F. (2002).<br />
Schwieriges Asthma: Klinische Phänotypen <strong>und</strong> Prinzipien der Therapie.<br />
Pneumologie, 56, 132-137.<br />
Menz, G. (2002). Diagnostik <strong>und</strong> Differenzialdiagnose <strong>des</strong> Asthma bronchiale – aktueller<br />
Stand. Allergo Journal, 11, 182-188.<br />
Morschhäuser, M. (1999). Alternsgerechte Arbeit: Gestaltungsaufgabe für die Zukunft<br />
oder Kampf gegen Windmühlen? In J. Behrens et al. Länger erwerbstätig<br />
– aber wie? (19-70). Opladen: Westdeutscher.<br />
Muthny, F.A. (1989). Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV-Manual).<br />
Weinheim: Beltz.<br />
Muthny, F.A. (1990). Persönliche Ursachen für die Erkrankung (PUK) <strong>und</strong> erkrankungsbezogene<br />
Kontrollattributionen (EKOA). Weinheim: Beltz.<br />
Muthny, F.A. (1991). Lebenszufriedenheit bei koronarer Herzkrankheit: ein empirischer<br />
Vergleich mit anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen. In H.M. Bullinger,<br />
M. Ludwig & N. von Steinbüchel (Hrsg.), Lebensqualität bei kardiovaskulären<br />
Erkrankungen (196-210). Göttingen: Hogrefe.<br />
180
Naegele, G. (1992). Zwischen Arbeit <strong>und</strong> Rente. Gesellschaftliche Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
älterer Arbeitnehmer. Augsburg: o.V.<br />
Naegele, G. (2001). Demographischer Wandel <strong>und</strong> „Erwerbsarbeit“. Aus Politik <strong>und</strong><br />
Zeitgeschichte, B 3-4, 3-4.<br />
Naegele, G. & Frerichs, F. (2001). Anhebung der Altersgrenzen <strong>und</strong> Herausforderung<br />
an die Arbeitsmarktpolitik (56). In C. Barkholdt (Hrsg.). Prekärer Übergang<br />
in den Ruhestand. Handlungsbedarf aus arbeitsmarktpolitischer, rentenrechtlicher<br />
<strong>und</strong> betrieblicher Perspektive. Opladen: Westdeutscher.<br />
Neuderth, S. & Vogel, H. (2000). Berufsbezogene Maßnahmen in der medizinischen<br />
Rehabilitation – bisherige Entwicklungen <strong>und</strong> aktuelle Perspektiven. Tagungsband<br />
<strong>des</strong> RFB Bayern zur Expertentagung am 25./26. Januar 2000 in Würzburg.<br />
Frankfurt: BAR.<br />
Niehaus, M. (1999). Erfolg von Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation. Freiburg:<br />
Lambertus.<br />
Nowak, D. (2000). Arbeitsmedizinische Beurteilung <strong>und</strong> Begutachtung. In W. Petro<br />
(Hrsg.). Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation (714-723). Berlin:<br />
Springer.<br />
Nowak, D. & v. Mutius, E. (2000). Epidemiologie der obstruktiven Atemwegserkrankungen,<br />
speziell <strong>des</strong> Asthma bronchiale. In W. Petro (Hrsg.). Pneumologische<br />
Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation (93-108). Berlin: Springer.<br />
Pack, J. et al. (2000). Zukunftsreport demographischer Wandel. Innovationsfähigkeit<br />
einer alternden Gesellschaft. Bonn: o.V.<br />
Pauwels, R.A., Buist, A.S. & Calverley, P.M.A. et al. (2001). Global strategy for the<br />
diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.<br />
Am J. Respir Crit Care Med, 163, 1256-1276.<br />
Petri, E. (2000). Anamnese. In W. Petro (Hrsg.). Pneumologische Prävention <strong>und</strong><br />
Rehabilitation. Ziele, Methoden, Ergebnisse (192-196). Berlin: Springer.<br />
Petri, E. & Haber, P. (2000). Sozialmedizinische Beurteilung <strong>und</strong> Begutachtung <strong>des</strong><br />
erwerbsbezogenen Leistungsvermögen bei Erwachsenen. In W. Petro (Hrsg.).<br />
Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation. Ziele, Methoden, Ergebnisse<br />
(698-708). Berlin: Springer.<br />
Petro, W. (Hrsg.). (2000). Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation. Ziele, Methoden,<br />
Ergebnisse. Berlin: Springer.<br />
Pleyer, K. & Schmitz, M. (1997). Ambulante Asthma-Sportgruppen unter die Lupe<br />
genommen. Krankengymnastik, 49, 2082-2086.<br />
Pleyer K. & Schmitz, M. (1998). Sport <strong>und</strong> Bewegung in der Asthmatherapie. Pneumologie<br />
52, 1, 41-43.<br />
Pleyer, K., Schmitz, M., Kaiser, U. & Schäfers, N. (1999). Auswirkungen von sporttherapeutischen<br />
Maßnahmen auf die Leistungsfähigkeit chronisch atemwegser-<br />
181
krankter junger Erwachsener innerhalb <strong>des</strong> Sommercamps an der Hochgebirgsklinik<br />
Davos-Wolfgang. Schweiz. Physikalische Medizin, 8, 152.<br />
Pleyer, K., Kaiser, U., Schäfers, N. & Schmitz, M. (2000). Auswirkungen von sporttherapeutischen<br />
Maßnahmen auf die Leistungsfähigkeit junger Erwachsener.<br />
Pneumologie, 54, 57.<br />
Prognosestudie „Stand <strong>und</strong> Entwicklung der Pneumologie in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland“ (unveröffentlicht).<br />
Radon, K. & Nowak, D. (2000). Karenzmaßnahmen in der Arbeitswelt. In W. Petro<br />
(Hrsg.). Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation (412-417). Berlin: Springer.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (2002). Gutachten<br />
2000/2001 – Bedarfsgerechtigkeit <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit. Band III: Über-,<br />
Unter- <strong>und</strong> Fehlversorgung. Ausgewählte Erkrankungen: ischämische Herzkrankheiten,<br />
Schlaganfall <strong>und</strong> chronische, obstruktive Lungenkrankheiten. Baden-Baden:<br />
Nomos.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (2002). Gutachten<br />
2000/2001 – Bedarfsgerechtigkeit <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit. Band III: Über-,<br />
Unter- <strong>und</strong> Fehlversorgung. Gr<strong>und</strong>lagen, Versorgung chronisch Kranker. Baden-Baden:<br />
Nomos.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ges<strong>und</strong>heitswesen (2003). Gutachten<br />
2003 – Nutzerorientierung <strong>und</strong> Qualität. Band II: Qualität <strong>und</strong> Versorgungsstrukturen.<br />
Baden-Baden: Nomos.<br />
Schäfers, N. (1998). Auswirkungen von sporttherapeutischen Maßnahmen auf die<br />
Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> Krankheitsbewältigung chronisch atemwegskranker junger<br />
Erwachsener innerhalb <strong>des</strong> Sommercamps an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang.<br />
Diplomarbeit an der Deutsche Sporthochschule Köln (unveröffentlicht).<br />
Schaub, E. (1995). Die berufliche Rehabilitation im Aufgabenbereich der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung. Deutsche Rentenversicherung, 1, 39-53.<br />
Schliehe, F & Haaf, H.G. (1996). Zur Effektivität <strong>und</strong> Effizienz der medizinischen Rehabilitation.<br />
Deutsche Rentenversicherung, 10-11, 666-689.<br />
Schliehe, F. & Röckelein, E. (2002). Berufsfördernde Maßnahmen aus der Sicht der<br />
gesetzlichen Rentenversicherung. In S. Neuderth & H. Vogel, (2000). Berufsbezogene<br />
Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation – bisherige Entwicklungen<br />
<strong>und</strong> aktuelle Perspektiven. Tagungsband <strong>des</strong> RFB Bayern zur Expertentagung<br />
am 25./26. Januar 2000 in Würzburg (17-24). Frankfurt: BAR.<br />
Schmitz, M. & Kaiser, U. (2000). Qualitätssicherung in der stationären pneumologischen<br />
Rehabilitation (757-726). In W. Petro (Hrsg.). Pneumologische Prävention<br />
<strong>und</strong> Rehabilitation. Berlin: Springer.<br />
Schultz, A., Meissner, E. & Fabel, H. (2000). Bronchopulmonale Erkrankungen unter<br />
besonderer Berücksichtigung der Einwirkungen am Arbeitsplatz. In W. Petro<br />
182
(Hrsg.). Pneumologische Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation (168-191). Berlin: Springer.<br />
Schultze-Werninghaus, M. & Debelic, G. (Hrsg.)(1988). Asthma. Gr<strong>und</strong>lagen, Diagnostik,<br />
Therapie. Berlin: Springer.<br />
Schuntermann, M.F. (1996). Die internationale Klassifikation der Impairments, Disabilities<br />
<strong>und</strong> Handicaps ICIDH - Ergebnisse <strong>und</strong> Probleme. Rehabilitation, 35, 6-<br />
13.<br />
Schuntermann, M.F. (2003). Gr<strong>und</strong>satzpapier der Rentenversicherung zur Internationalen<br />
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit (ICF)<br />
der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation (WHO). Deutsche Rentenversicherung, 1-2,<br />
52-59.<br />
Seyd, W., Nentwig, A. & Blumenthal, W. (Hrsg.)(1999). Zukunft der beruflichen Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> Integration in das Erwerbsleben. DVfR-Reihe: Interdisziplinäre<br />
Schriften zur Rehabilitation, Band 8. Ulm: Universitätsverlag.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2002). Statistisches Jahrbuch 2001. Wiesbaden: Statistisches<br />
B<strong>und</strong>esamt.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2003). Statistisches Jahrbuch 2002. Wiesbaden: Statistisches<br />
B<strong>und</strong>esamt.<br />
Trautner, C., Richter, B., Berger, M. (1993). Cost-Effectiveness of a Structured<br />
Treatment and Teaching Programme on Asthma. Eur Respir J, 6, 1485-1491.<br />
van den Boom, G., Rutten-van Mölken, M.P.M.H., Tirimanna, P.R.S., van Schayck,<br />
C.P., Folgering, H. & van Weel, C. (1998). Association between health-related<br />
quality of life and consultation for respiratory symptoms: results from the DIMCA<br />
programme. European Respiratory Journal; 11; 67-72.<br />
VDR (Hrsg.). (1991). Kommission zur Weiterentwicklung der Rehabilitation in der<br />
gesetzlichen Rentenversicherung. Abschlußberichte - Band III: Arbeitsbereich<br />
"Rehabilitationskonzepte" (Teilband 2). Frankfurt: VDR.<br />
VDR (Hrsg.). (1995). Sozialmedizinische Begutachtung in der gesetzlichen Rentenversicherung.<br />
Stuttgart: Fischer.<br />
VDR (1997). Abschlussbericht der Reha-Kommission-Berufsförderung <strong>des</strong> Verban<strong>des</strong><br />
Deutscher Rentenversicherungsträger. DRV-Schriften Band 7. Frankfurt:<br />
VDR.<br />
VDR (1999). Förderschwerpunkt „Rehabilitationswissenschaften“: Empfehlungen der<br />
Arbeitsgruppen „Generische Methoden“, „Routinedaten“ <strong>und</strong> „Reha-Ökonomie“.<br />
DRV-Schriften Band 16. Frankfurt: VDR.<br />
VDR (2000a). Das ärztliche Gutachten für die gesetzliche Rentenversicherung. Hinweise<br />
zur Begutachtung. DRV-Schriften Band 21. Frankfurt: VDR.<br />
183
VDR (Hrsg.)(2000b). Das Qualitätssicherungsprogramm der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
in der medizinischen Rehabilitation. Instrumente <strong>und</strong> Verfahren.<br />
DRV-Schriften, Band 18. Frankfurt: VDR.<br />
VDR (2000c). Rehabilitation <strong>des</strong> Jahres 1999, Statistiken <strong>des</strong> VDR Band 134.<br />
VDR (2000d). Rentenzugang <strong>des</strong> Jahres 1999, Statistiken <strong>des</strong> VDR Band 132.<br />
VDR (Hrsg.)(Schliehe, F., Schäfer, H., Buschmann-Steinhage, R. & Döll, S.) (2000e).<br />
Aktiv Ges<strong>und</strong>heit fördern. Ges<strong>und</strong>heitsbildungsprogramm der Rentenversicherung<br />
für die medizinische Rehabilitation. Stuttgart: Schattauer.<br />
VDR (2001). Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Anwendungsempfehlungen der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
zur ambulanten medizinischen Rehabilitation. (unveröffentlicht)<br />
Verhorst, H.G. (1996). Rückkehr zur Arbeit: Konzepte, Schwachstellen <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
der Verbesserung – Plenardiskussion mit einleitenden Statements - Evaluation<br />
in der Rehabilitation. 6. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium,<br />
Bad Säckingen. DRV-Schriften, Band 6, 295-297. Frankfurt: VDR.<br />
WHO (1980). International classification of impairments, disabilities and handicaps.<br />
Genf: World Health Organization.<br />
WHO (2001). International classification of functioning, disabilities and health. Genf:<br />
World Health Organization.<br />
Wettengel, R. & Volmer, T. (1994). Asthma: Medizinische <strong>und</strong> ökonomische Bedeutung<br />
einer Volkskrankheit. Stuttgart: Rupp.<br />
Weyer, G., Hodapp, V. & Neuhäuser, S. (1980). Weiterentwicklung von Fragebogenskalen<br />
zur Erfassung der subjektiven Belastung <strong>und</strong> Unzufriedenheit im beruflichen<br />
Bereich (SBUS-B). Psychologische Beiträge, 22, 335-355.<br />
Wittmann, W.W. (1985). Evaluationsforschung. Aufgaben, Probleme <strong>und</strong> Anwendungen.<br />
Berlin: Springer.<br />
Wittmann, W.W. (1995). Evaluation in der Rehabilitation: Methoden, Ergebnisse,<br />
Folgerungen für die Praxis. In K. Siek, F.-W. Pape, W. Blumenthal & M.<br />
Schmollinger (Hrsg.), Erfolgsbeurteilung in der Rehabilitation. Begründungen,<br />
Möglichkeiten, Erfahrungen. Arbeitstagung der Deutschen Vereinigung für die<br />
Rehabilitation. Interdisziplinäre Schriften zur Rehabilitation, Band 3 (77-88).<br />
Ulm: Universitätsverlag.<br />
Wittwer, U. (1997). Zukunft der beruflichen Rehabilitation - Berufliche Rehabilitation<br />
für die Zukunft. Eine Auseinandersetzung mit den Sparmassnahmen der B<strong>und</strong>esregierung.<br />
Rehabilitation, 36, 22-25.<br />
Worth H., Meyer, A., Folgering, H., Kirsten, D., Lecheler, J., Magnussen, H., Pleyer,<br />
K., Schmidt, S., Schmitz, M., Taube, K. & Wettengel, R. (2000). Empfehlungen<br />
der Deutschen Atemwegsliga zum Sport <strong>und</strong> körperlichen Training bei Patienten<br />
mit obstruktiven Atemwegserkrankungen. Pneumologie, 54, 61-77.<br />
184
Worth, H. et al. (2002). Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga <strong>und</strong> der Deutschen<br />
Gesellschaft für Pneumologie zur Diagnostik <strong>und</strong> Therapie von Patienten mit<br />
chronisch obstruktiver Bronchitis <strong>und</strong> Lungenemphysem (COPD). Pneumologie,<br />
56, 704-738.<br />
185
10. Anhang<br />
Tabellen<br />
Tabelle A1: Soziodemographische/sozioökonomische Merkmale (t2)<br />
Familienstand N %<br />
Ledig 51 9,3<br />
feste(r) Fre<strong>und</strong>(in) 51 9,3<br />
Geschieden 33 6,0<br />
Verheiratet 378 68,9<br />
Verwitwet 27 4,9<br />
Verlobt 2 ,4<br />
getrennt lebend 7 1,3<br />
Schulabschluss N %<br />
Haupt-/Volksschule ohne Abschluss 18 3,6<br />
Haupt-/Volksschule mit Abschluss 160 32,4<br />
Realschule/ Mittlere Reife 125 25,3<br />
Polytechnische Oberschule 8 1,6<br />
Fachhochschulreife 45 9,1<br />
Abitur/allgemeine Hochschulreife 129 26,1<br />
anderen Schulabschluss 9 1,8<br />
Konfession N %<br />
protestantisch 180 36,4<br />
katholisch 213 43,0<br />
sonstige Konfession 10 2,0<br />
konfessionslos 92 18,6<br />
Kinderanzahl N %<br />
Keine Kinder 145 29,3<br />
1 Kind 95 19,2<br />
2 Kinder 173 34,9<br />
3 Kinder 56 11,3<br />
4 Kinder 15 3,0<br />
5 Kinder 8 1,6<br />
6 Kinder 1 ,2<br />
9 Kinder 2 ,4<br />
Krankenkasse N %<br />
AOK 84 16,9<br />
Ersatzkasse 220 44,3<br />
Betriebskrankenkasse 44 8,9<br />
Innungskrankenkasse 9 1,8<br />
ausschließlich privat 59 11,9<br />
gesetzliche Krankenversicherung <strong>und</strong> private Zusatzvers. 19 3,8<br />
Beihilfe 52 10,5<br />
Sonstiges 10 2,0<br />
Rentenversicherung N %<br />
LVA 71 15,3<br />
BfA 295 63,6<br />
Bahnversicherung 1 ,2<br />
B<strong>und</strong>essknappschaft 2 ,4<br />
Seekasse 1 ,2<br />
Sonstiges 21 4,5<br />
weiß nicht 13 2,8<br />
nicht rentenversichert 60 12,9<br />
186
Fortsetzung Tabelle 1:<br />
Eigenes Nettoeinkommen N %<br />
bis 800,- DM 28 7,0<br />
801 - 1500,- DM 68 17,0<br />
1501 - 2500,- DM 83 20,8<br />
2501 - 3500,- DM 79 19,8<br />
über 3500,- DM 142 35,5<br />
Nettoeinkommen Haushalt N %<br />
bis 1000,- DM 5 1,3<br />
1001 - 2000,- DM 24 6,1<br />
2001 - 3000,- DM 40 10,2<br />
3001 - 4000,- DM 74 18,9<br />
4001 - 5000,- DM 81 20,7<br />
5001 - 6000,- DM 71 18,2<br />
6001 - 7000,- DM 42 10,7<br />
über 7000,- DM 54 13,8<br />
Zahl der Personen im Haushalt N %<br />
1 Person 72 17,6<br />
2 Personen 199 48,5<br />
3 Personen 79 19,3<br />
4 Personen 46 11,2<br />
5 Personen 10 2,4<br />
6 Personen 1 ,2<br />
7 Personen 1 ,2<br />
9 Personen 2 ,5<br />
Zahl der Personen über 18 Jahre im Haushalt N %<br />
1 Person 48 17,2<br />
2 Personen 166 59,5<br />
3 Personen 50 17,9<br />
4 Personen 10 3,6<br />
5 Personen 4 1,4<br />
9 Personen 1 ,4<br />
Größe <strong>des</strong> Wohnortes N %<br />
Dorf 142 28,6<br />
Kleinstadt 111 22,3<br />
mittlere Stadt 105 21,1<br />
Großstadt 139 28,0<br />
187
Tabelle A2: Berufliche Belastungen (Bellach et al. (1998)<br />
1=gar nicht – 5 sehr stark N MW SD<br />
Überst<strong>und</strong>en 357 2,26 1,37<br />
Wechselschicht 301 1,29 ,83<br />
Wechselschicht mit Nachtarbeit 295 1,37 1,03<br />
Akkord 293 1,30 ,96<br />
Lärm 365 2,28 1,30<br />
Gase 357 2,47 1,68<br />
Schadstoffpartikel 348 2,26 1,55<br />
Allergene 353 2,43 1,53<br />
Hitze, Kälte, Nässe 361 2,56 1,45<br />
Bildschirm 350 2,12 1,30<br />
schwere Arbeit 362 2,42 1,54<br />
einseitige Belastung 360 2,70 1,35<br />
Tempo 368 3,10 1,37<br />
Tempo durch Maschinen 334 1,43 1,04<br />
Konzentration 356 3,12 1,25<br />
widersprüchliche Anforderungen 351 2,53 1,36<br />
Langeweile 345 1,56 ,92<br />
Störungen 354 2,46 1,31<br />
schnelle Entscheidungen 355 2,52 1,29<br />
Hohe Verantwortung für andere 360 2,77 1,44<br />
Tabelle A3: Gründe für Frühberentung/Antrag <strong>und</strong> Erleben<br />
1=gar nicht – 5=sehr stark N MW SD<br />
Gründe für die Frühberentung:<br />
verminderte Leistungsfähigkeit 121 4,16 1,28<br />
Angst vor Verschlimmerung 103 3,35 1,44<br />
Schwierigkeiten bei Arbeit 95 1,63 1,19<br />
Partner/Familie 98 2,31 1,42<br />
Hausarzt 101 3,14 1,52<br />
Arbeitgeber 100 2,20 1,50<br />
Kollege 99 1,51 ,91<br />
geringere finanzielle Einbuße 97 1,73 1,07<br />
mein Alter 106 2,11 1,21<br />
körperliches Befinden 116 4,14 1,22<br />
Arbeitsplatz fehlt 103 1,72 1,31<br />
mehr vom Leben haben wollen 107 2,40 1,32<br />
Erleben der Frühberentung:<br />
vermisse Tagesablauf 166 1,75 1,00<br />
wieder Arbeit haben 166 1,74 1,07<br />
Kontakt zu Kollegen 165 1,97 1,06<br />
Weiß nicht, was mit Zeit anfangen 165 1,26 ,60<br />
Tag einteilen können 172 3,95 1,08<br />
Dingen widmen können 171 3,71 1,03<br />
nutzlos 167 1,35 ,74<br />
entlastet 169 3,67 1,08<br />
188
Tabelle A4: Ausprägung der Items <strong>des</strong> BSI<br />
Items BSI<br />
T1 T2<br />
1=gar nicht – 5=sehr stark<br />
Items der Subskala Angst<br />
N MW SD N MW SD<br />
Nervosität 289 2,53 1,13 501 2,50 1,03<br />
Erschrecken 289 1,61 ,93 496 1,75 ,89<br />
Furchtsamkeit 289 1,63 ,83 494 1,73 ,84<br />
Gespannt 290 2,49 ,99 495 2,47 ,89<br />
Panikanfälle 288 1,43 ,77 498 1,57 ,85<br />
Ruhelosigkeit 288<br />
Items der Subskala Depression<br />
2,00 1,08 497 2,14 1,05<br />
Suizidal 288 1,22 ,60 497 1,30 ,69<br />
Einsamkeit 289 1,66 ,87 497 1,77 1,02<br />
Schwermut 290 1,60 ,87 495 1,75 ,94<br />
Interessenlos 292 1,50 ,85 493 1,73 ,90<br />
Hoffnungslosigkeit 290 1,65 ,97 498 1,85 1,05<br />
Wertlos 291 1,51 ,92 497 1,68 ,99<br />
189
Tabelle A5: Asthma-Symptom-Liste (ASL)<br />
Items ASL<br />
T1 T2<br />
1=nie – 5=immer N MW SD N MW SD<br />
Schwindelig 279 2,02 1,05 493 2,15 1,05<br />
Träge 274 2,56 1,21 487 2,79 1,07<br />
Ärgerlich 280 2,42 1,10 483 2,66 1,07<br />
Erschwerte Atmung 287 4,31 ,81 487 3,65 1,06<br />
Angst, alleine gelassen zu werden 280 2,15 1,23 492 2,02 1,11<br />
Müde 287 3,12 1,18 487 3,27 1,04<br />
Jucken 280 1,92 1,17 490 2,15 1,16<br />
Gereizt 282 2,60 1,11 489 2,71 1,00<br />
Engegefühl in der Brust 286 3,62 1,14 490 3,14 1,21<br />
Entsetzt, erschrocken 280 1,93 ,97 488 1,98 ,95<br />
Tausend Stecknadeln 280 1,46 ,88 490 1,61 ,95<br />
Beunruhigt 283 2,76 1,10 493 2,60 1,00<br />
Bedrückt 282 2,68 1,15 491 2,66 1,05<br />
Kratzbürstig 277 2,02 1,08 487 2,25 1,06<br />
Sich verlassen fühlen 279 1,85 1,03 490 1,91 ,99<br />
Kribbeln <strong>und</strong> Prickeln 280 1,73 1,08 487 1,82 ,99<br />
Druck auf der Brust 283 3,19 1,27 493 2,84 1,20<br />
Hilflos 280 2,12 1,17 491 1,88 ,95<br />
Ängstlich, nervös 279 2,44 1,18 490 2,33 1,06<br />
Stau in der Brust 279 2,76 1,37 486 2,56 1,24<br />
Ungehalten 283 2,10 1,07 492 2,28 1,00<br />
Wütend 282 1,93 1,06 492 2,10 1,01<br />
Abgespannt 285 3,12 1,20 495 3,27 ,94<br />
Schlecht gelaunt 282 2,41 1,04 491 2,51 ,88<br />
Nach Luft ringend 289 3,54 1,05 493 3,03 1,18<br />
Aufbrausend 280 2,06 1,01 489 2,20 ,99<br />
Lahm 279 2,28 1,19 480 2,52 1,08<br />
Atemgeräusche 289 3,98 1,00 496 3,38 1,11<br />
Kopfschmerz 282 2,55 1,15 492 2,61 1,11<br />
Erschöpft 282 3,24 1,12 491 3,16 1,02<br />
Erstickungsgefühl 283 2,87 1,17 491 2,33 1,20<br />
Schläfrig 282 2,71 1,19 493 2,99 1,07<br />
Unglücklich 280 2,27 1,17 492 2,36 1,07<br />
Zornig 283 1,84 ,98 492 2,05 ,99<br />
190
Tabelle A6: Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV)<br />
Items FKV<br />
T1 T2<br />
1=gar nicht – 5=sehr stark N MW SD N MW SD<br />
Info über Erkrankung <strong>und</strong> Behandlung suchen 533 3,27 1,23 491 2,93 1,32<br />
Nicht-wahr-haben-wollen <strong>des</strong> Geschehens 523 2,23 1,23 492 2,07 1,13<br />
Herunterspielen der Bedeutung <strong>und</strong> Tragweite 525 2,46 1,22 496 2,29 1,13<br />
Wunschdenken <strong>und</strong> Tagträumen nachhängen 529 2,14 1,13 493 2,06 1,03<br />
Sich selbst die Schuld geben 533 1,81 1,05 492 1,64 ,90<br />
Andere verantwortlich machen 530 1,47 ,87 493 1,37 ,69<br />
Aktive Anstrengungen zur Problemlösung 526 3,39 1,16 494 3,24 1,16<br />
Einen Plan machen <strong>und</strong> danach handeln 526 2,82 1,26 493 2,90 1,19<br />
Ungeduldig <strong>und</strong> gereizt auf andere reagieren 532 2,39 1,10 492 2,26 1,01<br />
Gefühle auch nach außen zeigen 533 2,47 1,01 492 2,45 1,00<br />
Gefühle unterdrücken, Selbstbeherrschung 530 3,04 1,14 492 3,06 1,16<br />
Stimmungsverbesserung durch Alkohol/Psychopharmaka 533 1,32 ,68 493 1,33 ,71<br />
Sich mehr gönnen 532 2,56 1,10 495 2,68 1,06<br />
Sich vornehmen, intensiver zu leben 529 3,28 1,17 493 3,26 1,12<br />
Entschlossen gegen die Krankheit ankämpfen 529 3,75 1,06 495 3,56 1,10<br />
Sich selbst bemitleiden 531 1,56 ,81 494 1,50 ,75<br />
Sich selbst Mut machen 534 3,52 1,02 493 3,43 1,10<br />
Erfolge <strong>und</strong> Selbstbestätigung suchen 529 3,22 1,11 491 3,20 1,12<br />
Sich ablenken versuchen 531 3,21 1,13 494 3,07 1,13<br />
Abstand gewinnen versuchen 525 2,89 1,10 491 2,87 1,11<br />
Die Krankheit als Schicksal annehmen 528 2,57 1,27 492 2,63 1,25<br />
Ins Grübeln kommen 528 2,31 1,14 493 2,19 1,11<br />
Trost im religiösen Glauben suchen 533 2,08 1,24 495 2,13 1,23<br />
Versuch, in der Krankheit einen Sinn zu sehen 528 1,94 1,15 495 1,97 1,10<br />
Trost, dass es andere noch schlimmer getroffen hat 520 3,03 1,28 497 2,87 1,33<br />
Mit dem Schicksal hadern 524 1,77 ,98 492 1,69 ,89<br />
Genau den ärztlichen Rat befolgen 534 4,10 ,77 494 4,08 ,83<br />
Vertrauen in die Ärzte setzen 530 3,85 ,89 489 3,77 ,88<br />
Den Ärzten misstrauen, die Diagnose überprüfen lassen 530 1,82 1,01 491 1,80 ,95<br />
Anderen Gutes tun wollen 532 3,36 1,06 488 3,26 1,01<br />
Galgenhumor entwickeln 531 2,61 1,24 493 2,56 1,19<br />
Hilfe anderer in Anspruch nehmen 530 2,30 ,93 492 2,23 ,85<br />
Sich gerne umsorgen lassen 530 2,28 1,04 491 2,23 ,94<br />
Sich von anderen Menschen zurückziehen 531 2,11 1,16 494 2,13 1,11<br />
Sich auf frühere Schicksalsschläge besinnen 522 1,97 1,12 492 2,18 1,09<br />
191
Tabelle A7: Aspekte der Lebensqualität (LZI)<br />
Items LZI<br />
T1 T2<br />
1=sehr zufrieden – 5=sehr unzufrieden N MW SD N MW SD<br />
Ges<strong>und</strong>heit 528 3,29 1,09 479 2,94 1,13<br />
Bisheriger Behandlungserfolg 525 2,63 1,03 474 2,47 ,96<br />
<strong>Körperliche</strong> Verfassung 530 3,03 1,07 483 2,95 1,08<br />
Geistige Verfassung 530 2,15 ,92 478 2,08 ,97<br />
Stimmung 531 2,47 ,95 480 2,51 ,99<br />
Aussehen 532 2,53 ,94 483 2,57 ,93<br />
Fähigkeiten 529 2,30 ,80 478 2,32 ,80<br />
Charakter 519 2,07 ,72 474 2,11 ,75<br />
Berufliche Situation 486 2,50 1,13 438 2,47 1,04<br />
Finanzielle Lage 528 2,30 ,98 479 2,42 1,01<br />
Ehe <strong>und</strong> Partnerschaft 489 2,01 1,14 470 2,06 1,13<br />
Sexualleben 487 2,56 1,09 462 2,66 1,09<br />
Freizeitgestaltung 528 2,45 ,96 471 2,45 ,93<br />
Familienleben 512 2,00 1,01 466 2,77 1,04<br />
Verhältnis zu eigenen Kindern 447 1,90 ,98 478 1,96 ,92<br />
Sozialkontakte (Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Bekannte) 530 2,10 ,90 417 2,23 ,91<br />
Lebenszufriedenheit Insgesamt 531 2,22 ,85 477 2,21 .84<br />
Tabelle A8: Kontrollüberzeugungen Krankheitsverlauf<br />
Items EKOA<br />
T2<br />
1=gar nicht – 5=sehr stark N MW SD<br />
Zufall 478 1,71 ,95<br />
Können der Ärzte 486 3,41 1,07<br />
Eigene Lebenseinstellung 491 3,96 ,92<br />
Eigenes Verhalten 487 3,97 ,88<br />
Partner/Familie 489 3,56 1,14<br />
Engagement der Ärzte 485 3,57 ,99<br />
Schicksal 482 2,05 1,19<br />
Fortschritte der Medizin 485 3,88 1,00<br />
Naturheilverfahren 486 2,70 1,13<br />
Stress 492 3,62 1,05<br />
berufliche Belastungen 480 3,46 1,16<br />
körperliche Veranlagung 489 3,24 ,95<br />
Umgehensweise 490 3,49 1,21<br />
Umweltverschmutzung 492 3,70 1,00<br />
familiäre Sorgen 494 3,18 1,21<br />
Erdstrahlen... 479 1,67 ,86<br />
Bewältigungsfähigkeit 493 3,61 1,04<br />
seelische Probleme 492 3,16 1,13<br />
hohe Selbstansprüche 490 2,91 1,14<br />
Zufall 478 1,71 ,95<br />
Können der Ärzte 486 3,41 1,07<br />
Eigene Lebenseinstellung 491 3,96 ,92<br />
Eigenes Verhalten 487 3,97 ,88<br />
192
Tabelle 9: T-Test bei unabhängigen Stichproben (MZP Nachbefragung)<br />
F Signifikanz T df Sig. (2-seitig)<br />
ALTER_2 Alter in Jahren November 1999 (Beruf) 81,944 ,000 -10,705 406 ,000<br />
-15,335 319,768 ,000<br />
<strong>SF12</strong>_KB MEAN(<strong>SF12</strong>_K,ALL) ,614 ,434 5,166 406 ,000<br />
5,248 151,621 ,000<br />
<strong>SF12</strong>_PB MEAN(<strong>SF12</strong>_P,ALL) ,544 ,461 1,106 406 ,269<br />
1,059 139,416 ,291<br />
V10_1B Atemwegserkrankung ,869 ,352 -3,688 406 ,000<br />
-3,748 151,654 ,000<br />
V10_10B Bewertung Befindung ,441 ,507 -3,708 406 ,000<br />
-3,753 150,730 ,000<br />
V10_11B Kontrolle Befinden ,515 ,473 -3,660 406 ,000<br />
-3,822 158,270 ,000<br />
V10_12B Verschlechterung Befinden ,000 ,995 -3,541 406 ,000<br />
-3,534 147,657 ,001<br />
V10_13B Umgang mit Konflikten ,178 ,673 -1,957 406 ,051<br />
-1,887 140,772 ,061<br />
V10_14B Alltagsanforderung ,114 ,735 -3,228 406 ,001<br />
-3,127 141,625 ,002<br />
V10_15B Nebenwirkungen ,756 ,385 -4,615 406 ,000<br />
-4,450 140,696 ,000<br />
V10_16B Lebensqualität 1,016 ,314 -4,176 406 ,000<br />
-4,148 146,633 ,000<br />
V10_2B körperliche Verfassung ,554 ,457 -3,290 406 ,001<br />
-3,409 156,281 ,001<br />
V10_3B seelische Verfassung ,928 ,336 -,674 406 ,501<br />
-,645 139,099 ,520<br />
V10_4B allgemeiner Ges<strong>und</strong>heitszustand ,553 ,458 -4,337 406 ,000<br />
-4,017 133,618 ,000<br />
V10_5B allgemeine Leistungsfähigkeit 1,402 ,237 -5,096 406 ,000<br />
-4,815 136,952 ,000<br />
V10_6B berufliche Leistungsfähigkeit ,667 ,415 -2,466 406 ,014<br />
-2,368 139,917 ,019<br />
V10_7B Arbeitsfähigkeit ,317 ,574 -4,868 406 ,000<br />
-4,742 142,685 ,000<br />
V10_8B Allgemeinbefinden ,441 ,507 -3,635 406 ,000<br />
-3,611 146,673 ,000<br />
V10_9B Wahrnehmung asthmatischer Symptome ,375 ,540 -3,887 406 ,000<br />
-3,978 153,290 ,000<br />
ASL_ANB Nervöse Ängstlichkeit ,278 ,599 -,114 406 ,910<br />
-,112 145,701 ,911<br />
ASL_ATB obstruktive Atembeschwerden ,358 ,550 -,989 406 ,323<br />
-1,053 163,663 ,294<br />
ASL_GEB Ärgerliche Gereiztheit 2,168 ,142 -,263 406 ,793<br />
-,286 169,793 ,775<br />
ASL_HYB Hyperventilation ,149 ,700 -1,196 406 ,232<br />
-1,202 149,147 ,231<br />
ASL_MÜB Müdigkeit ,640 ,424 -,187 406 ,852<br />
-,200 165,046 ,842<br />
V12B Akzeptanz der chr. Atemwegserkrankung ,619 ,432 ,250 406 ,803<br />
,259 156,693 ,796<br />
BSI_A2B MEAN(BSI_A2,ALL) ,139 ,709 -1,794 406 ,074<br />
-1,757 143,687 ,081<br />
BSI_D2B MEAN(BSI_D2,ALL) 1,677 ,196 -,657 406 ,511<br />
-,600 131,395 ,549<br />
V16B Leiden unter Beschwerden 2,138 ,144 3,658 406 ,000<br />
3,654 147,841 ,000<br />
193
F Signifikanz T df Sig. (2-seitig)<br />
V17B Krankheitsgefühl ,134 ,715 -4,117 406 ,000<br />
-3,917 138,235 ,000<br />
V18B seelische Beeinträchtigung 1,368 ,243 -,363 406 ,717<br />
-,345 138,282 ,730<br />
V19B Einschätzung der Krankheitsentwicklung ,375 ,540 1,722 406 ,086<br />
1,851 166,197 ,066<br />
V31_1B Atemnot unter Belastung 3,129 ,078 -2,882 406 ,004<br />
-2,731 137,461 ,007<br />
V31_2B nächtliche Atemnot ,007 ,935 -2,367 406 ,018<br />
-2,347 146,237 ,020<br />
V31_3B Atemnot während <strong>des</strong> Tages 1,446 ,230 -4,069 406 ,000<br />
-3,879 138,577 ,000<br />
V31_4B ständige Atemnot trotz Medikamente 5,571 ,019 -4,047 406 ,000<br />
-3,756 133,948 ,000<br />
V31_5B Beschwerdefreiheit 9,303 ,002 3,069 406 ,002<br />
3,607 197,065 ,000<br />
FKV_ABLB Ablenkung ,025 ,875 -1,416 406 ,157<br />
-1,452 153,775 ,148<br />
FKV_BAGB Bagatellisierung/ Wunschdenken ,398 ,528 -1,589 406 ,113<br />
-1,575 146,273 ,117<br />
FKV_DEPB Depressive Verarbeitung ,592 ,442 ,304 406 ,761<br />
,308 150,395 ,759<br />
FKV_PROB Aktiv lösungsorientierte Strategien ,746 ,388 -2,720 406 ,007<br />
-2,856 159,697 ,005<br />
FKV_RELB Sinnsuche 1,607 ,206 -3,250 406 ,001<br />
-3,059 136,324 ,003<br />
V37_27B Befolgung <strong>des</strong> ärztlichen Rats ,174 ,677 -3,159 406 ,002<br />
-3,408 167,173 ,001<br />
V37_28B Vertrauen in die Ärzte ,223 ,637 -3,222 406 ,001<br />
-3,064 138,123 ,003<br />
V37_29B Misstrauen den Ärzten gegenüber ,019 ,891 -1,424 406 ,155<br />
-1,370 140,276 ,173<br />
V39B seelische Bewältigung der Erkrankung 2,007 ,157 1,107 406 ,269<br />
1,072 141,588 ,285<br />
V42B Erleben der Hilfsangebote 1,024 ,312 ,946 406 ,345<br />
,920 142,329 ,359<br />
V55B Dauer Arbeitsunfähigkeit 9,517 ,002 -2,963 406 ,003<br />
-2,175 107,094 ,032<br />
V58_1B Überst<strong>und</strong>en 3,429 ,065 1,177 406 ,240<br />
1,267 166,512 ,207<br />
V58_10B Arbeit am Bildschirm 2,994 ,084 -,516 406 ,606<br />
-,484 135,754 ,629<br />
V58_11B Körperlich schwere Arbeit 2,132 ,145 -2,303 406 ,022<br />
-2,190 138,099 ,030<br />
V58_12B Unangenehme Körperhaltung 4,449 ,036 -,899 406 ,369<br />
-,817 130,501 ,416<br />
V58_13B Hohes Arbeitstempo ,139 ,710 -3,189 406 ,002<br />
-3,400 163,846 ,001<br />
V58_14B Maschinell bestimmtes Arbeitstempo 9,319 ,002 -2,368 406 ,018<br />
-1,945 117,431 ,054<br />
V58_15B Starke Konzentration ,126 ,723 -3,832 406 ,000<br />
-3,991 157,604 ,000<br />
V58_16B Widersprüchliche Anweisungen ,493 ,483 -2,230 406 ,026<br />
-2,163 141,818 ,032<br />
V58_17B Langeweile ,307 ,580 -,887 406 ,376<br />
-,845 138,409 ,400<br />
V58_18B Häufige Störungen ,367 ,545 1,240 406 ,216<br />
194
F Signifikanz T df Sig. (2-seitig)<br />
1,290 157,215 ,199<br />
V58_19B Zwang zu schnellen Entscheidungen 4,835 ,028 -2,427 406 ,016<br />
-2,215 131,234 ,028<br />
V58_2B Wechselschicht ohne Nachtarbeit ,008 ,929 -,270 406 ,787<br />
-,274 151,100 ,785<br />
V58_20B Hohe Verantwortung für Menschen ,161 ,688 -2,664 406 ,008<br />
-2,686 149,930 ,008<br />
V58_21B Strenge Kontrolle durch Vorgesetzte 2,611 ,107 -2,826 406 ,005<br />
-2,679 137,580 ,008<br />
V58_3B Wechselschicht mit Nachtarbeit ,020 ,887 -,163 406 ,871<br />
-,162 147,132 ,871<br />
V58_4B Akkord- oder Stückarbeit 1,546 ,214 -,961 406 ,337<br />
-,846 126,047 ,399<br />
V58_5B Lärm ,992 ,320 -,817 406 ,414<br />
-,839 153,958 ,403<br />
V58_6B Gasförmige Schadstoffe ,077 ,781 -1,399 406 ,163<br />
-1,353 141,326 ,178<br />
V58_7B Schadstoffpartikel ,374 ,541 -1,447 406 ,149<br />
-1,388 139,655 ,167<br />
V58_8B Allergene ,633 ,427 -,677 406 ,499<br />
-,650 140,079 ,516<br />
V58_9B Hitze, Kälte, Nässe 1,224 ,269 -1,605 406 ,109<br />
-1,523 137,759 ,130<br />
V60B Arbeitszufriedenheit ,005 ,945 ,397 406 ,691<br />
,402 150,683 ,688<br />
V61_1B stärkere Belastung bei der Arbeit ,354 ,552 -4,961 406 ,000<br />
-4,859 143,725 ,000<br />
V61_10B andere Tätigkeit 1,113 ,292 -,095 406 ,924<br />
-,098 154,606 ,922<br />
V61_11B Anstieg Pausen 5,766 ,017 -2,433 406 ,015<br />
-2,121 124,660 ,036<br />
V61_12B berufl. Umschulung 2,059 ,152 ,479 406 ,632<br />
,557 192,978 ,578<br />
V61_13B Verschlechterung Verhältnis zu Kollegen 2,194 ,139 -1,719 406 ,086<br />
-1,593 133,637 ,114<br />
V61_14B Verbesserung Verhältnis Kollegen ,426 ,515 -,699 406 ,485<br />
-,741 162,265 ,460<br />
V61_16B Sonstiges 2,636 ,105 -1,631 406 ,104<br />
-1,428 125,208 ,156<br />
V61_2B rücksichtsvolle Kollegen ,747 ,388 -1,948 406 ,052<br />
-2,083 164,669 ,039<br />
V61_3B berufliche Rückstufung 3,797 ,052 -2,201 406 ,028<br />
-2,009 131,259 ,047<br />
V61_4B geringerer Verdienst 2,774 ,097 -2,164 406 ,031<br />
-1,939 128,440 ,055<br />
V61_5B Weiterkommen eingeschränkt 3,302 ,070 -3,421 406 ,001<br />
-3,266 138,841 ,001<br />
V61_6B Gefährdung <strong>des</strong> Arbeitsplatzes 4,372 ,037 -2,158 406 ,031<br />
-1,921 127,539 ,057<br />
V61_7B Behauptung gegen Konkurrenz 3,551 ,060 -3,401 406 ,001<br />
-3,189 135,622 ,002<br />
V61_8B Weniger arbeiten 2,285 ,131 -3,050 406 ,002<br />
-2,779 130,937 ,006<br />
V61_9B Versetzung an anderen Arbeitsort ,319 ,573 -,877 406 ,381<br />
-,853 142,224 ,395<br />
SBUS_T2B MEAN(SBUS_T2,ALL) ,178 ,673 -2,366 406 ,018<br />
-2,469 158,044 ,015<br />
195
F Signifikanz T df Sig. (2-seitig)<br />
QUAL_B MEAN(QUAL_ÜL,ALL) ,118 ,731 -2,351 406 ,019<br />
-2,385 151,289 ,018<br />
QUANT_B MEAN(QUANT_ÜL,ALL) 2,715 ,100 -2,007 406 ,045<br />
-2,180 169,312 ,031<br />
V64_1B geringerer Verdienst ,004 ,950 -1,428 406 ,154<br />
-1,404 144,475 ,163<br />
V64_2B Arbeitslosigkeit ,110 ,740 -,698 406 ,486<br />
-,693 146,624 ,489<br />
V64_3B schlechterer Arbeitsplatz ,153 ,696 -,999 406 ,318<br />
-,955 139,036 ,341<br />
V64_4B schlechtere Aufstiegsmöglichkeiten ,021 ,884 -1,377 406 ,169<br />
-1,341 142,589 ,182<br />
V64_5B vorzeitige Berentung ,848 ,358 -3,236 406 ,001<br />
-3,075 137,997 ,003<br />
V651_2B Ges<strong>und</strong>heit ,050 ,823 -1,810 406 ,071<br />
-1,809 147,895 ,073<br />
V6510_2B finanzielle Lage ,004 ,953 ,699 406 ,485<br />
,678 141,705 ,499<br />
V6511_2B Ehe/ Partnerschaft 1,986 ,160 ,322 406 ,748<br />
,338 159,743 ,736<br />
V6512_2B Sexualleben 4,605 ,032 ,053 406 ,957<br />
,059 175,940 ,953<br />
V6513_2B Freizeitgestaltung 4,705 ,031 ,047 406 ,963<br />
,042 127,098 ,967<br />
V6514_2B Familienleben ,216 ,642 ,727 406 ,468<br />
,723 146,995 ,471<br />
V6515_2B Sport <strong>und</strong> Bewegung ,206 ,650 ,485 406 ,628<br />
,480 145,565 ,632<br />
V6516_2B Verhältnis zu Kindern 1,595 ,207 ,245 406 ,807<br />
,231 137,059 ,818<br />
V6517_2B Sozialkontakte ,039 ,844 ,147 406 ,883<br />
,145 145,140 ,885<br />
V6518_2B Leben insgesamt ,131 ,718 ,898 406 ,370<br />
,854 138,223 ,395<br />
V652_2B bisheriger Behandlungserfolg 3,904 ,049 -1,390 406 ,165<br />
-1,272 131,737 ,206<br />
V653_2B körperliche Verfassung ,080 ,777 -3,057 406 ,002<br />
-3,009 144,711 ,003<br />
V654_2B geistige Verfassung 1,085 ,298 -,635 406 ,526<br />
-,602 137,405 ,548<br />
V655_2B Stimmung 2,058 ,152 -,547 406 ,585<br />
-,511 134,972 ,610<br />
V656_2B Aussehen ,177 ,674 ,311 406 ,756<br />
,313 149,524 ,755<br />
V657_2B Fähigkeiten ,771 ,380 -,874 406 ,383<br />
-,845 141,355 ,399<br />
V658_2B Charakter 2,219 ,137 -,305 406 ,760<br />
-,338 174,586 ,736<br />
V659_2B berufliche Situation ,584 ,445 -,442 406 ,658<br />
-,437 145,672 ,662<br />
196
Tabelle A10: Vergleich Belastungen Arzt Aufnahme Entlassung<br />
Status 1=sehr hohe Belastung -<br />
5=gar keine Belastung<br />
MW N SD<br />
Paaren 1 psychisch vorher 2,88 325 1,00<br />
psych Verf. nachher 4,04 325 ,65<br />
Paaren 2 körp. Leist. vorher 2,77 342 ,92<br />
körp. Leist. nachher 3,94 342 ,65<br />
Paaren 3 körp. Verf. vorher 2,87 317 ,97<br />
körp. Verf. nachher 3,92 317 ,67<br />
Paaren 4 allg. Leist. vorher 2,84 312 ,99<br />
allg. Leist. nachher 3,94 312 ,65<br />
Paaren 5 berufl. Leist. vorher 2,89 304 1,02<br />
ber. Leist. nachher 3,87 304 ,79<br />
Paaren 6 Wissen vorher 2,84 340 1,01<br />
Wissen nachher 4,10 340 ,65<br />
Paaren 7 Bewält. vorher 2,88 316 1,00<br />
Bewält. nachher 3,97 316 ,61<br />
Paaren 8 Compliace vorher 3,13 304 1,04<br />
Compliance nachher 4,01 304 ,70<br />
Paaren 9 Prognose 2,89 305 ,88<br />
Prognose nachher 3,73 305 ,82<br />
Paaren 10 Symptomwahrn. vorher 3,02 316 1,00<br />
adäq. Wahrn. nachher 3,97 316 ,66<br />
Paaren 11 adäq. Bewert. vorher 2,99 312 ,97<br />
adäq. Bewert. nachher 3,94 312 ,65<br />
Paaren 12 Einleit. Maßn. vorher 2,88 331 ,99<br />
Einleit. gez. Maßn. nachher 3,97 331 ,65<br />
Paaren 13 Lebensqualität vorher 2,87 331 ,91<br />
Lebensqualität 3,94 331 ,59<br />
197
Anhang: Screeninginstrument (Langfassung)<br />
Fragebogen zu berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen bei Erkrankungen der<br />
Lunge- <strong>und</strong> der Atemwege<br />
- Langfassung -<br />
U. Kaiser<br />
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
198
Fragebogen zu berufsbezogenen Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden<br />
<strong>und</strong> Belastungen bei Erkrankungen der<br />
Lunge- <strong>und</strong> der Atemwege<br />
- Langfassung -<br />
U. Kaiser<br />
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Liebe Patientin, lieber Patient, Pat.-ID: __________<br />
wie wir Ihnen in einem Informationsschreiben mitgeteilt haben, möchten wir mit diesem Fragebogen<br />
erreichen, dass wir bereits zu Beginn Ihres Klinikaufenthaltes über Ihre berufsbezogenen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbeschwerden <strong>und</strong> Belastungen sowie Ihre Erwartungen an den Aufenthalt bei uns<br />
informiert sind.<br />
Die Fragen beziehen sich auf Ihre Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Ihre berufliche Situation <strong>und</strong> wie Sie damit<br />
verb<strong>und</strong>ene Schwierigkeiten <strong>und</strong> Belastungen bewältigen. Um Ihnen umfassend helfen zu können,<br />
benötigen wir vollständige Angaben. Nehmen Sie sich bitte genügend Zeit, den Fragebogen<br />
auszufüllen <strong>und</strong> beantworten Sie die Fragen bitte so offen <strong>und</strong> ehrlich wie möglich.<br />
Wir möchten Ihnen nun noch die Fragentypen erklären, denen Sie im Laufe der Bearbeitung <strong>des</strong><br />
Fragebogens begegnen werden:<br />
1. Fragen, die Sie einfach mit „ja“ oder „nein“ beantworten sollen (Zutreffen<strong>des</strong> soll jeweils<br />
angekreuzt werden)<br />
2. Fragen, die ganz offen gestellt sind, d.h. nach der Frage haben wir einfach eine oder mehrere<br />
Zeilen Platz gelassen, in die Sie bitte Ihre Antwort stichwortartig hineinschreiben.<br />
3. Bei manchen Fragen bitten wir Sie, einzuschätzen, wie stark etwas für Sie zutrifft, z.B.: wie stark<br />
Ihre Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen behindert haben. Wir fragen dann meist in<br />
einer 5-stufigen Skala wie folgt:<br />
Beispiel:<br />
Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer<br />
Alltagstätigkeiten zu Hause <strong>und</strong> im Beruf behindert? (Bitte kreuzen Sie nur ein Kästchen an)<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
überhaupt ein mäßig ziemlich sehr<br />
nicht bisschen<br />
Bei Fragetypen, bei denen mehrere Antwortmöglichkeiten vorgesehen sind, können Sie bei jedem<br />
zutreffenden Kästchen ein Kreuz machen. Bei Bezug auf einen bestimmten Zeitraum ist dieser jeweils<br />
im Text der Frage besonders hervorgehoben.<br />
Bitte überlegen Sie bei den Antworten nicht lange, sondern kreuzen Sie möglichst spontan das<br />
Kästchen an, das nach Ihrem Gefühl am ehesten zutrifft.<br />
Diese Hinweise sind lediglich als Vorinformation gedacht. Bei den Fragen im Fragebogen wird bei<br />
Abweichungen von dem hier erklärten Prinzip im einzelnen deutlich gemacht, wie sie beantwortet<br />
werden sollen.<br />
Wir bitten Sie, jetzt mit der Bearbeitung zu beginnen.<br />
Vielen Dank!<br />
1
Ihre Erwartungen an den kommenden Aufenthalt in der Hochgebirgsklinik<br />
1.) Im folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, mit denen Patienten ihre Erwartungen <strong>und</strong><br />
Wünsche an den Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik beschrieben haben. Sicherlich sind<br />
auch Sie mit bestimmten Erwartungen <strong>und</strong> Wünschen in diese Klinik gekommen.<br />
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Aussagen der Reihe nach durch <strong>und</strong> kreuzen Sie bei jeder<br />
Aussage an, in welchem Maße die genannten Erwartungen <strong>und</strong> Wünsche auf Sie<br />
zutreffen. Falls die Aussagen nicht auf Sie zutreffen, kreuzen Sie bitte in der rechten Spalte an.<br />
Ich erwarte, dass... stimmt<br />
genau<br />
stimmt<br />
überwiegend<br />
stimmt eher<br />
nicht<br />
stimmt<br />
überhaupt<br />
nicht<br />
trifft auf<br />
mich nicht<br />
zu<br />
ich Abstand vom Alltag gewinne � � � � �<br />
ich mich erhole � � � � �<br />
ich mich eine Zeitlang um nichts<br />
kümmern muss<br />
� � � � �<br />
der Kurort ansprechend ist � � � � �<br />
es möglich ist, auch außerhalb<br />
der Rehabilitation etwas zu<br />
unternehmen<br />
man mir eine genaue Diagnose<br />
mitteilt<br />
ich meine körperliche<br />
Leistungsfähigkeit erhöhen kann<br />
ich bald wieder wie früher arbeiten<br />
kann<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
ich lerne, gesünder zu leben � � � � �<br />
ich Kontakt zu Patienten mit<br />
gleichen oder ähnlichen<br />
Problemen bekomme<br />
mein Selbstvertrauen gestärkt<br />
wird <strong>und</strong> dass man mir Mut macht<br />
ich beruflichen Stress abbauen<br />
kann<br />
ich lerne, mir mehr Freizeit zu<br />
nehmen <strong>und</strong> sie für mich zu<br />
nutzen<br />
man mir bei arbeits- <strong>und</strong><br />
sozialrechtlichen Fragen hilft<br />
man mir bei einer<br />
Rentenantragstellung hilft<br />
ich meine verminderte<br />
Leistungsfähigkeit hier bestätigt<br />
bekomme<br />
man mich über berufliche<br />
Umschulungsmöglichkeiten<br />
informiert <strong>und</strong> berät<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
2
Derzeitige Belastungen <strong>und</strong> Beschwerden<br />
Nachfolgend geht es um die Beurteilung Ihres Ges<strong>und</strong>heitszustan<strong>des</strong>. Dieser Teil ermöglicht es, im<br />
Zeitverlauf nachzuvollziehen, wie Sie sich fühlen <strong>und</strong> wie Sie im Alltag zurechtkommen. Bitte<br />
beantworten Sie jede der folgenden Fragen, indem Sie bei den Antwortmöglichkeiten das Kästchen<br />
ankreuzen, das am besten auf Sie zutrifft.<br />
2.) Unter welcher Atemwegserkrankung leiden Sie (bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich)<br />
Allergisches Asthma Mixed Asthma (Mischform)<br />
Intrinsic Asthma (überwiegend durch Chronisch obstruktive Bronchitis<br />
unspezifische Reize <strong>und</strong> Infekte) Lungenblähung (Lungenemphysem)<br />
Anstrengungsasthma die Diagnose ist mir nicht genau bekannt<br />
Sonstige Formen der Atemwegserkrankung:<br />
3.) Seit wie vielen Jahren leiden Sie unter einer Atemwegserkrankung?<br />
Seit ............ Jahren<br />
4.) Haben Sie außer der Atemwegserkrankung noch weitere Erkrankungen oder Beschwerden?<br />
nein<br />
ja wenn ja, welche: Allergien, <strong>und</strong> zwar gegen:<br />
Hausstaubmilben Pollen<br />
Schimmelpilze Tiere<br />
Latex Gase: ____________<br />
Nahrungsmittel<br />
sonstiges <strong>und</strong> zwar: _____________________<br />
Hauterkrankungen<br />
Muskeln, Skelettsystem<br />
Herz-Kreislauf<br />
Sonstiges: _________________________________<br />
5.) Denken Sie bitte an die letzten 12 Monate: Erinnern Sie sich bitte, wie es Ihnen in diesem<br />
Zeitraum ging, wie Sie sich gefühlt haben oder wo Sie Probleme hatten. Bitte kreuzen Sie für<br />
jeden Sachverhalt an, wie stark Sie unter möglichen Einschränkungen leiden bzw. welche<br />
Probleme Sie in bestimmten Bereichen in den letzten 12 Monaten hatten.<br />
Leiden unter ... bzw.<br />
Beeinträchtigung bzw. Probleme bei ...<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig mittel ziemlich<br />
Leiden unter der Atemwegserkrankung � � � � �<br />
Einschränkungen in der körperlichen Verfassung � � � � �<br />
Einschränkungen in der seelischen Verfassung � � � � �<br />
Einschränkungen im allg. Ges<strong>und</strong>heitszustand � � � � �<br />
Einschränkungen in der allg. Leistungsfähigkeit � � � � �<br />
Einschränkungen in der berufl. Leistungsfähigkeit � � � � �<br />
Einschränkungen in der Arbeitsfähigkeit � � � � �<br />
Einschränkungen im Allgemeinbefinden � � � � �<br />
Probleme, (asthmatische) Symptome frühzeitig<br />
wahrzunehmen<br />
3<br />
sehr<br />
stark<br />
� � � � �
Fortsetzung Frage 5<br />
Probleme, das momentane (asthmatische) Befinden<br />
sicher einzuschätzen<br />
Probleme, die Krankheitssymptome sicher zu<br />
kontrollieren<br />
Probleme, bei Verschlechterungen <strong>des</strong><br />
asthmatischen Befindens, frühzeitig <strong>und</strong> gezielt<br />
Maßnahmen zur Verbesserung <strong>des</strong> Befindens<br />
einzuleiten<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig mittel ziemlich<br />
sehr<br />
stark<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
Probleme im Umgang mit Konflikten/Belastungen � � � � �<br />
Probleme in der Bewältigung <strong>des</strong> Alltags � � � � �<br />
Leiden unter den Nebenwirkungen der Behandlung � � � � �<br />
Einschränkungen der Lebensqualität insgesamt � � � � �<br />
6.) Sie finden nachfolgend eine Liste mit Empfindungen <strong>und</strong> Symptomen, die viele Patienten<br />
während asthmatischer Beschwerden angeben. Geben Sie bitte an, wie häufig dies bei<br />
asthmatischen Problemen auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie alle Punkte, lassen Sie keinen<br />
aus.<br />
nie selten gelegentlich<br />
oft immer<br />
Schwindelig � � � � �<br />
Träge � � � � �<br />
Ärgerlich � � � � �<br />
erschwerte Atmung � � � � �<br />
Angst, alleine gelassen zu werden � � � � �<br />
Müde � � � � �<br />
Jucken <strong>und</strong> Brennen auf der Haut � � � � �<br />
Gereizt � � � � �<br />
Engegefühl in der Brust � � � � �<br />
entsetzt, erschrocken � � � � �<br />
Gefühl von tausend Stecknadeln � � � � �<br />
Beunruhigt � � � � �<br />
Bedrückt � � � � �<br />
Kratzbürstig � � � � �<br />
sich verlassen fühlen � � � � �<br />
Kribbeln <strong>und</strong> Prickeln � � � � �<br />
Druck auf der Brust � � � � �<br />
Hilflos � � � � �<br />
ängstlich, nervös � � � � �<br />
Stau in der Brust � � � � �<br />
Ungehalten � � � � �<br />
Wütend � � � � �<br />
4
Fortsetzung... nie selten gelegentlich<br />
oft immer<br />
abgespannt � � � � �<br />
schlecht gelaunt � � � � �<br />
nach Luft ringend � � � � �<br />
aufbrausend � � � � �<br />
Lahm � � � � �<br />
Atemgeräusche (z.B. Pfeifen,<br />
Giemen)<br />
� � � � �<br />
Kopfschmerz � � � � �<br />
Erschöpft � � � � �<br />
Erstickungsgefühl � � � � �<br />
Schläfrig � � � � �<br />
unglücklich � � � � �<br />
Zornig � � � � �<br />
7.) Sie finden nachstehend eine Liste von Problemen <strong>und</strong> Beschwerden, die man manchmal hat.<br />
Bitte lesen Sie jede Frage sorgfältig durch <strong>und</strong> entscheiden Sie, wie stark Sie durch diese<br />
Beschwerden in den letzten 12 Monaten gestört oder bedrängt worden sind.<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig mittel stark sehr<br />
stark<br />
Nervosität oder inneres Zittern � � � � �<br />
Plötzliches Erschrecken ohne Gr<strong>und</strong> � � � � �<br />
Furchtsamkeit � � � � �<br />
Das Gefühl, gespannt oder aufgeregt zu sein � � � � �<br />
Schreck- oder Panikanfälle � � � � �<br />
So starker Ruhelosigkeit, dass Sie nicht stillsitzen<br />
können<br />
� � � � �<br />
Gedanken, sich das Leben zu nehmen � � � � �<br />
Einsamkeitsgefühlen � � � � �<br />
Schwermut � � � � �<br />
Das Gefühl, sich für nichts zu interessieren � � � � �<br />
Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der<br />
Zukunft<br />
� � � � �<br />
Das Gefühl, wertlos zu sein � � � � �<br />
8.) Wie stark leiden Sie gegenwärtig insgesamt unter den Beschwerden bzw. der Erkrankung?<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
sehr stark stark etwas kaum gar nicht<br />
5
9.) Wie krank fühlen Sie sich gegenwärtig körperlich?<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
überhaupt wenig etwas ziemlich sehr<br />
nicht krank krank krank krank krank<br />
10.) Wie beeinträchtigt fühlen Sie sich gegenwärtig seelisch?<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
überhaupt wenig etwas ziemlich sehr<br />
nicht<br />
Behandlungen<br />
11.) Welche Behandlungen haben Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt wegen Ihrer<br />
Atemwegserkrankung in Anspruch nehmen müssen?<br />
Häufigkeit<br />
Wie häufig haben Sie einen Arzt aufgesucht? ca. ___________ mal<br />
Wie häufig waren Sie stationär im Krankenhaus aufgenommen? ca. ___________ mal<br />
Wie viel Tage waren Sie stationär im Krankenhaus aufgenommen? ca. ___________ Tage<br />
Wie häufig mussten Sie den Notarzt anrufen? ca. ___________ mal<br />
Wie häufig mussten Sie als Notfall in eine Klinik eingeliefert werden? ca. ___________ mal<br />
Wie oft mussten Sie auf der Intensivstation beatmet werden? ca. ___________ mal<br />
12.) Bei welchen Ärzten/Therapeuten waren Sie in den letzten 12 Monaten in Behandlung?<br />
Allgemeinmediziner niedergelassener Lungenfacharzt<br />
Internist Neurologe/Psychiater<br />
Urologe Gynäkologe<br />
Hautarzt Orthopäde<br />
Psychotherapeut nicht in Behandlung<br />
Sonstige: ________________________________________________________________<br />
13.) Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der ärztlichen Versorgung bei Ihnen zu Hause?<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
überhaupt wenig etwas ziemlich sehr<br />
nicht<br />
14.) Sind Sie zur Zeit krankgeschrieben? � nein � ja<br />
15.) Waren Sie in den letzten 12 Monaten krankgeschrieben?<br />
� nein, ich war in den letzten 12 Monaten nicht krankgeschrieben<br />
� ja, an insgesamt ...............Tagen<br />
16.) Haben Sie in den letzten fünf Jahre an einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme<br />
teilgenommen? (ausgenommen der aktuelle Aufenthalt)<br />
� nein � ja<br />
6
17.) Geben Sie bitte nachfolgend an, welche Medikamente Sie momentan einnehmen müssen. In der<br />
folgenden Tabelle finden Sie mögliche Kombinationen in Stufen unterteilt. Müssen Sie zum<br />
Beispiel Betamimetika zur Atemwegserweiterung <strong>und</strong> Kortisonsprays einnehmen, so kreuzen Sie<br />
Stufe 2 (in der Spalte „ja“) an. Müssen hierzu zusätzlich noch Theophyllinpräparate eingenommen<br />
werden, kreuzen Sie bitte bei Stufe 3 <strong>und</strong> bei zusätzlicher Einnahme von Kortisontabletten bei<br />
Stufe 4 an. Zu Ihrer Hilfe finden Sie jeweils für die markierten Gruppen (�)<br />
Medikamentenbeispiele.<br />
ja: Stufe<br />
Handelsnamen (Beispiele)<br />
Stufe 0 keine Medikamente<br />
Stufe 1: Betamimetika<br />
(kurzwirksam) �<br />
Stufe 2: Betamimetika<br />
+<br />
Kortison-Sprays �<br />
Stufe 3: inhalative Betamimetika<br />
(langwirksam) �<br />
+<br />
Kortisonsprays<br />
+<br />
Theophyllin �<br />
Stufe 4: Betamimetika<br />
+<br />
Kortisonsprays<br />
+<br />
Theophyllin<br />
+<br />
Kortison (-Tabletten) �<br />
Berotec, Sultanol, Bronchospray, Bricanyl,<br />
Allergospasmin, Aarane, Berodul, Aerodur<br />
Becloturmant, Sanasthmax, Viarox, Pulmicort, Inhacort,<br />
Flutide, Atemur, Bu<strong>des</strong>onid, Beclomet<br />
Foradil, Oxis, Serevent, Aeromax<br />
Afonilium retard, Bronchoretard, Euphylong retard,<br />
Pulmi-Dur retard, Pulmo-Timelets retard, Solosin retard,<br />
Uniphyllin retard<br />
Ultralan, Urbason, Medrate, Decortin-H, Prednisolon,<br />
Solu-Decortin-H (gespritzt), Metypred<br />
18.) Wie geht es Ihnen momentan bei dieser Medikation bezüglich Ihrer asthmatischen<br />
Beschwerden? Machen Sie ein Kreuz in einer der fünf Spalten rechts entsprechend der Stärke<br />
Ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung! Beantworten Sie alle Punkte, lassen Sie bitte keinen aus!<br />
Ich habe Atemnot unter Belastung<br />
Ich habe nachts häufig Atemnot<br />
Ich habe tagsüber häufig Atemnot<br />
Ich habe ständig Atemnot trotz<br />
Medikamenteneinnahme<br />
Ich bin vollkommen beschwerdefrei, ohne jegliche<br />
Atemnot<br />
gar<br />
nicht<br />
kaum etwas stark sehr<br />
stark<br />
19.) Wie schwer sind üblicherweise die Asthmaanfälle (bitte entsprechend ankreuzen)?<br />
Anfälle von Atemnot, die spontan vorübergehen<br />
Anfälle von Atemnot, die durch inhalative Maßnahmen vorübergehen<br />
Anfälle von Atemnot, die durch weitergehende oder nur durch ärztliche Behandlung<br />
vorübergehen<br />
20.) Wie genau halten Sie sich insgesamt an ärztliche Verordnungen <strong>und</strong> Ratschläge?<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
gar nicht wenig mittel ziemlich sehr genau<br />
7
21.) Wie wird sich Ihrer Meinung nach Ihr Asthma in den nächsten Jahren entwickeln? Es wird<br />
wahrscheinlich...<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
viel etwas gleich etwas viel<br />
schlechter schlechter bleiben besser besser<br />
Krankheitsverarbeitung<br />
22.) Im folgenden geht es darum, genauer zu erfahren, wie Sie in den vergangenen 12 Monaten mit<br />
Ihrer Erkrankung umgegangen sind, was Sie gedacht, gefühlt <strong>und</strong> getan haben <strong>und</strong> inwieweit<br />
Ihnen dies geholfen hat, mit der Situation fertig zu werden. Wir wissen aus vielen Gesprächen mit<br />
Patienten, dass es sehr verschiedene, sich zum Teil widersprechende, unter Umständen auch<br />
rasch wechselnde Gefühle, Gedanken <strong>und</strong> Handlungen sein können, die auftreten. Wir bitten Sie,<br />
in den folgenden Fragen alles anzukreuzen, was in diesem Zeitraum persönlich auf Sie<br />
zugetroffen hat.<br />
Zu diesem Zweck finden Sie nachfolgend Aussagen, wie sie von Patienten mit chronischen<br />
Atemwegserkrankungen geäußert wurden. Wir bitten Sie zu prüfen, ob <strong>und</strong> wie stark diese<br />
Aussagen für Sie persönlich zutrafen. Bitte kreuzen Sie für jeden der folgenden Begriffe an, wie<br />
stark er auf Ihre Situation zutrifft. Beantworten Sie bitte alle Punkte, lassen Sie bitte nichts aus!<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig<br />
mittel<br />
ziemlich<br />
Information über Erkrankung <strong>und</strong> Behandlung suchen � � � � �<br />
Nicht-wahrhaben-wollen <strong>des</strong> Geschehenen � � � � �<br />
Herunterspielen der Bedeutung <strong>und</strong> Tragweite � � � � �<br />
Wunschdenken <strong>und</strong> Tagträumen nachhängen � � � � �<br />
Sich selbst die Schuld geben � � � � �<br />
Andere verantwortlich machen � � � � �<br />
Aktive Anstrengungen zur Lösung der Probleme<br />
unternehmen<br />
sehr<br />
stark<br />
� � � � �<br />
Einen Plan machen <strong>und</strong> danach handeln � � � � �<br />
Ungeduldig <strong>und</strong> gereizt auf andere reagieren � � � � �<br />
Gefühle nach außen zeigen � � � � �<br />
Gefühle unterdrücken, Selbstbeherrschung � � � � �<br />
Stimmungsverbesserung durch Alkohol oder<br />
Beruhigungsmittel suchen<br />
� � � � �<br />
Sich mehr gönnen � � � � �<br />
Sich vornehmen, intensiver zu leben � � � � �<br />
Entschlossen gegen die Krankheit ankämpfen � � � � �<br />
Sich selbst bemitleiden � � � � �<br />
Sich selbst Mut machen � � � � �<br />
Erfolge <strong>und</strong> Selbstbestätigung suchen � � � � �<br />
Sich abzulenken versuchen � � � � �<br />
Abstand zu gewinnen versuchen � � � � �<br />
Die Krankheit als Schicksal nehmen � � � � �<br />
8
Fortsetzung... gar<br />
nicht<br />
wenig<br />
mittel<br />
ziemlich<br />
Ins Grübeln kommen � � � � �<br />
Trost im religiösen Glauben suchen � � � � �<br />
Versuch, in der Krankheit einen Sinn zu sehen � � � � �<br />
Sich damit trösten, dass es andere noch schlimmer<br />
getroffen hat<br />
sehr<br />
stark<br />
� � � � �<br />
Mit dem Schicksal hadern � � � � �<br />
Genau den ärztlichen Rat befolgen � � � � �<br />
Vertrauen in die Ärzte setzen � � � � �<br />
Den Ärzten misstrauen, die Diagnose überprüfen<br />
lassen, andere Ärzte aufsuchen<br />
� � � � �<br />
Anderen Gutes tun wollen � � � � �<br />
Galgenhumor entwickeln � � � � �<br />
Hilfe anderer in Anspruch nehmen � � � � �<br />
Sich gerne umsorgen lassen � � � � �<br />
Sich von anderen Menschen zurückziehen � � � � �<br />
Sich auf frühere Erfahrungen mit ähnlichen<br />
Schicksalsschlägen besinnen<br />
� � � � �<br />
23.) Wie gut sind Sie insgesamt seelisch mit der Erkrankung <strong>und</strong> Behandlung fertig geworden?<br />
Zutreffen<strong>des</strong> bitte ankreuzen.<br />
� ------------- � ------------- � ------------- � -------------�<br />
gar nicht wenig mittel ziemlich sehr gut<br />
24.) Wie stark haben Ihnen andere Personen geholfen, auch seelisch mit der Erkrankung <strong>und</strong><br />
Behandlung fertig zu werden?<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig Mittel ziemlich<br />
Unterstützung durch andere � � � � �<br />
<strong>und</strong> zwar folgende Personen:<br />
_________________________________________________________________________________<br />
Berufliche Situation<br />
25.) Welche Berufsausbildung haben Sie abgeschlossen?<br />
� Lehre (berufliche – betriebliche Ausbildung)<br />
� Fachschule (Meister-, Technikerschule, Berufs-, Fachakademie<br />
� Universität, Hochschule<br />
� Andere Berufsausbildung<br />
� Keine Berufsausbildung<br />
9<br />
sehr<br />
stark
26.) Sind Sie zur Zeit erwerbstätig<br />
� ja, ganztags<br />
� ja, min<strong>des</strong>tens halbtags<br />
� ja, weniger als halbtags<br />
� nein, Hausfrau / Hausmann<br />
� nein, in Ausbildung<br />
� nein, arbeitslos, erwerbslos<br />
� nein, Erwerbs-, Berufsunfähigkeitsrente<br />
� nein, Altersrente<br />
� nein, anderes<br />
wenn ja, in welcher beruflichen Stellung sind Sie derzeit beschäftigt?<br />
� Arbeiter � Angestellter � Beamter � Selbständiger � Sonstiges<br />
27.) Haben Sie in den letzten fünf Jahren eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt?<br />
� ja � nein<br />
31.) Haben Sie in den letzten fünf Jahre eine von Ihrem Rentenversicherungsträger (BfA, LVA)<br />
finanzierten Maßnahme zur beruflichen Förderung teilgenommen (z.B. Umschulung)?<br />
� ja � nein<br />
32.) Wie würden Sie Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit beurteilen (ungeachtet, ob Sie einer konkreten<br />
Erwerbstätigkeit nachgehen oder nicht)? Bitte machen Sie auf der folgenden Skala an der<br />
entsprechenden Stelle ein Kreuz (Das Kreuz kann auch zwischen den Linien liegen)!<br />
|----------- | ----------- | -----------|----------- |<br />
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %<br />
33.) Besitzen Sie einen Schwerbehindertenausweis?<br />
� nein<br />
� beantragt<br />
� ja; mit welchem Behinderungsgrad? ................%<br />
34.) Welche der folgenden Bedingungen belast(et)en Sie in Ihrer (letzten) Berufstätigkeit?<br />
Überst<strong>und</strong>en<br />
Wechselschicht ohne Nachtarbeit<br />
Wechselschicht mit Nachtarbeit<br />
Akkord- oder Stückarbeit<br />
Lärm<br />
Gasförmige Schadstoffe (z.B. Rauch, Bohr-,<br />
Schweißdämpfe,...)<br />
Schadstoffpartikel (z.B. Holzstaub, Ruß,...)<br />
Allergene (z.B. Tierhaare, Pollen, Latex...)<br />
Hitze, Kälte, Nässe<br />
Arbeit am Bildschirm, EDV-Terminal<br />
10<br />
gar nicht wenig mittel ziemlich stark
Fortsetzung gar nicht wenig mittel ziemlich stark<br />
Körperlich schwere Arbeit<br />
Unangenehme einseitige körperliche<br />
Beanspruchung, Körperhaltung<br />
Hohes Arbeitstempo, Zeitdruck<br />
Arbeitstempo wird durch Maschinen bestimmt<br />
Starke Konzentration<br />
Widersprüchliche Anforderungen, Anweisungen<br />
Langeweile, gleichförmige Arbeit<br />
Häufige Störungen <strong>und</strong> Unterbrechungen<br />
Zwang zu schnellen Entscheidungen<br />
Hohe Verantwortung für Menschen<br />
Strenge Kontrollen durch Vorgesetzte<br />
35.) Haben Sie infolge der Atemwegserkrankung berufliche Veränderungen erfahren? Geben Sie<br />
bitte an, inwieweit nachfolgende Aussagen auf Sie zutreffen:<br />
gar<br />
nicht<br />
wenig mittel stark sehr<br />
stark<br />
Ich fühle mich durch die Arbeit stärker belastet � � � � �<br />
Meine Kollegen sind rücksichtsvoller � � � � �<br />
Ich habe schon eine berufliche Rückstufung<br />
hinnehmen müssen<br />
� � � � �<br />
Ich habe einen geringeren Verdienst � � � � �<br />
Mein berufliches Weiterkommen ist eingeschränkt � � � � �<br />
Mein Arbeitsplatz ist gefährdet � � � � �<br />
Ich muss mich verstärkt gegen Konkurrenz<br />
behaupten<br />
� � � � �<br />
Ich arbeite weniger als vor der Erkrankung � � � � �<br />
Ich bin schon an einen anderen Arbeitsort versetzt<br />
worden<br />
Ich habe eine andere Tätigkeit als vor der<br />
Erkrankung<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
Ich habe mehr Pausen als vorher � � � � �<br />
Ich habe auf einen anderen Beruf umgeschult � � � � �<br />
mein Verhältnis zu Kollegen hat sich verschlechtert � � � � �<br />
mein Verhältnis zu Kollegen hat sich verbessert � � � � �<br />
Sonstiges:<br />
________________________________________<br />
11<br />
� � � � �
36.) Bitte geben Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, inwiefern sie auf Ihren<br />
Arbeitsplatz zutreffen.<br />
1. Man muss sich sehr beeilen, um fertig zu<br />
werden ...<br />
2. Man muss Dinge tun, für die man eigentlich zu<br />
wenig ausgebildet ist ...<br />
3. Man hat soviel zu tun, dass es einem über den<br />
Kopf wächst ...<br />
4. Es kommt schon vor, dass einem die Arbeit zu<br />
schwierig ist ...<br />
5. Es passiert soviel auf einmal, dass man es kaum<br />
bewältigen kann ...<br />
6. Bei dieser Arbeit gibt es Sachen, die zu<br />
kompliziert sind ...<br />
7. Bei dieser Arbeit muss man zu viele Dinge auf<br />
einmal erledigen ...<br />
stimmt<br />
gar<br />
nicht<br />
(nie)<br />
stimmt<br />
kaum<br />
(selten)<br />
stimmt<br />
teilweise<br />
(manch<br />
-mal)<br />
stimmt<br />
ziemlich<br />
(oft)<br />
stimmt<br />
auf<br />
jeden<br />
Fall<br />
(immer)<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
37.) Wie häufig machten Sie sich in den letzten 12 Monaten Sorgen, dass Sie wegen Ihres<br />
Ges<strong>und</strong>heitszustan<strong>des</strong> in Zukunft ...<br />
Nicht bis zum Erreichen <strong>des</strong> Rentenalters berufstätig<br />
sein zu können?<br />
Ihre Erwerbsfähigkeit/Ihr Verbleib im Beruf dauerhaft<br />
gefährdet ist?<br />
Sich überlegen, einen Antrag zur Frühberentung zu<br />
stellen?<br />
nie manchmal oft immer<br />
� � � �<br />
� � � �<br />
� � � �<br />
38.) Wenn Sie nun an alles denken, was für Ihre Arbeit eine Rolle spielt (z.B. die Tätigkeit, die<br />
Arbeitsbedingungen, die Kollegen, die Vorgesetzten, die Arbeitszeit etc.), wie zufrieden sind<br />
Sie dann insgesamt mit Ihrer Arbeit?<br />
------------- ------------- -------------- --------------<br />
sehr eher mittel eher sehr<br />
unzufrieden unzufrieden zufrieden zufrieden<br />
12
Lebenszufriedenheit<br />
39.) Wir möchten nun noch ein paar Fragen zu Ihrer Lebenszufriedenheit stellen. Sie finden in der<br />
folgenden Tabelle verschiedene Bereiche der Lebensqualität. Bitte kreuzen Sie das<br />
momentane Ausmaß an, das Ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem jeweiligen<br />
Bereich entspricht. Bitte lassen Sie keinen Bereich aus:<br />
sehr<br />
zufrieden<br />
eher<br />
zufrieden<br />
weder<br />
noch<br />
eher<br />
unzufrieden<br />
sehr<br />
unzufrieden<br />
Ges<strong>und</strong>heit � � � � �<br />
bisheriger Behandlungserfolg im<br />
Krankheitsverlauf<br />
� � � � �<br />
körperliche Verfassung � � � � �<br />
geistige Verfassung � � � � �<br />
Stimmung � � � � �<br />
Mit meinem Aussehen � � � � �<br />
Fähigkeiten � � � � �<br />
Charakter � � � � �<br />
berufliche Situation � � � � �<br />
finanzielle Lage � � � � �<br />
Ehe/Partnerschaft � � � � �<br />
Sexualleben � � � � �<br />
Freizeitgestaltung � � � � �<br />
Familienleben � � � � �<br />
Verhältnis zu den Kindern � � � � �<br />
Sozialkontakten<br />
(Fre<strong>und</strong>e/Bekannte)<br />
� � � � �<br />
Leben insgesamt � � � � �<br />
Beratungswünsche für die anstehende Rehabilitationsmaßnahme<br />
40.) Würden Sie sich generell für sich selbst eine ausführliche Beratung zu Themen im<br />
Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Situation oder Perspektive wünschen?<br />
------------- ------------- -------------- --------------<br />
gar nicht eher nein mittel eher ja ja, sehr<br />
13
41.) Zu welchen Themen würden Sie im Verlauf der Rehabilitationsmaßnahme gerne beraten<br />
werden?<br />
Themenbereich<br />
Allergien <strong>und</strong> die daraus folgenden<br />
Einschränkungen am Arbeitsplatz<br />
Zusammenhänge zwischen meiner<br />
Atemwegserkrankung <strong>und</strong> meiner beruflichen<br />
Situation<br />
Umgang mit Kollegen im Zusammenhang mit<br />
meiner Erkrankung<br />
Umgang mit Vorgesetzten im Zusammenhang<br />
mit meiner Erkrankung<br />
Zukunftsperspektiven im Berufsleben mit meiner<br />
Erkrankung<br />
nicht<br />
notwendig<br />
ja, kurzer<br />
Überblick<br />
ja, ausführliche<br />
Beratung<br />
Wie bleibe ich im Beruf ohne mich zu überfordern<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Beantragung der Berentung<br />
Medizinische Rehabilitation<br />
Berufliche Rehabilitation<br />
Weiter-/Fortbildungen<br />
Umschulungsmöglichkeiten<br />
Umgang mit Kollegen/Vorgesetzten<br />
Wer ist mein Ansprechpartner für...?<br />
Weiterführende Kontaktmöglichkeiten (Ämter,<br />
Kassen, Versicherungen, usw.)<br />
Wie geht es weiter?<br />
Kontaktmöglichkeiten vor Ort (Hilfsverbände,<br />
Selbsthilfegruppen, usw.)<br />
Angaben zur Person <strong>und</strong> allgemeine Informationen<br />
Wir möchten Sie bitten, uns abschließend einige Personaldaten anzugeben, die wir - wie alles übrige -<br />
streng vertraulich behandeln.<br />
42.) Wie alt sind Sie? Lebensalter in Jahren: ___<br />
43.) Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? deutsch nicht deutsch<br />
44.) Geschlecht: männlich weiblich<br />
45.) Familienstand (bitte ankreuzen):<br />
ledig verheiratet geschieden/getrennt lebend verwitwet<br />
46.) Leben Sie mit einem festen Partner zusammen?<br />
ja ja<br />
47.) Wie viele Kinder haben Sie?<br />
.............. Kinder<br />
14
48.) Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selber eingeschlossen?<br />
Insgesamt ..............Personen<br />
49.) Wie viele sind davon über 18 Jahre alt?<br />
Insgesamt ..............Personen<br />
50.) Höchster erreichter Schulabschluss<br />
Haupt-/Volksschule<br />
Realschule/ Mittlere Reife<br />
Polytechnische Oberschule<br />
Fachhochschulreife<br />
Abitur/ allgemeine Hochschulreife<br />
anderen Schulabschluss<br />
keinen Schulabschluss<br />
51.) Welcher Kostenträger finanziert Ihre anstehende Rehabilitationsmaßnahme?<br />
LVA (Name: ______________________)<br />
BfA<br />
Bahnversicherung<br />
B<strong>und</strong>esknappschaft<br />
Seekasse<br />
Krankenkasse<br />
Sonstiges, nämlich: ___________________<br />
Nachdem Sie nun alle Fragen bearbeitet haben, möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass<br />
die Richtigkeit Ihrer Angaben für Ihre umfassende Behandlung von großer Bedeutung ist. Daher<br />
möchten wir Sie bitten, die Fragen noch einmal durchzugehen <strong>und</strong> sie auf die Vollständigkeit der<br />
Bearbeitung <strong>und</strong> die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen.<br />
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!<br />
Falls Sie Anmerkungen haben, können Sie diese hier gerne aufschreiben:<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________________________<br />
15
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Projektgruppe<br />
Berufliche Orientierung in der<br />
pneumologischen Rehabilitation<br />
Zwischenbericht<br />
Dr. U. Kaiser, Dr. E. Petri, K. Pleyer,<br />
P. Bleuel, Dr. Chr. Bizer, S. Lippitsch<br />
Davos-Wolfgang<br />
November 2000
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Arbeitsauftrag <strong>und</strong> Zielsetzung der Projektgruppe<br />
2. Problemanalyse <strong>und</strong> wegleitende Fragen<br />
3. Ergebnisse<br />
3.2. Strukturen<br />
3.2. Prozesse<br />
3.2.1. Aufnahmeprozedur<br />
3.2.2. Vorläufige Definition der Risikopatienten<br />
3.2.3. Zielorientierter Zuweisungsprozess – Zuständigkeiten<br />
3.2.4. Verbesserung der Reha-Nachsorge<br />
4. Anlagen<br />
Anlage 1:<br />
Anlage 2:<br />
Anlage 3:<br />
Ablauf der Prozeßsteuerung in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Prozesssteuerung für Risikopatienten<br />
Folien zur Projektumsetzung<br />
- 2 -
1. Arbeitsauftrag <strong>und</strong> Zielsetzung der Projektgruppe<br />
� Umsetzung <strong>des</strong> gesetzlichen Auftrages der Rehabilitation<br />
� Konsequenzen aus den Ergebnissen <strong>des</strong> fortlaufenden Patientenbefragung<br />
� Analyse <strong>des</strong> Ist-Zustan<strong>des</strong> der Strukturen <strong>und</strong> Prozesse im Bereich der Sozialmedizin<br />
� Erarbeitung eines Soll-Zustan<strong>des</strong> der Strukturen <strong>und</strong> Prozesse<br />
� Qualitätsverbesserung im sozialmedizinischen Bereich innerhalb der Gesamtbehandlung<br />
Auswertungsbereiche im Kontext<br />
der Fragestellungen<br />
Bereiche<br />
der<br />
Reanalyse<br />
Nachbefragung<br />
Expertenbefragung<br />
Implementierung<br />
Einflußgrößen auf die Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit in der<br />
Wechselwirkung mit dem interdisziplinären Behandlungskonzept<br />
objektive<br />
Arbeitsplatzsituation<br />
Beanspruchung<br />
somatisch Diagnostik<br />
funktional<br />
Arbeits- <strong>und</strong><br />
Erwerbsfähigkeit<br />
Therapie<br />
Beratung<br />
psychosozial Schulung<br />
subjektives<br />
Erleben<br />
Belastung<br />
Risikoprofil Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit, Frühberentung<br />
Screening zur gezielten Zuweisung <strong>und</strong> Implementierung<br />
eines Beratungs- <strong>und</strong> Informationszentrums<br />
Einflußgrößen in der<br />
poststationären<br />
Phase:<br />
Krankheitsverlauf<br />
- somatisch<br />
- funktional<br />
- psychosozial<br />
- edukativ<br />
Nachsorgeangebote<br />
<strong>und</strong> Weiterbehandlung<br />
- Erreichbarkeit<br />
- Qualität<br />
- Zufriedenheit<br />
Bedingungen der<br />
Lebens- <strong>und</strong><br />
Arbeitswelt<br />
Verbesserung<br />
beruflicher/sozialer<br />
Hilfen<br />
In Anlehnung an das theoretische Modell <strong>des</strong> Verb<strong>und</strong>projektes muss die Erwerbsfähigkeit<br />
mehrdimensional hinsichtlich Risikofestlegung (Indikation), Diagnostik/Beurteilung <strong>und</strong> folglich<br />
auch für die Bereiche der Therapie, Schulung <strong>und</strong> Beratung Berücksichtigung finden.<br />
Insbesondere müssen hierbei objektive Faktoren der Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> das subjektive<br />
Erleben bzw. die subjektive Beurteilung <strong>des</strong> Patienten beachtet werden<br />
2. Problemanalyse <strong>und</strong> wegleitende Fragen<br />
� Unzureichende Berücksichtigung der beruflichen Situation der Patienten in der Aufnahmeprozedur<br />
� Passive Erwartungshaltung der Patienten an eine Rehabilitationsmaßnahme<br />
� Häufig Selbstzuweisung der Patienten in die Rehabilitationsangebote<br />
� Häufig werden Risikopatienten erst gegen Ende der Maßnahme erkannt, was zu Zeitproblemen<br />
führt<br />
� Hieraus resultiert eine unzureichende Einbeziehung <strong>des</strong> Patienten in dieses wesentliche<br />
Gebiet der Rehabilitation (Aufklärung, umfassende Beratung)<br />
� Schnittstellenprobleme (Stationsarzt – Sozialmedizin – Beratung) führen zu Zeitverlusten:<br />
langer Zeitraum bis die zu einer umfassenden Beurteilung <strong>und</strong> Beratung notwendigen<br />
Ergebnisse der weitergehenden Diagnostik vorliegen<br />
� Die Mehrdimensionalität der Erwerbsfähigkeit (Zusammenwirken von somatischen, funktionalen,<br />
psychosozialen <strong>und</strong> behandlungsbezogenen Einflussfaktoren) wird nicht berücksichtigt<br />
– einseitige somatische Sichtweise<br />
� Die Beurteilung erfolgt erst gegen Abschluss der Maßnahme, so dass eine umfassende<br />
Beratung nicht mehr möglich ist (insbesondere ein Problem, wenn die Erwerbsunfähigkeit<br />
- 3 -
die Folge ist bzw. weiterführende Maßnahmen zum Verbleib im Erwerbsleben notwendig<br />
sind)<br />
� Der Transfer der Ergebnisse durch den Stationsarzt <strong>und</strong> den Arztbrief (Dauer bis zur<br />
Versendung) verhindern bei den Problempatienten eine reibungslose Weiterberatung im<br />
Rahmen der Nachsorge (Schnittstellenproblem)<br />
� Verbesserung der Schnittstellen (Prozesse, Reha-Nachsorge)<br />
Hieraus ergeben sich für die Projektgruppe folgende wegleitende Fragen:<br />
1. Wie kommt der Stationsarzt möglichst bereits bei der Aufnahme zur Indikation für eine<br />
sozialmedizinische Beurteilung <strong>und</strong> Beratung (Risikoprofile, Assessmentinstrumente)?<br />
2. Wie können alle Strukturen der Klinik durch geeignete Prozesse gezielt zur Identifikation<br />
der Risikopatienten <strong>und</strong> zur umfassenden Therapie, Information <strong>und</strong> Beratung<br />
genutzt werden (Optimierung Strukturen/Prozesse, wie/wer begutachten, wie/wer beraten)<br />
3. Wie kann die Schnittstelle zur Nachsorge verbessert werden (Aufklärung, Arztbrief,<br />
Instrument zur Information <strong>des</strong> Hausarztes)?<br />
3. Ergebnisse<br />
3.1. Strukturen:<br />
Die Strukturen zur zielorientierten Einbeziehung beruflicher Aspekte in der pneumologischen<br />
Rehabilitation sind in der HKW überwiegend vorhanden. Veränderungen <strong>und</strong> Ausweitungen<br />
sind in folgenden Bereichen notwendig:<br />
� Implementierung eines Rehabilitations-Informations- <strong>und</strong> Beratungszentrums (BIZ): genauere<br />
Ausrichtung auf diesen Schwerpunkt erforderlich. Neben einer allgemeinen sozialrechtlichen<br />
Beratung <strong>und</strong> Information (Einzelberatung, Seminare, Merkblätter, Bücher,<br />
etc.) erfolgt insbesondere für die Risikopatienten die Beratung individuell <strong>und</strong> zielorientiert.<br />
Die Ziele ergeben sich aus der individuellen Problemlage, die aufgr<strong>und</strong> der Diagnostik<br />
<strong>und</strong> Bef<strong>und</strong>e durch die Sozialmedizin definiert wird. Die Beratung beinhaltet vorwiegend<br />
− Allgemeine Beratung <strong>und</strong> Information<br />
− Entwicklung von allgemeinen <strong>und</strong> krankheitsbezogenen Fragestellungen (Perspektive<br />
zur Reha-Nachsorge)<br />
− Erschließen von zeitnahen Informations- <strong>und</strong> Beratungsquellen nach Klinikentlassung<br />
� Erweiterung der Patientenschulung inklusive Merkblätter:<br />
− Seminar: „Sozialrechtliche Aspekte für Patienten mit chronischen Krankheiten“<br />
− Seminar: „Rehabilitation chronischer Erkrankungen“<br />
− Seminar „Asthma, Umwelt <strong>und</strong> Arbeitsplatz“<br />
− Merkblatt GdB<br />
- 4 -
Struktur- <strong>und</strong> Prozessmerkmale<br />
<strong>des</strong> beruflichen Ansatzes<br />
Diagnostik<br />
Indikation<br />
Intervention<br />
3.2. Prozesse<br />
Sozial-<br />
Arbeitsanamnese<br />
Stationsarzt<br />
(Case-Manager)<br />
Reha-<br />
Nachsorge<br />
Sozialmedizin<br />
Beurteilung<br />
BIZ<br />
Beratung<br />
Fallkonferenz<br />
Qualifizierung/Sensibilisierung<br />
der Mitarbeiter aller Bereiche<br />
Assessmentverfahren<br />
Frühzeitige Risikoabschätzung<br />
Zielorientierung<br />
Prozesssteuerung<br />
Sozialmedizin/Beurteilung<br />
Diagnostik/Interventionen<br />
Reha-Psychologie<br />
Sporttherapie<br />
Physiotherapie<br />
Schulung<br />
Beratungszentrum<br />
Hilfen zur Reha-Nachsorge<br />
Arztbrief<br />
Die vorhandenen Strukturen müssen durch eine Prozessoptimierung zur Zielerreichung verbessert<br />
werden. Hierzu wurden entsprechende Steuerungsinstrumente Überarbeitet bzw.<br />
erarbeitet (Anlage 3 <strong>und</strong> 4). Folgende Abläufe <strong>und</strong> Zuständigkeiten als erforderlich erachtet.<br />
3.2.1. Aufnahmeprozedur<br />
� Sensibilisierung <strong>des</strong> Stationsarztes für dieses Thema<br />
� Prüfung <strong>des</strong> Vorliegens von Risikomerkmalen bei Patienten (Prädiktoren eines erhöhten<br />
Risikos zur Frühberentung)<br />
� Ausführliche Verankerung dieses Bereiches in der Anamnese unter Berücksichtigung <strong>des</strong><br />
sozialmedizinischen Fragebogens<br />
3.2.2. Vorläufige Definition der Risikopatienten<br />
� Aktuell arbeitsunfähige Patienten <strong>und</strong> insbesondere Patienten, die 4 Wochen <strong>und</strong> länger<br />
in den letzten 12 Monaten arbeitsunfähig waren<br />
� Patienten, bei denen ein Rentenantrag läuft (Reha vor Rente)<br />
� Patienten die aus ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen arbeitslos sind<br />
� Patienten, die am Arbeitsplatz Probleme haben: Belastung, Beanspruchung, soziale Konflikte,<br />
Schadstoffe, etc.<br />
� Patienten, die sozialmedizinische Probleme haben (z.B. Rentenbegehren, Fragen zur<br />
Schwerbehinderung, etc.)<br />
� Patienten, die offensichtlich eine Tätigkeit/einen Beruf ausüben, der mit der Krankheit<br />
(Schwere, Prognose, Allergie, etc.) unvereinbar zu sein scheint<br />
- 5 -
3.2.3. Zielorientierter Zuweisungsprozess – Zuständigkeiten (vgl. Anlage 1 <strong>und</strong> 2)<br />
Aufnahmetag<br />
a. Anamnese zur Rehabilitation inkl. Auswertung <strong>des</strong> sozialmedizinischen Fragebogens<br />
b. Einleitung der Basisdiagnostik durch den Stationsarzt<br />
− Lungenfunktionsdiagnostik<br />
− Methacholintest/Histamintest<br />
− Ergometrie mit Blutgasen oder Laufbandgehstreckentest<br />
− evtl. EIA-Test<br />
− Allergiediagnostik<br />
− Psychosoziale Diagnostik<br />
− Funktionale Diagnostik Physiotherapie, Sporttherapie<br />
Alle Elemente der Prozeßsteuerung liegen beim Stationsarzt:<br />
c. Risikopatienten bestimmen (Anamnese, Gespräch, Merkmale)<br />
d. Risikoprofile festlegen<br />
e. Zielorientierte Einleitung sporttherapeutischer Maßnahmen<br />
f. Zielorientierte Zuweisung in die Patientenschulung (Vorträge <strong>und</strong> Seminare)<br />
g. Festlegung der Rehaziele unter besonderer Berücksichtigung beruflicher Aspekte unter<br />
Mitwirkung <strong>des</strong> Patienten (vgl. Anamnese Rehabilitation)<br />
Aufnahmevisite (24 h nach Aufnahme) durch CA/OA:<br />
ggf. Abstimmung der Risikoprofile/ Rehaziele mit CA/OA bei Risikopatienten<br />
1-7 Tag: Stationsarzt: zielorientierte Zuweisung<br />
a. Psychologische Basisdiagnostik<br />
b. Ernährungsberatung<br />
c. Sozialmedizinnische Begutachtung mit Anschluss einer Beratung im BIZ (Beratungs-<br />
<strong>und</strong> Informationszentrum)<br />
d. ....<br />
Spätestens 10-12 Tag: Vorstellung in der Sozialmedizin<br />
a. Risikopatienten vorstellen (Vorlage vollständiger Reha-Akte)<br />
b. Prüfung ob Prolongation (Erreichung der Reha-Ziele)<br />
c. Hinweise an den Stationsarzt zur Ergänzung der medizinischen Diagnostik (Integration<br />
Urteilsbildung)<br />
- 6 -
Prozesssteuerung beim Stationsarzt:<br />
Zielorientierte Zuweisung in<br />
− Reha-Psychologie: Angst, Depression, regressives Krankheitsverhalten, unzulängliche<br />
Krankheitsverarbeitung, erhöhte ges<strong>und</strong>heitliche Besorgnis <strong>und</strong><br />
vermindertes Belastbarkeitsempfinden, „Rentenneurose“, soziale Kompetenz,<br />
etc.<br />
− BIZ: zielorientierte Beratung nach Vorgabe Sozialmedizin<br />
− Sporttherapie<br />
− Physiotherapie<br />
− Andere: .....<br />
Fallkonferenz (Stationsarzt, Chefarzt, Oberarzt, Sozialmedizin, BIZ):<br />
a. Überprüfung <strong>des</strong> Risikostatus´ der Patienten<br />
b. ggf. (Neu-)Festlegung von Rehabilitationszielen<br />
c. Überprüfung der Notwendigkeit von Maßnahmen zur beruflichen Förderung<br />
Bis spätestens 1 Tag vor Entlassung: Berücksichtigung der Ergebnisse aus Diagnostik,<br />
Therapie <strong>und</strong> Beratung zur sozialmedizinischen Beurteilung (Sozialmedizin)<br />
<strong>und</strong> Sozialberatung (BIZ)<br />
a. Alle Berichte liegen vor (Reha-Psychologie, BIZ, Schlusstest Sporttherapie, etc.)<br />
b. Abschließende Beurteilung<br />
c. Mitteilung über Ergebnisse an Stationsarzt<br />
1 Tag vor Entlassung (Stationsarzt)<br />
a. Entlassungsgespräch<br />
b. Abschließende Bestimmung, Besprechung <strong>und</strong> Einleitung der Nachsorgemaßnahmen<br />
c. Nachsorgeformular an Patient, Formular an Kostenträger (Reha)<br />
Arztbrief (Stationsarzt)<br />
a. Mit Entlassung <strong>des</strong> Patienten versenden<br />
b. Sozialmedizinische Aspekte umfassend erläutern<br />
c. Nachsorgeformular <strong>und</strong> Kostenträgerformular beifügen (vgl. Anlage 4)<br />
3.2.4. Verbesserung der Reha-Nachsorge<br />
� Einbettung <strong>des</strong> Bereiches in den Arztbericht (Integration aller Aspekte zur Erwerbsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> Vorschläge weiterer Behandlungen, Beratungen, etc.)<br />
� Sensibilisierten, aufgeklärten, eigenverantwortlichen <strong>und</strong> handlungsfähigen Patienten<br />
schaffen<br />
� Hausarzt als Case-Manager <strong>und</strong> Kostenträger umfassend <strong>und</strong> zügig über die Ergebnisse<br />
<strong>und</strong> Empfehlungen informieren<br />
� Im Einzelfall Kontakt mit örtlichen Institutionen zur Sensibilisierung von Situationsproblematik<br />
<strong>und</strong> Einleitung weitergehender Maßnahmen aufnehmen, Wege ebnen<br />
� Kooperationen schaffen<br />
- 7 -
Anlage 1: Ablauf der Prozesssteuerung in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Schematischer Ablauf der Prozesssteuerung für Risikopatienten<br />
in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Zeitraum Ausführender Vorgang<br />
Aufnahmetag Stationsarzt • Anamnesegespräch unter Vorliegen<br />
<strong>des</strong> Fragebogens zur Sozial- <strong>und</strong> Arbeitsanamnese<br />
• Risikopatienten bestimmen<br />
• Reha-Ziele, Risikoprofil festlegen<br />
• (Basis-)diagnostik einleiten<br />
• Einleitung Sporttherapie<br />
Aufnahmevisite<br />
(24h<br />
nach Aufnah-<br />
me)<br />
Chefarzt/ Oberarzt<br />
mit Stationsarzt<br />
• Seminare<br />
ggf. Abstimmung der Rehaziele/<br />
Risikoprofile mit CA/OA<br />
1.-7. Tag Stationsarzt Zielorientierte individuelle Zuweisung:<br />
• Psychologische Basisdiagnostik<br />
• Ernährungsberatung<br />
• Sozialmedizinische Begutachtung mit<br />
anschließender Beratung im BIZ<br />
• ergänzende Diagnostik/ Therapie/ Be-<br />
bei Bedarf<br />
Einberufung<br />
spätestens<br />
nach 10 – 12<br />
Tagen<br />
bis spätestens<br />
1 Tag vor Ent-<br />
lassung<br />
Bis spätestens<br />
1 Tag vor Entlassung<br />
Fallkonferenz<br />
(Stationsarzt, OA,<br />
CA, Sozialmedi-<br />
zin, BIZ)<br />
ratung/ Schulung<br />
• Prüfung der Notwendigkeit berufsfördernder<br />
Maßnahmen<br />
• Überprüfung Rehaziele, Risikoprofil<br />
Sozialmedizin • Prüfung einer Prolongation<br />
• Begutachtung (vorläufig, endgültig)<br />
• Hinweise zu Maßnahmen an<br />
Stationsarzt<br />
Sozialmedizin Endgültige sozial-/ arbeitsmedizinische<br />
Beurteilung an Stationsarzt auf Gr<strong>und</strong>lage<br />
aller Ergebnisse/ Berichte<br />
Stationsarzt auf Gr<strong>und</strong>lage aller Ergebnisse/<br />
Berichte:<br />
• Entlassungsgespräch<br />
• Abschließende Bestimmung, Besprechung<br />
<strong>und</strong> Einleitung der Nachsorgemaßnahmen<br />
• Nachsorgeformular<br />
Entlassung Stationsarzt • Arztbrief mit sozialmed. Aspekten<br />
• Nachsorgeformular<br />
• Kostenträgerformular<br />
Erledigt<br />
am:
Anlage 2: Prozesssteuerung für Risikopatienten<br />
Verdacht<br />
ergänztes Basisprogramm<br />
Risikopatienten haben Priorität (Kennzeichnung!)<br />
individuell, zielorientiert<br />
Basisdiagnostik<br />
• Basis-Allergiediagnostik<br />
• Laboranalyse<br />
• Lungenfunktionsdiagnostik<br />
Basisangebote<br />
• Medikamentöse Therapie<br />
• Psychosoziale Rehabilitation<br />
• Physikalische Therapie<br />
• Ernährungsberatung<br />
Zusatzinformationen<br />
• Sozial– <strong>und</strong> Arbeitsanamnese (Patientenangaben)<br />
• Anforderungen (Stationsarztangaben)<br />
Prozesssteuerung:<br />
Stationsarzt<br />
BIZ<br />
spezifische<br />
Beratung<br />
nein<br />
alle Ergebnisse/Berichte<br />
BIZ<br />
ggf. Beratung<br />
Sozialmedizin<br />
abschließende Arbeits-/<br />
Sozialmedizinische<br />
Beurteilung<br />
(Reha-)Anamnese & sonstige Information<br />
Sozialmedizin<br />
vorläufige<br />
sozial–/arbeits-medizinische<br />
Beurteilung<br />
durch Sozialmediziner<br />
(weitere) Maßnahmen?<br />
Stationsarzt:<br />
Risikopatient?*<br />
Fallkonferenz<br />
(STA, CA, BIZ, SozM)<br />
• Urteilsbildung<br />
• Risikoprofil<br />
• Zieldefinition<br />
Stationsarzt<br />
Entlassungsgespräch (Stationsarzt)<br />
• Nachsorgeinformation <strong>und</strong> -formular für/an Patient<br />
• weitergehende Empfehlungen an andere Institutionen<br />
nein<br />
<br />
zum Nicht-Risikopatienten<br />
*Risikokriterien<br />
• Aktuell arbeitsunfähig (insbes. >4 Wochen<br />
im letzten Jahr)<br />
• Rentenantrag läuft<br />
• aus ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen arbeitslos<br />
• Probleme am Arbeitsplatz (Belastung, Beanspruchung,<br />
sozial,...)<br />
• sozialmedizinische Probleme<br />
(Rentenbegehren, Schwerbeh.,...)<br />
• mit Krankheit unvereinbare Tätigkeit<br />
Angebote insbesondere für<br />
Risikopatienten<br />
Risikopatienten haben Priorität<br />
Spezifische Diagnostik<br />
• Erweiterte Lungenfunktionsdiagnostik<br />
• Methacholintest/ Histamintest<br />
• Ergometrie mit Blutgasen oder Laufbandgehstreckentest<br />
• evtl. EIA-Test<br />
• Erweiterte Allergiediagnostik<br />
• Psychosoziale Diagnostik (FPI, BL,<br />
ASL, FKV)<br />
• Sport <strong>und</strong> Bewegung (6-Minuten-<br />
Gehtest, Ergometer)<br />
Spezifische Angebote<br />
• Patientenschulung<br />
• Psychologische Beratung/Therapie<br />
• Sporttherapie/Physiotherapie<br />
Ergebnis/Bericht/Akte<br />
nein<br />
Unterlagen versenden an zuweisenden Arzt/ zur Nachsorgeinstitution<br />
• BfA-Formular an zuständige Stelle<br />
• Arztbrief verschicken<br />
ja<br />
ja Bf-Fall?<br />
Risikopatient<br />
Zeitachse<br />
Aufnahmetag<br />
kurz vor<br />
Entlassung
Anlage 3: Folien zur Projektumsetzung
Berufliche Orientierung in der<br />
pneumologischen Rehabilitation<br />
Zwischenbericht der projektbegleitenden Projektgruppe<br />
November 2000<br />
Dr. U. Kaiser, Dr. E. Petri, K. Pleyer, P. Bleuel, Dr. C. Bitzer & S. Lippitsch<br />
Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang<br />
Auswertungsbereiche im Kontext<br />
der Fragestellungen<br />
Bereiche<br />
der<br />
Reanalyse<br />
Nachbefragung<br />
Expertenbefragung<br />
Implementierung<br />
Einflußgrößen auf die Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit in der<br />
Wechselwirkung mit dem interdisziplinären Behandlungskonzept<br />
objektive<br />
Arbeitsplatzsituation<br />
Beanspruchung<br />
somatisch Diagnostik<br />
funktional<br />
Arbeits- <strong>und</strong><br />
Erwerbsfähigkeit<br />
Therapie<br />
Beratung<br />
psychosozial Schulung<br />
subjektives<br />
Erleben<br />
Belastung<br />
Risikoprofil Arbeits- <strong>und</strong> Erwerbsfähigkeit, Frühberentung<br />
Screening zur gezielten Zuweisung <strong>und</strong> Implementierung<br />
eines Beratungs- <strong>und</strong> Informationszentrums<br />
Einflußgrößen in der<br />
poststationären<br />
Phase:<br />
Krankheitsverlauf<br />
- somatisch<br />
- funktional<br />
- psychosozial<br />
- edukativ<br />
Nachsorgeangebote<br />
<strong>und</strong> Weiterbehandlung<br />
- Erreichbarkeit<br />
- Qualität<br />
- Zufriedenheit<br />
Bedingungen der<br />
Lebens- <strong>und</strong><br />
Arbeitswelt<br />
Verbesserung<br />
beruflicher/sozialer<br />
Hilfen
Arbeitsauftrag Projektgruppe<br />
Umsetzung <strong>des</strong> gesetzlichen Auftrages der<br />
Rehabilitation<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> F-QS integrieren<br />
Analyse <strong>des</strong> Ist-Zustan<strong>des</strong> der Strukturen <strong>und</strong><br />
Prozesse im Bereich der Sozialmedizin<br />
Erarbeitung eines Soll-Zustan<strong>des</strong> der Strukturen<br />
<strong>und</strong> Prozesse<br />
Qualitätsverbesserung im sozialmedizinischen<br />
Bereich innerhalb der Gesamtbehandlung<br />
Problemanalyse (1)<br />
Unzureichende Berücksichtigung in der<br />
Aufnahmeprozedur<br />
Passive Erwartungshaltung der Patienten<br />
Häufige Selbstzuweisung der Patienten (Ziele,<br />
Therapiesteuerung)<br />
Zu späte Erkennung von Risikopatienten<br />
Unzureichende Einbeziehung <strong>des</strong> Patienten<br />
(Aufklärung, Beratung)<br />
Schnittstellenprobleme (Stationsarzt, Sozialmedizin,<br />
Beratung, etc.) führen zu Zeitverlusten
Problemanalyse (2)<br />
die Mehrdimensionalität der Erwerbsfähigkeit<br />
wird unzureichend berücksichtigt<br />
häufig einseitige somatische <strong>und</strong> funktionale<br />
Sichtweise<br />
Beurteilung erfolgt zu spät, was umfassende<br />
Beratung erschwert<br />
Einleitung der Nachsorge <strong>und</strong> Arztbrief<br />
Lösungsansätze<br />
Risikoprofile <strong>und</strong> Assessmentsteuerung zur<br />
‚sozialmedizinischen Indikation‘<br />
Ausrichtung aller Strukturen <strong>und</strong> Prozesse<br />
auf das zentrale Ziel der Erwerbsfähigkeit<br />
Verbesserung der sozialmedizinischen<br />
Beratung<br />
Verbesserung der Schnittstellen (Prozesse,<br />
Reha-Nachsorge)
Ergebnisse<br />
Ausweitung der Strukturen um ein Rehabilitations-<br />
Beratungs- <strong>und</strong> Informationszentrum<br />
Allgemeine Beratung <strong>und</strong> Information<br />
Umsetzung der sozialmedizinischen Beurteilung<br />
Entwicklung von allgemeinen <strong>und</strong> krankheitsbezogenen<br />
Fragestellungen<br />
Erarbeitung der Perspektive zur Reha-Nachsorge<br />
Erschließen von zeitnahen Informations- <strong>und</strong> Beratungsquellen<br />
nach der Entlassung<br />
Struktur- <strong>und</strong> Prozessmerkmale<br />
<strong>des</strong> beruflichen Ansatzes<br />
Diagnostik<br />
Indikation<br />
Intervention<br />
Sozial-<br />
Arbeitsanamnese<br />
Stationsarzt<br />
(Case-Manager)<br />
Reha-<br />
Nachsorge<br />
Sozialmedizin<br />
Beurteilung<br />
BIZ<br />
Beratung<br />
Fallkonferenz<br />
Qualifizierung/Sensibilisierung<br />
der Mitarbeiter aller Bereiche<br />
Assessmentverfahren<br />
Frühzeitige Risikoabschätzung<br />
Zielorientierung<br />
Prozesssteuerung<br />
Sozialmedizin/Beurteilung<br />
Diagnostik/Interventionen<br />
Reha-Psychologie<br />
Sporttherapie<br />
Physiotherapie<br />
Schulung<br />
Beratungszentrum<br />
Hilfen zur Reha-Nachsorge<br />
Arztbrief
Risikopatienten (vorläufig)<br />
arbeitsunfähig (aktuell, insbesondere >4 Wochen in den letzten 12<br />
Monaten<br />
laufender Rentenantrag (Reha vor Rente)<br />
arbeitslos aus ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen<br />
Konflikte/Probleme am Arbeitsplatz: Belastung/Beanspruchung,<br />
soziale Konflikte, Schadstoffe, etc.<br />
sozialmedizinische Probleme: z.B. Rentenbegehren,<br />
Schwerbehinderung, etc.<br />
Tätigkeit/Beruf, die/der mit der Krankheit nicht vereinbar erscheint<br />
(Schwere, Prognose, Allergie, etc.)<br />
Steuerungsinstrumente<br />
Fragebogen Sozial- <strong>und</strong> Arbeitsanamnese (vor<br />
Aufnahme)<br />
Anamnesebogen Rehabilitation<br />
Anmeldung zur sozialmedizinischen Beurteilung<br />
Rückmeldung der (vorläufigen/endgültigen)<br />
sozialmedizinischen Beurteilung an den Stationsarzt<br />
Basisdokumentation Reha-Psychologie<br />
Überweisungsformular Reha-BIZ<br />
Bericht BIZ (Kurz-/Langversion) an Stationsarzt
Sozial- <strong>und</strong> Arbeitsanamnese<br />
Basisdaten, allg. berufliche Situation<br />
Berufsausübung, Status<br />
Arbeitsbereich: Tätigkeitsmerkmale<br />
Beanspruchung <strong>und</strong> Arbeitsbelastungen<br />
Bisherige Rehabilitationsmaßnahmen<br />
Belastungen <strong>und</strong> Schwierigkeiten außerhalb<br />
<strong>des</strong> Berufes<br />
Reha-Anamnese (1)<br />
Diagnosen<br />
Allgemeine <strong>und</strong> klinische Anamnese<br />
Pneumologische Anamnese<br />
HNO-Anamnese<br />
Allergieanamnese<br />
Gegenwärtige Therapie<br />
Behandelnde Ärzte<br />
Initiative zur Reha-Antragstellung
Reha-Anamnese (2)<br />
Allgemeine Sozialanamnese<br />
Krankheitsverständnis <strong>und</strong> Informationsstand <strong>des</strong><br />
Patienten<br />
Aufnahmebef<strong>und</strong><br />
Vorbef<strong>und</strong>e<br />
Ergänzende Diagnostik<br />
Lebensqualitätsindices<br />
Rehabilitationsdiagnosen<br />
Rehabilitationsziele <strong>und</strong> Rehabilitationsplanung<br />
Somatische Therapieziele<br />
Problembereich<br />
Asthma<br />
Atemnot<br />
Atempumpe<br />
Auswurf<br />
Entzündungszeichen<br />
Gewicht<br />
Husten<br />
Hyperreagibilität<br />
Kardiopulmonale Leistungsfähigkeit<br />
Pulmonale Symptomatik<br />
Respiratorische Insuffizienz<br />
Schmerzen<br />
Sekretmobilisation<br />
Ventilationsstörung<br />
Therapieziel<br />
Reduktion der Anfallshäufigkeit<br />
Besserung der Atemnot<br />
Besserung der Funktion der Atempumpe<br />
Reduktion <strong>des</strong> Auswurfs<br />
Reduktion von Entzündungszeichen<br />
Gewichtsreduktion<br />
Reduktion <strong>des</strong> Hustens<br />
Verminderung der bronchialen Hyperreagibilität<br />
Besserung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit<br />
Besserung der nächtlichen (pulmonalen) Symptomatik<br />
Besserung der respiratorischen Insuffizienz<br />
Schmerzreduktion<br />
Besserung der Sekretmobilisation<br />
Besserung der Ventilationsstörung
Funktionsbezogene Therapieziele<br />
Problembereich<br />
Gehstrecke<br />
Schlafstörungen<br />
Selbstversorgung<br />
Treppensteigen<br />
Vigilanz<br />
Haushaltsführung<br />
Hobbys<br />
Reisefähigkeit<br />
Sportliche Aktivitäten<br />
Therapieziel<br />
Verlängerung der Gehstrecke<br />
Verminderung von Schlafstörungen (Durchschlafstörungen,<br />
Einschlafstörungen<br />
Verbesserung der Selbstversorgung<br />
Verbesserung der Fähigkeit, Treppen zu steigen<br />
Verbesserung der Vigilanz<br />
Verbesserung der Fähigkeit zur Haushaltsführung<br />
Verbesserung der Fähigkeit zur Ausführung von Hobbys<br />
Verbesserung der Reisefähigkeit<br />
Verbesserung der Fähigkeit zur Ausübung sportlicher Aktivitäten<br />
Psychosoziale Therapieziele<br />
Problembereich<br />
Ängstlichkeit<br />
Befindlichkeit<br />
Depressivität<br />
Selbstwertgefühl<br />
Berufliche Integration<br />
Soziale Integration<br />
Soziale Kompetenz<br />
Therapieziel<br />
Verminderung von Ängstlichkeit<br />
Verbesserung der Befindlichkeit<br />
Verminderung von Depressivität<br />
Verbesserung <strong>des</strong> Selbstwertgefühls<br />
Verbesserung der beruflichen Integration<br />
Verbesserung der sozialen Integration<br />
Verbesserung der sozialen Kompetenz<br />
Verbesserung der Fähigkeit zur Ausübung sportlicher Aktivitäten
Edukative Therapieziele<br />
Problembereich<br />
Information<br />
Notfallstrategien<br />
Selbstkontrolle<br />
Stressbewältigung<br />
Therapeutische Techniken<br />
Therapieziel<br />
Verbesserung <strong>des</strong> Informationsstan<strong>des</strong> über die Krankheit<br />
Beherrschen von Techniken <strong>und</strong> Strategien zum Abbau von<br />
Risikoverhalten<br />
Beherrschen von Techniken <strong>und</strong> Strategien zur Selbstkontrolle<br />
Beherrschen von Strategien <strong>und</strong> Techniken zur Stressbewältigung<br />
Beherrschen von speziellen therapeutischen Techniken (Inhalation,<br />
Dosieraerosolen, Bedienung von Inhalations-, Beatmungs- <strong>und</strong>/oder<br />
O 2 -Geräten, Autogene Drainage)<br />
Zieldefinition, Therapieplan,<br />
Maßnahmen zur Zielerreichung<br />
Therapieziele<br />
Arzt/Patient<br />
Obligatorisch/fakultativ<br />
Weitergehende Diagnostik im Hinblick auf den<br />
Reha-Prozess<br />
Medizin<br />
Physikalische Therapie<br />
Psychosoziale Rehabilitation<br />
Festlegung/Überweisung in - Anmeldung für ....
Risikopatient<br />
(Reha-)Anamnese & sonstige Information<br />
Aufnahmetag<br />
nein<br />
Stationsarzt:<br />
Risikopatient?*<br />
Verdacht<br />
Therapieverlaufskontrolle<br />
Individuelle<br />
Therapieziele<br />
ergänztes Basisprogramm<br />
<br />
zum Nicht -Risikopatienten<br />
Risi kopatienten haben P riorität (Kennzeichnung!)<br />
individuell, zielorientiert<br />
*Risikokriterien<br />
• Aktuellarbeitsunfähig(insbes. >4 Wochen<br />
im letzten Jahr)<br />
Basisdiagnostik<br />
• Basis-Allergiediagnostik<br />
• Laboranalyse<br />
• Lungenfunktionsdiagnostik<br />
• Rentenantragläuft<br />
• aus ges<strong>und</strong>heitlichen Gründen arbeitslos<br />
• Probleme amArbeitsplatz(Belastung, Bea nspruchung,<br />
sozial,...)<br />
• sozialmedizinischeProbleme<br />
(Rentenbegehren, Schwerbeh.,...)<br />
• mit Krankheit unvereinbare Tätigkeit<br />
Basisangebote<br />
• Medikamentöse Therapie<br />
• Psychosoziale Rehabilitation<br />
• Physikalische Therapie<br />
• Ernährungsberatung<br />
Priorität<br />
1=keine, 3=mittel, 5=hoch<br />
Zusatzinformationen<br />
• Sozial– <strong>und</strong> Arbeitsanamnese (Patientenangaben)<br />
• Anforderungen (Stationsa rztangaben)<br />
Angebote insbesondere für<br />
Risikopatienten<br />
Prozeßsteuerung :<br />
Stationsarzt<br />
Risi kopatienten haben Priorität (Kennzeichnung!)<br />
Sozialmedizin<br />
Zeitachse<br />
Spezifische Diagnostik<br />
• Erweiterte Lungenfunktionsdiagnostik<br />
• Methacholintest/ Histamintest<br />
• Ergometrie mit Blutgasen oder Lau fbandgehstreckentest<br />
• evtl. EIA-Test<br />
• Erweiterte Allergiediagnostik<br />
• Psychosoziale Diagnostik (FPI, B L,<br />
ASL, FKV)<br />
• Sport <strong>und</strong> Bewegung (6-Minuten-<br />
Gehtest, Ergometer)<br />
vorläufige<br />
sozial–/arbeits-medizinische<br />
Beurteilung<br />
durch Sozialmediziner<br />
BIZ<br />
spezifische<br />
Beratung<br />
ja<br />
(weitere) Maßnahmen?<br />
Spezifische Angebote<br />
• Patientenschulung<br />
• Psychologische Beratung/Therapie<br />
• Sporttherapie<br />
nein<br />
Ausmaß der<br />
Zielerreichung<br />
alle Ergebnisse/Berichte<br />
1=gar nicht, 3=mittel<br />
5=voll<br />
Ergebnis/Bericht/Akte<br />
F allkonferenz<br />
(STA, CA, B IZ, SozM)<br />
BIZ<br />
ggf. Beratung<br />
Bf-Fall?<br />
ja<br />
• Urteilsbildung<br />
• Risikoprofil<br />
• Zieldefinition<br />
nein<br />
Stationsarzt<br />
Sozialmedizin<br />
abschließende Arbeits -/<br />
Sozialmedizinische<br />
Beurteilung<br />
kurz vor<br />
Entlassung<br />
Entlassungsgespräch (Stationsarzt)<br />
• Nachsorgeinformation <strong>und</strong> -formular für/an Patient<br />
• weitergehende Empfehlungen an andere Instit utionen<br />
Unterlagen versenden an zuweisenden Arzt/ zur Nachsorgeinstitution<br />
• BfA-Formular an zuständige Stelle<br />
• Arztbrief verschicken
(Reha-)Anamnese & sonstige Information Nicht-R isikopatient<br />
Aufnahmetag<br />
nein<br />
Stationsarzt:<br />
Risikopatient?*<br />
Verdacht<br />
<br />
zum Risikopatienten<br />
Basisprogramm<br />
P rozeßsteuerung durch<br />
den Stationsarzt<br />
indi viduell, zielorientiert<br />
ja<br />
Basisdiagnostik<br />
• Basis-Allergiediagnostik<br />
• Laboranalyse<br />
• Lungenfunktionsdiagnostik<br />
Ergebnis/Bericht/<br />
Akte<br />
Risikoverdacht?<br />
Basisangebote<br />
• allgemeine Beratung imBIZ<br />
• Medikamentöse Therapie<br />
• Psychosoziale Rehabilitation<br />
nein<br />
• Physikalische Therapie<br />
• Ernährungsberat ung<br />
ja, Basis<br />
weitere Maßnahme?<br />
Erweiterte Angebote<br />
nein<br />
Zeitachse<br />
Spezifische Diagnostik<br />
• Erweiterte Lungenfunktionsdiagnostik<br />
• Methacholintest/ Histamintest<br />
• Ergometrie mit Blutgasen oder Laufban dgehstreckentest<br />
• evtl. EIA-Test<br />
• Erweiterte Allergiediagnostik<br />
• Psychosoziale Diagnostik (FPI, BL, ASL,<br />
FKV)<br />
• Sport <strong>und</strong> Bewegung -Minuten- (6<br />
Gehtest, Ergometer)<br />
Spezifische Angebote<br />
• Patientenschulung<br />
• Psychologische Beratung/Therapie<br />
• Sporttherapie<br />
Verbesserung der Reha-Nachsorge<br />
ja, erweitert<br />
kurz vor<br />
Entlassung<br />
Entlassungsgespräch (Stationsarzt)<br />
• Nachsorgeinformation <strong>und</strong> -formular für/an Patient<br />
• weitergehende Empfehlungen an andere Instit utionen<br />
Arztbericht (Integration aller Aspekte zur Erwerbsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Vorschläge weiterer Behandlungen, Beratungen, Hilfen)<br />
sensibilisierten,aufgeklärten, eigenverantwortlichen <strong>und</strong><br />
handlungsfähigen Patienten schaffen<br />
Hausarzt als Case-Manager <strong>und</strong> Kostenträger umfassend <strong>und</strong><br />
zügig über Ergebnisse <strong>und</strong> Empfehlungen informieren<br />
im Einzelfall Kontakt mit öffentlichen Institutionen zur<br />
Sensibilisierung von Situationsproblematik Einleitung<br />
weitergehender Schritte aufnehmen, Wege ebnen<br />
Kooperationen schaffen<br />
Unterlagen versenden an zuweisenden A rzt/ zur Nachsorgeinstitution<br />
• ggf. BfA-Formular an zuständige Stelle<br />
• Arztbrief verschicken