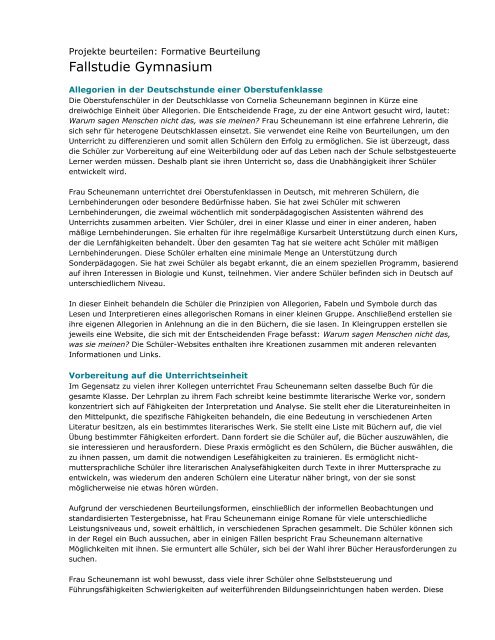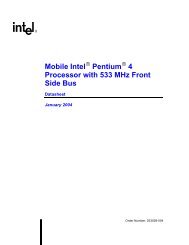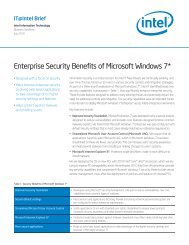Gymnasiale Fallstudie - Intel
Gymnasiale Fallstudie - Intel
Gymnasiale Fallstudie - Intel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Projekte beurteilen: Formative Beurteilung<br />
<strong>Fallstudie</strong> Gymnasium<br />
Allegorien in der Deutschstunde einer Oberstufenklasse<br />
Die Oberstufenschüler in der Deutschklasse von Cornelia Scheunemann beginnen in Kürze eine<br />
dreiwöchige Einheit über Allegorien. Die Entscheidende Frage, zu der eine Antwort gesucht wird, lautet:<br />
Warum sagen Menschen nicht das, was sie meinen? Frau Scheunemann ist eine erfahrene Lehrerin, die<br />
sich sehr für heterogene Deutschklassen einsetzt. Sie verwendet eine Reihe von Beurteilungen, um den<br />
Unterricht zu differenzieren und somit allen Schülern den Erfolg zu ermöglichen. Sie ist überzeugt, dass<br />
die Schüler zur Vorbereitung auf eine Weiterbildung oder auf das Leben nach der Schule selbstgesteuerte<br />
Lerner werden müssen. Deshalb plant sie ihren Unterricht so, dass die Unabhängigkeit ihrer Schüler<br />
entwickelt wird.<br />
Frau Scheunemann unterrichtet drei Oberstufenklassen in Deutsch, mit mehreren Schülern, die<br />
Lernbehinderungen oder besondere Bedürfnisse haben. Sie hat zwei Schüler mit schweren<br />
Lernbehinderungen, die zweimal wöchentlich mit sonderpädagogischen Assistenten während des<br />
Unterrichts zusammen arbeiten. Vier Schüler, drei in einer Klasse und einer in einer anderen, haben<br />
mäßige Lernbehinderungen. Sie erhalten für ihre regelmäßige Kursarbeit Unterstützung durch einen Kurs,<br />
der die Lernfähigkeiten behandelt. Über den gesamten Tag hat sie weitere acht Schüler mit mäßigen<br />
Lernbehinderungen. Diese Schüler erhalten eine minimale Menge an Unterstützung durch<br />
Sonderpädagogen. Sie hat zwei Schüler als begabt erkannt, die an einem speziellen Programm, basierend<br />
auf ihren Interessen in Biologie und Kunst, teilnehmen. Vier andere Schüler befinden sich in Deutsch auf<br />
unterschiedlichem Niveau.<br />
In dieser Einheit behandeln die Schüler die Prinzipien von Allegorien, Fabeln und Symbole durch das<br />
Lesen und Interpretieren eines allegorischen Romans in einer kleinen Gruppe. Anschließend erstellen sie<br />
ihre eigenen Allegorien in Anlehnung an die in den Büchern, die sie lasen. In Kleingruppen erstellen sie<br />
jeweils eine Website, die sich mit der Entscheidenden Frage befasst: Warum sagen Menschen nicht das,<br />
was sie meinen? Die Schüler-Websites enthalten ihre Kreationen zusammen mit anderen relevanten<br />
Informationen und Links.<br />
Vorbereitung auf die Unterrichtseinheit<br />
Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen unterrichtet Frau Scheunemann selten dasselbe Buch für die<br />
gesamte Klasse. Der Lehrplan zu ihrem Fach schreibt keine bestimmte literarische Werke vor, sondern<br />
konzentriert sich auf Fähigkeiten der Interpretation und Analyse. Sie stellt eher die Literatureinheiten in<br />
den Mittelpunkt, die spezifische Fähigkeiten behandeln, die eine Bedeutung in verschiedenen Arten<br />
Literatur besitzen, als ein bestimmtes literarisches Werk. Sie stellt eine Liste mit Büchern auf, die viel<br />
Übung bestimmter Fähigkeiten erfordert. Dann fordert sie die Schüler auf, die Bücher auszuwählen, die<br />
sie interessieren und herausfordern. Diese Praxis ermöglicht es den Schülern, die Bücher auswählen, die<br />
zu ihnen passen, um damit die notwendigen Lesefähigkeiten zu trainieren. Es ermöglicht nichtmuttersprachliche<br />
Schüler ihre literarischen Analysefähigkeiten durch Texte in ihrer Muttersprache zu<br />
entwickeln, was wiederum den anderen Schülern eine Literatur näher bringt, von der sie sonst<br />
möglicherweise nie etwas hören würden.<br />
Aufgrund der verschiedenen Beurteilungsformen, einschließlich der informellen Beobachtungen und<br />
standardisierten Testergebnisse, hat Frau Scheunemann einige Romane für viele unterschiedliche<br />
Leistungsniveaus und, soweit erhältlich, in verschiedenen Sprachen gesammelt. Die Schüler können sich<br />
in der Regel ein Buch aussuchen, aber in einigen Fällen bespricht Frau Scheunemann alternative<br />
Möglichkeiten mit ihnen. Sie ermuntert alle Schüler, sich bei der Wahl ihrer Bücher Herausforderungen zu<br />
suchen.<br />
Frau Scheunemann ist wohl bewusst, dass viele ihrer Schüler ohne Selbststeuerung und<br />
Führungsfähigkeiten Schwierigkeiten auf weiterführenden Bildungseinrichtungen haben werden. Diese
Fähigkeiten besitzen in ihrem Unterricht eine hohe Priorität. Die Schüler setzen sich Jahresziele, die – falls<br />
nötig – überarbeitet werden und auch Ziele für einzelne Unterrichtseinheiten. Diese Zielsetzungen<br />
betreffen grundsätzlich Lesen und Schreiben zusammen mit den Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert, wie<br />
Teamarbeit, Projektplanung, kritisches und systemisches Denken sowie Kreativität.<br />
Schülergeschichten: Julias und Toms Ziele<br />
Nach einer kurzen Einführung in die Unterrichtseinheit überprüfen die Schüler ihre Portfolios und<br />
identifizieren Bereiche mit persönlichen Stärken und Schwächen, die es während der Einheit zu<br />
fokussieren gilt. Die Schüler werden angehalten, ihre Ziele so zu gestalten, dass ihre Fähigkeiten<br />
ausgedehnt werden, was ihnen hilft, sowohl im Leben als auch in der Deutschklasse erfolgreich zu sein.<br />
Julia ist eine Schülerin mit schweren Lernbehinderungen. Sie arbeitet mit einer Assistentin an der<br />
Herausarbeitung von drei Zielen, an denen sie während der Einheit arbeiten will:<br />
<br />
<br />
<br />
Ich teile meine Ideen mit den anderen Schülern in meiner Kleingruppe.<br />
Ich werde meine Gründe mehr erläutern, wenn ich schreibe.<br />
Ich werde jeden Tag daran denken, meine eigenen Materialien mit in die Klasse zu bringen.<br />
Tom hat mäßige Lernbehinderungen und notiert folgende Ziele:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ich werde auf meinen Zeitplan achten und jeden Tag ein wenig an meinem Projekt arbeiten.<br />
Ich werde über mehrere Ideen nachdenken, bevor ich mich auf eine festlege.<br />
Ich werde sorgfältig über das Ende nachdenken, wenn ich schreibe.<br />
Ich werde meiner Verantwortung gegenüber meiner Gruppe nachkommen.<br />
Während der Einheit betrachten die Schüler ihre Ziele und reflektieren in ihren Protokollen darüber, wie<br />
gut sie an ihnen arbeiten. Frau Scheunemann liefert eine Anleitung, wie konkrete Fakten für ihre<br />
Schlussfolgerungen herangezogen werden.<br />
Lesen eines allegorischen Romans<br />
Nachdem die Schülergruppen den Roman ausgewählt haben, den sie lesen werden, müssen sie ihre<br />
Lesezeiten so planen, dass sie an den Aktivitäten der Klasse in vollem Umfang teilnehmen können.<br />
Schüler mit Behinderung erhalten teilweise ausgefüllte Checklisten zusammen mit Anweisungen, wie der<br />
zu lesende Stoff in überschaubare Teile aufgeteilt werden kann. Da von den Schülern in Frau<br />
Scheunemanns Klasse erwartet wird, dass sie die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, erhalten sie<br />
etwas weniger strukturierte Checklisten als beim vorherigen Projekt.<br />
Der Schwerpunkt dieser Einheit liegt im Aufbau der notwendigen Fähigkeiten für die Interpretation von<br />
Allegorien. Daher sammelt Frau Scheunemann Informationen darüber, beispielsweise welche<br />
unterschiedlichen Meinungen ihre Schüler über ihre Bücher haben. Sie überprüft alle paar Tage die<br />
Protokolle, wo einige ihrer Schüler ihre Fragen und Gedanken über das Gelesene hineinschreiben.<br />
Während die Schüler das Gelesene diskutieren, macht sie sich Notizen über die Denkprozesse der Schüler.<br />
Die folgende Beispieltabelle spiegelt die von einer Schülergruppe genutzten Fähigkeiten zum kritischen<br />
Denken bei der Besprechung des Romans Herr der Fliegen wieder:<br />
Stellt beim Ziehen von<br />
Schlussfolgerungen<br />
Verbindungen zu persönlichen<br />
Erfahrungen her<br />
Revidiert<br />
Schlussfolgerungen/Rückschlüsse<br />
anhand neuer Informationen<br />
Bastian Miriam Kim (mäßige<br />
Lernbehinderungen)<br />
Ausgezeichnet<br />
Nutzt nicht wirklich Machte einen<br />
eigene<br />
Vergleich<br />
Erfahrungen, wirkt<br />
distanziert zum<br />
Buch<br />
Nicht gesehen Gut Nicht gesehen<br />
Liefert konkrete Beispiele aus Hat nur ein Beispiel Gut Nur schwache
dem Buch, um Meinungen zu<br />
stützen<br />
Versteht Ereignisse genau<br />
für alle<br />
Schlussfolgerungen<br />
geliefert<br />
Bezieht beim<br />
Interpretieren des<br />
Buches zu viele<br />
persönliche<br />
Erfahrungen ein<br />
Gut<br />
Verweise<br />
Keine—hat das Buch<br />
eventuell nicht gelesen<br />
Frau Scheunemann stellt einige Hypothesen aufgrund dieser kurzen Beobachtung auf, die sie mit den<br />
Informationen aus anderen Einschätzungen vergleicht, wie zum Beispiel Protokolleinträgen und<br />
informellen Interviews. Sie beschließt, eine kurze Lektion zur Bereitstellung textlicher Unterstützung für<br />
Interpretationen durchzuführen, da dieses Problem in mehreren Beobachtungen von ihr auftauchte. Sie<br />
bespricht individuell mit Kim ihren Lesezeitplan. Sie bittet Kims Eltern, ihr zu helfen, Kim zum Lesen<br />
anzuhalten.<br />
In diesem Teil der Unterrichtseinheit sammelt Frau Scheunemann Daten über die literarische<br />
Interpretationen ihrer Schüler, deren Selbststeuerung und Kooperationsfähigkeiten. Was sie dabei erfährt<br />
nutzt sie für Einzel- und Gruppenfeedback und zur Unterrichtsplanung. Zusätzlich gibt sie die<br />
Informationen an die Mitarbeiter weiter, die mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf<br />
arbeiten. Eine abschließende Prüfung - in Form eines Aufsatzes - liefert ihr Informationen über die<br />
Fähigkeiten zur literarischen Interpretation ihrer Schüler, die sie bei der Planung zukünftiger<br />
Unterrichtseinheiten und bei der Arbeit mit einzelnen Schülern nutzen wird.<br />
Erstellen einer Allegorie<br />
Nach der Analyse und Interpretation ihrer allegorischen Romane verwenden die Schüler aus Frau<br />
Scheunemanns Klasse das, was sie im Unterricht über figurative Sprache, Symbole und Metaphern gelernt<br />
haben, um ihre eigenen Allegorien zu kreieren, die zum Teil auf den gelesenen Romanen beruhen. Um<br />
den Schülern zu ermöglichen, Vorteile aus ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen zu ziehen, schuf<br />
sie eine Matrix zur Beurteilung der wichtigsten Komponenten des Projekts, wobei den Schülern freigestellt<br />
wird, ein Medium, mit dem sie gerne arbeiten und das sie herausfordert, auszuwählen. Sie nutzt das, was<br />
sie über ihre Schüler aus früheren Projekten gelernt hat, für die Empfehlung geeigneter Formate.<br />
Jasmin, eine begabte Schülerin, entscheidet sich häufig für schriftliche Projekte, weil sie weiß, dass sie<br />
damit gut klarkommt. Sie setzte sich für dieses Jahr das Ziel, mehr kreative Risiken einzugehen. Frau<br />
Scheunemann weiß, dass Jasmin sich für Computergrafik interessiert und schlägt ihr vor, ihre Allegorie<br />
mithilfe einer Animationssoftware zu produzieren. Frau Scheunemann ermuntert Jasmin, mit einem<br />
Mitschüler zusammenzuarbeiten, der einige Erfahrungen mit Animationen hat und stellt für beide einen<br />
Kontakt zu einem Online-Mentor, der ein professioneller Animateur ist, her.<br />
Felix hingegen hat leichte Lernbehinderungen und ernsthafte Probleme mit dem Schreiben. Er hat sich<br />
zum Ziel gesetzt, sorgfältiger zu schreiben, aber wenn er die Wahl zwischen mehreren Projekten hat,<br />
wählt er immer das aus, was so wenig wie möglich Schriftliches verlangt. Wenn er in einer Gruppe<br />
arbeitet, gelingt es ihm in der Regel, jemand anderen zu finden, der das Schreiben für das Projekt<br />
übernimmt. Frau Scheunemann weiß, dass Felix sich für Video interessiert und schlägt ihm vor, ein<br />
Drehbuch für eine Allegorie zu schreiben und es dann von einer Gruppe aufführen und aufnehmen zu<br />
lassen. Die Aussicht, das Projekt mit der Hilfe eines professionellen Videofilmers zu absolvieren, motiviert<br />
ihn sein Bestes beim Drehbuchschreiben zu geben.<br />
Komplexe Projekte wie diese erfordern umfangreiche Planung durch die Schüler. Frau Scheunemann gibt<br />
den Schülern in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung in Form von Checklisten und<br />
Projektplanvorlagen. Schüler, die bekanntermaßen hochwertige Arbeit pünktlich abliefern, sind engagiert<br />
bei der Gestaltung ihrer eigenen Projektpläne, die nicht nur alle notwendigen Informationen beinhalten,<br />
sondern auch ihren Lernstilen entsprechen. Schüler, die Schwierigkeiten haben vorauszudenken,
komplettieren die Checklisten, wo viele Punkte bereits ausgefüllt sind, während andere nur eine Folge von<br />
Terminen vor Augen haben und entscheiden, was sie zu welchem Abgabetermin erledigen wollen. Alle<br />
Schüler sind aufgefordert die Vorlage zu modifizieren, damit sie ihren Bedürfnissen entspricht, solange sie<br />
die Termine einhalten können, die für die gesamte Klasse relevant sind.<br />
Frau Scheunemann gibt den Schülern eine Projektmatrix, die ihre Erwartungen an die Allegorien der<br />
Schüler beschreibt. Sie veranschaulicht wie die Matrix verwendet wird, um die Projektqualität zu<br />
beurteilen und konstruktives Mitschülerfeedback einzuholen. Während des gesamten Projekts reflektieren<br />
die Schüler über ihre Fortschritte, sowohl hinsichtlich bestimmter Punkte der Matrix als auch ihrer Ziele<br />
für die Einheit. Frau Scheunemann nutzt die Informationen aus den Reflexionen zur Planung von Schüler-<br />
Lehrer-Besprechungen, Kurzübungen zu Metakognition und Selbststeuerung sowie zur Ermittlung<br />
passender Ressourcen für die verschiedenen Bedürfnisse der Schüler.<br />
Ein Wiki erstellen<br />
In der letzten Phase des Projekts erstellen die Schülergruppen Wikis, in denen sie die Entscheidende<br />
Frage beantworten "Warum sagen Menschen nicht das, was sie meinen?" und ihre Allegorien mitteilen. Da<br />
dies ein Gruppenprojekt ist, beurteilt Frau Scheunemann die Fähigkeiten zur Teamarbeit zusammen mit<br />
inhaltlichen Befähigungen und Kenntnissen. Die Schüler erhalten außerdem eine Beurteilungsmatrix, die<br />
die unterschiedlichen Qualitätsstufen beschreibt, nach der ihre Arbeit zensiert wird. Sie erstellen von<br />
Grund auf ihre eigenen Projektpläne und teilen diese anderen Gruppen mit, um Feedback zu erhalten.<br />
Frau Scheunemann trifft sich mit den Gruppen, um Anregungen und Unterstützung für die Entwicklung<br />
ihrer Pläne anzubieten.<br />
Während die Schüler ihre Websites planen, verwendet Frau Scheunemann eine Checkliste für<br />
Beobachtungen. Im Folgenden ein Beispiel für Teamarbeit-Prozesse einer Gruppe:<br />
Datum: 28. Daniel Jasmin (begabt) Ivan (leichte Kim<br />
Januar<br />
Lernbehinderungen)<br />
Umschreibt was Nicht<br />
Gut Nicht beobachtetet Versucht es<br />
andere in unserer<br />
Gruppe sagen, um<br />
ein besseres<br />
Verständnis zu<br />
erzielen<br />
beobachtetet<br />
Stellt Nachfragen Gut Gut Nein Versucht es<br />
Schätzt die Ideen<br />
und Meinungen<br />
unserer<br />
Gruppenmitglieder<br />
und motiviert sie<br />
diese einzubringen<br />
Nicht beobachtetet Gut Nur mit einigen<br />
Schülern<br />
Ausgezeichnet<br />
Äußert Meinungen<br />
und Positionen,<br />
ohne die Gefühle<br />
anderer in unserer<br />
Gruppe zu<br />
verletzen<br />
Sucht<br />
unterschiedliche<br />
Meinungen und<br />
versucht die<br />
Einigung auf ein<br />
gemeinsames<br />
Verständnis<br />
Zeitweise<br />
ablehnend<br />
Ein bisschen<br />
schüchtern<br />
Verspottet andere<br />
manchmal<br />
Ausgezeichnet<br />
Nicht beobachtetet Gut Nein Versucht es
Nachdem Frau Scheunemann alle ihre Beobachtungsdaten überprüft hat, kommt sie zu dem Schluss, dass<br />
fast alle Schüler von zusätzlichem Unterricht im Umformulieren der Kommentare anderer profitieren<br />
könnten. Sie stellt außerdem fest, dass Ivan nicht respektvoll mit seiner Gruppe zusammenarbeitet. Sie<br />
teilt ihm ihre Beobachtungen in einer privaten Unterredung mit, zeigt ihm die Vorteile einer<br />
funktionierenden Zusammenarbeit auf und bittet ihn, seine Ziele um erfolgreiches Arbeiten in Gruppen zu<br />
ergänzen.<br />
Zum Abschluss des Projekts verwenden die Schüler eine Beurteilungsmatrix zur Zusammenarbeit, um ihre<br />
eigene Beteiligung an der Gruppe zu beurteilen und über die erlernten inhaltlichen Kenntnisse und<br />
Fähigkeiten zu reflektieren. Sie denken auch über die Entwicklung der Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert<br />
nach, wie den Einsatz von Technologie, Teamarbeit und Kreativität. Diese Überlegungen beurteilen die<br />
Fortschritte in Richtung der Ziele und legen neue fest.<br />
Während dieser Einheit wendet Frau Scheunemann eine Vielzahl formeller und informeller Beurteilungen<br />
an, um ihren Schülern zu helfen, inhaltlichen Anforderungen gerecht zu werden und ihr volles Potenzial zu<br />
erreichen. Die Schüler beurteilen sich selbst, um mehr Unabhängigkeit bei der Organisation ihres Lernens<br />
zu erlangen. Sie bewerten sich auch gegenseitig, um konstruktives Feedback für Mitschüler zu üben.<br />
Diese Integration von Beurteilung und Unterricht, mit einem Fokus auf Prozesse und Inhalte,<br />
gewährleistet, dass Schüler mit unterschiedlichen Möglichkeiten erfolgreich sein können.