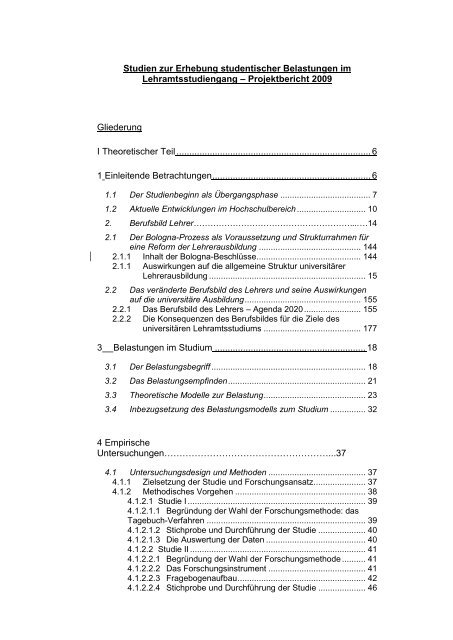Studien zur Erhebung studentischer Belastungen im ...
Studien zur Erhebung studentischer Belastungen im ...
Studien zur Erhebung studentischer Belastungen im ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Studien</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erhebung</strong> <strong>studentischer</strong> <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong><br />
Lehramtsstudiengang – Projektbericht 2009<br />
Gliederung<br />
I Theoretischer Teil ............................................................................ 6<br />
1 Einleitende Betrachtungen .............................................................. 6<br />
1.1 Der <strong>Studien</strong>beginn als Übergangsphase ...................................... 7<br />
1.2 Aktuelle Entwicklungen <strong>im</strong> Hochschulbereich ............................. 10<br />
2. Berufsbild Lehrer…………………………………………………...…14<br />
2.1 Der Bologna-Prozess als Voraussetzung und Strukturrahmen für<br />
eine Reform der Lehrerausbildung ........................................... 144<br />
2.1.1 Inhalt der Bologna-Beschlüsse ............................................ 144<br />
2.1.1 Auswirkungen auf die allgemeine Struktur universitärer<br />
Lehrerausbildung .................................................................. 15<br />
2.2 Das veränderte Berufsbild des Lehrers und seine Auswirkungen<br />
auf die universitäre Ausbildung ................................................. 155<br />
2.2.1 Das Berufsbild des Lehrers – Agenda 2020 ........................ 155<br />
2.2.2 Die Konsequenzen des Berufsbildes für die Ziele des<br />
universitären Lehramtsstudiums ......................................... 177<br />
3 <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium ........................................................... 18<br />
3.1 Der Belastungsbegriff ................................................................. 18<br />
3.2 Das Belastungsempfinden .......................................................... 21<br />
3.3 Theoretische Modelle <strong>zur</strong> Belastung ........................................... 23<br />
3.4 Inbezugsetzung des Belastungsmodells zum Studium ............... 32<br />
4 Empirische<br />
Untersuchungen………………………………………………...37<br />
4.1 Untersuchungsdesign und Methoden ......................................... 37<br />
4.1.1 Zielsetzung der Studie und Forschungsansatz ...................... 37<br />
4.1.2 Methodisches Vorgehen ....................................................... 38<br />
4.1.2.1 Studie I ........................................................................... 39<br />
4.1.2.1.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode: das<br />
Tagebuch-Verfahren ................................................................... 39<br />
4.1.2.1.2 Stichprobe und Durchführung der Studie .................... 40<br />
4.1.2.1.3 Die Auswertung der Daten .......................................... 40<br />
4.1.2.2 Studie II .......................................................................... 41<br />
4.1.2.2.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode .......... 41<br />
4.1.2.2.2 Das Forschungsinstrument ......................................... 41<br />
4.1.2.2.3 Fragebogenaufbau ...................................................... 42<br />
4.1.2.2.4 Stichprobe und Durchführung der Studie .................... 46
4.1.2.2.5 Auswertung der Daten ................................................ 48<br />
4.2 Ausgangsfragestellungen ........................................................... 49<br />
4.3 Hypothesen ................................................................................ 51<br />
4.3.1 Zur Gesamtbelastung ........................................................... 51<br />
4.3.2 Zum Lehramtsstudium .......................................................... 52<br />
4.3.3 Zur <strong>Studien</strong>zeit ...................................................................... 53<br />
4.3.4 Zum sozialen Netz und <strong>zur</strong> Unterstützungssituation ............. 53<br />
4.3.4 Zu den Persönlichkeitsvariablen ........................................... 54<br />
4.3.5 Zu den Ressourcen ............................................................... 54<br />
II Empirischer Teil ............................................................................ 55<br />
A Studie <strong>im</strong> WS 2007/08 ............................................................... 55<br />
1 Soziometrische Daten ............................................................... 55<br />
1.1 Geschlecht ................................................................................. 55<br />
1.2 Lehramtsart ................................................................................ 55<br />
1.3 Altersstruktur .............................................................................. 55<br />
1.4 Zeitpunkt der <strong>Studien</strong>aufnahme .................................................. 56<br />
1.5 Wartesemester ........................................................................... 57<br />
1.6 Studierte Fächer ......................................................................... 57<br />
1.7 Entfernung zwischen <strong>Studien</strong>ort und Lebensort .......................... 58<br />
1.8 Erwerbstätigkeit .......................................................................... 59<br />
1.9 Bildungsstand der Eltern ............................................................. 59<br />
1.10 Einkommensverhältnisse ............................................................ 60<br />
1.11 Wohnsituation ............................................................................. 62<br />
1.12 Elternkontakt .............................................................................. 63<br />
1.13 Partnerschaft .............................................................................. 64<br />
1.14 Gesundheitszustand ................................................................... 65<br />
1.15 <strong>Studien</strong>eingangsvoraussetzungen .............................................. 65<br />
2 <strong>Studien</strong>wahlmotive .................................................................... 66<br />
3 Persönliche Sicht des Studiums ................................................ 68<br />
4 Zukunftsperspektiven durch das Studium ................................. 71<br />
5 Soziale Kontakte unter den Studierenden ................................ 73<br />
6 Organisatorische und strukturelle Bedingungen des Studiums 74<br />
6.1 Lehrveranstaltungen und Semesterwochenstunden ................... 74<br />
6.2 Zeitaufwand für das Studium ...................................................... 76<br />
2
6.3 Belegungssituation in den Lehrveranstaltungen ......................... 81<br />
6.4 Modulprüfungen ......................................................................... 83<br />
6.5 <strong>Studien</strong>zufriedenheit ................................................................... 84<br />
6.6 Leistungspunkte ......................................................................... 86<br />
6.7 Beurteilung der Rahmenbedingungen des Studiums .................. 94<br />
6.8 Betreuungssituation .................................................................... 95<br />
7 <strong>Studien</strong>erwartungen ............................................................... 106<br />
8 <strong>Studien</strong>alltag und –realität...................................................... 110<br />
8.1 <strong>Studien</strong>anforderungen .............................................................. 110<br />
8.2 Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen ...................................... 115<br />
8.3 Strukturierungsgrad des Studiums ............................................ 119<br />
8.4 Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium ..................................................... 125<br />
8.5 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen ....... 131<br />
8.6 Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien ................................... 136<br />
8.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil ................................. 142<br />
8.8 Selbstwirksamkeitsüberzeugung .............................................. 143<br />
9 Persönlichkeitsvariablen ...................................................... 14545<br />
9.1 Frustrationstoleranz .................................................................. 145<br />
9.2 Informations- und Wissensbedürfnis ......................................... 147<br />
9.3 Flexibilität ................................................................................. 150<br />
9.4 Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft ............................ 152<br />
9.5 Erholungs- und Entspannungsfähigkeit .................................... 154<br />
9.6 Fähigkeit zu rationellem Arbeiten .............................................. 156<br />
9.7 Stressresistenz ......................................................................... 158<br />
9.8 Persönlichkeitsmerkmale .......................................................... 160<br />
10 Sorgen und Ängste <strong>im</strong> Studium ............................................... 162<br />
11 Alternativen zum gegenwärtigen Studium ............................... 167<br />
12 Belastungsempfinden .............................................................. 171<br />
12.1 Auswertung der einzelnen Items ............................................... 171<br />
12.2 Skala <strong>zur</strong> Belastung .................................................................. 177<br />
12.3 Belastungsmodell ..................................................................... 179<br />
B Studie <strong>im</strong> WS 2008/09 ............................................................. 185<br />
1 Soziometrische Daten ............................................................. 185<br />
3
1.1 Geschlecht ............................................................................... 185<br />
1.2 Lehramtsart .............................................................................. 185<br />
1.3 Altersstruktur ............................................................................ 185<br />
1.4 Zeitpunkt der <strong>Studien</strong>aufnahme ................................................ 185<br />
1.5 Wartesemester ......................................................................... 186<br />
1.6 Studierte Fächer ....................................................................... 186<br />
1.7 Entfernung zwischen <strong>Studien</strong>ort und Lebensort ........................ 187<br />
1.8 Erwerbstätigkeit ........................................................................ 187<br />
1.9 Bildungsstand der Eltern ........................................................... 187<br />
1.10 Einkommensverhältnisse .......................................................... 188<br />
1.11 Wohnsituation ........................................................................... 189<br />
1.12 Elternkontakt ............................................................................ 190<br />
1.13 Partnerschaft ............................................................................ 191<br />
1.14 Gesundheitszustand ................................................................. 192<br />
1.15 <strong>Studien</strong>eingangsvoraussetzungen ............................................ 192<br />
2 <strong>Studien</strong>wahlmotive .................................................................. 193<br />
3 Persönliche Sicht des Studiums .............................................. 194<br />
4 Zukunftsperspektiven durch das Studium ............................... 197<br />
5 Soziale Kontakte unter den Studierenden .............................. 198<br />
6 Organisatorische und strukturelle Bedingungen des Studiums<br />
199<br />
6.1 Lehrveranstaltungen und Semesterwochenstunden ................. 199<br />
6.2 Zeitaufwand für das Studium .................................................... 199<br />
6.3 Belegungssituation in den Lehrveranstaltungen ....................... 204<br />
6.4 Modulprüfungen ....................................................................... 206<br />
6.5 <strong>Studien</strong>zufriedenheit ................................................................. 207<br />
6.6 Leistungspunkte ....................................................................... 208<br />
6.7 Beurteilung der Rahmenbedingungen des Studiums ................ 213<br />
6.8 Betreuungssituation .................................................................. 214<br />
7 <strong>Studien</strong>erwartungen ................................................................ 220<br />
8 <strong>Studien</strong>alltag und –realität ...................................................... 224<br />
8.1 <strong>Studien</strong>anforderungen .............................................................. 224<br />
8.2 Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen ...................................... 227<br />
4
8.3 Strukturierungsgrad des Studiums ............................................ 230<br />
8.4 Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium ..................................................... 234<br />
8.5 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen ....... 238<br />
8.6 Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien ................................... 241<br />
8.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil ................................. 243<br />
8.8 Selbstwirksamkeitsüberzeugung .............................................. 244<br />
9 Persönlichkeitsvariablen .......................................................... 245<br />
9.1 Frustrationstoleranz .................................................................. 245<br />
9.2 Flexibilität ................................................................................. 247<br />
9.3 Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft ............................ 249<br />
9.4 Erholungs- und Entspannungsfähigkeit .................................... 251<br />
9.5 Fähigkeit zu rationellem Arbeiten .............................................. 253<br />
9.6 Stressresistenz ......................................................................... 255<br />
9.7 Skalenbildung ........................................................................... 257<br />
10 Sorgen und Ängste <strong>im</strong> Studium ............................................... 257<br />
11 Alternativen zum gegenwärtigen Studium ............................... 263<br />
12 Belastungsempfinden .............................................................. 266<br />
12.1 Auswertung der einzelnen Items ............................................... 266<br />
12.2 Skala <strong>zur</strong> Belastung .................................................................. 272<br />
12.3 Belastungsmodell ..................................................................... 275<br />
Literatur- und Quellenverzeichnis .................................................. 277<br />
5
I Theoretischer Teil<br />
1 Einleitende Betrachtungen<br />
Das Thema <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium und insbesondere in der universitären<br />
Ausbildung von Lehrern ist vor dem Hintergrund zahlreicher <strong>Studien</strong> <strong>zur</strong><br />
Lehrerbelastung (vgl. exemplarisch Schaarschmidt 2004 und 2007, von<br />
Dick 2006, Wendt 2001, Krause 2002, Frey 1996 u.a.m.) und vor dem<br />
Hintergrund der Neustrukturierung des Studiums infolge der Bologna-<br />
Beschlüsse von großer Aktualität. Parallel zu diesen Prozessen wurde,<br />
angeregt durch die internationalen Schulleistungserhebungen, zudem das<br />
Berufsbild des Lehrers neu definiert 1 , was teils erhebliche Auswirkungen<br />
auf die Ausbildung zukünftiger Lehrer hat.<br />
In diesem Sinne versteht sich die vorliegende Studie als eine<br />
hypothesenprüfende Untersuchung der <strong>Belastungen</strong> von Studierenden <strong>im</strong><br />
Lehramtsstudiengang. Sie versucht anwendungs- und praxisorientiert<br />
Antworten und Befunde auf die Fragen zu geben, die <strong>im</strong> Prozess der<br />
aktuellen Umstrukturierung der Lehrerbildung an der Friedrich-Schiller-<br />
Universität aufgeworfen wurden.<br />
Ausgehend von der Projektidee, die eng verknüpft ist mit zentralen<br />
Anliegen des Zentrums für Lehrerbildung und Didaktikforschung der<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena <strong>zur</strong> <strong>im</strong> weitesten Sinne Evaluierung des<br />
neu eingeführten Lehramtsstudiensystems, wird die Forschungsperspektive<br />
sehr frühzeitig durch zentrale Fragen fokussiert, nämlich die nach der<br />
Belastung der Studierenden. Aus dieser Perspektive werden die vom<br />
Individuum als relevant erachteten Erwartungen und Ansprüche der<br />
kognizierten Umwelt als <strong>Belastungen</strong> betrachtet.<br />
Die Studie ist wie folgt gegliedert. In den ersten Kapiteln werden<br />
theoretische Ausführungen gemacht, die einen Einblick in die<br />
Besonderheiten der Situation von Lehramtsstudierenden ermöglichen<br />
sollen und die gegenwärtige <strong>Studien</strong>struktur auf der Makroebene<br />
beschreiben und in ihren Zusammenhängen mit der Megaebene darstellen.<br />
Im Anschluss daran wird die Untersuchung in den bisherigen<br />
Forschungsstand <strong>zur</strong> Thematik eingeordnet und Fragestellung sowie<br />
Hypothesen werden abgeleitet. Im anschließenden empirischen Teil<br />
1 Vergleiche die Erklärung der Kultusministerkonferenz 2000, abrufbar unter<br />
www.kmk.org<br />
6
werden die einzelnen <strong>Studien</strong> sowohl methodisch als auch inhaltlich<br />
dargestellt und ausgewertet. Im abschließenden Kapitel werden die<br />
erhobenen Befunde theorie- und hypothesengeleitet diskutiert und<br />
Entwicklungsperspektiven aufgezeigt.<br />
1.1 Der <strong>Studien</strong>beginn als Übergangsphase<br />
Die Aufnahme eines Studiums stellt einen bedeutsamen Einschnitt in die<br />
Biografie eines Menschen dar und wird dementsprechend oftmals in der<br />
Literatur als Transitionsphase mit teilweise erheblichem Krisenpotenzial<br />
(Seiffge-Krenke 1999, Stewart et al. 1982) bezeichnet. Welche Aspekte<br />
sind für diesen Übergang kennzeichnend? Zunächst können die jungen<br />
Studierenden entwicklungspsychologisch in der Phase der Spätadoleszenz<br />
(Bakmann 1993 S. 5, Graf&Krischke 2004, S. 32ff) <strong>im</strong> Übergang zum<br />
frühen Erwachsenenalter verortet werden. Bildungsbiografisch befinden<br />
sich Studierende <strong>im</strong> Übergang von der sekundären Sozialisation (Schule<br />
und/oder Ausbildung) <strong>zur</strong> tertiären Sozialisation (Berufswahl, Erlernen des<br />
Berufs, berufliche Tätigkeit). Entwicklungspsychologisch ist diese Phase<br />
geprägt von der Aufgabe der jungen Erwachsenen, den Ablösungsprozess<br />
von den Eltern zu vollziehen. Begleitet wird dieser Prozess oftmals durch<br />
das Eingehen neuer und/oder festerer Partnerbeziehungen, die Ausbildung<br />
emotionaler Autonomie und psychologischer Reife sowie durch Prozesse<br />
der Neuorientierung sowie der Identitätsbildung (Krampen/Reichle 2002, S.<br />
319). Dabei ist dieser Prozess nicht notwendigerweise als Krise zu<br />
betrachten. Vielmehr beinhaltet er Chancen und Risiken: Chancen, etwa<br />
das Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Möglichkeiten zu gestalten, sich neu zu orientieren, Sinnhaftigkeit des<br />
Lebens zu erleben oder Selbstständigkeit als Entwicklungsaufgabe zu<br />
meistern.<br />
Mit den genannten Entwicklungen gehen jedoch oftmals auch Risiken<br />
einher, die mit den bezeichneten Besonderheiten der Lebenssituation<br />
zusammenhängen. Hier ist beispielsweise an das Risiko des Scheiterns,<br />
der falschen Orientierung oder auch der Überforderung durch die<br />
zunehmende Autonomie in der Lebensgestaltung zu denken. Das<br />
universitäre Studium bietet vielfältige Orientierungen, breite<br />
Entfaltungsmöglichkeiten, große Entscheidungsspielräume und Freiheiten.<br />
VOSGERAU stellt hierzu fest: „Keine andere Lebensphase und keine<br />
andere soziale Umgebung als die Institution der Universität mit ihren<br />
7
esonderen sozialen Situationen, Kommunikationsformen und Kulturen<br />
eröffnet eine derart eigenständige Biografieplanung durch bewusste<br />
Steuerung.“ (Vosgerau 2005, S. 109) Hiermit sind enormen Chancen, aber<br />
eben auch mit diesen einhergehende Risiken verbunden.<br />
Gleichzeitig sei darauf verwiesen, dass sich Lebensläufe stark<br />
unterscheiden (Bakmann 1993, Bachmann et al. 1999, Oerter/Montada<br />
2002) und dass diese Unterschiede einzubetten sind in eine Phase der<br />
Destandardisierung, die nach Untersuchungsergebnissen der<br />
soziologischen Lebenslaufforschung seit den 70er Jahren in der<br />
Bundesrepublik Deutschland eingesetzt hat und bis heute anhält (Mayer<br />
2001).<br />
Im weitesten Sinne orientieren sich Untersuchungen innerhalb der<br />
Entwicklungspsychologie an Ansätzen zu normierten,<br />
altersentsprechenden Entwicklungen und Entwicklungsaufgaben, die auf<br />
ERIKSON <strong>zur</strong>ückgehen. (Erikson 1998) Dabei werden folgende<br />
Entwicklungsaufgaben für das frühe Erwachsenalter als Konstituenten<br />
erachtet: Vollzug der berufliche Bildung und Ausbildung,<br />
Verantwortungsübernahme als Bürger, Lebensstilfindung und<br />
Identitätsentwicklung, soziale Integration und Partnerwahl<br />
(Krampen/Reichle 2002).<br />
Diese Entwicklungsaufgaben sind vor dem Hintergrund des <strong>Studien</strong>beginns<br />
zu betrachten. Zunächst ist der Übergang von der Schule zum Studium ein<br />
Statusübergang. In Anlehnung an das Phasenmodell von STEWART <strong>zur</strong><br />
sozio-emotionalen Anpassung des Individuums be<strong>im</strong> Übergang ins<br />
Studium, kann der <strong>Studien</strong>beginn durch folgende zentrale Momente<br />
charakterisiert werden (Phasenmodell der sozio-emotionalen Anpassung<br />
be<strong>im</strong> <strong>Studien</strong>übergang nach Stewart et al. 1982):<br />
Die beginnende Transitionsphase ist zunächst gekennzeichnet durch<br />
zahlreiche Orientierungsversuche und durch vielfältige oft neuartige Reize.<br />
Hierbei knüpfen die Studierenden neue soziale Kontakte, lernen ihre Rolle<br />
und die dazu gehörigen Rollenerwartungen und sozialen Regeln kennen<br />
und eruieren den für sie zunächst neuen Kontext. Dies bedeutet, die<br />
Studierenden vollziehen eine soziale und inhaltliche Neuorientierung.<br />
Gleichzeitig stehen die Studierenden vor der Aufgabe, sich möglichst<br />
umfassend in dem für sie oftmals ungewohnten und neuen universitären<br />
Kontext <strong>zur</strong>echtzufinden. Als Entwicklungsrisiken bezeichnet STEWART<br />
hier die soziale Isolation, Uninformiertheit oder zu hohen Konformismus.<br />
8
Diese Risiken sind gleichzeitig als mögliche Belastungsfaktoren <strong>im</strong> Studium<br />
anzusehen.<br />
Zweitens ergibt sich die Entwicklungsaufgabe der Autonomieausbildung<br />
und der Selbstbehauptung. Hier müssen Studierende zunächst den<br />
Umgang mit neuen informellen (z.B. durch Mitstudierende) und formellen<br />
sozialen Regeln (z.B. seitens der Universität) kennenlernen und sich mit<br />
ihnen auseinandersetzen. In dieser Hinsicht muss sich die<br />
Identitätsentwicklung vor dem Hintergrund eines einsetzenden<br />
Konformitätsdruckes vollziehen, wobei die Entwicklungsaufgabe hier<br />
vordergründig in der Ausbildung selbstständiger Handlungskompetenzen<br />
und der Integration des Selbst in das System Hochschule zu sehen ist.<br />
Entwicklungsrisiken werden hier benannt mit anhaltendem Konformismus<br />
oder generalisiertem Widerstand gegen die bestehenden Regeln und<br />
Strukturen. Tendenziell könnte dies <strong>zur</strong> Isolation und <strong>zur</strong> mangelnden<br />
Offenheit gegenüber Neuem führen.<br />
Drittens ist durch den Studierenden schließlich eine Integration in die<br />
Gruppe der Studierenden und in das System Hochschule auf sozialer und<br />
emotionaler Ebene zu vollziehen. Gelingt diese sozial-emotionale<br />
Integration, so wird von einer gelungenen Adaption an die neue<br />
Lebensumwelt ausgegangen. Risiken werden hier vor allem in der sozialen<br />
Isolierung, in individuell als mangelhaft wahrgenommenen persönlichen<br />
Ressourcen (Hornung/Gutscher 1994) und einem <strong>Studien</strong>abbruch aus<br />
sozio-emotionalen und inhaltlich-fachlichen Gründen gesehen.<br />
Insgesamt lässt sich die Übergangsphase ins Studium damit als Annahme<br />
der Herausforderung, sich einer neuen, zumindest partiell<br />
krisengefährdeten Lebenssituation zu stellen und diese zu bewältigen,<br />
charakterisieren. Insbesondere von der Bewältigung der Neuorientierung<br />
<strong>im</strong> Studium sind gravierende Effekte für die Belastung der Studierenden<br />
insbesondere <strong>im</strong> ersten Semester zu erwarten.<br />
Neben diesen Faktoren konnte BAKMANN (1993) nachweisen, dass das<br />
Studium als bedeutsame Phase der Identitätsbildung anzusehen und das<br />
Studium hier als eine wirksame Sozialisationsphase zu bezeichnen ist. Es<br />
ist die Zeit eines Moratoriums und individueller Um- oder Neudefinitionen<br />
(Krüger et al. 1986).<br />
9
Insgesamt sind damit die Studierenden als junge Erwachsene innerhalb der<br />
Transitionsphase von der Schule <strong>zur</strong> Universität und von einem von den<br />
Eltern geprägten Leben in eine Phase sich entwickelnder Lebensautonomie<br />
zu betrachten.<br />
1.2 Aktuelle Entwicklungen <strong>im</strong> Hochschulbereich<br />
Da sich <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium aus der Umwelt rekrutieren, ist der<br />
dargestellte individualpsychologische Bereich mit seinen<br />
belastungsrelevanten Besonderheiten zu ergänzen durch Entwicklungen,<br />
die sich auf den Ebenen der privaten und studienbezogenen Umwelt<br />
vollziehen bzw. von ihnen ausgehen. Gerade <strong>im</strong> Hochschulbereich<br />
vollziehen sich aktuell starke strukturelle und inhaltliche Veränderungen.<br />
Von welchen Wandlungsprozessen ist die Hochschule nun aber betroffen<br />
und welchen neuen Herausforderungen muss sie sich stellen? HUBER<br />
stellt 4 zentrale Elemente fest, in denen sich Entwicklungen <strong>im</strong><br />
Hochschulbereich manifestieren (Huber 1991):<br />
Zunächst ist eine stetig steigende Zahl von Studierenden zu verzeichnen,<br />
die ein universitäres Studium aufnehmen wollen. Daraus resultieren, wenn<br />
die universitäre Lehr- und Infrastrukturen nicht in ähnlich hohem Maße<br />
ausgebaut werden, gravierende Veränderungen für die Studierenden und<br />
deren Situation an der Universität. Der Selektionsdruck kann <strong>im</strong> Studium<br />
als erhöht wahrgenommen werden. Zu <strong>Studien</strong>beginn drückt sich dieser in<br />
einem universitätsinternen numerus clausus aus. Gleichzeitig werden<br />
ähnlich hohe universitäre Ressourcen von <strong>im</strong>mer mehr Studierenden<br />
beansprucht, sodass von einer Verschlechterung der Arbeits- und<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen ausgegangen werden muss. Ebenso ergeben sich<br />
gravierende Verschlechterungen innerhalb der Betreuungssituation der<br />
Studierenden durch die Lehrenden. Die sich hieraus zwangsläufig<br />
ergebenden Folgen sind wachsende Anonymisierung des Einzelnen <strong>im</strong><br />
universitären „Massenbetrieb“, Strukturverschlechterungen und sinkende<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit sowie entsprechend sinkende <strong>Studien</strong>motivation<br />
(Huber 1991). Ähnlich argumentieren BACHMANN et al. und gelangen zu<br />
der Aussage, dass, um den steigenden Studierendenzahlen zu begegnen,<br />
die Anforderungen erhöht, die Zeiträume für Leistungsüberprüfungen<br />
vorverlegt und der Leistungsdruck ausgebaut werden müssen, (Bachmann<br />
et al. 1999, S. 105) sodass hieraus eine hohe Beanspruchung der<br />
Studierenden resultieren könnte. Aus den allgemeinen Entwicklungen <strong>im</strong><br />
10
Hochschulbereich sind damit Zeitstress, mangelnde Betreuung,<br />
Überfrequentierung und Anonymisierung des Studiums sowie steigende<br />
<strong>Studien</strong>konkurrenz, erhöhte Anforderungen <strong>im</strong> Studium und entsprechend<br />
selektierende Überprüfungen der Studierenden als potenzielle<br />
Belastungsfaktoren theoretisch abzuleiten.<br />
Zweitens behauptet Huber eine zunehmend ungünstigere Entwicklung auf<br />
dem Arbeitsmarkt. Diese Entwicklung bleibt für die kommenden Jahre<br />
abzuwarten. Erste Indikatoren einer positiven Entwicklung in diesem<br />
Bereich können aber in der steigenden Zahl von Absolventen gesehen<br />
werden, die 2007 in den Vorbereitungsdienst übernommen wurden. 2 Da in<br />
der antizipierten späteren beruflichen Situation, den Einstellungs- und<br />
Karrieremöglichkeiten wichtige Momente für die Sinnfindung <strong>im</strong> Studium<br />
und damit für die <strong>Studien</strong>motivation zu sehen sind, könnten sich die<br />
aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt als motivations- und damit<br />
studienfördernd bei Lehramtsstudierenden auswirken.<br />
Drittens werden von aktuellen <strong>Studien</strong> ein gesellschaftlicher Wertewandel<br />
und damit einhergehend eine Polarisierung der Werthaltungen unter den<br />
Studierenden festgestellt (exemplarisch: 15. Shell-Jugendstudie 2006, 18.<br />
<strong>Erhebung</strong> des deutschen Studentenwerkes 2006/2007). Durch die<br />
weitgehende Strukturierung des Studiums infolge des Bologna-Prozesses<br />
werden die Studierenden mit einer Vielzahl verbindlicher Regeln, Normen<br />
und Prüfungen die Studierenden zu einer weitgehenden Adaption an das<br />
Hochschul- und <strong>Studien</strong>system gezwungen. Demzufolge sind hierbei<br />
sowohl heterogenisierende als auch homogenisierende Effekte zu<br />
erwarten. Der hohe Strukturierungsgrad des Studiums weist in dieser<br />
Hinsicht zum einen zumindest theoretisch belastende Faktoren auf, wenn<br />
damit gleichzeitig eine Einschränkung an Autonomie und Freiheit <strong>im</strong><br />
Studium verbunden ist. Zum anderen kann er als Hilfe <strong>zur</strong> Selbstständigkeit<br />
gesehen werden, da die <strong>Studien</strong>strukturierung erhebliche<br />
Überschneidungspunkte mit schulischen Strukturen aufweist und damit<br />
Probleme der Transitionsphase zu bewältigen hilft und Orientierungshilfen<br />
bietet.<br />
Auf der Ebene der Studierenden ist hervorzuheben, dass Studieren bei<br />
aller Strukturvereinheitlichung <strong>im</strong>mer ein individueller, aktiver Prozess (z.B.<br />
durch die Lernvoraussetzungen, die bisherige Bildungsbiografie, aber auch<br />
durch die Fächer und Fächerkombination <strong>im</strong> Lehramtsstudium) ist, der<br />
2 Vergleiche hierzu: Statistik des Thüringer Kultusministeriums 2008.<br />
11
durch unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen der Studierenden und<br />
Lehrenden, unterschiedliche Ressourcen und individuelle<br />
Unterstützungssysteme, verschiedenartige soziale Netze, Lebens- und<br />
Familienstile geprägt wird. Hinzu kommt noch der Umstand, dass vielfach<br />
das Studium nicht mehr als Lebensmittelpunkt gesehen wird, da eine<br />
Vielzahl von Studierenden zu den Teilzeitstudierenden gezählt werden<br />
müssen (Huber 1991, Bachmann et al. 1999). Daneben sind kaum lineare<br />
Bildungsverläufe erkennbar. Häufig kann bei Studierenden beobachtet<br />
werden, dass der Bildungsgang zwischen Abitur und Hochschulstudium<br />
durch eine Phase der Orientierung unterbrochen wird und die Abiturienten<br />
zunächst arbeiten oder ins Ausland gehen. Auch wenn hier eine rückläufige<br />
Tendenz konstatiert wird, gilt für 2006, dass durchschnittlich 17 Monate<br />
zwischen der jeweiligen Schul- und Hochschulausbildung liegen. (18.<br />
<strong>Erhebung</strong> des deutschen Studentenwerkes, S. 2) Daneben sind<br />
zunehmend pluralistische <strong>Studien</strong>wahlmotive zu erkennen. Damit muss in<br />
dieser Hinsicht von einer starken Heterogenität der Studierenden auch<br />
innerhalb eines <strong>Studien</strong>ganges gesprochen werden, die einige Autoren zu<br />
der Aussage veranlasst, dass es eine einheitliche Gruppe von<br />
Studierenden in diesem Sinne nicht mehr gibt. (Bachmann et al. 1999,<br />
Huber 1991)<br />
In der Gesamtschau betrachtet, steht damit das universitäre Studium in<br />
einem Prozess, der letztlich in einer Modernisierung münden, und die<br />
ihrerseits veränderte Organisationsformen der Hochschulen und des<br />
Studiums hervorbringen muss. In den gegenwärtigen Diskussionen<br />
manifestiert sich die Zielvorstellung, dass sich die Hochschulen als relativ<br />
autonome, „standortgerechte, individualisierende und effizienzorientierte<br />
Dienstleistungshochschulen“ (Vosgerau 2005, S. 104) entwickeln müssen,<br />
um den Anforderungen der sich wandelnden Gesellschaft und ihrer<br />
Ansprüche, der Internationalisierung und Globalisierung des Lebens<br />
gerecht werden zu können.<br />
Diese Entwicklungen müssen beachtet werden, wenn ein neuer<br />
<strong>Studien</strong>gang hinsichtlich seiner Effekte untersucht werden soll. Empirisch<br />
gesicherte Daten liegen hierzu noch nicht vor.<br />
Gleichzeitig muss vor diesem Hintergrund die Entwicklung betrachtet<br />
werden, die sich als konstitutiv für die Neustrukturierung der <strong>Studien</strong>gänge<br />
erweist, die Umstrukturierung des universitären Studiums durch und infolge<br />
des Bologna-Prozesses. Die hier angestrebten Reformen sollen den<br />
12
vorgestellten Prozessen Rechnung tragen und insbesondere die<br />
Überwindung der starken nationalen Ausrichtung des Studiums, seiner<br />
Inhalte und Abschlüsse zugunsten einer Vereinheitlichung des<br />
europäischen Hochschulraumes vorantreiben. Prägende Kennzeichen<br />
dieses Prozesses sind die Einführung gestufter akademischer Abschlüsse<br />
des Studiums und des European Credit Transfer Systems (ECTS).<br />
13
2 Berufsbild Lehrer 3<br />
2.1 Der Bologna-Prozess als Voraussetzung und Strukturrahmen<br />
für eine Reform der Lehrerausbildung<br />
2.1.1 Inhalt der Bologna-Beschlüsse<br />
1999 wurde europaweit ein Prozess initiiert, der nach dem ersten<br />
Veranstaltungsort als der Bologna-Prozess in die Geschichte der<br />
Bildungspolitik einging. Hintergrund dieser tiefgreifenden Hochschulreform<br />
war zu dieser Zeit vor allem die Absicht der Politik einerseits die Flexibilität<br />
und Mobilität der Studierenden in Europa länderübergreifend zu erhöhen<br />
und die <strong>Studien</strong>gänge durchlässiger zu gestalten und andererseits die<br />
europaweite Vergleichbarkeit der <strong>Studien</strong>abschlüsse sicherzustellen. Zu<br />
diesem Zweck wurde am 19.6.1999 die „Bologna-Deklaration“<br />
verabschiedet, die als wichtigste Vereinbarung der unterzeichnenden 29<br />
Nationen die Erklärung enthält, bis zum Jahre 2010 einen gemeinsamen<br />
europäischen Hochschulraum zu schaffen. Inhaltlich wurden in Bologna<br />
und auf den Nachfolgekonferenzen folgende Beschlüsse verabschiedet:<br />
Die Universitäten schaffen einheitliche universitäre Abschlüsse, die in<br />
einem zweistufigen <strong>Studien</strong>system zu erreichen sind. Dieses<br />
<strong>Studien</strong>system wird häufig mit dem sogenannten Bachelor- und<br />
Masterstudiensystem gleichgesetzt. Gleichzeitig werden für das Studium in<br />
diesen <strong>Studien</strong>gängen ECTS-Punkte aufgrund von Workloads vergeben,<br />
die studienbegleitend und durch Abschlussprüfungen erworben werden<br />
können. Inhaltlich folgt das Gesamtkonstrukt dem Modell des lebenslangen<br />
Lernens. Die konkrete Ausgestaltung der Vorgaben bleibt jedoch in den<br />
Ländern der Bundesrepublik Deutschland den zuständigen Ministerien und<br />
Hochschulen überlassen.<br />
3 Die Ausführungen hierzu sind zu großen Teilen publiziert in: Jantowski, Andreas:<br />
Berufsbild Lehrer – das Jenaer Modell der Lehrerbildung. In: Praxis Neue Schulleitung Nr.<br />
89 /2007, S. 1-14.<br />
14
2.1.2 Auswirkungen auf die allgemeine Struktur universitärer<br />
Lehrerausbildung<br />
Die Beschlüsse der Bologna-Erklärung und die zugrunde liegende<br />
Konzeption des lebenslangen Lernens haben Konsequenzen für die<br />
universitäre Ausbildung. Zunächst soll die Zweigliedrigkeit der<br />
Lehrerausbildung beibehalten werden. Das bedeutet, dass auch weiterhin<br />
in der ersten, der universitären Ausbildungsphase vorwiegend theoretische<br />
erziehungswissenschaftliche und fachwissenschaftliche Einsichten zu<br />
Inhalten des Studiums werden. Gleichzeitig wird der Praxisanteil jedoch<br />
deutlich gestärkt und ein Modulsystem eingeführt. Dies wiederum soll<br />
innerhalb des universitären Curriculums zu einer deutlichen Straffung des<br />
Studiums mit der Möglichkeit führen, Prüfungen studienbegleitend<br />
abzulegen. Im Anschluss daran müssen Übergangsmodalitäten für die<br />
zweite Phase der Lehrerbildung geschaffen und Konsequenzen für die<br />
Aus- und Fortbildungspraxis der Lehrer gezogen werden.<br />
2.2 Das veränderte Berufsbild des Lehrers und seine<br />
Auswirkungen auf die universitäre Ausbildung<br />
2.2.1 Das Berufsbild des Lehrers – Agenda 2020<br />
Das Berufsbild oder das Leitbild des Lehrerberufes setzt sich zusammen<br />
aus der Gesamtheit aller Anforderungen, die an einen Lehrer gestellt<br />
werden und den Kompetenzen, die er <strong>zur</strong> Bewältigung dieser<br />
Anforderungen erwerben und ausbilden muss. Hierzu wurde <strong>im</strong> Oktober<br />
2000 in einer gemeinsamen Erklärung des Präsidenten der<br />
Kultusministerkonferenz und den Vorsitzenden der Lehrerverbände ein<br />
Kompendium von Beschreibungen der Anforderungen des Lehrerberufs<br />
aufgestellt. 4 Die visionäre Weiterentwicklung dieses Bildes ist die Basis der<br />
nachfolgenden Ausführungen.<br />
Unter Berücksichtigung zentraler Kritikpunkte am Unterricht (Helmke 2004,<br />
Meyer 2000) ergeben sich wesentliche Implikationen für eine veränderte<br />
Rolle des Lehrers und sein Handeln auch in seinen tradierten<br />
Aufgabenfeldern. Der Lehrer wird vom Wissensvermittler zum Lernberater.<br />
Er versteht es, Lernen in vielfältigen Situationen zu initiieren und zu<br />
begleiten, leitet die Schüler zu <strong>im</strong>mer selbstständigeren Lernhandlungen an<br />
und hat letztlich zum Ziel, sich als Lernberater gleichsam zu substituieren.<br />
4 Die Erklärung ist abrufbar unter www.kmk.org<br />
15
Daneben plant der Lehrende und konstruiert gemeinsam mit seinen<br />
Schülern Lernumfelder, die das selbstständige, das selbstgesteuerte<br />
Lernen unterstützen. Der Lehrer ist damit nicht nur Experte seiner Fächer,<br />
sondern und vor allem Experte für Unterricht und damit für<br />
institutionalisierte, zielgerichtete Lehr-Lern-Prozesse. Der Lehrer entwickelt<br />
dabei seine Fachkompetenz in gleichem Maße wie seine didaktischmethodischen,<br />
personalen und sozial-kommunikativen Kompetenzen. Er<br />
verfügt daneben über ein breites Methodenrepertoire, das es ihm<br />
ermöglicht, selbst schwierige Sachverhalte nachvollziehbar und verstehbar<br />
zu erklären. Ergänzt werden diese Kompetenzen durch eine umfassende<br />
Medienkompetenz, die eine medienkritische Perspektive unbedingt<br />
beinhaltet.<br />
Sein Berufsbild wird geprägt durch die Liebe <strong>zur</strong> Arbeit mit Kindern und<br />
Jugendlichen, durch Anerkennung und Wertschätzung der ihm<br />
anvertrauten Schüler und durch Ziele, die sich sowohl auf eine am Kind<br />
orientierte Bildung als auch Erziehung erstrecken.<br />
Der Lehrer entwickelt seinen Unterricht kontinuierlich weiter und bezieht<br />
wissenschaftliche Erkenntnisse der Pädagogik, der Psychologie aber auch<br />
der Fachwissenschaften regelmäßig auf seinen Unterricht, der<br />
gekennzeichnet ist von einer effektiven und zugleich schülerorientierten<br />
Nutzung der <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Lernzeit.<br />
Der Lehrer ist selbst motiviert und engagiert und versteht es, die Schüler zu<br />
motivieren und <strong>zur</strong> Ausdauer be<strong>im</strong> Lernen an<strong>zur</strong>egen. Dabei gelingt ihm<br />
eine sinnstiftende Kommunikation mit seinen Schülern, die zu einem<br />
angenehmen und lernförderlichen Kl<strong>im</strong>a innerhalb des Unterrichts und<br />
innerhalb der gesamten Schule beiträgt.<br />
Die diagnostische Kompetenz des Lehrers, der sich an einem pädagogisch<br />
erweiterten Leistungsbegriff orientiert, ist umfassend in dem Sinne<br />
ausgebildet, dass der Lehrer nicht nur Leistungsvielfalt initiiert und<br />
berücksichtigt, sondern auch eine ausgewogene Balance innerhalb seiner<br />
Bezugsnormorientierung aufweist. Auf diese Weise legit<strong>im</strong>iert er seine<br />
schulischen Leistungsansprüche, seine Forderungen durch das Prinzip der<br />
Förderung. Dem Lehrer gelingt es, seine Schüler an ihren Aufgaben<br />
wachsen zu lassen, sie zerbrechen nicht an ihnen.<br />
Gleichfalls ist der Lehrer in der Lage, unterschiedlichen an ihn<br />
herangetragenen Ansprüchen gerecht zu werden. Er orientiert seinen<br />
Unterricht an Bildungsplänen und Standards, fordert und fördert aber<br />
16
individuell. Er beachtet die Ansprüche der Gesellschaft an Schule<br />
(Berechtigungsvergabe) und die individualpsychologische Perspektive. Er<br />
versteht es Lernschwierigkeiten zu erkennen, Defizite zu beheben und<br />
gleichzeitig Stärken und Begabungen gezielt zu fördern.<br />
Zur kontinuierlichen Verbesserung seines professionellen Handelns erhält<br />
er regelmäßig Rückmeldungen von seinen Schülern und Kollegen. Er<br />
evaluiert und reflektiert seinen Unterricht und betrachtet die daraus<br />
resultierenden Ergebnisse als Weichen für die Ausgestaltung seiner<br />
weiteren unterrichtlichen Handlungen.<br />
Der Lehrer versteht es darüber hinaus, alle an der Bildung und Erziehung<br />
Beteiligten (Schule, Elternhaus, kommunale/regionale Partner und<br />
Einrichtungen etc.) an der Ausgestaltung des Lernprozesses seiner Schüler<br />
zu beteiligen und entsprechende Aktivitäten nicht nur an<strong>zur</strong>egen, sondern<br />
auch zu koordinieren und aufrecht zu erhalten.<br />
Diese Liste, die sehr weitreichend und idealisierend ist, ließe sich endlos<br />
fortsetzen, wenn das Idealbild eines zukünftigen Lehrers beschrieben<br />
werden soll. Im Kern bedeuten diese Anregungen aber, dem zukünftigen<br />
Lehrer nicht nur zum Experten für seine studierten Fächer auszubilden,<br />
sondern diese Ausbildung um praktische, methodisch-didaktische, soziale,<br />
kommunikative und personale Kompetenzen zu erweitern.<br />
Zusammen mit der durch den Bologna-Prozess initiierten Reform der<br />
universitären Ausbildung hat diese Vision erhebliche Auswirkungen auf die<br />
Ausgestaltung und damit die Mission (Kaufman et al. 1996) der<br />
universitären Lehrerbildung.<br />
2.2.2 Die Konsequenzen des Berufsbildes für die Ziele des universitären<br />
Lehramtsstudiums<br />
Die universitäre Lehrerbildung wurde und wird noch <strong>im</strong>mer sehr kritisch<br />
gesehen. Oftmals ist von Wissenschaftslastigkeit der Lehrerbildung, von<br />
mangelnder pädagogisch-psychologischer Ausbildung und einer noch<br />
mangelhafteren Vorbereitung der Studierenden auf den künftigen<br />
Lehrerberuf die Rede. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wird<br />
über die Professionalisierung von Lehrern in unterschiedlicher Intensität,<br />
jedoch kontinuierlich, gestritten. Diese Diskussion kann zusammengefasst<br />
in der Aussage von DORIS AHNEN wiedergegeben werden: „Was die<br />
Lehrerbildung angeht, so ist in den Hochschulen die Organisation und<br />
Ausrichtung auf das <strong>Studien</strong>fach absolut dominant, und Lehrerbildung <strong>im</strong><br />
17
Sinne der Berufsvorbereitung hat eigentlich noch <strong>im</strong>mer keinen festen<br />
Platz.“ (Eckinger, L., Ahnen, D. und Klippert, H. 2005, S. 130.)<br />
Bis heute wird die Diskussion über die Ausrichtung der universitären<br />
Lehrerbildung durch die Fokussierung der wissenschaftlichen Ausbildung<br />
einerseits oder der Ausbildung berufsbezogener Kompetenzen<br />
andererseits geprägt.<br />
Als übergeordnetes Ziel universitärer Lehrerausbildung wird gegenwärtig<br />
eine weitergehende Professionalisierung des Lehrerberufs angesehen, die<br />
sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Anwendungen<br />
umfasst. Dabei steht nach wie vor die Ausbildung einer umfassenden<br />
Fachkompetenz in den studierten Fächern <strong>im</strong> Fokus des Studiums.<br />
Gleichzeitig soll diese Sachkompetenz entsprechend den Anforderungen<br />
des Lehrerberufs ergänzt werden durch eine entsprechende<br />
fachdidaktische Kompetenz. Hinsichtlich des erziehungswissenschaftlichen<br />
Studiums soll das Ziel darin bestehen, die zukünftigen Lehrer in eine<br />
grundlegende erziehungswissenschaftliche Handlungskompetenz<br />
einzuführen und wesentliche Einsichten in diesem Gebiet zu ermöglichen.<br />
Letztlich muss es Ziel sein, künftigen Lehrern ein entsprechendes<br />
Repertoire zu vermitteln, das es ihnen ermöglicht, ihr eigenes Handeln zu<br />
elaborieren, zu evaluieren und Evaluationsergebnisse für die eigene<br />
Unterrichtsentwicklung zu nutzen. Damit soll die universitäre Ausbildung<br />
der Lehrer letztlich den Grundstein für ein „...wissenschaftlich begründetes<br />
Verständnis der pädagogisch-psychologischen Bedingungen von Lernen,<br />
Unterricht und Schule“ (Eckinger et al., S. 127.) legen. Dies <strong>im</strong>pliziert neben<br />
hohen <strong>Studien</strong>anteilen in den Fächern den Ausbau der Praxisanteile <strong>im</strong><br />
Studium und die Erweiterung des erziehungswissenschaftlich orientierten<br />
Begleitstudiums.<br />
18
3 <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium<br />
3.1 Der Belastungsbegriff<br />
In den vorstehenden Aussagen wurde bereits mehrfach der<br />
Belastungsbegriff verwendet. Um eine präzise Ausrichtung des Begriffs auf<br />
die Untersuchung sowie eine begriffliche Kongruenz zwischen dem Autor<br />
und dem Leser zu ermöglichen, soll das Verständnis des<br />
Belastungsbegriffs zunächst expliziert werden.<br />
Untersucht man die Aussagen zum Belastungsbegriff in der<br />
wissenschaftlichen Literatur, so muss festgestellt werden, dass es eine<br />
einheitliche Begriffsbest<strong>im</strong>mung derzeit nicht gibt. (Faltmaier 1988, Rudow<br />
1994, Kramis-Aebischer 1996, Combe 1996, Krause 2002, von Dick et al.<br />
2007) Viele <strong>Studien</strong> <strong>zur</strong> Belastung verwenden daneben den Begriff, ohne<br />
exakte Definitionen vorzunehmen. (Krause 2002, S. 10)<br />
Nach FALTMAIER ist der Belastungsbegriff zwischenzeitlich ein Begriff<br />
interdisziplinären Charakters geworden. (Faltmaier 1988, S. 46) Dabei<br />
werden die Begriffe Belastung – Beanspruchung – Stress oftmals synonym<br />
verwendet, was eine Konkretisierung weiter erschwert.<br />
Der Begriff selbst geht <strong>im</strong> Wesentlichen <strong>zur</strong>ück auf die Definition von<br />
Belastung, die Hans SELYE 1936 vorgenommen hat. Er sieht in Stress<br />
eine Form von Belastung und hierin eine unspezifische Reaktion des<br />
Individuums auf jede Art von Anforderung. (Faltmaier 1988, S. 48) SELYE,<br />
der weitgehend als Begründer der Stresstheorie angesehen werden darf<br />
(Frey 1996, S. 16), charakterisiert damit Belastung als eine Reaktion des<br />
Organismus, als eine „Reaktionskette physiologischer Anpassung an<br />
unspezifische innere und äußere Reize.“ (Kläsener & Korte 2004, S. 179).<br />
Unter diesen Prämissen stellt der Belastungsbegriff nach FALTMAIER „…<br />
eine Zustandsform des Individuums dar, die auf einen best<strong>im</strong>mten Aspekt<br />
der gesellschaftlichen Umwelt bezogen ist; sie ist somit <strong>im</strong>mer ein Person-<br />
Umwelt-Verhältnis.“ (Faltmaier 1988, S. 57) Belastung ergibt sich demnach<br />
aus der Umwelt, der Person und der Wahrnehmung der Umwelt durch das<br />
Individuum. Außerdem besteht aufgrund des Zustandscharakters von<br />
<strong>Belastungen</strong> die Notwendigkeit, in zeitlichen Abständen Veränderungen<br />
innerhalb dieses Zustands zu überprüfen (Faltmaier 1988).<br />
Auf die subjektive Bewertung von <strong>Belastungen</strong> zielt der Belastungsbegriff<br />
ab, den VAN DICK, WAGNER & PETZEL verwenden. Sie definieren<br />
Belastung als „…die subjektive Wahrnehmung von Beanspruchung durch<br />
19
unterschiedliche Arbeitsbedingungen.“ (1999, S. 270) Diese subjektive<br />
Sicht unterstreicht auch ULICH, der definiert: „<strong>Belastungen</strong> sind<br />
Beeinträchtigungen der individuellen Befindlichkeit und St<strong>im</strong>mung, der<br />
Erlebnis-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten einer Person in<br />
einer gegebenen Situation, die subjektiven Leidensdruck hervorrufen.“<br />
(1996, S. 64) Beide Begriffsbest<strong>im</strong>mungen heben deutlich auf den<br />
individualisierten Aspekt von Belastung ab und gehen davon aus, dass sich<br />
<strong>Belastungen</strong> als Reflexionen von Umweltanforderungen durch das<br />
Individuum ergeben. ULICH betont die eher beeinträchtigend auf das<br />
Individuum einwirkenden Effekte von Belastung. Hier stellt sich jedoch die<br />
Frage, ob <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong>mer auch, wie von ULICH postuliert, negativ sein<br />
müssen, oder ob <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Sinne von bewältigbaren Anforderungen<br />
auch positive Auswirkungen haben können. Dieser Frage gehen besonders<br />
HÜBNER und WERLE nach, die definieren: „…dass der Begriff keine bloß<br />
negativ bewertete Erfahrung bezeichnen sollte, obwohl dies in den<br />
allermeisten Untersuchungen <strong>zur</strong> Lehrerbelastung der Fall zu sein scheint.<br />
Belastung kann und muss auch ebenso gut als Herausforderung…<br />
aufgefasst werden, die Bewältigungswillen und Kreativität freizusetzen<br />
vermag.“ (Hübner & Werle, 1997, S. 218f.) Innerhalb dieser Definition wird<br />
der Belastungsbegriff damit mit neutraler bis positiver Konnotation<br />
verwendet. <strong>Belastungen</strong> können also auch <strong>im</strong> Sinne von Anforderungen<br />
oder Herausforderungen, die das Individuum ann<strong>im</strong>mt, positive<br />
Rückwirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung aufweisen.<br />
Trotz unterschiedlicher Akzentuierungen sind einige grundlegende<br />
Merkmale des Belastungsbegriffs vorerst festzuhalten: <strong>Belastungen</strong><br />
ergeben sich aus Situationen heraus, aus Umweltbedingungen, die auf das<br />
Individuum einwirken und die von dem Individuum als relevant<br />
wahrgenommen werden. Das Individuum selbst setzt sich mit seiner<br />
Umwelt auseinander und n<strong>im</strong>mt die Bedingungen wahr. Relevante<br />
<strong>Belastungen</strong> sind damit als temporär und situativ gebunden anzusehen.<br />
Daneben ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung<br />
gleicher oder ähnlicher Umweltbedingungen ein nächstes Charakteristikum<br />
von <strong>Belastungen</strong>: Sie sind intraindividuell und interindividuell<br />
unterschiedlich.<br />
Damit ergibt sich eine wie folgt erweiterte Definition für Belastung:<br />
Belastung entsteht durch Anforderungen aus der Umwelt, die auf das<br />
Individuum einwirken und zu individuell interpretierten Beanspruchungen<br />
20
des Menschen führen. Die Gesamtheit der Beanspruchungen führt zum<br />
Belastungsempfinden, wobei sowohl der Begriff der Belastung als auch der<br />
Begriff Beanspruchung zunächst wertneutral aufzufassen sind.<br />
Wahrgenommene Beanspruchungen führen dann schließlich durch das<br />
Handeln des Individuums zu Beanspruchungsreaktionen.<br />
Demzufolge wird Belastung <strong>im</strong> vorliegenden Zusammenhang verstanden<br />
als durch das Individuum vor dem Hintergrund individueller<br />
Handlungsmöglichkeiten interpretierte Anforderung aus der kognizierten<br />
Umwelt, die direkt oder indirekt auf das Individuum einwirkt. Durch die<br />
Interpretation wird die Belastung aus der Umwelt zu einer individuellen<br />
Beanspruchung des Individuums. Die Gesamtbelastung der Person ergibt<br />
sich aus dem Zusammenspiel aller interpretierten <strong>Belastungen</strong> unter<br />
Berücksichtigung entlastender Momente und Unterstützungen sowie deren<br />
Interaktion. Die Höhe der Gesamtbelastung wird neben intrapersonellen<br />
Variablen wesentlich durch die Nutzung von vorhandenen Ressourcen<br />
durch das Individuum beeinflusst. Dies <strong>im</strong>pliziert, dass sich Belastung aus<br />
der erfahrbaren Komplexität der Lebensumwelt des Individuums heraus<br />
ergibt. Demzufolge darf diese Komplexität innerhalb von Untersuchungen,<br />
die Belastung thematisieren wollen, nicht durch eine einseitige<br />
Fokussierung auf berufliche Situationen reduziert werden. Vielmehr geht es<br />
darum, sich durch die Erfassung von Variablen aus dem privaten Umfeld<br />
der Personen, individuellen Persönlichkeitsmerkmalen,<br />
Handlungsvoraussetzungen und subjektiven Überzeugungen dieser<br />
Komplexität anzunähern.<br />
3.2 Das Belastungsempfinden<br />
Unter Berücksichtigung dieser Definition stellen Untersuchungen <strong>zur</strong><br />
Belastung die aus der Umwelt einwirkenden Bedingungen in den<br />
Vordergrund. Gleichzeitig darf aber eine Untersuchung hier nicht stehen<br />
bleiben, sondern muss versuchen zu erklären, wie diese aus der Umwelt<br />
einwirkenden Bedingungen von den Individuen wahrgenommen und<br />
interpretiert werden, kurz, in welchem Ausmaß sie als positiv oder negativ<br />
auf die Person einwirkend empfunden werden. Das Empfinden bezeichnet<br />
dabei einen situativ gebundenen physiologischen Erregungszustand des<br />
Individuums, der sich aus der subjektiven Gewichtung von<br />
Beanspruchungen einerseits und Bewältigungsmöglichkeiten andererseits<br />
ergibt. Diese Wahrnehmung mündet in das individuelle<br />
21
Belastungsempfinden, das darin kulminiert, dass gleiche oder ähnliche<br />
<strong>Belastungen</strong> aus der Umwelt zu unterschiedlichen Beanspruchungen des<br />
Individuums und hierüber zu einem interindividuell unterschiedlichem<br />
Belastungsempfinden führen.<br />
Insbesondere <strong>zur</strong> Unterschiedlichkeit des Belastungsempfindens führt<br />
bereits RUDOW aus: „Es liegt auf der Hand, dass die psychische<br />
Belastung in Abhängigkeit von der Art der Widerspiegelung (…) objektiver<br />
Anforderungen oder <strong>Belastungen</strong> von Individuum zu Individuum sehr<br />
variieren kann.“ (Rudow 1994, S. 44).<br />
Damit ergibt sich als Implikation für die vorliegende Studie, nicht nur<br />
<strong>Belastungen</strong>, sondern auch das Belastungsempfinden zu thematisieren.<br />
Die Frage, die sich hier jedoch stellt, ist, durch welche Faktoren das<br />
Belastungsempfinden in welchem Maße geprägt wird. Grundsätzlich kann<br />
davon ausgegangen werden, dass das Individuum über einen erarbeiteten<br />
Grundstock an Ressourcen <strong>im</strong> Sinne von emotionalen, motivationalen und<br />
kognitiven Handlungskompetenzen verfügt, also bereits eine<br />
intrapersonelle Disposition aufweist. Da grundsätzlich von der Person-<br />
Umwelt-Beziehung als Determinante ausgegangen und Verhalten als<br />
Interaktionsprozess zwischen Umwelt und Individuum (Lewin 1951)<br />
aufgefasst wird, sind jedoch diese intrapersonellen Dispositionen um<br />
Umwelteinflüsse und Interaktionen zwischen Person und Umwelt zu<br />
ergänzen.<br />
Das Belastungsempfinden ergibt sich damit aus dem Vergleich der<br />
Umweltanforderungen mit den Handlungsmöglichkeiten des Individuums,<br />
vor dem Hintergrund vorhandener bekannter Ressourcen und den daraus<br />
abgeleiteten Bewertungen der Anforderungen durch das Individuum. Dabei<br />
wirken motivationale, emotionale und volitionale Dispositionen auf das<br />
Belastungsempfinden ein.<br />
Das Belastungsempfinden ergibt sich unter diesem Ansatzpunkt aus<br />
aktuellen individuellen, sozialen und strukturellen Faktoren. Dabei schließt<br />
das Belastungsempfinden zum Einen belastende und zum Anderen<br />
entlastende Aspekte ein. Entlastende Aspekte werden in Anlehnung an<br />
Modelle der Gesundheitspsychologie (Hornung & Gutscher 1994, S. 73ff.,<br />
Beutel 1989) als individuelle Ressourcen aufgefasst, wobei auch dieser<br />
Begriff in der einschlägigen Literatur unscharf bleibt. Nachfolgend sollen<br />
Ressourcen verstanden werden als Potenziale, die <strong>zur</strong> Selbsterhaltung und<br />
Lebensbewältigung beitragen sowie die Entwicklung des Individuums<br />
22
fördern. Individualisiert muss der Ressourcenbegriff nicht nur dadurch<br />
verstanden werden, dass sich die Individuen hinsichtlich ihrer Potenziale<br />
unterscheiden, sondern auch in Bezug auf die Zugriffsmöglichkeiten auf die<br />
vorhandenen Ressourcen und die Bereitschaft zu deren Nutzung<br />
unterschiedlich disponiert sind. Ressourcen als Potenziale sind damit als<br />
situationsabhängig gebrauchte, habitualisierte, wie auch flexible<br />
Handlungsmuster und -möglichkeiten aufzufassen, die ihrerseits mit<br />
kognitiven Überzeugungen in Wechselwirkung stehen. (Hornung &<br />
Gutscher 1994, S. 92) Dabei sind soziale und individuelle Ressourcen zu<br />
unterscheiden.<br />
Insgesamt versucht die vorliegende Studie die drei Belastungsbereiche -<br />
objektive, subjektive und selbst auferlegte Belastung - zu thematisieren und<br />
sieht Belastungsempfinden als komplexes, in wechselnden Kontexten<br />
auftretendes, diskontinuierliches, reales Phänomen aus Belastung,<br />
Beanspruchung und individuellen Bewertungen an. (Fürstenberg 2000, S.<br />
108)<br />
3.3 Theoretische Modelle <strong>zur</strong> Belastung<br />
Auf den unterschiedlichsten Definitionen des Belastungsbegriffs aufbauend<br />
entwickelten sich eine Reihe unterschiedlicher Ansätze von Theorien zu<br />
dieser Thematik, die sich in die Gruppen der reaktionsbezogenen,<br />
reizbezogenen und relationale Ansätze untergliedern lassen. (Faltmaier<br />
1988, Nitsch 1981)<br />
Die in den verschiedenen Wissenschaftsgebieten am häufigsten genutzte<br />
Theorie entstand auf der Grundlage des transaktionalen Stresskonzeptes<br />
von LAZARUS. (Lazarus 1999, Lazarus und Launier 1981) Demgemäß<br />
entsteht Stress infolge einer Transaktionsbeziehung zwischen dem System<br />
Individuum und dem System Umwelt. Das Stressgeschehen äußert sich<br />
dabei in einem Prozess kognitiver Bewertungen des Individuums, der sich<br />
über mehrere Stufen hinweg entwickelt. In einer ersten Stufe bewertet das<br />
Individuum die Situation <strong>im</strong> Hinblick auf ihre Bedeutung für das Leben des<br />
betreffenden Menschen als unwichtig oder relevant und potenziell<br />
belastend. In dieser pr<strong>im</strong>ären Bewertung wird die Situation dann als<br />
potenzieller Belastungsfaktor wahrgenommen, wenn sie das Potenzial<br />
einer Herausforderung, einer Bedrohung, einer Schädigung oder eines<br />
Verlustes in sich birgt. Vor dem Hintergrund dieser pr<strong>im</strong>ären Bewertung<br />
gleicht das Individuum die Belastungssituation dann mit den vorhandenen<br />
23
Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten ab und wählt<br />
Bewältigungsstrategien aus. Dies wird von LAZARUS als sekundäre<br />
Bewertung bezeichnet. Der Unterschied zwischen der pr<strong>im</strong>ären und<br />
sekundären Bewertung darf damit weniger in einer zeitlichen Abfolge als<br />
vielmehr in einer inhaltlichen Beurteilung gesehen werden. Dabei kann<br />
subjektiv ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen in einer<br />
Situation und der Anpassungsfähigkeit einer Person an die Situation<br />
konstatiert werden. Wird dieses Ungleichgewicht wahrgenommen, entsteht<br />
als negative Belastung Stress. Das Ausmaß des Stresses hängt wesentlich<br />
davon ab, wie die Person die ihr <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Möglichkeiten<br />
einschätzt, um eine Situation erfolgreich bewältigen zu können und welche<br />
Bewältigungsstrategien <strong>zur</strong> Verfügung stehen (coping). Negativer Stress<br />
entsteht dann, wenn die vorhandenen Bewältigungsressourcen die für die<br />
erfolgreiche Bewältigung der jeweiligen Situation notwendigen übersteigen.<br />
Sowohl die pr<strong>im</strong>äre als auch die sekundäre Bewertung stehen in einem<br />
starken Zusammenhang mit der Konfiguration der Anforderungen, mit der<br />
Anforderungssituation selbst und den Persönlichkeitseigenschaften des<br />
Individuums. Emotionen können nach Untersuchungen von Lazarus als<br />
Moderatorvariablen betrachtet werden. (Lazarus 1999)<br />
Im Detail bedeutet dies, dass eine Situation zunächst durch die Person in<br />
Bezug auf das eigene Wohlbefinden pr<strong>im</strong>är bewertet wird. Die Situation<br />
kann als irrelevant, positiv/günstig oder stressend eingeschätzt werden. Bei<br />
einer positiven Einschätzung wird die Situation als Herausforderung<br />
angenommen. Wird die Situation dagegen als negativ-stressend bewertet,<br />
können Erwartungen entstehen, die eine negative Auswirkung der Situation<br />
vorwegnehmen (Bedrohung) oder aber die negativen Auswirkungen als<br />
bereits eingetreten konstatieren. Dann wird die jeweilige Situation als<br />
Schädigung oder Verlust bewertet. Innerhalb der sekundären Bewertung<br />
werden Bewältigungsverhalten und Bewältigungsmöglichkeiten mit der<br />
Situation abgeglichen. Die subjektiven Bewertungen sind damit als<br />
antizipatorisch zu betrachten. Belastung und Stress sind daneben nicht mit<br />
dem Bestehen einer Situation oder einer Person begründbar. Erst in der<br />
Transaktion zwischen Person und Umwelt und zwischen pr<strong>im</strong>ärer und<br />
sekundärer Bewertung kann es fortgesetzt zu Neubewertungen der<br />
Situation und damit zu Beanspruchungen kommen.<br />
Innerhalb dieser Transaktionen setzt die Situationsbewältigung ein. Unter<br />
Bewältigung werden dabei alle Reaktionen eines Individuums subsummiert,<br />
24
die in einer als relevant bewerteten Situation <strong>zur</strong> Problemlösung eingesetzt<br />
werden. Der Bewältigungsprozess besteht dabei aus zwei Komponenten –<br />
einer kognitiven und einer verhaltensbezogenen. Personen können dabei<br />
eine entstandene Belastungssituation entweder problemzentriert oder<br />
emotionszentriert angehen. Problemzentriertes Bewältigen der Situation<br />
mündet in konkrete Verhaltensweisen und Aktionen, d.h., die Beziehung<br />
zwischen dem Individuum und der Umwelt, die <strong>im</strong> aktuellen Geschehen ein<br />
Hindernis oder ein Problem beinhaltet, wird so verändert, dass das<br />
Hindernis oder das Problem gelöst werden kann. Problemzentrierte<br />
Lösungen werden zumeist dann angewandt, wenn die Situation als<br />
bewältigbar vor dem Hintergrund der vorhandenen Ressourcen erscheint.<br />
Im Gegensatz hierzu wird die emotionszentrierte Strategie meist innerhalb<br />
von Situationen eingesetzt, die die eigenen Ressourcen übersteigen und<br />
damit als ungünstig für das Individuum bewertet werden. Hierbei vollzieht<br />
sich die Bewältigung vor allem <strong>im</strong> kognitiven Bereich, d.h., nicht die<br />
Situation wird verändert, sondern die kognitive Bewertung der Situation. In<br />
vielen Situationen sind beide Bewältigungsarten nicht trennscharf und<br />
werden teilweise parallel verwendet. Die entsprechende Anpassung des<br />
Individuums an die Situation der Belastung ist daneben stark<br />
kontextbezogen und die Anpassungsleistung qualitativ stark<br />
unterschiedlich.<br />
Im Zentrum dieses Ansatzes stehen damit vor allem zwei grundlegende<br />
Aspekte – die Transaktion zwischen der Person und der Umwelt sowie die<br />
individuellen Bewertungsprozesse durch das Individuum. Stress wird in<br />
diesem Zusammenhang verstanden als „Beziehung zwischen Person und<br />
Umwelt, die von der Person als ihre eigenen Ressourcen auslastend oder<br />
überschreitend […] bewertet wird.“ (Lazarus & Folkman 1984, S. 19) Im<br />
Zusammenhang mit der in der vorliegenden Untersuchung gewählten<br />
Belastungsdefinition ist Stress damit unter der Bedingung der<br />
Überschreitung der bestehenden Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten<br />
als negative Beanspruchung und entsprechendes Belastungsempfinden zu<br />
kennzeichnen.<br />
In der arbeitspsychologisch orientierten Forschung werden demgegenüber<br />
eher situations-, reaktions- und reizbezogene Konzepte verwendet, die die<br />
objektiven Arbeitsanforderungen (Reize=Stressoren) und die<br />
Arbeitsbedingungen (Situation) in den Mittelpunkt des Untersuchungs- und<br />
Erklärungsinteresses stellen. Dabei werden diese Anforderungen und<br />
25
Bedingungen als auf das Individuum objektiv einwirkende Reize definiert<br />
und gemessen. Individuelle kognitive Bewertungsprozesse durch die<br />
handelnden Personen bleiben dabei oftmals ausgeklammert. (Schönpflug<br />
1987, Kramis-Aebischer 1996, Faltmaier 1988) Außerdem bleiben die<br />
Unterschiedlichkeit der auslösenden Reize, ihre Art und ihre Intensität<br />
innerhalb der reaktionsbezogenen Konzepte außer acht, während innerhalb<br />
der reizbezogenen Ansätze kaum beachtet wird, dass Reaktionen von<br />
Menschen auf gleiche oder ähnliche Reize in ähnlichen Kontexten<br />
vollkommen widersprüchlich verlaufen können. Dennoch richten die<br />
genannten Konzepte die Aufmerksamkeit auf Aspekte, die in ein Modell <strong>zur</strong><br />
Belastung einfließen sollten, nämlich die Merkmale der Arbeitsbelastung,<br />
die Komplexität der Anforderungen sowie die Reaktions- und<br />
Entscheidungsspielräume der Individuen. (Rudow 1995)<br />
In der vorliegenden Arbeit erscheint es deshalb als sinnvoll, beide Ansätze<br />
miteinander zu kombinieren. Der grundlegende Transaktionsansatz wird<br />
beibehalten, jedoch um die Untersuchung konkreter Arbeitsanforderungen<br />
(Reize), der Arbeitshandlungen (Reaktionen), personenbezogener<br />
Faktoren sowie personale, soziale und materielle Ressourcen der<br />
Personen erweitert.<br />
Des Weiteren wird in <strong>Belastungen</strong> als Anforderungen der kognizierten<br />
Umwelt und interpretierte Beanspruchungen unterschieden, die <strong>im</strong> Spiegel<br />
der Handlungsvoraussetzungen und –möglichkeiten durch transaktionale<br />
Bewertungsprozesse in ein subjektiv positives oder negatives<br />
Belastungsempfinden münden. (Belastungs-Beanspruchungsmodell nach<br />
Rudow 1994) Aus der Interpretation der Belastung ergeben sich damit die<br />
Beanspruchungen des Individuums und hieraus die<br />
Beanspruchungsreaktionen und -folgen. (van Dick et al. 2007, S. 36)<br />
Gleichzeitig muss der Faktor, wie eine Person vorhandene Ressourcen zu<br />
beschaffen und nutzen versteht, in diese Überlegungen einfließen. Die<br />
erfolgreiche Bewältigung der Situation ergibt sich dann als Folge einer<br />
kompetenten und adäquaten Reaktion des Individuums auf eine Situation.<br />
Daneben ist das Belastungsempfinden selbst ein Konstrukt, das durch<br />
objektive Parameter, wie beispielsweise Arbeitsaufgaben, Zeitbudget,<br />
Unterstützung, Prüfungsanzahl und deren subjektiven Interpretation,<br />
beeinflusst wird. Durch die Bewertung der objektiven <strong>Belastungen</strong> vor dem<br />
Hintergrund der Handlungsmöglichkeiten des Individuums ergibt sich die<br />
subjektive Belastung für das Individuum. Die so interpretierte Belastung<br />
26
mündet in Reaktionen, die RUDOW mit Beanspruchungsreaktionen<br />
beschreibt und „…kurzfristig auftretende, reversible psychophysische<br />
Phänomene“(Rudow 1994, S. 41) darstellen. Die Belastungsfolgen sollen in<br />
der vorliegenden Untersuchung nicht zum Gegenstand werden. Zum einen<br />
sind hierfür größer angelegte längsschnittliche Untersuchungen notwendig<br />
und zum Anderen konnte CHRIST in einer Studie mit Referendaren<br />
nachweisen, dass hier das gewählte Modell deutliche Defizite aufweist.<br />
Während die individuelle Belastung und das Wohlbefinden der Befragten in<br />
Übereinst<strong>im</strong>mung mit dem allgemeinen Stressmodell aus der subjektiven<br />
Bewertung der Situation durch die Referendare und die hierauf<br />
eingesetzten Bewältigungsverfahren erklärt werden konnten, konnte der<br />
Autor keinen Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und den<br />
längerfristigen Belastungsfolgen nachweisen. Daneben blieben auch die<br />
Ressourceneinschätzung und das gewählte Bewältigungsverhalten einer<br />
Person zeitlich konstant. (Christ 2004)<br />
In Hinsicht auf das hier aufgeworfene Untersuchungsanliegen wird ein<br />
transaktional orientierter Ansatz gewählt, auf den sich die weiteren<br />
Ausführungen stützen. Hinsichtlich der arbeitspsychologischen Perspektive<br />
erscheint vor allem das Job Characteristics Model nach HACKMAN und<br />
OLDHAM (1980, nach van Dick 2007, S. 19) von erheblicher Bedeutung.<br />
Dieses Modell umfasst die Tätigkeitsmerkmale, psychologische<br />
Erlebniszustände (Bedeutsamkeit der Arbeit und Verantwortlichkeit für die<br />
Arbeit, Kenntnis der Resultate) und Auswirkungen der Arbeit. Insbesondere<br />
die Tätigkeitsmerkmale sind von zentraler Bedeutung, da hier seitens der<br />
Umwelt Interventionsmöglichkeiten gesehen werden. Dabei werden die<br />
Tätigkeitsmerkmale charakterisiert durch die Vielfalt unterschiedlicher<br />
Anforderungen, die vom Individuum unterschiedliche Kompetenzen<br />
erfordern, die Ganzheitlichkeit der Aufgabe von der Planung bis <strong>zur</strong> Lösung<br />
und Evaluation sowie die Wichtigkeit der Aufgabe. Aus diesen<br />
Tätigkeitsmerkmalen ergibt sich die Wichtigkeit der Arbeit, die ausdrückt,<br />
welchen Stellenwert die jeweilige Arbeit <strong>im</strong> individuellen Wertesystem des<br />
Individuums einn<strong>im</strong>mt. Daneben kommen der erfahrenen Autonomie in den<br />
Arbeitshandlungen und den erhaltenen Rückmeldungen entsprechende<br />
Bedeutungen für die Tätigkeit zu.<br />
Als Auswirkungen der Arbeit werden diesem Modell nach vor allem<br />
intrinsische Motivationsvariablen angenommen, die aus der Arbeit<br />
resultieren und als Bedingungsvariable für folgende Arbeitsprozesse<br />
27
fungieren. Neben personenbezogenen Variablen spielen die Faktoren der<br />
spezifischen Zufriedenheit mit der konkreten Tätigkeit, der globalen<br />
Arbeitszufriedenheit und der Zufriedenheit mit den Möglichkeiten <strong>zur</strong><br />
Selbstverwirklichung eine wichtige Rolle bei der Arbeitsausgestaltung <strong>im</strong><br />
Sinne höherer Arbeitsmotivation.<br />
Methodisch liegt dem Modell das Vorgehen zugrunde, durch Fragebögen<br />
die subjektive Sicht der Individuen auf ihre Arbeit zu erfassen.<br />
28
Transaktional orientiertes Äquilibrationsmodell von Belastung<br />
Beruflich<br />
Objektive <strong>Belastungen</strong><br />
als Anforderungen aus<br />
der Umwelt<br />
Privat<br />
T<br />
R<br />
A<br />
N<br />
S<br />
A<br />
K<br />
T<br />
I<br />
O<br />
N<br />
Auf der Grundlage<br />
von:<br />
- persönlichen<br />
habituellen und<br />
situativen Motiven<br />
und Einstellungen<br />
- Bedürfnissen<br />
- Ressourcen,<br />
verstanden als<br />
Handlungs- und<br />
Bewältigungsvoraussetzungen<br />
und –möglichkeiten<br />
- situative und<br />
habituelle<br />
Persönlichkeitseigenschaften<br />
Individuum<br />
Kognitive Bewertungsprozesse<br />
Subjektive <strong>Belastungen</strong> und<br />
Selbstbelastungen als aufgrund<br />
verfestigter Verhaltensweisen selbst<br />
auferlegte <strong>Belastungen</strong>=<br />
Beanspruchungen<br />
Individuelles Belastungsempfinden<br />
als Gesamtheit aller<br />
Beanspruchungen und als Ergebnis<br />
der Anpassungsbemühungen des<br />
Individuums an die Umwelt =<br />
Stress<br />
I<br />
N<br />
T<br />
E<br />
R<br />
P<br />
R<br />
E<br />
T<br />
A<br />
T<br />
I<br />
O<br />
N<br />
R<br />
E<br />
A<br />
K<br />
T<br />
I<br />
O<br />
N<br />
Negativ-stressende<br />
Belastung aufgrund eines<br />
wahrgenommenen<br />
Ungleichgewichtes<br />
zwischen objektiver<br />
Belastung und<br />
individuellen<br />
Handlungsmöglichkeiten,<br />
Ressourcen ausgelastet<br />
oder überschritten,<br />
Gefühl: Bedrohung,<br />
Verlust, Schädigung<br />
Positive Belastung<br />
aufgrund eines<br />
wahrgenommenen<br />
Gleichgewichts<br />
(Äquilibration) zwischen<br />
objektiver Belastung und<br />
individuellen<br />
Handlungsmöglichkeiten;<br />
Ressourcen noch nicht<br />
ausgelastet,<br />
Gefühl des Gewinns oder<br />
der Herausforderung<br />
F<br />
O<br />
L<br />
G<br />
E<br />
N<br />
29
Unter Berücksichtigung der<br />
entwicklungspsychologischen Perspektive – <strong>Studien</strong>anfänger als junge<br />
Erwachsene in einer krisengefährdeten Transitionsphase ohne gefestigte<br />
Identität und mit unterschiedlichen personalen Ressourcen, Prädiktionen<br />
und Persönlichkeitseigenschaften –,<br />
der soziologisch-psychologisch Sichtweise – das Studium als Phase<br />
des Statusübergangs vom Schüler zum Studenten, der Neuorientierung in<br />
soziale Systeme und Institutionen sowie der Integration –,<br />
der pädagogischen Aspekte – Merkmale des selbstgesteuerten,<br />
selbstverantworteten Lernens in neuen Handlungszusammenhängen,<br />
veränderte Lehr-Lern-Formen, veränderte Leistungsbedingungen etc. –<br />
und<br />
organisationstheoretischer Aspekte der veränderten inhaltlichinstitutionellen<br />
Strukturen – neue Organisationsstrukturen, veränderte<br />
Rahmenbedingungen, unterschiedliche Ansprüche der studierten Fächer –<br />
muss hinsichtlich eines Konzeptes, das <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Anfangsstadium<br />
des Lehramtsstudiums erfassen soll, der oben dargestellte erhebliche<br />
Komplexitätsgrad des Modells gewählt werden. Einschränkend ist dabei die<br />
Kritik von GREIF zu berücksichtigen, die bereits am Rudow’schen Modell<br />
geäußert wurde. Das Modell insgesamt versucht sich zwar der Komplexität<br />
der Realität anzunähern, durch seinen transaktionalen Ansatz jedoch wird<br />
dieses Modell durch empirische Untersuchungen kaum erfass- und testbar.<br />
(Greif 1991, S. 10) Dennoch muss m.E. hier der Kompromiss zwischen<br />
Komplexität des Modells einerseits und empirischer Erfass- und Prüfbarkeit<br />
andererseits gefunden werden, um das Gesamtphänomen Belastung<br />
realitätsnah zu erfassen.<br />
Das gewählte Modell wird folgendermaßen verstanden:<br />
Aus der Umwelt ergeben sich an das Individuum Anforderungen. Da das<br />
Individuum selbst Teil seiner Umwelt ist, diese prägt und von ihr geprägt<br />
wird, ergeben sich zwischen beiden Komponenten Interaktionen. (Lewin<br />
1939) Die Umwelt selbst weist einen erheblichen Komplexitätsgrad auf,<br />
sodass zunächst eine grobe Bereichsdifferenzierung der Anforderungen in<br />
das private und das berufliche Umfeld vorgenommen wird. Gleichzeitig ist<br />
zu betonen, dass sich Untersuchungen zu den Umweltanforderungen<br />
<strong>im</strong>mer nur dem vorhandenen Komplexitätsgrad anzunähern versuchen<br />
können. Die Anforderungen, Bedingungen und Aufgaben, die sich aus der<br />
Umwelt an das Individuum stellen, sind zunächst als neutral aufzufassen.<br />
30
Sie gliedern sich in körperliche, geistige und soziale <strong>Belastungen</strong> auf.<br />
Durch die <strong>Belastungen</strong> wird das Individuum beansprucht. Diese<br />
Beanspruchung ergibt sich durch die subjektive Bewertung der als relevant<br />
wahrgenommenen Anforderungen vor dem Hintergrund intraindividueller<br />
Faktoren, Metakognitionen, situationsbezogener und damit aktueller<br />
Einflüsse und dem wahrgenommenen Repertoire an<br />
Handlungsvoraussetzungen und –möglichkeiten des Individuums. Dabei<br />
sind Interaktionsbeziehungen zwischen den Individuen ebenso Hintergrund<br />
der Bewertung von <strong>Belastungen</strong> wie beispielsweise materielle Ressourcen.<br />
Die Bewertung kann darüber hinaus auch von vorhandenen sozialen<br />
Strukturen abhängig sein. Insbesondere der kooperativen Arbeit, dem<br />
Lernen in sozialen Gruppen, scheint hier eine herausragende Bedeutung<br />
<strong>im</strong> Zusammenhang mit dem Belastungsempfinden zuzukommen. In dieser<br />
Hinsicht nehmen BUNGARD & WIENDIECK an: „Gruppen haben nicht nur<br />
Synergieeffekte <strong>im</strong> Sinne der Anregung und Ergänzung individueller<br />
Fähigkeiten, sondern sie können auch Unsicherheiten und <strong>Belastungen</strong><br />
reduzieren.“ (Bungard & Wiendieck 2001, S. 184)<br />
Vor dem Hintergrund der Handlungsressourcen, -möglichkeiten und –<br />
voraussetzungen werden die objektiven <strong>Belastungen</strong> der Umwelt<br />
interpretiert. Als Ergebnis dieser Interpretation entstehen subjektive<br />
Beanspruchungen, die wiederum zusammen mit den selbst auferlegten<br />
<strong>Belastungen</strong> das Belastungsempfinden der Person prägen. Durch Nutzung<br />
unterschiedlicher Bewertungs- und Bewältigungsstile ergibt sich die<br />
subjektive Beanspruchung des Individuums, auf die ebendieses reagieren<br />
muss. Es erfolgt das Bewältigungshandeln. Die Einschätzung der<br />
Belastung kann dabei in Abhängigkeit von den vorangegangenen<br />
Ereignissen, Prozessen, Anforderungen und Bewertungen als positiv,<br />
ambivalent oder negativ erfolgen.<br />
Eine anhaltende negative Bewertung der Belastung kann nach RUDOW zu<br />
psychischer Ermüdung, dauerhaftem Stress und gesundheitlichen<br />
Schädigungen führen. Auch Einschränkungen der Leistungsfähigkeit als<br />
kurzfristige Folge bis hin zu Syndromen des Burnout können Folgen einer<br />
dauerhaft negativen Belastung sein. (Rudow 1994, S. 40ff.)<br />
Gesundheitliche Schädigungen werden inzwischen allgemein als Folgen<br />
einer anhaltend als negativ bewerteten Belastung anerkannt. (Bauer 2007,<br />
S. 37) Zur Bewertung einer Situation als Bedrohung oder Gefahr führt<br />
BAUER aus: „Eine Bewertung als Gefahr ergibt sich dann, wenn die<br />
31
aktuelle Situation eine Erinnerung an eine frühere Situation wachruft, in der<br />
ungute Erfahrungen gemacht wurden. Als gefährlich werden Situationen<br />
eingeschätzt, die früheren Situationen gleichen, welche vom Betroffenen<br />
selbst oder von bedeutsamen Bezugspersonen nicht zu bewältigen waren<br />
oder bei denen der Betroffene keine Hilfe von anderen erhielt.“ (Bauer<br />
2007, S. 37) Damit kann die Bewertung einer Situation wesentlich durch<br />
Transparenz erzeugende Maßnahmen, die Erleichterung positiver<br />
Erfahrungen, durch Hilfe und Unterstützung und Modelllernen beeinflusst<br />
werden.<br />
Auf der Grundlage der Bewertung erfolgt dann die Handlung, die Reaktion<br />
des Individuums auf die subjektiv interpretierten Anforderungen. Der<br />
theoretische Hintergrund dieses Handelns wird in der<br />
Handlungsregulationstheorie gesehen. Hier stellt sich die Frage, wie die<br />
Individuen auf Anforderungen mit Handlungen reagieren, diese<br />
Handlungen regulieren und schließlich Handlungskompetenzen erwerben.<br />
Methodisch baut eine Untersuchung des Modells auf die in der<br />
Stressforschung gebräuchliche Form der multiplen Korrelationsanalyse<br />
(Regressionsanalyse) auf, bei der der Versuch unternommen wird,<br />
objektive Indikatoren der Belastung mit subjektiven Sichtweisen der<br />
Beanspruchung korrelationsstatistisch zu verknüpfen. Hierdurch werden die<br />
<strong>im</strong> Modell beschriebenen einzelnen Variablenkomplexe s<strong>im</strong>ultan als<br />
Varianz aufklärende Prädiktorvariablen für das individuelle<br />
Belastungsempfinden untersucht.<br />
3.4 Inbezugsetzung des Belastungsmodells zum Studium<br />
Als Vorbemerkung ist an dieser Stelle zu betonen, dass nicht alle der<br />
nachfolgend angeführten Aspekte Neuerungen infolge der Umsetzung der<br />
Beschlüsse des Bologna-Prozesses darstellen. Vielmehr wird eine Vielzahl<br />
von Bedingungen des bisherigen Studiums als Merkmale auch des<br />
modularisierten <strong>Studien</strong>ganges erhalten bleiben und wirkt somit auf die<br />
Studierenden ein.<br />
Zunächst sind die aus der Umwelt auf die Studierenden einwirkenden<br />
Bedingungen zu erfassen. Hierbei handelt es sich um<br />
Rahmenbedingungen, die zunächst nicht unmittelbar zu den<br />
Arbeitsaufgaben gehören. Dies sind die strukturellen Bedingungen der<br />
gewählten Universität, des Studiums, des <strong>Studien</strong>gangs und der studierten<br />
Fächer. In Anlehnung an Erkenntnisse der Organisationspsychologie wird<br />
32
die Umwelt <strong>im</strong> Organisat, dem Organisieren und der Organisiertheit der<br />
Institution betrachtet. Diese drei Aspekte stellen institutionelle<br />
Rahmenbedingungen dar, sind handlungsleitend, stellen Ressourcen <strong>zur</strong><br />
Verfügung (Lehrkapazität, Beratung, Betreuung), strukturieren das Studium<br />
(<strong>Studien</strong>gang, <strong>Studien</strong>ordnung, <strong>Studien</strong>struktur, Module) und sind<br />
Regelwerk für die Studierenden. Als Teil der Umwelt, wenngleich ein relativ<br />
abgrenzbarer und in sich gefügter Teil, interagiert die Institution Universität<br />
mit den Organisationsmitgliedern. Nach REIMANN sind dies<br />
Formalisierungsaspekte, die Zentralisation und die Spezialisierung.<br />
(Re<strong>im</strong>ann 1975). Der Ablauf des Studiums ist mit der Modularisierung stark<br />
formalisiert worden. Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten sind<br />
festgeschrieben und werden über Stundenpläne, Modulabfolgen,<br />
Sprechzeiten der Lehrenden, Leistungspunkte und Workloads etc. realisiert<br />
und über das Bestehen von Modulprüfungen kontrolliert. Die Zentralisation<br />
innerhalb der Universität wird geregelt durch das Verhältnis zwischen<br />
Lehrenden und Studierenden, durch Entscheidungsträger und –befugnisse<br />
und die verschiedenen Zuständigkeiten (Fachbereiche, <strong>Studien</strong>beratungen,<br />
Fakultäten) sowie die inneruniversitäre Hierarchie. Die Spezialisierung<br />
betrifft die Zerlegung des Studiums in Teilbereiche und Module als<br />
inhaltliche Zusammenfassung thematischer Schwerpunkte mit dem Ziel<br />
stärkerer Transparenz, also <strong>im</strong> weitesten Sinn die Aufteilung des Studiums<br />
in Teilbereiche. Hiervon sind neben belastenden Effekten aber auch<br />
Entlastungen zu erwarten, da so strukturelle Sicherheiten auf Seiten der<br />
Studierenden entstehen.<br />
Die Arbeitsaufgaben innerhalb der Lehrveranstaltungen definieren in ihrer<br />
Gesamtheit die zentralen Tätigkeiten des Studierens und damit auch die<br />
studentische Belastung oder Entlastung durch das Studium. Nach ULICH<br />
ermöglichen oder verhindern sie die Entwicklung der Persönlichkeit. (Ulich<br />
1998, S. 177) Eine Untersuchung zu <strong>studentischer</strong> Belastung muss<br />
deshalb arbeitspsychologische und organisationspsychologische Aspekte<br />
berücksichtigen und in ihrer Komplexität beachten, wenn studentische<br />
Belastung als ein Effekt <strong>studentischer</strong> Arbeit auf den Studierenden<br />
betrachtet wird.<br />
Daneben wirken direkte studienbezogene Belastungsfaktoren auf die<br />
Studierenden ein. Hierunter sind alle Aspekte der Tätigkeit der<br />
Studierenden zu summieren. Dies sind insbesondere die zeitlichen<br />
Belastungsfaktoren, ausgedrückt in Workloads und Leistungspunkten<br />
33
(Präsenzzeiten, Selbststudium und anderen studienbezogenen Aktivitäten),<br />
die Arbeitsaufträge, ausgedrückt in Formen und Anzahl der<br />
Leistungserbringungen und Prüfungen, die Koordination dieser Aktivitäten,<br />
und die Situation in den Lehrveranstaltungen. Diese <strong>Belastungen</strong> können<br />
sowohl durch relativ objektive Parameter (Summe der erbrachten<br />
Leistungspunkte, der Semesterwochenstunden, der Prüfungen, der<br />
Studierenden in einer Lehrveranstaltung etc.) als auch durch subjektive<br />
Einstellungen (Erreichen der Leistungsgrenze, Höhe der wahrgenommenen<br />
<strong>Belastungen</strong>) erfasst werden (Krause 2002, S. 22).<br />
Neben diesen studienbezogenen „objektiven“ <strong>Belastungen</strong> resultieren<br />
<strong>Belastungen</strong> aus den nichtstudienbezogenen Bedingungen. Hier sind<br />
familiäre Bedingungen wie die Bindung bzw. Loslösung an das bzw. vom<br />
Elternhaus und eine bestehende oder sich konstituierende Partnerschaft zu<br />
berücksichtigen.<br />
Um die Interpretation der objektiven <strong>Belastungen</strong> durch den Studierenden<br />
nachvollziehbar zu machen, sind intrapersonelle Faktoren zu erfassen.<br />
Hierzu werden gezählt: Persönlichkeitseigenschaften, Motive und<br />
Einstellungen, Erwartungen an das Studium, biografische und soziale<br />
Aspekte sowie vorhandene Ressourcen. Zu diesen sollen angesichts der<br />
besonderen entwicklungspsychologischen Situation der Studierenden vor<br />
allem die Unterstützung durch das Elternhaus, eventuell durch den Partner<br />
und durch das soziale Netz gezählt werden. Daneben wird angenommen,<br />
dass soziometrische Daten (Person, Alter, Geschlecht, Wohnort etc.) die<br />
Interpretation der objektiven Belastung zumindest partiell beeinflussen.<br />
Die subjektive Belastung der Studierenden ergibt sich aus der individuellen<br />
Beschreibung der Wahrnehmung und der Empfindung der Belastung. Dies<br />
soll an einem Beispiel verdeutlich werden. Aus einer Lehrveranstaltung in<br />
einem der studierten Fächer ergeben sich in der Regel zeitliche<br />
Anforderungen in Höhe von 2 Semesterwochenstunden Präsenzzeit, 2<br />
Stunden pro Semester Selbststudium und 1 Semesterwochenstunde für<br />
sonstige studienbezogen Aktivitäten. Die zeitliche Gesamtbelastung beträgt<br />
damit für diese Lehrveranstaltung 5 Semesterwochenstunden. In welchem<br />
Maße diese in Workloads ausgedrückt Zeit jedoch tatsächlich in das<br />
Studium investiert wird, inwiefern sie ausreicht, hängt von individuellen<br />
Parametern ab. Die Studierenden schätzen den Schwierigkeitsgrad der<br />
hiermit verbundenen Arbeitsaufgaben unterschiedlich ein, bewerten die<br />
Höhe der Anforderungen und des Komplexitätsgrades der Aufgaben<br />
34
unterschiedlich, besitzen verschiedenartige kognitive Voraussetzungen und<br />
weisen unterschiedliche Bewältigungsreaktionen auf. Dies führt dazu, dass<br />
die vorgegebenen Parameter mit unterschiedlichen individuellen<br />
Parametern umgesetzt werden und sich somit interindividuell verschiedene<br />
subjektive Belastungswahrnehmungen ergeben. Somit sollen diese<br />
individuellen, subjektiven Sichtweisen der studienbezogenen<br />
Einflussfaktoren als zentrale Bestandteile der Belastungsuntersuchung<br />
angesehen und erfasst werden.<br />
Schließlich sind die Folgen der subjektiven Belastungssituation der<br />
Studierenden zu berücksichtigen. Diese wiederum sind das Ausmaß des<br />
wahrgenommenen Stresses, Ängste und Sorgen, die <strong>Studien</strong>zufriedenheit,<br />
die Einstellung zum und die Bewertung des Studiums. Problematisierend<br />
ist hierzu anzumerken, dass insbesondere diese als Folgen der subjektiven<br />
<strong>Belastungen</strong> angenommenen Variablen auch als Moderatorvariablen des<br />
subjektiven Belastungsempfindens fungieren. Eine mit Ängsten und Sorgen<br />
vorbelastete Person wird eine objektive Belastung subjektiv anders<br />
interpretieren als ein Mensch, der sich der Belastung ohne Ängste und<br />
Sorgen stellt. Ängste und Sorgen können jedoch auch Folgen der<br />
Belastung sein. Somit ist hier ein Selektionsaspekt und ein<br />
Sozialisationsaspekt zu berücksichtigen (Jerusalem/Schwarzer 1989).<br />
Wenn davon ausgegangen wird, dass die Forschungsanliegen vor diesem<br />
Hintergrund zu untersuchen sind, müssen, auch unter Beachtung neuerer<br />
dialektisch-interaktionaler Ansätze (Fend 2000) sowohl als bedeutsam<br />
erachtete Persönlichkeitsmerkmale der Studierenden, bedeutsame<br />
Umweltvariablen <strong>im</strong> Sinne der Kontexterfassung als auch entsprechende<br />
Interaktionsvariablen Berücksichtigung finden. Dabei werden in diesem<br />
Sinne die Studierenden als Individuen mit Vorerfahrungen und<br />
Erwartungen an das Studium, mit unterschiedlichen persönlichen<br />
Ressourcen und individuellen Ansprüchen gesehen, die es vor dem<br />
Hintergrund des jeweiligen Interaktionseffektes zum Belastungserleben der<br />
Studierenden zu berücksichtigen gilt.<br />
In Anlehnung an die Belastungskategorien, die RUDOW (1994, S. 50) für<br />
den Lehrerberuf aufgestellt hat und diejenigen, die auf der Basis von 91<br />
Meta-Analysen und 270 ausgewerteten Artikeln von WANG et al (1993)<br />
ermittelt wurden, ergeben sich <strong>zur</strong> Untersuchung der Belastungssituation<br />
<strong>im</strong> Studium des Lehramtes folgende D<strong>im</strong>ensionen:<br />
35
1. <strong>Studien</strong>aufgaben, <strong>Studien</strong>organisation und <strong>Studien</strong>bedingungen<br />
- Arbeitsaufgaben<br />
- Arbeitszeit (Präsenzzeit, Selbststudiumszeit, Zeit für sonstige<br />
studienbezogene Tätigkeiten)<br />
- Studierte Fächer (z.B. Mathematik vs. Geschichte, Cheme vs.<br />
Geografie)<br />
- Art des <strong>Studien</strong>ganges (Gymnasium, Regelschule) aufgrund<br />
anderer Workloadzahlen<br />
- <strong>Studien</strong>plan, Stundenplan, Modulplan<br />
- Organisatorische Bedingungen der Lehre (Belegungssituation,<br />
Anzahl der Studierenden <strong>im</strong> Seminar, Wunschentsprechung der<br />
Lehrveranstaltungen, Ausstattung, inhaltliche Betreuung und<br />
Unterstützung)<br />
- Lehr- und Lernmittel, Materialien, Zugang zu Arbeitsmitteln<br />
- Prüfungen<br />
2. Umweltbedingungen<br />
- Räumliche Bedingungen<br />
- Spezifische Faktoren der studierten Fächer<br />
- Freizeit, Erholungszeit<br />
- Spezielle universitäre Bedingungen<br />
3. Soziale Bedingungen<br />
- Soziale Kontakte<br />
- Betreuung durch Kommilitonen und die universitären<br />
Unterstützungssysteme sowie Kontakte zu Lehrenden<br />
- Externe soziale Beziehungen (Freundeskreis, Familie)<br />
- Möglichkeiten <strong>zur</strong> Kommunikation und Kooperation<br />
- Tutorensystem<br />
4. Kulturelle Bedingungen<br />
- Universitätskultur und –kl<strong>im</strong>a<br />
- Gesellschaftliche Erwartungen innerinstitutionell und<br />
außerinstitutionell<br />
- Status und Image, Anerkennung als Studierender<br />
- Finanzielle Absicherung<br />
5. Personenbezogene Faktoren<br />
- Motive und Einstellungen<br />
- Persönliche Verhaltensmuster und –stile<br />
- Persönlichkeitsmerkmale<br />
36
4 Empirische Untersuchungen<br />
4.1 Untersuchungsdesign und Methoden<br />
4.1.1 Zielsetzung der Studie und Forschungsansatz<br />
Das Forschungsvorhaben wurde ausgehend von den zentralen<br />
Erkenntnisfragen und auf der Basis der Verortung der Problematik in den<br />
gegenwärtigen Forschungsstand in zwei Teilprojekte gegliedert: eine<br />
qualitative Tagebuchstudie <strong>zur</strong> Exploration des<br />
Untersuchungsgegenstandes und eine quantitative Studie. Das<br />
methodische Vorgehen entspricht somit einem Hypothesen generierenden<br />
und einem Hypothesen prüfenden Design und schließt an zentrale<br />
Theorien und Problematiken der Bildungsforschung an.<br />
Daneben sind die einzelnen D<strong>im</strong>ensionen an den Kategorien Institution<br />
(Universität), systembedingter Kontext und Individuum orientiert und<br />
postulieren auf hypothetischer Basis Wechselwirkungen zwischen den<br />
genannten D<strong>im</strong>ensionen und Einflüsse auf zentrale Fragen des<br />
Forschungsvorhabens.<br />
Methodologisch begreift sich die vorliegende Arbeit als<br />
Querschnittsuntersuchung 5 .<br />
Disziplinär stellt sich die vorliegende Studie in die Tradition der neueren<br />
empirischen Schulforschung, die durch E. TERHART geprägt wurde. Im<br />
forschungshistorischen Sinne ist die vorliegende Studie in die Tradition der<br />
Studentenforschung zu stellen, die die Situation von Studierenden zu<br />
einem spezifischen Zeitpunkt, hier dem <strong>Studien</strong>beginn, untersucht. (Huber<br />
1991)<br />
Ziel der vorliegenden Studie ist es, den neuen Ansatz der Lehrerbildung<br />
hinsichtlich seiner Umsetzung, seiner Wirkungen auf die Studierenden, der<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen und damit verbunden seiner Probleme und<br />
<strong>Belastungen</strong> zu untersuchen. Deshalb orientiert sich die Untersuchung,<br />
ausgehend von dem oben dargelegten Ansatz <strong>im</strong> theoretischen und<br />
praktischen Bereich an den konkreten Erwartungen und Bedürfnissen von<br />
Studierenden <strong>im</strong> ersten Semester des Lehramtsstudienganges und soll<br />
5 Vergleiche <strong>zur</strong> Begrifflichkeit: Blömeke, S.: Qualitativ-quantitativ, induktiv-deduktiv,<br />
Prozess-Produkt, national-international. Zur Notwendigkeit multikriterialer und<br />
multiperspektivischer Zugänge in der Lehrerbildungsforschung. In: Lüders, M. &<br />
Wissinger, J. (H): Kompetenzentwicklung und Programmevaluation – Forschung zu<br />
Lehrerbildung, S. 15ff.<br />
37
einen Überblick über den derzeitigen Stand an Belastungsfaktoren,<br />
Ressourcen, Umsetzungen und Strukturmerkmalen des Lehramtsstudiums<br />
geben. Der Fokus der Aufmerksamkeit soll dabei auf den<br />
Belastungswahrnehmungen und dem Belastungsempfinden der<br />
Studierenden liegen, die den neuen Lehramtsstudiengang beginnen.<br />
Letztlich ist es das Ziel, Varianzen innerhalb des Belastungsempfindens,<br />
die Prädiktoren für das Belastungsempfinden und damit studienbezogene<br />
<strong>Belastungen</strong> insgesamt zu untersuchen und aufzuzeigen, um hieraus<br />
Maßnahmen <strong>zur</strong> weiteren Ausgestaltung des universitären<br />
Lehreramtstudiums ableiten zu können.<br />
Deshalb werden die interessierenden Personen, <strong>im</strong> vorliegenden Fall die<br />
Studierenden <strong>im</strong> ersten Hochschulfachsemester des<br />
Lehramtsstudienganges, in ihrer Situation und ihrer Entwicklung <strong>im</strong> Kontext<br />
des Studiums betrachtet. Unter dem Kontextbegriff werden <strong>im</strong> weiteren<br />
Sinne alle universitäts- und studienbezogenen Momente sowie deren<br />
Interaktionsbedingungen zusammengefasst. Zusätzlich wird dieser<br />
Kontextbegriff um Elemente erweitert, die <strong>im</strong> privaten Kontext der<br />
Studierenden verortet sind. Daneben wird der Kontextbegriff aber auch in<br />
einem engeren Sinne dahin gehend verwendet, dass darunter Faktoren<br />
zusammengefasst werden, die sich auf das Lehramtsstudium <strong>im</strong> Rahmen<br />
des neuen Modells beziehen.<br />
5.1.2 Methodisches Vorgehen<br />
Um zunächst Problemfelder <strong>im</strong> Studium, allgemeine Verlaufsstrukturen,<br />
Alltagserfahrungen und –probleme, Lebensstrukturen und soziale<br />
Bezugssysteme, die für die vorliegende Untersuchungsthematik von<br />
Interesse sind, eruieren und in ihrer Bedeutung einschätzen zu können,<br />
wurden Methoden der qualitativen Sozialforschung mit entsprechenden<br />
Methoden der quantitativen Sozialforschung kombiniert.<br />
Nachfolgend wird die gewählte Methodik innerhalb des Forschungsdesigns<br />
dargelegt und begründet.<br />
38
5.1.2.1 Studie I<br />
5.1.2.1.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode: das<br />
Tagebuch-Verfahren<br />
Da zunächst die Exploration der Problemfelder <strong>im</strong> Vordergrund stand, also<br />
Situations- und Problemdeutungen, Handlungsmotive sowie <strong>im</strong>plizite<br />
Strategien und Denkweisen offenzulegen waren, wurde in der Tradition der<br />
theoretischen Ansätze der verstehenden Soziologie 6 die Methode des<br />
Tagebuches und damit ein individuell-kommunikativer Zugang gewählt. Die<br />
zu untersuchenden Gegenstände sollten vor dem Bedeutungshorizont des<br />
Befragten <strong>im</strong> Einzelfall beschrieben und interpretiert werden. 7 Gleichzeitig<br />
wird mit dieser Forschungsmethode davon ausgegangen, dass die<br />
Befragten Experten für ihre eigenen Bedeutungszusammenhänge sind und<br />
so ihre individuellen Problematiken in eigenen kommunikativen Aussagen<br />
darlegen. Daneben setzt die Forschung an einem konkreten und<br />
praxisrelevanten Problem an, dessen Teilaspekte, Variablen und<br />
Einflussfaktoren sich durch die Darlegung von<br />
Handlungszusammenhängen, subjektiven Wahrnehmungen und<br />
spezifischen Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realitäten <strong>im</strong><br />
konkreten kommunikativen Umfeld äußern. Die Befragten mussten deshalb<br />
dazu an<strong>im</strong>iert werden, ihre individuellen Denkweisen, Problemsichten und<br />
Wahrnehmungen mittels frei gewählter Formulierungen darzulegen.<br />
Gleichzeitig war anhand der so erhaltenen Äußerungen der Befragten der<br />
weitere Erkenntnisprozess zu strukturieren. Die Studierenden wurden<br />
deshalb gebeten, innerhalb eines Zeitraums von einer Woche in der<br />
Vorlesungszeit ein Tagebuch respektive ein Tagesprotokoll mit allen<br />
studienbezogenen und privaten Aktivitäten zu führen. Gleichzeitig sollten<br />
die Probanden angeben, in welchem Maße sie hierdurch entlastende oder<br />
belastende Effekte wahrnehmen. Durch ein solches spezifizierendes<br />
Vorgehen konnte eine entsprechend notwendige Problemzentrierung<br />
erreicht werden. Damit war grundlegend und wichtig an der gewählten<br />
Forschungsmethode ihr Potential, durch Kommunikation und Introspektion<br />
Handlungen und Motive der Befragten rekonstruieren und auf dieser Basis<br />
Probleme definieren und Hypothesen generieren zu können.<br />
6 Flick, U. u.a. (H): Handbuch der qualitativen Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte,<br />
Methoden und Anwendungen, Weinhe<strong>im</strong> 1995, S. 177f.<br />
7 Vergleiche hierzu: Witzel, A.: Verfahren qualitativer Sozialforschung – Überblick<br />
und Alternativen, Frankfurt/Main 1982.<br />
39
Anschließend wurden die Aussagen der Tagebücher nachträglich<br />
kategorial zusammengefasst, um die Vergleichbarkeit der Antworten zu<br />
unterstützen und zu ermöglichen, Beziehungen zwischen den einzelnen<br />
Aussagen herzustellen bzw. ihre qualitative Ausprägung und ihre<br />
quantitative Verteilung offen zu legen. Obwohl in der Literatur oftmals sehr<br />
unterschiedlich gebraucht 8 , soll in vorliegendem Zusammenhang von einer<br />
durch ein induktiv gebildetes Kategoriesystem geleiteten qualitativen<br />
Inhaltsanalyse der Tagesprotokolle gesprochen werden. Damit erfüllt diese<br />
Methode, wie für den vorliegenden Untersuchungsprozess erforderlich, die<br />
Anforderungen der Problemzentrierung, der Gegenstandsorientierung, der<br />
reflektierten Subjektivität und der Prozessorierentierung. 9<br />
5.1.2.1.2 Stichprobe und Durchführung der Studie<br />
Die Tagebuchstudie wurde vom Autor vom 2.-9. November 2007<br />
durchgeführt und umfasste insgesamt 10 Studierende des<br />
Lehramtsstudienganges, die <strong>im</strong> Oktober 2007 ihr Studium begannen. Die<br />
einzelnen Vordrucke für die Tagebuchführung wurden per Zufallsprinzip in<br />
einer Vorlesung nach Ansprache einzelner Studierender ausgegeben.<br />
5.1.2.1.3 Die Auswertung der Daten<br />
Die so erhobenen Daten wurden gesichtet und anschließend in ein aus den<br />
Tagebüchern erstelltes Kategoriesystem übertragen. Im Anschluss daran<br />
wurden die einzelnen Kategorien mittels des Verfahrens der qualitativen<br />
Inhaltsanalyse ausgewertet, um auf der Basis regelgeleiteter Textanalysen<br />
die kommunikativen Daten systematisch zu bearbeiten. Die Aussagen<br />
wurden demnach zunächst zu semantischen Einheiten generalisiert und<br />
unter einem best<strong>im</strong>mten Abstraktionsniveau vereinigt. Anschließend<br />
wurden diese Daten nach Sinneinheiten reduziert, gebündelt und neue<br />
Sinneinheiten wurden konstruiert, um die oben beschriebenen Probleme in<br />
ihrer qualitativen und quantitativen Ausprägung erkennen und<br />
entsprechende Hypothesen ableiten zu können. Die so gewonnenen<br />
Einsichten wurden in einem weiteren Schritt mit Mitgliedern des Zentrums<br />
für Lehrerbildung und Didaktikforschung der Friedrich-Schiller-Universität<br />
Jena besprochen und Interpretationsgedanken ausgetauscht, um so eine<br />
8 Vergleiche hierzu: Haft u.a. (H): Enzyklopädie der Erziehungswissenschaft, Bd. 2:<br />
Methoden der Erziehungs- und Bildungsforschung, Stuttgart und Dresden 1995, S.<br />
426ff.<br />
9 Vergleiche hierzu Mayring, Ph.: Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine<br />
40
Überprüfung der Interpretationslinien und eine erste kommunikative<br />
Validierung der Ergebnisse zu erhalten. Aus diesen Ergebnissen wiederum<br />
wurden Folgerungen, Problemkreise und Hypothesen abgeleitet, die nicht<br />
nur explorativ wirken sollten, sondern den gesamten nachfolgenden<br />
Forschungsprozess wesentlich strukturierten.<br />
5.1.2.2 Studie II<br />
5.1.2.2.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode<br />
Um die Hypothesen auf ihre Gültigkeit und Verallgemeinerbarkeit hin zu<br />
prüfen bzw. zu weiteren grundlegenden Aussagen zum<br />
Forschungsgegenstand zu gelangen, wurde das Verfahren der schriftlichen<br />
Befragung mittels Fragebogen gewählt. Dabei sollten zum Einen die <strong>im</strong><br />
Einzelfall erlangten Daten hinsichtlich ihrer Repräsentativität für die<br />
Lehramtsstudierenden an der Friedrich-Schiller-Universität Jena geprüft<br />
und zum Anderen allgemeine und spezifische Aussagen <strong>zur</strong> gegenwärtigen<br />
Situation der Studierenden erhoben werden. Qualitative Zugänge eignen<br />
sich für diese Zielsetzung nur eingeschränkt, sodass die Methode der<br />
schriftlichen Befragung mittels Fragebogens gewählt wurde.<br />
5.1.2.2.2 Das Forschungsinstrument<br />
Zunächst musste das Konstrukt „Belastung“ durch Indikatoren und<br />
Hinweisvariablen operationalisiert werden. Um den Grad der Wirkung<br />
dieser Operationalisierung zu ermitteln, wurde zunächst direkt nach dem<br />
Belastungsempfinden gefragt und dieses Belastungsempfinden dann durch<br />
konkrete Begleit- und Verhaltensaspekte dargestellt.<br />
Zur Operationalisierung sowohl personenbezogener als auch kontextueller<br />
Merkmale wird in der vorliegenden Untersuchung prinzipiell auf zwei<br />
Varianten <strong>zur</strong>ückgegriffen. In erster Linie werden quantifizierbare<br />
Parameter gesucht und erhoben. Hierzu zählen beispielsweise die Anzahl<br />
von absolvierten Semesterwochenstunden, die Anzahl der Prüfungen, aber<br />
auch der Zeitaufwand. In zweiter Linie werden quantifizierte subjektive<br />
Einschätzungen der Studierenden aggregiert auf Gruppenebene<br />
untersucht. Hierzu zählen beispielsweise die wahrgenommenen<br />
<strong>Belastungen</strong>, der Selektionsdruck oder auch die <strong>Studien</strong>zufriedenheit.<br />
Grundsätzlich werden, dem zentralen Forschungsinteresse geschuldet, die<br />
Anleitung zu qualitativem Denken, Weinhe<strong>im</strong> 1993.<br />
41
erhobenen Daten <strong>im</strong>mer vor dem Hintergrund ihrer belastenden oder<br />
entlastenden Wirkungen erhoben und dargestellt. Die Beurteilungen sind<br />
als individuelle Anschauungen vor dem Hintergrund persönlicher<br />
Lebensumstände und Interessen zu betrachten. (Fürstenberg 1999, S. 106)<br />
Die objektiven Indikatoren sollen dabei, wenn möglich, als Kriterium der<br />
Absicherung persönlicher Einschätzungen herangezogen werden.<br />
Auf der Basis der Ergebnisse der qualitativen Studie und unter Auswertung<br />
der <strong>zur</strong> Thematik vorliegenden Befunde wurde der Fragebogen entwickelt.<br />
Dabei wurde in Teilen auf bereits bestehende valide und erprobte Items,<br />
Itembatterien und Skalen <strong>zur</strong>ückgegriffen. Zu spezifischen<br />
Forschungsinteressen wurden eigene Fragen entwickelt und getestet.<br />
5.1.2.2.3 Fragebogenaufbau<br />
Der gesamte Fragebogen gliedert sich in neun Teile auf. Diese Teile<br />
nehmen sowohl Themenbereiche auf, die sich bereits in der traditionellen<br />
Lehrer-Berufsforschung als Belastungsindikatoren erwiesen haben (Böhm-<br />
Kasper et al. 2001), wie das vorherrschende Kl<strong>im</strong>a,<br />
Organisationsstrukturen, Zeit und <strong>Studien</strong>modell, als auch Fragen zu<br />
zentralen studien- und personenspezifischen Aspekten. In Bezug auf die<br />
Übertragungsmöglichkeiten berufsbezogener Lehrerforschung auf die<br />
Forschung innerhalb der Lehrerausbildung sei auf die Argumentation von<br />
GEHRMANN (2007, S. 87) verwiesen, der m.E. zu Recht die Forderung<br />
erhebt, Rückschlüsse aus dem Lehrerberuf für die Lehrerausbildung zu<br />
ziehen. Hinsichtlich der drei zentralen Teilaspekte sei <strong>im</strong> Zusammenhang<br />
mit dem Belastungsaspekt auf die <strong>Studien</strong> von RUDOW (1994),<br />
BAUER/KANDERS (1998), COMBE/BUCHEN (1996) und BACHMANN et<br />
al. (1999) verwiesen. In Hinsicht auf die Zufriedenheit kann die Arbeit von<br />
IPFLING (1995) als grundlegend angesehen werden. In Bezug auf die<br />
<strong>Studien</strong>zeitverwendung sei auf die Veröffentlichungen von<br />
LÜDERS/EISENACHER/PLESSMANN (2006) verwiesen.<br />
Im Hinblick auf erfolgreiches Handeln sieht WEINERT in persönlichen<br />
Überzeugungen und Werthaltungen bedeutsame Variablen, sodass das<br />
vorliegende Untersuchungsinstrument diese Variablen aus der Sicht des<br />
Autors aufnehmen muss, um dem Forschungsinteresse in seiner<br />
Komplexität zu genügen. Aus der Sicht der einschlägigen Forschung sind<br />
hiervon weitreichende Handlungsmotivationen und Orientierungen zu<br />
42
erwarten. 10 Insbesondere HOFER und PINTRICH haben hierzu <strong>im</strong><br />
Zusammenhang mit der Ausbildung von Lehrern und der Entwicklung<br />
professionellen Handelns grundlegende Einstellungsmuster und<br />
Überzeugungen generieren können. 11<br />
Innerhalb des ersten Teiles, bestehend aus 17 Items, werden Variablen<br />
erhoben, die neben soziometrischen Angaben (Alter, Geschlecht etc.) auch<br />
Rahmendaten der individuellen Bildungsbiografie, finanzieller und<br />
soziokultureller Rahmenbedingungen und persönlicher<br />
Lebensbedingungen erfassen. Die erkenntnistheoretische Implikation<br />
hierfür waren Hypothesen, dass einzelne dieser Faktoren <strong>im</strong><br />
Zusammenhang mit zentral interessierenden persönlichen<br />
Einstellungsmustern und vor allem mit der Belastungswahrnehmung <strong>im</strong><br />
Studium stehen.<br />
Der zweite Teil enthält das zentrale Anliegen des Fragebogens, die<br />
Aussagen <strong>zur</strong> persönlichen Belastung der Studierenden durch<br />
studienbedingte Faktoren. Die interne Skalenreliabilität und Aussagen <strong>zur</strong><br />
gebildeten Skala können innerhalb der Auswertung des Fragebogens<br />
nachgelesen werden. Inhaltlich wurden Aspekte der Gesamtbelastung, der<br />
<strong>Studien</strong>belastung, des individuellen Leistungsvermögens, der<br />
Belastungsgrenze, des Ausmaßes an verbleibender Freizeit, des<br />
Arbeitsaufwandes, der Stressbelastung, des Gesundheitszustandes und<br />
des Verhältnisses von privaten und studienbezogenen Lebensanteilen<br />
thematisiert. Insgesamt umfasst diese vom Autor entwickelte Skala 11<br />
Items.<br />
Die dritte D<strong>im</strong>ension eruiert Effekte, die das Studium als Ganzes betreffen.<br />
Hier werden in 19 Items sowohl objektive Daten des Studiums, wie Anzahl<br />
der Semesterwochenstunden, der zu erbringenden Leistungspunkte, der<br />
erfolgreichen Absolvierung der Zugangsvoraussetzungen oder die Zahl der<br />
zu absolvierenden Prüfungen <strong>im</strong> laufenden Semester, als auch subjektive<br />
Sichtweisen <strong>zur</strong> <strong>Studien</strong>wahl, <strong>zur</strong> <strong>Studien</strong>zufriedenheit und <strong>zur</strong> Sichtweise<br />
auf das Studium eruiert. Inn Anlehnung an OSER & OELKERS (2001)<br />
sowie BARGEL (1989) wurde davon ausgegangen, dass die Motive <strong>zur</strong><br />
<strong>Studien</strong>wahl das Studium hinsichtlich der Belastungsfrage erheblich<br />
beeinflussen. Unterschieden werden hier idealistische und praktisch-<br />
10 Vergleiche hierzu ausführlich Staub&Stern 2002.<br />
11 Hofer, B.K. & Pintrich, P.R. 2002 sowie Leuchter et al. 2006.<br />
43
materielle Motive. Die kognitive Bewertung des Studiums als Gewinn,<br />
Verlust, Herausforderung und Bedrohung folgt der Argumentation von<br />
LAZARUS & LAUNIER (1981).<br />
Letztlich steht hinter dieser D<strong>im</strong>ension die zentrale Frage, inwieweit sich<br />
<strong>Studien</strong>belastungen auf relativ objektive studien<strong>im</strong>manente Bedingungen<br />
und subjektive Einstellungen <strong>zur</strong>ückführen lassen bzw. das zentrale<br />
Forschungsinteresse, in welchem Maße die Studierenden die Vorgaben<br />
über ECTS-Punkte <strong>im</strong> ersten Semester umsetzen und welche<br />
Auswirkungen diese relativ hohe Punktzahl in Bezug auf das<br />
Belastungsempfinden der Studierenden aufweist.<br />
Die sich anschließende D<strong>im</strong>ension bezieht sich mit jeweils drei Items zum<br />
Einen auf die soziale Situation der Studierenden, da hier von<br />
verschiedenen Autoren Effekte für das Studium nachgewiesen wurden 12 ,<br />
und zum Anderen auf die Einschätzung der Studierenden, in welchem<br />
Maße sie mit ihrer Persönlichkeit zu dem von ihnen gewählten <strong>Studien</strong>gang<br />
und den beiden studierten Fächern passen. Da die Fachkombination<br />
getrennt erhoben wurde, können so eventuelle Verbindungen und<br />
Unterschiede aufgezeigt werden.<br />
Innerhalb der fünften D<strong>im</strong>ension wurden zentrale Fragen aufgeworfen, die<br />
in Form von Aussagen ausgewählte Detailaspekte des Studiums und als<br />
Prädiktorvariablen für relevant erachtete persönliche und studienbezogene<br />
Rahmenbedingungen thematisieren. Gleichzeitig wurde jedes dieser<br />
insgesamt 46 Items mit zwei weiteren Teilaspekten gekoppelt. Dies waren<br />
hinsichtlich der <strong>Studien</strong>erwartungen die Fragen, ob und in welchem Grad<br />
diese erfüllt wurden und in welchem Maße dieser Erfüllungsgrad als<br />
Belastung wahrgenommen wird. Hier soll in Anlehnung an BACHMANN et<br />
al. (1999) überprüft werden, welches <strong>Studien</strong>bild die Studierenden<br />
aufweisen, in welchem Maße die Erwartungen an ein universitäres<br />
Lehrerstudium erfüllt wurden und welche <strong>Belastungen</strong> die Studierenden<br />
hiervon wahrnehmen. In Bezug auf die Aspekte des <strong>Studien</strong>alltags soll<br />
hingegen erhoben werden, in welchem Maße die einzelnen Teilbereiche als<br />
Unterstützung und Gewinn oder aber als Belastung empfunden und<br />
wahrgenommen werden. Die einzelnen Itembatterien wurden mit geringen<br />
Modifizierungen aus der <strong>Erhebung</strong> von BACHMANN et al. (1999)<br />
verwendet und orientieren sich darüber hinaus an dem<br />
12 Vergleiche hierzu insbesondere die Ausführungen von Tinto 1982, Bachmann et al. 1999,<br />
Rauin & Meier 2007.<br />
44
<strong>Studien</strong>abbruchmodell von GOLD (1988). Da jedoch mehrere Autoren<br />
aufgrund eigener empirischer Arbeiten davon ausgehen, dass die<br />
Wahrnehmung fachspezifisch fokussiert wird und die Sozialisation der<br />
Lehramtsstudierenden durch die Fächer erfolgt 13 , wurde gegenüber den<br />
Itembatterien von BACHMANN et al. (1999) entsprechend den<br />
Erfordernissen des Lehramtsstudienganges eine Fokussierung<br />
vorgenommen. Inhaltlich blieb jedoch die Grundorientierung erhalten.<br />
Der folgende sechste Teil zielt darauf ab, die Betreuungssituation an der<br />
Universität in der Beurteilung der Studierenden zu erfassen. Wichtig war<br />
dabei herauszufinden, in welchem Maße die Betreuung gewünscht wird<br />
und wie sich das Verhältnis zwischen gewünschter Betreuung und<br />
tatsächlicher Betreuung gestaltet. Insgesamt umfasst diese D<strong>im</strong>ension 7<br />
Items.<br />
Im siebten Teil des Fragenbogens sollten Persönlichkeitseigenschaften der<br />
Studierenden thematisiert werden, die in den viel beachteten<br />
Belastungsstudien von Lehrern und Lehramtsanwärtern durch<br />
SCHAARSCHMIDT (Schaarschmidt & Fischer 2001, Schaarschmidt 2004,<br />
Schaarschmidt & Kieschke 2007) und nach dem Konzept von OSER (Oser<br />
2001) als relevant für eine erfolgreiche berufliche Praxis und <strong>zur</strong><br />
Bewältigung der „Lehrersituation“ beschrieben wurden. 14 Die Bedeutung<br />
von Persönlichkeitsmerkmalen für das Studium konnte darüber hinaus<br />
bereits von LIPOWSKY nachgewiesen werden. (Lipowsky 2003) Diese<br />
Skalen wurden unter der Hypothese, dass der Grad der Ausprägung<br />
best<strong>im</strong>mter Persönlichkeitsvariablen als personale Ressource fungiert, in<br />
den Fragebogen aufgenommen. Gleichzeitig wird davon ausgegangen,<br />
dass die Selbsteinschätzung der Studierenden über den Grad der<br />
Ausprägung best<strong>im</strong>mter Persönlichkeitsvariablen die gemachten<br />
Erfahrungen mit der eigenen Handlungsfähigkeit innerhalb<br />
studienbezogener Rahmenbedingungen wiedergeben. In dieser Hinsicht<br />
wird dem Argumentationsstrang von ABS (Abs 2007, S. 71) gefolgt, der<br />
derartige Einschätzungen als Indikator beruflichen Erfolges ansieht.<br />
Methodisch wurden die Itembatterien von SCHAARSCHMIDT mit<br />
Ergänzungen aus dem ersten Teil des Berufseignungsinventars „BEIL“<br />
(Rauin/Kohler/Becker 1994) <strong>zur</strong> <strong>Erhebung</strong> der entsprechenden Daten<br />
13 Vergleiche hierzu insbesondere: Herrmann, U.: Wie lernen Lehrer ihren Beruf? –<br />
empirische Befunde und praktische Vorschläge, Weinhe<strong>im</strong> & Basel 2002, S. 239.<br />
14 Vergleiche hierzu ausführlich: Schaarschmidt 2001.<br />
45
verwendet. Der Teil umfasst insgesamt 21 Items, die 7<br />
Persönlichkeitsvariablen abbilden sollen.<br />
Anschließend wurden <strong>im</strong> achten Teil des Fragebogens potenzielle Sorgen<br />
und Besorgnisse der Studierenden in Bezug auf ihr Studium thematisiert<br />
und innerhalb von 14 Items zu dem gewählten <strong>Studien</strong>gang<br />
Handlungsalternativen angeboten, um vergleichen zu können, in welchem<br />
Maße retrospektiv andere studienbezogene Entscheidungen getroffen<br />
werden würden. Abschließend wurden die Studierenden gebeten, sich<br />
innerhalb einer qualitativen, offenen Frage dazu zu äußern, wie sie mit der<br />
Zeit eines hypothetisch jede Woche vorhandenen 8. Tags umgehen<br />
würden. Diese Frage entspringt einer Anregung, die der Autor <strong>im</strong><br />
Zusammenhang mit der Durchführung der forschungsmethodischen<br />
Ausbildung für Doktoranden von den Teilnehmern erhielt. Der Hintergrund<br />
hierfür war die Überlegung, dass die Aktivitäten des 8. Tages diejenigen<br />
widerspiegeln würden, für die in der übrigen Wochenzeit kaum oder kein<br />
Raum sei. Die Auswertung dieser Frage erfolgt qualitativ.<br />
5.1.2.2.4 Stichprobe und Durchführung der Studie<br />
Die Gesamtstudie gliedert sich in zwei Teile, den Pretest und die<br />
eigentliche <strong>Erhebung</strong>. Der Pretest wurde am 19. November 2007<br />
durchgeführt. An ihm nahmen insgesamt 39 Studierende, dies entsprach<br />
ca. 10% aller Lehramtstudierender, die <strong>im</strong> Wintersemester 2007/08<br />
<strong>im</strong>matrikuliert wurden, teil. Im Rahmen dieses Pretests wurden die<br />
Anwesenden gebeten, die Fragebögen inhaltlich auszufüllen und ebenso<br />
schriftliche Kommentare zu den einzelnen Items und weitere Anregungen<br />
abzugeben.<br />
Nach der Analyse der ausgefüllten Fragebögen und unter Beachtung der<br />
zusätzlich erhobenen qualitativen Daten wurde der Fragebogen für die<br />
endgültige <strong>Erhebung</strong> erstellt und mit Mitarbeitern des Instituts für<br />
Erziehungswissenschaft und des Zentrums für Lehrerbildung und<br />
Didaktikforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena nochmals<br />
besprochen. So kommunikativ validiert, erfolgte die <strong>Erhebung</strong> am<br />
26.11.2007.<br />
Der Zeitpunkt wurde so gewählt, da die Studierenden zu diesem Zeitpunkt<br />
den universitären Ausbildungsgang in seinen Grundzügen kennen, aber<br />
auch Erinnerungen an eigene Erwartungen und Ansprüche an das Studium<br />
noch retrospektiv wiedergegeben werden konnten. Der <strong>Erhebung</strong>szeitpunkt<br />
46
lag damit in der Mitte des Semesters und erfasst die durchschnittlich<br />
anfallenden <strong>Belastungen</strong> der Studierenden ohne Beachtung der<br />
<strong>Belastungen</strong>, die auf die Leistungserbringung <strong>im</strong> Prüfungszeitraum fallen.<br />
Prinzipiell ist davon auszugehen, dass sich die Studierenden zum<br />
<strong>Erhebung</strong>szeitpunkt <strong>im</strong>mer noch in der Phase der Neuorientierung befinden<br />
und erst kurzzeitig durch die studien- und fachbezogenen Bedingungen<br />
beeinflusst wurden.<br />
Die Probanden waren die Teilnehmer an der Vorlesung „Einführung in die<br />
Schulpädagogik“, da hier davon auszugehen war, dass die meisten<br />
Teilnehmer Studierende <strong>im</strong> ersten Hochschulfachsemester sind, für die<br />
diese Veranstaltung ausgeschrieben war. Die Stichprobe umfasst hierdurch<br />
240 Befragte. Die Grundgesamtheit besteht aus den Studierenden des<br />
Lehramtsstudienganges <strong>im</strong> ersten Semester, der 408 Studierenden<br />
umfasst. Die so erfassten Probanden sind in Anlehnung an die<br />
Ausführungen von ZIMMER als relativ feste Gruppe anzusehen, die „…in<br />
kulturellen Zusammenhängen voneinander und miteinander lernen…“<br />
Dadurch „…konstituieren sie zugleich eine mehr oder weniger feste Gruppe<br />
oder Organisation.“ (Z<strong>im</strong>mer 2000, S. 123)<br />
Die <strong>Erhebung</strong> wurde am 17.11.2008 wiederholt, um die 2007 erhobenen<br />
Befunde anhand einer Kontrollkohorte zu überprüfen. Hierbei sollten<br />
Abweichungen und Übereinst<strong>im</strong>mungen mit der ersten Kohorte überprüft,<br />
Befunde repliziert und statistische Modelle konfirmiert werden.<br />
Um eine entsprechenden Anonymität und ehrliches Antworten zu<br />
ermöglichen, wurde den Studierenden in beiden Untersuchungen in einem<br />
Anschreiben der Grund der <strong>Erhebung</strong> und ihr Ziel dargelegt sowie die<br />
Anonymität der Daten zugesichert.<br />
47
5.1.2.2.5 Auswertung der Daten<br />
Nach der Datenerhebung wurden die Daten codiert und als Datensatz in<br />
eine entsprechende Datei des Statistikprogramms SPSS Version 15<br />
eingegeben. Die weiteren Auswertungsschritte erfolgten nach der<br />
Datenüberprüfung unter Verwendung der einschlägigen statistischen<br />
Verfahren der deskriptiven und schließenden Statistik 15 .<br />
Generell wird in den nachfolgenden Ausführungen dann von signifikanten<br />
Ergebnissen gesprochen, wenn das Signifikanzniveau (p) gleich oder<br />
kleiner dem Wert von 0,05 und von hoch signifikant, wenn sich die<br />
Irrtumswahrscheinlichkeit auf kleiner oder gleich 1% beläuft. Die<br />
verwendeten 5-stufigen Ratingskalen werden in diesem Zusammenhang<br />
als Likert-Skalen betrachtet.<br />
Die Exploration des Datensatzes erfolgt mittels rotierter<br />
Hauptkomponentenanalysen. Dabei gilt bei explorativem Vorgehen die<br />
Identifikation von Faktoren bis <strong>zur</strong> Ebene der Unterschreitung des<br />
Kaiserkriteriums. Hinsichtlich der empirischen Untermauerungen<br />
theoretischer Annahmen wurden Anzahlen für die Faktoren festgelegt. Die<br />
Ergebnisse wurden dann bei max<strong>im</strong>aler Reduktion der Faktoren und<br />
höchstmöglicher Information auf ihre inhaltlich-logische Plausibilität<br />
überprüft. Hohe Faktorladungen werden dabei als entscheidende<br />
Indikatoren für Korrelationen zwischen den Items und den D<strong>im</strong>ensionen<br />
betrachtet. Die einzelnen eindeutigen Ladungen entschieden über den<br />
Verbleib des Items.<br />
Wenn <strong>im</strong> Forschungsinteresse Skalen aus Items gebildet wurden, folgte<br />
diese Skalenbildung grundsätzlich folgenden Vorgehen: Die Items wurden<br />
formuliert und auf Itemschwierigkeit und Trennschärfe untersucht. Die<br />
D<strong>im</strong>ensionsbildung erfolgte durch das oben beschriebene Verfahren der<br />
rotierten Hauptkomponentenanalyse. Im Anschluss erfolgte eine inhaltlich<br />
begründete Skalenbildung, die statistisch durch das Verfahren der<br />
Reliabilitätsanalyse abgesichert wurden. Aufgrund der Skalenstatistik<br />
wurden Items aus der Skala entfernt, wenn durch ihre Entfernung eine<br />
deutliche Steigerung des Cronbachs Alpha erzielt werden konnte. Die<br />
Reliabilitätswerte der einzelnen Skalen sind innerhalb der Auswertung<br />
15 Die statistischen Verfahren orientieren sich <strong>im</strong> Wesentlichen an den<br />
Auswertungsschritten und Methoden aus: Wirtz, M. und Nachtigall, Chr.:<br />
Deskriptive Statistik, Weinhe<strong>im</strong> und München 1998. und Bortz, J.: Statistik für<br />
Sozialwissenschaftler, Berlin 1993. sowie Backhaus, K. et al.: Multivariate<br />
Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung, Berlin 1994.<br />
48
angegeben. Der vollständige Fragebogen befindet sich <strong>im</strong> Anhang dieser<br />
Arbeit.<br />
Auf der Datenbasis wird ein multiples Regressionsmodell <strong>zur</strong><br />
Belastungswahrnehmung erarbeitet. Das aus der Skala „Belastung“<br />
gebildete Datum wird als abhängige Variable in das Modell aufgenommen.<br />
Die Vorgehensweise erfolgt „Schritt-für-Schritt vorwärts“, wobei die<br />
Regressionsgleichung jeweils um die als unabhängig angenommene<br />
Variable erweitert wird, die den größten Teil an Varianz aufklärt. Das<br />
Modell wird abgeschlossen, wenn alle nicht aufgenommenen Variablen<br />
keinen signifikanten Erklärungsbeitrag <strong>zur</strong> Gesamtvarianz mehr leisten.<br />
5.2 Ausgangsfragestellungen<br />
Ausgehend von der zentralen Fragestellung, in welchem Maße Studierende<br />
des Lehramtes durch ihr Studium belastet sind, wurden folgende Fragen<br />
aus den theoretischen Vorannahmen, bisherigen Befunden und den<br />
Ergebnissen der Analyse der Tagebücher der Studierenden abgeleitet:<br />
In welchem Maß fühlen sich die Studierenden insgesamt, durch das<br />
Studium und durch Privates belastet?<br />
Erreicht die empfundene Belastung Ausmaße, die auf Überbelastungen<br />
durch das Studium hinweisen?<br />
Wie schätzen Studierende diese <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Verhältnis zu ihren<br />
eigenen Handlungskompetenzen ein?<br />
Welche objektiven und subjektiven <strong>Belastungen</strong> nehmen die Studierenden<br />
innerhalb des universitären Kontextes wahr?<br />
Wodurch können unterschiedliche Belastungswahrnehmungen, die auf<br />
ähnlichen objektiven <strong>Belastungen</strong> in vergleichbaren Kontexten beruhen,<br />
erklärt werden?<br />
Gibt es <strong>im</strong> Belastungsempfinden Varianzen, die sich aus den jeweils<br />
studierten Fächern heraus ergeben?<br />
Wie setzt sich das in das Studium investierte Ausmaß an Zeit zusammen<br />
und wie wirken sich Zeitinvestitionen auf das Belastungsempfinden aus?<br />
Welche Anteile umfasst die <strong>Studien</strong>zeitinvestition in Bezug auf<br />
Präsenzzeiten, Selbststudium, Vorbereitung und sonstige studienbezogene<br />
Aktivitäten?<br />
Werden die Zeitvorgaben der modularisierten <strong>Studien</strong>gänge, ausgedrückt<br />
in Workloads, für die ECTS-Punkte <strong>im</strong> Studium tatsächlich umgesetzt?<br />
49
Bilden demzufolge die Anzahl von zu erwerbenden Leistungspunkten und<br />
die <strong>Studien</strong>zeitinvestition einen Zusammenhang?<br />
Führen ECTS-Vorgaben per se <strong>zur</strong> Vereinheitlichung des zeitlichen<br />
Studierverhaltens? 16 Determiniert die zeitliche Belastung das<br />
Gesamtbelastungsempfinden der Studierenden und wenn ja, in welcher<br />
Weise?<br />
Werden die <strong>im</strong> Lehramtsstudiengang studierten Fächer in gleicher<br />
Intensität studiert?<br />
Werden die einzelnen Fächer unterschiedlich gewichtet? Wenn ja, wie?<br />
Gehen hohe zeitliche <strong>Belastungen</strong> in einem <strong>Studien</strong>fach einher mit ähnlich<br />
hohen oder geringeren <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> anderen Fach?<br />
Betreuungssituation<br />
Welchen Umfang hat das soziale Netz <strong>im</strong> Studium?<br />
Welche Bedeutung kommt dem sozialen Netz <strong>im</strong> Zusammenhang mit dem<br />
Belastungsempfinden zu?<br />
Wie werden soziale Betreuungsaspekte seitens der Universität für die<br />
Studierenden eingeschätzt?<br />
Persönlichkeitsvariablen<br />
Wie beurteilen sich Studierende hinsichtlich der von SCHAARSCHMIDT als<br />
zentral für den Lehrerberuf eingeschätzten persönlichen Eigenschaften und<br />
Fähigkeiten?<br />
Wie wirken sich diese personalen Eigenschaften auf das<br />
Belastungsempfinden aus?<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen<br />
Wie werden die <strong>Studien</strong>bedingungen in den studierten Fächern, in<br />
Erziehungswissenschaft und die allgemeinen Rahmenbedingungen des<br />
Studiums eingeschätzt?<br />
Welche Bedeutung nehmen diese Bedingungen innerhalb des<br />
Belastungsempfindens der Studierenden ein?<br />
Wie zufrieden sind die Studierenden mit ihrem derzeitigen Studium und<br />
welche Aspekte bedingen das Ausmaß an <strong>Studien</strong>zufriedenheit?<br />
16 Eine Frage, die auch Lüders 2007 bereits stellte, jedoch nur in thesenhafter Form<br />
beantworten konnte.<br />
50
Hat die Zufriedenheit mit dem Studium Auswirkungen auf den Grad der<br />
Belastung durch das Studium?<br />
<strong>Studien</strong>wahlmotivik<br />
Nach welchen Motiven entscheiden sich Studierende für ein<br />
Lehramtsstudium?<br />
Hat die unterschiedliche Motivik der Studierenden einen Einfluss auf das<br />
Belastungsempfinden der Studierenden?<br />
<strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Welche Vorannahmen über Erwartungen an das Studium haben die<br />
Studierenden und in welchem Maße können diese Erwartungen als erfüllt<br />
angesehen werden?<br />
Wirkt sich der Grad der Übereinst<strong>im</strong>mung zwischen den Erwartungen und<br />
der <strong>Studien</strong>realität auf das Belastungsempfinden aus?<br />
Welchen Einfluss übt der Grad der Passung zwischen Individuum und<br />
Studium auf das Maß wahrgenommener Belastung aus?<br />
Abhängigkeiten des Belastungsempfindens<br />
Hat das Belastungsausmaß Effekte auf das gesundheitliche Wohlbefinden<br />
der Studierenden?<br />
Können Ressourcen identifiziert werden, die <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium<br />
mildern und wenn ja, welche sind das?<br />
Wie kann die Belastung von Studierenden durch strukturelle<br />
Veränderungen verringert werden?<br />
Wirken best<strong>im</strong>mte soziometrische Merkmale als Kovariate auf das Ausmaß<br />
des Belastungsempfindens ein?<br />
5.3 Hypothesen<br />
Auf der Grundlage der theoretischen Vorbetrachtungen und der qualitativen<br />
Studie wurden folgende Hypothesen zum Forschungsgegenstand<br />
generiert. Geprüft wird generell das Zutreffen der Nullhypothese.<br />
5.3.1 Zur Gesamtbelastung<br />
Die Studierenden sind durchschnittlich belastete Menschen.<br />
Die Beanspruchung der Studierenden resultiert hauptsächlich aus den<br />
<strong>Belastungen</strong> durch das Studium.<br />
51
Der private Bereich besitzt bezüglich der Belastung der Studierenden keine<br />
herausragende Bedeutung.<br />
Eine Überlastung der Studierenden findet nicht statt.<br />
Die Gesamtbelastung bleibt unterhalb der Grenze, bei deren Erreichen<br />
kurzfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen eintreten können.<br />
Die Studierenden beurteilen gleiche oder ähnliche objektive Anforderungen<br />
in gleichen oder ähnlichen Kontexten nicht unterschiedlich.<br />
Es besteht kein Zusammenhang derart, dass je effektiver und höher die<br />
eigenen Handlungsressourcen von den Studierenden eingeschätzt werden,<br />
desto geringer die Einschätzung der Gesamtbelastung wird.<br />
5.3.2 Zum Lehramtsstudium<br />
Das Studium des Lehramts erfolgt pr<strong>im</strong>är aus Interesse an dem Beruf und<br />
an den studierten Fächern.<br />
Eine als un<strong>zur</strong>eichend wahrgenommene Passung zwischen Person und<br />
Studium, führt nicht zu einer Steigerung des Belastungsempfindens.<br />
Vom Studium selbst werden vor allem hohe inhaltlich-fachwissenschaftliche<br />
Effekte erwartet.<br />
Die Erwartungen an direkte Lehrinhalte werden in hohem Maße erfüllt.<br />
Die Erwartungen hinsichtlich der universitären Rahmenbedingungen, der<br />
Praxisbezogenheit des Studiums und der Betreuung weisen dem<br />
gegenüber keine Unterschiede auf.<br />
Die Anforderungen seitens des universitären Studiums sind hinsichtlich der<br />
Gesamtbelastung relevant.<br />
Hierbei wirken die studierten Fächer und das Studium der<br />
Erziehungswissenschaft als belastende Faktoren.<br />
Die Transparenz der Leistungsanforderungen und –bedingungen bildet<br />
keinen Zusammenhang zum Belastungsempfinden.<br />
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Transparenz der<br />
Anforderungen und der Belastung.<br />
Die einzelnen studierten Fächer führen nicht durch unterschiedliche<br />
Anforderungen und Fachkulturen zu unterschiedlich starken <strong>Belastungen</strong><br />
der Studierenden.<br />
Beide studierte Fächer werden in gleicher Intensität studiert.<br />
Es erfolgt innerhalb der studierten Fächer keine Schwerpunktsetzung durch<br />
die Studierenden.<br />
52
Die allgemeinen Rahmenbedingungen des Studiums stehen in keinem<br />
direkten Zusammenhang zum Belastungsempfinden.<br />
Die <strong>Studien</strong>zufriedenheit bildet keinen Zusammenhang <strong>zur</strong> Zufriedenheit in<br />
den studierten Fächern.<br />
Die Zufriedenheit mit dem Studium bildet keinen Zusammenhang mit der<br />
Belastung derart.<br />
5.3.3 Zur <strong>Studien</strong>zeit<br />
Der in das Studium investierte Zeitaufwand ist interindividuell<br />
unterschiedlich.<br />
Die Zeitvorgaben, die mit ECTS-Punkten und Workloads ausgedrückt<br />
werden, führen nicht zu einer Vereinheitlichung des zeitlichen<br />
Studierverhaltens.<br />
Unterschiedliche Anzahlen zu erwerbender ECTS-Punkte bilden keinen<br />
Zusammenhang zu den Zeitinvestitionen <strong>im</strong> Studium.<br />
Sie können die Belastung der Studierenden damit nicht erklären.<br />
Der zeitliche Gesamtaufwand für das Studium gliedert sich in<br />
Präsenzzeiten, Selbststudium und andere studienbezogene Tätigkeiten.<br />
Diese umfassen ähnliche Anteile am Gesamtaufwand.<br />
Die in das Studium investierte Zeit steht nicht mit der Belastung der<br />
Studierenden <strong>im</strong> Zusammenhang.<br />
Freizeit und Belastung bilden keinen Zusammenhang.<br />
Die zeitlichen <strong>Belastungen</strong> stellen keinen Prädiktor für das<br />
Belastungsempfinden der Studierenden dar.<br />
Die Fächer werden trotz relativ einheitlicher Vorgaben zeitlich nicht<br />
einheitlich studiert.<br />
Die zeitliche Belastung in Erziehungswissenschaft bildet keinen<br />
Zusammenhang zum Belastungsempfinden der Studierenden.<br />
5.3.4 Zum sozialen Netz und <strong>zur</strong> Unterstützungssituation<br />
Die familiären Bindungen und Ressourcen stehen in keinem<br />
Zusammenhang <strong>zur</strong> Belastung der Studierenden.<br />
Dem sozialen Netz der Studierenden innerhalb der Universität kommt keine<br />
Bedeutung hinsichtlich der Belastung zu.<br />
Die Belastung ist unabhängig von der Größe des sozialen Netzes.<br />
53
Die erfahrene Unterstützung der Studierenden seitens der Universität steht<br />
in keinem Zusammenhang <strong>zur</strong> Belastung.<br />
Der Fachstudienberatung kommt keine besondere Bedeutung hinsichtlich<br />
der Belastung der Studierenden zu.<br />
Die Zufriedenheit mit der universitären Betreuung steht in keinem<br />
Zusammenhang mit der Belastung.<br />
5.3.4 Zu den Persönlichkeitsvariablen<br />
Die Befragten gehören <strong>zur</strong> Grundgesamtheit aller Lehramtsstudierenden.<br />
Die durchschnittlichen Ausprägungen der einzelnen<br />
Persönlichkeitsvariablen entsprechen damit den Ausprägungen aus der<br />
<strong>Erhebung</strong> von SCHAARSCHMIDT et al.<br />
Persönlichkeitsvariable sind Handlungsressourcen und in dieser Hinsicht<br />
stehen sie in keinem Zusammenhang <strong>zur</strong> Belastung der Studierenden.<br />
5.3.5 Zu den Ressourcen<br />
Kompetenzen zum rationellen Arbeiten, <strong>zur</strong> Stressbewältigung und zum<br />
Organisieren der Arbeit sind wesentliche intraindividuelle Ressourcen der<br />
Studierenden.<br />
Die Höhe der Ausprägungen dieser Ressourcen steht in keinem<br />
Zusammenhang <strong>zur</strong> Belastung.<br />
Im Übergang zum Studium bilden die Eltern keine materielle und ideelle<br />
Ressource.<br />
Das soziale Netz der Studierenden bildet hinsichtlich des formellen und<br />
informellen Studierens keine wichtige Ressource.<br />
Unterstützungsangebote seitens der Universität werden nicht als<br />
Ressourcen für die Studierenden angesehen.<br />
54
II Empirischer Teil<br />
A Studie <strong>im</strong> WS 2007/08<br />
1 Soziometrische Daten<br />
1.1 Geschlecht<br />
Insgesamt wurden 240 Studierende des Lehramtsstudiengangs mit<br />
unterschiedlicher Fächerkombination befragt. Davon waren 67,5 % weiblich<br />
und 37,5 % männlich.<br />
Übersicht über Geschlechtsverteilung (Chi²=14,02, df=1, P
Zusammenfassende Übersicht über die Altersstruktur der Befragten<br />
N Min<strong>im</strong>um Max<strong>im</strong>um Mittelwert<br />
Standardabweichung<br />
in vollen Jahren 239 18,00 29,00 19,9038 1,77611<br />
Gültige Werte<br />
(Listenweise) 239<br />
Detailübersicht über die Altersstruktur der Befragten (Chi²=348,326, df=10, p
1.5 Wartesemester<br />
Ergänzt wird dieser Wert durch die Anzahl der Wartesemester, die wegen<br />
Zulassungsbeschränkungen absolviert werden mussten. Hier beträgt der<br />
Mittelwert 0,42 mit einer Standardabweichung von 0,96.<br />
Anzahl der Semester, die bis <strong>zur</strong> Aufnahme des Studiums gewartet werden musste<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
0 193 47,2 145,8<br />
1 1 47,2 -46,2<br />
2 34 47,2 -13,2<br />
3 1 47,2 -46,2<br />
4 7 47,2 -40,2<br />
Gesamt 236<br />
Die ermittelten Werte weichen signifikant von der Gleichverteilung ab. (Chi-<br />
Quadrat=578,746, df=4, p
Übersicht zu der Häufigkeit, mit denen die einzelnen Fächer studiert werden:<br />
Fach<br />
1. Fach 2. Fach<br />
Deutsch 28 11<br />
Mathematik 52 25<br />
Physik 2 9<br />
Chemie 9 24<br />
Biologie 17 9<br />
Geschichte 24 14<br />
Sozialkunde 10 24<br />
Wirtschaft und<br />
Recht 7 26<br />
Geografie 19 18<br />
Philosophie 9 22<br />
Religion 0 4<br />
Kunst 2 0<br />
Musik 4 0<br />
Informatik 0 8<br />
Englisch 15 13<br />
Französisch 10 10<br />
Latein 9 13<br />
Russisch 4 4<br />
Sport 20 2<br />
N<br />
74,1 % der Studierenden geben an, dass die studierten Fächer ihren<br />
ursprünglichen <strong>Studien</strong>plänen entsprechen.<br />
Beobachtetes<br />
N Erwartete Anzahl Residuum<br />
ja 177 119,5 57,5<br />
nein 62 119,5 -57,5<br />
Gesamt 239<br />
Die ermittelten Werte weichen signifikant von einer Gleichverteilung ab<br />
(Chi²=55,34, df=1, p
Die Hälfte aller Studierenden muss einen Fahrtweg zwischen der<br />
Universität und dem Lebensmittelpunkt während des Studiums von 5<br />
Kilometern und weniger absolvieren (Median 5).<br />
1.8 Erwerbstätigkeit<br />
Von den Befragten haben 20,4 % neben dem Studium ein<br />
Beschäftigungsverhältnis. Diese Anzahl weicht signifikant von einer<br />
Gleichverteilung ab. Der Anteil an neben dem Studium Erwerbstätigen ist<br />
unter Zugrundelegung der deutlichen Unterbesetzung der zust<strong>im</strong>menden<br />
Aussage zum Item damit vergleichsweise gering.<br />
Übersicht über erwerbstätige Studierende (Chi²=84,02, df=1, p
Höchster Bildungsabschluss des Vaters<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
kein Abschluss 4 1,7 1,7 1,7<br />
Mittlerer Abschluss<br />
(HS/RS/POS)<br />
117 48,5 49,2 50,8<br />
Abitur/EOS 35 14,5 14,7 65,5<br />
Hochschule 82 34,0 34,5 100,0<br />
Gesamt 238 98,8 100,0<br />
Damit wird deutlich, dass der Bildungsabschluss der Eltern in der Mehrzahl<br />
der Fälle einem höheren Abschluss entspricht. In 159 Fällen hat<br />
mindestens 1 Elternteil Abitur, in 82 Fällen entstammen die Studierenden<br />
Haushalten, in denen beide Elternteile die Hochschulreife besitzen. In 114<br />
Fällen hat mindestens ein Elternteil ein abgeschlossenes<br />
Hochschulstudium und in 57 Fällen weisen beide Elternteile ein<br />
abgeschlossenes Hochschulstudium auf.<br />
1.10 Einkommensverhältnisse<br />
In der Mehrzahl der Fälle (Median 2) liegt das monatliche Einkommen unter<br />
500 Euro. Dabei gliedern sich die Einkommensangaben wie folgt auf:<br />
Übersicht zum monatlichen Einkommen<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
bis 400 117 34,1 82,9<br />
bis 500 65 34,1 30,9<br />
bis 600 31 34,1 -3,1<br />
bis 700 18 34,1 -16,1<br />
bis 800 5 34,1 -29,1<br />
bis 900 2 34,1 -32,1<br />
mehr als 900 1 34,1 -33,1<br />
Gesamt 239<br />
Die Verteilung weicht (Chi-Quadrat=324,192, df=6, p=0,01) von einer<br />
Gleichverteilung ab. Insbesondere sind die Zellen, die ein geringes<br />
Einkommen abbilden, deutlich überfrequentiert. In einem weiteren Item<br />
wurden die Studierenden gebeten, ihre gegenwärtige finanzielle Situation<br />
einzuschätzen. Der Aussage: „Ich habe genügend Geld für meinen<br />
Lebensunterhalt“ st<strong>im</strong>men 61,4% der Befragten in vollem Maße (19,5%)<br />
und überwiegend (41,9%) zu.<br />
60
Ich habe genügend Geld für meinen Lebensunterhalt<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 18 59,0 -41,0<br />
trifft eher nicht zu 73 59,0 14,0<br />
trifft eher zu 99 59,0 40,0<br />
trifft voll zu 46 59,0 -13,0<br />
Gesamt 236<br />
Erkennbar sind hier die deutliche Unterfrequentierung der nicht<br />
zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorie sowie eine Überbesetzung der eher<br />
zust<strong>im</strong>menden Auswahlantwort. Die Antwortverteilung weicht signifikant<br />
von einer Gleichverteilung ab. (Chi-Quadrat = 61,797, df=3, P
Meine finanzielle Situation erlebe ich als Belastung.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 68 57,8 10,3<br />
trifft eher nicht zu 72 57,8 14,3<br />
trifft eher zu 58 57,8 ,3<br />
trifft voll zu 33 57,8 -24,8<br />
Gesamt 231<br />
Die voll zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie ist hierbei deutlich unterbesetzt,<br />
während die eher und voll ablehnenden Auswahlantworten überfrequentiert<br />
sind. (Chi-Quadrat=15,944, df=3, p=0,01)<br />
Dabei kann insbesondere in diesem finanziellen Aspekt ein bedeutender<br />
Belastungs- oder Unterstützungsfaktor gesehen werden. Eine als<br />
ungenügend empfundene finanzielle Situation wird mit einer<br />
Zusammenhangsstärke von Spearman-Rho=.826 (Signifikanz
Des Weiteren sind signifikante Effekte zwischen der Wohnform und dem<br />
Grad der Zufriedenheit mit der Wohnsituation nicht messbar.<br />
Statistiken <strong>zur</strong> Wohnsituation<br />
Wohnung<br />
Mit meiner Wohnsituation bin<br />
ich zufrieden.<br />
allein<br />
Partner<br />
zusammen WG<br />
Bei<br />
Eltern<br />
trifft gar nicht zu Anzahl 3 1 4 6<br />
Erwartet 2,5 1,7 7,9 2,0<br />
trifft eher nicht zu Anzahl 6 6 22 8<br />
Erwartet<br />
7,4 5,0 23,6 6,0<br />
trifft eher zu Anzahl 17 8 52 8<br />
Erwartet<br />
15,1 10,0 47,7 12,2<br />
trifft voll zu Anzahl 16 13 55 12<br />
Erwartet 17,0 11,3 53,9 13,8<br />
Gesamt: Anzahl 42 28 133 34<br />
Erwartet 42,0 28,0 133,0 34,0<br />
Teststatistik<br />
Wert<br />
df<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz (2-seitig)<br />
Chi-Quadrat nach<br />
Pearson 14,490(a) 9 ,106<br />
Likelihood-Quotient 12,323 9 ,196<br />
Zusammenhang linearmit-linear<br />
,936 1 ,333<br />
Anzahl der gültigen Fälle<br />
237<br />
1.12 Elternkontakt<br />
Die Mehrheit der Befragten gibt an, einen engen Kontakt zu den Eltern zu<br />
haben.<br />
Zust<strong>im</strong>mung <strong>zur</strong> Aussage: Ich habe einen engen Kontakt zu meinen Eltern.<br />
(Chi²=156,854, df=3, p
Als Belastung empfinden den Kontakt zu den Eltern nur 13,7%.<br />
Die Kontaktsituation zu den Eltern erlebe ich als Belastung (Chi-Quadrat =208,991,<br />
df=3, p
1.14 Gesundheitszustand<br />
Diesen Teil abschließend wurden die befragten Studierenden gebeten,<br />
ihren derzeitigen Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 5 (1=sehr<br />
gut bis 5=sehr schlecht) einzuschätzen. Dabei ergibt sich folgendes Bild:<br />
Einschätzung des persönlichen Gesundheitszustandes (Chi²=160,375, df=4, p
2 <strong>Studien</strong>wahlmotive<br />
Zur Motivik der <strong>Studien</strong>wahl wurden den Befragten 9 Items vorgelegt. Die<br />
Studierenden sollten hier jeweils zuordnen, welche Rolle das jeweilige<br />
Motiv für sie persönlich in der Auswahl des <strong>Studien</strong>gangs spielte (5=sehr<br />
wichtig, 1=gar nicht). Eine erste Übersicht veranschaulicht nachfolgende<br />
Tabelle:<br />
<strong>Studien</strong>wahlmotive<br />
Studium<br />
gewählt<br />
Mangel an<br />
Alternativen<br />
Zur Orientierung<br />
aus<br />
Interesse<br />
am Lehrerberuf<br />
Aus<br />
Interesse<br />
an den<br />
Fächern<br />
Durch den<br />
Einfluss<br />
anderer<br />
N Gültig 238 236 238 238 237<br />
Fehlend 40 42 40 40 41<br />
Mittelwert 1,6471 1,4068 4,6050 4,4958 2,0591<br />
Median 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000 2,0000<br />
Standardabweichung 1,01954 ,78537 ,66521 ,67971 1,01508<br />
<strong>Studien</strong>wahlmotive<br />
Aufgrund<br />
erwarteten<br />
beruflichen<br />
Prestiges<br />
Aufgrund<br />
erwarteten<br />
Verdienstes<br />
Aufgrund<br />
erwarteter<br />
Karrieremöglichkeiten<br />
Aufgrund der<br />
Aussicht auf<br />
einen sicheren<br />
Arbeitsplatz<br />
N Gültig 237 237 237 238<br />
Fehlend 41 41 41 40<br />
Mittelwert 2,1477 3,1392 2,6118 3,7185<br />
Median 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000<br />
Standardabweichung 1,03300 ,96640 1,09755 1,00240<br />
Aus beiden Abbildungen wird deutlich, dass die Lehramtsstudierenden<br />
ihren <strong>Studien</strong>gang vor allem sowohl aus Interessen, die den Lehrerberuf<br />
selbst betreffen, als auch aus Interessen hinsichtlich der beiden studierten<br />
Fächer gewählt haben. Materielle Überlegungen, vor allem die eines<br />
gesicherten Arbeitsplatzes, spielen darüber hinaus bei der<br />
<strong>Studien</strong>platzwahl eine gewisse Rolle, wobei der Beruf des Lehrers dabei<br />
nur in untergeordnetem Maße aus Karrieregründen gewählt wird. Nur<br />
schwachen Einfluss haben darüber hinaus Prestigegründe und das<br />
66
Einwirken anderer Personen. Das Orientierungs- und Ausweichmotiv hat<br />
einen vergleichsweise sehr schwachen Einfluss.<br />
Unter Beachtung obiger Daten kann daher für die Wahl des<br />
Lehramtsstudienganges durch die Befragten gesagt werden, dass das<br />
Lehrerstudium vor allem aus persönlichen Berufs- und Fachinteressen<br />
gewählt wird. Materielle Überlegungen fließen dabei in die <strong>Studien</strong>wahl mit<br />
ein.<br />
67
3 Persönliche Sicht des Studiums<br />
Hierzu wurden den Befragten 4 Items vorgelegt. In einem ersten Item<br />
sollten die Studierenden angeben, ich welchem Maße sie in ihrem<br />
derzeitigen Studium eine Herausforderung sehen. Die Antwortverteilung<br />
auf dieses Item veranschaulicht die folgende Übersicht:<br />
Ich sehe mein Studium als Herausforderung (Chi²=201,667, df=3, p
Ich sehe mein Studium als Bedrohung (Chi²=140,100, df=4, p
Für die Mehrheit der Befragten stellt das Studium damit in vollen Maße eine<br />
Herausforderung und in überwiegendem Maße einen Gewinn dar. Während<br />
die Mehrheit der Studierenden kaum bedrohliche Aspekte <strong>im</strong> Studium<br />
wahrn<strong>im</strong>mt, wird das Studium eher nicht mit Verlustwahrnehmungen<br />
verbunden. Es kann insgesamt von einer hohen positiven Beurteilung des<br />
Charakters des Studiums in der Sicht der Studierenden gesprochen<br />
werden. Gleichzeitig gehen aber für ca. 1/3 der Befragten auch zumindest<br />
partiell bedrohende Aspekte vom Studium aus. Dies wird deutlicher, wenn<br />
man die genannten Aspekte miteinander korreliert. Erwartungsgemäß<br />
korrelieren die Aussagen „Ich sehe das Studium als Herausforderung,<br />
…Gewinn“ mit r=.326 (Signifikanz
4 Zukunftsperspektiven durch das Studium<br />
Die Studierenden wurden aufgefordert, der Aussage: „Mein Studium<br />
eröffnet mir gute Zukunftsperspektiven“ in graduell abgestuftem Maße<br />
zuzust<strong>im</strong>men. Dabei st<strong>im</strong>men 86% dieser Aussage in vollem Maße (25%)<br />
und eher (61%) zu.<br />
Mein Studium eröffnet mir gute Zukunftsperspektiven<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 3 59,0 -56,0<br />
trifft eher nicht zu 30 59,0 -29,0<br />
trifft eher zu 144 59,0 85,0<br />
trifft voll zu 59 59,0 ,0<br />
Gesamt 236<br />
Die Auswahlantworten, die die Aussage eher oder vollständig ablehnen<br />
sind damit deutlich unterfrequentiert, während die zust<strong>im</strong>menden<br />
Kategorien überbesetzt sind. (Chi-Quadrat=189,864, df=3, p
Zusammenhang zwischen <strong>Studien</strong>bewertung und Belastung<br />
Spearmen-Rho<br />
Mein Studium eröffnet<br />
mir gute<br />
Zukunftsperspektiven<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Mein Studium<br />
eröffnet mir<br />
gute<br />
Zukunftsperspe<br />
ktiven<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
1,000 -,565(**)<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
N 236 230<br />
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).<br />
Zwischen beiden Aspekten besteht ein signifikanter, positiver, linearer<br />
Zusammenhang. Je stärker das Studium damit als Zukunftsperspektiven<br />
eröffnend beurteilt wird, desto geringer sind die hiermit verbundenen<br />
<strong>Belastungen</strong>. Für die vorliegende Untersuchung von Interesse ist damit der<br />
Umstand, dass die Belastungswahrnehmung zun<strong>im</strong>mt, wenn <strong>im</strong> Studium<br />
weniger Zukunftsperspektiven erkannt werden.<br />
72
5 Soziale Kontakte unter den Studierenden<br />
Hinsichtlich der sozialen Kontakte wurden die Beziehungen der<br />
Studierenden zu ihren Kommilitonen hinsichtlich der Anzahl der Kontakte<br />
und der Stärke der sozialen Nähe zu den anderen Studierenden<br />
untersucht. Dabei wurden die Kontakte in namentlich bekannte<br />
Mitstudierende, eher oberflächliche Kontakte und eher freundschaftlichvertraute<br />
Kontakte untergliedert. Hierbei gaben die Studierenden folgendes<br />
an:<br />
Zusammengefasste statistische Angaben <strong>zur</strong> Anzahl von Sozialkontakten<br />
Mit wie vielen<br />
Wie viele Studierenden hatten Sie<br />
Studierende in der vergangenen<br />
kennen Sie Woche oberflächliche<br />
namentlich? Gespräche<br />
Intensive,<br />
persönliche<br />
Kontakte<br />
N Gültig 230 231 233<br />
Fehlend 48 47 45<br />
Mittelwert 32,5087 17,7965 6,1288<br />
Median 25,5000 15,0000 5,0000<br />
Standardabweichung 21,69473 11,81404 7,31971<br />
Im Durchschnitt kennen damit die Studierenden ca. 33 Kommilitonen<br />
namentlich, hatten in der <strong>zur</strong>ückliegenden Woche ca. 18 oberflächliche<br />
Gesprächskontakte und ca. 6 persönlich-vertraute Gespräche.<br />
Zu beachten ist hier jedoch, dass die Werte auf alle Items eine relativ große<br />
Streuung aufweisen. Die Anzahl der Kontakte ist stark individualisiert und<br />
reicht hinsichtlich der Gesamtanzahl von 3 (Min<strong>im</strong>um) bis 140 (Max<strong>im</strong>um).<br />
Sie variiert damit interindividuell stark.<br />
73
6 Organisatorische und strukturelle Bedingungen des Studiums<br />
6.1 Lehrveranstaltungen und Semesterwochenstunden<br />
Die Studierenden geben bei einer Standardabweichung von 5,14 an,<br />
Lehrveranstaltungen <strong>im</strong> Rahmen von durchschnittlich 23,15<br />
Semesterwochenstunden zu besuchen.<br />
Übersicht <strong>zur</strong> Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen in SWS<br />
N Gültig 237<br />
Mittelwert 23,1519<br />
Median 24,0000<br />
Standardabweichung 5,13897<br />
Min<strong>im</strong>um 3,00<br />
Max<strong>im</strong>um 44,00<br />
Dabei entspricht die Verteilung signifikant (Chi²=343,857, df=28, p
Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen in SWS<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
3,00 1 8,2 -7,2<br />
4,00 1 8,2 -7,2<br />
11,00 1 8,2 -7,2<br />
12,00 5 8,2 -3,2<br />
13,00 1 8,2 -7,2<br />
14,00 3 8,2 -5,2<br />
15,00 1 8,2 -7,2<br />
16,00 6 8,2 -2,2<br />
17,00 2 8,2 -6,2<br />
18,00 13 8,2 4,8<br />
19,00 5 8,2 -3,2<br />
20,00 32 8,2 23,8<br />
21,00 6 8,2 -2,2<br />
22,00 30 8,2 21,8<br />
23,00 9 8,2 ,8<br />
24,00 37 8,2 28,8<br />
25,00 16 8,2 7,8<br />
26,00 20 8,2 11,8<br />
27,00 9 8,2 ,8<br />
28,00 15 8,2 6,8<br />
29,00 4 8,2 -4,2<br />
30,00 5 8,2 -3,2<br />
31,00 2 8,2 -6,2<br />
32,00 7 8,2 -1,2<br />
33,00 2 8,2 -6,2<br />
36,00 1 8,2 -7,2<br />
38,00 1 8,2 -7,2<br />
40,00 1 8,2 -7,2<br />
44,00 1 8,2 -7,2<br />
Gesamt 237<br />
Die Verteilung weist eine deutliche Überfrequentierung innerhalb der hohen<br />
Semesterwochenstundenzahlen auf. Daneben deutet die relativ geringe<br />
Standardabweichung darauf hin, dass trotz der großen Spannweite der<br />
Werte durchschnittlich relativ ähnliche Anzahlen von Lehrveranstaltungen<br />
besucht werden. Dabei konnten folgende Bezüge zu den Fächern ermittelt<br />
werden 19 :<br />
19 Berichtet werden generell nur die Fächer, bei denen signifikante Zusammenhänge<br />
zwischen der Anzahl besuchter Lehrveranstaltungen und dem Fach festgestellt werden<br />
konnten. Alle anderen Fächer wurden ebenso geprüft. Die entsprechenden Werte können<br />
be<strong>im</strong> Autor angefordert werden.<br />
75
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Anzahl an<br />
SWS<br />
Anzahl<br />
an SWS<br />
Quadrat<br />
Signifikanz<br />
Physik X 45,174 28 0,02 0,142<br />
Biologie X 79,664 28
N Gültig 239<br />
Median 9,0000<br />
Modus 9,00<br />
Standardabweichung 2,81618<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00<br />
Max<strong>im</strong>um 12,00<br />
In Relation <strong>zur</strong> Gleichverteilung weichen die beobachteten Werte signifikant<br />
ab. Es ist eine deutlich höhere Besetzung der oberen Zellenwerte zu<br />
konstatieren, als dies erwartbar gewesen wäre. Der Median fällt mit dem<br />
Modalwert bei 9 zusammen. Damit ist der häufigste Wert innerhalb dieser<br />
Variablen eine wöchentliche <strong>Studien</strong>zeitinvestition, die zwischen 39 und 40<br />
Wochenstunden liegt. Daneben leisten 50% der Befragten mehr als diese<br />
wöchentliche Arbeitszeit.<br />
Um in dieser Hinsicht exaktere Werte zu erhalten, wurden die Studierenden<br />
an einer anderen Stelle nochmals gebeten anzugeben, welches Maß an<br />
Zeit sie für die Präsenz an der Universität, das Selbststudium, die<br />
Vorbereitung und andere studienbezogene Aktivitäten aufwenden.<br />
Daneben wurde diese Zeit zusätzlich für das erste und zweite studierte<br />
Fach sowie für Erziehungswissenschaft spezifiziert, um möglichst exakte<br />
und konkrete Angaben zu erhalten. Generell erfolgt die Auswertung in zwei<br />
Richtungen. Zum Einen werden die entsprechenden Werte für die Fächer<br />
und die Erziehungswissenschaft zusammengefasst, zum Anderen in die<br />
Summe von Präsenzzeiten, Selbststudium, Vorbereitungszeit und sonstige<br />
studienbezogene Aktivitäten aufgegliedert. Für das als erstes studiertes<br />
Fach angegebene, sind folgende Werte ermittelt worden 20 :<br />
Statistik zum Zeitaufwand <strong>im</strong> ersten Fach<br />
Präsenzstunden<br />
pro<br />
Woche<br />
Zeit für<br />
Selbststudium<br />
pro Woche<br />
Zeit für die<br />
Vorbereitung<br />
Zeit für<br />
andere<br />
studienbezogene<br />
Aktivitäten<br />
N Gültig 233 233 232 228<br />
Mittelwert 8,7253 7,7554 3,7069 1,1491<br />
Median 9,0000 6,0000 2,0000 ,0000<br />
Standardabweichung 3,15574 5,71185 4,66082 2,11657<br />
Min<strong>im</strong>um ,00 ,00 ,00 ,00<br />
Max<strong>im</strong>um 22,00 35,00 30,00 10,00<br />
20 Auf die Darstellung der einzelnen Prozentwerte wird verzichtet. Diese können jedoch<br />
be<strong>im</strong> Autor angefordert werden.<br />
77
Für das zweite studierte Fach ergibt sich folgende Gesamtsicht:<br />
Statistik zum Zeitaufwand <strong>im</strong> zweiten Fach<br />
Zunächst verweisen die relativ großen Spannbreiten der Werte auf eine<br />
starke Individualisierung des zeitlichen <strong>Studien</strong>aufwandes. Die Betrachtung<br />
der einzelnen Streuungsmaße ergibt darüber hinaus, dass offensichtlich<br />
besonders innerhalb der Vorbereitung des Studiums und in noch stärkerem<br />
Maße in dem Ausmaß des Selbststudiums erhebliche interindividuelle<br />
Differenzen deutlich werden. Die Präsenzzeiten stellen sich als der Bereich<br />
mit dem durchschnittlich höchsten Zeitaufwand bei relativ geringer<br />
Streuung dar.<br />
Der durchschnittlich in das Studium des ersten Fachs investierte<br />
Zeitaufwand beträgt bei einer Standardabweichung von SD=9,0 M=21,35<br />
Stunden, wobei die Werte (Min<strong>im</strong>um 0, Max<strong>im</strong>um 52) auf eine starke<br />
Individualisierung der Zeitinvestition in das Studium schließen lassen. Setzt<br />
man die für das erste studierte Fach angegebene <strong>Studien</strong>zeitinvestition mit<br />
den Fächern in Beziehung, ergeben sich aufschlussreiche<br />
Zusammenhänge:<br />
Fach Geringere Höhere Chiquadrat<br />
df Asym. Eta<br />
Anzahl an<br />
Stunden<br />
Anzahl<br />
an<br />
Stunden<br />
Signifikanz<br />
Russisch X 46,840 40 0,014 0,211<br />
Biologie X 83,249 40
Innerhalb der Zeitinvestition für das Studium der Erziehungswissenschaft<br />
ergibt sich <strong>im</strong> Gegensatz hierzu ein wesentlich verändertes Bild.<br />
Statistik zum Zeitaufwand in Erziehungswissenschaft<br />
Auch für das zweite studierte Fach liegt die zeitliche Hauptbelastung in den<br />
Präsenzzeiten an der Universität, wohingegen Zeiten für die Vorbereitung<br />
und andere studienbezogene Aktivitäten deutlich geringer zeitliche<br />
Ressourcen beanspruchen. Auch hier streuen besonders die Werte für die<br />
Vorbereitungszeit und vor allem die investierte Zeit in das Selbststudium. In<br />
Betrachtung der einzelnen Extrempole (Min<strong>im</strong>um und Max<strong>im</strong>um) fällt<br />
jedoch <strong>im</strong> Vergleich zum ersten Fach auf, dass die Spannbreite der Werte<br />
wesentlich geringer ist, während die Streuungsmaße ähnliche Werte<br />
annehmen. Der durchschnittlich in das Studium des zweiten Fachs<br />
wöchentlich investierte Zeitumfang beträgt bei einer Standardabweichung<br />
von SD=10,54 M=17,24 Stunden. Das zweite Fach wird damit<br />
durchschnittlich mit einer geringeren zeitlichen Belastung studiert als das<br />
erste Fach. Auch hier lässt die Spannbreite der Werte (Min<strong>im</strong>um 0,<br />
Max<strong>im</strong>um 54) darauf schließen, dass die <strong>Studien</strong>zeitinvestition sehr stark<br />
individualisiert ist. In Abhängigkeit zu den studierten Fächern ergeben sich<br />
folgende Werte:<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Anzahl an Anzahl Quadrat Signifikanz<br />
Stunden an<br />
Stunden<br />
Physik X 64,605 39 0,006 0,14<br />
Biologie X 80,729 39
Jedoch bleibt auch hier das Kontingent der Präsenzzeiten der Schwerpunkt<br />
der zeitlichen Belastung. Die Streuung der einzelnen Werte ist in Relation<br />
zu den Mittelwerten jedoch auch hier als hoch zu bezeichnen, sodass auch<br />
in Erziehungswissenschaft von einem stark individualisierten Zeitaufwand<br />
ausgegangen werden muss.<br />
In der Summierung der einzelnen Zeiten ergeben sich folgende Werte:<br />
Übersicht zum Zeitaufwand<br />
N Min<strong>im</strong>um Max<strong>im</strong>um Mittelwert<br />
Standardabweichung<br />
Anzahl des<br />
Zeitaufwandes 1. Fach 228 ,00 52,00 21,3553 9,00421<br />
Zeitaufwand 2. Fach 229 ,00 54,00 17,2445 10,54362<br />
Zeitaufwand<br />
Erziehungswissenschaften<br />
230 ,00 31,00 8,5522 4,71589<br />
Zeitaufwand pro Woche<br />
insgesamt 228 12,00 104,00 47,2193 15,80457<br />
Gültige Werte<br />
(Listenweise) 228<br />
Der so ermittelte durchschnittliche Zeitaufwand pro Woche beträgt ca. 47<br />
Stunden, wobei dieser Wert stark streut, sodass insgesamt von einer stark<br />
individualisierten wöchentlichen <strong>Studien</strong>zeitinvestition ausgegangen<br />
werden muss. Dabei ist das erste Fach jenes, das mit der höchsten<br />
zeitlichen Intensität studiert wird. An zweiter Stelle <strong>im</strong> Zeitvolumen rangiert<br />
das zweite studierte Fach, während das Studium der<br />
Erziehungswissenschaft deutlich geringere zeitliche Investitionen aufweist.<br />
Diese 47 Wochenstunden gliedern sich in folgende Bereiche:<br />
Statistik zum Zeitaufwand insgesamt<br />
Präsenzzeiten<br />
Zeit für<br />
Selbststudium<br />
Zeit für die<br />
Vorbereitung<br />
Zeit für andere<br />
studienbezogene<br />
Aktivitäten<br />
N Gültig 233 233 230 228<br />
Mittelwert 20,43 16,83 7,52 2,42<br />
Median 20,0000 14,0000 6,0000 ,0000<br />
Standardabweichung 5,08534 10,68739 7,56902 3,62540<br />
Min<strong>im</strong>um 3,00 ,00 ,00 ,00<br />
Max<strong>im</strong>um 38,00 57,00 37,00 18,00<br />
Insgesamt stellt damit die Ebene der Präsenzzeit die zeitintensivste Ebene<br />
dar, die auch hinsichtlich ihrer Streuung auf ein relativ ähnliches zeitliches<br />
Studierverhalten der Befragten schließen lässt. Weitaus individualisierter ist<br />
80
das zeitliche Studierverhalten in Bezug auf das Selbststudium. Die<br />
Streuung der Werte ist bei geringerer durchschnittlicher Zeitbelastung<br />
höher, was eine stark personenbezogene Zeitinvestition widerspiegelt. Im<br />
Vergleich zwischen Präsenzzeit und Zeit für das Selbststudium ergibt sich<br />
ein Verhältnis von 1 Stunde Präsenzzeit zu 0,822 Stunden<br />
Selbststudiumszeit.<br />
Eine in Relation zu Präsenzzeiten und Selbststudium untergeordnete Rolle<br />
spielen die Vorbereitungszeiten und sonstige studienbezogene Aktivitäten,<br />
die ihrerseits aufgrund hoher Streuungswerte starke interindividuelle<br />
Unterschiede aufzeigen.<br />
6.3 Belegungssituation in den Lehrveranstaltungen<br />
Die Studierenden wurden gebeten in zwei Items anzugeben, wie viele<br />
Lehrveranstaltungen wegen Überschneidung und/oder zu hoher<br />
Teilnehmerzahlen <strong>im</strong> laufenden Semester nicht belegt werden konnten.<br />
Hierzu ergeben sich folgende Werte:<br />
Anzahl der Lehrveranstaltungen, die wegen Überschneidungen nicht belegt werden<br />
konnten (Chi²=281,958, df=4, p
Anzahl der Lehrveranstaltungen, die wegen begrenzter Teilnehmerzahlen nicht belegt<br />
werden konnten (Chi²=394, df=6, p
Zusammenhänge zwischen den Fächern und der Anzahl von<br />
Lehrveranstaltungen, die wegen zu hoher Teilnehmerzahlen nicht belegt<br />
werden konnten, wurden für die Fächer Deutsch, Englisch und Sport<br />
ermittelt:<br />
Anzahl der Lehrveranstaltungen, die wegen begrenzter Teilnehmerzahlen in den<br />
Fächern nicht belegt werden konnten<br />
Fach Höhere Anzahl an Chi- df Asym. Eta<br />
Nichtbelegung aufgrund Quadrat Signifikanz<br />
Teilnehmerbegrenzung<br />
Deutsch X 25,466 6
Hierbei wurde die Prüfungsanzahl insgesamt mit den studierten Fächern in<br />
einen Zusammenhang gesetzt, der folgende Werte erbringt:<br />
Übersicht: Anzahl der <strong>im</strong> laufenden Semester zu absolvierenden Prüfungen je Fach<br />
Fach Geringere Höhere Anzahl Chi- df Asym. Eta<br />
Anzahl<br />
Modulprüfungen<br />
Modulprüfungen<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Sozialkunde<br />
X 31,770 12
Statistik <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
erstes Fach<br />
Zufriedenheit<br />
zweites Fach<br />
Zufriedenheit<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Zufriedenheit<br />
Zufriedenheit<br />
gesamt<br />
N 239 238 238 239<br />
Mittelwert 3,5356 3,1891 3,5042 3,4477<br />
Median 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,96895 1,22301 ,89418 ,66452<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00 1,00 1,00 2,00<br />
Max<strong>im</strong>um 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
Die Befragten geben durchschnittlich eine mittlere <strong>Studien</strong>zufriedenheit an,<br />
die für das Studium <strong>im</strong> ersten Fach und in Erziehungswissenschaft höher<br />
eingeschätzt wird als für das zweite studierte Fach. Dabei weichen die<br />
Verteilungen für alle Bereiche signifikant von einer Gleichverteilung ab.<br />
Erstes Fach <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
nicht zufrieden 7 47,8 -40,8<br />
eher nicht zufrieden 28 47,8 -19,8<br />
teilweise zufrieden 67 47,8 19,2<br />
eher zufrieden 104 47,8 56,2<br />
zufrieden 33 47,8 -14,8<br />
Gesamt 239<br />
Zweites Fach <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
nicht zufrieden 35 47,6 -12,6<br />
eher nicht zufrieden 28 47,6 -19,6<br />
teilweise zufrieden 58 47,6 10,4<br />
eher zufrieden 91 47,6 43,4<br />
zufrieden 26 47,6 -21,6<br />
Gesamt 238<br />
Zufriedenheit mit dem Studium der Erziehungswissenschaft<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
nicht zufrieden 4 47,6 -43,6<br />
eher nicht zufrieden 23 47,6 -24,6<br />
teilweise zufrieden 90 47,6 42,4<br />
eher zufrieden 91 47,6 43,4<br />
zufrieden 30 47,6 -17,6<br />
Gesamt 238<br />
85
Gesamtzufriedenheit mit dem Studium<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
eher nicht zufrieden 12 59,8 -47,8<br />
teilweise zufrieden 119 59,8 59,3<br />
eher zufrieden 97 59,8 37,3<br />
zufrieden 11 59,8 -48,8<br />
Gesamt 239<br />
Teststatistik<br />
erstes Fach<br />
Zufriedenheit<br />
zweites Fach<br />
Zufriedenheit<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Zufriedenheit<br />
Zufriedenheit<br />
gesamt<br />
Chi-Quadrat 121,397 63,050 136,496 159,912<br />
df 4 4 4 3<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz<br />
,000 ,000 ,000 ,000<br />
Hinsichtlich der Zufriedenheit ergibt sich in allen Teilbereichen eine<br />
Verschiebung der Zellenbelegung in Richtung einer höheren<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit. Dennoch sind besonders die negativen und positiven<br />
Pole deutlich unterfrequentiert. Von Interesse ist auch hier wiederum, ob<br />
und wenn ja, welche Zusammenhänge zwischen der <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
und den einzelnen studierten Fächern auftreten. Hierzu ergeben sich<br />
folgende Werte:<br />
Übersicht: <strong>Studien</strong>zufriedenheit (1.und 2.Fach) in Abhängigkeit vom studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Mathematik<br />
X 34,121 4
Erziehungswissenschaft vorgenommen, um genauere Informationen über<br />
die Verteilung der Leistungspunkte zu erhalten.<br />
Einen ersten Einblick zu Tendenzen vermitteln die nachfolgenden Tabellen:<br />
Statistik Leistungspunkte<br />
Summe der<br />
Summe der Summe der Leistungspunkte,<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte<br />
1. Fach<br />
Leistungspunkte<br />
2.Fach<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Leistungspunkte<br />
gesamt<br />
N 192 188 199 204<br />
Mittelwert 13,4844 10,8085 7,8442 30,3284<br />
Median 15,0000 10,0000 8,0000 32,5000<br />
Modus 15,00 15,00 10,00 35,00<br />
Standardabweichung 4,43331 5,72596 2,39757 9,64467<br />
Min<strong>im</strong>um ,00 ,00 ,00 1<br />
Max<strong>im</strong>um 30 30 15 70<br />
Statistik Leistungspunkte, fehlende Werte<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte,<br />
die <strong>im</strong> 1. Fach<br />
erbracht werden<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte,<br />
die <strong>im</strong> 2.Fach<br />
erbracht werden,<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte,<br />
die in<br />
Erziehungswissenschaft<br />
erbracht werden<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte<br />
gesamt<br />
N Gültig 192 188 199 204<br />
Fehlend 49 53 42 37<br />
Zunächst fällt bei diesen Items die hohe Anzahl fehlender Werte auf. Ein<br />
Teil der Studierenden gibt hier keine Information an. Da hierdurch in<br />
Relation beispielsweise <strong>zur</strong> Matrikel-Nummer (fehlende Werte 11)<br />
personenbezogen nur gering sensible Informationen angegeben werden<br />
müssen, kann davon ausgegangen werden, dass zumindest teilweise<br />
Unkenntnis über die Anzahl der mit den Workloads verbundenen<br />
Leistungspunkte besteht.<br />
Insgesamt erreichen die Studierenden durchschnittlich die anvisierte Zahl<br />
von 30 ECTS-Punkten <strong>im</strong> ersten Semester. Dabei werden trotz des<br />
grundsätzlich gleichen Gesamtpunkteumfangs <strong>im</strong> ersten und zweiten<br />
studierten Fach beide Fächer in unterschiedlicher zeitlicher Intensität,<br />
ausgedrückt über die Workloads, die ihrerseits die Punkte abbilden sollen,<br />
studiert. Im ersten studierten Fach werden durchschnittlich mehr ECTS-<br />
Punkte erworben als in dem anderen studierten Fach. Dies korrespondiert<br />
87
mit der oben bereits festgestellten zeitlich unterschiedlichen<br />
<strong>Studien</strong>intensität für beide Fächer. Außerdem weisen die Werte besonders<br />
für das zweite studierte Fach eine hohe Spannbreite auf, sodass die<br />
Verteilungen hier aufschlussreiche Informationen liefern.<br />
Summe der Leistungspunkte, die <strong>im</strong> 1. Fach erbracht werden<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
Gültig ,00 1 ,4 ,5 ,5<br />
3,00 1 ,4 ,5 1,0<br />
5,00 3 1,1 1,6 2,6<br />
6,00 5 1,8 2,6 5,2<br />
7,00 1 ,4 ,5 5,7<br />
8,00 4 1,4 2,1 7,8<br />
9,00 5 1,8 2,6 10,4<br />
10,00 51 18,3 26,6 37,0<br />
11,00 1 ,4 ,5 37,5<br />
12,00 6 2,2 3,1 40,6<br />
13,00 4 1,4 2,1 42,7<br />
14,00 9 3,2 4,7 47,4<br />
15,00 67 24,1 34,9 82,3<br />
16,00 7 2,5 3,6 85,9<br />
18,00 3 1,1 1,6 87,5<br />
19,00 2 ,7 1,0 88,5<br />
20,00 17 6,1 8,9 97,4<br />
23,00 1 ,4 ,5 97,9<br />
24,00 1 ,4 ,5 98,4<br />
30,00 3 1,1 1,6 100,0<br />
Gesamt 192 69,1 100,0<br />
Hier wird deutlich, dass die Zahl jener Studierenden, die nur wenige<br />
Leistungspunkte erwerben, relativ gering ist. Im Vergleich hierzu ergibt die<br />
Verteilung für das zweite Fach ein anderes Ergebnis:<br />
88
Summe der Leistungspunkte, die <strong>im</strong> 2.Fach erbracht werden<br />
Gültige Kumulierte<br />
Häufigkeit Prozent Prozente Prozente<br />
Gültig ,00 22 7,9 11,7 11,7<br />
4,00 3 1,1 1,6 13,3<br />
5,00 14 5,0 7,4 20,7<br />
6,00 7 2,5 3,7 24,5<br />
8,00 2 ,7 1,1 25,5<br />
9,00 7 2,5 3,7 29,3<br />
10,00 44 15,8 23,4 52,7<br />
11,00 2 ,7 1,1 53,7<br />
12,00 10 3,6 5,3 59,0<br />
13,00 1 ,4 ,5 59,6<br />
14,00 2 ,7 1,1 60,6<br />
15,00 49 17,6 26,1 86,7<br />
16,00 8 2,9 4,3 91,0<br />
18,00 3 1,1 1,6 92,6<br />
19,00 1 ,4 ,5 93,1<br />
20,00 12 4,3 6,4 99,5<br />
30,00 1 ,4 ,5 100,0<br />
Gesamt 188 67,6 100,0<br />
Hier fällt auf, dass ein erheblicher Teil (11,7%) <strong>im</strong> zweiten studierten Fach<br />
überhaupt keine Leistungspunkte erwerben, d.h., dass ein Studium in<br />
diesem Fach <strong>im</strong> Sinne einer Arbeitsbelastung de facto nicht stattfindet. Die<br />
Unterschiede <strong>im</strong> Studierverhalten hinsichtlich der Leistungspunktezahl sind<br />
somit zumindest partiell darauf <strong>zur</strong>ückzuführen, dass die Stichprobe 22<br />
Befragte enthält, die ihr Studium praktisch nur auf ein Fach konzentrieren.<br />
Diese 22 Befragten studieren folgende Fächer als zweites Fach:<br />
Fach<br />
Anzahl der Studierenden, die hierin keine LP erwerben<br />
Kein 2. Fach 3<br />
Mathematik 4<br />
Chemie 4<br />
Wirtschaft/Recht 3<br />
Religion 2<br />
Englisch 2<br />
Physik, Biologie, Je 1<br />
Informatik &<br />
Russisch<br />
Generell bildet die Anzahl der zu erwerbenden Leistungspunkten zu<br />
einzelnen studierten Fächern Zusammenhänge:<br />
89
Übersicht: Leistungspunktezahl (1.und 2.Fach) in Abhängigkeit vom studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Anzahl an Anzahl an Quadrat Signifikanz<br />
Leistungs<br />
-punkten<br />
Leistungspunkten<br />
Mathematik<br />
X 35,648 19 =0,01 0,09<br />
Geschichte X 29,224 16 0,02 0,155<br />
Ethik X 36,250 19 =0,01 0,05<br />
Physik X 43,682 16
Korrelation der Leistungspunkte<br />
Leistungspunkte<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Leistungspunkte<br />
1.Fach<br />
Leistungs<br />
-punkte<br />
1.Fach<br />
Leistungspunkte<br />
2.Fach<br />
Summe<br />
der<br />
Leistungs<br />
-punkte<br />
Korrelation nach<br />
Pearson ,088 -,087 ,584(**)<br />
Signifikanz (2-seitig) ,231 ,237 ,000<br />
Leistungspunkte<br />
2.Fach<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
Signifikanz (2-seitig)<br />
-,031 ,732(**)<br />
,675 ,000<br />
Leistungspunkte<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
,244(**)<br />
Signifikanz (2-seitig) ,001<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte<br />
Korrelationen<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
,584(**) ,732(**) ,244(**) 1<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000 ,001<br />
(** sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.)<br />
Die Gesamtanzahl der zu erwerbenden Leistungspunkte korreliert<br />
erwartungsgemäß unterschiedlich hoch und signifikant mit den Punktzahlen<br />
der einzelnen Bereiche. Interessanter sind die nicht bestätigten<br />
Zusammenhänge. Zwischen der zu erwerbenden Punktzahl <strong>im</strong> ersten Fach<br />
und dem zweiten Fach konnten keine statistisch signifikanten linearen<br />
Zusammenhänge nachgewiesen werden. In diesen Werten drückt sich<br />
damit kein messbarer Zusammenhang zwischen dem Studierverhalten<br />
hinsichtlich des Erwerbs von Leistungspunkten zwischen dem ersten und<br />
dem zweiten Fach aus. Die Hypothese, dass Studierende, die <strong>im</strong> zweiten<br />
Fach wenige oder keine studienbezogenen Leistungen erbringen, dies in<br />
erhöhtem Maße <strong>im</strong> ersten Fach tun, muss deshalb verworfen werden.<br />
Vielmehr studieren die Befragten die einzelnen Fächer mit<br />
unterschiedlicher Gewichtung und unterscheiden sich vor allem hinsichtlich<br />
ihrer Gesamtanzahl der zu erbringenden Leistungspunkte.<br />
Die angegebenen Leistungspunkte für die Erziehungswissenschaft zeigen<br />
mit einer in Relation zum zweiten studierten Fach geringen<br />
Standartabweichung ein vergleichsweise einheitlicheres Bild.<br />
91
Summe der Leistungspunkte, die in Erziehungswissenschaften erbracht werden<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
Gültig ,00 1 ,4 ,5 ,5<br />
1,00 1 ,4 ,5 1,0<br />
2,00 1 ,4 ,5 1,5<br />
3,00 7 2,5 3,5 5,0<br />
4,00 3 1,1 1,5 6,5<br />
5,00 14 5,0 7,0 13,6<br />
6,00 47 16,9 23,6 37,2<br />
7,00 10 3,6 5,0 42,2<br />
8,00 30 10,8 15,1 57,3<br />
10,00 81 29,1 40,7 98,0<br />
11,00 1 ,4 ,5 98,5<br />
12,00 1 ,4 ,5 99,0<br />
15,00 2 ,7 1,0 100,0<br />
Gesamt 199 71,6 100,0<br />
Innerhalb dieser Verteilung fallen 2 Befragte auf, die Werte angeben, die<br />
für die Erziehungswissenschaft nicht erreichbar sind (1 Punkt, 2 Punkte).<br />
50% der Studierenden erwerben 8 Leistungspunkte und mehr in<br />
Erziehungswissenschaft.<br />
Zu hinterfragen bleibt in diesem Zusammenhang, in welchem<br />
Zusammenhang die Anzahl der zu erwerbenden Leistungspunkte und die<br />
in das Studium investierte Zeit stehen. Hierzu wurden folgende<br />
Korrelationen berechnet:<br />
92
Korrelationen des Zeitaufwands und der Leistungspunkte in beiden Fächern und<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Zeit 1.<br />
Fach<br />
Zeit 2.<br />
Fach<br />
Summe<br />
Zeit<br />
LP 1.<br />
Fach<br />
LP 2.<br />
Fach<br />
LP<br />
Erziehungswissenschaf<br />
Summe-<br />
LP<br />
Zeit<br />
1.Fach 1 ,067 ,691(**) ,260(**) -,187(*) -,030 ,019<br />
,314 ,000 ,000 ,011 ,679 ,793<br />
228 228 228 187 183 193 198<br />
Zeit<br />
2.Fach 1 ,708(**) ,025 ,455(**) -,008 ,223(**)<br />
,000 ,736 ,000 ,908 ,002<br />
229 228 187 183 193 198<br />
Zeit<br />
gesamt 1 ,101 ,142 ,076 ,134<br />
,170 ,055 ,294 ,060<br />
228 187 183 193 198<br />
LP 1.<br />
Fach 1 ,088 -,087 ,584(**)<br />
,231 ,237 ,000<br />
192 185 188 192<br />
LP 2.<br />
Fach 1 -,031 ,732(**)<br />
,675 ,000<br />
188 184 187<br />
1 ,244(**)<br />
LP Erziehungswissenschaft<br />
199 199<br />
Summe-<br />
LP 1<br />
,001<br />
204<br />
Zunächst ist erkennbar, dass kein genereller Zusammenhang zwischen der<br />
in das Studium investierten Zeit und der Anzahl der zu erwerbenden<br />
Leistungspunkte konstatiert werden kann. So korreliert der gesamte in das<br />
Studium investierte Zeitaufwand nicht signifikant mit der<br />
Leistungspunktezahl. Dem gegenüber kann ein positiver, signifikanter<br />
Zusammenhang gemessen werden zwischen dem Zeitaufwand für das<br />
93
erste studierte Fach und der Leistungspunkteanzahl des 1. Fachs (r=.260,<br />
p
Dies lässt sich mit der nachfolgenden Häufigkeitsbesetzung<br />
veranschaulichen:<br />
Die Rahmenbedingungen erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 62 57,8 4,3<br />
trifft eher nicht zu 107 57,8 49,3<br />
trifft eher zu 50 57,8 -7,8<br />
trifft voll zu 12 57,8 -45,8<br />
Gesamt 231<br />
Die starke Frequentierung der die Aussage <strong>zur</strong> Belastung eher und völlig<br />
verneinenden Antwortkategorien drückt aus, dass die Rahmenbedingungen<br />
der Universität für die überwiegende Anzahl von Studierenden kaum<br />
Effekte aufweisen, die als Belastung empfunden werden.<br />
Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen der Beurteilung der<br />
Rahmenbedingungen und der hiervon ausgehenden wahrgenommenen<br />
Belastung kann festgestellt werden, dass je positiver die<br />
Rahmenbedingungen beurteilt werden, desto geringer dies als Belastung<br />
erlebt wird.<br />
Korrelationen der Einschätzung der Rahmenbedingungen mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Die Rahmenbedingungen<br />
sind<br />
gut.<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Die Rahmenbedingungen<br />
Spearmen-Rho<br />
des<br />
1 -,726(**)<br />
Studiums sind gut.<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.<br />
6.8 Betreuungssituation<br />
Im Hinblick auf die Betreuung der Studierenden seitens der Universität<br />
wurde den Befragten zunächst die Aussage: „Ich fühle mich durch die<br />
Universität gut betreut.“, vorgelegt, zu der sie das Maß ihrer Zust<strong>im</strong>mung<br />
angeben sollten. Daneben wurden die Studierenden in 7 Items gebeten<br />
anzugeben, in welchem Maße die Aussagen auf sie zutreffen. Im Einzelnen<br />
waren dies:<br />
1. Ich brauche keine Unterstützung.<br />
2. Ich habe keine Unterstützung erfahren.<br />
3. Meine Dozenten haben mich sehr gut unterstützt.<br />
4. Meine Mitstudierenden haben mich sehr gut unterstützt.<br />
95
5. Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt.<br />
6. Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt.<br />
7. Mit den Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden bin ich sehr<br />
zufrieden.<br />
47% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage, sie fühlen sich seitens der<br />
Universität Jena gut betreut, in vollem Maße (3,8%) und eher (43,2%) zu.<br />
Detailliert ergeben sich folgende Werte:<br />
Ich fühle mich an der Uni gut betreut<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 18 59,0 -41,0<br />
trifft eher nicht zu 107 59,0 48,0<br />
trifft eher zu 102 59,0 43,0<br />
trifft voll zu 9 59,0 -50,0<br />
Gesamt 236<br />
Deutlich wird hier eine Unterfrequentierung der Extremantworten und eine<br />
Überfrequentierung der eher ablehnenden und eher zust<strong>im</strong>menden<br />
Antwortkategorien beobachtet, wobei jedoch insgesamt die die Aussage<br />
ablehnenden Kategorien häufiger besetzt sind. Hiervon gehen für 49,4%<br />
der Befragten zumindest eher belastende Effekte ausgehen.<br />
Die Betreuungssituation seitens der Uni erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 36 58,3 -22,3<br />
trifft eher nicht zu 82 58,3 23,8<br />
trifft eher zu 84 58,3 25,8<br />
trifft voll zu 31 58,3 -27,3<br />
Gesamt 233<br />
Statistik für Test<br />
Gute<br />
Betreuung<br />
Belastung<br />
Chi-Quadrat 141,254 42,313<br />
Df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Eine Überprüfung der Korrelation zwischen der wahrgenommenen<br />
Betreuung und der hiervon ausgehenden belastenden Effekte ergibt einen<br />
statistisch signifikanten negativen Zusammenhang zwischen beiden<br />
Aspekten:<br />
96
Korrelationen der Einschätzung der Betreuungssituation seitens der Uni und des<br />
Belastungsempfindens<br />
Spearman-Rho<br />
Ich fühle mich an<br />
der Uni gut betreut<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Ich fühle mich an<br />
der Uni gut<br />
betreut<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
1,000 -,747<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
Je besser die Betreuung der Studierenden damit in der Wahrnehmung der<br />
Studierenden beurteilt wird, desto geringer sind die belastenden Effekte,<br />
die hiervon ausgehend von den Studierenden wahrgenommen werden.<br />
Die Frage, ob die Studierenden überhaupt Unterstützung benötigen, wird<br />
mit einem separaten Item beantwortet. Der Aussage: „Ich brauche keine<br />
Unterstützung.“, st<strong>im</strong>men auf einer Skala von 1 bis 5 15,2% der Befragten in<br />
vollem (Kategorie 5: 3,4%) und überwiegendem Maße (Kategorie 4: 11,8%)<br />
zu. Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte für dieses Item:<br />
Ich brauche keine Unterstützung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 18 47,6 -29,6<br />
überwiegend nicht 69 47,6 21,4<br />
teilweise 115 47,6 67,4<br />
überwiegend 28 47,6 -19,6<br />
voll 8 47,6 -39,6<br />
Gesamt 238<br />
Auffällig ist hieran, dass zum einen beide Extrempole stark unterbesetzt<br />
sind, während eine deutliche Überfrequentierung der neutralen<br />
Antwortkategorie vorhanden ist. Die Studierenden artikulieren in Bezug auf<br />
das Benötigen von Unterstützung damit mehrheitlich zumindest partielle<br />
Zust<strong>im</strong>mung. Der Median liegt bei 3.<br />
20,1% der Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage, keine Unterstützung<br />
erfahren zu haben, in vollem Maße (Katgeorie 5: 0,8%) und überwiegend<br />
(Kategorie 4: 19,3%) zu.<br />
97
Ich habe keine Unterstützung erfahren.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 43 47,6 -4,6<br />
überwiegend nicht 68 47,6 20,4<br />
teilweise 79 47,6 31,4<br />
überwiegend 46 47,6 -1,6<br />
voll 2 47,6 -45,6<br />
Gesamt 238<br />
Dabei ist die starke Unterbesetzung der voll zust<strong>im</strong>menden<br />
Antwortkategorie auffällig. In der Mehrzahl haben die Befragten eine<br />
Unterstützung wahrgenommen und nur 2 Probanden haben grundsätzlich<br />
keine Unterstützung erfahren. Der Medianwert liegt bei 3.<br />
Im Anschluss hieran ist von Interesse, von welcher Seite die erfahrene<br />
Unterstützung geleistet wurde. 12,6% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage,<br />
die Lehrenden haben sie gut unterstützt, in vollem Maße (Kategorie 5:<br />
0,8%) und überwiegend (Kategorie 4: 11,8%) zu. Detailliert ergibt sich<br />
folgende Antwortverteilung:<br />
Meine Dozenten haben mich sehr gut unterstützt.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 30 47,6 -17,6<br />
überwiegend nicht 72 47,6 24,4<br />
teilweise 106 47,6 58,4<br />
überwiegend 28 47,6 -19,6<br />
voll 2 47,6 -45,6<br />
Gesamt 238<br />
Innerhalb der Verteilung werden zwei Besonderheiten deutlich. Zum Einen<br />
besteht eine starke Tendenz <strong>zur</strong> eher neutralen Mitte. Zum Anderen sind<br />
besonders die der Aussage eindeutig zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorien<br />
deutlich unterbesetzt. Insgesamt nehmen die Studierenden damit<br />
mehrheitlich nur eine partiell gute Unterstützung durch die Lehrenden wahr,<br />
während 42,9% der Befragten die Aussage eher und ganz ablehnen.<br />
Mit den Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden artikulieren 32,3% eine<br />
sehr hohe (Kategorie 5: 2,9%) und hohe (Kategorie 4: 29,4%)<br />
Zufriedenheit.<br />
98
Mit den Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden bin ich sehr zufrieden.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 13 47,6 -34,6<br />
überwiegend nicht 44 47,6 -3,6<br />
teilweise 104 47,6 56,4<br />
überwiegend 70 47,6 22,4<br />
voll 7 47,6 -40,6<br />
Gesamt 238<br />
Deutlich werden hierbei vor allem eine starke Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte<br />
und eine Unterfrequentierung der Extremantworten. Der Medianwert liegt<br />
bei 3.<br />
Hinsichtlich der Unterstützung innerhalb der Gruppe der Studierenden<br />
ergeben sich deutlich andere Werte. So st<strong>im</strong>men der Aussage, die<br />
Mitstudierenden haben eine gute Unterstützung geleistet, 67,6% der<br />
Befragten in vollem Maße (Kategorie 5: 21%) und überwiegend (Kategorie<br />
4: 46,6%) zu.<br />
Meine Mitstudierenden haben mich sehr gut unterstützt<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 3 47,6 -44,6<br />
überwiegend nicht 13 47,6 -34,6<br />
teilweise 61 47,6 13,4<br />
überwiegend 111 47,6 63,4<br />
voll 50 47,6 2,4<br />
Gesamt 238<br />
Die starke Unterfrequentierung der ablehnenden Antwortkategorie und die<br />
deutliche Überbesetzung des eher zust<strong>im</strong>menden Bereichs, verbunden mit<br />
einer nur sehr schwachen Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte zeigen deutlich an,<br />
dass die Studierenden eine gute Unterstützung durch die Mitstudierenden<br />
wahrnehmen. Der Median liegt bei 4.<br />
Die Unterstützung der allgemeinen <strong>Studien</strong>beratung wird wiederum nur von<br />
17% der Befragten als gut (Kategorie 5: 3%) und überwiegend gut<br />
(Kategorie:4: 14%) bezeichnet.<br />
99
Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 62 47,0 15,0<br />
überwiegend nicht 61 47,0 14,0<br />
teilweise 72 47,0 25,0<br />
überwiegend 33 47,0 -14,0<br />
voll 7 47,0 -40,0<br />
Gesamt 235<br />
Die die Aussage ablehnenden Antwortkategorien sind deutlich<br />
unterbesetzt, während eine erhebliche Überfrequentierung der Bereiche zu<br />
verzeichnen ist, die einer guten Unterstützung widersprechen. Der<br />
Medianwert liegt bei 2.<br />
Ein ähnliches Ergebnis erbringt die Auswertung der Antworten auf die<br />
Aussage, die Fachstudienberatung habe die Studierenden gut unterstützt.<br />
Hier st<strong>im</strong>men der Aussage 12% in vollem Maße (Kategorie 5: 1,7%) und<br />
überwiegend (Kategorie 4: 10,3%) zu.<br />
Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 65 46,4 18,6<br />
überwiegend nicht 58 46,4 11,6<br />
teilweise 81 46,4 34,6<br />
überwiegend 24 46,4 -22,4<br />
voll 4 46,4 -42,4<br />
Gesamt 232<br />
Hierbei wird wiederum eine deutliche Überfrequentierung der<br />
Antwortkategorien deutlich, die die Aussage ablehnen. Der Medianwert<br />
liegt auch hier bei 2.<br />
Statistik für Test<br />
Ich<br />
brauche<br />
keine<br />
Unterstütz<br />
ung<br />
Ich habe<br />
keine<br />
Unterstützung<br />
erfahren<br />
Chi-Quadrat 164,479 73,639<br />
Dozenten<br />
142,4<br />
20<br />
Mitstudierende<br />
155,2<br />
77<br />
Allgemei<br />
-ne<br />
<strong>Studien</strong>beratung<br />
Fachstudienberatung<br />
Kontakt<br />
möglichkeiten<br />
60,468 85,716 137,420<br />
df 4 4 4 4 4 4 4<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000<br />
Zu überprüfen ist zum Einen, ob sich die Beurteilungen hinsichtlich der<br />
Betreuung durch die einzelnen Personen und Institutionen signifikant<br />
100
voneinander unterscheiden und zum Anderen, ob und wie die einzelnen<br />
Aussagen in einem Zusammenhang stehen.<br />
Zunächst unterscheidet sich die Beurteilung der Betreuung durch die<br />
Lehrenden und durch die Allgemeine <strong>Studien</strong>beratung nicht signifikant<br />
voneinander: (Wilcoxon-Test, Z=-2,020, p=0,062)<br />
Ränge der Betreuung durch allgemeine <strong>Studien</strong>beratung und Dozenten<br />
Allgemeine <strong>Studien</strong>beratung<br />
und Dozenten<br />
N Mittlerer Rang Rangsumme<br />
Negative<br />
Ränge<br />
96(a) 80,93 7769,00<br />
Positive Ränge 66(b) 82,33 5434,00<br />
Bindungen<br />
73(c)<br />
Gesamt 235<br />
a Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt < Meine Dozenten haben<br />
mich sehr gut unterstützt<br />
b Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt > Meine Dozenten haben<br />
mich sehr gut unterstützt<br />
c Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt = Meine Dozenten haben<br />
mich sehr gut unterstützt<br />
Die Unterstützung durch die Fachstudienberatung wird hingegen signifikant<br />
schlechter beurteilt (Wilcoxon Test, Z=-2,935, p=0,003) als die durch die<br />
Lehrenden.<br />
Ränge der Betreuung durch Fachstudienberatung und Dozenten<br />
Fachstudienberatung<br />
und Dozenten<br />
Negative Ränge<br />
N Mittlerer Rang Rangsumme<br />
99(a) 78,00 7722,00<br />
Positive Ränge 57(b) 79,37 4524,00<br />
Bindungen<br />
76(c)<br />
Gesamt 232<br />
a Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt < Meine Dozenten haben mich<br />
sehr gut unterstützt<br />
b Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt > Meine Dozenten haben mich<br />
sehr gut unterstützt<br />
c Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt = Meine Dozenten haben mich<br />
sehr gut unterstützt<br />
Die Beurteilungen <strong>im</strong> Hinblick auf die Unterstützung durch die<br />
Fachstudienberatung und die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung unterscheiden<br />
sich jedoch nicht signifikant. (Wilcoxon Test, Z=-1,276, p=0,202)<br />
Die Beurteilung der Unterstützung durch Mitstudierenden hingegen<br />
unterscheidet sich auf einem Niveau von p
Ränge der Unterstützung durch die vier Bereiche<br />
Meine Dozenten haben mich sehr gut unterstützt<br />
Mittlerer Rang<br />
2,30<br />
Meine Mitstudierenden haben mich sehr gut<br />
unterstützt 3,59<br />
Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr<br />
gut unterstützt 2,10<br />
Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut<br />
unterstützt 2,02<br />
Statistik für Test (Friedman-Test)<br />
N 232<br />
Chi-Quadrat 286,577<br />
Df 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000<br />
Die Unterstützung durch die Studierenden selbst wird damit signifikant<br />
besser beurteilt als die Unterstützung durch die übrigen Personen und<br />
Institutionen.<br />
Die Prüfung von Zusammenhängen zwischen den einzelnen<br />
Einschätzungen zeigt folgende Ergebnisse:<br />
102
Korrelationen <strong>zur</strong> Unterstützungssituation<br />
Spearman-<br />
Rho<br />
Ich brauche<br />
keine<br />
Unterstützung.<br />
Ich habe<br />
keine<br />
Unterstützung<br />
erfahren.<br />
Dozenten<br />
Ich<br />
brauche<br />
keine<br />
Unterstützung<br />
Ich habe<br />
keine Unterstützung<br />
erfahren<br />
Dozenten<br />
Kommilitonen<br />
Allg.<br />
<strong>Studien</strong>beratung<br />
Fachstudienberatung<br />
Kontaktmöglichkeiten<br />
1,000 -,066 ,146 ,092 ,103 ,002 ,130<br />
,310 ,054 ,156 ,117 ,976 ,055<br />
1,000 -,073 -,232 -,038 -,022 -,102<br />
,259 ,000 ,563 ,734 ,116<br />
1,000 ,187 ,173 ,162 ,428<br />
,004 ,008 ,014 ,000<br />
Kommilitonen<br />
1,000 ,135 ,063 ,225<br />
,059 ,337 ,000<br />
Allg.<br />
<strong>Studien</strong>beratung<br />
1,000 ,627 ,191<br />
,000 ,003<br />
Fachstudienberatung<br />
1,000 ,142<br />
,030<br />
Kontaktmöglichkeiten<br />
1,000<br />
Aus den einzelnen Zusammenhängen wird zunächst deutlich, dass, je<br />
geringer die Unterstützung durch die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung beurteilt,<br />
auch die Unterstützung durch die Fachstudienberatung desto geringer<br />
bewertet wird. Des Weiteren hängt die Beurteilung der<br />
Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden mit der wahrgenommenen<br />
Unterstützung durch die Dozenten zusammen. Wer die<br />
Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden positiv beurteilt, bewertet auch die<br />
von den Lehrenden erhaltene Unterstützung positiv.<br />
Ein letztes Ergebnis ist aus der Tabelle hoch interessant. Je geringer die<br />
wahrgenommene Unterstützung durch die Mitstudierenden, desto stärker<br />
wird angegeben, keine Unterstützung erfahren zu haben.<br />
Da die Unterstützung eine wesentliche Ressource <strong>im</strong> Studium darstellt,<br />
wird auf der Basis des vorliegenden theoretischen Modells davon<br />
ausgegangen, dass diese Ressource einen wichtigen Beitrag <strong>zur</strong> Erklärung<br />
des Belastungsempfindens der Studierenden leistet. Aus den einzelnen<br />
Items, die die Unterstützung und Betreuung abbilden, wurde deshalb eine<br />
Skala gebildete, die folgende Reliabilitätswerte aufweist:<br />
103
Reliabilitätsstatistik: Unterstützungssituation<br />
Cronbachs<br />
Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,749 6<br />
Item-Skala-Statistik: Unterstützungssituation<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Meine Dozenten haben<br />
mich sehr gut unterstützt 14,0393 8,371 ,384 ,693<br />
Meine Mitstudierenden<br />
haben mich sehr gut<br />
unterstützt<br />
Die allgemeine<br />
<strong>Studien</strong>beratung hat mich<br />
sehr gut unterstützt<br />
Die Fachstudienberatung<br />
hat mich sehr gut<br />
unterstützt<br />
Mit den<br />
Kontaktmöglichkeiten zu<br />
den Lehrenden bin ich sehr<br />
zufrieden.<br />
12,8079 9,130 ,231 ,746<br />
14,2227 7,077 ,471 ,655<br />
14,2969 7,508 ,436 ,671<br />
13,5764 8,315 ,380 ,695<br />
Ich fühle mich an der Uni<br />
gut betreut 14,1790 9,227 ,336 ,713<br />
Im Anschluss wurde geprüft, ob die Skala von mehreren Faktoren geprägt<br />
wird. Hierzu wurde eine mit Var<strong>im</strong>ax rotierte Hauptkomponentenanalyse<br />
vorgenommen. Als Ergebnis muss eine zweifaktorielle Lösung (56,2%<br />
Gesamtvarianzerklärung, davon Faktor 1:29,21% und Faktor 2:26,99%)<br />
angenommen werden:<br />
104
Rotierte Komponentenmatrix(a) <strong>zur</strong> Unterstützungssituation<br />
Komponente<br />
1 2<br />
Ich fühle mich an der Uni<br />
gut betreut ,558 ,213<br />
Meine Dozenten haben<br />
mich sehr gut unterstützt ,766 ,067<br />
Meine Mitstudierenden<br />
haben mich sehr gut<br />
unterstützt<br />
Die allgemeine<br />
<strong>Studien</strong>beratung hat mich<br />
sehr gut unterstützt<br />
Die Fachstudienberatung<br />
hat mich sehr gut<br />
unterstützt<br />
Mit den<br />
Kontaktmöglichkeiten zu<br />
den Lehrenden bin ich sehr<br />
zufrieden.<br />
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.<br />
,461 ,086<br />
,161 ,878<br />
,107 ,888<br />
,777 ,044<br />
Die Faktoren bilden damit die allgemeine Unterstützung und Betreuung<br />
(Faktor 1) und die institutionalisierte Unterstützung und Betreuung (Faktor<br />
2) ab.<br />
105
7 <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Hinsichtlich der <strong>Studien</strong>erwartungen wurden den Studierenden 12 Items<br />
vorgelegt, die jeweils eine Erwartung an das Studium thematisierten. Die<br />
einzelnen Items wurden in Anlehnung an BACHMANN et al. (1999, S.<br />
210ff.) formuliert und skaliert, jedoch inhaltlich an die Gegebenheiten des<br />
Lehramtsstudienganges angepasst.<br />
Die Befragten sollten angeben, in welchem Maße sie den jeweiligen Aspekt<br />
von ihrem Studium erwartet haben. Daneben wurde erfragt, in welchem<br />
Maße diese Erwartung erfüllt wurde und in welchem Grad sich die<br />
Studierenden hierdurch belastet fühlen. Einen ersten Überblick liefern die<br />
nachfolgenden Tabellen:<br />
Statistik zu den <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Möglichkeit<br />
Freundschaft<br />
- liche<br />
Atmosphäre<br />
der<br />
persönlichen<br />
Weiterentwicklung<br />
Fundiertes<br />
Fachwissen<br />
Klare<br />
Leistungsanforderungen<br />
N Gültig 239 238 238 239<br />
Fehlend 39 40 40 39<br />
Mittelwert 3,2385 3,2185 3,3992 2,6485<br />
Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,54775 ,57603 ,58490 ,82114<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00 2,00 2,00 1,00<br />
Max<strong>im</strong>um 4,00 4,00 4,00 5,00<br />
Statistik zu den <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Gute<br />
Betreuung Praxisbezug<br />
Wahlmöglichkeiten<br />
Hohes<br />
wissenschaftliches<br />
Niveau<br />
N Gültig 238 237 234 235<br />
Fehlend 40 41 44 43<br />
Mittelwert 2,4622 2,7637 2,5726 3,3277<br />
Median 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,69707 ,94054 ,82677 ,65297<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Max<strong>im</strong>um 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
106
Statistik zu den <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Vermittlung<br />
komm. und<br />
kooper.<br />
Fähigkeiten<br />
Möglichkeiten<br />
<strong>zur</strong> eigenen<br />
inhaltlichen<br />
und zeitlichen<br />
Planung<br />
Klare<br />
<strong>Studien</strong>struktur<br />
Regelmäßige<br />
Überprüfung<br />
der Leistung<br />
N Gültig 236 236 236 236<br />
Fehlend 42 42 42 42<br />
Mittelwert 2,8136 2,8347 2,6356 2,6949<br />
Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,78224 ,90048 ,92405 ,85062<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Max<strong>im</strong>um 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
Unter Beachtung der Skalierung der Items (1=trifft gar nicht zu, 4=trifft voll<br />
zu) kann zunächst gesagt werden, dass Mittelwerte über 2,5 als<br />
Zust<strong>im</strong>mung <strong>zur</strong> Aussage aufgefasst werden können, während darunter<br />
liegende Werte angeben, dass diese Erwartung an das Studium eher nicht<br />
bestanden hat.<br />
Aus den Tabellen wird zunächst deutlich, dass alle genannten Aspekte<br />
zunächst als Erwartungen für das Studium relevant sind. In besonderem<br />
Maße werden vom Studium jedoch Aspekte erwartet, die die direkte<br />
universitäre Ausbildung betreffen:<br />
eine hohe fachwissenschaftliche<br />
Ausbildung und die Vermittlung fundierten Fachwissens sowie<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen Weiterentwicklung für die Studierenden. Die<br />
hohen Mittelwerte auf die entsprechenden Items geben zusammen mit<br />
einer relativ geringen Streuung an, dass in dieser Hinsicht relativ einheitlich<br />
die höchsten Erwartungen an das Studium gestellt werden. Ähnlich hohe<br />
Erwartungen werden <strong>im</strong> Hinblick auf eine freundschaftliche Atmosphäre<br />
unter den Studierenden artikuliert.<br />
Leistungsklarheit, Praxisbezug, transparente <strong>Studien</strong>strukturen, individuelle<br />
Möglichkeiten der <strong>Studien</strong>gestaltung und Erwartungen an indirekte<br />
Lehrinhalte werden zwar ebenso von einem universitären Studium erwartet,<br />
die Mittelwerte auf die Items sind aber bei einer größeren Streuung deutlich<br />
geringer ausgeprägt als die für die direkten Lehrinhalte.<br />
Betrachtet man die Erwartungen innerhalb einer Rangliste, ergibt sich<br />
folgendes Bild:<br />
107
Tabelle: Erwartungen an das Studium (N=239)<br />
Erwartungen (st<strong>im</strong>me voll und eher zu)<br />
Studierende<br />
Sympathische Atmosphäre unter den Studierenden 95,0%<br />
Vermittlung fundierten Fachwissens 95,0%<br />
Hohes wissenschaftliches Niveau 93,2%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen Weiterentwicklung 92,0%<br />
Vermittlung kommunikativer und kooperativer 68,8%<br />
Fähigkeiten<br />
Klare <strong>Studien</strong>struktur 62,7%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> eigenen Planung 61,0%<br />
Praxisbezug 57,4%<br />
Regelmäßige Leistungsüberprüfungen 56,4%<br />
Klarheit über geforderte Leistungen 54,4%<br />
Wahlmöglichkeiten 53,4%<br />
Gute Betreuung 47,9%<br />
Aus diesen Werten kann die obige Aussage nochmals bekräftigt werden,<br />
dass mit einem universitären Studium vor allem hohe inhaltliche Ansprüche<br />
verbunden werden und eine freundschaftliche Atmosphäre unter den<br />
Studierenden von nahezu allen Befragen erwartet wird. Ebenso wird vom<br />
Studium in Bezug auf die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten fast einmütig<br />
ein hoher Effekt erwartet. Die anderen Aspekte werden von deutlich<br />
weniger Studierenden als Erwartungen an das Studium formuliert, wobei<br />
eine gute Betreuung sogar mehrheitlich eher nicht oder gar nicht erwartet<br />
wird.<br />
Daneben ist von Interesse, in welchem Maße die Erwartungen dann auch<br />
in der Wahrnehmung der Befragten tatsächlich erfüllt wurden. Die<br />
nachfolgende Tabelle zeigt zunächst an, wie die einzelnen Erwartungen<br />
innerhalb der <strong>Studien</strong>anfangszeit als erfüllt angesehen werden:<br />
108
Tabelle: Erwartungen an das Studium wurden erfüllt (N=239)<br />
Erwartungen wurden erfüllt (st<strong>im</strong>me voll und Studierende<br />
eher zu)<br />
Sympathische Atmosphäre unter den Studierenden 94,2%<br />
Vermittlung fundierten Fachwissens 84,4%<br />
Hohes wissenschaftliches Niveau 89,4%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen Weiterentwicklung 81,6%<br />
Vermittlung kommunikativer und kooperativer 59,0%<br />
Fähigkeiten<br />
Klare <strong>Studien</strong>struktur 44,2%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> eigenen Planung 58,8%<br />
Praxisbezug 44,4%<br />
Regelmäßige Leistungsüberprüfungen 75,2%<br />
Klarheit über geforderte Leistungen 34,6%<br />
Wahlmöglichkeiten 52,0%<br />
Gute Betreuung 48,9%<br />
Aus der Tabelle geht hervor, dass die einzelnen Erwartungen in sehr<br />
unterschiedlichem Maße als <strong>im</strong> Studium erfüllt betrachtet werden.<br />
Mehrheitlich werden jedoch die Studierenden enttäuscht, die eine klare<br />
<strong>Studien</strong>struktur, den Praxisbezug des Studiums, die Klarheit der<br />
geforderten Leistungen und eine gute Betreuung durch die Universität<br />
erwartet haben. Dabei nehmen die Transparenzaspekte des Studiums eine<br />
exponierte Stellung ein. Hier werden diejenigen, die dies vom Studium in<br />
hohem Maße erwartet haben, stark enttäuscht. Dem gegenüber werden die<br />
Erwartungen hinsichtlich der wissenschaftlichen und inhaltlichen<br />
Fundierung der Ausbildung, der Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen<br />
Weiterentwicklung sowie der freundschaftlichen Atmosphäre unter den<br />
Studierenden mehrheitlich als erfüllt wahrgenommen.<br />
109
8 <strong>Studien</strong>alltag und –realität<br />
Die Studierenden wurden in einem breit angelegten Teil der Befragung<br />
gebeten, verschiedene Aspekte ihres Studiums einzuschätzen und zu<br />
artikulieren, in welchem Maße sie sich hierdurch belastet fühlen. Dabei<br />
wurden die einzelnen Aspekte an jenen Stellen, wo sie sich auf die<br />
einzelnen Fachrichtungen beziehen lassen, auf das erste und das zweite<br />
studierte Fach bzw. auf die Erziehungswissenschaft aufgegliedert. Die<br />
einzelnen Items wurden in Anlehnung an BACHMANN et al. (1999, S.<br />
215ff.) formuliert und skaliert, jedoch inhaltlich an die Gegebenheiten des<br />
Lehramtsstudienganges angepasst.<br />
8.1 <strong>Studien</strong>anforderungen<br />
59,7% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage „Die <strong>Studien</strong>anforderungen in<br />
meinem ersten studierten Fach sind zu hoch“ eher (39,8%) oder in vollem<br />
Maße (19,9%) zu. Detailliert ergibt sich folgendes Bild:<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen in meinem ersten Fach sind zu hoch. (Chi²=80,58, df=3,<br />
p
Die Statistik zeigt deutlich an, dass die belastenden Effekte, die von der<br />
Höhe der inhaltlichen Anforderungen <strong>im</strong> ersten Fach ausgehen, deutlich<br />
überwiegen.<br />
Werden nur diejenigen Studierenden ausgewählt, die der Aussage über zu<br />
hohe Anforderungen eher bzw. in vollem Maße zust<strong>im</strong>men, so ergeben<br />
sich folgende Werte:<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong> ersten Fach erlebe ich als Belastung (Auswahl der<br />
Befragten, die der Aussage zust<strong>im</strong>men)<br />
Gültige Kumulierte<br />
Häufigkeit Prozent Prozente Prozente<br />
Gültig trifft gar nicht zu 2 1,4 1,4 1,4<br />
trifft eher nicht zu 14 9,9 9,9 11,3<br />
trifft eher zu 69 48,9 48,9 60,3<br />
trifft voll zu 56 39,7 39,7 100,0<br />
Gesamt 141 100,0 100,0<br />
88,6% derjenigen Studierenden, die die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong> ersten<br />
Fach für zu hoch erachten, nehmen hiervon entsprechende belastende<br />
Wirkungen wahr, während bei denjenigen, die die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong><br />
ersten Fach für eher nicht zu hoch erachten, ein konträres Bild sichtbar<br />
wird:<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong> ersten Fach erlebe ich als Belastung (Auswahl der<br />
Befragten, die der Aussage nicht zust<strong>im</strong>men)<br />
Gültige Kumulierte<br />
Häufigkeit Prozent Prozente Prozente<br />
Gültig trifft gar nicht zu 9 9,5 9,7 9,7<br />
trifft eher nicht zu 64 67,4 68,8 78,5<br />
trifft eher zu 17 17,9 18,3 96,8<br />
trifft voll zu 3 3,2 3,2 100,0<br />
Gesamt 93 97,9 100,0<br />
Damit ergibt sich hier ein studienfachgebundener Belastungsfaktor.<br />
Die Beurteilung der Höhe der Anforderungen für das erste studierte Fach<br />
steht in einem signifikanten Zusammenhang zu folgenden Fächern:<br />
111
Übersicht: Zu hohe Anforderungen (1. Fach) in Abhängigkeit vom studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chiquadrat<br />
df Asym. Eta<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Signifi-<br />
kanz<br />
Mathematik<br />
X 25,568 3
Die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong> zweiten Fach erlebe ich als Belastung (Auswahl der<br />
Befragten, die der Aussage zust<strong>im</strong>men)<br />
Gültig<br />
Häufigkeit<br />
Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
trifft gar nicht zu 3 2,1 2,1 2,1<br />
trifft eher nicht zu 21 14,6 14,7 16,8<br />
trifft eher zu 68 47,2 47,6 64,3<br />
trifft voll zu 51 35,4 35,7 100,0<br />
Gesamt 143 99,3 100,0<br />
83,3% der Befragten, die die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong> zweiten Studierten<br />
Fach als zu hoch bewerteten, nehmen hiervon entsprechend belastende<br />
Effekte wahr, während diejenigen, die die Höhe der <strong>Studien</strong>anforderungen<br />
als nicht zu hoch einschätzen, hiervon wesentlich geringer belastende<br />
Effekte wahrnehmen.<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen <strong>im</strong> zweiten Fach erlebe ich als Belastung (Auswahl der<br />
Befragten, die der Aussage nicht zust<strong>im</strong>men)<br />
Gültige Kumulierte<br />
Häufigkeit Prozent Prozente Prozente<br />
Gültig trifft gar nicht zu 19 21,3 21,8 21,8<br />
trifft eher nicht zu 58 65,2 66,7 88,5<br />
trifft eher zu 9 10,1 10,3 98,9<br />
trifft voll zu 1 1,1 1,1 100,0<br />
Gesamt 87 97,8 100,0<br />
Fachspezifische Beurteilungen sind signifikant nur für das Fach Mathematik<br />
messbar. Hier ist die Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage, die Anforderungen<br />
seien zu hoch, signifikant höher (Chi-Quadrat 31,751, df=6, p
Wird die Grenze zwischen Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage auf der vierstufigen<br />
Antwortskala bei 2,5 angesetzt, so kann damit gesagt werden, dass die<br />
Studierenden durchschnittlich die inhaltlichen Anforderungen in beiden<br />
studierten Fächern als zu hoch einschätzen und hiervon ausgehende<br />
<strong>Belastungen</strong> wahrnehmen. Grundsätzlich ist damit in der Höhe der<br />
inhaltlichen Anforderungen der studierten Fächer, so wie sie durch die<br />
Studierenden wahrgenommen wird, ein Belastungsfaktor zu sehen.<br />
Ein gänzlich verändertes Bild wird deutlich, wenn die Höhe der<br />
Anforderungen in Erziehungswissenschaft beurteilt wird:<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen in Erziehungswissenschaft sind zu hoch<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 21 58,8 -37,8<br />
trifft eher nicht zu 156 58,8 97,3<br />
trifft eher zu 54 58,8 -4,8<br />
trifft voll zu 4 58,8 -54,8<br />
Gesamt 235<br />
Durch die starke Unterfrequentierung der voll zust<strong>im</strong>menden Zelle wird<br />
bereits deutlich, dass hier überhöhte Anforderungen in vergleichsweise<br />
geringer Anzahl wahrgenommen werden. Dementsprechend st<strong>im</strong>men auch<br />
nur 24,7% der Aussage, die Anforderungen in Erziehungswissenschaft sind<br />
zu hoch, eher (23%) und voll (1,7%) zu. Belastende Effekte werden hiervon<br />
nur durch eine geringe Zahl Studierender wahrgenommen.<br />
Die Anforderungssituation in Erziehungswissenschaft erlebe ich als Belastung<br />
(Chi²=236,643, df=3, p
Statistik zu Anforderungen in Erziehungswissenschaft<br />
Anforderungen<br />
in Erziehungswissenschaft<br />
sind zu hoch<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
N Gültig 235 234<br />
Fehlend 43 44<br />
Mittelwert 2,1745 2,0342<br />
Median 2,0000 2,0000<br />
Standardabweichung ,59860 ,69864<br />
Durchschnittlich werden damit die inhaltlichen Anforderungen in der<br />
Erziehungswissenschaft als eher nicht zu hoch eingeschätzt, wobei hiervon<br />
auch in vergleichsweise geringem Umfang belastende Effekte ausgehen.<br />
Die studierten Fächer sind damit als best<strong>im</strong>mende Belastungsfaktoren auf<br />
dem Gebiet der inhaltlichen <strong>Studien</strong>anforderungen zu bezeichnen.<br />
Die Einschätzung der inhaltlichen Anforderungen korreliert in den<br />
genannten Bereichen kaum. Die Stärken der Korrelationen liegen zwischen<br />
r=0,073 und r=0,21 und werden auf dem Niveau von 0,01 nicht signifikant.<br />
Es kann damit nicht gesagt werden, dass die inhaltlichen Anforderungen<br />
von einer Anzahl Studierender generell in allen Bereichen als zu hoch<br />
eingeschätzt werden.<br />
8.2 Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen<br />
Die Klarheit über die Struktur des Studiums und die zu erbringenden<br />
Leistungen wurden bereits als kritische Punkte hinsichtlich der Erfüllung der<br />
<strong>Studien</strong>erwartungen dargestellt. In einem weiteren Punkt wurden die<br />
Befragten gebeten anzugeben, in welchem Maße sie der Aussage, „Die<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen sind klar und transparent.“, zust<strong>im</strong>men.<br />
Im ersten studierten Fach st<strong>im</strong>mt eine Mehrheit von 61,3% der Befragten<br />
der Aussage eher (47,7%) und voll (13,6%) zu. Detailliert ergibt sich<br />
folgendes Antwortverhalten:<br />
Die <strong>Studien</strong>bedingungen in meinem ersten Fach sind klar und transparent.<br />
Beobachtetes<br />
N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 17 58,8 -41,8<br />
trifft eher nicht zu 74 58,8 15,3<br />
trifft eher zu 112 58,8 53,3<br />
trifft voll zu 32 58,8 -26,8<br />
Gesamt 235<br />
Zunächst wird ersichtlich, dass die extremen Antwortpole deutlich<br />
unterbesetzt sind. Die obigen prozentualen Werte ergeben sich jedoch aus<br />
115
der vergleichsweise hohen Anzahl derjenigen, die der These eher<br />
zust<strong>im</strong>men.<br />
Die Beurteilung der <strong>Studien</strong>bedingungen als transparent bildet keinen<br />
messbaren Zusammenhang zu einem best<strong>im</strong>mten studierten Fach.<br />
Bei der Auswahl der Studierenden, die der Aussage eher nicht und gar<br />
nicht zugest<strong>im</strong>mt haben, ergeben sich folgende Werte für die<br />
Belastungswahrnehmung durch die so konstatierte fehlende Transparenz:<br />
Die Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen <strong>im</strong> ersten Fach erlebe ich als Belastung<br />
(Auswahl der Befragten, die der Aussage nicht zust<strong>im</strong>men)<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
Gültig trifft gar nicht zu 5 5,5 5,5 5,5<br />
trifft eher nicht zu 19 20,9 20,9 26,4<br />
trifft eher zu 52 57,1 57,1 83,5<br />
trifft voll zu 15 16,5 16,5 100,0<br />
Gesamt 91 100,0 100,0<br />
Damit wird deutlich, dass 73,6% derjenigen, die die <strong>Studien</strong>bedingungen <strong>im</strong><br />
ersten studierten Fach als eher intransparent bezeichnen, hiervon<br />
ausgehende belastende Effekte wahrnehmen.<br />
Ähnlich gestaltet sich das Bild hinsichtlich der Klarheit der<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen <strong>im</strong> zweiten studierten Fach. Hier st<strong>im</strong>men 57,5% einer<br />
entsprechenden Aussage eher (46,8%) bzw. in vollen Maße (10,7%) zu.<br />
Die <strong>Studien</strong>bedingungen in meinem zweiten Fach sind klar und transparent<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 25 58,3 -33,3<br />
trifft eher nicht zu 74 58,3 15,8<br />
trifft eher zu 109 58,3 50,8<br />
trifft voll zu 25 58,3 -33,3<br />
Gesamt 233<br />
Auch hier sind die extremen Antwortkategorien deutlich unterbesetzt,<br />
jedoch st<strong>im</strong>mt eine klare Mehrheit der Befragten der Aussage eher zu,<br />
sodass die <strong>Studien</strong>bedingungen <strong>im</strong> zweiten studierten Fach mehrheitlich<br />
als eher transparent wahrgenommen werden. Für 43,3% gehen hiervon<br />
belastende Effekte aus. Wählt man für die Analyse wiederum nur<br />
diejenigen aus, die der Aussage nach transparenten <strong>Studien</strong>bedingungen<br />
eher nicht zust<strong>im</strong>men, so fühlen sich 70,4% der Studierenden hierdurch<br />
belastet. Die detaillierte Antwortverteilung der ausgewählten Studierenden<br />
stellt die nachfolgende Tabelle dar.<br />
116
Die Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen <strong>im</strong> zweiten Fach erlebe ich als Belastung<br />
(Auswahl der Befragten, die der Aussage nicht zust<strong>im</strong>men)<br />
Gültige Kumulierte<br />
Häufigkeit Prozent Prozente Prozente<br />
Gültig trifft gar nicht zu 9 9,1 9,2 9,2<br />
trifft eher nicht zu 20 20,2 20,4 29,6<br />
trifft eher zu 48 48,5 49,0 78,6<br />
trifft voll zu 21 21,2 21,4 100,0<br />
Gesamt 98 99,0 100,0<br />
Damit wird deutlich, dass die wahrgenommenen <strong>Studien</strong>bedingungen in<br />
den studierten Fächern zwar mehrheitlich als transparent wahrgenommen<br />
werden, jedoch ein erheblicher Prozentsatz an Studierenden diese<br />
Transparenz zumindest teilweise vermisst. Die fehlende Transparenz stellt<br />
zudem in Bezug auf beide studierte Fächer einen Belastungsfaktor für die<br />
Studierenden dar.<br />
Hinsichtlich der Erziehungswissenschaft bezeichnen 67,6% der befragten<br />
Studierenden die <strong>Studien</strong>bedingungen als eher (50,6%) oder in vollem<br />
Maße (17%) transparent. Im Detail stellt sich folgendes Antwortverhalten<br />
auf das entsprechende Item dar:<br />
Die <strong>Studien</strong>bedingungen in Erziehungswissenschaft sind klar und transparent.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 8 58,8 -50,8<br />
trifft eher nicht zu 68 58,8 9,3<br />
trifft eher zu 119 58,8 60,3<br />
trifft voll zu 40 58,8 -18,8<br />
Gesamt 235<br />
Innerhalb dieser Werte fällt besonders die deutliche Unterfrequentierung<br />
der die Aussage gänzlich ablehnenden Antwortkategorie auf. Dennoch ist<br />
auch für die <strong>Studien</strong>bedingungen in Erziehungswissenschaft zu<br />
konstatieren, dass hier eine vollständige Transparenz des Studiums nicht<br />
hergestellt werden konnte. Wenn wiederum nur diejenigen Studierenden,<br />
die der Aussage nach transparenten <strong>Studien</strong>bedingungen in<br />
Erziehungswissenschaft eher oder gar nicht zust<strong>im</strong>men, ausgewählt<br />
werden, so ergeben sich folgende Wert für die Belastung:<br />
117
Die Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen in Erziehungswissenschaft erlebe ich als<br />
Belastung (Auswahl der Befragten, die der Aussage nicht zust<strong>im</strong>men)<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
Gültig trifft gar nicht zu 3 3,9 3,9 3,9<br />
trifft eher nicht zu 18 23,7 23,7 27,6<br />
trifft eher zu 45 59,2 59,2 86,8<br />
trifft voll zu 10 13,2 13,2 100,0<br />
Gesamt 76 100,0 100,0<br />
Demnach gehen für 72,4% der Befragten von den als weniger oder gar<br />
nicht als transparent wahrgenommenen <strong>Studien</strong>bedingungen belastende<br />
Effekte aus.<br />
Betrachtet man die Mittelwerte der einzelnen Items ergeben sich folgende<br />
Werte:<br />
Statistik <strong>zur</strong> Transparenzeinschätzung der <strong>Studien</strong>bedingungen<br />
Transparenz<br />
1.<br />
Fach<br />
Dies<br />
erlebe ich<br />
als<br />
Belastung<br />
Transparenz<br />
2.<br />
Fach<br />
Dies<br />
erlebe ich<br />
als<br />
Belastung<br />
Transparenz<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Dies<br />
erlebe ich<br />
als<br />
Belastung<br />
Mittelwert 2,6766 2,3247 2,5751 2,4026 2,8128 2,2275<br />
Median 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000<br />
Standardab<br />
weichung<br />
,79909 ,88133 ,82246 ,88847 ,75039 ,82249<br />
Durchschnittlich st<strong>im</strong>men die Studierenden der Aussage nach<br />
transparenten <strong>Studien</strong>bedingungen eher zu, da die Grenze zwischen<br />
ablehnenden und zust<strong>im</strong>menden Antworten bei 2,5 zu setzen ist. Die<br />
Mittelwerte liegen aber zum einen relativ nah an dieser Grenze und streuen<br />
zum anderen bis zu ,823 um diesen Mittelwert. Dabei ist die Zust<strong>im</strong>mung<br />
zu transparenten <strong>Studien</strong>bedingungen in Erziehungswissenschaft<br />
durchschnittlich am höchsten. Dennoch wird auch hier keine vollständige<br />
Transparenz wahrgenommen. Daneben gehen von der Transparenz der<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen durchschnittlich eher kaum belastende Faktoren aus.<br />
Wird jedoch die Transparenz eher weniger wahrgenommen, so nehmen<br />
diejenigen auch belastende Effekte hiervon sowohl innerhalb der Fächer<br />
als auch innerhalb der Erziehungswissenschaft wahr.<br />
Auch hier wurden die Korrelationen zwischen der<br />
Transparenzwahrnehmung in drei Bereichen gerechnet. Die Korrelationen<br />
ergeben dabei Werte zwischen r=.009 und r=.019 und werden auf den<br />
Niveau von p=0,01 nicht signifikant. Damit kann kein generalisierter Blick<br />
auf die Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen konstatiert werden, sodass<br />
118
nicht gesagt werden kann, dass eine Gruppe von Studierenden generell die<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen für intransparent hält. Darüber hinaus ergeben sich<br />
keine fachspezifischen Implikationen<br />
8.3 Strukturierungsgrad des Studiums<br />
Die Studierenden wurden hier in 2 Items gebeten anzugeben, in welchem<br />
Maße sie der Aussage „Der <strong>Studien</strong>verlauf ist stark strukturiert und<br />
größtenteils vorgegeben“ für ihr erstes und zweites studiertes Fach sowie<br />
die Erziehungswissenschaft zust<strong>im</strong>men. In dieser Hinsicht sollten sie<br />
anschließend wiederum spezifiziert auf die Fächer angeben, in welchem<br />
Maße sie diese strukturellen Vorgaben als Belastung wahrnehmen und wie<br />
flexibel sie ihren Stundenplan gestalten konnten.<br />
Für das erste studierte Fach ergeben sich folgende Aussagen:<br />
78,8% der befragten Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage eines größtenteils<br />
vorgebenden und stark strukturierten Studiums eher (44,9%) oder voll<br />
(33,9%) zu. Einen Überblick über das Antwortverhalten vermittelt<br />
nachfolgende Tabelle:<br />
Der <strong>Studien</strong>verlauf <strong>im</strong> ersten Fach ist größtenteils vorgegeben und stark strukturiert<br />
(Chi²=97,661, df=3, p
kanz<br />
Mathematik<br />
Geschichte<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Quadrat<br />
Übersicht: Hohe vorgebende Struktur des Studiums in Abhängigkeit vom studierten<br />
Fach (beide Fächer)<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Signifi-<br />
X 19,78 3
Der <strong>Studien</strong>verlauf in Erziehungswissenschaft ist größtenteils vorgegeben und stark<br />
strukturiert (Chi²=138,746, df=3, p
ausgehenden Belastung nicht gemessen werden. Detailliert ergeben sich<br />
folgende Werte für die Zusammenhangsmaße:<br />
Korrelationen des wahrgenommenen Strukturierungsgrades des Studiums mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Struktur<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Spearmen- Struktur<br />
Struktur<br />
Rho 1. Fach<br />
2. Fach<br />
Struktur 1.<br />
Fach 1 -,116 ,388 ,033 ,200 -,136<br />
,077 ,000 ,627 ,002 ,039<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
1 ,040 ,331 -,037 ,335<br />
,545 ,000 ,580 ,000<br />
Struktur 2.<br />
Fach 1 -,026 ,135 ,022<br />
,693 ,041 ,747<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
1 -,156 ,256<br />
,020 ,000<br />
Struktur<br />
Erziehungswissenschaft<br />
1 -,145<br />
,028<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
1<br />
Aus den Werten geht hervor, dass der wahrgenommene Grad der<br />
Strukturiertheit des Studiums in den studierten Fächern und in<br />
Erziehungswissenschaft auf einem Niveau von p=0.01 hoch signifikant<br />
miteinander korreliert. Je höher die Strukturiertheit des Studiums in dem<br />
einen Fach wahrgenommen wird, desto höher wird dieser<br />
Strukturierungsgrad auch in dem anderen studierten Fach und in<br />
Erziehungswissenschaft gesehen. Dabei ist die Zusammenhangsstärke<br />
zwischen den studierten Fächern deutlich höher als zwischen den Fächern<br />
und der Erziehungswissenschaft. Ebenso ergeben sich hinsichtlich der<br />
Wahrnehmung von hiervon ausgehenden belastenden Effekten<br />
Zusammenhänge. Wer belastende Effekte vom Strukturierungsgrad <strong>im</strong><br />
122
ersten Fach wahrn<strong>im</strong>mt, konstatiert diese Effekte auch in Bezug auf das<br />
zweite Fach und die Erziehungswissenschaft. Auch die hier ermittelten<br />
Zusammenhänge sind auf dem Niveau von p=0,01 hoch signifikant und in<br />
ähnlich hoher Zusammenhangsstärke. Interessant ist jedoch ein<br />
Zusammenhang, der nicht gemessen werden konnte.<br />
Die Korrelationen zwischen dem eingeschätzten Grad der Strukturierung<br />
und der Vorgaben des Studiums einerseits und dem Belastungsempfinden<br />
andererseits werden in allen drei Bereichen auf dem Niveau von p=0,01<br />
nicht signifikant. Die Aussage, je stärker der Studierende den<br />
Strukturierungsgrad des Studiums wahrn<strong>im</strong>mt, desto stärker sieht er<br />
hiervon ausgehende belastende Effekte und umgekehrt, darf also nicht<br />
angestellt werden.<br />
In ähnliche Richtung zielt ein Item, durch das die Studierenden dazu<br />
aufgefordert wurden anzugeben, in welchem Maße sie der Aussage: „Ich<br />
konnte meinen Stundenplan sehr flexibel zusammenstellen.“ zust<strong>im</strong>men.<br />
Gleichzeitig sollten die Studierenden die Belastung einschätzen, die von<br />
dieser mehr oder weniger vorhandenen Flexibilität bei der<br />
Stundenplangestaltung für sie ausgeht.<br />
30,1% der Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage einer hohen Flexibilität bei<br />
der Stundenplanzusammenstellung in vollem Maße (5,1%) oder eher (25%)<br />
zu. Dabei nehmen 50% hiervon ausgehende belastende Effekte wahr. Im<br />
Detail ergeben sich die folgenden Werte:<br />
Ich konnte meinen Stundenplan sehr flexibel zusammenstellen<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 45 59,0 -14,0<br />
trifft eher nicht zu 120 59,0 61,0<br />
trifft eher zu 59 59,0 ,0<br />
trifft voll zu 12 59,0 -47,0<br />
Gesamt 236<br />
Die Flexibilität bei der Stundenplanerstellung erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 40 58,0 -18,0<br />
trifft eher nicht zu 76 58,0 18,0<br />
trifft eher zu 90 58,0 32,0<br />
trifft voll zu 26 58,0 -32,0<br />
Gesamt 232<br />
123
Teststatistik<br />
Hohe Flexibilität<br />
Dies erlebe ich als Belastung<br />
Chi-Quadrat 103,831 46,483<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Die deutliche Unterbesetzung der Zelle, die eine volle Zust<strong>im</strong>mung zu einer<br />
hohen Flexibilität bei der Stundenplanzusammenstellung beinhaltet zeigt<br />
zunächst zusammen mit einer deutlichen Überfrequentierung der die<br />
Aussage eher ablehnenden Zelle an, dass eine hohe Flexibilität hier eher<br />
nicht konstatiert wird. Gleichzeitig kann das Belastungsempfinden als<br />
ambivalent bezeichnet werden. Nähere Aufschlüsse liefert eine Analyse der<br />
bestehenden Zusammenhänge:<br />
Korrelationen der Flexibilität bei der Stundenplanerstellung mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Hohe Flexibilität<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Dies erlebe<br />
Hohe<br />
Flexibilität<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Spearmen-Rho 1 -,460<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Spearmen-Rho -,460 1<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Zwischen dem Ausmaß der Zust<strong>im</strong>mung zu einer hohen Flexibilität bei der<br />
Stundenplanerstellung und der Zust<strong>im</strong>mung zu hiervon ausgehenden<br />
wahrgenommenen Effekten besteht damit ein auf dem Niveau von p=0,01<br />
hoch signifikanter negativer linearer Zusammenhang. Dies bedeutet, je<br />
höher der Grad der Flexibilität in der Stundenplangestaltung, desto geringer<br />
ist der Grad der wahrgenommenen Belastung, der hiervon ausgeht. Da<br />
jedoch mehrheitlich ein eher geringerer Grad an Flexibilität festgestellt<br />
wurde, sind hiervon ausgehende belastende Effekte von Bedeutung.<br />
Hinsichtlich der Flexibilität der Stundenplangestaltung, belastenden<br />
Effekten und dem Strukturierungsgrad des Studiums konnten keine<br />
signifikanten Korrelationen gemessen werden.<br />
124
Korrelationen des Strukturierungsgrades des <strong>Studien</strong>verlaufs mit der Flexibilität der<br />
Stundenplangestaltung i.V.m. dem individuellen Belastungsempfinden<br />
Der <strong>Studien</strong>verlauf ist<br />
größtenteils vorgegeben<br />
und stark strukturiert 1.<br />
Fach<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Der <strong>Studien</strong>verlauf ist<br />
größtenteils vorgegeben<br />
und stark strukturiert 2.<br />
Fach<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Der <strong>Studien</strong>verlauf ist<br />
größtenteils vorgegeben<br />
und stark strukturiert<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Spearmen-Rho<br />
Ich konnte<br />
meinen<br />
Stundenplan<br />
sehr flexibel<br />
zusammenstellen<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
-,076 -,007<br />
Signifikanz (2-seitig) ,248 ,911<br />
Spearmen-Rho<br />
-,096 ,202<br />
Signifikanz (2-seitig) ,146 ,002<br />
Spearmen-Rho<br />
-,023 -,017<br />
Signifikanz (2-seitig) ,729 ,802<br />
Spearmen-Rho<br />
-,060 ,123<br />
Signifikanz (2-seitig) ,369 ,066<br />
Spearmen-Rho<br />
,033 ,114<br />
Signifikanz (2-seitig) ,618 ,084<br />
Spearmen-Rho<br />
-,076 -,021<br />
Signifikanz (2-seitig) ,250 ,757<br />
8.4 Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium<br />
Den Studierenden wurde die Aussage: „Der Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium ist<br />
sehr hoch.“ vorgegeben und erfragt, in welchem Maße sie dieser Aussage<br />
für ihre beiden studierten Fächer und für ihr erziehungswissenschaftliches<br />
Studium zust<strong>im</strong>mten. Für das erste studierte Fach ergeben sich folgende<br />
Werte: 74,6 % der Befragten st<strong>im</strong>mten der Aussage in vollem Maße<br />
(44,5%) oder eher (30,1%) zu. Im Einzelnen wurden folgende Antworten<br />
gegeben:<br />
Der Selektionsdruck <strong>im</strong> ersten Fach ist sehr hoch<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 8 59,0 -51,0<br />
trifft eher nicht zu 52 59,0 -7,0<br />
trifft eher zu 71 59,0 12,0<br />
trifft voll zu 105 59,0 46,0<br />
Gesamt 236<br />
125
Die Zellen, die Antworten beinhalten, die die Aussage voll oder eher<br />
ablehnen sind deutlich unterbesetzt. Besonders bei der die Aussage<br />
vollständig ablehnenden Antwortkategorie wird eine starke<br />
Unterfrequentierung deutlich, während die zust<strong>im</strong>menden Antworten<br />
wesentlich häufiger gewählt werden. Der Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium des<br />
ersten studierten Faches wird damit mehrheitlich als sehr hoch<br />
wahrgenommen. Hiervon gehen für 64,8% der Befragten belastende<br />
Effekte aus.<br />
Den Selektionsdruck <strong>im</strong> ersten Fach erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 24 59,0 -35,0<br />
trifft eher nicht zu 59 59,0 ,0<br />
trifft eher zu 64 59,0 5,0<br />
trifft voll zu 89 59,0 30,0<br />
Gesamt 236<br />
Teststatistik<br />
Der Selektionsdruck <strong>im</strong> zweiten Fach ist Dies erlebe ich<br />
sehr hoch<br />
als Belastung<br />
Chi-Quadrat 83,220 36,441<br />
df 3 3<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz<br />
,000 ,000<br />
Durch die deutlich zu geringe Besetzung der die Aussage in vollem Umfang<br />
verneinenden Zelle und die Überfrequentierung der positiv zust<strong>im</strong>menden<br />
Auswahlantworten ergibt sich, dass die Studierenden durch den<br />
wahrgenommenen Selektionsdruck in ihrem ersten studierten Fach<br />
mehrheitlich belastet werden. Um zu untersuchen, in welcher Richtung der<br />
wahrgenommene Selektionsdruck und die Belastung zusammenhängen,<br />
wurden die Korrelationen zwischen beiden Items berechnet. Hierfür ergab<br />
sich folgendes Bild:<br />
Korrelation des empfundenen Selektionsdrucks <strong>im</strong> ersten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho<br />
Der Selektionsdruck<br />
<strong>im</strong> ersten Fach ist<br />
sehr hoch<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Der Selektionsdruck<br />
<strong>im</strong> ersten Fach ist<br />
sehr hoch<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
1 ,714<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000<br />
126
Die Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage eines sehr hohen Selektionsdrucks und der<br />
zu einer hiervon ausgehenden belastenden Wirkung korrelieren hoch und<br />
signifikant miteinander. Je stärker damit der Selektionsdruck eingeschätzt<br />
wird, desto stärker wirkt dieser Selektionsdruck belastend auf die<br />
Studierenden ein.<br />
Für das zweite studierte Fach ergeben sich hinsichtlich dieser Aspekte<br />
folgende Werte. 67,4% st<strong>im</strong>men der Aussage eines sehr hohen<br />
Selektionsdrucks in vollem Maße (33,5%) und eher (33,9%) zu. Auch <strong>im</strong><br />
Studium des zweiten studierten Faches wird damit mehrheitlich ein hoher<br />
Selektionsdruck wahrgenommen. Detailliert ergibt sich folgendes Bild:<br />
Der Selektionsdruck <strong>im</strong> zweiten Fach ist sehr hoch<br />
Erwartete<br />
Beobachtetes N Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 20 57,5 -37,5<br />
trifft eher nicht zu 55 57,5 -2,5<br />
trifft eher zu 78 57,5 20,5<br />
trifft voll zu 77 57,5 19,5<br />
Gesamt 230<br />
Insbesondere ist auch hier wieder die Zelle, die die stark ablehnenden<br />
Antworten repräsentiert, deutlich unterbesetzt, während die zust<strong>im</strong>menden<br />
Antwortkategorien überfrequentiert sind. Für 60,8 % der Befragten gehen<br />
hiervon belastende Effekte aus.<br />
Den Selektionsdruck <strong>im</strong> zweiten Fach erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 27 57,5 -30,5<br />
trifft eher nicht zu 63 57,5 5,5<br />
trifft eher zu 67 57,5 9,5<br />
trifft voll zu 73 57,5 15,5<br />
Gesamt 230<br />
Teststatistik<br />
Der Selektionsdruck <strong>im</strong> zweiten Fach ist Dies erlebe ich<br />
sehr hoch<br />
als Belastung<br />
Chi-Quadrat 38,487 22,452<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Um auch hier wiederum darstellen zu können, in welchem Maße der<br />
wahrgenommene Selektionsdruck und das Belastungsempfinden<br />
zusammenhängen, wurden beide Items miteinander korreliert. Dabei<br />
ergaben sich folgende Werte:<br />
127
Korrelation des empfundenen Selektionsdrucks <strong>im</strong> zweiten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho<br />
Der Selektionsdruck<br />
<strong>im</strong> zweiten Fach ist<br />
sehr hoch<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Der Selektionsdruck<br />
<strong>im</strong> zweiten Fach ist<br />
sehr hoch<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
1 ,744<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Die Zust<strong>im</strong>mung zu wahrgenommenen belastenden Effekten korreliert damit<br />
hoch und signifikant mit dem wahrgenommenen Selektionsdruck. Die<br />
Aussagen, die bereits für das erste studierte Fach getroffen wurden, können<br />
damit auch für das andere studierte Fach gelten: Je höher der<br />
wahrgenommene Selektionsdruck, desto höher die hiervon ausgehenden<br />
belastenden Effekte.<br />
Zusammenhänge zwischen der Zust<strong>im</strong>mung zu einem hohen<br />
Selektionsdruck und den studierten Fächern können für folgende studierte<br />
Fächer angegeben werden:<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Quadrat<br />
X 14,183 6 0,03 0,241<br />
X 16,285 3
Der Selektionsdruck in Erziehungswissenschaft ist sehr hoch<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 35 58,5 -23,5<br />
trifft eher nicht zu 139 58,5 80,5<br />
trifft eher zu 46 58,5 -12,5<br />
trifft voll zu 14 58,5 -44,5<br />
Gesamt 234<br />
Insbesondere durch die deutliche Unterfrequentierung der eher und voll<br />
zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorien mit deutlicher Überbesetzung der eher<br />
ablehnenden Kategorie kann gesagt werden, dass der wahrgenommene<br />
Selektionsdruck in der Erziehungswissenschaft mehrheitlich nicht als hoch<br />
eingeschätzt wird. Dabei gehen von diesem Wert für 20,2% der Befragten<br />
belastende Effekte aus. Im Einzelnen konnten folgende Daten ermittelt<br />
werden:<br />
Den Selektionsdruck in Erziehungswissenschaft erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 63 58,3 4,8<br />
trifft eher nicht zu 123 58,3 64,8<br />
trifft eher zu 28 58,3 -30,3<br />
trifft voll zu 19 58,3 -39,3<br />
Gesamt 233<br />
Statistik für Test<br />
Der Selektionsdruck in<br />
Erziehungswissenschaft<br />
ist sehr hoch<br />
Dies erlebe ich als Belastung<br />
Chi-Quadrat 156,735 114,519<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Belastende Effekte treten damit von dem Selektionsdruck in<br />
Erziehungswissenschaft nur in geringem Maße und für die Mehrheit der<br />
Befragten kaum auf. Auch hier wird das Auftreten belastender Effekte<br />
durch die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen beiden Items<br />
deutlich:<br />
129
Korrelation des Selektionsdrucks in Erziehungswissenschaft mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho<br />
Der Selektionsdruck in<br />
Erziehungswissenschaft ist<br />
sehr hoch<br />
Der Selektionsdruck<br />
in Erziehungswissenschaft<br />
ist sehr<br />
hoch<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Korrelationskoeffizient<br />
1 ,738<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Beide Items korrelieren hoch und stark miteinander. Auch für das Studium<br />
in Erziehungswissenschaft gilt damit: Je höher der Grad des<br />
Selektionsdrucks beurteilt wird, desto mehr belastende Effekte werden<br />
wahrgenommen, die hiervon ausgehen. Der Selektionsdruck in<br />
Erziehungswissenschaft ist aber <strong>im</strong> Vergleich zu den Fächern deutlich<br />
geringer, sodass sich hier auch die Belastungseffekte deutlich geringer<br />
äußern.<br />
Insgesamt soll geprüft werden, in welchem Zusammenhang sowohl die<br />
einzelnen Einschätzungen zum Selektionsdruck als auch zum<br />
Belastungsempfinden stehen. Dabei ergeben sich folgende Werte:<br />
Korrelationen des empfundenen Selektionsdrucks in den einzelnen Fächern mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman<br />
Belastung<br />
Belas-<br />
Belas-<br />
Rho<br />
1. Fach<br />
2. Fach tung Ezw tung<br />
1. Fach Korrelationkoeffizient<br />
1 ,714 ,224 ,149 ,170 ,081<br />
Belastung<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,000 ,001 ,024 ,009 ,220<br />
Korrelationkoeffizient<br />
1 ,189 ,317 ,141 ,171<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,041 ,000 ,031 ,009<br />
2. Fach Korrelationskoeffizient<br />
1 ,744 ,146 ,165<br />
Belastung<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,000 ,027 ,013<br />
Korrelationskoeffizient<br />
,128 ,279<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,054 ,000<br />
Die Wahrnehmungen zwischen den einzelnen Teilbereichen korrelieren<br />
signifikant schwach sowohl hinsichtlich des Selektionsdrucks als auch der<br />
belastenden Effekte miteinander. Wer sich durch den Selektionsdruck <strong>im</strong><br />
130
ersten studierten Fach belastet fühlt, weist zumindest ähnliche Effekte auch<br />
<strong>im</strong> zweiten studierten Fach auf, während dieser Zusammenhang für die<br />
Erziehungswissenschaft zwar signifikant, aber sehr gering ausfällt. Die<br />
Wahrnehmung eines hohen Selektionsdruckes ist damit grundsätzlich mit<br />
belastenden Effekten verbunden.<br />
Insgesamt kann damit gesagt werden, dass die Studierenden mehrheitlich innerhalb ihrer<br />
studierten Fächer einen hohen Selektionsdruck wahrnehmen, der mit belastenden Effekten<br />
einhergeht. Obwohl für das Studium in Erziehungswissenschaft der Selektionsdruck in<br />
Relation zu den Fächern deutlich geringer beurteilt wird, sind hier ähnliche belastende<br />
Effekte messbar, wenn der Selektionsdruck als hoch empfunden wird.<br />
8.5 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen<br />
Den Studierenden wurde die Aussage „Mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen bin ich sehr zufrieden.“ vorgelegt. Hierauf wurde der<br />
Grad der Zust<strong>im</strong>mung zu diesem Item in Bezug auf das erste und das<br />
zweite studierte Fach sowie auf Erziehungswissenschaft untersucht.<br />
52,4% der Befragten st<strong>im</strong>mten der Aussage <strong>im</strong> Hinblick auf das erste<br />
studierte Fach in vollem Maße (11,5%) und eher (40,9%) zu. Im Detail<br />
ergibt sich folgende Übersicht:<br />
Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre <strong>im</strong> ersten Fach bin ich sehr zufrieden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 39 58,8 -19,8<br />
trifft eher nicht zu 73 58,8 14,3<br />
trifft eher zu 96 58,8 37,3<br />
trifft voll zu 27 58,8 -31,8<br />
Gesamt 235<br />
Hieraus geht zunächst hervor, dass die Extrempole der Antworten,<br />
besonders aber die extreme positive Antwortkategorie deutlich unterbesetzt<br />
sind. Der aus den Prozentangaben leicht positive Trend begründet sich<br />
damit vor allem aus der Überfrequentierung der eher zust<strong>im</strong>menden<br />
Antwortkategorie. 44,4% der Befragten geben dabei an, die Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen zumindest als partiell belastend zu erleben.<br />
131
Die didaktische Gestaltung <strong>im</strong> ersten Fach erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 35 58,3 -23,3<br />
trifft eher nicht zu 96 58,3 37,8<br />
trifft eher zu 65 58,3 6,8<br />
trifft voll zu 37 58,3 -21,3<br />
Gesamt 233<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit 1. Fach<br />
Dies erlebe ich als Belastung<br />
Chi-Quadrat 50,872 42,279<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Dabei existiert zwischen der Beurteilung der Zufriedenheit mit der<br />
Gestaltung der Lehrveranstaltungen und den hiervon ausgehenden<br />
Belastungswahrnehmungen ein statistisch signifikanter negativer<br />
Zusammenhang:<br />
Korrelation der Zufriedenheit mit der didaktischen Gestaltung <strong>im</strong> ersten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho<br />
Zufriedenheit<br />
1.Fach<br />
Dies erlebe ich<br />
als Belastung<br />
Zufriedenheit Korrelationskoeffizient<br />
1. Fach<br />
1 -,642<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Damit konnte ein Zusammenhang zwischen beiden Items derart gemessen<br />
werden, dass eine Ablehnung der ersten Aussage mit einer Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> zweiten Aussage zusammenhängt. Wer also mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen eher unzufrieden ist, für den gehen hiervon auch eher<br />
belastende Effekte aus.<br />
Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit den Lehrveranstaltungen<br />
und den studierten Fächern können in folgenden Fällen gemessen werden:<br />
Übersicht: Hohe Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehre in Abhängigkeit vom<br />
studierten Fach (1.und 2. Fach):<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Mathematik<br />
X 25,031 3
Ähnliche Ergebnisse konnten für die Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen für das zweite studierte Fach gemessen werden. Hier<br />
st<strong>im</strong>men der Aussage 55,2% der Befragten in vollen Maße (10,9%) oder<br />
eher (44,3%) zu.<br />
Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre <strong>im</strong> zweiten Fach bin ich sehr zufrieden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 47 57,5 -10,5<br />
trifft eher nicht zu 56 57,5 -1,5<br />
trifft eher zu 102 57,5 44,5<br />
trifft voll zu 25 57,5 -32,5<br />
Gesamt 230<br />
Auch hier sind die Extremantworten unterfrequentiert, wohingegen die eher<br />
zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie eine deutliche Überbesetzung aufweist.<br />
<strong>Belastungen</strong> gehen hiervon für 39,3% der Studierenden aus.<br />
Die didaktische Gestaltung <strong>im</strong> zweiten Fach erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 41 57,3 -16,3<br />
trifft eher nicht zu 98 57,3 40,8<br />
trifft eher zu 54 57,3 -3,3<br />
trifft voll zu 36 57,3 -21,3<br />
Gesamt 229<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit 2. Fach<br />
Dies erlebe ich als Belastung<br />
Chi-Quadrat 54,765 41,690<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Zwischen der Beurteilung der eigenen Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen und dem Belastungsempfinden in dieser Beziehung<br />
besteht ein statistisch signifikanter negativer Zusammenhang:<br />
Korrelation der Zufriedenheit mit der didaktischen Gestaltung <strong>im</strong> zweiten Fach mit<br />
dem Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho<br />
Zufriedenheit<br />
2.Fach<br />
Dies erlebe ich<br />
als Belastung<br />
Zufriedenheit 2.Fach Korrelationskoeffizient 1 -,595<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Je stärker die Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen,<br />
desto geringer ist damit der Grad der Belastungswahrnehmung. Die<br />
133
Korrelation bestätigt damit für das zweite <strong>Studien</strong>fach die für das erste<br />
studierte Fach gemessenen Zusammenhänge.<br />
In Bezug auf das Studium innerhalb der Erziehungswissenschaft st<strong>im</strong>men<br />
der Aussage zu einer Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen 66% der Befragten in vollem Maße (14,5%) und eher<br />
(51,5%) zu.<br />
Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre in Erziehungswissenschaft bin ich sehr<br />
zufrieden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 16 58,8 -42,8<br />
trifft eher nicht zu 64 58,8 5,3<br />
trifft eher zu 121 58,8 62,3<br />
trifft voll zu 34 58,8 -24,8<br />
Gesamt 235<br />
Auch hier fällt wieder auf, dass die Extremantworten unterbesetzt, die eher<br />
positiv zust<strong>im</strong>menden Kategorien jedoch deutlich überfrequentiert sind.<br />
Prozentual ist die Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen<br />
in Erziehungswissenschaft deutlich höher. Dementsprechend gehen auch<br />
nur für 29,5% der Befragten hiervon belastende Wirkungen aus.<br />
Die didaktische Gestaltung in Erziehungswissenschaft erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 56 58,5 -2,5<br />
trifft eher nicht zu 109 58,5 50,5<br />
trifft eher zu 58 58,5 -,5<br />
trifft voll zu 11 58,5 -47,5<br />
Gesamt 234<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit Ezw<br />
Dies erlebe ich als Belastung<br />
Chi-Quadrat 107,962 82,274<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Indes kann der für die studierten Fächer ermittelte Zusammenhang<br />
zwischen beiden Variablen auch für die Erziehungswissenschaft bestätigt<br />
werden. Die Wahrnehmung einer höheren Zufriedenheit mit der Gestaltung<br />
der Lehrveranstaltungen in Erziehungswissenschaft korreliert hoch und<br />
statistisch signifikant mit einer geringeren Belastungswahrnehmung:<br />
134
Korrelation der Zufriedenheit mit der didaktischen Gestaltung in<br />
Erziehungswissenschaft mit dem Belastungsempfinden<br />
Dies erlebe<br />
Spearman Rho<br />
Zufriedenheit<br />
Ezw<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Zufriedenheit Ezw Korrelationskoeffizient 1 -,589<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Korrelationskoeffizient -,589 1<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Daneben wurde untersucht, ob sich die Beurteilungen <strong>zur</strong> Zufriedenheit mit<br />
der Gestaltung der Lehrveranstaltung zwischen den einzelnen Bereichen<br />
signifikant voneinander unterscheiden. Die Prüfung der Werte ergab<br />
folgende Ergebnisse:<br />
Ränge: Zufriedenheit mit der didaktischen Gestaltung der Lehrveranstaltungen<br />
(1.&2.Fach)<br />
Zufriedenheit mit<br />
Lehrveranstaltungen<br />
1.& 2. Fach<br />
N Mittlerer Rang Rangsumme<br />
Negative Ränge 68(a) 72,70 4943,50<br />
Positive Ränge 71(b) 67,42 4786,50<br />
Bindungen<br />
90(c)<br />
Gesamt 229<br />
a Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre zufrieden 2. Fach < Mit der didaktischen<br />
Gestaltung der Lehre zufrieden 1. Fach<br />
b Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre zufrieden 2. Fach > Mit der didaktischen<br />
Gestaltung der Lehre zufrieden 1. Fach<br />
c Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre zufrieden 2. Fach = Mit der didaktischen<br />
Gestaltung der Lehre zufrieden 1. Fach<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit 1.& 2. Fach<br />
Z<br />
-,170(a)<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz (2-seitig) ,865<br />
a Basiert auf positiven Rängen. b Wilcoxon-Test<br />
Die Werte für die Beurteilung für die Zufriedenheit mit der Gestaltung von<br />
Lehrveranstaltungen in beiden studierten Fächern unterscheiden sich damit<br />
nicht signifikant voneinander. Ein verändertes Ergebnis kann gemessen<br />
werden, wenn die entsprechende Zufriedenheit zwischen den studierten<br />
Fächern und der Erziehungswissenschaft untersucht wird:<br />
Ränge: Zufriedenheit mit der didaktischen Gestaltung der Lehrveranstaltungen<br />
(1.&2.Fach, Erziehungswissenschaft)<br />
Mittlerer Rang<br />
Zufriedenheit 1. Fach 1,91<br />
Zufriedenheit 2. Fach 1,94<br />
Zufriedenheit Ezw 2,15<br />
135
Statistik für Test(a)<br />
N 228<br />
Chi-Quadrat 11,766<br />
df 2<br />
Asymptotische Signifikanz ,003<br />
a Friedman-Test<br />
Die Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen ist damit in<br />
der Wahrnehmung der Studierenden in Veranstaltungen der<br />
Erziehungswissenschaft signifikant größer als in den beiden studierten<br />
Fächern.<br />
Die genannten Werte wurden dahingehend untersucht, ob<br />
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Beurteilungen messbar sind.<br />
Hier ergibt sich folgende Übersicht:<br />
Korrelationen der Zufriedenheit mit der didaktischen Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen in den beiden Fächern und Erziehungswissenschaft<br />
Spearman Rho<br />
Zufriedenheit<br />
1. Fach<br />
Zufriedenheit<br />
2. Fach<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Zufriedenheit<br />
1. Fach<br />
Zufriedenheit<br />
2. Fach<br />
Zufriedenheit<br />
Ezw<br />
1,000 -,038 ,004<br />
Sig. (2-seitig) ,570 ,952<br />
Korrelationskoeffizient<br />
1,000 ,057<br />
Sig. (2-seitig) ,388<br />
Zufriedenheit Ezw Korrelationskoeffizient 1,000<br />
Sig. (2-seitig)<br />
Die Belastungswahrnehmungen und die Beurteilung der eigenen<br />
Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen korrelieren<br />
zwischen den einzelnen Fächern und zwischen den studierten Fächern und<br />
der Erziehungswissenschaft nicht signifikant.<br />
8.6 Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien<br />
Ähnlich wie bei der Beurteilung der Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen wurden die Studierenden gebeten anzugeben, in<br />
welchem Maße sie einer entsprechenden Aussage für die<br />
Arbeitsmaterialien, die in den Lehrveranstaltungen ausgegeben bzw. <strong>zur</strong><br />
Verfügung gestellt werden, zust<strong>im</strong>mten und welche Effekte hiervon<br />
ausgehen. Dabei wurde wieder zwischen den studierten Fächern und der<br />
Erziehungswissenschaft unterschieden.<br />
Für das erste Fach st<strong>im</strong>mten einer Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien<br />
71,5% der Befragten in vollem Maße (26,8%) und eher (44,7%) zu. In<br />
Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
136
Mit der Qualität der Materialien <strong>im</strong> ersten Fach bin ich sehr zufrieden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 21 58,8 -37,8<br />
trifft eher nicht zu 46 58,8 -12,8<br />
trifft eher zu 105 58,8 46,3<br />
trifft voll zu 63 58,8 4,3<br />
Gesamt 235<br />
Hier wird besonders die Unterfrequentierung der ablehnenden<br />
Antwortkategorien deutlich. Mehrheitlich sind die Befragten mit den<br />
Materialien sehr zufrieden. Dementsprechend gehen hiervon auch nur für<br />
28,1% belastende Effekte aus, wobei die Belastungswahrnehmung und die<br />
Zufriedenheit mit den Materialien signifikant negativ korrelieren.<br />
Die Qualität der Materialien <strong>im</strong> ersten Fach erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 67 58,0 9,0<br />
trifft eher nicht zu 100 58,0 42,0<br />
trifft eher zu 44 58,0 -14,0<br />
trifft voll zu 21 58,0 -37,0<br />
Gesamt 232<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit 1. Fach<br />
Belastung<br />
Chi-Quadrat 63,740 58,793<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Korrelation der Zufriedenheit mit der Qualität der Materialien <strong>im</strong> ersten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Zufriedenheit Belastung<br />
Zufriedenheit Korrelation nach Pearson 1 -,684<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
N 235 230<br />
Belastung Korrelation nach Pearson -,684 1<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
N 230 232<br />
Eine hohe Beurteilung der Qualität der Materialien <strong>im</strong> Studium geht einher<br />
mit einem entsprechend geringerem Belastungsempfinden in dieser<br />
Hinsicht, während als qualitativ eher gering empfundene Materialien auch<br />
stärker belastende Effekte in der Wahrnehmung der Studierenden<br />
ausbilden.<br />
137
Für das zweite Fach st<strong>im</strong>men der Aussage <strong>zur</strong> Zufriedenheit mit den<br />
Arbeitsmaterialien 55,2% der Befragten in vollem Maße (16,1%) und eher<br />
(39,1%) zu. Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
Mit der Qualität der Materialien <strong>im</strong> zweiten Fach bin ich sehr zufrieden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 32 57,5 -25,5<br />
trifft eher nicht zu 71 57,5 13,5<br />
trifft eher zu 90 57,5 32,5<br />
trifft voll zu 37 57,5 -20,5<br />
Gesamt 230<br />
Die mehrheitliche Zufriedenheit mit den Materialien <strong>im</strong> zweiten Fach ist<br />
bedingt durch eine Unterfrequentierung der extremen Antwortkategorien<br />
und eine Überbesetzung der eher zust<strong>im</strong>menden Auswahlantwort. Von der<br />
Qualität der Materialien gehen dabei für 40% der Befragten zumindest<br />
partiell belastende Effekte aus.<br />
Die Qualität der Materialien <strong>im</strong> zweiten Fach erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 50 56,3 -6,3<br />
trifft eher nicht zu 85 56,3 28,8<br />
trifft eher zu 59 56,3 2,8<br />
trifft voll zu 31 56,3 -25,3<br />
Gesamt 225<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit 2. Fach<br />
Belastung<br />
Chi-Quadrat 40,157 26,858<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Die Prüfung des Zusammenhangs zwischen der Beurteilung der Qualität<br />
der Materialien und den hiervon wahrgenommenen belastenden Effekten<br />
erbrachte einen starken signifikanten negativen Zusammenhang:<br />
138
Korrelation der Zufriedenheit mit der Qualität der Materialien <strong>im</strong> zweiten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Zufriedenheit Belastung<br />
Spearman-Rho Zufriedenheit Korrelationskoeffizi<br />
ent 1,000 -,717<br />
Belastung<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
Korrelationskoeffizi<br />
ent -,717 1,000<br />
Sig. (2-seitig) ,000 .<br />
Je höher damit die Qualität der Materialien beurteilt wird, desto geringer<br />
sind die hiervon ausgehenden <strong>Belastungen</strong>.<br />
Für die Erziehungswissenschaft st<strong>im</strong>men einer entsprechenden Aussage<br />
71% der Befragten in vollem Maße (17,4%) und eher (53,6%) zu.<br />
Detailliert ergeben sich die folgenden Werte:<br />
Mit der Qualität der Materialien in Erziehungswissenschaft bin ich sehr zufrieden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 11 58,8 -47,8<br />
trifft eher nicht zu 57 58,8 -1,8<br />
trifft eher zu 126 58,8 67,3<br />
trifft voll zu 41 58,8 -17,8<br />
Gesamt 235<br />
Hier fällt besonders die starke Unterbesetzung der völlig verneinenden<br />
Antwortkategorie auf, während die eher zust<strong>im</strong>mende Kategorie deutlich<br />
überbesetzt ist. Dementsprechend gehen hiervon nur für 30,2% der<br />
Befragten belastende Effekte aus.<br />
Die Qualität der Materialien in Erziehungswissenschaft erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 50 58,0 -8,0<br />
trifft eher nicht zu 112 58,0 54,0<br />
trifft eher zu 55 58,0 -3,0<br />
trifft voll zu 15 58,0 -43,0<br />
Gesamt 232<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit Ezw<br />
Belastung<br />
Chi-Quadrat 121,204 83,414<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
139
Die Prüfung des Zusammenhangs bestätigt die Ergebnisse, die bereits für<br />
die studierten Fächer formuliert wurden. Je höher die Qualität der<br />
Materialien beurteilt wird, desto geringer wird die damit verbundene<br />
Belastungswahrnehmung.<br />
Korrelation der Zufriedenheit mit der Qualität der Materialien in<br />
Erziehungswissenschaft mit dem Belastungsempfinden<br />
Zufriedenheit Belastung<br />
Spearman-Rho Zufriedenheit Korrelationskoeffizient 1,000 -,723<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
Belastung Korrelationskoeffizient -,723 1,000<br />
Sig. (2-seitig) ,000 .<br />
Um zu prüfen, in welchem Maße sich die einzelnen Beurteilungen für die<br />
Materialien in den studierten Fächern und der Erziehungswissenschaft<br />
unterscheiden, wurde der Wilcoxon-Test verwendet, der folgende Werte<br />
erbringt:<br />
Ränge: Zufriedenheit mit der Qualität der Arbeitsmaterialien (1. & 2. Fach)<br />
Mittlerer<br />
N<br />
Rang Rangsumme<br />
Zufriedenheit 1. und 2. Negative Ränge<br />
Fach<br />
97(a) 78,18 7583,00<br />
Positive Ränge 52(b) 69,08 3592,00<br />
Bindungen<br />
80(c)<br />
Gesamt 229<br />
a Mit der Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden.2. Fach < Mit der Qualität der<br />
Materialien bin ich sehr zufrieden.1. Fach<br />
b Mit der Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden.2. Fach > Mit der Qualität der<br />
Materialien bin ich sehr zufrieden.1. Fach<br />
c Mit der Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden.2. Fach = Mit der Qualität der<br />
Materialien bin ich sehr zufrieden.1. Fach<br />
Statistik für Test(b)<br />
Z<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
Zufriedenheit 1. und 2. Fach<br />
-3,906(a)<br />
,000<br />
a Basiert auf positiven Rängen.<br />
b Wilcoxon-Test<br />
Die Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien wird für das erste studierte<br />
Fach in höherem Maße artikuliert als für das zweite studierte Fach.<br />
Im Vergleich zwischen den drei einzelnen Komponenten ergeben sich nach<br />
dem Friedman-Test folgende Kennwerte:<br />
140
Ränge: Zufriedenheit mit der Qualität der Arbeitsmaterialien (1. & 2. Fach,<br />
Erziehungswissenschaft)<br />
Mittlerer Rang<br />
1. Fach 2,15<br />
2. Fach 1,82<br />
Ezw 2,03<br />
Statistik für Test(a)<br />
N 228<br />
Chi-Quadrat 19,032<br />
df 2<br />
Asymptotische Signifikanz ,000<br />
a Friedman-Test<br />
Die Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien wird zwischen dem ersten und<br />
dem zweiten studierten Fach und zwischen dem zweiten studierten Fach<br />
und der Erziehungswissenschaften statistisch signifikant unterschiedlich<br />
bewertet. Die unterschiedliche Bewertung wir für den Vergleich der<br />
Beurteilung der Qualität der Materialien für das erste studierte Fach und die<br />
Erziehungswissenschaft hingegen nicht signifikant.<br />
Ränge: Zufriedenheit mit der Qualität der Arbeitsmaterialien (1.Fach und<br />
Erziehungswissenschaft)<br />
Mittlerer<br />
N Rang Rangsumme<br />
Zufriedenheit Ezw und 1. Negative Ränge<br />
Fach<br />
77(a) 64,34 4954,00<br />
Positive Ränge 58(b) 72,86 4226,00<br />
Bindungen<br />
99(c)<br />
Gesamt 234<br />
a Mit der Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden. Erziehungswissenschaft < Mit der<br />
Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden.1. Fach<br />
b Mit der Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden. Erziehungswissenschaft > Mit der<br />
Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden.1. Fach<br />
c Mit der Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden. Erziehungswissenschaft = Mit der<br />
Qualität der Materialien bin ich sehr zufrieden.1. Fach<br />
Statistik für Test(b)<br />
Zufriedenheit 1. Fach und Ezw<br />
Z<br />
-,839(a)<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz (2-seitig) ,401<br />
a Basiert auf positiven Rängen.<br />
b Wilcoxon-Test<br />
Abschließend soll wiederum geprüft werden, ob die Einschätzungen <strong>zur</strong><br />
Zufriedenheit mit den Materialien in den einzelnen Fächern und<br />
Erziehungswissenschaft korrelieren. Hierzu ergeben sich folgende Werte:<br />
141
Korrelation der Zufriedenheit mit der Qualität der Materialien in den einzelnen<br />
Fächern und Erziehungswissenschaft<br />
Spearman<br />
Rho<br />
Zufriedenheit<br />
1. Fach<br />
Zufriedenheit<br />
2. Fach<br />
Zufriedenheit<br />
Ezw<br />
Zufriedenheit<br />
1. Fach<br />
Zufriedenheit<br />
2. Fach<br />
Korrelationskoeffizient<br />
1,000 ,065 ,149<br />
Sig. (2-seitig) ,329 ,023<br />
Korrelationskoeffizient<br />
1,000 ,099<br />
Zufriedenheit<br />
Ezw<br />
Sig. (2-seitig) . ,137<br />
Korrelationskoeffizient<br />
1,000<br />
Sig. (2-seitig)<br />
Wie zu erkennen ist stehen die einzelnen Zufriedenheitseinschätzungen in<br />
keinem auf p=0,01-Niveau signifikanten Zusammenhang. Es kann somit<br />
nicht von einer grundsätzlich eher zufriedeneren oder unzufriedeneren<br />
Ausgangshaltung der Befragten ausgegangen werden.<br />
Die Studierenden artikulieren damit mehrheitlich sowohl für die studierten<br />
Fächer als auch die Erziehungswissenschaft eine hohe Zufriedenheit mit<br />
den Materialien. Dabei wird die entsprechende Qualität <strong>im</strong> ersten studierten<br />
Fach und der Erziehungswissenschaft signifikant besser beurteilt als <strong>im</strong><br />
zweiten studierten Fach. Dabei gilt für alle drei Bereiche, dass je höher die<br />
Qualität der Materialien beurteilt wird, desto geringere belastende Effekte<br />
hiervon ausgehend wahrgenommen werden.<br />
Fachspezifische Beurteilungen konnten nicht nachgewiesen werden.<br />
8.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil<br />
46,6% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage, mit meinem Arbeitsstil bin ich<br />
sehr zufrieden, in vollem Maße (4,2%) und eher (42,4%) zu. Damit äußern<br />
die Studierenden mehrheitlich eine zumindest partielle Unzufriedenheit mit<br />
dem eigenen Arbeitsstil. Detailliert ergeben sich folgende Ergebnisse:<br />
Ich bin mit meinem Arbeitsstil sehr zufrieden.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 9 59,0 -50,0<br />
trifft eher nicht zu 117 59,0 58,0<br />
trifft eher zu 100 59,0 41,0<br />
trifft voll zu 10 59,0 -49,0<br />
Gesamt 236<br />
Aus der Übersicht wird zunächst deutlich, dass die Extremantwortpole<br />
deutlich und in ähnlich hohem Maße unterfrequentiert sind. Die<br />
142
mehrheitliche partielle Unzufriedenheit resultiert aus einer deutlichen<br />
Überfrequentierung der Antwortkategorie, die die Aussage eher verneint.<br />
Die Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil empfinden 56,3% zumindest<br />
teilweise als Belastung:<br />
Meinen Arbeitsstil erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 27 58,3 -31,3<br />
trifft eher nicht zu 75 58,3 16,8<br />
trifft eher zu 108 58,3 49,8<br />
trifft voll zu 23 58,3 -35,3<br />
Gesamt 233<br />
Statistik für Test<br />
Zufriedenheit<br />
Belastung<br />
Chi-Quadrat 168,576 85,403<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Dieses Belastungsempfinden resultiert aus der Überfrequentierung der<br />
eher zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorie und zugleich einer deutlichen<br />
Unterbesetzung der Extremantworten. Zwischen der Wahrnehmung zum<br />
eigenen Arbeitsstil und dem damit verbundenen Belastungsempfinden<br />
können statistisch signifikante negative Zusammenhänge gemessen<br />
werden:<br />
Korrelation der Zufriedenheit mit dem Arbeitsstil mit dem Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho Zufriedenheit Belastung<br />
Zufriedenheit Korrelationskoeffizient 1,000 -,697<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
Je höher damit die Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil ausgeprägt ist,<br />
desto geringer sind die hiervon ausgehenden wahrgenommenen<br />
belastenden Effekte.<br />
8.8 Selbstwirksamkeitsüberzeugung<br />
In dieser Hinsicht wurden die Studierenden gebeten anzugeben, in<br />
welchem Maße sie der Aussage: „Ich bin überzeugt davon, dass meine<br />
Fähigkeiten für die erfolgreiche Bewältigung des Studiums ausreichen.“,<br />
143
zust<strong>im</strong>men. 72,9% der Befragten st<strong>im</strong>men dieser Aussage in vollem Maße<br />
(15,7%) und eher (57,2%) zu. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:<br />
Ich bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten für das Studium ausreichen<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 9 59,0 -50,0<br />
trifft eher nicht zu 55 59,0 -4,0<br />
trifft eher zu 135 59,0 76,0<br />
trifft voll zu 37 59,0 -22,0<br />
Gesamt 236<br />
Deutlich wird aus dieser Tabelle vor allem, dass die Anzahl derjenigen, die<br />
stark an ihren Fähigkeiten zweifeln deutlich geringer ist als die derjenigen,<br />
die ihre Fähigkeiten in vollem Maße als ausreichend einschätzen. Daneben<br />
ist besonders die der Aussage eher zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie deutlich<br />
überfrequentiert. Von der Einschätzung ihrer Fähigkeiten gehen für 41,4%<br />
zumindest teilweise belastende Effekte aus:<br />
Das Potential meiner Fähigkeiten erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 41 58,0 -17,0<br />
trifft eher nicht zu 95 58,0 37,0<br />
trifft eher zu 52 58,0 -6,0<br />
trifft voll zu 44 58,0 -14,0<br />
Gesamt 232<br />
Statistik für Test<br />
Ausreichende Fähigkeiten<br />
Belastung<br />
Chi-Quadrat 148,746 32,586<br />
df 3 3<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000<br />
Die Extremantwortpole sind deutlich unterbesetzt, wohingegen eine<br />
deutliche Überfrequentierung der eher die Aussage verneinenden<br />
Antwortkategorie zu konstatieren ist. Eine Prüfung der Zusammenhänge<br />
zwischen der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und der hiervon<br />
ausgehenden Belastungseffekte erbringt folgende Ergebnisse:<br />
144
Korrelation der empfundenen Fähigkeiten mit dem Belastungsempfinden<br />
Spearman-Rho<br />
Ausreichende<br />
Fähigkeiten Belastung<br />
Ausreichende Fähigkeiten Korrelationskoeffizient 1,000 -,748<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten als ausreichend korreliert hoch<br />
und signifikant negativ mit dem hiervon ausgehenden<br />
Belastungsempfinden. Je günstiger damit die eigenen Fähigkeiten für die<br />
Bewältigung des Studiums eingeschätzt werden, umso geringer sind die<br />
belastenden Effekte, die hiervon ausgehen.<br />
9 Persönlichkeitsvariablen<br />
Den Studierenden wurden hier 21 Items aus dem Fragebogen <strong>zur</strong> Selbstund<br />
Fremdevaluation für Lehramtsstudenten (Schaarschmidt & Kieschke<br />
2007, S. 158ff) vorgelegt. Diese Items sollen die Merkmale<br />
Frustrationstoleranz, Wissens- und Informationsbedürfnis, Flexibilität,<br />
Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft, Erholungsfähigkeit, Fähigkeit<br />
zum rationellen Arbeiten und Stressresistenz messen. Zu jedem Merkmal<br />
wurden 3 Items vorgelegt.<br />
9.1 Frustrationstoleranz<br />
Der ersten Aussage hierzu: „Wenn ich nicht erreiche, was ich wollte,<br />
resigniere ich schnell“, st<strong>im</strong>mten 19,4% der Befragten in vollem Maße<br />
(2,1%) und überwiegend (17,3%) zu. Im Einzelnen ergibt sich folgendes<br />
Bild:<br />
Wenn ich nicht erreiche, was ich wollte, resigniere ich schnell.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 30 47,4 -17,4<br />
überwiegend nicht 77 47,4 29,6<br />
teilweise 84 47,4 36,6<br />
überwiegend 41 47,4 -6,4<br />
voll 5 47,4 -42,4<br />
Gesamt 237<br />
Deutlich wird hier die starke Unterbesetzung der voll zust<strong>im</strong>menden<br />
Antwortkategorie. Insgesamt ist eine Überfrequentierung der neutralen bis<br />
überwiegend nicht zust<strong>im</strong>menden Antworten zu verzeichnen.<br />
145
Zur zweiten Aussage: „Ich verliere schnell die Lust, wenn ich keine Erfolge<br />
habe.“, äußerten 32% der Befragten ihre volle (6,3%) und überwiegende<br />
(25,7%) Zust<strong>im</strong>mung. Detailliert lassen sich folgende Werte messen:<br />
Ich verliere schnell die Lust, wenn ich keine Erfolge habe.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 12 47,4 -35,4<br />
überwiegend nicht 70 47,4 22,6<br />
teilweise 79 47,4 31,6<br />
überwiegend 61 47,4 13,6<br />
voll 15 47,4 -32,4<br />
Gesamt 237<br />
Innerhalb dieser Aussage fallen besonders die Tendenz <strong>zur</strong> neutralen<br />
Antwortkategorie und die Vermeidung der extremen Antwortkategorien auf.<br />
Der dritten Aussage.“ Wenn ich irgendwo versagt habe, spornt mich das<br />
an, mehr zu tun.“, st<strong>im</strong>mten 45,1% in vollem Maße (9,7%) und<br />
überwiegend (35,4%) zu.<br />
Wenn ich irgendwo versagt habe, spornt mich das an, mehr zu tun.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 23 47,4 -24,4<br />
überwiegend 84 47,4 36,6<br />
teilweise 83 47,4 35,6<br />
überwiegend nicht 42 47,4 -5,4<br />
gar nicht 5 47,4 -42,4<br />
Gesamt 237<br />
Die diese Aussage voll ablehnende Antwortkategorie ist deutlich<br />
unterfrequentiert, wohingegen die überwiegend zust<strong>im</strong>mende<br />
Antwortkategorie eine deutliche Überbesetzung aufweist.<br />
Statistik für Test<br />
Wenn ich nicht<br />
erreiche, was ich<br />
wollte, resigniere<br />
ich schnell.<br />
Ich verliere<br />
schnell die Lust,<br />
wenn ich keine<br />
Erfolge habe.<br />
Wenn ich irgendwo<br />
versagt habe, spornt<br />
mich das an, mehr<br />
zu tun.<br />
Chi-Quadrat(a) 91,924 84,329 106,101<br />
df 4 4 4<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000 ,000<br />
146
Aus den drei Items wurde eine Skala <strong>zur</strong> Messung des Konstrukts<br />
„Frustrationstoleranz“ gebildet. Der von SCHAARSCHMIDT für die<br />
Reliabilität angegebene Wert beträgt Cronsbachs Alpha=.75.<br />
(Schaarschmidt und Kieschke, 2007, S. 251) Die Skala wurde für die<br />
vorliegende Untersuchung einer Reliabilitätsanalyse unterzogen, die<br />
folgende Werte aufweist:<br />
Reliabilitätsstatistik: Frustrationstoleranz<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,727 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Frustrationstoleranz<br />
Wenn ich nicht<br />
erreiche, was ich<br />
wollte, resigniere ich<br />
schnell.<br />
Ich verliere schnell die<br />
Lust, wenn ich keine<br />
Erfolge habe.<br />
Wenn ich irgendwo<br />
versagt habe, spornt<br />
mich das an, mehr zu<br />
tun.<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte Item-<br />
Skala-Korrelation<br />
Cronbachs Alpha,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
5,6582 2,717 ,586 ,593<br />
5,3080 2,604 ,603 ,571<br />
5,6245 3,125 ,462 ,737<br />
Der Skalenmittelwert beträgt M=3,24 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=.78. Die Referenzwerte von SCHAARSCHMIDT & KIESCHKE liegen<br />
für den Skalenmittelwert bei M=3,26 und SD= .75. (Ebenda S. 251)<br />
Nach Transformation auf die Stanineform ergibt sich für die Antworten der<br />
Studierenden auf der Skala ein Mittelwert von M=9,7 mit einer<br />
Standardabweichung von SD=2,36. Im Vergleich <strong>zur</strong> Studierendennorm ist<br />
die Frustrationstoleranz der Befragten als durchschnittlich (Werte zwischen<br />
8-10), <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Idealnorm ebenfalls als durchschnittlich (Werte<br />
zwischen 10-12) zu bezeichnen, wobei die Studierenden hinsichtlich der<br />
Studierendennorm <strong>im</strong> oberen und in Bezug auf die Idealnorm <strong>im</strong> unteren<br />
Durchschnittsbereich verortet werden. (Ebenda S. 233)<br />
9.2 Informations- und Wissensbedürfnis<br />
Dem ersten Item hierzu: „Ich will <strong>im</strong>mer auf dem neuesten Stand sein.“,<br />
st<strong>im</strong>men 74,8% der Befragten in vollem Maße (19,2%) und überwiegend<br />
(55,6%) zu. Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
147
Ich will <strong>im</strong>mer auf dem neuesten Stand sein.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
überwiegend nicht 9 59,8 -50,8<br />
teilweise 51 59,8 -8,8<br />
überwiegend 133 59,8 73,3<br />
voll 46 59,8 -13,8<br />
Gesamt 239<br />
Hieraus wird deutlich ersichtlich, dass die völlig verneinende<br />
Antwortkategorie nicht besetzt und die überwiegende verneinende stark<br />
unterfrequentiert ist.<br />
Dagegen geben nur 31,8% an, sich <strong>im</strong>mer umfassend über Politik und<br />
Gesellschaft zu informieren. (Kategorie 5: 6,7%, Kategorie 4: 25,1%)<br />
Ich informiere mich umfassend über Politik und Gesellschaft.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 11 47,8 -36,8<br />
überwiegend nicht 61 47,8 13,2<br />
teilweise 91 47,8 43,2<br />
überwiegend 60 47,8 12,2<br />
voll 16 47,8 -31,8<br />
Gesamt 239<br />
Der vergleichsweise geringe Prozentwert ergibt sich in Auswertung der<br />
Zellenbesetzung durch die Tendenz <strong>zur</strong> Mitte und die starke<br />
Unterbesetzung der extremen Antwortkategorien.<br />
Dem Item: „Es stört mich nicht, wenn ich tagelang keine Nachrichten höre.“,<br />
st<strong>im</strong>men 25,1% der Befragten in vollem Maße (8,4%) und überwiegend<br />
(16,7%) zu.<br />
Es stört mich nicht, wenn ich tagelang keine Nachrichten höre<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 20 47,8 -27,8<br />
überwiegend 40 47,8 -7,8<br />
teilweise 67 47,8 19,2<br />
überwiegend nicht 82 47,8 34,2<br />
gar nicht 30 47,8 -17,8<br />
Gesamt 239<br />
Hierbei ist eine Unterbesetzung der verneinenden Antwortkategorien<br />
feststellbar, wobei gleichzeitig eine Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Antwortkategorie<br />
zu konstatieren ist.<br />
148
Statistik für Test<br />
Ich will <strong>im</strong>mer<br />
auf dem<br />
neuesten Stand<br />
sein.<br />
ich informiere<br />
mich<br />
umfassend<br />
über<br />
Pol./Gesell.<br />
Es stört mich nicht,<br />
wenn ich tagelang<br />
keine Nachrichten<br />
höre<br />
Chi-Quadrat 137,351 95,289 56,251<br />
df 3 4 4<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000 ,000<br />
Entsprechend dem Vorgehen bei den übrigen Persönlichkeitsvariablen soll<br />
auch hier wieder eine Skala gebildet werden, die mit „Informations- und<br />
Wissensbedürfnis“ überschrieben ist. Die Items wurden somit einer<br />
Skalenreliabilitätsanalyse unterzogen. In der Untersuchung von<br />
SCHAARSCHMIDT & KIESCHKE betrug der Wert für Cronsbachs<br />
Alpha=.67. (Ebenda S. 251)<br />
Die Reliabilitätsanalyse für die vorliegende Untersuchung erbrachte<br />
folgende Werte:<br />
Reliabilitätsstatistiken: Informations- und Wissensbedürfnis<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,379 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Informations- und Wissensbedürfnis<br />
Skalenmittel<br />
wert, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Ich will <strong>im</strong>mer auf dem<br />
neuesten Stand sein. 6,2971 3,033 ,061 ,519<br />
ich informiere mich<br />
umfassend über<br />
Pol./Gesell.<br />
Es stört mich nicht,<br />
wenn ich tagelang<br />
keine Nachrichten<br />
höre<br />
7,1632 1,851 ,348 ,018<br />
6,9414 1,652 ,276 ,172<br />
Der anvisierte Cronsbachs Alpha konnte damit in der vorliegenden<br />
Untersuchung nicht repliziert werden. Die einzelnen Items messen<br />
demzufolge nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße dasselbe<br />
Konstrukt. Auf mögliche Ursachen hierfür wurde in dem Teil der<br />
Methodendiskussion dieser Arbeit eingegangen. Auf die Bildung einer<br />
entsprechenden Skala wurde deshalb verzichtet, als Bestandteil der<br />
übergeordneten Skala Persönlichkeitsvariablen werden die vorliegenden<br />
Items nicht verwendet.<br />
149
9.3 Flexibilität<br />
Dem ersten Item: „Ich kann mich auf unvorhergesehene Situationen gut<br />
einstellen.“, st<strong>im</strong>men 63% der Befragten in vollen Maße (8%) und<br />
überwiegende (55%) zu. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:<br />
Ich kann mich auf unvorhergesehene Situationen gut einstellen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 3 47,6 -44,6<br />
überwiegend nicht 11 47,6 -36,6<br />
teilweise 74 47,6 26,4<br />
überwiegend 131 47,6 83,4<br />
voll 19 47,6 -28,6<br />
Gesamt 238<br />
Hieraus wird besonders die starke Unterfrequentierung der ablehnenden<br />
Antwortkategorien deutlich, wobei auch die in vollem Maße zust<strong>im</strong>mende<br />
Kategorie unterbesetzt ist.<br />
Der Aussage: „Ich bin darauf angewiesen, dass alles in vertrauten Bahnen<br />
verläuft.“, st<strong>im</strong>mten 24,8% voll (4,6%) und überwiegend (20,2%) zu.<br />
Ich bin darauf angewiesen, dass alles in vertrauten Bahnen verläuft<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 11 47,6 -36,6<br />
überwiegend 48 47,6 ,4<br />
teilweise 80 47,6 32,4<br />
überwiegend nicht 87 47,6 39,4<br />
gar nicht 12 47,6 -35,6<br />
Gesamt 238<br />
Die Extremantworten sind deutlich unterbesetzt und eine Tendenz <strong>zur</strong><br />
neutralen Mitte in Verbindung mit einer Überfrequentierung der<br />
überwiegend verneinenden Antwortkategorie wird erkennbar.<br />
Die Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage: „An neue Bedingungen kann ich mich<br />
problemlos anpassen.“, beträgt 54,6 % (Kategorie 5=8,4% und Kategorie 4<br />
= 46,2%).<br />
150
An neue Bedingungen kann ich mich problemlos anpassen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 1 47,6 -46,6<br />
überwiegend nicht 13 47,6 -34,6<br />
teilweise 94 47,6 46,4<br />
überwiegend 110 47,6 62,4<br />
voll 20 47,6 -27,6<br />
Gesamt 238<br />
Die Besetzung der Zellen zeigt hierbei eine deutliche Überfrequentierung<br />
der überwiegend zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorie, wobei die<br />
Extremantworten in unterschiedlich starkem Maße unterbesetzt sind.<br />
Aus den Einzelitems wurde die Skala „Flexibilität“ gebildet.<br />
SCHAARSCHMIDT & KIESCHKE geben für die Skalenreliabilität einen<br />
Cronbachs Alpha von .76 an. (Ebenda S. 251) Die <strong>im</strong> Rahmen der<br />
vorliegenden Untersuchung durchgeführte Analyse erbringt folgende<br />
Werte:<br />
Reliabilitätsstatistik: Flexibilität<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,716 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Flexibilität<br />
Ich kann mich auf<br />
unvorhergesehene<br />
Situa. gut einstellen<br />
Ich bin eher darauf<br />
angewiesen, dass<br />
alles in vertrauten<br />
Bahnen verläuft<br />
An neue Bedingungen<br />
kann ich mich<br />
problemlos anpassen<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
6,7395 2,025 ,529 ,621<br />
7,2059 1,540 ,521 ,657<br />
6,8109 2,188 ,444 ,689<br />
Der Skalenmittelwert beträgt M=3,45 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=.64. Die entsprechenden Referenzwerte in der Vergleichsuntersuchung<br />
von SCHAARSCHMIDT und KIESCHKE betragen M= 3,81 und SD= .67.<br />
(Ebenda S. 251)<br />
151
Nach einer Transformation auf die Stanineskala ergibt sich ein<br />
Durchschnittswert der Skala von 10,38 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=.193. Die Studierenden weisen damit <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Studentennorm<br />
(Wertebereich 10-11) durchschnittliche und <strong>im</strong> Vergleich mit der Idealnorm<br />
(Wertebereich 11-13) leicht unterdurchschnittliche Merkmalsausprägungen<br />
hinsichtlich der Flexibilität auf.<br />
9.4 Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft<br />
Dem ersten Item hierzu: „Ich bin darauf eingestellt, dass es <strong>im</strong> Studium<br />
keinen wirklichen Feierabend gibt.“, st<strong>im</strong>men 62% der Befragten in vollem<br />
Maße (15,1%) und überwiegend (46,9%) zu. Detailliert ergeben sich<br />
folgende Werte:<br />
Im Studium gibt es keinen Feierabend.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 2 47,8 -45,8<br />
überwiegend nicht 27 47,8 -20,8<br />
teilweise 62 47,8 14,2<br />
überwiegend 112 47,8 64,2<br />
voll 36 47,8 -11,8<br />
Gesamt 239<br />
Besonders sind die nicht zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorien hierbei deutlich<br />
unter- und die überwiegend zust<strong>im</strong>mende Zelle deutlich überbesetzt.<br />
Eine Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage: „Ich bin bereit, Privates zugunsten des<br />
Studiums <strong>zur</strong>ückzustellen.“, äußerten dagegen nur 36,4% der Befragten in<br />
vollem (4,2%) und überwiegendem Maße (32,2%).<br />
Ich bin bereit, Privates <strong>zur</strong>ückzustellen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 13 47,8 -34,8<br />
überwiegend nicht 42 47,8 -5,8<br />
teilweise 97 47,8 49,2<br />
überwiegend 77 47,8 29,2<br />
voll 10 47,8 -37,8<br />
Gesamt 239<br />
Hier wiederum begründet sich der Prozentwert durch eine starke<br />
Unterbesetzung der Extremantwortkategorien mit einer Tendenz <strong>zur</strong><br />
neutralen Mitte. Gleichzeitig ist jedoch auch hier wieder die überwiegend<br />
zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie überbesetzt.<br />
152
Der Aussage: „Es fällt mir schwer, mich abends und am Wochenende mit<br />
dem Studium zu befassen.“, st<strong>im</strong>men wiederum 58,6% der Befragten in<br />
vollem Maße (14,2%) und überwiegend (30,1%) zu. Im Einzelnen ergeben<br />
sich hierfür die folgenden Werte:<br />
Es fällt mir schwer, mich abends und am Wochenende mit Studium zu befassen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 34 47,8 -13,8<br />
überwiegend 72 47,8 24,2<br />
teilweise 89 47,8 41,2<br />
überwiegend nicht 37 47,8 -10,8<br />
gar nicht 7 47,8 -40,8<br />
Gesamt 239<br />
Aus der Tabelle geht eine deutliche Unterbesetzung der die Aussage stark<br />
verneinenden Kategorie hervor. Die der Aussage teilweise und<br />
überwiegend zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorien sind deutlich<br />
überfrequentiert.<br />
Aus den drei Aussagen wurde eine Skala für das Konstrukt „Anstrengungs-<br />
und Entbehrungsbereitschaft“ gebildet. SCHAARSCHMIDT & KIESCHKE<br />
geben für die Skalenreliabilität einen Cronbachs Alpha Wert von .70, einen<br />
Skalenmittelwert von M=3,49 und eine Standardabweichung von SD=.76<br />
an. (Ebenda S. 251)<br />
Die <strong>im</strong> Rahmen der vorliegenden Untersuchung durchgeführte Analyse<br />
erbringt folgende Werte.<br />
Reliabilitätsstatistik: Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,698 3<br />
153
Item-Skala-Statistiken: Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Im Studium gibt es<br />
keinen Feierabend 5,7490 2,441 ,403 ,580<br />
Ich bin bereit,<br />
Privates<br />
<strong>zur</strong>ückzustellen.<br />
6,2678 2,146 ,497 ,425<br />
Es fällt mir schwer,<br />
mich abends und<br />
am Wochenende mit<br />
dem Studium zu<br />
befassen.<br />
6,7615 2,208 ,398 ,595<br />
Die gebildete Skala weist einen Skalenmittelwert von M= 3,13 mit einer<br />
Standardabweichung von SD= .68 auf.<br />
Nach Transformation auf die Stanineform ergibt sich ein Mittelwert von<br />
M=9,39 mit einer Standardabweichung von SD=2,03. Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Studentennorm sind die Merkmalsausprägungen hinsichtlich des<br />
Konstrukts „Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft“ als<br />
durchschnittlich (Wertebereich 9-11) und <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Idealnorm als<br />
unterdurchschnittlich (Wertebereich 10-12) zu bezeichnen.<br />
9.5 Erholungs- und Entspannungsfähigkeit<br />
Der ersten Aussage hierzu. „Ich verstehe es, Arbeit und Erholung<br />
miteinander zu vereinbaren.“, st<strong>im</strong>men 26,8% der Befragten in vollem<br />
Maße (2,5%) und überwiegend (24,3%) zu. Im Einzelnen betragen die<br />
Werte:<br />
Ich verstehe es, Arbeit und Erholen zu vereinbaren.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 1 47,8 -46,8<br />
überwiegend nicht 69 47,8 21,2<br />
teilweise 105 47,8 57,2<br />
überwiegend 58 47,8 10,2<br />
voll 6 47,8 -41,8<br />
Gesamt 239<br />
Hierbei fällt wiederum die deutliche Unterbesetzung der extremen<br />
Antwortpole auf. Die neutrale Mittelkategorie ist hingegen Überfrequentiert.<br />
Der Aussage: „Ich kann mich in meiner Freizeit gut entspannen und<br />
erholen.“, st<strong>im</strong>men 47,3% der Befragten voll (12,1%) und überwiegend<br />
(35,1%) zu.<br />
154
Ich kann mich in meiner Freizeit gut erholen und entspannen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 13 47,8 -34,8<br />
überwiegend nicht 54 47,8 6,2<br />
teilweise 59 47,8 11,2<br />
überwiegend 84 47,8 36,2<br />
voll 29 47,8 -18,8<br />
Gesamt 239<br />
Hieraus wird eine deutliche Überfrequentierung der überwiegend<br />
zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorie deutlich, wohingegen die<br />
Antwortkategorie, die die Aussage in vollem Maße ablehnt, stark<br />
unterbesetzt ist.<br />
Bezüglich der Aussage: „Ich kann nur schwer abschalten.“, äußerten 34,5%<br />
der Befragten ihre volle(11,8%) oder überwiegende (22,7%) Zust<strong>im</strong>mung.<br />
Dieser Wert ergibt sich vor allem aus einer Unterfrequentierung der<br />
Extremantworten und einer Überbesetzung der die Aussage überwiegend<br />
ablehnenden Antwortkategorie.<br />
Ich kann nur schwer abschalten.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 28 47,6 -19,6<br />
überwiegend 54 47,6 6,4<br />
teilweise 73 47,6 25,4<br />
überwiegend nicht 67 47,6 19,4<br />
gar nicht 16 47,6 -31,6<br />
Gesamt 238<br />
Statistik für Test<br />
Ich verstehe<br />
es, Arbeit und<br />
Erholen zu<br />
vereinbaren<br />
Ich kann mich in<br />
meiner Freizeit<br />
gut erholen und<br />
entspannen<br />
Ich kann nur schwer<br />
abschalten<br />
Chi-Quadrat 162,402 63,573 51,370<br />
df 4 4 4<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000 ,000<br />
Die drei Items wurden in einer Skala „Erholungs- und<br />
Entspannungsfähigkeit“ zusammengefasst. Die hierfür von<br />
SCHAARSCHMIDT und KIESCHKE ermittelten Werte betragen:<br />
Cronbachs Alpha =.84, M=3,88, SD=.74. (Ebenda S. 251)<br />
155
Die <strong>im</strong> Rahmen der vorliegenen Untersuchung durchgeführte<br />
Reliabilitätsanalyse zeigt folgende Werte:<br />
Reliabilitätsstatistik: Erholungs- und Entspannungsfähigkeit<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,770 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Erholungs- und Entspannungsfähigkeit<br />
Ich verstehe es, Arbeit<br />
und Erholen zu<br />
vereinbaren<br />
Ich kann mich in meiner<br />
Freizeit gut erholen und<br />
entspannen<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha,<br />
wenn Item<br />
weggelass<br />
en<br />
6,2059 4,088 ,506 ,796<br />
5,9496 2,749 ,669 ,614<br />
Ich kann nur schwer<br />
abschalten 6,2479 2,677 ,675 ,607<br />
Der Mittelwert der so gebildeten Skala beträgt M=3,06 bei einer<br />
Standardabweichung von SD= .84.<br />
Nach der Transformation auf die Stanineform beträgt der Skalenmittelwert<br />
in der vorliegenden Untersuchung M=9,2 mit einer Standardabweichung<br />
von SD=2,53. Mit diesen Werten kann die Merkmalsausprägung des<br />
Konstruktes „Erholungs- und Entspannungsfähigkeit“ der Studierenden in<br />
der vorliegenden Untersuchung <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Studentennorm als<br />
unterdurchschnittlich (Wertebereich für durchschnittliche Ausprägung 10-<br />
12) und in Relation <strong>zur</strong> Idealnorm als deutlich unterdurchschnittlich<br />
(Wertebereich für durchschnittliche Ausprägung 11-13) bezeichnet werden.<br />
9.6 Fähigkeit zu rationellem Arbeiten<br />
Dem ersten Item: „Es fällt mir schwer, Prioritäten zu setzen.“, st<strong>im</strong>men<br />
32,3% der Befragten in vollem Maße (5,9%) und überwiegend (26,4%) zu.<br />
Im Einzelnen ergeben sich hierfür folgende Werte:<br />
Es fällt mir schwer, Prioritäten zu setzen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 8 47,8 -39,8<br />
überwiegend nicht 64 47,8 16,2<br />
teilweise 90 47,8 42,2<br />
überwiegend 63 47,8 15,2<br />
voll 14 47,8 -33,8<br />
Gesamt 239<br />
156
Diese Werte sind damit in starkem Maße geprägt durch die<br />
Unterfrequentierung der Extremantworten und eine starke Tendenz <strong>zur</strong><br />
neutralen Mitte.<br />
Der Aussage: „Ich komme in der vorgegebenen Zeit meist gut klar mit<br />
meinen Arbeiten.“, st<strong>im</strong>men 30,5% der Befragten in vollem (2,1%) und<br />
überwiegendem Maße (28,5%) zu.<br />
Ich komme in der vorgegebenen Zeit meist gut mit meinen Arbeiten klar.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 5 47,8 -42,8<br />
überwiegend 68 47,8 20,2<br />
teilweise 93 47,8 45,2<br />
überwiegend nicht 68 47,8 20,2<br />
gar nicht 5 47,8 -42,8<br />
Gesamt 239<br />
Auch hierbei ergibt sich eine deutliche Unterbesetzung der beiden<br />
Extremantworten mit einer starken Tendenz <strong>zur</strong> Auswahlantwort „teilweise“.<br />
Ihre Zust<strong>im</strong>mung <strong>zur</strong> dritten Aussage: “Ich fürchte, ich arbeite nicht rationell<br />
genug.“, artikulierten 37,2% in vollem (7,1%) und überwiegendem Maße<br />
(30,1%).<br />
Ich fürchte, ich arbeite nicht rationell genug.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 10 47,8 -37,8<br />
überwiegend nicht 51 47,8 3,2<br />
teilweise 89 47,8 41,2<br />
überwiegend 72 47,8 24,2<br />
voll 17 47,8 -30,8<br />
Gesamt 239<br />
Diese Werte werden wiederum geprägt durch die starke Überbesetzung<br />
der neutralen Kategorie und die deutliche Unterfrequentierung der<br />
Extremantworten.<br />
Statistik für Test<br />
Es fällt mir<br />
schwer,<br />
Prioritäten zu<br />
setzen<br />
Ich komme in der<br />
vorgegebenen Zeit<br />
meist gut mit<br />
meinen Arbeiten<br />
klar.<br />
Ich fürchte, ich<br />
arbeite nicht<br />
rationell genug<br />
Chi-Quadrat 104,619 136,460 97,715<br />
df 4 4 4<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000 ,000<br />
157
Die Aussagen sollen <strong>zur</strong> Skala „Fähigkeit zum rationellen Arbeiten“<br />
zusammengefasst werden. SCHAARSCHMIDT & KIESCHKE geben hierfür<br />
folgende Werte an: Cronbachs Alpha =.73, M=3,80, SD=.72.<br />
In der vorliegenden Untersuchung konnten für die Reliabilität der Skala<br />
folgende Werte gemessen werden:<br />
Reliabilitätsstatistik: Fähigkeit zum rationellen Arbeiten<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,713 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Fähigkeit zum rationellen Arbeiten<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte Item-<br />
Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Es fällt mir schwer,<br />
Prioritäten zu setzen 6,1464 2,092 ,444 ,586<br />
Ich komme in der<br />
vorgegebenen Zeit<br />
meist gut mit<br />
meinen Arbeiten klar<br />
6,1925 2,400 ,400 ,658<br />
Ich fürchte, ich<br />
arbeite nicht<br />
rationell genug<br />
6,0460 2,036 ,443 ,588<br />
Der Mittelwert der so gebildeten Skala beträgt M=2,93, die<br />
Standardabweichung SD=.66. Nach Transformation der Werte auf die Form<br />
einer Stanienskale beträgt der Mittelwert der Skala M=8,81 und die<br />
Standardabweichung SD=1,98. Im Vergleich <strong>zur</strong> Studentennorm erreichen<br />
die untersuchten Studierenden damit unterdurchschnittliche (Wertebereich<br />
für durchschnittliche Ausprägungen 10-12) und <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Idealnorm<br />
stark unterdurchschnittliche (Wertebereich für durchschnittliche<br />
Ausprägungen 11-12) Ergebnisse.<br />
9.7 Stressresistenz<br />
Der ersten Aussage: „Unter Stress lebe ich erst so richtig auf.“, st<strong>im</strong>men<br />
30,3% der Befragten in vollem Maße (6,7%) und überwiegend (23,5%) zu.<br />
Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
Unter Stress lebe ich erst richtig auf.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
voll 16 47,6 -31,6<br />
überwiegend 56 47,6 8,4<br />
teilweise 78 47,6 30,4<br />
überwiegend nicht 66 47,6 18,4<br />
gar nicht 22 47,6 -25,6<br />
Gesamt 238<br />
158
Hierbei ist <strong>im</strong> Antwortverhalten besonders die deutliche Vermeidung der<br />
Extremantworten mit Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte erkennbar.<br />
Eine ähnliche Antwortverteilung ergibt sich hinsichtlich des nächsten Items.<br />
Der Aussage: „Bei großem Druck gerate ich leicht in Panik.“, st<strong>im</strong>men<br />
36,1% der Befragten in vollem (8,8%) und überwiegendem Maße (21,3%)<br />
zu.<br />
Bei großem Druck gerate ich leicht in Panik<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 11 47,6 -36,6<br />
überwiegend nicht 73 47,6 25,4<br />
teilweise 81 47,6 33,4<br />
überwiegend 52 47,6 4,4<br />
voll 21 47,6 -26,6<br />
Gesamt 238<br />
Der Aussage: „Wenn mehreres gleichzeitig zu tun ist, wird mir das schnell<br />
zu viel.“, st<strong>im</strong>men 36,1% in vollem (9,2%) und überwiegendem Maße<br />
(26,9%) zu.<br />
Wenn mehreres gleichzeitig zu tun ist, wird mir das schnell zu viel.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 8 47,6 -39,6<br />
überwiegend nicht 51 47,6 3,4<br />
teilweise 93 47,6 45,4<br />
überwiegend 64 47,6 16,4<br />
Voll 22 47,6 -25,6<br />
Gesamt 238<br />
Auch hier werden die Extremantworten vermieden, wobei die eher<br />
zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie vergleichsweise überfrequentiert ist.<br />
Statistik für Test<br />
Unter Stress<br />
lebe ich erst<br />
richtig auf.<br />
Bei großem<br />
Druck gerate<br />
ich leicht in<br />
Panik<br />
Wenn mehreres<br />
gleichzeitig zu tun ist,<br />
wird mir das schnell zu<br />
viel.<br />
Chi-Quadrat 62,756 80,403 95,908<br />
df 4 4 4<br />
Asymptotische Signifikanz ,000 ,000 ,000<br />
159
Aus den vorliegenden Items soll die Skala „Stressresistenz“ gebildet<br />
werden. Hierfür liegen bei SCHAARSCHMIDT und KIESCHKE die Werte<br />
für Cronbachs Alpha von .69, Skalenmittelwert M=3,57 und<br />
Standardabweichung SD=.74 vor. (Ebenda S. 251)<br />
Die Reliabilitätsanaylse für die in der vorliegenden Untersuchung gebildete<br />
Skala erbringt folgende Werte:<br />
Reliabilitätsstatistik: Stressresistenz<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,703 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Stressresistenz<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Unter Stress lebe ich erst<br />
richtig auf. 6,1681 3,305 ,393 ,772<br />
Bei großem Druck gerate<br />
ich leicht in Panik 6,2647 2,719 ,645 ,448<br />
Wenn mehreres<br />
gleichzeitig zu tun ist, wird<br />
mir das schnell zu viel.<br />
6,0882 3,136 ,543 ,587<br />
Der Skalenmittelwert liegt bei M=2,91 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=.81. Nach Transformation auf eine Stanineskala erreicht der Mittelwert<br />
der Skala M=8,74 und die Standardabweichung SD=2,45. Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Studentennorm ist damit die Merkmalsausprägung „Stressresistenz“ als<br />
unterdurchschnittlich (Wertebereich für durchschnittliche Ausprägungen 9-<br />
11) und in Relation <strong>zur</strong> Idealnorm als deutlich unterdurchschnittlich<br />
(Wertebereich für durchschnittliche Ausprägungen 11-12) zu bezeichnen.<br />
9.8 Persönlichkeitsmerkmale<br />
Die Skalen, die aufgrund der vorliegenden Reliabilitätsstatistik gebildet<br />
werden konnten, werden zu einer Gesamtskala „Persönlichkeitsmerkmale“<br />
zusammengefasst. Diese Skala wurde einer Reliabilitätsanalyse<br />
unterzogen, die folgende Werte aufweist:<br />
Reliabilitätsstatistik: Persönlichkeitsmerkmale<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,797 5<br />
Item-Skala-Statistiken: Persönlichkeitsmerkmale<br />
160
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha,<br />
wenn Item<br />
weggelass<br />
en<br />
Frustrationstoleranz 46,4468 49,983 ,484 ,752<br />
Flexibilität 45,7787 55,549 ,434 ,770<br />
Entbehrungsbereitschaft 46,7617 58,516 ,302 ,805<br />
Erholungsfähigkeit 46,9957 52,295 ,364 ,795<br />
Stressresistenz 47,4340 46,614 ,574 ,719<br />
Die Skala wurde einer rotierten Hauptkomponentenanalyse unterzogen, um<br />
zu prüfen, durch welche Faktoren die Skala geprägt wird. Die Ergebnisse<br />
sind nachfolgend dargestellt:<br />
Rotierte Komponentenmatrix(a)<br />
Komponente<br />
1 2<br />
Frustrationstoleranz ,403 ,605<br />
Flexibilität ,603 ,253<br />
Entbehrungsbereitschaft -,056 ,858<br />
Erholungsfähigkeit ,836 -,144<br />
Stressresistenz ,663 ,380<br />
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.<br />
Rotationsmethode: Var<strong>im</strong>ax mit Kaiser-Normalisierung.<br />
a Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.<br />
Als Ergebnis der Analyse ist damit eine zweifaktorielle Lösung<br />
anzunehmen, wobei die Faktoren 57,88% an Gesamtvarianz, der erste<br />
Faktor 31,72% und der zweite 26,16% erklären. Der erste Faktor kann<br />
nach obiger Rotation bezeichnet werden als „effizient-flexible<br />
regenerationsfähige Arbeitsweise“. Der zweite Faktor thematisiert das<br />
Ausmaß des persönlichen Einsatzes und der Misserfolgsverarbeitung.<br />
Beide Faktoren werden in das zu bildende Belastung-Regressionsmodell<br />
als unabhängige Variable für das Belastungsempfinden der Studierenden<br />
einbezogen.<br />
161
10 Sorgen und Ängste <strong>im</strong> Studium<br />
Den Studierenden wurden 8 Items vorgelegt, die vermutete Ängste und<br />
Sorgen, die mit dem individuellen Studium in Zusammenhang stehen<br />
könnten, thematisieren. Diesen Aussagen war in einer 5 Auswahlantworten<br />
umfassenden Skala zuzust<strong>im</strong>men.<br />
Die Antworten auf die einzelnen Items werden zunächst <strong>im</strong> Überblick mit<br />
den Werten der zentralen Tendenz und in ihren Streuungen dargestellt, um<br />
hieraus eine Rangfolge der einzelnen Themen bilden zu können.<br />
Statistik zu Ängsten und Sorgen<br />
Orientierung<br />
in Fachinhalten<br />
Anforderung<br />
gerecht<br />
zu<br />
werden<br />
Mangelnde<br />
Praxisnähe<br />
Fehlender<br />
roter<br />
Faden<br />
Konkurrenz<br />
In der<br />
Masse<br />
untergehen<br />
Studium<br />
scheitert<br />
Keinen<br />
persönlichen<br />
Nutzen<br />
Mittelwert<br />
3,3431 3,8787 3,1590 2,9205 2,6151 2,7741 3,9038 2,1339<br />
Median 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 2,0000<br />
,93455 ,92464 ,99570 1,04014 1,09733 1,08813 1,1241 1,07241<br />
Werden zudem die Kategorien „st<strong>im</strong>me sehr stark zu“ und „st<strong>im</strong>me stark<br />
zu“ zusammengefasst, ergibt sich prozentual folgende Übersicht:<br />
Statistik zu Ängsten und Sorgen<br />
St<strong>im</strong>me<br />
sehr stark<br />
und stark<br />
zu<br />
Standardabweichung<br />
Orientierung<br />
in Fachinhalten<br />
Anforderung<br />
gerecht<br />
zu<br />
werden<br />
Mangelnde<br />
Praxisnähe<br />
Fehlender<br />
roter<br />
Faden<br />
Konkurrenz<br />
In der<br />
Masse<br />
untergehen<br />
Studium<br />
scheitert<br />
Keinen<br />
persönlichen<br />
Nutzen<br />
42,3% 69,9% 36,8% 27,6% 24,3% 26,8% 66,9% 12,2%<br />
Die Sorgen mit dem Studium zu scheitern und den Anforderungen nicht<br />
gerecht zu werden sind sowohl prozentual als auch durchschnittlich am<br />
stärksten ausgeprägt. Dies unterstreicht nochmals der relativ hohe<br />
Medianwert. Im Einzelnen ergeben sich für beide Items folgende Werte:<br />
162
Ich habe Sorge, den Anforderungen nicht gerecht zu werden.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
weniger 23 59,8 -36,8<br />
teilweise 49 59,8 -10,8<br />
stark 101 59,8 41,3<br />
sehr stark 66 59,8 6,3<br />
Gesamt 239<br />
Bei diesem Item wird ersichtlich, dass insbesondere die stark zust<strong>im</strong>mende<br />
Antwortkategorie überfrequentiert ist, während die eher weniger<br />
zust<strong>im</strong>mende Kategorie eine deutliche Unterbesetzung aufweist. Daneben<br />
ergibt sich innerhalb des Antwortverhaltens die Besonderheit, dass die<br />
vollständig ablehnende Auswahlantwort nicht besetzt wurde. Die Sorgen,<br />
den Anforderungen des Studiums nicht gerecht werden zu können, werden<br />
demzufolge zumindest partiell von allen befragten Studierenden geteilt.<br />
Ähnlich gestaltet sich das Antwortbild auf die Aussage: „Ich habe Sorge,<br />
mit meinem Studium zu scheitern.“:<br />
Ich habe Sorge mit meinem Studium zu scheitern<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 8 47,8 -39,8<br />
weniger 22 47,8 -25,8<br />
teilweise 49 47,8 1,2<br />
stark 66 47,8 18,2<br />
sehr stark 94 47,8 46,2<br />
Gesamt 239<br />
Auch hier sind die Antwortkategorien, die die Aussage eher ablehnen,<br />
deutlich unterbesetzt, während eine deutliche Mehrheit der Aussage stark<br />
und sehr stark zust<strong>im</strong>mt.<br />
Ebenso ist die Befürchtung, in den Inhalten der Fachwissenschaften die<br />
Orientierung zu verlieren, bei 42,3% der Befragten in mindestens starkem<br />
Maße gegeben.<br />
Mit bereitet Sorge, in der Vielfalt der Fachinhalte die Orientierung zu verlieren.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 4 47,8 -43,8<br />
weniger 38 47,8 -9,8<br />
teilweise 96 47,8 48,2<br />
stark 74 47,8 26,2<br />
sehr stark 27 47,8 -20,8<br />
Gesamt 239<br />
163
In der Werteübersicht ergibt sich hier jedoch nicht wie bei den bereits<br />
dargestellten Aussagen die Tendenz <strong>zur</strong> Wahl der eher neutralen Mitte,<br />
während die Extremantwortkategorien unterbesetzt sind. Der Medianwert<br />
n<strong>im</strong>mt <strong>im</strong> Vergleich zu den beiden anderen Aussagen den geringeren Wert<br />
von 3 an.<br />
Eine mangelnde Praxisnähe wird ebenfalls als Sorge artikuliert.<br />
Ich habe Sorge, dass es <strong>im</strong> Studium an Praxisnähe mangelt.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 10 47,8 -37,8<br />
weniger 51 47,8 3,2<br />
teilweise 90 47,8 42,2<br />
stark 67 47,8 19,2<br />
sehr stark 21 47,8 -26,8<br />
Gesamt 239<br />
Auch hier ergeben sich die festgestellten Werte der zentralen Tendenz<br />
durch eine deutliche Unterbesetzung der Extremantworten und eine<br />
Überbesetzung der neutralen Kategorie.<br />
Die Sorge, in der Masse der Studierenden unterzugehen, sowie die um die<br />
Konkurrenz unter den Studierenden, werden von vergleichsweise wenigen<br />
Studierenden geteilt.<br />
Ich habe Sorge in der Masse unterzugehen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 28 47,8 -19,8<br />
weniger 76 47,8 28,2<br />
teilweise 71 47,8 23,2<br />
stark 50 47,8 2,2<br />
sehr stark 14 47,8 -33,8<br />
Gesamt 239<br />
Ich habe Sorge um die starke Konkurrenz unter den Studierenden<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 37 47,8 -10,8<br />
weniger 86 47,8 38,2<br />
teilweise 58 47,8 10,2<br />
stark 48 47,8 ,2<br />
sehr stark 10 47,8 -37,8<br />
Gesamt 239<br />
Hier wird deutlich, dass die Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte zwar wiederum<br />
gegeben ist, dass die zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie jedoch sehr stark<br />
164
unterbesetzt ist, während diese Unterfrequentierung innerhalb der<br />
verneinenden Kategorie weniger deutlich ausfällt. Der vergleichsweise<br />
geringe Medianwert der Aussage: „Ich habe Sorge um die starke<br />
Konkurrenz unter den Studierenden“, von 2 weist zudem eine relativ<br />
geringe Ausprägung dieser Sorge bei den Befragten nach.<br />
Deutlich am geringsten wird von den Studierenden die Sorge artikuliert, <strong>im</strong><br />
Studium keinen persönlichen Nutzen zu erkennen.<br />
Ich habe Sorge, in meinem Studium keinen persönlichen Nutzen zu sehen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 76 47,8 28,2<br />
weniger 93 47,8 45,2<br />
teilweise 41 47,8 -6,8<br />
stark 20 47,8 -27,8<br />
sehr stark 9 47,8 -38,8<br />
Gesamt 239<br />
Hierbei geht eine deutliche Unterfrequentierung der zust<strong>im</strong>menden<br />
Antworten einher mit einer starken Ablehnung der Aussage.<br />
Statistik für Test<br />
Roter<br />
Faden<br />
Nutzen<br />
Masse<br />
Chi-<br />
Quadrat 114,15 53,669 90,100 79,724 65,038 60,100 98,678 108,0<br />
Orientierung<br />
Fachinhalte<br />
Anforderungen<br />
Praxisnähe<br />
Konkurrenz<br />
Scheitern<br />
df<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz<br />
4 3 4 4 4 4 4 4<br />
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000<br />
Zwischen den Aussagen ergeben sich aufschlussreiche Zusammenhänge<br />
165
Korrelationen der Ängste und Sorgen<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
Signifikanz<br />
Praxis<br />
-nähe<br />
Roter<br />
Faden<br />
Orientierung<br />
Fachinhalte<br />
Anforderungen<br />
Konkurrenz<br />
Masse<br />
Scheitern<br />
Nutzen<br />
1 ,442 ,171 ,223 ,109 ,205 ,240 ,076<br />
,000 ,008 ,001 ,093 ,001 ,000 ,245<br />
Roter<br />
Faden<br />
Masse<br />
Orientie<br />
-rung<br />
Fachinhalte<br />
Anforderung<br />
Praxisnähe<br />
Konkurrenz<br />
Scheitern<br />
Nutzen<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1 ,222 ,178 ,223 ,181 ,591 ,203<br />
Signifikanz<br />
,001 ,006 ,001 ,005 ,000 ,002<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1 ,248 ,064 ,157 -,013 ,196<br />
Signifikanz<br />
,000 ,325 ,015 ,847 ,002<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1 ,128 ,092 ,170 ,247<br />
Signifikanz<br />
,049 ,157 ,009 ,000<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1 ,522 ,140 ,083<br />
Signifikanz<br />
,000 ,030 ,200<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1 ,174 ,094<br />
Signifikanz<br />
,007 ,145<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1 ,209<br />
Signifikanz<br />
Korrelation nach<br />
Pearson 1<br />
Signifikanz<br />
,001<br />
Der stärkste Zusammenhang ergibt sich zwischen den Aussagen, Sorge zu<br />
haben, den Anforderungen nicht zu genügen und mit dem Studium zu<br />
scheitern. Derjenige, der befürchtet, den Anforderungen nicht gerecht<br />
werden zu können, empfindet eher die Sorge, mit dem Studium insgesamt<br />
zu scheitern. Daneben korreliert die Sorge, den Anforderungen nicht<br />
gerecht werden zu können, mit unterschiedlicher Effektstärke zu allen<br />
anderen Sorgen, die die Studierenden artikulieren. Daneben hängt die<br />
Befürchtung, den Anforderungen nicht gerecht werden zu können, mit der<br />
Sorge zusammen, in den Fachinhalten die Orientierung zu verlieren. Wer<br />
befürchtet, diese Orientierung verlieren zu können, befürchtet in<br />
166
steigendem Maße auch, den Anforderungen nicht gerecht werden zu<br />
können.<br />
Ein ebenfalls wegen seiner hohen Effektstärke sehr interessanter<br />
Zusammenhang ergibt sich zwischen den Aussagen: „Ich habe Sorge in<br />
der Masse der Studierenden unterzugehen.“ und „Ich habe Sorge vor der<br />
starken Konkurrenz unter den Studierenden“. Beide Aussagen bilden einen<br />
positiven Zusammenhang. Dies heißt, wer die erste Sorge in verstärktem<br />
Maße artikuliert, n<strong>im</strong>mt die zweite in ähnlich hohem Ausmaß an sich wahr.<br />
11 Alternativen zum gegenwärtigen Studium<br />
Abschließend wurden die Studierenden gebeten einzuschätzen, welche<br />
Handlungsalternativen sie wählen würden, wenn sie ihre berufliche<br />
Entwicklung nochmals planen würden. Hierzu ergeben sich folgende<br />
Werte:<br />
Statistik zu den Handlungsalternativem<br />
Nicht<br />
wieder<br />
studieren<br />
Anderen<br />
<strong>Studien</strong>gang<br />
wählen<br />
Anderes<br />
1. Fach<br />
studieren<br />
Anderes<br />
2. Fach<br />
studieren<br />
Andere<br />
Uni<br />
wählen<br />
alles<br />
wieder so<br />
machen<br />
Mittelwert 1,6568 2,1021 1,9316 2,5063 2,2152 3,0464<br />
Median 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000<br />
Standardabweichung<br />
,98326 1,15016 1,22721 1,45736 1,19679 1,23592<br />
Die Studierenden st<strong>im</strong>men durchschnittlich der Aussage, alles genauso<br />
wieder machen zu würden, in Relation zu den anderen Items am stärksten<br />
zu. 36,3% der Befragten wählen hier die Antwort „sehr stark“ (13,1%) und<br />
stark (23,2%). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Antwortbild:<br />
Ich würde wieder alles genauso machen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 38 47,4 -9,4<br />
weniger 30 47,4 -17,4<br />
teilweise 83 47,4 35,6<br />
stark 55 47,4 7,6<br />
sehr stark 31 47,4 -16,4<br />
Gesamt 237<br />
Die Übersicht gibt eine deutliche Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte an, wobei die<br />
extremen Antwortkategorien deutlich unterbesetzt sind.<br />
167
Die durchschnittlich stärkste alternative Wahl sehen die Studierenden für<br />
ihr zweites studiertes Fach. Hier st<strong>im</strong>men 26,1% der entsprechenden<br />
Aussage in sehr starkem (16%) und starkem Maße (10,1%) zu.<br />
Ich würde ein anderes zweites Fach wählen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 83 47,4 35,6<br />
weniger 51 47,4 3,6<br />
teilweise 41 47,4 -6,4<br />
stark 24 47,4 -23,4<br />
sehr stark 38 47,4 -9,4<br />
Gesamt 237<br />
Innerhalb der Antworten sind die ablehnenden Kategorien deutlich<br />
überfrequentiert, während die zust<strong>im</strong>menden Kategorien unterbesetzt sind.<br />
Zusammenhänge zu den einzelnen studierten Fächern können in<br />
folgenden Fällen gemessen werden:<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Quadrat<br />
X 22,933 8
Ich würde ein anderes erstes Fach wählen.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 122 46,8 75,2<br />
weniger 51 46,8 4,2<br />
teilweise 33 46,8 -13,8<br />
stark 11 46,8 -35,8<br />
sehr stark 17 46,8 -29,8<br />
Gesamt 234<br />
Ein Zusammenhang zum jeweils studierten Fach ist hier nur für Mathematik<br />
feststellbar. Der Handlungsoption st<strong>im</strong>men die Mathematikstudierenden in<br />
signifikant höherem Maße zu. (Chi-Quadrat 16,757, df=4, p
Besonders deutlich wird <strong>im</strong> Antwortverhalten die sehr starke<br />
Überfrequentierung der stark ablehnenden Antwortkategorie, wobei die<br />
zust<strong>im</strong>menden Zellen stark unterbesetzt sind.<br />
Der Aussage, lieber nicht wieder studieren zu wollen, st<strong>im</strong>men nur 7,2% in<br />
sehr starkem (2,1%) und starkem Maße (5,1%) zu.<br />
Wenn ich nochmal entscheiden könnte, würde ich nicht wieder studieren.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gar nicht 141 47,2 93,8<br />
weniger 57 47,2 9,8<br />
teilweise 21 47,2 -26,2<br />
stark 12 47,2 -35,2<br />
sehr stark 5 47,2 -42,2<br />
Gesamt 236<br />
Die mehrheitlich starke Ablehnung dieser Alternative wird anhand des<br />
Antwortverhaltens durch die sehr starke Überbesetzung der<br />
Auswahlantwort „gar nicht“ deutlich.<br />
170
12 Belastungsempfinden<br />
12.1 Auswertung der einzelnen Items<br />
Den Befragten wurden insgesamt 11 Items vorgelegt, die das individuelle<br />
Belastungsempfinden der Studierenden abbilden sollen. Im Folgenden<br />
werden die einzelnen Items zunächst deskriptiv ausgewertet.<br />
In einem ersten Item wurden die Studierenden danach befragt, in welchem<br />
Maße sie sich derzeit insgesamt belastet fühlen. 71,9 % der Befragten<br />
wählen hier die Antworten „sehr stark“ (23,8%) und stark (48,1%). Der<br />
Mittelwert der 5-stufigen Antwortskala beträgt M=3,94, die<br />
Standardabweichung SD=,755 und der Medianwert 4. Im Einzelnen<br />
ergeben sich folgende Antworten:<br />
In welchem Maße fühlen Sie sich derzeit insgesamt belastet?<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gering 4 57,8 -53,8<br />
teils 61 57,8 3,3<br />
stark 111 57,8 53,3<br />
sehr stark 55 57,8 -2,8<br />
Gesamt 231<br />
Neben der deutlichen Überfrequentierung der Auswahlantwort „stark“ und<br />
der starken Unterbesetzung der Auswahlantwort „gering“ wird in der<br />
Übersicht deutlich, dass kein Befragter die Kategorie „sehr gering“ gewählt<br />
hat. Durchschnittlich und mehrheitlich geben die Studierenden eine starke<br />
Belastung an.<br />
In Abhängigkeit zu den Fächern ergeben sich folgende Zusammenhänge:<br />
Übersicht: Belastung insgesamt in Abhängigkeit zum studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Belastung Belastung Quadrat Signifikanz<br />
Mathematik<br />
X 11,031 3 0,012 0,179<br />
Chemie X 10,026 3 0,018 0,169<br />
In zwei weiteren Items wurde dieses Belastungsempfinden aufgegliedert in<br />
die Bereiche der Belastung durch das Studium und die durch den<br />
Privatbereich. 70,6% der Studierenden geben in Bezug auf <strong>Belastungen</strong>,<br />
171
die vom Studium ausgehen an, hier sehr starke (23,4%) und starke (47,2%)<br />
Effekte wahrzunehmen. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Antwortbild:<br />
In welchem Maße fühlen Sie sich derzeit durch Ihr Studium belastet?<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 1 46,2 -45,2<br />
gering 2 46,2 -44,2<br />
teils 65 46,2 18,8<br />
stark 109 46,2 62,8<br />
sehr stark 54 46,2 7,8<br />
Gesamt 231<br />
Wie zu sehen ist, sind besonders die Auswahlantworten, die eine nur<br />
geringe Belastung artikulieren, deutlich unterbesetzt, während vor allem <strong>im</strong><br />
Hinblick auf die Antwort einer starken Belastung eine starke<br />
Überfrequentierung vorliegt. Der Mittelwert von M=3,92 mit einer<br />
Standardabweichung von SD=,765 und einem Median von 4 repräsentieren<br />
eine starke Belastungswahrnehmung durch den <strong>Studien</strong>bereich bei den<br />
Befragten. Zusammenhänge zu einzelnen studierten Fächern waren hierbei<br />
nicht messbar.<br />
Andere Werte ergeben sich für die <strong>Belastungen</strong>, die vom privaten Bereich<br />
ausgehen. Hier geben 22,9% der Befragten an, sehr starke (6,9%) und<br />
starke (16,0%) <strong>Belastungen</strong> wahrzunehmen.<br />
In welchem Maße fühlen Sie sich derzeit durch Privates belastet?<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 17 46,2 -29,2<br />
gering 69 46,2 22,8<br />
teils 92 46,2 45,8<br />
stark 37 46,2 -9,2<br />
sehr stark 16 46,2 -30,2<br />
Gesamt 231<br />
Zum Einen fällt die aufgrund der niedrigen oben angegebenen<br />
Prozentwerte erwartete deutliche Unterfrequentierung der<br />
Antwortkategorien auf, die eine sehr starke und starke Belastung<br />
artikulieren. Zum Anderen ergibt sich eine Tendenz <strong>zur</strong> neutralen<br />
Mittelkategorie mit einer Unterfrequentierung der Auswahlantworten, die<br />
eine sehr geringe Belastung durch den privaten Bereich repräsentieren.<br />
Der Mittelwert auf das Item beträgt M=2,85 mit einer Standardabweichung<br />
von SD=1,0 und einem Medianwert von 3. Durchschnittlich nehmen die<br />
172
Studierenden damit <strong>im</strong> privaten Bereich bei relativ hohen individuellen<br />
Streuungen nur teilweise <strong>Belastungen</strong> wahr.<br />
In den nachfolgenden 4 Items wurden die Studierenden gebeten, einzelnen<br />
Aussagen in dem Grad zuzust<strong>im</strong>men, den sie für ihre gegenwärtige<br />
Situation für zutreffend halten. Zunächst wurde den Befragten die Aussage:<br />
„Ich bin an der obersten Belastungsgrenze <strong>im</strong> Studium angelangt.“<br />
vorgelegt. Diesem Item st<strong>im</strong>men 38,5 % in sehr starkem (5,2%) und<br />
starkem Maße (33,3%) zu.<br />
Ich bin an der obersten Belastungsgrenze <strong>im</strong> Studium angelangt.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 5 46,2 -41,2<br />
gering 40 46,2 -6,2<br />
teils 97 46,2 50,8<br />
stark 77 46,2 30,8<br />
sehr stark 12 46,2 -34,2<br />
Gesamt 231<br />
Der Mittelwert auf das Item (M=3,22) mit einer Standardabweichung von<br />
SD=0,87 und einem Medianwert von 3 erklärt sich, wie aus der Tabelle<br />
ersichtlich ist, aus einer deutlichen Unterbesetzung der extremen<br />
Antwortpole und einer Überfrequentierung der Antwortzelle „stark“.<br />
Gleichzeitig kann eine Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Kategorie erkannt werden.<br />
Ergänzt wurde diese Aussage durch das Item: „Ich arbeite so viel wie<br />
möglich für meinen <strong>Studien</strong>erfolg.“ Dieser Aussage st<strong>im</strong>men 51,6 % der<br />
Befragten in sehr starkem Maße (8,7%) und stark (42,9%) zu. Im Einzelnen<br />
ergeben sich folgende Antwortverteilungen:<br />
Ich arbeite so viel wie nur möglich für meinen <strong>Studien</strong>erfolg.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gering 18 57,8 -39,8<br />
teils 94 57,8 36,3<br />
stark 99 57,8 41,3<br />
sehr stark 20 57,8 -37,8<br />
Gesamt 231<br />
Der negative Extrempol ist nicht besetzt, während sich eine<br />
Unterbesetzung der Kategorien „gering“ und „sehr stark“ ergibt. Die stark<br />
zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie ist ebenso wie die neutrale Mittelkategorie<br />
überfrequentiert. Der Mittelwert auf das Item beträgt M=3,5, die<br />
Standardabweichung SD=,762 und der Median 4.<br />
173
In der nachfolgenden Aussage werden die Auswirkungen studienbedingter<br />
<strong>Belastungen</strong> auf den privaten Bereich erfragt. Der Aussage: „Ich<br />
vernachlässige wegen des Studiums oftmals Privates.“ st<strong>im</strong>men 35,7 % der<br />
befragten Studierenden in sehr starkem Maße (10%) und stark (25,7%) zu.<br />
Detailliert ergibt sich die folgende Verteilung der Antworten auf das Item:<br />
Ich vernachlässige wegen des Studiums oftmals Privates.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 6 46,0 -40,0<br />
gering 39 46,0 -7,0<br />
teils 103 46,0 57,0<br />
stark 59 46,0 13,0<br />
sehr stark 23 46,0 -23,0<br />
Gesamt 230<br />
Die extremen Antwortkategorien sind unterbesetzt, während sich eine<br />
deutliche Tendenz <strong>zur</strong> Wahl der neutralen Mittelkategorie und eine leichte<br />
Überfrequentierung der stark zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorie ergeben. Der<br />
Mittelwert des Items beträgt M=3,23, die Standardabweichung SD=,937<br />
und der Medianwert 3.<br />
In einer letzten Aussage wurde als Spiegelung des Items „Ich arbeite so<br />
viel wie möglich für meinen <strong>Studien</strong>erfolg.“ die Aussage präsentiert: „Ich<br />
könnte <strong>im</strong> Studium auch mehr leisten.“ Dieser Aussage st<strong>im</strong>men 30,3 %<br />
der Befragten in sehr starkem (6,5%) und starkem Maße (23,8%) zu.<br />
Ich könnte <strong>im</strong> Studium auch mehr leisten.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 12 46,2 -34,2<br />
gering 64 46,2 17,8<br />
teils 85 46,2 38,8<br />
stark 55 46,2 8,8<br />
sehr stark 15 46,2 -31,2<br />
Gesamt 231<br />
Sehr deutlich wird innerhalb der Antwortverteilung, dass beide Extrempole<br />
deutlich unterbesetzt sind, währenddessen eine relativ starke Tendenz <strong>zur</strong><br />
neutralen Mitte zu verzeichnen ist. Der Mittelwert des Items beträgt M=2,99<br />
mit einer Standardabweichung von SD=,993 und einem Medianwert von 3.<br />
Im folgenden Item sollten die Befragten den Umfang ihrer Freizeit<br />
beurteilen. Dabei beurteilten 0,9 % der Befragten diesen Umfang als sehr<br />
hoch und weitere 5,2% als hoch. Dem gegenüber sagen 60,6 % der<br />
174
Studierenden, der Umfang ihrer Freizeit sei gering bis sehr gering. Im<br />
Einzelnen ergeben sich folgende Antworten:<br />
Wie beurteilen Sie den Umfang ihrer Freizeit?<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 43 46,2 -3,2<br />
gering 97 46,2 50,8<br />
teils 77 46,2 30,8<br />
hoch 12 46,2 -34,2<br />
sehr hoch 2 46,2 -44,2<br />
Gesamt 231<br />
Die Auswahlantworten, die einen hohen und sehr hohen Umfang an<br />
Freizeit repräsentieren, sind deutlich unterbesetzt, während die<br />
Auswahlantwort „gering“ stark überfrequentiert ist. Außerdem besteht eine<br />
Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte. Der Mittelwert des Items beträgt M=2,88 mit<br />
einer Standardabweichung von SD=1,15 und einem Medianwert von 2.<br />
Das nachfolgende Item eruiert die durchschnittliche Stressbelastung.<br />
Hierbei geben 7,8% der Befragten an, ihre Stressbelastung sei sehr hoch.<br />
Weitere 25,3 % beurteilen ihre Stressbelastung als hoch. Im Einzelnen<br />
ergibt sich folgendes Bild:<br />
Wie beurteilen Sie Ihre durchschnittliche Stressbelastung?<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
gering 38 57,8 -19,8<br />
teils 116 57,8 58,3<br />
hoch 59 57,8 1,3<br />
sehr hoch 18 57,8 -39,8<br />
Gesamt 231<br />
Auffällig ist zunächst, dass keiner der Befragten die durchschnittliche<br />
Stressbelastung als sehr gering beurteilt. Außerdem ist die<br />
Antwortkategorie „gering“ deutlich unterbesetzt. Daneben ist eine Tendenz<br />
<strong>zur</strong> Auswahl der neutralen Mittelkategorie feststellbar. Der positive<br />
Extremantwortpol ist darüber hinaus deutlich unterfrequentiert. Der<br />
Mittelwert des Items beträgt M=3,25 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=,821 und einem Medianwert von 3.<br />
Neben diesen Angaben st<strong>im</strong>men 4,8 % der Befragten der Aussage: „Im<br />
Vergleich zu meiner Schulzeit bin ich wesentlich krankheitsanfälliger.“ in<br />
sehr starkem Maße und weitere 14,7% in starkem Maße zu.<br />
175
Ich bin wesentlich krankheitsanfälliger als <strong>zur</strong> Schulzeit.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 54 46,2 7,8<br />
gering 72 46,2 25,8<br />
teils 60 46,2 13,8<br />
stark 34 46,2 -12,2<br />
sehr stark 11 46,2 -35,2<br />
Gesamt 231<br />
Im Antwortverhalten auf dieses Item wird besonders deutlich, dass die stark<br />
und sehr stark zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorien unterfrequentiert sind. Der<br />
Mittelwert der Antworten auf das Item beträgt M=2,46 mit einer<br />
Standardabweichung von SD=1,14 und einem Medianwert von 2.<br />
Durchschnittlich artikulieren die Studierenden damit nur teilweise eine<br />
höhere Krankheitsanfälligkeit, wobei die individuellen Einschätzungen<br />
relativ stark streuen.<br />
In einem letzten Item sollten die Befragten dem Item: „Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Schulzeit ist mein Arbeitsaufwand wesentlich höher.“ graduell zust<strong>im</strong>men.<br />
Hier st<strong>im</strong>men 37,7% der Studierenden dem Item in sehr starkem Maße und<br />
weitere 41,6% stark zu. Damit befürworten 79,3% aller Befragten die<br />
Aussage in nahezu uneingeschränktem Maße. Im Einzelnen ergibt sich<br />
folgende Antwortverteilung auf das Item:<br />
Im Vergleich <strong>zur</strong> Schule ist Arbeitsaufwand <strong>im</strong> Studium wesentlich höher.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
sehr gering 1 46,2 -45,2<br />
gering 9 46,2 -37,2<br />
teils 38 46,2 -8,2<br />
stark 96 46,2 49,8<br />
sehr stark 87 46,2 40,8<br />
Gesamt 231<br />
Die Antworten, die das Item eher verneinen oder auch nur teilweise<br />
zust<strong>im</strong>men, sind deutlich unterfrequentiert. Es erfolgt eine Konzentration<br />
der Auswahlantworten auf die Kategorien „st<strong>im</strong>me sehr stark“ und „st<strong>im</strong>me<br />
stark zu“. Der Mittelwert des Items beträgt M=4,12 mit einer<br />
Standardabweichung von SD=,851 und einem Medianwert von 4.<br />
176
Statistik für Test<br />
Belastung<br />
Summe<br />
Belastung<br />
<strong>im</strong><br />
Studium<br />
Belastung<br />
Privat<br />
Max<strong>im</strong>ale<br />
Arbeit<br />
Chi-Quadrat 99,442 180,840 96,684 139,281 104,255<br />
df 3 4 4 4 3<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000<br />
Statistik für Test<br />
Belastungsgrenze<br />
Vernachlässigung<br />
Privates<br />
Mehr<br />
leisten<br />
möglich Freizeit Stress Krankheit Aufwand<br />
Chi-Quadrat 121,652 87,506 144,216 92,896 49,887 165,342<br />
df 4 4 4 3 4 4<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000<br />
12.2 Skala <strong>zur</strong> Belastung<br />
Aus dem einzelnen Items <strong>zur</strong> Belastung wurde eine Skala<br />
„Belastungsempfinden“ gebildet, die als abhängige Variable in das<br />
Regressionsmodell eingehen soll. Hierzu wurden die Items „In welchem<br />
Maße fühlen Sie sich derzeit durch Privates belastet?“ und „Im Vergleich<br />
<strong>zur</strong> Schulzeit bin ich jetzt wesentlich krankheitsanfälliger.“ wegen zu<br />
geringer Item-Skalen-Korrelation aus der Skala entfernt. Die übrigen 9<br />
Items wurden in die Skala „Belastungsempfinden“ aufgenommen. Für die<br />
Skala liegen folgende Reliabilitätswerte vor:<br />
Reliabilitätsstatistik Belastungsempfinden<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,879 9<br />
177
Item-Skala-Statistiken: Belastungsempfinden<br />
In welchem Maße<br />
fühlen Sie sich<br />
derzeit insgesamt<br />
belastet?<br />
In welchem Maße<br />
fühlen Sie sich<br />
derzeit durch Ihr<br />
Studium belastet?<br />
Zust<strong>im</strong>mung: Ich bin<br />
an der obersten<br />
Belastungsgrenze<br />
<strong>im</strong> Studium<br />
angelangt.<br />
Ich arbeite so viel<br />
wie nur möglich für<br />
meinen<br />
<strong>Studien</strong>erfolg.<br />
Ich vernachlässige<br />
wegen des<br />
Studiums oftmals<br />
Privates.<br />
Ich könnte <strong>im</strong><br />
Studium auch mehr<br />
leisten.<br />
Wie beurteilen Sie<br />
den Umfang ihrer<br />
Freizeit?<br />
Wie beurteilen Sie<br />
Ihre<br />
durchschnittliche<br />
Stressbelastung?<br />
Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Schule ist der<br />
Arbeitsaufwand <strong>im</strong><br />
Studium wesentlich<br />
höher.<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
27,9783 25,454 ,674 ,876<br />
28,0000 25,284 ,685 ,875<br />
28,7000 24,115 ,734 ,870<br />
28,4000 26,101 ,573 ,883<br />
28,6870 24,303 ,646 ,878<br />
28,9348 23,694 ,668 ,877<br />
28,2000 24,746 ,666 ,876<br />
28,6739 25,243 ,634 ,879<br />
27,8000 25,654 ,553 ,885<br />
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest für die Skala: Belastungsempfinden<br />
Belastungswert Skala<br />
N 230<br />
Parameter der<br />
Mittelwert<br />
3,5469<br />
Normalverteilung<br />
Standardabweichung<br />
,62019<br />
Extremste Differenzen Absolut ,053<br />
Positiv ,053<br />
Negativ -,053<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z ,801<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,542<br />
178
Mittels des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests wurde überprüft, ob die<br />
Skala die Kriterien einer Normalverteilung als Voraussetzung für die<br />
Regressionsanalyse erfüllt. Nach den Ergebnissen des Tests weist die<br />
Skala eine Normalverteilung auf.<br />
Abschließend wurde überprüft, in wie viele Faktoren die Skala untergliedert<br />
ist. Zu diesem Zweck wurden die 9 Items einer rotierten<br />
Hauptkomponentenanalyse mit Var<strong>im</strong>ax-Rotation unterzogen, die die<br />
folgenden Ergebnisse erbringt:<br />
Erklärte Gesamtvarianz: Belastungsempfinden<br />
Komponente<br />
Anfängliche Eigenwerte<br />
Gesamt % der Varianz Kumulierte %<br />
1 4,836 53,736 53,736<br />
2 ,786 8,731 62,467<br />
3 ,730 8,115 70,582<br />
4 ,594 6,595 77,178<br />
5 ,516 5,728 82,906<br />
6 ,505 5,616 88,521<br />
7 ,409 4,542 93,064<br />
8 ,352 3,915 96,979<br />
9 ,272 3,021 100,000<br />
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.<br />
Aufgrund der Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse wird für die Skala<br />
„Belastungsempfinden“ unter Zugrundelegung des Kaiser-Kriteriums von<br />
einer einfaktoriellen Lösung ausgegangen.<br />
12.3 Belastungsmodell<br />
Um das individuelle Belastungsempfinden durch als unabhängig<br />
angenommene Einflussvariablen erklären zu können, wurde ein<br />
Regressionsmodell errechnet. Dazu wurde eine lineare<br />
Regressionsanalyse durchgeführt, wobei die Skala „Belastungsempfinden“<br />
(SummeSkala1) als abhängige Variable eingesetzt wurde. Entsprechend<br />
den theoretischen Annahmen wurden als unabhängige Variablen<br />
einbezogen:<br />
I <strong>Studien</strong>bezogene Faktoren:<br />
1. Zeitliche Belastung in Semesterwochenstunden<br />
2. Anzahl der Lehrveranstaltungen<br />
3. Anzahl der zu erwerbenden Leistungspunkte<br />
4. <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
179
5. <strong>Studien</strong>gang (Lehramt Gymnasium oder Regelschule)<br />
6. Persönliche, in das Studium investierte Zeit<br />
7. <strong>Studien</strong>erwartungen und deren Erfüllung<br />
8. Beurteilung des Studiums und seiner Rahmenbedingungen<br />
II Private und personenbezogene Rahmenbedingungen<br />
1. Soziometrische Daten (Geschlecht, Erststudent, Wartezeitraum,<br />
Hochschulsemesterzahl, <strong>Studien</strong>fachwunschentsprechung,<br />
Arbeitstätigkeit, Bildungsstand der Eltern, finanzielle Situation,<br />
Wohnsituation)<br />
2. Private Rahmenbedingungen (Partnerschaft, Elternkontakt, Kinder)<br />
3. Soziales Netz (Sozialkontakte oberflächlich, intensiver, int<strong>im</strong>vertraut)<br />
III Einstellungen und Motive<br />
1. <strong>Studien</strong>wahlmotive (eher materiell, eher ideell)<br />
2. Persönliche Beurteilung des Studiums (Herausforderung,<br />
Bedrohung, Gewinn, Verlust)<br />
3. Passung zwischen Person und <strong>Studien</strong>fächern<br />
4. Zukunftsperspektiven<br />
IV Betreuungssituation<br />
1. Betreuung durch die Universität<br />
2. Unterstützungserfahrungen<br />
V Persönlichkeitsvariablen<br />
1. Frustrationstoleranz<br />
2. Flexibilität<br />
3. Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft<br />
4. Erholungsfähigkeit<br />
5. Fähigkeit zum rationellen Arbeiten<br />
6. Stressresistenz<br />
(Entsprechend der oben angegebenen Faktorenlösung wurden<br />
dabei die einzelnen Skalen zu 2 Faktoren zusammengefasst.)<br />
Mit diesen angegebenen Variablen wurde eine lineare Regression<br />
„schrittweise“ durchgeführt. Dabei wurden Variablen in das Modell als<br />
unabhängige Variablen aufgenommen, wenn sie einen signifikanten Beitrag<br />
<strong>zur</strong> Erklärung der Varianz der abhängigen Variable leisteten. Alle anderen<br />
Variablen wurden entfernt. Als Ergebnis konnte das nachfolgende<br />
Regressionsmodell aufgestellt werden:<br />
180
Modellzusammenfassung<br />
Modell R R-Quadrat<br />
Korrigiertes R-<br />
Quadrat<br />
Standardfe<br />
hler des<br />
Schätzers<br />
Durbin-<br />
Watson-<br />
Statistik<br />
1 ,654(a) ,428 ,413 4,23469 1,830<br />
a Einflussvariablen: (Konstante), Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen in SWS,<br />
Erfahrene Unterstützung durch die <strong>Studien</strong>beratungen, Persönlichkeitsvariable Flexibilität,<br />
Rationelles Arbeiten und Erholungsfähigkeit sowie Stressresistenz, Kontakt zu Eltern,<br />
Zeitaufwand pro Woche insgesamt<br />
b Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
ANOVA(b)<br />
Modell<br />
Quadratsumme<br />
df<br />
Mittel der<br />
Quadrate F Signifikanz<br />
1 Regression 2616,347 5 523,269 29,180 ,000(a)<br />
Residuen 3496,857 195 17,933<br />
Gesamt 6113,204 200<br />
a Einflussvariablen: (Konstante), Persönlichkeitsvariable Flexibilität, Rationelles Arbeiten<br />
und Erholungsfähigkeit sowie Stressresistenz, Kontakt zu Eltern, Erfahrene Unterstützung<br />
durch die <strong>Studien</strong>beratungen, Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen in SWS,<br />
Zeitaufwand pro Woche insgesamt<br />
b Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
Koeffizienten(a)<br />
Nicht standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten T Signifikanz<br />
B<br />
Standardfehler<br />
Beta B<br />
Standardfehler<br />
(Konstante) 20,707 1,602 12,930 ,000<br />
Zeitaufwand pro<br />
Woche<br />
insgesamt ohne<br />
Präsenzzeiten<br />
,103 ,020 ,295 5,180 ,000<br />
Kontakt zu Eltern ,728 ,313 ,-130 -2,327 ,021<br />
Anzahl der<br />
besuchten<br />
Lehrveranstaltungen<br />
in<br />
SWS<br />
Erfahrene<br />
Unterstützung<br />
durch die<br />
<strong>Studien</strong>beratungen<br />
Persönlichkeitsvariable<br />
Flexibilität,<br />
Rationelles<br />
Arbeiten und<br />
Erholungsfähigkeit<br />
sowie<br />
Stressresistenz<br />
,279 ,061 ,257 4,548 ,000<br />
-,873 ,300 -,159 -2,905 ,004<br />
-1,976 ,313 -,355 -6,312 ,000<br />
181
Häufigkeit<br />
a Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
Das Modell ist mit einer Varianzaufklärung von insgesamt 41,3%<br />
(Korrigierter R-Quadrat-Wert) als gut zu bezeichnen. Das Modell insgesamt<br />
ist hoch signifikant. Daneben werden alle aufgenommenen Variablen auf<br />
dem Niveau von p=0,05 signifikant.<br />
Um die Gütekriterien des Modells zu überprüfen, wurden die<br />
nachfolgenden Statistiken berechnet:<br />
Residuenstatistik(a)<br />
Min<strong>im</strong>um Max<strong>im</strong>um Mittelwert<br />
Standardabweichung<br />
N<br />
Nicht standardisierter<br />
vorhergesagter Wert 23,1013 42,1231 32,0945 3,61687 201<br />
Nicht standardisierte<br />
Residuen -12,23507 10,99829 ,00000 4,18142 201<br />
Standardisierter<br />
vorhergesagter Wert -2,486 2,773 ,000 1,000 201<br />
Standardisierte Residuen -2,889 2,597 ,000 ,987 201<br />
a Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
Histogramm<br />
Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-3<br />
-2 -1<br />
0<br />
1<br />
2<br />
Regression Standardisiertes Residuum<br />
3<br />
Mittelwert =5,06E-16<br />
Std.-Abw. =0,987<br />
N =201<br />
182
Regression Standardisierter geschätzter<br />
Wert<br />
P-P-Diagramm von Standardisiertes Residuum<br />
Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
0,0<br />
0,2<br />
0,4<br />
0,6<br />
Beobachtete Kum. Wahrsch.<br />
0,8<br />
1,0<br />
Streudiagramm<br />
Abhängige Variable: SummeSkala1<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-3<br />
-2<br />
-1<br />
0<br />
1<br />
Regression Standardisiertes Residuum<br />
2<br />
3<br />
Entsprechend den Voraussetzungen für die Gültigkeit der multivariaten<br />
Regressionsanalyse ist zu prüfen, ob die Annahme einer Linearität<br />
zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen gerechtfertigt<br />
ist, ob die Varianzen der Residuen annähernd gleich sind<br />
(Homoskedastizität) und ob die Residuen normalverteilt sind.<br />
Als Form der Prüfung wurde die graphische Veranschaulichung gewählt. Im<br />
vorliegenden Diagramm wurden die Residuen standardisiert (ZRESID) um<br />
sie mit der Standardnormalverteilung vergleichen zu können. Die Säulen<br />
183
des Histogramms entsprechen dabei den standardisierten Residuen, die<br />
glockenförmige Linie gibt die Normalverteilung an. Wie zu sehen, weicht<br />
die Verteilung der Residuen kaum von der Normalverteilung ab.<br />
Diese Aussage wird auch durch den Normalverteilungsplott dargestellt.<br />
Dieser stellt die kummulierte Häufigkeitsverteilung der standardisierten<br />
Residuen dar. Sind die Residuen normalverteilt, liegen sie wie <strong>im</strong><br />
vorliegenden Fall entlang einer Geraden.<br />
Die Linearitätsannahme wird anhand eines Streudiagramms zwischen den<br />
standardisierten Vorhersagewerten (ZPRED) und den standardisierten<br />
Residuen (ZRESID) deutlich. Die zu erkennende horizontale Wolke besteht<br />
aus Punkten, die zufällig um die Waagerechte (Wert 0) streuen. Da kein<br />
systematischer Kurvenverlauf vorliegt, kann von einer linearen Beziehung<br />
zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen ausgegangen<br />
werden.<br />
Die Voraussetzungen für die multivariate Regressionsanalyse sind damit<br />
und unter Beachtung des oben angegebenen Wertes für den Durbin-<br />
Watson-Test als erfüllt anzusehen.<br />
184
B Studie <strong>im</strong> WS 2008/09<br />
Die Befragung wurde mit Studierenden des Immatrikulationsjahrganges<br />
WS 2008/2009 mit dem identischen <strong>Erhebung</strong>sinstrument wiederholt. Die<br />
Auswertung erfolgt <strong>im</strong>mer <strong>im</strong> Vergleich mit den Werten der Befragung zum<br />
<strong>Erhebung</strong>szeitpunkt t1.<br />
1 Soziometrische Daten<br />
1.1 Geschlecht<br />
Insgesamt wurden 275 Studierende des ersten Semesters des<br />
modularisierten Lehramtsstudiengangs befragt. Hiervon konnten 266<br />
vollständig ausgefüllte Fragebögen in die Analyse einbezogen werden.<br />
Davon waren 59,2 % weiblich und 40,8 % männlich. Damit ist der Anteil<br />
weiblicher Studierenden <strong>im</strong> Lehramtsstudiengang deutlich höher.<br />
1.2 Lehramtsart<br />
26,1% der Probanden studieren das jeweilige Regelschullehr- und 73,9 %<br />
das Gymnasiallehramt. Das Studium des Lehramts für Gymnasien wird<br />
damit eindeutig gegenüber dem Lehramt an Regelschulen präferiert.<br />
1.3 Altersstruktur<br />
Die befragten Studierenden sind zwischen 18 (Min<strong>im</strong>um) und 26<br />
(Max<strong>im</strong>um) Jahre alt, wobei das Durchschnittsalter der Befragten 19,88<br />
Jahre mit einer Standardabweichung von SD=1,49 beträgt.<br />
1.4 Zeitpunkt der <strong>Studien</strong>aufnahme<br />
90,9 % der befragten Probanden absolvieren ihr erstes Studium, wobei <strong>im</strong><br />
Mittelwert 12,71 Monate Zeit zwischen der Schulzeit und der<br />
<strong>Studien</strong>aufnahme lagen.<br />
Dabei ist zu beachten, dass Extremwerte diesen Mittelwert, der eine<br />
Standardabweichung von SD=11,28 aufweist, stark beeinflussen. Die<br />
Werte befinden sich in einem Spektrum zwischen 2 und 84 Monaten, wobei<br />
das 50. Perzentil (Median) 12 beträgt.<br />
185
1.5 Wartesemester<br />
Ergänzt wird dieser Wert durch die Anzahl der Wartesemester, die wegen<br />
Zulassungsbeschränkungen absolviert werden mussten. Hier beträgt der<br />
Mittelwert M=0,41 mit einer Standardabweichung von SD=1,01.<br />
1.6 Studierte Fächer<br />
Die Studierenden wurden gebeten anzugeben, welche beiden Fächer sie<br />
als studierte Fächer belegen. Dabei wurde in der Wertigkeit nicht zwischen<br />
erstem und zweitem studierten Fach unterschieden. Die nachfolgende<br />
Übersicht widerspiegelt die Häufigkeiten, mit denen die Befragten die<br />
Fächer als erstes und zweites studiertes Fach eingetragen haben.<br />
Übersicht zu der Häufigkeit, mit denen die einzelnen Fächer studiert werden:<br />
Fach<br />
1. Fach 2. Fach<br />
Deutsch 43 12<br />
Mathematik 34 21<br />
Physik 9 9<br />
Chemie 13 11<br />
Biologie 14 13<br />
Geschichte 39 21<br />
Sozialkunde 10 24<br />
Wirtschaft und<br />
Recht 6 17<br />
Geografie 12 35<br />
Philosophie 11 23<br />
Religion 3 19<br />
Kunst 4 3<br />
Musik 4 0<br />
Informatik 2 9<br />
Englisch 33 16<br />
Französisch 8 7<br />
Latein 3 11<br />
Russisch 2 6<br />
Sport 14 8<br />
N<br />
76,1 % der Studierenden geben an, dass die studierten Fächer ihren<br />
ursprünglichen <strong>Studien</strong>plänen entsprechen.<br />
Die Studierenden artikulieren mehrheitlich eine Realisierung der<br />
ursprünglichen <strong>Studien</strong>fachwünsche. Signifikante fachspezifische<br />
Besonderheiten konnten nicht festgestellt werden. 21<br />
21 Methodisch realisiert über Kreuztabellierung mit Chi-Quadrat Test, wobei die einzelnen<br />
Fächer als unabhängige Variable und die Anzahl der Wunschentsprechung als abhängige<br />
Variable eingesetzt wurden. Die Daten können be<strong>im</strong> Autor angefordert werden.<br />
186
1.7 Entfernung zwischen <strong>Studien</strong>ort und Lebensort<br />
Durchschnittlich beträgt die Entfernung 17,92 km, bei einer<br />
Standardabweichung von SD=34,6 und einem Medianwert von 5.<br />
Die Hälfte aller Studierenden muss einen Fahrweg zwischen der Universität<br />
und dem Lebensmittelpunkt während des Studiums von 5 Kilometern und<br />
weniger absolvieren.<br />
1.8 Erwerbstätigkeit<br />
Von den Befragten haben 17,7% neben dem Studium ein<br />
Beschäftigungsverhältnis.<br />
Durchschnittlich arbeiten diejenigen Studierenden, die angeben, ein<br />
Beschäftigungsverhältnis zu haben, wöchentlich 26,24 Stunden mit einer<br />
Standardabweichung von SD=44,54. Der Median beträgt 20,0.<br />
1.9 Bildungsstand der Eltern<br />
Die Bildungsabschlüsse der Elternteile gliedern sich wie nachfolgend<br />
dargestellt auf:<br />
Höchster Bildungsabschluss der Mutter<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
Gültig kein Abschluss 3 1,1 1,1 1,1<br />
Mittlerer Abschluss<br />
(HS/RS/POS) 118 42,9 44,7 45,8<br />
Abitur/EOS 46 16,7 17,4 63,3<br />
Hochschule 97 35,3 36,7 100,0<br />
Gesamt 264 96,0 100,0<br />
Fehlend 99999,00 2 ,7<br />
System 9 3,3<br />
Gesamt 11 4,0<br />
Gesamt 275 100,0<br />
Höchster Bildungsabschluss des Vaters<br />
Häufigkeit Prozent<br />
Gültige<br />
Prozente<br />
Kumulierte<br />
Prozente<br />
Gültig kein Abschluss 2 ,7 ,8 ,8<br />
Mittlerer Abschluss<br />
(HS/RS/POS) 142 51,6 54,0 54,8<br />
Abitur/EOS 22 8,0 8,4 63,1<br />
Hochschule 97 35,3 36,9 100,0<br />
Gesamt 263 95,6 100,0<br />
Fehlend 99999,00 3 1,1<br />
System 9 3,3<br />
Gesamt 12 4,4<br />
Gesamt 275 100,0<br />
187
Damit wird deutlich, dass der Bildungsabschluss der Eltern in der Mehrzahl<br />
der Fälle einem höheren Abschluss entspricht.<br />
1.10 Einkommensverhältnisse<br />
In der Mehrzahl der Fälle (Median 2) liegt das monatliche Einkommen unter<br />
500 Euro. Nur 23,4% aller Probanden geben an, einen höheren<br />
monatlichen Betrag <strong>zur</strong> Verfügung zu haben.<br />
In einem weiteren Item wurden die Studierenden gebeten, ihre<br />
gegenwärtige finanzielle Situation einzuschätzen. Der Aussage: „Ich habe<br />
genügend Geld für meinen Lebensunterhalt“ st<strong>im</strong>men 63,4% der Befragten<br />
in vollem Maße (21,8%) und überwiegend (41,6%) zu.<br />
Zwischen der Höhe der monatlichen Einkommensangaben und der<br />
Einschätzung, genügend Geld für den Lebensunterhalt <strong>zur</strong> Verfügung zu<br />
haben, konnten signifikante Zusammenhänge gemessen werden 22 .<br />
Korrelation des monatlichen Einkommens mit der Einschätzung, genügend Geld für<br />
den Lebensunterhalt <strong>zur</strong> Verfügung zu haben<br />
Spearman-Rho<br />
Monatlicher<br />
Betrag, der zum<br />
Ausgeben <strong>zur</strong><br />
Verfügung steht<br />
in Euro<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Monatlicher<br />
Betrag, der<br />
zum Ausgeben<br />
<strong>zur</strong> Verfügung<br />
steht in Euro<br />
Ich habe<br />
genügend<br />
Geld für<br />
meinen<br />
Lebensunterhalt<br />
1,000 ,409<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
N 261 257<br />
Erwartungsgemäß steigt somit mit zunehmendem Einkommen auch die<br />
Beurteilung einer zufrieden stellenden finanziellen Situation.<br />
Des Weiteren wurde danach gefragt, ob und in welchem Maße die<br />
finanzielle Lage der Befragten zu einer Belastung führt. Dabei st<strong>im</strong>men<br />
39,4 % der Befragten der Aussage, ihre finanzielle Situation als Belastung<br />
wahrzunehmen, in vollem Maße (14,3%) und überwiegend (25,1%) zu.<br />
22 Spearman-Rho wurde genutzt, da das monatliche Einkommen nur ordinalskaliert<br />
vorliegt.<br />
188
Meine finanzielle Situation erlebe ich als Belastung<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 68 57,8 10,3<br />
trifft eher nicht zu 72 57,8 14,3<br />
trifft eher zu 58 57,8 ,3<br />
trifft voll zu 33 57,8 -24,8<br />
Gesamt 231<br />
Die voll zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie ist hierbei deutlich unterbesetzt,<br />
während die eher und voll ablehnenden Auswahlantworten überfrequentiert<br />
sind. (Chi-Quadrat=15,944, df=3, p=0,01)<br />
Dabei kann insbesondere in diesem finanziellen Aspekt ein bedeutender<br />
Belastungs- oder Unterstützungsfaktor gesehen werden. Eine als<br />
ungenügend empfundene finanzielle Situation wird mit einer<br />
Zusammenhangsstärke von Spearman-Rho=.826 (Signifikanz
Des Weiteren sind signifikante Effekte zwischen der Wohnform und dem<br />
Grad der Zufriedenheit mit der Wohnsituation nicht messbar.<br />
Statistik: Zufriedenheit mit der Wohnsituation<br />
Wohnung<br />
Mit meiner Wohnsituation bin<br />
ich zufrieden.<br />
allein<br />
Partner<br />
zusammen WG<br />
Bei<br />
Eltern<br />
trifft gar nicht zu Anzahl 3 1 4 6<br />
Erwartet 2,5 1,7 7,9 2,0<br />
trifft eher nicht zu Anzahl 6 6 22 8<br />
Erwartet<br />
7,4 5,0 23,6 6,0<br />
trifft eher zu Anzahl 17 8 52 8<br />
Erwartet<br />
15,1 10,0 47,7 12,2<br />
trifft voll zu Anzahl 16 13 55 12<br />
Erwartet 17,0 11,3 53,9 13,8<br />
Gesamt: Anzahl 42 28 133 34<br />
Erwartet 42,0 28,0 133,0 34,0<br />
Teststatistik<br />
Wert<br />
df<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz (2-seitig)<br />
Chi-Quadrat nach<br />
Pearson 14,490(a) 9 ,106<br />
Likelihood-Quotient<br />
12,323 9 ,196<br />
Zusammenhang linearmit-linear<br />
,936 1 ,333<br />
Anzahl der gültigen Fälle<br />
237<br />
1.12 Elternkontakt<br />
Die Mehrheit der Befragten gibt an, einen engen Kontakt zu den Eltern zu<br />
haben.<br />
Zust<strong>im</strong>mung <strong>zur</strong> Aussage: Ich habe einen engen Kontakt zu meinen Eltern<br />
(Chi²=156,854, df=3, p
Die Verteilung weicht signifikant von einer Gleichverteilung ab. In Relation<br />
hierzu äußern ungewöhnlich viele Befragte, einen engen Kontakt zu den<br />
Eltern zu haben.<br />
Als Belastung empfinden den Kontakt zu den Eltern nur 13,7%.<br />
Die Kontaktsituation zu den Eltern erlebe ich als Belastung (Chi² =208,991, df=3,<br />
p
(Auswahlantworten „st<strong>im</strong>me eher zu“ und „st<strong>im</strong>me eher nicht zu“), klare<br />
Vorstellungen ihres derzeitigen Beziehungsstatus besitzen.<br />
Wer angibt, nicht in einer Partnerbeziehung zu leben, empfindet dies auch<br />
eher als Belastung. (Spearmans Rho=.353, Signifikanz p=0,01)<br />
Für eine Familie oder Kinder müssen nur 8,1% der Befragten sorgen.<br />
1.14 Gesundheitszustand<br />
Diesen Teil abschließend wurden die befragten Studierenden gebeten,<br />
ihren derzeitigen Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 5 (1=sehr<br />
gut bis 5=sehr schlecht) einzuschätzen. Dabei ergibt sich folgendes Bild:<br />
Einschätzung des persönlichen Gesundheitszustandes (Chi²=160,375, df=4, p
<strong>Studien</strong>voraussetzungen beschrieben sind, aber noch studienbegleitend<br />
erbracht werden müssen, als in der Mehrheit erfüllt bezeichnet werden.<br />
Dennoch ist der Anteil an noch zu erbringenden Leistungen erheblich.<br />
2 <strong>Studien</strong>wahlmotive<br />
Eine erste Übersicht zu den Antworttendenzen auf die Frage der<br />
<strong>Studien</strong>wahlmotive veranschaulicht nachfolgende Tabelle:<br />
<strong>Studien</strong>wahlmotive<br />
Mangel an<br />
Alternativen<br />
Zeit<br />
gewinnen<br />
Interesse<br />
am Lehrerberuf<br />
Fachinteresse<br />
Einfluss<br />
anderer<br />
N Gültig 257 258 261 261 260<br />
Fehlend 18 17 14 14 15<br />
Mittelwert 1,6342 1,3798 4,5594 4,5057 2,1731<br />
Median 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000 2,0000<br />
Standardabweichung ,96343 ,76085 ,59591 ,63622 1,07483<br />
Einfluss<br />
sicherer<br />
anderer Prestige Verdienst Karriere Arbeitsplatz<br />
N Gültig 260 260 260 261 260<br />
Fehlend 15 15 15 14 15<br />
Mittelwert 2,1731 2,3077 3,2462 2,7586 3,8538<br />
Median 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000<br />
Standardabweichung 1,07483 1,04232 1,10500 1,13306 1,70446<br />
Aus beiden Abbildungen wird deutlich, dass die Lehramtsstudierenden<br />
ihren <strong>Studien</strong>gang vor allem sowohl aus Interessen, die den Lehrerberuf<br />
selbst betreffen, als auch aus Interessen hinsichtlich der beiden studierten<br />
Fächer gewählt haben. Materielle Überlegungen, vor allem die eines<br />
gesicherten Arbeitsplatzes, spielen darüber hinaus bei der<br />
<strong>Studien</strong>platzwahl eine gewisse Rolle, wobei der Beruf des Lehrers dabei<br />
nur in untergeordnetem Maße aus Karrieregründen gewählt wird. Nur<br />
schwachen Einfluss haben darüber hinaus Prestigegründe und das<br />
Einwirken anderer Personen. Das Orientierungs- und Ausweichmotiv hat<br />
einen vergleichsweise sehr schwachen Einfluss.<br />
193
Unter Beachtung obiger Daten kann daher für die Wahl des<br />
Lehramtsstudienganges durch die Befragten gesagt werden, dass das<br />
Lehrerstudium vor allem aus persönlichen Berufs- und Fachinteressen<br />
gewählt wird. Materielle Überlegungen fließen dabei in die <strong>Studien</strong>wahl mit<br />
ein.<br />
3 Persönliche Sicht des Studiums<br />
Hierzu wurden den Befragten 4 Items vorgelegt. In einem ersten Item<br />
sollten die Studierenden angeben, ich welchem Maße sie in ihrem<br />
derzeitigen Studium eine Herausforderung sehen. Die Antwortverteilung<br />
auf dieses Item veranschaulicht die folgende Übersicht:<br />
Ich sehe mein Studium als Herausforderung (Chi²=320,226, df=4, p
signifikant hoher Anzahl einen Gewinn wahrnehmen. Nur 2,3 % lehnen die<br />
Aussage eher oder in vollem Maße ab.<br />
Ein entgegengesetztes Bild ergibt sich hinsichtlich der Sichtweisen auf das<br />
Studium, die eher ein Gefahrenpotenzial oder ein Verlustempfinden<br />
anzeigen.<br />
Ich sehe mein Studium als Verlust (Chi²=293,923, df=4, p
Für die Mehrheit der Befragten stellt das Studium damit in vollem Maße<br />
eine Herausforderung und in überwiegendem Maße einen Gewinn dar.<br />
Während die Mehrheit der Studierenden kaum bedrohliche Aspekte <strong>im</strong><br />
Studium wahrn<strong>im</strong>mt, wird das Studium eher nicht mit<br />
Verlustwahrnehmungen verbunden. Es kann insgesamt von einer hohen<br />
positiven Beurteilung des Charakters des Studiums aus Sicht der<br />
Studierenden gesprochen werden.<br />
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aussagen konnten in folgendem<br />
Maße festgestellt werden:<br />
Korrelationen bzgl. der Sicht auf das Studium<br />
Ich sehe mein<br />
Studium als<br />
Herausforderung<br />
Ich sehe mein<br />
Studium als<br />
Bedrohung<br />
Ich sehe mein<br />
Studium als Gewinn<br />
Ich sehe mein<br />
Studium als Verlust<br />
Ich sehe<br />
mein<br />
Studium<br />
als<br />
Herausforderung<br />
Ich sehe<br />
mein<br />
Studium<br />
als<br />
Bedrohung<br />
Ich sehe<br />
mein<br />
Studium<br />
als Gewinn<br />
Ich sehe<br />
mein<br />
Studium<br />
als Verlust<br />
Korrelation<br />
nach Pearson 1 ,141 ,281 -,023<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,023 ,000 ,713<br />
Korrelation<br />
nach Pearson 1 -,136 ,416<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,027 ,000<br />
Korrelation<br />
nach Pearson 1 -,301<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,000<br />
Korrelation<br />
nach Pearson 1<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig)<br />
Hervorgehobene Korrelationen: sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.<br />
196
4 Zukunftsperspektiven durch das Studium<br />
Die Studierenden wurden aufgefordert, der Aussage: „Mein Studium<br />
eröffnet mir gute Zukunftsperspektiven“ in graduell abgestuftem Maße<br />
zuzust<strong>im</strong>men. Dabei st<strong>im</strong>men 95,4% dieser Aussage in vollem Maße<br />
(50,6%) und eher (44,8%) zu.<br />
Mein Studium eröffnet mir gute Zukunftsperspektiven.<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 2 65,3 -63,3<br />
trifft eher nicht zu 10 65,3 -55,3<br />
trifft eher zu 117 65,3 51,8<br />
trifft voll zu 132 65,3 66,8<br />
Gesamt 261<br />
Die Auswahlantworten, die die Aussage eher oder vollständig ablehnen<br />
sind damit deutlich unterfrequentiert, während die zust<strong>im</strong>menden<br />
Kategorien überbesetzt sind. (Chi-Quadrat=217,421, df=3, p
Korrelation der Einschätzung der durch das Studium eröffneten<br />
Zukunftsperspektiven mit dem Belastungsempfinden<br />
Spearmen-Rho<br />
Mein Studium eröffnet<br />
mir gute<br />
Zukunftsperspektiven<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Mein Studium<br />
eröffnet mir<br />
gute<br />
Zukunftsperspe<br />
ktiven<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
1,000 -,362(**)<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).<br />
Zwischen beiden Aspekten besteht ein signifikanter positiver linearer<br />
Zusammenhang. Je stärker das Studium damit als Zukunftsperspektiven<br />
eröffnend beurteilt wird, desto geringer sind die hiermit verbundenen<br />
<strong>Belastungen</strong>. Für die vorliegende Untersuchung von Interesse ist damit der<br />
Umstand, dass die Belastungswahrnehmung zun<strong>im</strong>mt, wenn <strong>im</strong> Studium<br />
weniger Zukunftsperspektiven erkannt werden.<br />
5 Soziale Kontakte unter den Studierenden<br />
Hinsichtlich der sozialen Kontakte wurden die Beziehungen der<br />
Studierenden zu ihren Kommilitonen hinsichtlich der Anzahl der Kontakte<br />
und der Stärke der sozialen Nähe zu den anderen Studierenden<br />
untersucht. Dabei wurden die Kontakte in namentlich bekannte<br />
Mitstudierende, eher oberflächliche Kontakte und eher freundschaftlichvertraute<br />
Kontakte untergliedert. Hierbei gaben die Studierenden folgendes<br />
an:<br />
Zusammengefasste statistische Angaben <strong>zur</strong> Anzahl von Sozialkontakten<br />
Mit wie vielen<br />
Wie viele Studierenden hatten Sie<br />
Studierende in der vergangenen<br />
kennen Sie Woche oberflächliche<br />
namentlich? Gespräche<br />
Intensive,<br />
persönliche<br />
Kontakte<br />
N Gültig 262 257 258<br />
Fehlend 13 18 17<br />
Mittelwert 33,3168 18,8716 6,2674<br />
Median 20 15 5<br />
Standardabweichung 68,92 19,04 5,917<br />
Im Durchschnitt kennen damit die Studierenden ca. 33 Kommilitonen<br />
namentlich, hatten in der <strong>zur</strong>ückliegenden Woche ca. 19 oberflächliche<br />
Gesprächskontakte und ca. 6 persönlich-vertraute Gespräche.<br />
Zu beachten ist hier jedoch, dass die Werte auf alle Items eine relativ große<br />
198
Streuung aufweisen. Die Anzahl der Kontakte ist stark individualisiert und<br />
reicht hinsichtlich der Gesamtanzahl von 3 (Min<strong>im</strong>um) bis 300 (Max<strong>im</strong>um).<br />
Sie variiert damit interindividuell stark.<br />
6 Organisatorische und strukturelle Bedingungen des Studiums<br />
6.1 Lehrveranstaltungen und Semesterwochenstunden<br />
Die Studierenden geben bei einer Standardabweichung von SD=5,51 an,<br />
Lehrveranstaltungen <strong>im</strong> Rahmen von durchschnittlich 22,36<br />
Semesterwochenstunden zu besuchen.<br />
Übersicht <strong>zur</strong> Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen in SWS<br />
N Gültig 266<br />
Mittelwert 22,36<br />
Median 23<br />
Standardabweichung 5,13897<br />
Min<strong>im</strong>um 3,00<br />
Max<strong>im</strong>um 5,511<br />
Die relativ geringe Standardabweichung deutet darauf hin, dass trotz der<br />
großen Spannweite der Werte (Min<strong>im</strong>um=0, Max<strong>im</strong>um=44) durchschnittlich<br />
relativ ähnliche Anzahlen von Lehrveranstaltungen besucht werden. Dabei<br />
konnten folgende Bezüge zu den Fächern ermittelt werden 23 :<br />
Übersicht: Bezüge der Lehrveranstaltungen in SWS zu den Fächern<br />
Fach<br />
Geringere<br />
Höhere<br />
Chi-<br />
Anzahl an<br />
SWS<br />
Anzahl<br />
an SWS<br />
Quadrat<br />
Signifikanz<br />
Biologie X 53,716 27
Zeitaufwand pro Woche für Studium inkl. studienbezogenen Tätigkeiten/Anwesenheit<br />
(Chi²=76,748, df=11, p
studienbezogene Aktivitäten aufgegliedert. Für das als erstes studiertes<br />
Fach angegebene, sind folgende Werte ermittelt worden 24 :<br />
Statistik: Zeitinvestition 1. Fach<br />
Präsenz<br />
-stunden<br />
pro<br />
Woche<br />
Zeit für<br />
Selbststudium<br />
pro<br />
Woche<br />
Zeit für die<br />
Vorbereitung<br />
der<br />
Erbringung<br />
von Leistung<br />
pro Woche<br />
Zeit für andere<br />
studien-bezogene<br />
Aktivitäten pro<br />
Woche<br />
N Gültig 259 253 247 238<br />
Mittelwert<br />
Fehlend 16 22 28 37<br />
8,5608 6,7984 3,3502 1,3445<br />
Median 8,0000 5,0000 2,0000 ,0000<br />
Standardabweichung<br />
4,58516 6,1021 4,40572 2,45099<br />
Die Betrachtung der einzelnen Streuungsmaße ergibt, dass offensichtlich<br />
besonders innerhalb des Ausmaßes des Selbststudiums erhebliche<br />
interindividuelle Differenzen deutlich werden. Die Präsenzzeiten stellen sich<br />
als der Bereich mit dem durchschnittlich höchsten Zeitaufwand bei relativ<br />
geringer Streuung dar.<br />
Der durchschnittlich in das Studium des ersten Fachs investierte<br />
Zeitaufwand beträgt bei einer Standardabweichung von SD=10,85 M=19,61<br />
Stunden, wobei die Werte (Min<strong>im</strong>um=0, Max<strong>im</strong>um=76) auf eine starke<br />
Individualisierung der Zeitinvestition in das Studium schließen lassen. Setzt<br />
man die für das erste studierte Fach angegebene <strong>Studien</strong>zeitinvestition mit<br />
dem als erstes Fach studierten Fach in Beziehung, ergeben sich nur bei<br />
dem Fach Physik aufschlussreiche Zusammenhänge:<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Anzahl an<br />
Stunden<br />
Anzahl<br />
an<br />
Stunden<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Physik X 279,521 94 0,014 0,356<br />
Für das zweite studierte Fach ergibt sich folgende Gesamtsicht:<br />
24 Auf die Darstellung der einzelnen Prozentwerte wird verzichtet. Diese können jedoch<br />
be<strong>im</strong> Autor angefordert werden.<br />
201
Statistik: Zeitinvestition 2.Fach<br />
Präsenzstunden<br />
pro Woche<br />
Zeit für<br />
Selbststudium<br />
pro<br />
Woche<br />
Zeit für die<br />
Vorbereitung<br />
der<br />
Erbringung<br />
von Leistung<br />
pro Woche<br />
Zeit für andere<br />
studienbezogene<br />
Aktivitäten pro<br />
Woche<br />
N Gültig 260 257 245 241<br />
Fehlend 15 18 30 34<br />
Mittelwert 7,8962 6,6148 3,0041 1,1120<br />
Median 8,0000 5,0000 2,0000 ,0000<br />
Standardabweichung 3,82745 5,85864 3,93231 2,22671<br />
Auch für das zweite studierte Fach liegt die zeitliche Hauptbelastung in den<br />
Präsenzzeiten an der Universität, wohingegen Zeiten für die Vorbereitung<br />
und andere studienbezogene Aktivitäten etwas geringere zeitliche<br />
Ressourcen beanspruchen. Auch hier streuen besonders die Werte für die<br />
Vorbereitungszeit und vor allem die investierte Zeit in das Selbststudium.<br />
Der durchschnittlich in das Studium des zweiten Fachs wöchentlich<br />
investierte Zeitumfang beträgt bei einer Standardabweichung von<br />
SD=10,53 M=18,39 Stunden. Das zweite Fach wird damit durchschnittlich<br />
mit einer geringeren zeitlichen Belastung studiert als das erste Fach. In<br />
Abhängigkeit zu den studierten Fächern ergeben sich folgende Werte:<br />
Übersicht: Zeitinvestition <strong>im</strong> zweiten Fach in Bezug auf die Fächer<br />
Fach<br />
Geringere<br />
Höhere<br />
Chi-<br />
Anzahl an<br />
Stunden<br />
Anzahl<br />
an<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Stunden<br />
Physik X 282,007 90
Statistik: Zeitinvestition Erziehungswissenschaft<br />
Zeit für die<br />
Vorbereitung<br />
der<br />
Erbringung<br />
von Leistung<br />
Zeit für andere<br />
studienbezogene<br />
Aktivitäten pro<br />
Woche<br />
Zeit für<br />
Präsenzstunden<br />
pro Woche<br />
Selbststudium<br />
pro Woche pro Woche<br />
N Gültig 258 252 246 238<br />
Fehlend 17 23 29 37<br />
Mittelwert 4,0988 2,6111 1,1504 ,4496<br />
Median 4,0000 2,0000 ,0000 ,0000<br />
Standardabweichung<br />
1,80814 3,49609 2,07555 1,11547<br />
Die Studierenden investieren durchschnittlich wesentlich weniger Zeit in<br />
das Studium der Erziehungswissenschaft als in das Studium der Fächer.<br />
Jedoch bleibt auch hier das Kontingent der Präsenzzeiten der Schwerpunkt<br />
der zeitlichen Belastung. Die Streuung der einzelnen Werte ist in Relation<br />
zu den Mittelwerten jedoch auch hier als hoch zu bezeichnen, sodass auch<br />
in Erziehungswissenschaft von einem stark individualisierten Zeitaufwand<br />
ausgegangen werden muss.<br />
In der Summierung der einzelnen Zeiten ergeben sich folgende Werte:<br />
Statistik zum Zeitaufwand in den beiden Fächern und Erziehungswissenschaft<br />
Zeitaufwand Zeitaufwand Zeitaufwand Zeitaufwand<br />
1 Fach 2 Fach Ezw<br />
Summe<br />
N Gültig 233 235 232 226<br />
Fehlend 42 40 43 49<br />
Mittelwert 19,6019 18,3851 8,1358 46,0763<br />
Median 17,0000 17,0000 6,0000 42,0000<br />
Standardabweichung<br />
10,85884 10,52813 6,05726 20,56626<br />
Der so ermittelte durchschnittliche Zeitaufwand pro Woche beträgt ca. 46<br />
Stunden, wobei dieser Wert stark streut, sodass insgesamt von einer stark<br />
individualisierten wöchentlichen <strong>Studien</strong>zeitinvestition ausgegangen<br />
werden muss. Dabei ist das erste Fach jenes, das mit der höchsten<br />
zeitlichen Intensität studiert wird. An zweiter Stelle <strong>im</strong> Zeitvolumen rangiert<br />
das zweite studierte Fach, während das Studium der<br />
Erziehungswissenschaft deutlich geringere zeitliche Investitionen aufweist.<br />
Diese 46 Wochenstunden gliedern sich in folgende Bereiche:<br />
203
Statistik: Aufgliederung der Zeitinvestition<br />
sonstige<br />
studienbezogene<br />
Präsenz<br />
Selbststudium<br />
Vorbereitung Aktivitäten<br />
N Gültig 257 249 239 234<br />
Mittelwert<br />
Fehlend 18 26 36 41<br />
20,5671 15,9920 7,5460 2,8718<br />
Median 20,0000 13,0000 6,0000 ,0000<br />
Standardabweichung<br />
6,17246 12,46996 8,66510 4,55588<br />
Min<strong>im</strong>um<br />
Max<strong>im</strong>um<br />
,00 ,00 ,00 ,00<br />
56,00 108,00 69,00 30,00<br />
Insgesamt stellt damit die Ebene der Präsenzzeit die zeitintensivste Ebene<br />
dar, die auch hinsichtlich ihrer Streuung auf ein relativ ähnliches zeitliches<br />
Studierverhalten der Befragten schließen lässt. Weitaus individualisierter ist<br />
das zeitliche Studierverhalten in Bezug auf das Selbststudium. Die<br />
Streuung der Werte ist bei geringerer durchschnittlicher Zeitbelastung<br />
höher, was eine stark personenbezogene Zeitinvestition widerspiegelt. Im<br />
Vergleich zwischen Präsenzzeit und Zeit für das Selbststudium ergibt sich<br />
ein Verhältnis von 1 Stunde Präsenzzeit zu 0,777 Stunden<br />
Selbststudiumszeit.<br />
Eine in Relation zu Präsenzzeiten und Selbststudium untergeordnete Rolle<br />
spielen die Vorbereitungszeiten und sonstige studienbezogene Aktivitäten,<br />
die ihrerseits aufgrund hoher Streuungswerte starke interindividuelle<br />
Unterschiede aufzeigen.<br />
6.3 Belegungssituation in den Lehrveranstaltungen<br />
Die Studierenden wurden gebeten in zwei Items anzugeben, wie viele<br />
Lehrveranstaltungen wegen Überschneidung und/oder zu hoher<br />
Teilnehmerzahlen <strong>im</strong> laufenden Semester nicht belegt werden konnten.<br />
Hierzu ergeben sich folgende Werte:<br />
204
Anzahl der Lehrveranstaltungen, die wegen Überschneidungen nicht belegt werden<br />
konnten (Chi²=386,162,df5, p
können. Für 48,4% der Studierenden ergaben sich in diesem Bereich keine<br />
Einschränkungen.<br />
Zusammenhänge zwischen beiden Items und den Fächern konnten nicht<br />
gemessen werden.<br />
6.4 Modulprüfungen<br />
Hinsichtlich der Abschlussprüfungen der einzelnen Module wurde deren<br />
Anzahl auf das erste und zweite studierte Fach sowie auf die<br />
Erziehungswissenschaft spezifiziert sowie die Art der Leistungserbringung<br />
erfragt.<br />
Übersicht: Anzahl der <strong>im</strong> laufenden Semester zu absolvierenden Prüfungen<br />
Prüfungen Prüfungen Prüfungen<br />
1.Fach 2.Fach<br />
Ezw<br />
N Gültig 239 234 239<br />
Fehlend 36 41 36<br />
Mittelwert 3,4603 2,8846 2,1799<br />
Median 3,0000 3,0000 2,0000<br />
Standardabweichung 2,57442 1,82011 ,93320<br />
Min<strong>im</strong>um ,00 ,00 ,00<br />
Max<strong>im</strong>um 17,00 10,00 4,00<br />
Die Studierenden absolvieren <strong>im</strong> ersten Fach, das, wie oben dargestellt,<br />
mit der höheren zeitlichen Intensität studiert wird, durchschnittlich auch<br />
eine erhöhte Prüfungsanzahl. Dabei ist die relativ große Streuung der<br />
Werte für die studierten Fächer zu beachten.<br />
Insgesamt unterziehen sich die Studierenden durchschnittlich 8,48<br />
Modulprüfungen <strong>im</strong> ersten Semester, wobei sowohl die Streuung der Werte<br />
als auch die Spannbreite erhebliche interindividuelle Differenzen aufzeigt.<br />
Hierbei wurde die Prüfungsanzahl insgesamt mit den studierten Fächern in<br />
einen Zusammenhang gesetzt, der jedoch keine statistisch signifikanten<br />
Werte erbringt.<br />
206
Art der Erbringung der Leistung<br />
Mündliche<br />
Sonstige<br />
Klausuren Prüfungen Hausarbeiten Prüfungen<br />
N Gültig 258 234 237 234<br />
Fehlend 17 41 38 41<br />
Mittelwert 5,8837 ,4957 1,1814 ,9786<br />
Median 6,0000 ,0000 1,0000 ,0000<br />
Standardabweichung<br />
1,68365 1,17282 1,39186 1,92219<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00 ,00 ,00 ,00<br />
Max<strong>im</strong>um 13,00 6,00 8,00 14,00<br />
Durchschnittlich werden die Prüfungsleistungen in weitaus überwiegendem<br />
Maße durch schriftliche Leistungen in Form von Klausuren erbracht. Die<br />
anderen Arten der Leistungserbringung sind dieser deutlich nachgeordnet.<br />
6.5 <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
Die Studierenden wurde in 4 Items danach befragt, wie zufrieden sie mit<br />
ihrem jeweiligen Studium <strong>im</strong> ersten Fach, <strong>im</strong> zweiten Fach, in<br />
Erziehungswissenschaft und insgesamt sind. Eine zusammenfassende<br />
Sicht eröffnet nachfolgende Tabelle:<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
Ich bin mit<br />
meinem<br />
Studium <strong>im</strong><br />
ersten Fach<br />
zufrieden<br />
Ich bin mit<br />
meinem<br />
Studium <strong>im</strong><br />
zweiten Fach<br />
zufrieden<br />
Ich bin mit<br />
meinem<br />
Studium in<br />
Erziehungswissenschaft<br />
zufrieden<br />
Zufriedenheit<br />
gesamt<br />
N Gültig 264 263 264 264<br />
Fehlend 11 12 11 11<br />
Mittelwert 4,0038 3,5665 3,7197 3,8485<br />
Median 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000<br />
Standardabweichung<br />
,89144 1,08527 1,03044 ,81324<br />
Min<strong>im</strong>um 1,00 1,00 1,00 2,00<br />
Max<strong>im</strong>um 5,00 5,00 5,00 11,00<br />
Die Befragten geben durchschnittlich eine mittlere <strong>Studien</strong>zufriedenheit an,<br />
die für das Studium <strong>im</strong> ersten Fach und in Erziehungswissenschaft höher<br />
eingeschätzt wird als für das zweite studierte Fach. Dabei weichen die<br />
Verteilungen für alle Bereiche signifikant von einer Gleichverteilung ab.<br />
Hinsichtlich der Zufriedenheit ergibt sich in allen Teilbereichen eine<br />
Verschiebung der Zellenbelegung in Richtung einer höheren<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit. Dennoch sind besonders die negativen und positiven<br />
Pole deutlich unterfrequentiert. Von Interesse ist auch hier wiederum, ob<br />
207
und wenn ja, welche Zusammenhänge zwischen der <strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
und den einzelnen studierten Fächern auftreten. Hierzu ergibt sich<br />
folgender Wert:<br />
Übersicht: <strong>Studien</strong>zufriedenheit (1.und 2.Fach) in Abhängigkeit vom studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
<strong>Studien</strong>zufriedenheit<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Mathematik<br />
X 14,088 4
Unkenntnis über die Anzahl der mit den Workloads verbundenen<br />
Leistungspunkte besteht.<br />
Insgesamt erreichen die Studierenden durchschnittlich die Zahl von 33<br />
ECTS-Punkten <strong>im</strong> ersten Semester. Im ersten studierten Fach werden<br />
durchschnittlich mehr ECTS-Punkte erworben als in dem anderen<br />
studierten Fach. Dies korrespondiert mit der oben bereits festgestellten<br />
zeitlich unterschiedlichen <strong>Studien</strong>intensität für beide Fächer. Außerdem<br />
weisen die Werte besonders für das zweite studierte Fach (Min<strong>im</strong>um=0,<br />
Max<strong>im</strong>um=39) eine hohe Spannweite und generell starke Streuungen auf.<br />
Des Weiteren enthält die Stichprobe 17 Probanden, die nur in einem Fach<br />
Leistungspunkte erwerben, d.h. dass ein Studium in einem Fach <strong>im</strong> Sinne<br />
einer Arbeitsbelastung de facto nicht stattfindet. Die Unterschiede <strong>im</strong><br />
Studierverhalten hinsichtlich der Leistungspunktezahl sind somit zumindest<br />
partiell darauf <strong>zur</strong>ückzuführen, dass die Stichprobe 17 Befragte enthält, die<br />
ihr Studium praktisch nur auf ein Fach konzentrieren. Diese 17 Befragten<br />
studieren folgende Fächer als zweites Fach:<br />
Übersicht: Anzahl der Studierenden in den einzelnen Fächern, die keine<br />
Leistungspunkt erwerben<br />
Fach<br />
Anzahl der Studierenden, die hierin keine LP erwerben<br />
Kein 2. Fach 2<br />
Mathematik 4<br />
Chemie 3<br />
Wirtschaft/Recht 2<br />
Religion 2<br />
Englisch 2<br />
Physik, Biologie Je 1<br />
Generell bildet die Anzahl der zu erwerbenden Leistungspunkten zu<br />
einzelnen studierten Fächern Zusammenhänge:<br />
209
Mittels Korrelationsanalyse soll geprüft werden, ob ein Zusammenhang<br />
zwischen den verschiedenen Anzahlen von Leistungspunkten besteht.<br />
Hypothetisch ist zu prüfen, ob die Anzahl der Leistungspunkte <strong>im</strong> ersten<br />
Fach mit der <strong>im</strong> zweiten Fach korreliert und so gefolgert werden kann, dass<br />
Studierende, die <strong>im</strong> zweiten Fach keine oder wenige Punkte erwerben, dies<br />
durch eine erhöhte Anzahl <strong>im</strong> ersten Fach ausgleichen. Dies erbrachte<br />
folgende Ergebnisse:<br />
Korrelation der Anzahl der Leistungspunkte in den beiden studierten Fächern und<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Summe<br />
der<br />
Leistungspunkte<br />
Leistungspunkte<br />
1. Fach<br />
Übersicht: Leistungspunktezahl (1.und 2.Fach) in Abhängigkeit vom studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Anzahl an Anzahl an Quadrat Signifikanz<br />
Leistungspunkten<br />
Leistungspunkten<br />
Geografie X 29,004 16 0,024 0,220<br />
Physik X 115,647 38
Die Gesamtanzahl der zu erwerbenden Leistungspunkte korreliert<br />
erwartungsgemäß unterschiedlich hoch und signifikant mit den Punktzahlen<br />
der einzelnen Bereiche. Interessanter sind die nicht bestätigten<br />
Zusammenhänge. Zwischen der zu erwerbenden Punktzahl <strong>im</strong> ersten Fach<br />
und dem zweiten Fach konnten keine statistisch signifikanten linearen<br />
Zusammenhänge nachgewiesen werden. In diesen Werten drückt sich<br />
damit kein messbarer Zusammenhang zwischen dem Studierverhalten<br />
hinsichtlich des Erwerbs von Leistungspunkten zwischen dem ersten und<br />
dem zweiten Fach aus. Die Hypothese, dass Studierende, die <strong>im</strong> zweiten<br />
Fach wenige oder keine studienbezogenen Leistungen erbringen, dies in<br />
erhöhtem Maße <strong>im</strong> ersten Fach tun, muss deshalb verworfen werden.<br />
Vielmehr studieren die Befragten die einzelnen Fächer mit<br />
unterschiedlicher Gewichtung und unterscheiden sich vor allem hinsichtlich<br />
ihrer Gesamtanzahl der zu erbringenden Leistungspunkte.<br />
Zu hinterfragen bleibt in diesem Kontext, in welchem Zusammenhang die<br />
Anzahl der zu erwerbenden Leistungspunkte und die in das Studium<br />
investierte Zeit stehen. Hierzu wurden folgende Korrelationen berechnet:<br />
211
Korrelationen der zu erwerbenden Leistungspunkte in den beiden Fächern und<br />
gesamt mit dem Zeitaufwand<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte<br />
1.Fach<br />
Summe der<br />
Leistungspunkte<br />
2.Fach<br />
Summe<br />
der<br />
Leistungs<br />
punkte<br />
1.Fach<br />
Summe<br />
der<br />
Leistungs<br />
punkte<br />
2.Fach<br />
Summe<br />
Leistungspunkte<br />
Zeitaufwand<br />
1. Fach<br />
Zeitaufwand<br />
2. Fach<br />
Zeitaufwand<br />
Summe<br />
1 ,084 ,646(**) ,401(**) ,013 ,292(**)<br />
,241 ,000 ,000 ,860 ,000<br />
203 199 203 184 187 179<br />
1 ,718(**) ,046 ,327(**) ,173(*)<br />
,000 ,540 ,000 ,022<br />
200 200 180 184 176<br />
Summe<br />
Leistungspunkte<br />
Zeitaufwand<br />
1.Fach<br />
Zeitaufwand<br />
2.Fach<br />
Zeitaufwand<br />
Summe<br />
1 ,253(**) ,219(**) ,270(**)<br />
,000 ,002 ,000<br />
211 189 192 183<br />
1 ,287(**) ,828(**)<br />
,000 ,000<br />
233 230 226<br />
1 ,746(**)<br />
,000<br />
226<br />
1<br />
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.<br />
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.<br />
226<br />
Zunächst ist erkennbar, dass ein schwacher genereller Zusammenhang<br />
zwischen der in das Studium investierten Zeit und der Anzahl der zu<br />
erwerbenden Leistungspunkte konstatiert werden kann. So korreliert der<br />
gesamte in das Studium investierte Zeitaufwand signifikant mit der<br />
Leistungspunktezahl. Außerdem kann ein positiver, signifikanter<br />
Zusammenhang gemessen werden zwischen dem Zeitaufwand für das<br />
erste studierte Fach und der Leistungspunkteanzahl des 1. Fachs und<br />
zwischen dem Zeitaufwand für das zweite studierte Fach und der hier zu<br />
erwerbenden Leistungspunkteanzahl.<br />
212
6.7 Beurteilung der Rahmenbedingungen des Studiums<br />
Die Studierenden wurden in zwei Items gebeten, die Rahmenbedingungen<br />
des Studiums in Bezug auf die sachbezogenen Ausstattungsmerkmale der<br />
Universität und die Effekte, die hiervon für sie ausgehen, einzuschätzen.<br />
Hierzu ergeben sich folgende Werte:<br />
Statistik: Einschätzung der Rahmenbedingungen und des damit verbundenen<br />
Belastungsempfindens<br />
Die Rahmenbedingungen<br />
des Studiums sind gut.<br />
(Räume...)<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
N Gültig 263 262<br />
Fehlend 12 13<br />
Mittelwert 2,7072 1,9962<br />
Median 3,0000 2,0000<br />
Standardabweichung ,84360 ,94483<br />
Der Mittelwert der vierstufigen Antwortskala drückt eine durchschnittliche<br />
Zust<strong>im</strong>mung <strong>im</strong> Antwortverhalten aus. 53,1% aller Befragten st<strong>im</strong>men der<br />
Aussage guter Rahmenbedingungen des Studiums eher (46,8%) und voll<br />
(16,3%) zu. Daneben weist die Zellenbesetzung eine deutliche<br />
Überfrequentierung innerhalb der eher zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorie<br />
und eine Unterfrequentierung beider Extrempunkte der Antwortskala auf.<br />
Die Rahmenbedingungen des Studiums sind gut. (Räume...)<br />
Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 23 65,8 -42,8<br />
trifft eher nicht zu 74 65,8 8,3<br />
trifft eher zu 123 65,8 57,3<br />
trifft voll zu 43 65,8 -22,8<br />
Gesamt 263<br />
Den Effekt, der von diesen Rahmenbedingungen ausgeht, nehmen 30,6%<br />
als Belastung wahr. Der Mittelwert der Antwortskala sagt aus, dass von den<br />
universitären Ausstattungsmerkmalen nur wenig belastende Effekte<br />
ausgehen.<br />
Dies lässt sich mit der nachfolgenden Häufigkeitsbesetzung<br />
veranschaulichen:<br />
213
Die Rahmenbedingungen des Studiums erlebe ich als Belastung.<br />
Beobachtetes<br />
N Erwartete Anzahl Residuum<br />
trifft gar nicht zu 99 65,5 33,5<br />
trifft eher nicht zu 83 65,5 17,5<br />
trifft eher zu 62 65,5 -3,5<br />
trifft voll zu 18 65,5 -47,5<br />
Gesamt 262<br />
Die starke Frequentierung der die Aussage <strong>zur</strong> Belastung eher und völlig<br />
verneinenden Antwortkategorien drückt aus, dass die Rahmenbedingungen<br />
der Universität für die überwiegende Anzahl von Studierenden kaum<br />
Effekte aufweisen, die als Belastung empfunden werden.<br />
Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen der Beurteilung der<br />
Rahmenbedingungen und der hiervon ausgehenden wahrgenommenen<br />
Belastung kann festgestellt werden, dass je positiver die<br />
Rahmenbedingungen beurteilt werden, desto geringer dies als Belastung<br />
erlebt wird.<br />
Korrelationen der Einschätzung der Rahmenbedingungen mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman-Rho<br />
Die Rahmenbedingungen<br />
des Studiums sind gut.<br />
(Räume...)<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
Die Rahmenbedingungen<br />
des<br />
Studiums sind gut.<br />
(Räume...)<br />
** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).<br />
Dies erlebe ich als<br />
Belastung<br />
1,000 -,671(**)<br />
. ,000<br />
263 262<br />
-,671(**) 1,000<br />
,000 .<br />
262 262<br />
6.8 Betreuungssituation<br />
Im Hinblick auf die Betreuung der Studierenden seitens der Universität<br />
wurde den Befragten 8 Aussagen vorgelegt, zu der sie das Maß ihrer<br />
Zust<strong>im</strong>mung angeben sollten.<br />
44,8% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage, sie fühlen sich seitens der<br />
Universität Jena gut betreut, in vollem Maße (9,1%) und eher (36,7%) zu.<br />
Detailliert ergeben sich folgende Werte:<br />
214
Ich fühle mich an der Uni gut betreut. (Chi²=154,864, df4, p
Ich brauche keine Unterstützung.<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
voll 9 53,0 -44,0<br />
überwiegend 62 53,0 9,0<br />
teilweise 112 53,0 59,0<br />
überwiegend nicht 52 53,0 -1,0<br />
gar nicht 30 53,0 -23,0<br />
Gesamt 265<br />
Auffällig ist hieran, dass zum einen beide Extrempole stark unterbesetzt<br />
sind, während eine deutliche Überfrequentierung der neutralen<br />
Antwortkategorie vorhanden ist. Die Studierenden artikulieren in Bezug auf<br />
das Benötigen von Unterstützung damit mehrheitlich zumindest partielle<br />
Zust<strong>im</strong>mung. Der Median liegt bei 3.<br />
13,2% der Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage, keine Unterstützung<br />
erfahren zu haben, in vollem Maße (Katgeorie 5: 2,3%) und überwiegend<br />
(Kategorie 4: 10,9%) zu.<br />
Ich habe keine Unterstützung erfahren.<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
voll 6 53,0 -47,0<br />
überwiegend 29 53,0 -24,0<br />
teilweise 57 53,0 4,0<br />
überwiegend nicht 87 53,0 34,0<br />
gar nicht 86 53,0 33,0<br />
Gesamt 265<br />
Dabei ist die starke Unterbesetzung der voll zust<strong>im</strong>menden<br />
Antwortkategorie auffällig. In der Mehrzahl haben die Befragten eine<br />
Unterstützung wahrgenommen und nur 6 Probanden haben grundsätzlich<br />
keine Unterstützung erfahren. Der Medianwert liegt bei 3.<br />
Im Anschluss hieran ist von Interesse, von welcher Seite die erfahrene<br />
Unterstützung geleistet wurde. 21,5% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage,<br />
die Lehrenden haben sie gut unterstützt, in vollem Maße (Kategorie<br />
5=3,4%) und überwiegend (Kategorie 4= 18,1%) zu. Detailliert ergibt sich<br />
folgende Antwortverteilung:<br />
216
Meine Dozenten haben mich sehr gut unterstützt<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
gar nicht 28 53,0 -25,0<br />
überwiegend nicht 70 53,0 17,0<br />
teilweise 110 53,0 57,0<br />
überwiegend 48 53,0 -5,0<br />
voll 9 53,0 -44,0<br />
Gesamt 265<br />
Innerhalb der Verteilung werden zwei Besonderheiten deutlich. Zum Einen<br />
besteht eine starke Tendenz <strong>zur</strong> eher neutralen Mitte. Zum Anderen sind<br />
besonders die der Aussage eindeutig zust<strong>im</strong>menden Antwortkategorien<br />
deutlich unterbesetzt. Insgesamt nehmen die Studierenden damit<br />
mehrheitlich nur eine partiell gute Unterstützung durch die Lehrenden wahr,<br />
während 42,9% der Befragten die Aussage eher und ganz ablehnen.<br />
Mit den Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden artikulieren 36,6% eine<br />
sehr hohe (Kategorie 5: 6,8%) und hohe (Kategorie 4: 29,8%)<br />
Zufriedenheit.<br />
Mit den Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden bin ich sehr zufrieden.<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
gar nicht 14 53,0 -39,0<br />
überwiegend nicht 42 53,0 -11,0<br />
teilweise 112 53,0 59,0<br />
überwiegend 79 53,0 26,0<br />
voll 18 53,0 -35,0<br />
Gesamt 265<br />
Deutlich werden hierbei vor allem eine starke Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte<br />
und eine Unterfrequentierung der Extremantworten. Der Medianwert liegt<br />
bei 3.<br />
Hinsichtlich der Unterstützung innerhalb der Gruppe der Studierenden<br />
ergeben sich deutlich andere Werte. So st<strong>im</strong>men der Aussage, die<br />
Mitstudierenden haben eine gute Unterstützung geleistet, 68,7% der<br />
Befragten in vollem Maße (Kategorie 5: 21,9%) und überwiegend<br />
(Kategorie 4: 46,8%) zu.<br />
217
Meine Mitstudierenden haben mich sehr gut unterstützt.<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
gar nicht 4 53,0 -49,0<br />
überwiegend nicht 16 53,0 -37,0<br />
teilweise 63 53,0 10,0<br />
überwiegend 124 53,0 71,0<br />
voll 58 53,0 5,0<br />
Gesamt 265<br />
Die starke Unterfrequentierung der ablehnenden Antwortkategorie und die<br />
deutliche Überbesetzung des eher zust<strong>im</strong>menden Bereichs, verbunden mit<br />
einer nur sehr schwachen Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mittel zeigen deutlich an,<br />
dass die Studierenden eine gute Unterstützung durch die Mitstudierenden<br />
wahrnehmen. Der Median liegt bei 4.<br />
Die Unterstützung der allgemeinen <strong>Studien</strong>beratung wird wiederum nur von<br />
18,2% der Befragten als sehr gut (Kategorie 5: 3%) und überwiegend gut<br />
(Kategorie:4: 15,2%) bezeichnet.<br />
Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
gar nicht 59 52,6 6,4<br />
überwiegend nicht 71 52,6 18,4<br />
teilweise 85 52,6 32,4<br />
überwiegend 40 52,6 -12,6<br />
voll 8 52,6 -44,6<br />
Gesamt 263<br />
Die die Aussage ablehnenden Antwortkategorien sind deutlich überbesetzt,<br />
während eine erhebliche Unterfrequentierung der Bereiche zu verzeichnen<br />
ist, die eine gute Unterstützung artikulieren. Der Medianwert liegt bei 3.<br />
Ein ähnliches Ergebnis erbringt die Auswertung der Antworten auf die<br />
Aussage, die Fachstudienberatung habe die Studierenden gut unterstützt.<br />
Hier st<strong>im</strong>men der Aussage 26,4% in vollem Maße (Kategorie 5: 2,7%) und<br />
überwiegend (Kategorie 4: 23,7%) zu.<br />
218
Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt.<br />
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
gar nicht 54 52,4 1,6<br />
überwiegend nicht 56 52,4 3,6<br />
teilweise 83 52,4 30,6<br />
überwiegend 62 52,4 9,6<br />
voll 7 52,4 -45,4<br />
Gesamt 262<br />
Hierbei werden wiederum eine geringe Überfrequentierung der<br />
Antwortkategorien deutlich, die die Aussage ablehnen und die Tendenz <strong>zur</strong><br />
neutralen Mittelkategorie. Der Medianwert liegt auch hier bei 3.<br />
Statistik für Test<br />
Ich<br />
brauche<br />
keine<br />
Unterstützung<br />
Ich habe<br />
keine<br />
Unterstützung<br />
erfahren<br />
Dozenten<br />
Mitstudierende<br />
Allgemeine<br />
<strong>Studien</strong>beratung<br />
Fachstudienberatung<br />
Kontaktmöglichkeiten<br />
Chi-Quadrat 113,736 95,208 115,5 168,6 68,008 59,260 132,528<br />
df 4 4 4 4 4 4 4<br />
Asymptotische<br />
Signifikanz<br />
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000<br />
Da die Unterstützung eine wesentliche Ressource <strong>im</strong> Studium darstellt,<br />
wird auf der Basis des vorliegenden theoretischen Modells davon<br />
ausgegangen, dass diese Ressource einen wichtigen Beitrag <strong>zur</strong> Erklärung<br />
des Belastungsempfindens der Studierenden leistet. Aus den einzelnen<br />
Items, die die Unterstützung und Betreuung abbilden, wurde eine Skala<br />
„Betreuung“ (Reliabilitätswert: Cronsbachs Alpha= ,763) gebildet.<br />
Meine Dozenten haben<br />
mich sehr gut unterstützt<br />
Meine Mitstudierenden<br />
haben mich sehr gut<br />
unterstützt<br />
Die allgemeine<br />
<strong>Studien</strong>beratung hat<br />
mich sehr gut unterstützt<br />
Die Fachstudienberatung<br />
hat mich sehr gut<br />
unterstützt<br />
Skalenmittel<br />
wert, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz<br />
, wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
14,5385 9,477 ,450 ,601<br />
13,4846 12,077 ,309 ,762<br />
14,8077 9,044 ,439 ,604<br />
14,6308 8,743 ,468 ,592<br />
219
Mit den<br />
Kontaktmöglichkeiten<br />
zu den Lehrenden bin<br />
14,1423 11,308 ,312 ,748<br />
ich sehr zufrieden.<br />
Ich fühle mich an der<br />
Uni gut betreut<br />
14,8962 9,777 ,493 ,592<br />
Item-Skala-Statistiken Skala Betreuung<br />
Ich fühle mich an der Uni gut betreut<br />
Meine Dozenten haben mich sehr gut unterstützt<br />
Meine Mitstudierenden haben mich sehr gut unterstützt<br />
Die allgemeine <strong>Studien</strong>beratung hat mich sehr gut unterstützt<br />
Die Fachstudienberatung hat mich sehr gut unterstützt<br />
Mit den Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden bin ich sehr<br />
zufrieden.<br />
Komponente<br />
1 2<br />
,<br />
,576 199<br />
,731 , 098<br />
,511 ,071<br />
,146 ,881<br />
,101 ,892<br />
,781 ,051<br />
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.<br />
Hauptkomponentenanalyse der Skala Betreuung<br />
Die Faktoren bilden damit die allgemeine Unterstützung und Betreuung (Faktor 1)<br />
und die institutionalisierte Unterstützung und Betreuung (Faktor 2) ab und werden<br />
in dieser Form als Prädiktorvariablen in das Regressionsmodell zum<br />
Belastungsempfinden einbezogen.<br />
7 <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Hinsichtlich der <strong>Studien</strong>erwartungen wurden den Studierenden 12 Items<br />
vorgelegt, die jeweils eine Erwartung an das Studium thematisierten. Die<br />
Befragten sollten angeben, in welchem Maße sie den jeweiligen Aspekt von<br />
ihrem Studium erwartet haben. Daneben wurde erfragt, in welchem Maße<br />
diese Erwartung erfüllt wurde und in welchem Grad sich die Studierenden<br />
hierdurch belastet fühlen. Einen ersten Überblick liefern die nachfolgenden<br />
Tabellen:<br />
220
Statistiken: <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Erwartet wurde<br />
eine freundschaftliche<br />
Atmosphäre<br />
unter den<br />
Studierenden<br />
Erwartet<br />
wurden<br />
Möglichkeiten<br />
<strong>zur</strong><br />
persönlichen<br />
Weiterentwicklung<br />
Erwartet<br />
wurde die<br />
Vermittlung<br />
von<br />
fundiertem<br />
Fachwissen<br />
Erwartet<br />
wurden klare<br />
Leistungsanforderungen<br />
N 266 266 259 262<br />
9 9 16 13<br />
Mittelwert 3,3083 3,3421 3,4749 2,6794<br />
Median 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,57206 ,63801 ,60549 ,77080<br />
Statistiken: <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Erwartet<br />
wurde eine<br />
gute und<br />
persönliche<br />
Betreuung<br />
durch<br />
Dozenten<br />
Erwartet<br />
wurde die<br />
Vermittlung<br />
praxisbezogener<br />
Fähigkeiten<br />
Erwartet<br />
wurden<br />
Wahlmöglichkeiten<br />
in<br />
Bezug auf<br />
<strong>Studien</strong>schwerpunkte<br />
Erwartet<br />
wurde ein<br />
hohes<br />
wissenschaft<br />
liches<br />
Niveau der<br />
Ausbildung<br />
N 262 263 262 263<br />
13 12 13 12<br />
Mittelwert 2,5649 2,9962 2,6336 3,3308<br />
Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,77409 1,95073 ,79468 ,68300<br />
Statistiken: <strong>Studien</strong>erwartungen<br />
Erwartet<br />
wurde die<br />
Vermittlung<br />
von<br />
Fähigkeiten<br />
<strong>zur</strong> Kommunikation<br />
und<br />
Kooperation<br />
Erwartet wurde<br />
die klare<br />
Strukturierung<br />
des Studiums<br />
Erwartet<br />
wurden<br />
regelmäßige<br />
Leistungsüberprüfungen<br />
Erwartet<br />
wurden<br />
Möglichkeiten<br />
<strong>zur</strong> eigenen<br />
inhaltlichen und<br />
zeitlichen<br />
Planung<br />
N 264 265 264 265<br />
11 10 11 10<br />
Mittelwert 2,7879 2,8679 2,6402 2,9434<br />
Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000<br />
Standardabweichung ,73511 ,96996 ,86945 1,42243<br />
Unter Beachtung der Skalierung der Items (1=trifft gar nicht zu, 4=trifft voll<br />
zu) kann zunächst gesagt werden, dass Mittelwerte über 2,5 als<br />
Zust<strong>im</strong>mung <strong>zur</strong> Aussage aufgefasst werden können, während darunter<br />
liegende Werte angeben, dass diese Erwartung an das Studium eher nicht<br />
bestanden hat.<br />
221
Aus den Tabellen wird zunächst deutlich, dass alle genannten Aspekte<br />
zunächst als Erwartungen für das Studium relevant sind. In besonderem<br />
Maße werden vom Studium jedoch Aspekte erwartet, die die direkte<br />
universitäre Ausbildung betreffen: eine hohe fachwissenschaftliche<br />
Ausbildung und die Vermittlung fundierten Fachwissens sowie<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen Weiterentwicklung für die Studierenden. Die<br />
hohen Mittelwerte auf die entsprechenden Items geben zusammen mit<br />
einer relativ geringen Streuung an, dass in dieser Hinsicht relativ einheitlich<br />
die höchsten Erwartungen an das Studium gestellt werden. Ähnlich hohe<br />
Erwartungen werden <strong>im</strong> Hinblick auf eine freundschaftliche Atmosphäre<br />
unter den Studierenden artikuliert.<br />
Leistungsklarheit, Praxisbezug, transparente <strong>Studien</strong>strukturen, individuelle<br />
Möglichkeiten der <strong>Studien</strong>gestaltung und Erwartungen an indirekte<br />
Lehrinhalte werden zwar ebenso von einem universitären Studium erwartet,<br />
die Mittelwerte auf die Items sind aber bei einer größeren Streuung deutlich<br />
geringer ausgeprägt als die für die direkten Lehrinhalte.<br />
Betrachtet man die Erwartungen innerhalb einer Rangliste, ergibt sich<br />
folgendes Bild:<br />
Tabelle: Erwartungen an das Studium (N=264)<br />
Erwartungen (st<strong>im</strong>me voll und eher zu)<br />
Studierende<br />
Sympathische Atmosphäre unter den Studierenden 95,3%<br />
Vermittlung fundierten Fachwissens 95,1%<br />
Hohes wissenschaftliches Niveau 91,6%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen Weiterentwicklung 91,4%<br />
Vermittlung kommunikativer und kooperativer 67,1%<br />
Fähigkeiten<br />
Klare <strong>Studien</strong>struktur 66,6%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> eigenen Planung 64,8%<br />
Praxisbezug 63,8%<br />
Regelmäßige Leistungsüberprüfungen 58,3%<br />
Klarheit über geforderte Leistungen 57,9%<br />
Wahlmöglichkeiten 56,4%<br />
Gute Betreuung 53,2%<br />
Aus diesen Werten kann die obige Aussage nochmals bekräftigt werden,<br />
dass mit einem universitären Studium vor allem hohe inhaltliche Ansprüche<br />
verbunden werden und eine freundschaftliche Atmosphäre unter den<br />
Studierenden von nahezu allen Befragen erwartet wird. Ebenso wird vom<br />
222
Studium in Bezug auf die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten fast einmütig<br />
ein hoher Effekt erwartet. Die anderen Aspekte werden von deutlich<br />
weniger Studierenden als Erwartungen an das Studium formuliert.<br />
Daneben ist von Interesse, in welchem Maße die Erwartungen dann auch<br />
in der Wahrnehmung der Befragten tatsächlich erfüllt wurden. Die<br />
nachfolgende Tabelle zeigt zunächst an, wie die einzelnen Erwartungen<br />
innerhalb der <strong>Studien</strong>anfangszeit als erfüllt angesehen werden:<br />
Tabelle: Erwartungen an das Studium wurden erfüllt (N=264)<br />
Erwartungen wurden erfüllt (st<strong>im</strong>me voll und Studierende<br />
eher zu)<br />
Sympathische Atmosphäre unter den Studierenden 87,5%<br />
Vermittlung fundierten Fachwissens 84,0%<br />
Hohes wissenschaftliches Niveau 89,4%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen Weiterentwicklung 81,7%<br />
Vermittlung kommunikativer und kooperativer 59,3%<br />
Fähigkeiten<br />
Klare <strong>Studien</strong>struktur 44,2%<br />
Möglichkeiten <strong>zur</strong> eigenen Planung 58,8%<br />
Praxisbezug 44,8%<br />
Regelmäßige Leistungsüberprüfungen 75,1%<br />
Klarheit über geforderte Leistungen 33,6%<br />
Wahlmöglichkeiten 52,0%<br />
Gute Betreuung 49,9%<br />
Aus der Tabelle geht hervor, dass die einzelnen Erwartungen in sehr<br />
unterschiedlichem Maße als <strong>im</strong> Studium erfüllt betrachtet werden.<br />
Mehrheitlich werden jedoch die Studierenden enttäuscht, die eine klare<br />
<strong>Studien</strong>struktur, den Praxisbezug des Studiums, die Klarheit der<br />
geforderten Leistungen und eine gute Betreuung durch die Universität<br />
erwartet haben. Dabei nehmen die Transparenzaspekte des Studiums eine<br />
exponierte Stellung ein. Hier werden diejenigen, die dies vom Studium in<br />
hohem Maße erwartet haben, stark enttäuscht. Dem gegenüber werden die<br />
Erwartungen hinsichtlich der wissenschaftlichen und inhaltlichen<br />
Fundierung der Ausbildung, der Möglichkeiten <strong>zur</strong> persönlichen<br />
Weiterentwicklung sowie der freundschaftlichen Atmosphäre unter den<br />
Studierenden mehrheitlich als erfüllt wahrgenommen.<br />
223
8 <strong>Studien</strong>alltag und –realität<br />
8.1 <strong>Studien</strong>anforderungen<br />
43% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage: „Die <strong>Studien</strong>anforderungen in<br />
meinem ersten studierten Fach sind zu hoch.“, eher (31,6%) oder in vollem<br />
Maße (11,4%) zu. Detailliert ergibt sich folgendes Bild:<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen in meinem ersten Fach sind zu hoch. (Chi²=88,163, df=3,<br />
p
Übersicht: Zu hohe Anforderungen (1. Fach) in Abhängigkeit vom studierten Fach<br />
Fach Geringere Höhere Chi- df Asym. Eta<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Quadrat Signifikanz<br />
Mathematik<br />
X 12,793 3
In der Gegenüberstellung der Mittelwerte für die einzelnen Items wird<br />
außerdem deutlich, dass die Zust<strong>im</strong>mungen zu überhöhten inhaltlichen<br />
Anforderungen <strong>im</strong> ersten studierten Fach geringer ausfallen als <strong>im</strong> zweiten:<br />
Statistiken: Einschätzung der <strong>Studien</strong>anforderungen in den beiden Fächern und das<br />
damit verbundene Belastungsempfinden<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen<br />
in<br />
meinem<br />
ersten Fach<br />
sind zu hoch.<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen<br />
in<br />
meinem 2. Fach<br />
sind zu hoch.<br />
Dies erlebe ich<br />
als Belastung<br />
N 263 264 260 261<br />
12 11 15 14<br />
Mittelwert 2,4297 2,1894 2,6385 2,4100<br />
Median 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000<br />
Standardabweichung<br />
,83905 ,98762 ,81020 ,99060<br />
Wird die Grenze zwischen Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage auf der vierstufigen<br />
Antwortskala bei 2,5 angesetzt, so kann damit gesagt werden, dass die<br />
Studierenden durchschnittlich die inhaltlichen Anforderungen in beiden<br />
studierten Fächern als sehr hoch einschätzen und hiervon ausgehende<br />
<strong>Belastungen</strong> wahrnehmen. Grundsätzlich ist damit in der Höhe der<br />
inhaltlichen Anforderungen der studierten Fächer, so wie sie durch die<br />
Studierenden wahrgenommen wird, ein potenzieller Belastungsfaktor zu<br />
sehen.<br />
Ein gänzlich verändertes Bild wird deutlich, wenn die Höhe der<br />
Anforderungen in Erziehungswissenschaft beurteilt wird:<br />
Die <strong>Studien</strong>anforderungen in Erziehungswissenschaft sind zu hoch. (Chi²=148,483,<br />
df=3, p
Die <strong>Studien</strong>anforderungen in Erziehungswissenschaft erlebe ich als Belastung<br />
(Chi²=134,186, df=3. P
Befragten gebeten anzugeben, in welchem Maße sie der Aussage: „Die<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen sind klar und transparent.“, zust<strong>im</strong>men.<br />
Im ersten studierten Fach st<strong>im</strong>mt eine Mehrheit von 68% der Befragten der<br />
Aussage eher (48,5%) und voll (19,5%) zu. Detailliert ergibt sich folgendes<br />
Antwortverhalten:<br />
Die <strong>Studien</strong>bedingungen in meinem ersten Fach sind klar und transparent.<br />
(Chi²=115,221, df=3, p
Auch hier sind die extremen Antwortkategorien deutlich unterbesetzt,<br />
jedoch st<strong>im</strong>mt eine Mehrheit der Befragten der Aussage eher zu, sodass<br />
die <strong>Studien</strong>bedingungen <strong>im</strong> zweiten studierten Fach mehrheitlich als eher<br />
transparent wahrgenommen werden. Für 39,2% gehen hiervon belastende<br />
Effekte aus. Beide Aspekte korrelieren statistisch signifikant (p
Statistiken: Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen in den beiden Fächern und<br />
Erziehungswissenschaft sowie das damit verbundene Belastungsempfinden<br />
Transparenz<br />
1. Fach Belastung<br />
Transparenz<br />
2. Fach Belastung<br />
Transparenz<br />
Ezw Belastung<br />
N 262 263 257 258 263 263<br />
13 12 18 17 12 12<br />
Mittelwert 2,8473 1,8935 2,6537 2,1550 2,8973 1,8517<br />
Median 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000<br />
Standardab<br />
weichung<br />
,75783 ,83579 ,77606 ,89050 ,72108 ,81310<br />
Durchschnittlich st<strong>im</strong>men die Studierenden der Aussage nach<br />
transparenten <strong>Studien</strong>bedingungen eher zu, da die Grenze zwischen<br />
ablehnenden und zust<strong>im</strong>menden Antworten bei 2,5 zu setzen ist. Die<br />
Mittelwerte liegen aber zum einen relativ nah an dieser Grenze und streuen<br />
zum anderen bis zu ,776 um diesen Mittelwert. Dabei ist die Zust<strong>im</strong>mung<br />
zu transparenten <strong>Studien</strong>bedingungen in Erziehungswissenschaft<br />
durchschnittlich am höchsten. Dennoch wird auch hier keine vollständige<br />
Transparenz wahrgenommen. Daneben gehen von der Transparenz der<br />
<strong>Studien</strong>bedingungen durchschnittlich eher kaum belastende Faktoren aus.<br />
Wird jedoch die Transparenz eher weniger wahrgenommen, so nehmen<br />
diejenigen auch belastende Effekte hiervon sowohl innerhalb der Fächer<br />
als auch innerhalb der Erziehungswissenschaft wahr.<br />
Auch hier wurden die Korrelationen zwischen der<br />
Transparenzwahrnehmung in den drei Bereichen gerechnet. Die<br />
Korrelationen ergeben dabei Werte zwischen r=.007 und r=.021 und<br />
werden auf den Niveau von p=0,01 nicht signifikant. Damit kann kein<br />
generalisierter Blick auf die Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen<br />
konstatiert werden, sodass nicht gesagt werden kann, dass eine Gruppe<br />
von Studierenden generell die <strong>Studien</strong>bedingungen für intransparent hält.<br />
Darüber hinaus ergeben sich keine fachspezifischen Implikationen.<br />
8.3 Strukturierungsgrad des Studiums<br />
Die Studierenden wurden gebeten anzugeben, in welchem Maße sie der<br />
Aussage: „Der <strong>Studien</strong>verlauf ist stark strukturiert und größtenteils<br />
vorgegeben.“, für ihr erstes und zweites studiertes Fach sowie die<br />
Erziehungswissenschaft zust<strong>im</strong>men. In dieser Hinsicht sollten sie<br />
anschließend wiederum spezifiziert auf die Fächer angeben, in welchem<br />
Maße sie diese strukturellen Vorgaben als Belastung wahrnehmen und wie<br />
flexibel sie ihren Stundenplan gestalten konnten.<br />
230
Für das erste studierte Fach ergeben sich folgende Aussagen:<br />
74,3% der befragten Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage eines größtenteils<br />
vorgebenden und stark strukturierten Studiums eher (44,8%) oder voll<br />
(29,5%) zu. Einen Überblick über das Antwortverhalten vermittelt<br />
nachfolgende Tabelle:<br />
Zust<strong>im</strong>mung <strong>zur</strong> Aussage: Der <strong>Studien</strong>verlauf <strong>im</strong> ersten Fach ist größtenteils<br />
vorgegeben und stark strukturiert (Chi²=86,939, df=3, p
stark vorgebend wahrgenommen. Damit können die Aussagen, die für das<br />
erste studierte Fach getroffen werden, auch für das zweite studierte Fach in<br />
ähnlicher Weise gelten.<br />
Für das Studium in Erziehungswissenschaft ergeben sich folgende Werte:<br />
77,2% der Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage, das Studium in<br />
Erziehungswissenschaft sei stark strukturiert und vorgebend in vollem<br />
Maße (21,7%) oder eher (55,5%) zu. Im Detail ergeben sich folgende<br />
Werte für das Antwortverhalten:<br />
Der <strong>Studien</strong>verlauf in Erziehungswissenschaft ist größtenteils vorgegeben und stark<br />
strukturiert. (Chi²=161,837, df=3, p
universitäre Lehramtsstudium in Jena kann damit als stark vorgebend und<br />
strukturiert bezeichnet werden.<br />
Belastende Aspekte werden dabei durchschnittlich eher nicht<br />
wahrgenommen. Für 50% (Median 2) der Befragten ergeben sich aus dem<br />
Grad der Strukturierung des Studiums eher keine belastenden Effekte.<br />
Grundsätzlich kann ein linearer Zusammenhang zwischen der Zust<strong>im</strong>mung<br />
zum hohen Grad der Strukturiertheit des Studiums und einer hiervon<br />
ausgehenden Belastung nicht gemessen werden.<br />
Die Korrelationen zwischen dem eingeschätzten Grad der Strukturierung<br />
und der Vorgaben des Studiums einerseits und dem Belastungsempfinden<br />
andererseits werden in allen drei Bereichen auf dem Niveau von p=0,01<br />
nicht signifikant. Die Aussage, je stärker der Studierende den<br />
Strukturierungsgrad des Studiums wahrn<strong>im</strong>mt, desto stärker sieht er<br />
hiervon ausgehende belastende Effekte und umgekehrt, darf also nicht<br />
angestellt werden.<br />
In ähnliche Richtung zielt ein Item, durch das die Studierenden dazu<br />
aufgefordert wurden anzugeben, in welchem Maße sie der Aussage, „Ich<br />
konnte meinen Stundenplan sehr flexibel zusammenstellen.“, zust<strong>im</strong>men.<br />
Gleichzeitig sollten die Studierenden die Belastung einschätzen, die von<br />
dieser mehr oder weniger vorhandenen Flexibilität bei der<br />
Stundenplangestaltung für sie ausgeht.<br />
33,3% der Studierenden st<strong>im</strong>men der Aussage einer hohen Flexibilität bei<br />
der Stundenplanzusammenstellung in vollem Maße (8,4%) oder eher<br />
(24,9%) zu. Dabei nehmen 41% hiervon ausgehende belastende Effekte<br />
wahr. Im Detail ergeben sich die folgenden Werte:<br />
Ich konnte meinen Stundenplan sehr flexibel zusammenstellen. (Chi²=62,326, df=3,<br />
p
Die Flexibilität bei der Stundenplanerstellung erlebe ich als Belastung (Chi²=25,759,<br />
df=3, p
untersuchen, in welcher Richtung der wahrgenommene Selektionsdruck<br />
und die Belastung zusammenhängen, wurden die Korrelationen zwischen<br />
beiden Items berechnet. Hierfür ergab sich folgendes Bild:<br />
Korrelationen des Selektionsdrucks <strong>im</strong> ersten Fach mit der damit verbundenen<br />
Belastung<br />
Spearman Rho<br />
Der Selektionsdruck<br />
ist sehr hoch 1. Fach<br />
Korrelationskoeffizient<br />
Der Selektionsdruck<br />
ist sehr hoch 1.<br />
Fach<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
1 ,729<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000 ,000<br />
Die Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage eines sehr hohen Selektionsdrucks und der<br />
zu einer hiervon ausgehenden belastenden Wirkung korrelieren hoch und<br />
signifikant miteinander. Je stärker damit der Selektionsdruck eingeschätzt<br />
wird, desto stärker wirkt dieser Selektionsdruck belastend auf die<br />
Studierenden ein.<br />
Für das zweite studierte Fach ergeben sich hinsichtlich dieser Aspekte<br />
folgende Werte. 63,7% st<strong>im</strong>men der Aussage eines sehr hohen<br />
Selektionsdrucks in vollem Maße (28,2%) und eher (35,5%) zu. Im Studium<br />
des zweiten studierten Faches wird damit mehrheitlich ein hoher<br />
Selektionsdruck wahrgenommen. Detailliert ergibt sich folgendes Bild:<br />
Der Selektionsdruck <strong>im</strong> zweiten Fach ist sehr hoch. (Chi²=46,467, df=3, p
studierte Fach gelten: Je höher der wahrgenommene Selektionsdruck,<br />
desto höher die hiervon ausgehenden belastenden Effekte.<br />
Zusammenhänge zwischen der Zust<strong>im</strong>mung zu einem hohen<br />
Selektionsdruck und den studierten Fächern können für folgende studierte<br />
Fächer angegeben werden:<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> Aussage<br />
Quadrat<br />
X 21,962 3
Befragten kaum auf. Auch hier wird das Auftreten belastender Effekte<br />
durch die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen beiden Items<br />
deutlich:<br />
Korrelationen des Selektionsdrucks in Erziehungswissenschaft mit dem damit<br />
verbundenen Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho<br />
Der Selektionsdruck ist<br />
sehr hoch<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Dies erlebe<br />
ich als<br />
Belastung<br />
Der Selektionsdruck<br />
ist sehr hoch<br />
Erziehungswissenschaft<br />
Korrelationskoeffizient<br />
1 ,708<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Beide Items korrelieren hoch und stark miteinander. Auch für das Studium<br />
in Erziehungswissenschaft gilt damit: Je höher der Grad des<br />
Selektionsdrucks beurteilt wird, desto mehr belastende Effekte werden<br />
wahrgenommen, die hiervon ausgehen. Der Selektionsdruck in<br />
Erziehungswissenschaft ist aber <strong>im</strong> Vergleich zu den Fächern deutlich<br />
geringer, sodass sich hier auch die Belastungseffekte deutlich geringer<br />
äußern.<br />
Insgesamt soll geprüft werden, in welchem Zusammenhang sowohl die<br />
einzelnen Einschätzungen zum Selektionsdruck als auch zum<br />
Belastungsempfinden stehen. Dabei ergeben sich folgende Werte:<br />
Korrelationen: Selektionsdruck in beiden Fächern und Erziehungswissenschaft mit<br />
dem damit verbundenen Belastungsempfinden<br />
Belastung<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,002 ,000<br />
Spearman<br />
Belastung<br />
Belas-<br />
Rho<br />
1. Fach<br />
2. Fach tung Ezw<br />
1. Fach Korrelationkoeffizient<br />
,192 ,290<br />
Belastung<br />
Korrelationkoeffizient<br />
,404 ,430<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,000 ,000<br />
2. Fach Korrelationskoeffizient<br />
Belastung<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig)<br />
Korrelationskoeffizient<br />
,258<br />
Signifikanz (2-<br />
seitig) ,000<br />
237
Die Wahrnehmungen zwischen den einzelnen Teilbereichen korrelieren<br />
signifikant schwach sowohl hinsichtlich des Selektionsdrucks als auch der<br />
belastenden Effekte miteinander. Wer sich durch den Selektionsdruck <strong>im</strong><br />
ersten studierten Fach belastet fühlt, weist zumindest ähnliche Effekte auch<br />
<strong>im</strong> zweiten studierten Fach auf, während dieser Zusammenhang für die<br />
Erziehungswissenschaft zwar signifikant, aber sehr gering ausfällt. Die<br />
Wahrnehmung eines hohen Selektionsdruckes ist damit grundsätzlich mit<br />
belastenden Effekten verbunden.<br />
Insgesamt kann damit gesagt werden, dass die Studierenden mehrheitlich<br />
innerhalb ihrer studierten Fächer einen hohen Selektionsdruck<br />
wahrnehmen, der mit belastenden Effekten einhergeht. Obwohl für das<br />
Studium in Erziehungswissenschaft der Selektionsdruck in Relation zu den<br />
Fächern deutlich geringer beurteilt wird, sind hier ähnliche belastende<br />
Effekte messbar, wenn der Selektionsdruck als hoch empfunden wird.<br />
8.5 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen<br />
Den Studierenden wurde die Aussage: „Mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen bin ich sehr zufrieden.“, vorgelegt. Hierauf wurde der<br />
Grad der Zust<strong>im</strong>mung zu diesem Item in Bezug auf das erste und das<br />
zweite studierte Fach sowie auf Erziehungswissenschaft untersucht.<br />
64,1% der Befragten st<strong>im</strong>mten der Aussage <strong>im</strong> Hinblick auf das erste<br />
studierte Fach in vollem Maße (16,4%) und eher (47,7%) zu. Im Detail<br />
ergibt sich folgende Übersicht:<br />
Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre <strong>im</strong> ersten Fach bin ich sehr zufrieden.<br />
(Chi²=82,750, df=3, p
Gestaltung der Lehrveranstaltungen zumindest als partiell belastend zu<br />
erleben<br />
Dabei existiert zwischen der Beurteilung der Zufriedenheit mit der<br />
Gestaltung der Lehrveranstaltungen und den hiervon ausgehenden<br />
Belastungswahrnehmungen ein statistisch signifikanter negativer<br />
Zusammenhang:<br />
Korrelation der Zufriedenheit der didaktischen Gestaltung <strong>im</strong> ersten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho Zufriedenheit Belastung<br />
Zufriedenheit Korrelationskoeffizient 1 -,672<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Damit konnte ein Zusammenhang zwischen beiden Items derart gemessen<br />
werden, dass eine Ablehnung der ersten Aussage mit einer Zust<strong>im</strong>mung<br />
<strong>zur</strong> zweiten Aussage zusammenhängt. Wer also mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen eher unzufrieden ist, für den gehen hiervon auch eher<br />
belastende Effekte aus.<br />
Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit den Lehrveranstaltungen<br />
und den studierten Fächern können nicht gemessen werden.<br />
Ähnliche Ergebnisse konnten für die Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen für das zweite studierte Fach gemessen werden. Hier<br />
st<strong>im</strong>men der Aussage 61,4% der Befragten in vollen Maße (13%) oder eher<br />
(48,4%) zu.<br />
Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre <strong>im</strong> zweiten Fach bin ich sehr zufrieden.<br />
(Chi²=86,126, df=3, p
Korrelation der Zufriedenheit der didaktischen Gestaltung <strong>im</strong> zweiten Fach mit dem<br />
Belastungsempfinden<br />
Spearman Rho Zufriedenheit Belastung<br />
Zufriedenheit Korrelationskoeffizient 1 -,573<br />
Signifikanz (2-seitig) ,000<br />
Die Korrelation bestätigt damit für das zweite <strong>Studien</strong>fach die für das erste<br />
studierte Fach gemessenen Zusammenhänge.<br />
In Bezug auf das Studium innerhalb der Erziehungswissenschaft st<strong>im</strong>men<br />
der Aussage zu einer Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen 75,2% der Befragten in vollem Maße (26%) und eher<br />
(49,2%) zu.<br />
Mit der didaktischen Gestaltung der Lehre in Erziehungswissenschaft bin ich sehr<br />
zufrieden. (Chi²=103,372, df=3, p
8.6 Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien<br />
Ähnlich wie bei der Beurteilung der Zufriedenheit mit der Gestaltung der<br />
Lehrveranstaltungen wurden die Studierenden gebeten anzugeben, in<br />
welchem Maße sie einer entsprechenden Aussage für die<br />
Arbeitsmaterialien, die in den Lehrveranstaltungen ausgegeben bzw. <strong>zur</strong><br />
Verfügung gestellt werden, zust<strong>im</strong>mten und welche Effekte hiervon<br />
ausgehen. Dabei wurde wieder zwischen den studierten Fächern und der<br />
Erziehungswissenschaft unterschieden.<br />
Für das erste Fach st<strong>im</strong>mten einer Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien<br />
69,3% der Befragten in vollem Maße (33,3%) und eher (36%) zu. Im<br />
Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
Mit der Qualität der Materialien <strong>im</strong> ersten Fach bin ich sehr zufrieden. (Chi²=51,720,<br />
df=3, p
Für das zweite Fach st<strong>im</strong>men der Aussage <strong>zur</strong> Zufriedenheit mit den<br />
Arbeitsmaterialien 65,6% der Befragten in vollem Maße (23,9%) und eher<br />
(41,7%) zu. Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
Mit der Qualität der Materialien <strong>im</strong> zweiten Fach bin ich sehr zufrieden. (Chi²=61,757,<br />
df=3, p
Hier fällt besonders die starke Unterbesetzung der völlig verneinenden<br />
Antwortkategorie auf, während die eher zust<strong>im</strong>mende Kategorie deutlich<br />
überbesetzt ist. Dementsprechend gehen hiervon nur für 16,5% der<br />
Befragten belastende Effekte aus.<br />
Die Prüfung des Zusammenhangs bestätigt die Ergebnisse, die bereits für<br />
die studierten Fächer formuliert wurden. Je höher die Qualität der<br />
Materialien beurteilt wird, desto geringer wird die damit verbundene<br />
Belastungswahrnehmung.<br />
Korrelation der Zufriedenheit mit der Qualität der Materialien in<br />
Erziehungswissenschaft mit dem Belastungsempfinden<br />
Zufriedenheit Belastung<br />
Spearman-Rho Zufriedenheit Korrelationskoeffizient 1,000 -,509<br />
Sig. (2-seitig) . ,000<br />
8.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil<br />
57,3% der Befragten st<strong>im</strong>men der Aussage: "Mit meinem Arbeitsstil bin ich<br />
sehr zufrieden.", in vollem Maße (9,2%) und eher (48,1%) zu. Damit äußern<br />
die Studierenden mehrheitlich eine zumindest partielle Unzufriedenheit mit<br />
dem eigenen Arbeitsstil. Detailliert ergeben sich folgende Ergebnisse:<br />
Ich bin mit meinem Arbeitsstil sehr zufrieden. (Chi²=330,351, df=5, p
Je höher damit die Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil ausgeprägt ist,<br />
desto geringer sind die hiervon ausgehenden wahrgenommenen<br />
belastenden Effekte.<br />
8.8 Selbstwirksamkeitsüberzeugung<br />
In dieser Hinsicht wurden die Studierenden gebeten anzugeben, in<br />
welchem Maße sie der Aussage: „Ich bin überzeugt davon, dass meine<br />
Fähigkeiten für die erfolgreiche Bewältigung des Studiums ausreichen.“,<br />
zust<strong>im</strong>men. 81,3% der Befragten st<strong>im</strong>men dieser Aussage in vollem Maße<br />
(20,2%) und eher (61,1%) zu. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:<br />
Ich bin überzeugt, dass meine Fähigkeiten für das Studium ausreichen. (Chi²=205,511,<br />
df=3, p
Bewältigung des Studiums eingeschätzt werden, umso geringer sind die<br />
belastenden Effekte, die hiervon ausgehen.<br />
9 Persönlichkeitsvariablen<br />
9.1 Frustrationstoleranz<br />
Der ersten Aussage hierzu: „Wenn ich nicht erreiche, was ich wollte,<br />
resigniere ich schnell“, st<strong>im</strong>men 16,6% der Befragten in vollem Maße<br />
(3,0%) und überwiegend (13,3%) zu. Im Einzelnen ergibt sich folgendes<br />
Bild:<br />
Wenn ich nicht erreiche, was ich wollte, resigniere ich schnell. (Chi²=132,906, df4,<br />
p
Wenn ich irgendwo versagt habe, spornt mich das an, mehr zu tun. (Chi²=99,182,<br />
df=4, p
Studierendennorm ist die Frustrationstoleranz der Befragten als<br />
durchschnittlich (Werte zwischen 8-10), <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Idealnorm<br />
ebenfalls als durchschnittlich (Werte zwischen 10-12) zu bezeichnen, wobei<br />
die Studierenden hinsichtlich der Studierendennorm <strong>im</strong> oberen und in<br />
Bezug auf die Idealnorm <strong>im</strong> unteren Durchschnittsbereich verortet werden.<br />
(Ebenda S. 233)<br />
9.2 Flexibilität<br />
Dem ersten Item, „Ich kann mich auf unvorhergesehene Situationen gut<br />
einstellen.“, st<strong>im</strong>men 51,5% der Befragten in vollem Maße (9,1%) und<br />
überwiegende (42,4%) zu. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:<br />
Ich kann mich auf unvorhergesehene Situationen gut einstellen. (Chi²=185,091, df=4,<br />
p
Die Zust<strong>im</strong>mung zu der Aussage „An neue Bedingungen kann ich mich<br />
problemlos anpassen.“ beträgt 57,4% (Kategorie 5=14% und Kategorie 4 =<br />
43,4%).<br />
An neue Bedingungen kann ich mich problemlos anpassen. (Chi²=205,132, df=4,<br />
p
Der Skalenmittelwert beträgt M=3,376 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=.67.<br />
Nach einer Transformation auf die Stanineskala ergibt sich ein<br />
Durchschnittswert der Skala von M=0,13 mit einer Standardabweichung<br />
von SD=.201. Die Studierenden weisen damit <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong><br />
Studentennorm (Wertebereich 10-11) durchschnittliche und <strong>im</strong> Vergleich<br />
mit der Idealnorm (Wertebereich 11-13) leicht unterdurchschnittliche<br />
Merkmalsausprägungen hinsichtlich der Flexibilität auf.<br />
9.3 Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft<br />
Dem ersten Item hierzu, „Ich bin darauf eingestellt, dass es <strong>im</strong> Studium<br />
keinen wirklichen Feierabend gibt.“, st<strong>im</strong>men 52,8% der Befragten in vollem<br />
Maße (14,3%) und überwiegend (38,5%) zu. Detailliert ergeben sich<br />
folgende Werte:<br />
Im Studium gibt es keinen wirklichen Feierabend. (Chi²=104,755, df=4, p
neutralen Mitte. Gleichzeitig ist jedoch auch hier wieder die überwiegend<br />
zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie überbesetzt.<br />
Der Aussage „Es fällt mir schwer, mich abends und am Wochenende mit<br />
dem Studium zu befassen.“ st<strong>im</strong>men wiederum 27,6% der Befragten in<br />
vollem Maße (9,1%) und überwiegend (18,5%) zu. Im Einzelnen ergeben<br />
sich hierfür die folgenden Werte:<br />
Es fällt mir schwer, mich abends und am Wochenende mit Studium zu befassen.<br />
(Chi²=76,792, df=4, p
Item-Skala-Statistiken: Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft<br />
Im Studium gibt es<br />
keinen Feierabend.<br />
Ich bin bereit,<br />
Privates<br />
<strong>zur</strong>ückzustellen.<br />
Es fällt mir schwer,<br />
mich abends und<br />
am Wochenende mit<br />
Studium zu<br />
befassen.<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
6,2642 2,612 ,365 ,390<br />
6,5434 2,598 ,429 ,295<br />
6,6566 2,704 ,247 ,592<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Die gebildete Skala weist einen Skalenmittelwert von M= 3,24 mit einer<br />
Standardabweichung von SD= .73 auf.<br />
Nach Transformation auf die Stanineform ergibt sich ein Mittelwert von<br />
M=9,73 mit einer Standardabweichung von SD=2,19. Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Studentennorm sind die Merkmalsausprägungen hinsichtlich des<br />
Konstrukts „Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft“ als<br />
durchschnittlich (Wertebereich 9-11) und <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Idealnorm als<br />
leicht unterdurchschnittlich (Wertebereich 10-12) zu bezeichnen.<br />
9.4 Erholungs- und Entspannungsfähigkeit<br />
Der ersten Aussage hierzu, „Ich verstehe es, Arbeit und Erholung<br />
miteinander zu vereinbaren.“, st<strong>im</strong>men 32,5% der Befragten in vollem<br />
Maße (9,1%) und überwiegend (23,4%) zu. Im Einzelnen betragen die<br />
Werte:<br />
Ich verstehe es, Arbeit und Erholen zu vereinbaren. (Chi²=124,302, df=4, p
Der Aussage: „Ich kann mich in meiner Freizeit gut entspannen und<br />
erholen.“, st<strong>im</strong>men 56,6% der Befragten voll (21,9%) und überwiegend<br />
(34,7%) zu.<br />
Ich kann mich in meiner Freizeit gut erholen und entspannen. (Chi²=63,094, df=3,<br />
p
Reliabilitätsstatistik: Erholungs- und Entspannungsfähigkeit<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,771 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Erholungs- und Entspannungsfähigkeit<br />
Ich verstehe es, Arbeit<br />
und Erholen zu<br />
vereinbaren.<br />
Ich kann mich in meiner<br />
Freizeit gut erholen und<br />
entspannen.<br />
Ich kann nur schwer<br />
abschalten.<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
6,8302 4,429 ,495 ,800<br />
6,4340 3,148 ,720 ,550<br />
6,6679 3,374 ,617 ,677<br />
Cronbachs<br />
Alpha,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Der Mittelwert der so gebildeten Skala beträgt M=3,32 bei einer<br />
Standardabweichung von SD= .90.<br />
Nach der Transformation auf die Stanineform beträgt der Skalenmittelwert<br />
in der vorliegenden Untersuchung M=9,96 mit einer Standardabweichung<br />
von SD=2,71. Mit diesen Werten kann die Merkmalsausprägung des<br />
Konstruktes „Erholungs- und Entspannungsfähigkeit“ der Studierenden in<br />
der vorliegenden Untersuchung <strong>im</strong> Vergleich <strong>zur</strong> Studentennorm als<br />
durchschnittlich (Wertebereich für durchschnittliche Ausprägung 10-12) und<br />
in Relation <strong>zur</strong> Idealnorm als deutlich unterdurchschnittlich (Wertebereich<br />
für durchschnittliche Ausprägung 11-13) bezeichnet werden.<br />
9.5 Fähigkeit zu rationellem Arbeiten<br />
Dem ersten Item: „Es fällt mir schwer, Prioritäten zu setzen.“, st<strong>im</strong>men<br />
31,0% der Befragten in vollem Maße (6,8%) und überwiegend (24,2%) zu.<br />
Im Einzelnen ergeben sich hierfür folgende Werte:<br />
Es fällt mir schwer, Prioritäten zu setzen. (Chi²=74,453, df=4, p
Der Aussage: „Ich komme in der vorgegebenen Zeit meist gut klar mit<br />
meinen Arbeiten.“, st<strong>im</strong>men 42,8% der Befragten in vollem (3,8%) und<br />
überwiegendem Maße (39%) zu.<br />
Ich komme in der vorgegebenen Zeit meist gut mit meinen Arbeiten klar.<br />
(Chi²=137,780, df=4, p
Reliabilitätsstatistik: Fähigkeit zum rationellen Arbeiten<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,476 3<br />
Item-Skala-Statistiken: Fähigkeit zum rationellen Arbeiten<br />
Es fällt mir schwer,<br />
Prioritäten zu<br />
setzen.<br />
Ich komme in der<br />
vorgegebenen Zeit<br />
meist gut mit<br />
meinen Arbeiten<br />
klar.<br />
Ich fürchte, ich<br />
arbeite nicht<br />
rationell genug<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte Item-<br />
Skala-<br />
Korrelation<br />
5,7909 2,219 ,292 ,389<br />
5,8745 2,583 ,263 ,433<br />
5,7262 2,413 ,339 ,307<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Auf die Bildung der entsprechenden Skala muss aufgrund einer deutlich<br />
un<strong>zur</strong>eichenden Reliabilität verzichtet werden.<br />
9.6 Stressresistenz<br />
Der ersten Aussage: „Unter Stress lebe ich erst so richtig auf.“, st<strong>im</strong>men<br />
35,9% der Befragten in vollem Maße (10,6%) und überwiegend (25,3%) zu.<br />
Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:<br />
Unter Stress lebe ich erst richtig auf. (Chi²=58,679, df=4, p
Bei großem Druck gerate ich leicht in Panik. (Chi²=63,509, df=4, p
Item-Skala-Statistiken: Stressresistenz<br />
Unter Stress lebe ich erst<br />
richtig auf.<br />
Bei großem Druck gerate<br />
ich leicht in Panik<br />
Wenn mehreres<br />
gleichzeitig zu tun ist, wird<br />
mir das schnell zu viel.<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelas<br />
sen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
5,6377 3,524 ,567 ,702<br />
5,8377 2,939 ,634 ,424<br />
5,6491 3,418 ,538 ,561<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Der Skalenmittelwert liegt bei M=3,01 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=.85. Nach Transformation auf eine Stanineskala erreicht der Mittelwert<br />
der Skala M=9,44 und die Standardabweichung SD=2,56. Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Studentennorm ist damit die Merkmalsausprägung „Stressresistenz“ als<br />
durchschnittlich (Wertebereich für durchschnittliche Ausprägungen 9-11)<br />
und in Relation <strong>zur</strong> Idealnorm als deutlich unterdurchschnittlich<br />
(Wertebereich für durchschnittliche Ausprägungen 11-12) zu bezeichnen.<br />
9.7 Skalenbildung<br />
Die Skalen, die aufgrund der vorliegenden Reliabilitätsstatistik gebildet<br />
werden konnten, werden zu einer Gesamtskala „Persönlichkeitsmerkmale“<br />
zusammengefasst. Diese Skala wurde einer Reliabilitätsanalyse<br />
unterzogen, die folgende Werte aufweist:<br />
Reliabilitätsstatistik: Persönlichkeitsmerkmale<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,753 5<br />
Item-Skala-Statistiken: Persönlichkeitsmerkmale<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
Frustrationstoleranz 39,2710 43,133 ,562 ,626<br />
Flexibilität 38,8282 46,036 ,593 ,625<br />
Entbehrungsbereitschaft 39,2023 53,580 ,247 ,743<br />
Erholungsfähigkeit 38,9924 44,092 ,409 ,696<br />
Stressresistenz 39,5382 40,571 ,585 ,613<br />
Cronbachs<br />
Alpha,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
257
Die Skala wurde einer rotierten Hauptkomponentenanalyse unterzogen, um<br />
zu prüfen, durch welche Faktoren die Skala geprägt wird. Die Ergebnisse<br />
sind nachfolgend dargestellt:<br />
Rotierte Komponentenmatrix(a)<br />
Komponente<br />
1 2<br />
Frustrationstoleranz ,447 ,663<br />
Flexibilität ,698 ,352<br />
Entbehrungsbereitschaft -,004 ,927<br />
Erholungsfähigkeit ,839 -,186<br />
Stressresistenz ,786 ,205<br />
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.<br />
Rotationsmethode: Var<strong>im</strong>ax mit Kaiser-Normalisierung.<br />
a Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.<br />
Als Ergebnis der Analyse ist damit eine zweifaktorielle Lösung<br />
anzunehmen, wobei die Faktoren 69,708% an Gesamtvarianz, der erste<br />
Faktor 42,160% und der zweite 27,548% erklären. Der erste Faktor kann<br />
nach obiger Rotation bezeichnet werden als „Flexible regenerationsfähige<br />
Arbeitsweise“. Der zweite Faktor thematisiert das Ausmaß des<br />
persönlichen Einsatzes und der Misserfolgsverarbeitung. Beide Faktoren<br />
werden in das zu bildende Belastung-Regressionsmodell als unabhängige<br />
Variable für das Belastungsempfinden der Studierenden einbezogen.<br />
10 Sorgen und Ängste <strong>im</strong> Studium<br />
Den Studierenden wurden 8 Items vorgelegt, die vermutete Ängste und<br />
Sorgen, die mit dem individuellen Studium in Zusammenhang stehen<br />
könnten, thematisieren. Diesen Aussagen war in einer 5 Auswahlantworten<br />
umfassenden Skala zuzust<strong>im</strong>men.<br />
Die Antworten auf die einzelnen Items werden zunächst <strong>im</strong> Überblick mit<br />
den Werten der zentralen Tendenz und in ihren Streuungen dargestellt, um<br />
hieraus eine Rangfolge der einzelnen Themen bilden zu können.<br />
Statistiken: Ängste und Sorgen <strong>im</strong> Studium<br />
Orientierung<br />
in Fachinhalten<br />
Anforderung<br />
gerecht<br />
zu<br />
werden<br />
Mangelnde<br />
Praxisnähe<br />
Fehlender<br />
roter<br />
Faden<br />
Konkurrenz<br />
In der<br />
Masse<br />
untergehen<br />
Studium<br />
scheitert<br />
Keinen<br />
persönlichen<br />
Nutzen<br />
2,9774 3,5019 3,0151 2,7358 2,5076 2,6642 3,5189 2,0113<br />
Median 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 4,0000 2,0000<br />
Mittelwert<br />
Standardabweichung<br />
,97286 1,02294 1,0407 1,08974 1,14032 1,16955 1,2238 1,03163<br />
258
Werden zudem die Kategorien „st<strong>im</strong>me sehr stark zu“ und „st<strong>im</strong>me stark<br />
zu“ zusammengefasst, ergibt sich prozentual folgende Übersicht:<br />
Statistiken: Ängste und Sorgen <strong>im</strong> Studium (starke und sehr starke Zust<strong>im</strong>mung)<br />
St<strong>im</strong>me<br />
sehr stark<br />
und stark<br />
zu<br />
Orientierung<br />
in Fachinhalten<br />
Anforderung<br />
gerecht<br />
zu<br />
werden<br />
Mangelnde<br />
Praxisnähe<br />
Fehlender<br />
roter<br />
Faden<br />
Konkurrenz<br />
In der<br />
Masse<br />
untergehen<br />
Studium<br />
scheitert<br />
Keinen<br />
persönlichen<br />
Nutzen<br />
29,9% 52,8% 31,3% 24,9% 21,6% 26,8% 54,5% 10,2%<br />
Die Sorgen, mit dem Studium zu scheitern und den Anforderungen nicht<br />
gerecht zu werden, sind sowohl prozentual als auch durchschnittlich am<br />
stärksten ausgeprägt. Dies unterstreicht nochmals der relativ hohe<br />
Medianwert. Im Einzelnen ergeben sich für beide Items folgende Werte:<br />
Ich habe Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. (Chi²=92,943, df=4,<br />
p
Auch hier sind die Antwortkategorien, die die Aussage eher und gänzlich<br />
ablehnen, deutlich unterbesetzt, während eine deutliche Mehrheit der<br />
Aussage stark und sehr stark zust<strong>im</strong>mt.<br />
Demgegenüber rangiert die Befürchtung, in den Inhalten der<br />
Fachwissenschaften die Orientierung zu verlieren, eher nachrangig:<br />
Mir bereitet Sorge, in der Vielfalt der Fachinhalte die Orientierung zu verlieren.<br />
(Chi²=107,962, df=4, p
Beobachtetes<br />
N<br />
Erwartete<br />
Anzahl Residuum<br />
gar nicht 55 52,8 2,2<br />
weniger 90 52,8 37,2<br />
teilweise 62 52,8 9,2<br />
stark 44 52,8 -8,8<br />
sehr stark 13 52,8 -39,8<br />
Gesamt 264<br />
Ich habe Sorge in der Masse unterzugehen. (Chi²=46,604, df=4, p
Korrelationen der Ängste und Sorgen <strong>im</strong> Studium<br />
Roter<br />
Faden<br />
Masse<br />
Orientie<br />
-rung<br />
Fachinhalte<br />
Anforderung<br />
Praxisnähe<br />
Konkurrenz<br />
Scheitern<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
Orientierung<br />
Fachinhalte<br />
Anforderungen<br />
Praxis Roter Konkurrensterzen<br />
Mas-<br />
Schei-<br />
Nut-<br />
-nähe Faden<br />
1 ,476 ,187 ,441 ,310 ,300 ,401 ,151<br />
Signifikanz ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
1 ,189 ,344 ,343 ,303 ,669 ,203<br />
Signifikanz ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
1 ,388 ,209 ,294 ,204 ,141<br />
Signifikanz ,000 ,001 ,000 ,001 ,022<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
1 ,278 ,340 ,374 ,269<br />
Signifikanz ,000 ,000 ,000 ,000<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
1 ,547 ,352 ,207<br />
Signifikanz ,000 ,000 ,001<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
1 ,374 ,261<br />
Signifikanz ,000 ,000<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
1 ,244<br />
Signifikanz ,000<br />
Nutzen<br />
Korrelation nach<br />
Pearson<br />
Signifikanz<br />
1<br />
Der stärkste Zusammenhang ergibt sich zwischen den Aussagen, Sorge zu<br />
haben, den Anforderungen nicht zu genügen und mit dem Studium zu<br />
scheitern. Derjenige, der befürchtet, den Anforderungen nicht gerecht<br />
werden zu können, empfindet eher die Sorge, mit dem Studium insgesamt<br />
zu scheitern. Daneben korreliert die Sorge, den Anforderungen nicht<br />
gerecht werden zu können, mit unterschiedlicher Effektstärke zu allen<br />
anderen Sorgen, die die Studierenden artikulieren. Daneben hängt die<br />
Befürchtung, den Anforderungen nicht gerecht werden zu können, mit der<br />
Sorge zusammen, in den Fachinhalten die Orientierung zu verlieren. Wer<br />
befürchtet, diese Orientierung verlieren zu können, befürchtet in<br />
262
steigendem Maße auch, den Anforderungen nicht gerecht werden zu<br />
können.<br />
Ein ebenfalls wegen seiner hohen Effektstärke sehr interessanter<br />
Zusammenhang ergibt sich zwischen den Aussagen: „Ich habe Sorge in<br />
der Masse der Studierenden unterzugehen.“ und „Ich habe Sorge vor der<br />
starken Konkurrenz unter den Studierenden“. Beide Aussagen bilden einen<br />
positiven Zusammenhang. Dies heißt, wer die erste Sorge in verstärktem<br />
Maße artikuliert, n<strong>im</strong>mt die zweite in ähnlich hohem Ausmaß an sich wahr.<br />
11 Alternativen zum gegenwärtigen Studium<br />
Abschließend wurden die Studierenden gebeten einzuschätzen, welche<br />
Handlungsalternativen sie wählen würden, wenn sie ihre berufliche<br />
Entwicklung nochmals planen würden. Hierzu ergeben sich folgende<br />
Werte:<br />
Statistiken: Alternativen<br />
Nicht<br />
wieder<br />
studieren<br />
Anderes<br />
1. Fach<br />
studieren<br />
Anderes<br />
2. Fach<br />
studieren<br />
Andere<br />
Uni<br />
wählen<br />
alles<br />
wieder so<br />
machen<br />
Mittelwert 1,4189 1,9031 1,6641 2,4138 1,9547 3,3182<br />
Median 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000<br />
Anderen<br />
<strong>Studien</strong>gang<br />
wählen<br />
Standardabweichung<br />
,84051 1,02228 1,02543 1,39960 1,12050 1,31859<br />
Die Studierenden st<strong>im</strong>men durchschnittlich der Aussage, alles genauso<br />
wieder machen zu würden, in Relation zu den anderen Items am stärksten<br />
zu. 48,8% der Befragten wählen hier die Antwort „sehr stark“ (22,3%) und<br />
stark (26,5%). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Antwortbild:<br />
Alles genauso machen (Chi²=25,280, df=4, p
Die durchschnittlich stärkste alternative Wahl sehen die Studierenden für<br />
ihr zweites studiertes Fach. Hier st<strong>im</strong>men 23,8% der entsprechenden<br />
Aussage in sehr starkem (11,5%) und starkem Maße (12,3%) zu.<br />
Ich würde ein anderes zweites Fach wählen. (Chi²=55,916, df=4, p
Handlungsoption 10,2% der Befragten in sehr starkem Maße (4,5%) und<br />
stark (5,7%) zu.<br />
Wenn, würde ich eine andere Uni wählen (Chi²=156,415, df=4, p
Die mehrheitlich starke Ablehnung dieser Alternative wird anhand des<br />
Antwortverhaltens durch die sehr starke Überbesetzung der<br />
Auswahlantwort „gar nicht“ deutlich.<br />
12 Belastungsempfinden<br />
12.1 Auswertung der einzelnen Items<br />
Im Folgenden werden die einzelnen Items <strong>zur</strong> Belastung der Studierenden<br />
zunächst deskriptiv ausgewertet.<br />
In einem ersten Item wurden die Studierenden danach befragt, in welchem<br />
Maße sie sich derzeit insgesamt belastet fühlen. 46,7% der Befragten<br />
wählen hier die Antworten „sehr stark“ (11,7%) und „stark“ (35%). Der<br />
Mittelwert der 5-stufigen Antwortskala beträgt M=3,44, die<br />
Standardabweichung SD=,901 und der Medianwert 3. Im Einzelnen<br />
ergeben sich folgende Antworten:<br />
In welchem Maße fühlen Sie sich derzeit insgesamt belastet? (Chi²=155,466, df=4,<br />
p
In welchem Maße fühlen Sie sich derzeit durch Ihr Studium belastet? (Chi²=184,489,<br />
df=4, p
M=2,70 mit einer Standardabweichung von SD=1,22 und einem<br />
Medianwert von 3. Durchschnittlich nehmen die Studierenden damit <strong>im</strong><br />
privaten Bereich bei relativ hohen individuellen Streuungen nur teilweise<br />
<strong>Belastungen</strong> wahr.<br />
In den nachfolgenden 4 Items wurden die Studierenden gebeten, einzelnen<br />
Aussagen in dem Grad zuzust<strong>im</strong>men, den sie für ihre gegenwärtige<br />
Situation für zutreffend halten. Zunächst wurde den Befragten die Aussage:<br />
„Ich bin an der obersten Belastungsgrenze <strong>im</strong> Studium angelangt.“,<br />
vorgelegt. Diesem Item st<strong>im</strong>men 14,3 % in sehr starkem (1,1%) und<br />
starkem Maße (13,2%) zu.<br />
Ich bin an der Belastungsgrenze angelangt. (Chi²=98,737, df=4, p
Es zeigt sich eine Unterbesetzung der Kategorien „gering“, „sehr gering“<br />
und „sehr stark“. Die stark zust<strong>im</strong>mende Antwortkategorie ist ebenso wie<br />
die neutrale Mittelkategorie überfrequentiert. Der Mittelwert auf das Item<br />
beträgt M=3,28, die Standardabweichung SD=,98 und der Median 3.<br />
In der nachfolgenden Aussage werden die Auswirkungen studienbedingter<br />
<strong>Belastungen</strong> auf den privaten Bereich erfragt. Der Aussage: „Ich<br />
vernachlässige wegen des Studiums oftmals Privates.“, st<strong>im</strong>men 26,3 %<br />
der befragten Studierenden in sehr starkem Maße (7,5%) und stark<br />
(18,8%) zu. Detailliert ergibt sich die folgende Verteilung der Antworten auf<br />
das Item:<br />
Ich vernachlässige wegen des Studiums oftmals Privates. (Chi²=58,774, df=4, p
Sehr deutlich wird innerhalb der Antwortverteilung, dass beide Extrempole<br />
sowie die gering zust<strong>im</strong>mende Auswahlantwort deutlich unterbesetzt sind,<br />
während dessen eine relativ starke Tendenz <strong>zur</strong> neutralen Mitte und <strong>zur</strong><br />
stark zust<strong>im</strong>menden Kategorie zu verzeichnen ist. Der Mittelwert des Items<br />
beträgt M=2,66 mit einer Standardabweichung von SD=1,13 und einem<br />
Medianwert von 3.<br />
Im folgenden Item sollten die Befragten den Umfang ihrer Freizeit<br />
beurteilen. Dabei beurteilten 1,9 % der Befragten diesen Umfang als sehr<br />
hoch und weitere 10,9% als hoch. Dem gegenüber sagen 53,9% der<br />
Studierenden, der Umfang ihrer Freizeit sei gering bis sehr gering. Im<br />
Einzelnen ergeben sich folgende Antworten:<br />
Wie beurteilen Sie den Umfang ihrer Freizeit? (Chi²=91,962, df=4, p
Auffällig ist zunächst, dass nur 2 der Befragten die durchschnittliche<br />
Stressbelastung als sehr gering beurteilt. Außerdem ist die<br />
Antwortkategorie „gering“ deutlich unterbesetzt. Daneben ist eine Tendenz<br />
<strong>zur</strong> Auswahl der neutralen Mittelkategorie feststellbar. Der positive<br />
Extremantwortpol ist darüber hinaus deutlich unterfrequentiert. Der<br />
Mittelwert des Items beträgt M=3,45 mit einer Standardabweichung von<br />
SD=,767 und einem Medianwert von 3.<br />
Neben diesen Angaben st<strong>im</strong>men 2,6 % der Befragten der Aussage: „Im<br />
Vergleich zu meiner Schulzeit bin ich wesentlich krankheitsanfälliger.“, in<br />
sehr starkem Maße und weitere 7,9% in starkem Maße zu.<br />
Ich bin wesentlich krankheitsanfälliger als <strong>zur</strong> Schulzeit. (Chi²=180,075, df=4, p
Die Antworten, die das Item eher verneinen oder auch nur gering<br />
zust<strong>im</strong>men, sind deutlich unterfrequentiert. Es erfolgt eine Konzentration<br />
der Auswahlantworten auf die Kategorien „st<strong>im</strong>me stark zu“. Der Mittelwert<br />
des Items beträgt M=3,80 mit einer Standardabweichung von SD=,967 und<br />
einem Medianwert von 4.<br />
12.2 Skala <strong>zur</strong> Belastung<br />
Aus dem einzelnen Items <strong>zur</strong> Belastung wurde wiederum die Skala<br />
„Belastungsempfinden“ gebildet, die als abhängige Variable in das<br />
Regressionsmodell eingehen soll. Hierzu wurden die Items „In welchem<br />
Maße fühlen Sie sich derzeit durch Privates belastet?“ und „Im Vergleich<br />
<strong>zur</strong> Schulzeit bin ich jetzt wesentlich krankheitsanfälliger.“ wegen zu<br />
geringer Item-Skalen-Korrelation aus der Skala entfernt. Die übrigen 9<br />
Items wurden in die Skala „Belastungsempfinden“ aufgenommen. Für die<br />
Skala liegen folgende Reliabilitätswerte vor:<br />
Reliabilitätsstatistik: Belastungsempfinden<br />
Cronbachs Alpha<br />
Anzahl der Items<br />
,870 9<br />
272
Item-Skala-Statistiken: Belastungsempfinden<br />
In welchem Maße<br />
fühlen Sie sich<br />
derzeit insgesamt<br />
belastet?<br />
In welchem Maße<br />
fühlen Sie sich<br />
derzeit durch Ihr<br />
Studium belastet?<br />
Zust<strong>im</strong>mung: Ich bin<br />
an der obersten<br />
Belastungsgrenze<br />
<strong>im</strong> Studium<br />
angelangt.<br />
Ich arbeite so viel<br />
wie nur möglich für<br />
meinen<br />
<strong>Studien</strong>erfolg.<br />
Ich vernachlässige<br />
wegen des<br />
Studiums oftmals<br />
Privates.<br />
Ich könnte <strong>im</strong><br />
Studium auch mehr<br />
leisten.<br />
Wie beurteilen Sie<br />
den Umfang ihrer<br />
Freizeit?<br />
Wie beurteilen Sie<br />
Ihre<br />
durchschnittliche<br />
Stressbelastung?<br />
Im Vergleich <strong>zur</strong><br />
Schule ist der<br />
Arbeitsaufwand <strong>im</strong><br />
Studium wesentlich<br />
höher.<br />
Skalenmittelwert,<br />
wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
Skalenvarianz,<br />
wenn Item<br />
weggelassen<br />
Korrigierte<br />
Item-Skala-<br />
Korrelation<br />
25,5321 31,083 ,638 ,854<br />
25,5208 31,023 ,692 ,850<br />
25,3321 30,617 ,584 ,859<br />
25,5245 32,470 ,601 ,858<br />
26,5208 30,114 ,657 ,852<br />
25,6906 31,040 ,576 ,859<br />
26,1623 29,129 ,641 ,854<br />
26,3094 30,222 ,548 ,863<br />
25,1660 31,192 ,572 ,860<br />
Cronbachs<br />
Alpha, wenn<br />
Item<br />
weggelassen<br />
273
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest für die Skala: Belastungsempfinden<br />
Summe<br />
Belastung<br />
N 265<br />
Mittelwert 3,33<br />
Parameter der<br />
Standardabweichung<br />
Normalverteilung(a,b)<br />
0,68<br />
Extremste Differenzen Absolut ,075<br />
Positiv ,075<br />
Negativ -,048<br />
Kolmogorov-Smirnov-Z 1,228<br />
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)<br />
,098<br />
a Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung.<br />
b Aus den Daten berechnet.<br />
Mittels des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests wurde überprüft, ob die<br />
Skala die Kriterien einer Normalverteilung als Voraussetzung für die<br />
Regressionsanalyse erfüllt. Nach den Ergebnissen des Tests weist die<br />
Skala eine Normalverteilung auf.<br />
Abschließend wurde überprüft, in wie viele Faktoren die Skala untergliedert<br />
ist. Zu diesem Zweck wurden die 9 Items einer rotierten<br />
Hauptkomponentenanalyse mit Var<strong>im</strong>ax-Rotation unterzogen, die die<br />
folgenden Ergebnisse erbringt:<br />
Erklärte Gesamtvarianz: Belastungsempfinden<br />
Komponente<br />
Anfängliche Eigenwerte<br />
Gesamt % der Varianz Kumulierte %<br />
1 4,511 50,127 50,127<br />
2 ,998 11,092 61,219<br />
3 ,732 8,132 69,352<br />
4 ,667 7,416 76,768<br />
5 ,543 6,034 82,802<br />
6 ,478 5,310 88,112<br />
7 ,431 4,789 92,901<br />
8 ,394 4,381 97,282<br />
9 ,245 2,718 100,000<br />
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.<br />
Aufgrund der Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse wird für die Skala<br />
„Belastungsempfinden“ unter Zugrundelegung des Kaiser-Kriteriums von<br />
einer einfaktoriellen Lösung ausgegangen.<br />
274
12.3 Belastungsmodell<br />
Um das individuelle Belastungsempfinden durch als unabhängig<br />
angenommene Einflussvariablen erklären zu können, wurde ein<br />
Regressionsmodell errechnet. Dazu wurde eine lineare<br />
Regressionsanalyse durchgeführt, wobei die Skala „Belastungsempfinden“<br />
(SummeBelastung) als abhängige Variable eingesetzt wurde. Der Einbezug<br />
unabhängiger Variablen erfolgte analog dem Vorgehen bei der Auswertung<br />
der 1. Studie. Die Analyse erbrachte folgendes Modell:<br />
Modellzusammenfassung<br />
Standardfe<br />
Modell R R-Quadrat<br />
Korrigiertes R-<br />
Quadrat<br />
hler des<br />
Schätzers<br />
1 ,743(a) ,552 ,541 4,15439<br />
a Einflussvariablen : (Konstante), Entbehrungsbereitschaft und Frustrationstoleranz,<br />
Flexibilität, Erholungsfähigkeit, Stressresistenz, Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen<br />
in SWS, Ich habe einen engen Kontakt zu meinen Eltern, Gute Unterstützung durch und<br />
Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden, Zeitaufwand pro Woche für Studium inkl.<br />
studienbezogenen Tätigkeiten<br />
ANOVA(b)<br />
Modell<br />
Quadratsumme<br />
df<br />
Mittel der<br />
Quadrate F Signifikanz<br />
1 Regression 5202,352 6 867,059 50,238 ,000(a)<br />
Residuen 4228,454 245 17,259<br />
Gesamt 9430,806 251<br />
a Einflussvariablen : (Konstante), Entbehrungsbereitschaft und Frustrationstoleranz,<br />
Flexibilität, Erholungsfähigkeit, Stressresistenz, Anzahl der besuchten Lehrveranstaltungen<br />
in SWS, Ich habe einen engen Kontakt zu meinen Eltern, Gute Unterstützung durch und<br />
Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden, Zeitaufwand pro Woche für Studium inkl.<br />
studienbezogenen Tätigkeiten<br />
b Abhängige Variable: SummeBelastung<br />
275
Koeffizienten(a)<br />
Nicht standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Standardisierte<br />
Koeffizienten<br />
Standardfehler<br />
Modell<br />
B<br />
Beta<br />
T Signifikanz<br />
1 (Konstante) 24,121 1,376 17,532 ,000<br />
Gute Unterstützung durch<br />
und Kontaktmöglichkeiten<br />
zu den Lehrenden<br />
-,771 ,279 -,127 -2,769 ,006<br />
Ich habe einen engen<br />
Kontakt zu meinen Eltern -1,058 ,270 -,177 -3,919 ,000<br />
Anzahl der besuchten<br />
Lehrveranstaltungen in<br />
SWS<br />
Zeitaufwand pro Woche für<br />
Studium inkl.<br />
studienbezogenen<br />
Tätigkeiten ohne<br />
Anwesenheit<br />
Flexibilität<br />
,200 ,054 ,182 3,725 ,000<br />
,363 ,102 ,189 3,539 ,000<br />
Erholungsfähigkeit<br />
Stressresistenz<br />
-2,419 ,285 -,394 -8,497 ,000<br />
Entbehrungsbereitschaft<br />
und Frustrationstoleranz 1,460 ,289 ,236 5,053 ,000<br />
a Abhängige Variable: SummeBelastung<br />
Das Modell ist mit einer Varianzaufklärung von insgesamt 54,1%<br />
(Korrigierter R-Quadrat-Wert) als sehr gut zu bezeichnen. Das Modell<br />
insgesamt ist hoch signifikant. Daneben werden alle aufgenommenen<br />
Variablen auf dem Niveau von p=0,01 hoch signifikant.<br />
276
Literatur- und Quellenverzeichnis<br />
Abs, H. J.: Überlegungen <strong>zur</strong> Modellierung diagnostischer Kompetenzen<br />
bei Lehrerinnen und Lehrern. In: Lüders, M. & Wissinger, J. (H):<br />
Kompetenzentwicklung und Programmevaluation – Forschung zu<br />
Lehrerbildung, Münster, New York, München, Berlin 2007, S. 63-84.<br />
Allemann-Ghionda C. & Terhart, E. (H): Kompetenzen und<br />
Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und<br />
Weiterbildung. 51. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik.<br />
Apel, H.: Bildungshandeln <strong>im</strong> soziokulturellen Kontext. <strong>Studien</strong>fachwahl<br />
und <strong>Studien</strong>gestaltung unter dem Einfluss familiärer Ressourcen.<br />
Wiesbaden 1993.<br />
Bachmann et al.: Macht studieren krank – Die Bedeutung von Belastung<br />
und Ressourcen für die Gesundheit der Studierenden, Bern 1999.<br />
Badura, B. & Pfaff, H.: Streß – ein Moderinisierungsrisiko? Mikro- und<br />
Makroaspekte soziologischer Belastungsforschung <strong>im</strong> Übergang <strong>zur</strong><br />
postindustriellen Zivilisation. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und<br />
Sozialpsychologie Nr. 41(4) 1989, S. 644-668.<br />
Badura, B. & Pfaff, H.: Für einen subjektorientierten Ansatz in der<br />
soziologischen Streßforschung. Erwiderung auf Heinz-Günter Vester. In:<br />
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Nr. 44 (2) 1992, S.<br />
354-363.<br />
Bandura, A.: Self-efficacy mechanismen in human agency. American<br />
Psychologist Nr. 47/1982, S. 122-147.<br />
Bargel, T. et al.: <strong>Studien</strong>erfahrungen und studentische Orientierungen in<br />
den 80er Jahren: Trends und Stabilitäten. 3. <strong>Erhebung</strong> an Universitäten<br />
und Fachhochschulen 1983, 1985, 1987. Bad Nonnef 1987.<br />
Bargel, T. et al.: <strong>Studien</strong>situation und studentische Orientierungen. 7.<br />
Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen. Bonn 2001.<br />
277
Bauer, J.: Das Gedächtnis des Körpers. München 2007.<br />
Bäumer, T. et al.: Der Einfluss von Zufallsbedingungen auf die<br />
<strong>Studien</strong>fachwahl. Schweizer Zeitschrift für Psychologie Nr. 13/1994, S.<br />
166-177.<br />
Becker, P.: Der Trierer Persönlichkeitsfragebogen TPF. Handanweisungen.<br />
Göttingen 1982.<br />
Bellenberg, G. & Thierack, A.: Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in<br />
Deutschland. Bestandsaufnahme und Reformbestrebungen. Opladen 2003.<br />
Bengel, J.: Gesundheit, Risikowahrnehmung und Vorsorgeverhalten.<br />
Göttingen 1993.<br />
Berning, E. et al.: Teilzeitstudenten und Teilzeitstudium an den<br />
Hochschulen in Deutschland. München 1996.<br />
Beutel, M.: Was schützt Gesundheit? – Zum Forschungsstand und der<br />
Bedeutung personaler Ressourcen in der Bewältigung von<br />
Alltagsbelastungen und Lebensereignissen. Psychotherapie und<br />
medizinische Psychologie Nr. 39/1989, S. 452-462.<br />
BISS: Befragung internationaler Studierender <strong>zur</strong> <strong>Studien</strong>situation, Uni<br />
Leipzig 2002.<br />
Blömeke, S./Reinhold, P./Tulodziecki, Wildt, J. (H): Handbuch<br />
Lehrerbildung, Bad Heilbrunn 2004.<br />
Blömeke, S.: Qualitativ-quantitativ, induktiv-deduktiv, Prozess-Produkt,<br />
national-international. Zur Notwendigkeit multikriterialer und<br />
multiperspektivischer Zugänge in der Lehrerbildungsforschung. In: Lüders,<br />
M. & Wissinger, J. (H): Kompetenzentwicklung und Programmevaluation –<br />
Forschung zu Lehrerbildung, Münster, New York, München, Berlin 2007, S.<br />
13-36.<br />
278
Böhm-Kasper, O. et al.: Sind 12 Jahre stressiger? Belastung und<br />
Beanspruchung von Lehrern und Schülern am Gymnasium. Weinhe<strong>im</strong><br />
2001.<br />
Bromme, R.: Der Lehrer als Experte. Bern 1982.<br />
Brühwiler, C.: Die Bedeutung von Motivation in der Lehrerinnen- und<br />
Lehrerausbildung. In: Oser, F. & Oelkers, J. (H): Die Wirksamkeit der<br />
Lehrerbildungssysteme, Von der Allrounderbildung <strong>zur</strong> Ausbildung<br />
professioneller Standards. Chur u.a. 2001, S. 343-398.<br />
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung<br />
Heft 115: Strategien für lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, S. 4ff. Abrufbar unter: www.bmbf.de<br />
Bungard, W. & Wiendieck, G.: Eine Standortbest<strong>im</strong>mung der Arbeits- und<br />
Organisationspsychologie. In: Silbereisen, R. K. & Frey, D. (H):<br />
Perspektiven der Psychologie – Einführung und Standortbest<strong>im</strong>mung,<br />
Weinhe<strong>im</strong> und Basel 2001, S. 174-193.<br />
Christ, O.: Die Überprüfung der transaktionalen Stresstheorie <strong>im</strong><br />
Lehramtsreferendariat. Online-diss. Marburg 2004.<br />
Clemens, W. & Strübing, J. (H): Empirische Sozialforschung und<br />
gesellschaftliche Praxis. Bedingungen und Formen angewandter<br />
Forschung in den Sozialwissenschaften, Opladen 2000.<br />
Clemens, S.: Angewandte Sozialforschung und Politikberatung –<br />
Praxisbezüge empirischer Forschung am Beispiel der Alternsforschung. In:<br />
Clemens, W. & Strübing, J. (H): Empirische Sozialforschung und<br />
gesellschaftliche Praxis. Bedingungen und Formen angewandter<br />
Forschung in den Sozialwissenschaften, Opladen 2000, S: 211-232.<br />
Clemens, W. & Strübing, J.: Einleitung: Empirische Sozialforschung –<br />
methodische Aspekte und gesellschaftliche Verwendung. In: Clemens, W.<br />
& Strübing, J. (H): Empirische Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis.<br />
279
Bedingungen und Formen angewandter Forschung in den<br />
Sozialwissenschaften, Opladen 2000, S. 2-22.<br />
Coleman, J. S.: Macht und Gesellschaftsstruktur. Tübingen 1979.<br />
Combe, A.: Pädagogische Professionalität, Hermeneutik und<br />
Lehrerbildung. Am Beispiel der Berufsbelastung von Grundschullehrkräften.<br />
In: Combe, A. & Helster, W. (H): Pädagogische Professionalität –<br />
Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns, Frankfurt/M. 1997,<br />
S. 501-520.<br />
Combe, A. & Buchen, S.: Belastung von Lehrerinnen und Lehrern. Zur<br />
Bedeutung alltäglicher Handlungsabläufen in unterschiedlichen<br />
Schulformen, Weinhe<strong>im</strong> und Basel 1996.<br />
Cronbach, L. J.: Coefficient alpha and the internal structure of tests.<br />
Psychometrica Nr. 16/1951, S. 297-334.<br />
Czerwenka, K. & Nölle, K.: Probleme des Erwerbs professioneller<br />
Kompetenz <strong>im</strong> Kontext universitärer Lehrerbildung. In: Jaumann-<br />
Graumann, O. & Köhnlein, W. (H): Lehrerprofessionalität –<br />
Lehrerprofessionalisierung. Bad Heilbrunn 2000 S. 67-77.<br />
Daxner, M.: Studierfähigkeit: Zum Verhältnis von Wissenschaft und Gewalt.<br />
In: Kellermann, P. (H): Universität und Hochschulpolitik. Wien, Köln, Graz<br />
1986, S. 259-275.<br />
Der Spiegel Nr. 18/2008: Die Turbo-Uni – Reformchaos: Hochschulen<br />
werden zu Lernfabriken, Hamburg 2008.<br />
Dick, R. v. & Wagner, U.: Stress und strain in teaching: A structural<br />
equation approach. In: British Journal of educational Psychology, Nr.<br />
71/1999, S. 243-259.<br />
Dick, R. v., Wagner, U. & Petzel, T.: Arbeitsbelastung und gesundheitliche<br />
Beschwerden von Lehrerinnen und Lehrern: Einflüsse von<br />
280
Kontrollüberzeugungen, Mobbing und sozialer Unterstützung. In:<br />
Psychologie in Erziehung und Unterricht, Nr. 46/1999, S. 269-280.<br />
Dietz, S.: Emotionen in Veranstaltungs- und Lernsituationen des<br />
Hochschulstudiums – Skalenentwicklung und Fragebogenuntersuchung an<br />
der Universität zu Köln. In: Europäische Hochschulschriften Reihe VI<br />
Psychologie, Wien 2000.<br />
Dollase, R, Hammerich, K & Tokarski, K (H): Temporale Muster, Opladen<br />
1999.<br />
Eckinger, L., Ahnen, D. und Klippert, H.: Lehrerbildung und neue<br />
Lernkultur. In: Forum Bildung (H): Erfolgreich Lehren und Lernen: Ansätze<br />
und Wege in der Bildungsreform, Frankfurt am Main 2005<br />
Engler, S.: Fachkultur, Geschlecht und soziale Reproduktion: Eine<br />
Untersuchung über Studentinnen und Studenten der<br />
Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaft, Elektrotechnik und des<br />
Maschinenbaus, Weinhe<strong>im</strong> und Basel 1993.<br />
Erikson, E. H.: Kindheit und Gesellschaft Stuttgart 1950.<br />
Erikson, E. H.: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt/M. 1959.<br />
Erikson, E. H.: Jugend und Krise. Die Psychodynamik <strong>im</strong> sozialen Wandel.<br />
Stuttgart 1968.<br />
Erikson, E. H.: Der vollständige Lebenszyklus. Frankfurt/M. 1988.<br />
Faltmaier, T.: Notwendigkeit einer sozialwissenschaftlichen<br />
Belastungskonzeption. In: Brüderl, L. (H): Theorien und Methoden der<br />
Bewältigungsforschung, München 1988.<br />
Fend, H. (2000). Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Opladen:<br />
Leske + Budrich.<br />
281
Filipp, S.-H. & Aymanns, P.: Die Bedeutung sozialer und personaler<br />
Ressourcen in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen.<br />
In: Zeitschrift für klinische Psychologie Nr. 16/1987, S. 383-396.<br />
Flammer, A. & Alsaker, F. (2001). Entwicklungspsychologie der<br />
Adoleszenz. Die Erschließung innerer und äußerer Welten <strong>im</strong> Jugendalter.<br />
Bern: Hans Huber.<br />
Folkman, S.: Personal control and stress and coping processes: a<br />
theoretical analysis. In: Journal of Personality and Social Psychology Nr.<br />
46/1984, S. 839-852.<br />
Frese, E. (H): Handwörterbuch der Organisation, Stuttgart 1992.<br />
Frey; A.: Die Kompetenzstruktur von Studierenden des Lehrerberufs. Eine<br />
internationale Studie. In: Zeitschrift für Pädagogik Nr. 50/2004, S. 903-925.<br />
Frey, A.: Methoden und Instrumente <strong>zur</strong> Diagnose beruflicher<br />
Kompetenzen von Lehrkräften – eine Standortbest<strong>im</strong>mung zu bereits<br />
publizierten Instrumenten. In: Allemann-Ghionda C. & Terhart, E. (H):<br />
Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern:<br />
Ausbildung und Weiterbildung. 51. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik, S.<br />
30-46.<br />
Friebertshäuser, B.: Übergangsphase <strong>Studien</strong>beginn. Eine Feldstudie über<br />
Riten der Initiation in einer studentischen Fachkultur. Weinhe<strong>im</strong> 1992.<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena – Zentrum für Lehrerbildung und<br />
Didaktikforschung: Das Jenaer Modell der Lehrerbildung, Faltblatt, Mai<br />
2007.<br />
Fürstenberg, F.: Zur Problematik von Hochschul-Rankings. In: Clemens, W.<br />
& Strübing, J. (H): Empirische Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis.<br />
Bedingungen und Formen angewandter Forschung in den<br />
Sozialwissenschaften, Opladen 2000, S: 103-112.<br />
Gehrmann, A.: Der professionelle Lehrer. Muster der Begründung –<br />
Empirische Rekonstruktion. Opladen 2003.<br />
282
Gehrmann, A.: Kompetenzentwicklung <strong>im</strong> Lehramtsstudium. Eine<br />
Untersuchung an der Universität Rostock. In: Lüders, M. & Wissinger, J.<br />
(H): Kompetenzentwicklung und Programmevaluation – Forschung zu<br />
Lehrerbildung, Münster, New York, München, Berlin 2007, S. 85-102.<br />
Gehrmann, A.: Zufriedenheit und Überlastung – Integration und Selektivität.<br />
Zum beruflichen Selbstverständnis Berliner Lehrerinnen und Lehrer. In:<br />
Merkens, H. & Wessel, A. (H): Schulentwicklung in den neuen<br />
Bundesländern. Berlin 1999, S. 157-186.<br />
Göhmann, C. et al.: Das Studium und die Lehre am Pädagogischen<br />
Seminar aus der Sicht der Studierenden – Ergebnisse einer Befragung an<br />
der Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 2000.<br />
Gold, A.: <strong>Studien</strong>abbruch, Abbruchneigung und <strong>Studien</strong>erfolg.<br />
Vergleichende Bedingungsanalyse des <strong>Studien</strong>verlaufs. Frankfurt/M. 1988.<br />
Graf, S. & Krischke, N.: Psychische <strong>Belastungen</strong> und Arbeitsstörungen <strong>im</strong><br />
Studium, Stuttgart 2004.<br />
Greif, S. et al. (H): Psychischer Stress am Arbeitsplatz, Göttingen 1991.<br />
Grützmacher, J. et al.: Gestufte <strong>Studien</strong>strukturen in der Lehrerbildung.<br />
Auswirkungen in der Bachelorphase, München 2007.<br />
Gudjons, Herbert: Neue Unterrichtskultur – veränderte Lehrerrolle. In:<br />
Forum Bildung (H): Erfolgreich Lehren und Lernen: Ansätze und Wege in<br />
der Bildungsreform, Frankfurt am Main 2005.<br />
Hagemann, W., Rose, F.-J.: Zur Lehrer/innen-Erfahrung von<br />
Lehramtsstudierenden. In: Zeitschrift für Pädagogik Heft 44/1998, S. 7-19.<br />
Harvey, D.: The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of<br />
Cultural Change. Oxford/Cambridge 1989.<br />
283
Heil, S. & Faust-Siehl, G.: Universitäre Lehrerausbildung und pädagogische<br />
Professionalität <strong>im</strong> Spiegel von Lehrenden. Weinhe<strong>im</strong> 2000.<br />
Heiland, H.-G. & Schulte, W.: Zeit und Studium – Untersuchung zum<br />
Zeitbewusstsein und <strong>zur</strong> Zeitverwendung von Studierenden. Herbolzhe<strong>im</strong><br />
2002.<br />
Helsper, W. & Kolbe, F.U.: Bachelor und Master in der Lehrerbildung –<br />
Potenzial für Innovation oder ihre Verhinderung. In: Zeitschrift für<br />
Erziehungswissenschaft Nr. 5/2002, S. 253-258.<br />
Herrmann, U.: Wie lernen Lehrer ihren Beruf? – empirische Befunde und<br />
praktische Vorschläge. Weinhe<strong>im</strong> und Basel 2002.<br />
Herzog, Roman „Aufbruch in der Bildungspolitik” in Rutz, Michael (Hrsg.)<br />
„Aufbruch in der Bildungspolitik” Roman Herzogs Rede und 25 Antworten,<br />
München 1997.<br />
Hilligus, A.H. & Rinkens, D. (H): Standards und Kompetenzen – neue<br />
Qualität in der Lehrerbildung? Münster 2006.<br />
HIS: Befragungen von <strong>Studien</strong>anfängern <strong>im</strong> Wintersemester 2005/2006.<br />
HISBUS: Befragungen von Studierenden <strong>zur</strong> <strong>Studien</strong>belastung an der<br />
Universität Rostock, Rostock 2006.<br />
Hofer, B.K. & Pintrich, P.R.: Personal Eipstemology. The Psychology of<br />
Beliefs about knowlegde und Knowing, Mahwah 2002.<br />
Hornung, R. & Gutscher, H.: Gesundheitspsychologie – Die<br />
sozialpsychologische Perspektive. In: Schwenkmezger, P. & Schmidt, L. R.<br />
(H): Lehrbuch der Gesundheitspsychologie. Stuttgart 1994, S. 65-87.<br />
Huber, L.: Sozialisation in der Hochschule. In: Hurrelmann, K. & Ulich, D.<br />
(H): Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinhe<strong>im</strong> 1991, S. 417-<br />
441.<br />
284
Hübner, P. & Werle, M.: Arbeitszeit und Arbeitsbelastung Berliner<br />
Lehrerinnen und Lehrer. In: Buchen, S., Carle, U. et al. (H): Jahrbuch für<br />
Lehrerforschung Band 1 /1997, Weinhe<strong>im</strong> 1997, S. 203-226.<br />
Hurrelmann, K.: Gesundheitssoziologie. Weinhe<strong>im</strong> und Basel 2006.<br />
Hurrelmann, K.: Einführung in die Sozialisationstheorie. Weinhe<strong>im</strong> und<br />
Basel 2002.<br />
Jantowski, A.: Das Seminarfach in Thüringen – Leistungsermittlung und –<br />
bewertung. In: Neue Praxis Schulleitung Heft 85/2007<br />
Jantowski, Andreas: Das Seminarfach in Thüringen, Diss., Jena 2007.<br />
Jaumann-Graumann, O. & Köhnlein, W. (H): Lehrerprofessionalität –<br />
Lehrerprofessionalisierung. Bad Heilbrunn 2000.<br />
Kahl, R.: Voll die Leere. 12 Wanderungen durch die deutsche Universität.<br />
In: Laske, St. et al. (H): Universität <strong>im</strong> 21. Jahrhundert. Zur Interdependenz<br />
von Begriff und Organisation der Wissenschaft. München 2000, S. 274-<br />
298.<br />
Keller, G. (2000). Schulische Entwicklungspsychologie. Entwicklung,<br />
Entwicklungsprobleme, Entwicklungsförderung. Donauwörth: Auer.<br />
Kellermann, P. (H): Universität und Hochschulpolitik. Wien, Köln, Graz<br />
1986.<br />
Kerber, H. & Schmieder, A. (H): Handbuch Soziologie. Zur Theorie und<br />
Praxis sozialer Beziehungen. Reinbeck 1984.<br />
Kiener, U. & Christen, S.: <strong>Studien</strong>ziele, <strong>Studien</strong>motivation und<br />
<strong>Studien</strong>verhalten. Analyse des Studierverlaufs der Zürcher Maturanten<br />
1985. Zürich 1992.<br />
285
Kiener, U.: Sozialerhebung bei Studierenden. Eine Studie zum<br />
Forschungsstand in der Schweiz <strong>im</strong> Vergleich zum europäischen Ausland.<br />
Bern 1995.<br />
Kiener, U.: Studieren <strong>im</strong> Kontext. Zum Verhältnis von Studium und anderen<br />
Lebensbereichen. Winterthur 1997.<br />
Kieschke, U.: Arbeit, Persönlichkeit und Gesundheit. Beiträge zu einer<br />
differenziellen Psychologie beruflichen Belastungsgeschehens. Berlin<br />
2003.<br />
Kläsener, C. & Korte, M.: Gute Noten, Berlin 2004.<br />
Kleber, E.: Aktuelle Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden, Frankfurt/M.<br />
2000.<br />
KMK (Hrsg.) „Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern heute- Fachleute für<br />
das Lernen” Gemeinsame Erklärung des Präsidenten der<br />
Kultusministerkonferenz und der Vorsitzenden der Bildungs- und<br />
Lehrergewerkschaften sowie ihrer Spitzenor-ganisationen DGB und DBB,<br />
Bremen 2001.<br />
Kramis-Aebischer, K.: Stress, <strong>Belastungen</strong> und Belastungsverarbeitung <strong>im</strong><br />
Lehrerberuf, Bern 1996.<br />
Krampen, G. & Reichle, B.: Frühes Erwachsenenalter. In: Oerter, R. &<br />
Montada, L. (H): Entwicklungspsychologie – Ein Lehrbuch, Weinhe<strong>im</strong> u.a.<br />
2002, S. 319-330.<br />
Krause, A.: Psychische <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Unterricht – ein<br />
aufgabenbezogener Ansatz. diss. Flensburg 2002.<br />
Krause, A.: Lehrerbelastungsforschung – Erweiterung durch ein<br />
Handlungspsychologisches Belastungskonzept. In: Zeitschrift für<br />
Pädagogik Nr 49/2003, S. 254-273<br />
286
Krohne, H. W.: Stress und Stressbewältigung. In: R. Schwarzer (H):<br />
Gesundheitspsychologie. Göttingen 1990, S. 263-277.<br />
Kromrey, H.: Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium statt<br />
sogenannter Lehrevaluation. In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie<br />
Nr. 10/1996, S. 153-166.<br />
Kromrey, H.: Evaluation. Empirische Konzepte <strong>zur</strong> Bewertung von<br />
Handlungsprogrammen und die Schwierigkeit ihrer Realisierung. In:<br />
Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie Nr.<br />
15(4)/1995, S. 313-336.<br />
Kromrey, H.: Von den Problemen anwendungsorientierter Sozialforschung<br />
und den Gefahren methodischer Halbbildung. In: Sozialwissenschaften und<br />
Berufsbildung Nr. 22 (1) 1999, S. 58-77.<br />
Krüger, H. J. et al.: Studium und Krise – Eine empirische Untersuchung<br />
über studentische <strong>Belastungen</strong> und Probleme, Weinhe<strong>im</strong> 1986.<br />
König, S. & Dalbert, C.: Ungewissheitstoleranz, Belastung und Befinden bei<br />
Berufsschullehrern. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und<br />
pädagogische Psychologie Nr. 36/2004, S. 190-199.<br />
Laitreiter, A.: Begriffe und Methoden der Netzwerk- und<br />
Unterstützungsforschung. In: Laitreiter, A. (H): Soziales Netzwerk und<br />
soziale Unterstützung, Bern 1983, S. 15-44.<br />
Lamnek, S.: Sozialforschung in Theorie und Praxis. Zum Verhältnis von<br />
qualitativer und quantitativer Forschung. In: Clemens, W. & Strübing, J. (H):<br />
Empirische Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis. Bedingungen und<br />
Formen angewandter Forschung in den Sozialwissenschaften, Opladen<br />
2000, S. 23-46.<br />
Lamprecht, M. & Stamm, H.: Soziale Ungleichheit <strong>im</strong> Bildungswesen. Bern<br />
1992.<br />
287
Laske, St. et al. (H): Universität <strong>im</strong> 21. Jahrhundert. Zur Interdependenz<br />
von Begriff und Organisation der Wissenschaft. München 2000.<br />
Lazarus, R. S.: Stress and emotion. A new synthesis. New York 1999.<br />
Lazarus, R. S. & Folkman, S.: Stress, appraisal und coping. New York<br />
1984.<br />
Lazarus, R. S. & Launier, R.: Stressbezogene Transaktion zwischen<br />
Person und Umwelt. In: Nitsch, I. A. (H): Stress, Theorien,<br />
Untersuchungen, Maßnahmen, S. 213-260, Bern 1981.<br />
Leuchter, M. et al.: Unterrichtsbezogene Überzeugungen und<br />
handlungsleitende Kognitionen von Lehrpersonen. In: Zeitschrift für<br />
Erziehungswissenschaft Nr. 4/2006, S. 562-579.<br />
Lewin, K.: Field theory in social science. New York 1951.<br />
Lipowsky; F.: Wege von der Hochschule in den Beruf. Eine empirische<br />
Studie zum beruflichen Erfolg von Lehramtsabsolventen in der<br />
Berufseinstiegsphase. Bad Heilbrunn 2003.<br />
Lüders, M. & Wissinger, J.: Forschung <strong>zur</strong> Lehrerbildung, Münster, New<br />
York, München, Berlin 2007.<br />
Lüders, M. & Eisenacher, S.: Zeitlicher Studieraufwand <strong>im</strong> Urteil von<br />
Studierenden. In: Lüders, M. & Wissinger, J. (H): Kompetenzentwicklung<br />
und Programmevaluation – Forschung zu Lehrerbildung, Münster, New<br />
York, München, Berlin 2007, S. 133-150.<br />
Lüders, M./Eisenacher, S. & Pleßmann, S.: Der Umgang mit <strong>Studien</strong>zeit.<br />
Eine empirische Untersuchung bei Studierenden in Lehrämtern und <strong>im</strong><br />
Diplom-<strong>Studien</strong>gang Erziehungswissenschaft. In: Allemann-Ghionda C. &<br />
Terhart, E. (H): Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen<br />
und Lehrern: Ausbildung und Weiterbildung. 51. Beiheft der Zeitschrift für<br />
Pädagogik, S. 116-129.<br />
288
Lüdtke, H.: Wer und was erzeugt studentischen Zeitstreß? Temporale<br />
Muster an Universitäten als Basis von <strong>Studien</strong>beratung und Evaluation. In:<br />
Clemens, W. & Strübing, J. (H): Empirische Sozialforschung und<br />
gesellschaftliche Praxis. Bedingungen und Formen angewandter<br />
Forschung in den Sozialwissenschaften, Opladen 2000, S: 135-154.<br />
Lüdtke, H.: Erfahrung, Fachkultur und <strong>Studien</strong>orientierung als<br />
Determinanten der Zeitmusterpräferenz von Studenten. In: Dollase, R. et<br />
al. (H): Temporale Muster, Opladen 1999.<br />
Mayr, J. (H): Lehrer/in werden. Innsbruck 1994.<br />
Mayr, J. & Neuweg, G. H.: Der Persönlichkeitsansatz in der<br />
Lehrer/innen/forschung. In: Greiner, U. & Heinrich, M. (H): Schauen, was<br />
rauskommt. Kompetenzförderung, Evaluation und Systemsteuerung <strong>im</strong><br />
Bildungswesen, Münster 2006.<br />
Mayr, J. & Mayrhofer, E.: Persönlichkeitsmerkmale als Determinanten von<br />
Leistung und Zufriedenheit bei LehramtsstudentInnen. In: Mayr, J. (H):<br />
Lehrer/in werden. Innsbruck 1994 S. 113-127.<br />
Mayr, J.: Ein Lehrerstudium beginnen? Selbsterkundungs-Verfahren als<br />
Entscheidungshilfe. In: Journal für LehrerInnenbildung, H.1/2001, S. 88-97.<br />
Mayr, J.: Wie Lehrer/innen lernen. Befunde <strong>zur</strong> Beziehung von<br />
Lernvoraussetzungen, Lernprozessen und Kompetenz. In: Lüders, M. &<br />
Wissinger, J. (H): Kompetenzentwicklung und Programmevaluation –<br />
Forschung zu Lehrerbildung, Münster, New York, München, Berlin 2007, S.<br />
151-168.<br />
Mayr, J.: Theorie + Übung + Praxis = Kompetenz. Empirisch begründete<br />
Rückfragen zu den Standards in der Lehrerbildung. In: Allemann-Ghionda<br />
C. & Terhart, E. (H): Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von<br />
Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und Weiterbildung. 51. Beiheft der<br />
Zeitschrift für Pädagogik, S. 149-163.<br />
289
Meyer, C. & Rüegger, H.: Idee und Zukunft der Universität. In: Hermann, M.<br />
et al. (H): Elfenbeinturm oder Denkfabrik. Ideen für eine Universität mit<br />
Zukunft. Zürich 1998, S. 55-68.<br />
Meyer, Th.: <strong>Studien</strong>abbruch an Schweizer Hochschulen – Eine<br />
Strukturanalyse. Bern 1996.<br />
Mohler, P.: Universität und Lehre: Ihre Evaluation als Herausforderung an<br />
die empirische Sozialforschung. Münster 1994.<br />
Müller-Fohrbrodt, G.: Wie sind Lehrer wirklich? Ideale – Vorurteile –<br />
Fakten. Eine empirische Untersuchung über angehende Lehrer. Stuttgart<br />
1973.<br />
Nachtigall, Chr. (H) : Kompetenztest Landesbericht 2005 und 2006.<br />
Nolle, A.: Evaluation der universitären Lehrerinnen- und Lehrerausbildung.<br />
<strong>Erhebung</strong> <strong>zur</strong> pädagogischen Kompetenz von Studierenden der<br />
Lehramtsstudiengänge. München 2004.<br />
Oerter, R. & Montada, L. (H): Entwicklungspsychologie – Ein Lehrbuch,<br />
Weinhe<strong>im</strong> u.a. 2002.<br />
Oesterreich, D.: Vorschläge von Berufsanfängern für Veränderungen in der<br />
Lehrerausbildung. In: Zeitschrift für Pädagogik Nr. 33/1987, S. 771-786.<br />
Oser, F. & Oelkers, J. (H): Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme.<br />
Von der Allrounderbildung <strong>zur</strong> Ausbildung professioneller Standards.<br />
Chur/Zürich 2001.<br />
Oser, F. & Renold, U.: Kompetenzen von Lehrpersonen – über das<br />
Auffinden von Standards und ihre Messung. In: 4. Beiheft der Zeitschrift für<br />
Erziehungswissenschaft 2005, S. 119-140.<br />
Pabst, M.: Institution. In: Kerber, H. & Schmieder, A. (H): Handbuch<br />
Soziologie. Zur Theorie und Praxis sozialer Beziehungen. Reinbeck 1984,<br />
S. 255-262.<br />
290
Parsons, R. D., Hinson, S. L. & Sardo-Brown, S. (2001). Educational<br />
Psychology: A practitioner-researcher-model of teaching. Belmont, CA:<br />
Wadsworth/ Thomson Learning.<br />
Peterßen, W. H.: Kleines Methoden-Lexikon, München 2001.<br />
Peterßen, W. H.: Wissenschaftliche(s) Arbeiten – Eine Einführung für<br />
Schule und Studium, München 1996.<br />
Rauin, U. & Meier, U.: Subjektive Einschätzungen des Kompetenzerwerbs<br />
in der Lehramtsausbildung. In: Lüders, M. & Wissinger, J. (H):<br />
Kompetenzentwicklung und Programmevaluation – Forschung zu<br />
Lehrerbildung, Münster, New York, München, Berlin 2007, S. 103-132.<br />
Rauin, U. et al.: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ein<br />
Berufseignungsinventar für das Lehramtsstudium. In: Pädagogik Nr.<br />
46/1994, S. 34-39.<br />
Re<strong>im</strong>ann, B. C.: Strukturd<strong>im</strong>ensionen bürokratischer Organisationen: Eine<br />
empirisch fundierte Würdigung. In: Türck, K. (H): Organisationstheorie (S.<br />
18-31), Hamburg 1975.<br />
Rißland, B.: Humor – ein vernachlässigter Faktor in der Lehrerbildung? In:<br />
Brunner, H. et al. (H): Lehrerinnen- und Lehrerbildung braucht Qualität.<br />
Und wie?! München 2002, S. 445-455.<br />
Rogge, K.-E.: Psychophysiologie. In: Rogge, K.-E. (H): Steckbrief der<br />
Psychologie, Heidelberg 1971, S. 121-137.<br />
Röhrle, B.: Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung. Weinhe<strong>im</strong> 1994.<br />
Rohrmann, A.: Auswertung der <strong>Erhebung</strong> <strong>zur</strong> sozialen und wirtschaftlichen<br />
Lage der Studierenden an der evangelischen Gesamthochschule<br />
Darmstadt, Darmstadt 2006.<br />
291
Rothland, M. (H).: Belastung und Beanspruchung <strong>im</strong> Lehrerberuf. Modell,<br />
Befunde, Interventionen. Wiesbaden 2007.<br />
Rinkens, H.D.: Damit studieren gelingt – Anmerkungen zu den<br />
Rahmenbedingungen heute und morgen, Paderborn 2006.<br />
Rudow, B.: Die Arbeit des Lehrers: Zur Psychologie der Lehrertätigkeit,<br />
Lehrerbelastung und Lehrergesundheit. Göttingen 1994.<br />
Rychen, D.S. & Salganik, L. H. (H): Defining und Selecting Key<br />
Competencies. Göttingen 2001.<br />
Schaarschmidt, U. & Fischer, A.W.: Bewältigungsmuster <strong>im</strong> Beruf.<br />
Persönlichkeitsmuster in der Auseinandersetzung mit der Arbeitsbelastung.<br />
Göttingen 2001.<br />
Schaarschmidt, U. (H): Halbtagsjobber – Psychische Gesundheit <strong>im</strong><br />
Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes,<br />
Weinhe<strong>im</strong> und Basel 2004.<br />
Schaarschmidt, U. & Kieschke, U.: Gerüstet für den Schulalltag, Weinhe<strong>im</strong><br />
und Basel 2007.<br />
Schaefers, Chr.: Forschung <strong>zur</strong> Lehrerausbildung in Deutschland – eine<br />
bilanzierende Übersicht der neueren empirischen <strong>Studien</strong>. In: Schweizer<br />
Zeitschrift für Bildungswissenschaften Nr. 24/2002, S. 65-88.<br />
Schönpflug, W.: Beanspruchung und Belastung bei der Arbeit. In:<br />
Kleinbeck, U. & Rutenfranz, J. (H): Arbeitspsychologie, Göttingen 1987, S.<br />
130-184.<br />
Schönwälder, H.-G.: D<strong>im</strong>ensionen der Belastung <strong>im</strong> Lehrerberuf. In:<br />
Buchen, S. et al. (H): Jahrbuch für Lehrerforschung Band 1, Weinhe<strong>im</strong><br />
1997, S. 179-202.<br />
292
Schröder, K. Persönlichkeit, Ressourcen und Bewältigung. In: Schwarzer,<br />
R. (H): Gesundheitspsychologie – Ein Lehrbuch. Göttingen 1997, S. 319-<br />
347.<br />
Schubarth, W. et al.: Die 2. Phase der Lehrerausbildung aus der Sicht<br />
Brandenburger Lehramtskandidaten – die Potsdamer Studie. In: Lüders, M.<br />
& Wissinger, J. (H): Kompetenzentwicklung und Programmevaluation –<br />
Forschung zu Lehrerbildung, Münster, New York, München, Berlin 2007, S.<br />
169-193.<br />
Schwarz, B. : Schlechte Lehrer. Mindeststandards für die Lehrtätigkeit. In:<br />
Sieland, B. & Rißland, B. (H): Qualitätssicherung in der Lehrerbildung.<br />
Hamburg 2000, S. 39-54.<br />
Seel, N.: Psychologie des Lernens. München 2000.<br />
Sennett, R.: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus.<br />
Wien/Frankfurt am Main 1998.<br />
Shaffer, D. R. (1999). Developmental Psychology: Childhood and<br />
adolescence (5th edition). Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.<br />
Silbereisen, R. K. & Frey, D. (H): Perspektiven der Psychologie –<br />
Einführung und Standortbest<strong>im</strong>mung, Weinhe<strong>im</strong> und Basel 2001.<br />
Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology. Theory and practice (8th<br />
ed.). Boston: Allyn & Bacon. (aktuell, vielfältig, hervorragend auf Schule<br />
bezogen).<br />
Staub, F.C. & Stern, E.: The nature of teachers‘ pedagogical content belief<br />
matters for students’ achievement gains. Quasiexper<strong>im</strong>ental evidence from<br />
elementary mathematics. In: Journal of Educational Psychology Nr.<br />
94/2002, S. 344-355.<br />
Stengel, M.: Psychologie der Arbeit. Weinhe<strong>im</strong> und Basel 1997.<br />
293
Stolz, G. E.: Der schlechte Lehrer aus der Sicht von Schülern. In: Schwarz,<br />
B. & Prange, K.: Schlechte Lehrer/innen. Zu einem vernachlässigten<br />
Aspekt des Lehrberufs. Weinhe<strong>im</strong>/Basel 1997.<br />
Tenorth, H. E.: Der Beitrag der Erziehungswissenschaft <strong>zur</strong><br />
Professionalisierung pädagogischer Berufe. In: Apel, H.J. et al. (H):<br />
Professionalisierung pädagogischer Berufe <strong>im</strong> historischen Prozess. Bad<br />
Heilbrunn 1999., S. 429-461.<br />
Terhart, E.: Sozialwissenschaftliche Theorie und Forschungsansätze zum<br />
Beruf des Lehrers 1970-1990. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und<br />
Erziehungssoziologie Nr. 10/1990, S. 235-254.<br />
Terhart, E.: Erfassung und Beurteilung der beruflichen Kompetenz von<br />
Lehrkräften. In: Lüders, M. & Wissinger, J. (H): Kompetenzentwicklung und<br />
Programmevaluation – Forschung zu Lehrerbildung, Münster, New York,<br />
München, Berlin 2007, S. 37-62.<br />
Terhart, E.: Was wissen wir über gute Lehrer. In: Zeitschrift für Pädagogik<br />
Nr. 58/2006, S. 42-47.<br />
Terhart, E.: Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde,<br />
Problemanalysen, Reformkonzepte. Weinhe<strong>im</strong> 2001.<br />
Terhart, E.: Standards für die Lehrerbildung. Eine Expertise für die<br />
Kultusministerkonferenz. Münster 2002.<br />
Tinto, V.: Defining dropout. A matter of perspective. In: Pascarella, E. (H):<br />
New directions for institutional research. Studying student attrition. San<br />
Francisso 1982, S. 3-15.<br />
Trautmann-Sponsel, R. D.: Definition und Abgrenzung des Begriffs<br />
Bewältigung. In: Brüderl, L. (H): Theorien und Methoden der<br />
Bewältigungsforschung, Weinhe<strong>im</strong> 1988, S. 14-24.<br />
Türk, K.: Organisationspsychologie. In: Frese, E. (H): Handwörterbuch der<br />
Organisation, Spalte 1633-1648, Stuttgart 1992.<br />
294
Türk, K. (H): Organisationstheorie, Hamburg 1975.<br />
Ulich, K.: Beruf LehrerIn – Arbeitsbelastung, Beziehungskonflikte,<br />
Zufriedenheit, Weinhe<strong>im</strong> 1996.<br />
Ulich, K.: Berufswahlmotive angehender LehrerInnen – Eine Studie über<br />
Unterschied in Geschlecht und Lehramt. In: Die Deutsche Schule Nr.<br />
90/1998, S. 64-78.<br />
Ulich, E..: Arbeitspsychologie, Zürich und Stuttgart 1998.<br />
Urban, W.: Untersuchungen zu Netzwerken erlebter <strong>Belastungen</strong> bei<br />
künftigen Pflichtschullehrern. In: Sieland, B. & Rißland, B. (H):<br />
Qualitätssicherung in der Lehrerbildung. Hamburg 2000, S. 93-137.<br />
Van Dick, R.: Stress und Arbeitszufriedenheit <strong>im</strong> Lehrerberuf. Eine Analyse<br />
von Belastung und Beanspruchung <strong>im</strong> Kontext sozialpsychologischer,<br />
klinisch-psychologischer und organisationspsychologischer Konzepte.<br />
Marburg 1999.<br />
Van Dick, R. & Stegmann, S.: Belastung, Beanspruchung und Stress <strong>im</strong><br />
Lehrerberuf – Theorien und Modelle. In: Rothland, M.: Belastung und<br />
Beanspruchung <strong>im</strong> Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen.<br />
Wiesbaden 2007.<br />
Vollrath, M.: Studentinnen: Stress und Stressbewältigung <strong>im</strong> Studium.<br />
Frankfurt/M. 1988.<br />
Vosgerau, K.: Studentische Sozialisation in Hochschule und Stadt, Theorie<br />
und Wandel eines Feldes.diss. Frankfurt/M. 2005.<br />
Weidenmann, B.: Psychische <strong>Belastungen</strong> von Lehrern – ein kritischer<br />
Überblick über neuere empirische Arbeiten. In: Ingenkamp, K.-H. (H):<br />
Sozialemotionales Verhalten in Lehr- und Lernsituationen, Landau 1984, S.<br />
139-153.<br />
295
Weinert, F.E.: Concept of Competence. A Conceptual Clarification. In:<br />
Rychen, D.S. & Salganik, L. H. (H): Defining und Selecting Key<br />
Competencies. Göttingen 2001, S. 45-66.<br />
Wendt, W.: Belastung von Lehrkräften. Fakten zu Schwerpunkten,<br />
Strukturen und Belastungstypen. Eine repräsentative Befragung von<br />
Berliner Lehrerinnen und Lehrern. Reihe Psychologie, Bd. 43, Landau,<br />
2001.<br />
Z<strong>im</strong>mer, G.: Evaluation der Lehre durch logische Rekonstruktion der<br />
Lernhandlungen. In: Clemens, W. & Strübing, J. (H): Empirische<br />
Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis. Bedingungen und Formen<br />
angewandter Forschung in den Sozialwissenschaften, Opladen 2000, S.<br />
113-134.<br />
18. <strong>Erhebung</strong> des deutschen Studentenwerkes 2006.<br />
Methodisch orientierte Literatur<br />
Atteslander, P./Kopp, M.: Die Befragung. In: Roth, E. 1987, S. 148-172.<br />
Backhaus, K. et al.: Multivariate Analysemethoden: Eine<br />
anwendungsorientierte Einführung, Berlin 1994.<br />
Bortz, J.: Statisktik für Sozialwissenschaftler, Berlin 1993.<br />
Flick, U. et.al.(H): Handbuch der qualitativen Sozialforschung: Grundlagen,<br />
Konzepte, Methoden und Anwendungen, Weinhe<strong>im</strong> 1995.<br />
Haft, E. et al. (H): Enzyklopädie der Erziehungswissenschaft, Bd. 2:<br />
Methoden der Erziehungs- und Bildungsforschung, Stuttgart/Dresden 1995.<br />
Hopf, Chr./Weingarten/F. (H): Qualitative Sozialforschung, Stuttgart 1984.<br />
Hopf, Chr.: Qualitative Interviews in der Sozialforschung. In Flick, U. 1995,<br />
S. 177ff.<br />
Hron, A.: Strukturiertes Interview. In: Haft 1995, S. 426-431.<br />
296
Huber, G. & Mandl, H. (H): Verbale Daten. Eine Einführung in die<br />
Grundlagen und Methoden der <strong>Erhebung</strong> und Auswertung. Beltz,<br />
Weinhe<strong>im</strong> 1982.<br />
Huber, G.: Qualitative Analyse. Oldenbourg Verlag, München 1992.<br />
Lisch, R. und Kriz, J.: Grundlagen und Modelle der Inhaltsanalyse.<br />
Rowohlt, Reibeck 1978.<br />
Mayring, Ph.: Einführung in der qualitative Sozialforschung: eine Anleitung<br />
zu qualitativem Denken, Weinhe<strong>im</strong> 1993.<br />
Mayring, Ph.: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundfragen und Techniken.<br />
Deutscher <strong>Studien</strong>verlag, Weinhe<strong>im</strong> 1993<br />
Merton, K.: Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis,<br />
Westdeutscher Verlag, Opladen 1983.<br />
Merton, R./Kendall, P.: Das fokussierte Interview. In: Hopf/Weingarten<br />
1984.<br />
Mollenhauer, K. & Rittelmeyer, Ch.: Methoden der Erziehungswissenschaft,<br />
Juventa, München 1977.<br />
Riedel, M.: Verstehen oder Erklären?, Klett, Stuttgart 1978.<br />
Roth, E.: Sozialwissenschaftliche Methoden, München/Wien 1987.<br />
Rust, H.: Qualitative Inhaltsanalyse – begriffslose Willkür oder<br />
wissenschaftliche Methode? Ein theoretischer Entwurf, ..?<br />
Rust, H.: Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse. Eine Einführung,<br />
Narr, Tübingen 1981.<br />
Soeffner, H.-G. (H): Interpretative Verfahren in den Sozial- und<br />
Textwissenschaften. Sammlung Mtzler, Stuttgart 1979.<br />
297
Spöring, W.: Qualitative Sozialforschung, Stuttgart 1989.<br />
Titzmann, M.: Strukturale Textanalyse. Theorie und Praxis der<br />
Interpretation, Fink, München 1977.<br />
Wirtz, M./Nachtigall, Chr.: Deskriptive Statistik, Weinhe<strong>im</strong>/München 1998<br />
Witzel, A.: Verfahren qualitativer Sozialforschung – Überblick und<br />
Alternativen, Frankfurt/M. 1982.<br />
Zedler, P. und Moser, H. (H): Aspekte qualitativer Sozialforschung, Leske,<br />
Opladen 1983.<br />
298