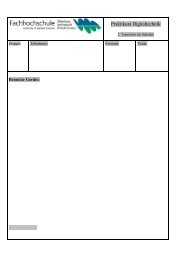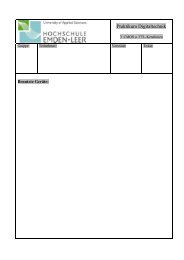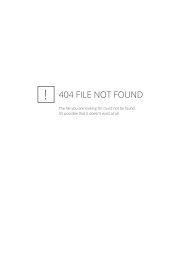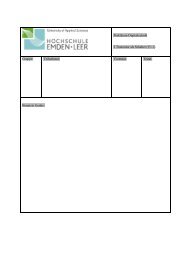8. Betriebsbedingungen elektrischer Maschinen - FB E+I: Home
8. Betriebsbedingungen elektrischer Maschinen - FB E+I: Home
8. Betriebsbedingungen elektrischer Maschinen - FB E+I: Home
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>8.</strong> <strong>Betriebsbedingungen</strong> <strong>elektrischer</strong> <strong>Maschinen</strong><br />
Neben den Forderungen, die die Wirkungsweise an den Aufbau der elektrischen <strong>Maschinen</strong> stellt,<br />
müssen bei der Konstruktion noch die Bedingungen des Aufstellungsortes und der Schutz des<br />
Menschen gegen Berührung spannungsführender oder umlaufender Teile und der Schutz gegen<br />
eine Beschädigung der Maschine selbst berücksichtigt werden. Dies wird durch genormte Bauformen<br />
und Schutzarten gewährleistet.<br />
Bauformen und Schutzarten<br />
Bei den Transformatoren unterscheidet man Trockentransformatoren (bis 1000 kVA), Gießharztransformatoren<br />
(100 kVA bis 15 MVA) und Öltransformatoren (50 kVA bis 1500 MVA).<br />
Die Bauformen der drehenden <strong>Maschinen</strong> sind nach VDE 0530 Teil 7 (früher DIN 42 950)<br />
genormt. Es bedeuten die Kennbuchstaben<br />
A <strong>Maschinen</strong> ohne Lager, waagerechte Anordnung;<br />
B Maschine mit Schildlagern, waagerechte Anordnung;<br />
C Maschine mit Schild- und Stehlagern, waagerechte Anordnung;<br />
D Maschine mit Stehlagern, waagerechte Anordnung;<br />
V Maschine mit Führungslagern, Traglagern oder Schildlagern, senkrechte Anordnung.<br />
In Nachfolge von DIN 42950 findet heute die internationale Norm DIN IEC 34 Teil 7 mit den<br />
IEC-Codes I und II (IM = International Mounting) Anwendung. Die wichtigsten Bauformen sind<br />
B3 (Fußmotor) und B5 (Flanschmotor). Die Baugrößen dieser <strong>Maschinen</strong> sind in DIN 747 festgelegt.<br />
IM B3 IM B5 IM V1<br />
Bauformen <strong>elektrischer</strong> <strong>Maschinen</strong> (Auswahl DIN 42950)<br />
Zur Kennzeichnung des Schutzgrades werden nach DIN 40050 bzw. VDE 0530 Teil 5 je eine<br />
Ziffer verwendet, der die Buchstaben IP (International Protection) vorangestellt sind. Für den<br />
Berührungs- und Fremdkörperschutz gibt es fünf, für den Wasserschutz sogar acht verschiedene<br />
Schutzgrade.<br />
allgemeine Kennbuchstaben für Schutzart IP 2 3<br />
1. Kennziffer, Grad des Berührungs- und Fremdkörperschutzes<br />
2. Kennziffer, Grad des Wasserschutzes<br />
Die wichtigsten Schutzarten für elektrische <strong>Maschinen</strong> sind IP12, IP21, IP22, IP23, IP44, IP54,<br />
IP55.<br />
G. Schenke, 9.2006 Elektrische Netze und <strong>Maschinen</strong> <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 86
Schutzarten <strong>elektrischer</strong> <strong>Maschinen</strong>, Schutzgrad<br />
1.<br />
Kennziffer<br />
Berührungs- und<br />
Fremdkörperschutz<br />
Schutzumfang<br />
2.<br />
Kennziffer<br />
Wasserschutz<br />
Schutzumfang<br />
0 Kein Berührungsschutz hinsichtlich 0 Kein Wasserschutz<br />
unter Spannung stehender oder sich<br />
bewegender Teile<br />
1 Schutz gegen zufällige großflächige<br />
Berührung mit der Hand, Fremdkörper<br />
ø > 50 mm<br />
2 Schutz gegen Berührung mit den<br />
Fingern, Fremdkörper ø > 12 mm<br />
3 Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen,<br />
Fremdkörper ø > 2,5 mm<br />
4 Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen,<br />
Fremdkörper ø > 1 mm<br />
1 Schutz gegen senkrecht fallendes<br />
Tropfwasser<br />
2 Schutz gegen Tropfwasser aus<br />
senkrechter oder schräger Richtung bis<br />
15° zur Senkrechten<br />
3 Schutz gegen Sprühwasser aus beliebiger<br />
Richtung bis 60° zur Senkrechten<br />
4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen<br />
Richtungen<br />
5 Schutz gegen Strahlwasser aus allen<br />
Richtungen<br />
5 Vollständiger Schutz gegen 6 Schutz bei Überflutung<br />
Berühren mit Hilfsmitteln jeglicher<br />
Art, Staubschutz im Inneren<br />
7 Schutz beim Eintauchen, festgelegte<br />
Druck und Zeitbedingungen<br />
6 Staubdichte Maschine 8 Schutz beim Untertauchen (dauernd)<br />
Werden elektrische <strong>Maschinen</strong> in Bereichen eingesetzt, in denen ein Funke infolge des Betriebs<br />
des Motors oder schon seine Oberflächentemperatur eine Explosion hervorrufen kann, so sind<br />
hinsichtlich der Motorausführung besondere Bestimmungen einzuhalten. Diese sind in einer<br />
Reihe von Normen für "Elektrische Betriebsmittel für schlagwetter- und explosionsgefährdete<br />
Bereiche" festgelegt und eine gesetzlich bindende Vorschrift für Hersteller und Betreiber.<br />
Je nach den Eigenschaften des explosionsgefährdeten Bereichs werden die Betriebsmittel in zwei<br />
Gruppen eingeteilt. Gruppe I erfasst <strong>Maschinen</strong> für schlagwettergefährdete Grubenbaue,<br />
Gruppe II alle anderen Bereiche, wobei hier entsprechend den Gaseigenschaften die weitere<br />
Unterteilung in IIA, IIB, IIC vorgenommen wird.<br />
Zur Klassifizierung der Maßnahmen gegen Explosionsgefahr sind eine Reihe von Zündschutzarten<br />
in den VDE-Bestimmungen 0170/0171 definiert, sie stimmen mit den Europanormen<br />
EN 50014-50020 überein. Für elektrische <strong>Maschinen</strong> kommen zur Anwendung:<br />
- Erhöhte Sicherheit EEx e;<br />
- Druckfeste Kapselung EEx d;<br />
- Überdruckkapselung EEx p.<br />
Die Ausführung einer elektrischen Maschine in Schlagwetter- bzw. Explosionsschutz muss auf<br />
dem Leistungsschild eindeutig vermerkt sein.<br />
G. Schenke, 9.2006 Elektrische Netze und <strong>Maschinen</strong> <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 87
Erwärmung und Kühlung<br />
In elektrischen <strong>Maschinen</strong> treten stromunabhängige Verluste (Eisenverluste, mechanische Lagerund<br />
Bürstenreibungsverluste, Lüftungsverluste), stromabhängige Verluste (Stromwärmeverluste<br />
in Wicklungen, Übergangsverluste in Kohlebürsten), lastabhängige Zusatzverluste und Erregerverluste<br />
auf.<br />
Der Wirkungsgrad wird bei größeren <strong>Maschinen</strong>leistung meistens indirekt über die aufsummierten<br />
Teilverluste P V angegeben.<br />
P2<br />
PV<br />
η = = 1−<br />
(<strong>8.</strong>1)<br />
P P + P<br />
1<br />
2<br />
V<br />
Die in einem <strong>Maschinen</strong>teil entstehende Verlustwärme erhöht dessen Temperatur gegenüber der<br />
Umgebung. Für die Zeitspanne dt gilt folgende Energiebilanz.<br />
Erzeugte Wärme = abgegebene Wärme + gespeicherte Wärme<br />
P V ⋅ dt = α ⋅ O ⋅ Θ ⋅ dt + c ⋅ m ⋅ dΘ<br />
(<strong>8.</strong>2)<br />
P V = Verlustleistung<br />
α = Wärmeübergangszahl<br />
O = Oberfläche<br />
Θ = Temperaturdifferenz zwischen dem Körper und dem Kühlmittel<br />
c = spezifische Wärmekapazität<br />
m = Masse des Körpers<br />
dΘ = Änderung der Temperaturdifferenz<br />
Die Erwärmung erfolgt prinzipiell nach einer Exponentialfunktion. Mit konstanter Kühlmitteltemperatur<br />
gilt:<br />
−t<br />
T<br />
( 1−<br />
E<br />
)<br />
Θ = ∆ϑ = ∆ϑ<br />
(<strong>8.</strong>3)<br />
1 ⋅ e<br />
mit der Endübertemperatur des Körpers gegenüber dem Kühlmittel (Umgebung)<br />
PV<br />
∆ ϑ1<br />
= (<strong>8.</strong>4)<br />
α ⋅ O<br />
und der Zeitkonstanten<br />
c ⋅ m<br />
T E =<br />
(<strong>8.</strong>5)<br />
α ⋅ O<br />
Die zulässige Erwärmung <strong>elektrischer</strong> <strong>Maschinen</strong> ist mit Rücksicht auf die Wärmebeständigkeit<br />
der Isolierstoffe begrenzt. Je nach eingesetztem Material sind unterschiedliche Höchstwerte<br />
zulässig.<br />
In VDE 0530, Teil 1 werden mehrere Isolierstoffklassen unterschieden und diesen jeweils höchstzulässige<br />
Dauertemperaturen zugeordnet.<br />
Die Einhaltung der zulässigen Temperaturwerte ist mit Rücksicht auf die Lebensdauer der<br />
<strong>Maschinen</strong> von großer Bedeutung.<br />
G. Schenke, 9.2006 Elektrische Netze und <strong>Maschinen</strong> <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 88
Isolierstoffklassen und höchstzulässige Dauertemperatur<br />
(Umgebungstemperatur 40°C, Aufstellungshöhe bis 1000 m, Auswahl aus VDE 0530, Teil 1)<br />
Klasse<br />
Höchstzulässige<br />
Dauertemperatur<br />
Isolierstoffe<br />
A 105°C<br />
E 120°C<br />
B 130°C<br />
F 155°C<br />
H 180°C<br />
Baumwolle, Naturseide, Kunstseide, Papier, Holz,<br />
Pressspan mit Lacken getränkt<br />
Drahtlacke verschiedener Art, Pressteile mit<br />
mineralischen Füllstoffen<br />
Glasfaser, Glimmerprodukte, Pressteile mit<br />
Zellulosefüllstoff Drahtlacke auf Imid-Polyesterbasis<br />
Glasfaser, Glimmerprodukte, Drahtlacke auf Imid-<br />
Polyesterbasis<br />
Glasfaser, Glasfaser mit Silikon-Harzen behandelt,<br />
Silikon-Kautschuk<br />
Bei gegebenen Verlusten einer Maschine lässt sich die Endtemperatur im wesentlichen nur durch<br />
eine intensivere Kühlung senken. Man unterscheidet zwischen den Kühlarten:<br />
Selbstkühlung; die Maschine wird ohne Verwendung eines Lüfters durch Luftbewegung und<br />
Strahlung gekühlt.<br />
Eigenkühlung; die Kühlluft wird durch einen am Läufer angebrachten oder von ihm<br />
angetriebenen Lüfter bewegt.<br />
Fremdkühlung; die Maschine wird durch einen Lüfter gekühlt, der nicht von der Welle der<br />
Maschine angetrieben wird, oder statt der Luft durch ein anderes fremdbewegtes Kühlmittel<br />
gekühlt.<br />
Mit Rücksicht auf eine gute Materialausnutzung ist man bestrebt die zulässige Grenzübertemperatur<br />
im Nennbetrieb annähernd zu erreichen. Um diese Aufgabe zu erleichtern, legen die<br />
Bestimmungen in VDE 0530, Teil 1 unterschiedliche Nennbetriebsarten fest, denen jeweils ein<br />
charakteristisches Belastungsprogramm zugrunde liegt.<br />
Dauerbetrieb - Betriebsart S1: Die Nennbelastung dauert so lange an, dass der thermische<br />
Beharrungszustand, d.h. die Endtemperatur erreicht wird. Im Dauerbetrieb ist P N die mögliche<br />
Belastung.<br />
Kurzzeitbetrieb - Betriebsart S2: Die Nennbelastung ist von so kurzer Dauer, dass der<br />
thermische Endzustand nicht erreicht wird. In der spannungslosen Pause kann die Maschine<br />
praktisch wieder voll abkühlen. Am Ende der Belastungszeit t B darf wie bei Dauerbetrieb die<br />
zulässige Grenzübertemperatur der betreffenden Isolierstoffklasse auftreten.<br />
1 = ∆ϑ2<br />
⋅ e<br />
−t ( B T<br />
1- E<br />
)<br />
∆ ϑ<br />
(<strong>8.</strong>6)<br />
Nimmt man vereinfacht an, dass die Wicklungstemperatur nur von den Stromwärmeverlusten<br />
abhängig ist, so erhält man aus der Dauerleistung P N die Kurzzeitleistung (P N ) S2 .<br />
1<br />
(PN<br />
) S2 = PN<br />
⋅ (<strong>8.</strong>7)<br />
−t B T<br />
1- e E<br />
G. Schenke, 9.2006 Elektrische Netze und <strong>Maschinen</strong> <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 89
(P N ) S2<br />
t<br />
t B<br />
∆ϑ<br />
∆ϑ 2<br />
∆ϑ 1<br />
T E<br />
Verlauf von Abgabeleistung und<br />
Wicklungsübertemperatur bei<br />
Kurzzeitbetrieb S2<br />
t B<br />
T A<br />
t<br />
Periodischer Aussetzbetrieb - Betriebsart S3: Belastungen in der Zeit t B mit der Leistung (P N ) S3<br />
wechseln sich in periodischer Folge mit Stillstandszeiten t St ab. Die VDE-Bestimmungen<br />
definieren die Spieldauer t S und die relative Einschaltdauer t r .<br />
tB<br />
t S = tB<br />
+ tSt<br />
tr<br />
=<br />
(<strong>8.</strong>8)<br />
t<br />
Für die zulässige Belastung gilt:<br />
(P<br />
N<br />
)<br />
S3<br />
=<br />
P<br />
N<br />
S<br />
TE<br />
1−<br />
tr<br />
⎛ tB<br />
1+<br />
1<br />
TA<br />
tr<br />
T ⎟ ⎞<br />
⋅ ⋅ ⋅ ⎜ −<br />
(<strong>8.</strong>9)<br />
⎝ E ⎠<br />
t B<br />
t St<br />
Für die Abkühlzeitkonstante T A gilt bei oberflächengekühlten<br />
Motoren T A /T E = 4 bis 6.<br />
(P N ) S3<br />
t<br />
t S<br />
∆ϑ 1<br />
∆ϑ<br />
Verlauf von Abgabeleistung und<br />
Wicklungsübertemperatur bei<br />
Aussetzbetrieb S3<br />
t<br />
Periodischer Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anlaufvorganges - Betriebsart S4: Das<br />
Lastspiel entspricht dem Betrieb S3, nur wird die zusätzliche Erwärmung während der Anlaufzeit<br />
t A berücksichtigt.<br />
t S<br />
t A<br />
P<br />
t B<br />
t St<br />
Einfluss des Anlaufvorganges<br />
beim Aussetzbetrieb S4<br />
t<br />
G. Schenke, 9.2006 Elektrische Netze und <strong>Maschinen</strong> <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 90
Periodischer Aussetzbetrieb mit <strong>elektrischer</strong> Bremsung - Betriebsart S5: Das Lastspiel<br />
entspricht dem Betrieb S3, nur wird die zusätzliche Erwärmung durch Anlauf und elektrische<br />
Bremsung berücksichtigt.<br />
t S<br />
t A<br />
P<br />
t B<br />
t Br<br />
Aussetzbetrieb S5 mit Einfluss von Anlauf<br />
und <strong>elektrischer</strong> Bremsung<br />
t St<br />
t<br />
Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Aussetzbelastung - Betriebsart S6: Die<br />
Maschine wird in den Lastpausen nicht abgeschaltet. Für die zulässige Leistung gilt:<br />
1 tS<br />
( PN<br />
) S6 = PN<br />
⋅ − (1 − tr<br />
) ⋅<br />
(<strong>8.</strong>10)<br />
t T<br />
r<br />
E<br />
Ununterbrochener periodischer Betrieb mit <strong>elektrischer</strong> Bremsung - Betriebsart S7: Das<br />
Lastspiel entspricht dem Betrieb S5 mit t St = 0, d.h. nach der elektrischen Bremsung erfolgt sofortiger<br />
Wiederanlauf.<br />
Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Last-/Drehzahländerungen - Betriebsart S8:<br />
Lastspiel mit wechselnden Drehzahlen und Belastungen (z.B. polumschaltbare Asynchronmaschinen).<br />
Betrieb mit nicht periodischen Last- und Drehzahländerungen - Betriebsart S9: Die<br />
Belastung und die Drehzahl können sich im zulässigen Bereich nichtperiodisch ändern.<br />
Betrieb mit einzelnen konstanten Belastungen - Betriebsart S10: Ein Betrieb mit nicht mehr<br />
als vier einzelne Belastungswerte.<br />
Toleranzen von Betriebswerten <strong>elektrischer</strong> <strong>Maschinen</strong> sind in VDE 0530 Teil 1, Tafel <strong>8.</strong>8<br />
zusammengestellt. Die zulässigen Toleranzen weisen teilweise erhebliche Werte auf.<br />
Die Toleranzen für die Gesamtverluste von <strong>Maschinen</strong> P > 50 kW betragen ±10%. Die Toleranzen<br />
für den Nennschlupf von Asynchronmaschinen P ≥ 1 kW betragen ±20% und bei Asynchronmaschinen<br />
P < 1 kW betragen sie sogar ±30%.<br />
Auf dem Leistungsschild einer elektrischen Maschine sind alle für den Einsatz der Maschine<br />
wichtigen Daten, insbesondere die bei Nennbetrieb auftretenden Werte für Leistung, Spannung,<br />
Strom und Drehzahl aufgeführt. Der Umfang der erforderlichen Angaben ist in VDE 0530 Teil 1<br />
festgelegt.<br />
G. Schenke, 9.2006 Elektrische Netze und <strong>Maschinen</strong> <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 91