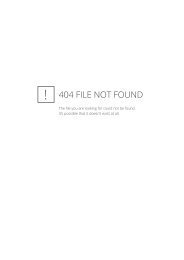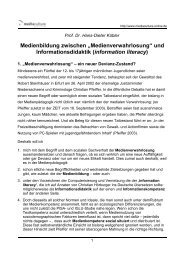4. Auswahl - die unterschiedlichen Meldungen - Mediaculture online
4. Auswahl - die unterschiedlichen Meldungen - Mediaculture online
4. Auswahl - die unterschiedlichen Meldungen - Mediaculture online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Autor: Zehrt, Wolfgang.<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Titel: Hörfunk-Nachrichten. Kap. 3: Formulierung der Meldung; Kap. 4: <strong>Auswahl</strong> - <strong>die</strong><br />
<strong>unterschiedlichen</strong> <strong>Meldungen</strong>.<br />
Quelle: Wolfgang Zehrt: Hörfunk-Nachrichten. Konstanz 1996. S. 31-108, S.218-221.<br />
Verlag: UVK Me<strong>die</strong>n.<br />
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags.<br />
3.1 Grundregel<br />
Wolfgang Zehrt<br />
3. Formulierung der Meldung<br />
Verständlich und lebendig schreiben - kein Lexikon-Eintrag, keine Diplomarbeit keine<br />
Fremdwörter, aber auch keine Umgangssprache. <strong>Meldungen</strong> sollten in normalem Deutsch<br />
für Menschen mit durchschnittlichem Bildungsstand verfaßt werden. Normales Deutsch<br />
meint unsere Alltagssprache, aber eben keine Slang-, Mode- oder Szeneausdrücke.<br />
Darüber hinaus muß ein Nachrichtensatz einfach und übersichtlich formuliert werden,<br />
damit <strong>die</strong> Meldung gut verständlich ist.<br />
Komplizierte und unübersichtliche Sätze werden manchmal von Politikern bewußt<br />
eingesetzt - z.B., wenn etwas verschleiert werden soll. Diese Verschleierungstaktik sollte<br />
uns Journalisten davon abhalten, ebenfalls mit chaotischen Satzungetümen Hörer und<br />
Leser zu verwirren. Überlassen wir <strong>die</strong>s den Politikern.<br />
Das Meisterstück einer solchen Verschleierungstaktik wurde 1978 vom damaligen<br />
Regierungssprecher Klaus Bölling formuliert. Es ging um den Rücktrittsgrund von<br />
Verteidigungsminister Leber, <strong>die</strong> Frankfurter Rundschau dokumentierte <strong>die</strong>sen Satz am<br />
3.Februar 1978:<br />
1
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Bundesminister Leber hat heute dem Kabinett vorgetragen, daß er <strong>die</strong> von ihm im Verlauf der<br />
Debatte über den Verteidigungshaushalt am 26.Januar 1978 vor dem Deutschen Bundestag<br />
abgegebene Erklärung, der Lauschmitteleinsatz des Militärischen Abschirm<strong>die</strong>nstes (MAD) in<br />
der Privatwohnung einer Mitarbeiterin sei der einzige <strong>die</strong>ser Art gewesen, nach seinem<br />
nunmehrigen tatsächlichen Kenntnisstand und aufgrund einer erneuten rechtlichen Beurteilung<br />
der Frage, ob unter bestimmten Umständen auch nicht zu Wohnzwecken <strong>die</strong>nende Räume im<br />
rechtlichen Sinne als Wohnung anzusehen seien, nicht aufrechterhalte.«<br />
Solche verschachtelten Satzkonstruktionen finden sich in abgeschwächter Form in vielen<br />
Zeitungen, in noch schwächerer Ausprägung zum Ärger der Hörer aber auch im<br />
Rundfunk.<br />
Eine einfache Regel verbietet solche Zumutungen schon im Ansatz:<br />
Verschachtelte Sätze, eingeschobene Nebensätze, Nominal- -und<br />
Partizipialkonstruktionen sollten ebensowenig in einer Meldung stehen wie<br />
schwierige Ausdrücke oder Fremdwörter.<br />
3.2 Lead-Satz<br />
Die Regel, einfach und übersichtlich zu schreiben, gilt ganz besonders für den Lead-Satz<br />
(kurz Lead). Der Lead der Meldung ist wie <strong>die</strong> Schlagzeile der Straßenverkaufs-Zeitung<br />
am Kiosk. Wenn der Lead nicht stimmt, nicht verstanden wird oder schlicht langweilt<br />
schaltet der Hörer - zumindest geistig - ab.<br />
Zeitungsleser entscheiden spätestens nach dem ersten Satz einer Meldung, ob sie <strong>die</strong>se<br />
ganz lesen wollen. Wenn nicht, wenden sie sich der Meldung daneben zu. Wenn aber<br />
Hörer nach dem ersten Satz einer Meldung abschalten, ist es fraglich, ob sie darauf<br />
hoffen, <strong>die</strong> nächste zu verstehen. Fazit: Auch bei interessanten Inhalten kann ein<br />
langweilig oder unverständlich formulierter Lead-Satz ausreichen, um den Hörer<br />
abzuschrecken. Dies gilt - wie das folgende Beispiel zeigt - auch für Zeitungsmeldungen.<br />
Das folgende Beispiel stammt aus einer Lokalzeitung und ist wegen seiner<br />
Schachtelkonstruktion für Print- und Funkme<strong>die</strong>n gleichermaßen ungeeignet.<br />
Beispiel:<br />
2
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Nach vier Jahren ist am Freitag einer der letzten großen NS-Prozesse in Deutschland, der<br />
gegen den 90jährigen Boselvav Maikowski, in Münster wegen Verhandlungsunfähigkeit des<br />
Angeklagten ohne Urteil zuende gegangen.«<br />
Im Lead-Satz darf genau eine Hauptinformation stehen. Darüber hinaus nur <strong>die</strong> ein oder<br />
zwei Nebeninformationen, <strong>die</strong> zum Verständnis des Lead-Satzes notwendig sind. In dem<br />
Beispiel »NS-Prozeß« ist der Lead-Satz ein Sammelbecken vieler Nebeninformationen,<br />
<strong>die</strong> auch weiter hinten in der Meldung folgen könnten. Auch für den Zeitungsleser wäre<br />
ein einfacherer Lead-Satz schneller aufzunehmen gewesen, für den Radiohörer wäre ein<br />
solcher Lead-Satz nahezu unverständlich.<br />
Besser:<br />
»Einer der letzten großen NS-Prozesse in Deutschland ist heute in Münster ohne Urteil zu Ende<br />
gegangen. Zu einem Urteilsspruch kam es nicht weil das Gericht den Angeklagten für<br />
verhandlungsunfähig hält. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen...«<br />
Lesen Sie immer ihren Lead-Satz noch einmal durch und markieren dabei (im Geiste)<br />
jede Information mit einem dicken, schwarzen Punkt - wenn Ihr Lead-Satz anschließend<br />
aussieht wie eine dichtgereihte Perlenkette, schreiben Sie ihn schleunigst um. Eine<br />
solche Perlenkette wird von keinem Hörer verdaut.<br />
Beispiel:<br />
»Beim Absturz einer Sportmaschine am Nachmittag in der Nähe des kleinen Flughafens von St.<br />
Michaelisdonn im Kreis Dithmarschen sind zwei Menschen getötet und zwei weitere schwer<br />
verletzt worden. Die Bergung der verletzten Pilotin dauert noch an. Über <strong>die</strong> Identität der Toten<br />
und Verletzten wurden keine Angaben gemacht. Die Maschine hatte Schwierigkeiten beim<br />
Landeanflug und startete durch. Kurze Zeit später stürzte sie ab.«<br />
Eine umständliche Satzkonstruktion kann man <strong>die</strong>sem Autoren nicht vorwerfen - <strong>die</strong>ser<br />
Lead-Satz ist in der Tat ein einfach konstruierter Hauptsatz ohne eingeschobene<br />
Nebensätze. Daran wird deutlich, daß auch ein einfacher Hauptsatz schwer verständlich<br />
sein kann. Listet man <strong>die</strong> Informationen des Lead-Satzes auf, wird <strong>die</strong> Überfrachtung<br />
deutlich:<br />
Beim Absturz 1. Information<br />
einer Sportmaschine 2. Information<br />
am Nachmittag 3. Information<br />
in der Nähe des kleinen <strong>4.</strong> Information<br />
Flughafens + Nebeninformation (»klein«)<br />
3
von St. Michalisdonn 5. Information<br />
im Kreis Dithmarschen 6. Information<br />
sind zwei Menschen 7. Information<br />
getötet 8. Information<br />
und zwei weitere 9. Information<br />
schwer verletzt worden 10. Information.<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Der Redakteur läßt den Hörer <strong>die</strong> Arbeit machen, <strong>die</strong> eigentlich seine eigene Aufgabe ist:<br />
das Herausfiltern der Hauptinformation.<br />
Besser:<br />
»Bei dem Absturz eines Sportflugzeuges im Kreis Dithmarschen sind heute nachmittag zwei<br />
Menschen getötet worden. Zwei weitere Insassen der Maschine wurden schwer verletzt. Die<br />
Maschine stürzte in der Nähe des Flughafens von St. Michaelisdonn ab.<br />
Nachrichtenredakteure sollten hinsichtlich des Satzbaus nicht Kant und Hegel nacheifern.<br />
Eine durchschnittliche Hörfunk-Meldung ist nach 35 Sekunden vorbei. In <strong>die</strong>ser Zeit<br />
müssen <strong>die</strong> Hörer alles verstanden haben. Das wird vor allem erschwert, wenn schon der<br />
Lead-Satz erfordert, daß sich <strong>die</strong> Hörer Informationen vom Beginn des Satzes merken,<br />
um den letzten Teil noch verstehen zu können.<br />
Beispiel:<br />
»Nach zwei ausverkauften und vom Publikum stürmisch gefeierten Gastspielen der sächsischen<br />
Staatskapelle Dresden in der Carnegie Hall, hat das Management des Hauses das Dresdner<br />
Orchester spontan zu regelmäßigen Konzerten in Nordamerikas Konzertsäle eingeladen. Wie<br />
Konzertdramaturg Eberhard Steindorf in Washington mitteilte, wurden bereits konkrete<br />
Angebote für 1996 und 1998 unterbreitet. Heute abend wird das renommierte Orchester zu<br />
einem Gastspiel im Kennedy Center von Washington erwartet. Die sächsische Staatskapelle<br />
weilt seit Mittwoch vergangener Woche zu einer dreiwöchigen Tournee in den USA.«<br />
Dieser Lead-Satz ist so schlecht formuliert, daß ein Umformulieren nicht mehr möglich ist<br />
- zu vieles ist unklar. Denn auch <strong>die</strong> Hörer werden sich - wenn sie nicht abgeschaltet<br />
haben - einige Fragen nicht beantworten können (und daß nicht nur wegen der Länge des<br />
Satzes). Der Grund: Die Bezüge in dem Lead-Satz sind für den Hörer nicht<br />
nachvollziehbar.<br />
»Das Management des Hauses« hat das Dresdner Orchester zu Konzerten eingeladen.<br />
Vorsicht - warum sollte denn das Management der Carnegie Hall in der Lage sein, ein<br />
Dresdner Orchester zu Konzerten in ganz »Nordamerika« einzuladen? Und wenn <strong>die</strong>se<br />
ehrenvolle Einladung in Washington bekanntgegeben wird, dann wird ja auch <strong>die</strong><br />
einladende Carnegie Hall in Washington stehen - könnte man jedenfalls denken ...<br />
4
3.3 Nebensatz im Lead-Satz<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Ein Nebensatz ist im Lead-Satz erlaubt, wenn sonst Abstriche an der Verständlichkeit<br />
gemacht werden müßten. Dies ist z. B. der Fall, wenn Prädikat und Objekt zu sehr<br />
voneinander getrennt werden.<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
»Der Kanzlerkandidat der SPD, Rudolf Scharping, besteht bei Koalitionsverhandlungen seiner<br />
Partei in Sachsen-Anhalt nicht auf einen Unvereinbarkeitsbeschluß gegenüber der PDS.«<br />
»Der Kanzlerkandidat der SPD, Rudolf Scharping, besteht nicht darauf, daß seine Partei bei den<br />
Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt einen Unvereinbarkeitsbeschluß gegenüber der<br />
PDS trifft.«<br />
3.4 Zusammenfassender Lead-Satz<br />
Fehler beim Aufbau einer Nachrichten-Meldung sind vor allem dann ärgerlich, wenn sie<br />
beim Hörer Verwirrung auslösen - sei es durch unverständliche, sei es durch überflüssige<br />
Informationen. Auch komplizierte Sachverhalte lassen sich zwar - wie im folgenden<br />
Beispiel - grammatikalisch korrekt ausdrücken, erfordern aber einen kleinen »Kunstgriff«,<br />
der hier nicht angewendet wurde.<br />
Beispiel:<br />
»Politiker aus Nordirland haben heute das Angebot des irischen Ministerpräsidenten Reynolds<br />
zurückgewiesen, in einem künftigen gemeinsamen Irland dem derzeit britischen Norden ein<br />
Drittel aller Regierungsposten in Dublin zu garantieren. Reynolds hatte das Angebot gestern in<br />
der irischen Hauptstadt verkündet. Der Regierungschef der Republik Irland wollte sein Angebot<br />
als Versuch des Brückenbaus verstanden wissen.«<br />
Diese Nachrichten-Meldung enthält drei Fehler, <strong>die</strong> sie hörerunfreundlich macht:<br />
1.Der Lead-Satz ist viel zu lang und kompliziert.<br />
5
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Durch vermeintliche Präzision werden <strong>die</strong> in den irischen Verhältnissen nicht<br />
bewanderten Zuhörer in <strong>die</strong> Irre geführt: Wie soll jemand innerhalb der vier Sekunden,<br />
<strong>die</strong> der Lead-Satz dauert, begreifen, daß Dublin <strong>die</strong> Hauptstadt Irlands sein muß, in der<br />
<strong>die</strong> nordirischen Politiker, wenn sie denn wollten und es ein gemeinsames Irland geben<br />
sollte, ein Drittel aller Regierungssitze bekommen könnten, was sie aber bereits<br />
abgelehnt haben?<br />
2. Auf im Hörfunk sinnvolle Wortwiederholungen wird verzichtet:<br />
Ministerpräsident Reynolds - Reynolds - der Regierungschef der Republik Irland. Der<br />
Redakteur hätte konsequent bei »irischer Ministerpräsident Reynolds« bleiben müssen.<br />
3. Der letzte Satz läßt einen grübelnden Hörer zurück.<br />
»Der Regierungschef wollte sein Angebot als Versuch des Brückenbaus verstanden<br />
wissen«. Hat das der Regierungschef nun selbst gesagt oder bietet uns ein hilfreicher<br />
Redakteur eine Interpretation <strong>die</strong>ses Angebotes an? Wenn auch etwas verklausuliert,<br />
ist <strong>die</strong>ser letzte Satz der Kern der Meldung - wieder einmal ist ein »Brückenbau-<br />
Versuch« fehlgeschlagen. Diese Information wird in der Meldung aber nicht ausreichend<br />
unterstrichen, sie muß am Anfang stehen. Dann kommen erst <strong>die</strong> Details: Wie sah das<br />
Angebot aus, und auf welchem Wege ist es abgelehnt worden.<br />
Zeitungskollegen arbeiten ständig mit einem zusammenfassenden Meldungseinstieg, dem<br />
Summary-Lead. Dieser Einstieg stellt <strong>die</strong> Quintessenz der Meldung dar. Dies sollte bei<br />
Hörfunk-<strong>Meldungen</strong> aber nur bei komplizierten Sachverhalten passieren. Ein weiterer<br />
Unterschied zum Summary-Lead der Zeitungsmeldung: Bei einer Rundfunkmeldung<br />
handelt es sich immer nur um einen Summary-Lead-Satz, <strong>die</strong> Zusammenfassung geht<br />
also nie über mehr als den ersten Satz der Meldung hinaus.<br />
Beispiel:<br />
»Ein weiterer Vermittlungs-Versuch im Nord-Irland-Konflikt ist gescheitert. Der irische<br />
Ministerpräsident Reynolds hatte den Politikern des britischen Nord- Irlands angeboten, sich an<br />
der Regierung eines vereinigten Irlands zu beteiligen. Reynolds hatte vorgeschlagen, daß <strong>die</strong><br />
nordirischen Politiker im Falle einer Vereinigung ein Drittel der Kabinettssitze übernehmen<br />
sollten. Die nordirischen Politiker lehnten den Vorschlag Reynolds heute ab.«<br />
Die Funktion eines Summary-Leads kann auch von Inhaltsmarken übernommen werden,<br />
<strong>die</strong> z. B. beim zweiten Programm des NDR vor <strong>die</strong> Meldung gestellt werden. Wie<br />
Zeitungsüberschriften formuliert fassen sie das Ereignis bereits grob zusammen. Dadurch<br />
sind <strong>die</strong> Hörer vorgewarnt und können <strong>die</strong> nachfolgenden Detailinformationen gleich<br />
<strong>die</strong>ser Basisinformation zuordnen.<br />
Bei komplizierten Sachverhalten bietet es sich also an, das Ereignis in einem Satz<br />
zusammenzufassen. Vor allem bei Gerichts- oder Politikerentscheidungen ist oft nicht das<br />
6
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
eigentliche Ereignis das Interessanteste, sondern <strong>die</strong> Auswirkung, <strong>die</strong> Konsequenz. Wenn<br />
das Ereignis selbst nur bei bereits informierten Hörern einen Aha-Effekt auslösen würde,<br />
sollte man <strong>die</strong> Zusammenfassung, <strong>die</strong> Bedeutung des Ereignisses an den Anfang stellen.<br />
Beispiel:<br />
»Der Bundesrat hat heute das Planungsgesetz für <strong>die</strong> Magnetschwebebahn Transrapid in den<br />
Vermittlungsausschuß überwiesen.«<br />
Ein völlig korrekter Lead-Satz - aber, wird sich der Hörer vielleicht fragen, was ist daran<br />
denn so interessant, ist das nicht vielleicht das übliche Verfahren?<br />
Besser:<br />
»Der Bundesrat hat heute dem Planungsgesetz für <strong>die</strong> Magnetschwebebahn Transrapid nicht<br />
zugestimmt.«<br />
Noch hörerfreundlicher - denn unter Planungsgesetz können sich mit Sicherheit viele<br />
Menschen überhaupt nichts vorstellen - wäre <strong>die</strong>se Version:<br />
»Der Bundesrat hat heute dem notwendigen Gesetz zum Bau der Magnetschwebebahn<br />
Transrapid nicht zugestimmt.«<br />
Es ist hilfreich, wenn sich der Redakteur/<strong>die</strong> Redakteurin als Dienstleistungsunternehmen<br />
versteht - als Anbieter eines Informations-Service, den <strong>die</strong> Hörer jederzeit abwählen<br />
können. Sachlich richtige <strong>Meldungen</strong> erwartet der Konsument von jedem Sender, aber mit<br />
dem Bemühen um größtmögliche Verständlichkeit kann sich eine Station auch bei den<br />
Nachrichten positiv von den Konkurrenten absetzen. Gerade bei den sogenannten<br />
Service-<strong>Meldungen</strong>, deren Inhalte für Hörer einen hohen Nutzwert haben, würde es<br />
verärgern, wenn <strong>die</strong> Botschaft nicht glasklar transportiert wird. Diese <strong>Meldungen</strong> haben<br />
den höchsten Aufmerksamkeitsgrad und werden entsprechend kritisch gehört. Das kann<br />
z. B. für komplizierte Gerichtsentscheidungen gelten.<br />
Beispiel:<br />
»Das Oberlandesgericht Hamburg hat heute in einer Revisionsverhandlung <strong>die</strong> Klage eines<br />
Urlaubers abgewiesen, der aufgrund der Lärmbelästigung durch einen nahegelegenen<br />
Flughafen seinen Urlaub vorzeitig abgebrochen und vom Veranstalter Schadensersatz verlangt<br />
hatte.«<br />
Sachlich ist <strong>die</strong>se Meldung richtig - der Kern des Ereignisses wird im Lead-Satz<br />
dargestellt. Aber welcher Hörer ist schon in der speziellen Situation, während des Urlaubs<br />
7
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
ausgerechnet in einer Einflugschneise zu wohnen? Dieser Kern der Meldung würde also<br />
an 99 Prozent der Hörer vorbeigehen. Die Bedeutung <strong>die</strong>ses Urteils dagegen würde einen<br />
weitaus größeren Anteil der Hörer interessieren.<br />
Besser:<br />
»Eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamburg hat <strong>die</strong> Rechte von Urlaubern bei<br />
Schadenseratz-Forderungen eingeschränkt. Das Gericht entschied heute, daß auch bei<br />
erheblicher Lärmbelästigung durch einen Flugplatz nicht unbedingt vom Veranstalter<br />
Schadensersatz gezahlt werden muß.«<br />
Aber aufpassen: Solche Interpretationen müssen selbstverständlich fachlich abgesichert<br />
sein, sei es durch einen schnellen Anruf beim Grundeigentümer- oder Mieterverband, bei<br />
der Gerichtspressestelle oder bei dem juristisch versierten Kollegen, am bestem dem<br />
Gerichtsreporter. Interpretationen dürfen keinesfalls »auf dem eigenen Mist gewachsen«<br />
sein. Ein Lob den Nachrichten-Agenturen: Immer mehr Dienste gehen dazu über, eben<br />
solche Einordnungshilfen und Interpretationen anzubieten. Doch auch hier gilt für <strong>die</strong><br />
bearbeitenden Nachrichten-Redakteure: Solche Hilfen stehen - beim Aufbau der Agentur-<br />
Meldung konsequent - oft im letzten Absatz.<br />
3.5 Langweiliger Lead-Satz<br />
Die Lead-Sätze einer Nachrichten-Sendung haben <strong>die</strong> Funktion der Überschriften in einer<br />
Straßenverkaufszeitung: Wer <strong>die</strong> Überschriften langweilig findet, kauft keine oder eine<br />
andere Zeitung und wer den ersten Satz der jeweiligen Meldung langweilig findet, hört<br />
nicht hin. Bei der kritischen Beurteilung, ob der eben niedergeschriebene Satz interessant<br />
und gut verständlich ist, kann nie von dem eigenen Hörverhalten ausgegangen werden:<br />
Daß Journalisten bemüht sind, eine Nachrichten-Sendung vollständig zu hören, hat wenig<br />
mit dem alltäglichen Hörverhalten ihrer Kunden gemeinsam. Lead-Sätze wie in den<br />
folgenden - authentischen - Beispielen sollten vermieden werden:<br />
Beispiel:<br />
»Der Bundestag hat heute in einer lebhaften Diskussion über Bundeswehreinsätze außerhalb<br />
des Nato-Gebietes diskutiert.«<br />
8
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Allgemeiner und nichtssagender geht es kaum. Nun könnte der Autor argumentieren, <strong>die</strong>s<br />
sei ein Summary-Lead, der das gesamte Ereignis in einem Satz wiedergibt. Deswegen sei<br />
noch einmal daran erinnert: Zusammenfassende Leadsätze haben in Hörfunk-<strong>Meldungen</strong><br />
wirklich nur etwas zu suchen, wenn der eigentliche Kern <strong>die</strong> Quintessenz des Ereignisses<br />
ist und der Kern der Handlung allein nichts über <strong>die</strong> Bedeutung des Ereignisses aussagen<br />
würden.<br />
Die Kriterien für einen Summary-Lead sind bei der Bundeswehr-Debatte nicht erfüllt.<br />
Weder ist das Ereignis besonders kompliziert noch gibt es einen Sachverhalt, dessen<br />
Bedeutung erst durch eine Zusammenfassung ersichtlich würde.<br />
Bei solchen Ereignissen muß schlaglichtartig das wichtigste Detail in den Lead-Satz<br />
gerückt werden, um das Interesse der Hörer zu wekken. Schon in der nächsten Stunde<br />
kann ein anderes wichtiges Detail aus <strong>die</strong>ser Debatte im Lead-Satz stehen.<br />
Besser:<br />
»Außenminister Klaus Kinkel hat der SPD vorgeworfen, in der Frage von Bundeswehreinsätzen<br />
im Ausland völlig zerstritten zu sein. In der Bundestagsdebatte sagte Kinkel heute vormittag ... «<br />
Sicher ist <strong>die</strong>ser Vorwurf nicht neu, aber so erhalten <strong>die</strong> Hörer schon im ersten Satz einen<br />
kleinen Einblick in den Plenarsaal, sie hören, was dort eben von wem gesagt wurde. Ein<br />
Eindruck bildet sich, und mit etwas Mühe kann sogar eine optische Vorstellung entstehen.<br />
Nachrichten können und sollen anschaulich sein.<br />
Auch ein anderer Lead-Satz ist oft zu hören (und in Lokalzeitungen zu lesen), der kaum<br />
Hörer einer Lokal-Station fesseln wird:<br />
Beispiel:<br />
»In Memmingen hat gestern der Gemeinderat getagt. Es ging unter anderem«<br />
Stop - wenigstens einen Beschluß wird <strong>die</strong>ser Gemeinderat doch gefaßt haben. Und wenn<br />
er keinen gefaßt hat, wird es vermutlich interessanter sein, das Warum-nichts-<br />
beschlossen-wurde in den Lead-Satz zu nehmen. Wenn auch das nichts hilft, sollte <strong>die</strong><br />
Meldung in Reichweite des Papierkorbs gerückt werden ...<br />
9
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Der Anfang einer Meldung ist auch langweilig, wenn <strong>die</strong> Hörer gleich zu Beginn von einem<br />
bürokratischen Fachwort erschlagen werden, das niemals auch nur in den Verdacht<br />
geraten könnte, etwas mit der Alltagssprache der Hörer zu tun zu haben.<br />
Beispiel:<br />
»Schwerin. Die Funktionalreform kann in Mecklenburg-Vorpommern wie geplant am 12. Juni in<br />
Kraft treten. Der Landtag verabschiedete heute mit den Stimmen der Koalition einen<br />
entsprechenden Gesetzesentwurf des Innenministeriums. Die erste Funktionalreform in<br />
Ostdeutschland regelt <strong>die</strong> Neuverteilung der Aufgaben zwischen Land, Kommunen und<br />
Gemeinden nach der Landkreisneuordnung. Innenminister Rudi Geil will mit der Reform <strong>die</strong><br />
kommunale Verwaltung straffen und so Geld einsparen. Kernpunkt des Gesetzes ist <strong>die</strong><br />
Übertragung von Aufgaben des Landes an <strong>die</strong> zwölf Landkreise und sechs kreisfreien Städte.«<br />
Welcher Hörer wird gespannt am Lautsprecher sitzen bleiben, um zu erfahren, was sich<br />
hinter einer »Funktionalreform« verbirgt? Zumal <strong>die</strong>se merkwürdige Reform ja erst in zwei<br />
Monaten in Kraft treten soll. Der Verdacht liegt nahe, daß hier direkt von einer Presse-<br />
Mitteilung oder Agentur-Meldung abgeschrieben wurde. Dieses Ereignis wäre ein<br />
klassisches Beispiel für <strong>die</strong> Anwendung des Summary-Leads - was bedeutet <strong>die</strong>se<br />
Reform eigentlich? Dazu würde es reichen, daß unsägliche Wort »Funktional-Reform«<br />
anschaulicher zu umschreiben. So, wie es der Autor im letzten Satz der Meldung getan<br />
hat.<br />
Besser:<br />
»Im Juni werden zahlreiche Aufgaben des Landes an <strong>die</strong> zwölf Landkreise und sechs kreisfreien<br />
Städte übertragen. Die Übertragung <strong>die</strong>ser Aufgaben ist der wichtigste Bestandteil der<br />
sogenannten Funktional-Reform, <strong>die</strong> heute vom Landtag beschlossen wurde.«<br />
Mut zur eigenen Formulierung fehlt manchmal, wenn es um scheinbar schwierige<br />
juristische Vorgänge geht. Doch während bedauerlich wenige Journalisten Hemmungen<br />
haben, aus mutmaßlichen Tätern Täter zu machen, werden heiße Eisen lieber wörtlich<br />
von Presse-Agenturen abgeschrieben. Das Resultat: Die Hörer können sich unter dem<br />
Geschilderten erst etwas vorstellen, wenn sie <strong>die</strong> Meldung in <strong>die</strong> Alltagssprache übersetzt<br />
haben.<br />
Beispiel:<br />
»Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt will auch <strong>die</strong> Gläubigerbanken der im<br />
Konkursverfahren stehenden Schneider-Gruppe in Ermittlungen einbeziehen. Dabei soll geprüft<br />
werden, ob <strong>die</strong> Banken an Betrugshandlungen mitgewirkt haben. Angeblich soll der ... «<br />
10
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Mit 30 Sekunden Nachdenken wäre auch der Redakteur darauf gekommen, was<br />
eigentlich gemeint ist: »in Ermittlungen einbeziehen« heißt: Auch gegen <strong>die</strong><br />
Gläubigerbanken wird ermittelt. Nicht als Hauptverdächtige, aber wenn eine Bank<br />
Bestandteil eines Ermittlungsverfahren wird, heißt das nicht, daß <strong>die</strong> Bank in einer<br />
Zeugen- oder Opferrolle ist. Dies wird spätestens mit dem zweiten Satz deutlich: »... ob<br />
<strong>die</strong> Banken an Betrugsverhandlungen mitgewirkt haben ... «<br />
Besser:<br />
»Die Frankfurter Staatsanwaltschaft prüft, ob Banken im Zusammenhang mit dem Schneider-<br />
Konkurs Betrügereien begangen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft will ... «<br />
Zu plakativ? Zu drastisch? Nein - sachlich völlig richtig und vor allem für jeden beim<br />
ersten Hören zu verstehen. Natürlich folgt unter »weitere wichtige Informationen«, um<br />
welche Banken es sich handelt und eine kurze Erläuterung des Schneider-<br />
Konkursverfahrens.<br />
Oft genug berichten Nachrichten über Ereignisse, deren ganze Handlung aus<br />
»Entschließungen«, »Abstimmungen«, »Empfehlungen«, »Erklärungen« oder<br />
»Gesprächen« besteht. Wenn dann ein Ereignis einmal eine wirklich dramatische,<br />
plastische, greifbare Handlung ist, dann muß das auch so dargestellt werden. Das gilt<br />
besonders, wenn es um ein noch laufendes Ereignis geht, also wenn <strong>die</strong> ganze<br />
Schnelligkeit des Mediums Radio ausgespielt werden kann.<br />
Zu allgemein formulierte Lead-Sätze können jede sachlich begründete »Action«<br />
unkenntlich machen.<br />
Beispiel:<br />
»Die Situation im Gebiet des Alberner Hafens in Wien, wo Umweltschützer <strong>die</strong> Rodung des<br />
Auwaldes im sogenannten Sauhaufen verhindern wollen, hat sich heute zugespitzt. Am frühen<br />
Morgen haben etwa 50 Arbeiter mit vier Schaufelbaggern unter dem Schutz der Polizei mit einer<br />
großangelegten Holzschlägerunsaktion begonnen. Eine Gruppe von Umweltschützern<br />
versuchte sie daran zu hindern. Sie haben sich vor Lastfahrzeuge gelegt und sind auf Bäume<br />
geklettert. Die Polizei hat mehrere Personen festgenommen. Das gesamte Gebiet des<br />
Sauhaufens ist von Polizisten abgeriegelt. Die Wiener Hafengesellschaft beansprucht das<br />
Gebiet als Schüttgutdeponie.« (Beispiel aus: Benedikt, 1987)<br />
Erst im vierten Satz erfährt der Hörer, was jetzt passiert: Umweltschützer blockieren<br />
Lastwagen und sitzen demonstrierend auf Bäumen. Darunter kann sich der Hörer etwas<br />
vorstellen, das macht Appetit auf den Rest der Meldung - aber nicht <strong>die</strong> farb- und saftlose<br />
11
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Zuspitzung« im Original-Lead-Satz. Dieses Ereignis ist auch nicht so kompliziert, daß es<br />
eines erläuternden, zusammenfassenden Lead-Satzes bedarf. Doch in <strong>die</strong>ser Meldung<br />
stecken abgesehen von dem falschen Aufbau noch weitere Fehler:<br />
1. Ein Grazer oder Innsbrucker wird sich nicht dafür interessieren, daß das besagte<br />
Auwäldchen den Namen »Sauhaufen« trägt überflüssiger Ballast.<br />
2. »etwa 50 Arbeiter« - eine unwichtige und unpräzise Zahlenangabe, auch <strong>die</strong><br />
Anzahl der Schaufelbagger ist unerheblich.<br />
3. »Holzschlägerungsaktion« - Nominalstil, zuhörerfeindlich (warum nicht einfach: ...<br />
beginnen Bäume zu fällen ... )<br />
<strong>4.</strong> »großangelegt« - im waldreichen Österreich dürfte <strong>die</strong>s nicht unbedingt eine<br />
»großangelegte« Rodung sein, für Wien möglicherweise schon - warum darf der Hörer<br />
nicht selbst anhand der <strong>Meldungen</strong> beurteilen, ob es aus seiner Sicht eine kleine, große<br />
oder mittlere »Aktion« ist. Überflüssiges Adjektiv.<br />
5. »beansprucht das Gebiet als Schüttgutdeponie« - blutleeres Verb, zudem<br />
irreführend: »beansprucht als« würde wörtlich genommen bedeuten, daß <strong>die</strong>se Deponie<br />
auf <strong>die</strong>sem Gelände bereits existiert. Da aber <strong>die</strong> Rodungsarbeiten erst begonnen<br />
haben, ist anzunehmen, daß <strong>die</strong> Deponie erst entstehen soll.<br />
Doch am wichtigsten wäre es gewesen, <strong>die</strong>se Meldung spannender (und richtiger)<br />
aufzubauen.<br />
Besser:<br />
»Umweltschützer blockieren im Alberner<br />
Hafen von Wien <strong>die</strong> Rodung eines<br />
Auwaldes. Die Demonstranten haben<br />
sich vor Lastwagen gelegt und sind auf<br />
<strong>die</strong> Bäume geklettert, <strong>die</strong> gefällt werden<br />
sollen. Inzwischen hat <strong>die</strong> Polizei das<br />
gesamte Gelände abgeriegelt und erste<br />
Demonstranten festgenommen<br />
Heute morgen hatten etwa 50 Arbeiter<br />
mit Beginn des Schaufelbaggern<br />
begonnen, <strong>die</strong> ersten Ereignisses Bäume<br />
zu fällen<br />
Kern des Ereignisses<br />
Aktualität<br />
Weitere wichtige Informationen<br />
Beginn des Ereignisses<br />
12
Die Wiener Hafengesellschaft will auf<br />
dem Waldgebiet eine Deponie für<br />
Schüttgut errichten.«<br />
Hintergrund<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
In derselben Nachrichten-Sendung des Österreichischen Rundfunks wird eine andere<br />
Meldung ebenfalls mit einem zusammenfassenden, erläuternden Lead-Satz aufgemacht.<br />
Diesmal ist <strong>die</strong>se Zusammenfassung inhaltlich auch gerechtfertigt, aber der gute Ansatz<br />
erstickt in umständlichen Satzkontruktionen:<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
»Tunesien. Die nach der drastischen Erhöhung der Brotpreise ausgebrochenen schweren<br />
Unruhen bedrohen nach Ansicht von Diplomaten den vor kurzem von der Regierung<br />
eingeleiteten Liberalisierungsprozeß. ... «<br />
»Tunesien. Die gerade eingeleiteten liberalen Reformen werden nach Ansicht von Diplomaten<br />
von den Unruhen im Land bedroht. Die Unruhen waren ausgebrochen, nachdem <strong>die</strong> Regierung<br />
<strong>die</strong> Brotpreise drastisch erhöht hatte. ...«<br />
Es muß nicht - wie in der Original-Meldung - betont werden, daß <strong>die</strong> Reformen von der<br />
Regierung eingeleitet worden sind, dafür kommt keine andere Institution in Frage. Der<br />
verhängnisvolle Griff zum Adjektiv »schwere« ist auch in <strong>die</strong>ser Meldung ungebrochen.<br />
Der Lead-Satz sollte ein einfacher Hauptsatz sein, der nicht mit Informationen<br />
überladen ist, sondern nur den Kern der Meldung enthält. Ein einfacher Nebensatz<br />
ist erlaubt.<br />
3.6 Zeitwahl<br />
Für alle Sätze, <strong>die</strong> nach dem Lead-Satz folgen, gilt natürlich nicht, daß sie schlichte und<br />
einfache Hauptsätze sein sollten. Eine Meldung, <strong>die</strong> aus fast gleich langen Sätzen ohne<br />
Nebensätzen besteht, wäre für <strong>die</strong> Hörer unerträglich, weil sie nicht unserem normalen<br />
Hör- und Sprachverhalten entspräche. So wird <strong>die</strong> gut geschriebene Nachrichten-Meldung<br />
13
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
immer unterschiedlich lange Sätze haben und auch zwischen einfachen Hauptsätzen und<br />
Nebensatz-Konstruktionen abwechseln.<br />
Wollte man versuchen, <strong>die</strong>s auf eine Formel zu bringen, müßte <strong>die</strong>se etwa so lauten<br />
(»Klemmkonstruktion«):<br />
Lead-Satz = Hauptsatz (im Notfall mit Nebensatz)<br />
Meldungs-Satz = Hauptsatz<br />
Meldungs-Satz = Hauptsatz + Nebensatz<br />
Meldungs-Satz = Hauptsatz + Nebensatz + Hauptsatz<br />
Ein Großteil aller deutschen Nachrichten-Leadsätze enthält ein »hat«: Der<br />
Bundesgerichtshof hat entschieden, <strong>die</strong> Bundesanstalt für Arbeit hat heute <strong>die</strong> neueste<br />
Statistik bekanntgegeben und der FC. St. Pauli hat heute wieder verloren - alles Lead-<br />
Sätze, <strong>die</strong> im Perfekt geschrieben sind. Das Perfekt kann getrost benutzt werden, um all<br />
<strong>die</strong> Vorgänge zu schildern, <strong>die</strong> zwar abgeschlossen sind, aber deren Bedeutung oder<br />
Auswirkung noch anhält. Denn <strong>die</strong> Schilderung <strong>die</strong>ser Ereignisse im Imperfekt würde von<br />
der Alltagssprache weit weg führen: »Ich arbeitete heute sehr viel« ist gekünstelt, »ich<br />
habe heute viel gearbeitet« entspricht dagegen dem normalen Sprachgebrauch.<br />
Gebraucht wird das Imperfekt dagegen, wenn ein tatsächlich abgeschlossenes Ereignis<br />
von dem Ereignis unterschieden werden soll, das noch Auswirkungen in <strong>die</strong> Gegenwart<br />
hinein hat. Also:<br />
»Der FC St. Pauli hat heute wieder verloren. Die Dresdner Mannschaft erzielte bereits in der<br />
ersten Minute den Führungstreffer gegen <strong>die</strong> Hamburger.«<br />
Gerade am Ende der <strong>Meldungen</strong> wird dann oft noch ein weiterer Schritt in <strong>die</strong><br />
Vergangenheit notwendig: Wenn es darum geht, den Sachverhalt »hochaufzulösen«, also<br />
Hintergründe und Zusammenhänge darzustellen. Dann kommt das Plusquamperfekt zum<br />
Einsatz:<br />
»Der FC St. Pauli hat heute wieder verloren. Die Dresdner Mannschaft erzielte bereits in der<br />
ersten Minute den Führungstreffer gegen <strong>die</strong> Hamburger. Der Trainer der Sankt Paulianer hatte<br />
bereits vor dem Spiel gesagt, daß er von seinem Amt zurücktreten werde.«<br />
Auch <strong>die</strong> Verwendung von Gegenwarts- und Zukunftsform dürften unproblematisch sein.<br />
Die Zukunftsform (Futur) gehört allerdings zu den nicht häufig benutzten Formen in der<br />
14
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Nachrichten-Sprache, auch für erst noch erwartete Ereignisse wird normalerweise <strong>die</strong><br />
einfachere und übersichtlichere Gegenwartsform benutzt.<br />
»Der FC St.Pauli spielt heute nachmittag gegen <strong>die</strong> Mannschaft aus Dresden.«<br />
anstelle von:<br />
»Der FC St.Pauli wird heute nachmittag gegen <strong>die</strong> Mannschaft aus Dresden spielen.«<br />
Die Verwendung der Gegenwartsform verhindert hier, daß das Verb in zwei Hälften<br />
zerrissen wird.<br />
3.7 Schachtelsatz und Klemmkonstruktion<br />
Beide Begriffe stehen für eine Krankheit, <strong>die</strong> Nachrichten-Sätze zu verschwommenen,<br />
orientierungslosen Ungetümen macht, <strong>die</strong> von niemanden mehr so richtig verstanden<br />
werden, den Journalisten aber <strong>die</strong> Arbeit erspart, um <strong>die</strong> verständlichste Formulierung zu<br />
ringen.<br />
Zur Erinnerung: Die Nachrichtensprache muß der Alltagssprache möglichst ähnlich sein.<br />
All das, was von unseren Hörern subjektiv als gestelzt oder geschraubt empfunden wird,<br />
ist verboten. Wenn ein Satz nicht klar strukturiert wird, haben <strong>die</strong> Hörer Probleme, den<br />
Inhalt aufzunehmen. Unter dem einprägsamen Begriff Klemmkonstruktion läßt sich alles<br />
zusammenfassen, was den Handlungsstrang im Satz unterbricht und damit das<br />
Verständnis erschwert - also eingeschobene Nebensätze oder grammatikalisch korrekte,<br />
aber hörerunfreundliche Konstruktionen. Eine Mixtur aus Hauptsatz-Teilen, Nebensätzen<br />
und Rückbezügen ist auch mit dem Begriff Schachtelsatz zutreffend beschrieben.<br />
Führe den Hörer klar und geradlinig durch <strong>die</strong> Meldung - so verlangt es <strong>die</strong> BBC von ihren<br />
Nachrichtenschreibern. Schon lange vor der BBC fluchte Arthur Schopenhauer über <strong>die</strong><br />
redaktionelle Unverschämtheit der Schachtelsätze:<br />
»Wenn es eine Impertinenz ist, andere zu unterbrechen, so ist es nicht minder eine solche, sich<br />
selbst zu unterbrechen.«<br />
15
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Daß ein »eingeklemmter« Nebensatz nicht <strong>die</strong> wünschenswerte Gradlinigkeit eines<br />
Satzes im Sinne Schopenhauers fördert ist leicht einzusehen. Schon ein angehängter<br />
Nebensatz läßt aus dem Satz einen Schachtelsatz werden, der allerdings nicht<br />
zwangsläufig unverständlich sein muß. Wenn <strong>die</strong> Hauptsache im Hauptsatz, der eher<br />
nebensächliche Aspekt im Nebensatz steht, können <strong>die</strong> Hörer meistens problemlos<br />
folgen. Aber wer würde z. B. seinem Arbeitskollegen so über einen gerade gesehenen<br />
Verkehrsunfall berichten:<br />
»Der Lastwagen, der offenbar mehrere schwere Stahlträger und Zementsäcke geladen hatte,<br />
fuhr direkt in <strong>die</strong> Seite des Taxis.«<br />
Der Arbeitskollege möchte natürlich zunächst erfahren, wie der Unfall passierte - <strong>die</strong><br />
andere Information mitten im Satz lenkt ab und unterbricht <strong>die</strong> Schilderung eines<br />
Ereignisses. Eingeschobene Nebensätze verringern im Gegensatz zu einfachen<br />
Satzkonstruktionen mit angehängten Nebensätzen <strong>die</strong> Verständlichkeit. Es heißt also<br />
korrekt:<br />
»Der Lastwagen hatte Vorfahrt und fuhr direkt in <strong>die</strong> Seite des Taxis. Der Lastwagen hatte<br />
offenbar Zementsäcke geladen.«<br />
Noch geht es um <strong>die</strong> leichteste Form des Regelverstoßes - um den eingeschobenen<br />
Nebensatz. Dieser Verstoß - also <strong>die</strong> vorsätzliche oder unbeabsichtigte Konstruktion<br />
eines Schachtelsatzes - ist beim sorgfältigen Durchlesen der Meldung schnell<br />
auszubügeln.<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
oder:<br />
»Morgen werden <strong>die</strong> fünften Leipziger Juristentage eröffnet. Rund 450 Teilnehmer, vor allem<br />
Experten zu Eigentumsfragen in Ostdeutschland, werden erwartet. Themen sind Probleme der<br />
kommunalen Wohnungswirtschaft und <strong>die</strong> neuen Regelungen zur Nutzung von<br />
Wohngrundstücken.«<br />
»Morgen werden <strong>die</strong> fünften Leipziger Juristentage eröffnet.Viele der erwarteten 450 Teilnehmer<br />
sind Experten für Eigentumsfragen in Ostdeutschland.«<br />
»Morgen werden <strong>die</strong> fünften Leipziger Juristentage eröffnet. Rund 450 Teilnehmer werden<br />
erwartet, darunter werden vor allem Experten für Eigentumsfragen in Ostdeutschland sein.«<br />
16
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Die Sünde aus dem obigen Beispiel gehört noch zu den kleinen je mehr Worte den roten<br />
Faden im Satz unterbrechen, desto größer wird <strong>die</strong> Gefahr, daß <strong>die</strong> Hörer eben <strong>die</strong>sen<br />
verlieren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn das zentrale Verb brutal zweigeteilt wird.<br />
Dazu kommt es fast zwangsläufig, wenn ein Nebensatz mitten in den Hauptsatz<br />
eingebaut wird. In den bisherigen Beispielen war zwar der Hauptsatz unterbrochen<br />
worden, aber das Verb blieb intakt.<br />
3.8 Zerrissene Verben<br />
Einer der über <strong>die</strong>se sehr deutsche Erscheinung stolperten, war Mark Twain. Er schrieb in<br />
»Bummel durch Europa« (1990, S. 459):<br />
»Im Deutschen hat man <strong>die</strong> Angewohnheit, <strong>die</strong> Verben auseinanderzusetzen und zu zerreißen.<br />
Man stellt <strong>die</strong> eine Hälfte an den Anfang irgendeines aufregenden Satzbaus und <strong>die</strong> zweite<br />
Hälfte ans Ende. Etwas Verwirrenderes kann man sich nicht vorstellen.«<br />
Wer mit zerrissenen Verben operiert, der erwartet von den Zuhörern, daß sie sich den<br />
ersten Teil des Verbes gut merken - denn sonst können sie den entscheidenden zweiten<br />
Teil des Verbes und damit <strong>die</strong> Satzaussage nicht verstehen. Ein Hilfsverb allein ist<br />
schließlich nicht in der Lage, den Satzinhalt zu transportieren.<br />
Beispiel:<br />
»Rußlands Präsident Jelzin hat <strong>die</strong> bosnischen Serben zum Abzug aus Gorazde aufgefordert. ...<br />
«<br />
Bei <strong>die</strong>sem Satz sind <strong>die</strong> Hörer noch nicht unbedingt überfordert aber schon haben sich<br />
acht Wörter zwischen dem ersten und den zweiten Teil des Verbes gedrängt. Doch in<br />
<strong>die</strong>sem Fall ist der Verstoß noch nicht so schwerwiegend, weil bereits nach dem ersten<br />
Teil des Satzes erkannt wird, welches Verb folgen muß. Niemand wird vermuten, daß<br />
Präsident Jelzin <strong>die</strong> bosnischen Serben zum Abzug eingeladen oder beglückwunscht hat.<br />
Trotzdem wäre <strong>die</strong> folgende Variante noch übersichtlicher:<br />
Besser:<br />
»Rußlands Präsident Jelzin hat <strong>die</strong> bosnischen Serben aufgefordert, aus Gorazde abzuziehen.«<br />
17
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Ein Nachrichten-Satz darf keine Rätsel aufgeben - das passiert aber, wenn das<br />
Schlüsselwort - das Verb - erst am Satzende steht, quasi als Auflösung des bereits<br />
Geschilderten.<br />
Beispiel:<br />
»Der Berliner Marathonläufer Gerd Schmidt ist heute nachmittag nach seiner Rückkehr aus New<br />
York von mehreren Tausend begeisterten Fans auf dem Flughafen Tempelhof ... «<br />
... und jetzt folgt erst der alles verständlich machende zweite Teil des Verbes, auf den der<br />
Hörer schon solange warten mußte. Den ganzen Satz über war alles möglich: Schmidt<br />
kann zusammengebrochen, erschossen worden, geehrt worden oder eingeschlafen sein.<br />
Besser:<br />
»Der Berliner Marathonläufer Gerd Schmidt ist heute nachmittag geehrt worden. Tausende<br />
begeisterter Fans hatten den Läufer bei seiner Rückkehr aus New York auf dem Flughafen<br />
Tempelhof empfangen., «<br />
Gerade bei Aufzählungen wird oft vergessen, daß <strong>die</strong> Hörer noch gar nicht wissen<br />
können, um was es eigentlich geht.<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
»Die acht Richter wollen unter anderem über <strong>die</strong> verfassungsrechtliche Bedeutung des Begriffs<br />
>VerteidigungVerteidigung<<br />
verfassungsrechtlich bedeutet und welche Stellung <strong>die</strong>ser Begriff im Völkerrecht hat. Bei der<br />
Verhandlung wird es auch um <strong>die</strong> Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Streitkräften gehen. «<br />
Zwar bleibt <strong>die</strong>se Meldung aufgrund des komplizierten Themas weiterhin schwer greifbar,<br />
aber <strong>die</strong> Entzerrung ermöglicht es, mehr von <strong>die</strong>sem Ereignis aufzunehmen als in der<br />
Originalfassung. In <strong>die</strong>ser hätten <strong>die</strong> Hörer bis zum letzten Wort des Satzes damit<br />
rechnen müssen, daß <strong>die</strong> Richter nicht etwa »verhandeln« wollen, sondern vielleicht<br />
bereits entscheiden.<br />
18
Der unnötig, eingeschobene Nebensatz und das zerrissene Verb sind<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Formulierungsfehler, <strong>die</strong> das Verstehen von <strong>Meldungen</strong> unnötig erschweren.<br />
Während der Lead-Satz nach Möglichkeit immer ein einfacher Hauptsatz ist, können<br />
sich <strong>die</strong> anderen Sätze der Meldung aus Haupt- und Nebensatz zusammensetzen.<br />
Satzlängen und Satzbau; sollten variieren, um <strong>die</strong> Meldung lebendig zu machen.<br />
Hauptsätze mit eingeschobenen Nebensätzen (»Schachtelsätze«) sind in den<br />
Nachrichten-<strong>Meldungen</strong> nicht erlaubt, Hauptsätze mit angehängten Nebensätzen<br />
dagegen tragen zur Abwechslung im Sprachfluß bei und ermöglichen es, das Verb<br />
zu Beginn des Satzes einzuführen und nicht erst am Ende.<br />
3.9 Partizipialkonstruktionen<br />
Klar und übersichtlich wird <strong>die</strong> Satzaussage präsentiert - bei einer Partizipialkonstruktion<br />
passiert genau das Gegenteil. Die Hörer werden mit brachialer Gewalt vom<br />
Satzgegenstand vertrieben und schaffen es nur mit großer Konzentration, dem Satz<br />
weiter zu folgen.<br />
Die ständige Gefährdung unbescholtener Nachrichten-Redakteure durch überall lauernde<br />
Partizipialkonstruktionen ist besonders dramatisch, weil <strong>die</strong>se Konstrukte durchaus <strong>die</strong><br />
Form eines Hauptsatzes haben können. Kein Nebensatz ist erforderlich, um mit Hilfe<br />
einer Partizipialkonstruktion einen Hauptsatz zu basteln, der viel unverständlicher ist als<br />
es selbst ein Satz mit ein oder sogar zwei eingeklemmten Nebensätzen je sein könnte.<br />
Merke: Ein Hauptsatz allein macht noch lange keinen guten Nachrichten-Satz. Von der<br />
Theorie in <strong>die</strong> Praxis:<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
»Der durch <strong>die</strong> dem NATO-Rat unterstehende Eingreiftruppe in Bedrängnis geratene<br />
Generalsekretär wird morgen dem nach seinen eigenen Worten von der Entscheidung<br />
überraschten US-Verteidigungsminister seinen Rücktritt erklären.«<br />
19
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Der Generalsekretär wird morgen dem US-Verteidigungsminister seinen Rücktritt erklären. Der<br />
US-Verteidigungsminister ist nach seinen eigenen Worten von <strong>die</strong>ser Entscheidung überrascht.<br />
Der Generalsekretär war durch <strong>die</strong> Eingreiftruppe in Bedrängnis geraten, <strong>die</strong> dem NATO-Rat<br />
untersteht.«<br />
Es gibt in der Nachrichten-Sprache keinen Grund, Partizipialkonstruktionen zu verwenden.<br />
Sie erschweren den Hörern, <strong>die</strong> Meldung zu verstehen - und weniger Zeit beim<br />
Präsentieren als normale, klar strukturierte Sätze nehmen sie auch nicht in Anspruch. Es<br />
gibt noch ein weiteres gewichtiges Argument <strong>die</strong>sen Konstruktionen den Kampf<br />
anzusagen: Die Gefahr ist groß, daß der Präsentierende selbst den roten Faden verliert<br />
und ins Stocken gerät.<br />
Partizipialkonstruktionen können immer durch einen Haupt- mit einem angehängten<br />
Nebensatz ersetzt werden - <strong>die</strong>s macht <strong>die</strong> Meldung verständlicher<br />
.<br />
3.10 Stellung von Subjekt, Prädikat und Objekt<br />
Fast, aber auch nur fast selbstverständlich ist <strong>die</strong> Gliederung eines Satzes: Subjekt vor<br />
Prädikat, Prädikat vor Objekt. Es gibt eine Gelegenheit, <strong>die</strong> viele Redakteure ergreifen,<br />
um <strong>die</strong>se sinnvolle und logische Satzbauweise umzukehren: Die Quellenangabe. Vor<br />
allem bei ARD-Nachrichten-Redaktionen ist <strong>die</strong>s oft zu hören. Eine mögliche Erklärung:<br />
Ein Profi-Sprecher mag es schaffen, ohne in eine hörbare Kunstsprache zu verfallen, den<br />
Satzinhalt - den Kern der Aussage - auch dann noch ausreichend zu betonen, wenn<br />
<strong>die</strong>ser am Anfang des Satzes steht. Dann wird das Subjekt am Satzende eben nur noch<br />
gehaucht gesprochen, schließlich ist es ja auch nicht das Entscheidende. Nur -<br />
normalerweise betonen wir am Satzende. Wenn dort wider Erwarten das Subjekt steht,<br />
muß man sich entgegen der eigenen Sprechgewohnheit bemühen, das Satzende weniger<br />
stark zu betonen als den Anfang.<br />
Beispiel:<br />
»Vor einem Mißbrauch der kommenden Wahlen durch rechtsextreme Parteien und<br />
Splittergruppen hat auf dem Hamburger Parteitag der CDU Fraktionschef Wolfgang Schäuble<br />
gewarnt.«<br />
20
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Die kursiv gedruckten Worte machen ohne Zweifel den zu betonenden Satzinhalt aus, <strong>die</strong><br />
Stimme muß also nach den »Splittergruppen« nach unten gehen. Wenn <strong>die</strong>s nicht<br />
geschieht, wird fast automatisch der »Fraktionschef« über Gebühr betont. Dies wäre<br />
gerechtfertigt, wenn es ganz besonders interessant gewesen wäre, daß Schäuble und<br />
nicht etwa ein anderer CDU-Politiker <strong>die</strong>se Aussage gemacht hat.<br />
Besser:<br />
»CDU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble hat davor gewarnt, daß rechtsextreme Parteien und<br />
Splittergruppen <strong>die</strong> kommenden Wahlen mißbrauchen. Auf dem Hamburger Parteitag der CDU<br />
sagte Schäuble ... «<br />
3.11 Substantivierungen<br />
Bei der Formulierung eines Nachrichten-Satzes ist es immer als Optimierung anzusehen,<br />
wenn <strong>die</strong> Substantivierung eines Verbes einer Umkehrung unterzogen wird und somit eine<br />
Rückführung in <strong>die</strong> ursprüngliche Form erfolgt.<br />
Also: Ein Nachrichten-Satz wird verständlicher formuliert, wenn fälschlicherweise in<br />
Substantive umgewandelte Verben umgekehrt und wieder zu Verben gemacht werden.<br />
Ganz deutlich wird der Sinn <strong>die</strong>ser Regelung, wenn man anstelle des Wortes »Verb« den<br />
deutschen Ausdruck benutzt: »Tätigkeitswort«. Von <strong>die</strong>sen Tätigkeitswörtern kann es in<br />
einer Nachrichten-Meldung nie genug geben. Da Nachrichten über das Geschehen in der<br />
Welt berichten, sollte eine Meldung auch ausdrücken, daß etwas passiert, etwas<br />
geschieht. Das vor allem, wenn Tätigkeitswörter eingesetzt werden.<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
»Das Bundeskabinett will noch in <strong>die</strong>ser Woche eine Entscheidung über <strong>die</strong> Erhöhung der<br />
Mehrwertsteuersätze erreichen.«<br />
»Das Bundeskabinett will noch in <strong>die</strong>ser Woche entscheiden, ob <strong>die</strong> Mehrwertsteuer erhöht<br />
werden soll.«<br />
21
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Selten taucht ein Fehler beim Formulieren von Nachrichten-<strong>Meldungen</strong> allein auf -<br />
meistens handelt es sich um Kettenreaktionen. Der inflationäre Einsatz von Substantiven<br />
verursacht oft, daß das Verb an der falschen Stelle des Satzes steht.<br />
Beispiel:<br />
Besser:<br />
»Die FDP hat eine Festlegung der Bonner Regierungskoalition auf <strong>die</strong> Pläne von<br />
Verteidigungsminister Volker Rühe /CDU zur Verkleinerung der Bundeswehr abgelehnt.«<br />
»Die FDP hat es abgelehnt, sich auf <strong>die</strong> Pläne von Verteidigungsminister Volker Rühe /CDU<br />
festzulegen. Rühe will <strong>die</strong> Bundeswehr verkleinern.«<br />
Nicht jedes Verb ist geeignet, eine Nachrichten-Meldung anschaulicher und lebendiger zu<br />
machen. Auch Verben können nichtssagend sein, vor allem, wenn sie ihren Ursprung in<br />
der Behörden- und Politikersprache haben:<br />
»erreichen, anstreben, erwägen, befinden, unterstreichen, erklären ... «<br />
Das Lieblingsverb aller Politiker ist sicher »erklären«. Können Sie sich daran erinnern,<br />
wann das letzte Mal ein Politiker an seine Rede erinnerte, ohne <strong>die</strong> Wendung »wie ich<br />
bereits erklärte« zu benutzen?<br />
Dieses »erklären« ist ein unsinniges Verb mit Blähfunktion - etwas soll sich bedeutender<br />
anhören als es eigentlich war. Denn in Wirklichkeit erklären Politiker höchst selten etwas;<br />
genau wie ganz normale Menschen »sagen« sie meistens etwas mehr oder weniger<br />
Intelligentes. Wenn der Bürgermeister zu einer Kritik etwas sagt, dann erklärt er nicht, daß<br />
er mit der Kritik nicht einverstanden ist, sondern er sagt es. Wenn der Bürgermeister aber<br />
für den Bau einer teuren Sporthalle eintritt, dann erklärt er hoffentlich auch in der<br />
Ratssitzung, woher das Geld dafür kommen soll.<br />
3.12 Aktiv und Passiv<br />
Die Nachricht wurde von den Redakteuren verbreitet - passiv. Die Redakteure<br />
verbreiteten <strong>die</strong> Nachricht - aktiv.<br />
22
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Einsichtig und logisch - <strong>die</strong> Aktiv-Form belebt, <strong>die</strong> Meldung bekommt, um es neudeutsch<br />
auszudrücken, mehr »drive«. Mit der Verwendung des Passivs sinkt <strong>die</strong> Verständlichkeit,<br />
<strong>die</strong>s haben Sprachwissenschaftler nachgewiesen. Wenn also <strong>die</strong> nächste Meldung eines<br />
Handtaschen-Diebstahles von der Presse-Stelle der Polizei kommt, heißt es nicht mehr:<br />
Besser:<br />
»Der Frau wurde ihre Handtasche von unbekannten Tätern entrissen.«<br />
»Unbekannte Täter entrissen der Frau ihre Handtasche.«<br />
Abgesehen davon, daß Passiv-Konstruktionen ungeeignet sind, Handlungen darzustellen,<br />
führen sie auch zu den kritisierten Satz-Klammern.<br />
Besser:<br />
»Durch Wirbelstürme im Mittleren Westen der USA sind im vergangenen Jahr Schäden in Höhe<br />
von rund zwei Milliarden Mark angerichtet worden.«<br />
»Wirbelstürrne haben im Mittleren Westen der USA im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von<br />
zwei Milliarden Mark angerichtet.«<br />
Auch wenn sprachwissenschaftlich unumstritten ist, daß Passiv-Konstruktionen Hörfunk-<br />
<strong>Meldungen</strong> unverständlicher machen, bestätigen Ausnahmen <strong>die</strong> Regel. In bestimmten<br />
Fällen wäre es irreführend, den Satz im Aktiv zu formulieren.<br />
Beispiel:<br />
»Ein Reaktorblock im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl hat sich nach einem Störfall<br />
abgeschaltet. Die Sicherheitsautomatik stoppte das Anfahren des Reaktors, weil im Kühlsystem<br />
zuwenig Wasser war. «<br />
Nun wird sich <strong>die</strong>ser Reaktorblock nicht verstört am Kinn gekratzt haben, um dann<br />
kurzentschlossen den eigenen Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Selbst wenn<br />
Technik-Freaks anführen, daß es in einem Reaktorblock sehr wohl einen<br />
»vollautomatischen Abschaltmechanismus« gibt ist <strong>die</strong>ser Reaktorblock nur mittelbar <strong>die</strong><br />
ausführende »Person« - er kann keine aktive Rolle spielen. Eine solche »Handlung« muß<br />
im Passiv formuliert werden.<br />
Besser:<br />
»Im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist ein Reaktorblock nach einem Störfall<br />
abgeschaltet worden. Die Sicherheitsautomatik stoppte das Anfahren des Reaktors, weil im<br />
Kühlsystem zu wenig Wasser war.«<br />
23
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Der in der Original-Meldung folgende zweite Satz kann dagegen im Aktiv bleiben, denn<br />
nun ist bereits klar, daß ein technischer Vorgang in Gang gesetzt wurde. Damit ist <strong>die</strong><br />
aktive Rolle, <strong>die</strong> der »Sicherheitsautomatik« im zweiten Satz zugestanden wird, inhaltlich<br />
richtig einzuordnen. Stünde <strong>die</strong>ser zweite Satz isoliert in der Meldung, hätte auch er im<br />
Passiv formuliert werden müssen:<br />
»Das Anfahren des Reaktors wurde von der Sicherheitsautomatik gestoppt weil im Kühlsystem<br />
zu wenig Wasser war.«<br />
Nicht immer steht <strong>die</strong> aktive Person gleichzeitig für den Sinnkern des Satzes - auch dann<br />
ist es angebracht im Passiv zu formulieren. Der falsch eingesetzte Aktiv:<br />
»Dr. X. operierte heute nachmittag den Papst am Bein.«<br />
Ohne Zweifel ist es in <strong>die</strong>sem Fall wichtiger, den Akzent auf <strong>die</strong> passive Haltung des<br />
Papstes zu legen:<br />
»Der Papst wurde heute (von Dr. X.) am Bein operiert.«<br />
3.13 Wortgleiche Wiederholungen<br />
Was in der Reportage oder dem Feature erlaubt und manchmal sogar sinnvoll ist ist in<br />
den Nachrichten tabu: Die Synonym-Suche. In einer Nachrichten-Meldung kann vor allem<br />
der zentrale Begriff nicht beliebig ausgetauscht werden. Auch <strong>die</strong>se Regel ist dadurch<br />
begründet, daß Hörer in den seltensten Fällen Radionachrichten mit einem Höchstmaß an<br />
Konzentration verfolgen (können). Hören sie nun den Lead-Satz, gießen sich während<br />
des zweiten Satzes aber einen frischen Kaffee ein und hören erst beim dritten Satz wieder<br />
zu, müssen sie dort erneut auf den »zentralen Begriff« stoßen. Dies gilt natürlich ganz<br />
besonders bei schwierigen Sachverhalten.<br />
Beispiel:<br />
»Erst gegen Ende des Jahres wird der Landkreis Garmisch- Partenkirchen über eine mögliche<br />
Privatisierung des Kreiskrankenhauses entscheiden. Doch schon jetzt macht Landrat Helmut<br />
Fischer den 935 Beschäftigten <strong>die</strong> Zusage, daß sich keinerlei Nachteile durch eine veränderte<br />
Rechtsform für sie ergeben wird. Für den Landkreis steht dennoch <strong>die</strong> Wirtschaftlichkeit des<br />
Kreiskrankenhauses im Vordergrund. «<br />
24
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Viele Hörer werden in der Kürze der Zeit Schwierigkeiten haben, sich den Begriff<br />
»Privatisierung« klar zu machen. Zwar ist <strong>die</strong>ses Wort durch <strong>die</strong> Treuhandanstalt in den<br />
vergangenen Jahren relativ populär gemacht worden, trotzdem ist es von unserer<br />
Alltagssprache noch weit entfernt. Doch nun kommt eine unüberwindbare Hürde: Es<br />
gehört schon Phantasie dazu, zu entdecken, daß sich hinter der »veränderten<br />
Rechtsform« im dritten <strong>die</strong> »Privatisierung« des ersten Satzes verbirgt. Eine »veränderte<br />
Rechtsform« ist für viele Hörer überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, der Autor hätte sich<br />
also zumindest für den zentralen Begriff »Privatisierung« entscheiden müssen. Auch<br />
wenn man bei dem Begriff »Privatisierung« bleiben möchte, könnte man <strong>die</strong> Meldung<br />
verständlicher formulieren.<br />
Besser:<br />
»Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird erst Endes des Jahres darüber entscheiden, ob<br />
das Kreiskrankenhaus privatisiert wird. Landrat Helmut Fischer machte den fast 1000<br />
Beschäftigten <strong>die</strong> Zusage, daß es für sie bei einer Privatisierung keine Nachteile geben würde.«<br />
Noch besser:<br />
»Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird Ende des Jahres darüber entscheiden, ob das<br />
Kreiskrankenkaus in Privatbesitz übergehen soll. Landrat Helmut Fischer versprach den fast<br />
1000 Beschäftigten, daß durch eine solche Entscheidung keine Nachteile für sie entstehen<br />
würden.«<br />
Die Wortwiederholung (Redundanz) macht vieles erst verständlich.<br />
Also nicht:<br />
Sondern:<br />
»Der Elefant trampelte in der Fußgängerzone drei Menschen zu Boden. Anschließend zog der<br />
Dickhäuter weiter.«<br />
»Der Elefant trampelte in der Fußgängerzone drei Menschen zu Boden. Anschließend zog der<br />
Elefant weiter.«<br />
Ebenfalls beliebt:<br />
Ägypten - das Nilland<br />
Köln - <strong>die</strong> Rheinstadt<br />
Bundesrat - <strong>die</strong> Länderkammer<br />
25
Beim zentralen Begriff bleiben, heißt auch, das Substantiv nicht durch ein<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Personalpronomen zu ersetzen. Die Personalpronomen (er, sie, es), sollten nur anstelle<br />
der Person oder des konkret benannten Substantives treten, wenn keine<br />
Verständnisschwierigkeiten zu befürchten sind.<br />
Beispiel:<br />
»Das erste Aachener Kompostwerk soll jetzt doch in Fletschau entstehen. Die rot-grüne<br />
Ratsmehrheit hat sich beim gestrigen Umweltausschuß für <strong>die</strong> Variante A entschieden. Sie sieht<br />
... «<br />
STOP - wie könnte der Satz weitergehen?<br />
Vielleicht:<br />
oder:<br />
» ... keine Schwierigkeiten, den Ratsbeschluß umzusetzen.«<br />
» ... vor, daß das Kompostwerk kleiner als geplant wird.«<br />
Auflösung:<br />
Besser:<br />
»Das erste Aachener Kompostwerk soll jetzt doch in Fletschau entstehen. Die rot-grüne<br />
Ratsmehrheit hat sich beim gestrigen Umweltausschuß für <strong>die</strong> Variante A entschieden. Sie sieht<br />
ein Kornpostwerk in Fletschau sowie Kompostanlagen in Brandt und in der Sörs vor.<br />
Voraussetzung für den Beschluß ist jedoch, daß <strong>die</strong> Anlage ausschließlich über einen<br />
Autobahnanschluß angefahren wird.<br />
»Das erste Aachener Kompostwerk soll jetzt doch in Fletschau entstehen. Die rot-grüne<br />
Ratsmehrheit hat sich beim gestrigen Umweltausschuß für <strong>die</strong> sogenannte Variante A<br />
entschieden. Die Variante A sieht ein Kompostwerk ... «<br />
Stellen Sie sich im nächsten Beispiel einmal vor, der Hörer würde im zweiten Satz bei<br />
dem zusammengesetzten Hauptwort »Spielzeug-LKW« den ersten Teil des Wortes nicht<br />
verstanden haben.<br />
Beispiel:<br />
»Gestern abend gegen 19 Uhr geriet in Mainertshagen auf der Birkershöhestraße ein<br />
vierjähriger Junge unter ein Auto. Er kam mit seinem Spielzeug-LKW aus dem abschüssigen<br />
Drosselweg auf <strong>die</strong> Straße gerollt. Der Vierjährige wurde vom Hinterrad des PKW überfahren<br />
und schwer verletzt.«<br />
26
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Wenn <strong>die</strong> Hörer nicht erfassen, daß ein Spielzeug-LKW auf <strong>die</strong> Straße gerollt kam,<br />
sondern nur »LKW« verstehen, ist <strong>die</strong> Verwirrung komplett. Denn bei »Er ... « hätten <strong>die</strong><br />
Hörer davon ausgehen müssen, daß der Autofahrer gemeint ist, der den Jungen<br />
angefahren hat.<br />
Auch hier wurde ein überflüssiges und verwirrendes Personalpronomen benutzt.<br />
Abgesehen davon, daß <strong>die</strong> Meldung falsch aufgebaut ist, hätte es heißen müssen:<br />
»Der Vierjährige (oder zumindest Der Junge) kam mit seinem Spielzeug-LKW ... «<br />
3.14 Direkte und indirekte Rede<br />
Da selten über das Handeln von Politikern berichtet werden kann, informieren <strong>die</strong> meisten<br />
Nachrichten-Sendungen ihre Hörer über das, was <strong>die</strong> Politiker gesagt haben. Wenn der<br />
Politiker <strong>die</strong>s nicht gegenüber dem Sender oder auf einer Pressekonferenz gesagt hat,<br />
liegt auch kein O-Ton vor: Wir müssen also zitieren. Dazu wird der Konjunktiv der<br />
indirekten Rede benötigt: Der Konjunktiv 1. Obwohl der Konjunktiv I schon immer <strong>die</strong><br />
unverzichtbare grammatikalische Form der Nachrichten-Redakteure war, ist seine<br />
Anwendung in vielen Fällen nicht unumstritten. Ist in der einen Redaktion der Konjunktiv<br />
in bestimmten Fällen zwingend vorgeschrieben, handhaben andere Chefredakteure seine<br />
Anwendung großzügiger. Der Stoßseufzer des Sprachwissenschaftlers Wolfgang Kayser<br />
(Bern 1973, S. 86):<br />
»Ein schwieriges Gebiet der Untersuchung ist der Konjunktiv. In allen Sprachen entzieht er sich<br />
einer letzten Festlegung, und <strong>die</strong> Diskrepanzen zwischen dem, was in der Grammatik fixiert<br />
wird, und dem Gebrauch in den verschiedensten Schichten des sprachlichen Lebens sind<br />
beträchtlich.«<br />
Zunächst <strong>die</strong> unumstrittene Regel für Journalisten: Wenn Aussagen in der indirekten<br />
Rede wiedergegeben werden, kann der Konjunktiv fast immer angewendet werden - er<br />
muß es aber nicht<br />
Ohne Zweifel ist das folgende Beispiel korrekt:<br />
»Der Bürgermeister sagte, er habe keine Möglichkeit gehabt, <strong>die</strong> Versammlung aufzulösen.«<br />
27
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Doch schon folgt der Streitfall. Es wird nämlich nach Auffassung der deutschen<br />
Sprachwissenschaftler immer häufiger so formuliert:<br />
»Der Bürgermeister sagte, er hat keine Möglichkeit gehabt, <strong>die</strong> Versammlung aufzulösen.«<br />
Vorsicht - <strong>die</strong> Sprachberatungsstelle der Duden-Redaktion läßt <strong>die</strong>se Indikativ-Variante<br />
ausdrücklich nur für das Schriftdeutsch zu. Radio-Journalisten müssen also ganz<br />
eindeutig bei der ersten Variante (»er habe keine Möglichkeit gehabt«) bleiben.<br />
Eine wiedergegebene, also indirekte Rede, <strong>die</strong> im Indikativ steht ist trotzdem immer öfter<br />
im Radio zu hören. Das ist schlicht falsch, weil allein aus der Pronominaltransformation<br />
nicht eindeutig genug hervorgeht, daß es sich um eine zitierte Aussage handelt. Die<br />
Transformation im zweiten Beispiel, also <strong>die</strong> Veränderung des »Bürgermeisters« in ein<br />
schlichtes »er«, macht nicht hinreichend deutlich, daß es sich um ein Zitat handelt.<br />
Für das Schriftdeutsch - und immer mehr Zeitungen verfahren so - ist <strong>die</strong> Transformation<br />
des Bürgermeisters in das »er« ausreichend, <strong>die</strong> Leser merken, daß der Redakteur hier<br />
zitiert. So können schreibende Kollegen argumentieren und wie gesagt erlaubt wird es<br />
von den Sprach-Experten auch. Trotzdem - der Konjunktiv »er habe« im ersten Beispiel<br />
ist eindeutiger als der Indikativ »er hat« im zweiten Beispiel. Gerade im Nebenbei-Medium<br />
Radio sollten keine Sprach-Mißverständnisse möglich sein.<br />
Die Anwendung der direkten Rede dagegen ist immer eindeutig, Fehler können kaum<br />
passieren. Es heißt nicht:<br />
Sondern:<br />
»Der Bürgermeister sagte wörtlich, es habe keine Möglichkeit gegeben, <strong>die</strong> Versammlung<br />
aufzulösen.«<br />
»Der Bürgermeister sagte wörtlich (Stockpause): Es hat keine Möglichkeit gegeben, <strong>die</strong><br />
Versammlung aufzulösen.«<br />
Unweigerlich steht jede Hörfunk-Nachrichten-Redakteurin, <strong>die</strong> ganz korrekt <strong>die</strong> indirekte<br />
Rede immer im Konjunktiv formuliert, früher oder später vor einem Problem: Denn in<br />
vielen Fällen entspricht der Konjunktiv I dem Indikativ - der Unterschied zwischen<br />
Wirklichkeits- und Wahrscheinlichkeitsform wäre dann also nicht mehr hörbar.<br />
Beispiel:<br />
28
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Der Bürgermeister sagte, <strong>die</strong> Einsatzleiter kommen noch heute zu einer Sondersitzung<br />
zusammen.«<br />
Zwar wäre <strong>die</strong>ses »kommen« der korrekte Konjunktiv I, aber in <strong>die</strong>sem Fall identisch mit<br />
dem Indikativ. Wir könnten also nicht unterscheiden, ob <strong>die</strong> Möglichkeits- oder<br />
Tatsächlichkeitsform gemeint ist. Aus <strong>die</strong>ser Zwangslage befreit uns der Konjunktiv II.<br />
Also:<br />
»Der Bürgermeister sagte, <strong>die</strong> Einsatzleiter kämen noch heute zu einer Sondersitzung<br />
zusammen.«<br />
Also - während sich <strong>die</strong> Kollegen der gedruckten Me<strong>die</strong>n auch bei der Wiedergabe von<br />
Zitaten in der indirekten Rede des Indikatives be<strong>die</strong>nen dürfen, sollten Hörfunk-<br />
Journalisten stets den Konjunktiv verwenden. Wer ganz sicher sein will, verwendet selbst<br />
<strong>die</strong> indirekte Rede im Konjunktiv nicht, ohne einen ganz klaren Bezug zur Quelle, also zu<br />
der zitierten Person herzustellen. Dann kann auch bei abgelenkten Hörern kein Zweifel<br />
daran aufkommen, von wem <strong>die</strong>se Aussage stammt.<br />
Beispiel:<br />
»Düsseldorf. Mit der Vernehmung des vierten Angeklagten ist heute der Prozeß um den<br />
Mordanschlag von Solingen fortgesetzt worden. Der 21jährige Christian B. bestritt erneut jede<br />
Beteiligung an der Tat. Er sei in der fraglichen Nacht auf einem Polterabend gewesen und habe<br />
sich anschließend von seiner Mutter abholen lassen. Auch der 16jährige Felix K. und der<br />
17jährige Christian R. hatten vor Gericht abgestritten, den Anschlag verübt zu haben.«<br />
Für eine Zeitungs-Nachricht ist <strong>die</strong>se Formulierung nicht zu beanstanden, aber im<br />
Rundfunk könnte es noch deutlicher sein. Denn inzwischen wissen <strong>die</strong> Hörer, daß bei<br />
Rundfunk-Nachrichten <strong>die</strong> Quelle oft erst nach der Satzaussage kommt - in vielen Lead-<br />
Sätzen beispielsweise.<br />
Der Satz in der indirekten Rede »Er sei in der fraglichen Nacht ... « hätte also - ohne <strong>die</strong><br />
Hörer zu überraschen - auch ganz anders aufgelöst werden können:<br />
»Er sei in der fraglichen Nacht auf einem Polterabend gewesen und habe sich anschließend von<br />
seiner Mutter abholen lassen. Dies sagte sein Verteidiger, Rechtsanwalt Lehmann.«<br />
In <strong>die</strong>sem Fall macht der Einsatz des Personalpronomens - »Er« - anstelle des zentralen<br />
Begriffs (Christian B.) den Satz mißverständlich. Auch wenn der Großteil der Hörer<br />
trotzdem verstehen wird, daß mit dem »Er« Christian B. gemeint ist, wäre eine klarere<br />
Formulierung wünschenswert.<br />
29
Besser:<br />
oder:<br />
»Christian B. gab an, in der fraglichen Nacht auf einem Polterabend gewesen zu sein,<br />
anschließend habe ihn seine Mutter abgeholt.«<br />
»Er - Christian B. - sei in der fraglichen Nacht auf einem Polterabend gewesen ...<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
«Zur Erinnerung - es ist in der Tat nicht »verboten«, auch in der indirekten Rede den<br />
Indikativ zu gebrauchen. Bei glasklaren Zuordnungen sei es gestattet, obwohl es im<br />
Hörfunk nicht <strong>die</strong> eindeutigste Art der Formulierung ist. Wenn aber im Lead-Satz <strong>die</strong><br />
Quelle überhaupt nicht erwähnt wird, sollte der Indikativ nur bei unstrittigen Ereignissen<br />
benutzt werden. Die Hörer erfahren im folgenden Beispiel nämlich erst im zweiten Satz,<br />
daß es sich um ein Zitat handelt.<br />
Beispiel:<br />
»Kein Bauarbeiter aus Leipzig wird wegen des Schneider-Desasters seinen Arbeitsplatz<br />
verlieren. Das versicherte Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube heute in Leipzig. Das<br />
Fiasko kann seiner Ansicht nach ... «<br />
Hier hat ein der Redakteur <strong>die</strong> Behauptung des Bürgermeisters in seinem Lead-Satz zu<br />
einer feststehenden Tatsache gemacht. Es gibt zwar <strong>die</strong> Regel, daß <strong>die</strong> sogenannte<br />
»daß-Transformation« (<strong>die</strong> Einleitung der wiedergegebenen Aussage mit einem »daß«)<br />
reicht, um auf den Konjunktiv verzichten zu dürfen - aber <strong>die</strong>s gilt nicht, wenn ein »das«<br />
irgendwo im nächsten Satz steht. In <strong>die</strong>sem Beispiel wäre der Konjunktiv also korrekter<br />
gewesen.<br />
Richtig:<br />
»Kein Bauarbeiter aus Leipzig werde wegen des Schneider-Desasters seinen Arbeitsplatz<br />
verlieren. «<br />
Problemlos wäre <strong>die</strong> Verwendung des Indikatives dagegen gewesen, wenn der Zitierte<br />
seinen Platz im Lead-Satz gefunden hätte.<br />
»Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube sagte heute, daß kein Bauarbeiter aus Leipzig<br />
seinen Arbeitsplatz wegen des Schneider-Desasters verlieren wird.«<br />
So wird der Indikativ in deutschen Nachrichten-Texten in rund 40 Prozent aller Fälle<br />
eingesetzt (laut Duden-Redaktion). Aber <strong>die</strong>se Ausnahme-Regelung bezieht sich<br />
30
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
ausdrücklich nur auf <strong>die</strong> Fälle, bei denen <strong>die</strong> zitierte Aussage mit einem »daß« eingeleitet<br />
wird. Es darf also auch nicht heißen:<br />
»Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube sagte heute, kein Bauarbeiter wird wegen des<br />
Schneider-Desasters seinen Arbeitsplatz verlieren.«<br />
Wenn <strong>die</strong> Quelle bereits genannt wurde, kann der darauffolgende Satz im Konjunktiv<br />
stehen, ohne daß <strong>die</strong> Quelle noch einmal erwähnt werden muß - vorausgesetzt der Satz<br />
ist wirklich eindeutig der bereits genannten Quelle zuzuordnen. Ist <strong>die</strong>se Zuordnung nicht<br />
eindeutig genug, muß <strong>die</strong> Quelle auch im zweiten Satz noch einmal genannt werden.<br />
Schließlich können <strong>die</strong> Hörer sonst nicht erkennen, daß es sich um ein Zitat handelt.<br />
Beispiel:<br />
»Oschatz. Ein Arbeiter ist bei einem Betriebsunfall in der Oschatzer BKN Baustoffwerke mbH<br />
Sachsen ums Leben gekommen. Kurz vor Ende der Nachtschicht wurde der Mann ohne<br />
Lebenszeichen und mit Verletzungen im Brustbereich von Kollegen an seinem Arbeitsplatz<br />
aufgefunden, teilte <strong>die</strong> Kriminalpolizei mit. Vermutlich hat der Arbeiter den Unfall selbst<br />
verschuldet, als er eine Störung an einer Bandanlage beseitigen wollte.«<br />
Abgesehen vom verbesserungsbedürftigen Meldungsaufbau und dem unschönen Lead-<br />
Satz ist dem Autor mit dem letzten Satz ein katastrophaler Fehler unterlaufen. Zwar hätte<br />
er auf eine Wiederholung der Quellenangabe verzichten können. Aber nun ist genau das<br />
passiert, was nicht vorkommen darf: Der Nachrichten-Redakteur hat aufgedeckt, wie es<br />
zu dem Betriebsunfall kam. Anders können <strong>die</strong> Hörer den Schlußsatz ja nicht verstehen.<br />
Seinen Fehler hätte der Redakteur vermutlich in dem Moment bemerkt, in dem er <strong>die</strong><br />
Quelle auch noch einmal im letzten Satz nennt. Zwei richtige Formulierungen stehen zur<br />
<strong>Auswahl</strong>:<br />
• vermutlich habe der Arbeiter den Unfall selbst<br />
• nach Polizeiangaben habe der Arbeiter ...<br />
Fazit: Gewissenhafte Nachrichten-Redakteure arbeiten bei zitierten Aussagen immer<br />
mit dem Konjunktiv, auch dann, wenn der Indikativ erlaubt ist (beispielsweise nach<br />
»daß«-Einleitungen). Schließlich ist <strong>die</strong> Frage, ob Konjunktiv oder Indikativ benutzt<br />
werden soll, nicht nur ein sprachliches Problem, sondern auch ein journalistisches:<br />
Wer auf den Konjunktiv verzichtet, verringert <strong>die</strong> Distanz zwischen Journalist und<br />
Zitierten.<br />
31
3.15 Adjektive<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Es gibt zwei Gründe, Adjektive so selten wie möglich einzusetzen: Adjektive sind fast<br />
immer überflüssiger Wort-Ballast und Adjektive werten. Der Trend, für jedes Ereignis ein<br />
passendes Adjektiv zu finden, ist eine unmittelbare Folge der Informationsüberflutung. In<br />
der Hoffnung, nur so ihre Leser und Hörer noch fesseln zu können, werden <strong>Meldungen</strong><br />
mit Hilfe von übersteigerten Adjektiven aufgepeppt. Eine Unsitte, <strong>die</strong> inzwischen auch bei<br />
den seriösen Nachrichten-Agenturen weit verbreitet ist.<br />
Beispiele:<br />
»... haben <strong>die</strong> Serben massiv zurückgeschossen ... «<br />
Kann sich der Zuhörer unter einem »massiven« Beschuß etwas anderes vorstellen als<br />
unter einem »Beschuß«? Und - wenn <strong>die</strong>ser Beschuß nun massiv war, was waren denn<br />
dann <strong>die</strong> anderen Bombardements, <strong>die</strong> Hunderte von Menschen töteten? Vielleicht halb-<br />
massive oder fast-massive?<br />
»... der schwere Verkehrsunfall ... «<br />
Der Ehrlichkeit halber sollte <strong>die</strong>ses Wort inzwischen zusammengeschrieben werden:<br />
»Schwererverkehrsunfall« - oder wann haben Sie das letzte Mal von einem Verkehrsunfall<br />
gehört oder gelesen, der nicht »schwer« gewesen wäre? Viele Redakteure scheinen ihre<br />
Kunden für so unbedarft zu halten, daß sie ihnen lieber ganz deutlich sagen, daß ein<br />
Unfall mit drei Toten »schwer« ist, von allein würden <strong>die</strong> Hörer und Leser ja auch nicht<br />
darauf kommen ... Ein norddeutscher Sender steigerte <strong>die</strong> sprachliche Katastrophe bis zur<br />
Satire: »Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn sind heute morgen<br />
vier Menschen leicht verletzt worden ... «<br />
»... der heftige Kälteeinbruch ... «<br />
Diese Formulierung kommt mit Sicherheit nicht vom Wetteramt und wie der<br />
Nachrichtenredakteur den Kälteeinbruch empfindet, interessiert niemanden. Reicht es den<br />
Hörern tatsächlich nicht, <strong>die</strong> Temperaturen zu erfahren, um sich dann ein ganz<br />
subjektives Urteil über <strong>die</strong>sen Kälteeinbruch zu erlauben?<br />
»... Das Erdbeben hat in mehreren Orten Nord-Algeriens schwere Zerstörungen angerichtet.«<br />
32
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Schwere Zerstörungen« - wenn etwas zerstört ist, kann es keine Steigerung mehr<br />
geben. Ein Teil eines Dorfes kann zerstört sein, eine große Kirche kann teilweise zerstört<br />
werden - aber weder ein Teil des Dorfes noch der Kirche kann schwer zerstört werden.<br />
Durch Adjektive lassen sich fast nie zusätzliche Informationen vermitteln, <strong>die</strong>s wäre aber<br />
der einzige Grund, <strong>die</strong>se Wortgattung in den Nachrichten einzusetzen. Ohne Zweifel<br />
setzen <strong>die</strong> meisten Nachrichtenredakteure Adjektive ein, weil sie sich damit eine exaktere<br />
Beschreibung eines Ereignisses erhoffen. Nur eine Minderheit wird <strong>die</strong> Adjektive<br />
gebrauchen, um zu werten und zu urteilen. Genau das passiert aber automatisch, wenn<br />
Adjektive benutzt werden. Lassen Sie <strong>die</strong> Hörer selbst entscheiden, wie sie ein Ereignis<br />
einstufen.<br />
Also nicht:<br />
»In Görlitz hat sich gestern abend ein schwerer Raubüberfall ereignet. Zwei bewaffnete Männer<br />
stürmten in einen Drogeriemarkt auf der Luisenstraße und zwangen <strong>die</strong> Kassiererin zur<br />
Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit ihrer Beute ... «<br />
Der durchreisende Berliner oder Frankfurter, der <strong>die</strong> Meldung im Autoradio hört, wird<br />
schmunzeln müssen: Was für <strong>die</strong>se Provinzler doch alles ein »schwerer« Raubüberfall<br />
ist ... Mit Adjektiven, <strong>die</strong> zum Bestandteil eines zusammengesetzten Hauptwortes<br />
gemacht worden sind, sieht es nicht anders aus: Auch sie wollen <strong>die</strong> Hörer auf eine ganz<br />
bestimmte Fährte locken.<br />
Beispiel:<br />
»Bei einem Großbrand ist in der vergangenen Nacht ein Teil der Inneneinrichtung einer Kirche<br />
in Altona zerstört worden ... «<br />
Wie wird es nun folgerichtig heißen müssen, wenn - wie bereits einmal passiert - eine<br />
Ölraffinerie im Hamburger Hafen in Flammen steht? Vielleicht:<br />
»Bei einem historischen, mörderischen, unglaublichen Riesenuniversumsgroßbrand ist in der<br />
vergangenen Nacht ein Teil einer Abfüllanlage einer stillgelegten Raffinerie abgebrannt.«<br />
Manchmal werden Hörer durch wertende Zusätze vor dem Hauptwort auf eine völlig<br />
falsche Fährte gelockt.<br />
Beispiel:<br />
»Auf der nur fünf Meter breiten Gemeindestraße zwischen Halfern und Anschlag kam heute<br />
morgen in einer leichten Kurve einem VW-Bulli ein LKW entgegen. «<br />
33
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Man erwartet nun, daß auf <strong>die</strong> offenbar zu schmale Gemeindestraße noch einmal<br />
eingegangen wird, sonst hätte der Redakteur ja <strong>die</strong>se Einordnung der Straße nicht<br />
vorgenommen - aber Fehlanzeige. Wenn ein solch eindeutig wertendes Wort eingesetzt<br />
wird, darf man sich über Irritationen bei den Hörern nicht wundern. Auch hier gilt: Der<br />
Redakteur hat in den Nachrichten keine, wirklich überhaupt keine Einschätzungen und<br />
kein Werturteile abzugeben.<br />
Wenn auch Adjektive nicht mehr reichen, um mit Reizwörtern Hörer und Leser zu wecken,<br />
werden Superlative konstruiert:<br />
»Der Rauschgiftfund ist der bislang größte, der bei einer routinemäßigen Straßenkontrolle in<br />
Süd-Kalifornien gemacht wurde.«<br />
Vielleicht werden <strong>die</strong> Gurus der deutschen Sprache bald das Wort »bislang« zum Unwort<br />
des Jahres erklären. Mit »bislang« läßt sich ein Thema selbst im Sommerloch an den<br />
Mann und an <strong>die</strong> Frau bringen: So machte <strong>die</strong> Boulevard-Presse im Sommer 1994 ihre<br />
Titelseite abwechselnd damit auf, daß wir nun den »bislang heißester Sommer seit 1953«,<br />
den »bislang trockensten Sommer seit dem Mai 1912« und <strong>die</strong> »bislang längste<br />
Sonnenscheindauer« seit <strong>die</strong>sem einen Tag irgendwann in <strong>die</strong>sem einen Monat hatten -<br />
aber das ist ja auch egal ...<br />
Dürfen wir nun überhaupt keine Adjektive mehr benutzen? Doch - wenn der Fluchtwagen<br />
blau, der untergegangene Dampfer weiß und <strong>die</strong> Chemiewolke am Rhein gelb war, dann<br />
erfüllen <strong>die</strong> Adjektive ihre eigentliche Aufgabe.<br />
3.16 Satzende<br />
Immer wieder ist in den Nachrichten ein ebenso unnötiger wie ärgerlicher Fehler zu hören:<br />
Die Quelle oder eine Nebensächlichkeit wird an das Satzende gestellt. Dabei ist es in der<br />
Alltagssprache genau umgekehrt, das Wichtigste eines Satzes steht fast immer am Ende.<br />
Es heißt also nicht, wie in vielen Nachrichten-Sendungen zu hören ist:<br />
Beispiel:<br />
34
Richtig:<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Die Hannover-Messe habe auch in <strong>die</strong>sem Jahr wieder gezeigt, daß sich <strong>die</strong> wirtschaftliche<br />
Entwicklung in Deutschland verstärke, sagte Staatssekretär Martin Mustermann.«<br />
»Staatsekretär Martin Mustermann sagte, daß <strong>die</strong> Hannover- Messe auch in <strong>die</strong>sem Jahr<br />
gezeigt habe, daß sich <strong>die</strong> wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verstärke.«<br />
Der Grund für <strong>die</strong>se Regel ist einfach: Selten ist <strong>die</strong> Quelle <strong>die</strong> eine, zentrale<br />
Satzaussage. Ohne Zweifel ist sie <strong>die</strong> zweitwichtigste Information eines solchen Satzes,<br />
aber sogar Staatssekretär Mustermann selbst wird einräumen, daß wichtiger ist was er<br />
gesagt hat.<br />
Haben wir erst einmal <strong>die</strong>se Regel akzeptiert werden wir mit der nächsten überhaupt<br />
keine Probleme haben: Das zweitwichtigste eines Satzes steht nie an dessen Ende.<br />
Lauschen wir probeweise der Alltagssprache, werden wir kaum hören, daß der Arbeiter<br />
dem Kollegen zuruft:<br />
Sondern:<br />
»Ein schrecklicher Autounfall hat sich heute vormittag bei nasser Fahrbahn ereignet.«<br />
»Heute Vormittag, als es so naß war, hat's einen schrecklichen Autounfall gegeben.«<br />
Wir betonen unbewußt am Satzende - deswegen hat dort auch das zu stehen, was<br />
unbedingt beim Hörer ankommen soll. Neben der Annäherung an das normale Sprech-<br />
und Betonungsverhalten gibt es einen zweiten Grund, das Wichtigste des Satzes an das<br />
Ende zu stellen: Viele Hörer schalten sich erst Sekundenbruchteile nach Meldungsbeginn<br />
in <strong>die</strong> Meldung ein, nehmen den Inhalt erst auf, wenn <strong>die</strong> ersten Worte schon gefallen<br />
sind. Diese Einhörzeit wird von den meisten Menschen nicht bewußt registriert, ist aber<br />
hinlänglich nachgewiesen. Wird den Hörern <strong>die</strong>se minimale Einhörzeit nicht zugestanden,<br />
sondern <strong>die</strong> entscheidende Satzaussage gleich durch <strong>die</strong> ersten Worte des Satzes<br />
formuliert, haben <strong>die</strong> Hörer kein Chance mehr, den Kern zu erfassen.<br />
Dies gilt besonders für den Lead-Satz: Oft schalten sich <strong>die</strong> Hörer erst nach<br />
Sekundenbruchteilen in eine neue Meldung ein: Wer das Unwichtigste an das Ende, das<br />
Wichtigste aber an den Anfang stellt läßt <strong>die</strong>sen Spät-Einschaltern keine Chance.<br />
Beispiel:<br />
35
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Das Leipziger oder Entcreative-Center soll noch in <strong>die</strong>sem Jahr fertiggestellt werden, so <strong>die</strong><br />
Leipziger Messe-GmbH. Anfang Januar sollen <strong>die</strong> ersten Mieter einziehen können. Das werden<br />
nach Messe-Angaben ausschließlich Firmen der Mode-Branche sein. Der Bau kostet insgesamt<br />
43 Millionen Mark.«<br />
Nun weiß der geneigte Hörer also, daß »<strong>die</strong> Leipziger Messe GmbH« irgendetwas gesagt<br />
oder getan haben muß - was genau, das stand bereits am Satzanfang. Auch wenn der<br />
Redakteur seine Meldung am liebsten unverändert lassen würde, wäre ein kleiner Eingriff<br />
doch empfehlenswert.<br />
Besser:<br />
»Das Leipziger-Center soll noch in <strong>die</strong>sem Jahr fertiggestellt werden. Nach Angaben der<br />
Leipziger Messe-GmbH sollen in das Center Anfang des Jahres <strong>die</strong> ersten Mieter einziehen.«<br />
Anstelle der verwirrenden Namensangabe im Original-Lead-Satz reicht es aus, den<br />
prominenteren Begriff zu nehmen. Zur Not kann der zweite Name im Verlauf der Meldung<br />
auch noch genannt werden. Der Satzinhalt, der Kern der Aussage, ist nicht immer das<br />
Objekt. Gleich drei verschiedene Wortgattungen können den Kern der Aussage darstellen<br />
- müssen also am Ende des Satzes stehen:<br />
1. Objekt als Kern der Aussage<br />
»Der Bürgermeister versprach den Anwohnern, so schnell wie möglich einen<br />
Kindergarten einzurichten.«<br />
2. Prädikat als Kern der Aussage<br />
»Der Bürgermeister versprach den Anwohnern, <strong>die</strong> umstrittene Kläranlage stillzulegen.«<br />
3. Adverbiale Bestimmung (Umstandsbestimmung) als Kern der Aussage<br />
»Der Bürgermeister kündigte seinen Rücktritt wegen der Skandale um den Kindergarten<br />
und der Kläranlage für den nächsten Monat an.«<br />
3.17. Behördensprache, Politikerdeutsch und Fachausdrücke<br />
Abgesehen von dem Sonderfall News-Show ist auch <strong>die</strong> Umgangssprache für<br />
Nachrichten tabu: Im Gegensatz zur Alltagssprache. Der Unterschied: Während <strong>die</strong><br />
Umgangssprache auch Slang- und Modeausdrücke einschließt, ist <strong>die</strong> Alltagssprache das<br />
normalerweise verwendete Deutsch, bei dem weder Slang- noch Modeausdrücke<br />
36
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
vorkommen. Aber auch keine unerläuterten Fachausdrücke oder Fremdwörter. Gehen Sie<br />
also nie von dem Vokabular eines Akademikers aus.<br />
Auch <strong>die</strong> zu verwendende sprachliche Form eines Senders muß formatiert sein - es darf<br />
nicht passieren, daß der eine Redakteur mundartliche Ausdrücke einfließen läßt, <strong>die</strong><br />
andere Redakteurin wie für eine Universitätszeitschrift schreibt und der studentische, freie<br />
Mitarbeiter im Slang der 20jährigen formuliert. Einige Sender haben allerdings sogar<br />
innerhalb einer Sendung erhebliche Sprünge im sprachlichen Erscheinungsbild: Während<br />
<strong>die</strong> ersten drei oder vier <strong>Meldungen</strong> nachrichtlich-sachlich geschrieben sind, wird eine<br />
etwas weniger wichtige Abschlußmeldung »unheimlich locker« in den Computer getippt.<br />
Beispiel:<br />
»In Leipzig geht der Fahrradklau um. Dabei sind nach Angaben der Polizei <strong>die</strong> Diebe nicht<br />
wählerisch. Billig-Räder sind genauso wie Mountain-Bikes im Rennen. Im letzten Jahr sind über<br />
22.000 Drahtesel entwendet worden. Die Polizei empfiehlt Rahmen und beide Räder an<br />
festverankerte Gegenstände anzuschließen.«<br />
Umgangssprache im Lead-Satz, unsachliche Formulierungen im dritten Satz - so<br />
überzeugt man keine Hörer, daß <strong>die</strong> Nachrichten <strong>die</strong>ser Station immer gleichermaßen<br />
kompetent und sachlich sind.<br />
Nicht nur Vokabeln der Umgangssprache beeinflußen das Erscheinungsbild der<br />
Nachrichten, auch Redewendungen.<br />
Beispiel:<br />
»Die Botschafter der 16 NATO-Staaten beraten in Brüssel über weitere Einsätze in Bosnien.<br />
UNO-Generalsekretär Buthros Gali hatte <strong>die</strong> NATO aufgerufen, <strong>die</strong> Sicherheitszonen durch<br />
neue Luftangriffe zu schützen. Die USA wollen auf <strong>die</strong> Forderungen eingehen und einen<br />
härteren Kurs gegen <strong>die</strong> Serben fahren, wenn möglich gemeinsam mit Rußland.«<br />
»Einen härteren Kurs fahren« - das ist weder sachlich, noch anschaulich, noch<br />
nachrichtlich. Es ist ein Stammtisch-Ausdruck, der nichts in den Nachrichten zu suchen<br />
hat.<br />
Keine Umgangssprache - <strong>die</strong>ses Gebot darf nun auch nicht dazu führen, daß aus der<br />
schlichten Formulierung eine bürokratische wird. Behördensprache, Begriffe aus dem<br />
Politikerdeutsch oder dem Juristen-Deutsch sind meist unverständlich. Übersetzen ist<br />
Pflicht.<br />
37
Beispiel:<br />
Besser:<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Der Sohn des Steuer-Flüchtlings Eduard Zwick, Johannes Zwick, wird in der nächsten Woche<br />
zwangsweise vor dem Landtags-Untersuchungsausschuß vorgeführt. Außerdem muß er ein<br />
Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Mark zahlen. Das beschloß das Gremium, nachdem ... «<br />
»Der Sohn des Steuer-Flüchtlings Eduard Zwick, Johannes Zwick, muß in der nächsten Woche<br />
vor dem Untersuchungs-Ausschuß des Landtages erscheinen. ...«<br />
Vorgänge werden - wann immer es geht - so anschaulich wie möglich geschildert. Und<br />
Ausdrücke, <strong>die</strong> in den Amtsstuben oder an Universitäten entstanden sind, mögen<br />
beeindruckend anzuhören sein - aber anschaulich sind sie nicht.<br />
Beispiel:<br />
»... Die CSU und <strong>die</strong> junge Union forderten außerdem in einem Antrag, <strong>die</strong> Infrastruktur der<br />
heimischen Badeseen zu verbessern. Im Rahmen eines Vereins könnte <strong>die</strong>s am besten<br />
geschehen. Zu <strong>die</strong>sem Zweck stellte der Kreisausschuß noch einmal 40.000 Mark zur<br />
Verfügung.«<br />
Was kann sich hinter der »Infrastruktur« eines Badesees verstecken? Grillplätze?<br />
Umkleidekabinen? Parkplätze? Nur eine konkrete Benennung <strong>die</strong>ser<br />
»Infrastruktur«-Maßnahmen würde <strong>die</strong> Meldung interessanter und anschaulicher machen.<br />
Daß unverständliche Ausdrücke nichts in Nachrichten-<strong>Meldungen</strong> zu suchen haben, ist<br />
eigentlich klar. Theoretisch jedenfalls. Die folgenden Ausdrücke stammen aus nur sechs<br />
aufeinanderfolgenden Sendungen eines öffentlich-rechtlichen Senders.<br />
»Polizeiliche Mittel« Verhaftungen? Promille-Test?<br />
»Planmittel« zur Verfügung stehendes Geld<br />
»finanzieller Fehlbetrag« Minus<br />
»defizitäre Entwicklung« weniger Umsatz<br />
»strukturelle Maßnahmen« Maßnahmen<br />
»duales Ausbildungssystem« zweigleisige Ausbildung,<br />
im Betrieb und auf der Berufsschule<br />
38
3.18 Bericht und Meinung<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Selbstverständlich schleichen sich in Nachrichten-<strong>Meldungen</strong> auch Wertungen ein. Das<br />
Kommentieren und Analysieren sollten wir aber den Kollegen überlassen. Übrigens -<br />
<strong>die</strong>ses Neutralitätsgebot gilt für alle Bestandteile einer Nachrichten-Sendung, auch für <strong>die</strong><br />
O-Ton-Berichte der Reporter. Im Eifer des Gefechts vergessen aber Reporter manchmal,<br />
daß sie in den Nachrichten auftreten.<br />
Nachrichtensprecher:<br />
Reporter:<br />
»Während einer Demonstration von Bosniern in Hamburg flogen Steine gegen das<br />
Konsulatsgebäude des ehemaligen Jugoslawiens.«<br />
»Jetzt zieht der Demonstrationszug weiter, <strong>die</strong> Situation hat sich beruhigt. Das liegt<br />
vermutlich daran, daß <strong>die</strong> Demonstranten erkannt haben, daß man Gewalt eben<br />
nicht mit Gewalt bekämpfen darf.«<br />
Pastorale Zeigefinger-Mentalität ist (schlechten) Kommentaren vorbehalten, in<br />
Nachrichten darf sie nie vorkommen. Während <strong>die</strong> Fehler in dem Demonstrations-Beitrag<br />
offensichtlich sind, hat <strong>die</strong>ser bayrische Privatsender weniger deutlich, aber trotzdem<br />
unzulässig gewertet:<br />
Nachrichtensprecher:<br />
»Auch heute gab es wieder Warnstreiks im öffentlich Dienst. Die Gespräche<br />
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern waren gestern nacht abgebrochen worden.«<br />
Reporter:<br />
»In der Innenstadt von Berlin herrschte den ganzen Tag über Chaos. Am härtesten<br />
traf es aber Bremen. Dort ... «<br />
»Chaos« ist ein Begriff, mit dem <strong>die</strong> meisten Menschen Negatives assoziieren. Chaoten<br />
sind fast immer <strong>die</strong>, <strong>die</strong> das Chaos anrichten. Über <strong>die</strong>se Verwandtschaft mit - von der<br />
konservativen Presse so bezeichneten - Hausbesetzern oder Atomkraftgegnern wären mit<br />
39
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Sicherheit <strong>die</strong> wenigsten gestandenen Gewerkschafter einverstanden. Mehr Sachlichkeit<br />
wäre hier seriöser gewesen.<br />
Auch »am härtesten traf es Bremen« ist ein nicht akzeptabler Verstoß gegen Nachrichten-<br />
Richtlinien: Ein Herzinfarkt ist ohne Zweifel ein harter Schicksalsschlag, aber <strong>die</strong>se<br />
gesetzlich erlaubte Arbeitskampfmaßnahme kann höchstens den Straßenverkehr, kaum<br />
aber eine ganze Stadt »hart treffen«.<br />
Vor allem Berufseinsteiger sollten bei Live-Berichten vorsichtig sein und vor dem Beginn<br />
ihres Beitrages im Geiste noch einmal mögliche Klippen im Manuskript durchgehen. Ein<br />
Reporter bei einem Hamburger Privatsender durchlitt <strong>die</strong> längsten Minuten seines<br />
Lebens, als unerwartet der Geschäftsführer, der Chefredakteur und der Programmdirektor<br />
in den Nachrichten-Raum stürzten und nach dem Mitschnitt-Band der vergangenen<br />
Sendung griffen. Der Grund: Einer der Gesellschafter des Kommerz-Senders (in <strong>die</strong>sem<br />
Fall sei <strong>die</strong> abwertende Bezeichnung gestattet) hatte sich beschwert, daß der Reporter in<br />
seinem Bericht angeblich Sympathien für eine Demonstration auf dem Rathausplatz hatte<br />
erkennen lassen. Hätte der Mitschnitt nicht belegt, daß der Reporter lediglich eine mit den<br />
Demonstranten sympathisierende Politikerin zitiert hatte, wäre <strong>die</strong>ser Reporter das letzte<br />
Mal für <strong>die</strong>sen Sender unterwegs gewesen.<br />
Eine der größten Nachteile der O-Ton-Nachrichten ist ohne Zweifel, daß <strong>die</strong> saubere<br />
Trennung von Bericht und Meinung schnell verwischen kann, vor allem bei Live-Auftritten<br />
unerfahrener Reporter. Dabei muß es oberstes, unumstößliches Prinzip aller Nachrichten-<br />
Redaktionen sein, daß <strong>die</strong> Neutralität und Objektivität selbstverständlich auch für O-Ton-<br />
Berichte innerhalb von Nachrichten gilt. Die zunehmende Skepsis in der Bevölkerung<br />
gegenüber sich selbst in Sensationsmacherei überbietenden Me<strong>die</strong>n sollte für jeden<br />
Redakteur Anlaß genug sein, <strong>die</strong> Nachrichten sozusagen nach einem unbestechlichen<br />
»Reinheitsgebot« zu machen - ohne fremde Zutaten wie Wertung, Tendenz oder<br />
Kommentar. Berichte wie der folgende haben in Nachrichten nichts zu suchen.<br />
Nachrichtensprecher:<br />
Reporter:<br />
»Schwerin. Der Landtag kommt heute zu einer insgesamt dreitägigen Sitzung<br />
zusammen. 46 Punkte stehen auf der Tagesordnung.«<br />
40
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Begonnen wird <strong>die</strong> 101. Sitzung der Parlamentarier mit einer aktuellen Stunde<br />
zum Thema >Wirtschaftliche Lage in MecklenburgVorpommern
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Generell gilt, daß das Gebot der absoluten Überparteilichkeit Vorrang vor allen anderen<br />
Kriterien hat. Wenn eine Formulierung auch nur in den Verdacht geraten könnte, zu<br />
gewichten, Stellung zu beziehen oder tendenziös zu sein, muß sie ausgetauscht werden.<br />
Dies geht in vielen Fällen mit ganz einfachen sprachlichen Hilfsmitteln:<br />
Nicht:<br />
Sondern:<br />
Nicht:<br />
Sondern:<br />
»Nach Auffassung der CDU hat <strong>die</strong> PDS Gelder in Millionenhöhe unterschlagen ... «<br />
»Nach Auffassung der CDU soll <strong>die</strong> PDS Gelder ... «<br />
»Aufgrund der von der FDP befürchteten Unruhe ... «<br />
»Aufgrund einer von der FDP befürchteten Schäden ... «<br />
Umstrittene Ausdrücke müssen immer als Wort-Kreation des Zitierten kenntlich gemacht<br />
werden: Wer von einem »vollen Boot« angesichts steigender Flüchtlings-Zahlen spricht,<br />
muß als Urheber der Wortschöpfung klar zu erkennen sein.<br />
Nicht erlaubt ist es dabei, über das Ziel hinauszuschießen: Die Einleitung eines Zitates mit<br />
»... angeblich soll ... « ist zuviel des Guten: Dies bewertet das Gesagte als<br />
wahrscheinliche Lüge, zumindest aber als sehr unwahrscheinliche Behauptung.<br />
Weil heute auch in Zeitungs- und Hörfunkredaktionen Rassismus und Neo-Nazismus<br />
anzutreffen sind, sollten Journalisten besonders sensibel sein, wenn es um<br />
»Minderheiten« geht. Das ethische Gebot ist dabei recht einfach umzusetzen: Wenn eine<br />
Straftat nicht im Zusammenhang mit der Nationalität des mutmaßlichen Täters steht,<br />
braucht <strong>die</strong> Herkunft auch nicht herausgestellt zu werden. Schließlich berichten wir ja<br />
auch nicht darüber, ob der Bankräuber Hesse, Sachse oder Berliner ist. Wenn <strong>die</strong><br />
Nationalität aber eine Rolle spielt - z. B. bei organisierter Kriminalität, bei der ein<br />
bestimmtes Delikt von einer bestimmten Ausländer-Gruppe begangen wird - wäre es<br />
unseriös, <strong>die</strong>s zu unterschlagen. Doch bei der Mehrzahl der Kriminal-Fälle spielt es<br />
42
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
überhaupt keine Rolle, aus welchem Land der mögliche Täter ursprünglich stammt - eine<br />
Zuordnung kann also entfallen.<br />
Angesichts der Unterstützung des Nationalsozialismus durch <strong>die</strong> überwältigende Mehrheit<br />
der damaligen Journalisten in Deutschland sollte das Gebot, Nachricht und Meinung<br />
voneinander zu trennen, über jedem Redaktionsschreibtsich hängen - symbolisch<br />
zumindest. Die Leichtfertigkeit, mit der mit <strong>die</strong>sem Gesetz umgegangen wird, ist<br />
erschreckend. So wird eine Errungenschaft verspielt, <strong>die</strong> <strong>die</strong> deutschen Journalisten nach<br />
1945 bzw. nach 1989 als Geschenk der alliierten Verwaltungen erhielten - <strong>die</strong> Objektivität.<br />
Peter von Zahn, der den Vorgänger des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg mit<br />
aufbaute:<br />
»Das deutsche Erbübel, <strong>die</strong> Vermischung von Nachricht und Meinung, bekämpfte er (der<br />
Sender-Leiter der Alliierten, W.Z.) mit Zähnen und Klauen. Er wies seinen Schützlingen nach,<br />
wieviel Meinung und Vorurteil in einem harmlos klingenden Adjektiv stecken kann.«<br />
3.19. Zahlen und Abkürzungen<br />
Es gibt Abkürzungen, <strong>die</strong> wirklich nicht mehr erklärt werden müssen: NATO, UNO oder<br />
USA sind längst in <strong>die</strong> Alltagssprache übernommen worden. Aber der Begriff »KSZE«<br />
sollte am Ende einer Meldung erläutert werden; <strong>die</strong> Hörer werden Ihnen dankbar sein.<br />
Es gibt einen Privatsender in der Nähe von Aachen, der nicht von einer verhängnisvollen<br />
Abkürzung abzubringen ist: Dort taucht immer wieder ein »OB Peter Meier« in den<br />
Nachrichten auf. Nicht nur wegen der Verwechslungsgefahr mit der gleichnamigen<br />
Tampon-Marke »OB« empfiehlt es sich dringend, <strong>die</strong> zwei Sekunden Zeit zu finden, <strong>die</strong><br />
der »Oberbürgermeister« in Anspruch nimmt.<br />
Auch bei Abkürzungen, <strong>die</strong> einem Großteil Ihrer Hörer bekannt sein dürften, muß einmal<br />
in der Meldung der vollständige Name der Institution genannt werden - <strong>die</strong>s gebietet <strong>die</strong><br />
journalistische Korrektheit schließlich reden wir in <strong>Meldungen</strong> ja auch nicht nur von<br />
»Kohl«, obwohl 99 Prozent der Hörer den Vornamen des Kanzlers kennen. In der<br />
folgenden Meldung wurde gleich zweimal mit nicht erklärten Abkürzungen gearbeitet.<br />
Beispiel:<br />
»Wismar. In wenigen Tagen will <strong>die</strong> EU-Kommission über <strong>die</strong> Verlagerung der MTW-Werft<br />
entscheiden. In der Stadt wächst <strong>die</strong> Sorge um einen möglichen negativen Bescheid aus<br />
43
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Brüssel. Deshalb wurden gestern Politiker und Werft-Mitarbeiter nochmals aktiv. Wismars<br />
Bürgermeisterin Rosemarie Wilken und <strong>die</strong> MTW-Betriebsratvorsitzende Inge Pohlmann<br />
appellierten in einem offenen Brief, den Erhalt des Werkes zu garantieren.«<br />
Das Gebot »Tell one story only« bezieht sich in abgeschwächter Form auch auf Zahlen:<br />
Das Aufnahmevermögen Ihrer Hörer ist begrenzt, auch bei solch wichtigen Ereignissen<br />
wie Wahlen. Es macht keinen Sinn, neben den bundesweiten Wahlergebnissen der<br />
Parteien in Prozent und deren voraussichtlicher Abgeordnetenzahl auch noch <strong>die</strong><br />
Entwicklung der Wahlbeteiligung in Prozent zu melden, wenn möglicherweise auch noch<br />
<strong>die</strong> Ergebnisse einer gleichzeitig stattgefundenen Landtagswahl präsentiert werden<br />
müssen. Wenn Sie wirklich alle Zahlen verlesen müssen: Absätze bilden und ganz<br />
besonders auf <strong>die</strong> klare Strukturierung achten.<br />
3.20 Zeitangaben<br />
Nachrichten sind aktuell - <strong>die</strong> Hörer müssen es nur merken. Erstaunlich oft wird<br />
vergessen, beim Formulieren der Meldung den konkreten, aktuellen Anlaß zu nennen.<br />
»In Ostdeutschland mußten im letzten Jahr über <strong>die</strong> Hälfte der Stellenvermittlungen durch <strong>die</strong><br />
Arbeitsämter subventioniert werden. Diese Bilanz stellte der Deutsche Gewerkschaftsbund in<br />
Berlin auf.«<br />
Das reicht nicht - <strong>die</strong> Hörer müssen zumindest erfahren, ob <strong>die</strong> Bilanz »heute vormittag«<br />
oder »heute nachmittag« vorgestellt wurde. Noch weniger konkret ist <strong>die</strong> Angabe im<br />
nächsten Beispiel:<br />
»Für den Neubau des Bundeskanzleramtes in Berlin ist ein europaweiter Architektenwettbewerb<br />
angelaufen. Ein Preisgericht entscheidet Mitte Dezember über <strong>die</strong> eingereichten Unterlagen.<br />
>Wir liegen damit voll im Zeitplan
Doppelt notwendig wäre eine Zeitangabe im nächsten Beispiel gewesen:<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Der Kulturausschuß hat <strong>die</strong> Verwaltung in seiner letzten Sitzung beauftragt, ein Konzept für <strong>die</strong><br />
zukünftige Nutzung des alten Kurhauses zu erstellen. Wenn das Museum Ende des Jahres<br />
auszieht, soll das alte Kulturhaus für <strong>die</strong> Aachener Kulturszene nutzbar gemacht werden.«<br />
Moment - <strong>die</strong> »letzte« Sitzung des Kulturauschusses? Vermutlich <strong>die</strong> letzte Sitzung vor<br />
der Sommerpause - oder sollte <strong>die</strong>ser honorige Ausschuß tatsächlich in Aachen<br />
abgeschafft werden? Und auch <strong>die</strong> Aachener möchten wissen, wann der Ausschuß getagt<br />
hat.<br />
»Ich kann doch nicht schreiben, daß das schon gestern war« - das klagen<br />
Lokalredakteure, <strong>die</strong> auf eine Geschichte durch <strong>die</strong> örtliche Zeitung aufmerksam werden,<br />
das Ereignis liegt dann manchmal schon 24 Stunden zurück. Da bleibt nur der Ausweg,<br />
<strong>die</strong> Zeitangabe etwas unpräziser ausfallen zu lassen. Wenn also vor der Sechs-Uhr-<br />
Sendung auf der Titelseite der Lokalseite entdeckt wird, daß es am Vortag zur selben Zeit<br />
einen Chemie-Unfall gegeben hat, dann darf allgemein von »gestern« gesprochen<br />
werden. Denn das ist <strong>die</strong> Kehrseite des schnellsten Mediums Radio: Die Hörer erwarten<br />
auch von Lokalsendern, daß sie Ereignisse nicht erst 24 Stunden später melden.<br />
<strong>4.</strong> <strong>Auswahl</strong> - <strong>die</strong> <strong>unterschiedlichen</strong> <strong>Meldungen</strong><br />
<strong>4.</strong>1 Was ist eine Meldung?<br />
Viele Journalisten schätzen ihren Beruf, weil es nicht für jedes Problem einen genau<br />
vorgegebenen, wissenschaftlich fun<strong>die</strong>rten Lösungsweg gibt. So läßt sich auch <strong>die</strong>se<br />
Frage nicht eindeutig beantworten, aber <strong>die</strong> Antwort läßt sich zumindest einkreisen.<br />
Zunächst mit der Definition der Gebrüder Grimm: Eine Nachricht ist »eine Mittheilung zum<br />
Darnachrichten«.<br />
Diese Definition ist noch nicht veraltet und sie bringt uns der Antwort ein Stück näher: Die<br />
Grimmsche Definition beschreibt auch heute noch eine wichtige Kategorie von <strong>Meldungen</strong><br />
45
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
- nämlich <strong>die</strong> <strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Hörer interessieren, weil <strong>die</strong> mitgeteilten Ereignisse eine<br />
Bedeutung für sie haben, weil sie möglicherweise Auswirkungen auf ihren Alltag haben.<br />
So gesehen haben <strong>die</strong> Gebrüder Grimm frühzeitig <strong>die</strong> Bedeutung von Service-<strong>Meldungen</strong><br />
erkannt. Ob Wetter-Prognose, Steuer- und Kaffeepreiserhöhung - in gewisser Weise<br />
werden sich <strong>die</strong> Hörer danach richten: Sie kaufen vielleicht weniger Kaffee, und bei der<br />
Steuererklärung sind sie noch sorgfältiger als sonst.<br />
Auch <strong>die</strong> Rundfunkanstalt BBC, <strong>die</strong> über Jahrzehnte für alle Radio-Stationen in Europa<br />
prägend war, hat <strong>die</strong>se Kategorie der <strong>Meldungen</strong> ausdrücklich in den<br />
Programmgrundsätzen verankert: <strong>Meldungen</strong> sind danach Informationen, <strong>die</strong> für <strong>die</strong><br />
Zuhörer von persönlichem Belang sind.<br />
Zumindest für <strong>die</strong>se Meldungskategorie gibt es ein fast schon objektives Kriterium. Denn<br />
ob ein Ereignis für eine größere Zahl von Menschen Auswirkungen haben kann oder nicht<br />
ist nicht von subjektiven Erwägungen des Redakteurs abhängig.<br />
Und all <strong>die</strong> anderen <strong>Meldungen</strong>? »News is whats different?« Ein vielzitierter Satz und ein<br />
wenig hilfreicher Allgemeinplatz, der aus dem US-amerikanischen Radio-Journalismus<br />
stammt. Schließlich haben wir es bei dem Krieg in Bosnien, bei dem Kieler Schubladen-<br />
Untersuchungsauschuß, der Stagnation der Arbeitslosenzahlen, der anhaltenden<br />
Hitzewelle ständig mit <strong>Meldungen</strong> zu tun, <strong>die</strong> eben nicht aufgrund einer Veränderung ins<br />
Programm kommen - im Gegenteil.<br />
In den folgenden Abschnitten geht es um »Mittheilungen zum Darnachrichten«, »um<br />
<strong>Meldungen</strong> von persönlichem Belang« und um Ereignisse, <strong>die</strong> »different« sind. Welche<br />
der beschriebenen Meldungs-Kategorien in Ihrer Redaktion besonders berücksichtigt<br />
werden sollen, muß jeder Sender im Detail selbst festlegen. Aber es gibt Kategorien von<br />
<strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> unabhängig von der Zielgruppe der jeweiligen Station zu einem<br />
ansprechenden Nachrichten-Angebot dazu gehören.<br />
<strong>4.</strong>2 Service-<strong>Meldungen</strong><br />
46
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Ob Sie <strong>die</strong>se Meldungs-Art als Service-, Nutzwert- oder News-youcan-use-Nachricht<br />
bezeichnen, ist einerlei: Es geht um Ereignisse, <strong>die</strong> Auswirkungen auf den Alltag Ihrer<br />
Hörer haben oder haben können.<br />
Beispiel:<br />
• Steuern wieder erhöht!<br />
• Benzinpreise steigen!<br />
• Mietrecht erweitert!<br />
• Ozonbelastung steigt!<br />
Immer, wenn es um finanzielle Ent- oder Belastungen geht wenn gesundheitliche Risiken<br />
oder medizinische Fortschritte zu melden sind, wenn es um <strong>die</strong> Stauprognose für das<br />
Wochenende oder den Skiwetterbericht für den Harz geht - immer, wenn <strong>die</strong> Hörer oder<br />
zumindest ein nicht unerheblicher Teil von ihnen <strong>die</strong> Informationen konkret für den Alltag<br />
verwerten können, kann mit einer besonderen Aufmerksamkeit für <strong>die</strong>se Sendung<br />
gerechnet werden. Angesichts der Informationsflut werden Nachrichtenangebote<br />
besonders dann honoriert, wenn sie sich mit dem Alltag praktisch auseinandersetzen.<br />
So ist <strong>die</strong> Meldung über <strong>die</strong> neue Mietrechtsregelung nicht nur eine Top-Meldung, weil <strong>die</strong><br />
Pressekonferenz zu <strong>die</strong>sem Thema zufällig in der eigenen Stadt tagt, sondern weil viele in<br />
der Zielgruppe des eingeschalteten Senders selbst von allen Änderungen im Mietrecht<br />
betroffen sein werden.<br />
Stauprognosen zum Wochenende, <strong>die</strong> Sperrung wichtiger Straßen, der Ausfall wichtiger<br />
Zugverbindungen, Wetterlagen mit möglichen gesundheitlichen Folgen (Ozon, Smog),<br />
sich ändernde Steuergesetze, gesundheitsgefährdende Lebensmittel, <strong>die</strong> Meldung von<br />
TUI, daß alle Mallorca-Reisen im Sommer ausgebucht sind, <strong>die</strong> Meldung des ADAC, daß<br />
Fährplätze nach Griechenland kaum noch zu bekommen sind - das alles sind Themen,<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> Hörer als Service-<strong>Meldungen</strong> in der Sendung erwarten dürfen. Wenn manchmal<br />
auch nicht <strong>die</strong> gesamte Original-Meldung der Presse-Agentur oder einer Presse-Stelle<br />
<strong>die</strong>sen Service-Charakter hat, so gibt es doch oft einzelne Aspekte, <strong>die</strong> eine Service-<br />
Information darstellen.<br />
In der folgenden Nachrichten-Sendung wurde <strong>die</strong> Service-Meldung nicht prominent<br />
plaziert und der Service-Charakter einer anderen nicht herausgestellt.<br />
47
Beispiel:<br />
• Keine Nato-Flüge gegen Serben<br />
• Neue Übergangsverfassung in Südafrika<br />
• SPD bietet Abtrünnigen Mitarbeit an<br />
• Strompreise und Sozialmieten steigen<br />
• Bürgerschaft berät Haushalt 1994<br />
• Demo gegen Bildungsabbau<br />
• Wetter<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Zum Zeitpunkt <strong>die</strong>ser Nachrichten-Sendung war erst kurze Zeit bekannt, daß es<br />
tatsächlich eine Erhöhung der Strompreise und Sozialmieten geben wird. Dies wäre <strong>die</strong><br />
Aufmacher-Meldung der Sendung gewesen.<br />
Die beiden ersten internationalen <strong>Meldungen</strong> behandeln Sachverhalte, <strong>die</strong> im Fall Serbien<br />
seit Tagen unverändert bzw. im Fall Südafrika eine reine Vollzugsmeldung sind.<br />
In der letzten Meldung wird eine Möglichkeit verschenkt, <strong>die</strong>se bloße Vorab-Meldung für<br />
den Hörer interessanter zu gestalten. Der durchaus enthaltene Service-Aspekt der<br />
Meldung ist nicht erkannt worden:<br />
Beispiel:<br />
»Mit einer Demonstration durch <strong>die</strong> Hamburger Innenstadt wollen gegen Mittag Lehrer, Schüler<br />
und Eltern gegen Bildungsabbau protestieren. Der Protest richtet sich vor allem dagegen, daß<br />
inHamburg trotz rapide steigender Schülerzahlen in den nächstenJahren keine zusätzlichen<br />
Lehrerstellen geschaffen werden sollen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rechnet<br />
mit 50.000 Demonstrationsteilnehmern. Geplant ist zunächst ein Sternmarsch aus<br />
verschiedenen Stadtteilen zur Moorweide. Ab elf Uhr wird esdaher im gesamten Stadtgebiet zu<br />
Verkehrsbehinderungen kommen.«<br />
Allein <strong>die</strong> Tatsache, daß (vom Zeitpunkt der Nachrichten-Sendung an gerechnet) in mehr<br />
als sechs Stunden eine Demonstration beginnt, ist keine Meldung. Zur Meldung würde<br />
<strong>die</strong>se Vorausschau werden, wenn zwei interessante Faktoren an <strong>die</strong> Spitze gerückt<br />
würden: Die ungewöhnlich große Zahl der erwarteten Teilnehmer (»Gesprächswert«)<br />
oder/ und <strong>die</strong> dadurch zu erwartenden erheblichen Verkehrsbehinderungen (»Service-<br />
Meldung«).<br />
Besser:<br />
48
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Zu einer Demonstration gegen <strong>die</strong> Bildungspolitik des Hamburger Senates werden heute bis zu<br />
50.000 Menschen erwartet. Diese Zahl nannte <strong>die</strong> Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,<br />
<strong>die</strong> zu dem Protestmarsch aufruft. Wegen der Demonstration muß bereits ab elf Uhr im<br />
gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Protest richtet sich<br />
vor allem dagegen, daß an den Schulen aufgrund fehlender Lehrer immer mehr<br />
Unterrichtsstunden ausfallen.«<br />
Obwohl es mehrere denkbare Leads gibt, wurde <strong>die</strong> Original-Meldung unverändert in allen<br />
drei Morgen-Sendungen so präsentiert. Dabei hätte man <strong>die</strong> Meldung in der nächsten<br />
Stunde durchaus mit den erwarteten Verkehrsbehinderungen beginnen können, also mit<br />
dem Service-Aspekt.<br />
Noch besser:<br />
»In der Hamburger Innenstadt muß heute ab elf Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen<br />
gerechnet werden. Die Behinderungen werden aufgrund einer Demonstration erwartet, an der<br />
nach Angaben der Veranstalter bis zu 50.000 Menschen teilnehmen werden. Die Demonstration<br />
richtet sich gegen Einsparungen im Bildungsbereich; an dem Protestzug wollen sich Lehrer,<br />
Eltern und Schüler beteiligen.«<br />
Es gibt auch Service-<strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> keine sind: jeder Autofahrer weiß, daß es sich im<br />
Herbst empfiehlt, frühzeitig das Abblendlicht einzuschalten, darauf muß man niemanden<br />
aufmerksam machen - auch nicht, wenn der Automobilverband <strong>die</strong> dritte Presse-Mitteilung<br />
dazu veröffentlicht.<br />
Service-<strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> über Ereignisse berichten, <strong>die</strong> den Alltag der Zuhörer<br />
unmittelbar betreffen und ihm unter Umständen hilfreiche Informationen anbieten,<br />
sollten besonders berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Service-Bestandteile<br />
innerhalb einer Meldung.<br />
<strong>4.</strong>3 Gesprächswert-<strong>Meldungen</strong><br />
Erna sitzt im Wohnzimmer und liest Zeitung, Erwin steht in der Küche und wäscht ab,<br />
dabei hört er Nachrichten - Ihre Nachrichten! Nach dem Abwasch geht er in das<br />
Wohnzimmer zu seiner Frau - und wenn er jetzt seiner Frau nicht eine einzige<br />
interessante Meldung aus Ihrer Nachrichten-Sendung zu erzählen hat, haben Sie bei der<br />
<strong>Auswahl</strong> Ihrer <strong>Meldungen</strong> etwas falsch gemacht. Eine Nachrichten-Sendung, bei der nicht<br />
49
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
eine Meldung vorkommt, über <strong>die</strong> es wert wäre zu sprechen, ist - eine Sendung ohne<br />
jeden Gesprächswert.<br />
Gesprächswert-<strong>Meldungen</strong> sind dabei nicht mit den bunten <strong>Meldungen</strong> zu verwechseln -<br />
»bunt« sind auch Kuriositäten aus Italien oder den USA, <strong>die</strong> in dem Sendegebiet einer<br />
Station in Thüringen oder Bayern kaum zum Gesprächsthema werden. Einen hohen<br />
Gesprächswert haben dagegen Themen, <strong>die</strong> sich auch in der Boulevard-Presse<br />
niederschlagen. Der Umstand, daß über ein Verbrechen auch in der unter Journalisten<br />
weniger angesehenen - Straßenverkaufszeitung berichtet wird, darf nicht dazu führen,<br />
daß <strong>die</strong> eigenen Nachrichten <strong>die</strong>ses Thema nicht aufgreifen.<br />
»Das melde ich nicht, daß ist mir zu blutig« - niemand erwartet von einem Redakteur, daß<br />
er unnötig blutige Einzelheiten detailliert beschreibt. Aber ein blutiges Verbrechen, einen<br />
grauenhaften Unfall nicht zu melden, weil eine persönliche Abneigung gegen solche<br />
Berichte besteht, ist Zensur: Auch <strong>die</strong>se Ereignisse gehören zum Alltag und beschäftigen<br />
<strong>die</strong> Menschen weit mehr als <strong>die</strong> dreiundreißigste Pressekonferenz in Bonn zur<br />
Gesundheitsreform.<br />
Es versteht sich von selbst, daß ein ernstzunehmender Radio-Sender bei solchen<br />
<strong>Meldungen</strong> dem Voyeurismus keinen Vorschub leistet. Einzelheiten, <strong>die</strong> nicht nötig sind,<br />
um das Ereignis zu verstehen und lediglich Emotionen auslösen sollen, sind unseriös. Im<br />
Übrigen gehen inzwischen <strong>die</strong> ersten US-amerikanischen Fernseh- und Radio-Stationen<br />
wieder davon ab, besonders blutige Ereignisse marktschreierisch zu verbreiten. Die<br />
Publikums- und Hörerreaktionen deuten immer mehr darauf hin daß der Schock- und<br />
damit Werbeeffekt solcher <strong>Meldungen</strong> längst erschöpft ist. Im folgenden zwei Beispiele für<br />
schlechte Nachrichten-<strong>Meldungen</strong>.<br />
Ein Hamburger Privatsender zu einem tödlichen Unfall:<br />
»Der 12jährige lag in einer riesigen Blutlache«<br />
Ein schleswig-holsteinischer Privatsender zu der tödlichen Attacke eines Hundes gegen<br />
ein Baby:<br />
»Durch den heftigen Biß zersplitterte der Schädelknochen«.<br />
50
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Solche Sätze sind unseriös und haben nur <strong>die</strong> Absicht, bei den Hörern einen Schock- und<br />
Gruseleffekt auszulösen. Es reicht, zu schreiben:<br />
und:<br />
»Der 11jährige starb noch an der Unfallstelle«<br />
»Der Hund fügte dem Baby tödliche Bißverletzungen zu«<br />
In beiden Fällen ist es ausnahmsweise angebracht, sich der Behördensprache<br />
anzunähern, um nicht als »Revolver«-Sender belächelt zu werden.<br />
Gesendet werden müssen <strong>die</strong>se Informationen auf jeden Fall. Anstelle marktschreierisch<br />
Details der blutigen Ereignisse auszugraben, gibt es durchaus Möglichkeiten, auch bei<br />
<strong>die</strong>sen Themen mit Hilfe von O-Tönen Sachkompetenz zu beweisen.<br />
Im Fall des tödlich verletzten Babys entschied eine andere Nachrichtenredaktion nach<br />
heftigen Diskussionen schließlich, auf einen sehr detaillierten und farbenfrohen Bericht<br />
eines freien Reporters vom Ort des Geschehens zu verzichten. Dafür wurde folgende<br />
Alternative gefunden.<br />
Nachrichtensprecher:<br />
O-Ton:<br />
»Hamburg. Der Hund einer Familie in Hamburg-Bergstedt hat heute nachmittag das Kleinkind<br />
der Familie angefallen und tödlich verletzt. Der Bernhardiner ist bei der Familie aufgewachsen<br />
und galt nach Polizeiangaben als völlig friedlich. Gegenüber radio X. nahm der Berliner<br />
Tierpsychologe Y. zu <strong>die</strong>sem Fall Stellung:«<br />
»Es ist durchaus möglich, daß bei einem Tier völlig unerwartet Aggressionen auftreten, das ist<br />
keine Seltenheit ... «<br />
Entsprechend des von der Redaktion übereinstimmend festgestellten hohen<br />
Gesprächswertes - bei gleichzeitigem Unbehagen, <strong>die</strong>s überhaupt zu melden - entschied<br />
man, eine »neue Drehe« für <strong>die</strong>ses Thema zu finden. Während sich andere Privatsender<br />
damit beschäftigten, den Abtransport des Kindersarges zu schildern, berichtete man hier<br />
über mögliche Ursachen und Konsequenzen.<br />
Einige Sender wählen <strong>Meldungen</strong> gezielt aus, <strong>die</strong> nichts mit ihrem Verbreitungsgebiet<br />
oder ihrer Zielgruppe zu tun haben, sondern ausschließlich nach dem Vorbild der<br />
Straßenverkaufszeitungen einen Werbe- und Hinhöreffekt haben sollen. Skurrile<br />
51
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Ereignisse um den Preis journalistischer Seriösität gehen auf Kosten der Glaubwürdigkeit<br />
der eigenen Nachrichten - irgendwann erwarten <strong>die</strong> Hörer keine ernsthaften Informationen<br />
mehr.<br />
Beispiel (aus Hamburg):<br />
»Ein blutiges Ende nahm gestern am späten Abend ein Fischessen unter Freunden und<br />
Bekannten in Frauenau im bayrischen Wald. Ein 43jähriger Arbeitsloser erschoß eine 27jährige<br />
Frau, mit der er befreundet war, und deren Mutter. Weitere Schüsse trafen einen Urlauber.<br />
Anschließend erschoß der Täter sich selbst.«<br />
Keine Frage - wenn <strong>die</strong>ses Ereignis im Empfangsgebiet <strong>die</strong>ses Hamburger Senders<br />
stattgefunden hätte, wäre es selbstverständlich zu melden gewesen. So aber handelt es<br />
sich um eine reine Boulevard-Meldung, <strong>die</strong> in Hamburg kaum jemanden interessieren<br />
wird. »Was soll das?« ist aber eine Reaktion bei Hörern, <strong>die</strong> zum Umschalten führen kann<br />
- zunächst bei den Nachrichten.<br />
Auch bei Katastrophenmeldungen muß <strong>die</strong> Information im Vordergrund stehen. Dazu<br />
gehört auch, auf Schicksale aufmerksam zu machen, ohne in einen »Boulevard-<br />
Journalismus« abzugleiten wie in der folgenden Meldung.<br />
Beispiel:<br />
»Durch das Hochwasser in Thüringen ist erneut ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche<br />
des 64jährigen Rentners wurde im Schwarzatal im Wasser treibend entdeckt. Der Mann wurde<br />
seit zwei Tagen vermißt. Er hatte sich in seinem Schuppen aufgehalten, als <strong>die</strong>ser von den<br />
Wassermassen unterspült und weggerissen wurde. Am Donnerstag war bereits <strong>die</strong> Leiche eines<br />
59jährigen Mannes gefunden worden. Inzwischen sinken <strong>die</strong> Wasserstände in Thüringen<br />
wieder.«<br />
Der kursive Teil <strong>die</strong>ser Meldung hat in der Sendung eines seriösen Senders nichts zu<br />
suchen, solange <strong>die</strong>ses Ereignis nicht in der eigenen Stadt oder der eigenen Region<br />
spielt. Nur dann würden <strong>die</strong> genauen Umstände des Todes zu einer wichtigen Information<br />
werden. In der obigen Meldung erfüllen sie nur den Zweck, beim Zuhörer einen<br />
Gänsehaut-Effekt zu erzielen.<br />
Andere wichtige Informationen zu <strong>die</strong>sem Thema werden dafür in <strong>die</strong>ser Meldung nicht<br />
erwähnt, weil <strong>die</strong> Zeit nicht reicht. Dabei gab es zu <strong>die</strong>sem Zeitpunkt und zu <strong>die</strong>sem<br />
Thema durchaus eine ganze Fülle sachlicher Informationen, wie <strong>die</strong> folgende Meldung<br />
zeigt <strong>die</strong> zur selben Zeit bei dem Konkurrenzsender lief. Auch <strong>die</strong>ser Sender hat das<br />
tragische Einzelschicksal des 64jährigen Rentners aufgegriffen, es aber nicht plakativ<br />
52
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
ausgewalzt - denn <strong>die</strong> Nachricht ist <strong>die</strong> gesamte Hochwasser-Situation und nicht der<br />
Todesfall eines Einzelnen.<br />
Beispiel:<br />
»In Sachsen-Anhalt steigt das Hochwasser in der Region Sachsen-Anhalt und im Landkreis<br />
Stassfurt bedrohlich. Am Pegel Halle-Trotte hat das Hochwasser einen neuen Rekordstand<br />
erreicht.Auch das Hochwasser der Bode stieg weiter an. Aus Thüringen, Niedersachsen und<br />
Baden-Württemberg wird dagegen ein Stillstand beziehungsweise Rückgang des Hochwassers<br />
gemeldet. In Thüringen haben Rettungsmannschaften heute ein weiteres Todesopfer geborgen,<br />
der 64jährige Rentner war in der Schwarza ertrunken. «<br />
Ohne Gesprächswert-<strong>Meldungen</strong> ist ein Radio-Sender nicht denkbar: Das, was <strong>die</strong> Hörer<br />
morgens beim Bäcker, zu Arbeitsbeginn oder in der Pause besprechen, macht das<br />
Lebendige einer Stadt, einer Region oder eines ganzen Landes aus. Daraus folgt, daß<br />
Themen wie »Innere Sicherheit«, »Verkehr« oder auch »Verbrechen« ein ganz normaler<br />
Bestandteil einer Nachrichten-Sendung sein müssen.<br />
Auch bei Gesprächswert-<strong>Meldungen</strong> gelten alle Formulierungsregeln, aber eine ganz<br />
besonders: Wenn ein solches Ereignis in <strong>die</strong> Sendung aufgenommen wird, dann weil der<br />
Redakteur überzeugt ist, daß <strong>die</strong> Menschen aufgrund der Fakten der Meldung über <strong>die</strong>ses<br />
Thema reden werden. Dann muß dem Ereignis auch nicht mit unnötigen Adjektiven noch<br />
mehr Farbe gegeben werden.<br />
Beispiel:<br />
»Wippoldeswalde. In einer dramatischen Aktion haben Mitarbeiter der Feuerwehr, des<br />
Rettungsamts und Beamte der Polizei das Leben eines Neugeborenen gerettet. Nach<br />
Polizeiangaben hatte <strong>die</strong> hochschwangere Mutter auf der Toilette eine Sturzgeburt erlitten, <strong>die</strong><br />
sich nicht durch Wehen angekündigt hatte. Das Baby war dabei durch das Fallrohr von der<br />
ersten Etage des Hauses bis ins Erdgeschoß gerutscht, wo es steckenblieb und von<br />
Rettungskräften befreit wurde. Der kleine Junge kam zur Behandlung in ein Dresdner<br />
Krankenhaus.«<br />
Das Adjektiv »dramatisch« ist überflüssig wie ein Kropf - wer <strong>die</strong>se Meldung hört, ist von<br />
der Dramatik der Ereignisse durch <strong>die</strong> nüchternen Fakten hinreichend überzeugt.<br />
In derselben Sendung wird auch der umgekehrte Fehler gemacht - eine gar nicht so<br />
uninteressante Meldung wird so geschrieben, daß sie fade und trocken wirkt. Dann reden<br />
<strong>die</strong> Leute selbstverständlich nicht darüber, was sie in <strong>die</strong>sem Sender gerade gehört<br />
haben, der Werbeeffekt ist verschenkt worden.<br />
Beispiel:<br />
53
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
»Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt will sich im Juli in Japan offiziell um <strong>die</strong> Austragung<br />
des magischen Weltkongresses 1997 bewerben. Die Chancen schätzt der Präsident des<br />
magischen Zirkels von Deutschland, Wolfgang Sommer, als sehr gut ein. Bei dem Weltkongress<br />
würden sich rund 2.000 Magier aus allen Nationen in Dresden treffen.«<br />
Daß sich <strong>die</strong> Landeshauptstadt um <strong>die</strong> Austragung eines Kongresses bewirbt - das wird<br />
bei den meisten Hörern nach <strong>die</strong>ser Meldung hängenbleiben (oder auch nicht). Mit einem<br />
nachrichtlich völlig korrekten Umbau <strong>die</strong>ser Meldung läßt sich aber das Hörer-Interesse<br />
viel eher wecken:<br />
Besser:<br />
»Dresden. In vier Jahren werden möglicherweise rund 2.000 Zauberer in <strong>die</strong> Landeshauptstadt<br />
kommen. Die Voraussetzung dafür ist, daß Dresden in vier Jahren Gastgeber des magischen<br />
Weltkongresses ist. Der Präsident des magischen Zirkels von Deutschland, Wolfgang Sommer,<br />
schätzt <strong>die</strong> Chancen einer Bewerbung Dresdens um <strong>die</strong>se Gastgeber-Rolle als sehr gut ein.<br />
Offiziell wird sich <strong>die</strong> Landeshauptstadt im Juli bewerben.«<br />
Fragen Sie sich wirklich bei jeder Meldung, <strong>die</strong> Sie auswählen wollen: Wen könnte das<br />
interessieren und warum? Oder halte nur ich <strong>die</strong> Meldung für so wichtig, daß ich sie<br />
unbedingt bringen muß?<br />
Die Chefin eines wenig erfolgreichen norddeutschen Privatsenders wurde während einer<br />
Krisensitzung gefragt, warum sie nicht das Musikformat ändere. Antwort: »Weil ich jetzt<br />
endlich mal <strong>die</strong> Musik spielen kann, <strong>die</strong> ich selbst am liebsten höre.«<br />
Senden Sie nicht <strong>die</strong> Nachrichten, <strong>die</strong> Sie selbst am liebsten hören würden - senden Sie<br />
<strong>die</strong> <strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Mehrheit Ihrer Hörer interessieren könnten.<br />
Ereignisse aller Art, <strong>die</strong> erwartungsgemäß in der Öffentlichkeit und damit unter den<br />
Zuhörern diskutiert werden, sind ein wichtiger Bestandteil der Nachrichten. Dazu<br />
gehören ausdrücklich auch <strong>Meldungen</strong> über Verbrechen oder Unglücksfälle.<br />
Entscheidend ist der voraussichtliche Gesprächswert. Berichtet werden sollte aber<br />
sachlich und im Zweifelsfall eher zurückhaltend.<br />
<strong>4.</strong><strong>4.</strong> »Provinz«-<strong>Meldungen</strong><br />
Was passiert mit dem Brand in der Bäckerei oder im Keller eines Mietshauses? Was mit<br />
der Kreistagssitzung, <strong>die</strong> mal wieder nichts Spannendes zu bieten hatte? Muß ich das<br />
54
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
melden oder wirken meine Nachrichten dann provinziell? Während der Kellerbrand,<br />
solange es wirklich nur ein auf den Keller beschränktes Feuer war, getrost den<br />
kostenlosen Anzeigenblättern überlassen werden kann, sieht es bei dem Brand in der<br />
Bäckerei anders aus. Und eine Kreistags-Sitzung ist journalistische Pflichtübung: Alle<br />
Sender - ob öffentlich-rechtlich oder privat - müssen sich bemühen, in <strong>die</strong> Öffentlichkeit zu<br />
transportieren, wie Politik funktioniert (vgl. <strong>4.</strong>6 »Chronistenpflicht«). Aber - sowohl den<br />
Kellerbrand als auch <strong>die</strong> langweilige Sitzung muß man so anschaulich und lebendig<br />
aufbereiten wie möglich.<br />
Es geht darum, auch durch das Informieren über kleinere Ereignisse in der Stadt oder der<br />
Region den Hörern das sichere Gefühl zu vermitteln, daß der eigenen Station nichts<br />
entgeht und daß garantiert auch dann berichtet wird, wenn einmal in ihrem Stadtteil oder<br />
ihrem Landesteil etwas passiert. Der Brand in einer Bäckerei ist Stadtteilgepräch des<br />
Tages. Und <strong>die</strong> Kreistags-Sitzung gehört zu den Themen, <strong>die</strong> Ihre Hörer - wenn auch<br />
manchmal nur der Vollständigkeit halber von einem ernstzunehmenden Sender erwarten -<br />
allerdings erwarten sie auch <strong>die</strong> Ehrlichkeit, nichts zu melden, wenn »nix los war«. Erst<br />
<strong>die</strong> Summe <strong>die</strong>ser kleineren Ereignisse in den Nachrichten schafft bei den Hörern das<br />
Vertrauen, mit Sicherheit etwas zu erfahren, wenn in ihrem Stadtteil, in ihrer Nähe etwas<br />
passiert ist.<br />
Es müssen keineswegs immer <strong>die</strong> spektakulären Geschichten sein. Bei einem Lokal-<br />
Sender beispielsweise geht es darum, möglichst viele interessierende Facetten der Stadt<br />
abzubilden.<br />
Beispiele:<br />
• 20 Parkuhren aufgebrochen<br />
• Vollsperrung der Stadt-Brücke<br />
• Überfall auf Zeitungskiosk<br />
• Bürgermeister trifft Boris Becker<br />
• Radstreifen Hochallee fertiggestellt<br />
• Neo-Naziaufkleber an der Uni<br />
• Sparkasse kündigt drei neue Filialen an<br />
• Schuldenberg des Fußballvereins wächst<br />
55
Der Kerngebietsausschuß, <strong>die</strong> Bezirksversammlung, der Ortsausschuß, <strong>die</strong><br />
Kreisversammlung - alles öffentliche Sitzungen. Nur sind <strong>die</strong> Zuhörer- und<br />
Zuschauerbänke meistens leer. Es sei denn, es geht um eine umstrittene<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Verkehrsberuhigung, einen Bebauungsplan an prominenter Stelle des Stadtteils oder um<br />
<strong>die</strong> Verlagerung eines Schrebergartens. Dann sind <strong>die</strong> Initiativen und Anwohner auf den<br />
Beinen. Dies sollte ein Anhaltspunkt für <strong>die</strong> Berücksichtigung stadtteilpolitischer Themen<br />
sein. Die meisten Zuhörer wissen über <strong>die</strong> Bezirksversammlungen und <strong>die</strong><br />
angeschlossenen Institutionen zumindest eines: Daß <strong>die</strong>se kaum etwas Wichtiges<br />
entscheiden dürfen.<br />
Zu der - teilweise von den Me<strong>die</strong>n erfundenen - Politikverdrossenheit trägt auch bei, daß<br />
ausführlich und langatmig über politische Ereignisse berichtet wird, deren Belanglosigkeit<br />
schnell zu durchschauen ist. Bei <strong>Meldungen</strong> aus Kreis- und Bezirksversammlungen, aus<br />
Fachausschüssen und Senioren-Beiräten gibt es eine ganz wichtige Regel: Nehmen Sie<br />
Ihre Hörer nicht auf den Arm. Wenn es nun einmal aus untergeordneten politischen<br />
Gremien überhaupt nichts zu berichten gibt dann lassen Sie <strong>die</strong> Presse-Mitteilung liegen.<br />
Wünschen Sie dem Verbandssprecher, der Ihnen eine 100zeilige Meldung diktieren will,<br />
freundlich einen schönen Tag.<br />
Wenn Sie an einem Sonntag vormittag oder an einem Freitag abend nur eine solche<br />
belanglose Meldung haben und sonst gar nichts, dann formulieren Sie so knapp und<br />
interessant wie irgend möglich. Bei solchen <strong>Meldungen</strong> ist weitaus mehr Mühe<br />
erforderlich als bei Gesprächswert-<strong>Meldungen</strong>, Service-<strong>Meldungen</strong> oder nationalen/<br />
internationalen <strong>Meldungen</strong>. Sonst langweilen Sie Ihre Hörer.<br />
Beispiel:<br />
»Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Stadtdirektor. Diese Möglichkeit will jetzt der Vorstand der<br />
Mendener SPD überprüfen. Nachdem der Fraktionsvorstand Protokolle einer Dezernenten-<br />
Konferenz vom 20. September vergangenen Jahres eingesehen hatte, sah er sich in der<br />
Meinung bestätigt, daß Stadtdirektor Franz-Josef Lohmann ohne entsprechende<br />
Rechtsgrundlage gehandelt habe. Lohmann habe gegen einen Beschluß des Bauausschusses<br />
überprüfen lassen, ob auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne an der Bismarckstraße eine<br />
Schule eingerichtet werden könne.«<br />
Wer soll damit etwas anfangen können? Nichts stimmt: Der Lead-Satz soll offenbar durch<br />
<strong>die</strong> Themenmarke ersetzt sein, <strong>die</strong> Dienstaufsichtsbeschwerde aus der Themenmarke ist<br />
aber noch gar keine (wird ja erst geprüft), <strong>die</strong> Hörer rätseln über ominöse Protokolle einer<br />
56
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Konferenz, über deren Funktion man nichts erfährt, ein Satz bricht mit einer Länge von 27<br />
Wörtern munter Rekorde, und erst im letzten Satz wird vorsichtig angedeutet, um was es<br />
eigentlich geht - so wird Lokalpolitik zur Provinzposse. Man kann nur versuchen, <strong>die</strong>se<br />
Meldung zu retten.<br />
Besser:<br />
»Möglicherweise Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Stadtdirektor. Eine solche Beschwerde will<br />
möglicherweise <strong>die</strong> Mendener SPD gegen Stadtdirektor Franz-Josef Lohmann einreichen. Der<br />
Fraktionsvorstand der SPD wirft Lohmann vor, sich nicht an einen Beschluß des<br />
Bauausschusses gehalten zu haben. Nach Überzeugung des SPD-Vorstandes hat Lohmann<br />
eigenmächtig geprüft, ob auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne an der Bismarckstraße eine<br />
Schule eingerichtet werden kann. Eine solche Prüfung hatte der Bauausschuß ausdrücklich<br />
abgelehnt.«<br />
Immerhin vier Informationen in der Originalmeldung sind überflüssig: »Protokolle«,<br />
»Dezernenten-Konferenz«, »20. September«, »Rechtsgrundlage« Ehrlich währt auch in<br />
Lokal-Nachrichten am längsten, selbst bei Themenmangel und Sommerloch. Nicht jeder<br />
Hörer kennt sich in kommunalpolitischen Institutionen so gut aus, daß eine Einordnung<br />
eines Ereignisses möglich wäre. Das müssen <strong>die</strong> Hörer auch nicht, denn <strong>die</strong>s ist <strong>die</strong><br />
Aufgabe der Journalisten. Die <strong>die</strong>se Aufgabe nicht immer erfüllen.<br />
Beispiel:<br />
»Der Kerngebietsausschuß Stellingen hat sich gestern gegen eine Aufhebung des<br />
Landschaftsschutzgebietes Niendorfer Gehege ausgesprochen. Der Antrag war von der SPD,<br />
der CDU und den Grünen gemeinsam eingebracht worden. Die Baubehörde will quer durch das<br />
Niendorfer Gehege eine Verbindungsstraße zum Flughafen bauen. «<br />
Der ganz normale Hörer wird sich nun zu seinem Arbeitskollegen umdrehen und sagen<br />
»nu kommt das Ding doch nicht durch«. Und schon hat der Sender ein Stückchen<br />
Informationskompetenz verloren. Denn selbstverständlich muß am Ende <strong>die</strong>ser Meldung<br />
der wichtige, legendäre »hochauflösende« Satz stehen:<br />
»Der Beschluß des Kerngebietsausschusses hat für <strong>die</strong> Planungen der Baubehörde keine<br />
Auswirkungen«.<br />
und wenn <strong>die</strong> Zeit reicht:<br />
»..., weil das Niendorfer Gehege ausschließlich von der Stadt und nicht dem Bezirksamt<br />
verwaltet wird.«<br />
57
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
So ist <strong>die</strong> notwendige Erklärung mit einer Selbstkontrolle verbunden: Denn, wenn der<br />
Beschluß des Kerngebietsauschusses keine Auswirkungen hat, sollte man überlegen, ob<br />
<strong>die</strong>se Meldung nicht in den Papierkorb gehört.<br />
Es gibt aber auch <strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> bei allen Formulierungskünsten, aller Anstrengung und<br />
bei aller Verzweifelung über nicht vorhandene Themen nicht in <strong>die</strong> Sendung gehören.<br />
<strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> Hörer langweilen und <strong>die</strong> nach keinem einzigen Kriterium der<br />
Nachrichten-<strong>Auswahl</strong> eine Existenzberechtigung haben.<br />
Beispiel:<br />
»Kunststoffverarbeiter tauschen Erfahrungen aus. Rund 50 Unternehmen aus Hagen, dem<br />
Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis haben sich in Hagen zu einer Gruppe<br />
zusammengeschlossen. Der Kreis will sich in loser Folge über Fachthemen aus dem<br />
Kunststoffbereich austauschen. Organisiert werden <strong>die</strong> Veranstaltungen von der Industrie- und<br />
Handelskammer und dem Kunststoffinstitut in Lüdenscheid.«<br />
Sind wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden, aus <strong>die</strong>sem Langweiler noch eine<br />
passable Meldung zu machen? Hat man gefragt, ob <strong>die</strong> Kunststoff-Industrie im<br />
Sendegebiet wirtschaftliche Schwierigkeiten hat? Oder ob sie vor ungeahnten<br />
Umsatzsteigerungen steht? Wenn auch das alles nichts erbracht hat, um <strong>die</strong>sem<br />
substanzlosen Sechszeiler Leben einzuhauchen - ab in den Papierkorb.<br />
Dieses Beispiel soll aber keine Aufforderung sein, auf <strong>die</strong> ganz große Story zu warten. Es<br />
ist eine Aufforderung, an den anderen Geschichten »dran« zu bleiben. Das rettet über<br />
meldungsschwache Zeiten hinweg, verhindert, daß man »Kunstoffverarbeiter-<br />
Arbeitsgruppen« melden muß und demonstriert Kompetenz durch Kontinuität.<br />
Beispiel:<br />
»Rabiater Autofahrer ermittelt. Der Fahrer des VW-Bulli der vor zwei Wochen eine 27jährige<br />
Frau auf der Felsenmehrstraße angegriffen hatte, konnte von der Polizei ausfindig gemacht<br />
werden. Es handelt sich um einen 28jährigen Hemaraner. Die Polizei ermittelt zur Zeit noch <strong>die</strong><br />
näheren Tatumstände.«<br />
Das ist keine große Geschichte, aber sicher haben vor zwei Wochen viele Hörer <strong>die</strong>ses<br />
Lokal-Senders am Abendbrottisch oder am Arbeitsplatz über <strong>die</strong>sen Fall gesprochen. Und<br />
jetzt dreht sich Erwin wieder um und ruft zu seiner Frau im Wohnzimmer: »Erna, nu haben<br />
sie <strong>die</strong>sen ollen Schlägertypen« Und wo hat Erwin das erfahren - in seinem Lokalsender.<br />
58
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Auch kleine Geschichten im Lokalen oder der Region können meldenswert sein -<br />
wenn man journalistisch korrekt alles aus der Meldung herausholt. Nachfragen!<br />
Nachhaken! Dran bleiben! Wirkliche Null-<strong>Meldungen</strong> gehören dagegen in den<br />
Papierkorb.<br />
<strong>4.</strong>5 »Bonner«- oder Parlaments-<strong>Meldungen</strong><br />
Eine Meldung aus der unmittelbaren Umgebung der Hörer muß bei den Nachrichten fast<br />
immer Priorität vor Bonner Politik-<strong>Meldungen</strong> haben. Für landesweite Sender gilt <strong>die</strong>s mit<br />
Einschränkungen: Eine Top-Story aus dem Bundesland schlägt eine wichtige Meldung<br />
aus Bonn, aber von den Landes-Sendern werden in aller Regel Nachrichten-Angebote<br />
erwartet, <strong>die</strong> am ehesten mit der ARD-Tagesschau oder ähnlichen Sendungen zu<br />
vergleichen sind (siehe auch »Landes-Magazine«).<br />
<strong>Meldungen</strong> aus Bonn (das heißt alle bundespolitischen <strong>Meldungen</strong>) sind für das<br />
Programm eines Stadt- oder Regionalsenders nur von entscheidender Bedeutung, wenn<br />
sie zweifelsfrei einen gewissen Stellenwert im Tagesgespräch der Zuhörer haben oder<br />
das eng auszulegende Kriterium der Chronistenpflicht erfüllen. So wird über eine<br />
Bundestagsdebatte zum §218 auch berichtet werden, wenn <strong>die</strong> bevorstehende Diskussion<br />
noch nicht das Interesse der breiten Öffentlichkeit hat.<br />
Aber im Gegensatz zu den 50er und 60er Jahren hat das Radio und damit auch <strong>die</strong><br />
Radio-Nachricht eine Funktion weitgehend eingebüßt: Was Tagesgespräch ist,<br />
bestimmen heute weitgehend <strong>die</strong> Fernsehmagazine und (nach wie vor) <strong>die</strong> Zeitungen. Es<br />
ist nicht aussichtsreich, mit dem Medium Rundfunk ein Thema ins Gespräch bringen zu<br />
wollen, daß von den anderen Me<strong>die</strong>n nicht beachtet wird.<br />
Im Zweifelsfall - »Nehme ich <strong>die</strong>se bundespolitische Meldung mit oder nicht?« - sollten<br />
Sie sich fragen, ob <strong>die</strong>ses Ereignis auch auf den ersten drei Seiten einer renommierten<br />
Zeitung stehen könnte oder ob <strong>die</strong> ARD-Tagesschau <strong>die</strong> Meldung am Abend ebenfalls<br />
aufgreifen würde.<br />
59
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Kein Hörer wird sich für einen privaten oder regionalen Sender entscheiden, weil er dort<br />
etwas über bundespolitische Themen erfahren will. Die Hörer wollen zwar auch das<br />
Wichtigste aus Bonn, Berlin oder Frankfurt hören, aber eben nicht in erster Linie. Bei<br />
landesweiten privaten Sendern wird erwartet, daß zumindest das nationale und<br />
internationale Pflichtprogramm der Nachrichtenversorgung erfüllt wird.<br />
Der hohe Anteil an solchen »Bonner« oder zukünftig Berliner <strong>Meldungen</strong> in allen<br />
Nachrichten-Agenturen kann keine Orientierungshilfe für <strong>die</strong> Zusammenstellung der<br />
eigenen Sendung sein. Der Kellerbrand im Dortmunder Kaufhaus ist für <strong>die</strong> Nachrichten<br />
von Radio Dortmund und der S-Bahn-Ausfall in München für Radio Gong wichtiger als <strong>die</strong><br />
FDP-Präsidiums-Sitzung zu Bundeswehreinsätzen im Ausland, solange <strong>die</strong>se keine<br />
unmittelbaren Auswirkungen hat.<br />
Eine besondere Unterart der »Bonner« oder Parlaments-<strong>Meldungen</strong> sind <strong>die</strong><br />
Verlautbarungs-<strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> aber inzwischen auch bei den ARD-Anstalten immer mehr<br />
am Aussterben sind: Daß Herr Bundeskanzler ohne jeden aktuellen Anlaß meint, <strong>die</strong><br />
Wirtschaftslage als überragend darstellen zu müssen, ist sein gutes Recht - nur sollte das<br />
kein Journalist melden, der von seinen Hörern ernst genommen werden will.<br />
Bonner und internationale Politik ist für <strong>die</strong> Nachrichten lokaler und regionaler<br />
Sender wichtig, wenn sie einen objektiv anzunehmenden Gesprächswert unter den<br />
Zuhörern hat oder eine aus journalistischer Sicht jederzeit begründbare, wichtige<br />
Entwicklung dokumentiert (»Chronistenpflicht«).<br />
<strong>4.</strong>6 Chronistenpflicht<br />
Die Pflicht, wirklich wichtige politische oder gesellschaftliche Prozesse auch dann zu<br />
dokumentieren, wenn sie nicht gerade abgeschlossen oder abgebrochen werden, gilt für<br />
alle Nachrichten-Sendungen. Doch <strong>die</strong> <strong>Auswahl</strong>kriterien sind dabei ebenso streng<br />
auszulegen wie bei den Bonner <strong>Meldungen</strong>. Die x-te ergebnislose Sitzung des Stolpe-<br />
Untersuchungsausschusses ist keine Meldung, der vorläufige Abschlußbericht zur<br />
»Schubladen«-Affäre selbstverständlich. Zu <strong>die</strong>ser Chronistenpflicht gehört auch,<br />
Themen, <strong>die</strong> einst mit größter Aufmerksamkeit dargestellt wurden, sporadisch wieder<br />
60
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
aufzunehmen. Auch wenn es vielleicht nicht gerade einen wirklich zwingenden Anlaß gibt:<br />
Was ist aus dem großen Prozeß geworden, der am Anfang so stark beachtet wurde?<br />
Was ist aus der Gesetzes-Initiative geworden, <strong>die</strong> einst so lautstark begrüßt wurde? Was<br />
ist mit den Verbotsanträgen gegen <strong>die</strong> rechtsextremen Parteien, <strong>die</strong> vor neun Monaten<br />
eingereicht wurden?<br />
Erkundigen Sie sich einmal in der Presse-Stelle des Bundestages, wieviele<br />
Untersuchungssauschüsse noch tagen und wann das letzte Mal jemand über einen <strong>die</strong>ser<br />
Ausschüsse berichtet hat ... Das ist keine Nachricht? Doch - das gehört zum Nachrichten-<br />
Geschäft genauso dazu wie der Untergang eines Ozean-Dampfers.<br />
Es gibt auch eine falsch verstandene Chronistenpflicht - das Sendungsbewußtsein einiger<br />
ARD-Redaktionen, frei nach dem Motto: Ich halte es für wichtig, also müssen <strong>die</strong> Leute<br />
jetzt zuhören. Diese Berufsauffassung berücksichtigt nicht, daß <strong>die</strong> Hörer jederzeit zu<br />
einem Konkurrenzprogramm ausweichen können. Nachrichten sollen weder Schul- noch<br />
Bildungsfunk sein.<br />
Auf <strong>die</strong> lokale oder regionale Politik bezogen, ist das Kriterium der Chronistenpflicht<br />
selbstverständlich großzügiger anzulegen: Auch <strong>die</strong> lllte Stunde der<br />
Koalitionsverhandlungen ist dann Gegenstand der Berichterstattung (wenn auch in der<br />
gebotenen Kürze).<br />
Nachrichten dokumentieren Ereignisse abgesehen von allen anderen Kriterien, wenn<br />
sie für <strong>die</strong> politische oder gesellschaftliche Entwicklung eine tatsächliche<br />
Veränderung bedeuten oder bedeuten könnten. Das Kriterium ist mit wachsender<br />
Entfernung zum Sendegebiet immer enger auszulegen.<br />
<strong>4.</strong>7 Bunte <strong>Meldungen</strong><br />
Eine bunte Meldung ist noch lange keine Gesprächswert-Meldung:<br />
61
AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP<br />
EILT<br />
ZNV-Nr: 28.6.00554 Eingang: 09:07<br />
REAG.NORD. TIER, WASS<br />
AP-071 2 vm 61 APD 3258<br />
Alligator-1 VORRANG<br />
Vorrang<br />
Kaiman lebend gefangen<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Im Sommer 1994 berichteten alle Me<strong>die</strong>n tagelang über den Kaiman »Sammy«, der<br />
seinem Besitzer entwischt und in einem Baggersee untergetaucht war. Darüber sprach<br />
<strong>die</strong> Nation, das war ein Gesprächs-Thema. Einer bunten Meldung hätte <strong>die</strong> Agentur ap<br />
auch nie <strong>die</strong> Einstufung »Vorrang« verliehen, <strong>die</strong> normalerweise z. B. bei dem Tod<br />
prominenter Persönlichkeiten eingesetzt wird.<br />
Bunte <strong>Meldungen</strong> dagegen sind meistens skurril, oft makaber und haben eines<br />
gemeinsam: Sie sind selten Gesprächsstoff, sie sollen <strong>die</strong> Hörer nur für einige Sekunden<br />
zum Schmunzeln oder zum Schaudern bringen.<br />
Als Ende der 80er Jahre <strong>die</strong> betuliche Frankfurter Allgemeine Zeitung auf der ersten Seite<br />
<strong>die</strong> Meldung »Bauer sah Ufo-Schwarm« druckte, war <strong>die</strong>s noch ein Me<strong>die</strong>n-Ereignis:<br />
Bunte <strong>Meldungen</strong> wurden lange Zeit verschämt auf der letzten Seite der Zeitung<br />
untergebracht, durchaus mit dem Wissen der Redaktionsleiter, daß <strong>die</strong> »vermischte«<br />
Seite zu den meistgelesenen Abschnitten seines Blattes gehört. Inzwischen schreibt <strong>die</strong><br />
Süddeutsche Zeitung auf der Titelseite »Deutsche werden immer fetter! « und<br />
unterhaltende <strong>Meldungen</strong> ziehen von ihren Plätzen in der Magazin-Sendung immer<br />
stärker in <strong>die</strong> Nachrichten-Sendung ein. Doch während der Leser einer Zeitung <strong>die</strong><br />
Möglichkeit hat eine ihn nicht interessierende »lustige« Meldung zu überlesen, ist der<br />
Radio-Hörer der Nachrichten-<strong>Auswahl</strong> des Redakteurs ausgeliefert.<br />
Kaum etwas ist peinlicher als eine bunte Meldung, <strong>die</strong> von den Zuhörern weder als<br />
originell noch als witzig betrachtet wird. Es gibt nur einen Ausweg: Die bunten <strong>Meldungen</strong><br />
62
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
bleiben der Magazin-Sendestrecke vorbehalten, in den Nachrichten haben sie nichts zu<br />
suchen, schon gar nicht als Pflichtveranstaltung. Es gibt ohnehin selten ausreichend gute<br />
bunte Hörfunk-<strong>Meldungen</strong>, wenn aber der »lustige Aussteiger« zur Pflicht wird, kommen<br />
Redakteure bei der Suche nach einem entsprechenden Ereignis in größte<br />
Schwierigkeiten. Als Aussteiger aus längeren Nachrichten-Magazinen können sie<br />
allerdings durchaus gebraucht werden, weil hier ohnehin eine lockerere Präsentation<br />
angebracht ist.<br />
Bunte <strong>Meldungen</strong> sollten im Gegensatz zu den Gesprächswert-Themen den<br />
Unterhaltungsmagazinen vorbehalten bleiben.<br />
<strong>4.</strong>8 Wetter-<strong>Meldungen</strong><br />
Die Wetter-Meldung ist Service und Gesprächswert zugleich - <strong>die</strong> Hörer werden sich<br />
vielleicht nicht mehr an <strong>die</strong> dritte Meldung erinnern können, aber mit Sicherheit daran, ob<br />
Regen zu erwarten ist oder nicht. Am Ende der Nachrichten wird das Wetter ausführlicher<br />
präsentiert: Ist eine höhere Ozonbelastung oder sogar Smog zu erwarten? Wie wird das<br />
Wetter zum Feierabend? Muß mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden?<br />
Wie wird es in den nächsten 48 Stunden, besonders am Wochenende?<br />
Bei Sendern, <strong>die</strong> ihre Nachrichten mit Schlagzeilen beginnen, sollte als letzte Schlagzeile<br />
eine Wetter-Schlagzeile stehen.<br />
Beispiel:<br />
»Heute nachmittag um 13 Grad, schwachwindig und trocken. Die <strong>Meldungen</strong> ... «<br />
Auch eine noch plakativere Plazierung ist denkbar:<br />
>JINGLE: >Nachrichten!«<<br />
»Das Wetter: Schwachwindig, gelegentlich leichter Sprühregen, um 13 Grad.«<br />
»Die Schlagzeilen: Ozon-Alarm in Frankfurt/ Oder ausgelöst.«<br />
»In Frankfurt /Oder ist heute nachmittag der sogenannte Ozon-Alarm ausgelöst worden.«<br />
63
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Der Wetterbericht hat viel von seinem Verlautbarungs-Charakter verloren und ist zum<br />
wichtigen Service-Element geworden. Inzwischen bemüht sich sogar <strong>die</strong> ARD-<br />
Tagesschau darum, einen allgemeinverständlichen Wetterbericht zu präsentieren. Wenn<br />
wir akzeptieren, daß <strong>die</strong> Wettervorhersage für viele Hörer sehr wichtig ist, dann müssen<br />
wir uns entsprechend bemühen, eine interessante und nutzwertorientierte Vorhersage<br />
anzubieten.<br />
Also nicht:<br />
»Ein Grönlandtief über dem Baltikum verändert seine Lage nur langsam, an seiner Rückseite<br />
gelangt zunächst mäßig warme Luft in den Vorhersagebereich, <strong>die</strong> später unter<br />
Hochdruckeinfluß gerät ... «<br />
Diese Form des Wetterberichtes gehört auch bei den meisten ARD-Nachrichten der<br />
Vergangenheit an. Zu Recht: Der Autor hält sich ja nicht einmal an <strong>die</strong> grundlegende<br />
Regel, daß das Wichtigste am Anfang einer Meldung stehen muß. Im Gegenteil - <strong>die</strong>ser<br />
Aufbau ist chronologisch, so wurden Zeitungsmeldungen um <strong>die</strong> Jahrhundertwende<br />
formuliert.<br />
Stattdessen:<br />
»Heute werden <strong>die</strong> Temperaturen bis auf 15 Grad steigen. Gegen nachmittag wird es noch<br />
wärmer, dann können bis zu 20 Grad erreicht werden.«<br />
Die neueste Errungenschaft ist <strong>die</strong> prozentuale Regenwetter-Prognose: Wer denkt, daß<br />
<strong>die</strong>se Angaben <strong>die</strong> Erfindung des jeweiligen Nachrichten-Redakteurs sind, der irrt. Diese<br />
Daten werden neuerdings vom Wetter<strong>die</strong>nst geliefert. Ob <strong>die</strong> Angabe<br />
»Regenwahrscheinlichkeit 30 Prozent« wissenschaftlich haltbar ist, mag dahingestellt<br />
bleiben. Aber es hört sich auf jeden Fall sachlicher, nachrichtlicher an als »am Nachmittag<br />
kann es vereinzelt regnen«.<br />
Daß in den Wetterbericht auch Warnungen vor Smog und Ozon gehören - solange <strong>die</strong>se<br />
nicht ohnehin als normale Meldung am Anfang der Sendung stehen - versteht sich von<br />
selbst.<br />
Einige Sender leisten sich einen »Wetter-man« oder eine »Wetter-woman« Als O-Ton<br />
über Telefon oder im Studio stellt er oder sie <strong>die</strong> Wetteraussichten vor. Diese Form der<br />
Wetterberichterstattung hat zwei Vorteile, wenn sie professionell erfolgt:<br />
64
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
1. Der Wetter-man ist wesentlich schneller als der Wetter<strong>die</strong>nst, er/ sie kann aktuell<br />
auf Veränderungen reagieren und den Bericht immer genau dem Programm-Format<br />
anpassen.<br />
2. Ein Wetter-O-Ton-Bericht kann lockerer präsentiert werden als der normale<br />
Meldungsteil. So kann der Wetter-Berichterstatter als Bindeglied wirken, eine<br />
unauffällige Verknüpfung zwischen Nachrichten und der anschließend beginnenden<br />
Magazin-Sendung ist möglich.<br />
Bei O-Ton-Nachrichten spricht nichts dagegen, mit einem Wetter-Reporter zu arbeiten.<br />
Bei den landesweiten Sendern liegen <strong>die</strong> Kosten für einen Wetter-man kaum höher als für<br />
das Abonnement beim Deutschen Wetter<strong>die</strong>nst.<br />
Die Wetter-Schlagzeile zu Beginn der Sendung unterstreicht <strong>die</strong> Bedeutung, <strong>die</strong> der<br />
Hörer <strong>die</strong>sem Nachrichten-Bestandteil beimißt. Entsprechend hörerorientiert wird der<br />
Wetterbericht am Ende der Sendung formuliert. Unverständliche Fachausdrücke sind<br />
auch im Wetterbericht nicht erlaubt. Wann immer <strong>die</strong>s möglich ist, werden<br />
Wetterberichte serviceorientiert aufgebaut, damit Hörer einen möglichst großen<br />
Nutzen von <strong>die</strong>ser Vorhersage haben. Die Menschen wollen nicht wissen, ob ein<br />
Grönlandtief kommt, sondern ob sie den Regenschirm mitnehmen müssen.<br />
<strong>4.</strong>9 Exklusiv-<strong>Meldungen</strong><br />
Wenn sich ein Politiker / Prominenter / Experte in einem Exklusiv-Interview geäußert hat,<br />
ist ein entsprechender Interview-Ausschnitt selbstverständlich Bestandteil der nächsten<br />
Nachrichten-Sendung. Wird das aufgezeichnete Interview erst nach den Nachrichten<br />
gesendet, darf ein entsprechender Hinweis auf <strong>die</strong> Sendezeit des vollständigen Interviews<br />
nicht fehlen.<br />
»Das vollständige Interview hören Sie um ... « »Weitere Informationen zu <strong>die</strong>sem Thema ... «<br />
Da der Hörer erwarten darf, nur aussagekräftige und relevante Interviews auf der<br />
Frequenz zu hören, sollten entsprechende <strong>Meldungen</strong> dazu in den Nachrichten prominent<br />
plaziert werden.<br />
65
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Das Interview oder der Interview-Ausschnitt müssen als eigene journalistische Leistung<br />
gekennzeichnet werden:<br />
• »... in einem Radio X Interview ... « (o.ä.)<br />
• »... XY sagte in Radio X: ... «<br />
Nachrichtensprecher:<br />
»Für eine private Hochschule in Görlitz hat sich jetzt der Universitätsverein ausgesprochen. Wie<br />
der Vorsitzende Ralf K. gegenüber Radio X erklärte, überlege man derzeit, wie ein solches<br />
Projekt zu realisieren sei.<br />
Wir wissen um <strong>die</strong> finanziellen Nöte und Schwierigkeiten im Freistaat. Wir können nur<br />
annehmen, daß sich das in den nächsten zehn Jahren verändern wird, so daß irgendwann mal<br />
wieder jemand <strong>die</strong> Möglichkeit sieht, eine solche private Hochschuleinrichtung mitzutragen und<br />
mitzufinanzieren, sofern in dem Freistaat bis dahin nicht solche Bedingungen sind, daß wir<br />
unser eigentliches Ziel, <strong>die</strong> Gründung einer staatlichen Universität erreichen.«<br />
Bei aller Liebe zur Exklusiv-Meldung: »Gegenüber« einem Sender mag sich alles<br />
mögliche befinden, aber nur selten der Interviewpartner - auch der Interviewpartner erklärt<br />
meistens nichts. Also korrekt: »Wie der Vorsitzende Ralf K. Radio X sagte ... / ... unserem<br />
Sender sagte ... «<br />
Für selbstrecherchierte Geschichten gelten andere Gesetze: Hier ist es erlaubt, ein<br />
Thema »höher zu hängen« als es normalerweise - wenn es von einer Nachrichten-<br />
Agentur stammen würde - der Fall wäre. Schließlich wollen wir für unsere Nachrichten<br />
werben, wie könnte das besser geschehen als mit der eigenen, exklusiven Story? Dazu<br />
gehört auch <strong>die</strong> »eigene Drehe«. Wenn also aus Ruanda gemeldet wird, daß deutsche<br />
Helfer vorzeitig aus den Flüchtlingslagern zurückkehren werden, wird in der Nachrichten-<br />
Redaktion sofort <strong>die</strong> rote Warnlampe angehen: Wann kommen <strong>die</strong> Helfer zurück und vor<br />
allem - ist ein Helfer aus unserer Region / Stadt / unserem Bundesland dabei?<br />
Ein Reporter wird <strong>die</strong> zurückkehrenden Helfer am Bahnhof oder Flughafen empfangen<br />
und sich ihre Version der Geschichte erzählen lassen. Für <strong>die</strong> Hörer Ihrer Station ist es<br />
viel spannender, wenn ein Mitbürger aus Ruanda erzählt, als wenn es der Sprecher <strong>die</strong>ser<br />
Hilfsorganisation in Bonn tut.<br />
66
<strong>4.</strong>10 Eil-<strong>Meldungen</strong> und Agenturgläubigkeit<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Nachrichten-Agenturen werden fälschlicherweise als unfehlbare, einzige Instanz<br />
angesehen, wenn es um <strong>die</strong> Wichtigkeit und <strong>die</strong> Einordnung von Ereignissen geht. Dabei<br />
wird übersehen, daß auch eine Agentur-Meldung von mehreren Journalisten ausgewählt,<br />
geprüft, gekürzt und redigiert wird. Dieser Weg über vier Stationen macht deutlich, daß <strong>die</strong><br />
Regel der zweiten Bestätigung einen Sinn hat: je sensationeller eine überraschende<br />
Meldung erscheint, desto wichtiger ist, <strong>die</strong> Meldung einer weiteren Nachrichtenagentur als<br />
Bestätigung zu erhalten, oder aber aus einer anderen, sicheren Quelle <strong>die</strong> Information<br />
bestätigen zu lassen.<br />
Warum <strong>die</strong>se zweite Bestätigung so wichtig ist, wurde den Journalisten in aller Welt durch<br />
eine Meldung der Nachrichten-Agentur ap deutlich: Als Charles De Gaulle 1958 erneut<br />
französischer Präsident wurde, meldete ein junger Korrespondent der ap, daß Tausende<br />
voller Panik <strong>die</strong> Hauptstadt Paris verlassen. Der Reporter hatte übersehen und mangels<br />
Sprachkenntnisse auch überhört, daß <strong>die</strong> Pariser immer mit Sack und Pack und<br />
quietschenden Reifen ihre Stadt verlassen wenn <strong>die</strong> Ferien beginnen.<br />
Unseriöse Kollegen sollten auch Anlaß genug sein, bei wichtigen Ereignissen niemals nur<br />
einer Quelle zu glauben. Ein freier Journalist verbreitete in einer Situation, in der nur ein<br />
Funke zur Explosion fehlte, eine Meldung, <strong>die</strong> in Hamburg Geschichte machte. Der<br />
Reporter meinte entdeckt zu haben, daß <strong>die</strong> Räumung der umstrittenen Häuser an der<br />
Hafenstraße unmittelbar bevorsteht, eine Kolonne mit schweren Polizeifahrzeugen würde<br />
sich bereits nähern. Daraufhin bereiteten sich <strong>die</strong> Bewohner der Häuser auf »Widerstand<br />
mit allen Mitteln« vor, <strong>die</strong> Verhandlungen schienen ja gescheitert zu sein. In Wirklichkeit<br />
war <strong>die</strong> Fahrzeugkolonne gerade dabei, Hamburg zu verlassen ...<br />
Ob und wieviele Radio-Sender den Schnellschuß <strong>die</strong>ses Kollegen verbreitet haben, ist<br />
nicht überliefert. Heute könnte man leider davon ausgehen, daß <strong>die</strong> Mehrheit aller Sender<br />
<strong>die</strong>se Nachricht sofort bringen würden: Die Schnelligkeit, mit der Eil-<strong>Meldungen</strong><br />
ausgestrahlt werden, hat sich zu einem Sport unter Programm-Anbietern entwickelt. Dabei<br />
ist es für <strong>die</strong> Hörer höchst uninteressant, ob sie von dem schweren Erdbeben in Los<br />
Angeles um 6.13 Uhr oder 6.16 Uhr erfahren. Wer einen vermeintlichen Giftunfall in seiner<br />
67
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Stadt oder sogar einen Störfall im benachbarten Atomkraftwerk meldet, ohne eine sichere<br />
Bestätigung der ersten Meldung oder der ersten Information abzuwarten, handelt<br />
unprofessionell und verantwortungslos.<br />
Verfälschungen und Irritationen entstehen nicht nur, wenn sich Nachrichtenagenturen mit<br />
Ereignissen fernab der Redaktionszentrale beschäftigen. Es kommt durchaus vor, daß <strong>die</strong><br />
<strong>Meldungen</strong> für den Landes<strong>die</strong>nst einer renommierten deutschen Nachrichtenagentur von<br />
der Sekretärin eines Hörfunk-Studios verfaßt werden, weil <strong>die</strong> Korrespondentenstelle der<br />
Agentur dort gerade nicht besetzt ist. Hinzu kommt daß bei <strong>die</strong>ser Agentur der Dienstleiter<br />
des Landes<strong>die</strong>nstes dermaßen überlastet ist daß ein Überprüfen, ein Nachfassen bei<br />
Ungereimtheiten in zugelieferten <strong>Meldungen</strong> nur in Ausnahmefällen möglich ist.<br />
Um Korrespondenten-<strong>Meldungen</strong> der Agenturen aus dem Ausland richtig einschätzen zu<br />
können, darf man einen Umstand nicht vergessen: Auch Agentur-Journalisten unterliegen<br />
in vielen Ländern einer Zensur, <strong>die</strong> erhebliche Einfluß auf ihre Berichterstattung haben<br />
kann. Nicht daß <strong>die</strong> Kollegen bewußt <strong>die</strong> offizielle Regierungsmeinung verbreiten würden,<br />
aber oft bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als bestimmte Informationen wegzulassen -<br />
<strong>die</strong>s geschieht oft auf eine »Bitte« der Regierung hin. Auch europäische und US-<br />
amerikanische Journalisten machten Erfahrungen mit der Zensur, als sie während des<br />
zweiten Golfkrieges von den Vertretern der Anti-Irak-Koalition ausschließlich gefilterte und<br />
verfälschte Informationen geliefert bekamen.<br />
Als US-Außenminister Baker zu Beginn seiner Nahost-Friedensmission in Amman eine<br />
gemeinsame Pressekonferenz mit dem jordanischen König Hussein gab, passierte etwas,<br />
was aus jordanischer Sicht unerhört ist: Nachdem <strong>die</strong> beiden Staatsmänner ihre kurzen<br />
Statements abgegeben hatten, dankte der Monarch den Journalisten für ihre<br />
Aufmerksamkeit und wollte mit seinem Gast den Raum verlassen. Darauf sprangen <strong>die</strong><br />
Korrespondenten auf, <strong>die</strong> Baker in seinem Troß aus Washington mitgebracht hatte und<br />
riefen den Politikern ihre Fragen zu. Ein sichtlich erschütterter König Hussein beschied<br />
den Journalisten daraufhin, daß <strong>die</strong>se Pressekonferenz zuende sei, Fragen seien nicht<br />
erwünscht. Die einheimischen Kollegen, <strong>die</strong> natürlich keine Fragen gestellt hatten, erklärte<br />
daraufhin den verdutzten Amerikanern, daß sich der König nun einmal selbst aussuche,<br />
welche Fragen er sich anhört und welche nicht. Dabei ist nicht zu vergessen, daß<br />
Jordanien im Vergleich zu seinen Nachbarländern schon sehr demokratische Züge trägt.<br />
68
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Verantwortungsvolle Nachrichten-Redakteure benutzen auch zugelieferte Agentur-<br />
<strong>Meldungen</strong> nur mit der gebotenen Sorgfalt. Agentur-<strong>Meldungen</strong> werden nicht von<br />
unbeeinflußbaren Recherche-Computern geschrieben, sondern von Kolleginnen und<br />
Kollegen, <strong>die</strong> unter zum Teil schwierigen Bedingungen versuchen, neutral und<br />
unabhängig zu berichten.<br />
Die Bewertungsmaßstäbe und <strong>die</strong> Einstufung der Meldung durch <strong>die</strong> Presse-Agentur<br />
können nur ein Anhaltspunkt sein. Die üblichen Kategorien von »4« (Buntes, Vermischtes,<br />
Hintergrund) bis »l« oder »Vorrang« (nur Spitzen-<strong>Meldungen</strong>) sind inzwischen fast nur<br />
noch für den agenturinternen Arbeitsablauf von Bedeutung. Um <strong>die</strong> Meldung innerhalb der<br />
eigenen Sendung an den richtigen Platz zu stellen, taugen <strong>die</strong>se Einstufungen nur selten.<br />
Vor allem bei Eil-<strong>Meldungen</strong>, <strong>die</strong> Reaktionen unter den Zuhörern auslösen könnten<br />
oder <strong>die</strong> presserechtlich schwierig zu beurteilen sind und an deren Inhalt Zweifel<br />
bestehen, muß auf <strong>die</strong> Bestätigung durch eine weitere Agentur oder eine andere<br />
verläßliche Quellegewartet werden. Agentur-<strong>Meldungen</strong> allgemein können als<br />
Anhaltspunkt für <strong>die</strong> Gewichtung der einzelnen <strong>Meldungen</strong> nur sehr eingeschränkt<br />
herangezogen werden.<br />
<strong>4.</strong>11 Null-<strong>Meldungen</strong><br />
Auch und gerade an nachrichtenschwachen Tagen ist Verzicht oft mehr. Es ist ein Irrtum,<br />
anzunehmen, daß Hörer nicht merken, ob eine Meldung völlig belanglos ist oder nicht. Sie<br />
merken es - und könnten sich für ein anderes Programm entscheiden, das so ehrlich ist,<br />
nur zwei Minuten Nachrichten zu machen, wenn es nichts zu melden gibt. <strong>Meldungen</strong> wie<br />
im nächsten Beispiel sind Abschaltfaktoren.<br />
Beispiel:<br />
»Die deutschen Firmen im Ausland sollten nach Meinung der Hamburger Handelskammer das<br />
in Deutschland übliche duale Ausbildungssystem exportieren. Damit könnten sie<br />
Auslandsmärkte sichern und <strong>die</strong> Qualifikation der ortsansässigen Fachkräfte verbessern, sagte<br />
Kammergeschäftsführer Gerhard Schröder auf der »Asien- Pazifik«-Konferenz der deutschen<br />
Wirtschaft in Bangkok.«<br />
69
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Diese Meinungsäußerung ist von einer solchen Belanglosigkeit, daß es sich um eine<br />
klassische Null-Meldung handelt. »Wen könnte das interessieren?«, <strong>die</strong>se Frage hat sich<br />
der Redakteur nicht gestellt. Eine Umfrage würde darüber hinaus ergeben, daß viele<br />
Hörer nicht wissen, was mit dem »dualen Ausbildungssystem« gemeint ist. Der Autor hat<br />
sich <strong>die</strong> Mühe gespart, <strong>die</strong>sen Begriff zu erklären.<br />
Wo sollen wir denn <strong>Meldungen</strong> hernehmen - <strong>die</strong>se Frage wird auf Seminaren häufig<br />
gestellt, vor allem von Mitarbeitern der Lokal-Stationen. Darauf gibt es nur eine Antwort:<br />
Wenn man alles mögliche getan hat, um Kontakte zu Verbänden, Institutionen und<br />
Amtsstellen zu knüpfen, wenn <strong>die</strong> Reporter jeden Grashalm wachsen hören und der<br />
Geschäftsführer dafür gesorgt hat, daß der Landes<strong>die</strong>nst von dpa in der Redaktion<br />
aufläuft - dann hat man sich nichts vorzuwerfen, wenn man trotzdem einmal vor einem<br />
Themenloch steht.<br />
Allerdings kann sich kaum ein Lokalsender den Luxus erlauben, mittelmäßig spannende<br />
<strong>Meldungen</strong> so zu präsentieren, daß der einzige interessante Aspekt dabei verloren geht.<br />
Beispiel:<br />
»Mit einer Jubiläumsmünze würdigt <strong>die</strong> Peitiger Einrichtung Herzog-Sägmühle anläßlich ihres<br />
einhundertjährigen Bestehens ihren Begründer Adolf von Kahl. 1894 hatte er <strong>die</strong> Arbeiterkolonie<br />
Herzog-Sägmühle gegründet. Die Peitiger Einrichtung entwickelte sich seit ihrer Gründung zu<br />
einem Ort zum Leben für Kinder, jugendliche und Erwachsene mit Problemen, Krankheit oder<br />
Behinderung. Hilfen zur persönlichen Entwicklung leistet <strong>die</strong> Einrichtung mit Wohngruppen und<br />
Beratungs<strong>die</strong>nsten in der Region. Die Vorderseite der Jubiläumsmünze zeigt das Portrait des<br />
Begründers im Profil. Auf der Rückseite ist das Herzog-Sägmühler Wahrzeichen, ein Häuschen<br />
mit dem Kroning-Kreuz abgebildet.«<br />
Die Meldung ist schlecht aufgebaut und einige wichtige, aber recherchierbare Details<br />
fehlen. Der rote Faden ist eher ein rosa Knäuel denn der Hintergrund des Ereignisses<br />
steht im zweiten Satz. Zunächst müßte <strong>die</strong> Meldung also umgestellt werden.<br />
Besser:<br />
»Die Peitiger Einrichtung Herzog-Sägmühle würdigt ihren Begründer Adolf von Kahl jetzt mit<br />
einer Jubiläumsmünze. Die Vorderseite der Jubiläumsmünze zeigt das Portrait des Begründers<br />
im Profil. Auf der Rückseite ist das Herzog-Sägmühler Wahrzeichen, ein Häuschen mit dem<br />
Kroning-Kreuz abgebildet. 1894 hatte Adolf von Kahl <strong>die</strong> Arbeiterkolonie Herzog-Sägmühle<br />
gegründet. Die Peitiger Einrichtung entwickelte sich seit ihrer Gründung zu einem Ort für Kinder,<br />
Jugendliche und Erwachsene mit Problemen, Krankheit oder Behinderung. Hilfen zur<br />
persönlichen Entwicklung leistet <strong>die</strong> Einrichtung mit Wohngruppen und Beratungs<strong>die</strong>nsten in der<br />
Region.«<br />
70
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Der Anlaß ist dürftig, der Hintergrund-Teil ist offenbar als Ausgleich ausufernd geworden.<br />
Aber stand wirklich nicht mehr in der Presse-Mitteilung? Ein kurzer Anruf bei der<br />
Einrichtung hätte vielleicht gereicht, um <strong>die</strong>se sicher nicht für viele Menschen<br />
faszinierende Meldung aufzuwerten.<br />
Besser:<br />
»Die 100 Jahre alte Sozialeinrichtung Herzog-Sägmühle in Peitig hat heute eine<br />
Jubiläumsmünze vorgestellt. Die Münze kann ab morgen in zahlreichen Geschäften des<br />
Landkreises gekauft werden, sie kostet zehn Mark. Von dem Kaufpreis kommen fünf Mark der<br />
Herzog-Sägmühle zugute. Die Vorderseite der Silber-Münze zeigt das Portrait des Gründers,<br />
Adolf von Kahl. Kahl hatte <strong>die</strong> Sozialeinrichtung vor genau einhundert Jahren gegründet. Die<br />
Einrichtung hilft seitdem Menschen mit Problemen, Krankheiten oder Behinderungen.«<br />
<strong>4.</strong>12 Vorab-<strong>Meldungen</strong> anderer Me<strong>die</strong>n<br />
»Wie der SPIEGEL in seiner neuesten Ausgabe berichtet« - <strong>die</strong>ser Satz ist in<br />
vielen Nachrichten-Sendungen am Sonnabend ab 14 Uhr zu hören. Denn<br />
pünktlich zum Wochenend-Themenloch sendet das Magazin seine Vorab<br />
<strong>Meldungen</strong> an <strong>die</strong> Agenturen, <strong>die</strong>se verbreiten sie gerne weiter. Immer mehr<br />
Magazine versuchen mit Vor-ab-<strong>Meldungen</strong> einen Werbeeffekt zu erzielen.<br />
Jeder, der <strong>die</strong>se sogenannten »Klapper-<strong>Meldungen</strong>« verwendet, nimmt das<br />
Risiko in Kauf, daß er für <strong>die</strong> unkorrekte Arbeit anderer Redakteure später<br />
seinen Kopf hinhalten muß.<br />
Ein Beispiel: Ein Nachrichten-Magazin berichtete in einer solchen Vorab-Meldung 1994<br />
»exklusiv«, daß hinter dem Brandanschlag auf <strong>die</strong> jüdische Synagoge in Lübeck<br />
vermutlich radikale Palästinenser stehen. Daß <strong>die</strong>se peinliche Falsch-Meldung nicht<br />
korrigiert wurde, spricht nicht gerade für journalistische Seriösität.<br />
Andere Zeitungen versuchen gerne, mit sensationellen Umfrage-Ergebnissen in <strong>die</strong><br />
Nachrichten-Sendungen zu kommen: »Deutsche Männer ab 40 bevorzugen rote Autos«<br />
entspringt nicht der Phantasie; <strong>die</strong>ses »Umfrage-Ergebnis« wurde tatsächlich als Vorab-<br />
Meldung veröffentlicht. Wer es weiter verbreitet, ist selbst schuld.<br />
Daß sich Zurückhaltung bei <strong>Meldungen</strong> der Boulevard-Presse besonders auszahlt wurde<br />
im Sommer 1994 deutlich: Eine Boulevard-Zeitung berichtete, daß Jugendliche mit<br />
71
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
gestohlenen Autos gegen Bäume rasen, weil sie es so toll finden, wenn der Air-bag<br />
aufgeht - auch das plakative Schlagwort war schnell gefunden: Air-Bagging. Diese<br />
Geschichte ließ sich mitten im Sommer blendend über andere Me<strong>die</strong>n an <strong>die</strong><br />
Öffentlichkeit transportieren. Bis eine andere Zeitung herausbekam, daß es sich bei dem<br />
Air-Bagging um eine Erfindung des Reporters handelte.<br />
Jede Redaktion sollte für sich festlegen, von welchen Me<strong>die</strong>n man Vorab-<strong>Meldungen</strong><br />
übernimmt und von welchen nicht. Während Spiegel und Stern sowie <strong>die</strong> großen<br />
Tageszeitungen und <strong>die</strong> renommierte Fachpresse ruhigen Gewissens ausgewertet<br />
werden können, ist bei den Hochglanz-Info-Illustrierten und den Boulevard-Blättern<br />
Vorsicht angebracht<br />
.<br />
72
Meldungs- Typen<br />
1934<br />
•Unmittelbarkeit eines Ereignisses<br />
•räumliche Nähe<br />
• Prominenz der beteiligten Personen<br />
•Ungewöhnlichkeit<br />
•Konflikt<br />
•Spannung<br />
•Emotionen<br />
•Auswirkungen<br />
1994<br />
•Aktuelle <strong>Meldungen</strong><br />
u.a. Lokal-<strong>Meldungen</strong><br />
•Gesprächswert- <strong>Meldungen</strong><br />
•diverse Kategorien<br />
•Human- Interest- <strong>Meldungen</strong><br />
•Service <strong>Meldungen</strong><br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Übereinstimmend gehen <strong>die</strong> Nachrichtenwert-Theoretiker von <strong>die</strong>sen oder sehr ähnlichen<br />
Katalogen aus, nach denen ihrer Auffassung nach der Journalist seine <strong>Auswahl</strong>-<br />
Entscheidung treffen sollte. Äußere Einflüsse auf <strong>die</strong>se <strong>Auswahl</strong> spielen nur eine<br />
untergeordnete Rolle. Allerdings verweisen Laurence R. Campbell/ Roland E. Wolseley<br />
(1961) darauf, daß <strong>die</strong> objektive <strong>Auswahl</strong> anhand <strong>die</strong>ser Prüfsteine durch <strong>die</strong> redaktionelle<br />
Linie des Mediums und <strong>die</strong> angestrebte Zielgruppe beeinflußt wird. Die redaktionelle<br />
Leitlinie nehmen sie in einer Überarbeitung ihres Modells später als gleichwertigen<br />
Einflußfaktor auf. Die Faktoren-Tabelle von Warren findet sich auch heute noch in US-<br />
Lehrbüchern für Journalisten - wie »lngre<strong>die</strong>nzien nach Art eines Kochbuchs<br />
zusammengestellt« (Noelle-Neumann (1991, S. 235).<br />
Daß <strong>die</strong>se Nachrichtenwert-Faktoren nahezu allgemeingültig sind, wurde in mehreren<br />
Versuchen nachgewiesen: Unter anderem wurde so festgestellt, daß indische und US-<br />
amerikanische Journalisten anhand einer vorliegenden Nachrichtenwert-Tabelle fast<br />
identisches Meldungsmaterial auswählen.<br />
Die in den 60er Jahren entstandene europäische NachrichtenwertForschung geht über <strong>die</strong><br />
in den USA formulierten Faktoren-Auflistungen hinaus: Johan Galtung und Mari Holmboe<br />
73
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Ruge (1970) verweisen auf weitere <strong>Auswahl</strong>-Faktoren. Ihre Auflistung ist bislang <strong>die</strong><br />
Grundlage der europäischen Nachrichtenwert-Theorie:<br />
Nachrichten-Faktoren nach Galtung/Ruge<br />
Nachrichten- Faktoren nach Galtung/Ruge<br />
Nachrichten - Faktor 1 Frequenz: Je mehr der<br />
zeitliche<br />
Ablauf eines Ereignisses der<br />
Erscheinungsperiodik der<br />
Me<strong>die</strong>n entspricht, desto<br />
wahrscheinlicher wird das<br />
Ereigniss zur Nachricht.<br />
Nachrichten - Faktor 2 Schwellenfaktor: Es gibt einen<br />
bestimmten Schwellenwert<br />
der<br />
Auffälligkeit, den ein Ereignis<br />
überschreiten muß, damit es<br />
registriert wird.<br />
Nachrichten - Faktor 3 Eindeutigkeit: Je eindeutiger<br />
und<br />
überschaubarer ein Ereignis<br />
ist,<br />
desto eher wird es zur<br />
Nachricht.<br />
Nachrichten - Faktor 4 Bedeutsamkeit: Je größer <strong>die</strong><br />
Tragweite eines Ereignisses, je<br />
mehr es persönliche<br />
Betroffenheit<br />
auslöst, desto eher wird es<br />
zur<br />
Nachricht.<br />
Nachrichten - Faktor 5 Konsonanz: je mehr ein<br />
Ereignis<br />
mit vorhandenen<br />
Vorstellungen<br />
und Erwartungen<br />
übereinstimmt,<br />
desto eher wird es zur<br />
Nachricht.<br />
Nachrichten - Faktor 6 Überraschung:<br />
Überraschendes<br />
hat <strong>die</strong> größte Chance, zur<br />
Nachricht zu werden,<br />
allerdings<br />
74
nur dann, wenn es im Rahmen<br />
der Erwartungen<br />
überraschend<br />
ist.<br />
Nachrichten - Faktor 7 Kontinuität: Ein Ereignis, das<br />
bereits als Nachricht definiert<br />
Nachrichten -<br />
Faktor 8<br />
Nachrichten -<br />
Faktor 9<br />
Nachrichten -<br />
Faktor 10<br />
Nachrichten -<br />
Faktor 11<br />
Nachrichten -<br />
Faktor 12<br />
ist,<br />
hat eine hohe Chance, von<br />
den<br />
Me<strong>die</strong>n auch weiterhin<br />
beachtet<br />
zu werden.<br />
Variation: Der Schwellenwert für<br />
<strong>die</strong> Beachtung eines Ereignisses<br />
ist niedriger, wenn es zur<br />
Ausbalancierung und Variation<br />
des gesamten Nachrichten -<br />
Bildes beiträgt.<br />
Bezug auf Elite- Nationen:<br />
Ereignisse, <strong>die</strong> Elite- Nationen<br />
betreffen (wirtschaftlich oder<br />
militärisch mächtige Nationen)<br />
haben einen überproportional<br />
hohen Nachrichtenwert.<br />
Bezug auf Elite- Personen:<br />
Entsprechend Faktor 9 gilt <strong>die</strong>s<br />
auch für Personen, das heißt<br />
prominente oder mächtige<br />
Persönlichkeiten.<br />
Personalisierung: Je stärker ein<br />
Ereignis personalisiert ist, sich im<br />
Handeln oder Schicksal von<br />
Personen darstellt, desto eher<br />
wird es zur Nachricht.<br />
Negativismus: Je »negativer« ein<br />
Ereignis, je mehr es auf Konflikt,<br />
Kontroverse, Aggression, Zerstörung<br />
oder Tod bezogen ist,<br />
desto stärker wird es von den<br />
Me<strong>die</strong>n beachtet.<br />
75<br />
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
Einar Östgaard (1965) betont in seinen Untersuchungsergebnissen, daß <strong>die</strong>se zwölf<br />
Faktoren und Warrens Nachrichtenfaktoren nicht nur Entscheidungshilfe bei der <strong>Auswahl</strong><br />
von Nachrichten-<strong>Meldungen</strong> sind. Laut Östgaard werden <strong>die</strong> Meldungsbestandteile, <strong>die</strong><br />
dem oder den Faktor/ en entsprechen, besonders herausgestellt. Weil sich <strong>die</strong>se<br />
Betonung durch <strong>die</strong> gesamte Informationskette hindurch verstärkt, kommt es zu einer<br />
Verzerrung der Berichterstattung.<br />
Zusammengefaßt laufen alle Modelle der Nachrichtenwert-Theorie darauf hinaus, daß <strong>die</strong><br />
objektiven Merkmale eines Ereignisses festlegen, ob es vom Journalisten weiterverbreitet<br />
wird oder nicht. Darüber hinausgehende Thesen <strong>die</strong>ses Modells würden an <strong>die</strong>ser Stelle<br />
zu weit vom Praxisbezug wegführen. Nach jahrelangen Kontroversen von<br />
Kommunikationswissenschaftlern über <strong>die</strong> Bedeutung und Gültigkeit der Nachrichtenwert-<br />
Theorie kommt Staab zu dem Ergebnis, daß sich <strong>die</strong>se Theorie »nicht als eine Theorie<br />
der Nachrichten-Selektion, sondern als ein Modell zur Beschreibung und Analyse von<br />
Strukturen in der Me<strong>die</strong>nrealität« behauptet hat und in ein »umfassenderes theoretisches<br />
Modell, das auch politische Faktoren berücksichtigt integriert werden muß«.<br />
Fazit für <strong>die</strong> praktische Arbeit<br />
Der bereits 1934 angefertigte Katalog von Warren ist weitgehend bis heute gültig. Die in<br />
den 60er Jahren in der europäischen Forschung hinzugekommenen Nachrichten-Faktoren<br />
von Galtung / Ruge sind dagegen nicht mehr als <strong>Auswahl</strong>kriterien zu benutzen, erfüllen<br />
aber eine andere Funktion: Da <strong>die</strong>se Faktoren aufgrund zahlreicher Untersuchungen<br />
zusammengestellt worden sind, kann man zumindest davon ausgehen, daß sie<br />
tendenziell zutreffend sind. Dann aber wäre es jedem Nachrichten-Redakteur anzuraten,<br />
gelegentlich zu prüfen, ob nicht<br />
• Redakteure wirklich manchmal <strong>die</strong> Mühe scheuen, einen neuen Einstieg in ein schon<br />
länger auf dem Nachrichtenmarkt befindliches Thema zu finden,<br />
• tatsächlich Ereignisse schneller in <strong>die</strong> Nachrichten kommen, wenn sie platzsparend<br />
und schnell zu formulieren sind,<br />
76
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
• durch das ständige Melden negativer Ereignisse (Kriminalität, Überfälle, Einbrüche)<br />
eine Scheinwirklichkeit konstruiert wird, <strong>die</strong> erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen<br />
haben kann (bis zu Law-and-order-Rufen, <strong>die</strong> u.U. zur Wahl extremistischer Parteien<br />
führen),<br />
• Erwartungshaltungen beim Hörer eingelöst werden, obwohl das Ereignis gar nicht so<br />
eingetreten ist wie vielleicht erwartet oder sogar angekündigt war.<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des<br />
Rechteinhabers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und <strong>die</strong> Speicherung und Verarbeitung in<br />
elektronischen Systemen.<br />
77