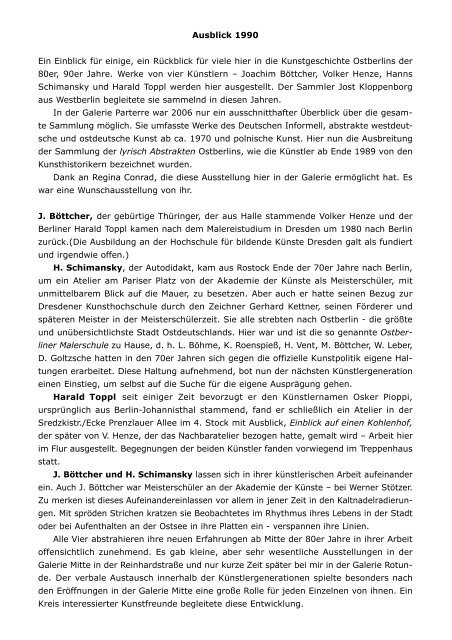Eröffnung: Inga Kondeyne - Galerie Forum Amalienpark
Eröffnung: Inga Kondeyne - Galerie Forum Amalienpark
Eröffnung: Inga Kondeyne - Galerie Forum Amalienpark
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausblick 1990<br />
Ein Einblick für einige, ein Rückblick für viele hier in die Kunstgeschichte Ostberlins der<br />
80er, 90er Jahre. Werke von vier Künstlern – Joachim Böttcher, Volker Henze, Hanns<br />
Schimansky und Harald Toppl werden hier ausgestellt. Der Sammler Jost Kloppenborg<br />
aus Westberlin begleitete sie sammelnd in diesen Jahren.<br />
In der <strong>Galerie</strong> Parterre war 2006 nur ein ausschnitthafter Überblick über die gesamte<br />
Sammlung möglich. Sie umfasste Werke des Deutschen Informell, abstrakte westdeutsche<br />
und ostdeutsche Kunst ab ca. 1970 und polnische Kunst. Hier nun die Ausbreitung<br />
der Sammlung der lyrisch Abstrakten Ostberlins, wie die Künstler ab Ende 1989 von den<br />
Kunsthistorikern bezeichnet wurden.<br />
Dank an Regina Conrad, die diese Ausstellung hier in der <strong>Galerie</strong> ermöglicht hat. Es<br />
war eine Wunschausstellung von ihr.<br />
J. Böttcher, der gebürtige Thüringer, der aus Halle stammende Volker Henze und der<br />
Berliner Harald Toppl kamen nach dem Malereistudium in Dresden um 1980 nach Berlin<br />
zurück.(Die Ausbildung an der Hochschule für bildende Künste Dresden galt als fundiert<br />
und irgendwie offen.)<br />
H. Schimansky, der Autodidakt, kam aus Rostock Ende der 70er Jahre nach Berlin,<br />
um ein Atelier am Pariser Platz von der Akademie der Künste als Meisterschüler, mit<br />
unmittelbarem Blick auf die Mauer, zu besetzen. Aber auch er hatte seinen Bezug zur<br />
Dresdener Kunsthochschule durch den Zeichner Gerhard Kettner, seinen Förderer und<br />
späteren Meister in der Meisterschülerzeit. Sie alle strebten nach Ostberlin - die größte<br />
und unübersichtlichste Stadt Ostdeutschlands. Hier war und ist die so genannte Ostberliner<br />
Malerschule zu Hause, d. h. L. Böhme, K. Roenspieß, H. Vent, M. Böttcher, W. Leber,<br />
D. Goltzsche hatten in den 70er Jahren sich gegen die offizielle Kunstpolitik eigene Haltungen<br />
erarbeitet. Diese Haltung aufnehmend, bot nun der nächsten Künstlergeneration<br />
einen Einstieg, um selbst auf die Suche für die eigene Ausprägung gehen.<br />
Harald Toppl seit einiger Zeit bevorzugt er den Künstlernamen Osker Pioppi,<br />
ursprünglich aus Berlin-Johannisthal stammend, fand er schließlich ein Atelier in der<br />
Sredzkistr./Ecke Prenzlauer Allee im 4. Stock mit Ausblick, Einblick auf einen Kohlenhof,<br />
der später von V. Henze, der das Nachbaratelier bezogen hatte, gemalt wird – Arbeit hier<br />
im Flur ausgestellt. Begegnungen der beiden Künstler fanden vorwiegend im Treppenhaus<br />
statt.<br />
J. Böttcher und H. Schimansky lassen sich in ihrer künstlerischen Arbeit aufeinander<br />
ein. Auch J. Böttcher war Meisterschüler an der Akademie der Künste – bei Werner Stötzer.<br />
Zu merken ist dieses Aufeinandereinlassen vor allem in jener Zeit in den Kaltnadelradierungen.<br />
Mit spröden Strichen kratzen sie Beobachtetes im Rhythmus ihres Lebens in der Stadt<br />
oder bei Aufenthalten an der Ostsee in ihre Platten ein - verspannen ihre Linien.<br />
Alle Vier abstrahieren ihre neuen Erfahrungen ab Mitte der 80er Jahre in ihrer Arbeit<br />
offensichtlich zunehmend. Es gab kleine, aber sehr wesentliche Ausstellungen in der<br />
<strong>Galerie</strong> Mitte in der Reinhardstraße und nur kurze Zeit später bei mir in der <strong>Galerie</strong> Rotunde.<br />
Der verbale Austausch innerhalb der Künstlergenerationen spielte besonders nach<br />
den <strong>Eröffnung</strong>en in der <strong>Galerie</strong> Mitte eine große Rolle für jeden Einzelnen von ihnen. Ein<br />
Kreis interessierter Kunstfreunde begleitete diese Entwicklung.
1987 zur 750 Jahrfeier Berlins entdeckt der Sammler Jost Kloppenborg während eines<br />
Tagesausfluges, der ihn ins Alte Museum führte, zeitgenössische originale Kunst aus dem<br />
Osten im Behelfsstand der <strong>Galerie</strong> Rotunde. Der passionierte Sammler nahm die Spur<br />
auf. Atelierbesuche folgten. Die Gespräche mit dem Kunstkenner, dessen Augen besonders<br />
geschult sind durch die Kunst des Informell und überhaupt durch internationale<br />
Kunst, wurde wichtiger als der Verkauf. Es war eine Anerkennung über die Grenze hinaus.<br />
Richtig wesentlich wurde für uns die fortan bestärkende Begleitung und Freundschaft<br />
durch Jost Kloppenborg.<br />
1988 in der Ausstellung Der eigene Blick – Berliner Kritiker zeigen Kunst ihrer Wahl<br />
im Ephraimpalais. Matthias Flügge, Gabriele Muschter, Barbara Barsch, Christoph Tannert,<br />
ich und heute längst Vergessene der älteren Kritikergeneration wie u. a. Peter Michel<br />
oder Hermann Peters hatten dort jeder einen eigenen Raum zur Verfügung.<br />
Demonstrativ stellte ich durch die Werke von Joachim Böttcher, Volker Henze, Hanns<br />
Schimansky und Harald Toppl einen geschlossenen eigenwilligen Raumeindruck her. Hier<br />
ergab sich die Möglichkeit, alle 4 zusammen zu zeigen und die besondere Entwicklung der<br />
Abstraktion in Ostberlin. Geprägt von vernetzten, vergitterten Rhythmen oder rausstrebenden<br />
Bildzeichen dieser Stadt der 80er Jahre wurde etwas Grundlegendes als künstlerische<br />
Entsprechung wahrnehmbar. Es wurde eine neue Dimension dieser Entwicklung<br />
deutlich. Alle 4 Künstler sind wiederum sehr unterschiedlich in ihrer künstlerischen Prägung,<br />
nicht auf Kontrast ausgerichtet, sondern verschiedene Möglichkeiten einer Richtung<br />
forderten sich gegenseitig stärkend heraus in diesem Raum im Ephraimpalais. Die<br />
genannten damals jüngeren Kunstkritiker und ich wurden in der Tageszeitung Neues<br />
Deutschland heftig kritisiert. Aber eine deutliche Veränderung und weitere Öffnung in der<br />
offiziellen Sicht, die durch den sozialistischen Realismus geprägt war, nahm ihren Lauf. Es<br />
waren ja schon seit Jahren Formulierungen wie Surrealer Realismus oder Phantastischer<br />
Realismus bei Kulturfunktionären im Umlauf. Zum lyrisch, abstrakten Realismus kam es<br />
zum Glück nicht mehr.<br />
Aber in der Ausstellung Konturen, Werke seit 1949 geborener Künstler der DDR,<br />
anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung der DDR, in der Alten Nationalgalerie Berlin<br />
hatte sich das Blatt offensichtlich gewendet. Eine wirklich umfangreiche Ausstellung,<br />
mit sehr unterschiedlich arbeitenden Künstlern.<br />
Eugen Blume, damals im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen arbeitend, veröffentlicht<br />
im Katalog zur Ausstellung einen erstaunlichen Text: Eine Landkarte des inneren<br />
Raumes – Anmerkungen zur ungegenständlichen Kunst in der DDR. Er hebt nach der Traditionsentwicklung<br />
die vier hier ausgestellten Künstler als die wichtigsten Vertreter der<br />
lyrischen Abstraktion hervor. Somit war dieser Begriff in die Welt der Kunstkritik eingebracht.<br />
Bilder oder Plastiken von J. Böttcher waren nicht mit ausgestellt, da er vor 1949<br />
geboren wurde. Die Ausstellung wurde am 5. 10. 1989 eröffnet und lief über die Novemberereignisse<br />
hinaus bis zum 3. 12. 1989.<br />
In diesem Dezember 1989 erzählte mir Christoph Tannert von der Einladung der Französischen<br />
Regierung, vertreten durch Jack Lang zu einer umfassenden Ausstellung der<br />
Off-Szene Ostdeutschlands in Paris: Paris, Grande Halle de la Vilette – L’autre Allemagne<br />
hors le murs, 1990. Das war natürlich unglaublich. Plötzlich standen wir in Paris, mit der<br />
Kunst, die uns das Wichtigste war. Ich habe als Mitveranstalterin eine Ausstellung mit
den vier Künstlern dort präsentiert. Wir bekamen einen so genannten Balkon über der riesigen<br />
Veranstaltungshalle zugewiesen. Auf dem gegenüberliegenden Balkon malte Strawalde<br />
vor laufender Kamera. Unter uns war schräg durch die Halle eine Bildermauer mit Werken<br />
unterschiedlichster meist expressiv arbeitender Künstler gezogen und und direkt unter<br />
unserem Balkon ein Labyrinth von Jörg dem Knöfel mit permanent ertönenden Schlachthausschweineschreien.<br />
Wir wollten eine sich gegenseitig steigernde gemischte Hängung auf unserem Balkon<br />
installieren. Das Hauptproblem waren die stark glänzenden Metallwände, die uns zur Verfügung<br />
standen. Henzes Farben brillierten, konnten nur durch Schimanskys große Schwarzweißtuschen<br />
gebändigt werden, daneben entfalteten sich auch Böttchers großformatige Collagen<br />
in ihren feinen Farbklängen. Toppls Arbeiten zogen sich auf dem glänzenden Metall<br />
ganz introvertiert, dunkel in sich zurück Ich musste für seine Arbeiten weiße Stellwände<br />
organisieren. Irgendwie funktionierte der Zusammenhang dann doch richtig gut als Klang.<br />
Tausende Franzosen schoben sich innerhalb von wenigen Tagen über unseren Balkon. (1990<br />
war die Eventkultur für Menschenmassen noch nicht üblich.) Die eine oder andere wichtige<br />
Freundschaft begann damals. Eines von den Bildern von Volker Henze, das damals in Paris<br />
zu sehen war, ist hier mit ausgestellt.<br />
Wir haben in dieser Ausstellung bewusst für jeden Künstler jeweils einen Raum gewählt,<br />
um die Eigenheiten jedes einzelnen Künstlers konzentriert zu präsentieren.<br />
In Volker Henzes Raum zeigt sich die Kraft seiner expressiven Malerei Ende der 80er<br />
Jahre. Ein nahezu explodierender Eindruck von Farbe in seinem typischen direkt erfrischenden<br />
Auftrag als Dimension. Es gibt noch weitaus großformatigere Bilder aus diesen Jahren.<br />
Wunderbar Papierarbeiten mit fließender Farbe und Tusche von Henze im Flur. Anmerkung:<br />
Mit der Maueröffnung begann V. Henze mit Objekten zu experimentieren: Zeichenmaschine.<br />
Von Harald Toppl haben wir hier auch einen fast geschlossenen Raum. Es handelt sich<br />
ausschließlich um Arbeiten aus den 80er Jahren. Hier kann man gut nachvollziehen, wie der<br />
Stadtneurotiker Toppl sein Leben in Berlin wahrgenommen hat. In einer Arbeit sind noch<br />
Häusersilhouetten sichtbar. Mitte der 80er Jahre gehen diese ein in vielschichtige Überlagerungen<br />
von Farbzeichen und Bildräumen, er kratzt sgraffitimäßig Rhythmen frei. Papiere<br />
werden durchs ständige Überarbeiten immer dicker und fester. Diese klebt er wiederum auch<br />
aufeinander, zerschneidet sie, klebt sie wieder ein. Er reißt beim arbeiten Löcher ins Papier,<br />
die er wiederum mit seinen typischen Farbbalken netzhaft überzieht, bis sein Berlingewebe<br />
in den richtigen Rhythmus kommt.<br />
In den Raum von Joachim Böttcher hätten eigentlich auch Plastiken gehört. Aber Herr<br />
Kloppenborg hat keine Plastiken von ihm gesammelt. Im Atelier von Joachim Böttcher in den<br />
80er Jahren im Prenzlauer Berg standen mitten im Raum im 4. Stock sich spreizende Gestellte<br />
- hohe Ständer für seine Gipsköpfe und Gipsfiguren unter der niedrigen Zimmerdecke, an<br />
denen er ständig arbeitete. Sie inspirierten ihn für so manches Bild. In seinen großen Collagebildern<br />
tauchen oft Kopfsilhouetten oder expressiv aufstrebende spröde Linien auf, die mich<br />
an die Atelieratmosphäre von damals erinnern. Von Joachim Böttcher hängen hier frühe<br />
Papierarbeiten von 1984/86, Bilder von 1989 und auch Papierarbeiten der späten 90er Jahren<br />
– die Spanne ist weit. Sie alle zeigen, dass Böttcher radikale Schnitte in seiner Arbeitweise<br />
benötigt, um neue Ansätze zu finden, die ihn zum Weiterarbeiten herausfordern. In den
meisten Werken verspannen sich schwarz linear seine Zeichenstrukturen über letztendlich<br />
ausgewogenen Kompositionen.<br />
Hanns Schimansky, der Zeichner, hingegen findet für sich Ende der 80er Jahre das<br />
Falten von Papieren als wichtige Arbeitsmethode. Genauer: Packpapierfaltungen gibt es<br />
ab 1987. Die hier ausgestellten sind aus den 90er Jahren. Das Prinzip ist erfunden. Er<br />
testet bis heute die Möglichkeiten, die ihm damit gegeben werden, in seiner Papierarbeit<br />
aus. Dadurch, dass er seine Tuschformen im Faltprozess unerwartet zueinander setzt, findet<br />
er auch für sich selbst zu überraschenden neuen abstrakten Formulierungen.<br />
In der hier installierten Wand befinden sich Werke aus unterschiedlichen Arbeitsphasen<br />
in verschiedenen Techniken. Ölkreidezeichnungen, Tuschzeichnungen oder Faltungen<br />
in unterschiedlichsten Rahmungen sind zueinander gehängt. Die einzelnen Arbeiten zeigen,<br />
wie er aus dem Impuls heraus zu konzentrierten Setzungen findet. Seine Reisen auf<br />
den viereckigen Papieren ins Abenteuer gibt der Phantasie der Betrachter viel Raum.<br />
Werke von J. Böttcher, V. Henze, H. Schimanksy und H. Toppl sind noch einmal von<br />
allen vier hier Versammelten zusammen in der Ausstellung Berlin-Berlin 1990 in Weinheim<br />
zu sehen - diesmal mit Werken von Hans Scheib, Reinhard Stangl und Peter Hermann<br />
wiedervereint.. Die vor Jahren verstorbene ehemalige Bundestagsabgeordnete Dr.<br />
Renate Lepsius hatte mit ungeheurem Enthusiasmus diese Ausstellung in ihrem Kunstförderverein<br />
Weinheim organisiert.<br />
In den 90ern fand jeder von diesen Künstlern seine eigenen Wege von Ausstellung zu Ausstellung<br />
– auch in der weiten Welt. Herrn Kloppenborg, den treuen Sammler, zog seine<br />
Neugier mehr und mehr weiter nach Osten – nach Polen. Er baute einen weiteren Teil seiner<br />
Sammlung auf.<br />
Bis zu dieser Ausstellung hier wüsste ich nicht von einer Ausstellung, in der die vier<br />
Künstler zusammengeführt wurden nach der Wende. Nach über zwanzig Jahren hat das<br />
Zusammenspiel zwischen Joachim Böttcher, Volker Henze und Hanns Schimansky wieder<br />
gut beim Aufbau funktioniert. Das Ergebnis sehen Sie hier.<br />
<strong>Inga</strong> <strong>Kondeyne</strong><br />
Berlin, im Mai 2013