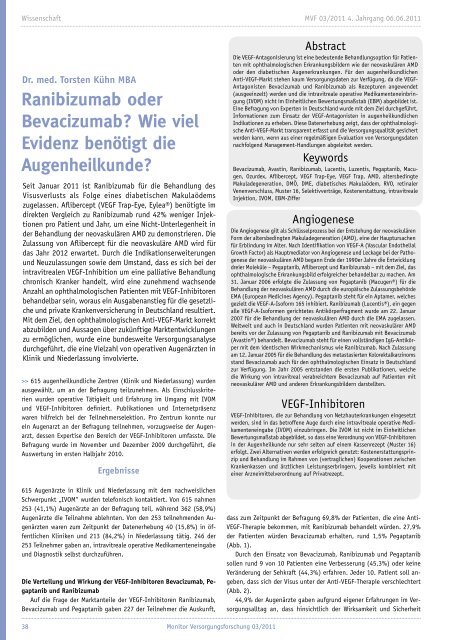Open Access-PDF zum Zitieren - Monitor Versorgungsforschung
Open Access-PDF zum Zitieren - Monitor Versorgungsforschung
Open Access-PDF zum Zitieren - Monitor Versorgungsforschung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wissenschaft<br />
MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />
Dr. med. Torsten Kühn MBA<br />
Ranibi<strong>zum</strong>ab oder<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab? Wie viel<br />
Evidenz benötigt die<br />
Augenheilkunde?<br />
Seit Januar 2011 ist Ranibi<strong>zum</strong>ab für die Behandlung des<br />
Visusverlusts als Folge eines diabetischen Makulaödems<br />
zugelassen. Aflibercept (VEGF Trap-Eye, Eylea®) benötigte im<br />
direkten Vergleich zu Ranibi<strong>zum</strong>ab rund 42% weniger Injektionen<br />
pro Patient und Jahr, um eine Nicht-Unterlegenheit in<br />
der Behandlung der neovaskulären AMD zu demonstrieren. Die<br />
Zulassung von Aflibercept für die neovaskuläre AMD wird für<br />
das Jahr 2012 erwartet. Durch die Indikationserweiterungen<br />
und Neuzulassungen sowie dem Umstand, dass es sich bei der<br />
intravitrealen VEGF-Inhibition um eine palliative Behandlung<br />
chronisch Kranker handelt, wird eine zunehmend wachsende<br />
Anzahl an ophthalmologischen Patienten mit VEGF-Inhibitoren<br />
behandelbar sein, woraus ein Ausgabenanstieg für die gesetzliche<br />
und private Krankenversicherung in Deutschland resultiert.<br />
Mit dem Ziel, den ophthalmologischen Anti-VEGF-Markt korrekt<br />
abzubilden und Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen<br />
zu ermöglichen, wurde eine bundesweite Versorgungsanalyse<br />
durchgeführt, die eine Vielzahl von operativen Augenärzten in<br />
Klinik und Niederlassung involvierte.<br />
>> 615 augenheilkundliche Zentren (Klinik und Niederlassung) wurden<br />
ausgewählt, um an der Befragung teilzunehmen. Als Einschlusskriterien<br />
wurden operative Tätigkeit und Erfahrung im Umgang mit IVOM<br />
und VEGF-Inhibitoren definiert. Publikationen und Internetpräsenz<br />
waren hilfreich bei der Teilnehmerselektion. Pro Zentrum konnte nur<br />
ein Augenarzt an der Befragung teilnehmen, vorzugsweise der Augenarzt,<br />
dessen Expertise den Bereich der VEGF-Inhibitoren umfasste. Die<br />
Befragung wurde im November und Dezember 2009 durchgeführt, die<br />
Auswertung im ersten Halbjahr 2010.<br />
Ergebnisse<br />
615 Augenärzte in Klinik und Niederlassung mit dem nachweislichen<br />
Schwerpunkt „IVOM“ wurden telefonisch kontaktiert. Von 615 nahmen<br />
253 (41,1%) Augenärzte an der Befragung teil, während 362 (58,9%)<br />
Augenärzte die Teilnahme ablehnten. Von den 253 teilnehmenden Augenärzten<br />
waren <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Datenerhebung 40 (15,8%) in öffentlichen<br />
Kliniken und 213 (84,2%) in Niederlassung tätig. 246 der<br />
253 Teilnehmer gaben an, intravitreale operative Medikamenteneingabe<br />
und Diagnostik selbst durchzuführen.<br />
Die Verteilung und Wirkung der VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab, Pegaptanib<br />
und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
Auf die Frage der Marktanteile der VEGF-Inhibitoren Ranibi<strong>zum</strong>ab,<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab und Pegaptanib gaben 227 der Teilnehmer die Auskunft,<br />
Abstract<br />
Die VEGF-Antagonisierung ist eine bedeutende Behandlungsoption für Patienten<br />
mit ophthalmologischen Erkrankungsbildern wie der neovaskulären AMD<br />
oder den diabetischen Augenerkrankungen. Für den augenheilkundlichen<br />
Anti-VEGF-Markt stehen kaum Versorgungsdaten zur Verfügung, da die VEGF-<br />
Antagonisten Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab als Rezepturen angewendet<br />
(ausgeeinzelt) werden und die intravitreale operative Medikamenteneinbringung<br />
(IVOM) nicht im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgebildet ist.<br />
Eine Befragung von Experten in Deutschland wurde mit dem Ziel durchgeführt,<br />
Informationen <strong>zum</strong> Einsatz der VEGF-Antagonisten in augenheilkundlichen<br />
Indikationen zu erheben. Diese Datenerhebung zeigt, dass der ophthalmologische<br />
Anti-VEGF-Markt transparent erfasst und die Versorgungsqualität gesichert<br />
werden kann, wenn aus einer regelmäßigen Evaluation von Versorgungsdaten<br />
nachfolgend Management-Handlungen abgeleitet werden.<br />
Keywords<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab, Avastin, Ranibi<strong>zum</strong>ab, Lucentis, Luzentis, Pegaptanib, Macugen,<br />
Ozurdex, Aflibercept, VEGF Trap-Eye, VEGF Trap, AMD, altersbedingte<br />
Makuladegeneration, DMÖ, DME, diabetisches Makulaödem, RVO, retinaler<br />
Venenverschluss, Muster 16, Selektivverträge, Kostenerstattung, intravitreale<br />
Injektion, IVOM, EBM-Ziffer<br />
Angiogenese<br />
Die Angiogenese gilt als Schlüsselprozess bei der Entstehung der neovaskulären<br />
Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), eine der Hauptursachen<br />
für Erblindung im Alter. Nach Identifikation von VEGF-A (Vascular Endothelial<br />
Growth Factor) als Hauptmediator von Angiogenese und Leckage bei der Pathogenese<br />
der neovaskulären AMD begann Ende der 1990er Jahre die Entwicklung<br />
dreier Moleküle – Pegaptanib, Aflibercept und Ranibi<strong>zum</strong>ab – mit dem Ziel, das<br />
ophthalmologische Erkrankungsbild erfolgreicher behandelbar zu machen. Am<br />
31. Januar 2006 erfolgte die Zulassung von Pegaptanib (Macugen®) für die<br />
Behandlung der neovaskulären AMD durch die europäische Zulassungsbehörde<br />
EMA (European Medicines Agency). Pegaptanib steht für ein Aptamer, welches<br />
gezielt die VEGF-A-Isoform 165 inhibiert. Ranibi<strong>zum</strong>ab (Lucentis®), ein gegen<br />
alle VEGF-A-Isoformen gerichtetes Antikörperfragment wurde am 22. Januar<br />
2007 für die Behandlung der neovaskulären AMD durch die EMA zugelassen.<br />
Weltweit und auch in Deutschland wurden Patienten mit neovaskulärer AMD<br />
bereits vor der Zulassung von Pegaptanib und Ranibi<strong>zum</strong>ab mit Bevaci<strong>zum</strong>ab<br />
(Avastin®) behandelt. Bevaci<strong>zum</strong>ab steht für einen vollständigen IgG-Antikörper<br />
mit dem identischen Wirkmechanismus wie Ranibi<strong>zum</strong>ab. Nach Zulassung<br />
am 12. Januar 2005 für die Behandlung des metastasierten Kolorektalkarzinoms<br />
stand Bevaci<strong>zum</strong>ab auch für den ophthalmologischen Einsatz in Deutschland<br />
zur Verfügung. Im Jahr 2005 entstanden die ersten Publikationen, welche<br />
die Wirkung von intravitreal verabreichtem Bevaci<strong>zum</strong>ab auf Patienten mit<br />
neovaskulärer AMD und anderen Erkrankungsbildern darstellten.<br />
VEGF-Inhibitoren<br />
VEGF-Inhibitoren, die zur Behandlung von Netzhauterkrankungen eingesetzt<br />
werden, sind in das betroffene Auge durch eine intravitreale operative Medikamenteneingabe<br />
(IVOM) einzubringen. Die IVOM ist nicht im Einheitlichen<br />
Bewertungsmaßstab abgebildet, so dass eine Verordnung von VEGF-Inhibitoren<br />
in der Augenheilkunde nur sehr selten auf einem Kassenrezept (Muster 16)<br />
erfolgt. Zwei Alternativen werden erfolgreich genutzt: Kostenerstattungsprinzip<br />
und Behandlung im Rahmen von (vertraglichen) Kooperationen zwischen<br />
Krankenkassen und ärztlichen Leistungserbringern, jeweils kombiniert mit<br />
einer Arzneimittelverordnung auf Privatrezept.<br />
dass <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung 69,8% der Patienten, die eine Anti-<br />
VEGF-Therapie bekommen, mit Ranibi<strong>zum</strong>ab behandelt würden. 27,9%<br />
der Patienten würden Bevaci<strong>zum</strong>ab erhalten, rund 1,5% Pegaptanib<br />
(Abb. 1).<br />
Durch den Einsatz von Bevaci<strong>zum</strong>ab, Ranibi<strong>zum</strong>ab und Pegaptanib<br />
sollen rund 9 von 10 Patienten eine Verbesserung (45,3%) oder keine<br />
Veränderung der Sehkraft (44,3%) erfahren. Jeder 10. Patient soll angeben,<br />
dass sich der Visus unter der Anti-VEGF-Therapie verschlechtert<br />
(Abb. 2).<br />
44,9% der Augenärzte gaben aufgrund eigener Erfahrungen im Versorgungsalltag<br />
an, dass hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit<br />
38<br />
<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011
MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />
Wissenschaft<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
©MVF<br />
Marktanteile der<br />
VEGF-Antagonisten<br />
Avastin<br />
Macugen<br />
1,5<br />
27,9<br />
69,8<br />
Lucentis<br />
Abb. 1: Marktanteile der<br />
VEGF-Inhibitoren Ranibi<strong>zum</strong>ab,<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab & Pegaptanib,<br />
bezogen auf behandelte Patienten<br />
<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung<br />
(November und Dezember 2009).<br />
Über alle Indikationen hinweg besitzt<br />
Ranibi<strong>zum</strong>ab mit 69,8% den<br />
größten Marktanteil (n=227)<br />
100%<br />
10%<br />
0%<br />
©MVF<br />
Nutzen-Einschätzung<br />
gleichbleibend<br />
Visusverbesserung<br />
verschlechtert<br />
Abb. 2 : Nach Einschätzung der teilnehmenden<br />
Augenärzte profitieren<br />
89,6% der behandelten Patienten von<br />
der Anti-VEGF-Therapie mit Macugen,<br />
Avastin oder Lucentis (n=201).<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab gleichwertig und beide Arzneimittel<br />
Pegaptanib überlegen seien (n=214).<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10,4<br />
44,3<br />
45,3<br />
Ärzte, die Patienten<br />
mit und ohne<br />
diabetischen Augenerkrankungen<br />
behandeln<br />
Patienten mit diab. Augenerkrankungen<br />
Patienten ohne diab. Augenerkrankungen<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
2,5<br />
97,2<br />
Abb. 3: Anteil der Augenärzte, die<br />
<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung Patienten<br />
mit diabetischen Augenerkrankungen<br />
behandeln (n=253).<br />
nach der Lasertherapie positionieren<br />
56,6% der Befragten VEGF-Inhibitoren<br />
(n=214).<br />
Die intravitreale Arzneimitteltherapie<br />
findet bei mehreren Erkrankungsbildern<br />
Anwendung<br />
Die Befragung fand im November<br />
und Dezember 2009 statt. In<br />
Deutschland war bis <strong>zum</strong> Januar<br />
2011 die neovaskuläre AMD das<br />
einzige Erkrankungsbild, für dessen<br />
Behandlung die intravitreale Verabreichung<br />
eines VEGF-Inhibitors zugelassen<br />
war. Vor diesem Hintergrund<br />
wurde den teilnehmenden Ophthalmologen<br />
die Frage gestellt, ob sich<br />
die intravitreale Arzneimitteltherapie<br />
lediglich auf die neovaskuläre<br />
AMD beschränkt oder darüber hinaus<br />
auch andere Anwendungsgebiete<br />
umfasst. 79,5% der Augenärzte gaben<br />
an, weitere Erkrankungsbilder zu<br />
behandeln, während 17,7% mitteilten,<br />
dass sie die intravitreale Arzneimitteltherapie<br />
auf die neovaskuläre<br />
AMD begrenzen. 2,8% der Teilnehmer<br />
machten zu dieser Fragestellung<br />
keine Angabe (Tab. 1).<br />
Die Augenärzte, welche mitteilten,<br />
dass sie die VEGF-Inhibition<br />
nicht auf die neovaskuläre AMD begrenzen,<br />
wurden aufgefordert, spontan<br />
die Erkrankungsbilder zu nennen,<br />
welche sie mit der intravitrealen<br />
Arzneimitteltherapie behandeln. 197<br />
Ophthalmologen nannten spontan neben der neovaskulären AMD 16<br />
weitere Anwendungsgebiete der intravitrealen VEGF-Inhibition. Zu den<br />
Erkrankungsbildern, die in über 50% der Fälle genannt wurden, zählen<br />
das diabetische Makulaödem, das Irvine-Gass-Syndrom, die neovaskuläre<br />
AMD und das Makulaödem als Folge eines Venenverschlusses (Tab. 2).<br />
Anti-VEGF-Therapie für Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen<br />
Der Begriff „diabetische Augenerkrankungen“ vereint hier die diabetische<br />
Retinopathie und die diabetische Makulopathie (das diabetische<br />
Makulaödem). 97,2% der befragten Augenärzte gaben an, Patienten<br />
mit diabetischen Augenerkrankungen zu behandeln. 2,8% behandelten<br />
<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung nach eigenen Angaben keine Patienten<br />
mit diabetischen Augenerkrankungen (Abb. 3).<br />
Während 26,1% der Augenärzte davon ausgehen, dass weniger als<br />
10% der Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen in Behandlung<br />
sind, schätzen 23,4% dass alle behandelbaren Patienten gegenwärtig<br />
in Behandlung sind (Abbildung 4).<br />
89,2% der Augenärzte definieren <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Datenerhebung<br />
die Lasertherapie als ‚First Line‘ für Patienten mit diabetischen<br />
Augenerkrankungen. Dagegen betrachten rund 5,6% der Experten VE-<br />
GF-Inhibitoren als Mittel der ersten Wahl (n=251). Als ‚Second Line‘<br />
in Prozent<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
©MVF<br />
0<br />
26,1<br />
unter<br />
10%<br />
Anteil der Patienten mit diabetischen<br />
Augenerkrankungen in Behandlung<br />
23,9<br />
10 bis<br />
49%<br />
26,6<br />
50 bis<br />
99%<br />
23,4<br />
100%<br />
Abb. 4 : Anteil der Patienten, die von einer diabetischen Augenerkrankung<br />
betroffen und in Behandlung sind (n=188).<br />
<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011 39
Wissenschaft<br />
MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />
Arzneimittelpreise, Honorare, Selektivverträge und Medikamentenauseinzelung<br />
Über 90% der Augenärzte halten die Arzneimittel Macugen und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
für überteuert. Lediglich 8,7% der Augenärzte empfinden<br />
den Apothekenverkaufspreis von Macugen für angemessen, nur 7,9%<br />
halten den Apothekenverkaufspreis von Ranibi<strong>zum</strong>ab für gerechtfertigt<br />
(Tab.3).<br />
60,0% der Augenärzte sind nach eigenen Angaben <strong>zum</strong> Zeitpunkt<br />
der Befragung Vertragspartner von Krankenkassen hinsichtlich der<br />
IVOM. Dabei handele es sich vorwiegend um Verträge gemäß §§140a<br />
ff. SGB V (integrierte Versorgung) und weniger um Verträge gemäß<br />
§73c SGB V (besondere ambulante ärztliche Behandlung). 40,0% der<br />
Befragten gaben an, keiner vertraglichen Krankenkassenkooperation<br />
beigetreten zu sein (Abb. 5).<br />
Die Fragestellung, ob das Honorar für die intravitreale operative Medikamenteneingabe<br />
den ärztlichen Aufwand angemessen widerspiegelt,<br />
bejahten 83,3% der befragten Augenärzte. Dagegen halten 16,7% der<br />
Augenärzte die IVOM für nicht ausreichend honoriert (Tabelle 4). Im<br />
bundesweiten Durchschnitt beträgt das ärztliche Honorar für die IVOM<br />
<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Datenerhebung nach Aussagen der Befragten 291,15<br />
Behandeln Sie ausschließlich Patienten mit<br />
neovaskulärer AMD mit intravitrealer Arzneimittelgabe?<br />
Anteil der<br />
Augenärzte<br />
(n=248)<br />
Ja 17,7%<br />
Nein 79,5%<br />
Keine Angabe 2,8%<br />
Tab. 1: Anteil der Augenärzte, welche ausschließlich die neovaskuläre AMD<br />
mit der intravitrealen Verabreichung von Arzneimitteln behandeln oder zudem<br />
weitere Erkrankungsbilder (n=248).<br />
Eur, während die Spannbreite von 150,00 Eur bis 450,00 Eur reicht<br />
(n = 185). Die Implementierung einer EBM-Ziffer für die intravitreale<br />
operative Medikamenteneingabe befürworteten 9,4% der Augenärzte.<br />
Während 62,9% der Augenärzte die EBM-Ziffer für den Fall akzeptieren<br />
würden, dass das Honorar für die IVOM bei mindestens 300,00 Eur liegt,<br />
lehnen 27,7% der Teilnehmer die EBM-Ziffer kategorisch ab (Tab. 4).<br />
Ist die Auseinzelung der VEGF-Inhibitoren bedenklich?<br />
Die Auseinzelung der VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
halten 66,4% der Augenärzte für bedenklich. Von diesen<br />
66,4% würden 50,7% die Auseinzelung und den nachfolgenden Transport<br />
<strong>zum</strong> Operateur für den Fall befürworten, dass der Nachweis der<br />
Arzneimittelqualität (Wirksamkeit und Sicherheit) erbracht wird und<br />
das ausgeeinzelte Produkt als bedenkenlos eingestuft werden kann.<br />
Dagegen lehnen 49,3% der Augenärzte, welche die Auseinzelung als<br />
bedenklich einstuften, diese Praxis auch unter allen Hypothesen ab.<br />
31,8% der Augenärzte halten die Auseinzelung der VEGF-Inhibitoren<br />
für unbedenklich, während 1,8% keine Angaben zu dieser Fragestellung<br />
machten (n = 220; Abb. 6)<br />
Diskussion<br />
Die Dominanz von Ranibi<strong>zum</strong>ab im Markt der intravitrealen VEGF-<br />
Inhibitoren mit einen Marktanteil von 69,8% basiert auf einer juristischen<br />
Diskussion um Off Label Use und Arzthaftung.<br />
In Bezug auf behandelte Patienten besitzt Ranibi<strong>zum</strong>ab im Markt<br />
Bitte nennen Sie spontan die Erkrankungsbilder,<br />
die Sie regelmäßig mit VEGF-Inhibitoren<br />
behandeln!<br />
Anteriore Ischämische Optikusneuropathie (AION) 1,5%<br />
Arterienverschluss (AAV und ZAV) 25,4%<br />
Chorioretinitis 1,0%<br />
CNV idiopathischer Genese 17,3%<br />
CNV infolge pathologischer Myopie 20,8%<br />
Diabetische Retinopathie 28,4%<br />
Diabetisches Makulaödem 85,8%<br />
Hornhautneovaskularisationen (subkonjunktival) 38,6%<br />
Irvine-Gass-Syndrom 55,8%<br />
Morbus Best (vitelliforme Makuladystrophie) 2,5%<br />
Neovaskuläre AMD (feuchte AMD) 98,0%<br />
Neovaskularisationsglaukom 33,0%<br />
Pseudoexfoliationssyndrom 3,6%<br />
Retinopathia centralis serosa (RCS) 6,1%<br />
Strahlenretinopathie 0,5%<br />
Uveitis 6,6%<br />
Venenverschluss (VAV und ZVV) 55,8%<br />
Anteil der<br />
Augenärzte<br />
(n=197)<br />
Tab.2: Darstellung der Erkrankungsbilder, welche von den teilnehmenden Augenärzten<br />
(n=197) durch die intravitreale Verabreichung von VEGF-Inhibitoren<br />
behandelt werden. Mehrfachnennungen waren möglich und gewünscht.<br />
Halten Sie den Apothekenverkaufspreis von<br />
Macugen in Höhe von 854,15 Euro* für angemessen?<br />
Ja 8,7%<br />
Nein, zu hoch 91,3%<br />
Halten Sie den Apothekenverkaufspreis von<br />
Lucentis in Höhe von 1.296,22 Eur* für angemessen?<br />
Ja 7,9%<br />
Nein, zu hoch 92,1%<br />
Anteil der<br />
Augenärzte<br />
(n=173)<br />
Anteil der<br />
Augenärzte<br />
(n=215)<br />
Tab.3: Anteil der Augenärzte, welche die Apothekenverkaufspreise von Macugen<br />
(n=173) und Lucentis (n=215) für angemessen oder ungerechtfertigt (zu<br />
hoch) halten.<br />
*Apothekenverkaufspreis (AVP) <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung. Zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt liegt der AVP für Lucentis bei 1.285,90 Eur und der AVP von<br />
Macugen bei 847,36 Eur (Stand: 01.05.2011)<br />
der intravitrealen VEGF-Inhibitoren einen Marktanteil in Höhe von<br />
69,8% und Bevaci<strong>zum</strong>ab einen Marktanteil in Höhe von 27,9%, obwohl<br />
• Ranibi<strong>zum</strong>ab und Bevaci<strong>zum</strong>ab mit der VEGF-A-Inhibition einen identischen<br />
Wirkmechanismus besitzen,<br />
• 44,9% der Augenärzte aufgrund eigener Erfahrung annehmen, dass<br />
Ranibi<strong>zum</strong>ab und Bevaci<strong>zum</strong>ab in Wirksamkeit und Sicherheit für die<br />
Behandlung ophthalmologischer Erkrankungsbilder gleichwertig sind<br />
und der durchschnittliche Apothekenverkaufspreis einer 1,25mg-Bevaci<strong>zum</strong>ab-Spritze<br />
mit rund 59,00 Euro deutlich geringer ist als der<br />
AVP einer 0,5mg-Ranibi<strong>zum</strong>ab-Spritze.<br />
40<br />
<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011
MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />
Wissenschaft<br />
Ärzte mit und ohne<br />
Selektiv-Vertrag<br />
mit Vertrag<br />
ohne vertrag<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
40,0<br />
Die Dominanz von Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
ist durchaus nachvollziehbar, da<br />
aus der juristischen Diskussion um<br />
Off-Label-Anwendung und Arzthaftung<br />
Unsicherheit unter den<br />
ärztlichen Leistungserbringern<br />
resultiert. Schließlich wird Bevaci<strong>zum</strong>ab<br />
in der Augenheilkunde weder<br />
durch einen pharmazeutischen<br />
Unternehmer vermarktet noch ist<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab für die Behandlung<br />
augenheilkundlicher Erkrankungen<br />
zugelassen.<br />
Ist das durchschnittliche Honorar für die IVOM<br />
angemessen?<br />
Ja 83,3%<br />
Nein, zu niedrig 16,7%<br />
Befürworten Sie die Implementierung einer<br />
EBM-Ziffer für die IVOM?<br />
Ja 9,4%<br />
Ja, solange das IVOM-Honorar ≥ 300,00 Eur ist 62,9%<br />
Anteil der<br />
Augenärzte<br />
(n=220)<br />
Anteil der<br />
Augenärzte<br />
(n=224)<br />
©MVF<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
60,0<br />
Abb.5: Anteil der Augenärzte, die<br />
keiner oder mindestens einer vertraglichen<br />
Kooperation mit einer Krankenkasse<br />
beigetreten sind (n=210)<br />
Die VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab,<br />
Ranibi<strong>zum</strong>ab und Pegaptanib<br />
werden bei einer Vielzahl<br />
an augenheilkundlichen<br />
Erkrankungen gleichermaßen<br />
‚off-label‘ eingesetzt<br />
Gegenwärtig ist Pegaptanib<br />
ausschließlich für die Behandlung<br />
der neovaskulären AMD zugelassen,<br />
während Ranibi<strong>zum</strong>ab eine<br />
Zulassung für die Behandlung der<br />
neovaskulären AMD sowie des Visusverlusts<br />
als Folge eines diabetischen<br />
Makulaödems besitzt. Darüber<br />
hinaus existiert eine Vielzahl an<br />
Erkrankungsbildern, welche mit den<br />
VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab, Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
und Pegaptanib behandelt<br />
werden, obgleich keines der<br />
genannten Arzneimittel für diese<br />
Indikationen zugelassen ist. Insbesondere<br />
die Off-Label-Anwendung<br />
von Bevaci<strong>zum</strong>ab stellt für viele<br />
Erkrankungsbilder in der Augenheilkunde eine sinnvolle, und vom Betroffenen<br />
aus eigener Kraft finanzierbare Behandlungsmöglichkeit dar.<br />
Der Einsatz der VEGF-Inhibitoren für Patienten mit diabetischen<br />
Augenerkrankungen wird zunehmen<br />
97,2% der Augenärzte behandeln <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung Patienten<br />
mit diabetischen Augenerkrankungen. 89,2% der Augenärzte<br />
definieren die Lasertherapie als ‚First Line‘, 56,6% die VEGF-Inhibitoren<br />
als ‚Second Line‘. Erfolgreiche Phase-II-Studien reichten für 5,6%<br />
der Augenärzte aus, um bereits <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung – <strong>zum</strong><br />
Zeitpunkt der Befragung lag für keinen VEGF-Inhibitor eine Zulassung<br />
zur Behandlung von diabetischen Augenerkrankungen vor – die VEGF-<br />
Inhibitoren vor die Laserbehandlung als Mittel der Wahl für Patienten<br />
mit diabetischen Augenerkrankungen zu positionieren. Sehr häufig gaben<br />
Augenärzte an, dass mit Vorliegen positiver Ergebnisse der Phase-<br />
III-Studien die VEGF-Inhibition den Vorzug vor der Laserbehandlung<br />
erhielte. Mittlerweile ist Ranibi<strong>zum</strong>ab für die Behandlung einer Visusbeeinträchtigung<br />
infolge eines diabetischen Makulaödems zugelassen.<br />
Die Ausgaben der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung für<br />
die Behandlung von Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen<br />
werden sich erhöhen, indem die Marktanteile der VEGF-Inhibitoren –<br />
insbesondere Ranibi<strong>zum</strong>ab – innerhalb des Marktes „diabetische Au-<br />
Nein 27,7%<br />
Tab.4: Anteil der Augenärzte, welche das IVOM-Honorar für angemessen oder<br />
zu niedrig bewerten (n=220) und die Implementierung einer EBM-Ziffer für die<br />
IVOM befürworten oder ablehnen (n=224).<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
©MVF<br />
unbedenklich<br />
Auseinzelung bedenklich<br />
31,8<br />
66,4<br />
Keine Angabe<br />
Auseinzelung<br />
1,8<br />
Abb.6: Anteil der Augenärzte, welche die Auseinzelung der VEGF-Antagonisten<br />
für bedenklich bzw. unbedenklich einstufen. 66,4% der Augenärzte stufen<br />
das gegenwärtige Verfahren zur Aufteilung von Arzneimitteln als bedenklich<br />
ein, davon fordern 50,7% Nachweise zur Bestätigung der Arzneimittelqualität<br />
(n=220)<br />
49,3<br />
Auseinzelung<br />
der VEGF- Antagonisten<br />
ist<br />
bedenklich<br />
50,7<br />
Auseinzelung der<br />
VEGF- Antagonisten<br />
ist unbedenklich,<br />
wenn<br />
die Bestätigung<br />
der Arzneimittelqualität<br />
erbracht<br />
wird<br />
<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011 41
Wissenschaft<br />
MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />
generkrankungen“ steigen und sich die Anzahl behandelbarer Patienten<br />
erhöht. Immerhin sind 76,0% der Augenärzte davon überzeugt, dass<br />
nicht alle Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen behandelt<br />
werden, während nur 24,0% davon ausgehen, dass sich alle behandelbaren<br />
Patienten auch in Behandlung befinden. Die Kommunikation<br />
von positiven Resultaten klinischer Phase-III-Studien kann die Anzahl<br />
der Patienten in den augenärztlichen Praxen und Kliniken signifikant<br />
steigern.<br />
60% der operativ tätigen Augenärzte nutzen das Instrument „Selektivvertrag“<br />
60,0% der teilnehmenden Ophthalmologen gaben an, dass sie einem<br />
oder mehreren Krankenkassenverträgen beigetreten sind. Kaum eine<br />
andere Fachgruppe wird eine derartige Flächendeckung an Krankenkassenkooperationen<br />
vorweisen können. Die Kombination aus fehlender<br />
EBM-Ziffer und einer für die ärztlichen Leistungserbringer nicht nachvollziehbaren<br />
Preisbildung der pharmazeutischen Hersteller kann als<br />
treibende Kraft für die Vielzahl der Kooperationen angesehen werden.<br />
Vertragliche Krankenkassenkooperationen lassen neben der Kostenbegrenzung<br />
und der Qualitätsbestimmung und -sicherung auch eine Verminderung<br />
des ärztlichen bürokratischen Aufwands zu. Schließlich ist<br />
der bürokratische Aufwand des Kostenerstattungsprinzips für Patient<br />
und behandelnden Arzt hoch.<br />
Durch die Selektivverträge ist für behandlungsbedürftige Patienten<br />
flächendeckend ein Zugang zur notwendigen Anti-VEGF-Therapie gegeben.<br />
Die Schaffung einer EBM-Ziffer brächte hinsichtlich einer zeitnahen<br />
und unbürokratischen Patientenversorgung keinerlei Vorteile.<br />
Die Erfassung des ophthalmologischen Anti-VEGF-Marktes erfordert<br />
eine spezifische Datengewinnung und -verwertung<br />
Die Verordnung der VEGF-Inhibitoren findet nahezu ausschließlich<br />
auf Privatrezepten statt. Dies begründet die Tatsache, dass Versorgungsdaten<br />
über den ophthalmologischen Markt der VEGF-Inhibitoren fehlen.<br />
Regionen-spezifische oder bundesweite Hochrechnungen sind mit den<br />
gebräuchlichen Software-Lösungen, die in der Regel auf abgerechnete<br />
Muster 16 zugreifen, nicht möglich. Die gesetzlichen und privaten Krankenversicherer<br />
können – unter Aufwendung gesteigerter Ressourcen –<br />
den eigenen ophthalmologischen Anti-VEGF-Markt auswerten.<br />
Der Rückschluss von abgerechneten Muster 16 auf die behandelte<br />
Anzahl der Patienten ist jedoch nicht möglich, da Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ra-<br />
nibi<strong>zum</strong>ab ausgeeinzelt werden. Aus den Packungen werden Teilmengen<br />
entnommen und zur Patientenbehandlung genutzt. Eine einzelne<br />
abgerechnete Packung von Ranibi<strong>zum</strong>ab und Bevaci<strong>zum</strong>ab steht somit<br />
für mehrere behandelte Patienten. Zudem verbleibt nach Herstellung<br />
der körpergewichtsadaptierten Bevaci<strong>zum</strong>ab-Infusionslösungen für<br />
onkologische Patienten häufig eine Wirkstoffrestmenge, die für die<br />
Behandlung von ophthalmologischen Patienten verwendet werden<br />
kann. Eine einzelne abgerechnete Packung Bevaci<strong>zum</strong>ab kann somit<br />
für einen onkologischen Patienten und mehrere ophthalmologische<br />
Patienten stehen. Das Ziel, die intravitreale Arzneimitteltherapie in<br />
ihrer Quantität und Qualität zu evaluieren und zu sichern, erfordert<br />
die vollständige und transparente Erfassung der Arzneimittelwertschöpfungskette.<br />
Dagegen brächte die Schaffung einer EBM-Ziffer hinsichtlich<br />
der Transparenz des augenheilkundlichen Anti-VEGF-Marktes<br />
keinerlei Vorteile.<br />
Ist Aflibercept der kommende Goldstandard?<br />
Forschung und Entwicklung von Aflibercept werden von dem USamerikanischen<br />
Unternehmen Regeneron in Kooperation mit Sanofi-<br />
Aventis (Onkologie) und Bayer Healthcare (Ophthalmologie) geleistet.<br />
Diese Art der Kooperation erinnert stark an die Konstellation rund um<br />
Ranibi<strong>zum</strong>ab. Genentech entwickelte und vertreibt mit Novartis Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
und mit Roche Bevaci<strong>zum</strong>ab. Doch während es sich bei Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
und Bevaci<strong>zum</strong>ab um unterschiedliche Moleküle handelt, wird<br />
hinter der onkologischen Therapieoption VEGF Trap und der ophthalmologischen<br />
Therapieoption VEGF Trap-Eye der identische Wirkstoff<br />
Aflibercept stehen.<br />
Die Zulassung von Aflibercept für die Behandlung von Patienten<br />
mit neovaskulärer AMD wird für das Jahr 2012 erwartet. Der Erfolg<br />
von Eylea® ist abhängig von der Bereitschaft Bayers, innovative Vermarktungsmaßnahmen<br />
in Kooperation mit gesetzlichen und privaten<br />
Krankenkassen sowie den augenheilkundlichen Leistungserbringern zu<br />
verwirklichen.<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab ist in der Phase-III-Studie CATT Ranibi<strong>zum</strong>ab nicht<br />
unterlegen<br />
Ein identischer Wirkmechanismus von Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
war in der Vergangenheit ausreichend, um die Ergebnisse<br />
der Phase-III-Studien MARINA, ANCHOR und PIER, in welchen die<br />
Literatur<br />
Ferrara N, Damico L, Shams N et al. Development of Ranibi<strong>zum</strong>ab, an anti-vascular endothelial growth factor antigen binding fragment, as therapy or neovascular<br />
age-related macular degeneration. Retina 2006; 26: 859-870<br />
Pfizer Pharma GmbH: Fachinformation Pegaptanib®. In,Pfizer Pharma GmbH (Hrsg). Fachinformation Pegaptanib®. Rote Liste GmbH (Stand: März 2009)<br />
Gragoudas ES, Adamis AP, Cunningham ET Jr, et al. Pegaptanib for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2004; 351: 2805-2816<br />
Ng EW, Sima DT, Calias P, et al. Pegaptanib, a targeted anti-VEGF aptamer for ocular vascular disease. Nat Rev Drug Discov 2006; 5: 123-132<br />
Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. Ranibi<strong>zum</strong>ab for neovascular age-related macular degeneration: 2-year results of the MARINA study. N Engl J Med 2006;<br />
355: 1419-31<br />
Brown DM, Kaiser PK, Michels M et al. Ranibi<strong>zum</strong>ab versus Verteporfin for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. N Engl J Med 2006; 355: 1432-44<br />
Novartis Pharma GmbH: Fachinformation Ranibi<strong>zum</strong>ab®. In, Novartis Pharma GmbH (Hrsg). Fachinformation Ranibi<strong>zum</strong>ab®. Rote Liste GmbH (Stand: Dezember 2008)<br />
Roche Pharma AG: Fachinformation Bevaci<strong>zum</strong>ab®. In,Roche Pharma AG (Hrsg). Fachinformation Bevaci<strong>zum</strong>ab®. Rote Liste GmbH (Stand: Juli 2009)<br />
Rosenfeld PJ, Moshfeghi AA, Puliafito CA. Optical coherence tomography findings after an intravitreal injection of bevaci<strong>zum</strong>ab (Bevaci<strong>zum</strong>ab) for neovascular agerelated<br />
macular degeneration. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2005 Jul-Aug; 36(4): 331-5<br />
Rosenfeld PJ, Fung AE, Puliafito CA. Optical coherence tomography findings after an intravitreal injection of bevaci<strong>zum</strong>ab (Bevaci<strong>zum</strong>ab) for macular edema from<br />
central retinal vein occlusion. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2005 Jul-Aug;36(4): 336-9<br />
Ahmadieh H, Moradian S, Malihi M. Rapid regression of extensive retinovitreal neovascularization secondary to branch retinal vein occlusion after a single intravitreal<br />
injection of bevaci<strong>zum</strong>ab. Int Ophthalmol. 2005 Aug-Oct; 26(4-5): 191-3<br />
The CATT Research Group. Ranibi<strong>zum</strong>ab and Bevaci<strong>zum</strong>ab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. N Engl J Med 2011; abgerufen am 08.05.2011 unter:<br />
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1102673<br />
42<br />
<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011
MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />
Wissenschaft<br />
Wirksamkeit und Sicherheit von Ranibi<strong>zum</strong>ab in der Behandlung der<br />
neovaskulären AMD untersucht wurde, auf Bevaci<strong>zum</strong>ab zu übertragen<br />
und trotz fehlender Zulassung die intravitreale Bevaci<strong>zum</strong>ab-Verabreichung<br />
als Standardbehandlung durchzuführen. Im Februar 2008<br />
wurde die Phase-III-Studie CATT (Comparison of Age-related Macular<br />
Degeneration Treatments Trials: Lucentis-Avastin Trial) durch die nationale<br />
Gesundheitsbehörde (National Eye Institute) der Vereinigten<br />
Staaten von Amerika mit 59 teilnehmenden Zentren gestartet. Rund<br />
1200 Patienten mit neovaskulärer AMD wurden auf vier Studienarme<br />
randomisiert, mit dem Ziel einen direkten Vergleich zwischen Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />
und Bevaci<strong>zum</strong>ab bei der AMD-Behandlung herzustellen. Dabei<br />
wurden Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab sowohl monatlich als auch<br />
variabel bei Bedarf verabreicht. Die Patienten, welche in die Studienarme<br />
mit monatlicher Ranibi<strong>zum</strong>ab- oder Bevaci<strong>zum</strong>ab-Verabreichung<br />
randomisiert wurden, konnten nach einem Jahr re-randomisiert werden,<br />
um weiterhin monatlich oder nach Bedarf behandelt zu werden<br />
(Abb. 7).<br />
Die Ergebnisse der CATT-Studie liegen seit Ende April 2011 vor und<br />
zeigen, dass Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab vergleichbare Ergebnisse<br />
bei der Behandlung der neovaskulären AMD bewirken und die in den<br />
Zulassungsstudien für Ranibi<strong>zum</strong>ab durchgeführten monatlichen Injektionen<br />
bei den meisten Patienten nicht erforderlich sind. Mit monatlichen<br />
Untersuchungen des Augenhintergrundes und Re-Injektionen nach<br />
Bedarf lassen sich Ergebnisse erzielen, welche mit den Ergebnissen monatlicher<br />
Verabreichungen vergleichbar sind.<br />
Ranibi<strong>zum</strong>ab or Bevaci<strong>zum</strong>ab?<br />
What Evidence is needed for<br />
Ophthalmology?<br />
VEGF antagonism is an important treatment option for patients with<br />
eye diseases like wet AMD or diabetic eye diseases. Concerning VEGF<br />
antagonism in Germany`s Ophthalmology there is lack of health care<br />
data. A standardized telephonic survey addressing treating ophthalmologists<br />
in Germany was used to acquire information in terms of<br />
VEGF antagonists in Ophthalmology. To evaluate the ophthalmologic<br />
anti VEGF market in Germany and to identify and secure the treatment<br />
quality a recurring acquisition of health care data with following<br />
management actions is needed.<br />
Keywords<br />
Bevaci<strong>zum</strong>ab, Avastin, Ranibi<strong>zum</strong>ab, Lucentis, Pegaptanib, Macugen,<br />
Ozurdex, Aflibercept, VEGF Trap-Eye, VEGF Trap, AMD, age-related<br />
macular degeneration, DME, diabetic macular edema, RVO, retinal<br />
vein occlusion, reimbursement, intravitreal Injection<br />
Schlussfolgerung<br />
Der ophthalmologische Anti-VEGF-Markt erfordert zwingend eine<br />
regelmäßige Evaluation der Versorgungsdaten mit nachfolgender Ableitung<br />
von Management-Handlungen zur Bestimmung und Sicherung der<br />
Versorgungsqualität.<br />
Neben der Optimierung der Arzneimittelwertschöpfungskette ist<br />
eine dauerhafte und regelmäßig wiederkehrende Evaluation von Versorgungsdaten<br />
zu empfehlen. Schlüsselindikatoren zur Wirksamkeit und<br />
Sicherheit der VEGF-Inhibitoren sind hilfreich, um im Versorgungsalltag<br />
die ophthalmologische Anti-VEGF-Therapie in ihrer Qualität und<br />
Quantität zu bestimmen. Diese Daten eröffnen zudem die Möglichkeit,<br />
Managementhandlungen abzuleiten, um eine Qualitätssicherung der Behandlung<br />
auf höchstem Niveau zu erreichen.