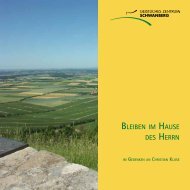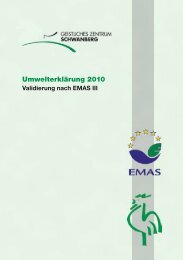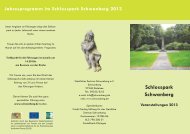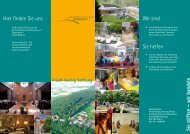Der Schwanberg und seine Geschichte - und Geistliches Zentrum ...
Der Schwanberg und seine Geschichte - und Geistliches Zentrum ...
Der Schwanberg und seine Geschichte - und Geistliches Zentrum ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Der</strong> <strong>Schwanberg</strong> <strong>und</strong> <strong>seine</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
10.000 - 4.000 v. Chr.<br />
F<strong>und</strong>e aus Alt-, Mittel- <strong>und</strong> Jungsteinzeit auf dem <strong>Schwanberg</strong><br />
erste Siedlungen in der Mittelsteinzeit<br />
750 - 450 v. Chr.<br />
erste Befestigungsanlagen<br />
400 v. Chr.<br />
Keltensiedlung auf dem <strong>Schwanberg</strong><br />
6./7: Jhd. n. Chr.<br />
Hadelogasage vom Königsschloss auf dem <strong>Schwanberg</strong><br />
1023<br />
Heinrich II. schenkt dem <strong>Schwanberg</strong> den Hochstift Würzburg<br />
1248 - 1268<br />
Bau einer Burg unter Fürstbischof Hermann von Lobdeburg<br />
1525 - 1527<br />
Zerstörung der Burg im Bauernkrieg<br />
1605<br />
Verkauf der Burg an Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn<br />
Beginn des 18. Jhds.<br />
Wiederaufbau der zerstörten Burg durch verschiedene Pächter der Würzburger Hofkammer<br />
1802/03<br />
Georg Bevern, Würzburger Hofkonditor, kauft das Schloss vom bayerischen Staat, errichtet Brunnen<br />
<strong>und</strong> Weinberge auf dem Kappelrangen, Saal <strong>und</strong> Gästezimmer im Schloss.<br />
Auf dem <strong>Schwanberg</strong> finden Veranstaltungen <strong>und</strong> Bälle statt<br />
1815 - 1897<br />
Zahlreiche wechselnde Besitzer auf dem <strong>Schwanberg</strong><br />
1897<br />
Jean <strong>Der</strong>n, ein Kaufmann aus Gießen, kauft den gesamten <strong>Schwanberg</strong>besitz. Er gilt als der<br />
Wiederhersteller des <strong>Schwanberg</strong>s. Er renoviert die Gebäude, baut das Forsthaus <strong>und</strong> eine Straße<br />
<strong>und</strong> macht den <strong>Schwanberg</strong> zu einem vielbesuchten Ausflugsziel mit Gasthaus <strong>und</strong> zu einem<br />
Aufenthaltsort zur Sommerfrische<br />
1911<br />
Alexander Graf zu Faber-Castell kauft am 2.7.1911 den gesamten <strong>Der</strong>n’schen Besitz am <strong>Schwanberg</strong><br />
<strong>und</strong> beginnt mit dem Ausbau der Infrastruktur<br />
1917<br />
Neubau einer Straße auf den <strong>Schwanberg</strong> <strong>und</strong> Bau des Gutshofes (Fertigstellung 1922), Verlegung<br />
der Stallungen aus dem Schloss, Einrichtung der Wasser- <strong>und</strong> Stromversorgung, Telefon<br />
1919 - 1921<br />
<strong>Der</strong> Schlosspark wird auf den wenig ertragreichen Feldern nordöstlich des Schlosses angelegt<br />
1928<br />
Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen (*22.8.1922) wird nach dem Tod <strong>seine</strong>s Vaters neuer Besitzer<br />
des <strong>Schwanberg</strong>s<br />
Gestaltung des „Würzgärtleins“ vor dem Schloss durch <strong>seine</strong> Mutter, Margaretha Gräfin zu Castell-<br />
Rüdenhausen, geb. Reichsgräfin von Zedtwitz-Moraván <strong>und</strong> Duppau,<br />
Renovierung des Schlosses
1944 - 1949<br />
Amerikanische Einheiten besetzen das Schloss<br />
Bei ihrem Abzug 1949 werden alle Unterlagen vernichtet, darunter auch alle Dokumente <strong>und</strong> Pläne<br />
zum Entwurf <strong>und</strong> zum Bau des Parks<br />
1949 - 1957<br />
Das Schloss wird Altenheim des Landkreises Kitzingen<br />
1957<br />
<strong>Der</strong> Pfadfinderinnen - Dienst e.V., heute <strong>Geistliches</strong> <strong>Zentrum</strong> <strong>Schwanberg</strong> e.V. pachtet das Schloss<br />
Ordenshaus <strong>und</strong> Tagungsstätten entstehen<br />
1986<br />
Bau der Michaelskirche auf dem <strong>Schwanberg</strong> nach dem Entwurf des Architekten Alexander Freiherr<br />
von Branca aus München<br />
2004<br />
Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen stirbt unvermählt <strong>und</strong> kinderlos<br />
2005<br />
Das Geistliche <strong>Zentrum</strong> <strong>Schwanberg</strong> e.V. kauft das Schloss <strong>und</strong> den Park<br />
2009<br />
Beginn der Sanierung des Schlossparks<br />
<strong>Der</strong> Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> im gartenhistorischen Kontext<br />
Die Erbauung des Parks fiel in eine Zeit, die in der Gartenarchitektur von Aufbruchstimmung<br />
<strong>und</strong> neuen Strömungen geprägt war.<br />
Nach dem Ende des klassischen Landschaftsgartens bemühte man sich um eine<br />
zweckgerichtete Naturlandschaft. Die Einbeziehung ökologischer <strong>und</strong> standortgerechter<br />
Pflanzenzusammenstellungen <strong>und</strong> eine regelmäßige Formensprache waren neue<br />
Gestaltungsgr<strong>und</strong>sätze, die auch bei der Anlage des Schlossparks <strong>Schwanberg</strong> deutlich<br />
spürbar sind.<br />
Auch die für die damalige Zeit zumindest nicht alltägliche Pflanzenverwendung, die in<br />
verschiedenen, herausragend platzierten Baumgruppen ganz bewusst inszeniert wurden, zeugt<br />
von einer besonderen botanischen Kenntnis <strong>und</strong> Vorliebe des Erbauers.<br />
Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen<br />
Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen (geb. 1866) heiratet 1896 Ottilie Freiin von Faber<br />
aus Stein bei Nürnberg, die Tochter des Bleistiftfabrikanten Wilhelm Freiherr von Faber <strong>und</strong><br />
Bertha Freiin von Faber. Laut einer Heiratsklausel nimmt das Paar den Namen Faber-Castell
an. 1903 geht das Unternehmen A.W. Faber-Castell in den Besitz von Alexander <strong>und</strong> Ottilie<br />
über, Alexander führt das Unternehmen.<br />
1911 kauft Alexander Graf zu Faber-Castell den <strong>Schwanberg</strong>besitz <strong>und</strong> beginnt, ihn<br />
auszubauen. 1918 wird die Ehe mit Ottilie geschieden.<br />
1919 bis 1921 wird der Schlosspark angelegt<br />
1920 vermählt sich Graf Alexander mit Margaretha Gräfin von Zedtwitz-Morávan <strong>und</strong><br />
Duppau, der Sohn Radulf wird 1928 geboren. 1922 nehmen Graf Alexander, <strong>seine</strong> Frau <strong>und</strong><br />
sein Sohn Radulf den gemeinsamen Familiennamen Castell-Rüdenhausen an.<br />
1928 stirbt Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen in Oberstdort, <strong>seine</strong>m Sohn Radulf<br />
vererbt er das Schloss <strong>und</strong> die Ländereien auf dem <strong>Schwanberg</strong>.<br />
Die Gartenarchitekten<br />
Für die Planung des Schlossparks wurde mit Möhl & Schnizlein ein renommiertes Büro für<br />
Gartenarchitektur beauftragt.<br />
Jakob Möhl war Münchner Hofgartendirektor <strong>und</strong> prägte das Gesicht Münchens nachhaltig.<br />
Ludwig Schnizlein war Obergärtner unter Hofgartendirektor Jakob Möhl in München.<br />
1896 gründeten sie gemeinsam die Firma Möhl & Schnizlein, ein „Bureau für angewandte<br />
Gartenkunst“ in München, später auch eine Dependance in Nürnberg.<br />
Die Firma plante nicht nur zahlreiche Gartenanlagen sondern führte auch deren Bau aus, so<br />
z.B. Zoologischer Garten München, Schloß Fuschl in Fuschl a. See, sowie Privatgärten in<br />
München, Nürnberg, Feldafing, Düren uva.<br />
<strong>Der</strong> Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> <strong>und</strong> <strong>seine</strong> Gestaltung<br />
<strong>Der</strong> Eingang zum Park ist heute nicht mehr vom Hauptzugang aus möglich. Zum einen wegen<br />
der nicht sicher begehbaren Treppenanlage, die den Zugang zum Park bildet, andererseits<br />
liegt der ehemalige Haupteingang in einem für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich<br />
der Tagungsstätten des Geistlichen <strong>Zentrum</strong>s <strong>Schwanberg</strong> e.V. Im Zuge der<br />
Sanierungsmaßnahmen soll der Haupteingang aber wieder zugänglich gemacht werden.<br />
Die Allee<br />
Eine große Achse durchzieht den Park von Osten nach Westen <strong>und</strong> teilt ihn symmetrisch auf.<br />
Die Achse ist in der westlichen Hälfte als Lindenallee ausgebildet, in der östlichen Hälfte hat<br />
sich die Allee geteilt <strong>und</strong> bildet eine Kante als Übergang zum landschaftlichen Teil. <strong>Der</strong> Weg<br />
läuft heute jedoch mittig auf das Mausoleum zu. Diese Wegeführung entspricht allerdings<br />
nicht mehr dem ursprünglichen Verlauf. Früher teilte sich der Weg <strong>und</strong> führte auch in diesem<br />
Bereich entlang der Allee. <strong>Der</strong> Gr<strong>und</strong> für diese Veränderung liegt in der forstwirtschaftlichen<br />
Nutzung des angrenzenden Waldes. Im Laufe der Jahre war es immer schwieriger geworden,<br />
mit Maschinen <strong>und</strong> Fahrzeugen am Waldrand entlang zu fahren, deshalb wurde der Weg in<br />
die Mitte der großen rechteckig geformten Wiesenfläche verlegt.<br />
Die Allee ist eine „einheitliche Allee“, die aus<br />
gegenständig angeordneten Linden (Tilia cordata,<br />
Winterlinde <strong>und</strong> Tilia x euchlora, Krim-Linde)<br />
besteht.<br />
<strong>Der</strong> Höhenverlauf ist in diesem Bereich Teil des<br />
Gestaltungskonzeptes. Von der Öffnung der Allee aus<br />
steigt das Gelände zunächst leicht an, ab ca. der<br />
Hälfte der Strecke zum Mausoleum fällt es wieder<br />
sanft ab. Somit erscheint die Entfernung verzerrt <strong>und</strong>
der Blick auf das Mausoleum entwickelt sich erst im Verlauf des Weges dorthin vollständig.<br />
Die Lindenallee als Hauptachse verläuft zwar in einer Linie von Westen nach Ost, doch weitet<br />
sie sich zu Plätzen unterschiedlicher Größe <strong>und</strong> Ausgestaltung auf:<br />
Das Rondell<br />
Im Westen öffnet sich die Allee kurz hinter dem Haupteingang zu einem ovalen Platz, in<br />
dessen Mittelpunkt ein Steinerner Tisch <strong>und</strong> ein Obelisk stehen. <strong>Der</strong> Obelisk trägt auf <strong>seine</strong>m<br />
Sockel eine Inschrift zum Gedenken an den Erbauer <strong>und</strong> an die Entstehungszeit.<br />
Dieser Platz war ehemals durch geometrisch exakt geformte<br />
Beete <strong>und</strong> Wege aufgeteilt <strong>und</strong> präsentierte sich als<br />
großzügige Freifläche, die mit einigen, für die damalige Zeit<br />
besonderen Gehölzen, wie Zeder, Thujen, Kugelrobinien,<br />
Rhododendren usw. bestückt waren. Dies erhöhte die<br />
repräsentative Wirkung des Platzes. Die Beetränder waren mit<br />
Stauden, später auch mit wechselnden Sommerblumen<br />
bepflanzt. Pflanzflächen beschränkten sich aber, laut<br />
Überlieferung von Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen,<br />
bereits schon früh auf wenige Pflanzen, wie zum Beispiel<br />
Schwertlilien, da nur wenige Pflanzen dem ständigen<br />
Wildverbiss standhielten. Alte Bandstahlreste im Boden geben<br />
aber immer noch Aufschluss über die ursprüngliche<br />
Aufteilung <strong>und</strong> Wegeführung.<br />
Am östlichen Ende des Rondells sind die Figuren der vier Jahreszeiten <strong>und</strong> drei<br />
Sandsteinbänke in die Zwischenräume der Allee platziert.<br />
Das Neptunbassin <strong>und</strong> der zentrale Platz<br />
Die Mitte des Parks ist mit dem größten Platz markiert. Die Allee öffnet sich zu einer<br />
rechteckigen Fläche, deren zentrales Element das kreisr<strong>und</strong>e Neptunbassin ist.<br />
Figuren <strong>und</strong> Putten<br />
1930 erhielt Carlo Müller, ein Würzburger<br />
Bildhauer, der aus Hoheim bei Kitzingen<br />
den Auftrag für die Neptunfigur. Auch „Vier<br />
Jahreszeiten“ stammen von Carlo Müller,<br />
die Figuren von Pippin <strong>und</strong> Hadeloga (den<br />
Sagengestalten des <strong>Schwanberg</strong>s) am<br />
Haupteingang zum Park, der Faun, die<br />
<strong>und</strong> die Sitzbänke. Als Material diente der<br />
Blasensandstein des <strong>Schwanberg</strong>s.<br />
Das Becken wird derzeit saniert, die Figur<br />
einen neuen Dreizack <strong>und</strong> die Brunnentechnik wird erneuert.<br />
stammte,<br />
außerdem<br />
Nymphe<br />
erhält<br />
Um das Becken herum waren bis 1956 noch weitere Putten gruppiert, die ursprünglichen<br />
Standorte sind allerdings nicht mehr eindeutig nachvollziehbar.<br />
Einige der Figuren waren beim Antiquariat Seligsberger in Würzburg gekauft worden, bei<br />
denen es sich um Kopien von Figuren von Johann Peter Wagner (1730 – 1809) handeln soll.
Im Zweiten Weltkrieg wurden einige der Figuren stark beschädigt. Auch in den späteren<br />
Jahren wurden sie nach ihrer Restaurierung mehrmals Opfer mutwilliger Zerstörung, sodass<br />
sich Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen 1956 dazu entschloss, die empfindlichsten Stücke in<br />
den nur privat zugänglichen kleinen Garten vor dem Schloss auf dem Kappelrangen zu<br />
bringen. (Deshalb wird dieses Gärtchen seither auch das ‚Puttengärtchen’ genannt). Dieser<br />
Garten war der Wirtsgarten der früheren Gastwirtschaft, der 1928 von Gräfin Margaretha zu<br />
<strong>seine</strong>r heutigen Form umgestaltet worden war.<br />
Gestaltung r<strong>und</strong> um den zentralen Platz<br />
An die Freifläche um das Bassin schließen nördlich <strong>und</strong> südlich Wiesenflächen an, die jedoch<br />
etwas tiefer liegen.<br />
Als Vorbild hierfür könnten Boulingrins (Bowling greens) gedient haben, ein aus England<br />
stammendes gartenkünstlerisches Motiv, das häufig in den Gartenanlagen des 17. <strong>und</strong> 18.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts verwendet wurde. Darunter versteht man eine vertieft liegendes, von einer<br />
Berme umgebende Rasenfläche, die zum Ball-, bzw. Bowlingspiel benutzt wurde. Ob dies ein<br />
Vorbild für den Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> war, kann allerdings nur vermutet werden.<br />
Die vier vorderen Eckpunkte dieser<br />
Wiesenflächen sind mit Balustervasen aus<br />
Sandstein betont.<br />
Parallel zur Allee sind in diesem Bereich<br />
die sog. ‚Bleistiftbäume’ gepflanzt. Es<br />
handelt sich hierbei um einige Exemplare<br />
von Juniperus virginiana, der Bleistiftzeder.<br />
Aus Erzählungen des letzten Besitzers,<br />
Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen, ist<br />
bekannt, dass diese z. T. in früherer Zeit zu<br />
Versuchszwecken für die Bleistiftproduktion angepflanzt wurden.<br />
Die Bleistiftzedern stehen in einer Linie entlang der<br />
Rasenflächen, so dass angenommen werden kann, dass<br />
Bäume bewusst als gestalterisches Andenken an die<br />
verwandtschaftlichen Beziehungen zum Hause Fabergepflanzt<br />
wurden. Alexander Graf zu Castell-<br />
Rüdenhausen selbst hatte das Unternehmen viele Jahre<br />
<strong>und</strong> maßgeblich geprägt. Die Koniferen gelten daher als<br />
Zeugnis der Familiengeschichte <strong>und</strong> werden bei der<br />
entsprechend behandelt.<br />
Aussichtsbalkon<br />
Die beiden Flächen, die den Platz flankieren, werden<br />
beiderseits von attraktiven Blickpunkten begrenzt. Im<br />
ist dies eine Mauer, die als ‚Aussichtsbalkon’ in die<br />
Landschaft diente. Von hier aus führt auch eine<br />
Treppenanlage in den Wald.<br />
vertieften<br />
die<br />
Castell<br />
geführt<br />
schönes<br />
Sanierung<br />
Norden<br />
Die Pergola
Gegenüberliegend im Süden bildet eine Pergola aus schlichten Sandsteinquadern den<br />
Abschluss des Platzes. Sie wurde 1921 aus <strong>Schwanberg</strong>sandstein gebaut. Das Material<br />
stammte aus einem Steinbruch im Park. Dort entstand an dessen Stelle einige Jahre später ein<br />
Alpinum, wie es sich in den zwanziger <strong>und</strong> dreißiger Jahren großer Beliebtheit erfreute.<br />
Direkt vor der Pergola steht die Hirschplastik aus Bronze. Sie stammt von dem Nürnberger<br />
Bildhauer Hans Göschel, der auch das Mausoleum entworfen hat. Ursprünglich trug der<br />
Hirsch ein Hubertuskreuz auf dem Kopf, nachdem es jedoch mehrmals entwendet worden<br />
war, hat der frühere Besitzer darauf verzichtet, es zu ersetzen. Über den heutigen Verbleib<br />
einer Nachbildung, die vor Jahrzehnten angefertigt wurde, ist leider nichts bekannt.<br />
Das Mausoleum<br />
Den Schlusspunkt der Allee im Osten bildet das Mausoleum. Es wurde 1930 bis 1932 nach<br />
dem Entwurf von Hans Göschel gebaut. Nach <strong>seine</strong>r Fertigstellung wurde der 1928 in<br />
Oberstdorf verstorbene Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen dorthin überführt. Neben<br />
Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen liegen dort <strong>seine</strong> Frau Margaretha, geborene von<br />
Zedtwitz-Morávan <strong>und</strong> Duppau, spätere Prinzessin zur Lippe-Weißenfeld, <strong>und</strong> sein Sohn<br />
Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen begraben.<br />
Das Mausoleum selbst gehört allerdings zum Besitz der Familien Castell-Rüdenhausen <strong>und</strong><br />
Castell-Castell..<br />
<strong>Der</strong> äußere Teil<br />
Den Gartenkunsttheorien der Zeit entsprechend, wird die strenge architektonische Aufteilung<br />
mit einer landschaftlichen Gestaltung verzahnt. Die geometrische Gestaltung des inneren<br />
Teils wird nach außen hin aufgelöst, der Übergang in die freie Landschaft wird locker<br />
ausgebildet. Während geradlinige, exakt ausgerichtete Wege durch den inneren, formalen<br />
Parkteil führen, erschließen gew<strong>und</strong>ene <strong>und</strong> unregelmäßig geformte Wege den<br />
landschaftlichen äußeren Teil.<br />
Immer wieder gibt es Abzweigungen, die alle Gartenteile miteinander verbinden, es gibt aber<br />
auch die Möglichkeit, jeden Teil getrennt voneinander zu begehen.<br />
Das „Prinzessinnenbad“<br />
<strong>Der</strong> landschaftliche Teil des Parks ist nach<br />
klassischen Vorbildern mit kleineren<br />
Schwerpunkten besetzt, die den Gang durch den<br />
Wald noch attraktiver machen sollten. Im<br />
Südosten ist dies ein kleiner See, das sog.<br />
‚Prinzessinnenbad’, der etwas tiefer als der Weg<br />
liegt. Er diente sowohl als Rast- <strong>und</strong><br />
Aussichtsplatz, der einen schönen Blick auf die<br />
Felder <strong>und</strong> den Wald bot, als auch zum Baden.<br />
Verborgen zwischen hohen Bäumen liegt der See<br />
stimmungsvoller Umgebung.<br />
in<br />
<strong>Der</strong> Friedhof der Communität Casteller Ring<br />
Etwas versteckt im Wald ist auf der Höhe dieses Sees ein Friedhof für die Schwestern der<br />
Communität Casteller Ring angelegt.
In diesem Bereich war bereits vor Jahrzehnten schon eine Lichtung freigehalten, sie diente<br />
einstmals als gräflicher Tennisplatz.<br />
Die Aussichtskanzel im Wald <strong>und</strong> das Alpinum<br />
<strong>Der</strong> nordwestliche Parkteil bietet attraktive<br />
Aussichtspunkte in das Tal. Deshalb wurde dort<br />
Wald eine Aussichtskanzel aus Sandsteinquadern<br />
im<br />
gebaut.<br />
Gegenüber dieser Kanzel war früher ein kleiner<br />
Steinbruch, der u.a. das Material für die Pergola<br />
lieferte. An dieser Stelle entstand dann später ein<br />
Alpinum, das heute jedoch kaum mehr zu<br />
erkennen ist. Das Alpinum lag früher inmitten einer sonnigen freien Fläche. Heute ist es Teil<br />
des Waldes, von hohen Bäumen umstellt, <strong>und</strong> nicht mehr erkennbar. Die veränderten<br />
Standortverhältnisse machen den Erhalt mit typischen Pflanzen aber nicht möglich.<br />
Dieses Gestaltungselement ist die Kategorie<br />
„Pflanzensammlungen“, bzw.<br />
„Spezialsammlungen“ einzuordnen. Für ein<br />
Alpinum auf dem <strong>Schwanberg</strong> könnte es mehrere<br />
Gründe gegeben haben: Nicht nur, dass<br />
Pflanzensammlungen eine zunehmend häufiger<br />
verwendetes Element in der Gartengestaltung<br />
waren, sondern es bot sich auch die Nutzung der<br />
natürlichen Gegebenheiten des Steinbruches an<br />
diesem Ort an. Nicht zuletzt könnte der Bezug von Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen<br />
zu <strong>seine</strong>m weiteren Wohnsitz in Oberstdorf im Allgäu der Anreiz gewesen sein, auf der<br />
Hochfläche des <strong>Schwanberg</strong>s in <strong>seine</strong>m Schlosspark einen Alpengarten zu errichten.<br />
Erzählungen von Graf Radulf zufolge wurden die Pflanzen hierfür von einer Gärtnerei aus<br />
dem nahe gelegenen Rüdenhausen geliefert, die damals auf Enziane <strong>und</strong> dergleichen<br />
spezialisiert gewesen sein soll.<br />
Parkräume<br />
<strong>Der</strong> gesamte nordöstliche Bereich zwischen Alpinum <strong>und</strong> Lindenallee war als offener Raum<br />
mit Wiesen angelegt. Die Ränder der waldartigen Bereiche haben sich im Laufe der<br />
Jahrzehnte immer weiter zum inneren Parkteil in Richtung Allee vorgeschoben, sodass die<br />
freien Flächen fast völlig zugewachsen sind <strong>und</strong> ihre Raumwirkung für den Park nicht mehr<br />
erkennbar ist.<br />
Ähnlich sieht es auch im nordwestlichen Bereich zwischen dem Aussichtsbalkon <strong>und</strong> der<br />
Lindenallee aus. Auch hier haben sich die Ränder des angrenzenden Waldes immer weiter zur<br />
Allee hin verschoben, die räumliche Wirkung der Wiesen spielt nur noch eine untergeordnete<br />
Rolle.<br />
Wie in den klassischen Landschaftsgärten wurden auch im Schlosspark <strong>Schwanberg</strong><br />
Baumgruppen platziert, die frei von Unterwuchs gehalten wurden, um den Blick nicht zu<br />
begrenzen. Auch waren die Wege so angelegt, dass der Blick im <strong>und</strong> durch den Park bewusst<br />
gelenkt wurde <strong>und</strong> so die Räume im Park nach einer geplanten Abfolge erlebt werden<br />
konnten. Gehölze, Hecken <strong>und</strong> Baumgruppen dienten als „Kulisse“, die den Rahmen für die<br />
Inszenierung der Plätze <strong>und</strong> Ausstattungen bildete.
Parkwiesen<br />
Parkwiesen sind Teile von meist weitläufigen Landschaftsparks. Sie haben sich aus der<br />
traditionellen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsform entwickelt. Auch sie haben eine<br />
raumbildende Funktion, die besonders in der Verbindung mit den o.g. Gehölzkulissen zur<br />
Wirkung kommt.<br />
Im Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> bilden die Parkwiesen einerseit die Räume zwischen dem<br />
inneren, formalen Teil <strong>und</strong> dem äußeren, landschaftlichen Teil. Gleichzeitig schaffen sie aber<br />
auch als Wiesensaum den Übergang zu den Waldrändern. Die landwirtschaftliche Nutzung<br />
dieser Wiesenflächen war <strong>und</strong> ist schon immer Teil des Bewirtschaftungskonzepts, genauso<br />
wie die forstwirtschaftliche Nutzung der Gehölzbereiche im landschaftlichen Teil des Parks.<br />
Blickachsen<br />
Wie in vielen anderen historischen Parks <strong>und</strong> Gärten wird der Blick des Betrachters auch im<br />
Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> durch die bewusste Platzierung der Gehölze gelenkt. Durch die<br />
Veränderungen im Gehölzbestand, der Auflösung von Gehölzgruppen oder durch<br />
unkontrollierten Unterwuchs von Wildgehölzen sind viele Blickachsen heute nicht mehr so<br />
erlebbar wie beabsichtigt. Am deutlichsten ist dies bei den beiden Aussichtspunkten im<br />
Norden des Parks zu spüren, wo der Blick in das Tal nur eingeschränkt bzw. überhaupt nicht<br />
möglich ist. Auch innerhalb des Parks sind verschiedene - einstmals geplante -<br />
Blickrichtungen verstellt. Große Einzelbäume, die als Bezugspunkt dienten, sind z.T. nicht<br />
mehr als solche sichtbar. Im Zuge der Sanierung des Schlossparks werden die wichtigsten<br />
Blickbezüge aber wieder hergestellt.<br />
<strong>Der</strong> Gehölzbestand<br />
Auf historischen Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, dass der südliche Pfad zwischen<br />
Rondell <strong>und</strong> Pergola von ganz unterschiedlichen Gehölzgruppen begleitet war. Dies hatte<br />
genau geplante Gründe. Einerseits verhinderten Nadelgehölze <strong>und</strong> dichte Baum- <strong>und</strong><br />
Strauchgruppen, dass der Blick schon von Weitem auf die Pergola fallen konnte, andererseits<br />
ließen Birkengruppen mit hohen Kronenansätzen <strong>und</strong> transparenten Kronen die Durchsicht in<br />
einzelne Räume des Schlossparks zu.<br />
Die Verwendung unterschiedlichster Baumarten diente nicht nur der Vielfalt des Bestandes,<br />
sondern hatte auch die Funktion gezielte Parkstimmungen zu erzeugen. Baumgruppen (z.B.<br />
aus Zypressen, Scheinzypressen <strong>und</strong> Lebensbaumarten wie westlich der Pergola) wurden
ewusst gepflanzt, um mit den unterschiedlichen Wuchsformen <strong>und</strong> Färbungen der Nadeln<br />
eine besondere Stimmung zu inszenieren.<br />
Gehölzgruppen entlang des Weges im südwestlichen, landschaftlichen Teil dienten dazu, den<br />
Blick einzugrenzen, während andere – z.B. Birkengruppen in den Freiflächen – eine bewusste<br />
Durchsichtigkeit zuließen. Einzelne Bäume dieser Gehölzgruppen wurden in der<br />
Vergangenheit nach Bedarf entnommen, andere dafür ergänzt, teilweise aber ohne besondere<br />
Berücksichtigung der Gestaltungsabsicht.<br />
Einzelgehölze, wie Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera), Atlaszedern (Cedrus atlanticus),<br />
Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum), Trompetenbaum (Catalpa bignonioides), oder<br />
auch der sog. Bleistiftbäume (Juniperus virginiana), die für die damalige Zeit exotische<br />
Bäume waren, erhielten Einzelstellungen, die sie weithin sichtbar machten.<br />
Auffallend häufig ist die Esskastanie im Park zu finden. Im Bereich r<strong>und</strong> um den Friedhof der<br />
Communität Casteller Ring <strong>und</strong> im nordöstlichen Teil stehen einige große Bäume, die auch<br />
reiche - wenn auch nicht ganz ausreifende - Früchte tragen.<br />
Die Vielfalt des Gehölzbestandes lässt nicht nur die Vorliebe <strong>und</strong> die Fachkenntnis des<br />
Erbauers <strong>und</strong> <strong>seine</strong>s Nachfolgers für Botanik <strong>und</strong> Forstwirtschaft erkennen, sie ist ein<br />
Charakteristikum <strong>und</strong> eine weitere Besonderheit des<br />
Parks.<br />
Die Wirkung der Solitärgehölze <strong>und</strong> Gehölzgruppen<br />
entfaltet sich aber ganz besonders durch die offenen<br />
Räume, die als Wiesenflächen angelegt sind.<br />
Ziele der Parksanierung<br />
2008 wurde ein umfassendes „Parkpflegewerk“ für den<br />
Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> erstellt.<br />
„Ein Parkpflegewerk ist ein Instrument zur Analyse, zur Dokumentation, zur<br />
denkmalgerechten Pflege, zur Erhaltung <strong>und</strong> Restaurierung historischer Gärten, Parks,<br />
Plätzen <strong>und</strong> Grünanlagen. Es umfasst jeweils ein mit allen Beteiligten verabredetes<br />
Programm für die Pflege, Unterhaltung <strong>und</strong> Umgestaltung im Hinblick auf den Denkmalwert<br />
der Anlage.“ 1<br />
In dieser Gr<strong>und</strong>lage ist einerseits die <strong>Geschichte</strong> <strong>und</strong> die Gestaltung des Parks dargestellt <strong>und</strong><br />
analysiert. Andererseits sind darin für jeden einzelnen Parkbereich Entwicklungsziele<br />
definiert <strong>und</strong> die dafür notwendigen Maßnahmen aufgeführt.<br />
Die Veränderungen im Schlosspark <strong>Schwanberg</strong> sind derzeit noch einigermaßen<br />
nachvollziehbar. Bandstahlreste entlang der Wege lassen auf den ursprünglichen Verlauf <strong>und</strong><br />
auf die Breiten schließen. Auch aus den vorhandenen Luftbildaufnahmen auf den alten<br />
Postkarten lassen sich viele Details nachvollziehen.<br />
1 Hrsg: Deutsche Gesellschaft für Gartenkultur <strong>und</strong> Landespflege (DGGL) e.V.<br />
Arbeitskreis Historische Gärten. In: Historische Gärten in Deutschland,<br />
Neustadt 2000
In manchen Fällen, wie zum Beispiel dem Alpinum, werden die veränderten<br />
Standortverhältnisse den Sinn einer Wiederherstellung in Frage stellen. Dagegen werden die<br />
Bereiche, in denen wichtige Raumkanten <strong>und</strong> Bezüge verschoben sind, in ihre beabsichtigen<br />
Proportionen zurückgeführt werden müssen.<br />
Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Flächeneinteilungen nach historischem Vorbild neu zu<br />
ordnen <strong>und</strong> prägende Elemente langfristig zu erhalten. Es wird weniger darum gehen, eine<br />
detailgetreue Rekonstruktion aller historischen Vorbilder zu schaffen, sondern darum, die<br />
Gestaltungsabsicht wieder erlebbar zu machen, die auch dauerhaft pflegbar ist.<br />
Die wichtigsten Maßnahmen:<br />
Im Sommer 2009 wurde die gesamte Lindenallee einem Pflegeschnitt unterzogen, der ihren<br />
Fortbestand für die nächsten Jahrzehnte sichern wird.<br />
Im Herbst 2009 wurde mit der Sanierung des Neptunbassins begonnen, die im Frühjahr 2010<br />
abgeschlossen sein wird.<br />
Im Rondell sollen die ursprünglichen Strukturen wieder hergestellt <strong>und</strong> die Flächengestaltung<br />
neu geordnet werden.<br />
Die Pergola wird saniert <strong>und</strong> die Gestaltung des Umfeldes neu geordnet.<br />
Wege <strong>und</strong> Treppen werden ihrem historischen Verlauf entsprechend saniert.<br />
Waldränder werden als Raumkanten von den umliegenden Flächen abgegrenzt.<br />
Die Blickbeziehungen werden so weit wie möglich wieder herausgearbeitet, dies wird im<br />
Zuge der Pflege des Gehölzbestandes geschehen.<br />
Besucher sollen die Möglichkeit haben, den Park per Audio-Guide zu erleben. (seit 2008<br />
stehen auch Tafeln im Park, die einige Basisinformationen bieten)<br />
Für die<br />
Maßnahmen zur<br />
des Schlossparks<br />
finanzielle<br />
von Förderungen<br />
Leader,<br />
Denkmalpflege<br />
verschiedener<br />
Einzelpersonen<br />
können.<br />
umfangreichen<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Belebung<br />
bedarf es beträchtliche<br />
Mittel, die nur mit Hilfe<br />
aus dem EU-Programm<br />
Zuwendungen der<br />
<strong>und</strong> Spenden<br />
Institutionen <strong>und</strong><br />
aufgebracht werden