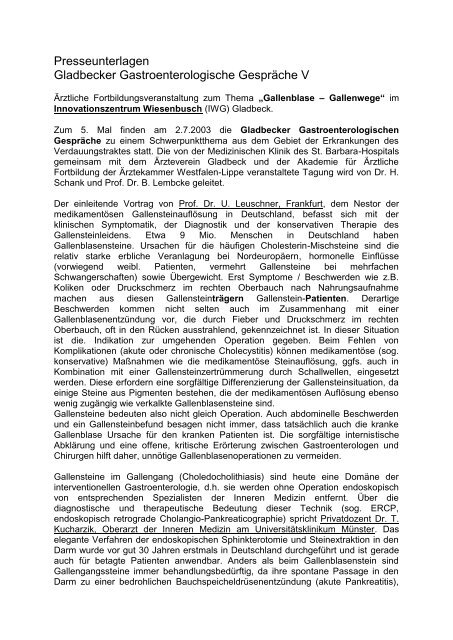Professor Dr
Professor Dr
Professor Dr
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Presseunterlagen<br />
Gladbecker Gastroenterologische Gespräche V<br />
Ärztliche Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Gallenblase – Gallenwege“ im<br />
Innovationszentrum Wiesenbusch (IWG) Gladbeck.<br />
Zum 5. Mal finden am 2.7.2003 die Gladbecker Gastroenterologischen<br />
Gespräche zu einem Schwerpunktthema aus dem Gebiet der Erkrankungen des<br />
Verdauungstraktes statt. Die von der Medizinischen Klinik des St. Barbara-Hospitals<br />
gemeinsam mit dem Ärzteverein Gladbeck und der Akademie für Ärztliche<br />
Fortbildung der Ärztekammer Westfalen-Lippe veranstaltete Tagung wird von <strong>Dr</strong>. H.<br />
Schank und Prof. <strong>Dr</strong>. B. Lembcke geleitet.<br />
Der einleitende Vortrag von Prof. <strong>Dr</strong>. U. Leuschner, Frankfurt, dem Nestor der<br />
medikamentösen Gallensteinauflösung in Deutschland, befasst sich mit der<br />
klinischen Symptomatik, der Diagnostik und der konservativen Therapie des<br />
Gallensteinleidens. Etwa 9 Mio. Menschen in Deutschland haben<br />
Gallenblasensteine. Ursachen für die häufigen Cholesterin-Mischsteine sind die<br />
relativ starke erbliche Veranlagung bei Nordeuropäern, hormonelle Einflüsse<br />
(vorwiegend weibl. Patienten, vermehrt Gallensteine bei mehrfachen<br />
Schwangerschaften) sowie Übergewicht. Erst Symptome / Beschwerden wie z.B.<br />
Koliken oder <strong>Dr</strong>uckschmerz im rechten Oberbauch nach Nahrungsaufnahme<br />
machen aus diesen Gallensteinträgern Gallenstein-Patienten. Derartige<br />
Beschwerden kommen nicht selten auch im Zusammenhang mit einer<br />
Gallenblasenentzündung vor, die durch Fieber und <strong>Dr</strong>uckschmerz im rechten<br />
Oberbauch, oft in den Rücken ausstrahlend, gekennzeichnet ist. In dieser Situation<br />
ist die. Indikation zur umgehenden Operation gegeben. Beim Fehlen von<br />
Komplikationen (akute oder chronische Cholecystitis) können medikamentöse (sog.<br />
konservative) Maßnahmen wie die medikamentöse Steinauflösung, ggfs. auch in<br />
Kombination mit einer Gallensteinzertrümmerung durch Schallwellen, eingesetzt<br />
werden. Diese erfordern eine sorgfältige Differenzierung der Gallensteinsituation, da<br />
einige Steine aus Pigmenten bestehen, die der medikamentösen Auflösung ebenso<br />
wenig zugängig wie verkalkte Gallenblasensteine sind.<br />
Gallensteine bedeuten also nicht gleich Operation. Auch abdominelle Beschwerden<br />
und ein Gallensteinbefund besagen nicht immer, dass tatsächlich auch die kranke<br />
Gallenblase Ursache für den kranken Patienten ist. Die sorgfältige internistische<br />
Abklärung und eine offene, kritische Erörterung zwischen Gastroenterologen und<br />
Chirurgen hilft daher, unnötige Gallenblasenoperationen zu vermeiden.<br />
Gallensteine im Gallengang (Choledocholithiasis) sind heute eine Domäne der<br />
interventionellen Gastroenterologie, d.h. sie werden ohne Operation endoskopisch<br />
von entsprechenden Spezialisten der Inneren Medizin entfernt. Über die<br />
diagnostische und therapeutische Bedeutung dieser Technik (sog. ERCP,<br />
endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreaticographie) spricht Privatdozent <strong>Dr</strong>. T.<br />
Kucharzik, Oberarzt der Inneren Medizin am Universitätsklinikum Münster. Das<br />
elegante Verfahren der endoskopischen Sphinkterotomie und Steinextraktion in den<br />
Darm wurde vor gut 30 Jahren erstmals in Deutschland durchgeführt und ist gerade<br />
auch für betagte Patienten anwendbar. Anders als beim Gallenblasenstein sind<br />
Gallengangssteine immer behandlungsbedürftig, da ihre spontane Passage in den<br />
Darm zu einer bedrohlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis),
ihre Persistenz im Gallengang zu einer gefährlichen Gallengangsinfektion<br />
(Cholangitis) führen kann. Strategien, praktische Kniffe, komplizierte Befunde und<br />
Komplikationen der Technik, die auch im St. Barbara-Hospital langjährig zum<br />
therapeutischen Standard gehört, sollen erörtert werden.<br />
Zur operativen Behandlung des Gallensteinleidens spricht Chefarzt <strong>Dr</strong>. N. Brüstle,<br />
Gladbeck, unter dem Titel: Cholecystektomie – modern times are better times. Die<br />
Entwicklung der laparoskopischen Cholecystektomie, d.h. die Entfernung der<br />
Gallenblase durch endoskopische Instrumente, die vom Operateur außerhalb des<br />
Körpers bedient werden und die nur minimale Hautschnitte erfordern, bedeutet<br />
gegenüber der traditionellen Methode einen erheblichen Zugewinn an<br />
Patientenkomfort, Sicherheit sowie eine drastische Verkürzung der Rekonvaleszenz<br />
und Liegedauer. Insbesondere übergewichtige Patienten profitieren von diesem<br />
schonenden Verfahren und auch postoperative Schmerzen sind bei der<br />
laparoskopischen Cholecystektomie deutlich geringer. Auch diese inzwischen<br />
weltweit praktizierte Technik geht auf Erfindungen und innovative Entwicklungen in<br />
Deutschland zurück. Aber: nicht jeder Patient, nicht jede Situation eignet sich für<br />
dieses Verfahren, d.h. mitunter ist das früher übliche operative Vorgehen<br />
vorzuziehen. Große Erfahrungen mit beiden Verfahren und eine differenzierte<br />
Verfahrenswahl – das ist ein bedeutsamer Fortschritt, von dem Patienten heute<br />
profitieren.<br />
Abschließend berichtet Prof. <strong>Dr</strong>. B. Lembcke, Chefarzt der Medizinischen Klinik am<br />
St. Barbara-Hospital, über seltenere – aber keineswegs unwichtige – hepatobiliäre<br />
Erkrankungen in Wort und Bild. Hintergrund dieses Exkurses über sehr<br />
unterschiedliche und teilweise für den betroffenen Patienten einschneidende,<br />
andererseit auch ggfs. harmlose (und dann unter dem Aspekt der Vermeidung von<br />
Überdiagnostik bedeutsame) Störungen und Befunde ist die Vielzahl<br />
differentialdiagnostischer Hintergründe bei pathologischen Leberwerten. Nicht alle<br />
erhöhten Leberwerte sind durch Alkohol oder eine Hepatitis bedingt, nicht jeder<br />
Ultraschallbefund einer „Fettleber“ ist auch tatsächlich eine Fettleber. Was der<br />
Gastroenterologe als Spezialist für Verdauungs-, Leber- und Gallenwegkrankheiten<br />
hierzu beitragen kann, stützt sich dabei sowohl auf labordiagnostische wie<br />
bildgebende (Ultraschall, endoskopische Gallengangsdarstellung, feingewebliche<br />
Untersuchung von Leberbiopsien) Verfahren. Umfassende klinische Erfahrungen<br />
sind aber gerade bei den vielfältigen diagnostischen Möglichkeiten unabdingbar, und<br />
dies nicht nur unter den heute so vordergründig gewordenen Kostenaspekten.<br />
Prof. Lembcke weist darauf hin, dass eine Reihe von Erkrankungen mit Cholestase<br />
(Gallestau) durch genetische Mutationen bedingt ist und z.T. bereits im Kindesalter<br />
auftritt. Dabei können Kombinationen mit anderen Auffälligkeiten und auch<br />
Missbildungen z.B. des Herzens oder der Wirbelsäule bestehen. Andere Cholestase-<br />
Syndrome entstehen z.B. bei Nierentumoren. Malformationen der Gallenwege,<br />
Veränderungen und Infektionen der Gallenwege bei AIDS, Gallenblasen- und<br />
Gallenwegsbefunde bei der cystischen Fibrose (Mukoviszidose) und parasitäre<br />
Infektionen der Gallenwege, z.B. durch Würmer oder Egel, die durch den<br />
Ferntourismus näher an unsere Welt herangerückt sind, runden das Spektrum ab.<br />
Die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) ist eine progressive<br />
Gallengangserkrankung, die vorwiegend bei jungen Männern mit einer<br />
Darmentzündung (Colitis ulcerosa) auftritt und das Risiko eines Übergangs in ein<br />
Gallengangskarzinom birgt. Durch frühe medikamentöse und endoskopische<br />
Therapie, enge fachärztliche Betreuung und die zeitgerechte Indikationsstellung zur
Lebertransplantation ist jedoch heute eine gute Prognose gegeben. Die primär biliäre<br />
Cirrhose (PBC) betrifft demgegenüber zu 90 % Frauen mittleren Lebensalters (30-60<br />
J.); sie ist häufiger mit anderen Autoimmunerkrankungen vergesellschaftet und<br />
äußert sich anfangs oft nur mit diskreten Symtomen (Juckreiz, Abgeschlagenheit,<br />
Gelenkbeschwerden; später Gelbverfärbung, Gewichtsabnahme). Neben der<br />
Stadiengerechten medikamentösen Therapie mit Gallensäuren vom Typ der<br />
Bärengalle ist auch hier die fachärztliche Kontrolle der Leberfunktion zur<br />
rechtzeitigen Indikationsstellung zur Lebertransplantation entscheidend. Aber auch<br />
nach einer Lebertransplantation werden nicht ganz selten Gallengangsveränderungen<br />
beobachtet, die eigenen Krankheitswert besitzen; neben Infektionen<br />
mit dem Cytomegalievirus sind hierbei Gewebe-Unverträglichkeiten, Durchblutungsstörungen,<br />
operative Schwierigkeiten und die Zeit des Transplantattransports<br />
wichtige Einflußgrößen. Ein weites Feld mit schwieriger Thematik also, durch das<br />
<strong>Professor</strong> Lembcke seine Kolleginnen und Kollegen sowie interessierte<br />
Mitarbeiter(innen) des St. Barbara-Hospitals mit reichlich anschaulichem Bildmaterial<br />
führt; „fast mehr Expedition als Exkursion“.<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. B. Lembcke