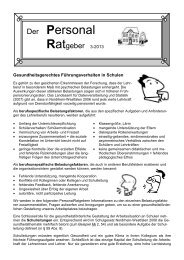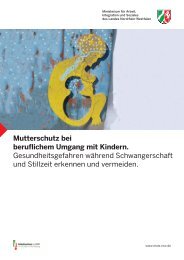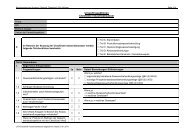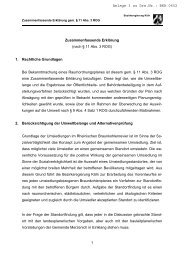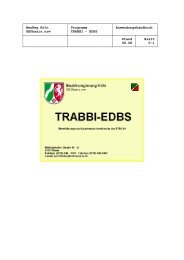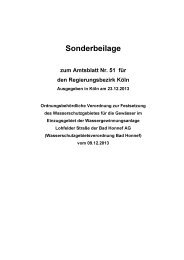(NÖV) 2/2006 - Bezirksregierung Köln
(NÖV) 2/2006 - Bezirksregierung Köln
(NÖV) 2/2006 - Bezirksregierung Köln
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>NÖV</strong><br />
Nachrichten aus dem öffentlichen Vermessungswesen<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Innenministerium<br />
des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
<strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong><br />
Geodätischer Raumbezug in NRW – gestern, heute und zukünftig –<br />
Wolfgang Irsen 3<br />
Mit ALKIS ® in ein neues Zeitalter<br />
Stephan Heitmann 13<br />
Präsentation von ALKIS ® Standardausgaben in NRW<br />
– ein Werkstattbericht<br />
Klaus Heyer 17<br />
Amtliche Hauskoordinaten, ein Angebot der AdV<br />
Martin Knabenschuh und Gerfried Westenberg 27<br />
Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen mit SAPOS ®<br />
Wolfgang Kuttner, Katja Nitzsche und Peter Reifenrath 37<br />
Zur Vertretung von Kirchengemeinden im Grenzfeststellungsund<br />
Abmarkungsverfahren<br />
Markus Rembold 51<br />
GPS-Antennenkalibrierungen beim Landesvermessungsamt NRW<br />
– Konzept und erste Erfahrungen<br />
Manfred Spata, Bernhard Galitzki, Klaus Strauch und<br />
Heidrun Zacharias 62<br />
Neue Mess-Schiene mit CFK-Stab zur EDM-Eichung<br />
beim Landesvermessungsamt NRW<br />
Walter Knapp 78<br />
Zur Überprüfung der NN- und NAP-Höhen der Unterirdischen<br />
Festlegungen (UF) an der Grenze zu den Niederlanden<br />
Reiner Boje, Winfried Klein, Jürgen Schulz und Manfred Spata 81
Inhaltsverzeichnis<br />
Aufsätze, Abhandlungen 3<br />
Geodätischer Raumbezug in NRW – gestern, heute und zukünftig –<br />
Wolfgang Irsen 3<br />
Mit ALKIS ® in ein neues Zeitalter<br />
Stephan Heitmann 13<br />
Präsentation von ALKIS ® Standardausgaben in NRW – ein Werkstattbericht<br />
Klaus Heyer 17<br />
Amtliche Hauskoordinaten, ein Angebot der AdV<br />
Martin Knabenschuh und Gerfried Westenberg 27<br />
Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen mit SAPOS ®<br />
Wolfgang Kuttner, Katja Nitzsche und Peter Reifenrath 37<br />
Zur Vertretung von Kirchengemeinden im Grenzfeststellungs- und Abmarkungsverfahren<br />
Markus Rembold 51<br />
GPS-Antennenkalibrierungen beim Landesvermessungsamt NRW<br />
– Konzept und erste Erfahrungen<br />
Manfred Spata, Bernhard Galitzki, Klaus Strauch und Heidrun Zacharias 62<br />
Neue Mess-Schiene mit CFK-Stab zur EDM-Eichung beim Landesvermessungsamt NRW<br />
Walter Knapp 78<br />
Zur Überprüfung der NN- und NAP-Höhen der Unterirdischen Festlegungen (UF)<br />
an der Grenze zu den Niederlanden<br />
Reiner Boje, Winfried Klein, Jürgen Schulz und Manfred Spata 81<br />
Nachrichten/Aktuelles 93<br />
Termine 104<br />
Aufgespießt 104<br />
Buchbesprechungen 105
Aufsätze, Abhandlungen<br />
Der geodätische Raumbezug in Nordrhein-Westfalen<br />
– gestern, heute und zukünftig –<br />
Von Wolfgang Irsen<br />
Einleitung<br />
Der geodätische Raumbezug steht in Deutschland<br />
vor einem großen Umbruch. Die Auswirkungen<br />
des Global Positioning System (GPS)<br />
machen sich überall im Vermessungswesen<br />
bemerkbar, nicht zuletzt bei der Einführung<br />
eines einheitlichen, europaweiten Bezugssystems<br />
in allen Bereichen der Landesvermessung<br />
und des Liegenschaftskatasters. Die AdV hat<br />
2004 in einem Grundsatzbeschluss eine Strategie<br />
für den einheitlichen Raumbezug in<br />
Deutschland vorgeschlagen. Möglichkeiten für<br />
die in NRW beabsichtigte Umsetzung dieses<br />
Beschlusses werden vorgestellt und diskutiert.<br />
1 Wie war der geodätische Raumbezug<br />
bisher festgelegt und geregelt?<br />
Um Punkte in der Ebene oder im dreidimensionalen<br />
Raum untereinander in Beziehung zu<br />
bringen, werden bekanntlich Koordinaten und<br />
Höhen benutzt, die in einem festgelegten<br />
Bezugssystem bestimmt sind. Grundlegende<br />
Bedingung hierfür ist der Bezug auf eine einheitliche<br />
geodätische Grundlage. Diese<br />
Grundlagen ermittelten in zurückliegender<br />
Zeit die einzelnen Staaten jeweils für sich,<br />
sodass es für Europa über mehrere Jahrhunderte<br />
hinweg keine einheitlichen Festlegungen<br />
gab, sondern stets nur nationale Referenzsysteme.<br />
Dabei wurde die Positionierung von<br />
Punkten an der Erdoberfläche in die lagemäßige<br />
und in die höhenmäßige Bearbeitung aufgeteilt,<br />
bedingt durch verschiedene Messverfahren<br />
der Lage- und Höhenmessung wie auch<br />
durch die Tatsache, dass für beide Angaben<br />
völlig andersartige Bezugssysteme zugrunde<br />
liegen. Während Lageangaben stets auf einer<br />
mathematisch definierten, geometrischen Bezugsfläche<br />
basieren, gründen sich Höhensysteme<br />
meist auf physikalisch festgelegte<br />
Bezugsflächen. Die Realisierung der Bezugssysteme<br />
für die Lage, die Höhe und die Schwere<br />
erfolgte durch dauerhaft vermarkte Festpunkte<br />
an der Erdoberfläche, für die jeweils<br />
Koordinaten, Höhen oder Schwerewerte in den<br />
jeweiligen Bezugssystemen bestimmt und<br />
nachgewiesen wurden. Neben der Bestimmung<br />
der Referenzwerte dieser Punkte erforderte<br />
vor allem die Pflege und Erhaltung der<br />
Festpunkte einen großen und kostenträchtigen<br />
Personaleinsatz.<br />
1.1 Lagebezug<br />
Der heutige amtliche Lagebezug in Nordrhein-<br />
Westfalen geht zurück auf die Königlich<br />
Preußische Landesaufnahme nach 1875 und in<br />
einigen Bereichen sogar auf die Zeit davor, also<br />
datiert in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.<br />
Mehrfach wurde der Lagebezug im Laufe der<br />
Zeit erneuert und den Gegebenheiten und<br />
Erfordernissen abgepasst, vornehmlich in solchen<br />
Gebieten, in denen sich die Erdoberfläche<br />
als Auswirkung von Bergbauaktivitäten veränderte.<br />
So verzeichnen wir heute in NRW mehr<br />
als 20 unterschiedliche Lagebezugssysteme,<br />
die zwar zumeist nur regionale Bedeutung<br />
haben, aber oft nicht zueinander kompatibel<br />
sind und nicht miteinander vermischt werden<br />
dürfen. Eine durchgreifende Erneuerung erfuhr<br />
der Lagebezug in NRW in den 70er Jahren<br />
des 20. Jahrhunderts. Das bis dahin zugrunde<br />
liegende Lagefestpunktfeld war fast<br />
ausschließlich durch Winkelmessung entstanden,<br />
seinen Maßstab erhielt das gesamte trigonometrische<br />
Netz in Preußen lediglich durch<br />
einige wenige, über Preußen verteilte Basismessungen.<br />
Ein Maßstabsgefälle im gesamten<br />
Netz sowie Spannungen bei der Stückvermessung<br />
im Liegenschaftskataster im Detail waren<br />
die Folge. Durch die in den 1970er Jahren aufkommende<br />
elektronische Streckenmessung<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 3
konnte man erstmals die Strecken zwischen<br />
Trigonometrischen Punkten (TP) unmittelbar<br />
messen und somit die Mängel des bestehenden<br />
Lagebezugsnetzes aufdecken und nachweisen.<br />
Sehr bald genügte das vorhandene Lagenetz<br />
nicht mehr den Anforderungen und man entschloss<br />
sich zu einer groß angelegten Netzerneuerung,<br />
die hauptsächlich auf dem Verfahren<br />
der Trilateration basierte. In vielen Bundesländern<br />
machte man ähnliche Erfahrungen; man<br />
konnte sich jedoch aus verschiedenen Gründen<br />
nicht zu einem bundesweit einheitlichen Handeln<br />
verständigen. So entstanden unterschiedliche<br />
Realisierungen dieser Netzerneuerung<br />
auf der Ebene einzelner Länder, wie z.B. in<br />
NRW das Netz77, in Rheinland-Pfalz das<br />
Netz80 oder in Niedersachsen das Netz mit der<br />
Bezeichnung Lagestatus 100. Für NRW wurde<br />
durch geeignete Anschlussvermessungen und<br />
-berechnungen ein nahtloser Übergang zu den<br />
Nachbarländern sicher gestellt.<br />
1.2 Höhenbezug<br />
Auch der amtliche Höhenbezug in Nordrhein-<br />
Westfalen geht zurück auf die Königlich<br />
Preußische Landesaufnahme. Nach einer ersten<br />
weitmaschigen Höhenmessung und -auswertung<br />
ohne Berücksichtigung des Erdschwerefeldes<br />
erneuerte man ab 1912 das<br />
Höhenfestpunktfeld unter Verwendung normalorthometrischer<br />
Korrektionen. Die Höhen<br />
werden als Höhen über Normal Null (NN)<br />
bezeichnet, Ausganghöhe war in beiden Fällen<br />
der Haupthöhenpunkt bei Berlin, der vom<br />
Amsterdamer Pegel abgeleitet worden war.<br />
1980 – 1986 haben die (alten) Bundesländer<br />
der Bundesrepublik Deutschland das Haupthöhennetz<br />
nach einheitlichen Kriterien neu<br />
gemessen und anschließend in einer Gesamtausgleichung<br />
ausgewertet (DHHN85). Bevor<br />
die Ergebnisse des neuen Haupthöhennetzes<br />
in den Bundesländern eingeführt waren, kam<br />
es zur Wiedervereinigung mit der DDR. Da<br />
auch dort nur wenige Jahre zuvor eine Erneuerung<br />
des Höhennetzes durchgeführt worden<br />
war, hat man auf Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft<br />
der Vermessungsverwaltungen der<br />
Länder der Bundesrepublik Deutschland<br />
(AdV) Verbindungen zwischen den beiden<br />
Höhennetzen gemessen und eine Gesamtausgleichung<br />
aller Nivellementmessungen durch-<br />
4<br />
geführt. Das Ergebnis ist das heutige amtliche<br />
Höhenbezugssystem, das Deutsche Haupthöhennetz<br />
1992 (DHHN92). Die Gebrauchshöhen<br />
sind als Normalhöhen nach Molodenski<br />
berechnet und werden als Höhen über<br />
Normalhöhennull (NHN) bezeichnet. Bezugsfläche<br />
ist das Quasigeoid, das unter Verwendung<br />
von Parametern des GRS80 berechnet ist<br />
und durch den Nullpunkt des ehemaligen<br />
Amsterdamer Pegels verläuft.<br />
1.3 Schwerebezug<br />
Die Entwicklung der Schweremessungen<br />
hoher Genauigkeiten ist sehr eng mit der Entwicklung<br />
geeigneter, vor allem auch mobiler<br />
Geräte verbunden. In der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
wurde in Deutschland die Schwere im<br />
Rahmen der geophysikalischen Reichsaufnahme<br />
durch Pendelbeobachtungen im Potsdamer<br />
Schweresystem bestimmt. Mit der technischen<br />
Verbesserung der Absolut- und der Relativgravimeter<br />
wurden in der Folge immer wieder<br />
amtliche gravimetrische Beobachtungen in<br />
Netzen durchgeführt, die heute nur noch historische<br />
Bedeutung haben (Günther, 2005). Heutige<br />
Grundlage des Schwereniveaus in<br />
Deutschland ist das Deutsche Schweregrundnetz<br />
1994 (DSGN94). Durch Einrechnung des<br />
Deutschen Hauptschwerenetzes 1982 in dieses<br />
Grundnetz entstand in den alten Bundesländern<br />
das Deutsche Hauptschwerenetz 1996<br />
(DHSN96), während es in den neuen Bundesländern<br />
durch Neumessung entstand (AdV,<br />
1999).<br />
2 Änderungen durch das Satellitenpositionierungssystem<br />
GPS<br />
Infolge der Ende des 20. Jahrhunderts ständig<br />
fortschreitenden Entwicklung des weltweit<br />
zugänglichen Global Positioning Systems<br />
(GPS) und dessen Nutzbarmachung für Positionierungen<br />
und hochgenaue Vermessungsarbeiten<br />
entstanden sehr bald Forderungen nach<br />
einem europaweit einheitlichen Bezugssystem.<br />
Diese Vorschläge wurden durch die zur gleichen<br />
Zeit ständig wachsende europäische Integration<br />
auf politischer Ebene – einschl. der<br />
Wiedervereinigung der deutschen Staaten<br />
1990 – unterstützt. Bereits 1989 fand auf Anregung<br />
europäischer Vermessungsverwaltungen<br />
eine erste, weite Teile Europas umfassende<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
GPS-Beobachtungskampagne zur Realisierung<br />
eines einheitlichen europaweiten Bezugssystems<br />
statt, die sogenannte EUREF-Messung,<br />
die Geburtsstunde des Europäischen<br />
Terrestrischen Referenz Systems 1989<br />
(ETRS89).<br />
Schon 2 Jahre später, im Mai 1991, hat die<br />
AdV die Einführung dieses europaweit favorisierten<br />
Bezugssystems ETRS89 für die Bereiche<br />
Landesvermessung und Liegenschaftskataster<br />
beschlossen. Dieser Beschluss wurde<br />
1995 nach sorgfältiger Prüfung nochmals<br />
bestätigt und gleichzeitig die Universale<br />
Transversale Merkator Abbildung (UTM) als<br />
verebnete Darstellung für groß- und kleinmaßstäbige<br />
Karten festgelegt (AdV, 1995).<br />
Das ETRS89 ist ein geozentrisches Bezugssystem,<br />
das auf dem weltumspannenden Internationalen<br />
Terrestrischen Referenzsystem<br />
(ITRS) basiert. Aufgrund der Plattentektonik<br />
und anderer globaler Einflüsse unterliegen die<br />
Koordinaten der erdfesten ITRS-Stationen<br />
einer ständigen Änderung. Daher wird das<br />
ITRS in etwa zweijährigen Abständen unter<br />
Einsatz von GPS und weiterer hochgenauer<br />
Messverfahren wie Satellite-Laser-Ranging<br />
(SLR) und Very Long Baseline Interferometry<br />
(VLBI) neu beobachtet und ausgewertet. Diese<br />
ständig eintretenden Veränderungen in den<br />
Koordinaten der ITRS-Stationen sind im vermessungstechnischen<br />
Alltag äußerst störend.<br />
Deshalb wurden die in und um Europa gelegenen<br />
Stationen des ITRS mit den zum Jahresbeginn<br />
1989 gültigen Koordinaten festgehalten<br />
und als Grundlage für das ETRS89 festgelegt.<br />
Alle das ETRS89 definierenden Stationen des<br />
ITRS liegen auf der eurasischen Platte, die in<br />
sich als weitgehend stabil angesehen wird. Von<br />
diesen, also als gegenseitig fest anzunehmenden<br />
Stationen ausgehend, wurden durch umfangreiche<br />
Messungen in ganz Europa weitere<br />
Vermessungspunkte mit ETRS89-Koordinaten<br />
bestimmt und bilden den Rahmen für das zeitgemäße,<br />
europaweit einheitliche Bezugssystem<br />
ETRS89.<br />
Das ETRS89 definiert ein dreidimensionales<br />
kartesisches Koordinatensystem mit Ursprung<br />
im Massenschwerpunkt der Erde (Geozentrum).<br />
Die Z-Achse ist die Erdachse, die X-Z-<br />
Ebene steht senkrecht auf der Äquatorebene<br />
und verläuft parallel zur Meridianebene der<br />
Sternwarte von Greenwich, ihre Schnittgrade<br />
mit der Äquatorebene ist die X-Achse; die Y-<br />
Achse ist durch 90°-Drehung der X-Achse<br />
gegen den Uhrzeigersinn definiert. Durch die<br />
Dreidimensionalität des Bezugssystems steht<br />
für geodätische Anwendungen ein auf einfache<br />
Weise nutzbares einheitliches Bezugssystem<br />
für die Lage und die Höhe zur Verfügung.<br />
Als Bezugsfläche für das ETRS89 wird das<br />
geozentrisch gelagerte Erdellipsoid des Geodätischen<br />
Referenzsystems 1980 (GRS80) verwendet.<br />
Die geozentrische Lagerung des Ellipsoids<br />
unterscheidet sich hier von nahezu allen<br />
anderen herkömmlichen Landesvermessungen,<br />
bei denen die Referenzellipsoide jeweils<br />
über konkrete Punkte für begrenzte Bereiche<br />
bestanschließend zur Erdoberfläche gelagert<br />
sind.<br />
Die mit dem Satellitenpositionierungssystem<br />
ermittelten Höhen beziehen sich auf den Erdschwerpunkt<br />
bzw. auf das im Erdschwerpunkt<br />
gelagerte GRS80-Ellipsoid, weshalb sie auch<br />
als ellipsoidische Höhen bezeichnet werden.<br />
Sie sind mit den Gebrauchshöhen der Landesvermessung<br />
und des Liegenschaftskatasters<br />
nicht unmittelbar vergleichbar, sondern sie<br />
müssen durch rechentechnische Umformung<br />
mittels geeigneter Passpunkte oder Parameter<br />
(Undulationen) erst in Gebrauchshöhen umgewandelt<br />
werden (Abb.1).<br />
Abb. 1: Zusammenhang zwischen ellipsoidischen und<br />
Gebrauchshöhen<br />
Das ETRS89 wird durch an der Erdoberfläche<br />
vermarkte Punkte realisiert, wie bisher auch<br />
die anderen Bezugssysteme. Es wird aber auch<br />
durch die GPS-Satelliten transportiert und<br />
übermittelt: Die aus GPS-Messungen abgelei-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 5
teten Koordinatenunterschiede im Bezugssystem<br />
der Satelliten, das World Geodetic System<br />
1984 (WGS84) basieren auf gleichen geodätischen<br />
Grundlagen wie das ETRS89 und sind<br />
mit ihm nahezu identisch. Hierdurch kommt<br />
dem Satellitenpositionierungssystem der deutschen<br />
Landesvermessung SAPOS ® , das auf<br />
dem GPS basiert, in zweifacher Hinsicht große<br />
Bedeutung zu; zum einen ist es ein äußerst<br />
wirtschaftliches Vermessungssystem, zum<br />
anderen dient es der Realisierung des Bezugssystems<br />
ETRS89. Alle mit SAPOS ® bestimmten<br />
Koordinaten sind unmittelbar diesem europaweit<br />
einheitlichen Bezugssystem ETRS89<br />
zugehörig. Man bezeichnete also nicht ohne<br />
Grund bald nach den ersten Einsätzen von GPS<br />
in der Landesvermessung im Jahre 1983 die<br />
GPS-Satelliten auch als aktives Festpunktfeld,<br />
im Gegensatz zum passiven Festpunktfeld der<br />
vermarkten Vermessungspunkte.<br />
3 Strategie der AdV für ein bundesweit<br />
einheitliches Festpunktfeld<br />
Sehr schnell erkannte man in der deutschen<br />
Landesvermessung die enormen Vorteile des<br />
GPS, insbesondere die Realisierung eines einheitlichen<br />
Bezugssystems. Die Auswirkungen<br />
waren jedoch in den einzelnen Bundesländern<br />
sehr unterschiedlich, die einen stellten zugunsten<br />
des Aufbaus von SAPOS ® jegliche Erneuerungs-<br />
und Pflegearbeiten an den traditionellen<br />
Lagenetzen ein, während die anderen<br />
zunächst die weitere Entwicklung des GPS-<br />
Geschehens abwarteten. So entstanden vornehmlich<br />
in den 90er Jahren im Lagefestpunktfeld<br />
und somit in der Grundlage für das<br />
Liegenschaftskataster äußerst heterogene Verhältnisse<br />
in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
W. Lindstrot u.a. haben diese Ziellosigkeit in<br />
einem Bericht über die Anfänge der SAPOS ® -<br />
Permanentstationen in (Lindstrot u.a., 1997)<br />
trefflich formuliert: „Mit dieser Vision wirft<br />
mancher bereits ganze AP-Felder aus dem Fenster<br />
des Katasteramtes und hofft damit .. die<br />
geforderte Kosteneinsparung zu erreichen“.<br />
Zwar hatte die AdV bereits recht früh das<br />
ETRS89 als einheitliches Bezugssystem für<br />
die Bereiche Landesvermessung und Liegenschaftskataster<br />
empfohlen, doch wurde nichts<br />
6<br />
über den Aufbau oder die Gestalt eines zukünftigen<br />
Festpunktfeldes ausgesagt. Der Aufbau<br />
von SAPOS ® war in den 90er Jahren die wichtigste<br />
Aufgabe der Grundlagenvermessung<br />
und band so viel Kapazitäten, dass daneben<br />
kaum weitere Schwerpunkte, wie insbesondere<br />
der Umbau der bisherigen Festpunkfelder,<br />
behandelt werden konnten.<br />
So befasste sich der Arbeitskreis Raumbezug<br />
(damals noch AK Grundlagenvermessung) erst<br />
im Jahre 2001 mit dieser Thematik und richtete<br />
eine Arbeitsgruppe ein, die die Verfahrensweisen<br />
in den traditionellen Netzen überprüfen<br />
und Zielsetzungen für den Aufbau und die<br />
Gestalt zukünftiger Netze erarbeiten sollte.<br />
Der Kernauftrag wurde als Optimierung der<br />
Festpunktfelder beschrieben, wobei man an<br />
„kombinierte Festpunkte mit ETRS- und traditionellen<br />
Lagekoordinaten, Höhen- und<br />
Schwerewerten in gleichmäßiger Dichte“<br />
dachte. Zusätzlich waren Stichworte wie z.B.<br />
Wirtschaftlichkeitsanalysen, zeitgemäße Vermarkung,<br />
Untersuchung rationeller Verfahrensweisen<br />
zur Pflege der Festpunktfelder,<br />
Aufgabe oder Fortbestand hierarchischer Netze<br />
oder Auswirkung neuer Messverfahren in<br />
den Auftrag eingebunden – eine wirklich nicht<br />
einfache Aufgabe! Die verschiedenartigen<br />
Vorstellungen der Bundesländer konnten erst<br />
unter einen Hut gebracht werden als man 2003<br />
im AK Raumbezug eine langfristig angelegte<br />
Gesamtstrategie für die Zukunft aller Festpunkte<br />
erarbeitete. Das Ergebnis stellte man<br />
der AG in einem Eckpunktepapier als Grundlage<br />
für ihre weitere Arbeit zur Verfügung. Im<br />
Herbst 2004 beschloss dann das Plenum der<br />
AdV auf ihrer Sitzung in Wismar die zuvor im<br />
AK Raumbezug kontrovers diskutierte und mit<br />
Kompromissen versehene Strategie für den<br />
einheitlichen Raumbezug des amtlichen<br />
Vermessungswesens in der Bundesrepublik<br />
Deutschland (AdV, 2004).<br />
Danach wird der Raumbezug des amtlichen<br />
Vermessungswesens in Deutschland realisiert<br />
durch ein bundeseinheitliches, homogenes<br />
Festpunktfeld, das aus vier, z.T. unterschiedlichen<br />
Komponenten besteht (Abb. 2):<br />
a) Geodätische Grundnetzpunkte im Bezugssystem<br />
ETRS89<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
) Referenzstationspunkte im Bezugssystem<br />
ETRS89<br />
c) Höhenfestpunkte 1. Ordnung im Bezugssystem<br />
DHHN92<br />
d) Schwerefestpunkte des Schweregrundnetzes<br />
und des Schwerenetzes 1.Ordnung im<br />
Bezugssystem DHSN96<br />
Für die Geodätischen Grundnetzpunkte sind<br />
folgende Spezifikationen festgelegt:<br />
� Punktabstand bis 30 km<br />
� 3D-Vermarkung<br />
� mindestens 2 Punkt-Sicherung<br />
� satellitengeodätisch hochgenau bestimmte<br />
ETRS89-Koordinaten<br />
� Anschluss an das amtliche Höhenfestpunktfeld<br />
mittels Präzisionsnivellement im<br />
System DHHN92<br />
� Periodische Überwachung<br />
� Erhaltungsmaßnahmen und Ersatzpunktbestimmung<br />
bei Zerstörung<br />
� Anschluss an das amtliche Schwerefestpunktfeld<br />
Damit alle Bundesländer diesem einheitlichen<br />
homogenen Raumbezug zustimmen konnten,<br />
wurde als Kompromiss zusätzlich auch zugelassen,<br />
dass der Raumbezug des amtlichen Vermessungswesens<br />
aufgrund von länderspezifischen<br />
Gegebenheiten durch weitere Festpunkte<br />
ergänzt werden kann. Diese Anforderungen,<br />
der Umfang und die Dichte sind nicht bundeseinheitlich<br />
festgelegt; die Ausgestaltung der<br />
länderspezifischen Festpunktfelder obliegt den<br />
Vorgaben der einzelnen Bundesländer und ist<br />
nicht Gegenstand einer bundesweit einheitlichen<br />
Regelung. Besonders in der Übergangs-<br />
Abb. 2: Grundstruktur des bundeseinheitlichen Festpunktfeldes<br />
zeit, bis in allen Bereichen von Landesvermessung<br />
und Liegenschaftskataster das<br />
ETRS89 als einheitliches Bezugssystem eingeführt<br />
ist, wird im Lagebereich dieses Nebeneinander<br />
von neuem und altem Bezugssystem<br />
erforderlich sein. Danach muss jedes Bundesland<br />
für sich entscheiden, welche weiteren Vermessungspunkte<br />
man über das einheitliche<br />
homogene Festpunktfeld hinaus bereitstellen<br />
und pflegen will.<br />
4 Realisierung in Nordrhein-Westfalen<br />
Das Gesetz über die Landesvermessung und<br />
das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW)<br />
vom 1. März 2005 legt in § 1 fest, dass das amtliche<br />
Vermessungswesen den einheitlichen<br />
geodätischen Raumbezug einrichtet. Es erhebt<br />
hierzu Festpunktdaten und unterhält einen<br />
Positionierungsdienst. Der Gesetzgeber weist<br />
dem einheitlichen geodätischen Raumbezug<br />
hohe Bedeutung zu, denn er ist in Verbindung<br />
mit den Geobasisdaten als Grundlage für alle<br />
raum- und bodenbezogenen Informationssysteme,<br />
Planungen und Maßnahmen der Landesverwaltung<br />
und der Kommunen zu verwenden.<br />
Andere öffentliche und private Stellen sollen<br />
die Daten verwenden.<br />
In der Durchführungsverordnung zum Verm-<br />
KatG NRW, die bislang nur als Entwurf vorliegt,<br />
wird der geodätische Raumbezug weiter<br />
präzisiert: Er wird realisiert durch den Satellitenpositionierungsdienst,<br />
das Raumbezugspunktfeld<br />
der Landesvermessung und die Vermessungspunktfelder<br />
des Liegenschaftskatasters.<br />
Das Raumbezugspunktfeld umfasst<br />
alle geodätischen Grundnetzpunkte, Lagefestpunkte,<br />
Höhenfestpunkte, Schwerefestpunkte<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 7
und Referenzstationspunkte, die im Geobasisinformationssystem<br />
für den Bereich der<br />
Landesvermessung geführt werden. Mit dieser<br />
Formulierung wird einerseits die neue Philosophie<br />
und Terminologie der AdV berücksichtigt<br />
und andererseits das Koordinatenkataster<br />
im Liegenschaftskataster festgeschrieben.<br />
Dadurch wird das einheitliche Bezugssystem<br />
neben SAPOS ® durch jeden in diesem Bezugssystem<br />
koordinatenmäßig festgelegten Punkt<br />
realisiert. Folglich kann zukünftig, wenn diese<br />
Vorgabe konsequent eingeführt und realisiert<br />
ist, auf die große Menge der bislang bestimmten<br />
und gepflegten Lagefestpunkte und Anschlusspunkte,<br />
wie z.B. TP und AP, zu einem<br />
großen Teil verzichtet werden.<br />
Wie sehen nun die Pläne für eine Realisierung<br />
in Nordrhein-Westfalen konkret aus?<br />
4.1 Geodätische Grundnetzpunkte<br />
Das LVermA NRW hat nach der Verdichtung<br />
des EUREF-Netzes durch das DREF91 bereits<br />
1993 eine weitere Verdichtungsstufe für Nordrhein-Westfalen<br />
geschaffen, das NWREF-<br />
Netz. 114 gleichmäßig über das Land verteilte<br />
Punkte wurden in einer zusammenhängenden<br />
Messkampagne mit GPS eingemessen und<br />
ausgewertet. Alle Punkte sind nach einheitlichen<br />
Kriterien durch Platte mit Kugelbolzen<br />
vermarkt, sodass auch eine exakte Höhenbestimmung<br />
möglich ist (Geef u.a., 1999). Da für<br />
alle Punkte mindestens Koordinaten im Netz77<br />
und im ETRS89 vorliegen, konnten sie seit<br />
ihrer Realisierung als Anschluss für weitere<br />
GPS-Messungen sowie als Stützpunkte für<br />
Transformationen zwischen den beiden Systemen<br />
dienen. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt<br />
für Kartographie und Geodäsie (BKG)<br />
hat das LVermA 1999 73 ausgewählte Punkte<br />
dieses NWREF-Netzes erneut mit GPS eingemessen<br />
und im Rahmen der AdV-Quasigeoidbestimmung<br />
durch das BKG auswerten lassen.<br />
Die bestehenden Koordinaten wurden durch<br />
diese Neubestimmung im Zentimeterbereich<br />
bestätigt, was als Bestätigung für die Zuverlässigkeit<br />
der gesamten NWREF-Bestimmung<br />
angesehen wurde.<br />
In Nordrhein-Westfalen werden die 4 EU-<br />
REF-, 5 DREF- und 114 NWREF-Punkte<br />
zusammen mit den 27 SAPOS ® -Referenzsta-<br />
8<br />
tionen das Netz der Geodätischen Grundnetzpunkte<br />
bilden. Durch die Hinzunahme der<br />
Referenzstationen zu den Grundnetzpunkten<br />
weicht man zwar von den Vorgaben der AdV<br />
ab, aber man sieht durch den Zusammenhang<br />
dieser beiden Punktgruppen und deren Wechselwirkung<br />
zueinander einen besonders festen<br />
Rahmen für die Realisierung des ETRS89.<br />
Die Koordinatenbestimmung aller SAPOS ® -<br />
Referenzstationen, die kontinuierlich von 1995<br />
bis 2002 eingerichtet wurden, erfolgte aus dem<br />
stabilen NWREF-Netz heraus. Die übrigen<br />
Bundesländer bestimmten auf ähnliche Art und<br />
Weise die Koordinaten ihrer Referenzstationen,<br />
nur selten wurden dabei Verbindungen<br />
über die Landesgrenzen hinweg berücksichtigt.<br />
Bei der Einführung des Verfahrens der<br />
vernetzten SAPOS ® -Referenzstationen wurden<br />
für die SAPOS ® -Korrekturdatenbestimmung<br />
auch die Verbindungen zu den Stationen<br />
in den benachbarten Bundesländern geschaffen.<br />
Es zeigte sich sehr schnell, dass die innere<br />
Genauigkeit des SAPOS ® -Netzes nun nicht<br />
mehr ausreichte; verlangten doch die zur Berechnung<br />
einer Echtzeitvernetzung eingesetzten<br />
Programme Zentimetergenauigkeit für die<br />
Referenzstationskoordinaten untereinander.<br />
Diese Genauigkeit war bei den Koordinaten<br />
der SAPOS ® -Stationen insbesondere über die<br />
Ländergrenzen hinweg nicht überall gewährleistet.<br />
Auch SAPOS ® -Nutzer, die länderübergreifend<br />
tätig sind, verlangten bundesweit<br />
hochgenaue und homogene Koordinatensätze<br />
für alle SAPOS ® -Referenzstationen. Die AdV<br />
hat deshalb auf ihrer Sondertagung am<br />
20.09.2002 in Hannover beschlossen, zur Diagnose<br />
der SAPOS ® -Netze die Daten aller Stationen<br />
einer Woche (GPS Woche 1188, 42.<br />
Kalenderwoche 2002) gemeinsam auszugleichen.<br />
Das Plenum der AdV legte weiterhin fest,<br />
die Neuausgleichung im DREF91 zu lagern,<br />
um eine möglichst geringe Abweichung gegenüber<br />
der Menge der bereits vor diesem<br />
Zeitpunkt im ETRS89 sowohl vom vermarkten<br />
Punktfeld als auch von SAPOS ® -Referenzstationen<br />
abgeleiteten Koordinaten zu erhalten.<br />
Diesem Vorteil steht der Nachteil gegenüber,<br />
dass mögliche Spannungen zu den Nachbarstaaten<br />
Deutschlands in Kauf genommen werden,<br />
die ihre Stationskoordinaten zumeist an<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Abb. 3: Grundstruktur des einheitlichen Festpunktfeldes in Nordrhein-Westfalen<br />
die jeweiligen neuesten Lösungen des ITRF<br />
anpassen.<br />
Die Diagnoseausgleichung wurde vom Bundesamt<br />
für Kartographie und Geodäsie (BKG)<br />
ausgeführt und das Ergebnis von der AdV festgestellt,<br />
die die Einführung auf allen SAPOS ® -<br />
Referenzstationen mit Nachdruck empfohlen<br />
hat. Man erzielte durch diese Neubestimmung<br />
für die SAPOS ® -Referenzstationen in ganz<br />
Deutschland einen homogenen Koordinatensatz<br />
mit einer inneren Genauigkeit von etwa<br />
einem Zentimeter im ETRS89 (Beckers u.a.,<br />
2005).<br />
Nordrhein-Westfalen hat die neuen Koordinaten,<br />
die in der Lage maximal 2 cm, in der Höhe<br />
jedoch bis 5 cm von den alten Werten abweichen,<br />
zum 1. September 2003 eingeführt und<br />
im Anschluss daran sämtliche im ETRS89<br />
bereits vorhandenen Koordinaten der Landesvermessung<br />
und des Liegenschaftskatasters an<br />
diese neue Realisierung (ETRS89/Realisierung<br />
2003) angepasst. Somit stehen die Koordinaten<br />
des NWREF-Netzes in einem sehr<br />
engen Zusammenhang zu den SAPOS ® -Referenzstationen,<br />
was die Integration beider<br />
Punktgruppen zu Geodätischen Grundnetzpunkten<br />
zumindest in NRW rechtfertigt.<br />
Die geodätischen Grundnetzpunkte (Abb. 4)<br />
werden zukünftig den festen Rahmen für die<br />
Realisierung des ETRS89 in Nordrhein-Westfalen<br />
bilden; sie werden in einem dreijährigen<br />
Turnus vom LVermA NRW überwacht und<br />
instand gehalten, während die Masse der übrigen<br />
TP nicht weiter gepflegt wird. Dies gilt insbesondere<br />
für die Zeit ab 2010, wenn alle<br />
Daten des Liegenschaftskatasters in das<br />
ETRS89 überführt sein sollen, wie im<br />
ETRS89/UTM-Einführungserlass des Innenministeriums<br />
NRW vom 9. August 2004<br />
(ETRS89/UTM-Einführungserlass, 2004)<br />
festgeschrieben ist. NRW macht also von der<br />
Kompromissformel, dass auch länderspezifische<br />
Festpunktfelder das Bezugssystem<br />
ETRS89 definieren, für den Lagebereich keinen<br />
Gebrauch.<br />
4.2 Höhenfestpunkte 1. Ordnung<br />
Die Höhenfestpunkte 1. Ordnung wurden in<br />
den neuen Bundesländern zuletzt Mitte der<br />
70er Jahre und in Westdeutschland Anfang der<br />
80er Jahre durch Netzerneuerung neu bestimmt<br />
und gemeinsam als DHHN92 in den<br />
Nachweis der Festpunkte übernommen. Verschiedene<br />
Gründe haben dazu geführt, dass<br />
von <strong>2006</strong> bis 2011 ausgewählte Nivellementlinien<br />
nach fast 30 Jahren erneut gemessen werden.<br />
Unter Berücksichtigung der im Strategiepapier<br />
zu einem einheitlichen Raumbezug in<br />
Deutschland (AdV, 2004) dargelegten Vorgaben<br />
sollen neben dem Präzisionsnivellement<br />
auch epochengleiche GNSS- und Absolutschweremessungen<br />
durchgeführt werden. Ziel<br />
dieses Projektes sind nach (AdV, 2005a):<br />
� Überprüfung des amtlichen Höhenbezugssystems,<br />
� Einbindung des DHHN in ein zukünftiges,<br />
integriertes Raumbezugssystem,<br />
� Modellierung hochgenauer Geoidinformationen,<br />
� Schaffung aktueller Grundlagen für wissenschaftliche<br />
Arbeiten (Rezente Krustenbewegungen).<br />
Mit einer Fertigstellung dieses Projektes, an<br />
dem NRW neben der Messung des eigenen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 9
10<br />
Abb. 4: Geodätische Grundnetzpunkte in Nordrhein-Westfalen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Linienanteils auch als Nivellement-Auswertestelle<br />
erheblich beteiligt sein wird, kann nicht<br />
vor 2013 gerechnet werden.<br />
4.3 Weitere Höhenfestpunkte<br />
Der Netzentwurf für das geplante DHHN-Netz<br />
ist aus wirtschaftlichen Gründen gegenüber<br />
der Messung der 80er Jahre um etwa 40% ausgedünnt.<br />
In einem Land wie NRW, das mit seinen<br />
geotektonisch und bergbaulich beeinflussten<br />
Regionen stets auf aktuelle Höhenangaben<br />
angewiesen ist, müssen auf jeden Fall<br />
auch die nicht zu dem bundesweiten Projekt<br />
gehörenden Niv-Linien des Haupthöhennetzes<br />
gleichzeitig neu gemessen werden, um eine<br />
homogene Ausgangssituation für Folgearbeiten<br />
zu haben. Zu diesen Folgearbeiten zählen<br />
auf jeden Fall, die in regelmäßigen Abständen<br />
in Kooperation mit den Bergbaubetreibern<br />
durchgeführten Leitnivellements, die zur<br />
Überprüfung der Gebrauchshöhen in den<br />
durch Bergbau beeinflussten Gebieten dienen.<br />
Inwieweit auch die Nivellementlinien 2. Ordnung,<br />
die zuletzt ab Mitte der 70er Jahre systematisch<br />
erneuert und in den Rahmen der<br />
1. Ordnung eingerechnet wurden, wiederum<br />
neu gemessen werden, ist noch zu diskutieren.<br />
Dies gilt insbesondere auch für die Folgenetze<br />
der 3. Ordnung. In NRW kann es also durchaus<br />
für den Bereich der Höhenfestpunkte über das<br />
homogene Festpunktfeld hinaus zu einer länderspezifischen<br />
Lösung kommen.<br />
Bei dieser Diskussion ist auch zu berücksichtigen,<br />
dass in NRW ein sogenanntes Undulationsmodell<br />
zur Verfügung steht, das die mit<br />
GPS ermittelten ETRS89-Höhen mittels Quasigeoidundulationen<br />
in die Gebrauchshöhen<br />
im DHHN92 (Höhenstatus 160) transformiert<br />
(Abb.5). Neben der Möglichkeit der Postprocessing-Auswertung<br />
gibt es auch ein Modul<br />
für die Integration in GPS-Empfänger, sodass<br />
bei der GPS-Messung NHN-Gebrauchshöhen<br />
in Echtzeit bestimmt werden können. Diese<br />
Transformation liefert mit dem heute vorliegenden<br />
Modell bereits Genauigkeiten der<br />
Höhen im Zentimeterbereich. Verbesserungen<br />
des Quasigeoidundulationsmodells, wie z.B.<br />
durch die geplanten Maßnahmen zur Erneuerung<br />
des DHHN sowie durch die künftige Nutzung<br />
des europäischen Satellitennavigations-<br />
systems GALILEO lassen noch eine deutliche<br />
Steigerung der Genauigkeiten erwarten. Für<br />
viele technische Anwendungen reichen derart<br />
ermittelte Höhen schon heute aus und eine<br />
Nutzen-Kostenanalyse muss erweisen, ob und<br />
wie wichtig höhere Genauigkeiten der Gebrauchshöhen<br />
tatsächlich sind. Bei dieser Diskussion<br />
müssen auch Sicherheitsgesichtspunkte<br />
des Außendienstes einen sehr hohen<br />
Stellenwert erhalten, denn Nivellementmessungen,<br />
die zumeist auf Straßen stattfinden<br />
müssen, stellen in der heutigen stark motorisierten<br />
Welt eine große Gefahrenquelle für die<br />
Messtrupps, aber auch für die Verkehrsteilnehmer<br />
dar. Die Frage wird also zu beantworten<br />
sein, wofür man absolute Höhen in der derzeit<br />
vorliegenden Genauigkeit tatsächlich braucht<br />
oder ob nicht mit GPS ermittelte Höhen für die<br />
meisten Zwecke ausreichen.<br />
Abb. 5: Ausschnitt aus der Karte der Quasigeoidundulationen<br />
von NRW<br />
4.4 Schwerefestpunkte des Schweregrundnetzes<br />
und des Schwerenetzes 1. Ordnung<br />
Für die Bestimmung hochgenauer Quasigeoide,<br />
die für die Ableitung von Gebrauchshöhen<br />
aus satelliten-geodätischen Messungen erforderlich<br />
sind, kommt den Schwerefestpunkten<br />
heute eine entscheidende Bedeutung zu. Alle<br />
vorhandenen Schwerefestpunkte liegen in dem<br />
im AdV-Beschluss vorgegebenen Schwerebezugssystem<br />
des Deutschen Hauptschwerenetzes<br />
1996 vor. Durch die bei der Erneuerung des<br />
Haupthöhennetzes vorgesehenen Absolutschweremessungen<br />
wird dieser Rahmen noch<br />
deutlich verbessert und dürfte für die in absehbarer<br />
Zeit erkennbaren Nutzungen voll ausreichen.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 11
5 Perspektiven<br />
Der geodätische Raumbezug steht derzeit vor<br />
einem großen Umbruch. Durch die schnelle<br />
Entwicklung der GPS-Technik und der damit<br />
verbundenen Satellitenpositionierungsdienste<br />
werden alte traditionelle Realisierungen der<br />
Bezugssysteme weitgehend überflüssig. Erste<br />
Ansätze und Strategien wurden erarbeitet,<br />
doch das volle Potential dieser neuen Technik<br />
ist sicherlich noch lange nicht ausgeschöpft.<br />
Wenn in wenigen Jahren das europäische<br />
Satellitennavigationssystem GALILEO seine<br />
volle Operabilität aufnimmt, wird mit den dann<br />
weltweit über 60 verfügbaren Satelliten (GPS<br />
und GALILEO) nochmals ein gewaltiger<br />
Schritt zur Ablösung klassischer Vermessungsverfahren<br />
gemacht werden. Die Deutsche<br />
Landesvermessung ist schon heute gut<br />
aufgestellt, um dann auch diese neuen Entwicklungen<br />
wieder für sich nutzbar zu<br />
machen.<br />
Literaturangaben:<br />
AdV: Einführung und Anwendung des European<br />
Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), AdV-<br />
Beschluss, Potsdam 1995<br />
AdV: Berechnung des Deutschen Hauptschwerenetzes<br />
1996 (DHSN96), AdV-Beschluss, Berlin<br />
1999<br />
AdV: Strategie für den einheitlichen Raumbezug<br />
des amtlichen Vermessungswesens in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, AdV-Beschluss, Wismar 2004<br />
AdV: Erneuerung des DHHN – Kostenabschätzung<br />
und Begründung –, Vorlage des AK Raumbezug zur<br />
116. Tagung der AdV, 2005 (nicht veröffentlicht)<br />
AdV: Erneuerung des DHHN, AdV-Beschluss,<br />
Bonn 2005<br />
H. Beckers, K. Behnke, H. Derenbach, U. Faulhaber,<br />
J. Ihde, W. Irsen, J. Lotze, M. Strerath: Diagnoseausgleichung<br />
SAPOS ® -Homogenisierung des<br />
Raumbezugs im System ETRS89 in Deutschland,<br />
ZfV, 130. Jahrgang, 2005, Seiten 203 - 208<br />
D. Geef,W. Lindstrot, B. Ruf, M. Spata: Zur Realisierung<br />
des Systems ETRS89 in Nordrhein-Westfalen<br />
– Die Bestimmung des NWREF-Netzes, <strong>NÖV</strong>,<br />
32. Jahrgang, 1999, Seiten 142 - 155<br />
G. Günther: Schwerenetze in Deutschland und<br />
GCG05, Anhang 1 zu Gravimetrisches Glossar,<br />
Bonn, 2005<br />
12<br />
IM NRW: Einführung des Europäischen Terrestrischen<br />
Referenzsystems 1989 mit Universaler Transversaler<br />
Mercatorabbildung (ETRS89/UTM) als<br />
amtliches Bezugssystem für das Liegenschaftskataster<br />
in NRW (ETRS89/UTM-Einführungserlass),<br />
RdErl. des IM NRW vom 9.8.2004<br />
W. Irsen, M. Spata: ETRS89 – European Terrestrial<br />
Reference System, <strong>NÖV</strong>, 32. Jahrgang, 1999, Seiten<br />
135 - 141<br />
C. H. Jahn: Das Lagebezugssystem heute – Grundlagenvermessung<br />
100 Jahre nach Oskar Schreiber,<br />
Hannover 2005<br />
W. Lindstrot, K. A. Heinz, F. J. Schauerte, H.<br />
Calefice, N. Schlüter, W. Flöck, J. Seidel: Polare<br />
GPS-Punktbestimmung – ein Praxisbericht, ZfV,<br />
122. Jahrgang, 1997, S. 175-185<br />
Wolfgang Irsen<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
Muffendorfer Str. 19-21<br />
53177 Bonn<br />
E-Mail: irsen@lverma.nrw.de<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Mit ALKIS ® in ein neues Zeitalter<br />
Von Stephan Heitmann<br />
1 Kurzinhalt<br />
Geodaten sind sowohl Planungsgrundlage als<br />
auch Wirtschaftsgut. Sie können ihren organisatorischen<br />
und finanziellen Wert aber nur<br />
dann voll entfalten, wenn die Rahmenbedingungen<br />
richtig gesetzt werden. Der Beitrag der<br />
Katasterverwaltung ist das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem<br />
ALKIS ® .<br />
ALKIS ® stellt die Geobasisinformationen des<br />
Liegenschaftskatasters – die Liegenschaftskarte<br />
sowie die Personen- und Bestandsdaten –<br />
Nutzern in Wirtschaft und Verwaltung in einem<br />
bundesweit einheitlichen Datenmodell und<br />
einem bundesweit einheitlichen Austauschformat<br />
zur Verfügung. Die Verwendung internationaler<br />
Normen bei der Definition des Datenmodells<br />
und des Austauschformats sichert eine<br />
größtmögliche Verwendbarkeit der Daten.<br />
Das Amtliche Liegenschaftskataster, steht als<br />
Informationssystem nicht isoliert, sondern ist<br />
in die Konzepte so genannter Geodateninfrastrukturen<br />
eingebettet. Diese sind ihrerseits<br />
Bestandteil der E-Government-Bemühungen<br />
aller staatlichen und kommunalen Stellen und<br />
sollen die Verfügbarkeit von Geoinformationen<br />
nachhaltig verbessern.<br />
2 Die Bedeutung von Geoinformationen<br />
Geoinformationen beschreiben Sachverhalte,<br />
die sich auf einen bestimmten Punkt oder<br />
abgrenzbaren Bereich der Erdoberfläche beziehen.<br />
Oder anders ausgedrückt: Geoinformationen<br />
lassen sich in einer Karte darstellen 1) .<br />
Nach den Erkenntnissen des Markforschungsunternehmens<br />
MICUS 2) haben 80% aller Entscheidungen<br />
einen Raumbezug, sind also mit<br />
Fragen nach dem „Wo“ oder nach dem<br />
„Wohin“ verknüpft. Zielgerichtetes Handeln<br />
ist demnach ohne das Vorhandensein geeigneter<br />
Geoinformationen kaum möglich.<br />
Auch die Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasters<br />
zählen zu den Geoinformationen. Sie<br />
sind jedoch nicht nur für das Liegenschaftskataster<br />
selbst von Bedeutung, sondern eignen<br />
sich darüber hinaus als geometrische Grundlage<br />
zur Darstellung weiterer Fachinformationen<br />
(z.B. Leitungsnetze, Bebauungspläne etc.).<br />
Daher werden sie speziell als Geobasisinformationen<br />
bezeichnet.<br />
Angesichts der Bedeutung von Geoinformation<br />
überrascht es nicht, wenn ihre Verfügbarkeit<br />
auch im Rahmen des E-Government eine entscheidende<br />
Rolle spielt. Dabei nimmt sie, oftmals<br />
aufbereitet als Karte, in der Praxis verschiedene<br />
Rollen ein. So dient sie der<br />
Kommunikation der Verwaltung mit dem Bürger,<br />
wenn z.B. Planungsvorhaben der Öffentlichkeit<br />
vorgestellt werden. Ebenso stellt sie<br />
ein Planungswerkzeug dar, indem sie eine Örtlichkeit,<br />
ein geplantes Vorhaben, rechtliche<br />
Gegebenheiten u.ä. anschaulich visualisiert<br />
und Wechselwirkungen erkennen lässt. Darüber<br />
hinaus ist sie ein Wirtschaftsgut.<br />
Hinter letzterem verbirgt sich das Bild vom<br />
„Rohstoff Geoinformation 3) “. Bieten die Produzenten<br />
von Geoinformationen diese in<br />
geeigneter Form an, so die Vorstellung, wird<br />
dieser Rohstoff von der Privatwirtschaft zu<br />
kundengerechten Produkten (z.B. Dienstleistungen<br />
im Rahmen von Immobilienbewertungen)<br />
weiter veredelt. Mit der wachsenden<br />
Nachfrage beim Endkunden wächst auch der<br />
Bedarf am Rohstoff selbst und damit der<br />
Gebührenumsatz des Datenproduzenten.<br />
Während Geobasisdaten traditionell lediglich<br />
als Bestandteil der Daseinsvorsorge gesehen<br />
wurden, tritt damit die Gewinnung eines volkswirtschaftlichen<br />
Mehrwertes als neuer Aspekt<br />
hinzu.<br />
1) Die beim Land NRW gebräuchliche, detailliertere Definition lautet: Geoinformationen sind Informationen zu Erscheinungen, die direkt<br />
durch räumliche Koordinaten oder indirekt durch Adresse, Postleitzahlbezirk, administrative Einheit o.ä. mit einer auf die Erde bezogenen<br />
Position verbunden sind.<br />
2) http://www.micus.de<br />
3) MICUS<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 13
Geoinformationen können ihren Wert im oben<br />
beschriebenen Sinne nur dann entfalten, wenn<br />
sie ihren Nutzern – Bürgern, Verwaltungen<br />
oder der Privatwirtschaft – in einfacher Weise<br />
zugänglich gemacht werden. Im Rahmen des<br />
E-Government wird daher der Aufbau so<br />
genannter Geodateninfrastrukturen vorangetrieben.<br />
Ansatz der Geodateninfrastruktur ist<br />
es, Anbieter und Nutzer von Geoinformationen<br />
über ein Netzwerk (z.B. Intranet oder Internet)<br />
miteinander zu verknüpfen. Die Katasterverwaltung<br />
übernimmt dabei die Aufgabe, durch<br />
die Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters<br />
weiteren Anwendungen eine<br />
eindeutige Geobasis zur Verfügung zu stellen.<br />
ALKIS ® darf daher nicht allein als Werkzeug<br />
innerhalb der Vermessungsverwaltung betrachtet<br />
werden. Vielmehr ordnet es sich als<br />
Basisinformationssystem in den beschriebenen<br />
Gesamtzusammenhang ein. Der Erfolg<br />
von ALKIS ® muss sich demzufolge daran messen<br />
lassen, welche Vorteile für die Vermessungsverwaltung<br />
selbst, aber insbesondere für<br />
ihre Kunden und für den Aufbau von Geodateninfrastrukturen<br />
erzielt werden.<br />
3 Das Liegenschaftskataster bis zur<br />
ALKIS ® -Einführung<br />
Traditionell besteht das Liegenschaftskataster<br />
aus einem beschreibenden Teil, dem Liegenschaftsbuch,<br />
und einem darstellenden Teil, der<br />
Liegenschaftskarte. Als in den 70er Jahren<br />
Konzepte entwickelt wurden, das Liegenschaftskataster<br />
auf eine digitale Führung<br />
umzustellen, musste diese Trennung aufgrund<br />
der damaligen technischen Möglichkeiten weiterhin<br />
beibehalten werden. Es entstanden zwei<br />
getrennte Datenbanken, zunächst das Automatisierte<br />
Liegenschaftsbuch (ALB) und in einem<br />
zweiten Schritt die Automatisierte Liegenschaftskarte<br />
(ALK), samt der dazugehörigen<br />
Austauschformate für die Datenabgabe.<br />
Die Einführung des ALB und später der ALK<br />
war seinerzeit richtungsweisend und hat eine<br />
durchgreifende Technisierung der Arbeitsabläufe<br />
in der Vermessungsverwaltung bewirkt.<br />
Gleichwohl wurzeln die technischen Strukturen<br />
des Liegenschaftskatasters bis heute im<br />
informationstechnischen Kenntnisstand der<br />
14<br />
70er Jahre. Um das Liegenschaftskataster<br />
grundlegend zu modernisieren und die neuen<br />
Möglichkeiten der Informationstechnik zu nutzen,<br />
wurde daher Mitte der 90er Jahre durch<br />
die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik<br />
Deutschland (AdV) der Beschluss gefasst,<br />
ALB und ALK durch ein gemeinsames System,<br />
ALKIS ® zu ersetzen.<br />
Dabei wird bei der Umsetzung ein neuer Weg<br />
beschritten. Während ALB und ALK noch<br />
weitgehend von verschiedenen kooperierenden<br />
Landesverwaltungen selbst programmiert worden<br />
sind, hat sich die Verwaltung bei der Konzeption<br />
von ALKIS ® rein auf die fachlichen<br />
Vorgaben beschränkt. Die Entwicklung der<br />
entsprechenden Software wird hingegen bewusst<br />
der Privatwirtschaft überlassen.<br />
4 Vorteile der ALKIS ® -Einführung für<br />
die Kunden von Geobasisinformationen<br />
4.1 Einheitlichkeit durch fest definierte<br />
Produkte<br />
Kunden von Geobasisinformation sind oftmals<br />
überregional tätig. Dementsprechend beziehen<br />
sie Daten des Liegenschaftskatasters häufig<br />
nicht nur aus einem Katasteramtsbezirk, sondern<br />
für das ganze Landes- oder Bundesgebiet.<br />
Diese Kunden fordern daher völlig zu<br />
recht, dass Verwaltungsgrenzen keine Datengrenzen<br />
darstellen. Die Daten der örtlichen<br />
Katasterbehörden müssen vielmehr nach einheitlichen<br />
Regeln bereitgehalten werden:<br />
Datensätze müssen über Amtsbezirksgrenzen<br />
hinweg gleiche Inhalte aufweisen; Datenformate<br />
müssen identisch sein.<br />
In der Praxis hat sich seit der Einführung von<br />
ALB und ALK jedoch gezeigt, dass diese Zielvorstellung<br />
bis heute nur teilweise erreicht<br />
werden konnte. Interpretationsspielräume in<br />
den entsprechenden Dokumentationen haben<br />
dazu geführt, dass sich die Daten des Liegenschaftskatasters<br />
von Amt zu Amt unterscheiden<br />
können. Kunden mit Bedarf nach Verwaltungsgrenzen<br />
überschreitenden Daten sind<br />
daher gegebenenfalls gezwungen, diese mit<br />
eigenem Aufwand nachzubearbeiten.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Um diesem Problem zu begegnen, wird es<br />
unter ALKIS ® künftig auf Bundes- und auf<br />
Landesebene fest definierte Produkte geben,<br />
die bei allen katasterführenden Stellen für<br />
ihren Amtsbezirk verfügbar sein müssen.<br />
Einem Kunden wird sich dann erstmalig die<br />
Möglichkeit bieten, für das gesamte Bundesgebiet<br />
einheitliche Datensätze bzw. daraus<br />
abgeleitete, einheitliche Produkte zu beziehen,<br />
deren Informationsgehalt anhand des so genannten<br />
AdV-Grunddatenbestandes in Strenge<br />
festgelegt ist. Nordrhein-Westfalen hat zudem<br />
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für<br />
sein Landesgebiet zusätzlich einen NRW-<br />
Grunddatenbestand festzuschreiben, der einen<br />
im Vergleich erweiterten Inhalt aufweist.<br />
Neben den bundesweit verfügbaren Produkten<br />
werden damit für das Landesgebiet Nordrhein-<br />
Westfalens auch standardisierte NRW-Produkte<br />
erhältlich sein. Darüber hinaus ist es den<br />
Katasterbehörden in NRW freigestellt, weitere<br />
Daten entsprechend den Bedürfnissen vor Ort<br />
zu erheben und anzubieten.<br />
Selbstverständlich bietet ALKIS ® immer auch<br />
die Möglichkeit, Datenlieferungen nach Nutzervorgaben<br />
individuell zu konfigurieren. Der<br />
Kunde kann Inhalt und räumliche Ausdehnung<br />
frei bestimmen und hat dabei die Möglichkeit,<br />
neben aktuellen auch historische Daten zu<br />
erwerben. Im Zuge der Einführung von<br />
ALKIS ® wird der Begriff des Amtlichen Liegenschaftskatasters<br />
daher endgültig zu einer<br />
verlässlichen Produktbezeichnung ohne dabei<br />
den Katasterbehörden vor Ort die notwendige<br />
Flexibilität zu nehmen.<br />
4.2 Offene Standards der Vermessungsverwaltung<br />
Die Führung des Liegenschaftskatasters ist<br />
kein Selbstzweck. Vielmehr soll es als Geobasisinformationssystem<br />
anderen als Grundlage<br />
eigener Anwendungen zur Verfügung stehen.<br />
Es ist daher konsequent, die zugrunde liegenden<br />
Standards der Vermessungsverwaltung<br />
offenzulegen. Dementsprechend steht die<br />
Dokumentation von ALKIS ® , d.h. insbesondere<br />
der Objektartenkatalog, der beschreibt, wie<br />
die reale Welt digital im Liegenschaftskataster<br />
abgebildet wird, im Internet allen Interessierten<br />
kostenfrei zum Download zur Verfügung 4) .<br />
Darüber hinaus existiert ein ebenfalls im Internet<br />
bereitstehender Leitfaden zur Modellierung<br />
von Fachinformationen nach den Regeln,<br />
die auch ALKIS ® zu Grunde liegen 5) . Anwendern,<br />
die das Liegenschaftskataster als geometrische<br />
Grundlage für die eigenen Fachinformationen<br />
verwenden wollen, wird auf diese<br />
Art und Weise ein Informationspool zur Verfügung<br />
gestellt, der als Grundlage weiterer<br />
Arbeiten dienen kann.<br />
4.3 International anerkannte Normen<br />
Die Verfügbarkeit von Geoinformationen ist<br />
weltweit als notwendige Voraussetzung für<br />
geplantes Handeln von Staat und Wirtschaft<br />
anerkannt. Dementsprechend vielfältig sind<br />
die entwickelten Lösungen um Geoinformationen<br />
bereitzustellen. Um die erforderliche<br />
Harmonisierung bemühen sich die International<br />
Organization of Standardization (ISO) und<br />
das Open Geospatial Consortium (OGC). In<br />
Absprache miteinander entwickeln und veröffentlichen<br />
diese beiden Institutionen Regelwerke<br />
(vergleichbar den DIN-Normen in<br />
Deutschland), die als Grundlage zur Datenmodellierung<br />
und zur Entwicklung von Schnittstellen<br />
herangezogen werden können.<br />
Bei der Konzeption von ALKIS ® wurden diese<br />
Normen zu Grunde gelegt. Für den Kunden<br />
von Geoinformationen bedeutet dies eine auch<br />
über nationale Grenzen hinweg vergleichsweise<br />
einfache Nutzung der Daten, für den Hersteller<br />
von Software größtmögliche Verwendbarkeit<br />
einmal entwickelter Module.<br />
Auch beim Datenformat zur Abgabe von<br />
ALKIS ® -Daten wird auf Eigenentwicklungen<br />
verzichtet und auf Standardtechniken zurückgegriffen.<br />
Als Format wird künftig die Normbasierte<br />
Austauschschnittstelle (NAS) angeboten.<br />
Diese basiert auf Regeln der so genannten<br />
Extensible Markup Language (XML), einem<br />
Werkzeug, das im Bereich des Internets weite<br />
Verbreitung gefunden hat. In Kombination mit<br />
dem genormten Objektmodell sind ALKIS ® /<br />
4) http://www.adv-online.de<br />
5) Modellierung von Fachinformationen unter Verwendung der GeoInfoDok – Leitfaden; http://www.adv-online.de<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 15
NAS-Daten trotz ihrer Komplexität für Nutzer<br />
daher relativ einfach zu interpretieren.<br />
5 Vorteile der ALKIS ® -Einführung für<br />
die Arbeitsabläufe in der Katasterverwaltung<br />
Die Aufspaltung des Liegenschaftskatasters in<br />
die zwei Datenbanken ALB und ALK hat dazu<br />
geführt, dass eine Vielzahl von Informationen<br />
im Liegenschaftskataster doppelt enthalten ist.<br />
Hieraus resultiert bei jeder Fortführung ein<br />
Mehraufwand, der bei der gemeinsamen<br />
Datenhaltung in ALKIS ® nicht auftreten wird.<br />
Zudem besteht im Falle mehrfach vorhandener<br />
Daten immer die Gefahr, dass sich eigentlich<br />
identische Informationen z.B. durch Fehlbedienung<br />
der entsprechenden Softwaresysteme<br />
auseinanderentwickeln. Die Katasterämter<br />
müssen daher z.Z. im Rahmen ihres Qualitätsmanagements<br />
geeignete organisatorische<br />
und technische Gegenmaßnahmen treffen.<br />
ALKIS ® führt die beiden Informationsquellen<br />
Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte<br />
erstmalig zusammen. Die Nachteile der bisherigen<br />
Doppelführung entfallen.<br />
6 Vorteile der ALKIS ® -Einführung für<br />
den Aufbau von Geodateninfrastrukturen<br />
Auf allen Ebenen des Verwaltungshandelns<br />
(Europäische Union 6) , Bund 7) , NRW 8) , Kommunen<br />
9) ) werden gegenwärtig Geodateninfrastrukturen<br />
aufgebaut. Dabei ist die individuelle<br />
Zielrichtung dieser Initiativen durchaus<br />
unterschiedlich. Teilweise liegt der Schwerpunkt<br />
auf der Optimierung von Verwaltungsprozessen,<br />
teilweise wird der marktwirtschaftliche<br />
Aspekt betont. Verbindendes Element<br />
und damit Garant für gegenseitige Integrationsfähigkeit<br />
ist jedoch die Forderung nach<br />
Bereitstellung von Geoinformationen in standardisierten<br />
Formaten und Schnittstellen. Das<br />
Liegenschaftskataster als Informationssystem<br />
muss sich in diesen Kontext einfügen. Durch<br />
den Rückgriff auf übergeordnete, allgemein<br />
anerkannte Normen (s.o.) ist dies unter<br />
ALKIS ® sichergestellt.<br />
16<br />
Wer eine Ware anbietet, muss auch die entscheidenden<br />
Eigenschaften seines Produktes<br />
benennen können. Nur so ist es einem Kunden<br />
möglich, die Eignung des betreffenden Angebots<br />
für seine Zwecke zu beurteilen. Dieses<br />
Prinzip gilt selbstverständlich auch für die<br />
Anbieter von Geodaten. Fragen z.B. zu Aktualität,<br />
räumlicher Überdeckung und Genauigkeit<br />
müssen beantwortet werden können.<br />
Befindet sich der Nutzer innerhalb derselben<br />
Verwaltung, so mag eine mündliche Beratung<br />
noch ausreichen. Unter dem Gesichtspunkt der<br />
Geodateninfrastruktur genügt dies nicht mehr.<br />
Zwingende Voraussetzung für ihr Funktionieren<br />
ist das Vorhandensein von Daten über<br />
Daten, den so genannten Metadaten.<br />
Wesentliches Kennzeichen der Geodateninfrastruktur<br />
ist die Verfügbarkeit von Geoinformationen<br />
in einem – im Falle des Internets letztlich<br />
weltweiten – Netzwerk. Die Informationsrecherche<br />
im Internet wird von zentralen Einstiegsseiten<br />
geprägt. Es liegt daher nahe, für<br />
Geodaten vergleichbare Mechanismen aufzubauen.<br />
Genau wie die Geodaten selbst müssen<br />
die Metadaten für eine größtmögliche Verständlichkeit<br />
in bestimmten, fest definierten<br />
Strukturen vorliegen. Daher existieren von den<br />
bereits genannten Gremien ISO und OGC auch<br />
normierende Regeln für Metadaten. Die Einführung<br />
von ALKIS ® umfasst folgerichtig<br />
auch die Beschreibung der Geobasisdaten mit<br />
Metadaten, denen diese internationale Standards<br />
zugrundegelegt werden.<br />
7 Fazit<br />
ALKIS ® erfüllt die zentralen Anforderungen<br />
der Kunden der Vermessungsverwaltung: Erstmalig<br />
werden bundes- bzw. landesweit einheitliche<br />
Produkte des Liegenschaftskatasters verfügbar<br />
sein. Durch die Verwendung international<br />
anerkannter Normen wird zudem<br />
der Gefahr einer vermessungstechnischen<br />
Insellösung vorgebeugt. Damit genügt<br />
ALKIS ® auch den Anforderungen, die in jüngster<br />
Zeit durch die Konzepte zum Aufbau von<br />
Geodateninfrastrukturen an das Liegenschaftskataster<br />
formuliert worden sind.<br />
6) http://inspire.jrc.it<br />
7) http://www.imagi.de; www.gdi-de.de<br />
8) http://www.gdi-nrw.org<br />
9) http://www.lverma.nrw.de/produkte/liegenschaftsinformation/katasterinfo/alkis/ALKIS_Geobasis_NRW.htm<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
ALKIS ® ist daher mehr als ein neues technisches<br />
System, das die alten Werkzeuge ALB<br />
und ALK ablösen wird. Mit der Einführung<br />
von ALB und ALK wurde der Übergang vom<br />
analog zum digital geführten Liegenschaftskataster<br />
eingeleitet. Auch ALKIS ® steht nunmehr<br />
für einen Evolutionssprung in der Vermessungsverwaltung.<br />
So wie seinerzeit der Wechsel<br />
in das Computerzeitalter vollzogen wurde,<br />
1 Ausgangssituation<br />
Mit den neuen Präsentationsvorschriften in<br />
NRW werden die altgedienten Richtlinien zur<br />
Darstellung von Signaturen und Beschriftungen<br />
in der Liegenschaftskarte und der Deutschen<br />
Grundkarte 1: 5000 abgelöst. Die Zeichenvorschrift<br />
NW, die ZV-Aut NRW und das<br />
Musterblatt DGK 5 haben über Jahrzehnte hin<br />
das Erscheinungsbild nordrhein-westfälischer<br />
Karten geprägt.<br />
Die ZV-Aut NRW legt die uns bekannten vier<br />
Standardausgaben der Liegenschaftskarte fest:<br />
a) Liegenschaftskarte/Flurkarte,<br />
b) Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte,<br />
c) Liegenschaftskarte/Schätzungskarte,<br />
d) Deutsche Grundkarte.<br />
Das neue VermKatG NRW definiert die Deutsche<br />
Grundkarte – im neuen Sprachgebrauch<br />
als Amtliche Basiskarte (ABK) bezeichnet –<br />
als ein Bestandteil des Liegenschaftskatasters.<br />
Die Standardausgaben ABK und Liegenschaftskarte/Flurkarte<br />
ergeben sich aus ein und<br />
demselben Datenbestand. Mit dem Programm<br />
MAP (Maßstabsabhängige Präsentation) lassen<br />
sich hieraus Kartendarstellungen im mittleren<br />
und großmaßstäbigen Bereich ableiten.<br />
repräsentiert ALKIS ® heute den notwendigen<br />
Eintritt des Amtlichen Vermessungswesens in<br />
die vernetzte Kommunikationsgesellschaft.<br />
Stephan Heitmann<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
Muffendorfer Str. 19-21<br />
53177 Bonn<br />
E-Mail: heitmann@lverma.nrw.de<br />
Die Präsentation von ALKIS ® -Standardausgaben in Nordrhein-Westfalen<br />
– ein Werkstattbericht –<br />
Von Klaus Heyer<br />
Soweit die Digitale Grundkarte bzw. ABK<br />
bereits hergestellt wurde, werden auch farbige<br />
Präsentationen ausgegeben.<br />
In NRW wurde bisher z.B. für die Standardausgabe<br />
Liegenschaftskarte/Flurkarte ein<br />
Minimal- und ein Maximalinhalt (ZV-AUT<br />
NRW) festgelegt. Innerhalb dieser Grenzen<br />
liegt die Entscheidung zur Erfassung und Präsentation<br />
von Objekten in der Kompetenz der<br />
jeweiligen Katasterbehörde. D.h. trotz vereinbarter<br />
Standardausgaben bzw. -auszüge konnte<br />
die Liegenschaftskarte nach außen hin unterschiedlich<br />
erscheinen. Mit dem DGK-Erlass<br />
werden übergangsweise bis zur Festlegung<br />
neuer Präsentationsvorschriften kartographische<br />
Darstellungen akzeptiert, die sich an<br />
denen des Musterblattes orientieren. Durch die<br />
verschiedenen, z.T. unterschiedlichen Vorgaben<br />
hat sich, insbesondere durch den Einsatz<br />
des Programms MAP, die kartographische<br />
Darstellung der digitalen Grundkarte im Vergleich<br />
zum Musterblatt gleichwohl verändert.<br />
2 Präsentationsvorschriften der AdV<br />
und im Land NRW<br />
2.1 Präsentationsvorschriften der AdV<br />
Mit der Einführung von ALKIS ® ändert sich<br />
nicht nur die Datenmodellierung im Liegen-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 17
schaftskataster. Die AdV hat im Rahmen der<br />
GeoInfoDok 1) im Kapitel 7.3 den Signaturenkatalog<br />
ALKIS ® (AdV-SK) mit Teilbereichen<br />
zur Signaturenbibliothek (Teil B) und zu Präsentationsvorschriften<br />
(Teil C) veröffentlicht.<br />
Der AdV-SK enthält die Vorgaben für die Präsentation<br />
von ALKIS ® -Bestandsdaten (Präsentationsausgaben).<br />
Ziel des AdV-SK ist eine<br />
bundeseinheitliche Kartendarstellung für die<br />
bundeseinheitlich definierten Standardprodukte<br />
(Liegenschaftskarte mit bzw. ohne<br />
Bodenschätzung) jeweils in einer Farb- und<br />
Schwarzweißausgabe.<br />
Der AdV-SK liegt derzeit in der Version 4.0<br />
vor; die Veröffentlichung der Version 5.0 bzw.<br />
5.1 steht in diesem Frühjahr an. Mit den bisherigen<br />
verschiedenen Versionen waren z.T. gravierende<br />
Änderungen bezüglich der Präsentation<br />
verbunden.<br />
Anders als bisher in der ALK NRW legt das<br />
ALKIS ® -Konzept Standardausgaben inhaltlich<br />
exakt fest. Das Erscheinungsbild der Standardauszüge<br />
für die Liegenschaftskarte verändert<br />
sich darüber hinaus z.B. durch die Harmonisierung<br />
mit dem ALKIS ® , aber auch<br />
aufgrund einer zukünftig moderneren, durch<br />
die Internettechnologie mitgeprägten anderen<br />
Sicht auf die Darstellung kartographischer<br />
Inhalte. Ausführungen zur bundeseinheitlichen<br />
Definition und Darstellung der ABK 5 (AdV-<br />
Ausgabe) sind in (Gärtner <strong>2006</strong>) zu finden.<br />
2.2 Präsentationsvorschriften im Land<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Im Rahmen von ALKIS ® besteht die Möglichkeit,<br />
auf der Basis des von der AdV definierten<br />
Grunddatenbestandes eigene länderspezifische<br />
Festlegungen sowohl für den Grunddatenbestand<br />
als auch für die Präsentation zu treffen.<br />
Von dieser Möglichkeit macht NRW<br />
Gebrauch und definiert grundlegend den<br />
Gesamtdatenumfang des Amtlichen Liegenschaftskatasters<br />
NRW. Der einheitliche Grunddatenbestand<br />
NRW für das Liegenschaftskataster<br />
ist eine Teilmenge des Amtlichen Liegenschaftskatasters<br />
NRW, er umfasst zugleich den<br />
Grunddatenbestand der AdV. Aus diesem<br />
1) Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens<br />
2) Namensvorschläge der Projektgruppe Präsentation<br />
18<br />
Grunddatenbestand NRW werden dann die<br />
inhaltlich fest definierten Standardausgaben<br />
Flurkarte NRW 2) , Schätzungskarte NRW 2) und<br />
Amtliche Basiskarte NRW 2) in einer Farb- und<br />
Schwarzweißdarstellung abgeleitet. Das bedeutet,<br />
dass über den Grunddatenbestand der<br />
AdV hinaus wichtige individuelle Ergänzungen<br />
und Abweichungen vorgenommen werden.<br />
Das bedeutet allerdings auch, dass die<br />
Katasterbehörden dem Nutzerwunsch entsprechend<br />
sowohl die AdV-Ausgaben als auch die<br />
NRW-Ausgaben präsentieren können müssen.<br />
Auf der Basis der Grunddatenbestände AdV<br />
und NRW werden alle Standardausgaben inhaltlich<br />
festgelegt. Die Signaturenkataloge der<br />
AdV sind wiederum grundlegend für die Festlegung<br />
der Präsentationsvorschriften für die<br />
o.a. Standardausgaben in NRW. Dabei wird<br />
grundsätzlich versucht, den Umfang der landesspezifischen<br />
Abweichungen auf ein Mindestmaß<br />
zu beschränken. Die Signaturenkataloge<br />
für NRW werden darüber hinaus aber auch<br />
Präsentationsempfehlungen für alle im<br />
ALKIS ® -Objektartenkatalog NRW nachgewiesenen<br />
darstellungsrelevanten Objekte enthalten,<br />
die über den festen Inhalt der Standardausgaben<br />
hinausgehen.<br />
3 Entwicklung und Stand der<br />
Präsentationsvorschriften in NRW<br />
3.1 Gründung einer landesweiten<br />
Projektgruppe „Präsentation“<br />
Das Innenministerium beauftragte eine Projektgruppe,<br />
bestehend aus Vertretern der kommunalen<br />
Spitzenverbände, des Landesvermessungsamtes<br />
und der <strong>Bezirksregierung</strong>en, mit<br />
der Konzeption landesspezifischer Vorgaben<br />
für die Präsentation nordrhein-westfälischer<br />
Kartenausgaben im mittleren und großmaßstäbigen<br />
Bereich (1: 500 – 1: 5000). Dabei sollte<br />
geprüft werden, inwieweit der AdV-SK zur<br />
Ausgabe der Liegenschaftskarte eine zufrieden<br />
stellende Präsentation einer nordrheinwestfälischen<br />
Liegenschaftskarte und auch<br />
Grundkarte ermöglicht. Die Projektgruppe<br />
„Präsentation“ arbeitet neben den zahlreichen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
übrigen Projektgruppen der übergeordneten<br />
PG ALKIS-Vorschriften bzw. der sich gerade<br />
aus ihr neu gegründeten PG Katastermodernisierung<br />
zu.<br />
Die Arbeiten wurden bereits im Sommer 2003<br />
aufgenommen. Die Präsentationsvorschriften<br />
in ALKIS ® befanden sich zu dieser Zeit in<br />
einem sehr frühen Stadium. Die Installation<br />
der NRW-Projektgruppe zu diesem Zeitpunkt<br />
war sehr sinnvoll, da auf diese Weise frühzeitig<br />
wertvolle Erkenntnisse für die konkrete<br />
Fortentwicklung der AdV-Präsentationsvorschriften<br />
(GeoInfoDok von Version 2 zur Version<br />
5) an die entsprechenden AdV-Gremien<br />
weitergegeben werden konnten. Im Rahmen<br />
der Bearbeitung der Präsentationsthematik<br />
konnten Probleme im Detail erkannt werden,<br />
die ihrerseits auch Auswirkungen auf die Weiterentwicklung<br />
des Migrationskonzeptes NRW<br />
hatten.<br />
3.2 Grundsätze zur Präsentation<br />
Die Präsentation der landesspezifischen Standardausgaben<br />
orientiert sich am AdV-Signaturenkatalog<br />
für die Liegenschaftskarte. Analog<br />
der AdV-Ausgaben erscheinen die Schriften<br />
generell in Schriftart Arial und die Angaben<br />
zur Bodenschätzung in der Schätzungskarte in<br />
der Schriftart Times New Roman. Eigennamen<br />
erscheinen in Fettschrift. Für die Standardausgaben<br />
ist jeweils eine Schwarz-Weiß- und eine<br />
Farbausgabe vorgesehen.<br />
3.2.1 Präsentation der Flurkarte NRW<br />
und der Schätzungskarte NRW<br />
Ziel ist, unter weitgehender Berücksichtigung<br />
des AdV-SK das bisherige Erscheinungsbild<br />
der Liegenschaftskarte möglichst zu erhalten.<br />
Dies gilt insbesondere für die bisherigen freien<br />
Schriftzusätze, die im erforderlichem Maß<br />
das Kartenbild erläutern. Diese freien Texte<br />
– ob Bezeichnung oder Eigenname – werden<br />
als Präsentationsobjekte mit neuer Schrift<br />
(Arial), ggf. in anderer Schriftgröße, aber am<br />
selben Kartenort dargestellt. Mit der Übernahme<br />
der Verortung der Schriften aus der Liegenschaftskarte<br />
wird auch ein bei der Neupräsentation<br />
der Liegenschaftsdaten nach<br />
ALKIS ® -Anforderungen ggf. erforderlicher<br />
Nachbearbeitungsaufwand möglichst gering<br />
gehalten.<br />
Abweichend zum AdV-SK werden in NRW die<br />
Gebäude entsprechend ihrer Erfassungsgenauigkeit<br />
unterschiedlich dargestellt. Im Liegenschaftskataster<br />
NRW werden Gebäude in den<br />
Folien 011 und 084/086 der ALK nachgewiesen.<br />
In den letzten Jahren wurde der Gebäudebestand<br />
in der ALK durch Auswertungen<br />
von Orthophotos und der Deutschen Grundkarte<br />
umfassend ergänzt. Da diese Gebäude<br />
nur in topographischer Genauigkeit erfasst<br />
wurden, ist auch weiterhin eine spezielle Kennzeichnung<br />
im Kartenwerk des Liegenschaftskatasters<br />
erforderlich.<br />
Die Farben bzw. Grautöne, die im Signaturenkatalog<br />
der AdV festgelegt sind, können im<br />
Wesentlichen übernommen werden. Ausnahmen<br />
werden da notwendig, wo das gesamte<br />
Kartenbild erheblich gestört wird. Dazu zählen<br />
die grau präsentierten Flächen der Tatsächlichen<br />
Nutzung „Industrie- und Gewerbefläche“<br />
(Weiß für NRW), die z.T. zu dunklen Grautöne<br />
der Gebäudeflächen und die ebenfalls mit einer<br />
grauen Flächenfüllung dargestellten Standflächen<br />
von Bauwerken.<br />
In der Farbausgabe erfolgt die Schriftausgabe<br />
nicht in verschiedenen Farben (AdV: Gewässername<br />
in Blau, Gewannennamen in Braun,<br />
Waldeigennamen in Grün) sondern generell im<br />
Schwarzton. Auch soll die in Gelb/Ocker dargestellte<br />
Straßenklassifizierung der Bundesautobahnen,<br />
Bundes- und Landesstraßen nicht<br />
übernommen werden, da diese hervorgehobene<br />
Darstellung eher für eine Straßenkarte als<br />
für die amtliche Flurkarte geeignet erscheint.<br />
Während die ZV-Aut NRW bisher für die Darstellung<br />
der Gebäudenutzungen Textausgaben<br />
festlegte, sieht der AdV-SK (Zielmaßstab<br />
1:1000) hierfür überwiegend Signaturen vor.<br />
Soweit die Signaturen gut interpretierbar sind,<br />
sollen sie für NRW übernommen werden. Leider<br />
konnte im AdV-SK keine durchgängige<br />
Struktur für die Ausgabe von Signaturen oder<br />
alternativ Schriften gefunden werden. Dies<br />
liegt natürlich am begrenzten Vorrat an allgemeingültigen,<br />
sprechenden und auch gleichzeitig<br />
in den verschiedenen Maßstäben (1:500<br />
bis 1:2000) ausreichend erkennbaren Signaturen.<br />
Neben den klassischen Signaturen für<br />
Postamt, Krankenhaus oder Kirche kommen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 19
jetzt ganz neue Signaturen für Bücherei, Theater,<br />
Kindergarten, Zoo, Spielplatz etc. hinzu.<br />
Daneben werden Gebäudenutzungen wie Rathaus,<br />
Zoll, Museum, Schule, etc. weiterhin mit<br />
Textausgaben dargestellt.<br />
Tabelle 1: Diskussionsbeispiele Gebäudesignaturen<br />
Bei der Auswahl der Signaturen für den AdV-<br />
SK stand nur die Präsentation der Liegenschaftskarte<br />
im Maßstab 1:1.000 an. Da in<br />
NRW auch die ABK NRW aus dem gleichen<br />
Datenbestand des Liegenschaftskatasters abgeleitet<br />
wird wie die Flurkarte NRW bietet sich<br />
hier zwangsläufig eine „ganzheitliche“ Sicht<br />
an. D.h. bei der Prüfung der Übernahmemöglichkeiten<br />
der AdV-SK-Signaturen spielt die<br />
Erkennbarkeit nach entsprechender Verkleinerung<br />
für den Maßstab der ABK NRW eine<br />
große Rolle. Von daher werden in Einzelfällen<br />
Signaturenentwürfe aus der ABK NRW rückwirkend<br />
für die Flurkarte vorgeschlagen, damit<br />
zwischen den beiden Kartenwerken eine Einheitlichkeit<br />
hergestellt wird.<br />
Im Teil B – Signaturenbibliothek – des AdV-<br />
SK ab Version 4.0 wurden standardmäßige<br />
Textabkürzungen für Präsentationsobjekte mit<br />
spezieller Signaturnummer (SNR) definiert<br />
(z.B. Fhs für Forsthaus, Tabelle 1). Allerdings<br />
existieren hierfür noch keine Präsentationsregeln<br />
im Teil C des AdV-SK. Wird die Präsentation<br />
dieser Abkürzungen künftig realisiert,<br />
20<br />
Bezeichnung ALKIS � SK Flurkarte ABK<br />
Theater Oper<br />
Spielplatz<br />
Kindergarten<br />
Zoo Zoo Zoo<br />
Umformer<br />
Bahnhof Bahnhof<br />
Omnibusbahnhof Busbahnhof Busbahnhof<br />
Bf<br />
Windmühle<br />
Forsthaus Fhs 3<br />
Gewächs- und Treibhaus Gwhs 3<br />
Tankstelle<br />
Bf Bf<br />
3) Diese Abkürzung ist nicht in ALKIS ® zu sehen!!!<br />
Sie ist bislang nur im AdV-SK Teil B „definiert“.<br />
T<br />
so eröffnen sich für die ABK NRW und damit<br />
auch für die Flurkarte NRW nochmals neue<br />
Wege. Alle bisherigen Überlegungen, die stets<br />
einen Kompromiss darstellten, der niemals<br />
allen Grundsätzen gerecht werden konnte,<br />
können wieder neu angestellt werden. In diesem<br />
Fall wäre es möglich für die ABK NRW –<br />
wie auch bisher in der Grundkarte – mehr<br />
Textabkürzungen zu verwenden. Im Vergleich<br />
zu Signaturen, die im Maßstab 1:5000 eine<br />
Flächenausdehnung von ca. 300 m 2 haben, verdecken<br />
Abkürzungen oder eine kurze textliche<br />
Bezeichnung insgesamt weniger Grundrisssituation<br />
und lassen sich besser positionieren.<br />
Die Überlegungen zu diesen Einzelsignaturen<br />
sind noch nicht abgeschlossen, einzelne Vorschläge<br />
wurden und werden auch weiterhin<br />
dem Revisionsausschuss der AdV zugeleitet.<br />
Mit einer gewissen Spannung werden die Festlegungen<br />
des AdV-SK in der Version 5.1 mit<br />
einem sehr weit reichend überarbeiteten SK<br />
erwartet.<br />
Der AdV-SK ermöglicht die Ausgabe von<br />
Flächensignaturen im festgelegten Raster, in<br />
einer zufallsgenerierten Einzelsignaturendarstellung<br />
und in Gruppenanordnung. Den Vorstellungen<br />
der Arbeitsgruppe nach, sollen<br />
Flächensignaturierungen nur für Vegetationsflächen<br />
(AdV: auch z.B. Flächen für Abbauland)<br />
vorgesehen werden. Die Möglichkeiten<br />
der unterschiedlichen Anordnung der Signaturen<br />
werden auch für NRW übernommen.<br />
Jedoch belasten die nach AdV-SK in Schwarz<br />
erscheinenden Signaturen sehr stark das Kartenbild,<br />
„überschwemmen“ praktisch andere<br />
Inhalte (Bild 1). Für NRW sieht die Arbeitsgruppe<br />
entweder die Ausgabe von Flächensignaturen<br />
im Grauton und/oder in deutlich<br />
reduzierter Anzahl von Einzelsignaturen pro<br />
Flächeneinheit vor (Bild 2, 3 und 4).<br />
Im NRW-Entwurf (Bild 3) ist abweichend auch<br />
die Flurstücksnummer zur besseren Erkennbarkeit<br />
freigestellt.<br />
In ALKIS ® ist zukünftig eine Aggregation von<br />
bisher flurstücksbezogenen Nutzungsarten zu<br />
Großobjekten vorgesehen. Dabei entsteht das<br />
Problem, dass die Flächensignaturen, die dann<br />
über die Nutzungsartengrenzen hinausgehen,<br />
durch die in der Darstellungspriorität höher-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Abb. 2: AdV-SK Original 4)<br />
Abb. 1: AdV-SK Original mit Rasteranordnung 4)<br />
Abb. 3: NRW-Entwurf Grau 4)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 21
Abb. 4: NRW-Entwurf mit reduzierten Abständen 4)<br />
rangigen Grenzen durchkreuzt werden. Abhilfe<br />
für derartige „unschöne“ Darstellungen<br />
könnten nur aufwändigere Präsentationsprozesse<br />
liefern.<br />
Die generelle Prüfung der von der Arbeitsgruppe<br />
definierten Signaturen, Schriften, Farben,<br />
etc. für den NRW-SK erfolgt in einem<br />
Musterkartenentwurf, der sich mit veränderten<br />
Einstellung aus MAP erzeugen lässt.<br />
3.2.2 Präsentation der ABK<br />
Nach (Gärtner <strong>2006</strong>) existieren auf Bundesebene<br />
neben grundsätzlichen Ausführungen<br />
keine konkreten Festlegungen für die Präsentation<br />
der ABK 5-AdV. Doch gilt auch hier der<br />
Grundsatz einer möglichst weitgehenden<br />
Anlehnung an den AdV-SK. Die Anlehnung<br />
hat natürliche Grenzen, dort wo z.B. bereits in<br />
der Flurkarte sehr komplizierte und detaillierte<br />
Signaturen vorgesehen sind, die im Maßstabsbereich<br />
der ABK NRW von 1:2500 bis<br />
1:10000 nicht mehr erkennbar sind. Grenzen<br />
werden auch dort erreicht, wo der Projektgruppe<br />
eine Übereinstimmung im Kartenbild<br />
mit der Flurkarte NRW wichtiger erschien, als<br />
eine Übereinstimmung mit der AdV-Ausgabe.<br />
Viele der für die Flurkarte NRW entworfenen<br />
Darstellungen bzw. Abweichungen zum AdV-<br />
SK gelten auch für die Abbildung der ABK<br />
NRW. Dazu gehören die einheitliche Beschrif-<br />
4) Originale AdV-SK-Festlegungen mit MAP nachgeahmt.<br />
22<br />
tung in Schwarz, die Überlegungen zur<br />
Flächensignaturierung im Bereich der Vegetationsflächen<br />
und nicht zuletzt auch die einheitliche<br />
Färbung aller Straßen in Weiß. Dieser<br />
„Weißdecker“, den der AdV-SK nicht vorsieht,<br />
wird hier wie auch in der Flurkarte NRW<br />
benötigt, um unerwünschte Darstellungen von<br />
z.B. Brückenbauwerkslinien im Straßenverlauf<br />
abzudecken. Die Darstellungspriorität liegt<br />
dabei niedriger als die der Flurstücksgrenzen.<br />
Die bisher in der DGK 5 verwendete Schriftdifferenzierung<br />
in Abhängigkeit von statistischen<br />
Daten (Flächengröße von Seen, Länge<br />
von Gewässern, Einwohnerzahlen bei Wohnplatznamen<br />
etc.) werden aufgegeben bzw. stark<br />
eingeschränkt.<br />
So ist vorgesehen, die Schriftgröße z.B. von<br />
Wohnplatznamen unabhängig von der Einwohnerzahl<br />
nur nach der Bedeutung des Wohnplatzes<br />
(kreisfreie Stadt, Stadtteil oder kreisangehörige<br />
Gemeinde, Gemeindeteil) festzulegen.<br />
Hierdurch wird zukünftig Fortführungsaufwand<br />
reduziert, der immer dann<br />
erforderlich würde, wenn sich statistische<br />
Daten ändern.<br />
Der größte Teil der Schriften für die ABK<br />
NRW (Bezugsmaßstab 1:5000) kann automatisch<br />
über einen Umrechnungsfaktor aus der<br />
Schriftvorgabe für die Flurkarte NRW<br />
(Bezugsmaßstab 1:1000) abgeleitet werden.<br />
Soweit damit kein zufrieden stellendes Resultat<br />
zu erreichen ist, soll eine spezielle Schriftgröße<br />
angegeben werden. Für mögliche Ausgabemaßstäbe<br />
von 1:2500 bis 1:10000<br />
empfiehlt die Projektgruppe unterschiedliche<br />
Anpassungsfaktoren, die eine ausreichende<br />
Lesbarkeit in den unterschiedlichen Maßstäben<br />
gewährleisten sollen.<br />
Während in der Farbausgabe der ABK alle<br />
Flächen der TN Farbdecker erhalten, wird die<br />
SW-Ausgabe generell ohne Flächenfarbe<br />
(Grauraster) ausgegeben.<br />
3.3 Inhaltliche und formale Gestaltung der<br />
Standardauszüge in NRW<br />
Alle Standardauszüge umfassen einen fest<br />
definierten Inhalt, der sich aus dem Grunddatenbestand<br />
NRW ergibt. Im Einzelnen sind diese<br />
Inhalte noch detailliert festzulegen. Ein Aus-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
zug aus dem Liegenschaftskataster umfasst<br />
maximal den Datenumfang des in NRW definierten<br />
Amtlichen Liegenschaftskatasters.<br />
Darüber hinaus sind auch weitere Auszüge aus<br />
dem Liegenschaftskataster denkbar z.B. als<br />
„Topographische Stadtkarte“ in einer Art<br />
Nachfolge zur bisherigen Liegenschaftskarte/<br />
Stadtgrundkarte.<br />
Ähnlich wie in der ZV-Aut NRW wird auch die<br />
formale Gestaltung des Standardauszuges<br />
Abb. 5: Ausgabekopf Standardauszug NRW<br />
Abb. 6: Ausgabekopf Standardauszug Schätzungskarte NRW<br />
Abb. 7: Ausgabekopf Standardauszug ABK NRW<br />
5) In der digitalen Version auf der Homepage des LVermA NRW erscheinen die Farbausgaben.<br />
selbst mit Ausgabekopf und Kartenbild vorgegeben.<br />
Der einfach gestaltete Kartenrahmen<br />
mit Gitterkreuzen und Koordinaten unter<br />
Angabe des jeweiligen Bezugssystems in der<br />
linken unteren Blattecke wird sowohl für die<br />
Flurkarte NRW und Schätzungskarte NRW als<br />
auch für die ABK NRW einheitlich in den<br />
Standardformaten DINA4/A3 verwendet.<br />
(Bild 10: Flurkarte NRW, Bild 11: ABK<br />
NRW) 5) . Alle drei Standardauszüge werden<br />
mit einem nahezu identischen Ausgabekopf<br />
versehen.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 23
Die unterlegten Felder (Bild 5) können ausgabespezifisch<br />
belegt werden (Bilder 6 - 9).<br />
Wichtig erschien der Projektgruppe, die postalische<br />
Adresse des in der Auskunft nachgefragten<br />
Flurstücks mit auszugeben. Die<br />
zugehörigen Katasterbezeichnungen des Flurstücks<br />
können bei mehreren beantragten<br />
zusammenhängenden Flurstücken mit der<br />
Angabe „u.a.“ ergänzt werden. Da die Grenzen<br />
eines Bodenordnungsverfahrens, in dem das<br />
beantragte Flurstück liegen könnte, auf dem<br />
Kartenauszug nicht immer erkennbar sind,<br />
werden in der Bemerkungszeile zum Bodenordnungsverfahren<br />
entsprechende Hinweise<br />
(z.B. Umlegung) aufgenommen. An gleicher<br />
Stelle erscheint in der ABK NRW mit Höhenangabe<br />
ggf. der Hinweis auf Bodenbewegungen.<br />
Obwohl die Inhalte der Standardauszüge fest<br />
definiert sein werden, sollte in Ausnahmefäl-<br />
24<br />
Abb. 8: Ausgabekopf Historische Flurkarte NRW<br />
Abb. 9: Ausgabekopf Topographische Stadtkarte NRW<br />
len eine manuelle Ergänzung um z.B. Straßennamen<br />
oder Flurnummern möglich sein.<br />
Alle Standardauszüge enthalten nur noch ein<br />
Ausgabedatum. Die bisher für die Grundkartenblätter<br />
nachgewiesenen detaillierten Angaben<br />
zum Fortführungsstand lassen sich nicht<br />
mehr realisieren. Das Ausgabedatum entspricht<br />
dem an diesem Tag erreichten Stand der<br />
Übername der Daten in das Liegenschaftskataster.<br />
Zusätzlich kann dem Auszug auf Wunsch ein<br />
Beiblatt mit einer Legende beigefügt werden,<br />
die die Interpretation der verwendeten Farben<br />
und Signaturen möglich macht. Diese Erläuterungen<br />
sind z.B. dann sehr hilfreich, wenn in<br />
der Liegenschaftskarte auf die unterschiedlichen<br />
Genauigkeiten von Gebäuden (Folie 011<br />
durchgezogene Darstellung und Folie 086<br />
strichpunktierte Darstellung) hingewiesen<br />
werden soll.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Abb. 10: Entwurf Standardauszug Flurkarte NRW (SW) 5)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 25
26<br />
Abb. 11: Entwurf Standardausgabe ABK NRW (SW) 5)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
4 Fazit und Ausblick<br />
Obwohl bereits viele Grundsätze und Details<br />
der Präsentation unserer nordrhein-westfälischen<br />
Standardauszüge zumindest in der Projektgruppe<br />
feststehen, ist immer noch einiges<br />
im Fluss. Doch dies ist ein augenblicklich ganz<br />
normaler Zustand. Die Präsentation steht in<br />
enger Wechselwirkung mit den Modellierungen<br />
in ALKIS und den Festlegungen des<br />
Migrationskonzeptes NRW.<br />
Was bleibt noch zu tun? Die Arbeiten zur Definition<br />
von Signaturen und Schriften sind kurzfristig<br />
abzuschließen. Für die weiteren Arbeiten<br />
fehlen z.T. noch detailliertere Vorgaben<br />
(Grunddatenbestand NRW, definitiver Inhalt<br />
der Standardauszüge). Der Aufbau der landesspezifischen<br />
Signaturenkataloge für die Flurkarte<br />
NRW/Schätzungskarte NRW sowie für<br />
die ABK NRW beginnt sinnvollerweise mit der<br />
Veröffentlichung der neuen Version der GeoInfoDok<br />
in der Version 5.1.<br />
Literaturangabe:<br />
Gärtner, <strong>NÖV</strong> 1/<strong>2006</strong>, S. 4-14<br />
Klaus Heyer<br />
<strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong>, Dezernat 33<br />
Zeughausstr. 10-12<br />
50606 <strong>Köln</strong><br />
E-Mail: klaus.heyer@bezreg-koeln.nrw.de<br />
Amtliche Hauskoordinaten – ein Angebot der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik Deutschland<br />
Von Martin Knabenschuh und Gerfried Westenberg<br />
1 Der Markt – Ausgangssituation,<br />
Entwicklung und Anforderungen<br />
Der Geodatenmarkt hat sich in der näheren<br />
Vergangenheit in einem rasanten Tempo entwickelt.<br />
Auf den diversen Messen, Fachveranstaltungen<br />
und Kongressen werden immer<br />
mehr Lösungen präsentiert, die einer Vielzahl<br />
von Branchen helfen, effizienter zu arbeiten<br />
und immer bessere Ergebnisse zu erzielen.<br />
Dabei gelingt es zunehmend, den Mehrwert<br />
eines geografischen Bezuges deutlich zu<br />
machen, der bei der Beantwortung komplexer<br />
Fragestellungen Garant für einfache und transparente<br />
Lösungen ist. Dass die zugrunde liegenden<br />
Geodatenbestände dabei eine fundamentale<br />
Bedeutung haben, führt zu einer<br />
spürbar zunehmenden Wertschätzung von<br />
Kundenseite. Auch das Bewusstsein für die<br />
besondere Rolle der amtlichen Geobasisdaten,<br />
als Basismodelle für die Abbildung raumbezogener<br />
Fachinformationen wächst allmählich,<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 27
ebenso wie das Bewusstsein auf Seiten der Vermessungsverwaltung,<br />
maßgeschneiderte Geobasisprodukte<br />
und -dienste bereitzustellen.<br />
Mit der fortschreitenden Entwicklung des<br />
Geodatenmarktes wachsen auch die Anforderungen<br />
an die Geoprodukte und Geodienste.<br />
So können heute durch Integration hausgenauer<br />
Geodaten in die Unternehmensprozesse<br />
neue Wertschöpfungs- und Marktpotenziale<br />
erschlossen werden. Standen bei vielen bundesweit<br />
agierenden Unternehmen in der Vergangenheit<br />
die aus dem Navigationsbereich<br />
bekannten digitalen Straßenkarten im Fokus<br />
des Interesses, erfordern heute zunehmend<br />
feinräumigere Fragestellungen der Kunden<br />
gebäudescharfer Basismodelle. Eine Betrachtung<br />
auf Straßenebene reicht heute in vielen<br />
Fällen nicht mehr aus. Mit der Erschließung<br />
der neuen Dimension gebäudescharfer Betrachtungen<br />
sind auch die Dienstleister gehalten,<br />
ihre Produkte und Dienste entsprechend<br />
anzupassen.<br />
Das amtliche Liegenschaftskataster der Bundesländer<br />
umfasst eine Vielzahl von Informationen<br />
zu Flurstücken und Gebäuden. Es bildet<br />
eine wesentliche Basis für den Grundstückverkehr<br />
in Deutschland und stellt als Solches eine<br />
einzigartige Quelle flurstücksbezogener und<br />
hausgenauer Informationen dar. Die Führung<br />
des Liegenschaftskatasters obliegt den regional<br />
agierenden Katasterbehörden der Länder. Für<br />
großräumig agierende Unternehmen bedeutet<br />
dies, dass bei überregionalem Bedarf Kontakt<br />
zu mehreren Datenanbietern aufgenommen<br />
werden muss, dass gegebenenfalls unterschiedliche<br />
Nutzungsmodelle zugrunde liegen,<br />
und dass die bezogenen Datenbestände<br />
unter Umständen in ein gemeinsames Format<br />
überführt werden müssen, bevor sie für den<br />
vorgesehenen Nutzungszweck eingesetzt werden<br />
können. Um den Zugang zu den Geobasisdaten<br />
des Liegenschaftskatasters zu erleichtern,<br />
haben die meisten Bundesländer Geodatenzentren<br />
zur Verbreitung von Katasterdaten<br />
bei katasteramtsübergreifender Anforderung<br />
installiert. Damit wurde ein wichtiger<br />
Schritt zur Öffnung des Geodatenmarktes<br />
getan.<br />
Der nächste konsequente Schritt hin zu einer<br />
bundesweiten Bündelung der Kompetenzen<br />
28<br />
blieb zunächst aus. Erst der immer konkreter<br />
werdende Bedarf einer zunehmenden Zahl von<br />
Kunden nach bundesweit homogenen Daten<br />
des Liegenschaftskatasters, die zu einheitlichen<br />
Konditionen und zentral bereitgestellt<br />
werden, führte zu einem Umdenken und einer<br />
kompletten Neuausrichtung in der Vermarktung<br />
amtlicher Datenangebote des Liegenschaftskatasters.<br />
2 Die Gemeinschaft – Modell zur<br />
länderübergreifenden Verbreitung<br />
Im Herbst 2003 legten die Bundesländer Bayern,<br />
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-<br />
Westfalen und Rheinland-Pfalz den Grundstein<br />
zur bundesweiten Vermarktung eines aus<br />
dem Basisdatenbestand des Liegenschaftskatasters<br />
generierten Marktproduktes, den amtlichen<br />
Hauskoordinaten. Damit wurde eine<br />
wichtige Voraussetzung zur optimalen Erfüllung<br />
einer der Kernaufgaben der amtlichen<br />
Vermessungsverwaltungen geschaffen: Amtliche<br />
Geobasisdaten konnten nun auch für länderübergreifende<br />
Anwendungen der Nutzung<br />
zugeführt werden, weil Wertschöpfungsprozesse<br />
im Sinne einer bedarfsgerechten Aufbereitung<br />
und Bereitstellung von Folgeprodukten<br />
und Folgediensten fortan leichter möglich<br />
waren.<br />
Zu diesem Zweck unterzeichneten die genannten<br />
Länder eine Verwaltungsvereinbarung,<br />
nach der alle Beitrittsländer länderübegreifend<br />
die „Gemeinschaft zur Verbreitung der Hauskoordinaten<br />
(GVHK)“ bilden. Die GVHK hat<br />
sich dabei an den Kernanforderungen des<br />
Marktes orientiert und deren Erfüllung als<br />
erklärtes Ziel in den Mittelpunkt ihres Wirkens<br />
gestellt.<br />
Dementsprechend waren die folgende Aspekte<br />
unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche<br />
Vermarktung des neuen Angebotes:<br />
� Alle Aktivitäten zur gemeinsamen Verbreitung<br />
des neuen Geobasisproduktes müssen<br />
auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet<br />
sein.<br />
� Das Geobasisprodukt muss ein bundesweit<br />
einheitliches Datenformat aufweisen.<br />
� Der Einräumung von Nutzungsrechten und<br />
der Preisbildung im Zusammenhang mit<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Abb. 1: Entwicklung der „Gemeinschaft zur Verbreitung der amtlichen Hauskoordinaten“<br />
der Bereitstellung des Geobasisproduktes<br />
muss ein einheitliches Lizenzmodell zugrunde<br />
liegen.<br />
� Das Geobasisprodukt muss von einer zentralen<br />
Stelle (zentraler Ansprechpartner für<br />
aktuelle und potenzielle Kunden) aus bereitgestellt<br />
werden.<br />
Bis zum Ende 2004 waren der Gemeinschaft<br />
bereits insgesamt 9 Bundesländer beigetreten.<br />
Zum Ende 2005, also binnen 2 Jahren seit<br />
Gründung, hatten sich dann alle 16 Bundesländer<br />
der GVHK angeschlossen. Damit haben<br />
die Vermessungsverwaltungen der Länder wesentlich<br />
dazu beigetragen, das für eine erfolgreiche<br />
Vermarktung der amtlichen Hauskoordinaten<br />
zwingend erforderliche bundesweit<br />
einheitliche Geobasisdatenangebot zu realisieren.<br />
3 Der Auftrag – Rolle einer zentralen<br />
Stelle<br />
Mit der Vermarktung der amtlichen Hauskoordinaten<br />
für die Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder wurde das Landesvermessungsamt<br />
Nordrhein-Westfalen (LVermA NRW) betraut.<br />
Es bündelt somit die Kompetenzen der<br />
GVHK-Mitglieder, fungiert als Ansprechpartner<br />
für die Kunden und wird bei länderübergreifenden<br />
Kundenaufträgen als Vertreter der<br />
Länder tätig. Im Rahmen dieser Aufgabe wird<br />
beim LVermA NRW bis auf weiteres ein<br />
Sekundärdatenbestand der Daten aller Länder<br />
vorgehalten, aus dem Kundenanfragen beantwortet<br />
und Bestellungen bedient werden. Der<br />
Vermarktungsaktivität liegt ein Konzeptpapier<br />
zugrunde, das im Start der Initiative entwickelt<br />
worden war, und das seitdem kontinuierlich<br />
fortgeschrieben wird.<br />
Das LVermA NRW war seit Gründung der<br />
GVHK außerdem damit befasst, die Gemeinschaft<br />
aktiv auszubauen, indem weitere Vermessungsverwaltungen<br />
schrittweise hinzugewonnen<br />
werden. Ziel war es, den Kundenwunsch<br />
nach einer bundesweit einheitlichen<br />
Lösung so kurzfristig wie möglich nachzukommen<br />
und die Initiative als Referenzprojekt<br />
auf Ebene der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik<br />
Deutschland (AdV) zu einem<br />
Erfolgsmodell werden zu lassen. Im Zuge dieser<br />
verwaltungsinternen Akquisition galt es,<br />
die Ziele der GVHK und die Rollenverteilung<br />
in der Gemeinschaft transparent zu machen,<br />
Unterstützung bei dem Abbau diverser Hemmnisse<br />
zu leisten und bestehende Unklarheiten<br />
aus dem Weg zu räumen. So wurden aus Informationsgesprächen<br />
nicht selten Akquisitionsgespräche,<br />
deren Erfolg nicht zuletzt davon<br />
abhing, inwieweit es gelang, den ideellen und<br />
materiellen Nutzen überzeugend darzulegen.<br />
Nichts anderes geschah und geschieht heute im<br />
Rahmen von Kundengesprächen; die Erfolgfaktoren<br />
sind identisch.<br />
Wesentlicher Bestandteil eines reibungslosen<br />
Vertriebs ist die einwandfreie technische Aufbereitung<br />
der Hauskoordinaten. Dazu werden<br />
die Länderdaten zum 01. April eines jeden Jahres<br />
an das LVermA NRW geliefert und dort<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 29
zusammengeführt. Das LVermA NRW stellt<br />
die Abgabe der Hauskoordinaten aller Länder<br />
in dem einheitlichen, von der AdV verabschiedeten<br />
Abgabeformat sicher. Die Qualität der<br />
gelieferten Daten bleibt dabei unverändert. Im<br />
Zuge der Zusammenführung des Gesamtdatenbestandes<br />
aller Länder werden ebenfalls im<br />
Jahresrhythmus postalische Informationen<br />
(insbesondere die Postleitzahl) zugespielt. Diese<br />
Aufgabe wird im Vergabewege aufgrund<br />
bundesweiter Ausschreibung erledigt und im<br />
direkten Kontakt des jeweiligen Dienstleisters<br />
mit dem LVermA NRW abgewickelt. Nach der<br />
Anfelderung der postalischen Informationen<br />
wird der dann komplette Datenbestand der<br />
„Hauskoordinaten Deutschland“ zur abschließenden<br />
Qualitätsprüfung an die Länder<br />
gegeben.<br />
Mit der Freigabe von Seiten der Länder (zum<br />
01. Juli eines jeden Jahres) stehen die aktuellen<br />
Daten zur Nutzung bereit. Zu diesem Zeitpunkt<br />
werden die aktualisierten Daten wahlweise<br />
als neuer Komplett- oder als Differenzdatensatz<br />
an solche Kunden ausgeliefert,<br />
die eine jährliche Aktualisierungslieferung<br />
lizenziert haben. Im Anschluss an eine jede<br />
Auslieferung von Hauskoordinaten, sei es zur<br />
Datenaktualisierung bei bestehenden Kunden<br />
oder zur Erstbelieferung von Neukunden,<br />
erfolgt die Abrechnung sowohl gegenüber<br />
dem Lizenznehmer als auch im Innenverhältnis<br />
mit den jeweils betroffenen Ländern. Das<br />
LVermA NRW erstellt und versendet dazu entsprechende<br />
Rechnungen und Übersichten, aus<br />
denen die Verteilung der auf die Mitglieder der<br />
GVHK entfallenen Einnahmeanteile hervorgeht.<br />
Vertriebsbegleitend erfordert die angestrebte<br />
Marktnähe ein rasches und zuverlässiges Handeln<br />
aller beteiligten Personen. Dabei messen<br />
die Kunden das LVermA NRW an klassischen<br />
Faktoren, die mitentscheidend für den Erfolg<br />
oder Misserfolg der Gemeinschaft sind:<br />
� Verständliche und in aller Kürze aufbereitete<br />
Basisinformationen zum aktuellen<br />
Angebot.<br />
� Rasche Bereitstellung von Testdaten ausgewählter<br />
Gebiete.<br />
� Erstellen individueller Angebote, die neben<br />
einer detaillierten Kostenaufstellung auch<br />
30<br />
Nutzenargumente für jeden einzelnen Kunden<br />
beinhalten.<br />
� Zuverlässige und umfassende Auskünfte<br />
zu allen Fragen rund um das Produkt.<br />
� Rasche und sichere Korrektur von aufgetretenen<br />
Fehlern.<br />
Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen<br />
von Kundenseite ist davon auszugehen,<br />
dass die ersten Schritte in ein vom Wettbewerb<br />
geprägtes Umfeld erfolgreich absolviert wurden.<br />
Damit konnte eine günstige Ausgangsbasis<br />
geschaffen werden, die es erlaubt, sich<br />
ernsthaft am Markt zu bewegen und das Leistungsspektrum<br />
schrittweise auszubauen.<br />
4 Das Produkt – Merkmale und<br />
Verfügbarkeit<br />
Die amtlichen Hauskoordinaten definieren die<br />
genaue Position eines Hauses. Datenquelle ist<br />
das Liegenschaftskataster der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder und somit das amtliche<br />
Verzeichnis aller Flurstücke und Gebäude<br />
in Deutschland. Im Gegensatz zu den durch<br />
Interpolation berechneten Daten, wie sie im<br />
Navigationsbereich verwendet werden, beruhen<br />
die amtlichen Hauskoordinaten auf einer<br />
individuellen Vermessung vor Ort. Der Gebäudedatenbestand<br />
wird durch die örtlichen Katasterbehörden<br />
permanent fortgeführt und stellt<br />
damit eine zuverlässige und werthaltige<br />
Grundlage für alle gebäudescharfen Geoanwendungen<br />
von Wirtschaft, Wissenschaft und<br />
Verwaltung dar.<br />
Abb. 2a: Hausgenaue Positionierung mit den<br />
amtlichen Hauskoordinaten<br />
Die Hauskoordinaten werden bundesweit in<br />
einem einheitlichen einfachen marktüblichen<br />
Format (ASCII-Format) bereitgestellt. Dadurch<br />
ist eine einfache Weiterverarbeitung und<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Abb. 2b: Hausgenaue Positionierung mit den amtlichen Hauskoordinaten<br />
Integration in die verschiedensten Kundenlösungen<br />
gewährleistet.<br />
Der Datenbestand umfasst heute folgende<br />
Inhalte:<br />
� Kennung des Datensatzes, bundesweit eindeutige<br />
ID.<br />
� Qualitätsangabe A, B<br />
– exakte Hauskoordinate, Flurstückskoordinate.<br />
� Land, Regierungsbezirk, Kreis/kreisfreie<br />
Stadt, Gemeinde<br />
– aufgebaut nach bundesweit gültigem Statistikschlüssel.<br />
� Straßenschlüssel, Straßenname, Hausnummer,<br />
Adressierungszusatz, Postleitzahl,<br />
postalischer Ortsname, Zusatz zum postalischen<br />
Ortsnamen.<br />
� Koordinatenpaar<br />
– Gauß-Krüger, UTM oder geografische<br />
Koordinaten.<br />
Abb. 3: Lagequalität der amtlichen Hauskoordinaten<br />
Hervorzuheben ist die Integration der postalischen<br />
Informationen (Postleitzahl und postalischer<br />
Ortsname plus Zusatz). Bei der Postleitzahl<br />
handelt es sich um ein unbedingt nachgefragtes<br />
Element zu einer jeden Adresse, das<br />
jedoch nicht in allen Ländern zum originären<br />
Bestandteil des Liegenschaftskatasters zählt.<br />
Um den Kunden dennoch einen optimalen<br />
Basisdatenbestand anbieten zu können, haben<br />
sich die Vermessungsverwaltungen der Länder<br />
dazu entschieden, diese Informationen entweder<br />
in Eigenregie oder durch Einbindung eines<br />
externen Dienstleisters zu ergänzen. Hier sind<br />
die Anforderungen des Marktes unmittelbar<br />
maßgebend für die Inhalte des amtlichen Angebotes;<br />
ein Beleg für die verstärkte Ausrichtung<br />
der amtlichen Produkte an den tatsächlichen<br />
Anforderungen der Kunden.<br />
Mit der Freigabe des derzeit in Vorbereitung<br />
befindlichen Updates zum 01. Juli <strong>2006</strong> wird<br />
erstmals ein bundesweit flächendeckender<br />
Datenbestand vorliegen. Das heißt, alle derzeit<br />
verfügbaren amtlichen Hauskoordinaten der<br />
Bundesländer können fortan über das LVermA<br />
NRW bezogen werden. Dabei sind die Hauskoordinaten<br />
aller Gebäude mit einer Lagebezeichnung<br />
(Adresse), die im Liegenschaftskataster<br />
nachgewiesen sind, im Datenbestand<br />
enthalten. Die Vollständigkeit des Datenbe-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 31
standes entspricht dabei dem aktuellen Stand<br />
des Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster.<br />
Abb. 4a: Datendichte der amtlichen Hauskoordinaten<br />
Bundesland Hauskoordinaten [Anzahl]<br />
Nordrhein-Westfalen 3.900.964<br />
Bayern 3.071.307<br />
Baden-Württemberg 2.638.845<br />
Niedersachsen 2.277.997<br />
Hessen 1.417.855<br />
Rheinland-Pfalz 1.133.966<br />
Schleswig-Holstein 790.726<br />
Sachsen 744.231<br />
Sachsen-Anhalt 587.983<br />
Brandenburg 532.405<br />
Berlin<br />
– lieferbar ab Juli <strong>2006</strong><br />
zirka 500.000<br />
Saarland 310.413<br />
Hamburg 262.923<br />
Bremen/Bremerhaven 165.177<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
– lieferbar ab Juli <strong>2006</strong><br />
zirka 150.000<br />
Thüringen 117.289<br />
GESAMT zirka 18.000.000<br />
Abb. 4b: Anzahl der amtlichen Hauskoordinaten<br />
je Bundesland (Stand: März <strong>2006</strong>)<br />
Mit der bundesweiten Flächendeckung konnte<br />
ein wichtiger Meilenstein in der länderübergreifenden<br />
Vermarktung von Geobasisdaten<br />
des Liegenschaftskatasters erreicht werden.<br />
5 Die Vermarktung<br />
– Aspekte, Strategien und Aktivitäten<br />
Seit Bestehen der zentralen Vermarktung wurde<br />
eine Vielzahl von Gesprächen mit Unternehmen<br />
aus den verschiedensten Branchen<br />
geführt. Ziel der Gespräche war es, die Anforderungen<br />
der Kundenseite kennen zu lernen,<br />
32<br />
das Marktpotenzial der amtlichen Hauskoordinaten<br />
abzuschätzen, und in Erfahrung zu<br />
bringen, welche Branchen heute und zukünftig<br />
für die Vermarktung relevant sein werden.<br />
Darüber hinaus dienten die Aktivitäten dazu,<br />
das neue Angebot der amtlichen Vermessungsverwaltungen<br />
am Markt bekannt zu machen,<br />
Informationen über potenzielle Wettbewerber<br />
zu erhalten, die Möglichkeit von Kooperationen<br />
zu erörtern und im Idealfall gemeinsame<br />
Geschäftsmodelle zu entwickeln.<br />
Ausfluss dieser aktiven Markterschließung<br />
war unter anderem die wesentliche und für das<br />
weitere Vorgehen entscheidende Erkenntnis,<br />
dass es nicht genügen würde, die Hauskoordinaten<br />
ausschließlich in der oben beschriebenen<br />
„Rohform“ anzubieten, da sich die Wünsche<br />
der potenziellen Kunden als sehr individuell<br />
erweisen: Branchenspezifische Schwerpunktthemen<br />
und -anwendungen bestimmen dabei<br />
maßgeblich das Geschehen. Diese richten sich<br />
nach aktuellen Bedürfnissen, Markttrends und<br />
Entwicklungen und ändern sich in immer kürzeren<br />
Zyklen. Damit einhergehend ermöglichen<br />
auch technische Neuentwicklungen<br />
schon heute Applikationen, die gestern noch<br />
nicht realisierbar erschienen.<br />
Wesentliche Nutzenargumente aus Kundensicht<br />
sind die folgenden Aspekte:<br />
� Gewährleistung höchster Qualität und<br />
Zuverlässigkeit<br />
– Basis ist das amtliches Liegenschaftskataster.<br />
� Flächendeckende Erfassung und Fortführung<br />
– auch in ländlichen Regionen.<br />
� Exakte (hausgenaue) Hauskoordinaten<br />
– keine Interpolation.<br />
� Langfristige Investitionssicherheit<br />
– durch garantierte kontinuierliche Bereitstellung.<br />
Auf diese Anforderungen musste reagiert werden.<br />
Die Idee, ein „Produkt für alle“ zu generieren<br />
und anzubieten, ist nicht tragfähig.<br />
Ebenso wenig gelingt es, individuelle Nutzungs-<br />
und Geschäftsmodelle für alle erdenklichen<br />
Anwendungen und bis in das letzte<br />
Detail zu regeln. Der Kunde wünscht sich zwar<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
einheitliche Datenformate und Preisstrukturen,<br />
sieht eine angemessene Preisbildung im<br />
Zusammenhang mit der Lizenzierung amtlicher<br />
Daten aber immer nur gegeben, wenn der<br />
eigene Nutzen und die unternehmensspezifischen<br />
Mehrwerte dabei berücksichtigt wurden.<br />
Im Ergebnis gleicht kein Geschäftsmodell dem<br />
anderen, und unterschiedliche Geschäftsmodelle<br />
erfordern verschiedene Lizenzmodelle.<br />
Der Phantasie der Marktteilnehmer sind dabei<br />
keine Grenzen gesetzt. Überraschende Ideen<br />
werden immer wieder mit innovativen Ansätzen<br />
über moderne Formen der Datenlizenzierung<br />
kombiniert. Darauf gilt es auf jeden konkreten<br />
Einzelfall rasch zu reagieren und in<br />
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den<br />
Ländern einen bundesweiten Konsens herbeizuführen.<br />
Intensive und auf das Wesentliche<br />
fokussierte Kommunikation bildet an dieser<br />
Stelle die Basis für immer kürzere Entscheidungszeiträume.<br />
Es steht außer Frage, dass die Vermessungsverwaltungen<br />
die Vermarktung ihrer Produkte<br />
weiter forcieren müssen. Unabdingbare Voraussetzung<br />
dafür sind Produkte, die nicht alleine<br />
durch technische Reife bestechen, sondern<br />
auch durch konsequente und ständige Orientierung<br />
an den Bedürfnissen des Marktes und<br />
der Kunden. Gepaart mit einem marktfähigen<br />
Lizenzmodell ist die Grundlage für eine erfolgreiche<br />
Vermarktung der Hauskoordinaten<br />
gegeben. Produkt und Preis haben sich in vielen<br />
Bereichen als marktfähig erwiesen. Wo<br />
dies nicht der Fall war, wurde schnell nachgebessert.<br />
So wird das Lizenzmodell auch zurzeit<br />
wieder überarbeitet.<br />
Tragende Säule einer nachhaltigen Erlössteigerung<br />
ist aber der aktive Vertrieb. Und genau<br />
in diesem Punkt unterscheidet sich die Initiative<br />
zur gemeinsamen Verbreitung der amtlichen<br />
Hauskoordinaten erheblich von den vorangegangenen<br />
Projekten der AdV: Das LVermA<br />
NRW sondiert bei diesem neuen Projekt systematisch<br />
und kontinuierlich den Markt, geht auf<br />
die potenziellen Kunden zu, generiert aus den<br />
Rückmeldungen der Gesprächspartner erhebliches<br />
Marktwissen und steigert so signifikant<br />
den Bekanntheitsgrad des neuen Angebotes<br />
der Vermessungsverwaltungen. Das Feedback<br />
des Marktes fließt kontinuierlich in die Opti-<br />
mierung von Produkt und Vermarktung ein und<br />
wird darüber hinaus in alle Bundesländer hinein<br />
kommuniziert.<br />
6 Der Vertrieb – zielgruppengerechte<br />
Varianten<br />
Der Direktverkauf der Hauskoordinaten an<br />
Endkunden darf als klassischer Weg der<br />
Lizenzierung gesehen werden. Bedingt durch<br />
die einfache Datenstruktur des Angebotes und<br />
die unkomplizierte Integrierbarkeit in existierende<br />
Datenstrukturen und Softwarelösungen<br />
erfolgt der Direktvertrieb in erster Linie an<br />
klassische Nutzer von Geoinformationssystemen.<br />
Oftmals werden die Hauskoordinaten<br />
zusätzlich zu anderen bereits lizenzierten amtlichen<br />
Geobasisdaten bezogen, um das Datenportfolios<br />
des Kunden zu ergänzen. Dabei profitiert<br />
das LVermA NRW oftmals nicht zuletzt<br />
vom Wissen des Kunden um die amtlichen<br />
Datenangebote.<br />
Neue Zielgruppen, die bislang nicht zum festen<br />
Kundenstamm der Vermessungsverwaltungen<br />
gehörten, erreicht das LVermA NRW hingegen<br />
verstärkt über Partnerunternehmen.<br />
Diese Unternehmen lizenzieren die Hauskoordinaten,<br />
„veredeln“ sie durch individuelle und<br />
branchenspezifisch unterschiedliche Aufbereitung<br />
und stellen Folgeprodukte und Folgedienste<br />
bereit. Dabei profitiert das LVermA<br />
NRW in zunehmendem Maße vom Know How<br />
der Unternehmen, die sich seit Jahren mit den<br />
speziellen Bedürfnissen ihrer Kunden auseinandersetzen.<br />
Sie sind in der Lage, aus dem<br />
Basisprodukt amtliche Hauskoordinaten maßgeschneiderte<br />
Angebote zu generieren, mit<br />
deren Hilfe die Nutzenerwartungen der Kunden<br />
bestmöglich erfüllt werden.<br />
Über das im Aufbau befindliche engmaschige<br />
Netzwerk von Partnerunternehmen möchte<br />
das LVermA NRW heute und in Zukunft Kunden<br />
erreichen, die<br />
� neben Geodaten noch weitere Fach- und<br />
Sachdaten (Soziodemografie-, Wirtschaftsund<br />
Adressdaten etc.) inklusive ergänzender<br />
Services benötigen,<br />
� umfassenden Beratungs- und Schulungsbedarf<br />
weit über das reine Datenangebot hinaus<br />
wünschen,<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 33
� den „Mehrwert für mein Unternehmen“<br />
zurzeit nicht zwingend mit den amtlichen<br />
Vermessungsverwaltungen verbinden,<br />
� individuelle Dienstleistungen und Produktangebote<br />
benötigen, die durch das LVermA<br />
NRW selbst nicht erbracht werden können,<br />
� im eigenen Umfeld nicht über eine ausreichende<br />
„Geo-Kompetenz“ verfügen.<br />
Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben,<br />
dass auch die Partnerunternehmen und<br />
ihre Kunden erheblich vom Wandel im amtlichen<br />
Vermessungsumfeld profitieren. Auch sie<br />
können ihr Angebotsportfolio hochwertig ergänzen<br />
und in einer Qualität bundesweit „hausgenau<br />
agieren“, was bisher nicht möglich war.<br />
Viele Anbieter verfeinern und erweitern nun<br />
ihre bislang auf interpolierten Daten basierenden<br />
Angebote mit Hilfe der Hauskoordinaten.<br />
Hierdurch wird die Realisierung von Wertschöpfungsprozesse<br />
begünstigt und letztend-<br />
34<br />
lich auch das Image der Vermessungsverwaltungen<br />
verbessert.<br />
Seit Gründung der Gemeinschaft gelang es,<br />
eine Vielzahl von Unternehmen aus verschiedenen<br />
Branchen als Kunden zu gewinnen.<br />
Dabei erfolgte der Abverkauf der Daten sowohl<br />
direkt als auch über Partnerunternehmen.<br />
Insbesondere in den nachfolgend aufgeführten<br />
Kernbranchen konnten diverse Kunden erreicht<br />
werden:<br />
� Immobilien,<br />
� Navigation (Fahrzeugnavigation, Internetdienste,<br />
Location-Based-Services),<br />
� Netzdokumentation (Kabelnetzbetreiber,<br />
Telekommunikation, Ver- und Entsorgung),<br />
� Rettungsdienste,<br />
� Zustellung (Zeitungsverlage, Anzeigenblätter,<br />
Pressevertrieb, alternative Postzustellung).<br />
Abb. 5: Öffentliche Portale mit Zugriff auf die amtlichen Hauskoordinaten<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
7 Die Zukunft – Vermarktungsgrundsatz<br />
und neue Produkte<br />
Abb. 6a: „Adressnavigation“ mit Hilfe der amtlichen Hauskoordinaten<br />
Abb. 6b: „Adressnavigation“ mit Hilfe der amtlichen Hauskoordinaten<br />
Mit der Komplettierung der Hauskoordinaten<br />
zu einem bundesweiten Datenangebot ist ein<br />
wesentlicher Schritt für eine erfolgreiche Vermarktung<br />
des Produktes getan. Nun gilt es, den<br />
Vertrieb weiterhin aktiv zu betreiben und das<br />
bestehende Partnernetzwerk konsequent auszubauen,<br />
ohne dabei den Direktvertrieb an<br />
Endkunden zu vernachlässigen. Dies erfordert<br />
eine kontinuierliche Anpassung an die Markterfordernisse;<br />
dies gilt für das Vertriebsgeschäft<br />
an sich als auch für alle weiteren Marketing-Bausteine<br />
– Produkt, Preis und Kommunikation.<br />
Dabei wird der permanente Wandel<br />
die einzige Konstante im Räderwerk von<br />
Angebot und Nachfrage sein. Die Zeit starrer<br />
Gebühren- und Lizenzmodelle ist vorbei. Sie<br />
müssen sukzessive einfachen und flexiblen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 35
Strukturen Platz machen. Gleiches gilt für die<br />
Produktgestaltung. Auch hier werden permanente<br />
Anpassungen nötig sein.<br />
Eine wesentlicher Punkt ist der von Kundenseite<br />
in den vergangenen Jahren immer wieder<br />
angesprochene Wunsch nach Realisierung<br />
weiterer selektiver Datenangebote aus der<br />
Datenbasis des Liegenschaftskatasters. Diesem<br />
Wunsch wollen die amtlichen Vermessungsverwaltungen<br />
schrittweise nachkommen,<br />
um sich so langfristig als kompetenter Partner<br />
für Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung<br />
zu etablieren. Dabei müssen am Kundennutzen<br />
orientierte bundesweite Produkte und Services,<br />
die zu marktgerechten Konditionen und in<br />
einheitlichen Datenformaten angeboten werden,<br />
immer im Vordergrund stehen. Erster, die<br />
Hauskoordinaten ergänzender Baustein werden<br />
die Hausumringe sein. Dabei handelt es<br />
sich um georeferenzierte Umringpolygone,<br />
welche die Grundrisse der Gebäude beschreiben.<br />
Ein Konzeptentwurf mit allen wesentlichen<br />
und für die Vermarktung erforderlichen<br />
Eckpunkten wird in Kürze an die Ländervertreter<br />
versandt. Erklärtes Ziel ist die Bereitstellung<br />
erster Daten noch in diesem Jahr.<br />
Ergänzend zur Ableitung weiterer Produkte<br />
aus dem Basisdatenbestand des Liegenschaftskatasters<br />
wird die Verknüpfung und die kombinierte<br />
Bereitstellung von Hauskoordinaten<br />
36<br />
mit den Daten des ATKIS ® -Basis-DLM angestrebt.<br />
Die Kombination beider Geobasisdatenbestände<br />
soll die Attraktivität des Gesamtangebotes<br />
der amtlichen Vermessungsverwaltungen<br />
nachhaltig verbessern und so<br />
dazu beitragen, neue Zielgruppen zu erschließen.<br />
Durch diese Zusammenführung<br />
amtlicher Geobasisdaten von Landesvermessung<br />
und Liegenschaftskataster sollen vorhandene<br />
Synergien effizienter genutzt werden.<br />
Außerdem befindet sich ein GDI-konformer<br />
Geocodierungsdienst in der Entwicklung<br />
(Gazetter-Service), mit dem eine Online-<br />
Codierung von Adressen im Internet möglich<br />
sein wird. Mit dieser Erweiterung der Angebotspalette<br />
wird ein erster wichtiger Schritt zur<br />
vernetzten Bereitstellung der Hauskoordinaten<br />
erreicht.<br />
Gerfried Westenberg<br />
GeoMarketing<br />
Hohenzollernstraße 56<br />
30161 Hannover<br />
E-Mail: gerfried.westenberg@t-online.de<br />
Martin Knabenschuh<br />
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen<br />
Muffendorfer Straße 19-21<br />
53177 Bonn<br />
E-Mail: knabenschuh@lverma.nrw.de<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Veröffentlichung des Handbuches:<br />
„Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen mit SAPOS ®<br />
Von Wolfgang Kuttner, Katja Nitzsche und Peter Reifenrath<br />
1 Einführung<br />
Im März <strong>2006</strong> hat bei der <strong>Bezirksregierung</strong><br />
<strong>Köln</strong> eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema<br />
„Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen<br />
mit SAPOS ® “ stattgefunden. Dabei<br />
wurden die Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft<br />
„Anwendung satellitengeodätischer<br />
Verfahren“ präsentiert. Sie sind auch in einem<br />
Handbuch dargestellt, welches unter anderem<br />
kostenfrei im Internet zur Verfügung gestellt<br />
wird.<br />
Eines der vorrangigen Ziele der neuen Landesregierung<br />
ist die Verwaltungsmodernisierung.<br />
Privatisierung und Kommunalisierung<br />
sind die Zauberworte, mit denen die Sanierung<br />
der öffentlichen Haushalte erfolgen soll.<br />
Wenn auch die Erhebung und Bereitstellung<br />
von Geobasisdaten auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters<br />
als wichtige Aufgabe<br />
bestehen bleiben und zukünftig für immer<br />
mehr geobasierte Anwendungen als Grundlage<br />
dienen wird, werden auch auf die Vermessungsverwaltung<br />
tiefgreifende Änderungen<br />
zukommen und Einsparungen gefordert werden.<br />
Was die Organisationsstruktur betrifft, ist die<br />
Vermessungsverwaltung schon sehr modern<br />
aufgestellt:<br />
� Das operative Vermessungsgeschäft, d.h.<br />
die Erhebung der Geobasisdaten, liegt im<br />
Bezirk <strong>Köln</strong> schon heute zu ca. 90 % in den<br />
Händen der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure.<br />
� Die Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten<br />
ist komplett kommunalisiert und<br />
damit Aufgabe der Katasterbehörden.<br />
Einsparpotenzial im Sinne der Verwaltungsmodernisierung<br />
besteht daher vor Allem im<br />
Einsatz moderner Verfahren, der Straffung der<br />
Aufgabenwahrnehmung und der Optimierung<br />
der Schnittstellen zwischen freiem Beruf und<br />
Katasterbehörden.<br />
Die <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong> versteht sich dabei<br />
als moderne Behörde, die bei dem hohen Grad<br />
der Privatisierung und Kommunalisierung für<br />
die erforderliche Einheitlichkeit sorgt. Das ist<br />
nur zu erreichen, wenn sie über die Mittel der<br />
klassischen Aufsicht hinausgeht und sich als<br />
Kompetenzzentrum versteht, das die Katasterbehörden<br />
und Vermessungsstellen berät und<br />
bei der Einführung und Entwicklung neuer<br />
Verfahren im Sinne von § 23(4) VermKatG<br />
NRW unterstützt.<br />
Die <strong>Bezirksregierung</strong> forciert daher seit Jahren<br />
die Anwendung moderner, kostensparender<br />
Vermessungsmethoden unter Nutzung des<br />
GPS-Satellitensystems. Das Land Nordrhein-<br />
Westfalen hat mit SAPOS ® einen zukunftsweisenden<br />
Satellitenpositionierungsdienst aufgebaut.<br />
Die Kommunen profitieren bereits<br />
davon durch den Wegfall von Arbeiten im Aufnahmepunktfeld.<br />
Wichtig ist, auch die ÖbVermIng<br />
von den Vorteilen der neuen Technik zu<br />
überzeugen.<br />
Angesichts der vielfältigen Anforderungen<br />
und Probleme bei der Anwendung der neuen<br />
Technik im Liegenschaftskataster wurde bereits<br />
vor einigen Jahren eine Arbeitsgemeinschaft<br />
„Anwendung satellitengeodätischer<br />
Verfahren“ ins Leben gerufen, in der sowohl<br />
der freie Beruf (3 ÖbVermIng), die Kreise und<br />
kreisfreien Städte als Katasterbehörden (3 Vertreter)<br />
und die <strong>Bezirksregierung</strong> (3 Vertreter<br />
incl. Leitung und Koordination) vertreten sind<br />
(Abb. 1).<br />
Abb. 1: Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 37
Es handelt sich dabei also um eine „public private<br />
partnership“ im weitesten Sinne dieses<br />
Wortes. Ziel ist die Erarbeitung praxistauglicher<br />
Verfahrensabläufe und einer einheitlichen<br />
Dokumentation der Vermessungsergebnisse.<br />
Mit diesen Maßnahmen verbindet sich die<br />
Hoffnung, einen beachtenswerten Beitrag zur<br />
rationelleren Bearbeitung von Liegenschaftsvermessungen<br />
bei ÖbVermIng und Katasterbehörden<br />
zu leisten.<br />
2 Einrichtung der AG „Anwendung<br />
satellitengeodätischer Verfahren“<br />
Die Anwendung des NAVSTAR-Global-Positioning-System<br />
(GPS) hat in der Landesvermessung<br />
und im Liegenschaftskataster inzwischen<br />
Tradition. Bereits seit Mitte der<br />
80er-Jahre wurden GPS-Beobachtungen bei<br />
Messungen im Festpunktfeld des Landes NRW<br />
eingesetzt. Planung, Durchführung, Auswertung<br />
und Beurteilung der Arbeiten waren einer<br />
handvoll Spezialisten vorbehalten. Mit der<br />
vollständigen Operabilität des GPS-Spacesegments<br />
wurden diese Arbeiten von einem erweiterten<br />
Personenkreis durchgeführt. Trotzdem<br />
wurde die Technik fast ausschließlich im TP-<br />
Feld des Landes eingesetzt.<br />
Die erste signifikante Änderung im Anwendungsspektrum<br />
wurde durch die Einführung<br />
der sogenannten RTK-Systeme (Echtzeitmessung)<br />
eingeleitet. Sie wurden von Mitte der<br />
90er-Jahre bis zum Jahr 2000 vornehmlich zur<br />
Bestimmung eines ausgedünnten AP(1)-Feldes<br />
eingesetzt. Diese Systeme arbeiteten mit zwei<br />
Empfängern auf der Anwenderseite, einer<br />
Referenz und einem Rover. Dieser Aufwand<br />
stand einer weiten Verbreitung im Liegenschaftskataster<br />
über das AP-Feld hinaus im<br />
Weg. Darüber hinaus wurden diese Systeme<br />
als geschlossene Mess- und Auswertesysteme<br />
angeboten. Diese für den Weltmarkt konzipierten<br />
Systeme hatten von der Dokumentation<br />
und den Auswertestrategien her nur wenig<br />
mit den Anforderungen des Liegenschaftskatasters<br />
gemein. Der Anwender hatte mitunter<br />
Schwierigkeiten prüffähige Ergebnisse zu<br />
erzeugen. Auch dieser Aspekt stand der Akzeptanz<br />
der GPS-Verfahren im Liegenschaftskataster<br />
entgegen.<br />
38<br />
Mit der Vernetzung der SAPOS ® -Stationen<br />
und den GPS-Richtlinien wurde im Jahr 2002<br />
eine neue tragfähige Grundlage für die Anwendung<br />
der GPS-Technik im Liegenschaftskataster<br />
geschaffen. Durch den SAPOS ® -HEPS-<br />
Dienst wurde das Beschaffungserfordernis und<br />
der Einsatzaufwand in der Örtlichkeit auf<br />
einen GPS-Empfänger (SAPOS ® -Rover) reduziert.<br />
Messergebnisse sind unter Nutzung der<br />
SAPOS ® -Dienste Koordinaten im amtlichen<br />
Bezugssystem ETRS89. Diese Neuerung wurde<br />
von den GPS-Richtlinien aufgenommen<br />
und zu einem einheitlichen Auswerteweg und<br />
einer einheitlichen Dokumentation von GPS-<br />
Messungen zusammengefasst. Damit wurde in<br />
Verbindung mit den Beschlüssen der AdV, das<br />
Liegenschaftskataster in den Lagebezug<br />
ETRS89/UTM zu überführen, eine ganz neue<br />
Perspektive für den Einsatz der GPS-Technologie<br />
im Liegenschaftskataster eröffnet. Dabei<br />
werden über die Kombination der SAPOS ® -<br />
und Tachymeteranwendung neue wirtschaftliche<br />
und qualitative Potenziale in der Liegenschaftsvermessung<br />
geschaffen.<br />
Die damalige Prognose der <strong>Bezirksregierung</strong><br />
<strong>Köln</strong> über die Vielfalt der Einsatzbereiche für<br />
SAPOS ® -Anwendungen wird bis heute<br />
bestätigt. Die bisherige Entwicklung des Einsatzes<br />
der SAPOS ® -Anwendung ähnelt dabei<br />
sehr stark der der EDM-Anwendung. Wir<br />
gehen davon aus, dass sich die zukünftige Entwicklung<br />
des Einsatzes der SAPOS ® -Anwendung<br />
im Liegenschaftskataster ähnlich verhalten<br />
wird.<br />
Um das Potenzial der SAPOS ® -Anwendung<br />
im Liegenschaftskataster aufzuzeigen und eine<br />
einheitliche Anwendung und Dokumentation<br />
zu etablieren, verfolgte die <strong>Bezirksregierung</strong><br />
<strong>Köln</strong> eine neue Strategie. Es wurde eine<br />
Arbeitsgemeinschaft gegründet, in der Vertreter<br />
der Katasterbehörden und Vermessungsstellen<br />
mit Praxiserfahrung das Thema grundlegend<br />
bearbeiten sollten. Darin sollten die<br />
Interessen und Ziele aller Beteiligten nach dem<br />
Leitsatz „Aus der Praxis für die Praxis“<br />
berücksichtigt werden. Dem Leitsatz wurde<br />
das Ziel beiseite gestellt, die Arbeitsergebnisse<br />
immer auf absehbare zukünftige Entwicklungen<br />
abzustimmen. Für die Verbreitung der<br />
Arbeitsergebnisse wurden drei Wege gewählt:<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
eine schriftliche Form, eine Fortbildungsveranstaltung<br />
und die Beratung durch alle beteiligten<br />
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.<br />
Das erste Projekt wurde im Handbuch „Auswertung<br />
von SAPOS ® -Messungen im Kataster“<br />
(Handbuch I) dargestellt. In der zugehörigen<br />
Informationsveranstaltung am 4.<br />
Dezember 2002 wurden neben dem Handbuch<br />
SAPOS ® -Anwendungen im Liegenschaftskataster<br />
und die GPS-Richtlinien vorgestellt.<br />
Bereits kurz darauf wurde durch neue Softwareprodukte<br />
eine neue überarbeitete Auflage<br />
notwendig.<br />
3 Projekt „Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen<br />
mit SAPOS ® “<br />
Bereits während der Beratungen zum Handbuch<br />
I hat die Arbeitsgemeinschaft festgestellt,<br />
dass das Thema SAPOS ® -Anwendung in der<br />
Liegenschaftsvermessung noch viel breiter<br />
angelegt werden müsste. Alle Prozesse der Liegenschaftsvermessung<br />
sind mehr oder minder<br />
durch die Anwendung von SAPOS ® beeinflusst.<br />
Die Fortbildungsangebote beziehen sich<br />
bisher schwerpunktmäßig auf die technische<br />
Durchführung von SAPOS ® -HEPS-Messungen,<br />
der Fortbildungsbedarf bei der Vorbereitung<br />
und Nachbereitung der Messung und der<br />
Integration von SAPOS ® in die bestehenden<br />
Arbeitsprozesse im Außendienst wird bisher<br />
vernachlässigt. Ein Grund für diesen Mangel<br />
ist sicher die komplexe Materie aus der sich die<br />
bestehenden Prozeduren entwickelt haben.<br />
Allein sie zu beschreiben, wäre ein umfangreiches<br />
Projekt.<br />
„Das ist aber viel Arbeit“ war die einhellige<br />
Meinung der Arbeitsgemeinschaft über unser<br />
neues Projekt im Mai 2003. Deswegen hatten<br />
wir ein Jahr Zeit bis zur Präsentation des nächsten<br />
Handbuches eingeplant. Es dauerte dennoch<br />
2 1/2 Jahre bis zum Redaktionsschluss für<br />
das aktuelle Handbuch „Arbeitsabläufe bei<br />
Liegenschaftsvermessungen mit SAPOS ® “.<br />
Obwohl wir von Anfang an die Verhältnisse in<br />
den bestehenden Arbeitsabläufen bei Liegenschaftsvermessungen<br />
als sehr inhomogen eingeschätzt<br />
haben, waren wir immer wieder aufs<br />
neue überrascht, wie schwierig es ist, die<br />
Arbeitsabläufe allgemeingültig zu beschreiben.<br />
Die unterschiedlichen Interessen und<br />
Sichtweisen der beteiligten Stellen in eine Darstellungsform<br />
zu bringen, die für alle Stellen in<br />
ihrer Begründung nachvollziehbar ist und<br />
dabei gleichzeitig ein Interesse an den Inhalten<br />
erzeugt, gestaltete sich von Anfang an als<br />
schwierig. Wenn man bedenkt, dass es sich<br />
hierbei um täglich angewandte Routinen handelt,<br />
ist es erstaunlich, wie unterschiedlich die<br />
Arbeitsprozesse ausfallen können, die doch<br />
zum gleichen Produkt führen und den gleichen<br />
Verwaltungsvorschriften folgen.<br />
Neben der Vereinheitlichung sollten aber auch<br />
die Erfahrungen der Mitglieder, die sich<br />
abzeichnenden Entwicklungen bei der Anwendung<br />
von SAPOS ® im Liegenschaftskataster<br />
und der bevorstehende Lagebezugswechsel des<br />
Katasternachweises in das ETRS89 in der<br />
Abbildung UTM dargestellt werden. Hier war<br />
die Erarbeitung eines Arbeitsablaufes notwendig,<br />
der den Zielzustand nach dem Lagebezugswechsel<br />
und der Etablierung von SAPOS ®<br />
als Standardmessmethode im Liegenschaftskataster<br />
beschreibt. Denn nur mit diesem konkreten<br />
Arbeitsablauf als Entwicklungsziel<br />
konnten die notwendigen Veränderungen im<br />
derzeitigen Arbeitsablauf ermittelt werden.<br />
Auch hier waren die Ergebnisse zunächst<br />
unkonkret und deswegen schwierig zu gebrauchen.<br />
Denn Anfang 2003 war SAPOS ® zwar<br />
bereits realisiert, aber die Erfahrungen der<br />
Anwendung im Liegenschaftskataster noch<br />
sehr dürftig. Als konzeptionelle Basis für unsere<br />
Arbeit dienten uns die vorhandenen Entwürfe<br />
der beim Innenministerium im Jahr 2001<br />
eingerichteten Arbeitgruppe ETRS89 und<br />
ihrer Unterarbeitsgruppen. Die Unterarbeitsgruppe<br />
1 erarbeitete dabei Überführungsstrategien<br />
für den Katasternachweis, die Unterarbeitsgruppe<br />
3 beschrieb Verfahrensabläufe bei<br />
Katastervermessungen im ETRS89/UTM. Im<br />
späteren Verlauf war der Einführungserlass<br />
ETRS89/UTM vom 09.08.2004 eine wichtige<br />
Absicherung für unsere Arbeit.<br />
Durch den frühen Zeitpunkt unserer Tätigkeit<br />
wollten wir einen einheitlichen Arbeitsablauf<br />
anbieten, bevor sich zu viele individuelle<br />
Lösungen etabliert haben. Mit den tief greifenden<br />
Veränderungen der Realisierung des<br />
Lagebezuges bei Liegenschaftsvermessungen<br />
durch SAPOS ® sollte der komplette Arbeitsab-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 39
lauf der Liegenschaftsvermessung einheitlich<br />
strukturiert werden. Ein höheres Maß an Einheitlichkeit<br />
ist der entscheidende Schlüssel zu<br />
wirtschaftlichen Abläufen. Dies ist das wichtigste<br />
Ergebnis unserer Beratungen. Bei der<br />
Erledigung der täglichen Arbeiten geht zuviel<br />
Energie in Auseinandersetzungen über Missverständlichkeiten<br />
konkreter Liegenschaftsvermessungen<br />
verloren. Reibungsverluste, die<br />
durch mangelnde Koordinierung der Arbeitsabläufe<br />
auftreten. Mehr Einheitlichkeit und<br />
damit weniger Differenzierungen, weniger<br />
Zwänge und mehr Transparenz müssen das<br />
Ziel sein. Deswegen wollten wir dem Leser<br />
einen einheitlichen Arbeitsablauf präsentieren,<br />
der vielen heutigen Ansprüchen gerecht wird.<br />
Dieser soll eine Orientierung bieten, um die<br />
eigenen Arbeitsprozesse kritisch zu betrachten<br />
und die Möglichkeit öffnen den eigenen<br />
Arbeitsprozess neu zu strukturieren und sich<br />
mit den Sachbearbeitern vor- und nachgeschalteter<br />
Arbeitsprozesse neu abzustimmen.<br />
Je schwieriger die Analyse des Ist-Zustandes<br />
ausfiel, desto motivierter waren wir, die Abläufe<br />
für die Zukunft einheitlich zu beschreiben.<br />
Alle Bereiche des Arbeitsablaufes mit der gleichen<br />
hohen Kompetenz in der Arbeitsgemeinschaft<br />
zu vertreten, war uns unmöglich. Dies<br />
bedeutete für unsere Arbeit, dass wir Abgrenzungen<br />
und Schwerpunkte schaffen mussten.<br />
So werden nur von der SAPOS ® -Anwendung<br />
betroffene Arbeitsprozesse dargestellt.<br />
Schwerpunkt ist nicht die Beschreibung der<br />
technischen Abläufe bei der SAPOS ® -Anwendung,<br />
sondern deren Integration in die tägliche<br />
Arbeit.<br />
Das Handbuch ist neben dem kostenlosen<br />
Download aus dem Internet in einer begrenzten<br />
Auflage als Druck verfügbar. Zu dieser<br />
schriftlichen Darreichung unserer Arbeitsergebnisse<br />
haben wir am 15. März <strong>2006</strong> eine<br />
Informationsveranstaltung bei der <strong>Bezirksregierung</strong><br />
<strong>Köln</strong> durchgeführt, die nicht nur den<br />
Inhalt des Handbuches in ausgewählten Themen<br />
darstellte, sondern auch die Rahmenbedingungen<br />
und Zielsetzungen des Landes und<br />
Neuerungen, die vor Redaktionsschluss nicht<br />
in das Handbuch eingearbeitet werden konnten.<br />
Die Vorträge sind ebenfalls im Internet als<br />
kostenloser Download verfügbar. Darüber hin-<br />
40<br />
aus steht die Arbeitsgemeinschaft als Ansprechpartner<br />
für Fragen, Beratungen, Anregungen<br />
und Fehlerbeseitigungen im Handbuch<br />
zur Verfügung. Alle Leser des Handbuches<br />
sind aufgefordert, uns ihre Anmerkungen und<br />
Verbesserungsvorschläge zu schicken. Wir<br />
werden Sie beurteilen und, wenn sie mit unserem<br />
Ziel vereinbar sind, in einer überarbeiteten<br />
Version des Handbuches im Internet zur Verfügung<br />
stellen.<br />
Die Zielgruppe des Handbuches ist ähnlich<br />
komplex und inhomogen wie das Thema<br />
selbst. Der Fortbildungsbedarf ist nur schwer<br />
abzuschätzen. So gibt es Themenbereiche,<br />
deren Inhalte sich von selbst verbreiten, andere<br />
sind nur schwer an die zuständige Stelle zu<br />
bringen. Unsere Ansprüche an den Umgang<br />
mit unserem Handbuch haben wir deswegen<br />
mehrstufig gefasst (Abb. 2).<br />
Abb. 2: Ziele des Handbuchs II<br />
Die Neugierde an den neuen Fakten, das Interesse<br />
eigene Erfahrungen zu sammeln und das<br />
Verständnis der etablierten Prozesse soll die<br />
Verbreitung vereinfachen. Der einfachste<br />
Anspruch ist, dass wir die Diskussion über die<br />
dargestellten Inhalte anregen wollen. Des Weiteren<br />
können die Inhalte eine Orientierung bilden,<br />
die eigene Arbeitsweise zu überdenken<br />
und zu gestalten. Der eine oder andere Inhalt<br />
wird vielleicht neu sein oder in einem neuen<br />
Kontext dargestellt. Damit schaffen wir einen<br />
Rahmen der Fortbildung. Und zuletzt haben<br />
wir die Hoffnung, dass der abgebildete<br />
Arbeitsablauf eine zukünftige Arbeitsgrundlage<br />
bildet. Einheitliche Arbeitsabläufe, Dokumentationen<br />
und Beurteilungskriterien sind<br />
die Grundlage für transparente und nachvoll-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
ziehbare Prüfprozeduren und damit für wirtschaftliches<br />
Arbeiten. Diese Ansprüche sowie<br />
der Umfang der gesamten Thematik machen es<br />
notwendig, den Inhalt des Handbuches unterschiedlich<br />
detailliert darzustellen. Denn einerseits<br />
wollen wir eine übergeordnete Sichtweise<br />
wahren, andererseits trotzdem eine praxisnahe<br />
beispielhafte Darstellung bieten. Das<br />
Handbuch verfolgt eine bedarfsorientierte und<br />
themenspezifische Intensität in der Darstellung.<br />
Der Sachbearbeiter soll sich in seinem<br />
Arbeitsprozess wiederfinden, aber auch ein<br />
Interesse für die benachbarten Arbeitsprozesse<br />
entwickeln. Dies ergibt sich durch Querverweise<br />
über den Abschnitt hinaus. Da viele<br />
Sachverhalte in unterschiedlichen Arbeitsprozessen<br />
gleich oder ähnlich sind, werden solche<br />
nur an einer Stelle ausführlich behandelt. Darüber<br />
hinaus sollen die Querverweise die Sachbearbeiter<br />
benachbarter Arbeitsprozesse animieren<br />
ohne konkreten Anlass ins Gespräch zu<br />
kommen.<br />
Der Inhalt des Handbuches teilt sich in<br />
Abschnitte, die wiederum in drei Blöcke zusammengefasst<br />
werden können (Abb. 3).<br />
Abb. 3: Inhalt des Handbuches II<br />
Der erste Block enthält ein Vorwort und eine<br />
Einleitung. Des Weiteren wird die Ausgangssituation<br />
definiert. Hierbei wird der Katasternachweis<br />
in drei Fallgruppen differenziert. Auf<br />
diese wird im ganzen Handbuch immer wieder<br />
zurückgegriffen. In einer grundlegenden Betrachtung<br />
der Arbeitsabläufe einer Liegenschaftsvermessung<br />
im Außendienst wird eine<br />
reine Tachymeteranwendung einer integrierten<br />
SAPOS ® -Tachymeteranwendung gegenübergestellt<br />
und eine Abschätzung über das Einsparungspotenzial<br />
abgegeben.<br />
Der zweite Block enthält die Beschreibung der<br />
Arbeitsabläufe der Liegenschaftsvermessung<br />
von der Erstellung der Vermessungsunterlagen<br />
bis zur Übernahme in das Liegenschaftskataster,<br />
die von der SAPOS ® -Anwendung betroffen<br />
sind. Wie bereits dargestellt, handelt es sich<br />
hierbei nicht um eine detaillierte Darstellung<br />
wie in unserem ersten Handbuch, sondern um<br />
eine Anleitung zur Selbsterfahrung.<br />
Im dritten Block werden die Quellen und<br />
Ansprechpartner genannt sowie Themen in so<br />
genannten Konzeptpapieren behandelt, die<br />
durch ihren Umfang den Rahmen der einzelnen<br />
Abschnitte gesprengt hätten. Dort werden<br />
das Bezugssystem ETRS89 mit der Abbildung<br />
UTM dargestellt, Auswirkungen eines hierarchiefreien<br />
VP-Feldes und die Notwendigkeit<br />
von Anschlusspunkten aufgezeigt und die Fehlerquellen<br />
einer RTK-Messung behandelt.<br />
Wir hoffen mit dem Inhalt und der Gestalt des<br />
Handbuches dem Sachbearbeiter in den nächsten<br />
Jahren eine Hilfe zu geben. Der nachfolgende<br />
Abschnitt soll einen Einblick in ausgewählte<br />
Themenbereiche des Handbuches<br />
bieten. Unserer Meinung nach sind an den<br />
gewählten Spotlights die derzeitigen Veränderungsprozesse<br />
in einer Liegenschaftsvermessung<br />
sehr gut nachvollziehbar.<br />
4 Spotlights<br />
4.1 Verwendung der Stützpunktdatei<br />
Zur effizienten Bearbeitung einer Liegenschaftsvermessung<br />
ist es nach Meinung der<br />
Arbeitsgemeinschaft „Anwendung satellitengeodätischer<br />
Verfahren“ sinnvoll den<br />
SAPOS ® -HEPS-Dienst des Landesvermessungsamtes<br />
einzusetzen. Dabei ergeben sich<br />
als Messwerte ETRS89-Koordinaten.<br />
Bei einer koordinatenbasierten Arbeitsweise,<br />
welche vorzugsweise bei der Integration von<br />
SAPOS ® - und Tachymeter-Messwerten Einsatz<br />
finden sollte (siehe Abschnitt 4.2), muss<br />
sich die Vermessungsstelle für die Verwendung<br />
eines Koordinatensystems im Außendienst entscheiden.<br />
Die Arbeitsgruppe favorisiert hier<br />
die Verwendung des ETRS89/UTM. Denn<br />
einerseits ist es, wie in dem Erlass des Innenministeriums<br />
zur Einführung des ETRS89/<br />
UTM im Liegenschaftskataster ausgeführt,<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 41
erklärtes Ziel der Landes NRW das Lagebezugssystem<br />
des Katasternachweises auf das<br />
ETRS89/UTM umzustellen. Insofern nähert<br />
sich diese Vorgehensweise der zukünftigen<br />
Arbeit im Liegenschaftskataster an. Andererseits<br />
entstehen durch den Einsatz von<br />
SAPOS ® -HEPS im Außendienst immer<br />
ETRS89-Messwerte in Koordinatenkatasterqualität<br />
und deren hohe Qualität sollte möglichst<br />
auch bei den endgültigen Koordinatenberechnungen<br />
erhalten bleiben.<br />
Für den Wechsel zwischen dem Lagebezugssystem<br />
des Katasternachweises (i.d.R. Netz 77<br />
oder Preußische Landesaufnahme) und dem<br />
Bezugssystem ETRS89 wird eine Transformation<br />
notwendig. Um diese durchführen zu können,<br />
werden in beiden Bezugssystemen identische<br />
Punkte, so genannte Stützpunkte, benötigt.<br />
Eine einheitliche Vorgehensweise zur Verwendung<br />
von Stützpunkten kann über die Stützpunktdatei<br />
erreicht werden. Diese wird beim<br />
Landesvermessungsamt NRW als zentrale<br />
Datenbank und Auskunftssystem vorgehalten,<br />
um für den Aufbau des Stützpunktfeldes in<br />
Nordrhein-Westfalen eine einheitliche Grundlage<br />
bieten zu können. Sie ist einerseits als<br />
Datenbank für die Koordinatenpaare der Stützpunkte<br />
zu verstehen, die zum Lagebezugswechsel<br />
des Liegenschaftskatasters verwendet<br />
werden sollen. Andererseits ist die Datei als<br />
Auskunftssystem realisiert, über welches sich<br />
Vermessungsstellen selbstständig Punktauszüge<br />
erzeugen können (Abb.4). Die Datei ist über<br />
die Internetseite www.stuetzpunktdatei-nrw.de<br />
zu erreichen.<br />
Abb. 4: Zweck der Stützpunktdatei<br />
Gefüllt werden soll die Stützpunktdatei auf der<br />
Grundlage der jeweiligen Stützpunktkonzepte<br />
42<br />
der Katasterämter und daraus resultierender<br />
Stützpunktpläne. Der Stand der Befüllung<br />
spiegelt dabei auch den Umgang und Nutzen<br />
der Datenbank für die Vermessungsstellen<br />
wider:<br />
� In einer ersten Phase hat das Landesvermessungsamt<br />
unter Rücksprache mit den<br />
Katasterämtern die Stützpunktdatei mit<br />
geeigneten Stationspunkten des TP-Feldes<br />
gefüllt. Die Katasterämter haben ein Konzept<br />
zum Aufbau eines Stützpunktfeldes<br />
und einen Stützpunktplan aufgestellt. In<br />
dieser Phase hat die SAPOS ® -nutzende<br />
Vermessungsstelle selbst zu entscheiden,<br />
welche Punkte für die fachgerechte Überführung<br />
der Fortführungsvermessung in<br />
das für den Katasternachweis maßgebende<br />
Lagebezugssystem geeignet sind. Die Auswahl<br />
der lokalen, projektbezogenen Stützpunkte<br />
ist mit dem Katasteramt abzustimmen.<br />
Dabei handelt es sich in den meisten<br />
Fällen um bestehende Aufnahmepunkte.<br />
Vorhandene Sicherungsmarken können<br />
alternativ zum Zentrum bestimmt werden,<br />
wenn sie im Lagebezugssystem des Katasternachweises<br />
koordinierbar und für die<br />
SAPOS ® -Messung besser geeignet sind.<br />
� In der zweiten Phase sind die Planungen<br />
des Katasteramtes abgeschlossen und ein<br />
koordinierter Aufbau der Stützpunktdatei<br />
findet statt. Das Katasteramt erteilt den<br />
Vermessungsstellen Auskunft darüber, welche<br />
Punkte für die Transformation vom<br />
ETRS89 in das Lagebezugssystem des<br />
Katasternachweises zu benutzen sind.<br />
Dabei wird Auskunft über die bereits vorhandenen<br />
Stützpunkte und die noch im<br />
ETRS89 zu bestimmenden Punkte gegeben.<br />
Die Vermessungsstelle bestimmt die<br />
fehlenden Stützpunkte im Rahmen der<br />
Durchführung der Vermessungsarbeiten<br />
(im zumutbaren Rahmen) und benutzt beim<br />
Lagebezugswechsel die vom Katasteramt<br />
vorgegebenen Punkte.<br />
� In der dritten Phase ist die Stützpunktdatei<br />
vollständig vorhanden. Sie wurde von<br />
dem Katasteramt freigegeben. Nun ist der<br />
eindeutige Bezug zwischen dem aktuellen<br />
Lagebezugssystem des Katasternachweises<br />
und dem Lagebezug ETRS89/UTM durch<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
den Inhalt der Stützpunktdatei abgebildet.<br />
Das heißt, Transformationen sind zwischen<br />
dem Lagebezug des Katasternachweises<br />
und ETRS89/UTM und umgekehrt über das<br />
Stützpunktfeld ohne Qualitätsverlust möglich.<br />
Die Vermessungsstellen können jetzt<br />
die für ihre Vermessungen benötigten Stützpunkte<br />
aus der Stützpunktdatei selbst entnehmen.<br />
Inhaltliche Änderungen der Stützpunktdatei<br />
können nun nur noch durch das<br />
Landesvermessungsamt sowie mit Benachrichtigung<br />
von Katasteramt und Nutzern<br />
der Stützpunktdatei durchgeführt werden.<br />
Das Katasteramt legt die Gebiete, in denen eine<br />
Freischaltung der Stützpunktdatei möglich ist,<br />
selber fest und beantragt deren Freigabe beim<br />
Landesvermessungsamt. Insofern wird der<br />
Stand der Befüllung der Stützpunktdatei je<br />
Katasteramtsbezirk variieren. Aktuell ist die<br />
Stützpunktdatei mit geeigneten Stationspunkten<br />
der TP 1.- 4. Ordnung im Regierungsbezirk<br />
<strong>Köln</strong> gefüllt. Die erste Phase der Befüllung der<br />
Stützpunktdatei ist damit abgeschlossen. Eine<br />
Freigabe von Gebieten erfolgte bisher nur bei<br />
der Stadt Aachen (Abb. 5).<br />
Abb. 5: Freigeschaltete Gebiete am Beispiel<br />
der Stadt Aachen<br />
Eine Bedienungsanleitung befindet sich auf<br />
der Internetseite der Stützpunktdatei oder im<br />
Handbuch „Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen<br />
mit SAPOS ® “ der Arbeitsgemeinschaft<br />
„Anwendung satellitengeodätischer<br />
Verfahren“.<br />
Ist eine Freigabe der Stützpunktdatei gemäß<br />
der oben genannten dritten Phase für das Vermessungsgebiet<br />
erfolgt, kann die Vermessungsstelle<br />
die entsprechend in der Stützpunktdatei<br />
nachgewiesenen Stützpunkte für<br />
Transformationsberechungen bei der Liegenschaftsvermessung<br />
verwenden. Die Notwendigkeit<br />
einer Transformation bei einer koordinatenbasierten<br />
Arbeitsweise besteht dabei bis<br />
zur Überführung der Daten des Liegenschaftskatasters<br />
in das ETRS89/UTM einerseits bei<br />
der Vorbereitung der Vermessung im Innendienst<br />
(Vorabtransformation) und andererseits<br />
nach Abschluss der Koordinatenberechnungen<br />
zur Überführung der Koordinaten in das<br />
Gebrauchssystem des Liegenschaftskatasters.<br />
Die Vorabtransformation kann für die Bereitstellung<br />
von Koordinaten zum Aufsuchen von<br />
Vermessungspunkten erfolgen. Sie ist auch<br />
erforderlich, um die in Koordinatenkatasterqualität<br />
vorhandenen Koordinaten des Katasternachweises<br />
im Außendienst auf ihre Identität<br />
zu prüfen oder um vorab berechnete<br />
Sollkoordinaten in der Örtlichkeit abzustecken.<br />
Ist die Stützpunktdatei freigeschaltet (dritte<br />
Phase) können für die Vorabtransformation<br />
sowie für die endgültige Transformation ins<br />
Gebrauchsnetz des Katasters einheitliche, also<br />
dieselben, Transformationsparameter verwendet<br />
werden ( Abb. 6). Ein Vorteil dieser Vorgehensweise<br />
ist auch, dass in das Lagebezugssystem<br />
des Katasternachweises transformierte<br />
ETRS89/UTM-Koordinaten, welche ja in<br />
Koordinatenkatasterqualität vorliegen, zum<br />
Zeitpunkt der Überführung der Daten des Liegenschaftskatasters<br />
in den Jahren 2009/2010<br />
mit denselben Transformationsparametern<br />
erneut in das ETRS89/UTM zurück transformiert<br />
werden. Insofern sind die hier verwendeten<br />
Transformationsparameter eindeutig.<br />
Der Qualitätsstandard des Koordinatenkatasters<br />
bleibt dauerhaft erhalten. Die Transformation<br />
ist ohne Qualitätsverlust möglich, der<br />
Bezug zwischen den beiden Bezugssystemen<br />
ändert sich nicht.<br />
Ist bisher keine Freigabe der Stützpunktdatei<br />
erfolgt, ist die Wahl und Dichte der Stützpunkte<br />
eng mit der Frage nach der Qualität des<br />
Katasternachweises verbunden. Für deren<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 43
Auswahl ist eine individuelle Absprache mit<br />
dem Katasteramt gemäß der oben genannten<br />
zweiten Phase erforderlich.<br />
Befindet sich das Messgebiet in einem Bereich<br />
mit homogener Katastergrundlage wird i.d.R.<br />
eine Transformation über die Stützpunkte des<br />
TP-Feldes ausreichend sein. Liegt jedoch im<br />
betreffenden Gebiet eine inhomogene Netzgrundlage<br />
vor, ist eine nachbarschaftliche<br />
Transformation über lokale Stützpunkte erforderlich.<br />
Diese werden i.d.R. erst bei der Aufmessung<br />
im Außendienst gewonnen.<br />
Liegen zudem die für die endgültige Transformation<br />
der neu ermittelten Koordinaten<br />
benötigten Stützpunkte zu Beginn der Messung<br />
noch nicht vor, können für die Vorabtransformation<br />
lediglich globale Transformationsparameter<br />
(z.B. Verwendung von<br />
Stützpunkten aus dem TP-Feld) herangezogen<br />
werden. Dies ist für die Punktsuche nach Koordinaten<br />
ausreichend.<br />
Ein Nachteil der nicht freigegebenen Stützpunktdatei<br />
(Phase 1 und 2) besteht darin, dass<br />
die in das Gebrauchssystem des Katasternachweises<br />
transformierten ETRS89-Koordinaten<br />
bei der endgültigen Überführung des Lagebezuges<br />
des Liegenschaftskatasters nach<br />
ETRS89/UTM i.d.R. nicht mehr reproduzier-<br />
44<br />
Abb. 6: Auswahl der Transformationsstützpunkte<br />
bar sind. Das heißt die ursprüngliche Qualität<br />
der berechneten ETRS89-Koordinate in Koordinatenkatasterqualität<br />
bleibt nicht erhalten.<br />
Die Transformation ist nicht eindeutig reproduzierbar.<br />
4.2 Integration von SAPOS ® - und<br />
Tachymeteranwendung<br />
Die satellitengestützte Messmethode entwickelt<br />
im Außendienst die größte Effektivität,<br />
wenn sie mit der terrestrischen Messmethode,<br />
d.h. der Tachymeteraufnahme, verknüpft wird.<br />
Für den Arbeitsbereich Liegenschaftsvermessung<br />
stellt diese Verknüpfung sogar eine Notwendigkeit<br />
dar, da es die örtlichen Gegebenheiten<br />
nur selten erlauben werden, die erforderlichen<br />
Arbeiten für Grenzuntersuchung,<br />
Absteckung und Aufmaß lediglich unter Nutzung<br />
satellitengestützter Aufnahmemethoden<br />
zu erledigen. Insofern kann es nur sinnvoll<br />
sein, das von SAPOS ® ausgehende wirtschaftlich<br />
positive Potenzial in Ergänzung zur bisherigen<br />
Arbeit mit dem Tachymeter einzusetzen.<br />
Einen Standardablauf für die Kombination beider<br />
Messverfahren im Außendienst gibt es<br />
nicht. Der Einsatz eines SAPOS ® -Rovers ist<br />
stark von den örtlichen Gegebenheiten, wie die<br />
Himmelsfreiheit der einzelnen Vermessungspunkte,<br />
im Vermessungsgebiet abhängig.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Die Verknüpfung von satellitengeodätischen<br />
und terrestrischen Messdaten im Außendienst<br />
ist inzwischen von allen namhaften Geräteherstellern<br />
technisch realisiert. So stehen also bei<br />
einer koordinatenbasierten Arbeitsweise in<br />
gleicher Weise die mittels Tachymeter<br />
bestimmten Koordinaten und die mittels<br />
SAPOS ® -HEPS bestimmten Echtzeitkoordinaten<br />
zur weiteren Verwendung im Außendienst<br />
zur Verfügung. Die Controller moderner<br />
Messsysteme können i.d.R. kombinierte Messverfahren<br />
(SAPOS ® bzw. Tachymeter) in einer<br />
Projektdatenbank verwalten. Dies hat den Vorteil,<br />
dass ein einheitlicher Datenfluss trotz verschiedener<br />
Messverfahren und Messgeräte<br />
gewährleistet ist. Neben Komplettlösungen der<br />
Gerätehersteller gibt es auch Controller von<br />
Anbietern, die in Verbindung mit Geräten von<br />
verschiedenen Herstellern benutzt werden<br />
können. Für die dv-technische Integration von<br />
Messwerten im Feld gibt es derzeit drei Konzepte.<br />
Diese unterscheiden sich in der Kombination<br />
von Messgerät, Datenspeicher, Auswertesoftware<br />
und Controller:<br />
1. Tachymeter, SAPOS ® -Rover, Datenspeicher<br />
und Controller mit Auswertesoftware<br />
sind in einem Gerätesystem kombiniert.<br />
Die gesamte Datenverarbeitung erfolgt im<br />
integrierten Controller (Abb. 7).<br />
Abb. 7: Kombiniertes<br />
Gerätesystem<br />
(z.B. Fa. Leica, SmartStation)<br />
2. Tachymeter und SAPOS ® -Rover sind zwei<br />
eigenständige Geräte. Die Integration erfolgt<br />
über die Verwendung von einem Controller<br />
mit Auswertesoftware, welcher an<br />
beide Systeme angeschlossen werden kann<br />
und auch die Datenspeicherung übernimmt<br />
(Abb. 8, Fa. Trimble, Fa. Topcon, Sokkia,<br />
Gart 2000, etc.).<br />
Abb. 8: Integration von GPS-Rover und Tachymeter<br />
mittels Controller (z.B. Fa. Trimble, TCU)<br />
3. Tachymeter und SAPOS ® -Rover sind zwei<br />
eigenständige Geräte. Beide werden über<br />
ihre eigene Controllereinheit mit Auswertesoftware<br />
betrieben. Die Integration erfolgt<br />
über die Verwendung eines externen Datenspeichers<br />
(z.B. Speicherkarte), welcher das<br />
gesamte Projekt und alle zugehörigen<br />
Daten enthält (Abb. 9).<br />
Abb. 9: Integration erfolgt mittels Data Card<br />
(z.B.: Fa. Leica, System 1200)<br />
Die Umsetzung der Konzepte durch die<br />
Gerätehersteller führt zu unterschiedlichen<br />
Funktionsumfängen. Teilweise können die<br />
Systeme in Kombination mit einem Robotiktachymeter<br />
eingesetzt werden. Zum Beispiel<br />
kann möglicherweise ein solcher Tachymeter<br />
und ein SAPOS ® -Rover parallel von einem<br />
Lotstock aus bedient werden. (Abb. 10).<br />
Bei SAPOS ® -HEPS-Anwendungen ist eine<br />
koordinatenbasierte Arbeitsweise im Außendienst<br />
vorzuziehen, da als Messwerte am Controller<br />
direkt Koordinaten im ETRS89/UTM<br />
bereitgestellt werden. Da mit der Veröffentlichung<br />
des Einführungserlasses ETRS89/UTM<br />
vom 09.08.2004 die Einführung des Lagebezugssystems<br />
ETRS89/UTM für das Liegenschaftskataster<br />
eingeleitet worden ist, wird<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 45
somit auch unmittelbar die Herstellung des<br />
amtlichen Lagebezuges im ETRS89/UTM ermöglicht.<br />
Die koordinatenbasierte Arbeitsweise<br />
ist auch bisher schon über den Lageanschluss<br />
der umliegenden AP im Außendienst<br />
möglich gewesen. Insofern ist sie in ihrer<br />
Anwendung nicht neu. Sie wird aber durch die<br />
SAPOS ® -HEPS-Anwendung und dem damit<br />
verbundenen Aufbau des Koordinatenkatasters<br />
erheblich an Bedeutung gewinnen.<br />
Abb. 10: Bedienung des Robotiktachymeters und des<br />
SAPOS ®<br />
-Rovers vom Lotstock aus<br />
(z.B.: Trimble, IS-Rover)<br />
Als Vorbereitung des Außendienstes sind die<br />
Koordinaten des Katasternachweises auf ihre<br />
mögliche Verwendung im Außendienst zu<br />
überprüfen. Wie schon im vorhergehenden<br />
Abschnitt beschrieben, bietet es sich an, die im<br />
Außendienst benötigten Koordinaten des<br />
Katasternachweises aus dem Gebrauchssystem<br />
in das ETRS89/UTM zu transformieren, um<br />
sie für die Arbeiten zur Grenzuntersuchung,<br />
Identitätsprüfung und Absteckung nutzen zu<br />
können.<br />
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden,<br />
dass eine SAPOS ® -gestützte Liegenschaftsvermessung<br />
effizienter und vor allem<br />
zeitsparender durchführbar ist. Dies spiegelt<br />
sich z.B. auch an dem Personalbedarf bei den<br />
einzelnen Arbeitsschritten wider. Wird z.B.<br />
46<br />
eine Absteckung mittels SAPOS ® -Rover<br />
durchgeführt, reicht dafür eine Person, welche<br />
den Rover zum Punkt bewegt und gleichzeitig<br />
die Bedienung des Controllers sicherstellt. Die<br />
einzelnen Arbeitsschritte im Außendienst<br />
umfassen das Herstellen des Lagebezuges, die<br />
Grenzuntersuchung, die Identitätsprüfung, das<br />
Abstecken und ggf. das Wiederherstellen und<br />
das Aufmaß der Vermessungspunkte.<br />
Die Herstellung des amtlichen Lagebezuges<br />
mittels Tachymeter ist mitunter sehr zeitaufwändig.<br />
Um herkömmlich an das AP-Feld<br />
anzuschließen, sind meistens zusätzliche zwischengeschaltete<br />
Tachymeterstandpunkte erforderlich.<br />
Bei der SAPOS ® -gestützten Anwendung<br />
kann der Lagebezug dagegen über als<br />
Hilfspunkte genutzte temporäre Anschlusspunkte<br />
erfolgen. Dabei entstehen der Vermessungsstelle<br />
folgende wirtschaftliche Vorteile:<br />
� Das Aufsuchen, Überprüfen und ggf. das<br />
Herstellen oder Einrichten von AP entfällt.<br />
� Die Lage der temporären Anschlusspunkte<br />
kann der örtlichen Situation angepasst werden.<br />
� Die Vermessungspunkte können ggf. direkt<br />
beobachtet werden.<br />
In Gebieten mit wenigen Anschlusspunkten<br />
kann dabei mit einer Zeitersparnis von ca. 20<br />
Prozent gerechnet werden. Die temporären<br />
Anschlusspunkte können dabei so gewählt<br />
werden, dass Einflussgrößen auf die GPS-<br />
Messung (Mehrwegeeffekte, Abschattungen)<br />
möglichst gering sind. Eine dauerhafte Vermarkung<br />
dieser Anschlusspunkte ist i.d.R.<br />
nicht erforderlich, da sie nach der Vermessung<br />
nicht mehr benötigt werden. Die Arbeitsgruppe<br />
sieht hier ein sehr großes Einsparpotenzial<br />
im Gegensatz zu dem herkömmlichen Anschluss<br />
an das AP-Feld, da hier die Arbeiten an<br />
den AP vollständig entfallen können. Dies gilt<br />
natürlich vorbehaltlich der Tatsache, dass eine<br />
SAPOS ® -gestützte Anwendung im Vermessungsgebiet<br />
überhaupt möglich ist. Die Verknüpfung<br />
temporär mittels SAPOS ® -HEPS<br />
bestimmter Anschlusspunkte mit einer Freien<br />
Stationierung des Tachymeters, stellt ein fast<br />
universelles Hilfsmittel dar, um Arbeiten im<br />
Liegenschaftskataster vorzunehmen.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Bei den Arbeiten zur Grenzuntersuchung und<br />
Identitätsprüfung ist von einem durchschnittlichen<br />
Einsparpotenzial von ca. 10 Prozent auszugehen.<br />
Hier kommt insbesondere die koordinatenbasierte<br />
Arbeitsweise für das Aufsuchen<br />
der VP zum Tragen. So können die im<br />
ETRS89/UTM vorliegenden Grenzpunkte bei<br />
entsprechender Himmelsfreiheit direkt mittels<br />
SAPOS ® -Rover abgesteckt werden. Der Vermesser<br />
kann sich dabei über das Absteckmenü<br />
des Controllers am Rover bis zur Solllage des<br />
Punktes hinführen lassen. Ist ein direkter Einsatz<br />
von SAPOS ® an speziellen VP nicht möglich,<br />
kann die Arbeit über Hilfskonstruktionen,<br />
wie z.B. Bogenschlag über zwei mit SAPOS ® -<br />
HEPS bestimmte Hilfspunkte oder orthogonale<br />
Absteckung von zwei mit SAPOS ® -HEPS<br />
bestimmten Hilfspunkten aus, erleichtert werden.<br />
Die Grenzuntersuchung und Identitätsprüfung<br />
erfolgt gemäß den Vorschriften des Fortführungsvermessungserlasses.<br />
Liegen für die<br />
Grenzpunkte bereits Koordinaten in Koordinatenkatasterqualität<br />
vor, so erfolgt die Identitätsprüfung<br />
über den Koordinatenvergleich.<br />
Dies ist natürlich besonders bei einem beobachtungsfähigen<br />
SAPOS ® -HEPS-Punkt effizient,<br />
da in diesem Fall die Arbeitsschritte des<br />
Aufsuchens des Grenzpunktes, der Identitätsprüfung<br />
und des Aufmaßes in einem Arbeitsgang<br />
am SAPOS ® -Rover durchgeführt werden<br />
können. Liegt, wie es im Regelfall sein wird,<br />
im Vermessungsgebiet noch kein Koordinatenkataster<br />
vor, so erfolgt die Identitätsprüfung<br />
über die aus früheren Messungen vorliegenden<br />
Aufnahmeelemente. Bei der koordinatenbasierte<br />
Arbeitsweise können diese für die Identitätsprüfung<br />
auch aus Koordinaten abgeleitet<br />
werden.<br />
Für das Abstecken von Grenzpunkten ist bei<br />
einer möglichen Verwendung des SAPOS ® -<br />
Rovers mit einer zeitlichen Ersparnis von ca.<br />
15 Prozent zu rechnen. Es wird vor allem<br />
dadurch vereinfacht, dass die Vermessungsstelle<br />
bei dem Einsatz des SAPOS ® -Rovers<br />
nicht mehr in dem Maße auf Tachymeteraufstellungen<br />
angewiesen ist und Sichtverbindungen<br />
zu anderen Vermessungspunkten nicht<br />
benötigt werden.<br />
Die Vorgehensweise beim Aufmaß der Vermessungspunkte<br />
vereinfacht sich dergestalt,<br />
dass bereits schon bei den Arbeitsschritten<br />
Aufsuchen des Vermessungspunktes und<br />
Grenzuntersuchung ein erstes Aufmaß in<br />
SAPOS ® -HEPS erhalten wird. Diesbezüglich<br />
verschneiden sich die Arbeitsschritte. Es ist für<br />
diesen Arbeitsschritt bei einer integrierten Vermessung<br />
mit einem Einsparpotenzial von ca. 5<br />
Prozent zu rechnen. Um unnötigen Mehraufwand<br />
zu vermeiden, sollten zuerst alle Vermessungspunkte,<br />
die SAPOS ® -HEPS fähig<br />
sind, aufgemessen werden. Die restlichen<br />
Punkte werden anschließend mittels Tachymeter<br />
aufgemessen und entweder über die temporären<br />
Anschlusspunkte (mittels SAPOS ®<br />
koordiniert) oder über die AP-Netz-Masche an<br />
das amtliche Lagebezugssystem angeschlossen.<br />
4.3 Dokumentation der<br />
Liegenschaftsvermessung<br />
Für die Gewährleistung eines reibungslosen<br />
Arbeitsablaufes und einer optimalen Zusammenarbeit,<br />
kommt der Schnittstelle zwischen<br />
Katasterbehörde und Vermessungsstelle eine<br />
besondere Bedeutung zu. Neben der Erteilung<br />
der Vermessungsunterlagen, die im Abschnitt 4<br />
des Handbuches II behandelt wird, nehmen<br />
diesbezüglich die Vermessungsschriften eine<br />
besonders wichtige Stellung ein.<br />
Die Erstellung der Vermessungsschriften wird<br />
im Abschnitt 7 des Handbuches II beschrieben.<br />
Die Ansprüche an deren Dokumentation sind<br />
aus zwei Perspektiven zu beleuchten: Für die<br />
Vermessungsstelle ist die Dokumentationsform<br />
insbesondere ein Abbild der Arbeitsabläufe<br />
des vermessungstechnischen Außen- und<br />
Innendienstes. Für die Katasterbehörde ergeben<br />
sich die Notwendigkeiten aus der Übernahmeprüfung<br />
nach den geltenden Verwaltungsvorschriften.<br />
Eine isolierte Betrachtung<br />
der beiden verschiedenen Bedürfnisse an die<br />
Dokumentation würde zu kurz greifen, da z.B.<br />
die rein formelle Beschreibung aus Sicht der<br />
Katasterbehörde der Funktion der Vermessungsschriften<br />
nicht gerecht werden würde.<br />
Die Anforderungen beider Bereiche wurden<br />
zunächst von der Arbeitsgemeinschaft erarbei-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 47
tet und auf die Anlage 3 und 6 des Einführungserlasses<br />
ETRS89/UTM und die absehbaren<br />
zukünftigen Arbeitsbedingungen<br />
abgestimmt. Die Ergebnisse wurden in die Protokollierungsvorschrift<br />
der Anlage 6 zum Einführungserlass<br />
eingearbeitet. Der Umfang<br />
wurde an die preferierte Auswertestrategie<br />
angepasst. Deswegen wurden für die Vermessungsschriften<br />
keine freie und keine gezwängte<br />
Ausgleichung dokumentiert. Alle im Handbuch<br />
II gezeigten Protokolle wurden in<br />
mühsamer Handarbeit gefüllt. Sie zeigen konzentriert<br />
und übersichtlich alle Parameter der<br />
Liegenschaftsvermessung. Die Erstellung dieser<br />
oder ähnlicher Protokolle kann zukünftig<br />
nur im Datenfluss wirtschaftlich gelöst werden.<br />
Voraussetzung ist daher eine standardisierte<br />
Software, die den Bedürfnissen aller<br />
beteiligten Stellen gerecht wird.<br />
In diese Richtung weist ein neuer Ansatz, der<br />
von dem Arbeitskreis Liegenschaftskataster<br />
der AdV verfolgt wird. Grundgedanke ist, die<br />
Protokolle zukünftig nicht mehr in Formulare<br />
zu fassen, sondern eine Datenbank zu erstellen,<br />
aus der nach Bedarf Auszüge gefertigt<br />
oder auf die Prüfwerkzeuge angewendet werden<br />
können. Dementsprechend ist der Arbeitskreis<br />
mit der Erarbeitung einer logischen<br />
Datenstruktur beschäftigt, die als Grundlage<br />
für Softwareentwicklungen dienen kann.<br />
Bei allen Bestrebungen sollte die Einheitlichkeit<br />
der Durchführung der Liegenschaftsvermessung,<br />
der Dokumentation und der Beurteilungskriterien<br />
bei der Übernahmeprüfung<br />
gleichermaßen berücksichtigt werden. Nur so<br />
lässt sich durchgehende Transparenz in der<br />
Dokumentation und der Beurteilung der<br />
Ergebnisse der Liegenschaftsvermessung als<br />
Voraussetzung für eine insgesamt wirtschaftliche<br />
optimierte Bearbeitung erreichen.<br />
4.4 Gedanken zur Ausgleichungsrechnung<br />
Der Ausgleichung kommt nach Anlage 3 des<br />
Einführungserlasses ETRS89/UTM eine herausgehobene<br />
Bedeutung als Auswertemethode<br />
für Liegenschaftsvermessungen zu. Dort wird<br />
sie als Standardmethode etabliert. Neben dieser<br />
Standardmethode werden Ausnahmebedingungen<br />
definiert, unter denen weiterhin auch<br />
48<br />
hierarchisch bzw. linear ausgewertet werden<br />
darf. Diese Regeln gelten zukünftig auch für<br />
die Bearbeitung von Liegenschaftsvermessungen,<br />
für die ein Anschluss an das ETRS89 über<br />
SAPOS ® oder ein qualifiziertes Anschlusspunktfeld<br />
benötigt werden. Um die Privilegierung<br />
der Ausgleichungsrechnung verständlich<br />
zu machen, müssen die Vor- und Nachteile der<br />
einzelnen Berechnungsmethoden abgewogen<br />
werden.<br />
Die hierarchische oder lineare Auswertemethode<br />
hat eine lange Tradition in der Liegenschaftsvermessung.<br />
Dies liegt in den klassischen<br />
hierarchisch geprägten Aufnahmemethoden<br />
(Orthogonal- und Einbindeverfahren)<br />
begründet. Der Grundsatz „Vom Großen<br />
ins Kleine“ wird dabei streng umgesetzt. Die<br />
angebotenen Softwaresysteme haben über die<br />
Jahrzehnte ein hohes Maß an Bedienungsergonomie<br />
entwickelt. Seit der Einführung der<br />
tachymetrischen Aufmessungsmethode in das<br />
Liegenschaftskataster ergibt sich die Berechnungshierarchie<br />
nicht immer eindeutig aus der<br />
Aufmessung. Polare Messelemente stehen teilweise<br />
in Konkurrenz zu orthogonalen Messelementen<br />
oder werden voneinander abgeleitet.<br />
Die Auswertung und Prüfung müssen mit<br />
deutlich mehr Sachverstand und damit Aufwand<br />
durchgeführt werden. Das Berechnungsergebnis<br />
ist unter anderem von der individuellen<br />
Reihenfolge der Auswertung abhängig.<br />
Gleichwohl ist die hierarchische Auswertemethode<br />
heute noch die Übliche – ein tradierter<br />
Standard.<br />
Gegen diese Tradition hat es jede alternative<br />
Auswertemethode schwer, insbesondere wenn<br />
sie sich von der Bedienungs- und Beurteilungsergonomie<br />
der Softwarerealisierungen<br />
schlechter darstellt. Darüber hinaus ist bei<br />
Anwendung der Ausgleichung ein Mindestmaß<br />
an Vorkenntnissen in Fehlerlehre und Ausgleichungsrechnung<br />
notwendig. Für die<br />
Durchführung einer ersten Ausgleichung eines<br />
Projektes lassen sich zwar Prozeduren entwickeln,<br />
jedoch ist danach das Ergebnis mit<br />
Sachverstand zu prüfen und gegebenenfalls<br />
einem modifizierten Berechnungslauf zuzuführen.<br />
Um diesen Sachverstand herzustellen,<br />
werden Erfahrungen und Grundlagen benötigt,<br />
die bei vielen beteiligten Dienststellen zu-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
nächst intensiv erarbeitet oder in Fortbildungen<br />
erworben werden müssen. Darüber hinaus<br />
muss i.d.R. ein neuer Datenfluss realisiert werden.<br />
Diese Investitionen darf man nicht unterschätzen,<br />
sie belasten von vornherein die<br />
Bilanz.<br />
Sind die Arbeitsabläufe neu organisiert und auf<br />
die Ausgleichungsrechnung ausgerichtet, so<br />
ergeben sich Vorteile, die nicht von der Hand<br />
zu weisen sind. So ist keine Reihenfolge der<br />
Berechnung einzelner Messelemente festzulegen.<br />
Alle Messelemente werden über automatisierte<br />
Prozeduren der Berechnung in der richtigen<br />
Reihenfolge zugeführt. Eine interaktive<br />
Tätigkeit während der Berechnung entfällt<br />
vollständig. Ebenso entfällt die individuelle<br />
Prüfung der Berechnungsfolge bei der Beurteilung<br />
der Berechnungsergebnisse. Vermessungsstelle<br />
und Katasterbehörde bekommen<br />
anhand weniger statistischer Beurteilungsparameter,<br />
die in einer Liste zusammengefasst<br />
werden können (Blatt G, Anlage 6, Einführungserlass<br />
ETRS89/UTM), einen schnellen<br />
Überblick über den Erfolg der Berechnung.<br />
Die Vermessungsstelle kann bis zur Abgabe<br />
die ggf. ausgewiesenen „groben Fehler“ beseitigen<br />
oder kommentieren. Dies lässt sich ebenfalls<br />
in dem oben genannten Listenprotokoll<br />
zusammenfassen. So ist zu überlegen, ob einer<br />
Auswertung durch Ausgleichungsrechnung<br />
überhaupt ein langschriftliches Protokoll der<br />
Berechnung beigefügt werden muss. Denn bei<br />
Übernahmefähigkeit der Vermessungsschriften<br />
dürften dort keine beurteilungsrelevanten<br />
Inhalte mehr dokumentiert sein. Wie aus diesen<br />
Ausführungen geschlossenen werden<br />
kann, ist der Dokumentations- und Berechnungsaufwand<br />
einer Ausgleichungsrechnung<br />
unabhängig vom Umfang der Vermessung<br />
weitgehend konstant. Dies steht einer annähernd<br />
linearen Entwicklung des Aufwandes<br />
bei einer hierarchisch/linearen Berechnungsmethode<br />
gegenüber. Mitunter wächst der Beurteilungsaufwand<br />
einer hierarchisch/linearen<br />
Berechnung ab einer gewissen Größe exponential,<br />
da die einzelnen Abhängigkeiten der<br />
Messelemente nur noch schwer im Überblick<br />
zu halten sind. Diese Eigenschaft verschafft<br />
der Ausgleichungsrechnung ab einer bestimmten<br />
Größe einen Vorteil beim Arbeitsaufwand.<br />
Von vielen Stellen wird der konstante Teil des<br />
Arbeitsaufwandes einer Ausgleichungsrechnung<br />
sehr hoch eingeschätzt. Ist aber der<br />
Datenfluss und die Datenaufbereitung mit dem<br />
gleichen Qualitätsstandard eines vergleichbaren<br />
hierarchisch/linearen Berechnungsablaufes<br />
realisiert, so könnte sich der Break-Even<br />
sehr früh einstellen und die Ausgleichungsrechnung<br />
schnell im Vorteil sein. Leider fehlen<br />
für einen fairen Vergleich Softwareprodukte,<br />
die einen vergleichbaren, komfortablen und<br />
allumfassenden Berechnungsablauf realisiert<br />
haben. Eine weitere positive Eigenschaft der<br />
Ausgleichung ist die Anspruchslosigkeit bei<br />
der Kombination unterschiedlicher Messelemente,<br />
wie z.B. in dem Programm Kafka für<br />
Windows 2.0. Mit ihr lassen sich Koordinatenmesswerte,<br />
Tachymetermesswerte, Spannmaße,<br />
orthogonale Elemente und Bedingungen<br />
problemlos gemeinsam verarbeiten und<br />
mit adäquater Gewichtung am Ergebnis beteiligen.<br />
Jedes Element dient dem Ergebnis.<br />
Neben diesen wirtschaftlichen Vorteilen ist das<br />
Argument der Genauigkeitssteigerung durch<br />
Ausgleichungsrechnung nur von nachrangiger<br />
Bedeutung. Ja, es kann sogar gefährlich sein,<br />
da dadurch die Schraube erhöhter Anforderungen<br />
zulasten der Wirtschaftlichkeit wieder in<br />
Gang gesetzt werden kann. Bei einer normalen<br />
Standardliegenschaftsvermessung sind die<br />
Vorteile der Ausgleichung ohnehin mehr theoretischer<br />
Natur. In der Regel führt die hierarchische<br />
Berechnung im Rahmen der angestrebten<br />
Genauigkeit zu gleichwertigen<br />
Ergebnissen.<br />
Die Umstellung vom einem hierarchischen/<br />
linearen Berechnungsablauf zu einer Ausgleichungsrechnung<br />
kommt einem Dogmenwechsel<br />
gleich. Die Hemmnisse sind zu großen Teilen<br />
in der Psyche der Anwender begründet.<br />
Ausgleichung wird bisher mit komplizierten<br />
mathematischen Verfahren und einer Papierflut<br />
von Ergebnisdrucken verbunden, deren<br />
Einsatz sich nur bei komplexen Aufgaben<br />
lohnt. Von dieser Vorstellung muss man sich<br />
heute lösen. Der Anschubaufwand der Ausgleichung<br />
ist zwar groß, das Potenzial für Einsparungen<br />
aber nicht minder. Um zukünftige<br />
Arbeitsabläufe wirtschaftlich zu gestalten, sind<br />
aber auf jedem Fall auch die Dokumentations-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 49
formen der Berechnung zu überdenken und<br />
anzupassen. Denn der Status Quo berechtigt<br />
nicht neue Darstellungsformen abzulehnen.<br />
Die Ausgleichungsrechnung kann dazu einen<br />
schönen Beitrag leisten.<br />
5 Fazit<br />
Der Einsatz von SAPOS ® bei Liegenschaftsvermessungen<br />
erschließt gegenüber der herkömmlichen<br />
Arbeitsweise ein erhebliches<br />
Einsparpotential ganz im Sinne der Verwaltungsmodernisierung.<br />
Voraussetzung ist, dass<br />
die wirtschaftlichen Vorteile konsequent genutzt<br />
und nicht durch erhöhte Anforderungen<br />
kompensiert werden. Neben der Optimierung<br />
der Arbeitsabläufe liegt das größte Potential in<br />
der Optimierung der Zusammenarbeit zwischen<br />
Katasterbehörden und Vermessungsstellen.<br />
Für Land und Kommunen bringt SAPOS ®<br />
bereits durch den Wegfall des Festpunktfeldes<br />
erhebliche Einsparungen. Für die Vermessungsstelle<br />
wird durch SAPOS ® die Zugangsschwelle<br />
zur satellitengeodätischen Messung<br />
gesenkt, da nur noch ein Empfänger erforderlich<br />
ist. Weiterhin ergeben sich erhebliche Vorteile<br />
bei der Durchführung der Messung wie<br />
z.B. durch einfacheres Aufsuchen von Punkten,<br />
einfacheren Anschluss ans Landesnetz und<br />
weitgehende Unabhängigkeit von der Topografie.<br />
In Anbetracht des Lagebezugswechsels der<br />
Nachweise des Liegenschaftskatasters nach<br />
ETRS89/UTM werden sich die Vorteile des<br />
koordinatenbasierten Arbeitens zukünftig verstärkt<br />
bemerkbar machen. Da durch jede Fortführungsvermessung<br />
mit SAPOS ® ein Stück<br />
Koordinatenkataster entsteht, wird die besonders<br />
wirtschaftliche Grenzuntersuchung durch<br />
Koordinatenvergleich verstärkt zur Anwendung<br />
kommen können.<br />
Da Tachymeter- und GPS-Messung weitgehend<br />
ausgereizt sind, liegt in der nahen Zukunft<br />
Entwicklungspotential in der integrierten<br />
Anwendung von SAPOS ® - und Tachymetermessungen.<br />
Die Chance für einen wirklich bedeutenden<br />
Entwicklungsschub sieht die Arbeitsgemein-<br />
50<br />
schaft in einer ganzheitlichen Lösung für den<br />
Gesamtvorgang Liegenschaftsvermessung<br />
unter Einbeziehung der Möglichkeiten der grafischen<br />
Datenverarbeitung und der modernen<br />
Nachrichtentechnik: Ein optimierter digitaler<br />
Workflow von der Bereitstellung der Vermessungsunterlagen<br />
über die Vorbereitung des<br />
Außendienstes und die komplette Auswertung<br />
der Messung bis hin zur Erzeugung von digitalen<br />
Fortführungsdatensätzen, die von den<br />
Katasterbehörden mit entsprechender Prüfsoftware<br />
geprüft und in den Nachweis übernommen<br />
werden. Unter Nutzung des webbasierten<br />
Datentransfers und durch Einsatz<br />
grafikfähiger digitaler Feldbücher wäre insgesamt<br />
ein beträchtlicher Rationalisierungserfolg<br />
möglich.<br />
Allerdings setzt das einheitliche Arbeitsabläufe<br />
und Datenstrukturen voraus. Die von dem<br />
AdV-Arbeitskreis Liegenschaftskataster entwickelte<br />
Idee, statt eine Dokumentation vorzuschreiben<br />
eine logische Datenstruktur zu<br />
entwickeln, auf deren Grundlage ein kompletter<br />
Datenfluss realisiert werden könnte, ist<br />
daher zukunftweisend. Nach Auffassung der<br />
Arbeitsgemeinschaft „Anwendung satellitengeodätischer<br />
Verfahren“ könnte dieser Ansatz<br />
eingebettet in ein einheitliches Konzept für<br />
NRW der entscheidende Modernisierungsansatz<br />
sein. Die Erfahrungen mit der Anlage 4<br />
der GPS-Richtlinien sind ermutigend, denn sie<br />
haben gezeigt, dass der Wille zur Standardisierung<br />
in der Fachwelt durchaus vorhanden<br />
ist. Ansonsten ist zu befürchten, dass die uns<br />
allen geläufigen Zentrifugalkräfte des kommunalisierten<br />
und privatisierten Liegenschaftskatasters,<br />
wie wir sie aus den zurückliegenden<br />
Jahrzehnten nur zu gut kennen, auch<br />
hier in kontraproduktiver Weise wirksam werden,<br />
indem eine Vielzahl nicht kompatibler<br />
Einzellösungen entsteht.<br />
Literaturangaben:<br />
[1] AG „Anwendung satellitengeodätischer Verfahren“<br />
bei der <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong>: Handbuch<br />
I „Auswertung von SAPOS ® -Messungen im<br />
Kataster“, Neuauflage von August 2004<br />
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/html/organisation/abt3/dez33/03330201.html<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
2] AG „Anwendung satellitengeodätischer Verfahren“<br />
bei der <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong>: Handbuch<br />
II „Arbeitsabläufe bei Liegenschaftsvermessungen<br />
mit SAPOS ® “, Auflage von Februar 2005<br />
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/html/organisation/abt3/dez33/03330202.html<br />
[3] AG „Anwendung satellitengeodätischer Verfahren“<br />
bei der <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong>: Vorträge<br />
der AG im Rahmen der Informationsveranstaltung<br />
am 15.03.<strong>2006</strong> bei der <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong><br />
http://www.bezreg-koeln.nrw.de<br />
[4] Innenministerium NRW: Einführung des<br />
Europäischen Terrestrischen Referenzsystems 1989<br />
mit Universaler Transversaler Mercator Abbildung<br />
(ETRS89/UTM) als amtliches Bezugssystem für das<br />
Liegenschaftskataster in NRW – Einführungserlass<br />
ETRS89/UTM vom 09.08.2004<br />
http://www.lverma.nrw.de/aufgaben/entwicklung/et<br />
rs89/ALK_ETRS89.htm#<br />
[5] Innenministerium NRW: Gesetz über die Landesvermessung<br />
und das Liegenschaftskataster – Vermessungs-<br />
und Katastergesetz (VermKatG NRW)<br />
vom 01.03.2005, in Kraft getreten am 23.03.2005<br />
(GV.NRW.2005 S. 174, SGV.NRW.7134)<br />
1 Einleitung<br />
Katholische und evangelische Kirchengemeinden<br />
nehmen wie natürliche und andere juristische<br />
Personen am Rechtsverkehr teil und können<br />
insbesondere auch Eigentümer von<br />
Grundstücken sein. Für den Fall, dass im<br />
Grundbuch als Eigentümer eines Grundstücks<br />
eine Kirchengemeinde, ein kirchliches Institut<br />
oder andere kirchliche Körperschaften des<br />
öffentlichen Rechts eingetragen sind, stellt sich<br />
die Frage, wer im Grenztermin die zur Feststellung<br />
der Grundstücksgrenzen notwendigen<br />
Anerkennungserklärungen abgeben darf und<br />
wem die Abmarkung bekannt gegeben wird<br />
(§ 21 Abs. 2 VermKatG NRW).<br />
Das VermKatG NRW stellt dabei spezialgesetzlich<br />
in § 21 Abs. 1 VermKatG NRW auf<br />
[6] Innenministerium NRW: Richtlinien zum Einsatz<br />
von satellitengeodätischen Verfahren im Vermessungspunktfeld<br />
– GPS-Richtlinien in der Fassung<br />
vom 15.04.2003; Landesvermessungsamt<br />
NRW, Bonn<br />
http://www.lverma.nrw.de/produkte/druckschriften/verwaltungsvorschriften/images/gps/GPS_<br />
Richtlinien_23_09_05_text.pdf<br />
Bildnachweise:<br />
[Abb. 7, 9 (Montage)]: Leica Geosystems AG, (mit<br />
freundlicher Genehmigung vom 9. Januar <strong>2006</strong>);<br />
www.leica-geosystems.com<br />
[Abb. 8 (Montage), 10]: Trimble Navigation Limited,<br />
(mit freundlicher Genehmigung vom 29.<br />
Dezember 2005); www.trimble.com<br />
Wolfgang Kuttner<br />
Katja Nitzsche<br />
Peter Reifenrath<br />
<strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong><br />
Zeughausstr. 10-12, 50606 <strong>Köln</strong><br />
E-Mail:<br />
wolfgang.kuttner@bezreg-koeln.nrw.de<br />
katja.nitzsche@bezreg-koeln.nrw.de<br />
peter.reifenrath@bezreg-koeln.nrw.de<br />
Zur Vertretung von Kirchengemeinden im Grenzfeststellungs- und<br />
Abmarkungsverfahren<br />
Von Markus Rembold<br />
einen materiellen Beteiligtenbegriff ab und<br />
legt nicht den (allgemeineren) formellen Beteiligtenbegriff<br />
nach § 13 VwVfG NRW zugrunde<br />
(Simmerding 2000, S. 43 ff; Landtag NRW<br />
1990, S. 31).<br />
Als Körperschaften des öffentlichen Rechts<br />
sind die Kirchen und ihre einzelnen Untergliederungen<br />
als solche nicht verfahrenshandlungsfähig,<br />
sondern werden durch besonders<br />
Beauftragte vertreten (organschaftliche Vertretung;<br />
Kopp/Ramsauer 2003, S. 204). Wer die<br />
unterschiedlichen kirchlichen Körperschaften<br />
vertreten darf, ergibt sich aus dem jeweils geltenden<br />
Kirchenrecht bzw. Staatskirchenrecht.<br />
Im folgenden werden für<br />
� die katholische Kirche und<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 51
� die Evangelische Kirche im Rheinland, die<br />
Evangelische Kirche von Westfalen sowie<br />
die Lippische Landeskirche<br />
im Landesgebiet von Nordrhein-Westfalen die<br />
im (Staats-)Kirchenrecht enthaltenen Vertretungs-,<br />
Form- und Genehmigungserfordernisse<br />
zur Abgabe wirksamer Verpflichtungserklärungen<br />
im Grenzfeststellungs- und Abmarkungsverfahren<br />
erörtert. Der Schwerpunkt<br />
liegt dabei auf der Darstellung der Vertretungsregelungen<br />
der Kirchengemeinden auf<br />
Ortskirchenebene. Eine Übersicht über die<br />
deutschlandweit bestehenden Vertretungsregelungen<br />
von Kirchengemeinden findet sich beispielsweise<br />
für die Evangelischen Landeskirchen<br />
bei (Scheffler, 1977) und für die<br />
katholische Kirche bei (Loggen, 1990) und<br />
(Busch, 1995).<br />
2 Verpflichtungserklärungen und<br />
Geschäfte der laufenden Verwaltung<br />
Die Vertretung von Kirchen ist auf der Ebene<br />
der Kirchengemeinden angelehnt an die bei<br />
den politischen Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />
vorhandenen Regelungen, wie sie beispielsweise<br />
für Gemeinden in § 64 GO NRW<br />
und für Kreise in § 43 KrO NRW manifestiert<br />
sind. Unterschieden wird in der Regel zwischen<br />
Verpflichtungserklärungen bzw. rechtsverbindlichen<br />
Erklärungen einerseits und<br />
Geschäften der laufenden Verwaltung andererseits.<br />
Analog zu den politischen Gemeinden<br />
und Gemeindeverbänden stehen auch bei den<br />
Kirchengemeinden nur diejenigen Willenserklärungen<br />
unter dem Wirksamkeitsvorbehalt<br />
bestimmter Form- und Vertretungsvorschriften,<br />
die die Gemeinde „verpflichten“ bzw. die<br />
im Gesetz als „rechtsverbindliche Erklärungen“<br />
bezeichnet sind, wobei im Vergleich zu<br />
den politischen Gemeinden „verschärfte<br />
Sicherheitsvorkehrungen“ zum Schutz des<br />
Kirchenvermögens auffallen (Zilles/Kämper<br />
1994, S. 111).<br />
Verpflichtungserklärungen sind begrifflich<br />
alle abgegebenen Willenserklärungen im Rahmen<br />
des öffentlich-rechtlichen oder bürgerlich-rechtlichen<br />
Rechtsverkehrs, die eine<br />
rechtliche Verpflichtung der jeweiligen Kör-<br />
52<br />
perschaft zum Ziel haben und die nicht ausschließlich<br />
unmittelbare Rechtswirkungen<br />
erzeugen (Kirchhof 2004, Erl. zu § 43, S. 2).<br />
Als Erklärungen, durch welche die Gemeinde<br />
verpflichtet werden soll, sind Erklärungen<br />
anzusehen, die darauf abzielen, eine Verpflichtung<br />
einzugehen (Held et al. 2004, Erl.<br />
zu § 64, S. 1). Zu den Verpflichtungserklärungen<br />
zählt demnach das Eingehen von Verträgen<br />
jeder Art (Wenner 1954, S. 74; Fritz 1983,<br />
S. 128 ff), nicht aber dingliche Rechtsgeschäfte<br />
wie zum Beispiel die Auflassung von<br />
Grundstücken (Kirchhof 2004, Erl. zu § 43,<br />
Seite 2).<br />
Die gemäß § 21 Abs. 2 VermKatG NRW zur<br />
Feststellung von Grundstücksgrenzen notwendigen<br />
Anerkennungserklärungen sind regelmäßig<br />
als Verpflichtungserklärungen zu betrachten,<br />
da die Anerkennung des Ergebnisses<br />
der Grenzermittlung eine Willenserklärung der<br />
Betroffenen in der Art darstellt, dass der in der<br />
Grenzverhandlung ermittelte Grenzverlauf als<br />
so vereinbart anerkannt wird; die Willenserklärungen<br />
werden von der Vermessungsbehörde<br />
protokollmäßig festgehalten und münden in<br />
einen Grenzfeststellungsvertrag zwischen den<br />
Beteiligten (vgl. Urteil des OVG NRW vom<br />
12.02.1992 - 7 A 1910/89, besprochen in Mattiseck/Meier<br />
1993 und Mattiseck 1999). Die<br />
Verbindlichkeit der getroffenen Feststellung<br />
über den Grenzverlauf erfolgt durch Willensbildung<br />
der Betroffenen (vgl. Urteil des OVG<br />
NRW vom 06.02.1985 - 7A 3129/83). Was für<br />
den eigentlichen Grenzfeststellungsvertrag<br />
gilt, ist auch auf die Zustimmung zur Abmarkung<br />
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 VermKatG<br />
NRW) oder amtlichen Bestätigung (§ 20 Abs.<br />
1 Sätze 2 und 3 VermKatG NRW) von Grundstücksgrenzen<br />
anwendbar (Bengel/Simmerding<br />
2000, Seite 405 ff). Die Anerkennung der<br />
Abmarkung ist jeweils eine öffentlich-rechtliche<br />
Willenserklärung, gerichtet an die Vermessungsbehörde<br />
(Häde 1993, S. 308).<br />
Der von (Suckow, 1917, S. 49; 1930, S. 20)<br />
vertretenen Meinung, es handele sich bei der<br />
Grenzanerkennung nur dem Sprachgebrauch<br />
nach um die Übernahme einer Verpflichtung,<br />
ist nicht zuzustimmen. Auch wenn durch den<br />
Grenzfeststellungsvertrag jeder der Beteiligten<br />
lediglich das erhält, was ihm gebührt (Ben-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
gel/Simmerding 2000, S. 399), und demzufolge<br />
kein Eigentum übertragen wird, besteht die<br />
Verpflichtung gerade darin, bindendes Recht<br />
für den Grenzverlauf für die Zukunft zu schaffen<br />
(Bengel/Simmerding 2000, S. 405).<br />
Dass die zur Feststellung, Abmarkung oder<br />
amtlichen Bestätigung von Grundstücksgrenzen<br />
notwendigen Anerkennungserklärungen<br />
als rechtsverbindliche Erklärungen zu qualifizieren<br />
sind, ergibt sich unmittelbar aus den<br />
vorigen Ausführungen.<br />
Es darf angemerkt werden, dass für die bestehenden<br />
Formvorschriften zur Vertretung des<br />
Kirchenvermögens es letztendlich unerheblich<br />
ist, ob die Grenzfeststellung als privatrechtlicher<br />
Vertrag (vgl. o.g. Urteile des OVG NRW),<br />
als Vertrag bzw. Verfahren sui generis (Bengel/Simmerding<br />
2000, Seite 404; Mattiseck<br />
1999, Seite 78) oder als qualifizierter verfahrensrechtlicher<br />
Mitwirkungsakt in Form einer<br />
öffentlich-rechtlichen Erklärung (Zachert<br />
2005, Seite 192) anzusehen ist.<br />
Für Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten<br />
die Formvorschriften, wie sie für Verpflichtungserklärungen<br />
bzw. als „rechtsverbindlich“<br />
bezeichnete Erklärungen bestehen, nicht; die<br />
Gemeinden werden insoweit durch eine formlose<br />
Erklärung des jeweiligen Organs verpflichtet.<br />
Der Begriff „Geschäfte der laufenden<br />
Verwaltung“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff,<br />
der in vollem Umfang von den Verwaltungsgerichten<br />
nachgeprüft werden kann (Held<br />
et al. 2004, Erl. zu § 41, S. 9). Geschäfte der<br />
laufenden Verwaltung sind solche, die mit<br />
gewisser Regelmäßigkeit wiederkehren, nicht<br />
von besonderer Bedeutung für die Gemeinde<br />
sind, und deren Erledigung nach feststehenden<br />
Grundsätzen und auf eingefahrenen Gleisen<br />
erfolgt; die Ausfüllung des Begriffs ist dabei<br />
von der Größe und dem Aufgabenbestand der<br />
Gemeinde abhängig. Dabei kommt es auch<br />
nicht auf die rechtliche oder tatsächliche<br />
Schwierigkeit der Angelegenheit an (Kirchhof<br />
et al. 2004, Erl. zu § 42, S. 2; Schilberg 2003,<br />
S. 63). Teilweise wird auch der Begriff des<br />
„einfachen Geschäftes der laufenden Verwaltung“<br />
verwendet (vgl. Art. 30 Abs. 2 KO<br />
EKiR). Das beigefügte Adjektiv „einfach“<br />
bedeutet hierbei keine Einengung des Bedeu-<br />
tungsinhaltes, sondern nur eine Umschreibung<br />
des Begriffs, die die Möglichkeit unschwieriger<br />
Erledigung als ein Merkmal betonen will<br />
(Eckhardt 1961, S. 84).<br />
Der Vorsitzende des jeweiligen Organs entscheidet<br />
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob<br />
ein Rechtsgeschäft oder ein Verwaltungsvorgang<br />
zu einem Geschäft der laufenden Verwaltung<br />
gehört oder nicht (Loggen 1990, S. 348;<br />
Kirchhof 2004, Erl. zu § 42, S. 3). Dabei kann<br />
nur vom Standpunkt der innergemeindlichen<br />
Organisation aus beurteilt werden, ob ein<br />
Geschäft der laufenden Verwaltung vorliegt,<br />
keinesfalls aber aus der Sicht des jeweiligen<br />
Geschäftspartners der Gemeinde (Fritz 1983,<br />
Seite 149).<br />
3 Katholische Kirche<br />
Gesetzliche Grundlage für die kirchliche Vermögensverwaltung<br />
ist das Gesetz über die Verwaltung<br />
des katholischen Kirchenvermögens<br />
vom 24.07.1924, im folgenden als Vermögensverwaltungsgesetz,<br />
kurz VVG bezeichnet;<br />
das Vermögensverwaltungsgesetz gilt in Nordrhein-Westfalen<br />
als Landesrecht fort (§ 4 Nr. 6<br />
des Gesetzes zur Bereinigung des in Nordrhein-Westfalen<br />
geltenden preußischen Rechts<br />
vom 07.11.1961, GV. NRW. S. 325, siehe auch<br />
Loggen 1990, S. 136 ff). Da die rechtliche Ordnung<br />
der Vermögensverhältnisse zu den der<br />
Kirche eigenen Angelegenheiten gehört, fällt<br />
diese eigentlich unter das durch Art. 140 GG<br />
i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV garantierte Selbstbestimmungsrecht<br />
der Kirchen. Das Vermögensverwaltungsgesetz,<br />
das historisch auf die<br />
preußische Kulturkampfgesetzgebung zurückzuführen<br />
ist und nunmehr gewohnheitsrechtliche<br />
Geltung erlangt hat, stellt kirchenrechtlich<br />
somit eine sogenannte lex canonizata, eine<br />
vom kirchlichen Recht übernommene Bestimmung<br />
staatlichen Rechts dar (Loggen 1990, S.<br />
140 ff, Bauschke 2003, Seite 18). Diese<br />
Rechtslage besteht kraft Gewohnheitsrechts<br />
auch im Bereich des ehemaligen Landes Lippe,<br />
das ursprünglich nicht zum Geltungsbereich<br />
des Vermögensverwaltungsgesetzes<br />
gehörte (Bauschke 2003, S. 34). Das Vermögensverwaltungsgesetz<br />
regelt in formeller<br />
Hinsicht die Vermögensverwaltung<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 53
� in den Einzelgemeinden (Kirchengemeinden,<br />
§§ 1 - 21 VVG),<br />
� in den Gemeindeverbänden (§§ 22 - 27<br />
VVG),<br />
� der Diözesen (§ 28 VVG).<br />
In Nordrhein-Westfalen bestehen dabei die<br />
Erzdiözesen Paderborn und <strong>Köln</strong>; das Erzbistum<br />
<strong>Köln</strong> umfasst dabei in Nordrhein-Westfalen<br />
die Diözesen Aachen, Essen und Münster.<br />
Die Diözesen und Erzbistümer sind wie die<br />
dazu gehörigen Kirchengemeinden und<br />
Gemeindeverbände jeweils Körperschaften<br />
des öffentlichen Rechts (Art. 140 GG i.V.m.<br />
Art. 137 Abs. 5 WRV und Art. 13 RK).<br />
3.1. Kirchengemeinde<br />
Nach § 1 Abs. 1 VVG verwaltet der Kirchenvorstand<br />
das Vermögen in der Kirchengemeinde;<br />
weiterhin vertritt er die Gemeinde und das<br />
Vermögen. Der Kirchenvorstand ist demnach<br />
das gesetzliche Organ der Kirchengemeinde,<br />
durch den sie sich – als juristische Person (Körperschaft<br />
öffentlichen Rechts nach staatlichem<br />
Recht) und öffentliche juristische Person des<br />
Kirchenrechts – in Vertragsangelegenheiten<br />
äußern und dessen sie sich bei der Verwaltung<br />
des örtlichen Vermögens bedienen muss (Emsbach<br />
2000, S. 121; Bauschke 2003, S. 29).<br />
Das in § 1 Abs. 1 VVG genannte „Vermögen in<br />
der Kirchengemeinde“ besteht im wesentlichen<br />
aus dem Vermögen der Kirchengemeinde<br />
als Körperschaft des öffentlichen Rechts<br />
(Bezeichnung im Grundbuch zum Beispiel<br />
„Pfarrgemeinde St. N. in N.“) sowie weiteren<br />
Vermögensmassen, den sogenannten kirchlichen<br />
Institute (Sondervermögen, Fonds), im<br />
Einzelnen<br />
� das Gotteshausvermögen (Bezeichnungen<br />
im Grundbuch: „Fabrikvermögen“, „Fabrikfonds“,<br />
„Kirchenstiftung“ etc.),<br />
� das Stellenvermögen (Bezeichnungen im<br />
Grundbuch: „Benefizium“, „Pfründenvermögen“,<br />
„Pfründenstiftung“, „Pfarrfonds“,<br />
„Vikariefonds“, „Küstereifonds“ etc.),<br />
� das Stiftungsvermögen.<br />
(Wenner 1954, S. 20 ff, Bauschke 2003, S. 29<br />
ff) Die einzelnen kirchlichen Institute sind<br />
nach kanonischem (kirchlichem) und gemei-<br />
54<br />
nem Recht selbständige Rechtsträger; so ist<br />
zum Beispiel das Gotteshausvermögen das<br />
Vermögen, das dem Kirchengebäude als rechtlich<br />
selbständiger Institution gehört (Bauschke<br />
2003, S. 29; zur sogenannten Institutentheorie<br />
siehe Wenner 1954, S. 27 ff).<br />
Die genannten kirchlichen Institute (Sondervermögen,<br />
Fonds) besitzen auch heute noch<br />
Rechtsfähigkeit, wenn sie diese vor Einführung<br />
des Preußischen Allgemeinen Landrechts<br />
besaßen. Dies ist von Bedeutung für<br />
deren Eintragung und Bezeichnung im Grundbuch.<br />
Eine Berichtigung der Eigentümerbezeichnung<br />
durch das Grundbuchamt dahingehend,<br />
dass anstelle der kirchlichen Institute die<br />
Kirchengemeinde als Eigentümerin eingetragen<br />
wird, führt dazu, dass das Grundbuch<br />
unrichtig wird (Beschluss des OLG Hamm 15<br />
W 462/65 vom 19.12.1967, enthalten in Althaus<br />
2004, S. 502 ff). Auch die Verwaltung<br />
und Vertretung der kirchlichen Institute fällt<br />
nach § 1 Abs. 2 VVG in die Zuständigkeit des<br />
Kirchenvorstands.<br />
Das Stellenvermögen nimmt unter den<br />
genannten kirchlichen Instituten eine gewisse<br />
Sonderstellung ein; es ist vergleichbar mit<br />
einem Nießbrauchrecht nach bürgerlichem<br />
Recht, das originär dem jeweiligen Pfarrer der<br />
Kirchengemeinde zusteht. Aus dem Nutzungsrecht<br />
des Pfarrers folgt für den Kirchenvorstand<br />
eine Einschränkung seiner Verwaltungsbefugnisse.<br />
Das Vermögensverwaltungsgesetz<br />
bestimmt in § 1 Abs. 3 ausdrücklich, dass die<br />
Rechte der Kirchendiener an den zu ihrer<br />
Besoldung bestimmten Vermögensstücken<br />
durch dass VVG nicht berührt werden (Emsbach<br />
2000, S. 65). Über das Stellenvermögen<br />
darf jedoch der Pfarrer selbst nicht verfügen,<br />
da nicht er, sondern die Pfründe an sich<br />
Eigentümerin des Vermögens ist (Bauschke<br />
2003, S. 30). Die Zuständigkeit zur rechtlichen<br />
Verfügung über das Stellenvermögen liegt wiederum<br />
beim Kirchenvorstand (Emsbach 2000,<br />
Seite 65).<br />
Die Willenserklärungen des Kirchenvorstands<br />
verpflichten die Gemeinde und die vertretenden<br />
Vermögensmassen nur dann, wenn sie der<br />
Vorsitzende (i.d.R. der Pfarrer, § 2 Abs. 1<br />
VVG) oder sein Stellvertreter sowie zwei Mit-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
glieder schriftlich unter Beidrückung des<br />
Amtssiegels abgeben (§ 14 Satz 2 VVG). Bei<br />
dem Amtssiegel handelt es sich um das Kirchenvorstandssiegel<br />
(Umschrift: Kath. Kirchenvorstand<br />
St. N. zu (in) N.) und nicht um<br />
das Siegel der Kirchengemeinde, etwa das<br />
Pfarrsiegel (Umschrift: Sigillum Ecclesiae ad<br />
s. N. in N. oder Katholische(s) Kirchengemeinde/Pfarramt<br />
St. N zu (in) N. o.ä.; siehe<br />
auch Emsbach 2000, S. 95; Bauschke 2003,<br />
S. 96; Althaus 2004, S. 460). Zudem wird in<br />
den Geschäftsanweisungen für die Verwaltung<br />
des Kirchenvermögens, die die bischöfliche<br />
Behörde aufgrund der Ermächtigung in § 21<br />
Abs. 1 VVG erlassen hat, nochmals ausdrücklich<br />
klargestellt, dass Willenserklärungen des<br />
Kirchenvorstandes vom Vorsitzenden oder seinem<br />
Stellvertreter und zwei Mitgliedern<br />
schriftlich unter Beidrückung des Kirchenvorstandssiegels<br />
abgegeben werden, so zum Beispiel<br />
Art. 9 der Geschäftsanweisung für die<br />
Verwaltung des Vermögens in den Kirchengemeinden<br />
und Gemeindeverbänden der Erzdiözese<br />
<strong>Köln</strong> (abgedruckt in Emsbach 2000,<br />
S. 146 ff; für das Erzbistum Paderborn siehe<br />
Bauschke 2003, S. 127 ff; Althaus 2004,<br />
S. 397 ff).<br />
(Loggen 1990, S. 347) führt dazu aus, dass in<br />
der täglichen Verwaltungspraxis nahezu alle<br />
Geschäfte rechtsverbindliche Verpflichtungen<br />
zum Gegenstand haben und dementsprechend<br />
der Form des § 14 Satz 2 VVG bedürfen. Das<br />
Vermögensverwaltungsgesetz kennt dabei<br />
nicht den Begriff des Geschäftes der laufenden<br />
Verwaltung, so dass die beschriebenen formalen<br />
Anforderungen für alle Verpflichtungserklärungen<br />
gelten, also auch für solche<br />
Erklärungen, die ansonsten als Geschäft der<br />
laufenden Verwaltung anzusehen sind.<br />
Die Regelung des § 14 Satz 2 VVG bezieht sich<br />
dabei auf alle Willenserklärungen, also nicht<br />
nur auf die Fälle, wo schon nach bürgerlichen<br />
Recht die Schriftform verlangt wird (Wenner<br />
1954, S. 73). Wenn die Kirchengemeinde eine<br />
Willenserklärung abzugeben hat, ist die Form<br />
auch dann zu beachten, wenn die Erklärung<br />
nicht schriftlich im eigentlich Sinne, sondern<br />
in öffentlich beurkundeter Form – wie der<br />
Grenzniederschrift – abgegeben wird (Wenner<br />
1954, S. 75).<br />
Falls eine solche Willenserklärung des Kirchenvorstands<br />
in der Form des § 14 Satz 2<br />
VVG vorliegt, ist damit nach außen hin unwiderlegbar<br />
festgestellt, dass sie ordnungsgemäß<br />
durch einen entsprechenden Beschluss des<br />
Kirchenvorstandes zustande gekommen ist<br />
(Wenner 1954, S. 73, vgl. § 14 Abs. 3 VVG).<br />
Für Willenserklärungen ist somit einerseits die<br />
Form des § 14 Satz 2 VVG erforderlich, andererseits<br />
aber auch ausreichend; der Pfarrer als<br />
Vorsitzender des Kirchenvorstandes ist demzufolge<br />
zunächst nicht befugt, die Gemeinde<br />
und ihr Vermögen alleine zu vertreten.<br />
Die genannten Form- und Zuständigkeitsvorschriften<br />
des § 14 Abs. 2 VVG gelten auch für<br />
die zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen<br />
erteilten Vollmachten, weil ansonsten der<br />
Schutzzweck des § 14 Abs. 2 VVG unterlaufen<br />
würde (Marx 1974, S. 68; Fritz 1983, S. 145;<br />
Busch 1995, S. 963; vgl. für politische<br />
Gemeinden § 64 Abs. 3 GO NRW, § 43 Abs. 3<br />
KrO NRW); diese gelten somit uneingeschränkt<br />
auch für Vollmachten (Spezial- oder<br />
Gattungsvollmacht), mit denen eine natürliche<br />
Person (im Einzelfall oder dauernd) bevollmächtigt<br />
wird, die Kirchengemeinde als Körperschaft<br />
öffentlichen Rechts oder die kirchlichen<br />
Institute im Grenztermin zu vertreten und<br />
die zur Feststellung, Abmarkung oder amtlichen<br />
Bestätigung der Grundstücksgrenzen<br />
notwendigen Anerkennungserklärungen abzugeben<br />
(vgl. § 21 Abs. 2 VermKatG NRW).<br />
Die Erteilung einer Gattungsvollmacht bedarf<br />
zu ihrer Rechtsgültigkeit zudem der Genehmigung<br />
der Erzbischöflichen Behörde (Generalvikariat),<br />
vgl. zum Beispiel Art. 7 Nr. 1 lit. n<br />
der Geschäftsanweisung für die Verwaltung<br />
des Vermögens in den Kirchengemeinden und<br />
Gemeindeverbänden des Erzbistums Paderborn<br />
(Bauschke 2003, S. 127 ff; Althaus 2004,<br />
S. 397 ff; siehe auch Bekanntmachung vom<br />
02.03.2003 zur Ausführung des Gesetzes über<br />
die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens<br />
vom 24.07.1924, GV. NRW. S. 215).<br />
Die vom Kirchenvorstand ohne Genehmigung<br />
durch die Bischöfliche Behörde getroffenen<br />
Beschlüsse verpflichten die Kirchengemeinde<br />
nicht und sind auch dann unwirksam, wenn der<br />
andere Teil, gegenüber dem der Bevollmächtigte<br />
Erklärungen abgegeben hat, von der<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 55
Beschränkung der Vertretungsmacht keine<br />
Kenntnis hatte (Wenner 1954, Seite 110 ff).<br />
Eine Spezialvollmacht ist gegenüber dem Verhandlungsleiter<br />
durch eine Vollmachtsurkunde<br />
in der Form des § 14 Satz 2 VVG nachzuweisen.<br />
Aus dieser hat hervorzugehen, dass die<br />
natürliche Person unter Bezugnahme auf den<br />
entsprechenden Kirchenvorstandsbeschluss<br />
bevollmächtigt ist, die Kirchengemeinde im<br />
Grenztermin zu vertreten und rechtsverbindliche<br />
Erklärungen zur Feststellung, Abmarkung<br />
oder amtlichen Bestätigung der betreffenden<br />
Grundstücksgrenzen abzugeben. Für den Fall<br />
einer Gattungsvollmacht ist zusätzlich die<br />
Genehmigung der Bischöflichen Behörde<br />
nachzuweisen.<br />
Es sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich<br />
darauf hingewiesen, dass der Pfarrer aufgrund<br />
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des<br />
Kirchenvorstandes oder seiner Amtsstellung<br />
als Leiter der Kirchengemeinde nicht befugt<br />
ist, das ortskirchliche Vermögen alleine, d.h.<br />
ohne entsprechende Vollmacht, zu vertreten.<br />
3.2. Gemeindeverband<br />
Gemäß § 22 Abs. 1 VVG können Kirchengemeinden<br />
zu einem Gemeindeverband zusammengeschlossen<br />
werden, der ganz oder teilweise<br />
die Erfüllung gemeinsamer örtlicher<br />
Aufgaben sowie die Versorgung der Gemeinden<br />
mit äußeren kirchlichen Einrichtungen und<br />
mit Mitteln zur Erfüllung ihrer gesetzlichen<br />
Leistungen übernehmen kann (§ 24 VVG). Der<br />
Gemeindeverband ist wie die Kirchengemeinde<br />
eine Körperschaft öffentlichen Rechts und<br />
kann als juristische Person genau wie diese am<br />
Rechtsverkehr teilnehmen, insbesondere auch<br />
Eigentümer von Grundstücken sein (Emsbach<br />
2000, S. 125). Die Angelegenheiten des Verbandes<br />
werden nach § 25 Abs. 1 VVG von der<br />
Verbandsvertretung wahrgenommen. Diese<br />
kann nach § 26 VVG einen Verbandsausschuss<br />
bestellen, der den Verband vertritt und das Vermögen<br />
nach Maßgabe der Beschlüsse der Verbandsvertretung<br />
verwaltet. Für die Gemeindeverbände<br />
sind die Regelungen des<br />
Vermögensverwaltungsgesetzes – insbesondere<br />
auch §§ 13, 14 VVG – maßgebend (§ 27<br />
VVG). Damit gelten bei der Abgabe von Wil-<br />
56<br />
lenserklärungen für die Gemeindeverbände die<br />
gleichen Vorschriften wie für die Kirchenvorstände<br />
in den Kirchengemeinden (siehe<br />
Abschnitt 3.1). An die Stelle des Vorsitzenden<br />
des Kirchenvorstandes tritt der Vorsitzende der<br />
Verbandsvertretung, der auch gleichzeitig Vorsitzender<br />
des Verbandsausschusses ist.<br />
3.3. Diözese<br />
Die Bistümer, die Bischöflichen Stühle und die<br />
Domkapitel sind jeweils als Körperschaften<br />
des öffentlichen Rechts anerkannt (Busch<br />
1995, S. 960 mit weiteren Nachweisen), vgl.<br />
auch § 28 VVG und Art. 13 RK. Während das<br />
Bistum eine kirchliche Gebietskörperschaft<br />
ist, die von einem mit eigenberechtigter oberhirtlicher<br />
Gewalt ausgestatteten Bischof geleitet<br />
wird, dürfte der Bischöfliche Stuhl – in<br />
Abgrenzung zum persönlichen Vermögen der<br />
Bischöfe – als das Bischöfliche Verwaltungsvermögen<br />
zu kennzeichnen sein (Wenner<br />
1940, S. 252; Marx 1974, S. 62). Für die Vertretung<br />
der Bistümer, Bischöflichen Stühle und<br />
Domkapitel sind die Formvorschriften des § 14<br />
VVG nicht einschlägig (§ 28 Abs. 1 VVG). Die<br />
Bistümer und die Bischöflichen Stühle werden<br />
vielmehr vertreten durch den jeweiligen Diözesanbischof<br />
oder seinen Stellvertreter, den<br />
Generalvikar, die Domkapitel durch den ersten<br />
Dignitär des Kapitels (Dompropst oder Domdekan,<br />
im Einzelnen Marx 1974, S. 57; Bauer/Oefele<br />
1999, S. 658).<br />
4 Evangelische Landeskirchen<br />
Als Evangelische Landeskirchen bestehen in<br />
Nordrhein-Westfalen die Evangelische Kirche<br />
im Rheinland, die Evangelische Kirche von<br />
Westfalen und die Lippische Landeskirche.<br />
Die Evangelische Kirche im Rheinland umfasst<br />
dabei gebietsmäßig im wesentlichen die<br />
Regierungsbezirke Düsseldorf und <strong>Köln</strong>, die<br />
Evangelische Kirche von Westfalen die Regierungsbezirke<br />
Arnsberg, Detmold und Münster<br />
mit Ausnahme des Kreises Lippe.<br />
Im Gegensatz zu der durch das Vermögensverwaltungsgesetz<br />
staatskirchenrechtlich geprägten<br />
Vermögensverwaltung der katholischen<br />
Kirche sind die Regelungen der Evangelischen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Landeskirchen überwiegend kirchenrechtlicher<br />
Natur. Kirchenrecht ist vom Staat unabhängiges,<br />
eigenständiges und eigengeartetes<br />
Recht, das der deutsche Staat aufgrund des<br />
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts (Art.<br />
140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV) innerhalb<br />
der Schranken der für alle geltenden Gesetze<br />
im weltlichen Bereich anerkennt (Schilberg<br />
2003, S. 5). Gesetzliche Grundlage sind die<br />
entsprechenden Kirchenordnungen, im Einzelnen<br />
� die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche<br />
im Rheinland vom 10.01.2003, zuletzt<br />
geändert durch Kirchengesetz vom<br />
14.01.2005 (im folgenden mit KO EKiR<br />
bezeichnet),<br />
� die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche<br />
von Westfalen in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14.01.1999, zuletzt<br />
geändert durch Kirchengesetz vom<br />
14.11.2002 (im folgenden mit KO EKvW<br />
bezeichnet),<br />
� die Verfassung der Lippischen Landeskirche<br />
vom 17.02.1931 in der Fassung des Kirchengesetzes<br />
vom 23.11.1998, zuletzt<br />
geändert durch Kirchengesetz vom<br />
23.11.2004 (im folgenden mit KV LK<br />
bezeichnet).<br />
Die Evangelische Kirche im Rheinland und die<br />
Evangelische Kirche von Westfalen gliedern<br />
sich in Kirchengemeinden, Kirchenverbände<br />
sowie Kirchenkreise, die nach Art. 140 GG<br />
i.V.m. Art. 137 Abs. 5 WRV jeweils – ebenso<br />
wie die Landeskirchen – Körperschaften des<br />
öffentlichen Rechts darstellen (vgl. auch Art. 3<br />
Abs. 3 KO EKiR, Art. 4 KO EKvW). Die Lippische<br />
Landeskirche gliedert sich in Kirchengemeinden<br />
und Klassen. Die Kirchengemeinden<br />
sind – ebenso wie die Lippische Landeskirche<br />
– Körperschaften des öffentlichen<br />
Rechts (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5<br />
WRV, vgl. auch Art. 5 KV LK). Lediglich die<br />
Klassen sind keine Körperschaften des öffentlichen<br />
Rechts, sondern kirchenrechtliche Körperschaften<br />
sui generis (Schilberg 2003, S. 70).<br />
Das kirchliche Grundvermögen ist die<br />
Gesamtheit aller Sachen, Rechte und Verbindlichkeiten<br />
einer kirchlichen Körperschaft und<br />
im allgemeinen zweckbestimmt gegliedert in<br />
Kirchenvermögen, Pfarr- und sonstige Zweck-<br />
vermögen (zum Beispiel Diakonie-, Krankenhaus-,<br />
Stiftungs- und Friedhofsvermögen), so<br />
zum Beispiel § 14 Abs. 1 VwO EKvW. Das<br />
kirchliche Vermögensrecht war vor Inkrafttreten<br />
des Preußischen Allgemeinen Landrechts<br />
auch im evangelischen Bereich anstaltlich<br />
geordnet und auf der Trägerschaft einzelner<br />
Institute aufgebaut, die selbständige juristische<br />
Personen bildeten (Marx 1974, S. 59). Der<br />
Übergang dieser Anstalten in die Kirchengemeinde<br />
vollzog sich im Laufe der Zeit kraft<br />
Gewohnheitsrechts; diese Kirchenvermögen<br />
werden jetzt nur noch als durch Zweckbestimmung<br />
gebundene Teile eines Vermögens angesehen<br />
(Meyer 1995, S. 923 ff) und im allgemeinen<br />
auf den Namen der kirchlichen Körperschaft<br />
unter der Bezeichnung der Zweckbestimmung<br />
im Grundbuch eingetragen, vgl.<br />
auch § 16 Abs. 1 VwO EKvW.<br />
4.1. Evangelische Kirche im Rheinland<br />
Die Kirchengemeinde wird vom Presbyterium<br />
geleitet, insbesondere vertritt es die Gemeinde<br />
im Rechtsverkehr und ist verantwortlich für<br />
die ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde<br />
(Art. 15 KO EKiR). Zudem wird in<br />
Art. 30 Abs. 1 KO EKiR geregelt, dass die oder<br />
der Vorsitzende des Presbyteriums gemeinsam<br />
mit einem weiteren Mitglied des Presbyteriums<br />
rechtsverbindlich für die Kirchengemeinde<br />
zeichnet. Urkunden und Vollmachten sind<br />
zusätzlich zu siegeln. Für einfache Geschäfte<br />
der laufenden Verwaltung gelten die eben<br />
genannten Formvorschriften nicht, vgl. Art. 30<br />
Abs. 2 KO EKiR.<br />
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche<br />
im Rheinland differenziert somit zwischen<br />
rechtsverbindlichen Erklärungen und einfachen<br />
Geschäften der laufenden Verwaltung,<br />
denen unterschiedliche Formerfordernisse zugewiesen<br />
werden. Wie schon in Abschnitt 2<br />
näher ausgeführt, kann demnach nur das Presbyterium<br />
vom gemeindeinternen Stand der<br />
Vermögensverwaltung beurteilen, ob die zur<br />
Feststellung, Abmarkung oder amtlichen<br />
Bestätigung abzugebenden Anerkennungserklärungen<br />
als einfache Geschäfte der laufenden<br />
Verwaltung zu qualifizieren sind oder<br />
nicht. In diesem Zusammenhang kommt der<br />
oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums eine<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 57
esondere Bedeutung zu, da sie oder er die<br />
Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwaltung<br />
der Kirchengemeinde trägt (Art. 28<br />
Abs. 2 KO EKiR).<br />
Die Kirchenkreise der Evangelischen Kirche<br />
im Rheinland werden durch den jeweiligen<br />
Kreissynodalvorstand im Rechtsverkehr vertreten<br />
(Art. 114 Abs. 2 lit. d KO EKiR). Die<br />
Superintendentin oder der Superintendent als<br />
Vorsitzender des Kreissynodalvorstandes (Art.<br />
120 Abs. 1 lit. b KO EKiR) zeichnet gemeinsam<br />
mit einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvorstandes<br />
rechtsverbindlich für den Kirchenkreis.<br />
Urkunden und Vollmachten sind<br />
zusätzlich zu siegeln (Art. 119 Abs. 1 KO<br />
EKiR). Für einfache Geschäfte der laufenden<br />
Verwaltung gelten die eben genannten Formerfordernisse<br />
nicht (Art. 119 Abs. 2 KO<br />
EKiR).<br />
Die Evangelische Kirche im Rheinland als<br />
Körperschaft öffentlichen Rechts wird durch<br />
die Kirchenleitung als Präsidium der Landessynode<br />
im Rechtsverkehr vertreten (Art. 148<br />
Abs. 3 lit. j KO EKiR). Rechtsverbindlich<br />
zeichnen zwei Mitglieder der Kirchenleitung<br />
(Art. 151 Abs. 1 KO EKiR) bzw. die oder der<br />
nach der Geschäftsordnung des Landeskirchenamtes<br />
zuständige Dezernentin oder<br />
Dezernent oder die oder der im Rahmen der<br />
Delegation Beauftragte (Art. 162 Abs. 1 KO<br />
EKiR). Urkunden und Vollmachten sind<br />
zusätzlich zu siegeln. Für einfache Geschäfte<br />
der laufenden Verwaltung gelten die Formerfordernisse<br />
der Art. 151 Abs. 1, 162 Abs. 1 KO<br />
EKiR nicht.<br />
4.2. Evangelische Kirche von Westfalen<br />
Die Kirchengemeinde wird vom Presbyterium<br />
geleitet (Art. 55 Abs. 1 KO EKvW), es leitet<br />
und verwaltet die Kirchengemeinde (Art. 56<br />
lit. i KO EKvW), insbesondere verwaltet es<br />
das Vermögen der Kirchengemeinde und vertritt<br />
die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr<br />
(Art. 57 lit. q, r KO EKvW). Für die Abgabe<br />
von Erklärungen im Grenztermin ist Art. 70<br />
Abs. 2 KO EKvW maßgebend. Demzufolge<br />
sind Urkunden, durch die für die Kirchengemeinde<br />
rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben<br />
werden, sowie Vollmachten von der oder<br />
dem Vorsitzenden und zwei gewählten Mit-<br />
58<br />
gliedern des Presbyteriums zu unterzeichnen<br />
und mit dem Siegel der Kirchengemeinde zu<br />
versehen. Dadurch wird Dritten gegenüber die<br />
Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt<br />
(Art. 70 Abs. 2 Satz 2 KO EKvW).<br />
Die zuvor genannten Formerfordernisse entsprechen<br />
den im Abschnitt 4.1 angeführten<br />
Regelungen der Evangelischen Kirche im<br />
Rheinland, lediglich die Anzahl der mitzeichnenden<br />
gewählten Mitglieder des Presbyteriums<br />
ist unterschiedlich. Für den Fall, dass die<br />
Erklärungen vom Presbyterium als Geschäfte<br />
der laufenden Verwaltung angesehen werden,<br />
gelten die zuvor genannten Formerfordernisse<br />
des Art. 70 Abs. 2 Sätze 1 und 2 nicht, vgl. Art.<br />
70 Abs. 2 Satz 3 KO EKvW. Es genügt dann,<br />
wenn die Erklärungen von der oder dem Vorsitzenden<br />
des Presbyteriums abgegeben werden;<br />
eine Bevollmächtigung einer natürlichen<br />
Person ist dann mittels einfacher Vollmacht,<br />
also ohne besondere Formerfordernisse möglich.<br />
Zudem kann in eiligen Fällen, in denen<br />
die Einberufung des Presbyteriums nicht möglich<br />
ist, die oder der Vorsitzende einstweilen<br />
das Erforderliche veranlassen (Art. 71 Abs. 3<br />
KO EKvW). Dies ist dem Presbyterium in der<br />
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.<br />
Die Kirchenkreise der Evangelischen Kirche<br />
von Westfalen werden durch den jeweiligen<br />
Kreissynodalvorstand vertreten (Art. 106 Abs.<br />
2 lit. h KO EKvW). Die Formvorschriften entsprechen<br />
im wesentlichen denen der Evangelischen<br />
Kirche im Rheinland (vgl. Abschnitt<br />
4.1), im einzelnen Art. 111 KO EKvW.<br />
Die Evangelische Kirche von Westfalen als<br />
Körperschaft öffentlichen Rechts wird durch<br />
die Kirchenleitung als Präsidium der Landessynode<br />
im Rechtsverkehr vertreten (Art. 142<br />
Abs. 2 lit. o KO EKvW). Die Formerfordernisse<br />
entsprechen denen der Evangelischen<br />
Kirche im Rheinland (vgl. Abschnitt 4.1), im<br />
einzelnen Art. 145 KO EKvW.<br />
4.3. Lippische Landeskirche<br />
In der Lippischen Landeskirche liegt die Leitung<br />
und Verwaltung der Kirchengemeinde<br />
beim Kirchenvorstand (Art. 36 Abs. 1 KV LK),<br />
er vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsver-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
kehr (Art. 51 Abs. 1 KV LK). Für die Vertretung<br />
einer Kirchengemeinde im Grenztermin<br />
ist Art. 51 Abs. 3 KV LK maßgebend: Demnach<br />
sind Urkunden über Rechtsgeschäfte,<br />
durch die die Kirchengemeinde gegenüber<br />
Dritten verpflichtet wird, sowie Vollmachten<br />
von der oder dem Vorsitzenden und zwei weiteren<br />
Mitgliedern des Kirchenvorstandes zu<br />
unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel des<br />
Kirchenvorstandes zu versehen; darüber hinaus<br />
bedürfen Urkunden und Vollmachten der<br />
Bestätigung durch das Landeskirchenamt. Der<br />
Kirchenvorstand ist berechtigt, durch eine<br />
gemäß Art. 51 Abs. 3 KV LK ausgefertigte<br />
Vollmacht mit der Vollziehung von Rechtsgeschäften<br />
eins oder mehrere seiner Mitglieder<br />
zu beauftragen (Art. 51 Abs. 4 KV LK). Die<br />
Lippische Landeskirche wird durch den Landeskirchenrat<br />
vertreten, vgl. im einzelnen Art.<br />
109 KV LK.<br />
5 Rechtsfolgen<br />
Die Tragweite der beschriebenen Form- und<br />
Zuständigkeitsvorschriften wird insbesondere<br />
bei Rechtsverstößen erkennbar; die Konsequenzen<br />
für einen Grenzfeststellungsvertrag<br />
sollen im folgenden kurz beschrieben werden.<br />
Dabei rechtfertigen der Schutzzweck der auch<br />
im Bereich der kirchlichen Vermögensverwaltung<br />
geltenden formgebundenen Vertretungsregelungen<br />
und die Gleichheit der Interessenlage<br />
die Anwendung der für den Kommunalbereich<br />
entwickelten Rechtsgrundsätze<br />
(Busch 1995, S. 964). Zu unterscheiden sind in<br />
diesem Zusammenhang (Zilles/Kämper 1994,<br />
S. 113 ff):<br />
1. Verstöße gegen gesetzlich normierte Vertretungsregelungen,<br />
bei denen entweder<br />
gänzlich unzuständige Personen oder aber<br />
an sich – zumindest auch – zuständige Einzelpersonen<br />
oder Personenmehrheiten unter<br />
Umgehung der organschaftlichen Kompetenz<br />
in verpflichtender Weise rechtsgeschäftlich<br />
tätig werden,<br />
2. Verstöße gegen gesetzliche Formvorschriften,<br />
bei denen beispielsweise Erklärungen<br />
unter Verstoß gegen Schriftform- oder<br />
Unterschriftserfordernisse sowie ohne<br />
Beifügung des erforderlichen Siegels abgegeben<br />
werden,<br />
3. Verstöße gegen Genehmigungsvorbehalte,<br />
bei denen übersehen wird, dass bestimmte<br />
Rechtsgeschäfte einer kirchenaufsichtlichen<br />
Genehmigung bedürfen.<br />
Bei Verstößen gegen gesetzlich normierte Vertretungsregelungen<br />
(Vertretungsmangel) richtet<br />
sich die Rechtsverbindlichkeit nach § 177<br />
BGB (Fritz 1983, S. 179 ff; Zilles/Kämper<br />
1994, S. 114), ein Grenzfeststellungsvertrag<br />
ist demzufolge zunächst schwebend unwirksam.<br />
Vertretungsunzuständiges Handeln der<br />
Organwalter kann durch die Genehmigung der<br />
vertretenen Kirchengemeinde geheilt werden<br />
(§ 184 Abs. 1 BGB); die Genehmigung bedarf<br />
zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der Einhaltung<br />
der jeweiligen Form- und Zuständigkeitsvorschriften<br />
(Busch 1995, S. 964).<br />
Demgegenüber hat der Verstoß gegen eine<br />
gesetzliche Formvorschrift nach § 125 Satz 1<br />
BGB in jedem Fall die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts<br />
zur Folge (Fritz 1983, S. 176 ff; Zilles/Kämper<br />
1994, S. 115); Verstöße gegen<br />
gesetzliche Formvorschriften sind das Fehlen<br />
der Schriftlichkeit, der handschriftlichen<br />
Unterzeichnung oder des Siegels.<br />
Eine weitere Wirksamkeitsvoraussetzung für<br />
rechtsverbindliche Erklärungen der ortskirchlichen<br />
Vertretungsorgane ist die kirchenaufsichtliche<br />
Genehmigung; beispielsweise<br />
bedarf in der katholischen Kirche eine Gattungsvollmacht,<br />
mit der eine natürliche Person<br />
grundsätzlich – also unabhängig vom Einzelfall<br />
– bevollmächtigt wird, die Kirchengemeinde<br />
und ihr Vermögen im Grenztermin zu<br />
vertreten und rechtverbindliche Erklärungen<br />
zur Feststellung, Abmarkung und amtlichen<br />
Bestätigung von Grundstücksgrenzen abzugeben,<br />
der Genehmigung der Erzbischöflichen<br />
Behörde (vgl. Abschnitt 3.1). Auch soweit sie<br />
auf kirchlichen Vorschriften beruhen (vgl. beispielsweise<br />
die Bestätigung von Vollmachten<br />
und Urkunden durch das Landeskirchenamt<br />
der Lippischen Landeskirche in Art. 51 Abs. 3<br />
KV LK), sind die Genehmigungsvorbehalte<br />
auch im säkularen Rechtsverkehr wirksam; sie<br />
beinhalten ein gesetzliches Verbot im Sinne<br />
des § 134 BGB, welches die Vertretungsmacht<br />
der Organwalter nachgeordneter Rechtsträger<br />
einschränkt (Busch 1995, S. 966 ff); gleichwohl<br />
wird aber nach dem Zweck der Regelun-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 59
gen nicht die Nichtigkeitsfolge des § 134 BGB<br />
ausgelöst (Zilles/Kämper 1994, S. 113). Vielmehr<br />
sind die abgebebenen Willenserklärungen<br />
wie beim Handeln eines vollmachtlosen<br />
Vertreters zunächst schwebend unwirksam bis<br />
zum Zeitpunkt der nachträglichen Erteilung<br />
oder Versagung der aufsichtlichen Genehmigung.<br />
Dagegen ist beim Vorliegen einer bezüglich<br />
Vertretungsmacht, Form und ggf. Genehmigungsvorbehalt<br />
ordnungsgemäß vorliegenden<br />
Verpflichtungserklärung nicht zu hinterfragen,<br />
ob es im Vorfeld überhaupt zu einem wirksamen<br />
Presbyteriums- oder Kirchenvorstandsbeschluss<br />
gekommen ist. Liegt eine ordnungsgemäße<br />
Verpflichtungserklärung vor, so ist<br />
nach außen gegenüber Dritten die Ordnungsbzw.<br />
Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung<br />
unwiderleglich festgestellt, siehe explizit § 14<br />
Satz 3 VVG, § 70 Abs. 2 Satz 2 KO EKvW.<br />
6 Zusammenfassung<br />
Katholische und evangelische Kirchengemeinden<br />
werden bei der Teilnahme am Rechtsverkehr<br />
durch ihre gesetzlichen Organe oder im<br />
Wege der Vollmacht durch einzelne Organmitglieder<br />
oder auch Dritte vertreten (Zilles/<br />
Kämper 1994, S. 115). Dabei setzt die Abgabe<br />
wirksamer Verpflichtungserklärungen die Einhaltung<br />
bestimmter Vertretungs-, Form- und<br />
Genehmigungserfordernisse voraus, wobei ein<br />
Verstoß gegen eine oder mehrere dieser Voraussetzungen<br />
in der Regel die Unwirksamkeit<br />
der Erklärung zur Folge hat. Für den Fall der<br />
Grenzfeststellung führt dies im Regelfall zu<br />
Grenzen, die katasterrechtlich als nicht festgestellte<br />
Grenzen zu werten sind, da aufgrund<br />
unwirksamer Willenserklärungen im Grenztermin<br />
die Tatbestandsvoraussetzungen des § 19<br />
Abs. 1 VermKatG NRW nicht erfüllt sind.<br />
Das Liegenschaftskataster wird in Nordrhein-<br />
Westfalen wie auch in den anderen Bundesländern<br />
mit hohen vermessungstechnischen<br />
und rechtlichen Standards geführt, um seiner<br />
in § 11 VermKatG NRW manifestierten<br />
Zweckbestimmung gerecht zu werden. Dazu<br />
zählt auch, dass die Grenzniederschrift als<br />
öffentliche Urkunde im Sinne des § 415 ZPO<br />
(Simmerding 2000, S. 145) besonders in Streit-<br />
60<br />
und Zweifelsfällen als überzeugendes Beweismittel<br />
herangezogenen werden kann (Mattiseck<br />
1999, S. 79). Dies kann bei der Beteiligung<br />
von Kirchengemeinden bzw. deren Vermögensmassen<br />
nur dann erfüllt sein, wenn die<br />
zur Feststellung, Abmarkung und amtlichen<br />
Bestätigung abgegebenen Erklärungen unter<br />
Beachtung der beschriebenen Vertretungs-,<br />
Form- und ggf. Genehmigungserfordernisse<br />
wirksam erklärt werden.<br />
Literaturangaben<br />
Althaus, Rüdiger: Sammlung des Rechts im Erzbistum<br />
Paderborn Bonifatius, 2. Auflage, Paderborn<br />
2004<br />
Bauer, Hans-Joachim/Oefele, Helmut von:<br />
Grundbuchordnung, Kommentar Verlag Franz Vahlen,<br />
München 1999<br />
Bauschke, Karl: Der Kirchenvorstand im Erzbistum<br />
Paderborn; Bonifatius, 2. Auflage, Paderborn<br />
2003<br />
Bengel, Manfred/Simmerding, Franz: Grundbuch,<br />
Grundstück, Grenze. Handbuch zur Grundbuchordnung<br />
unter Berücksichtigung katasterrechtlicher<br />
Fragen Luchterhand Verlag, Neuwied/<br />
Kriftel/Berlin 2000<br />
Busch, Wolfgang: Die Vermögensverwaltung und<br />
das Stiftungsrecht im Bereich der katholischen Kirche<br />
in: Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik<br />
Deutschland, Hrsg. Joseph Listl und<br />
Dietrich Pirson Duncker & Humblot, 2. Auflage,<br />
Berlin 1995<br />
Eckardt, Ulrich: Privatrechtsgeschäftliche Außenvertretung<br />
der deutschen Gemeinden. Zugleich ein<br />
Beitrag zum allgemeinen Organisationsrecht Dissertation,<br />
Münster 1961<br />
Emsbach, Heribert: Rechte und Pflichten des Kirchenvorstandes<br />
J. P. Bachem, 8. Auflage, <strong>Köln</strong> 2000<br />
Fritz, Christoph: Vertrauensschutz im Privatrechtsverkehr<br />
mit Gemeinden – Insbesondere<br />
zum Vertrauensschutz bei Nichtbeachtung der<br />
gemeinderechtlichen Sondervorschriften für Verpflichtungserklärungen<br />
Duncker & Humblot, Berlin<br />
1983<br />
Häde, Ulrich: Rechtsfragen der Grenzabmarkung<br />
Zeitschrift für Vermessungswesen 7/1993, S. 305-<br />
319<br />
Held, Friedrich Wilhelm et al.: Gemeindeordnung<br />
für das Land Nordrhein-Westfalen – Kommentar;<br />
Kommunal- und Schul-Verlag, Wiesbaden 2004<br />
Kirchhof, Roland et al.: Kreisordnung für das Land<br />
Nordrhein-Westfalen – Kommentar; Kommunalund<br />
Schul-Verlag, Wiesbaden 2004<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Kopp, Ferdinand O./Ramsauer, Ulrich: Verwaltungsverfahrensgesetz<br />
– Kommentar Verlag C.H.<br />
Beck, 8. Auflage, München 2003<br />
Landtag NRW: Gesetz zur Änderung des Vermessungs-<br />
und Katastergesetzes (VermKatG NW), amtliche<br />
Begründung Landtags-Drucksache 10/4435,<br />
Düsseldorf 1990<br />
Loggen, Helmut: Formen rechtlicher Mitwirkung<br />
in katholischen Kirchengemeinden. Die Zuordnung<br />
von Pfarrer, Vermögensverwaltungsorganen und<br />
Pfarrgemeinderat in den Pfarreien der Diözesen in<br />
der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)<br />
Dissertation, <strong>Köln</strong> 1990<br />
Marx, Siegfried: Das Kirchenvermögens- und Stiftungsrecht<br />
im Bereich der katholischen Kirche in der<br />
Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin<br />
unter besonderer Berücksichtigung des Kirchenvermögensverwaltungsrechts,<br />
dargestellt am Staatskirchen-<br />
und Diözesanrecht; Dissertation, München<br />
1974<br />
Mattiseck, Klaus: Zur Feststellung und Abmarkung<br />
von Grundstücksgrenzen in Nordrhein-Westfalen<br />
Nachrichten aus dem öffentlichen Vermessungsdienst<br />
2/1999, S. 71-80<br />
Mattiseck, Klaus/Meier, E.: Die Behandlung eines<br />
Zeichenfehlers im Liegenschaftskataster; Nachrichten<br />
aus dem öffentlichen Vermessungsdienst 2/1993,<br />
S. 87-96<br />
Meyer, Christian: Die Vermögensverwaltung und<br />
das Stiftungsrecht im Bereich der evangelischen<br />
Kirche in: Handbuch des Staatskirchenrechts der<br />
Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Joseph Listl und<br />
Dietrich Pirson Duncker & Humblot, 2. Auflage,<br />
Berlin 1995<br />
Scheffler, Gerhard: Rechtsstellung und Vertretung<br />
der evangelischen Landeskirchen im staatlichen<br />
Bereich Neue juristische Wochenschau 1977, S. 740<br />
- 745<br />
Schilberg, Arno: Evangelisches Kirchenrecht in<br />
Rheinland, Westfalen und Lippe; Kohlhammer<br />
Deutscher Gemeindeverlag, Stuttgart 2003<br />
Simmerding, Franz: Bayerisches Abmarkungsrecht<br />
Richard Boorberg Verlag, 2. Auflage, Stuttgart/München/Hannover<br />
2000<br />
Suckow: Die Feststellung der rechtlichen Grenzen<br />
nach den Ergänzungsvorschriften für die Ausführung<br />
von Fortschreibungsvermessungsarbeiten<br />
vom 21. Februar 1913 nebst einem Zuständigkeitsverzeichnis<br />
Verlag von R. Reiß, Liebenwerda 1917<br />
Suckow: Die Grenzanerkennungsverhandlungen<br />
Verlag von R. Reiß, 2. Auflage, Liebenwerda 1930<br />
Wenner, Joseph: Kirchliches Vermögensrecht mit<br />
besonderer Berücksichtigung der Verwaltung des<br />
katholischen Kirchenvermögens in Preußen und in<br />
der Ostmark; Ferdinand Schöningh, 3. Auflage,<br />
Paderborn 1940<br />
Wenner, Joseph: Kirchenvorstandsrecht; Ferdinand<br />
Schöningh, 1. Auflage, Paderborn 1954<br />
Zachert, Rüdiger: Vermessungsrechtliche Beurkundungen<br />
i.S.v. § 61 BeurkG Allgemeine Vermessungsnachrichten<br />
5/2005, S. 188-193<br />
Zilles, Hans/Kämper, Burkhard: Kirchengemeinden<br />
als Körperschaften im Rechtsverkehr. Voraussetzungen<br />
und Funktionsstörungen rechtswirksamer<br />
Betätigung; Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht<br />
1994, S. 109 - 115<br />
Rechtsquellen<br />
GG: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland<br />
vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1/BGBl. III 100-1)<br />
GO NRW: Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen<br />
(GO NRW) in der Fassung der<br />
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.<br />
666/SGV. NRW. 2023)<br />
KO EKiR: Kirchenordnung der Evangelischen Kirche<br />
im Rheinland vom 10.01.2003, zuletzt geändert<br />
durch Kirchengesetz vom 14.01.2005 (KABl. S.<br />
102; Gesetzestext unter www.ekir.de)<br />
KO EKvW: Kirchenordnung der Evangelischen<br />
Kirche von Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 14.01.1999, zuletzt geändert durch<br />
Kirchengesetz vom 14.11.2002 (KABl. S. 336;<br />
Gesetzestext unter www.ekvw.de)<br />
KrO NRW: Kreisordnung für das Land Nordrhein-<br />
Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646/SGV.<br />
NRW. 2021)<br />
KV LK: Verfassung der Lippischen Landeskirche<br />
vom 17.02.1931 in der Fassung des Kirchengesetzes<br />
vom 23.11.1998 (Ges. u. VOBl. Bd. 11 Nr. 13),<br />
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom<br />
23.11.2004 (Ges. u. VOBl. Bd. 13 Nr. 10; Gesetzestext<br />
unter www.lippische-landeskirche.de)<br />
RK: Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und<br />
dem Deutschen Reich (Reichskonkordat) vom<br />
20.07.1933 (RGBl. II S. 679), abgedruckt zum Beispiel<br />
in Althaus (2004, S. 60 ff)<br />
VermKatG NRW: Gesetz über die Landesvermessung<br />
und das Liegenschaftskataster (Vermessungsund<br />
Katastergesetz - VermKatG NRW) vom<br />
01.03.2005 (GV. NRW. S. 174/SGV. NRW. 7134)<br />
VVG: Gesetz über die Verwaltung des katholischen<br />
Kirchenvermögens vom 24.07.1924 (GV. NRW. S.<br />
325/SGV. NRW. 114)<br />
VwO EKvW: Verordnung für die Vermögens- und<br />
Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise<br />
und der kirchlichen Verbände in der<br />
Evangelischen Kirche von Westfalen (Verwaltungsordnung<br />
– VwO) vom 26. 04. 2001 (KABl. S. 137,<br />
239)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 61
VwVfG NRW: Verwaltungsverfahrensgesetz für das<br />
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der<br />
Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV.<br />
NRW. S. 602/SGV. NRW. 2010)<br />
WRV: Die Verfassung des Deutschen Reichs vom<br />
11.08.1919 (RGBl. S. 1383), „Weimarer Reichsverfassung“<br />
1 Einleitung<br />
Das Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen<br />
(LVermA NRW) kalibriert seit Dezember<br />
2000 die geodätischen GPS-Antennen der<br />
nordrhein-westfälischen SAPOS ® -Referenzstationen.<br />
Das Ziel der Kalibrierung besteht<br />
darin, genaue Kenntnisse über die elektrischen<br />
Empfangseigenschaften einer GPS-Antenne<br />
zu erhalten, damit unterschiedliche Antennentypen<br />
und Fabrikate gleichzeitig eingesetzt<br />
werden können, ohne dass es bei den SAPOS ® -<br />
Nutzungen zu Qualitätsverlusten kommt<br />
(www.saposnrw.de). Der vorliegende Beitrag<br />
gibt eine Einführung in die Thematik der GPS-<br />
Antennenkalibrierung am praktischen Beispiel<br />
des Kalibrierstandortes LVermA NRW in Bonn<br />
(Spata 2001). Danach wird über die bisher<br />
gewonnenen Erfahrungen aus rund 120 Einzelkalibrierungen<br />
mit dem Vergleich relativer<br />
und absoluter Antennenparameter sowie mit<br />
dem Vergleich individueller und typspezifischer<br />
Parameter ausführlich berichtet.<br />
2 GPS-Antennenparametermodell<br />
Zur eindeutigen Zuordnung von Kalibrierparametern<br />
müssen der Antennenreferenzpunkt<br />
(ARP) und die Nordorientierung der GPS-<br />
Antenne definiert sein. Der ARP ist definiert<br />
als Durchstoßpunkt der vertikalen Symmetrieachse<br />
der Zentriervorrichtung durch die dazu<br />
senkrecht stehende horizontale Antennenreferenzebene.<br />
Der virtuelle ARP liegt stets auf der<br />
Unterseite des Antennengehäuses und wird im<br />
englischen mit „bottom of antenna mount“<br />
62<br />
Markus Rembold<br />
Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr-Kreis<br />
Hauptstr. 92<br />
58332 Schwelm<br />
E-Mail: m.rembold@en-kreis.de<br />
GPS-Antennenkalibrierungen beim Landesvermessungsamt NRW<br />
– Konzept und erste Erfahrungen<br />
Von Manfred Spata, Bernhard Galitzki, Klaus Strauch und Heidrun Zacharias<br />
bezeichnet (http://www.lverma.nrw.de/produkte/raumbezug/SAPOS/antennenphasen/im<br />
ages/antgraph.txt).<br />
Vom ARP aus werden sowohl die Exzentrizität<br />
zur Vermarkung des Vermessungspunktes<br />
(Zentrierelemente nach Lage und Höhe) als<br />
auch die Antennenparameter bestimmt<br />
(Abb. 1). Nicht bei allen GPS-Antennen ist<br />
eine Nordmarkierung werkseitig angebracht.<br />
Vor der Kalibrierung wird in solchen Fällen<br />
Norden auf der Antenne durch das LVermA<br />
NRW gekennzeichnet.<br />
Abb. 1: Geometrische Definition des Antennenreferenzpunktes<br />
(ARP) und des elektrischen<br />
Phasenzentrums (PZ)<br />
Das mechanische Phasenzentrum ist in der<br />
Regel ein dünnes Stück Metall, das als Messelement<br />
(engl.: Patch) bezeichnet wird<br />
(Abb. 2). Für Zweifrequenz-Messungen muss<br />
die Antenne sowohl L1- als auch L2-Satellitenträgerphasen<br />
empfangen können. Um einen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
optimalen Empfang zu gewährleisten, weist<br />
das Messelement für jede GPS-Frequenz andere<br />
Abmessungen auf.<br />
Abb. 2: Auseinandergebaute Spectra-Precision-<br />
Choke-Ring-Antenne (Foto: Strauch)<br />
Das elektrische Phasenzentrum (PZ) der GPS-<br />
Antenne befindet sich im Idealfall im Mittelpunkt<br />
des Messelementes, dem mechanischen<br />
Zentrum der Antenne. In der Praxis ist das<br />
effektive elektrische Phasenzentrum der Antenne<br />
jedoch kein konstanter Punkt, sondern<br />
unterliegt kleinen Variationen. Diese Variation<br />
ist eine Funktion des aktuellen Azimuts und<br />
der Elevation des verfolgten Satelliten. Die<br />
Variation zwischen diesen elektrischen Antennenphasenzentren<br />
beschreibt die Form eines<br />
Fehlerellipsoids (Görres 2001, Krantz et al.<br />
2001).<br />
Zur Beschreibung der Variationen werden zwei<br />
Typen von Korrektionsparametern unterschieden:<br />
Der konstante Antennenphasenoffset<br />
(engl.: Phase Center Offset, PCO) sowie<br />
Antennenphasenvariationen (engl.: Phase Center<br />
Variations, PCV), die aus elevations- oder<br />
elevations- und azimutabhängigen Termen<br />
bestehen können (Abb. 3). Die Bestimmung<br />
von Antennenphasenoffsets und Antennenphasenvariationen<br />
sind voneinander abhängig und<br />
dürfen nur als konsistenter Datensatz gemeinsam<br />
zur Korrektion verwendet werden.<br />
Der Antennenphasenoffset (PCO) beschreibt<br />
in seinen drei Komponenten die Exzentrizität<br />
nach Lage (Nord, Ost) und Höhe in einem<br />
antennenfesten Bezugssystem zwischen dem<br />
Antennenreferenzpunkt (ARP) und elektrischen<br />
Antennenphasenzentrum (PZ).<br />
Abb. 3: Definition der Antennenphasenoffsets (PCO)<br />
und der Antennenphasenvariationen (PCV)<br />
(Campbell et al. 2004)<br />
Die Antennenphasenvariationen (PCV) beschreiben<br />
die azimut- und elevationsabhängigen<br />
Abweichungen (d�) der realen von der<br />
idealen Phasenfront im antennenfesten Bezugssystem.<br />
Die Phasenfehler dF werden in<br />
einem Raster über alle Elevationen W und alle<br />
Azimute W bestimmt. Die Antennenparameter<br />
sind getrennt für beide GPS-Observablen L1<br />
und L2 zu ermitteln. Die Ergänzung einer<br />
GPS-Antenne um eine Grundplatte oder eine<br />
Wetterschutzhaube (Radom) beeinflusst das<br />
elektrische Antennenphasenzentrum und erfordert<br />
somit eine eigenständige Kalibrierung<br />
(Görres 2001, Menge 2003, Becker et al.<br />
<strong>2006</strong>).<br />
3 Bezugsniveau und Datenformate<br />
Relatives Niveau<br />
Die Antennenparameter einer relativen Kalibrierung<br />
beziehen sich auf eine Referenzantenne,<br />
hier konkret auf die allseits anerkannte<br />
US-amerikanische Referenzantenne Dorne-<br />
Margoline-Choke-Ring-Antenne, deren Lage-<br />
Offset-Werte und PCV-Werte zu Null gesetzt<br />
sind; lediglich Höhen-Offset-Werte von 110<br />
mm für L1 und 128 mm für L2 sind berücksichtigt.<br />
Auch die vom International GPS Service<br />
for Geodynamics (IGS) veröffentlichten<br />
Antennenparameter in Form von Typmitteln<br />
beziehen sich auf diese Referenzantenne (Görres<br />
2001, Wanninger 2002).<br />
Absolutes Niveau<br />
Die Antennenparameter einer absoluten Kalibrierung<br />
beziehen sich auf die zu kalibrieren-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 63
de Antenne selbst (i.d.R. auf den ARP), also<br />
nicht auf eine Referenzantenne (Menge 2003,<br />
Wübbena 2003a, Campbell et al. 2004, Becker<br />
et al. <strong>2006</strong>).<br />
AdV-Nullantenne<br />
Die Nullantenne bezeichnet eine quasi fehlerfreie<br />
GPS-Antenne. Werden die Messdaten<br />
einer Antenne um die in einer Kalibrierung<br />
bestimmten Einflüsse der PCO und PCV korrigiert,<br />
kann diese Fehlerfreiheit praktisch<br />
erreicht werden. Eine Nullantenne ist nur auswertetechnisch<br />
realisierbar, konstruktiv ist<br />
eine Nullantenne nicht möglich (Schmitz et al.<br />
2005). Die Antennenbezeichnung „ADVNUL-<br />
LANTENNA“ zeigt an, dass die gemessenen<br />
Satellitendaten um die absoluten Antennenparameter<br />
korrigiert sind und dass sich die Beobachtungen<br />
auf den Antennenreferenzpunkt<br />
ARP beziehen. Im SAPOS ® -HEPS wird zur<br />
Kennzeichnung dieses Bezugs in der RTCM-<br />
V2.3-Botschaft 23 der String „ADVNUL-<br />
LANTENNA“ verschickt (AdV SAPOS ® -<br />
Techkom, 8. Sitzung 2002; AdV-SAPOS ® -<br />
Flyer 2004).<br />
Datenformate<br />
Antennen-Kalibrierdaten gibt es in firmenspezifischen<br />
und firmenunabhängigen Formaten.<br />
Von SAPOS ® werden die firmenunabhängigen<br />
Formate IGS und ANTEX (engl.: Antenna<br />
64<br />
Abb. 4: Antennenparameter im IGS-Format (Auszug)<br />
Exchange) verwendet. Das IGS-Format<br />
(Abb. 4) berücksichtigt für die Frequenzen L1<br />
und L2 neben den PCO nur elevationsabhängige<br />
PCV in 5 Grad Schritten, theoretisch ab<br />
Null Grad Elevation, praktisch ab 10 Grad; es<br />
werden jedoch keine azimutabhängigen Terme<br />
berücksichtigt. Der internationale Dienst IGS<br />
veröffentlicht seit 1996 typspezifische Kalibrierergebnisse<br />
(Typmittel) verschiedener<br />
Nutzergruppen unter ftp://igscb.jpl.nasa.gov/<br />
pub/station/general/igs_01.pcv. Die Typmittel<br />
werden aus mehreren individuellen Kalibrierergebnissen<br />
baugleicher Antennen berechnet.<br />
Auch das NGS (National Geodetic Survey,<br />
U.S.A.) stellt im Internet typspezifische Kalibrierdaten<br />
im IGS-Format unter http://<br />
www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ frei zur Verfügung.<br />
GPS-Antennen werden nach den<br />
Namenskonventionen des IGS bezeichnet. Die<br />
Bezeichnungen sind im Internet unter<br />
http://www.epncb.oma.be/ftp/station/general/rcvr_ant.tab<br />
aufgelistet. Im SAPOS ® -<br />
Dienst werden diese Bezeichnungen ebenfalls<br />
verwendet.<br />
Um dem Wunsch von Wissenschaft und Praxis<br />
nachzukommen, eine detaillierte Beschreibung<br />
einer kalibrierten Antenne zu erhalten,<br />
wurde auf dem IGS-Symposium im März 2004<br />
in Bern ein neues Antennenparameterformat,<br />
das ANTEX-Format (Abb. 5), propagiert.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
(ftp://igscb.jpl.nasa.gov/pub/station/general/a<br />
ntex13.txt) Das neue Datenformat beinhaltet<br />
zusätzlich zum IGS-Format u.a. folgende<br />
Informationen:<br />
� Bezugsniveau,<br />
� individuelle Antennenangaben,<br />
� Kalibrierverfahren,<br />
� Kommentarzeilen,<br />
� azimutale Korrektionswerte in 5-Grad-<br />
Schritten.<br />
Hinsichtlich der Antennen-Nordrichtung<br />
besteht auch im neuen ANTEX-Format nur die<br />
Möglichkeit, diese als Kommentar zu erfassen,<br />
ohne eine wünschenswerte Abbildung.<br />
Das ANTEX-Datenformat für relative und<br />
absolute Kalibrierergebnisse sollte ab 2004 das<br />
bisherige offizielle IGS-Format ablösen. Die<br />
Einführung der Absolutparameter stieß jedoch<br />
bei den IGS-Beteiligten auf erhebliche logistische<br />
Schwierigkeiten, so dass in Bern noch<br />
kein konkreter Einführungszeitpunkt benannt<br />
worden ist (Rothacher und Schmid 2002,<br />
Schmid et al. 2004). Der Umstieg vom relativen<br />
auf das absolute Niveau soll innerhalb des<br />
IGS zeitgleich mit dem Umstieg auf das neue<br />
System ITRF2005 nun im Mai <strong>2006</strong> stattfinden.<br />
Bereits auf seiner Sitzung am 16./17.06.2004<br />
in Schwerin fasste der AdV-Arbeitskreis Geodätischer<br />
Raumbezug folgenden Beschluss:<br />
Abb. 5: Antennenparameter im Format ANTEX (Auszug)<br />
1. Der Arbeitskreis beschließt die Nutzung des<br />
Formates ANTEX zur Verwaltung der<br />
Antennenkorrektionsparameter.<br />
2. Die von den Ländern bei der Zentralen Stelle<br />
SAPOS ® vorliegenden Kalibrierwerte<br />
werden in das Format ANTEX gewandelt<br />
und von den Ländern gepflegt.<br />
Bei allen GPS-Auswertungen ist darauf zu<br />
achten, dass konsistente Kalibrierformate benutzt<br />
werden.<br />
4 Verfahren zur Kalibrierung von<br />
GPS-Antennen<br />
Zur Kalibrierung von GPS-Antennen gibt es<br />
folgende Messmethoden:<br />
� Absolute Kalibrierung in einer Messkammer,<br />
� Absolute Kalibrierung im Feldverfahren,<br />
� Relative Kalibrierung im Feldverfahren.<br />
Im folgenden werden die absolute und relative<br />
Feldkalibrierung näher behandelt, hingegen<br />
wird die absolute Kammerkalibrierung hier<br />
nicht erörtert.<br />
Die absolute Feldkalibrierung hat den<br />
großen Vorteil, das die Ergebnisse unabhängig<br />
von einer Referenzantenne (Mutterantenne)<br />
sind. Die Parameter aus einer Absolutkalibrie-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 65
ung sind nahezu frei von Mehrwegeeffekten<br />
und reichen bis zum Nullhorizont (Menge<br />
2003, Wübbena et al. 2003a, Campbell et al.<br />
2004, Becker et al. <strong>2006</strong>). Dazu muss die zu<br />
prüfende Antenne (Prüfling) in Azimut und<br />
Elevation auf einem Roboterarm gedreht werden<br />
(Abb. 6).<br />
Abb. 6: Roboterarm der Firma Geo++ ®<br />
(Foto: Geo++ ®<br />
)<br />
Das absolute Feldkalibrierverfahren wurde<br />
von der Firma Geo++ ® (www.geopp.de) in Zusammenarbeit<br />
mit dem Institut für Erdmessung<br />
(IfE) der Universität Hannover entwickelt. Das<br />
automatisierte Echtzeitverfahren setzt auf<br />
Epochendifferenz-Beobachtungen auf (Menge<br />
2003, Wübbena et al. 2003a).<br />
Beim Verfahren der relativen Feldkalibrierung<br />
werden stets in Bezug auf die bekannten<br />
Parameter der Mutterantenne die Antennenphasenoffsets<br />
(PCO) und Antennenphasenvariationen<br />
(PCV) des Prüflings bestimmt<br />
(Abb. 7) (Görres 2001, Wanninger 2002, Menge<br />
2003, Becker et al. <strong>2006</strong>). Seit Dezember<br />
2000 wird das Verfahren der relativen Feldkalibrierung<br />
beim Landesvermessungsamt NRW<br />
praktiziert. Die Eignung des Kalibrierstandortes<br />
wurde vorab vom Ingenieurbüro Wanninger<br />
untersucht. Eine erneute Untersuchung fand<br />
im Januar 2005 statt. Auf dem Flachdach des<br />
66<br />
Abb. 7: Prinzipieller Messaufbau der relativen<br />
Feldkalibrierung (nach Menge 2003)<br />
LVermA-Gebäudes ist eine rund vier Meter<br />
lange Messeinrichtung (Stahlschiene) fest<br />
montiert (Abb. 8). Auf dem einen Ende ist sie<br />
mit der Antenne vom Typ Trimble (TRM<br />
29659.00 TCWD) der SAPOS ® -Station RS<br />
0576 Bonn als Referenzantenne besetzt, auf<br />
dem anderen Ende der Schiene befindet sich<br />
die zu kalibrierende Antenne.<br />
Abb. 8: Messeinrichtung zur relativen Feldkalibrierung<br />
auf dem Flachdach des LVermA NRW, links die<br />
Referenzantenne (Mutterantenne), rechts der Prüfling<br />
(Foto: Galitzki)<br />
Um höchste Genauigkeiten für das Kalibrierergebnis<br />
zu erreichen, wurde der Höhenunterschied<br />
zwischen den beiden Antennenreferenzpunkten<br />
(ARP) vorab nivellitisch im<br />
Submillimeterbereich bestimmt (Abb.7). Die<br />
Kalibriermessungen werden über einen langen<br />
Beobachtungszeitraum von mehreren Tagen<br />
aufgezeichnet. Die Bestimmung von azimutabhängigen<br />
Phasenvariationen ist wegen des<br />
bekannten Nordlochs der GPS-Satellitenkonfiguration<br />
erst bei Messung in mindestens zwei<br />
Ausrichtungen des Prüflings sinnvoll. Die<br />
SAPOS ® -Referenzstationsantennen werden<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
über einen Zeitraum von 4 x 24 Stunden kalibriert,<br />
wobei der Prüfling in seiner horizontalen<br />
Lage alle 24 Stunden um 90 Grad gedreht<br />
wird. Mit dieser Vorgehensweise sind die<br />
Lagekomponenten Nord und Ost des PCO-<br />
Vektors absolut bestimmbar, d.h. unabhängig<br />
von der Mutterantenne; sie sind nahezu frei<br />
von Mehrwegeeffekten. Dagegen werden die<br />
Höhenkomponenten des PCO und die PCV-<br />
Werte immer nur relativ bestimmt; sie beziehen<br />
sich auf die Mutterantenne. Nachteilig am<br />
relativen Feldverfahren ist der Einfluss der<br />
lokalen Mehrwegeeffekte und die nicht mögliche<br />
Ermittlung der horizontnahen Parameteranteile<br />
(Görres 2001, Schmitz et al. 2001,<br />
Wanninger 2002, Menge 2003, Becker et al.<br />
<strong>2006</strong>).<br />
Alle GPS-Antennen der SAPOS ® -Referenzstationen<br />
werden gemäß GPS-Richtlinien<br />
NRW Nr. 2.3.3 (3) individuell kalibriert und in<br />
der SAPOS ® -Vernetzung NRW verwendet.<br />
5 Auswertestrategie des LVermA NRW<br />
mit WaSoft/Kalib<br />
Laut AdV-Beschluß 10/3 vom 13.11.2002 sind<br />
die auf den SAPOS ® -Referenzstationen eingesetzten<br />
GPS-Antennen hinsichtlich elevationsund<br />
azimutabhängiger Phasenzentrumsvariationen<br />
für den Elevationsbereich 5 bis 90 Grad<br />
und den Azimutbereich 0 bis 360 Grad mit<br />
einer formalen Unsicherheit (RMS über den<br />
gesamten Winkelbereich) von ≤1 mm in L1<br />
und ≤1,5 mm in L2 zu kalibrieren.<br />
Die Auswertung der relativen Feldkalibrierung<br />
geschieht mit dem Programmsystem WaSoft/<br />
Kalib des Ingenieurbüros Wanninger. Das Programm<br />
unterstützt unterschiedliche Arten von<br />
Antennenkalibrierungen im relativen Feldverfahren.<br />
Die einsetzbaren Mess- und Auswerteverfahren<br />
unterscheiden sich im Beobachtungsaufbau,<br />
in der Wahl der gewünschten<br />
Korrektionsparameter und im Ausgabeformat<br />
(www.wasoft.de, Wanninger 2002).<br />
Die Kalibrierauswertung mit WaSoft/Kalib<br />
besteht aus zwei Teilschritten:<br />
1. Basislinienauswertung und<br />
2. Berechnung der Antennenkorrektionswerte.<br />
Das Kalibrierergebnis umfasst Korrektionswerte<br />
für das mittlere Antennenphasenzentrum<br />
(PCO) und Korrektionen für Phasenzentrumsvariationen<br />
(PCV). Für die SAPOS ® -Referenzstationsantennen<br />
wird der Berechnungsansatz<br />
„unbekannte Basislinie“ gewählt.<br />
Zwingende Voraussetzung für diesen Rechenansatz<br />
ist die Antennenrotation des Prüflings,<br />
da nur so eine präzise Bestimmung der Lage<br />
seines Phasenzentrums möglich ist. Die Beobachtungsdaten<br />
werden im 60-Sekundentakt<br />
aufgezeichnet. Aufgrund der kurzen Basislinie<br />
von ca. 4 m zwischen Mutterantenne und Prüfling<br />
können die Mehrdeutigkeiten einfach<br />
gelöst werden. Das Ergebnis ist praktisch frei<br />
von ionosphärischen und troposphärischen<br />
Fehlern.<br />
Mit Bezug auf das bekannte Phasenzentrum<br />
der Mutterantenne werden die Parameter des<br />
Prüflings bestimmt. Es werden zunächst die<br />
PCO-Werte ermittelt und danach die PCV-<br />
Werte über Kugelfunktionsentwicklungen<br />
modelliert. Die Wahl der Korrektionsparameter<br />
für die Mutterantenne bestimmt das Niveau<br />
der Antennenkorrektionen des Prüflings im<br />
Sinne einer Relativkalibrierung oder einer<br />
Absolutkalibrierung. Da für die Mutterantenne<br />
Parameter auf dem relativen und absoluten<br />
Niveau vorliegen, können mit den Beobachtungen<br />
aus dem relativen Feldverfahren beim<br />
Landesvermessungsamt NRW Parameter auf<br />
beiden Niveaus bestimmt werden. Für die beim<br />
LVermA NRW kalibrierten GPS-Antennen<br />
beziehen sich<br />
� die Kalibrierergebnisse auf relativem<br />
Niveau auf die Werte der Mutterantenne<br />
Trimble (TRM29659.00 TCWD<br />
Nr. 022011 7349), die vom Geodätischen<br />
Institut der Universität Bonn GIUB 1999<br />
bestimmt wurden,<br />
� die Kalibrierergebnisse auf absolutem Niveau<br />
auf die Werte derselben Mutterantenne<br />
Trimble, die von der Firma Geo++ ® 2002<br />
bestimmt wurden.<br />
Desweiteren liegen für die Mutterantenne und<br />
für den Prüfling die Kalibrierparameter Parameter<br />
in den Formaten IGS und ANTEX vor.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 67
Im SAPOS ® -Dienst werden absolute und relative<br />
Parameter verwendet.<br />
� Bei SAPOS ® -HEPS werden Antennenparameter<br />
aus der Absolutkalibrierung in die<br />
RTCM-Korrekturdaten der SAPOS ® -Referenzstationen<br />
vor dem Versenden eingerechnet<br />
und mit der Botschaft „ADVNUL-<br />
LANTENNA“ ausgesandt. Ist die Nullantenne<br />
in der Rover-Firmware implementiert,<br />
braucht der Nutzer keine Kenntnis<br />
vom Bezugsniveau der verwendeten Antennenparameter<br />
der SAPOS ® -Referenzstationsantennen<br />
zu haben, sondern kann dafür<br />
immer die „ADVNULLANTENNA“ wählen.<br />
� Die RINEX-Daten des SAPOS ® -GPPS<br />
sind nicht auf diese Weise vorab korrigiert,<br />
sondern stellen unveränderte Rohdaten mit<br />
Bezug zum elektrischen Phasenzentrum<br />
dar. Im Postprocessing ist nun dafür Sorge<br />
zu tragen, dass bei allen weiteren Berechnungen<br />
ein einheitliches (absolutes oder<br />
relatives) Niveau verwendet wird (Görres<br />
2001, Dick 2002, Becker et al. <strong>2006</strong>). Für<br />
die Postprocessing-Anwendungen GPPS<br />
werden in NRW individuelle Kalibrierungen<br />
auf IGS-Niveau (relatives Niveau) für<br />
SAPOS ® -Stationsantennen unter (http://<br />
www.lverma.nrw.de/produkte/raumbezug/SAPOS/antennenphasen/images/SAP<br />
OS_Ref-Ant_NRW.txt) zum Download<br />
bereitgestellt. Auch Typmittel für eine Auswahl<br />
von GPS-Antennen bietet das Landesvermessungsamt<br />
NRW seit April <strong>2006</strong><br />
zusätzlich im Internet an.<br />
Damit in Postprocessing-Anwendungen (z.B.<br />
mit den Programmen ViGO und WaSoft/Virtuell)<br />
auch die individuellen Korrektionswerte<br />
den SAPOS ® -Stationsantennen in NRW zugeordnet<br />
werden können, wird das IGS-Format<br />
vom LVerma NRW leicht modifiziert. An Stelle<br />
der gebräuchlichen Herstellerbezeichnung<br />
(Vendor) verwendet das LVermA NRW die<br />
Seriennummer der Antenne. Auf Anfrage sind<br />
für die SAPOS ® -Antennen auch Kalibrierwerte<br />
auf absolutem Niveau im ANTEX-Format<br />
erhältlich.<br />
68<br />
6 Vergleich verschiedener Kalibrierergebnisse<br />
Beim Vergleich von Kalibrierergebnissen dienen<br />
alle Datenformate nur zur Darstellung der<br />
PCO- und PCV-Werte (mit Elevation oder Elevation<br />
und Azimut). Problematisch bleibt der<br />
Vergleich von Kalibrierergebnissen verschiedener<br />
Quellen. Ursache dafür sind folgende<br />
Einflüsse:<br />
� Örtliche Kalibriersituation (z.B. Mehrwegeeffekte,<br />
Antennenträger),<br />
� Bezeichnung der Antenne (eindeutige Feststellung<br />
des Typs, Seriennummer),<br />
� Definition des ARP und der Nordausrichtung<br />
der GPS-Antenne,<br />
� Kalibrieraufbau (z.B. mit und ohne<br />
Radom),<br />
� Kalibrierverfahren (relative Feldkalibrierung,<br />
absolute Feldkalibrierung, Messkammer),<br />
� Messverfahren (z.B. 4 x 24 Stunden mit<br />
Rotation des Prüflings),<br />
� Auswerteprogramm,<br />
� Parametermodell (z.B. mit oder ohne PCV-<br />
Werte).<br />
Daraus folgt, dass ein Vergleich von Kalibrierergebnissen<br />
aus verschieden Quellen nur mit<br />
genauer Kenntnis des Kalibrieransatzes und<br />
mit geeigneter Software (z.B. CCANT, Wanninger<br />
2004), statthaft ist. PCO-Werte dürfen<br />
hier nie für sich alleine betrachtet werden, da<br />
sie immer im Zusammenhang mit den PCV-<br />
Werten stehen. Die Auswirkung der Korrektionswerte<br />
für die Observablen L1 und L2 auf<br />
die ionosphärenfreie Linearkomibination L0<br />
sind erheblich (Wübbena et al. 2003a, Menge<br />
2003, Becker et al. <strong>2006</strong>).<br />
Alle nachfolgenden Vergleichsrechnungen<br />
wurden mit dem Programm CCANT des Ingenieurbüros<br />
Wanninger durchgeführt. Das Programm<br />
ermöglicht die differenzierte Betrachtung<br />
von verschiedenen GPS- Antennenkorrektionen,<br />
u.a.:<br />
� Umwandlung von Datenformaten,<br />
� Wechsel zwischen Relativ-Niveau und Absolut-Niveau,<br />
� Vergleich von Einzelkalibrierergebnissen,<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
� Zusammenfassung von Einzelkalibrierergebnissen<br />
zu Typmitteln einer Baugruppe.<br />
In den nachfolgenden Tabellen werden folgende<br />
CCANT-Begriffe verwendet (Wanninger<br />
2004):<br />
� dy (Nord), dx (Ost), dh (Höhe) = Differenzen<br />
des individuellen PCO zum mittleren<br />
PCO (Typmittel).<br />
� PCV-RMS = Standardabweichung einer<br />
einzelnen Antenne, berechnet über alle<br />
PCV-Werte aus den Differenzen zwischen<br />
mittlerem (Typmittel) und individuellem<br />
Datensatz.<br />
� RMS_diff = quadratisches Mittel über alle<br />
Differenz-PCV-Werte. Dieser Wert ist für<br />
die Beurteilung zweier Datensätze ausschlaggebend:<br />
Standardabweichungen für<br />
L1 und L2 um einen Millimeter deuten auf<br />
eine gute Übereinstimmung hin.<br />
� max_diff = maximaler Wert aller Differenz-<br />
PCV-Werte.<br />
Die Differenzbildung in CCANT geschieht<br />
folgendermaßen:<br />
� die PCV-Werte werden über den Elevationsbereich<br />
von 5 bis 90 Grad betrachtet,<br />
� für beide Datensätze werden die PCO in die<br />
PCV hineingerechnet (die PCO betragen<br />
dann für Nord, Ost und Höhe Null, wobei<br />
sich die Gesamtkorrekturwirkung aber<br />
nicht ändert),<br />
� es werden die Differenzen der PCV berechnet,<br />
� aus diesen Differenzen werden neue PCO<br />
geschätzt und die Differenz-PCV entsprechend<br />
angepasst.<br />
7 Ergebnisvergleich aus verschiedenen<br />
Kalibriereinrichtungen<br />
7.1 Tabelle 1a und 1b: Ergebnisvergleich<br />
individueller Antennenkalibrierungen<br />
aus verschiedenen Kalibriereinrichtungen<br />
In einem ersten Vergleich werden für vier<br />
Antennen vom Typ Trimble-Zephyr-Geodetic<br />
(TRM41249.00 NONE) (Abb. 9) die Kalibrierergebnisse<br />
des LVermA NRW und der Firma<br />
Geo++ ® gegenübergestellt. Die Tabellen zei-<br />
gen die Differenzen der Kalibrierungsergebnisse<br />
dieser vier Antennen zwischen Geo++ ®<br />
(Roboter 4. Quartal 2004) und LVermA NRW<br />
(Messeinrichtung 4. Quartal 2004). Trotz<br />
unterschiedlicher Kalibriermethoden, Kalibrierorte<br />
und Auswerteprogramme stimmen<br />
die PCO und PCV dieser vier Trimble-Zephyr-<br />
Geodetic-Antennen gut überein. Die Tab. 1a<br />
zeigt Differenzen zwischen Kalibrierungen auf<br />
absolutem Niveau, wobei die Kalibrierungen<br />
des LvermA mit einer Mutterantenne vorgenommen<br />
wurden, die durch Geo++ ® absolut<br />
kalibriert wurde. Die Tab. 1b enthält Differenzen<br />
zwischen Kalibrierungen auf relativem<br />
Niveau, wobei die Mutterantenne des LVermA<br />
durch das Geodätische Institut der Universität<br />
Bonn kalibriert wurde.<br />
Die Differenzen der Lageoffsets (dy, dx) liegen<br />
für L1 und L2 im Submillimeterbereich. Die<br />
Differenzen der Höhenoffsets (dh) liegen unter<br />
1,6 mm, lediglich die Antenne #948 weist für<br />
die L1-Frequenz eine ungeklärte Differenz von<br />
-2,3 mm auf. Für die Beurteilung der Übereinstimmung<br />
der PCV ist der Wert RMS_diff ausschlaggebend.<br />
Die Standardabweichungen für<br />
L1 und L2 streuen nur im Submillimeterbereich<br />
und bedeuten eine gute Übereinstimmung.<br />
7.2 Tabelle 1c:Vergleich von Typmitteln aus<br />
verschiedenen Kalibriereinrichtungen<br />
Um eine Aussage zur Übereinstimmung der<br />
Kalibrierwerte des NGS mit denen des Landesvermessungsamtes<br />
NRW machen zu können,<br />
wurden beispielhaft die Typmittel von<br />
Trimble-Zephyr-Geodetic-Antennen (Abb. 9)<br />
verglichen. In Tabelle 1c liegen die Differenzen<br />
der Lageoffsets (dy, dx) für L1 und L2 im<br />
Submillimeterbereich. Die Differenzen der<br />
Höhenoffsets (dh) betragen für L1 weniger als<br />
1 Millimeter, lediglich für L2 erhöht 3 Millimeter.<br />
Berechnet man eine ionosphärenfreie<br />
Linearkombination L0, wirken sich diese Differenzen<br />
in der Höhenkomponente mit etwa<br />
6 mm aus.<br />
Ein Vergleich der Typmittel von Trimble-Choke-Ring-Antennen<br />
ist nicht möglich, da bei<br />
den Kalibrierungen des NGS eine andere Wetterschutzhaube<br />
(Radom) verwendet wurde<br />
sowie Nordrichtung und ARP nicht beschrie-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 69
70<br />
Tab. 1a: Differenzen individueller Kalibrierungen von vier Trimble-Zephyr-Geodetic-Antennen (TRM41249.00 NONE)<br />
auf absolutem Niveau<br />
Tab. 1b: Differenzen individueller Kalibrierungen von vier Trimble-Zephyr-Geodetic-Antennen (TRM41249.00 NONE)<br />
auf relativem Niveau<br />
Tab. 1c: Differenzen der Typmittel des LVermA NRW und<br />
des NGS der Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne<br />
(TRM41249.00 NONE), 18 Antennen LVermA NRW und<br />
4 Antennen NGS auf relativem Niveau<br />
Abb. 9: Trimble-Zephyr-Geodetic-Antennen<br />
(TRM41249.00 NONE)<br />
(Foto: Galitzki)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
en sind. Deshalb sind Typmittel des NGS von<br />
den SAPOS ® -Betreibern für die Referenzstationsantennen<br />
nicht zu verwenden.<br />
8 Ergebnisvergleich individueller und<br />
typspezifischer Antennenparameter<br />
Zur Überprüfung der Produktgleichheit innerhalb<br />
der Fertigungstoleranz von GPS-Antennen<br />
wurden mit dem Programm CCANT Typmittel<br />
gerechnet. Bei der Berechnung des<br />
Typmittels werden individuelle Kalibrierdatensätze<br />
von baugleichen Antennen zu einem<br />
Kalibrierdatensatz zusammengefasst. Nach<br />
einer gemeinsamen Neuberechnung der PCOund<br />
PCV-Werte für jeden einzelnen Datensatz<br />
und einer Mittelbildung aller Datensätze werden<br />
hier die Differenzen zwischen mittlerem<br />
Datensatz (Typmittel) und den einzelnen Datensätzen<br />
ausgegeben. Die Darstellung erfolgt<br />
getrennt für L1 und L2 und besteht jeweils aus<br />
den PCO-Werten für Nord/Ost/Höhe und der<br />
Standardabweichung PCV-RMS.<br />
8.1 Tabelle 2a: Typmittelberechnung aus 6<br />
Spectra-Precision-Choke-Ring-Antennen<br />
(SPP571908273 SPKE)<br />
Bisherige Erfahrungen der IGS-Beteiligten<br />
haben gezeigt, dass die Parameterwerte zwischen<br />
einer Individualkalibrierung und einem<br />
Typmittel (z.B. von IGS oder NGS) bis zu<br />
wenigen Zentimetern differieren können.<br />
Tab. 2a: Typmittel aus 6 Spectra-Precision-Choke-Ring-<br />
Antennen (SPP571908273 SPKE), Feldkalibrierung<br />
beim LVermA NRW auf relativem Niveau; gegenläufige<br />
Lageoffsets sind farbig hinterlegt (in der Internetversion)<br />
Offenbar gibt es auch Antennentypen mit Bauuntergruppen,<br />
deren PCV-Werte um 180 Grad<br />
gedreht sind, was auf entsprechende Änderungen<br />
im elektrischen bzw. mechanischen Aufbau<br />
der Antennen einer Typreihe hindeutet<br />
(Schmid et al. 2004). In der ersten Ausbaustufe<br />
von SAPOS ® -NRW wurden u.a. sechs Spectra-Precision-Choke-Ring-Antennen<br />
(Abb. 2,<br />
10a und 10b) eingesetzt.<br />
Abb. 10a: Spectra-Precision-Choke-Ring-Antenne<br />
(SPP571908273), hier ohne Radom (Foto: Galitzki)<br />
Abb. 10b: Spectra-Precision-Choke-Ring-Antenne<br />
(SPP571908273 SPKE), hier mit Radom (Foto: Galitzki)<br />
Die Berechnung des Typmittels aus den sechs<br />
individuellen Datensätzen mit CCANT zeigt<br />
deutlich, dass dieser Antennentyp große<br />
gegenläufige Lageoffsets hat.<br />
Die Spectra-Precision-Choke-Ring-Antennen<br />
wurden von der U.S.-amerikanischen Firma<br />
AeroAntenna Technologies hergestellt. Die<br />
Konstruktion der Antenne erlaubt einen um<br />
180 Grad gedrehten Einbau der Antennenteile<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 71
(Patches, Abb. 2) für L1 und L2 im Antennengehäuse.<br />
Daraus folgt, dass eine uneinheitliche<br />
Nordausrichtung möglich ist und somit auch<br />
unterschiedliche Werte für die Lageexzentriztäten<br />
bei verschiedenen Antennen der gleichen<br />
Baureihe auftreten können. Hieraus erklären<br />
sich die umgekehrten Vorzeichen der Exzentrizitäten<br />
für Nord und Ost bei den Ergebnissen<br />
in Tab. 2a. Für diesen Antennentyp sollten deshalb<br />
keine Typmittel, sondern nur individuelle<br />
Kalibrierdatensätze verwendet werden. Ansonsten<br />
kann es zu Fehlern in der Lagebestimmung<br />
von bis zu 2 cm kommen.<br />
8.2 Tabelle 2b: Typmittelberechnung aus<br />
15 Trimble-Choke-Ring-Antennen mit<br />
Radom (TRM29659.00 TCWD)<br />
Die Trimble-Choke-Ring-Antenne (Abb. 11a<br />
und 11b) ist speziell für den stationären Einsatz,<br />
z.B. in Referenzstationsnetzen, konzipiert.<br />
Beim Aufbau des SAPOS ® -Referenzstationsnetzes<br />
in NRW wurden bis 2005 überwiegend<br />
diese Antennen mit Wetterschutzhaube<br />
(Abb. 11b) verwendet. Die 15 Antennen<br />
stimmen fertigungstechnisch gut überein.<br />
Nach Tab. 2b betragen die Differenzen der<br />
individuellen Lageoffsets für L1 und L2 zum<br />
Typmittel etwa 1 mm. Erwartungsgemäß sind<br />
die Höhenoffsets etwa zweifach größer, maximal<br />
–2,3 mm.<br />
72<br />
Abb. 11a: Trimble-Choke-Ring-Antenne (TRM29659.00)<br />
ohne Radom (Foto: Galitzki)<br />
Abb. 11b: Trimble-Choke-Ring-Antenne<br />
(TRM29659.00 TCWD) hier mit Radom (Foto: Galitzki)<br />
Tab. 2b: Typmittel aus 15 Trimble-Choke-Ring-Antennen (TRM29659.00 TCWD) mit Radom, Feldkalibrierung<br />
beim LVermA NRW auf relativem Niveau.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
8.3 Tabelle 2c:Typmittelberechnung aus 18<br />
Trimble-Zephyr-Geodetic-Antennen<br />
(TRM41249.00 NONE)<br />
Die Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne hat<br />
eine ähnlich hohe Produktgleichheit (Fertigungstoleranz)<br />
wie die Trimble-Choke-Ring-<br />
Antenne. Auch hier deuten in Tab. 2c die kleinen<br />
Differenzen der individuellen PCO zum<br />
Typmittel in dx, dy und dh sowie in PCV-RMS<br />
auf eine hohe fertigungstechnische Übereinstimmung<br />
der einzelnen Antennen hin. Die<br />
Trimble-Zephyr-Geodetic-Antennen werden<br />
z.Z. auf 18 der 27 SAPOS ® -Referenzstationen<br />
in NRW eingesetzt.<br />
Die Abbildungen 12a und b zeigen die gute<br />
Übereinstimmung der 18 individuellen elevationsabhängigen<br />
PCV-Werte gegenüber ihren<br />
Typmitteln in L1 und L2 auf relativem Niveau.<br />
Die Abweichungen zum Typmittel sind auch<br />
darin begründet, das die individuellen PCO-<br />
Werte nicht vorab auf einen Mittelwert gezwängt<br />
worden sind.<br />
Abb. 12a und 12b: Individuelle Kalibrierergebnisse und<br />
Typmittel von 18 Timble-Zephyr-Geodetic-Antennen<br />
(TRM41249.00 NONE); elevationsabhängige PCV,<br />
relatives Niveau, Feldkalibrierung beim LVermA NRW;<br />
Typmittel mit großen Rauten dargestellt<br />
Tab. 2c: Typmittel aus 18 Trimble-Zephyr-Geodetic-<br />
Antennen (TRM41249.00 NONE), Feldkalibrierung<br />
beim LVermA NRW auf relativem Niveau<br />
Die Abbildungen 13a und b enthalten die<br />
Typmittel in L1 und L2 der elevationsabhängigen<br />
PCV-Werte auf absolutem Niveau.<br />
Abb. 13a und 13b: PCV-Typmittel der 18 Timble-Zephyr-<br />
Geodetic-Antennen (TRM41249.00 NONE), dargestellt<br />
mit dem NRW-Programm BIANKA für L1 und L2;<br />
Zenitwinkel 0 o im Zentrum; absolutes Niveau,<br />
Feldkalibrierung beim LVermA NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 73
9 Kalibrierung unter verschiedenen<br />
Montagebedingungen (Grundplatte,<br />
Radom, Dreifuß)<br />
Der Einfluss eines veränderten Nahfeldes<br />
(Montage der Antenne) und seine elektrische<br />
Kopplung können das Empfangsverhalten der<br />
Antenne verändern (Wübbena et al. 2003b,<br />
Becker et al. <strong>2006</strong>). Die Kalibrierergebnisse<br />
wurden an folgenden drei Fällen untersucht:<br />
� Antenne mit Grundplatte,<br />
� Antenne mit Grundplatte und Radom,<br />
� Antenne mit zweitem Dreifuß über Grundplatte<br />
mit Radom.<br />
9.1 Tabelle 3a: Trimble-Zephyr-Geodetic-<br />
Antenne mit Grundplatte<br />
Die Montage einer Grundplatte unter einer<br />
Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne (Abb. 14)<br />
bewirkt eine Änderung beim L1–Höhenoffset<br />
von +1,89 mm und beim L2 –Höhenoffset von<br />
–1,10 mm (Tab. 3a). Die PCV-Werte weisen<br />
Differenzen von bis zu 4 mm aus.<br />
Tab. 3a: Differenzen der Antennenparameter einer<br />
Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne (TRM41249.00) mit<br />
bzw. ohne Grundplatte bei Feldkalibrierung des<br />
LVermA NRW auf relativem Niveau<br />
9.2 Tabelle 3b: Trimble-Zephyr-Geodetic-<br />
Antenne mit Grundplatte und Radom<br />
Die Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne wird<br />
auf den Referenzstationen in der Regel ohne<br />
Wetterschutzhaube (Radom) eingesetzt (Abb.<br />
9 und 15). Allerdings ist es sinnvoll, in Mittelgebirgslagen<br />
die Antenne durch Montage eines<br />
Radomes mit Grundplatte gegen Witterungseinflüsse<br />
zu schützen. Der Einfluss dieser<br />
Montage auf das Kalibrierergebnis (Tab. 3b)<br />
beträgt beim L1-Höhenoffset –3,18 mm und<br />
beim L2-Höhenoffset –2,16 mm. Die PCV-<br />
74<br />
Werte weisen Differenzen von bis zu 5 mm<br />
aus. Erfahrungen mit Eis und Schnee auf der<br />
GPS-Antenne liegen bei den eigenen Kalibrierungen<br />
nicht vor.<br />
Tab. 3b: Differenzen der Typmittel einer Trimble-Zephyr-<br />
Geodetic-Antenne (TRM41249.00) mit Trimble Conical<br />
Weather Dome (TCWD) bzw. ohne (NONE),<br />
Feldkalibrierung beim LVermA NRW auf relativem<br />
Niveau<br />
Abb. 14 Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne<br />
(TRM29659.00) mit Grundplatte auf Dreifuß<br />
(Foto: Galitzki)<br />
9.3 Tabelle 3c: Trimble-Zephyr-Geodetic-<br />
Antenne mit zweitem Dreifuß über<br />
Grundplatte im Radom<br />
Auch die Veränderung des Abstandes zwischen<br />
Antenne und Grundplatte durch Montage<br />
eines zusätzlichen Dreifußes im Radom<br />
(Abb. 15) hat einen signifikanten Einfluss auf<br />
das Empfangsverhalten (Tab. 3c). Dieser<br />
erhöhte Abstand von der Grundplatte wirkt auf<br />
den L1–Höhenoffset mit –3,61 mm und beim<br />
L2–Höhenoffset mit +6,73 mm. Die maximalen<br />
Differenzen bei den PCV-Werten betragen<br />
ca. 7 mm.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Tab. 3c: Differenzen der Antennenparameter einer<br />
Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne (TRM41249.00<br />
TCWD) mit bzw. ohne Dreifuß über Grundplatte im<br />
Radom, Feldkalibrierung beim LVermA NRW auf<br />
relativem Niveau<br />
Abb. 15: Trimble-Zephyr-Geodetic-Antenne<br />
(TRM29659.00) mit zusätzlichem Dreifuß auf<br />
Grundplatte, hier ohne Radom<br />
(Foto: Galitzki)<br />
Fazit: Diese drei Untersuchungen (Tab. 3a bis<br />
3c) verdeutlichen, dass Veränderungen im<br />
Nahfeld (Montage) der Antenne signifikante<br />
Auswirkungen auf das Empfangsverhalten<br />
haben. Es stellte sich heraus, dass hierbei die<br />
Höhenoffsets und auch die PCV-Werte bei L1<br />
und L2 Differenzen von mehreren Millimetern<br />
aufweisen. Bei Auswertungen mit der Linearkombination<br />
L0 können sie Höhenfehler von<br />
bis zu 2 cm zur Folge haben. Demgegenüber<br />
sind die Lagekomponenten durch die unterschiedliche<br />
Montage nicht signifikant beeinflusst.<br />
Die Betreiber von Referenzstationsnetzen<br />
haben daher zwingend Sorge zu tragen,<br />
dass der Kalibrieraufbau mit dem Referenzstationsaufbau<br />
übereinstimmt.<br />
10 Wiederholung und Alterung der<br />
Kalibrierergebnisse<br />
10.1 Tabelle 4: Wiederholung der Antennenkalibrierung<br />
Für eine Antenne Trimble microcentered<br />
L1/L2 w gp (TRM 33429.00+GP, #445,<br />
Abb. 16) ergaben die beiden direkt zeitlich<br />
aufeinanderfolgenden Kalibrierungen, dass die<br />
PCO-Werte im Submillimeterbereich übereinstimmen<br />
und somit die Kalibriersituation an<br />
diesen Tagen ausreichend stabil war (Tab. 4).<br />
Die Feldkalibrierungen auf relativem Niveau<br />
liefen an den Tagen 346 bis 350 und 351 bis<br />
354 des Jahres 2000, jeweils über 4 x 24 Stunden.<br />
Tab. 4: Wiederholung der Kalibrierung einer Trimble-<br />
Microcentered-Antenne mit Grundplatte<br />
(TRM33429.00+GP) im Jahr 2000 (Tage 346 und 351)<br />
Feldkalibrierung auf relativem Niveau<br />
Abb. 16: Trimble-Microcentered-Antenne<br />
(TRM33429.00+GP) mit Grundplatte<br />
(Foto: Galitzki)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 75
10.2 Tabelle 5:Alterung einer Trimble-<br />
Choke-Ring-Antenne<br />
Es ist nicht auszuschließen, dass die Antennenparameter<br />
einiger GPS-Antennen sich<br />
langfristig durch technische Alterung signifikant<br />
ändern. RTK-Feldantennen altern vermutlich<br />
stärker als Choke-Ring-Antennen<br />
(Wübbena et al. 2003a). Im Februar 2001 wurde<br />
eine Trimble-Choke-Ring-Antenne beim<br />
Landesvermessungsamt NRW erstmals kalibriert.<br />
Diese Antenne wurde nach vier Jahren<br />
Einsatz auf einer SAPOS ® -Referenzstation im<br />
Januar 2005 erneut unter vergleichbaren Bedingungen<br />
kalibriert. Der Vergleich der Kalibrierwerte<br />
von 2001 und 2005 zeigt lediglich<br />
eine Änderung von max. -1,6 mm im L2-Ostwert<br />
(Tab. 5). Berücksichtigt man, dass bei der<br />
wiederholten Kalibrierung die Differenzen im<br />
Submillimeterbereich liegen, kann die Differenz<br />
im L2-Ostwert zwar als signifikant bezeichnet<br />
werden, jedoch ist hieraus noch nicht<br />
auf eine Veränderung der Empfangseigenschaften<br />
durch technische Alterung zu<br />
schließen. Hierzu sind weitere, langjährigere<br />
Kalibrierwiederholungen erforderlich.<br />
Tab. 5: Alterung einer Trimble-Chokering-Antenne mit<br />
Radom (TRM29659.00 TCWD), Feldkalibrierung beim<br />
LVermA NRW auf relativem Niveau im<br />
Februar 2001 und Januar 2005<br />
11 Zusammenfassung<br />
Der Vergleich der Kalibrierergebnisse des<br />
LVermA NRW mit anderen Kalibrierstellen<br />
zeigt eine gute Übereinstimmung und bestätigt<br />
die bisherige Vorgehensweise bei der Antennenkalibrierung<br />
des LVermA NRW. Sowohl die<br />
Relativergebnisse als auch die Absolutergebnisse<br />
sind mit den entsprechenden Ergebnissen<br />
76<br />
anderer Stellen gleichwertig. Die Anforderungen<br />
nach Nr. 2.1.6 der GPS-Richtlinien NRW<br />
(Stand vom 23.09.2005) zur GPS-Antennenkalibrierung<br />
werden voll erfüllt. Alle zur Zeit<br />
eingesetzten SAPOS ® -Referenzstationsantennen<br />
in NRW sind individuell kalibriert; sie weisen<br />
innerhalb ihrer Baugruppen eine hohe Fertigungstoleranz<br />
auf. Somit können auch<br />
SAPOS ® -Nutzer mit hochpräzisen Anwendungen<br />
bedient werden. Dagegen reichen den<br />
SAPOS ® -Anwendern bei Katasterfortführungsvermessungen<br />
die Typmittel für die<br />
Referenzstationsantennen in NRW aus. Die<br />
Ergebnisvergleiche haben bestätigt, dass die<br />
Antennenmontagen vor Ort mit den entsprechenden<br />
Kalibriermontagen übereinstimmen<br />
müssen.<br />
Die Antennenkalibrierungen werden auch<br />
künftig beim LVermA NRW fortgeführt.<br />
Wesentliche Aspekte sind dabei die Untersuchung<br />
zur möglichen technischen Alterung<br />
von Antennen und zu verschiedenen Antennenmontagen.<br />
Eine messtechnisch wünschenswerte<br />
Stationskalibrierung in situ ist für<br />
die Zukunft denkbar, jedoch bis heute wirtschaftlich<br />
nicht realisierbar.<br />
Literaturangaben:<br />
Becker, M., E. Schönemann, P. Zeimetz: Gelöste<br />
und ungelöste Probleme der Antennenkalibrierung.<br />
In: Elliot Gordon (Hg.), GPS und GALILEO, 66.<br />
DVW-Seminar in Darmstadt, Augsburg <strong>2006</strong>, 189-<br />
208.<br />
Campbell, J., B. Görres, M. Siemes, J.Wirsch, M.<br />
Becker: Zur Genauigkeit der GPS-Antennenkalibrierung<br />
auf der Grundlage von Labormessungen<br />
und deren Vergleich mit anderen Verfahren. In: AVN<br />
1/2004, 2-11.<br />
Dick, H.-G.: GNSS-Antennen im SAPOS ® -Baden-<br />
Württemberg. In: Bernhard Heck und Michael Illner<br />
(Hg.), GPS 2002: Antennen, Höhenbestimmungen<br />
und RTK-Anwendungen, 57. DVW-Seminar in Karlsruhe,<br />
Stuttgart 2002, 136-148.<br />
Görres, B.: Kalibrierung von GPS-Antennen. In:<br />
Rolf Bull (Hg.), GPS-Referenzstationsdienste –<br />
GPS-Antennen, Koordinatensysteme und Transformationen,<br />
VDV-Schriftenreihe Band 19, Wiesbaden<br />
2001, 31-46; desgl. in: Hans Heister und Rudolf<br />
Staiger (Hg.), Qualitätsmanagement in der geodätischen<br />
Messtechnik, 54. DVW-Seminar in Fulda,<br />
Stuttgart 2001, 206-221.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Krantz, E., S. Riley, P. Large: Neuheiten in der<br />
GPS-Antennentechnologie: Die neuen Trimble<br />
Zephyr-Antennen. White paper, Trimble Navigation<br />
Limited, Sunnyvale, California, USA 2001.<br />
Menge, F.: Zur Kalibrierung der Phasenzentrumsvariationen<br />
von GPS-Antennen für die hochpräzise<br />
Positionsbestimmung. Diss. 2003, Wissenschaftliche<br />
Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen<br />
der Universität Hannover, Nr. 247, Hannover 2003.<br />
Rothacher M. und R. Schmid: GPS-Antennenkalibrierungen<br />
aus nationaler und internationaler<br />
Sicht., In: Landesvermessung und Geobasisinformation<br />
Niedersachsen (LGN) (Hg.), 4. SAPOS ® -<br />
Symposium, Hannover 2002, 124-131.<br />
Schmid, R., G. Mader, T. Herring: From Relative<br />
to Absolute Antenna Phase Center Corrections.<br />
Position Paper, IGS Workshop und Symposium in<br />
Bern März 2004.<br />
Schmitz, M., G. Böttcher, G. Wübbena: Konzept<br />
und Handhabung der NULLANTENNA in GNSS-<br />
Anwendungen. White Paper, Geo++ ® , Garbsen 2005<br />
(www.geopp.de).<br />
Schmitz, M., G. Wübbena, G. Böttcher: Umrechnung<br />
des Niveaus von GPS Antennenkalibrierungen.<br />
White Paper, Geo++ ® , Garbsen 2001<br />
(www.geopp.de).<br />
Spata, M.: Die Bedeutung der Kalibrierung in der<br />
amtlichen Vermessung. In: Hans Heister und Rudolf<br />
Staiger (Hg.), Qualitätsmanagement in der geodätischen<br />
Messtechnik, 54. DVW-Seminar in Fulda,<br />
Stuttgart 2001, 91-105.<br />
Wanninger, L.: Möglichkeiten und Grenzen der<br />
relativen GPS-Antennenkalibrierung. In: ZfV<br />
1/2002, 51-58.<br />
Wanninger, L.: Anleitung CCANT Version 2.1,<br />
07/2004 (www.wasoft.de).<br />
Wübbena, G., M. Schmitz, G. Böttcher: Analyse<br />
umfangreicher Messreihen von GPS-Antennen-<br />
PCV aus absoluten Roboter-Feldkalibrierungen seit<br />
Januar 2000. In: 5. GPS-Antennen-Workshop,<br />
Frankfurt am Main 2003a.<br />
Wübbena, G., M. Schmitz, G. Böttcher: Zum Einfluss<br />
des Antennennahfeldes. In: 5. GPS-Antennen-<br />
Workshop, Frankfurt am Main 2003b.<br />
Manfred Spata<br />
Bernhard Galitzki<br />
Klaus Strauch<br />
Heidrun Zacharias<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
Muffendorfer Str. 19-21<br />
53177 Bonn<br />
E-Mail:<br />
spata@lverma.nrw.de<br />
galitzki@lverma.nrw.de<br />
strauch@lverma.nrw.de<br />
zacharias@lverma.nrw.de<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 77
Neue Mess-Schiene mit CFK-Stab zur EDM-Eichung beim LVermA NRW<br />
Von Walter Knapp<br />
1 Einleitung<br />
Die Hersteller elektronischer Tachymeter (Firmen<br />
wie Leica, Sokkia, Topcon oder Trimble)<br />
stellen u.a. EDM-Instrumente her, die teilweise<br />
noch nach dem Phasenmessverfahren arbeiten.<br />
Im Gegensatz zu EDM-Instrumenten, die<br />
nach dem Impulsmessverfahren arbeiten, fällt<br />
hier eine zyklische Korrektion an, deren Größe<br />
experimentell auf einer Mess-Schiene oder<br />
einem Laserinterferenzkomparator zu ermitteln<br />
ist. Für Nordrhein-Westfalen ist dies generell<br />
in Nr. 16 Vermessungspunkterlass (IM<br />
NRW 1996) und für die Gruppe der elektronischen<br />
Tachymeter (EDM) in dem Ergebnisbericht<br />
der Arbeitsgruppe EDM-Eichrichtlinien<br />
festgelegt (IM NRW 2003, Knapp und Spata<br />
2004). Im Herbst 2005 erhielt das LVermA<br />
NRW für seine Mess-Schiene einen neuartigen<br />
Karbonfaserstab (CFK), über dessen Installation<br />
kurz berichtet wird.<br />
2 Beschreibung des zyklischen<br />
Phasenfehlers<br />
Bei allen EDM-Instrumenten mit Phasenmessungen<br />
sind grundsätzlich drei Korrektionen<br />
bei einer Streckenmessung zu berücksichtigen,<br />
und zwar eine<br />
� Nullpunktkorrektion,<br />
� Maßstabskorrektion,<br />
� Zyklische Korrektion.<br />
Die zyklische Einflussgröße wird in der Regel<br />
durch eine gleichmäßig wiederholende Sinus-<br />
Schwingung mit der Periode des Feinmaßstabes<br />
modelliert. Der Feinmaßstab ist lediglich<br />
eine Rechengröße und entspricht der halben<br />
Modulationswellenlänge �. Die Wellenlänge �<br />
errechnet sich aus Lichtgeschwindigkeit c (im<br />
Vakuum) und Frequenz f (Schwarz und Fröhlich<br />
1982, Joeckel und Stober 1999, LVermA<br />
NRW 2003).<br />
Bedingt durch Fehler in den Bauteilen, durch<br />
die Konstruktion selbst oder unvermeidbare<br />
Einflüsse wie Temperaturschwankungen infolge<br />
Aufheizeffekten oder fehlender Akklimati-<br />
78<br />
sierung des Instrumentes müssen Korrektionen<br />
angebracht werden. Von Herstellerseite<br />
wird über die implementierte Software ganz<br />
erheblich in den Fehlerhaushalt der Streckenmessung<br />
eingegriffen, indem ein Teil der systematischen<br />
Abweichungen rechnerisch eliminiert<br />
wird. Im Labor der Hersteller werden<br />
vorweg die Fehlergrößen bestimmt und im<br />
Instrument abgespeichert. Der Prüfer vor Ort<br />
ermittelt nur noch Restfehler, die das Messergebnis<br />
nicht stärker als 2 mm beeinflussen dürfen<br />
(Bild 1 und 2).<br />
Abb. 1: Zyklischer Phasenfehler eines älteren Tachymeters<br />
Abb. 2: Zyklischer Phasenfehler eines neueren Tachymeters<br />
Zur Erfassung des zyklischen Fehlers mit dem<br />
Auswerteprogramm AED2002 wird eine Fourierreihe<br />
zweiten Grades angesetzt. Sie besteht<br />
aus 4 Unbekannten K(11), K(12), K(21),<br />
K(22) sowie dem Koeffizienten K(00), der den<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
plausibelsten Abstand vom Instrumentenstandpunkt<br />
bis zur ersten Prismenmessung<br />
repräsentiert (LVermA 2002, IM NRW 2003).<br />
3 Beschreibung der Mess-Schiene<br />
Infolge der rasanten Entwicklung in der Elektronik<br />
bzw. durch die Entwicklung in der Telekommunikation<br />
(z.B. UMTS) waren auf dem<br />
Markt elektronische Teile zu erhalten, die von<br />
den Instrumentenherstellern nicht mehr mit<br />
großen Kosten selbst entwickelt und hergestellt<br />
werden mussten. Dadurch wurden die<br />
Feinmaßstäbe der Tachymeter in den vergangenen<br />
Jahrzehnten immer kleiner, von maximal<br />
33 m bis auf 10 m. Heute liegen gängige<br />
Feinmaßstäbe zwischen 10 m (ca. 15 MHz)<br />
und 1,50 m (100 MHz)vor, und sogar Instrumente<br />
bis zu einem Feinmaßstab von 0,37 m<br />
werden von Trimble angeboten.<br />
Die im Eichlabor des LVermA vorhandene 25<br />
m lange Mess-Schiene aus Stahl, die für den<br />
bisher gängigen Feinmaßstab von 10 m im<br />
Gebrauch ist, hat Messpunkte im Abstand von<br />
1 m. Die Punktabstände sind mit übergeordneter<br />
Genauigkeit von s = 0,3 mm durch die<br />
RWTH Aachen bestimmt. Kleinere Feinmaßstäbe<br />
können wegen der dann geringeren Anzahl<br />
von Messpunkten nicht aussagekräftig<br />
überprüft werden. Daher war es erforderlich,<br />
weitere Messpunkte auf der Schiene einzubringen.<br />
Dies wurde durch eine neue Mess-<br />
Schiene vom Geodätischen Institut der Universität<br />
Bonn realisiert. Sie besteht aus dem<br />
Alu-Körper einer Präzisions-Nivellierlatte als<br />
Träger, in die ein CFK-Stab (carbonfaserverstärkter<br />
Kunststoff) von 3 m gelegt und befestigt<br />
ist. Der CFK-Werkstoff zeichnet sich<br />
durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit und<br />
eine sogenannte „Nulldehnung“ aus. In diesem<br />
Karbonfaserstab sind 93 Bohrungen mit einer<br />
Messingbuchse im Abstand von 3,1 cm fixiert<br />
und auf 1/100 mm eingemessen. Mit 3 Winkelhalterungen<br />
ist die horizontal ausgerichtete<br />
Schiene an der Wandfläche befestigt. Auf der<br />
Schiene selbst befindet sich ein fahrbares Prisma<br />
mit einer Zentriereinheit für die Messingbuchsen<br />
(Bild 3).<br />
Um bei einem Prüfvorgang bei 93 Punkten<br />
nicht die Übersicht zu verlieren, sind auf dem<br />
seitlichen Alu-Körper Hinweise für die Feinmaßstäbe<br />
von 0,37 m, 0,50 m, 0,75 m, 1,50 m,<br />
2,00 m und 3,00 m angebracht. Die EDM-<br />
Eichrichtlinie empfiehlt, mindestens 15 Punkte<br />
gleichmäßig über den Feinmaßstab zu verteilen.<br />
Für den derzeit kürzesten Feinmaßstab<br />
von 0,37 m ist das nur suboptimal mit 13 Punkten<br />
realisierbar.<br />
Abb. 3: Mess-Schiene mit CFK-Stab und Prisma<br />
4 Beschreibung der Instrumentenhalterung<br />
Der Kellerflur, in dem sich Mess-Schiene und<br />
Instrumentenstandpunkt befinden, ist lang,<br />
aber schmal und wird zudem als Durchgang zu<br />
anderen Eichräumen (Nivellierlattenkomparator<br />
und der EDM-Frequenzmessplatz) genutzt.<br />
Fällige Flucht- und Rettungswege könnten<br />
durch das Aufstellen eines Statives oder gar<br />
einer festmontierten Instrumentenaufnahme in<br />
Flurmitte versperrt werden. So kam die Idee<br />
auf, eine dauerhafte Instrumentenhalterung<br />
(Konsole, Bild 4) seitlich an der Wand zu befestigen.<br />
Abb. 4: Mess-Schiene mit CFK-Stab und Prisma<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 79
Die feste Höhe der Konsole beträgt 1,40 m, so<br />
dass die Beobachtungshöhe am Instrument<br />
(Okular) unter Berücksichtigung einer mittleren<br />
Körpergröße des Prüfers bei ca. 1,65 m<br />
liegt. Die Messung selbst erfolgt in horizontaler<br />
Visur mit einem Abstand von ca. 22 m bis<br />
zum CFK-Stab.<br />
5 Ablauf einer Eichmessung<br />
Die Werte von Temperatur und Luftdruck zur<br />
meteorologischen Korrektion sind wie immer<br />
vor der Messung in das Instrument einzugeben.<br />
Als Vordruck zum Aufschreiben der einzelnen<br />
Messungsergebnisse kann Verm. Vordruck<br />
27.2 „Eichung elektrooptischer Distanzmessgeräte<br />
– Erfassungsbeleg“ (LVermA<br />
NRW 2002) oder sonst jede Art der Speicherung<br />
von Messwerten genutzt werden. Das<br />
fahrbare Prisma befindet sich auf dem Alu-<br />
Körper und wird vom LVermA zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Die erste Messung beginnt von der Konsole<br />
zum Anfangspunkt des CFK-Stabes. Diese<br />
Strecke ist unbekannt; in der AED-Auswertung<br />
wird diese Strecke mit K(00) bezeichnet.<br />
Mit dem Verschieben des Prismas vom<br />
Anfangspunkt um einen konstanten Betrag<br />
zum nächsten Punkt, abhängig vom Feinmaßstab,<br />
beginnt der Streckenvergleich zur Bestimmung<br />
der zyklischen Korrektion. Nachdem<br />
mindestens 15 Punkte bis zur Markierung<br />
des entsprechenden Feinmaßstabes angemessen<br />
worden sind, kann eine Auswertung mit<br />
dem Auswerteprogramm AED2002 oder<br />
einem anderen EDM-Auswerteprogramm erfolgen.<br />
Wird die Auswertung der Messung mit dem<br />
Programm AED2002 durch das LVermA ausgeführt,<br />
erfolgt eine Dokumentation der Auswerteergebnisse<br />
in einem Eichzeugnis. Gemäß<br />
Nr. 2.3(3) des Ergebnisberichtes (IM NRW<br />
2003) ist in einem Abstand von 3 Jahren diese<br />
Überprüfung zu wiederholen.<br />
Die Nutzung der Mess-Schiene durch Dritte ist<br />
kostenfrei. Hierbei sind in der Regel zwei Personen<br />
erforderlich. Die Auswertung durch das<br />
LVermA ist für Zwecke nichthoheitlicher Messungen<br />
kostenpflichtig. Ein Instrumentenuntersatz<br />
(Dreifuß) mit einem 5/8 "-Gewindeloch<br />
80<br />
zur Verbindung Konsole-Prüfling ist mitzubringen.<br />
Eine Terminabsprache mit dem<br />
zuständigen Eichsachbearbeiter (Herrn<br />
Knapp, Telefon: 0228-846-1111, E-Mail:<br />
knapp@lverma.nrw.de) ist stets angebracht.<br />
Weitere Informationen zur Eichung und Prüfung<br />
von Vermessungsinstrumenten stehen im<br />
Internet unter www.lverma.nrw.de >Produkte<br />
& Dienste >Dienstleistungen >Eichungen.<br />
6 Zusammenfassung<br />
Prüfmessungen zur Erfassung der zyklischen<br />
Korrektion von elektronischen Tachymetern<br />
sind eigenverantwortlich von jeder Vermessungsstelle<br />
zu besorgen. Sie sind in einem Zeitraum<br />
von 3 Jahren zu wiederholen, zu dokumentieren<br />
und bei den Berechnungen zu<br />
berücksichtigen. Im Land Nordrhein-Westfalen<br />
sind Mess-Schienen zur Erfassung der<br />
zyklischen Korrektion bereits bei den <strong>Bezirksregierung</strong>en<br />
in Arnsberg, Detmold und Münster<br />
vorhanden. Weitere Einrichtungen gibt es<br />
bei der FH Bochum, der RWTH Aachen und<br />
dem Geodätischen Institut der Universität<br />
Bonn. In einer Übersicht zu den EDM-Eichstrecken<br />
(IM NRW 2003) wird auf die Dienststellen/Hochschulen<br />
und die dort vorhandenen<br />
Eichmöglichkeiten (Eichstrecke, Mess-Schiene,<br />
Frequenzmessplatz) hingewiesen (siehe<br />
www.lverma.nrw.de). Mit dem neuen CFK-<br />
Stab der Mess-Schiene beim Landesvermessungsamt<br />
NRW hat die Vermessungsverwaltung<br />
NRW einen weiteren Beitrag geleistet, die<br />
Qualitätsanforderung der EDM-Instrumente<br />
zu erfüllen bzw. der technischen Entwicklung<br />
anzupassen.<br />
Literaturangaben:<br />
Innenministerium NRW (IM):Vermessungspunkterlass<br />
(VP-Erlass) vom 12.01.1996. Druck und Vertrieb:<br />
Landesvermessungsamt NRW, Bonn; Nr. 16<br />
Eichung der Messinstrumente und –geräte.<br />
Innenministerium NRW (IM): Ergebnisbericht<br />
der Arbeitsgruppe EDM-Eichrichtlinien. Stand<br />
2003; siehe www.lverma.nrw.de.<br />
Joeckel, R. und M. Stober: Elektronische Entfernungs-<br />
und Richtungsmessung, 4. Auflage 1999, 85<br />
ff, 119, 124-125.<br />
Knapp, W und M. Spata: Vergleich der EDM-<br />
Eichstrecken in NRW durch einen Ringversuch.<br />
<strong>NÖV</strong> 2/2004, 98 – 112.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Landesvermessungsamt NRW: Auswertung von<br />
Eichmessungen elektrooptischer Distanzmessgeräte<br />
mit AED (Version 2002), Handbuch, Bonn 2002.<br />
Landesvermessungsamt NRW: Glossar zur<br />
Eichung und Prüfung von EDM-Instrumenten.<br />
Bonn 2003; siehe www.lverma.nrw.de.<br />
Schwarz, W. und H. Fröhlich: Die Maßstabs- und<br />
die meteorologische Korrektion bei der elektrooptischen<br />
Distanzmessung. VR / Dezember 1982,<br />
Seite 419 ff.<br />
1 Einleitung<br />
Seit 1921 bestehen entlang der deutsch-niederländischen<br />
Grenze eine Anzahl unterirdischer<br />
Festlegungen (UF), die den Übergang<br />
zwischen den deutschen und niederländischen<br />
Höhenmessungen, zwischen den NN-Höhen<br />
und NAP-Höhen, vermitteln. Durch Wiederholung<br />
der Höhenmessungen in periodisch<br />
wiederholten Zeiträumen sollten etwaige geologisch-tektonische,<br />
bergbauliche oder netzspezifische<br />
Höhenänderungen festgestellt<br />
werden. Entlang des 340 km langen niederländisch-nordrhein-westfälischenGrenzverlaufs<br />
bestehen 8 solcher UF-Gruppen. Sie<br />
wurden im Verlaufe der letzten Jahrzehnte<br />
sowohl von niederländischer Seite als auch von<br />
deutscher Seite mehrmals durch Präzisionsnivellements<br />
1. Ordnung eingemessen, zuletzt in<br />
den 1990er Jahren. Die Höhenergebnisse der<br />
Höhensysteme NN und NAP werden nachfolgend<br />
zusammengestellt und analysiert. Die seit<br />
2002 in NRW eingeführten NHN-Höhen des<br />
Deutschen Haupthöhennetzes 1992 (DHHN<br />
92) finden hier noch keine Berücksichtigung.<br />
Die UF-Gruppe Losheim an der belgischen<br />
Grenze bleibt ebenfalls unberücksichtigt, weil<br />
dafür belgische Höhen nicht vorliegen.<br />
Walter Knapp<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
Muffendorfer Str. 19-21<br />
53177 Bonn<br />
E-Mail: knapp@lverma.nrw.de<br />
Zur Überprüfung der NN- und NAP-Höhen der Unterirdischen<br />
Festlegungen (UF) entlang der niederländisch-nordrhein-westfälischen<br />
Landesgrenze<br />
Von Manfred Spata, Reiner Boje, Winfried Klein und Jürgen Schulz<br />
2 Die Unterirdischen Festlegungen (UF)<br />
Etwa seit 1920 verwendete die seinerzeit für<br />
Höhenmessungen zuständige Trigonometrische<br />
Abteilung des Reichsamts für Landesaufnahme<br />
(RfL) einen erhöhten Aufwand zur Vermarkung<br />
(Verfestigung) des Höhennetzes 1.<br />
Ordnung. So wurde seither jeder Pfeilerbolzen<br />
an gesicherten Standorten seitlich der Straßen<br />
mit Ortbeton vermarkt. Zur weiteren Versicherung<br />
des Höhennetzes wurden an geologisch<br />
günstigen Stellen und entlang der Reichsgrenze<br />
in Abständen von 30 km bis 50 km unterirdische<br />
Festlegungen (UF) ähnlich denen des<br />
Normalhöhenpunktes NHP 1912 in Hoppegarten<br />
eingebracht. Auf diese Weise sollten für<br />
das Höhennetz Stützpunkte geschaffen werden,<br />
die als geologisch sicher und zuverlässig<br />
gelten und die nach menschlichem Ermessen<br />
auf absehbare Zeit volle Sicherheit für eine<br />
dauerhafte Erhaltung bieten (RfL 1930).<br />
Die UF besteht nach 1932 aus der quadratischen<br />
Granitplatte (a), dem Granitpfeiler (b)<br />
und dem Granitdeckel (c), (Abb. 1). In der Mitte<br />
der oberen Pfeilerfläche ist eine Halbkugel<br />
angearbeitet, deren höchster Punkt der Aufsatzpunkt<br />
der Niv-Latte ist. Bei den vor 1932<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 81
Abb. 1: Unterirdische Festlegung nach 1932 (RfL 1936)<br />
Abb. 2: Unterirdische Festlegung vor 1932 (RfL 1936)<br />
angefertigten UF trägt der Pfeiler einen in einer<br />
senkrechten Bohrung der Kopffläche (C-D)<br />
mit Zement befestigten Bronzebolzen (d) mit<br />
Achatkugel und Bronzedeckel (Abb. 2). Die<br />
Achatkugel (e) wird durch den Schraubring (f)<br />
im Bronzebolzen festgehalten. Der Bronzedeckel<br />
(g) ist durch zwei Messingschrauben<br />
gesichert und durch den Granitdeckel (c)<br />
geschützt (RfL 1936).<br />
82<br />
Im nahen Grenzbereich zwischen den Niederlanden<br />
und Nordrhein-Westfalen enstanden<br />
zwischen 1921 und 1954 acht UF-vermarkte<br />
Verbindungen der beiden Niv-Netze 1. Ordnung,<br />
und zwar bei Gronau, Ammeloe,<br />
Bocholt, Elten, Kranenburg, Straelen, Elmpt<br />
und Aachen (Abb. 3). Die UF bestehen einzeln<br />
oder zur lokalen Sicherung in Dreiergruppen.<br />
Technische Einzelheiten sind in Tabelle 1<br />
zusammengefasst. Die UF waren in den<br />
Höhenverzeichnissen der Trigonometrischen<br />
Abteilung nicht enthalten, da sie nicht für den<br />
praktischen Gebrauch bestimmt waren. Heute<br />
sind die UF im historischen Teil des NivP-<br />
Nachweises gespeichert, jedoch nicht im aktuellen<br />
Bestand der NivP-Datenbank PfiFF<br />
(Vahlensieck und Ottweiler 1951, LVermA<br />
1984, IM 2003).<br />
3 Die geologische Situation der<br />
Unterirdischen Festlegungen<br />
Die UF liegen im diluvialen Flachland des<br />
westlichen Münsterlandes und der Niederrheinischen<br />
Bucht. Lediglich die UF Aachen liegt<br />
auf dem devonischen Gebirgssockel des Rheinischen<br />
Schiefergebirges (Nordeifel). Auf<br />
Antrag des Landesvermessungsamtes gab das<br />
Geologische Landesamt in Krefeld im Jahre<br />
1954 zu verschiedenen UF-Standorten ein geologisches<br />
Gutachten ab, worin die Stabilität der<br />
UF an Hand geologischer Karten und Befunde<br />
erörtert wurde (Udluft 1937, LVermA o.J. und<br />
1984). Danach ergeben sich folgende geologische<br />
Stabilitäten:<br />
� UF Gronau, Glanerbrücke (Niv-Linie<br />
Gronau-Enschede)<br />
Entlang der Niv-Linie Ochtrup – Glanerbrücke<br />
bestehen tektonische Aufbrüche<br />
älterer Gesteine. Ein Teil der Linie führt<br />
über Niederterrassensand, der jedoch häufig<br />
hohen Grundwasserstand aufweist. Die<br />
UF liegt in einem Bereich mit etwas tieferem<br />
Grundwasserstand. Die UF wurde nach<br />
1955 durch eine Verkehrsinsel überbaut und<br />
ist nicht mehr zugänglich.<br />
� UFAmmeloe (Niv-Linie Vreden-Eibergen)<br />
Die Niv-Linie bis zur niederländischen<br />
Grenze liegt im Bereich der sandigen Niederterrasse,<br />
die vielfach schon in geringer<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Tiefe von wasserstauendem Geschiebemergel<br />
unterlagert wird. Die UF liegt an einer<br />
der wenigen Stellen, welche bis zu 2 Meter<br />
als grundwasserfrei angesprochen werden<br />
kann.<br />
� UF Bocholt, Hemden (Niv-Linie Hemden-<br />
Aalten)<br />
Die Niv-Linie verläuft großenteils auf der<br />
Rhein-Niederterrasse, in welcher mit sehr<br />
flachem Grundwasser gerechnet werden<br />
muss. In Hemdem steigt das Gelände zur<br />
Hohen Heide an, einer etwa 12 Meter höheren<br />
Talstufe mit tieferem Grundwasserstand<br />
und zuoberst liegenden diluvialen Sanden<br />
und Kiesen.<br />
� UF Elten (Elten-Zevenaar)<br />
Die geologische Situation entspricht derjenigen<br />
von Nütterden auf der anderen Rheinseite.<br />
� UF Kranenburg, Nütterden (Niv-Linie<br />
Kranenburg-Wyler)<br />
Zwischen Nütterden und Donsbrüggen<br />
erhebt sich das Gelände stellenweise bis 20<br />
Meter über NN. Der Boden ist aus Sand und<br />
Kies der Niederterrasse zusammengesetzt<br />
und das Grundwasser liegt mehrere Meter<br />
tief. Tektonische Störungen sind im tieferen<br />
Untergrund nicht bekannt.<br />
� UF Straelen (Niv-Linie Straelen-Venlo)<br />
Keine Angaben.<br />
� UF Elmpt (Niv-Linie Elmpt-Roermond)<br />
Zwischen Elmpt und der Landesgrenze treten<br />
Kiese und Sande zu Tage, die teilweise<br />
von 1 m bis 2 m mächtigen schwach lehmigen<br />
Feinsanden bedeckt sind. Der Grundwasserspiegel<br />
liegt durchweg tief. Die UF<br />
liegt nach Bodenart und Grundwasser an<br />
günstiger Stelle.<br />
� UF Aachen, Vaalser Quartier (Niv-Linie<br />
Aachen-Vaals)<br />
Devonisches Rheinisches Schiefergebirge,<br />
keine weiteren Angaben.<br />
4 Die NN-Höhen des Deutschen Haupthöhennetzes<br />
1912 (DHHN12)<br />
Die erstmalige Bestimmung der UF-Höhen ist<br />
dem Höhensystem des Deutschen Haupthöhennetzes<br />
1912 (DHHN12) zuzurechnen.<br />
Nach der Festlegung des neuen Normalhöhenpunktes<br />
(NHP 1912) in der Nähe von Hoppegarten<br />
(etwa 35 km östlich von Berlin) wurde<br />
in Preußen das gesamte Nivellementnetz mit<br />
Anschluss an den NHP 1912 und unter<br />
Berücksichtigung der normalorthometrischen<br />
Reduktion (NOR) berechnet. Damit war zwar<br />
das DHHN12 auf den Amsterdamer Pegel<br />
(NAP) bezogen, war aber von den langfristig<br />
zu befürchtenden küstennahen Vertikalbewegungen<br />
des NAP befreit. Die Entstehung dieses<br />
neuen Höhennetzes vollzog sich in mehreren<br />
Netzteilen, die jeweils für sich ausgeglichen<br />
wurden. Im Gebiet des nördlichen<br />
Rheinlandes erfolgten die Messungen zwischen<br />
1931 und 1937 innerhalb des Netzteiles<br />
III. Die Standardabweichung aus Hin- und<br />
Rückmessung von Niv-Strecken für 1 km Doppelnivellement<br />
betrug ss = 0,32 mm (RfL<br />
1930, Rüter 1953, Heller und Wernthaler<br />
1955). Seit 1935 wurde das neue Höhennetz<br />
„Reichshöhennetz (RHN) genannt; nach 1945<br />
lautete die Bezeichnung „Deutsches Haupthöhennetz<br />
1912“ (DHHN12) (Vahlensieck und<br />
Ottweiler 1951). Die Ergebnisse der Erstbestimmung<br />
der UF stehen in Tab. 1 mit Angabe<br />
des jeweiligen Bestimmungsjahres.<br />
5 Die NN-Höhen des Nivellementnetzes<br />
1960 (Niv-Netz 60)<br />
Das Nivellementnetz 1960 (Niv-Netz 60) ist<br />
die erste geschlossene Ausgleichung eines<br />
Niv-Netzes 1. Ordnung im damaligen Westdeutschland.<br />
Es folgte in Nordrhein-Westfalen<br />
in seiner Netzgestaltung im wesentlichen der<br />
Linienführung der Feineinwägungen des ehemaligen<br />
Reichsamts für Landesaufnahme<br />
(RfL) vor 1945. Das Haupthöhennetz wurde<br />
jedoch nach 1947 ergänzend verfestigt; die<br />
Vermarkungen stammten teilweise noch vom<br />
RfL vor 1945. Die Präzisionsnivellements der<br />
systematischen Erneuerung wurden in den<br />
Jahren 1947 bis 1960 nach den Vorschriften<br />
des Niv-Netzes 1. Ordnung ausgeführt. Es<br />
kamen teils Libellennivelliere und teils das<br />
automatisch horizontierende Zeiss-Nivellier<br />
Ni 2 zum Einsatz. Die Standardabweichung<br />
aus Hin- und Rückmessung von Niv-Strecken<br />
für 1 km Doppelnivellement betrug in NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 83
s s = 0,41 mm. Die NN-Höhen des Niv-Netzes<br />
60 entstammen einer freien Netzausgleichung<br />
mit Anschluss an den Höhenpunkt Wallenhorst<br />
(UF I mit NN-Höhe von 1928). Diese Höhen<br />
wurden nicht als Gebrauchshöhen in den amtlichen<br />
Nachweis der NivP übernommen, sondern<br />
nur in der Höhenzeitfolgedatei (HZF-<br />
DAT) gespeichert (AdV 1975). Die NN-Höhen<br />
der UF sind in Tab. 1 unter der Jahreszahl 1960<br />
eingetragen, wenn auch die Messungen aus<br />
den Jahren 1952-1954 stammen.<br />
6 Die NN-Höhen des Deutschen Haupthöhennetzes<br />
1985 (DHHN85)<br />
Das Deutsche Haupthöhennetz 1985 (DHHN<br />
85) beruht auf den in den Jahren 1980-1985<br />
nach einheitlichen messtechnischen Vorgaben<br />
ausgeführten Wiederholungs- und Erneuerungsmessungen<br />
in den Niv-Netzen 1. Ordnung<br />
der westlichen Bundesländer. Die Kompensator-Nivellierinstrumente<br />
wurden wegen<br />
des Einflusses des Erdmagnetfeldes untersucht.<br />
Für die Niv-Latten mit doppelter Teilung<br />
wurden Teilstrichverbesserungen und Temperaturausdehnungskoeffizienten<br />
auf einem<br />
Komparator der Physikalisch-Technischen<br />
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig ermittelt.<br />
Die Standardabweichung aus Hin- und<br />
Rückmessung von Niv-Strecken für 1 km Doppelnivellement<br />
betrug in NRW s s = 0,39 mm.<br />
Als Ausgangspunkt für die zwangsfreie Netzausgleichung<br />
von NN-Höhen wurde wiederum<br />
der Höhenpunkt Wallenhorst (NivP 501) mit<br />
seiner DHHN12-Höhe angehalten. Somit lassen<br />
sich die DHHN85-Höhen mit den Niv-<br />
Netz60-Höhen unmittelbar vergleichen (AdV<br />
1993 S. 160, Müller 1989 und 1990). Diese<br />
Höhen wurden in NRW ebenfalls nicht als<br />
Gebrauchshöhen in den amtlichen Nachweis<br />
der NivP übernommen, sondern nur in der<br />
HZFDAT gespeichert. Die Ergebnishöhen des<br />
DHHN85 stehen in der Tab. 1 unter der Jahreszahl<br />
1985; die Höhenmessungen zu den UF<br />
wurden in den Jahren 1980-1984 ausgeführt.<br />
Die spätere Auswertung des DHHN85 mit<br />
NHN-Höhen des DHHN92 (AdV 1995) bleibt<br />
in der vorliegenden Analyse unberücksichtigt.<br />
84<br />
7 Die NN-Höhen der Kontrollmessung<br />
1997<br />
Auf Anregung der Niederlande ergaben sich<br />
im Zuge des Fünften Niederländischen Hauptnivellements<br />
in den Jahren 1996/97 grenzüberschreitende<br />
Nivellementschleifen zur<br />
Kontrolle der UF, siehe Abb. 3. Vergleichbare<br />
grenzüberschreitende Nivellements waren<br />
auch schon in früheren Jahren ausgeführt worden.<br />
Die deutschen und niederländischen<br />
Höhenunterschiede wurden ohne eine Normalorthometrische<br />
Schwerereduktion ausgeglichen,<br />
weil entsprechende Werte für die Niv-<br />
Linien in NL nicht vorlagen (siehe Abschnitt<br />
8). Die hierbei erzielte Standardabweichung<br />
aus Hin- und Rückmessung von Niv-<br />
Strecken für 1 km Doppelnivellement betrug<br />
ss = 0,38 mm. Die Kontrollrechnung der NN-<br />
Höhen wurde als freies Netz auf die vier nördlichen<br />
UF gelagert, um insbesondere für die<br />
drei südlichen, bodenunsicheren UF neue Vergleichshöhen<br />
zu erhalten. Auch diese NN-<br />
Höhen sind nur in der HZFDAT abgelegt<br />
(LVermA 1997). Die NN-Höhenergebnisse<br />
sind in Tab. 1 unter 1997 notiert.<br />
8 Die NAP-Höhen der Niederländischen<br />
Hauptnivellements vor 2005<br />
Seit 1891 führt der niederländische Höhenbezug<br />
den Namen „Normaal Amsterdams Peil<br />
(NAP)“, um diese Höhen deutlich von älteren<br />
Höhen des Amsterdamer Stadtpegels (AP von<br />
1675) unterscheiden zu können. Der Höhenbezug<br />
änderte sich dadurch aber nicht. Zur<br />
dauerhaften Sicherung der NAP-Fläche wurden<br />
im ganzen Land verteilt 48 unterirdische<br />
Festlegungen in das Nivellement einbezogen.<br />
Der unveränderte Höhenbezug auf den NAP<br />
gilt auch für die nachfolgenden Hauptnivellements<br />
der zuständigen Abteilung NAP des<br />
„Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat“<br />
in Delft (heute: Adviesdienst Geoinformatie<br />
en ICT (AGI), www.rdnap.nl). Seit 1932 sind<br />
die deutschen grenznahen UF verschiedentlich<br />
angemessen worden. Es enstanden dadurch<br />
Höhenwerte des Höhensystems NAP (Tab. 1).<br />
So wurden beim zweiten Hauptnivellement<br />
1925 - 1940, beim dritten Hauptnivellement<br />
1950 - 1959 und beim vierten Hauptnivellement<br />
1965 - 1978 die unterirdischen Festle-<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
gungen durch Präzisionsnivellement überprüft<br />
und angemessen, aber nicht zum Höhenanschluss<br />
der niederländischen Hauptnivellementnetze<br />
genutzt (Murre 1985, Groenewoud<br />
et al. 1991).<br />
Die NAP-Höhen sind nach der sogenannten<br />
Methode der Delfter Schule nicht schwerereduziert.<br />
Eine Schwerereduktion ist für die<br />
flachen Niederlande auch vernachlässigbar,<br />
denn der Einfluss einer rein theoretisch angebrachten<br />
Normalorthometrischen Reduktion<br />
würde den Höhenunterschied von rund 200 m<br />
zwischen Amsterdam und Aachen lediglich im<br />
Subzentimeterbereich, also in der Größenordnung<br />
der Niv-Messgenauigkeit, ändern. Die in<br />
der Regel nur 2 m langen Niv-Latten wurden<br />
zwar überprüft, aber es wurden keine Lattenkorrektionen<br />
vorgenommen. Die zulässige<br />
Abweichung zwischen einer Hin- und Rückmessung<br />
beträgt Zs = 2,5 √S (mit Niv-Strecke<br />
S in km und Zs in mm). Im Rahmen einer Dissertation<br />
untersuchte L.M. Murre 1985 die<br />
Qualität des Zweiten, Dritten und Vierten<br />
Hauptnivellements durch vollständige Neuausgleichung<br />
der Niv-Netze. Danach betrugen<br />
die Standardabweichungen aus Hin- und<br />
Rückmessung von Niv-Strecken für 1 km Doppelnivellement<br />
im Zweiten, Dritten und Vierten<br />
Hauptnivellement ss = 0,76 mm bzw. 0,57<br />
mm bzw. 0,36 mm. Die Standardabweichung<br />
für 1 km Doppelnivellement im Netz betrug<br />
durchschnittlich so = 0,5 mm. Für die drei Netzausgleichungen<br />
behielt Murre wiederum den<br />
Höhenbezug im NAP jeweils streng an, so dass<br />
seine Diagnose-Höhen direkt miteinander verglichen<br />
werden können. Die Murre-Ergebnisse<br />
sind in Tab. 1 unter PR2-V, PR3-V bzw.<br />
PR4-V in der Spalte NAP-Höhen notiert.<br />
9 Die NAP-Höhen des Niederländischen<br />
Hauptnivellements nach 2005<br />
Die Präzisionsmessungen mit Digitalnivellieren<br />
des 5. Hauptnivellements 1995 - 1999 erhielten<br />
wiederum keine Lattenkorrektionen<br />
und keine Schwerereduktionen. Die Ausgleichung<br />
bestärkte frühere Vermutungen über<br />
säkulare Bodenbewegungen in den Niederlanden.<br />
Insbesondere der Westteil des Landes mit<br />
dem Amterdamer Pegel zeigt Höhendifferenzen<br />
gegenüber den bisherigen amtlichen NAP-<br />
Werten von bis zu –4 cm, wohingegen der östliche<br />
Landesteil weniger Höhendifferenzen<br />
aufweist. Wenn auch die Höhenänderungen<br />
weniger als 1 mm pro Jahr ausmachen, sind<br />
diese Änderungsraten über einen längeren<br />
Zeitraum von bis zu 100 Jahren für die Überwachung<br />
der niederländischen Wasserstände<br />
nicht mehr vernachlässigbar (Groenewoud et<br />
al. 1991, MD 1997, AGI 2004).<br />
Seit Januar 2005 veröffentlicht der AGI neue<br />
NAP-Höhen (nieuwe NAP-publicatie 2005).<br />
Deren Höhenbezug ist nicht mehr allein durch<br />
den NAP in Amsterdam gegeben, sondern<br />
durch eine mittlere Lagerung des Fünften<br />
Hauptnivellementnetzes auf alle innerhalb der<br />
Niederlande gelegenen UF-Punkte. Die<br />
Höhenänderungen zwischen NAP-Alt und<br />
NAP-Neu liegen zwischen –25 mm im Westen<br />
und +50 mm im Osten des Landes. Nutzer können<br />
via NAPINFO die neuen NAP-Höhen der<br />
Höhenfestpunkte abfragen (MD 1997, AGI<br />
2005). Im Zuge dieser Auswertung erhielten<br />
sieben grenznahe deutsche UF neue NAP-<br />
Höhen (Van Vliet 2004, Tab. 1 und 5).<br />
10 Eine Analyse der NN- und NAP-<br />
Höhen<br />
Die NN-Höhen der acht UF aus Tab. 1 sind in<br />
der Tab. 2 graphisch dargestellt. Der Höhenvergleich<br />
der einzelnen Epochen basiert auf<br />
den NN-Höhen der Epoche 1952/54. Die UF<br />
Gronau ist heute durch Straßenbau überbaut<br />
und fällt für weitere Analysen aus.<br />
Es fällt sogleich auf, dass die UF Ammeloe,<br />
Bocholt, Elten und Kranenburg über rund 40<br />
Jahre nur geringfügige Höhenänderungen von<br />
Die UF Aachen erfährt zwischen 1952/54 und<br />
1996/97 eine Hebung von +52 mm, siehe auch<br />
Tab. 4. Dies war schon bei der Auswertung des<br />
DHHN85 mit einem Wert von +50 mm aufgefallen<br />
(Müller 1989 und 1990). Der bereits im<br />
Niv-Netz 60 vorhandene Trend von +25 mm<br />
scheint sich offensichtlich bis heute fortzusetzen.<br />
Mälzer und Zippelt (1979a und b) ermittelten<br />
aus Wiederholungsnivellements der Jahre<br />
1951/54 und 1969/73 im Raum Blankenheim<br />
– Gemünd in der Nordeifel vergleichbare<br />
Hebungstendenzen von +30 mm bzw. rund<br />
2 mm/a. Die danach vermutete geologisch-tektonische<br />
Hebung des Raumes Nordeifel ist<br />
aber nicht für die Zeiträume 1939 – 1952 sowie<br />
1985 – 1997 signifikant feststellbar. Somit<br />
kann die lediglich für den Zeitraum 1952 –<br />
1985 erkennbare Hebung auch anderweitig<br />
verursacht sein, ggf. durch Niv-Netzspannungen<br />
(Kremers 1990, Abb. 6 bis 9) oder gar<br />
durch lokale Vermarkungsänderungen. So<br />
beeindruckend die Hebung durch drei zeitlich<br />
und messtechnisch separate Nivellements auch<br />
angezeigt ist, bleibt doch eine weitere Klärung<br />
durch die systematische Erneuerung des<br />
DHHN <strong>2006</strong>-2011 abzuwarten (AdV 2005).<br />
Die NAP-Höhen der acht UF aus Tab. 1 sind<br />
in Tab. 3 veranschaulicht. Dabei ist aus Gründen<br />
eines besseren Vergleichs derselbe Epochenbezug<br />
zu den NN-Höhen 1952/54 beibehalten<br />
worden. Wiederum zeigen die UF<br />
Ammeloe, Bocholt, Elten und Kranenburg die<br />
geringsten Höhenänderungen von
Abb. 3: Niv-Netzverbindungen 1. Ordnung zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen<br />
(Niv-Akte 1997/14, LVermA NRW)<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 87
88<br />
Tab. 1: Unterirdische Festlegungen (UF) im nahen Grenzbereich zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Tab. 2: NN-Höhenvergleich der UF<br />
Tab. 3: NAP-Höhenvergleich der UF<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 89
90<br />
Tab. 4: UF Aachen – Höhenvergleich NN und NAP<br />
Tab. 5: Höhenvergleich NAP-Neu minus NAP-Alt der UF<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Literaturangaben:<br />
Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI): De<br />
waterpasmetingen van de 5e NWP. Delft 2004.<br />
Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI): Een<br />
nieuwe NAP-publicatie – Feiten en achtergronden.<br />
Delft 2005 (www.rdnap.nl/NWE_PUB/html).<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik Deutschland<br />
(AdV): Nivellementnetz 1960, Anhang II Kurzbeschreibung<br />
technischer Einzelheiten der Landesnetze<br />
und Linienverzeichnisse der Länder – Nordrhein-<br />
Westfalen. Druck und Vertrieb: Bayerisches<br />
Landesvermessungsamt, München 1975.<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik Deutschland<br />
(AdV): Die Wiederholungsmessungen 1980 bis<br />
1985 im Deutschen Haupthöhennetz und das Haupthöhennetz<br />
1985 der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Druck und Vertrieb: Bayer. Landesvermessungsamt,<br />
München 1993.<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik Deutschland<br />
(AdV): Deutsches Haupthöhennetz 1992<br />
(DHHN92). Druck und Vertrieb: Bayer. Landesvermessungsamt,<br />
München 1995.<br />
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen<br />
der Länder der Bundesrepublik Deutschland<br />
(AdV): Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes<br />
in den Jahren <strong>2006</strong>-2011. Beschluss der 116.<br />
AdV-Tagung in Bonn vom April 2005 mit Vorbericht.<br />
Tab. 6: Höhenvergleich NAP minus NN der UF<br />
Groenewoud, W., G.K. Lorenz, F.J.J. Brouwer<br />
und R.E. Molendijk: Geodetic Determination of<br />
recent Land Subsidence in the Nederlands. In: Land<br />
Subsidence, Fourth Intenational Symposium on<br />
Land Subsidence, IAHS Publ. 200, 1991, 463-471.<br />
Haupt, P.: Leitnivellements in den Bergbaugebieten<br />
Nordrhein-Westfalens – Periodische Wiederholungsnivellements<br />
mit 100-jähriger Geschichte. In:<br />
VR, 8/1999, 436-444.<br />
Haupt, P.: 100 Jahre Leitnivellement – Die periodischen<br />
Wiederholungsnivellements in den Bergbaugebieten<br />
Nordrhein-Westfalens. In: <strong>NÖV</strong> NRW<br />
3/1999, 184-201.<br />
Heller, E. und R. Wernthaler: Entwicklung und<br />
Genauigkeit des neuen deutschen Haupthöhennetzes.<br />
DGK, Reihe B, Heft Nr. 17.<br />
Innenministerium NRW (IM): Das Nivellementpunktfeld<br />
in Nordrhein-Westfalen (NivP-Erlass)<br />
i.d.F.v. 2.6.2003. Druck und Vertrieb: LVermA NRW<br />
Bonn.<br />
Kremers, J.: Deformationsanalyse der Erdoberfläche<br />
beim Landesvermessungsamt Nordrhein-<br />
Westfalen. In: <strong>NÖV</strong> NRW 1/1990, 9-32.<br />
Landesvermessungsamt NRW: Übersichtskarte<br />
„Höhenbeständigkeitsbereiche in Nordrhein-Westfalen“.<br />
Maßstab 1:500 000, Geol. Kartenarchiv Nr.<br />
9.2., ohne Jahr.<br />
Landesvermessungsamt NRW: Niv. Akte 1984/27<br />
Unterirdische Festlegungen in NRW. Archiv Geodätischer<br />
Raumbezug.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 91
Landesvermessungsamt NRW: Niv. Akte 1997/14<br />
Netzverbindungen Niederlande/Nordrhein-Westfalen.<br />
Archiv Geodätischer Raumbezug.<br />
Mälzer, H. und K. Zippelt: Local height changes in<br />
the Rhenish Massif area. In: AVN, 10/1979a, 402-<br />
405.<br />
Mälzer, H. und K. Zippelt: On the „Map of Height<br />
Changes in the Federal Republic of Germany – Status<br />
1979“ – 1:1 000 000. In: AVN, 10/1979, 362-364.<br />
Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat<br />
(MD): NAP-Jaarbericht 1995-1996. Delft 1997.<br />
Müller, G.: Vergleich der Wiederholungsnivellements<br />
1980/85 im nordrhein-westfälischen Anteil<br />
des DHHN mit früheren Nivellementergebnissen.<br />
In: BDVI-Forum, 4/1989, 277-279.<br />
Müller, G.: Wiederholungsmessungen im nordrhein-westfälischen<br />
Anteil des DHHN 1980/85 und<br />
im Netz 2. Ordnung – Erfahrungen, erste Ergebnisse,<br />
Ausblick. In: Vermessungswesen und Raumordnung<br />
(VR), 52. Jg., 1990, 130-149.<br />
Murre, L.M.: Hervereffening van de tweede, derde<br />
en vierde nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland<br />
en vergelijking van de resultaten (Neuausgleichung<br />
der zweiten, dritten und vierten Höhennetzerneuerung<br />
der Niederlande und Vergleich der<br />
Ergebnisse). Afstudeerscriptie, Technische Hochschule<br />
Delft, 1985.<br />
Reichsamt für Landesaufnahme (RfL): Ergebnisse<br />
der Feineinwägungen – Vorheft. Berlin 1930.<br />
Reichsamt für Landesaufnahme (RfL): Instrumente,<br />
Geräte und Festlegungsmittel für die Einwägungsarbeiten<br />
der Trigonometrischen Abteilung des<br />
Reichsamts für Landesaufnahme (I. Niv.). Berlin<br />
1936.<br />
92<br />
Rüter, F.: Die Feineinwägung I. Ordnung. In: Der<br />
Fluchtstab, 4/1953, 75 - 78 und 93 - 97.<br />
Udluft, H.: Die geologischen und morphologischen<br />
Verhältnisse des bearbeiteten Gebietes sowie deren<br />
Beziehungen zu den Ergebnissen der Höhenmessung.<br />
In: RfL (Hg.): Die Nivellements von hoher<br />
Genauigkeit, Dritter Teil, mit 6 Anlagen. Berlin<br />
1937, 23-42.<br />
Vahlensieck, O. und G. Ottweiler: Die Nivellements<br />
im Lande Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt<br />
NRW, Bonn-Bad Godesberg 1951.<br />
Van Vliet,A.N.: Mail-Liste der NAP-Höhen der UF<br />
vom 15.12.2004.<br />
Wings, R.W.M.G., W.M.H. Miseré, J.J.E. Pöttgens:<br />
Bodensenkung – Bodenhebung – Bergschäden?<br />
In: 125 Jahre DMV, 44. Wissenschaftliche<br />
Fachtagung des Deutschen Markscheider-Vereins<br />
e.V. (Wissenschaftliche Schriftenreihe im Markscheidewesen<br />
Heft 21), Bochum 2004, 258 - 269.<br />
Manfred Spata<br />
Reiner Boje<br />
Winfried Klein<br />
Jürgen Schulz<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
Muffendorfer Str. 19-21<br />
53177 Bonn<br />
E-Mail:<br />
spata@lverma.nrw.de<br />
boje@lverma.nrw.de<br />
klein@lverma.nrw.de<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Nachrichten / Aktuelles<br />
Zulässigkeit der Darstellung von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren/innen<br />
(ÖbVermIng) im Internet vor dem Hintergrund des<br />
Werbeverbots<br />
1 Bisherige Entwicklung<br />
Seit einigen Jahren gewinnt das Thema „Internetdarstellungen<br />
der ÖbVermIng“ für die<br />
<strong>Bezirksregierung</strong>en als Aufsichtsbehörden<br />
zunehmend an Bedeutung. Bereits im Jahr<br />
2000 hat es seitens der <strong>Bezirksregierung</strong> Düsseldorf<br />
eine Rundverfügung an die ÖbVermIng<br />
des Bezirks gegeben, in der Hinweise für die<br />
Gestaltung von Internetpräsentationen gegeben<br />
wurden. Eine fast gleichlautende Rundverfügung<br />
gab die <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong><br />
Anfang 2001 heraus. Die Inhalte dieser Rundverfügungen<br />
fanden Eingang in die landeseinheitlich<br />
abgestimmten Grundsätze über die<br />
„Zulässigkeit von Präsentationen der ÖbVerm-<br />
Ing im Internet unter Beachtung des Werbeverbots<br />
der ÖbVermIng BO NW“. In den folgenden<br />
Jahren nahm die Zahl der Darstellungen<br />
im Internet zu. Gleichzeitig nahmen<br />
natürlich auch die Anfragen zu Gestaltungsspielräumen<br />
sowie die Beschwerden der<br />
ÖbVermIng bezüglich der Art der Internetpräsentationen<br />
ihrer Kollegen zu.<br />
Im Zuge des Anstiegs der Zulassungszahlen<br />
bei den ÖbVermIng und der ungünstigen Wirtschaftslage<br />
wurden bzw. werden vermehrt Verstöße<br />
gegen das Werbeverbot der ÖbVermIng<br />
und auch gegen die o.a. Grundsätze festgestellt.<br />
Deshalb haben die <strong>Bezirksregierung</strong>en<br />
Düsseldorf und <strong>Köln</strong> die Internetseiten der<br />
ÖbVermIng und der Katasterbehörden in den<br />
Jahren 2004 bis 2005 komplett überprüft.<br />
Beanstandungen wurden dabei in der Regel<br />
unverzüglich behoben.<br />
2 Ahndung als berufsrechtliche<br />
Pflichtverletzung<br />
Im Bezirk Düsseldorf ist es jedoch in drei Fällen<br />
zur Einleitung berufsrechtlicher Verfahren<br />
gekommen, in einem Verfahren wurde gegen<br />
den zurückweisenden Widerspruchsbescheid<br />
Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht<br />
erhoben.<br />
In diesem Verfahren ging es um die Internetseite<br />
einer Arbeitsgemeinschaft zweier<br />
ÖbVermIng, die mit dem Link „über uns“ und<br />
den nachgeordneten Seiten „Firmenprofil“,<br />
„Mitarbeiter“, „Historisches in der Presse“ und<br />
„bei der Arbeit“ ihr Büro in Wort und Bild dargestellt<br />
hatten. Die Darstellung umfasste<br />
Angaben über die Historie, Größe und Ausstattung<br />
des Büros, detaillierte Lebensläufe<br />
des Firmengründers und seiner beiden Nachfolger,<br />
die Wiedergabe historischer Zeitungsausschnitte,<br />
sowie historische Fotos bei der<br />
Arbeit, die allesamt seitens der <strong>Bezirksregierung</strong><br />
als berufswidrige, unzulässige Werbung<br />
bewertet wurden. Dagegen hatte der ÖbVerm-<br />
Ing geklagt.<br />
3 Das Urteil des Verwaltungsgerichtes<br />
Das Verwaltungsgericht hat die Klage als<br />
unbegründet abgewiesen. Es stellt fest, dass<br />
der ÖbVermIng seine Berufspflichten verletzt<br />
hat. Das Werbeverbot ist in der Berufsordnung<br />
der ÖbVermIng von NRW (ÖbVermIng BO<br />
NRW) normiert. Es ist auch mit dem Grundrecht<br />
der Berufsfreiheit gemäß Art. 12 GG vereinbar,<br />
weil die mit dem Werbeverbot verbundene<br />
Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit<br />
vernünftigen Zwecken des Gemeinwohls<br />
dient und den Berufstätigen nicht übermäßig<br />
oder unzumutbar trifft, wenn die<br />
Bestimmung des § 9 Abs. 1 Satz 5 ÖbVermIng<br />
BO NRW so ausgelegt wird, dass dem Öb-<br />
VermIng nicht jegliche, sondern lediglich die<br />
berufswidrige Werbung untersagt ist (vgl.<br />
Urteil des OVG NRW vom 27.April 2001, 7 A<br />
4490/99). Wo die Grenze zur berufswidrigen<br />
Werbung überschritten wird, ist gesetzlich<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 93
nicht näher definiert. Im Einzelfall muss dies<br />
die Aufsicht durch Auslegung unter Berücksichtigung<br />
der Verkehrsanschauung, des<br />
Berufsbildes und der besonderen Verantwortung,<br />
die mit der Beleihung hoheitlicher<br />
Befugnisse verbunden ist, festlegen.<br />
Das hat die <strong>Bezirksregierung</strong> im vorliegenden<br />
Fall getan und auch das Gericht kommt zu der<br />
Auffassung, dass der ÖbVermIng mit den<br />
beanstandeten Seiten seines Internetauftrittes<br />
über den berufsrechtlich erlaubten Rahmen<br />
hinaus gegangen ist.<br />
Das Werbeverbot diene „dem Zweck, die<br />
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des<br />
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs<br />
als Träger eines öffentlichen Amtes (§ 9 Abs. 1<br />
Satz 1 ÖbVermIng BO NRW) zu sichern“. Der<br />
ÖbVermIng nimmt mit den ihm übertragenen<br />
Befugnissen in hervorragender Funktion am<br />
Vermessungswesen teil, das seinerseits dem<br />
Rechtsverkehr zwischen Bürgern und damit<br />
dem Rechtsfrieden in der Gemeinschaft, mithin<br />
einem überragend wichtigen Gemeinschaftsgut<br />
dient (vgl. BVerfG, Beschluss vom<br />
1. Juli 1986 – 1 BvL 26/83 -, BVerfGE, 73, 301<br />
(316f.); Beschluss vom 3. Februar 1993 – 1<br />
BvR 552/91 – und – 1 BvQ 1/92 -; OVG NRW,<br />
Urteil vom 27. Juni 1996 – 7 A 4924/94 -).“<br />
Im weiteren führt das Gericht aus, dass dem<br />
ÖbVermIng jedes Verhalten untersagt sei, „das<br />
den Eindruck erwecken könnte, seine Amtstätigkeit<br />
werde durch ein gewerbliches, gewinnorientiertes<br />
Marktverhalten beeinflusst“.<br />
Die Amtsausübung ist unter Beachtung des<br />
Gleichheitssatzes und der Amtsneutralität<br />
streng gesetzesgebunden und allein der Sache<br />
und nicht der Gewinnerzielung verpflichtet“.<br />
Werbung sei nur dann zulässig, wenn sie sich<br />
auf die sachangemessene Information der<br />
interessierten Allgemeinheit beschränke. Zulässig<br />
sei Informationswerbung, die hier als<br />
„adressatenneutrale, in einer dem öffentlichen<br />
Amt angemessenen Zurückhaltung veröffentlichte<br />
Darstellung der möglichen Dienstleistungen“<br />
definiert wird.<br />
Unzulässig seien dagegen die Qualitäts- und<br />
Sympathiewerbung. Zur Qualitätswerbung<br />
zählt das Gericht das auffällige, plakative,<br />
reklamehafte Anpreisen eigener Leistungen,<br />
94<br />
aber auch die unterschwellige Beeinflussung<br />
durch entsprechende Darstellungen. Als Sympathiewerbung<br />
sind nach den Darlegungen im<br />
Urteil solche Darstellungen zu verstehen, die<br />
keinen sachlichen, auf die Tätigkeit des<br />
ÖbVermIng bezogenen Informationsgehalt<br />
haben. Sie sollen ein emotionales Wohlgefallen<br />
des Betrachters herstellen. Somit ist jede<br />
Form von Sympathiewerbung, die die Person<br />
des Amtsinhabers zum Gegenstand hat,<br />
unzulässig. „Die Tätigkeit des ÖbVermIng<br />
gewinnt ihr Vertrauen nicht durch die persönlichen<br />
Eigenschaften des Amtsinhabers (...),<br />
sondern durch die gesetzlich legitimierte und<br />
begrenzte Autorität des verliehenen Amtes.“<br />
Das Gericht klärt in dem Urteil, dass nicht das<br />
Interesse des potenziellen Kunden an Information<br />
und Präsentation ausschlaggebend für die<br />
Zulässigkeit der Werbung sei. Vielmehr seien<br />
allein der Wortlaut und der objektive Zweck<br />
der gesetzlichen Bestimmungen ausschlaggebend<br />
für den Umfang des berufsbezogenen<br />
Werbeverbots.<br />
Auch die Beschwerde des Klägers, die Behördenleitung<br />
der <strong>Bezirksregierung</strong> stelle sich<br />
aber mit Bild und Lebenslauf dar, wurde mit<br />
der Begründung abgewiesen, dass die <strong>Bezirksregierung</strong><br />
in ihrem hoheitlichen Zuständigkeitsbereich<br />
weder um Kunden werbe, noch in<br />
wirtschaftliche Konkurrenz zu anderen trete.<br />
Zum Vergleich mit möglichen Internetauftritten<br />
von Katasterbehörden, die in Bezug auf<br />
Vermessungsleistungen in Konkurrenz zu den<br />
ÖbVermIng stehen, stellt das Gericht klar, dass<br />
diese Auftritte keine über die sachliche Information<br />
hinausgehende Werbung für die hoheitliche<br />
Tätigkeit der Ämter enthalten dürfen,<br />
weil damit der Rahmen ihrer auf der Verfassung<br />
und dem Gesetz beruhenden und durch<br />
sie begrenzten öffentlich-rechtlichen Legitimation<br />
überschritten würde. Alles was über<br />
sachlich neutrale, unauffällige Informationswerbung<br />
hinausgeht, greift wettbewerbswidrig<br />
in die berufliche Betätigung der beliehenen<br />
Unternehmer ein und ist damit unzulässig.<br />
„Die Verquickung öffentlicher Aufgaben mit<br />
erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit zu Lasten<br />
privater Wettbewerber ist verboten (OLG<br />
Hamm, Urteil vom 11. März 1999, 3 U 40/98;<br />
OLG Celle. Urteil vom 9. September 2004, 13<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
U 133/04, GRUR-RR 2004, 374; BGH, Urteil<br />
vom 24. September 2002, KZR 4/01, NJW<br />
2003, 752 f.).“ Dies alles zu überprüfen und<br />
entsprechende Verstöße zu unterbinden, sei<br />
Aufgabe der <strong>Bezirksregierung</strong> als Aufsichtsbehörde,<br />
die diese auch wahrnehme. „Aus den<br />
rechtswidrigen Praktiken einzelner Katasterämter<br />
kann der Kläger keine Maßstäbe für<br />
die Auslegung seiner Berufsordnung gewinnen.“<br />
(vgl.a. FORUM 2005, Heft 4, S. 193)<br />
Abschließend stellt das Gericht fest, dass die<br />
Berufspflichtverletzung vorhersehbar und vermeidbar<br />
gewesen sei, so dass die von der Aufsichtsbehörde<br />
verhängte Ahndungsmaßnahme<br />
angemessen sei.<br />
Gegen das Urteil hat der Kläger Antrag auf<br />
Zulassung der Berufung gestellt. Dem Antrag<br />
wurde stattgegeben, die Entscheidung des<br />
OVG NRW steht noch aus.<br />
4 Weitere Vorgehensweise<br />
Die <strong>Bezirksregierung</strong>en <strong>Köln</strong> und Düsseldorf<br />
haben aufgrund der gesamten bisher ergangenen<br />
Rechtsprechung zum Werbeverbot der<br />
ÖbVermIng in Nordrhein-Westfalen die aus<br />
dem Jahr 2000 stammenden „Grundsätze der<br />
<strong>Bezirksregierung</strong>en zur gleichmäßigen Auslegung<br />
des Werbeverbots in Nordrhein-Westfalen“<br />
und die Grundsätze „Zur Zulässigkeit von<br />
Präsentationen der ÖbVermIng im Internet<br />
unter Beachtung des Werbeverbots der Öb-<br />
VermIng BO NW“ überarbeitet.<br />
Entstanden sind landeseinheitlich abgestimmte<br />
„Empfehlungen zur Auslegung des Werbeverbots<br />
der ÖbVermIng in NRW“ in Form<br />
eines Stichwortverzeichnisses, das in den<br />
Internetangeboten der <strong>Bezirksregierung</strong>en zu<br />
finden ist.<br />
Neuerungen, die sich ggf. aus der Berufungsentscheidung<br />
des OVG NRW ergeben, werden<br />
dort entsprechend eingearbeitet bzw. bei der<br />
Novellierung des Berufsrechts, welches in diesem<br />
Jahr in NRW ansteht, berücksichtigt.<br />
Annette Birkenhauer<br />
Kerstin Will<br />
<strong>Bezirksregierung</strong> Düsseldorf<br />
Dezernat 33<br />
Zusammenfassung der Podiumsdiskussion zum Berufsbild der<br />
Vermessungstechniker/innen am 1. 02. <strong>2006</strong> im Berufskolleg der Stadt Essen<br />
Auf Einladung des Berufskollegs Ost der Stadt<br />
Essen fand in den Räumlichkeiten der Schule<br />
eine Podiumsdiskussion zum Berufsbild der<br />
Vermessungstechniker/innen (VT) statt. Unter<br />
der Moderation von Prof. Dr. Kersting/FH<br />
Bochum diskutierten Vertreter der Berufsverbände,<br />
der kommunalen Spitzenverbände und<br />
Versorgungsbetriebe: Herr Kalischewski/Stadt<br />
Dortmund für den Städtetag NRW, Frau<br />
Lehmkuhl für den VDV NRW, Herr Lips/<br />
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in<br />
Kreuztal für den BDVI NRW, Herr Loef/Eon-<br />
Ruhrgas für Versorgungsunternehmen, Herr<br />
Störy/Stadt Ratingen für den Städte- und<br />
Gemeindebund NRW, Herr Theis/Kreis Borken<br />
für den Landkreistag NRW, Frau Will/<br />
<strong>Bezirksregierung</strong> Düsseldorf als Vorsitzende<br />
des gemeinsamen Prüfungsausschusses im<br />
Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/in<br />
für das Land NRW.<br />
Insgesamt 129 Zuhörer waren der Einladung<br />
gefolgt: 74 Behördenvertreter, 26 Öffentlich<br />
bestellte Vermessungsingenieure/innen (Öb-<br />
VermIng), 25 Berufsschullehrer und 4 Vertreter<br />
von Ingenieurbüros, Baufirmen und Versorgungsunternehmen.<br />
Die Eingangsfrage nach den aktuellen Einsatzgebieten<br />
ergab folgendes:<br />
VT werden bei ÖbVermIng und Behörden eingesetzt<br />
im klassischen Außendienst als Messgehilfen<br />
oder Messtruppführer, im Innendienst<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 95
ei der Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen,<br />
der Auswertung mit Rechen- und<br />
Zeichenprogrammen, der Datenerfassung für<br />
Ausgleichungsaufgaben und der Pflege von<br />
digitalen Datenbeständen. Die klassischen<br />
Aufgaben sind geblieben, die Methoden haben<br />
sich geändert. Bei Versorgungsunternehmen<br />
steht nicht mehr die eigentliche Vermessung<br />
sondern die Pflege von GIS und Auskunftssystemen<br />
im Vordergrund. Ausgebildet werden<br />
VT in NRW zu 60 % bei ÖbVermIng, zu 20 %<br />
bei öffentlichen Verwaltungen und zu weiteren<br />
20 % in der freien Wirtschaft.<br />
Abb. 1: Das Podium<br />
Einigkeit bestand in der Forderung, dass VT<br />
intensiver als bisher im GIS-Bereich ausgebildet<br />
und einige alte Zöpfe in der Ausbildung<br />
abgeschnitten werden müssen. Ebenso wurde<br />
die Notwendigkeit gesehen, das Berufsbild so<br />
zu öffnen, so dass VT auch in anderen Disziplinen<br />
der „Geo-Berufe“ Verwendung finden<br />
können.<br />
Ungeklärt blieb die Frage, ob die Spezialisierung<br />
in verschiedene Bereiche – genannt werden<br />
Bodenwirtschaft, Liegenschaftsvermessung<br />
und Geoinformation – schon innerhalb<br />
der Berufsausbildung durch das Angebot verschiedener<br />
Schwerpunkte oder erst danach<br />
stattfinden soll.<br />
Eindeutig verneint wurde die Frage, ob die<br />
Ausbildung der VT von der GIS-Ausbildung<br />
ganz getrennt werden soll. Damit die Ausbildungsbetriebe<br />
hier eine umfassende Ausbildung<br />
gewährleisten können, wurde ein Ausbildungsverbund<br />
zwischen spezialisierten Ausbildungsstellen<br />
angeregt.<br />
96<br />
Die meisten Redner sprachen sich für eine solide<br />
Grundausbildung mit erweiterten Kenntnissen<br />
in GIS ohne weitere Spezialisierung aus.<br />
Die Abgrenzung zum staatlich geprüften VT<br />
und zum Ingenieur bzw. Bachelor müsse<br />
beachtet werden.<br />
Abb. 2: Die Zuhörer<br />
Beklagt wurden allgemein die nicht ausreichenden<br />
mathematischen und allgemeinen<br />
Kenntnisse der Ausbildungsbewerber. Viele<br />
Jugendliche schreckten wegen der mathematischen<br />
Ansprüche vor dem Beruf zurück, für<br />
leistungsfähigere Jugendliche und Abiturienten<br />
sei der Beruf häufig nicht mehr attraktiv.<br />
Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe müssten<br />
enger zusammenarbeiten.<br />
Ausführlich diskutiert wurde der Gedanke, die<br />
Berufsausbildung zum VT zweistufig zu<br />
gestalten: Nach einer zweijährigen Ausbildung<br />
wäre ein erster Berufsabschluss möglich, nach<br />
dem dritten Ausbildungsjahr ein qualifizierter<br />
und spezialisierter Berufsabschluss. Dieser<br />
Vorschlag wurde vom Vertreter des Städtetages<br />
eingebracht, der ihn aber deutlich als eigenen<br />
Vorschlag und nicht den des Städtetages apostrophierte.<br />
Dieser Gedanke wurde von einigen<br />
Vertretern der Berufskollegs unterstützt, da<br />
damit auch schwächere Bewerber zu einem<br />
Berufsabschluss kommen könnten. Alle anderen<br />
Vertreter auf dem Podium lehnten eine Stufenausbildung<br />
ab: Keinesfalls dürfe das Ausbildungsniveau<br />
schwächeren Bewerbern angepasst<br />
werden, zweijährig Ausgebildete würden<br />
dreijährig Ausgebildete bei geringerem<br />
Lohn verdrängen und die Stufenausbildung<br />
verstärke die Wechselwirkung „billiger –<br />
schlechter“. In unserem Hochlohnland habe<br />
ein „VT-light“ keine Chance, eher müsse der<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
VT eine breite Ausbildung mit der Möglichkeit<br />
des Quereinstiegs in Nachbardisziplinen erhalten.<br />
Die Vertreterin einer Ausbildungsstelle<br />
sprach sich gegen eine zweijährige Berufsausbildung<br />
aus, da nach zwei Jahren intensiver<br />
Ausbildung das dritte Ausbildungsjahr, in dem<br />
der Auszubildende sich produktiv einbringen<br />
könne, entfalle.<br />
Die Notwendigkeit, das Berufsbild für leistungsfähige<br />
Jugendliche attraktiver zu gestalten<br />
wurde allgemein gesehen. Der BDVI<br />
schlug die Berufsbezeichnung „Vermessungsund<br />
Geoinformationstechniker“ oder ähnlich<br />
vor; diese Namensänderung wurde von der<br />
Vorsitzenden des gemeinsamen Prüfungsausschusses<br />
unterstützt. Der VDV war gegen eine<br />
Änderung der Berufsbezeichnung.<br />
Die Frage, ob eine Neuordnung der Berufsausbildung<br />
notwendig ist, wurde unterschiedlich<br />
beantwortet: Die Vertreter des Städte- und<br />
Gemeindebundes und des BDVI sahen keine<br />
gravierenden Umbrüche sondern nur eine<br />
gewöhnliche Fortentwicklung wie in anderen<br />
Berufen auch. Der VDV sah dringenden<br />
Modernisierungsbedarf. Ein Vertreter der<br />
Berufskollegs stellte dar, dass bei zurückgehender<br />
Beschäftigtenzahl im Vermessungswesen<br />
gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von VT<br />
gestiegen sei. Er sah die Gefahr, dass bei<br />
Erlassbereinigung<br />
Die Redaktion der Verkündungsblätter des<br />
Innenministeriums NRW weist darauf hin, dass<br />
immer wieder Anrufe kommen und fragen, ob<br />
und welche alten Erlasse noch gelten. Es wird<br />
vermutet, dass die Erlassbereinigung von 2002<br />
bis 2004 und ihre Auswirkung nicht hinreichend<br />
bekannt sind. Um dem offensichtlich<br />
bestehenden Informationsdefizit entgegen zu<br />
wirken, hat die Redaktion jetzt in die aktuelle<br />
SMBl.NRW. unter der Gliederungsnummer<br />
1141 und dem Datum 27.02.2004 folgenden<br />
Hinweis eingestellt:<br />
„Hinweis zu dem Projekt der Landesregierung<br />
NRW – Bereinigung der Verwaltungsvor-<br />
unverändertem Berufsbild der VT-Beruf weiter<br />
an Bedeutung verliere und für leistungsfähige<br />
Jugendliche immer unattraktiver werde. Der<br />
Vertreter des Städtetages wies darauf hin, dass<br />
die Neuordnung ein langwieriger Prozess auf<br />
Bundesebene sei und dabei die traditionsreiche<br />
Berufsbezeichnung wahrscheinlich verloren<br />
gehe. Deswegen gab er der einfachen Anpassung<br />
den Vorzug. Die Vorsitzende des gemeinsamen<br />
Prüfungsausschusses fragte, ob das vorhandene<br />
rechtliche Regelwerk ausreicht, die<br />
neuen Methoden und Techniken in der Berufsausbildung<br />
ausreichend zu berücksichtigen.<br />
Sie stellte fest, dass eine Initiative zur Neuordnung<br />
des Berufs auf Bundesebene zwecklos<br />
sei, wenn in NRW keine einhellige Meinung<br />
dazu entwickelt werde. Sie forderte alle<br />
Berufsgruppen auf, abgestimmte Stellungnahmen<br />
zu diesen Fragen zu entwickeln und ihr bis<br />
Ende März <strong>2006</strong> zukommen zu lassen.<br />
Nachträgliche Anmerkung: Inzwischen wurde<br />
im Diskussionsforum des Landesvermessungsamtes<br />
NRW (www.lverma-forum.nrw.<br />
de) ein Forum zum Thema „Neuordnung des<br />
Ausbildungsberufes Vermessungstechniker/<br />
in“ eingerichtet.<br />
Hermann Theune<br />
Berufskolleg Ost der Stadt Essen<br />
theune@cityweb.de<br />
schriften (Erlasse) 2002 bis 2004“ – Bek. D.<br />
Innenministeriums (Redaktion der Verkündungsmedien)<br />
v. 27.2.2004.<br />
Danach sind alle die in der Loseblattsammlung<br />
befindlichen Verwaltungsvorschriften (Erlasse)<br />
der Landesregierung oder der obersten<br />
Landesbehörden außer Kraft getreten, die bis<br />
dahin nicht in die neue aktuelle elektronische<br />
SMBl.NRW. aufgenommen sind. Als Zeitpunkt<br />
des Außer-Kraft-Tretens wird in der<br />
Abschlusserklärung der 15. März 2004 festgesetzt.<br />
Wolfgang Klaus<br />
Innenministerium NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 97
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen mit neuen Angeboten<br />
auf der CeBIT <strong>2006</strong><br />
Mit einer breiten Produktpalette und gleich<br />
zwei neuen Angeboten präsentierte sich das<br />
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen<br />
auf der diesjährigen CeBIT in Hannover am<br />
Stand „e-future in NRW“ im erstmals auf der<br />
Messe eingerichteten Public Sector Parc.<br />
Zu den Angeboten zählt die neue PDA-Software<br />
als Erweiterung der Geogrid ® -Produktreihe<br />
Top10, Top25, Top50 und Top200. Bei<br />
dem Geogrid ® -PDA-Viewer handelt es sich um<br />
ein weiteres Geogrid ® -Produkt, das in Zusammenarbeit<br />
der Landesvermessungsämter mit<br />
der EADS Deutschland GmbH entwickelt<br />
wurde. Die Software dient der Visualisierung<br />
von Kartendaten auf einem PDA. Über eine<br />
Exportschnittstelle können die Daten aus der<br />
Geogrid ® -Produktreihe vom PC auf den PDA<br />
übertragen und über eine einfach strukturierte<br />
Nutzeroberfläche an jedem Ort verwendet werden.<br />
Die Software zum Preis von 25,- Euro ist<br />
unkompliziert über die Internetseiten des Landesvermessungsamtes<br />
zu beziehen. Unter<br />
98<br />
Staatssekretär Karl Peter Brendel (Innenministerium NRW) zu Besuch am Stand „e-future in NRW“<br />
www.lverma.nrw.de sind darüber hinaus weitere<br />
Produktinformationen aufgeführt.<br />
Auf der Weltmesse CeBIT wurde auch das<br />
„Geobasisdatenportal“ vorgestellt. Sämtliche<br />
Geobasisdaten wie topografische Karten,<br />
Luftbilder und Geländemodelle aber auch Produkte<br />
wie der Geogrid ® -PDA-Viewer können<br />
nunmehr zu jeder Tages und Nachtzeit über<br />
das Internet erworben werden. Besonderer Vorteil:<br />
Die Daten werden im Anschluss an die<br />
Bestellung vollautomatisch über das Internet<br />
bereitgestellt. Dadurch lassen sich die Geobasisdaten<br />
ohne jede Wartezeit für die verschiedensten<br />
Anwendungen wie Planungen, Auswertungen<br />
und Marketingmaßnahmen einsetzen.<br />
Der Onlineshop wird vom Landesvermessungsamt<br />
NRW betrieben und ist in<br />
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für<br />
Datenverarbeitung und Statistik entwickelt<br />
worden. Offiziell wurde das Geobasisdatenportal<br />
am 12.04.<strong>2006</strong> im Rahmen einer Pressemitteilung<br />
des Innenministeriums NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
eröffnet und ist seither unter www.geobasis.<br />
nrw.de für jedermann zugänglich.<br />
Ebenfalls für Aufsehen sorgte die erstmals auf<br />
der CeBIT vorgestellte Pilotanwendung my-<br />
SDI mit deren Hilfe sich Karten und Luftbilder<br />
der Länder über das Handy abrufen lassen. Die<br />
Anwendung ermöglicht den Zugang zu den im<br />
Internet vorhandenen Geoinformationsdiensten<br />
über das Mobilfunknetz. Nach einem<br />
Download der Applikation kann mySDI direkt<br />
auf dem Handy gestartet werden und der<br />
Anwender bekommt den gewünschten Ausschnitt<br />
auf dem Display präsentiert. Dabei können<br />
die Karten und Luftbilder verschiedener<br />
Musterausschreibung ALKIS ® -NRW<br />
Um die Umstellung des Katasternachweises<br />
auf ALKIS ® zu fördern, beteiligt sich das Land<br />
NRW auch an der Entwicklung einer Musterausschreibung<br />
durch Finanzierung externer<br />
Beratung. Es hat sich ein Arbeitskreis gebildet,<br />
der bisher vornehmlich von den Ruhrgebietsstädten<br />
Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen<br />
und Herne und dem Kreis Paderborn getragen<br />
wird. Nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten<br />
ist davon auszugehen, dass bis zur Jahresmitte<br />
AdV-BDVI-Eckwertepapier:<br />
Gemeinsam für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft<br />
Das AdV-BDVI-Eckwertepapier „Memorandum<br />
über die Zusammenarbeit im amtlichen<br />
Vermessungswesen Deutschland“ mit dem<br />
Titel „Gemeinsam für Staat, Wirtschaft und<br />
Gesellschaft“ wurde am 08.11.2005 von dem<br />
AdV-Vorsitzenden Reinhard Klöppel und dem<br />
BDVI-Präsidenten Volkmar Teetzmann in<br />
Wiesbaden unterzeichnet. Das Papier steht im<br />
Internet zum Download zur Verfügung unter<br />
www.adv-online.de/extdeu/ broker.jsp? uMen<br />
=6ef405db-14d8-a901-e1f4-351ec0023010<br />
und www.bdvi.de. AdV und BDVI stellen in<br />
dem Papier ihre gemeinsamen Grundpositio-<br />
Maßstäbe stufenweise verkleinert oder vergrößert<br />
werden. Das neue Angebot entstand<br />
aus der Zusammenarbeit mit dem Technologie-<br />
Anbieter con terra GmbH aus Münster und den<br />
Vermessungsverwaltungen der Länder und<br />
wurde von der con terra GmbH ebenfalls im<br />
Public Sector Parc vorgestellt. Weitere Informationen<br />
zu mySDI und zum Download werden<br />
im Internet unter www.mysdi.de angeboten.<br />
Olaf Lüders<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
mit einer Version der Musterausschreibung<br />
gerechnet werden kann, die an interessierte<br />
Katasterbehörden abgegeben werden kann.<br />
Damit verbunden sein werden Hinweise zur<br />
Wahl des korrekten Vergabeverfahrens.<br />
Reinhard Gerner<br />
<strong>Bezirksregierung</strong> Detmold<br />
nen zur gesellschaftlichen Bedeutung des amtlichen<br />
Vermessungswesens und ihre jeweils<br />
spezifischen, aufeinander abgestimmten Aufgaben<br />
und Kernfunktionen heraus. Die sich<br />
daraus ergebenden gemeinsamen und sich<br />
ergänzenden Ziele werden dargestellt. Damit<br />
wollen beide Partner ihrer Verantwortung<br />
gerecht werden, das amtliche Vermessungswesen<br />
in Deutschland ganzheitlich zu stärken und<br />
weiterzuentwickeln.<br />
Ulrich Jäger, <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong><br />
Klaus Mattiseck, Innenministerium NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 99
Gelungenes Beispiel partnerschaftlicher Öffentlichkeitsarbeit<br />
Als gelungenes Beispiel partnerschaftlicher<br />
Öffentlichkeitsarbeit – ganz im Sinne des AdV-<br />
BDVI-Eckwertepapiers „Gemeinsam für<br />
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“ – ist ein<br />
Ende letzten Jahres vom Rhein-Erft-Kreis herausgegebener<br />
Flyer anzusehen. Darin werden<br />
die Aufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes<br />
und der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure<br />
unter dem Motto „Hand in<br />
Hand im Dienste der Bürgerinnen und Bürger“<br />
dargestellt. Der informative Faltprospekt ist<br />
100<br />
attraktiv gestaltet, gibt den Kunden wertvolle<br />
Hinweise und ist im Hinblick auf die partnerschaftliche<br />
Darstellung des kommunalisierten<br />
und „privatisierten“ Vermessungswesens in<br />
Nordrhein-Westfalen wegweisend. Im Internet<br />
ist der Flyer unter www.rhein-erft-kreis.de/<br />
stepone/data/downloads/1c/80/00/62_Flyer.<br />
pdf verfügbar.<br />
Ulrich Jäger, <strong>Bezirksregierung</strong> <strong>Köln</strong><br />
Klaus Mattiseck, Innenministerium NRW<br />
EDM-Eichstrecken NRW im Internet des Landesvermessungsamtes<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Um alle Eichstrecken in NRW einheitlich präsentieren<br />
zu können, hat das LVermA NRW<br />
die Eichstrecken, die in dem Ergebnisbericht<br />
der Arbeitsgruppe EDM-Eichrichtlinien aufgeführt<br />
sind, ins Internet gestellt.<br />
Über zwei Möglichkeiten kann auf die Eichstrecken<br />
zugegriffen werden. Unter www.lverma.nrw.de<br />
� Produkte & Dienste � Dienstleistungen<br />
� Eichungen � Tachymeter ist<br />
unter der Beschreibung der Eicheinrichtungen<br />
die Eichstrecke aufgeführt. Dort anklicken und<br />
es öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift<br />
Eichungen und Eichstrecken in NRW. Nach<br />
einem kurzen Einführungstext folgt eine Übersichtskarte<br />
von NRW, in der alle Eichstrecken<br />
dargestellt sind.<br />
Zum Anschauen und Aussuchen einer Eichstrecke<br />
ist in der Karte der Name der Eichstrecke<br />
anzuklicken. Es öffnet sich ein Fenster<br />
mit einem Ausschnitt der TK 100. Dieser Maßstab<br />
ist gedacht, um großräumig die Möglichkeit<br />
eines Anfahrtsweges mit einem Fahrzeug<br />
zu sondieren. Eine Leiste im linken Bildrand<br />
ermöglicht eine Vergrößerung über die TK 25<br />
und die DGK5. Unter „Bild“ kann ein Foto der<br />
Eichstrecke aufgerufen werden.<br />
Die Zusammenstellung mit den Namen der<br />
Eichstrecken, Ansprechpartner, Streckenlänge,<br />
Anzahl der Pfeiler und Download folgt unter<br />
der Übersichtskarte. Hier kann eine Karte der<br />
ausgesuchten Eichstrecke unter Anklicken des<br />
Symboles ZIP-Datei herunter geladen und ausgedruckt<br />
werden, um eine Karte zum Aufsuchen<br />
in der Örtlichkeit zur Hand zu haben.<br />
Ein weiterer Weg zu den Eichstrecken ist<br />
www.lverma.nrw.de � Tachymeter � Eichstrecken.<br />
Der Einstieg zum Aufrufen der Karten<br />
erfolgt wie oben beschrieben.<br />
Walter Knapp<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Wertermittlungsrichtlinien <strong>2006</strong> bekannt gegeben<br />
Am 1. März <strong>2006</strong> gab das Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die<br />
„Wertermittlungsrichtlinien <strong>2006</strong>“ bekannt.<br />
Schwerpunkte der Änderungen liegen in den<br />
Regelungen zur Bewertung der Erbbaurechte<br />
sowie der personenbezogenen Rechte. Die seit<br />
1976 insbesondere im 4. Kapitel weitgehend<br />
unverändert gebliebenen Richtlinien sind<br />
durch die nunmehr vorgenommenen durchgreifenden<br />
Änderungen, die den aktuellen<br />
Stand der herrschenden Fachmeinung widerspiegeln,<br />
als richtungsweisend zu bezeichnen.<br />
Sie entstanden in enger Zusammenarbeit mit<br />
Mitgliedern des Arbeitskreises Wertermittlung<br />
des Deutschen Städtetags. Auch Stellungnahmen<br />
z.B. anderer Fachressorts sowie der Sachverständigenverbände<br />
wurden berücksichtigt.<br />
Neben redaktionellen Änderungen und Klarstellungen<br />
des Vorschriftenwortlauts wurde<br />
nunmehr der Liegenschaftszinssatz als der in<br />
der Regel zugrunde zu legende Zinssatz definiert.<br />
Wegen der enthaltenen Öffnungsklausel<br />
sind jedoch im Einzelfall auch andere Zinssätze<br />
zugelassen.<br />
Wesentliche Änderungen haben sich im vierten<br />
Kapitel für Bewertungen im Zusammenhang<br />
mit Erbbaurechten ergeben. Da das Vergleichswertverfahren<br />
mangels geeigneter<br />
Vergleichsfälle in der Praxis selten zur Durchführung<br />
gelangt, wurde die sogenannte finanzmathematische<br />
Methode grundlegend überarbeitet.<br />
Im Mittelpunkt der bisherigen<br />
Fassungen der WertR stand der Wertfaktor, mit<br />
dem die kapitalisierte Differenz zwischen<br />
erzielbarem und angemessenem Erbbauzins<br />
multipliziert wird – er soll gleichzeitig u.a. die<br />
Einschränkungen des jeweiligen Rechts erfassen.<br />
An seine Stelle ist ein Marktanpassungsfaktor<br />
getreten, der lokal aus dem Verhältnis<br />
Kaufpreis zu finanzmathematischem Wert des<br />
Erbbaurechts abgeleitet wird.<br />
Konsequent an den Stand der Technik angepasst<br />
richten sich die Regelungen zur Bewertung<br />
der personenbezogenen Rechte „Wohnungsrecht“<br />
und „Nießbrauch“ an der<br />
Methodik der Leibrentenberechnungen aus.<br />
Die Vor- und Nachteile für den Rechtsinhaber<br />
und den Grundstückseigentümer werden mittels<br />
der für die aktuellen Sterbetafeln des Statistischen<br />
Bundesamts ermittelten Leibrentenbarwertfaktoren<br />
kapitalisiert. Neu bei der<br />
Ermittlung des Wertes eines durch Nießbrauch<br />
belasteten Einfamilienhauses ist die Diskontierung<br />
des Wertes der unbelasteten Immobilie<br />
mit Hilfe des an die Lebenserwartung gebundenen<br />
Abzinsungsfaktors über die Restlebenserwartung<br />
der berechtigten Person. Erst<br />
danach werden die kapitalisierten Vor- und<br />
Nachteile berücksichtigt. Neu gefasst wurden<br />
auch die Modelle zur Bewertung von Wegerechten<br />
und Überbauten.<br />
In Gänze überarbeitet wurden die insgesamt 24<br />
Beispielrechnungen. Sie erhellen die ohnehin<br />
klar gefassten textlichen Formulierungen und<br />
verdeutlichen die Modellstrukturen. Hervorzuheben<br />
ist die Tatsache, dass alle darin vorkommenden<br />
Zahlen lediglich beispielhaft aufgeführt<br />
sind und keineswegs Wertansätze<br />
festschreiben wollen, die der Sachverständige<br />
ohnehin aus dem örtlichen Immobilienmarkt<br />
und seinem persönlichen Erfahrungsschatz<br />
abzuleiten hat.<br />
Hans-Wolfgang Schaar<br />
Stadt Essen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 101
Gutachterausschüsse stellen Weichen für IRIS.NRW<br />
In der Plenarversammlung ihrer Arbeitsgemeinschaft<br />
schrieben die Vorsitzenden Mitglieder<br />
der Gutachterausschüsse und des Oberen<br />
Gutachterausschusses für Grundstückswerte<br />
in Nordrhein-Westfalen am 28. März<br />
<strong>2006</strong> im Essener Ratssaal erneut Geschichte:<br />
Mit überwältigender Mehrheit beschlossen sie<br />
die Einführung des Immobilien-Richtwert-<br />
InformationsSystems IRIS.NRW. Ab Oktober<br />
<strong>2006</strong> soll schrittweise für möglichst viele Städte<br />
und Gemeinden in NRW eine Online-Auskunft<br />
über Durchschnittspreise von Einfamilienhäusern<br />
und Wohnungseigentum realisiert<br />
werden. Ein flächendeckendes Angebot ist ab<br />
Oktober 2007 geplant. Nach Eingabe weniger<br />
objektbeschreibender Parameter wie z.B. Lage<br />
des Objekts, Ausstattungsmerkmale, Wohnungsgröße<br />
wird aus den in den Kaufpreissammlungen<br />
der Gutachterausschüsse gespeicherten<br />
tatsächlich gezahlten Kaufpreisen ein<br />
Mittelwert ermittelt und samt seiner Streubreite<br />
angezeigt. Der Kunde kann sich diese Information<br />
anonymisiert als Liste ausgeben sowie<br />
auf einer Karte anzeigen lassen. Programmroutinen<br />
stellen die Plausibilität der mitgeteilten<br />
Daten sicher. Da diese Informationen nicht<br />
für Wertermittlungen im Einzelfall geeignet<br />
sind sondern lediglich einen Überblick über<br />
das Wertniveau verschaffen bzw. die Prüfung<br />
der Plausibilität einer Kaufpreisvorstellung<br />
oder einer Wertangabe ermöglichen sollen, ist<br />
ein Entgelt nicht vorgesehen. Zielgruppe der<br />
allgemeinen Preisauskunft sind Käufer, Verkäufer,<br />
Makler, Kreditinstitute sowie Behörden<br />
wie Arbeits- und Sozialverwaltung und die<br />
Finanzverwaltung. Dass das System funktionsfähig<br />
ist und auch Nachfrage besteht, wurde<br />
mit einem zur Intergeo 2005 in Düsseldorf<br />
erstellten Prototyp und im Rahmen eines Kundenforums<br />
erfolgreich getestet. Die Web-<br />
102<br />
Adresse lautet www.iris.nrw.de; vorerst können<br />
allerdings ausschließlich die Gutachterausschüsse<br />
zu Testzwecken zugreifen.<br />
Als weitere Ausbaustufe ist ab 2007 ein<br />
System von Immobilienrichtwerten geplant,<br />
das ab 2008 flächendeckend verfügbar sein<br />
soll. Hierbei wird der Kunde den bekannten<br />
Bodenrichtwerten vergleichbare Richtwerte<br />
für unterschiedliche Typen bebauter Immobilien<br />
erhalten, die mit Hilfe entsprechender Korrekturwerte<br />
an die Merkmale der zu bewertenden<br />
Immobilie angepasst werden können. Die<br />
Immobilienrichtwerte sind konzipiert als<br />
Grundlage für die Verkehrswertermittlung im<br />
Vergleichswertverfahren. Zielgruppen sind in<br />
erster Linie Sachverständige, darüber hinaus<br />
auch die oben genannten Zielgruppen.<br />
Schon einmal, im Jahr 2003, war der Plenarsaal<br />
im Essener Rathaus Schauplatz einer richtungsweisenden<br />
Entscheidung: Die AG-<br />
VGA.NRW beschloss seinerzeit ihr Erfolgskonzept<br />
BORIS.NRW, das einen weitgehend<br />
kostenfreien Zugriff auf die 30.000 in NRW<br />
beschlossenen Bodenrichtwerte ermöglicht.<br />
Heute liegen die täglichen Zugriffe auf das<br />
System zwischen 50.000 und 80.000<br />
(www.boris.nrw.de). In dieser Sitzung wurde<br />
bereits der Grundstein für ein bundesweite<br />
Linkportal zu allen Gutachterausschüssen<br />
gelegt, das von der Arbeitsgemeinschaft der<br />
Vermessungsverwaltungen der Länder entwickelt<br />
wurde (www.gutachterauschüsse-online.de).<br />
Hans-Wolfgang Schaar<br />
Stadt Essen<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Große Staatsprüfung in der Fachrichtung Vermessungs- und<br />
Liegenschaftswesen in Bonn-Bad Godesberg<br />
Das Oberprüfungsamt für den höheren technischen<br />
Verwaltungsdienst nahm vom 28. bis 30.<br />
März <strong>2006</strong> im Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen<br />
in Bonn-Bad Godesberg die<br />
Große Staatsprüfung in der Fachrichtung Vermessungs-<br />
und Liegenschaftswesen ab. Fünf<br />
Vermessungsreferendarinnen und zehn Vermessungsreferendare<br />
des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen nahmen in zwei Gruppen an diesem<br />
Examen teil. Ergebnis: Alle Teilnehmer haben<br />
die Prüfung mit Erfolg bestanden!<br />
Gruppenfoto vom 29.3.<strong>2006</strong><br />
Das Oberprüfungsamt mit Sitz in Frankfurt am<br />
Main ist als gemeinschaftliches Amt des Bundes,<br />
der Bundesländer und kommunaler Spitzenverbände<br />
für die gesamte Bundesrepublik<br />
tätig. Jährlich legen mehr als 250 Referendarinnen<br />
und Referendare nach zweijährigem<br />
Vorbereitungsdienst in den verschiedenen<br />
Fachrichtungen Hochbau, Städtebau, Wasserwesen,<br />
Straßenwesen, Bahnwesen, Maschinen-<br />
und Elektrotechnik, Vermessungs- und<br />
Liegenschaftswesen, Wehrtechnik, Luftfahrttechnik,<br />
Umwelttechnik/Umweltschutz und<br />
Landespflege ihre Große Staatsprüfung ab. Sie<br />
erwerben damit die Befähigung für den höheren<br />
technischen Verwaltungsdienst und sind<br />
berechtigt die Berufsbezeichnung „Assessor“<br />
mit einem die Fachrichtung kennzeichnenden<br />
Zusatz zu führen.<br />
Bewerberinnen und Bewerber für ein technisches<br />
Referendariat müssen ein abgeschlossenes<br />
wissenschaftliches Studium an einer Technischen<br />
Hochschule/Universität oder einer<br />
Gesamthochschule mit gleichwertigem wissenschaftlichen<br />
Studienangebot nachweisen.<br />
Die Vorraussetzung wird auch durch einen<br />
Masterabschluss an einer Technischen Hochschule/Universität<br />
oder einer Gesamthochschule<br />
erfüllt. Entsprechendes gilt für den<br />
Masterabschluss an einer Fachhochschule,<br />
wenn der betreffende Akkreditierungsbeschluss<br />
auch die Öffnungsklausel für den Zugang<br />
zum höheren Dienst enthält.<br />
Gruppenfoto vom 30.3.<strong>2006</strong><br />
Mehr Informationen zum Oberprüfungsamt<br />
für den höheren technischen Verwaltungsdienst<br />
gibt es im Internet unter:<br />
www.oberpruefungsamt.de<br />
Olaf Lüders<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 103
Termine<br />
Kolloquium im Sommersemester <strong>2006</strong><br />
Die Universität Bonn und die Bezirksgruppe<br />
<strong>Köln</strong> des Deutschen Vereins für Vermessungswesen<br />
erlauben sich, alle Fachkollegen und<br />
Freunde der Geodäsie zum Geodätischen Kolloquium<br />
im Sommersemester <strong>2006</strong> einzuladen.<br />
Vortragsfolge:<br />
Donnerstag, den 22. Juni <strong>2006</strong><br />
ÖbVermIng. Dr. Walter Schwenk, Berlin<br />
Bewertung und Übernahme einer Geschäftsstelle<br />
eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs<br />
Aufgespießt<br />
Viele Vermesser haben viele Lagestati. Ich frage<br />
mich nur regelmäßig, woher sie die nehmen.<br />
Da denke ich gerne zurück an einen Referendarskollegen<br />
und großen Lateiner, der uns<br />
damals den sich aus der u-Deklination ergebenden<br />
Plural Statûs ins Gedächtnis gebrannt<br />
hat.<br />
An dieser Stelle also die Bitte an alle Fachkolleginnen<br />
und -kollegen, den Plural des Status<br />
(und damit auch des Lagestatus) mit Status zu<br />
104<br />
Donnerstag, den 06. Juli <strong>2006</strong><br />
Prof. Dr. Manfred Schneider, TU München<br />
Zur Entwicklung hochgenauer Bahntheorien<br />
Die Vorträge finden um 16.00 Uhr c.t. im Hörsaal<br />
XVI des Geodätischen Instituts, Nussallee<br />
17, 53115 Bonn, statt.<br />
Prof. Dr.-Ing. Kuhlmann<br />
Universität Bonn<br />
benennen, wobei der Plural mit einem langen<br />
u ausgesprochen wird. Es handelt sich hierbei<br />
um die so genannte u-Deklination der lateinischen<br />
Grammatik, die zum Beispiel auch für<br />
„Casus knacktus“ gilt.<br />
Deike Hagner<br />
<strong>Bezirksregierung</strong> Düsseldorf<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Buchbesprechungen<br />
Dr. Rainer Sandau (Hrsg.):<br />
„Digitale Luftbildkamera“<br />
Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co. KG,<br />
Heidelberg, 2005; ISBN 3-87907-391-0; 342 Seiten,<br />
kartoniert Preis: 52,00 e<br />
Seit vielen Jahrzehnten werden Luftbilder für Zwecke<br />
der Landesvermessung mit analogen Reihenmesskammern<br />
erflogen. Auf Grund der rasanten Entwicklung<br />
in der digitalen Aufnahmetechnik stehen in den<br />
Vermessungsverwaltungen derzeit Überlegungen an,<br />
ab wann und mit welchem digitalen Aufnahmesystem<br />
sie die zur Produktion digitaler Orthophotos erforderlichen<br />
Luftbilder erfliegen lassen. Dabei stellt sich<br />
ihnen ferner die Frage, wie die Ergebnisse der neuen<br />
Technologie in die derzeit praktizierten Arbeitsprozesse<br />
einzubinden sind.<br />
Die Informationen, die Herr Dr. Sandau in seinem<br />
Buch „Digitale Luftbildkamera“ über die verschiedenen<br />
Sensorsysteme vermittelt, werden sicherlich zu<br />
einer Entscheidungsfindung beitragen. Mit Herrn Dr.<br />
Sandau hat der herausgebende Herbert Wichmann<br />
Verlag einen erfahrenen Experten als Autor gewinnen<br />
können, der seit Jahrzehnten in der Weltraumforschung<br />
tätig ist und an der Entwicklung einer digitalen<br />
Kamera beteiligt war.<br />
Das Buch, in dem alle Komponenten der Zeilen- bzw.<br />
Matrixkameras vom Aufnahmeobjektiv bis zum Massendatenspeicher<br />
eingehend abgehandelt werden,<br />
gliedert sich in folgende Kapitel:<br />
� Einleitung<br />
Chronologisch wird der Fortschritt der Technologien<br />
aufgezeigt, der von der analogen Kamera zur<br />
Realisierung digitaler Luftbildkameras, einsetzbar<br />
für Anwendungsbereiche in der Photogrammetrie<br />
und Fernerkundung, führte.<br />
� Grundlage und Definitionen<br />
� Aufnahmeobjekt und Atmosphäre<br />
In diesen beiden Kapiteln werden vertieft - durchsetzt<br />
von mathematischen Formeln und Beziehungen<br />
– die Strahlungs-, Optik- und Sensoreigenschaften<br />
behandelt, die die Qualität der optischen<br />
Abbildung der Aufnahmeobjekte beeinflussen.<br />
� Aufbau einer digitalen Kamera<br />
Die Ausführungen dieses umfangreichsten Kapitels<br />
befassen sich mit den vielfältigen Komponenten,<br />
aus denen sich das äußerst komplexe System<br />
zusammensetzt. Beginnend mit den Bausteinen<br />
der Optik und Mechanik werden die Nutzung von<br />
Filtern und optoelektronischen Wandlern, der<br />
Aufbau einer Fokalebene, das Aufbauprinzip für<br />
die sensornahe Elektronik, die Aufgaben der Digitalrechner,<br />
die Nutzung von Positions- und Lagemesssystemen<br />
und die Anforderungen an die<br />
Montageplattform ausführlich beschrieben und<br />
erläutert. Die Ausführungen schließen auch das<br />
heute praktizierte Flugmanagementsystem, das<br />
der Einsatz moderner Hard- und Softwarekomponenten<br />
ermöglicht, ein.<br />
� Kalibrierung<br />
Es wird dargelegt, dass Digitale Luftbildkameras<br />
eine modifizierte Form der Laborkalibrierung<br />
erfordern. Die anzuwendenden Verfahren richten<br />
sich nach dem Typ der Kamera (Flächen- oder Zeilensensor).<br />
� Datenprozessierung und Archivierung<br />
In diesem Kapitel wird die Abfolge der Datenverarbeitungsschritte<br />
erläutert und schematisch<br />
dargestellt.<br />
� Beispielsystem ADS40<br />
Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf<br />
den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise<br />
von digitalen Matrix- bzw. Zeilenkameras.<br />
Hier wird die Realisierung einer bestimmten Zeilenkamera<br />
konkret beschrieben. Bilderbeispiele<br />
von Luftbildern, die mit diesem Kamerasystem<br />
erflogen wurden, und die Abbildung davon abgeleiteter<br />
Luftbildprodukte schließen die Informationsvermittlung<br />
ab.<br />
Bis auf die mathematisch geprägten Passagen wird in<br />
dem vorliegenden Buch leicht verständlich und detailliert<br />
der Aufbau digitaler Kamerasysteme beschrieben.<br />
Überzeugend wird dargelegt, dass sich über die<br />
Nutzung der Aufnahmen digitaler Kameras für die<br />
Erledigung der bisherigen Aufgaben in der Photogrammetrie<br />
und Fernerkundung u. a. Qualitätsverbesserungen<br />
und Kostenersparnisse bei der Fertigung der<br />
abgeleiteten Produkte erzielen lassen. Darüber hinaus<br />
lassen sich weitere Anwendungsgebiete erschließen.<br />
Immer wieder wird der Vergleich zum Einsatz der bisherigen<br />
analogen Kamera und zur Nutzung ihrer Bildflugergebnisse<br />
gezogen.<br />
Zahlreiche Abbildungen und Graphiken tragen zum<br />
leichteren Verständnis bei. Angenehm ist es auch, dass<br />
des Öfteren zusammenfassende Rückblicke und<br />
erneute Einleitungen formuliert sind.<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong> 105
Die Ausführungen liefern Informationen, die eine<br />
endgültige Entscheidung für die Realisierung einer<br />
Matrix- oder Zeilenkamera noch offen lassen. Maßgebend<br />
ist hierfür letztlich der angestrebte Verwendungszweck<br />
und die verfügbare technologische Basis.<br />
Gleichermaßen offen bleibt, ob der Nutzer digitaler<br />
Bildflugergebnisse dem Einsatz des einen oder anderen<br />
Systems den Vorzug geben soll.<br />
106<br />
Nützlich sind auch das Abkürzungsverzeichnis, das<br />
umfangreiche Literatur- und Quellenverzeichnis<br />
sowie das Sachwörterverzeichnis.<br />
Wolfgang Kickbusch<br />
Landesvermessungsamt NRW<br />
: <strong>NÖV</strong> NRW 2/<strong>2006</strong>
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Innenministerium<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Haroldstraße 5<br />
40213 Düsseldorf<br />
Telefon: (0211) 871- 01<br />
Telefax: (0211) 871- 2979<br />
E-Mail: referat36@im.nrw.de<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit<br />
Genehmigung des Herausgebers.<br />
Schriftleitung<br />
Ministerialrat Klaus Mattiseck<br />
Die Veröffentlichung eines Artikels besagt nicht,<br />
dass die vom Verfasser vertretene Ansicht mit der<br />
Auffassung des Innenministeriums unbedingt<br />
übereinstimmt.<br />
Einsendungen werden erbeten an:<br />
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen,<br />
Referat 36 – Schriftleitung <strong>NÖV</strong>, 40190 Düsseldorf<br />
Satz, Druck und Vertrieb:<br />
Landesvermessungsamt NRW, 53170 Bonn