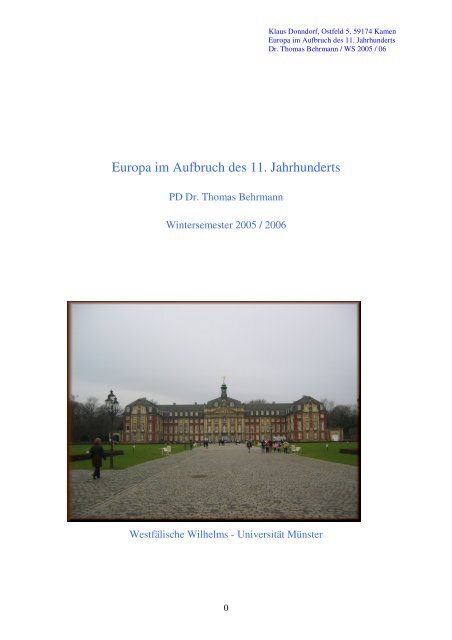Th. Behrmann - der Familie Donndorf
Th. Behrmann - der Familie Donndorf
Th. Behrmann - der Familie Donndorf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
0<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
PD Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong><br />
Wintersemester 2005 / 2006<br />
Westfälische Wilhelms - Universität Münster
1<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Vorlesung vom 28. 10.2005<br />
Vorlesung<br />
PD Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong><br />
Die erste Hälfte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts war die Übergangsphase vom Frühmittelalter<br />
zum Hochmittelalter. Es war eine Epoche <strong>der</strong> Umbrüche in Europa, von <strong>der</strong> alle<br />
europäischen Län<strong>der</strong> erfasst wurden. Das Europa des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts war in Hinblick<br />
auf Politik, Gesellschaft und Religion von tief greifenden Verän<strong>der</strong>ungen gekennzeichnet.<br />
Deshalb muss man diese Zeit als Ganzes sehen; die Entwicklung ist nicht ohne die<br />
italienische, die französische, die englische und die skandinavische Geschichte zu<br />
verstehen.<br />
Heiliges Römisches Reich im Hochmittelalter
Die Vorlesung ist in folgende Abschnitte unterteilt:<br />
1. Einführung: Das 11. Jahrhun<strong>der</strong>t in <strong>der</strong> Geschichte Europas<br />
2. Die Län<strong>der</strong> Europas nach <strong>der</strong> ersten Jahrtausendwende<br />
2.1 Italien und Spanien<br />
2.2 Frankreich und Deutschland<br />
2.3 England<br />
3. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des Investiturstreits<br />
3.1 Italien und Spanien<br />
3.2 Frankreich und Deutschland<br />
3.3 England<br />
3.4 Nord- und Osteuropa / Fragestunde<br />
4. Wirtschaft und Gesellschaft<br />
4.1 Ländliche und städtische Welt<br />
4.2 Die Gesellschaft<br />
4.3 Die europäische Romanik<br />
5. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des ersten Kreuzzuges<br />
5.1 Italien und Spanien<br />
5.2 Frankreich und Deutschland<br />
2<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
1. Einführung: Das 11. Jahrhun<strong>der</strong>t in <strong>der</strong> Geschichte Europas<br />
1.1 Wandel in Europa im Hochmittelalter<br />
Das Geschehen im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t erfasst, wie oben gesagt, alle europäischen Län<strong>der</strong>.<br />
Im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t erlebte Europa allen politischen Unruhen zum Trotz ein stabiles<br />
Wirtschaftswachstum, das allerdings in den einzelnen Län<strong>der</strong>n unterschiedlich stark<br />
ausgeprägt war. Die Fortschritte in <strong>der</strong> Landwirtschaft waren zwar vorerst nur von<br />
bescheidenem Umfang; Bischöfe, Äbte und weltliche Landesherren forcierten aber auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite auch die Urbarmachung und Besiedelung bisher nicht erschlossener<br />
Regionen, so dass die landwirtschaftliche Produktion deutlich gesteigert wurde, was<br />
angesichts des Bevölkerungswachstums auch dringend notwendig war.<br />
Daneben gewannen Garten- und Weinbau an Bedeutung, und aufgrund des<br />
wachsenden Bedarfs an Pferden für den Kriegsdienst o<strong>der</strong> den Transport entstanden<br />
große Pferdezuchten. Noch deutlicher war <strong>der</strong> Fortschritt im Handel zu erkennen. Der<br />
regionale, regionsübergreifende und sogar internationale Handel entlang <strong>der</strong> Flüsse und<br />
großen Verkehrswege und auf dem Seewege blühte auf.<br />
Die Stadtentwicklung machte Fortschritte, man legte Stadtmauern an, Kirchen wurden<br />
gebaut. Eine Verwaltung brauchte man natürlich auch. Und die Burgen, als ländlicher<br />
Herrschaftssitz, wurden jetzt aus Stein und nicht mehr aus Holz gebaut. Es gab die<br />
technischen und vor allem die finanziellen Mittel, um Baumeister zu bezahlen. Der neue<br />
Ritterstand sorgte für eine militärische Ausstattung <strong>der</strong> Burgen.<br />
Dabei waren die Krieger des FMA in <strong>der</strong> Regel Bauern, die ihrem bäuerlichen<br />
Obliegenheiten nachgingen und nur in Kriegszeiten zur Waffe griffen. Mit dem Erstarken<br />
eines eigenen Ritterstandes kommt es hier zu einer Differenzierung zwischen Ritter und<br />
Bauer. 1096 kommt es zum ersten Kreuzzug. Im August 1096 brachen reguläre<br />
Kreuzfahrerheere, vor allem französische und lothringische Ritter sowie Normannen aus<br />
Frankreich und Süditialien, Richtung Konstantinopel auf.
Kreuzzüge - Die Routen <strong>der</strong> Hauptheere<br />
(Bildquelle: www.gabrieleweis.de)<br />
3<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
1.2 Europa im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t – ein Kontinent regionaler Son<strong>der</strong>fälle<br />
Das Europa des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts ist ein Gebiet „regionaler Son<strong>der</strong>fälle“; d.h. jedes<br />
Land ist für sich solch ein Son<strong>der</strong>fall. Wir betrachten die einzelnen Län<strong>der</strong>:<br />
1. ITALIEN – nimmt durch sein historisches und geographisches Potential eine gewisse<br />
Son<strong>der</strong>stellung ein. So war <strong>der</strong> Urbanisierungsgrad <strong>der</strong> italienischen Städte<br />
größer, als in an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n. Es gab mehr Strassen und Brücken, die sog.<br />
Infrastruktur war besser, als sonst in Europa. Die oberitalienischen Städte<br />
suchten sich seit dem frühen 11. Jahrhun<strong>der</strong>t aus <strong>der</strong> Macht <strong>der</strong> vom Kaiser<br />
eingesetzten und von ihm mit umfassenden weltlichen Rechten ausgestatteten<br />
Bischöfe zu lösen.<br />
Es gab keinen König o<strong>der</strong> Kaiser und so konnten die Städte eine wirtschaftliche<br />
und politische Vormachtstellung erlangen. Mailand wird zur mächtigsten Stadt<br />
in Oberitalien.<br />
Und dann war da seine Lage am Mittelmeer, wodurch alle damals bedeutenden<br />
Handelswege nach Osten Italien berührten o<strong>der</strong> von ihm ausgingen. Der<br />
enorme wirtschaftliche Aufschwung vor allem <strong>der</strong> Hafenstädte Venedig, Genua<br />
und Pisa im Rahmen <strong>der</strong> Kreuzzüge stärkte das Selbstbewusstsein, die<br />
Autonomiebestrebungen und die Macht <strong>der</strong> oberitalienischen Kommunen noch<br />
weiter. <strong>Behrmann</strong> nennt das „die Spitze des ökonomischen Fortschritts“.<br />
2. SPANIEN – war seit 711 unter moslemischer Herrschaft und auch hier kommt es um<br />
1100 zu einem Wendepunkt. 1002 endet mit dem Tod des islamischen<br />
Feldherrn "Almansor" die Kalifenzeit und das arabische Spanien zerfällt in<br />
zahlreiche Kleinstaaten, Taifas. Die Zeit <strong>der</strong> Reconquista, <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>-<br />
eroberung beginnt. Es ist keine zentral gesteuerte Entwicklung, wird sie<br />
doch über 400 Jahre dauern. Erst mit <strong>der</strong> Eroberung des muslimischen<br />
Granada durch Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragonien 1492<br />
war die Reconquista abgeschlossen.<br />
Weiterhin löst sich PORTUGAL von Spanien und wird selbständige Grafschaft.
Die Reconquista zwischen 795 und 1300<br />
(Bildquelle: campoy5.wordpress.com)<br />
4<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
3.ENGLAND - Das Jahr 1066 markiert einen Wendepunkt <strong>der</strong><br />
englischen Geschichte. Wilhelm I. (<strong>der</strong> Eroberer / † 1087), und<br />
seine Söhne brachten eine neue lebhafte Herrschaft nach<br />
England. Die Normannen erobern das Land, wie sie in ganz<br />
Europa (Italien!) Geschichte geschrieben haben. England wird<br />
für die nächsten 400 Jahre mit <strong>der</strong> normannisch-französischen<br />
Kultur verbunden bleiben.<br />
Ein schönes Zeugnis <strong>der</strong> Eroberung durch Wilhelm ist <strong>der</strong><br />
„Teppich von Bayeux“.<br />
Wilhelm <strong>der</strong> Eroberer<br />
4. FRANKREICH – seine Geschichte - entstanden aus dem Reich Karl des Großen – geht<br />
über mehrere Jahrhun<strong>der</strong>te. Nach den Karolingern entstehen erst im 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t zwei selbständige „Gebilde“ (Staaten im heutigen Sinne gab<br />
es noch nicht). Die beiden Dynastien <strong>der</strong> Kapetinger im Westen und <strong>der</strong><br />
Salier im Osten stehen am Anfang <strong>der</strong> Geschichte im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t.
5<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die politisch-geographische<br />
Entwicklung bei<strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />
geht in verschiedene Rich -<br />
tungen. Während Frankreich<br />
sich nach England orientiert,<br />
liegen die deutschen Inter –<br />
essen im Osten und Norden<br />
(Polen / Dänen).<br />
Der französische König hat<br />
nur begrenzte Machtbefug –<br />
nisse; sein Einflussgebiet<br />
liegt um Paris, die sog. „Ile<br />
de France“. Die eigentliche<br />
Macht haben mächtige lokale<br />
<strong>Familie</strong>n. Insofern ist die Ge-<br />
schichte Frankreichs auch nur<br />
von den Regionen aus zu Das Reich <strong>der</strong> Kapetinger um 1000<br />
schreiben.<br />
5. DEUTSCHLAND – hier wird erwähnt, dass es immer das erste Ziel des deutschen<br />
Königs (Rex Romanorum) war, den Kaisertitel zu erlangen. Das bedeutete<br />
Beson<strong>der</strong>e religiöse Weihe und Erhöhung. Da dieser Titel nur vom Papst<br />
Verliehen werden kann, gewinnt dieser mehr Einfluss. Die Dramatik des 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts drückt sich u.a. im sog. Investiturstreit aus.<br />
6. POLEN /SCANDINAVIEN – auch dies Son<strong>der</strong>fälle, weil sich hier das Christentum erst zu<br />
etablieren beginnt. Die Fahrten <strong>der</strong> Wikinger hören auf, die Län<strong>der</strong> werden<br />
in die europäische Entwicklung eingebunden. Die Christianisierung schreitet<br />
erfolgreich fort, was auch eine Verbreitung <strong>der</strong> lateinischen Schrift mit sich<br />
bringt. So gibt es ab jetzt genuine (echte) schriftliche Zeugnisse aus diesen<br />
Län<strong>der</strong>n.<br />
Das Königtum in Dänemark, Norwegen und Schweden bildet sich aus, mit<br />
den Königen:<br />
Olaf II. <strong>der</strong> Heilige (†1030)<br />
Knut III. <strong>der</strong> Heilige (†1086)<br />
Erik <strong>der</strong> Heilige (†1160)<br />
1.3 Europa im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t – überregionale Gemeinsamkeiten<br />
Europa ist bei allen eigenständigen Entwicklungen ein Gebiet überregionaler<br />
Gemeinsamkeiten. So beim Bevölkerungswachstum, <strong>der</strong> Stadtentwicklung und <strong>der</strong><br />
Arbeitsteilung. Es entwickeln sich Formen „politischer Identitäten“, frühe nationale<br />
Entwicklungen zeichnen sich ab. Dabei spielt in allen Län<strong>der</strong>n – außer Italien – das<br />
Königtum eine Hauptrolle. Die Verän<strong>der</strong>ungen kommen nicht „von unten“, nicht<br />
vom Volk, son<strong>der</strong>n das jeweilige Königtum spielt die Hauptrolle. Ohne Königtum<br />
wäre also keine solche Entwicklung möglich geworden.<br />
Bei den Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen Län<strong>der</strong>n spielen Kirche<br />
und Mönchstum ebenfalls eine Hauptrolle. So tragen z.B. die Mönche von Cluny die<br />
neuen Gedanken in an<strong>der</strong>e europäische Län<strong>der</strong>. Das 11. Jahrhun<strong>der</strong>t markiert hier<br />
nur einen Anfang, ist aber eine „Zeit <strong>der</strong> Bewegung und <strong>der</strong> Bewegungen“. Und <strong>der</strong><br />
Beruhigungen – z.B. in Form <strong>der</strong> Christianisierung Ungarns.<br />
Ende des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts brechen die ersten Kreuzfahrer zum Kreuzzug ins<br />
Heilige Land auf. Sie kommen aus Italien, Frankreich und Deutschland, auch<br />
Normannen sind – wie<strong>der</strong> – mit dabei.
1.4 Die Län<strong>der</strong> Europas an <strong>der</strong> Jahrtausendwende<br />
6<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Das römisch-deutsche Reich besteht jetzt aus 4 Herzogtümern, und zwar<br />
• Sachsen<br />
• Schwaben<br />
• Bayern<br />
• Lothringen<br />
Dabei gibt es noch keinen<br />
Flächenstaat im mo<strong>der</strong>nen<br />
Sinne. Grafen und Bischöfe<br />
regieren eigene Herrschaftsgebiete.<br />
Der König war de<br />
facto ein „besserer Herzog“,<br />
konnte den an<strong>der</strong>en<br />
Herzögen aber nicht in <strong>der</strong>en<br />
Angelegenheiten reinreden<br />
o<strong>der</strong> –regieren. Lediglich bei<br />
einer sich ergebenden Vakanz<br />
– kein Erbe da – hatte er ein<br />
Mitspracherecht.<br />
Das Herrschaftsgebiet <strong>der</strong><br />
Ottonen und <strong>der</strong> Salier<br />
beschränkte sich also auf den<br />
Osten – mit den Städten u.a. Deutschland um das Jahr 1000<br />
Magdeburg, Quedlinburg o<strong>der</strong><br />
Merseburg.<br />
Südlich <strong>der</strong> Alpen gab es solche Strukturen nicht. Hier stellen die adligen<br />
<strong>Familie</strong>n den Papst, die Städte werden meist von einem Bischof regiert. Einen<br />
Son<strong>der</strong>fall stellt Venedig dar, das immer eine Republik war, wenn auch von einem<br />
Dogen mit umfassen<strong>der</strong> Machtfülle regiert. Sizilien gehörte zum muslimischen<br />
Kulturkreis, wie auch in Spaniens damaligen Zentrum Kalifen die politischen und<br />
religiösen Führer waren.<br />
Frankreich war politisch am stärksten aufgesplittert. Viele Große im Land sind<br />
mächtiger, als <strong>der</strong> König und bauen sich z.B. auch ihre Burgen selber Die<br />
Herrschaftsgebiet konzentrieren sich auf die Bretagne und auf das Gebiet südlich<br />
<strong>der</strong> Loire. Die mächtigsten Herzöge sind die von Aquitanien! Außerdem entwickeln<br />
sich zwei Sprachen, die „Langue d’oc“ im Süden und die „Langue d’oil“ im Norden.<br />
Ein ökonomischer Aufschwung kommt zögerlich in Gang – so in Flan<strong>der</strong>n, wo<br />
Eindeichungen zu Landgewinn führen.<br />
Im England <strong>der</strong> Angeln und <strong>der</strong> Sachsen sehen wir eine eigentümliche<br />
Entwicklung. Auch hier gibt es Einfälle <strong>der</strong> Wikinger, die sich dann dauerhaft hier<br />
nie<strong>der</strong>lassen. Unter Knut d.Gr. (um 995-1035) entsteht ein „Nordseekönigreich“.<br />
1.5 Die Menschen Europas an <strong>der</strong> Jahrtausendwende<br />
Die Lebensbedingungen für die Menschen damals – sieht man vom Adel und vom<br />
Klerus ab – waren in Nord-, Mittel- und Westeuropa sehr armselig. Man lebt in<br />
Holzhütten, die wenigen Fel<strong>der</strong> sind umgeben von großen Waldgebieten.<br />
Großflächige Rodungen gibt es noch nicht, diese kommen erst sehr viel später. Die<br />
Burgen, Klöster und Kirchen sind aus Holz gebaut und diesen Herren gehört das<br />
Land. Dafür bieten sie militärischen Schutz, gegen entsprechende Abgaben,<br />
versteht sich.
7<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Der Süden Europas ist reicher an urbaner Zivilisation, als die übrigen Gebiete.<br />
Überall aber ist durch die äußeren Umstände <strong>der</strong> <strong>Familie</strong>nverband gestärkt.<br />
Der burgundische Mönch Rodulfus Glaber (auch Raoul Glaber o<strong>der</strong> Rodulf <strong>der</strong><br />
Kahle) lebte wahrscheinlich von 980 bis 1046. Glaber verbrachte fast sein<br />
gesamtes Leben in burgundischen Klöstern, die unter <strong>der</strong> Herrschaft kapetingischer<br />
Herzöge standen. Er hat eine Hungersnot in den Jahren 1032-33 mit sehr<br />
drastischen Worten beschrieben:<br />
„Die Reichen und die Bürgerlichen litten genauso wie die Armen, und die<br />
Gewalttätigkeiten <strong>der</strong> Vornehmen wichen gegenüber dem gemeinsamen Elend. Die<br />
Reichen magerten ab und litten Not. Die Armen nagten an Baumwurzeln. Viele –<br />
es ist abscheulich, das sagen zu müssen – gingen sogar so weit, dass sie<br />
Menschenfleisch aßen.<br />
Entlang <strong>der</strong> Straßen überfielen die Starken die Schwachen, zerfleischten und<br />
brieten sie und aßen ihr Fleisch. Manche lockten Kin<strong>der</strong> mit einem Ei o<strong>der</strong> einer<br />
Frucht und zogen sie beiseite, um sie zu verschlingen. Die Raubgier führte<br />
schließlich dazu, dass das Tier sicherer war als <strong>der</strong> Mensch. …<br />
Im Wald von Mâcon hatte ein Unglücklicher in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Kirche Saint Jean<br />
eine Hütte errichtet, in <strong>der</strong> er nachts diejenigen, die dort Schutz suchten,<br />
ermordete. Ein Mann, <strong>der</strong> einige Knochen entdeckte, konnte fliehen. 48 Schädel<br />
von Männern, Frauen und Kin<strong>der</strong>n fand man dort.<br />
Die Hungersnot war so groß, dass man das Mehl mit Kreide mischte.”<br />
1.6 Die Wahrnehmung <strong>der</strong> Jahrtausendwende<br />
Wie haben nun die Menschen die Ereignisse dieser Jahrtausendwende gesehen<br />
und erfahren? Man muss dabei berücksichtigen, dass überhaupt nur sehr wenige<br />
Menschen die Zeit messen und erfassen konnten – z.B. die Mönche. Für die<br />
einfachen Menschen waren die Jahreszeiten <strong>der</strong> Maßstab. So wird den meisten <strong>der</strong><br />
Zeitpunkt <strong>der</strong> Wende gar nicht bewusst gewesen sein. Wurden doch auch Urkunden<br />
nur nach den Amtsjahren des Ausstellers bezeichnet.<br />
Nach <strong>der</strong> Bibel sollte <strong>der</strong> Teufel nach 1000 Jahren kommen und Christus<br />
auferstehen. Man kann sich die Unruhe in den Klöstern angesichts dieser<br />
Erwartungen vorstellen. Auch dazu schreibt Glaber. Auch nehmen die Pilgerreisen<br />
zu, aber jetzt nicht mehr nach Rom zu den Gräbern von Petrus und Paulus,<br />
son<strong>der</strong>n nach Jerusalem zum Grab Jesu.<br />
Vorlesung vom 4.11.2005<br />
2. Die Län<strong>der</strong> Europas nach <strong>der</strong> ersten Jahrtausendwende<br />
Man muss sich bei dem Wort „Län<strong>der</strong>“ darüber klar sein, dass es sich für die damalige<br />
Zeit nur um einen rein geographischen Begriff und noch nicht um einen „Staat“ in<br />
unserem heutigen Sinn gehandelt hat. Und die „Lebensbedingungen“ <strong>der</strong> Menschen <strong>der</strong><br />
damaligen Zeit waren eher „Über“-Lebensbedingungen.<br />
Zwischen dem 5. und dem 15. Jahrhun<strong>der</strong>t wurde das Erbe des antiken<br />
Mittelmeerraumes nach Norden in die Gebiete nördlich <strong>der</strong> Alpen getragen. (Die gesamte<br />
Vorlesung steht praktisch unter diesem Leitmotiv). Und dabei spielt das 11.Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
eine ganz entscheidende Rolle. Die Christianisierung schreitet in Skandinavien und im<br />
Osten (Polen, Ungarn) fort, die bisher so kriegerischen Wikinger und die Ungarn geben<br />
Ruhe – kurz: die Län<strong>der</strong> Europas kommen zur Ruhe.
8<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Es beginnt ein Prozess <strong>der</strong> Expansion. Hafenstädte wie Venedig, Pisa o<strong>der</strong> Genua<br />
werden im Osten aktiv und dieser Prozess wird dann im 13. Jahrhun<strong>der</strong>t (1273) u.a. von<br />
Marco Polo nach Asien weiter geführt.<br />
Und im 15. Jahrhun<strong>der</strong>t schließlich wird – fast zufällig – Amerika<br />
entdeckt. Denn im Bestreben, auf dem westlichen Seeweg von Europa<br />
nach Ostasien zu gelangen, erreicht Columbus (1451-1506) am 12.<br />
Oktober 1492 die dem amerikanischen Kontinent vorgelagerten<br />
karibischen Inseln.<br />
Für diese weitere europäische Entwicklung ist das 11. Jahrhun<strong>der</strong>t als<br />
eine Wendezeit zu bezeichnen, die den Weg hin zur „Weltgeschichte“<br />
bereitet. Marco Polo<br />
Betrachten wir die einzelnen Län<strong>der</strong>: (1254-1324)<br />
2.1 Italien und Spanien<br />
2.1.1 Das Ende des Königsreiches Italien<br />
2.1.2 Die Mitte Italiens unter den Tusculaner Päpsten<br />
2.1.3 Das Normannische Reich<br />
2.1.4 Italien und Spanien<br />
2.1.5 Der Zerfall des Kalifenreiches<br />
2.1.6 Christliche Reiche in Spanien<br />
2.1.1 Das Ende des Königreiches Italien<br />
Noch zurzeit Otto III. gab es in Italien einen Kaiser. Otto III. wollte sein Reich sogar von<br />
Rom aus regieren, aber sei jäher Tod 1002 – er war erst 22 Jahre alt – ließ auch diese<br />
seine Vision sterben. Denn sein Nachfolger Heinrich II. (973-1024) war mehr auf das<br />
Gebiet nördlich <strong>der</strong> Alpen konzentriert und war nur gelegentlich in (Reichs-) Italien, u.a.<br />
1014 zu seiner Kaiserkrönung durch Papst Benedikt VIII.<br />
So gab es in Italien keine sog. Zentralgewalt mehr und die großen Adelsfamilien<br />
übernehmen diese mehr und mehr. Allen voran die mächtigen Markgrafen von Canossa,<br />
die in ihrem Herrschaftsgebiet über 100 geistliche und weltliche Domänen besitzen. Sie<br />
sind langobardischer Herkunft. Nach dem Tod Heinrich II. im Jahr 1024 zerstören die<br />
Bürger von Pavia – damals die wichtigste Stadt in Oberitalien – die königliche Pfalz. Ein<br />
unerhörter Vorgang!<br />
Im weitern Verlauf wird <strong>der</strong> Burgenbau in Oberitalien von den Adelsfamilien verstärkt.<br />
Aber diese Burgen bekommen jetzt mehr eine herrschaftliche Bedeutung, dienen nicht<br />
mehr in erster Linie <strong>der</strong> Verteidigung. Denn für die Herrschaft über die Landbevölkerung<br />
braucht man solche Verteidigungsburgen nicht. Von denen <strong>der</strong> Herzog von Asti allein 37<br />
sein eigen genannt haben soll. Diese Entwicklung wird als „Incastellamento“ bezeichnet.<br />
Im weiteren Verlauf vertiefen sich die Gegensätze zwischen dem Adel und den Rittern<br />
gegenüber <strong>der</strong> Landbevölkerung. Ehemals freie Bauern sinken in die Abhängigkeit, es<br />
kommt zu einer stärkeren sozialen Differenzierung. Die auch die königlichen Vasallen, die<br />
Adelsfamilien erreicht und die größeren, die „Capitoren“ und die kleineren, die<br />
„Valvassoren“ entstehen lässt. Dies auch ein Zeichen für ein wirtschaftliches Wachstum<br />
und höhere landwirtschaftliche Erträge, erhalten doch beide Gruppen Abgaben von den<br />
Bauern zu ihrem Lebensunterhalt.<br />
In Italien brach 1035 ein allgemeiner Aufstand <strong>der</strong> großen und kleinen Lehensträger,<br />
<strong>der</strong> Valvassoren, gegen die Bischöfe, beson<strong>der</strong>s gegen Ebf. Aribert von Mailand, aus. Die<br />
Bischöfe versuchten nämlich, den Valvassoren zunehmend einen Teil ihrer Lehen<br />
einzuziehen, da sie <strong>der</strong>en Machtzuwachs fürchteten. In diesem Aufstand sah Konrad II.<br />
die Interessen des Reiches in Italien gefährdet, denn diese Valvassoren bildeten die<br />
militärische Stütze <strong>der</strong> Reichsgewalt in Italien.<br />
Die weitere Entwicklung in Italien zeigt ein Wachstum <strong>der</strong> städtischen Siedlungen<br />
(burgi / suburbium), bedingt durch ein Anwachsen <strong>der</strong> Bevölkerung und dies wie<strong>der</strong>um<br />
durch wirtschaftliches Wachstum. Städte gab es schon aus antiker Zeit, aber diese waren
9<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
eher klein und wenig bedeutend. Jetzt erhalten sie mehr Zuzug und damit steigen auch<br />
die Landpreise. Von dieser ganzen Entwicklung profitieren die Küstenstädte am meisten.<br />
Und einige Städte haben zum ersten Mal eigene territoriale Ambitionen. So<br />
kolonialisiert die Stadt Genua die Insel Sardinien, später Korsika und Elba, die bisher von<br />
Muslimen bewohnt waren. Aber auch das Binnenland – beson<strong>der</strong>s die Lombardei – zieht<br />
Vorteile aus dieser Entwicklung. Hier finden wir schon eine dichte Besiedlung, ist das<br />
Gebiet doch Transferland für Orientwaren (u.a. Gewürze, Färbestoffe).<br />
Mailand ist um das Jahr 1000 größer als Paris!<br />
Bischof San Ambrogio stiftet eine Kirche, die seinen<br />
Namen erhalten und später auch seine Grablege<br />
werden wird. Mailand, Genua und Pisa werden von<br />
Erzbischöfen regiert<br />
Die Kirche San Ambrogio in Mailand<br />
2.1.2 Die Mitte Italiens unter den Tusculaner Päpsten<br />
Italiens Mitte steht im Schatten <strong>der</strong> Entwicklung im Norden, selbst Rom ist z.B. mit<br />
Mailand nicht mehr zu vergleichen. Der Charakter des Papsttums – des Bischofs von Rom<br />
– verän<strong>der</strong>t sich im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t. Mit dem Verfall <strong>der</strong> politischen Ordnung in Italien im<br />
10. Jahrhun<strong>der</strong>t zeichnete sich das Papsttum, das in die Hände des ansässigen Adels<br />
geriet, immer mehr durch moralische Korruption, Weltlichkeit und Nepotismus aus. Eine<br />
Papstwahl heutiger Prägung gab es bis zur Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts noch nicht. Ein<br />
Papst wurde „erhoben“ und diese Erhebung war eine Machtfrage zwischen den adligen<br />
<strong>Familie</strong>n. Von 25 Päpsten zwischen 955 und 1057 waren nur 12 vom Kaiser ernannt, 13<br />
entstammten dem Adel aus dem Umland von Rom. Dabei war die <strong>Familie</strong> <strong>der</strong><br />
„Crescentier“ seit dem 10 Jahrhun<strong>der</strong>t bestimmend. Dazu diese Information aus dem<br />
Internet:<br />
Crescentier<br />
Römische Adelsfamilie, die in <strong>der</strong> 2. Hälfte des 10. Jh. die politische Herrschaft in Rom<br />
und in Teilen seines Umlandes (Sabina, Terracina, Palestrina) erlangte und in<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzungen mit den ottonischen Kaisern bis zum innerrömischen Umsturz des<br />
Jahres 1012 (TUSCULANER) mit unterschiedlichem Erfolg (in <strong>der</strong> Sabina auch noch<br />
länger) sich zu behaupten verstand. Der wissenschaftliche Hilfsname "CRESCENTIER"<br />
(kein zeitgenössischer <strong>Familie</strong>nname) leitet sich her von Crescentius, einem (neben<br />
Johannes und Bendedictus) in <strong>der</strong> <strong>Familie</strong> (aber nicht nur in dieser) verbreiteten<br />
Vornamen. Die Ursprünge <strong>der</strong> CRESCENTIER (ein Creszentius ist erstmals 901 in Rom<br />
bezeugt) sind ungeklärt.<br />
Nach dem Tod Otto’s III. erhalten diese „Tusculaner“ die Macht<br />
in und um Rom, in den nächsten 30 Jahren wird es 3 Tusculaner<br />
Päpste geben. U.a. Benedikt VIII. (seit 1013) und seinen Bru<strong>der</strong><br />
Johannes XIX. (seit 1024 / Bild links) und Benedikt IX. (seit<br />
1033). Die Römer vertrieben ihn im September 1044 wegen<br />
seines lasterhaften Lebenswandels und das ist <strong>der</strong> Beginn <strong>der</strong>
10<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Zeit des „Reformpapsttums“. Der Adelscharakter des Papsttums endet um die Mitte des<br />
11. Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
2.1.3 Das normannische Reich in Sizilien<br />
Die Entwicklung in Süditalien unterscheidet sich – bis heute – von <strong>der</strong> im Norden und<br />
in <strong>der</strong> Mitte Italiens. Der Süden ist viel weniger städtisch geprägt und auch weniger<br />
präsent in ökonomischen Belangen. Dafür aber stark in den Mittelmeerraum integriert.<br />
Und die Herrschaftssituation ist dreigeteilt. Es gibt<br />
• ein Gebiet unter langobardischer Herrschaft (Benevent)<br />
• ein Gebiet unter byzantinischer Herrschaft und<br />
• Sizilien, das unter muslimischer Herrschaft steht.<br />
In diesem germanisch-römisch-griechischen Völkergemisch tauchen jetzt die ersten<br />
Normannen auf. Seit Beginn des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts kamen diese Normannen (Pilger auf<br />
<strong>der</strong> Rückreise von Jerusalem) als Söldner in fremden Diensten nach Süditalien. Der Fürst<br />
von Salerno erbittet ihre Hilfe, sie bewähren sich und es werden weitere Normannen<br />
„angefor<strong>der</strong>t“, um gegen die Byzantiner zu kämpfen.<br />
Einzelne Normannengruppen dehnten mit dem beginnenden 11. Jahrhun<strong>der</strong>t ihre<br />
Streifzüge bis in den Mittelmeer-Raum aus und setzten sich um Aversa und Capua fest.<br />
Schließlich gelangten sie in beinahe ganz Süditalien und Sizilien, das sie von den<br />
Sarazenen eroberten, an die Herrschaft. Bald schon wird sich die <strong>Familie</strong> Hauteville<br />
als mächtigste unter den Normannen hervortun und hier beson<strong>der</strong>s Wilhelm Eisenarm<br />
(† 1045), einer <strong>der</strong> Söhne Tankreds von Hauteville und Robert Guiscard († 1085). Dieser<br />
folgte zwischen 1046 und 1047 seinen Brü<strong>der</strong>n nach S-Italien. Es gelang ihm in Kürze,<br />
Kalabrien zu unterwerfen (Beiname "<strong>der</strong> Verschlagene").<br />
Kaiser Heinrich III. erkennt im Jahre 1047 die normannische Herrschaft an. In<br />
Süditalien belehnt er die Normannen mit Aversa und Apulien und bindet sie so ans Reich.<br />
Robert Guiscard wird 1059 vom Papst zum Herzog von Apulien, Kalabrien und Sizilien<br />
ernannt.<br />
Die <strong>Familie</strong> Hauteville hat sich in späteren Jahren auch bei den Kreuzzügen engagiert.<br />
Die Normannen bleiben bis ins 13. Jahrhun<strong>der</strong>t in Süditalien und errichten dort ein<br />
mo<strong>der</strong>nes Staatswesen, bis die Herrschaft auf die Staufer übergeht.<br />
2.1.4 Italien und Spanien<br />
Im 10./11. Jahrhun<strong>der</strong>t erlebte das Kalifat von Córdoba an <strong>der</strong> Spitze eines<br />
muslimischen Spaniens eine beispiellose politische, wirtschaftliche und kulturelle<br />
Blütezeit. Córdoba mit einer<br />
Einwohnerzahl von über 100.000<br />
Menschen hatte sich neben<br />
Konstantinopel zur prächtigsten<br />
Stadt Europas entwickelt, und die<br />
maurische Kultur, die auch<br />
mediterrane Züge aufwies, war dem<br />
Rest von Europa weit überlegen.<br />
Kunst, Literatur, Philosophie und<br />
Wissenschaft hatten einen äußerst<br />
hohen Stellenwert.<br />
Für das hohe Niveau <strong>der</strong> Kunst<br />
sind die maurischen Bauten in<br />
Córdoba o<strong>der</strong> die Alhambra in<br />
Granada nur einige wenige Beispiele.<br />
Karte von Spanien im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t
11<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Zudem herrschte im Kalifat von Córdoba eine beispiellose Toleranz: Christen (die so<br />
genannten Mozaraber) wie auch Juden genossen volle Duldung und nahmen<br />
gleichberechtigt am kulturellen und wirtschaftlichen Leben teil und die Christen konnten<br />
sogar eigene Bischöfe ernennen.<br />
Im Norden Spaniens führen einige kleinere christliche Königreiche ein Eigenleben. Die<br />
weitere Entwicklung wird sich von Süden nach Norden ergeben, sie steht und fällt mit <strong>der</strong><br />
Fähigkeit <strong>der</strong> Herrscher, alle Kräfte um sich zu bündeln. Die Wirtschaft war schon hoch<br />
entwickelt und mit <strong>der</strong> im übrigen Europa nicht zu vergleichen. Man kannte schon<br />
Spiegelglas, beherrschte die Herstellung von Papier und betrieb Seidenraupenzucht. Nur<br />
die arabische Sprache konnte sich nicht gegen die spanische durchsetzen, nur daneben<br />
behaupten. Das Wort „Al - Andalus“ hat das Wort „Vandalen“ als Stamm! (Im 5. Jh.<br />
nannten die Berber Spanien tamurt wandalus, was soviel wie „Land <strong>der</strong> Vandalen"<br />
bedeutet, vermutlich leitet sich <strong>der</strong> Name davon ab)<br />
Die Bevölkerung stellt eine Gesellschaft mit extremen Gegensätzen dar. Neben vielen<br />
Berberfamilien gibt es Clanverbände. Die arabischen <strong>Familie</strong>n besitzen in <strong>der</strong> Regel die<br />
besseren Gebiete, als die Berber. Aus vorwiegend Osteuropa gibt es Sklaven.<br />
Vom 8. bis zum 11. Jahrhun<strong>der</strong>t (756-1031) errichten die Omajjaden ihr Reich in<br />
Spanien, das 929 in ein Kalifat umgewandelt wurde und <strong>der</strong> Höhepunkt <strong>der</strong> arabischen<br />
Macht und Kultur in Spanien war. Nachfolger des ersten Kalifen wurde dessen Sohn Al-<br />
Hakam II (961-976). Es war eine Periode <strong>der</strong> Ruhe, abgesehen von einigen<br />
Normanneneinfällen und zwei kleineren Zügen gegen die Christen.<br />
Al-Hakams Nachfolger wurde sein Sohn Hisam II. (976-1009). Allerdings musste <strong>der</strong><br />
die eigentliche Macht im Staate einem an<strong>der</strong>en überlassen: al-Mansur (<strong>der</strong> Siegreiche /<br />
976-1002), <strong>der</strong> bereits unter Abd- al Rahman Militärbefehlshaber im Krieg gegen die<br />
Fatimiden war, nahm nun, gestützt auf seinen Machtbereich und das Heer, den<br />
Königstitel an. Er stellte erstmals ein immer einsatzbereites „stehendes Heer“ auf.<br />
Etwa fünfzig Feldzüge führte al-Mansur auf <strong>der</strong> Halbinsel gegen die christlichen Reiche<br />
im Norden. Fast alle verliefen erfolgreich, und sein Hofdichter erträumte sich schon eine<br />
Vereinigung ganz Spaniens unter maurischer Führung. Aber diese konnten aus den<br />
militärischen Erfolgen kein Kapital schlagen, da es ihnen an Menschen fehlte, die<br />
zurückeroberten Gebiete zu besiedeln und dadurch längerfristig zu sichern.<br />
2.1.5 Der Zerfall des Kalifenreiches<br />
Die Zeit zwischen dem Tode al-Mansur 1002 und dem Ende des Kalifats von Córdoba<br />
im Jahre 1031 war die Zeit <strong>der</strong> Bürgerkriege in al-Andalus: Araber, Berber und Slawen<br />
schlugen sich um die<br />
Vorherrschaft im Lande,<br />
häufig mit Unterstützung<br />
ihrer opportunistischen<br />
christlichen Nachbarn im<br />
Norden <strong>der</strong> Halbinsel.<br />
Nachdem <strong>der</strong> letzte Kalif,<br />
Hisam III., 1031 zum<br />
Rücktritt gezwungen<br />
werden war, blieb al-<br />
Andalus in große<br />
Latifundien aufgeteilt, die<br />
sich bald zu eigenständigen<br />
Kleinreichen, den sog.<br />
Taifas, entwickelten.<br />
Der Karte rechts kann man<br />
die Lage <strong>der</strong> wichtigsten<br />
Taifas entnehmen.
2.1.6 Christliche Reiche in Spanien<br />
12<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Zunächst herrscht ein Zustand friedlicher Koexistenz zwischen Christen und Muslimen.<br />
Die Lage än<strong>der</strong>te sich erst, als es Alfons VI. (1072-1109), König von Galizien, Kastilien,<br />
León und Portugal, gelang, die Grenzen seiner Reiche nach Süden zu verlagern, Toledo<br />
zu erobern und militärischen und ökonomischen Druck auf die Taifas auszuüben. Deren<br />
Herrscher, allen voran al-Mutamid von Sevilla, entschieden sich für das kleinere Übel und<br />
riefen die Almoraviden aus Marokko zur Hilfe.<br />
In <strong>der</strong> Folgezeit (bis 1092) setzten die Almoraviden durch die Annexion <strong>der</strong> Taifa-<br />
Königreiche ihre Herrschaft in Andalusien durch. Nur Valencia unter El Cid und Saragossa<br />
unter den Hudiden konnten ihre Selbständigkeit zunächst behaupten. Die an<strong>der</strong>en<br />
Grenzlän<strong>der</strong> wurden nach und nach wie<strong>der</strong> besiedelt – man nennt diesen Vorgang<br />
„Repoblacion“ / Wie<strong>der</strong>besiedlung). Als Beispiele für größere Städte sollen Leon, Burgos<br />
und Salamanca gelten. Aufgrund <strong>der</strong> Kastelle, die hier zum Schutz <strong>der</strong> neu eroberten<br />
Gebiete und <strong>der</strong> neu angesiedelten Bauern errichtet wurden, wurde diese Region Castilla<br />
o<strong>der</strong> Kastilien genannt.<br />
Vorlesung vom 11.11.2005<br />
2.2 Frankreich und Deutschland<br />
Diese „Repoblacion“ erhält in <strong>der</strong> Mitte des 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts durch Zuwan<strong>der</strong>er aus Frankreich<br />
Auftrieb. Ein starker Pilgerstrom nach Santiago<br />
de Compostela (links) setzt ein, Frankreich wird<br />
im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t zum Durchzugsland für Pilger.<br />
Auf diese Pilgerbewegung und damit auf die<br />
gesamte Entwicklung in Nordspanien hat die große<br />
Klosterreformbewegung, die von Cluny ausgeht,<br />
ihre Auswirkungen. Klöster, die am Pilgerweg<br />
liegen, werden durch Cluny reformiert.<br />
Die Münzprägung nimmt zu, es kommt zu<br />
Tributzahlungen von Taifas – Herrschern an<br />
christliche Herrscher.<br />
Die Konsolidierung <strong>der</strong> christlichen Königreiche<br />
im Norden auf <strong>der</strong> einen und <strong>der</strong> Zerfall des<br />
Kalifats von Córdoba auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite<br />
leiteten nun die Phase <strong>der</strong> christlichen<br />
Reconquista (Karte Seite 4) des muslimischen<br />
Spanien ein.<br />
Die Kathedrale von Santiago de Compostela mit<br />
dem legendären Grab des Apostels Jakobus.<br />
(Bildquelle:de.wikipedia.org/Benutzer Janekpfeifer)<br />
2.2.1 Die Anfänge <strong>der</strong> Kapetinger<br />
2.2.2 Adelsherrschaft im Wandel<br />
2.2.3 Die Gottesdienstbewegung<br />
2.2.4 Das <strong>Th</strong>ronfolgeproblem zwischen Ottonen und Saliern<br />
2.2.5 Konrad II., <strong>der</strong> erste Salier<br />
2.2.6 Die Salier auf dem Gipfel ihrer Macht / Heinrich III.
2.2.1 Die Anfänge <strong>der</strong> Kapetinger<br />
13<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Im Westfrankenreich waren noch bis 987 Karolinger an <strong>der</strong> Macht, dann wurden sie<br />
von den Kapetingern verdrängt. Im Jahre 987 war Hugo Kapet († 996) Herzog von Paris<br />
(dort lag auch seine Krondomäne). Als sein Vorgänger Ludwig V. ohne Nachkommen<br />
starb, wurde Hugo Kapet durch eine Versammlung <strong>der</strong> Bischöfe und <strong>der</strong> wichtigsten<br />
französischen Bündnisfürsten (zu denen er gehörte) zum neuen König von Frankreich<br />
gewählt. Er ließ sich wie die meisten seiner Nachfolger in Reims krönen.<br />
Hugo hatte nur einen relativ kleinen Landbesitz mit seiner Krondomäne und so verbot<br />
es sich hier, dieses Gebiet bei Erbschaften noch weiter aufzuteilen. Also musste man<br />
„arrondieren“, d.h. an<strong>der</strong>e Gebiete mit dem eigenen zusammenlegen.<br />
Sein Sohn Robert II. (<strong>der</strong> Fromme / † 1031) folgte ihm auf dem <strong>Th</strong>ron. Er wird in<br />
seiner Regierungszeit nur einmal seine Krondomäne für eine Reise in Frankreichs Süden<br />
verlassen. Und das wird auch die letzte Reise eines Königs für die nächsten 100 Jahre<br />
sein. Überliefert ist ein Bericht des Mönchs Rudolfus Glaber über ein Treffen Roberts mit<br />
Heinrich II., bei dem man sich erst beim einen, am nächsten Tag beim an<strong>der</strong>en trifft.<br />
Wichtig an dieser Überlieferung ist, dass es undenkbar war, dass nur einer in das Lager<br />
des an<strong>der</strong>en kam. Damit hätte er diesen als höherwertig anerkannt.<br />
2.2.2 Adelsherrschaft im Wandel<br />
Der König hat in Frankreich wenig Macht, diese liegt bei den Großen, den Herzögen.<br />
Aber wer sind diese Großen? Zuerst sind die Herzöge von Aquitanien zu nennen, dann die<br />
von Anjou, Flan<strong>der</strong>n und <strong>der</strong> Normandie. Dazu aber auch einige Bischöfe, wenngleich<br />
diese weniger Macht haben, als ihre Amtsbrü<strong>der</strong> in Deutschland.<br />
Herzog Wilhelm von Aquitanien z.B. lebt wie ein König, hat Kontakte nach Spanien und<br />
England. Ja, sogar die italienische Krone wird ihm angeboten – er schlägt dieses Angebot<br />
aber aus. Wird vielmehr später als Pilger nach Rom und Santiago de Compostela ziehen,<br />
obwohl seine Verbindung zum französischen Königshaus nie ganz abreißt. 1059 wird er<br />
auch als einer <strong>der</strong> Herzöge zur Königskrönung Philipp I. nach Reims fahren.<br />
Die Normandie war im Mittelalter die Heimat <strong>der</strong> Normannen, des Volksstammes, <strong>der</strong><br />
England zum letzten Mal erfolgreich eroberte. Die Normannen entstanden aus den frühen<br />
französischen Einwohnern und den Wikingern unter ihrem Führer Herzog Rollo <strong>der</strong><br />
Normandie (Gånge Rolf), <strong>der</strong> das Gebiet <strong>der</strong> Seine um Paris verwüstete und daraufhin die<br />
Normandie im Vertrag von Saint-Clair-sur-Epte vom westfränkischen König Karl dem<br />
Einfältigen als Lehen zugesprochen bekam (911). Dafür sollte er die Normandie gegen<br />
weitere Überfälle <strong>der</strong> Wikinger verteidigen.<br />
Rollos Nachkomme Wilhelm <strong>der</strong> Eroberer, Herzog <strong>der</strong> Normandie, drang 1066 in<br />
England ein und wurde dort König. Lt. <strong>Behrmann</strong> sollten die Krieger Wilhelms „mal<br />
Dampf ablassen können“, deshalb unternahm er die Reise nach und die Eroberung von<br />
England. Wenn’s denn stimmt.<br />
Wichtigstes Merkmal in <strong>der</strong> <strong>Th</strong>ronfolge ist jetzt die „Individualsukzession“, also nur <strong>der</strong><br />
älteste Sohn erbt den <strong>Th</strong>ron. Das ist beim Königshaus so, aber auch bei den Herzögen.<br />
Und daraus baut sich ein enormes Konfliktpotential auf. Was die Adelsfamilien veranlasst,<br />
zu ihrem Schutz feste Burgen zu bauen und sich auf diese Standorte zu konzentrieren.<br />
Die 2. und weiteren Söhne orientieren sich – wie auch immer – nach außen.<br />
Diese erwähnten Burgen sind noch nicht aus Stein gebaut, sind eher „Wehrdörfer“, in<br />
denen die Herrscherfamilie mit den zu ihrem Hof gehörenden Menschen zusammen<br />
leben. Daraus entwickelt sich die Notwendigkeit, dass treue Gefolgsleute gebraucht<br />
werden. Die dann aber auch ihre For<strong>der</strong>ungen stellen. Es entstehen hierarchische<br />
Strukturen, aus denen sich die Miles und die Chevalliere (Reiter, in Deutschland die<br />
Ritter) entwickeln.
2.2.3 Die Gottesdienstbewegung<br />
14<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Wir hatten gehört, dass <strong>der</strong> König nur Machtbefugnisse hatte, die auf seine<br />
Krondomäne begrenzt waren und gleichzeitig die Adelsherrschaft sehr zu Konflikten<br />
neigte. Diese Situation mündet um das Jahr 1000 – vom Süden Frankreichs ausgehend -<br />
in die „Gottesdienstbewegung“. Der Bischof von Pluis (?) erlässt anlässlich eines Konzils<br />
im Jahr 994 bestimmte Regeln für ein gottgefälliges Verhalten <strong>der</strong> Menschen. Danach<br />
dürfen<br />
• Kirchen nicht mehr geplün<strong>der</strong>t und<br />
• Bauern nicht mehr beraubt werden.<br />
• Unbewaffnete Priester sind genauso tabu wie<br />
• Frauen, Pilger, Ritter, Mühlen und Rebstöcke.<br />
• Bestimmte Tage und Fristen sind von Gewalttaten ausgenommen<br />
Dazu WIKIPÄDIA:<br />
Der Gottesfrieden (lateinisch Pax Dei) in Verbindung mit <strong>der</strong> Waffenruhe Gottes<br />
(Treuga Dei) ist das Ergebnis <strong>der</strong> Zusammenarbeit von weltlicher und geistlicher Macht<br />
und stellt die Anfänge einer europäischen Friedensbewegung dar. Die Kirche fühlte sich<br />
im Mittelalter zunehmend durch die Privatkriege des Adels und seine Übergriffe auf das<br />
Kirchengut bedroht und versuchte, durch Anteilnahme an <strong>der</strong> Friedenswahrung Einfluss<br />
auf das politische Leben <strong>der</strong> damaligen Zeit zu gewinnen, auch im Interesse des<br />
weltlichen Wohls <strong>der</strong> Gläubigen.<br />
Die Kirche strebte allerdings damit keine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> bestehenden<br />
Herrschaftsverhältnisse an. Der Gottesfrieden bestand aus Beschlüssen, die beschworen<br />
wurden und unter Androhung <strong>der</strong> Kirchenstrafe (Exkommunikation) verhin<strong>der</strong>n sollten,<br />
dass Übergriffe auf Personengruppen (Geistliche, Bauern, Händler) bzw. Gebäude<br />
(Kirchen, Klöster, öffentliche Plätze und Straßen) stattfanden.<br />
Die Wiege des Gottesfriedens war die Auvergne in Frankreich im 10. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
Die alten (vor allem weltlichen) Institutionen konnten im 10. und vor allem 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t die Aufrechterhaltung <strong>der</strong> öffentlichen Ordnung nicht mehr garantieren,<br />
deshalb war die Bildung von neuen Exekutivorganen für die Kirche notwendig, die diese<br />
Aufgabe übernahmen, die so genannten Pax-Milizen.<br />
Bekämpft werden sollte <strong>der</strong> mittlere und nie<strong>der</strong>e Adel, während die Kirche mit dem<br />
Hochadel Solidarität übte, da sie bei ihren Friedensbemühungen auf sein Einvernehmen<br />
angewiesen war. Der geistliche Friede ist dadurch wie<strong>der</strong>um zu einem Machtinstrument<br />
in <strong>der</strong> Hand des gesamten Hochadels geworden, <strong>der</strong> dadurch seine Territorien sicher<br />
beherrschen konnte.<br />
Diese Bewegung dehnt sich seit den 1020-er Jahren weiter aus nach Spanien, Italien<br />
und auch nach Deutschland. Ist damit erstmals grenzüberschreitend – das ist neu. Sie<br />
endet 1038, als Bischof Heimo von Bourges (?) den „Friedenseid“ als kollektiven Eid<br />
einführt und damit die Einzelverfügungen hinfällig werden.<br />
2.2.4 Das <strong>Th</strong>ronfolgeproblem zwischen Ottonen und Saliern<br />
Deutschland ist im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t geprägt vom germanischen Lehnswesen.<br />
Gegenüber dem fortschrittlicheren Frankreich ist es als provinziell zu bezeichnen. Die<br />
Herrschaftsordnung ist wohl ähnlich <strong>der</strong> in Frankreich; d.h. die Könige haben nur in ihren<br />
Krondomänen unumschränkte Machtbefugnisse. Das ist die Situation im Norden und<br />
Osten des Reiches. Im Süden liegt die Macht in den Händen regieren<strong>der</strong> Herzöge o<strong>der</strong><br />
von Bischöfen und Äbten.
15<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Es gibt aber auch einige spezifische Unterschiede zwischen Deutschland und<br />
Frankreich, z.B. die Königswahl. Ist doch die Frage <strong>der</strong> <strong>Th</strong>ronfolge das gesamte<br />
Mittelalter hindurch in Deutschland ein Problem. (<strong>Behrmann</strong>: “Das wäre den Kapetingern<br />
nie passiert“).<br />
Nach dem Tod Otto III. am 24. Januar 1002 gab es unter den deutschen Herzögen<br />
mehrere, die seine Nachfolge antreten wollten. Noch im gleichen Jahr, am 6. Mai 1002,<br />
wurde <strong>der</strong> in Bad Abbach bei Regensburg geborene Heinrich II. (973-1024) von den<br />
an<strong>der</strong>en Fürsten zum neuen König gewählt. Er war ein Vetter Otto III. und somit blieb die<br />
<strong>Th</strong>ronfolge erstmal in <strong>der</strong> Ottonischen Linie.<br />
Heinrich war <strong>der</strong> Sohn von Heinrich dem Zänkerer, dem sein Herzogtum Bayern<br />
wegen andauern<strong>der</strong> Querelen von König Otto weggenommen worden war. Heinrich kam<br />
in die Klosterschule von Hildesheim und sollte - wohl um ihn aus <strong>der</strong> Erbfolge<br />
auszuschalten - auf den geistigen Stand vorbereitet werden.<br />
Als er nach dem Tod seines Vaters 995 dennoch das Herzogtum Bayern übernahm,<br />
sorgte er sich engagiert um eine Erneuerung <strong>der</strong> Kirche und <strong>der</strong> Klöster. Er gründete das<br />
Bistum Bamberg, den Dom in Bamberg ließ er ab 1002 erbauen.<br />
Nach seinem Tod am 13. Juli 1024 wurde schon Anfang September 1024 mit Konrad II.<br />
(um 990-4.6.1039) <strong>der</strong> erste Salier zum deutschen König gewählt. Wie es zu seiner Wahl<br />
kam, ist etwas unklar. Konrad war <strong>der</strong> Sohn von Heinrich von Speyer und <strong>der</strong> Gräfin<br />
Adelheid von Metz bzw. Egisheim.<br />
Bis zu seiner Wahl als König war Konrad wenig einflussreich, obgleich er <strong>der</strong> Enkel des<br />
im Jahre 1004 verstorbenen Herzogs Otto von Kärnten war. Trotzdem besaß er nur einen<br />
geringen Teil <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>eien <strong>der</strong> <strong>Familie</strong> und hatte nicht einmal den Titel eines Herzogs,<br />
ob zumindest Graf, ist zweifelhaft. Dies lag unter an<strong>der</strong>em daran, dass sein Vater<br />
Heinrich vor seinem Großvater Otto von Kärnten in den 990er Jahren gestorben war und<br />
er deshalb nach fränkischem Recht keinen Anspruch auf das Erbe Ottos hatte. So gab es<br />
mit noch seinem jüngeren Vetter Konrad noch einen Anwärter auf den <strong>Th</strong>ron. Dieser<br />
jüngere Konrad hat dann aber zu Gunsten des Älteren verzichtet.<br />
Auf einem Landtag in Konstanz brachten die Abgesandten aus Pavia dem König wertvolle<br />
Geschenke und versuchten sich damit zu rechtfertigen, dass nach dem Tod Kaiser<br />
Heinrichs, dem sie immer die Treue gehalten hätten, doch die Königsgewalt erloschen<br />
gewesen wäre. Konrad ließ diese Ausflüchte nicht zu und antwortete ihnen mit <strong>der</strong><br />
berühmt gewordenen Schiffsmetapher:<br />
Ich weiß, dass ihr nicht eures Königs Haus zerstört habt, denn damals hattet ihr ja<br />
keinen. Aber ihr könnt nicht leugnen, dass ihr einen Königspalast zerstört habt. Ist<br />
<strong>der</strong> König tot, so bleibt doch das Reich bestehen, ebenso wie ein Schiff bleibt, dessen<br />
Steuermann gefallen ist. (Lit.: Wipo, c. 7)<br />
2.2.5 Konrad II., <strong>der</strong> erste Salier<br />
Bereits wenige Tage nach seiner Krönung am 11. September brach Konrad zu einem<br />
Königsumritt auf, <strong>der</strong> von September 1024 bis Juni 1025 dauern sollte. Nach <strong>der</strong><br />
Krönung von Gisela in Köln am 21. September reiste Konrad bereits am nächsten Tag<br />
weiter nach Aachen. Es kam auf einem Hoftag zur Huldigung <strong>der</strong> lothringischen Adeligen.<br />
Zuvor hatte Konrad auf dem <strong>Th</strong>ron Karl des Großen Platz genommen und sich damit<br />
bewusst in die karolingische Tradition gestellt.
Konrad II. (Mitte) mit Leopold IV. von Bayern (links)<br />
und Hadmar I. von Kuenring, Fe<strong>der</strong>zeichnung 14. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
16<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Über Lüttich und Nimwegen reist er weiter<br />
nach Sachsen. Über Vreden dann weiter nach<br />
Dortmund, wo er Anfang Dezember eintraf<br />
und in <strong>der</strong> dortigen Pfalz einen gut besuchten<br />
Hoftag abhielt, Weihnachten wurde in Minden<br />
gefeiert. Die weiteren Stationen des Umrittes<br />
waren Pa<strong>der</strong>born (um Neujahr), Hildesheim<br />
(Anfang Januar 1025), Goslar, wo ein<br />
Königsgericht tagte, Gan<strong>der</strong>sheim, erneut<br />
Goslar, Halberstadt und Quedlinburg. Ende<br />
Januar 1025 erreichte Konrad die Elbe und<br />
nahm am 2. Februar in Magdeburg weitere<br />
Huldigungen entgegen. Am 8. Februar weilte<br />
<strong>der</strong> Hof in Merseburg und am 2. März ist ein<br />
Aufenthalt in <strong>der</strong> Pfalz Wallhausen<br />
nachweisbar. Nach einer Zwischenstation in<br />
Grone, wo versucht wurde, einen Streit um<br />
das Damenstift Gan<strong>der</strong>sheim zu schlichten,<br />
war das nächste Ziel Ostfranken.<br />
Weiter in das Kloster Fulda, anschließend ist ein Aufenthalt in Augsburg nachweisbar,<br />
wo ihm die schwäbischen Fürsten und Geistlichen ebenfalls huldigten. In Richtung Osten<br />
reiste Konrad weiter nach Bayern und nahm in Regensburg die Huldigungen <strong>der</strong><br />
bayrischen Adligen entgegen. Der Aufenthalt in Bayern hat wohl nur wenige Tage<br />
gedauert. Über das königliche Gut Beratzhausen und Bamberg ging es weiter an den<br />
Bodensee, wo in <strong>der</strong> Pfalz in Konstanz am 6. Juni 1025 Pfingsten gefeiert wurde.<br />
Zu dieser Zeit ist die Intensität <strong>der</strong> Verbindung des Königs zur Kirche beson<strong>der</strong>s groß.<br />
Die Herzöge entzogen sich seinem Einfluss und<br />
deshalb suchte er die Nähe <strong>der</strong> Bischöfe. Er ist es,<br />
<strong>der</strong> ihm genehme Personen in Amt und Würden<br />
bringt, gibt es doch verständlicherweise bei<br />
Bischöfen keine Erbfolge. Man spricht vom<br />
„Ottonisch-salischen Reichskirchensystem“. Und<br />
diese intensive Nähe zwischen König und Kirche<br />
macht den späteren Investiturstreit dann auch so<br />
heftig.<br />
Außerdem bilden sich im Dunstkreis des Königs<br />
mehr und mehr sog. „Ministeriale“ aus; das sind<br />
Unfreie, die abgabenpflichtig sind, sich aber durch<br />
beson<strong>der</strong>e Tüchtigkeit und spezielle Kenntnisse zu<br />
diesem Amt hoch gearbeitet haben (Reichs-<br />
Ministeriale).<br />
Die Abbildung, eine Buchmalerei aus dem im Jahr<br />
1046 dem Speyrer Dom gestifteten Codex aureus<br />
Spirensis (Escorial, Madrid), zeigt Heinrich III.<br />
und seine Gemahlin Agnes kniend vor <strong>der</strong> Jungfrau<br />
Maria.
2.2.6 Die Salier auf dem Gipfel ihrer Macht / Heinrich III.<br />
17<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Heinrich III. (1017-1056), Sohn und Nachfolger Konrads II. aus dem Hause <strong>der</strong> Salier.<br />
Bereits 1026 war Heinrich auf Veranlassung seines Vaters zum König gewählt und 1028<br />
gekrönt worden; 1039 folgte er seinem Vater als König nach. Das salische Königshaus<br />
besaß eine Herrschaftsfülle, wie nie vorher und nie wie<strong>der</strong> danach. Schon bei <strong>der</strong> Wahl<br />
Heinrichs gab es keine Wi<strong>der</strong>stände im Reich. Die Gebiete Burgund, Bayern, Schwaben<br />
und Kärnten kommen – sozusagen als Mitgift – zum Reich dazu. Böhmen und Ungarn<br />
kommen - wenigstens für kurze Zeit - ebenfalls als Lehen zum Reich.<br />
Sein Selbstverständnis als Vicarios Christi, also als Stellvertreter Christi, veranlasste<br />
ihn, auf seinem Romzug 1046 (Kaiserkrönung) persönlich in die Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
um den Heiligen Stuhl einzugreifen. Auf Synoden in Sutri und Rom im Dezember 1046<br />
setzte er die drei rivalisierenden Päpste Silvester III., Gregor VI. und Benedikt IX. ab,<br />
ließ den Reformbischof Suitger von Bamberg als Klemens II. zum Papst erheben und<br />
konfrontierte damit auch das Papsttum mit <strong>der</strong> Reformbewegung.<br />
Vorlesung vom 18.11.2005<br />
2.3 England<br />
Die Situation<br />
Die Verhältnisse in England unterscheiden sich grundlegend von denen in Deutschland.<br />
Die Wikingereinfälle waren jetzt massiver, als noch um das Jahr 1000 und es kommt zu<br />
einem Umsturz <strong>der</strong> angelsächsischen Königsdynastie. Das Christentum hat sich zwar<br />
durchgesetzt, wurde aber nicht praktiziert; es herrschten im Gegenteil archaische<br />
Lebensumstände. Es kam zu regionalen blutigen <strong>Familie</strong>nfehden, „gegen die die<br />
<strong>Th</strong>ronstreitigkeiten auf dem Kontinent harmlos waren“ (<strong>Behrmann</strong>).<br />
Die Tragödie Macbeth z.B.- von William Shakespeare geschrieben - ist eine<br />
lebensnahe Vorlage für den Dichter. Sie beschreibt den Aufstieg des königlichen<br />
Heerführers Macbeth zum König, seine Verän<strong>der</strong>ung zum Tyrannen und seinen Fall.<br />
Nachdem Macduff Macbeth getötet und den Kopf des Usurpators präsentiert hat, besteigt<br />
Malcolm endlich den <strong>Th</strong>ron Schottlands. Das Stück handelt von <strong>der</strong> Entdeckung o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Anatomie des Bösen. Shakespeare verwob in diesem Drama geschichtliche Fakten (über<br />
den historischen König Macbeth und den zeitgenössischen James I.) geschickt mit<br />
Aberglaube, Mythologie und Fiktion.<br />
In Wales und Schottland gab es keine zentralen Herrschaftssysteme. Es gab kaum<br />
Städte und keine richtige Geldwirtschaft. Irland erlebte ebenfalls Wickingereinfälle und<br />
Landnahmen an <strong>der</strong> West- wie an <strong>der</strong> Ostküste. Fast alle Städtegründungen gehen auf<br />
die Wikinger zurück. Es kam zu einer Verschmelzung von Wikingern und Kelten.<br />
Brian Boru, auch Brian Boruma, eigentlich Brian Mac Cennétig († 1014), war irischer<br />
Hochkönig und Sohn des Königs des Clans <strong>der</strong> Dál gCais (Delcassians). Am Karfreitag des<br />
Jahres 1014 kommt es zu <strong>der</strong> blutigen Schlacht von Clontarf, die als die Vertreibung <strong>der</strong><br />
Wikinger in die Legenden einging. In <strong>der</strong> Schlacht fielen Brian Boru und sein Sohn<br />
Murrogh. Brians Truppen gewinnen aber und stricken an den Legenden, die in den<br />
Annalen von Innisfallen zu Papier gebracht werden. Die Folge für Irland war das alles so<br />
blieb wie es vor Brians Auftreten war, auch die Wikinger blieben, nur die zahlreichen<br />
Nachkommen die Brian Boru mit seinen vier Frauen und 30 Konkubinen hatte, nannten<br />
sich fortan die O´Brians.<br />
(Mac steht für Sohn, O’ steht für Enkel)
Die Glie<strong>der</strong>ung:<br />
2.3.1 Das angelsächsische Reich um die Jahrtausendwende<br />
2.3.2 Knut <strong>der</strong> Große<br />
2.3.3 Der Ausklang <strong>der</strong> angelsächsischen Herrschaft in<br />
England<br />
2.3.4 Die Kirche in <strong>der</strong> Welt des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
2.3.5 Die klösterliche Reform<br />
2.3.6 Die kirchliche Reform<br />
2.3.7 Reform des Papsttums<br />
2.3.1 Das angelsächsische Reich um die Jahrtausendwende<br />
18<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Angelsachsen nennen sich die germanischen<br />
Stämme, die im 5. und 6. Jahrhun<strong>der</strong>t aus den<br />
Küstenlän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Nordsee zwischen den<br />
Nie<strong>der</strong>landen und Norwegen auf die Britischen<br />
Inseln einwan<strong>der</strong>ten, das britische Tiefland<br />
eroberten und die dort siedelnden Kelten<br />
verdrängten. In seiner Historia Ecclesiastica Gentis<br />
Anglorum (Kirchengeschichte des englischen<br />
Volkes) nennt <strong>der</strong> englische Geschichtsschreiber<br />
Beda die Sachsen, Angeln und Jüten als die drei<br />
wichtigsten Stämme.<br />
Laut Beda siedelten sich die aus Jütland<br />
stammenden Jüten in zwei relativ kleinen Regionen<br />
an: in Kent, im südlichen Teil von Hampshire und<br />
auf <strong>der</strong> Insel Wight. Die Angeln, von denen <strong>der</strong><br />
Name England abgeleitet ist, kamen aus dem<br />
Gebiet des heutigen Schleswig-Holsteins und von England um das Jahr 1000<br />
<strong>der</strong> dänischen Insel Fyn (Fünen) und eroberten von East Anglia und den östlichen<br />
Midlands bis nach Edinburgh im Norden einen Großteil des Ostens von Britannien. Die<br />
Sachsen aus dem Gebiet zwischen den Unterläufen von Weser und Elbe besiedelten<br />
Südengland.<br />
Im 9. Jahrhun<strong>der</strong>t unterwarfen dänische Wikinger die Königreiche Northumbria, East<br />
Anglia und Mercia. Nur das Königreich Wessex wurde verschont und unter Alfred dem<br />
Grossen und seinen Nachfolgern konnte <strong>der</strong> dänisch besetzte Teil von England wie<strong>der</strong><br />
zurückerobert werden. Mitte des 10. Jahrhun<strong>der</strong>ts hatte sich in England ein vereintes<br />
Königreich herausgebildet. Im frühen 11. Jahrhun<strong>der</strong>t kam England für eine kurze Zeit<br />
unter die Herrschaft des dänischen Königs Knut II. und seiner unmittelbaren Nachfolger,<br />
aber mit Eduard dem Bekenner gelangte 1042 wie<strong>der</strong> ein angelsächsischer Herrscher<br />
auf den englischen <strong>Th</strong>ron.<br />
Im besprochenen 11. Jahrhun<strong>der</strong>t normalisiert sich das Verhältnis zwischen den<br />
Wikingern einerseits und den Angelsachsen und Kelten an<strong>der</strong>erseits. Obwohl diese<br />
Volksgruppen in dem Danelaw genannten Gebiet zusammenlebten, hatten die Wikinger<br />
immer noch die Oberhand. Als Danelag (engl. Danelaw) bezeichnet man ein Gebiet in<br />
England, das ab 793 von Dänen erobert und spätestens 884 auch von den nicht<br />
unterworfenen angelsächsischen Reichen anerkannt wurde. In diesem Gebiet galt<br />
dänisches Gesetz und es wurden dänische Gebräuche gepflegt, die die Wikinger<br />
eingeführt hatten. Die Wikinger for<strong>der</strong>ten Tributzahlungen ein, das so genannte Danegeld<br />
(„Gold <strong>der</strong> Dänen“) und verzichteten dafür auf Kampfhandlungen.<br />
Jetzt wird Alfred <strong>der</strong> Große († 899), angelsächsischer König von Wessex, eine <strong>der</strong><br />
herausragenden Figuren <strong>der</strong> englischen Geschichte, erwähnt. Nach dem Tod seines<br />
Bru<strong>der</strong>s Ethelred I. wurde Alfred König und schloss mit den Dänen, die immer wie<strong>der</strong> in<br />
England einfielen, Frieden. Fünf Jahre später nahmen die Dänen ihre Plün<strong>der</strong>ungszüge an<br />
<strong>der</strong> englischen Küste wie<strong>der</strong> auf und Anfang 878 waren sie bis ins Landesinnere
19<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
vorgedrungen. Daraufhin begann Alfred im Frühjahr 878 eine Armee aufzustellen und im<br />
Sommer 878 besiegte er die Dänen bei Edington und wenig später wurde er von den<br />
Dänen als König von Wessex anerkannt.<br />
Alfred ließ Befestigungsanlagen errichten und eine Flotte<br />
bauen, reorganisierte das Heer und konnte so die<br />
neuerlichen Überfälle <strong>der</strong> Dänen ab 893 abwehren. Als<br />
einzigem <strong>der</strong> angelsächsischen Herrscher war es Alfred<br />
gelungen, den dänischen Angriffen erfolgreich Wi<strong>der</strong>stand<br />
zu leisten; er hatte verhin<strong>der</strong>t, dass ganz England unter<br />
dänische Herrschaft kam.<br />
Jetzt bildeten sich erste Grundherrschaften heraus,<br />
Wehrdörfer wurden errichtet und es gab erste Ansätze von<br />
Stadtgründungen. Diese wurden an Plätzen etabliert, wo<br />
bisher schon Marktplätze waren. Und Märkte wie<strong>der</strong>um<br />
sind ein Zeichen dafür, dass es einen Überschuss an<br />
landwirtschaftlichen Produkten gegeben haben muss, die<br />
so weiter verkauft werden konnten.<br />
Als Stadtgründungen sind zu nennen London, York und<br />
Winchester. Etwa ab dem Jahr 1000 sind auch Fernhandel<br />
Alfred <strong>der</strong> Große (†899) und ein sich entwickelndes Münzwesen bezeugt.<br />
Denkmal in Wessex<br />
(Bildquelle: Eigene Bil<strong>der</strong>)<br />
Die Dänenkriege haben sich auf das englische Verfassungswesen nachhaltig<br />
ausgewirkt. Die englischen Könige waren, an<strong>der</strong>s als in Deutschland und in Frankreich, in<br />
ihrer Herrschaftsausübung weniger durch Ambitionen <strong>der</strong> Herzöge eingeschränkt. Sie<br />
konnten freier schalten und walten. Und auch die Administration war weiter<br />
fortgeschritten; schon seit dem 10 Jahrhun<strong>der</strong>t konnte <strong>der</strong> König seine Anweisungen an<br />
seine Amtsträger schriftlich erteilen. Das geschah mit den sog. „writs“ und diese waren<br />
so ein wichtiges Instrument seiner Herrschaftsausübung.<br />
Trotzdem bleibt die Person, besser die Persönlichkeit des Königs für seinen Erfolg und<br />
seine Anerkennung vorrangig.<br />
Wie eingangs erwähnt, kommt es um das Jahr 1000 erneut zu massiven<br />
Wikingereinfällen in England. Eine <strong>Th</strong>eorie schlägt als Ursachen für die Expansion in <strong>der</strong><br />
Wikingerzeit Überbevölkerung und Ressourcenknappheit im Heimatland vor. Das<br />
archäologische Material bezeugt, dass parallel zur Expansion ins Ausland in dünn<br />
besiedelten Waldgebieten neue Höfe entstanden. Somit ist Überbevölkerung sicherlich ein<br />
mitwirken<strong>der</strong> Faktor.<br />
Ethelred II. († 1016)<br />
Ethelred II. (von England), genannt <strong>der</strong> Unberatene, (um 968 bis 1016), angelsächsischer<br />
König von England (978-1016), Sohn König Edgars und Halbbru<strong>der</strong> Eduards des Märtyrers.<br />
Ethelred schloss einen Vertrag mit Richard II., dem Herzog <strong>der</strong> Normandie (er regierte von 996 bis<br />
1026) und nahm dessen Schwester Emma zur Gemahlin.<br />
Diese Heirat bildete die Grundlage für die später von den Normannen erhobenen Ansprüche auf<br />
den englischen <strong>Th</strong>ron. Obwohl Ethelred an die plün<strong>der</strong>nden Dänen Tributzahlungen leistete, fiel<br />
Sven Gabelbart, König von Dänemark, 1013 in England ein und rief sich selbst zum König aus.<br />
1014 floh Ethelred in die Normandie, kehrte jedoch einige Monate später, nach dem Tode Svens,<br />
wie<strong>der</strong> zurück.<br />
Svens Sohn und Nachfolger, Knut II., suchte ein Jahr später England erneut heim und wurde<br />
nach dem Tode Ethelreds König von England.<br />
Ethelreds Beiname „<strong>der</strong> Unberatene” ist eine Anspielung auf die ihm wi<strong>der</strong>fahrenen<br />
Missgeschicke.
2.3.2 Knut <strong>der</strong> Große ( † 1035 / Knut Svenson )<br />
20<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Knut <strong>der</strong> Große war König von Dänemark, als es seine größte Ausdehnung erreicht<br />
hatte. Es reichte von Norwegen bis Schleswig und zwischen 1013-1016 war er zugleich<br />
König von England. Den Grundstein für dieses Großreich hatte bereits sein Vater, Sven<br />
Gabelbart († 1014), und sein Großvater, Harald Blauzahn, gelegt. Bereits Knuts<br />
Großvater, Harald Blauzahn († 987) hatte von Norwegen und Dänemark aus in England<br />
missioniert.<br />
Wie bereits gesagt führte er zu Ende was sein Vater Svend angefangen hatte. Nach<br />
Ethelreds (she. Kasten Seite 19) Flucht konnte Knut seinen Nachfolger Edmund ebenfalls<br />
sehr schnell vom <strong>Th</strong>ron verdrängen. Mit Gewalt holt er sich die englische Krone und ist<br />
fortan neuer König. Da die Wikinger jetzt England fest in ihrer Hand halten, wird ihnen<br />
dadurch eine neue Rolle zuteil. Viele werden entwe<strong>der</strong> sesshaft o<strong>der</strong> kehren in ihre<br />
Heimat zurück. Da die Gegend jetzt zunehmend christianisiert wird, ist die Zeit <strong>der</strong><br />
großen Wikinger vorbei.<br />
Knut führte nach dem Tod seines Vaters die von diesem begonnene Unterwerfung<br />
Englands mit „barbarischer Grausamkeit“ (<strong>Behrmann</strong>) fort. Er verlangte und erhielt von<br />
den Englän<strong>der</strong>n das höchste je gefor<strong>der</strong>te Danegeld: 82000 Pfund Silber. Damit zahlte er<br />
seinen Truppen das "Heregeld" (Sold). Seine Herrschaft gründete sich auf Furcht! Im<br />
Jahr 1017 heiratet er Emma († 1066), die Witwe Ethelreds, eine Normannin.<br />
Knut wandelt sich später, unternimmt sogar eine Pilgerreise zu den Apostelgräbern<br />
nach Rom und wird später wie ein Heiliger verehrt. Durch seinen – natürlichen (!) – Tod<br />
löst sich die dänische Reichsverfassung auf.<br />
2.3.3 Der Ausklang <strong>der</strong> angelsächsische Herrschaft in England<br />
In England gibt es nach Knuths Tod 3 herrschende Gruppen:<br />
• Die nordische Gruppe mit den Söhnen Knuths<br />
• Die angelsächsische Gruppe um Godwin und Harold und<br />
• Die anglonormannische Gruppe um Emma (ihr Sohn Eduard <strong>der</strong> Bekenner lebte<br />
am Hofe Wilhelm d.E.)<br />
Nach Knuts Tod 1035 wurde England unter seinen zwei Söhnen aufgeteilt. Nach <strong>der</strong>en<br />
Tod 1042 erneuerte Eduard <strong>der</strong> Bekenner (the Confessor / 1042-66 / Emmas Sohn) als<br />
Nachfolger auf dem englischen <strong>Th</strong>ron das angelsächsische Königtum. 1045 heiratete er<br />
die Grafentochter Edith, eine Frau aus hohem englischem Adel. Die Ehe blieb kin<strong>der</strong>los.<br />
Die eigentliche Macht lag jedoch in den Händen <strong>der</strong> „cal<strong>der</strong> men“, mächtiger Adliger,<br />
unter denen Godwin <strong>der</strong> Bedeutendste war. Eduard <strong>der</strong> Bekenner war von 1042 bis<br />
1066 König von England. Nach einer kurzen Phase <strong>der</strong> Herrschaft von Wikingerfürsten,<br />
übernahm mit Eduard 1042 wie<strong>der</strong> ein Angelsachse den englischen <strong>Th</strong>ron. Eduard lebte<br />
allerdings bis zu seinem 38. Lebensjahr in <strong>der</strong> normannischen Heimat seiner Mutter und<br />
bevorzugte normannische Adlige an seinem Hof, was ab 1050 zu einem Aufstand<br />
angelsächsischer Adliger führte. Eduard konnte den Aufstand nie<strong>der</strong>schlagen, Edith<br />
verstoßen und ihre Verwandtschaft aus dem Land verweisen, musste sie aber 1052 alle<br />
wie<strong>der</strong> in ihre Ämter einsetzen.<br />
Die normannische Prägung Eduards war Voraussetzung für die Eroberung Englands<br />
durch Wilhelm I.. Auf jeden Fall führte Eduards Versäumnis, offiziell einen Nachfolger zu<br />
benennen, nach seinem Tod zu einem Bürgerkrieg.<br />
1066 starb Eduard <strong>der</strong> Bekenner und wurde in <strong>der</strong> Westminster Abbey, die er zu<br />
Lebzeiten reichlich beschenkt hatte, beigesetzt. Im 12. Jahrhun<strong>der</strong>t wurde von den<br />
dortigen Mönchen seine Heiligsprechung betrieben.
2.3.4 Die Kirche in <strong>der</strong> Welt des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
21<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die Kirche bietet bis zum 11. Jahrhun<strong>der</strong>t im Ganzen kein geschlossenes Bild. Je<strong>der</strong><br />
lebt seine Vorstellung vom kirchlichen Leben auf seine Art und Weise aus. Es gibt z.B.<br />
kämpfende Bischöfe neben Einsiedlern und auch die päpstliche Autorität ist als nur mäßig<br />
zu bezeichnen. Die Kirche ist um das Jahr 1000 ganz einfach nicht zentral gelenkt (Eine<br />
„Papstkirche“ wird es sogar erst im 13. Jahrhun<strong>der</strong>t geben).<br />
Die Kultur <strong>der</strong> Angelsachsen – das galt sowohl für Geistliche als auch für Laien – wurde von den<br />
zeitgenössischen Geschichtsschreibern als nicht sehr hoch entwickelt beurteilt. Das Studium <strong>der</strong><br />
Wissenschaften und <strong>der</strong> <strong>Th</strong>eologie wurde vernachlässigt, die Geistlichen gaben sich mit einer nur<br />
mangelhaften Ausbildung zufrieden, und es erweckte Verwun<strong>der</strong>ung, wenn jemand Kenntnisse <strong>der</strong><br />
Grammatik aufweisen konnte. Die Angelsachsen lebten von <strong>der</strong> Hand in den Mund, in kleinen,<br />
armseligen Behausungen, ganz an<strong>der</strong>s als die Franzosen und Normannen. Die Angelsachsen<br />
galten als plump und ungebildet.<br />
Im Verlauf des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts tritt hier aber ein Wandel ein. Ein „Wind <strong>der</strong><br />
Erneuerung“ (<strong>Behrmann</strong>n) weht, das Papsttum und auch Klöster erfahren eine<br />
Reformierung. Es kommt zum einschneidensten Umbruch in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong><br />
mittelalterlichen Kirche. Und dieser Umbruch, diese Erneuerung wirkt bis in die Laien -<br />
gruppen hinein. Ein ungeheuer wichtiger, grenzüberschreiten<strong>der</strong> Umbruch, <strong>der</strong> die<br />
Grenzen zwischen Klerikern und Laien verwischt.<br />
Ab dem 11. Jahrhun<strong>der</strong>t kann man von <strong>der</strong> mittelalterlichen Kirche sprechen. Die<br />
Strukturen entwickelt, nicht mehr wie bisher „neben dem Leben steht“, die Gruppe <strong>der</strong><br />
Laien stärker in ihre Arbeit einbindet. Die Kirche wird zur Institution, bleibt aber<br />
weiterhin in <strong>der</strong> Welt verwurzelt!<br />
2.3.5 Die klösterliche Reform<br />
Starke weltliche Einflüsse auf die Kirche sind zu konstatieren. Bestes Beispiel ist <strong>der</strong><br />
deutsche Kaiser Heinrich III., <strong>der</strong> 1046 persönlich in die Auseinan<strong>der</strong>setzungen um den<br />
Heiligen Stuhl eingreift und auf Synoden in Sutri und Rom im Dezember 1046 die drei<br />
rivalisierenden Päpste Silvester III., Gregor VI. und Benedikt IX. absetzt und den<br />
Reformbischof Suitger von Bamberg als Klemens II. zum Papst erheben lässt. In <strong>der</strong><br />
Folge brachte Heinrich noch drei weitere Reformgeistliche aus Deutschland auf den<br />
Papstthron, u. a. Leo IX., ebenso besetzte er die Bistümer und Abteien im Reich mit<br />
Reformkräften.<br />
Man spricht von einem „Eigenkirchenwesen“; was bedeutet, dass die Bischöfe z.B. in<br />
ihren Städten die Herrschaft ausüben. Orden erhalten Län<strong>der</strong>eien zum Bau ihrer Klöster<br />
von den Grundherren – z.B. vom König / Kaiser, die aber weiterhin Eigentümer dieser<br />
Län<strong>der</strong>eien bleiben. So behalten sie ein Mitspracherecht, z.B. bei <strong>der</strong> Einsetzung eines<br />
Bischofs. Was natürlich den kirchlichen und klösterlichen Auftrag beeinflusst, weil eigene<br />
Interessen <strong>der</strong> Grundherren und nicht so sehr kirchliche Interessen ausschlaggebend<br />
sind.<br />
Trotzdem wurde dieser Zustand über Jahrhun<strong>der</strong>te akzeptiert, sogar priesterliche<br />
Eheschließungen! Es gibt materielle Gegenleistungen im Sinne <strong>der</strong> Simonie. Das Wort ist<br />
von dem biblischen Zauberer Simon Magus abgeleitet, <strong>der</strong> vom Apostel Petrus Gottes<br />
Gabe gegen Geld erwerben wollte (N. T., Apostelgeschichte 8, 18-24), und bezeichnet<br />
den Verkauf eines heiligen Amtes, von Pfründen, einer Zeremonie o<strong>der</strong> eines<br />
Gegenstandes. Am stärksten verbreitet war die Simonie vom 9. bis zum 11. Jahrhun<strong>der</strong>t,<br />
einer Zeit, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Verkauf geistlicher Sachen in <strong>der</strong> Kirche allgegenwärtig war, von<br />
den nie<strong>der</strong>en Geistlichen bis hin zum Papst.<br />
Jetzt im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t mehren sich die Stimmen, die eine Abschaffung <strong>der</strong><br />
Priesterehe for<strong>der</strong>n. Die Frau ist <strong>der</strong> große Verführer des Mannes und steht einem
22<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
sittenstrengen Leben, das wie<strong>der</strong> gefor<strong>der</strong>t wird, entgegen. Die klösterlichen Belange<br />
sollen im Vor<strong>der</strong>grund stehen, wichtig sein. Damit soll dann auch eine effektivere<br />
„Betleistung“ erzielt werden.<br />
Es gibt mehrere Reformbewegungen, wir wollen uns<br />
die von Cluny ansehen. Cluny wurde mit Urkunde vom<br />
11. September 910 durch Herzog Wilhelm I. von<br />
Aquitanien als Benediktinerkloster gegründet. Dabei<br />
verzichtete Herzog Wilhelm auf jede Gewalt über das<br />
Kloster und schloss jegliche Einmischung weltlicher o<strong>der</strong><br />
geistlicher Gewalt in die internen Angelegenheiten des<br />
Klosters aus (Exemption). Insbeson<strong>der</strong>e wurde auf die<br />
wirtschaftliche Nutzung verzichtet. Für die Verhältnisse<br />
des 10. Jahrhun<strong>der</strong>ts war dies eine Neuerung. Er<br />
ernannte lediglich den ersten Abt und erlaubte dem<br />
Konvent danach eine freie Abtswahl.<br />
Cluny - Rekonstruktion Diese beiden Kriterien, Exemption und freie Abtswahl,<br />
trugen wesentlich zur Entfaltung Clunys bei. Diese Neuerungen sowie eine strenge<br />
Auslegung <strong>der</strong> Benediktusregel machten Cluny zum Ausgangs- und Mittelpunkt <strong>der</strong><br />
cluniazensischen Reform, in <strong>der</strong>en Blütezeit etwa 1.200 Klöster mit rund 20.000 Mönchen<br />
zu Cluny gehörten. Bemerkenswert war die straffe Ordnung innerhalb <strong>der</strong> Gemeinschaft.<br />
In Deutschland schloss sich das Kloster Hirsau <strong>der</strong> cluniazensischen Reformbewegung<br />
an. Der Abt Wilhelm wurde <strong>der</strong> Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> neuen Hirsauer Reform. Er befreite 1075<br />
sein Kloster aus dem Eigenrecht <strong>der</strong> Stifterfamilie, führte 1079 die strengen Regeln des<br />
cluniazensischen Mönchtums ein und legte diese in den "Constitutiones Hirsaugienses"<br />
nie<strong>der</strong>. Er machte Hirsau kirchenpolitisch zum Mittelpunkt <strong>der</strong> päpstlichen Partei in<br />
Deutschland.<br />
2.3.6 Die Kirchliche Reform<br />
Es war nur eine Frage <strong>der</strong> Zeit, wann die klösterliche Reformbewegung auch auf die<br />
Kirche, zum Klerus und in die Pfarren getragen würde. Unter den Bischöfen wurde rege<br />
diskutiert - als Beispiel nennt <strong>Behrmann</strong> Bischof Wazo von Lüttich († 1048).<br />
Kirchenpolitisch verficht dieser die Beschränkung kaiserlich-weltlicher Herrschafts -<br />
ansprüche gegenüber episkopaler und pontifikaler als göttlich legitimierter Macht,<br />
verneint die Richtbarkeit des Episkopats und Papstes durch den Kaiser.<br />
Petrus Damiani († 1072) wurde Benediktinermönch und lebte in einer Einsiedelei mit<br />
außerordentlicher Strenge. Petrus kritisierte in seiner Korrespondenz mit dem Kaiser<br />
Heinrich III. und mit Papst Leo IX. scharf die Ausschweifungen des Klerus, wandte sich<br />
vor allem auch gegen die Simonie und die Nichteinhaltung des Zölibats.<br />
Solche Einlassungen hatte es vorher nie gegeben, ihr Ziel war eine Stärkung <strong>der</strong><br />
Macht des Papstes. Heinrich III. wird mit diesen Reformbestrebungen anl. einer Reise<br />
nach Rom konfrontiert und „ist beeindruckt“ (<strong>Behrmann</strong>). In <strong>der</strong> Folgezeit werden mehr<br />
als die Hälfte <strong>der</strong> von ihm ernannten Bischöfe aus seiner eigenen „Hofkapelle“ stammen.<br />
Und das alles ohne simonistische Gegenleistungen.<br />
Einer <strong>der</strong> von Heinrich III. eingestzten deutschen Päpste war Leo IX. (vorher Bruno<br />
Graf von Egisheim und Dagsburg / 1049-1054). Leo IX. war <strong>der</strong> bedeutendste deutsche<br />
Papst im Mittelalter. Während seines Pontifikats fand <strong>der</strong> lange Dogmenstreit zwischen<br />
West- und Ostkirche im ehemaligen Römischen Reich 1054 durch die Exkommunikation<br />
des Patriarchen von Konstantinopel seinen Höhepunkt. Dieser Schritt vollendete die<br />
Spaltung zwischen Rom und <strong>der</strong> orthodoxen Kirche (she. Seite 23/24).<br />
Er führte die offizielle Kirchenpolitik weiter, indem er für das Zölibat – und damit<br />
gegen die Priesterehe – eintrat und den Kauf kirchlicher Ämter (Simonie) bekämpfte.<br />
Während seiner Amtszeit reiste Leo IX. viel, wodurch er den unmittelbaren Einfluss des<br />
Papsttums auf von Rom ferne Gemeinden verstärkte. Auch leitete er die gregorianische
23<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Reform <strong>der</strong> Kirche ein. Eine Periode regionaler und überregionaler Treffen beginnt, die<br />
dann in den großen Konzilien mündet.<br />
Alle diese geschil<strong>der</strong>ten Maßnahmen haben die Kirche seit <strong>der</strong> Mitte des 11. Jahr -<br />
hun<strong>der</strong>ts zur „Institution“ geformt. So hatte es ein „Reisepapsttum“ vorher noch nie<br />
gegeben und Simonie und Priesterehe wurden endgültig verboten. Ging ein Priester eine<br />
Ehe ein, wurde er von seinem Amt ausgeschlossen. Die Autorität des Papstes ist stärker,<br />
als je zuvor. Es beginnt die Periode des „Reformpapsttums“, <strong>der</strong>en Ende mit dem 1.<br />
Laterankonzil zu sehen ist. Dieses erste dieser Konzilien wurde 1123 unter Papst<br />
Calixtus II. abgehalten und war das erste allgemeine Konzil des Westens. Seine<br />
wichtigste Entscheidung bestand in <strong>der</strong> Bestätigung des Wormser Konkordats von 1122,<br />
wodurch <strong>der</strong> Investiturstreit zwischen geistlicher und weltlicher Macht beendet wurde.<br />
Das Konzil untersagte die Eheschließung Geistlicher und annullierte die Ordination des<br />
Gegenpapstes Gregor VIII. Die Aera Papst Gregor VII. deutet sich an.<br />
Papst Leo IX. rief Hildebrand nach Rom zurück. Auch den vier Nachfolgern Leos auf dem Stuhl<br />
Petri diente er als Berater und stieg in hohe Ämter auf. Er begegnete Petrus Damiani und<br />
freundete sich mit dem Kardinal an. Zusammen mit diesem festigte er seinen Ruf als großer<br />
Kirchenreformer im Kampf gegen die Simonie, für die Einhaltung des Zölibats und gegen die<br />
Priesterehe und in den Kämpfen und Auseinan<strong>der</strong>setzungen zwischen den Päpsten in Rom und den<br />
deutschen Königen und Kaisern im Investiturstreit. Als Papst Alexan<strong>der</strong> II. starb, wurde<br />
Hildebrand 1073 gegen seinen Willen, aber auf Drängen des Volkes von Rom, zum Papst<br />
ausgerufen.<br />
2.3.7 Die Reform des Papsttums<br />
Die Reform innerhalb <strong>der</strong> Kirche konnte vor dem Papsttum nicht Halt machen und so<br />
kommt es in <strong>der</strong> Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts zu einem Wandel bei <strong>der</strong> Zeremonie <strong>der</strong><br />
Papsterhebung. Bisher kam ein Papst aus einer <strong>der</strong> adligen römischen <strong>Familie</strong>n o<strong>der</strong> er<br />
wurde vom Kaiser eingesetzt. Es war immer eine Einzelentscheidung. Jetzt entscheiden<br />
<strong>der</strong> Klerus von Rom und das Volk über einen neuen Papst. Auf <strong>der</strong> Lateransynode von<br />
1059 wird das sog. „Papstwahldekret“ verabschiedet, welches das Wahlrecht zunächst<br />
auf die Kardinalbischöfe einschränkt – später wurde es dann auf die gesamte Gruppe <strong>der</strong><br />
Kardinäle ausgeweitet - , um weltliche Einflüsse für die Zukunft auszuschalten.<br />
Der Papst bekommt jetzt neue Aufgaben, ein erweiterter Beraterstab steht ihm zur<br />
Seite. Dieser – meist Kardinäle – baut einen regelrechten Verwaltungsapparat auf. Bis es<br />
dann im Sommer 1054 zum entscheidenden Eklat kommt, <strong>der</strong> zum großen (Kirchen-)<br />
Schisma zwischen <strong>der</strong> West- und <strong>der</strong> Ostkirche führt.<br />
1054 exkommunizierte <strong>der</strong> römische Kardinal Humbert von Silva Candida den<br />
Patriarchen von Konstantinopel, was als Exkommunikation <strong>der</strong> gesamten griechischen<br />
Kirche gedeutet wurde. Patriarch Kerullarios antwortete acht Tage später und ließ<br />
Humbert von einer Synode verdammen. Spätere Ereignisse, wie etwa die Plün<strong>der</strong>ung<br />
Konstantinopels während des 4. Kreuzzuges 1204, besiegelten den Bruch, wobei alle<br />
Versöhnungsversuche erfolglos blieben (Bannbulle).<br />
Erst 1965 wurden im Zuge umfassen<strong>der</strong> Bemühungen die wechselseitigen<br />
Exkommunikationen von Papst Paul VI. und dem Patriarchen Athenagoras I.<br />
aufgehoben, um die beiden Kirchen einan<strong>der</strong> näher zu bringen.
24<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Morgenländisches "Schisma" - griechisch: "Trennung" - bezeichnet den Bruch zwischen <strong>der</strong><br />
Ost- und <strong>der</strong> Westkirche, <strong>der</strong> auf 1054 datiert wird.<br />
Die Entfremdung zwischen <strong>der</strong> Ost- und <strong>der</strong> Westkirche hatte tiefreichende kulturelle und<br />
politische Wurzeln und bahnte sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrhun<strong>der</strong>ten an. Die<br />
Kirche in Konstantinopel respektierte zwar grundsätzlich die Vorrechte Roms als <strong>der</strong><br />
ursprünglichen Hauptstadt des Reiches, lehnte jedoch die Rechts- und Führungs -ansprüche ab,<br />
die Papst Leo IX. und seine Nachfolger ab 1049 erhoben.<br />
Die westliche Kirche wie<strong>der</strong>um wandte sich gegen den Caesaropapismus, die Staatsform, bei<br />
<strong>der</strong> <strong>der</strong> weltliche Herrscher zugleich auch geistliches Oberhaupt ist, <strong>der</strong> die Kirche in<br />
Konstantinopel kennzeichnete. Als Michael Kerullarios 1043 Patriarch von Konstantinopel<br />
wurde, verschärften sich die Gegensätze zwischen <strong>der</strong> östlichen und westlichen Kirche, und es<br />
bildeten sich Glaubensunterschiede heraus, insbeson<strong>der</strong>e bezüglich des Dogmas vom Heiligen<br />
Geist.<br />
Vorlesung vom 25.11.2005<br />
3. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des Investiturstreits<br />
Wir hatten von den archaischen und anarchischen Zuständen und Entwicklungen in<br />
England gehört. Die kirchliche und klösterliche Reform sowie die Reform des Papsttums<br />
auf dem Kontinent waren besprochen worden. Für den Zölibat und gegen die Simonie<br />
waren diese Reformbestrebungen gerichtet. Und beson<strong>der</strong>s die klösterliche Reform<br />
(Cluny) rief weitere solcher Reformbewegungen auf den Plan, auch eine Folge <strong>der</strong><br />
Institutionalisierung <strong>der</strong> Kirche. Eine Entwicklung, die – über Jahrhun<strong>der</strong>te gehend - in<br />
<strong>der</strong> 2. Hälfte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts in den Investiturstreit münden sollte.<br />
In Spanien beginnt die Zeit <strong>der</strong> Reconquista (Zurückeroberung), die spanische und<br />
portugiesische Bezeichnung für die (Wie<strong>der</strong>-)Erlangung <strong>der</strong> Vorherrschaft auf <strong>der</strong><br />
iberischen Halbinsel durch die christlichen Nachkommen <strong>der</strong> Westgoten, die seit dem<br />
frühen 8. Jahrhun<strong>der</strong>t von aus Nordafrika vordringenden muslimisch - arabischen<br />
Eroberern verdrängt worden waren.<br />
3.1 Italien und Spanien<br />
Welchen Platz nimmt Italien in dieser Zeit ein? Es gibt eine ausgeprägte technische<br />
und auch soziale Entwicklung <strong>der</strong> Städte in Europa. Baumassnahmen größeren Umfanges<br />
erfolgen; hier ist beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> Bau von Kirchen zu nennen (Beispiel ist wie<strong>der</strong> Cluny –<br />
hier entsteht die größte Kirche dieser Zeit). Auch gibt es erste Anzeichen einer<br />
Selbstverwaltung <strong>der</strong> Bürger, die sich gegen die bisher alleine herrschenden Bischöfe<br />
wendet. Aber auch die feudale Welt wandelt sich. So lauschen in Frankreich bislang<br />
„hauende und stechende Ritter“ (<strong>Behrmann</strong>) jetzt <strong>der</strong> Musik. Es entstehen die ersten<br />
Heldenepen, als Beispiel wird das „Rolandslied“ genannt.<br />
Zurück zur Eingangsfrage, wo Italien bei diesen Entwicklungen steht. Man kann sagen,<br />
dass dieses Land bei fast allen Neuerungen „vorneweg marschiert“. Beson<strong>der</strong>s bei <strong>der</strong><br />
Urbanisierung, aber auch beim Handel und beim Gewerbe - selbst das Papsttum<br />
entwickelt sich weiter. Einige Beispiele:<br />
3.1.1 Der Doge und die städtische Verfassung in Venedig<br />
Das Venedig dieser Zeit ist mit an<strong>der</strong>en italienischen Städten kaum zu vergleichen.<br />
Und obwohl es schon einen stadtähnlichen Charakter aufweist, gibt es kaum bauliche<br />
Zeugnisse aus dieser Zeit des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts. Die entstehen erst im 12. Jahrhun<strong>der</strong>t –<br />
insofern ist Venedig für eine Reise in die Zeit <strong>der</strong> Romanik weniger geeignet (<strong>Behrmann</strong>).
25<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Venedig hat ja bekanntermaßen keine römische Tradition. Die Stadt wurde durch<br />
Flüchtlinge aus Oberitalien besiedelt, die sich vor <strong>der</strong> Invasion <strong>der</strong> Hunnen 452 und<br />
später <strong>der</strong> Langobarden 568 in den Sümpfen und auf den zahllosen Inseln <strong>der</strong> Brenta-<br />
Mündung verbargen. Venedig ist so ein genuines (unverfälschtes) mittelalterliches<br />
Gebilde, aufgrund <strong>der</strong> Lage am und fast im Wasser brauchte man z.B. keine Mauern. Als<br />
Außenposten des byzantinischen Reiches war man natürlich in dessen Einflussbereich.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Inselsituation lebte man<br />
ausschließlich vom Handel; es gab keinen Anbau<br />
von Getreide, da es auch kein dafür geeignetes<br />
Land gab und lange Zeit war die Salzgewinnung<br />
das einzige Gewerbe <strong>der</strong> Stadt. Dafür blühte <strong>der</strong><br />
Handel mit Gewürzen, Färbestoffen und an<strong>der</strong>en<br />
Waren aus dem Orient umso mehr. Zusätzlich<br />
schaffen sich die Venezianer aber auch ein<br />
„Hinterland“.<br />
Schon früh gelangt man zu einer Selbstverwal -<br />
tung unter Führung eines Dogen und seiner<br />
verschiedenen Ratsgremien, wie etwa des Kleinen<br />
und des Großen Rates. Damit erreichte <strong>der</strong> vene -<br />
Blick zum Dogenpalast und Campanile zianische Stadtadel eine Stabilisierung seiner<br />
Vorherrschaft in <strong>der</strong> Stadt durch Handelsprivile -<br />
gien, Abschließung gegen aufsteigende <strong>Familie</strong>n (1297) und die Einführung von<br />
Überwachungsgremien mit fast unbeschränkter Vollmacht (wie etwa dem Rat <strong>der</strong> Zehn).<br />
Diese Verwaltungsart gibt <strong>der</strong> Stadt das ganze Mittelalter über Stabilität.<br />
Das Amt des Dogen gilt auf Lebenszeit – deshalb wurden meist sehr alte Männer<br />
gewählt – und ist nicht erblich. Dadurch wird es auch Aufsteigern möglich, in dieses Amt<br />
zu gelangen. Das Volk bestimmt bei dieser Dogenwahl mit, Venedig wird zur Republik<br />
und behält diese Regierungsform für lange Zeit.<br />
Die Eroberung <strong>der</strong> östlichen Adriaküste bedeutet einen ersten Schritt zur Großmacht.<br />
Schon im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t besitzt Venedig eine starke Flotte, die sie auch als politisches<br />
Instrument einsetzt. Und Venezianer siedeln sich in Konstantinopel an und treiben nun<br />
ihrerseits Handel mit ihrer Heimatstadt.<br />
Der byzantinische Einfluss in <strong>der</strong> Stadt ist auch an vielen Bauten erkennbar, wie<br />
beispielsweise am Markusdom. Dieser und auch <strong>der</strong> Dogenpalast werden im 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t errichtet. Eine entscheidende Ausweitung seiner Machtstellung erreicht<br />
Venedig dann ab dem 12. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
3.1.2 Pataria und Adelsherrschaft in Mailand<br />
Die Pataria ist eine revolutionäre demokratische Bewegung in Mailand, die seit den<br />
1050er Jahren aktiv ist und die unter <strong>der</strong> Führung des Diakons Ariald und des<br />
Subdiakons Landulf die kirchlichen Reformideen ins Volk trug und gewaltsam gegen<br />
simonistische und verheiratete Priester einschritt. Unüberbrückbare Gegensätze zwischen<br />
<strong>der</strong>en Ideen und dem Verhalten des Ebf. Wido führen zu „Mord und Totschlag“<br />
(<strong>Behrmann</strong>).<br />
Mailand war zur größten Stadt Italiens aufgestiegen und hatte Rom in seiner<br />
Bedeutung praktisch abgelöst. In seinen Mauern lebten viele Handwerker und Kaufleute.<br />
Der Erzbischof Wido war als Oberhaupt mächtigster Kirchenmann in Oberitalien. Viele<br />
Mailän<strong>der</strong> <strong>Familie</strong>n waren mit <strong>der</strong> des Ebf. verbunden. Unter Wido gibt es nun in <strong>der</strong><br />
Mailän<strong>der</strong> Kirche eine Reihe eigener und eigenwilliger Riten, die 1054 sogar zum Streit<br />
mit Papst Leo IX. führen. Im Jahre 1053 führte er z.B. am ersten Oktobersonntag in die<br />
ambrosianische Liturgie <strong>der</strong> Stadt und des Erzbistums Mailand das Fest <strong>der</strong><br />
Kreuzerhöhung ein. Zu seinen Eigenwilligkeiten gehört aber auch die Tatsache, dass er<br />
mit einer Frau zusammen lebt und in Mailand die Priesterehe erlaubt. Von Kaiser<br />
Heinrich III. eingesetzt ist er das „Muster eines unwürdigen Kirchenmannes“<br />
(<strong>Behrmann</strong>).
26<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die erwähnten Ariald (†1066) und Landulf (†) sind Verfechter <strong>der</strong> Kirchenreform.<br />
Ariald (Arialdus) stammte aus nie<strong>der</strong>em Adel, Landulf stammte aus einer angesehenen<br />
<strong>Familie</strong>. Ihre Aktivitäten gegen Wido stützten sich auf das Volk von Mailand – es wurde<br />
Pataria genannt. Was als Schimpfwort gemeint war, wobei seine genaue Entstehung im<br />
Dunkeln liegt.<br />
Auslöser <strong>der</strong> Bewegung war eine Prozession Widos. Dabei wird von Ariald und Landulf<br />
die Frage <strong>der</strong> Nachfolge Christi gestellt. Diese Nachfolge bedeutete ein Leben in Armut<br />
und Bedürftigkeit und ein „alles miteinan<strong>der</strong> teilen“. Und das bei Widos Lebenswandel !<br />
Als Wido am 4.6. 1066, am Pfingstfest, im Dom gegen seine Exkommunikation vor dem<br />
Volk Klage führte, brach ein Tumult aus. Der patarenische Pöbel drang auf ihn ein,<br />
mißhandelte ihn schwer und stürmte dann den erzbischöflichen Palast.<br />
Ariald und Landulf zwingen den Mailän<strong>der</strong> Klerus zu einer Unterschrift unter ein<br />
Schreiben an den Papst in Sachen Zölibat. So wird ihre Bewegung bis zum „Heiligen<br />
Stuhl“ getragen, Wido muss einem Kompromiss zustimmen und eine Bußfahrt nach<br />
„Santiago de Compostela“ unternehmen. Er verzichtete daraufhin 1068 entnervt auf sein<br />
Erzbistum und zog sich nach Bergoglio zuück.<br />
Landulf erlag einem Lungenleiden. Ariald gewann in Erlembald, dem Bru<strong>der</strong> des<br />
Verstorbenen, einen ausgezeichneten Nachfolger. Bevor er dem Ruf Folge leistete, ging<br />
Erlembald nach Rom. Alexan<strong>der</strong> II. überreichte ihm mit kirchlichem Segen ein Banner<br />
und bekannte sich damit feierlich zur Pataria. Unter <strong>der</strong> Leitung Erlembalds wuchs die<br />
Pataria und setzte ihre Angriffe gegen den verheirateten und simonistischen Klerus und<br />
die Störung <strong>der</strong> Gottesdienste fort.<br />
Ariald räumte bald das Feld und wurde auf Veranlassung einer Nichte Widos kurz<br />
darauf am Lago Maggiore grausam ermordet, aber alsbald als Märtyrer verehrt. Die Frage<br />
<strong>der</strong> Investitur eines Wido-Nachfolgers gibt Anlass zu Streitigkeiten, die sogar in<br />
Straßenkämpfen eskalieren. Dabei wird Erlembald getötet und die Bewegung <strong>der</strong> Pataria<br />
endet.<br />
Bemerkenswert an <strong>der</strong> Pataria-Bewegung ist,<br />
• dass hier erstmals Bürger als Handelnde auftreten. Sie, die bisher mit<br />
Schimpfwörtern wie „Eselstreiber“ o<strong>der</strong> „Hofhunde“ bezeichnet wurden. Auch<br />
<strong>der</strong> schon erwähnte Petrus Damiani (she. Seite 22) hat sie schlecht gemacht.<br />
Er war 1059 vom Papst D. mit einer wichtigen Legation nach Mailand geschickt<br />
worden; es gelang ihm, die dortigen durch den Kampf <strong>der</strong> patarenischen<br />
Bewegung gegen den Erzbischof Wido und den Klerus zerrütteten kirchlichen<br />
Verhältnisse zu ordnen.<br />
• Zu vermerken ist auch, dass die Kirchenreform inzwischen sogar das einfache<br />
Volk erreicht hat.<br />
• Auch hat die Pataria erstmals gegen die angestammte Ordnung rebelliert und<br />
kann damit zu einer „Präkommunalen Bewegung“ gezählt werden.<br />
• Und in ihr zeigen sich erstmals Anzeichen einer richtigen Organisation - mit<br />
u.a. <strong>der</strong> Ablegung eines Eides - die aber wegen des Fehlens einer richtigen<br />
inneren Struktur nicht überleben konnte.<br />
3.1.3 Papsttum und Normannen in Süditalien<br />
Die Normannen gelangten in beinahe ganz Süditalien und Sizilien, das sie von den<br />
Sarazenen eroberten, an die Herrschaft. Das Papsttum suchte zunächst bei den Kaisern<br />
um Hilfe gegen die Normannen nach, als Papst Leos IX. Pläne, mit einem eigenen Heer<br />
und <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Griechen die Normannen aus Süditalien zu vertreiben,<br />
scheiterten. Sein Heer wurde bei Civitate (Apulien) geschlagen.<br />
Den zukunftweisenden Durchbruch brachte aber diese Schlacht von Civitate 1053, die<br />
dazu führte, dass die Normannenstaaten auf <strong>der</strong> Synode von Melfi 1059 päpstliche<br />
Lehensleute wurden. So finden beide – Papst und Normannen – zueinan<strong>der</strong> und 1059<br />
erhebt Papst Nikolaus II. den Normannen Robert Guiscard zum Herzog von Apulien,<br />
Kalabrien und Sizilien - das vorerst noch in sarazenischer Hand war und insofern „stand<br />
diese Belehnung nur auf dem Papier bzw. Pergament“ (<strong>Behrmann</strong>). Aber er sicherte
27<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
damit dem Papsttum – dessen Wandel sich hier zeigt - in seiner Auseinan<strong>der</strong>setzung mit<br />
den römisch-deutschen Kaisern die Unterstützung seitens <strong>der</strong> Normannen.<br />
Stellt diese Vorgehensweise auch dem Papst ein Zeugnis für selbstbewusstes Handeln<br />
aus, so ist aber auch festzustellen, dass er und sein Amt damit in die „große Politik“<br />
hinein gezogen wird. Was wie<strong>der</strong>um dem Reformgedanken wi<strong>der</strong>sprach. Der Krieg gegen<br />
die Muslime erhielt damit aber kirchlichen Segen.<br />
3.1.4 Spanien<br />
Seit dem Zerfall <strong>der</strong> Tarifenreiche erlangen die christlichen Königreiche in Spanien<br />
wie<strong>der</strong> mehr Macht. Es gibt den Gedanken an die Wie<strong>der</strong>errichtung – <strong>der</strong> Reconquista -<br />
des alten Westgotenreiches wie vor 711. Dieser „Neogotismus“ drückt sich u.a. darin aus,<br />
dass sich <strong>der</strong> König von Leon „Imperator“ nennt.<br />
Die kastilischen Herrscher profitieren von <strong>der</strong> Reconquista am meisten. Die<br />
Verhältnisse hatten sich ja jetzt umgekehrt und die christlichen Herrscher erhalten Tribut<br />
von den Muslimen. Der König von Kastilien und <strong>der</strong> Graf von Barcelona z.B.können<br />
eigene Münzen prägen und weiteres Gold lässt erhebliche Beträge in die Kassen<br />
kommen. Der Nachteil <strong>der</strong> Reconquista ist, dass nur wenige selbstständige christliche<br />
Königreiche übrig bleiben und es als Konsequenz zu einer Aufhebung <strong>der</strong> kulturellen<br />
Grenzen kommt:<br />
• Kastilien und Leon verschmelzen zu Kastilien und<br />
• Aragon und Katalonien verschmelzen zu Aragon.<br />
3.1.5 Beginn <strong>der</strong> Reconquista<br />
An den Zügen gegen die Muslime innerhalb <strong>der</strong> Reconquista sind französische Ritter<br />
sehr stark beteiligt. Barcelona – 985 noch von Al-Mansur, dem Kalifen von Córdoba, in<br />
Besitz genommen und zerstört – steigt wie<strong>der</strong> zu einer wirtschaftlichen Macht (Tribute)<br />
auf. Im Mittelalter war Barcelona Hauptstadt des Königreiches Aragonien und eine<br />
wichtige See- und Handelsmacht im westlichen Mittelmeer, mit bedeutenden Kolonien auf<br />
Sardinien und Sizilien. Auch nach Norden weitet die Stadt ihre Macht Richtung<br />
Carcassonne aus, nach Süden hat man Tarragona im Visier. Hat <strong>der</strong> Papst doch<br />
Vergebung aller Sünden - wie bei einem Kreuzzug - für dessen Wie<strong>der</strong>eroberung<br />
versprochen.<br />
Kastilien wird zur Hauptmacht innerhalb <strong>der</strong> Reconquista. Auf seinem Höhepunkt im<br />
Spätmittelalter erstreckte es sich vom Golf von Biscaya im Norden bis Andalusien im<br />
Süden und umfasste den Großteil <strong>der</strong> Iberischen Halbinsel. Altkastilien, dessen Name von<br />
<strong>der</strong> Vielzahl alter Burgen an <strong>der</strong> Grenze zum Herrschaftsbereich <strong>der</strong> Mauren herrührt,<br />
stand vom 8. Jahrhun<strong>der</strong>t bis 1037 unter <strong>der</strong> Herrschaft <strong>der</strong> Könige von Asturien und<br />
León, als Ferdinand I. (1005-65) das Vereinigte Königreich von Kastilien und León<br />
gründete.<br />
1058 wurde beim ersten einer Reihe von Kriegszügen gegen die Mauren das spätere<br />
Neukastilien erobert. Das Königreich vergrößerte sich vor allem während <strong>der</strong><br />
Regentschaft von Ferdinands Sohn Alfons VI. (1065-1109) und damit bekommt die<br />
Reconquista „eine neue Qualität“ (<strong>Behrmann</strong>). 1086 wird Toledo eingenommen, für die<br />
Muslime eine entscheidende Nie<strong>der</strong>lage. Die Moschee soll in eine christliche Kirche<br />
umgewandelt werden, die Mozaraber stehen bei diesem Vorhaben gegen Christen und<br />
Muslime.<br />
Mönche von Cluny werden Erzbischöfe in Spanien, u.a. in Santiago de Compostela.<br />
Papst Gregor VII. will Sitten <strong>der</strong> Mozaraber durch römische Sitten ersetzten und bedient<br />
sich dazu <strong>der</strong> Mönche aus Cluny.
3.1.6 El Cid Campeador (um 1043-99)<br />
28<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Aus nie<strong>der</strong>em Adel stammend wurde El Cid, wie er allgemein genannt wird, durch seine<br />
taten zum spanischen Nationalhelden, um und über den viele Erzählungen und Epen<br />
entstehen. Dazu aus dem Internet:<br />
Ein Mann aus <strong>der</strong> neuen militärischen Kaste, auf die sich im ganzen 11. Jahrhun<strong>der</strong>t die<br />
christlichen Königreiche stützten, war Rodrigo Diaz de Vivar, genannt El Cid. Sein Beispiel steht<br />
neben vielen an<strong>der</strong>en wie Gottfried von Bouillon, <strong>der</strong> im Heiligen Land eine neue Herrschaft<br />
begründete - das Königreich Jerusalem.<br />
Die Verklärung des El Cids als spanischen Nationalhelden geht<br />
aus verschiedenen Gründen fehl. Unbestritten ist jedoch, dass<br />
<strong>der</strong> Cid ein außerordentlich begabter militärischer Führer und ein<br />
vielseitig gebildeter Mann war. An<strong>der</strong>s als viele Standesgenossen<br />
nicht nur ein "Haudrauf", son<strong>der</strong>n sicher <strong>der</strong> in Spanien damalig<br />
gebräuchlichen Sprachen (darunter Arabisch) in Wort und Schrift<br />
mächtig, war er sogar für den kastilischen König als Jurist tätig.<br />
Als er sich mit seinem König überworfen hatte, wurde er, wie<br />
damals üblich, ins Exil geschickt. Im Dienste des Emirs von<br />
Zaragoza schlug er dessen Feinde, die christlichen Könige. Hier<br />
zeigte sich, dass er wie kein an<strong>der</strong>er verstand, die damalige<br />
Panzerreiterei als unbesiegbaren Truppenverband zu führen,<br />
seine kleine Söldnerarmee schlug mehrmals wesentlich größere<br />
Heere.<br />
Kurzfristig wie<strong>der</strong> mit Kastilien versöhnt, machte er sich<br />
erneut selbstständig, eroberte auf eigene Rechnung das Emirat<br />
Valencia und wurde dessen Fürst. Er schlug die Almoraviden<br />
mehrmals entscheidend zurück.<br />
Die Gründung einer eigenen Dynastie scheiterte aber, weil sein<br />
Sohn Diego 1097 in den Kämpfen um Toledo starb. 1099 starb<br />
<strong>der</strong> Cid in Valencia. Reiterstandbild El Cids<br />
(Bildquelle:www.flickr.com/photos)<br />
3.1.7 Die Konsolidierung <strong>der</strong> muslimischen Reiche unter den Almoraviden<br />
Die Almoraviden (Arabisch = Grenzkämpfer) waren eine Berberdynastie in Marokko,<br />
Algerien und Andalusien in <strong>der</strong> Zeit von 1046 bis 1147. Anfang des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
nomadisierten Viehzüchter in <strong>der</strong> westlichen Sahara. Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurden<br />
sie für einen orthodoxen sunnitischen Islam missioniert und zum Kampfbund <strong>der</strong><br />
Almoraviden zusammengeschlossen.<br />
Schon 1086 kam es auf Ersuchen <strong>der</strong> muslimischen Fürsten von Andalusien zu einem<br />
Feldzug nach Europa. Bei diesem Vorstoß wurde Kastilien unter Alfons VI. bei Zallaca<br />
vernichtend geschlagen. Durch diesen Sieg wurden die Grenzen zwischen Muslimen und<br />
Christen festgeschrieben.<br />
In <strong>der</strong> Folgezeit (bis 1092) setzten die Almoraviden durch die Annexion <strong>der</strong> Taifa-<br />
Königreiche ihre Herrschaft in Andalusien durch. Nur Valencia unter El Cid und Saragossa<br />
unter den Hudiden konnten ihre Selbständigkeit zunächst behaupten.
Vorlesung vom 2. 12. 2005<br />
Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des Investiturstreits<br />
3.2 Frankreich und Deutschland<br />
29<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
3.2.1 Frankreich<br />
Der Zugang zur französischen Geschichte ist schwieriger, als <strong>der</strong> zur spanischen;<br />
die Verhältnisse in Frankreich sind weniger klar. Der Einfluss- und Machtbereich des<br />
Königs beschränkt sich auf seine Krondomäne, dem Gebiet <strong>der</strong> Isle de France. Der<br />
Kapetinger Philipp I. (1060-1108) hat in 20 Bistümern im Nord-Osten Frankreichs das<br />
Recht <strong>der</strong> Bischofsinvestitur. Eine Reisetätigkeit wie bei den deutschen Königen und<br />
Kaisern gibt es nicht. Orleans hat den König 13-mal, Paris hat ihn 24-mal in seinem fast<br />
50-jährigen Leben gesehen. Im Süden des Reiches war er überhaupt nicht. Und<br />
umgekehrt kommen auch die Herzöge nicht zum Hof. Die Herzöge kennen den König in<br />
vielen Fällen gar nicht persönlich. Und am Beispiel Wilhelm des Eroberers wird<br />
deutlich, dass sie – wie er in England – außerhalb Frankreichs mehr Macht erhalten<br />
können, als in Frankreich selbst.<br />
Der Einfluss des Königs im Reich geht so mehr und mehr zurück, zumal er sich seit<br />
den 1020-er Jahren auch nicht mehr mit Adligen und Geistlichen, son<strong>der</strong>n mit kleinen<br />
Burgherren aus seiner Krondomäne umgibt. Die Herrschaft hat sich „provinzialisiert“<br />
(<strong>Behrmann</strong>). Und <strong>der</strong> König hat nur wenig „Trumpfkarten“ in seiner Hand. Die wichtigste<br />
ist dabei die Regelung <strong>der</strong> <strong>Th</strong>ronfolge, die sogar durch die Nicht-Anwesenheit <strong>der</strong><br />
Herzöge de facto noch gestärkt wird, weil sie in dieser Frage nicht mitreden und -<br />
entscheiden können.<br />
Die <strong>Th</strong>ronfolge in Frankreich ist sei Hugo Capet in dem Sinn geklärt, dass <strong>der</strong><br />
erstgeborene Sohn schon zu Lebzeiten des alten Königs inthronisiert wird. Wobei <strong>der</strong><br />
König auch in Frankreich eine sakrale Rolle spielt. Aber nicht diese Rolle allein ist es, was<br />
den König auszeichnet. Man spricht ihm auch übernatürliche Fähigkeiten zu. Das Beispiel,<br />
dass er Skrofeln durch Handauflegen heilen konnte, ist bekannt. Der Glaube an diese, auf<br />
den Heiligen Markulf zurückgehende Fähigkeit, ist bei Philipp I. zum ersten Mal<br />
bezeugt. Dieser Glaube hat sich bis zur französischen Revolution gehalten.<br />
MARKULF (†558) Er wurde Priester, errichtete auf einem dazu von König Childebert I.<br />
geschenkten Grund und Boden das Kloster Nanteuil und wurde dessen Abt.<br />
Vom Hlg. Laudus begraben, wurden seine Reliquien 898 nach Corbeny übertragen. Dieses<br />
pflegten die französischen Könige nach ihrer Krönung in Reims zu besuchen. Über <strong>der</strong> Krypta mit<br />
den Reliquien in Nanteuil entstand eine viel besuchte Wallfahrt, bevor die Reliquien nach Corbeny<br />
übertragen wurden.<br />
Markulf ist einer <strong>der</strong> Stadtpatrone von Reims, er wird angerufen gegen Kröpfe und Skrofolose.<br />
In Frankreich galt er als einer <strong>der</strong> bedeutenden Arztheiligen.<br />
Beson<strong>der</strong>s in Frankreich ist seine Darstellung mannigfach, in sehr vielen Gotteshäusern ist er auf<br />
Bil<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Statuen zu sehen.<br />
3.2.2. Strukturelle Verän<strong>der</strong>ungen in Frankreich<br />
2.1 Cluny und die Kirchenreform<br />
Die von Cluny ausgehende Wirkung war enorm; es gab im Laufe <strong>der</strong> Zeit über 1000<br />
von Cluny abhängige Priorate und Klöster. Ein Grund dafür war eher banal – es war die<br />
lange Lebenszeit dreier (von vier) Äbte des Klosters:<br />
• Abt Maiolus lebte von cá 954 bis 994<br />
• Abt Odilo (Odo) lebte von 994 bis 1049 und<br />
• Abt Hugo lebte von 1049 bis 1109
30<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Für die damalige Zeit sehr lange Lebensdauern, in <strong>der</strong> diese Äbte ihre Projekte<br />
gelassen angehen und auch hohe persönliche Wirkung erzielen konnten. Diese drei haben<br />
während ihrer Abbiate viele Könige und Päpste – auch Gegenpäpste - kommen und<br />
gehen sehen. Hugo z.B. erlebte neun Päpste!<br />
Hugo war viel auf Reisen, er hatte wohl auch die größte Ausstrahlung als Abt.<br />
Trotzdem war sein König während Hugos 50-jähriger Amtszeit nie in Cluny! Sein großer<br />
Einfluss auf den deutschen Kaiser Heinrich III. macht ihn zum Paten über dessen Sohn,<br />
Heinrich IV. Auch Wilhelm <strong>der</strong> Eroberer bittet ihn, Mönche aus Cluny nach England zu<br />
schicken und Alfons VI. von Kastilien verdoppelt die schon von seinem Vater geleistete<br />
jährliche Zahlung an das Kloster. Unter Hugos Führung steigt die Zahl <strong>der</strong> abhängigen<br />
Klöster von 60 im Jahr 1049 (Tod Odilos) auf 180 im Jahr 1070 und auf 240 in 1100.<br />
Obwohl man sagen muss, dass diese Entwicklung nicht nur alleine an Hugo gelegen<br />
hat. Auch adlige Laien sind treibende Kräfte, sie unterstellen ihre eigenen Klöster dem<br />
Abt von Cluny o<strong>der</strong> schenken dem Kloster Län<strong>der</strong>eien. Insofern profitiert Cluny von <strong>der</strong><br />
Kirchenreform; Hugo verwaltet diesen Besitz aber auch sehr professionell. Und erst unter<br />
ihm formt sich die Mönchsgemeinschaft von Cluny zu einem Orden, dem ersten<br />
überhaupt. Die Benediktiner, die sich <strong>der</strong> Ordnung von Cluny unterwerfen, werden auch<br />
aufgenommen. Der Orden hatte zur Zeit <strong>der</strong> cluniazensischen Reformen die größte<br />
Wirkung als geistliche Reformbewegung. Diese an<strong>der</strong>en Klöster und Priorate müssen vom<br />
Mutterkloster bestätigt werden und zahlen dann auch einen jährlichen Zins.<br />
Was geschah mit den immensen Summen, die so zusammen kamen? Cluny war auf<br />
400 Mönche angewachsen, dazu kamen Novizen und eine große Schar Bediensteter.<br />
Dazu die vielen Armen, die versorgt werden mussten. Denn die Mönche hier lebten nur<br />
fürs Gebet (ora) und nicht für die Arbeit (labora). Was ihnen in späterer Zeit viel Kritik<br />
eingebracht hat.<br />
Die Mönche haben also eine beson<strong>der</strong>e Stellung, stammen sie doch größtenteils aus<br />
adligen <strong>Familie</strong>n. Insofern mussten sie ihre Lebensumstände gar nicht groß verän<strong>der</strong>n.<br />
Aber das Scheitern <strong>der</strong> cluniazensischen<br />
Bewegung im 12. Jahrhun<strong>der</strong>t war durch<br />
diese Situation bedingt. <strong>Behrmann</strong> dazu:<br />
„ Erst Fundamentos, dann Realos“.<br />
In diesem Kontext ist <strong>der</strong> Bau <strong>der</strong><br />
gewaltigen Kirche in Cluny zu sehen, mit<br />
<strong>der</strong>en Bau 1088 begonnen wurde. Und die<br />
die größte Kirche <strong>der</strong> damaligen Zeit<br />
werden sollte, größer als <strong>der</strong> damalige<br />
Petersdom, bis zu dessen Neubau. Die<br />
Ausmaße von 187 x 77 m lassen die<br />
Frage zu: Geschieht das zur Ehre Gottes<br />
o<strong>der</strong> ist es nur übertriebene<br />
Zurschaustellung? Und so werden die<br />
For<strong>der</strong>ungen nach einer Reform immer<br />
lauter.<br />
2.2 Die Kirchenreform in Frankreich<br />
Plan von Cluny III.<br />
Der Papst sendet Legaten nach Frankreich, die dafür sorgen sollen, dass die Reform<br />
<strong>der</strong> Kirche angekurbelt wird. Der spätere Ebf. von Lyon, Hugo von Die hat sich in dieser<br />
Sache beson<strong>der</strong>s hervorgetan. Er setzt Simonisten und Äbte ab, bis ihm Gregors<br />
Nachfolger die Macht entzieht.<br />
Philipp ist von dieser Kirchenreform beson<strong>der</strong>s betroffen, weil ja beson<strong>der</strong>s die<br />
Bischofsinvestitur – eines seine bisherigen Vorrechte – ihm genommen werden soll. Und<br />
auch seine Auffassung von <strong>der</strong> Eheschließung ist <strong>der</strong> Kirche absolut nicht recht. Lebt er
31<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
doch getrennt von seiner Frau. Dann entführt er die Frau eines Grafen von Anjou, die er<br />
– obwohl beide noch verheiratet – tags darauf heiratet. Obwohl exkommuniziert, konnte<br />
er in seiner Krondomäne „seelenruhig“ – im wahrsten Sinn des Wortes – weiterleben, hat<br />
sich später auch wie<strong>der</strong> mit dem Papst vertragen und die Frage <strong>der</strong> Investitur wurde<br />
auch geklärt.<br />
Philipp I. († 1108) war <strong>der</strong> älteste Sohn Heinrich I. von Frankreich und dessen dritter<br />
Gemahlin Anna von Kiew. Nach dessen Tod am 4. August 1060 wurde er bereits als Kind gekrönt.<br />
In erster Ehe heiratete er 1071 Bertha von Holland (†1094), mit <strong>der</strong> er fünf Kin<strong>der</strong> hatte.<br />
1092 verliebte sich Philipp in Bertrada von Montfort, Ehefrau des Grafen Fulko IV. von Anjou.<br />
Er verstieß seine erste Frau, angeblich, weil sie zu dick geworden war, ließ aber etwa zeitgleich<br />
Bertrada entführen und heiratete sie tags darauf, am Pfingstsonntag, den 15. Mai 1092, obwohl<br />
beide noch verheiratet waren.<br />
Das war ein politisch sinnloses Unternehmen mit verheerenden Folgen, da Papst Urban II. den<br />
König 1095 auf <strong>der</strong> Synode von Clermont exkommunizierte. Das Paar bekam vier Kin<strong>der</strong>, die im<br />
Jahr 1104, dem gleichen Jahr, als Philipp Bertrada ebenfalls verstieß, als ehelich anerkannt<br />
wurden.<br />
2.3 Vom Land zur Stadt – Die Verän<strong>der</strong>ung in <strong>der</strong> Siedlungslandschaft<br />
Die vielen Landschenkungen an die Kirche (she. Seite 31) können als Indiz für<br />
Zuwächse bei landwirtschaftlichen Erträgen dienen. Denn die Stifter mussten trotz dieser<br />
Schenkungen nicht verhungern. Auch waren die wirtschaftlichen Impulse, die von Cluny<br />
ausgingen, enorm. Der Riesenbau <strong>der</strong> Kathedrale gab vielen Menschen Arbeit und es<br />
wurden z.B. viele neue Steinmetze ausgebildet. Menschen, die vorher meist Bauern<br />
waren. Und Kirchenneubauten gab es reichlich; ein Beispiel ist <strong>der</strong> Speyrer Kaiserdom,<br />
dessen Grundstein um 1030 von Konrad II. gelegt wurde. Arbeit gab es also reichlich und<br />
von dieser wirtschaftlichen Entwicklung war auch das Münzwesen betroffen.<br />
Die beim Kirchenbau gewonnenen Erkenntnisse werden jetzt auch beim Städtebau<br />
genutzt. Zunächst entstehen sog. „burgi“, befestigte Siedlungen, keine Burgen; oft als<br />
Anlagerungen an bestehende Siedlungen, beson<strong>der</strong>s in Nordfrankreich. Häufig sind auch<br />
Klöster o<strong>der</strong> alte römische „Civitas“ (Siedlungen) solche Anlagerungspunkte. Die<br />
Bewohner dieser „burgi“ sind die „burgenses“, aus diesem Wort entwickelt sich das Wort<br />
„bourgeois“. Die Entwicklung vom Land – zur Burg – zur Stadt entwickelt immer mehr<br />
eine Eigendynamik. Wobei sich auch <strong>der</strong> Abgabenrythmus verän<strong>der</strong>t. Orientierten sich<br />
diese Daten bisher – örtlich unterschiedlich - an den Namenstagen von Heiligen, werden<br />
sie jetzt überregional festgelegt. Dabei bildet sich <strong>der</strong> Termin <strong>der</strong> Messe von Blois bald<br />
als neuer Abgabentermin heraus.<br />
In Flan<strong>der</strong>n entstehen beson<strong>der</strong>s viele neue Städte und hier entwickelt sich auch eine<br />
Tuchproduktion, <strong>der</strong>en Ruf wegen <strong>der</strong> sehr guten Qualität und <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>en Farben<br />
ausgezeichnet ist. So sind flandrische Tuche schon um 1100 im russischen Nowgorod<br />
bezeugt. Es tauchen erstmals italienische Kaufleute in Flan<strong>der</strong>n auf und die<br />
Handelsbeziehungen zwischen diesen Län<strong>der</strong>n verflechten sich zusehends.<br />
3.2.3 Deutschland<br />
1. In Deutschland sind die strukturellen<br />
Bedingungen ähnlich wie in Frankreich;<br />
die politischen Bedingungen sind es nicht.<br />
So kann man das Kloster Hirsau in etwa<br />
mit Cluny vergleichen, obwohl seine<br />
wirtschaftliche und religiöse Dynamik<br />
nicht ganz so groß ist.<br />
Kloster Hirsau<br />
(Bildquelle:www.badenpage.de)
32<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die Kirchenreform nimmt in Deutschland einen an<strong>der</strong>en Verlauf, als in Frankreich. In<br />
Deutschland sind kirchliche Fragen von ungleich größerer Bedeutung. Der Salier<br />
Heinrich III. († 1056) befindet sich als unangefochtener Herrscher auf dem Gipfel<br />
seiner Macht. In Fragen <strong>der</strong> Kirche war im Wesentlichen alles in Ordnung, obwohl auch in<br />
Deutschland die Kirchenreform schon begonnen hat. Der daraus folgende Umschwung<br />
hat mehrere Ursachen und das Wort Investiturstreit bezieht sich nur auf ein Phänomen<br />
dieses Prozesses und vereinfacht dessen Darstellung.<br />
2. Das römisch–deutsche Reich während <strong>der</strong> Min<strong>der</strong>jährigkeit Heinrich IV.<br />
Heinrich IV. (1050-1106), <strong>der</strong> Sohn Heinrich III., wird nach dem Willen des Vaters<br />
im November 1053 in Trebur zum König gewählt, am 17.7. 1054 gekrönt und 1055 mit<br />
Bertha von Turin verlobt. Diese frühe Krönung sollte Zweifel über die Nachfolge gar<br />
nicht erst aufkommen lassen, denn Zweifel bedeuten Instabilität. Die Herzöge stimmen<br />
<strong>der</strong> Krönung des Kindes aber nur unter <strong>der</strong> Bedingung zu, dass sich Heinrich IV. später<br />
„als ein gerechter König“ erweist. Integrative Kraft und eine starke Persönlichkeit sind für<br />
einen Herrscher einfach nötig, um anerkannt zu werden. Zeigt er hier Schwäche, hat er<br />
schon verloren und seine Herrschaft ist bedroht.<br />
Und ist bei Heinrich III. noch alles in Ordnung, bricht unter Heinrich IV. diese Ordnung<br />
weg. Wegen seiner Min<strong>der</strong>jährigkeit führte seine Mutter, Kaiserin Agnes von Poiton, die<br />
Regierungsgeschäfte, erweist sich aber als dieser Aufgabe nicht gewachsen. Eine<br />
Verschwörung <strong>der</strong> Fürsten sann deshalb auf ihre Entfernung. An ihre Spitze trat Anno<br />
II., Erzbischof von Köln. Er brachte im April 1062 durch einen Überfall in Kaiserswerth<br />
Heinrich in seine Gewalt und entführte ihn auf einem Schiff. Heinrich will sich durch<br />
einen Sprung in den Rhein retten, wird aber wie<strong>der</strong> gefangen genommen.<br />
Anno entriss <strong>der</strong> Kaiserin-Witwe das Reichsregiment und wurde <strong>der</strong> alleinige<br />
Reichsverweser. Schon 1063 musste Anno II. die Erziehung Heinrichs und die<br />
Reichsverwaltung mit Adalbert I., Erzbischof von Hamburg-Bremen teilen, <strong>der</strong> auf den<br />
jungen König starken Einfluss gewann und Anno II. immer mehr zurückdrängte, zumal<br />
nach <strong>der</strong> am 29.3. 1065 in Worms erfolgten Mündigkeitserklärung Heinrichs.<br />
3. Die ersten Jahre Heinrich IV.<br />
Mit 15 Jahren wird Heinrich also für volljährig erklärt. Eine Reise nach Rom zur<br />
Kaiserkrönung muss zweimal verschoben werden. Inzwischen fallen slawische Verbände<br />
in Sachsen ein; <strong>der</strong> König steht dieser Situation hilflos gegenüber. Seine Entscheidung,<br />
hier einzugreifen, um Sachsen seinem Herrschaftsgebiet zu erhalten, erweist sich als<br />
fatal, denn hier ist ottonisches Stammland und Reichsgut.<br />
Heinrichs Engagement in Sachsen ist insofern zu verstehen, als es im Gebiet des<br />
Harzes schon im 10. Jahrhun<strong>der</strong>t zu einem wirtschaftlichen Aufschwung durch<br />
Silberfunde im Rammelsberg bei Goslar<br />
gekommen ist. Sein Vater hatte in Goslar<br />
zwischen 1040 – 50 eine Pfalz errichtet.<br />
Heinrich IV. legt zur Sicherung seiner<br />
territorialen Machtgrundlage im Gebiet des<br />
Harzes Burgen an. 1073 kam es deswegen<br />
zum Aufstand des sächsischen Adels. Mit<br />
Hilfe <strong>der</strong> süddeutschen Fürsten erfocht<br />
Heinrich am 13.6. 1075 bei Homburg /<br />
Unstrut den entscheidenden Sieg und damit<br />
die bedingungslose Unterwerfung <strong>der</strong><br />
Sachsen. Aber es bleiben Risse im Gefüge<br />
seiner Macht.<br />
Goslar / Kaiserpfalz<br />
(Bildquelle: Eigene Bil<strong>der</strong>)
33<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Auch hat er wohl nicht die geeigneten Berater. Er stützt sich auf die neue, aufstreben -<br />
de Schicht <strong>der</strong> Ministerialen. Das sind ehemalige Unfreie, meist Ritter, die sich als<br />
Fachleute auf bestimmten Gebieten einen Namen gemacht haben. Dass Heinrich <strong>der</strong>en<br />
Rat vorzieht, schürt das Misstrauen unter den Fürsten und dem gesamten Hochadel.<br />
Was auch erschüttert, ist Heinrichs Geständnis auf einer Synode in Mainz im Jahre<br />
1069, dass seine Ehe mit Berta von Turin bis dato nicht vollzogen wurde. Was Berta<br />
bestätigt. Eine Scheidung wird aber von dem aus Rom herbei geeilten Legaten Petrus<br />
Damiani strikt abgelehnt. Und das war gut so, denn „später funkte es doch noch<br />
zwischen den beiden“ (<strong>Behrmann</strong>).<br />
Heinrichs frühe Herrscherjahre standen also unter keinem guten Stern. In Deutschland<br />
konnte er keine Akzeptanz finden und aus dem Schatten seines übermächtigen Vaters<br />
konnte er auch nicht heraustreten.<br />
4. Die Anfänge des Investiturstreits<br />
Kaiser und Papst streiten sich um die Einsetzung (Investitur) <strong>der</strong> Bischöfe. Dies ist<br />
eine sehr vereinfachte Darstellung des Problems, hat <strong>der</strong> Streit doch viele Dimensionen.<br />
Es geht grundsätzlich um die Freiheit <strong>der</strong> Kirche von jedem weltlichen Einfluss, um den<br />
Zölibat und „vita apostolica“ – kirchengerechtes Leben. Nirgendwo wird dieser Streit so<br />
heftig ausgetragen, wie in Deutschland. Hier trifft das Herrschertum voll auf die Reform<br />
des Papsttums.<br />
1053 wird Papst Gregor VII. gewählt und dessen erklärtes Ziel ist diese Reform des<br />
Papsttums. Er hat unter dem Namen Hildebrand schon einige Vorgängerpäpste erlebt.<br />
Und zunächst ist auch noch alles in Ordnung, aber später bauen sich Spannungen im<br />
Verhältnis zwischen Heinrich und Gregor auf. Es geht um die Investitur des Bischofs von<br />
Mailand. Als <strong>der</strong> Erzbischof Wido von Mailand 1071 abdankte und 1073 starb, brach ein<br />
heftiger Streit um die Wie<strong>der</strong>besetzung des erzbischöflichen Stuhles aus. Heinrich<br />
ernannte den Grafen Gottfried von Castiglione zum Nachfolger Widos. Nach <strong>der</strong><br />
Nie<strong>der</strong>werfung des sächsischen Aufstandes mischte sich H. erneut in die Mailän<strong>der</strong><br />
Angelegenheit ein: er besetzte den Erzstuhl von Mailand und die Bistümer Spoleto und<br />
Fermo.<br />
Im Dezember 1075 drohte Gregor VII. mit Bann und Absetzung. Heinrich berief 1076<br />
eine Versammlung nach Worms ein, die von 26 Bischöfen besucht wurde. Sie sagten<br />
Gregor VII. den Gehorsam ab, weil er unrechtmäßig die Papstwürde erhalten habe.<br />
Heinrich setzte Gregor VII. ab. Auf <strong>der</strong> römischen Fastensynode vom 1076 erwi<strong>der</strong>te <strong>der</strong><br />
Papst mit Exkommunikation und Absetzung des deutschen Königs und <strong>der</strong> deutschen und<br />
oberitalienischen Bischöfe, die an <strong>der</strong> vorjährigen Versammlung in Worms teilgenommen<br />
hatten und löste die Untertanen vom Treueid.<br />
Es war die erste Absetzung eines deutschen Königs durch den Papst. Auf einer<br />
Fürstenversammlung in Tribur im Oktober 1076, an <strong>der</strong> auch päpstliche Legaten<br />
teilnahmen, musste Heinrich versprechen, dem Papst gehorsam zu sein und Genugtuung<br />
zu leisten; falls <strong>der</strong> König bis zum Jahrestag seines Bannes nicht von ihm gelöst werde,<br />
ginge er <strong>der</strong> Krone verlustig.<br />
Ende 1076 begibt er sich im kalten Winter auf eine Alpenüberquerung und erreicht<br />
am 25. Januar 1077 die Burg <strong>der</strong> Mathilde von Canossa. Vor <strong>der</strong>en Burg er 3 Tage<br />
barfuss und im Büßergewand ausharrt, bis ihn Gregor empfängt und vom Bann löst. Da<br />
Heinrich als Büßer gekommen ist, muss <strong>der</strong> Papst den Bann lösen. Bein anschließenden<br />
gemeinsamen Essen soll Heinrich grimmig verschlossen gewesen sein und mit den<br />
Fingernägeln auf dem Tisch gekratzt haben. Gegessen habe er nicht – so ein<br />
Augenzeuge.<br />
Die Probleme in Deutschland sind mit dieser Aufhebung des päpstlichen Banns aber<br />
noch nicht beendet. Kirchlich schon, aber politisch noch nicht, denn trotz <strong>der</strong> Lösung<br />
Heinrichs vom Bann wurde am 15.3. 1077 von den Fürsten Rudolf von Schwaben<br />
(1077-80) zum Gegenkönig gewählt. Im Oktober 1080 kommt es zwischen Heinrich und<br />
Rudolf zu einem Gefecht in Hohenmölsen, in dem Rudolf getötet wird. Heinrichs Macht<br />
wächst zwar, aber von einer stabilen Machtbasis ist er noch weit entfernt.
34<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Den Text <strong>der</strong> Vorlesung vom 9.12. hat mir dankenswerterweise Herr Duibjohann<br />
zu Verfügung gestellt (Seite 34 - 37).<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jh.<br />
<strong>Th</strong>. <strong>Behrmann</strong><br />
Stichworte 09.12.2005<br />
3. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des Investiturstreites<br />
3.3 England<br />
Vorab:<br />
Für diese Zeit gibt es mit dem Teppich von Bayeux ein einzigartiges Zeitzeugnis.<br />
Die Kirchenreform greift auch nach England über, aber eine Auseinan<strong>der</strong>setzung wie <strong>der</strong><br />
Investiturstreit zwischen Papst und deutschem König ist in England kein <strong>Th</strong>ema.<br />
Nach <strong>der</strong> Eroberung Englands durch die Normannen Mitte des 11. Jh. findet ein<br />
grundlegen<strong>der</strong> Umbruch in <strong>der</strong> Gesellschaft statt, dessen Auswirkungen bis in unsere Zeit<br />
reichen.<br />
Die Herrschaft wird völlig neu geordnet; normannische Adelige rücken in die<br />
Herrschaftspositionen <strong>der</strong> Angelsachsen ein; <strong>der</strong> König genießt eine unantastbare<br />
Autorität; dazu gehört auch, dass ihm niemand das Recht streitig macht, Bischöfe und<br />
Äbte einzusetzen.<br />
Der König von England ist in dieser Zeit <strong>der</strong> mächtigste Herrscher in Europa.<br />
Vor <strong>der</strong> Eroberung Englands sind die Angelsachsen unter Edward dem Bekenner<br />
(1003 – 1066) die unangefochtenen Herrscher des Landes; als er 1066 kin<strong>der</strong>los stirbt,<br />
ist die Situation <strong>der</strong> Nachfolge völlig offen; drei Interessengruppen lassen sich aber<br />
festmachen<br />
• Die Angelsächsische Gruppe unter Harald Godwinson (1020 – 1066), einem Vetter<br />
Edwards<br />
• Die Anglo-Normannische Gruppe, zu <strong>der</strong> auch Wilhelm, Herzog <strong>der</strong> Normandie,<br />
gehört; er ist über die Mutter Edward, Emma, mit Edward verwandt<br />
• Die nordische Gruppe unter dem Norweger Harald Hardrada.<br />
3.3.1 Wilhelm <strong>der</strong> Eroberer (ca. 1028 – 1087 ) als Herzog <strong>der</strong> Normandie.<br />
Zur Zeit Wilhelms erlebt auch die Normandie einen wirtschaftlichen Aufschwung; die<br />
Städte Rouen und Bayeux, beides römische Gründungen, entwickeln sich zu<br />
wirtschaftlichen Zentren. Auch die Neugründung Caens, von Wilhelm geför<strong>der</strong>t, fällt in<br />
diese Zeit.<br />
Die Herzöge <strong>der</strong> Normandie sind zwar stark und weithin unabhängig, auch vom König<br />
von Frankreich, gleichwohl ist ihre Herrschaft ständig bedroht. Sie müssen sich gegen<br />
die Großen innerhalb ihres Herrschaftsgebietes und gegen Gegner von außen behaupten.<br />
Nach dem Tod von Wilhelms Vater – Wilhelm ist zu diesem Zeitpunkt ca. 8 Jahre alt -<br />
versuchen einige Große die Herrschaft an sich zu reißen, es gibt zahlreiche<br />
Nachfolgekämpfe. In all diesen Auseinan<strong>der</strong>setzungen bleibt Wilhelm mit seinem Anhang<br />
siegreich, er besiegt auch den König von Frankreich.<br />
Wilhelm ist so seit frühester Jugend in Kämpfen erprobt und erfahren, gewinnt<br />
dadurch im Laufe <strong>der</strong> Jahre eine enorm starke Stellung im Land und bei seinen
35<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Anhängern. Nachdem sich die Lage um 1060 im Inneren endgültig zu seinen Gunsten<br />
geklärt hat, betreibt er die Erweiterung seines Herrschaftsgebietes nach Westen und<br />
Süden. Wilhelm hat auch Ambitionen in Richtung England. Er kennt Edward seit früher<br />
Jugend, nachdem dieser in seiner Kindheit eine lange Zeit im französischen Exil verbracht<br />
hat (she. Seite 20). Nach normannischen Quellen soll es aus dieser Zeit ein Versprechen<br />
Edwards aus dem Jahr 1051 an Wilhelm zur <strong>Th</strong>ronfolge in England geben, gesichert ist<br />
dies allerdings nicht.<br />
Im Jahr 1064 unternimmt Harold Godwinson eine Reise nach Nordfrankreich, wird nach<br />
<strong>der</strong> Landung von einem französischen Großen gefangen genommen und an Wilhelm<br />
übergeben. Dieser behandelt ihn freundlich, nimmt ihn mit auf die Jagd und zu einem<br />
Kriegszug in die Bretagne.<br />
Auf dem Teppich ist eine Eidesleistung Harolds (Bild unten) gegenüber Wilhelm<br />
überliefert, <strong>der</strong> Inhalt ist bis heute nicht bekannt; Vermutungen sprechen von einem<br />
möglichen Lehnseid, an<strong>der</strong>e von einer Eidesleistung unter Zwang.<br />
HI(EC) WILLELM DEDIT HAROLDO ARMA - HIC WILLELM VENIT BAGIAS - UBI HAROLD<br />
SACRAMENTUM FECIT WILLELMO DUCI<br />
Hier gab Wilhelm Harold Waffen - Hier kam Wilhelm nach Bayeux, - wo Harold Wilhelm einen Eid leistete<br />
Auf jeden Fall sind beim Tod Edward im Jahr 1066 beide von ihrem jeweiligen<br />
Anspruch auf den <strong>Th</strong>ron Englands überzeugt.<br />
3.3.2 Die normannische Eroberung Englands<br />
Im Herbst 1065 schwächelt Edward, nimmt Weihnachten nicht mehr an <strong>der</strong> feierlichen<br />
Messe in Westminster teil; Edward stirbt am 5.1.1066, wird am nächsten Tag beerdigt,<br />
und am gleichen Tag lässt sich Harold zum König krönen.<br />
Harold ist nach seiner Erhebung in England unangefochten; ein Indiz dafür: während<br />
seiner neunmonatigen Regierungszeit wurden in 45 Münzstätten Münzen mit den Zeichen<br />
seiner Herrschaft geschlagen.<br />
Nach dieser schnellen Erhebung wird in Norwegen und in <strong>der</strong> Normandie mit<br />
Kriegsvorbereitungen begonnen.<br />
England dagegen beginnt mit <strong>der</strong> Verstärkung <strong>der</strong> Verteidigungsanlagen; das Heer<br />
wird aufgefüllt, es besteht aus Berufskriegern und kleinen Adligen, die gegenüber dem<br />
König waffenpflichtig sind. Ihr Defizit: sie sind den Kampf zu Pferde nicht gewohnt, sie<br />
nutzen die Pferde überwiegend als Transportmittel.<br />
Die Normannen sind seit zwanzig Jahren durch die internen Auseinan<strong>der</strong>setzungen im<br />
Kampf erfahren; sie stellen überwiegend berittene Kämpfer; das Heer wird durch die<br />
Überschüsse aus <strong>der</strong> Landwirtschaft ernährt und finanziert.<br />
Im normannischen Heer sind Krieger aus vielen Regionen vertreten; <strong>der</strong> gute Ruf<br />
Wilhelms zieht sie an; sie kommen u.a. aus Flan<strong>der</strong>n, dem Süden Frankreichs und sogar<br />
Normannen aus Sizilien finden sich in seinem Heer. In <strong>der</strong> Mehrzahl besteht die Truppe<br />
aber aus normannischen Kriegern.
36<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Wilhelm lässt Schiffe bauen und neben den direkten Kriegsvorbereitungen betreibt er<br />
noch Diplomatie; so sucht er Unterstützung in Rom, verweist dort auf den von Harold<br />
angeblich gebrochenen Lehnseid; auch seine Unterstützung <strong>der</strong> Reformbewegung <strong>der</strong><br />
Kirche wirkt zu seinen Gunsten.<br />
In England gibt es Ereignisse, die als schlechte Zeichen<br />
gedeutet werden. So erscheint am 24.04.1066 <strong>der</strong> Halleysche<br />
Komet am Himmel (er taucht nach heutigem Wissensstand alle<br />
rd. 600 am Himmel auf / Bild links), dies wird als Zeichen<br />
bevorstehenden Unheils gedeutet.<br />
Im Sommer 1066 liegen sich bei<strong>der</strong>seits des Kanals die<br />
englischen und die normannischen Truppen gegenüber; dabei<br />
wird die Versorgung <strong>der</strong> englischen Truppen zunehmend<br />
problematischer; Harold kann sein Heer nicht mehr ernähren<br />
und am 08.09.1066 bricht die Verteidigung zusammen, er muss<br />
Leute nach Hause schicken.<br />
Diese Probleme gibt es in <strong>der</strong> Normandie nicht, es gibt auch keine Plün<strong>der</strong>ungen durch<br />
das Heer. Gleichwohl kann Wilhelm die für ihn günstige Lage nicht nutzen, da <strong>der</strong><br />
Nordwind ihn daran hin<strong>der</strong>t, mit seinen Truppen den Kanal zu überqueren.<br />
Dieser Wind nutzt aber dem Norweger, Harald Hardrada landet mit seinen Leuten in<br />
Mittelengland und schlägt die an <strong>der</strong> Küste aufgebotenen Verteidiger.<br />
Daraufhin zieht Harold innerhalb von fünf Tagen von <strong>der</strong> Südküste nach Norden, nach<br />
York und in <strong>der</strong> Schlacht besiegt er den Norweger vernichtend, er gewährt seinen Leuten<br />
zwei Tage Pause nach dem Kampf.<br />
Während dieser Ereignisse hat sich <strong>der</strong> Nordwind gedreht, er weht jetzt für die<br />
Normannen günstig. Am 27.9.1066 bricht Wilhelm mit seinem Heer von St. Valery sur<br />
Somme nach England auf und landet am 28.9.1066 an <strong>der</strong> Südküste in <strong>der</strong> Nähe von<br />
Hastings.<br />
Harold kommt mit seinem Heer zurück nach Süden, erscheint am 7.10.1066 bei<br />
Hastings. Die Heere mit jeweils rd.<br />
siebentausend Kriegern liegen sich<br />
gegenüber; Harolds Truppen sind<br />
aufgrund <strong>der</strong> vorherigen Ereignisse<br />
geschwächt, er will dies mit einem<br />
schnellen Angriff ausgleichen.<br />
Das gelingt nicht, die Normannen<br />
greifen überraschend an, die<br />
Angelsachsen verteidigen sich zu -<br />
nächst erfolgreich auf einer Anhöhe. Am<br />
Ende siegen die Normannen, Harold<br />
findet in <strong>der</strong> Schlacht den Tod, damit ist<br />
<strong>der</strong> Kampf beendet.<br />
Die Normannen ziehen durch den<br />
Süden Englands, finden kaum noch<br />
Wi<strong>der</strong>stand und nehmen im Dezember<br />
1066 London ein. Weihnachten 1066<br />
wird Wilhelm in Westminster Abbey<br />
zum König gekrönt. Er ergreift sofort<br />
Verteidigungsmaßnahmen, lässt schnell Die Invasion Englands 1066<br />
eine Festung bauen - (Bildquelle: www.eyewitnesstohistory.com)<br />
die Anfänge des Tower.
3.3.3 Die normannische Herrschaft in England<br />
37<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Nach <strong>der</strong> Eroberung <strong>der</strong> Normandie durch die Normannen dauerte es zwei bis drei<br />
Generationen, bis sich die Eroberer mit den alten Einwohnern vermischt hatten und <strong>der</strong>en<br />
alte Kultur und Sprache langsam verschwand.<br />
In England gab es keine dauerhafte Verbindung <strong>der</strong> Normannen mit den Angelsachsen,<br />
keine Assimilation. Die Normannen prägen auf Jahrhun<strong>der</strong>te Englands Kultur und<br />
Sprache, die bis in das HMA französisch ist.<br />
Sie haben das gesamte Herrschaftssystem umgestaltet und Schlüsselpositionen im<br />
Lande ausschließlich mit normannischen Gefolgsleuten besetzt. Lediglich im Norden<br />
Englands kam es vereinzelt zum Wi<strong>der</strong>stand gegen die Eroberer; dieser Wi<strong>der</strong>stand in<br />
York wurde von Wilhelm 1069/70 grausam nie<strong>der</strong>geschlagen.<br />
Die angelsächsische Führungsschicht wird nahezu vollständig ausgetauscht,<br />
normannische Gefolgsleute Wilhelms übernehmen ihre Positionen (dies wurde – leicht<br />
makaber – durch den Tod vieler Adeliger in <strong>der</strong> Schlacht bei Hastings erleichtert).<br />
Im Jahr 1086 sind rd. 80% des Landes in <strong>der</strong> Hand von Normannen, die restlichen<br />
20% hielten noch Angelsachsen. Von dem normannischen Anteil besaß <strong>der</strong> König 20%,<br />
die Kirche 25%, den restlichen Teil hielten normannische Adelige, die 1066 mit Wilhelm<br />
nach England gekommen waren und ihm bereits in den Jahren 1040 bis 1060 in den<br />
internen Kämpfen unterstützt hatten.<br />
Doch auch für diese Län<strong>der</strong>eien war Wilhelm ihr Lehnsherr und auch aus dieser<br />
wirtschaftlichen Grundlage erwuchs ihm eine enorme Machtfülle.<br />
Exkurs: Grundlage für die relativ genauen Aussagen über den Landbesitz bildet das<br />
„Domesday Book“; im Auftrag Wilhelms wurden im Jahr 1086 sämtliche Besitztümer<br />
Englands erfasst, alle Län<strong>der</strong>eien und sonstigen Einkünfte dokumentiert. Dies Buch ist bis<br />
heute erhalten.<br />
Hinzu kam, dass die Normannen von den Englän<strong>der</strong>n eine gut funktionierende<br />
Verwaltung und ein ebenso gutes Steuersystem übernehmen konnten; dies stellte neben<br />
den Län<strong>der</strong>eien eine solide finanzielle Basis für die Herrschaft dar.<br />
3.3.4 Der Teppich von Bayeux<br />
Dieser Teppich ist eine Quelle über das Geschehen<br />
vor und während <strong>der</strong> Eroberung Englands, stellt<br />
darüber hinaus eine Quelle für das Alltagsleben in<br />
dieser Zeit dar.<br />
Er ist 73 m lang, 0,50 m breit.<br />
Es gibt keine Quelle, in <strong>der</strong> man Aussagen finden<br />
könnte, warum <strong>der</strong> Teppich angefertigt worden ist,<br />
wer ihn an welchem Ort anschauen sollte. Es gibt<br />
keine Auskunft darüber, wo <strong>der</strong> Teppich in den<br />
ersten Jahren seiner Existenz aufbewahrt wurde. Er<br />
taucht erstmals Anfang des 15. Jh. im Inventar <strong>der</strong> Der Tod König Edwards am 5.12.1065<br />
Kathedrale von Bayeux auf. Auch ein Auftraggeber (Motiv vom Teppich von Bayeux)<br />
für den Teppich ist nicht bekannt. Vermutungen sprechen von Bischof Odo, da er auf<br />
dem Teppich viermal abgebildet worden ist.<br />
Sicher ist nur, dass <strong>der</strong> Teppich in England gefertigt wurde; dafür sprechen die Schrift<br />
und die Bezeichnung <strong>der</strong> Normannen als „franki“; sie selbst haben sich immer als<br />
„normanni“ bezeichnet, „franki“ waren für sie die Menschen im Kernland, in <strong>der</strong><br />
Krondomäne.
38<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Angefertigt wurde er vermutlich von Nonnen im Kloster Canterbury, wenige Jahre<br />
nach <strong>der</strong> Schlacht von 1066.<br />
Der Teppich erzählt die Geschichte <strong>der</strong> Eroberung Englands, aber nicht ausschließlich<br />
aus normannischer Sicht; so handeln rund 50% <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> von Harolds Aufenthalt in<br />
Frankreich, <strong>der</strong> Rest sind Szenen <strong>der</strong> Schlacht bei Hastings. Und, so ist gezählt worden –<br />
von 626 abgebildeten Personen sind lediglich drei Frauen!<br />
Vorlesung vom 16.12.2005<br />
3. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des Investiturstreites<br />
In einem kurzen Rückblick auf die letzte Vorlesung stellt <strong>Behrmann</strong> noch einmal fest,<br />
dass <strong>der</strong> englische Adel bis in die heutige Zeit normannischen Ursprungs ist. Und noch<br />
etwas bestätigt <strong>der</strong> Verlauf <strong>der</strong> englischen Geschichte, dass nämlich auch hier die<br />
Eroberung Englands, wie in ganz Europa, vom Süden (also vom Kontinent her) zum<br />
Norden erfolgte.<br />
3.4 Nord- und Osteuropa<br />
Für den Verlauf <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> nordeuropäischen Län<strong>der</strong> (Dänemark, Norwegen<br />
und Schweden) ist die Tatsache wichtig, das <strong>der</strong> christliche Glaube im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
hier Fuß fassen konnte. Bis weit in das 11. Jahrhun<strong>der</strong>t wurden die Dänen als Wikinger –<br />
und damit als Heiden - bezeichnet, welche in ganz Europa zwar Kolonien gründeten und<br />
Handel trieben, aber auch ganze Län<strong>der</strong> und Landstriche plün<strong>der</strong>ten und Kriege führten.<br />
Aber unter König Knut dem Großen († 1035) wurde das Land (und später auch<br />
Norwegen) christianisiert. Knut unternimmt sogar eine Pilgerreise nach Rom, wo er 1027<br />
an <strong>der</strong> Kaiserkrönung für Konrad II. teilnimmt.<br />
Neben <strong>der</strong> Christianisierung verdient die kulturelle Entwicklung Aufmerksamkeit; dabei<br />
sind das entstehende Münzwesen und eine beginnende Steinbauweise zu nennen. Auch<br />
eine Schriftlichkeit entsteht, Chroniken werden geschrieben und so kommt für uns „Licht<br />
in diese Zeit im Norden Europas“ (<strong>Behrmann</strong>). Als Beispiel nennt <strong>Behrmann</strong> die Stadt<br />
Haitabu – aber dazu später mehr.<br />
Warum wusste man auf dem Kontinent so wenig über die nordischen Län<strong>der</strong>? Zwei<br />
Gründe nennt <strong>Behrmann</strong>:<br />
• Es gab mit Flüssen und Meeren (Nord- und Ostsee) geographische, daneben aber<br />
• auch kulturelle Grenzen (eine an<strong>der</strong>e religiöse Entwicklung und eine geringe<br />
Bevölkerungsdichte<br />
machte die Gegend<br />
uninteressant).<br />
Trotzdem hat es zu allen<br />
Zeiten Kontakte gegeben und es<br />
wurde Handel betrieben, denn<br />
Flüsse waren die bevorzugten<br />
Handelswege dieser Zeit und<br />
über die Ostsee kamen sogar<br />
Orientwaren nach Europa. Ein<br />
gesuchtes Handelsgut waren<br />
Walrosszähne aus Murmansk, die<br />
man zu Schmuckstücken<br />
verarbeitete. Gotland war die<br />
zentrale Austauschstation für<br />
solche Waren; ansonsten gab es<br />
Die Handelsrouten <strong>der</strong> Wikinger reichten von nur wenige Anlaufplätze.<br />
Island bis weit nach Asien
39<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Gotland entwickelte sich im 10. und 11. Jahrhun<strong>der</strong>t zu einer beispiellosen Drehscheibe<br />
für den Ostseehandel, wie reiche Ausgrabungsfunde beweisen. Münzen wurden aus<br />
Sicherheitsgründen oft vergraben und das Erdreich mutierte so zur Spardose! Dennoch<br />
gab es im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t in Gotland noch keine richtige Stadtentwicklung. Die Händler<br />
waren gleichzeitig Bauern und umgekehrt.<br />
Die Handelswege waren also - geographisch gesehen – sehr ausgedehnt und<br />
weitläufig. Das Handelsvolumen war dagegen eher gering, gab es doch für Luxuswaren<br />
keine Käuferschicht in Mitteleuropa. Nur eine kleine Oberschicht konnte sich teure<br />
Luxusartikel leisten.<br />
Später unternahmen auch Wikinger solche Handelsfahrten. Und neben Pelzen,<br />
Bernstein, Eisenerz, Honig und Wachs – absolute Luxuswaren damals – waren slawische<br />
Sklaven ein bevorzugtes „Handelsgut“. Später auch Fisch als Massenware.<br />
In Sachen Stadtentwicklung nahm Haitabu einen beson<strong>der</strong>en Verlauf, hatte es doch<br />
schon um das Jahr 1000 einen stadtähnlichen Charakter. Haitabu lag an <strong>der</strong><br />
Schleimündung, südlich <strong>der</strong> heutigen Stadt Schleswig. Es verdankt seine Entstehung <strong>der</strong><br />
geographischen Lage, denn vom Ende <strong>der</strong> Schleimündung konnten Waren über Land zur<br />
Nordsee gebracht – teils über Flüsse, teils über Land – und so <strong>der</strong> weite Seeweg um<br />
Jütland herum gespart werden. Und so lebten die rund 1000 Einwohner Haitabus vom<br />
Handel; was eine Ausnahme bedeutete, denn die Bevölkerung lebte ansonsten von<br />
bäuerlichem Broterwerb.<br />
Und nach einer Blütezeit im 9. und 10. Jahrhun<strong>der</strong>t beginnt für Haitabu im 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>der</strong> langsame Untergang. Gibt es auch keine geschriebene Geschichte des<br />
Ortes, konnte er doch durch archäologische Ausgrabungen genau lokalisiert und erforscht<br />
werden.<br />
Die Bil<strong>der</strong> zeigen links den SKARTHI-Stein (Runenstein)<br />
Inschrift:<br />
"König Sven setzte diesen Stein für Skarthe, seinen<br />
Gefolgsmann, <strong>der</strong> nach Westen fuhr, aber nun fiel bei Haithabu."<br />
.<br />
In <strong>der</strong> Mitte eine bronzene Kirchenglocke die zeigt, dass auch hier<br />
das Christentum Einzug gehalten hat und rechts ein Kamm aus<br />
Elfenbein o<strong>der</strong> Walrossknochen
40<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Und so könnte Haitabu ausgesehen haben (oben)<br />
(Wikinger Museum Haithabu; Zeichnung Reinhard Kühn Archäologisches Landesmusum CAU)<br />
Auf diesem Luftbild erkennt man den<br />
mächtigen Halbkreiswall, <strong>der</strong> Haitabu<br />
einmal umgeben hat. Das Stadtgebiet<br />
umfasste damals stolze 24 ha<br />
(Münster 6-8 ha). Haitabu gilt als <strong>der</strong><br />
am besten erforschte Ort des<br />
Mittelalters. Es wurde um 1066 zum<br />
letzten Mal erwähnt und dann wohl<br />
von Slawen verwüstet. Aber eine<br />
Versandung des Hafens dürfte auch<br />
für den Nie<strong>der</strong>gang verantwortlich<br />
sein. Haitabus Rolle übernahm dann<br />
die Stadt Schleswig<br />
Dieser Wall umgab Haitabu<br />
Weiter in <strong>der</strong> Geschichte Dänemarks. Das Land war eine Schnittstelle für die<br />
Verbreitung des Christentums. Das südlich gelegene Europa war christianisiert, die<br />
nördlich gelegenen Län<strong>der</strong> waren „Christianisierungsland“. Es kommt zu ersten<br />
Königstaufen und zur Errichtung erster Bischofssitze. Auch hier ist wie<strong>der</strong> Haitabu zu<br />
nennen, das den ersten Bischof in Dänemark überhaupt hatte. Das Gebiet gehörte zum<br />
Erzbistum Hamburg/Bremen – ebenso wie auch Norwegen, wo um das Jahr 1000 in<br />
Bergen ein erster Bischof eingesetzt wurde.<br />
In Dänemark geht die Christianisierung vom Königshaus aus. Der König verspricht<br />
sich von einer christlichen Aura eine Stärkung auch seiner Person und Stellung. Ihr Land<br />
erhalten die Kirchen aus <strong>der</strong> Hand des Königs. Aber – bis um das Jahr 1100 sind noch<br />
beide Glaubensrichtungen nebeneinan<strong>der</strong> bezeugt – Christen und Heiden.<br />
In Island hat sich das Christentum auch schon um 1000 ansatzweise durchgesetzt,<br />
hier sind erste Bischöfe im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t bezeugt. Selbst auf Grönland wurde man<br />
teilweise christlich. Und in Schweden sind erste Bischofssitze auch schon in <strong>der</strong> 2. Hälfte<br />
des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts nachzuweisen, obwohl hier nur wenige Grabungen über bestehende<br />
Ansiedlungen Auskunft geben.<br />
Fazit: die nördlichen Gebiete Europas sind zwar (nur) Randgebiete, es gibt aber eine<br />
große „Sogwirkung“ vom Kontinent hierher. Und wenn man diese Gebiete auch so richtig<br />
erst im 12./13. Jahrhun<strong>der</strong>t „wahrnimmt“, liegen ihre geschichtlichen Anfänge doch in<br />
dieser Zeit.
41<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Wir kommen zu Adam von Bremen († nach 1081). Er wurde 1066/67 Domherr in<br />
Bremen. Um das Jahr 1075 verfasste er sein bekanntestes Geschichtswerk die Gesta<br />
Hammaburgensis ecclesiae pontificum, vier Bücher über die Geschichte des<br />
Erzbistums Hamburg und die Inseln des Nordens. Das Werk berichtet ausführlich über die<br />
Wikingerzeit, die Verhältnisse und Kriege im Ostseeraum sowie Großbritannien,<br />
Dänemark, Norwegen, Schweden und<br />
Norddeutschland. Auch die damals<br />
entferntesten Weltgegenden Island<br />
und Grönland sowie ihre<br />
Christianisierung werden erwähnt.<br />
Zudem berichtet er ausführlich über<br />
die Slawen (Sclavi) in Deutschland.<br />
Berühmt ist das Werk auch<br />
dadurch, dass es das erste schriftliche<br />
Zeugnis über die Entdeckung<br />
Amerikas (Vinlands) durch die<br />
Wikinger darstellt. Dabei wird dieses<br />
Vinland als Insel dargestellt, es ist<br />
aber sicher, dass <strong>der</strong> Ort L’Anse aux<br />
Meadows in Nordamerika gemeint ist.<br />
L’Anse aux Meadows auf Neufundland<br />
L'Anse aux Meadows ist eine Wikingersiedlung auf Neufundland. Sie liegt am nördlichsten<br />
Zipfel <strong>der</strong> Insel. Die Siedlung bestand aus mehreren Häusern sowie einer Schmiede, in <strong>der</strong><br />
Raseneisen verarbeitet wurde, welches die Indianer nicht kannten.<br />
Es handelt sich um die einzige sicher nachgewiesene Wikingersiedlung in Nordamerika. Sie<br />
wurde daher 1978 von <strong>der</strong> UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Zwei Häuser wurden (fast)<br />
originalgetreu nachgebaut und sind heute eine Touristenattraktion.<br />
Vermutlich wurde die Siedlung um das Jahr 1000 n. Chr. angelegt, möglicherweise von Leif<br />
Erikssons Expedition. Es könnte sich um Markland o<strong>der</strong> Vinland handeln.<br />
Die Siedlung war wahrscheinlich nur wenige Jahre bewohnt. Darauf deuten einerseits die Sagas,<br />
die von Kämpfen mit Eingeborenen (ob Indianer o<strong>der</strong> Eskimos, geht aus den Texten nicht hervor)<br />
berichten, an<strong>der</strong>erseits <strong>der</strong> archäologische Befund.<br />
Dänemark ist im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t das am<br />
stärksten besiedelte Land im Norden Europas.<br />
Trotzdem gibt es noch keine größeren Städte,<br />
meist nur kleinere Ansiedlungen. Kopenhagen<br />
(die Kaufmannsstadt!) wird erst in <strong>der</strong> Mitte des<br />
12. Jahrhun<strong>der</strong>ts gegründet.<br />
In Roskilde hat <strong>der</strong> dortige Bischof erstmals<br />
eine Kirche aus Steinen (Bild rechts) erbauen<br />
lassen. 1170 im romanischen Stil begonnen und<br />
seit 1200 im gotischen Stil umgebaut, ist sie <strong>der</strong><br />
letzte Ruheort vieler dänischer Könige und<br />
Königinnen.<br />
An Orten mit Bischofssitzen finden sich, wenn<br />
auch nur in sehr beschränkten Umfang, erste<br />
Münzprägungen. Diese Münzen sind sehr dünn und<br />
weisen nur auf einer Seite eine Prägung auf.<br />
Knut <strong>der</strong> Große (she. Seite 38) unternimmt<br />
den Versuch, das Christentum auch in an<strong>der</strong>e<br />
nördliche und in die baltischen Län<strong>der</strong> zu bringen.<br />
Aber beim Versuch, den „Zehnten“ einzuführen,<br />
wird er erschlagen! Um 1100 wird Knut schon<br />
heilig gesprochen. Die Kirche in Roskilde
Vorlesung vom 13.1.2006<br />
4. Wirtschaft und Gesellschaft<br />
4.1 Ländliche und städtische Welt<br />
Rekonstruktion eines Wikingerschiffes<br />
42<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
An<strong>der</strong>s, als einzelne Ereignisse des Mittelalters, die an bestimmten Daten<br />
„festgemacht“ werden können – Beispiel 1066 die Eroberung Englands durch Wilhelm<br />
o<strong>der</strong> Canossa 1077 – ist dies bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Städte nicht möglich. Denn diese<br />
Entwicklung erstreckt sich über einen langen Zeitraum; hat seine Anfänge aber auch im<br />
11. Jahrhun<strong>der</strong>t. Und sie ist vor allem in ihrer Wirkung wesentlich nachhaltiger, als<br />
einzelne „politische“ Daten bzw. Ereignisse. Selbst die Kreuzzüge haben nicht diese<br />
Nachhaltigkeit<br />
erreicht.<br />
Ausschlaggebend für eine Stadtentwicklung waren Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> landwirtschaft -<br />
lichen Verhältnisse mit steigenden Ernteerträgen. Zum einen bieten solche Erzeugnisse<br />
die Existenzgrundlage für die Ritter- bzw. Kriegerschaft. Aber auch eine – zum Teil durch<br />
die Kreuzzüge initiierten – Ausweitung <strong>der</strong> Handelsbeziehungen und die Ausbildung neuer<br />
Berufe tragen zur Stadtentwicklung im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t bei.<br />
„Die Landwirtschaft ist <strong>der</strong> Schlüssel für die gesamte europäische Entwicklung bis ins<br />
18. Jahrhun<strong>der</strong>t“ (<strong>Behrmann</strong>). Dabei ist das Frühmittelalter fast ausnahmslos geprägt<br />
von <strong>der</strong> ländlichen Welt, Städte bilden sich erst seit dem 11. Jahrhun<strong>der</strong>t in größerem<br />
Umfang heraus. Eine Ausnahme bilden hier nur Norditalien und Flan<strong>der</strong>n, wo es schon<br />
vorher größere Städte gab.<br />
Die zu verzeichnende dynamische Stadtentwicklung ist nun nicht durch politische<br />
Geschehnisse zu erklären. Zum einen kommt es zu einem Bevölkerungswachstum und<br />
das Geldwesen und <strong>der</strong> Handel weiten sich aus. Lei<strong>der</strong> geben nur wenig schriftliche<br />
Quellen darüber genaue Auskunft. Über das ländlich-bäuerliche Leben gibt es kaum<br />
Urwald wird gerodet.<br />
Deutlich wird <strong>der</strong> verschlungene<br />
Wildwuchs<br />
wi<strong>der</strong>gegeben.
43<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Urkunden und so bleibt diese Welt dem Historiker weitgehend verschlossen. Lediglich<br />
einige Zeugnisse aus Klöstern über z.B. Rodungsvorgänge gelten als Beleg.<br />
4.1.1. Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> ländlichen Welt des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Am Beispiel einer Landschaft an <strong>der</strong> „Diemel“ wird die Entwicklung vom Jahr 500<br />
gegenüber <strong>der</strong> Zeit um 1290 gezeigt. Um 500 n.Chr. gab es nur wenige Siedlungen,<br />
diese lagen meist an Flüssen und waren von Ackerland umgeben. Ansonsten dominierte –<br />
meist dichtes - Waldgebiet.<br />
Um 1290 zeigt sich ein genau umgekehrtes Bild. Kleine Ortschaften und viele ländliche<br />
Siedlungen waren entstanden, es gab weniger Wald unterschiedlicher Dichte. Hier muss<br />
es also eine gigantische Rodungsarbeit gegeben haben, die das systematische Vordringen<br />
<strong>der</strong> Menschen ermöglichte. Ähnliche Folgen erreichte man durch Trockenlegungen.<br />
Das Ziel war immer das gleiche: man suchte Land für eine wachsende Bevölkerung zu<br />
gewinnen. Aber auch durch eine Verbesserung <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte wie<br />
Pflug und Egge konnte man größere Flächen bearbeiten. Jetzt wurde Eisen zur<br />
Verstärkung eingesetzt, was den Beruf des Schmieds initiierte und die Herstellung von<br />
Holzkohle für die Eisengewinnung. Das Anschirren <strong>der</strong> Zugtiere wurde verbessert,<br />
indem man das Joch für die Ochsen und das Kummet für die Pferde entwickelte.<br />
Diese konnten dadurch besser atmen, was eine Leistungssteigerung bewirkte.<br />
Wesentliche treibende Kräfte für all diese Entwicklungen waren die geistlichen und<br />
weltlichen Grundherren. Stellvertretend wird <strong>der</strong> Bischof Benno II. von Osnabrück<br />
(† 1088) genannt. Benno amtierte, durch Heinrich IV. eingesetzt, von 1068-1088. Doch<br />
bevor er in den deutschen Reichsepiskopat aufstieg, legte er einen langen Weg zurück,<br />
beginnend mit seiner Ausbildung bei diversen Lehrern, dann in verschiedenen – meist<br />
weltlichen – Ämtern als Verwalter, Richter und Architekt, u.a. bei Heinrich III. und<br />
Heinrich IV. in Goslar, bis letzterer ihn schließlich in Amt und Würden hob. Bei Benno<br />
wird <strong>der</strong> Wille zur Verän<strong>der</strong>ung von Lebenssituationen beson<strong>der</strong>s deutlich.<br />
4.1.2. Mecklenbeck im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Mecklenbeck hat sich aus einer alten Bauernschaft entwickelt, die sich links und<br />
rechts des Meckelbachs (dem Namensgeber des Dorfes) angesiedelt hat. Schon im Jahr<br />
889 findet sich eine urkundliche Erwähnung eines dem Domkapitel gehörenden<br />
Bauernhofes auf dem Gebiet des heutigen Mecklenbeck. Zu vermuten ist, dass eine<br />
<strong>Familie</strong> Mecking- und das Beck für Bach dem Ort den Namen gegeben haben. Möglich<br />
ist aber auch eine Herleitung von Großer Bach.<br />
Von dieser frühen Besiedelung zeugt noch heute <strong>der</strong> alte Fachwerkspeicher von Haus<br />
Kump, einem Bauwerk aus dem 16. Jahrhun<strong>der</strong>t und damit das älteste Speichergebäude<br />
in Münster. Von Haus Kump aus wurden im 10. Jahrhun<strong>der</strong>t erste Waldrodungen<br />
vorgenommen und weitere Hofstellen angelegt. Diese Höfe hatten eine Größe von etwa<br />
10-12 Morgen je Hof. In <strong>der</strong> Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts kam es dann zu größeren<br />
Verän<strong>der</strong>ungen; es kamen weitere 6 Höfe dazu und die Anbaufläche je Hof verdreifachte<br />
sich auf bis zu 24 Morgen. Möglich wurde das durch Verkauf <strong>der</strong> landwirtschaftlichen<br />
Überschüsse an das Domkapitel in Mimigernaford / Münster und von dort weiter an<br />
Handwerker o.ä.<br />
4.1.3. Zur Bedeutung und Verbreitung <strong>der</strong> Wassermühle<br />
Das Wasser für eine menschliche Siedlung lebensnotwendig war, ist „fast mit Händen<br />
zu greifen“ (<strong>Behrmann</strong>). Beispiele aus <strong>der</strong> Region Münster sind<br />
• Mecklenbeck - Meckelbach<br />
• Gievenbeck - Gievenbach<br />
• Mimigenaford - Furt <strong>der</strong> Aa
44<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Auch die Nutzung <strong>der</strong> Wasserkraft geht auf das<br />
11.Jahrhun<strong>der</strong>t zurück. Ein weiterer Mosaikstein im Muster <strong>der</strong><br />
Erklärungen des Fortschritts ist die Erfindung <strong>der</strong><br />
Wassermühle. Denn Mühlen, die mit Menschen- o<strong>der</strong><br />
Pferdekraft betrieben wurden, waren schon aus römischer,<br />
vorchristlicher Zeit bekannt. Der riesige Fortschritt bestand jetzt<br />
in <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> Wasserenergie. Dabei gab es Wasserrä<strong>der</strong>,<br />
die horizontal und solche, die vertikal angeordnet waren.<br />
Letztere haben sich durchgesetzt.<br />
Und so kommt es, dass <strong>der</strong> Beruf des Müllers nach dem<br />
Schmied zu den ältesten nicht bäuerlichen Berufen überhaupt<br />
gehört. Es folgt <strong>der</strong> Beruf des Zimmermanns und des<br />
Mühlsteinherstellers.<br />
Alte Wassermühle Windmühlen kommen erst im 12. Jahrhun<strong>der</strong>t auf.<br />
4.1.4 Die städtische Welt<br />
Ein Anwachsen <strong>der</strong> Städte ist das zentrale <strong>Th</strong>ema im Hochmittelalter. In Deutschland<br />
gab es aus römischer Zeit nur wenige Stadtgründungen, wie z.B. Trier, Bonn o<strong>der</strong><br />
Xanten. Die Stadtentwicklung ist also eine genuin (echt) mittelalterliche Erscheinung.<br />
Was ist nun aber eine Stadt?<br />
Sie ist gut bevölkert, ummauert, also befestigt und wird von einem Rat regiert. Es gibt<br />
– mindestens eine – Kirche und ggf. eine Brücke, einen Markt und oft eine Münzprägung<br />
(Speyer). Im Unterschied zur reinen Landbevölkerung mit nur einem Beruf, dem des<br />
Bauern, findet man in <strong>der</strong> Stadt eine berufliche Differenzierung <strong>der</strong> Bevölkerung. Und<br />
diese Unterschiede zwischen Stadt und Land verfestigen sich mit <strong>der</strong> Zeit.<br />
Zur Ernährung für 3000 Städter sind übrigens 10 Dörfer notwendig. Keimzellen für<br />
Stadtgründungen sind oft Burgen o<strong>der</strong> Klöster.<br />
4.1.5 Fernhandel und städtische Wirtschaft<br />
Mit dem Anwachsen <strong>der</strong> Bevölkerung ganz allgemein wächst naturgemäß auch <strong>der</strong>en<br />
Bedarf an Lebensmitteln und an<strong>der</strong>en Gütern. Luxus-, aber auch Massengüter müssen<br />
herbeigeschafft werden. Der Beruf des Kaufmannes bildet sich aus. Da es diesen bisher<br />
noch nicht gab, waren die ersten Vertreter dieser Zunft den Menschen damals höchst<br />
suspekt! So schließen sie sich in Gilden zusammen.<br />
Im Fernhandel dieser Zeit werden hauptsächlich sog. Luxusgüter bewegt, als da sind:<br />
Pfeffer, Ingwer, Purpur und Damast. Aber auch flandrisches Tuch und Pelzwerk aus<br />
Russland (Fuchs, Hermelin und Zobel).<br />
4.1.6. Münster im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Auch Münster hatte zur Zeit des Mimigernaford eigene Münzen, einige davon wurden<br />
in Schweden gefunden. Was auf weitläufige Handelsbeziehungen schließen lässt. Und das<br />
es schon früh einen Markt gab, lässt auch hier das Vorhandensein von Kaufleuten<br />
vermuten. Auch „Dortmun<strong>der</strong> Münzen“ wurden in Skandinavien gefunden.<br />
Im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t entstanden das Mauritzstift und das Überwasserstift, weitere<br />
Bauten an einer Straßenkreuzung östlich von St. Lamberti. Die Lambertikirche im<br />
westfälischen Münster war die Markt- und Bürgerkirche, eine durch Kaufleute <strong>der</strong> Stadt<br />
finanzierte Gegengründung zum übermächtigen St.-Paulus-Dom. Am Kreuzungspunkt<br />
<strong>der</strong> ältesten Straßen Münsters (Roggenmarkt, Alter Fischmarkt, Salzstraße und ab 1121
45<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Prinzipalmarkt) existierte am Markt bereits um das Jahr 1000 eine kleine Kirche <strong>der</strong><br />
Kaufleute. Die heutige Stadt- und Marktkirche St. Lamberti entstand ab 1375.<br />
Blick von Süd-Westen auf Münster im Jahre 1570, gesehen von Remius Hogenberg.<br />
Links die Überwasserkiche, mittig <strong>der</strong> St. Paulus-Dom, rechts davon die Lambertikirche<br />
und rechts außen die Ludgerikirche. Im Vor<strong>der</strong>grund vor dem Dom das Neuwerk als Teil<br />
<strong>der</strong> Stadtbefestigung am Austritt <strong>der</strong> Aa aus <strong>der</strong> Stadt.<br />
Vorlesung vom 20.1.2006<br />
In den sich bildenden Städten kleinerer bis mittlerer Größe kommt es durch das dichtere<br />
Zusammenleben <strong>der</strong> dortigen Menschen zu einer Verdichtung und gleichzeitig zu einer<br />
beruflichen Differenzierung und mehr Reglement – es bilden sich Räte in diesen Städten.<br />
4.2 Die Gesellschaft / Menschen auf dem Land und in <strong>der</strong> Stadt<br />
4.2.1. Die Entstehung des Rittertums / Krieger und Bauern<br />
Die Gesellschaft des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts zeigt noch wenig Differenzierung zwischen den<br />
Menschen, zwischen Kriegern und Bauern. Ein Bauer bearbeitete nicht nur sein Land, er<br />
war vielmehr auch Gelegenheitskrieger, Gelegenheitskaufmann o<strong>der</strong> –Handwerker. In<br />
Gotland sprach man von Bauernkaufleuten. So gab es für den Bauern noch kein eigenes<br />
Wort, keine einheitliche Bezeichnung. Erst im Laufe des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts wird „Bauer“<br />
als eigenständiger Beruf genannt, <strong>der</strong> sich von an<strong>der</strong>en Berufen unterscheidet. Die<br />
entstehenden <strong>Familie</strong>nnamen haben oft den jeweiligen Beruf als Hintergrund.<br />
Auch bei den Kriegern entsteht eine neue Bezeichnung: Miles = Ritter. Bereits bei den<br />
Merowingern und den Karolingern wurde <strong>der</strong> Panzerreiter zum Träger <strong>der</strong> Stoßkraft in<br />
den kriegerischen Aufgeboten. Und jetzt im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t gewinnen diese Ritter an<br />
Profil. Je<strong>der</strong> Adlige, <strong>der</strong> "Kriegsdienst" leistete, konnte diesen Titel erwerben, sofern seine<br />
wirtschaftlichen Verhältnisse dies zuließen und vorausgesetzt, man brachte die dafür<br />
notwendigen sittlichen und militärischen Qualitäten mit.<br />
„Wirtschaftliche Verhältnisse“ bedeutete, dass <strong>der</strong> Ritter für Pferd und Rüstung selbst<br />
aufkommen konnte. Und woher nahm er dieses? Nun – entwe<strong>der</strong> gehörte er selbst <strong>der</strong><br />
entsprechenden, wohlhabenden Schicht an und hatte eine entsprechende Ausbildung und<br />
Qualifikation. Dazu die nötige körperliche Voraussetzung. Aber auch ein „Bauer“, <strong>der</strong> sich<br />
entsprechend „ausgezeichnet“ hatte, konnte Ritter werden.<br />
Im Reich nördlich <strong>der</strong> Alpen entwickelte sich das Rittertum aus zwei gesellschaftlichen<br />
Gruppen - dem nie<strong>der</strong>en Adel (in Fortsetzung <strong>der</strong> Tendenzen des Frankenreiches) und<br />
den Ministerialen. Ministerialen waren ursprünglich Unfreie, die im Hofdienst <strong>der</strong><br />
Bischöfe in herausgehobenen Positionen eingesetzt waren; dazu gehörte nicht nur <strong>der</strong><br />
Dienst unmittelbar bei Hofe, son<strong>der</strong>n auch die Verwaltung abgelegener Besitzungen. Eine<br />
solche Verwaltung schloss meist den bewaffneten Schutz solcher Besitzungen gegen<br />
Übergriffe an<strong>der</strong>er "Großer" ein. Sie mussten damit diesen ebenbürtig bewaffnet und<br />
ausgerüstet - also Panzerreiter - sein.
46<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Bald schon bestimmten die Ritter selbst, wer in ihren Stand aufgenommen wird. Dazu<br />
ist unter an<strong>der</strong>em <strong>der</strong> Ritterschlag notwendig. Eine <strong>der</strong><br />
ältesten Darstellungen eines solchen Ritterschlages ist<br />
auf dem „Teppich vom Bayeux“ dargestellt.<br />
Im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t vervielfachen sich die<br />
Informationen über die „Miles“, obwohl ein solcher<br />
„Miles“ noch kein „Nobilis“ war, eher ein Handlanger.<br />
Und die Ritter des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts hatten noch<br />
keinen festen Standort, erst gegen Ende des<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts werden ihre Namen zusammen mit<br />
Ortsnamen genannt. Sie werden also sesshaft und ihr<br />
Stand wird erblich.<br />
Wilhelm und Harold sind beide in voller Rüstung. Der<br />
Herzog schlägt Harold wegen dessen Verdiensten bei einem<br />
Feldzug gegen die Bretagne zum Ritter. Seine linke Hand<br />
packt den Helm des Angelsachsen, und seine rechte Hand<br />
scheint sein Kettenhemd zu berühren. Diese Handlung gibt<br />
dem Grafen den Status eines Vasallen<br />
4.2.2. Berufliche Differenzierung in <strong>der</strong> ländlichen Welt<br />
Der Bauernstand dieser Zeit ist für uns absolut anonym, es gibt praktisch keine<br />
Schriftlichkeit, wenigsten nicht im mittleren und nördlichen Europa. In den südlichen<br />
Län<strong>der</strong>n sieht das an<strong>der</strong>s aus. Dort sind viele Urkunden erhalten, die Auskunft geben<br />
über bestimmte <strong>Familie</strong>n, ihren Werdegang und – meist – Aufstieg. <strong>Behrmann</strong> berichtet<br />
von einer <strong>Familie</strong> aus Barcelona, des Lesens kundig und durch die Versorgung <strong>der</strong> Stadt<br />
Barcelona mit Lebensmitteln zu Reichtum gelangt. Mit dem verdienten Geld kann man<br />
weiteres Land zukaufen, es kommt zu einem sozialen Aufstieg. Teilweise sogar zur<br />
Einheirat in die Adelsschicht. Das sich ausbreitende Münzgeschäft lässt den Beruf des<br />
Bankiers entstehen. Alles oft innerhalb von 2-3 Generationen.<br />
4.2.3 Berufliche Differenzierung in <strong>der</strong> städtischen Welt<br />
Diese berufliche Differenzierung entwickelt sich in den Städten stärker, als auf dem<br />
Lande. Teilweise werden bestimmte Spezialisten auch in Klöstern herangezogen. Der<br />
Handel mit Waren nimmt zu. Neue Berufe wie Müller o<strong>der</strong> Salzsie<strong>der</strong> entstehen. Gewerke<br />
wan<strong>der</strong>n vom Land in die Stadt, aber es entstehen hier auch ganz neue Berufe, wie<br />
Bäcker, Metzger, Schnei<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Schuster.<br />
Viele neue Berufe schuf in beson<strong>der</strong>em Masse die Le<strong>der</strong>be- und –verarbeitung:<br />
Gerber, Sattler, Schuster o<strong>der</strong> den Zaumzeughersteller. Aber auch Berufe im Rahmen <strong>der</strong><br />
Metallverarbeitung entstehen, z.B. <strong>der</strong> Schmied. In Paris soll es alleine bei <strong>der</strong><br />
Metallverarbeitung 40 verschiedene Berufe gegeben haben!<br />
Ähnlich sieht es bei <strong>der</strong> Textilproduktion aus, wo sich eine starke Differenzierung <strong>der</strong><br />
Berufe ergeben hat. Beson<strong>der</strong>s die Färberei wird hier erwähnt, wo <strong>der</strong> Anbau <strong>der</strong><br />
„Krappwurzel“ und das Tauchen nach dem Sekret <strong>der</strong> „Purpurschnecke“ verbreitet war.<br />
So ist die Tuchproduktion ein erster stark differenzierter Arbeitsprozess in dieser Zeit.<br />
Und beson<strong>der</strong>s zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das Gebiet von Flan<strong>der</strong>n,<br />
mit <strong>der</strong> Stadt Gent als Zentrum.<br />
Das einzige Dienstleistungsgewerbe dieser Zeit ist <strong>der</strong> Handel, später kommt das<br />
Gastgewerbe dazu. Das entwickelt sich zunächst entlang <strong>der</strong> Pilgerstrasse nach Santiago<br />
de Compostela. (Und da war doch noch etwas in Richtung Dienstleistungsgewerbe!?)
4.2.4 Die Anfänge <strong>der</strong> jüdischen Wan<strong>der</strong>ung<br />
47<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die Frage, wann und warum Juden nach Mittel- und Nordeuropa gekommen sind,<br />
geht zurück auf die römische Geschichte und die Eroberung z.B. Jerusalems. Interessant<br />
ist dabei, dass sich jüdische Gemeinden nur in Städten bilden. Viele Juden zog es nach<br />
Spanien, da sie dort ihren Glauben – an<strong>der</strong>s als im übrigen Europa - praktizieren<br />
durften.<br />
Im Mittelalter bildeten die christliche Kirche und <strong>der</strong> Staat eine Einheit. Die Christen<br />
betrachteten Juden als Angehörige einer fremden, veralteten Religion. Sie begegneten<br />
dieser religiösen Min<strong>der</strong>heit mit Misstrauen und Feindschaft. Wo Krieg, Krankheit, Hunger<br />
auftraten, gaben die Menschen den Juden die Schuld. Massenmorde an Juden,<br />
Verbrennungen und Folterungen erhielten den kirchlichen Segen, wodurch die Täter von<br />
ihrem schlechten Gewissen befreit wurden.<br />
Aus <strong>der</strong> Zeit des 9. – 13. Jahrhun<strong>der</strong>ts gibt es viel Quellenmaterial, weil das Judentum<br />
schon früh eine enge Verbindung zur Schriftlichkeit hatte. Im Unterschied zur christlichen<br />
Welt. Beson<strong>der</strong>s viele Informationen besitzen wir von <strong>der</strong> jüdischen Gemeinde (Geniza)<br />
in Kairo. Informationen, die auch „erstaunlich mo<strong>der</strong>n in ihrer Anschaulichkeit“<br />
(<strong>Behrmann</strong>) sind. Und sie sind schon auf Papier geschrieben! Die berufliche<br />
Spezialisierung ist sehr weit fortgeschritten, <strong>Behrmann</strong> nennt die Zahl von 450<br />
verschiedenen Berufen. Und auch Frauen sind in das berufliche Leben stark eingebunden,<br />
als Ärztinnen und Lehrerinnen.<br />
4.2.5 Die Anfänge <strong>der</strong> jüdischen Gemeinden in Mitteleuropa<br />
Die Dichte <strong>der</strong> jüdischen Bevölkerung nimmt vom Süden zum Norden Europas zu. Ein<br />
Zusammenhang mit <strong>der</strong> Stadtentwicklung ist hier zu sehen. Schon im Karolingerreich gab<br />
es Juden in Europa, die hohes Ansehen genossen: „belohnt, beschenkt, geschützt“ – war<br />
das Motto. Ursprüngliche Bezeichnung für das erste relativ kompakte jüdische<br />
Siedlungsgebiet in Nordwesteuropa war das Wort „Aschkenas“, zunächst vor allem<br />
entlang des Rheins. Später - etwa im 12./13. Jahrhun<strong>der</strong>t - wurde <strong>der</strong> Begriff auf<br />
Deutschland, deutsches Judentum und deutsche Juden sowie ihre Nachfahren auch<br />
außerhalb Deutschlands übertragen. Im Gegensatz dazu die „Sepharden“, Juden, <strong>der</strong>en<br />
Vorfahren bis 1492 in Spanien und Portugal ansässig waren.<br />
Der erste Nachweis von Juden datiert aus dem Jahr 888 aus Metz. Es folgen<br />
Informationen aus Mainz, Regensburg, Magdeburg und Merseburg (?) – also alles<br />
Bischofsstädte. Warum dieses – nun, die Bischöfe waren Abnehmer <strong>der</strong> von den Juden<br />
gehandelten Luxusgüter, sie boten Sicherheit und die Städte lagen an Flüssen, also an<br />
Handelswegen. Auch Speyer will 1084 sein Ansehen und seine Wirtschaftskraft als Stadt<br />
steigern und nimmt Juden auf.<br />
Die Handelsaktivitäten <strong>der</strong> Juden weiten sich aus, ihre Gemeinden werden größer. Es<br />
kommt allmählich – im 12./13. Jahrhun<strong>der</strong>t - zu einer Verschiebung vom Waren- zum<br />
Geldhandel. Da Christen kein Geld gegen Zinsen verleihen durften, übernahmen dies die<br />
Juden und kamen so in den schlechten Ruf Wucherer zu sein und zu hohe Zinsen zu<br />
nehmen.<br />
Juden werden Ärzte. Sie heiraten sehr früh und haben so meist keine<br />
Berufsausbildung, können also auch nicht Handwerker werden. Die Frau genießt bei den<br />
Juden ein hohes Ansehen und Selbständigkeit. Lediglich in kultischen (Glaubens-) Dingen<br />
dominierte <strong>der</strong> Mann. Der <strong>Familie</strong>nsinn war sehr ausgeprägt und drückte sich in einem<br />
starken Zusammenhalt aus.<br />
Das Zusammenleben von Christen und Juden war immer von Spannungen gezeichnet.<br />
Diese Spannungen gehen aber in <strong>der</strong> Regel von den Christen aus. Für die christliche<br />
Kirche waren alle Juden "Gottesmör<strong>der</strong> und Brunnenvergifter". Obwohl es auch<br />
selbstgewählte Ausgrenzungen gab, z.B. bei den Essgewohnheiten. Die Juden einer Stadt<br />
wohnten in abgegrenzten Wohnbezirken, sog. Ghettos. Ihre Häuser waren häufig mit<br />
Bibelsprüchen gezeichnet. Ende des 11. Jahrhun<strong>der</strong>t kommt es zu ersten<br />
Judenverfolgungen in Deutschland.
48<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Einige Bil<strong>der</strong> vom ältesten erhaltenen Judenfriedhof in Europa, dem Friedhof<br />
„Heiliger Sand“ in Worms<br />
Vorlesung vom 27.1.2006<br />
5. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des 1. Kreuzzuges<br />
.<br />
Die Motive <strong>der</strong> Kreuzfahrer reduzierten sich keineswegs nur auf religiösen Eifer;<br />
vielmehr handelten sie aus vielschichtigen Gründen, die sich zudem im Laufe <strong>der</strong> Zeit<br />
wandelten. Ein wesentlicher Anlass waren Expansionsbestrebungen, die das Wachstum<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung notwendig machten. Und waren in den vorangegangenen Jahrhun<strong>der</strong>ten<br />
an<strong>der</strong>e Völker von außen nach Europa eingedrungen, haben wir ab dem 11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
eine genau entgegengesetzte Situation. Jetzt ziehen im Rahmen <strong>der</strong> Kreuzzüge<br />
Menschen aller Schichten und aus vielen europäischen Län<strong>der</strong>n ins „Heilige Land“.<br />
Dabei ist <strong>der</strong> kulturelle Rückstand dieser europäischen gegenüber den orientalischen<br />
Län<strong>der</strong>n auch durch religiösen Fanatismus nicht zu kaschieren. Und es werden viele<br />
Tausende von Menschen während dieser Kreuzzüge sterben und alle einmal eroberten<br />
Positionen in Palästina müssen bis zum Ende des 13. Jahrhun<strong>der</strong>ts wie<strong>der</strong> geräumt<br />
werden.<br />
5.0.1. Das „Heilige Land“ und <strong>der</strong> vor<strong>der</strong>e Orient im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
In dieser Zeit erweitert sich <strong>der</strong> geographische Horizont <strong>der</strong> Menschen in Europa, <strong>der</strong><br />
bei den meisten Bewohnern noch sehr eingeschränkt war. Nur wenige herausgehobene<br />
Gruppen, wie Adel und Klerus, hatten „mehr von <strong>der</strong> Welt gesehen“ und einen<br />
erweiterten Horizont. Der „normale Mensch“ hatte außer seiner Hütte und seinem<br />
nächsten Dorf nichts gesehen. Sogar in <strong>der</strong> Antike hatten die Menschen mehr<br />
geographische Kenntnisse; bei ihnen waren z.B. Afrika und <strong>der</strong> Orient schon bekannt.<br />
Im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t tritt hier in Europa eine Än<strong>der</strong>ung ein, man erreicht auf vielen<br />
Gebieten das Wissen <strong>der</strong> Antike (was in <strong>der</strong> Folge im 13. Jahrhun<strong>der</strong>t u.a. die Reisen<br />
eines Marco Polo möglich macht). Es kommt zu grundlegenden Verän<strong>der</strong>ungen im<br />
Mittelmeerraum, <strong>der</strong> in politischer Hinsicht in drei Teile geteilt ist:<br />
• <strong>der</strong> Westen ist Lateinisch – Christlich<br />
• <strong>der</strong> Osten ist Griechisch – Byzantinisch und<br />
• <strong>der</strong> Süden ist Arabisch – Islamisch
49<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die muslimischen Türken, die Seldschuken waren schon aus Mittelasien in den Län<strong>der</strong>n<br />
des vor<strong>der</strong>en Orient eingefallen, hatten sie<br />
in Besitz genommen und die Vormacht -<br />
stellung <strong>der</strong> Araber abgelöst. Auch gegen<br />
die Byzantiner gingen sie vor. Das alles<br />
bedeutete aber nur ein „Auswechseln“ <strong>der</strong><br />
Machthaber – die Christen in diesen<br />
Gebieten blieben unbehelligt. Doch wie<br />
wurden diese Ereignisse im Westen<br />
wahrgenommen? Man muss bedenken, dass<br />
es ja kein Nachrichtenwesen gab und oft<br />
nur Gerüchte weitergegeben wurden, die<br />
die tatsächliche Situation niemals<br />
wahrheitsgetreu wie<strong>der</strong>gaben.<br />
5.0.2 Die Entstehung <strong>der</strong> Kreuzzugsidee<br />
Das Reich <strong>der</strong> Groß-Seldschuken<br />
Ausschlaggebend für diese Kreuzzugsidee waren die Pilgerfahrten nach Jerusalem, die<br />
gemacht wurden, um einen Erlass <strong>der</strong> Sündenschuld zu erlangen. Dazu musste man die<br />
Grabeskirche besuchen. Auch von solchen Pilgerfahrten sind ab dem 11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
mehr Informationen überliefert.<br />
Pilgerfahrten, sog. Peregrinatio, sind also die wichtigste historische Tradition <strong>der</strong><br />
Kreuzzüge. Dabei trugen die Pilger als äußere Zeichen Stab und Tasche und waren<br />
ansonsten unbewaffnet. Die Bezeichnung „Kreuzzug“ entstand erst später, es wurde das<br />
aufgenähte Kreuz zum Zeichen und die Kreuzzügler trugen Waffen. Auch standen jetzt<br />
militärische Truppen zur Verfügung.<br />
Der entscheidende Grund für die Kreuzzüge war <strong>der</strong> Kampf gegen die Heiden als<br />
größte mögliche Busleistung. Dieser geistliche Verdienst verhieß Vergebung aller Sünden<br />
und das ewige Leben. Es war eine an<strong>der</strong>e Form des Ablasses und versprach auch<br />
Straffreiheit von irdischen Verfehlungen. Die Idee war schon von den Päpsten des 9.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts verbreitet worden. <strong>Behrmann</strong> zieht einen Vergleich zur Reconquista in<br />
Spanien.<br />
Der abendländische Adel erhoffte sich außerdem durch die Eroberung neue<br />
Besitztümer. Auch und gerade traf das auf die jüngeren Söhne des Adels zu, die nicht<br />
erbberechtigt waren (Primogenitur) und nun die Chance sahen, doch über ein eigenes<br />
Gebiet zu herrschen. Dies war genauso auch ein Ziel <strong>der</strong> Kirche, da <strong>der</strong> Kirchenfrieden<br />
(eine päpstliche Regel, die streng regelte, wann und wie gekämpft werden durfte;<br />
Weihnachten und an<strong>der</strong>e hohe Feiertage waren beispielsweise tabu) immer wie<strong>der</strong> durch<br />
Konflikte, die sich in erster Linie um Gebietsstreitigkeiten drehten, gestört wurde. So<br />
waren die Kreuzzüge auch willkommene Ventile für die überzähligen Söhne, die nicht im<br />
Kloster o<strong>der</strong> im Klerus untergebracht werden konnten o<strong>der</strong> wollten.<br />
Wirtschaftlich profitierten auch die italienischen Seerepubliken (Genua, Pisa, Venedig<br />
und an<strong>der</strong>e) vom Handel mit dem Orient.
50<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
5.0.3 Der Kreuzzugsaufruf Papst Urban II.<br />
Anlass <strong>der</strong> Kreuzzüge in das Heilige Land war 1085 ein Hilferuf des byzantinischen<br />
Kaisers Alexios I. an den Westen. Seit <strong>der</strong> Mitte des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts bedrängten die<br />
muslimischen Seldschuken das Byzantinische Reich; 1071 hatten sie bei Manzikert in<br />
Anatolien das byzantinische Heer vernichtend geschlagen, 1077 Jerusalem, die<br />
bedeutendste Stätte <strong>der</strong> Christenheit, erobert und 1085 Antiochia.<br />
Am 27. November 1095 hielt Papst Urban II.<br />
auf dem Konzil von Clermont eine Rede (she.<br />
Rahmen auf Seite 50), in <strong>der</strong> er die<br />
Verwüstungen <strong>der</strong> heiligen Stätten durch die<br />
türkischen Seldschuken beklagte und die<br />
europäische Ritterschaft aufrief, ihren<br />
christlichen Brü<strong>der</strong>n im Osten zu helfen. Die<br />
Wirkung <strong>der</strong> Rede hatte alle überrascht und das<br />
Volk war außer sich vor Begeisterung.<br />
Es schrie: Deus lo volt (Gott will es).<br />
Stellvertretend für die gesamte Christenheit<br />
übergibt Papst Urban II. einem Bischof und<br />
einem Ritter den Auftrag zur Eroberung des<br />
Heiligen Landes.<br />
Der Aufruf Papst Urban II. auf dem Konzil von Clermont<br />
,,Ihr wisst, geliebte Brü<strong>der</strong>, wie <strong>der</strong> Erlöser <strong>der</strong> Menschheit, als er uns zum Heile menschliche<br />
Gestalt angenommen hatte, das Land <strong>der</strong><br />
Verheißung mit seiner Gegenwart verherrlichte<br />
und durch seine vielen Wun<strong>der</strong> und durch das<br />
Erlösungswerk, das er hier vollbrachte, noch<br />
beson<strong>der</strong>s denkwürdig machte. Hat nun gleich<br />
<strong>der</strong> Herr durch gerechtes Urteil zugegeben, dass<br />
die Heilige Stadt wegen <strong>der</strong> Sünden ihrer<br />
Bewohner mehrmals in die Hände ihrer<br />
Ungläubigen geriet, hat er sie auch eine Zeitlang<br />
das schwere Joch <strong>der</strong> Knechtschaft tragen<br />
lassen, so dürfen wir darum doch nicht glauben,<br />
dass er sie verschmäht und verworfen habe. Die<br />
Wiege unseres Heils nun, das Vaterland des<br />
Herrn, das Mutterland <strong>der</strong> Religion, hat ein<br />
gottloses Volk in seiner Gewalt. Das gottlose<br />
Volk <strong>der</strong> Sarazenen drückt die heiligen Orte, die<br />
von den Füßen des Herrn betreten worden sind,<br />
schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei und Bildhafte Darstellung des Kreuzzugsgedanken -<br />
hält die Gläubigen in Knechtschaft und Unterwer- Christus auf dem Weg nach Jerusalem,<br />
fung. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen, und gefolgt von seinen Rittern<br />
das Allerheiligste ist entweiht. Das Volk, das den wahren Gott verehrt, ist erniedrigt; das<br />
auserwählte Volk muss unwürdige Bedrückung leiden. Das königliche Priestertum muss als Sklave<br />
Ziegel brennen; die Fürstin <strong>der</strong> Län<strong>der</strong>, die Stadt Gottes, muss Tribut zahlen. Will einem nicht die<br />
Seele darüber zergehen, will einem nicht darüber das Herz zerfließen? Liebe Brü<strong>der</strong>, wer kann das<br />
mit trockenen Augen anhören? Der Tempel des Herrn, aus dem er in seinem Eifer die Käufer und<br />
Verkäufer hinausgetrieben hat, damit das Haus seines Vaters nicht eine Mör<strong>der</strong>grube werde, ist<br />
nun Sitz des Teufels geworden. Die Stadt des Königs aller Könige, die den an<strong>der</strong>n die Gesetze des<br />
unverfälschten Glaubens gegeben hat, muss heidnischem Aberglauben dienstbar sein. Die Kirche<br />
zur heiligen Auferstehung, die Ruhestätte des Herrn, steht unter <strong>der</strong> Herrschaft <strong>der</strong>er, die an <strong>der</strong><br />
Auferstehung keinen Teil haben, son<strong>der</strong>n als Stoppeln zur Erhaltung des ewigen höllischen Feuers<br />
werden dienen müssen. Die ehrwürdigen Orte sind in Schafkrippen und Viehställe verwandelt.<br />
Dem preiswürdigen Volke werden die Söhne entrissen und gezwungen, heidnischer Unreinheit
51<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
dienstbar zu werden und den Namen des lebendigen Gottes zu verleugnen o<strong>der</strong> mit lasterhaftem<br />
Munde zu schmähen, und wenn sie sich den gottlosen Befehlen wi<strong>der</strong>setzen, so werden sie wie<br />
das Vieh hingeschlachtet, Genossen <strong>der</strong> heiligen Märtyrer. Den Tempelschän<strong>der</strong>n gilt je<strong>der</strong> Ort,<br />
jede Person gleichviel; sie morden die Priester im Heiligtum. Wehe uns, die wir in den Jammer <strong>der</strong><br />
gefahrvollen Zeit versunken sind, von <strong>der</strong> <strong>der</strong> fromme König David, sie im Geiste voraussehend,<br />
klagend gesprochen hat: ,,Gott, es sind Heiden in dein Erbe gefallen; die haben deinen heiligen<br />
Tempel verunreinigt. Herr, wie lange wirst du zürnen und deinen Eifer wie Feuer brennen lassen?"<br />
Wehe uns, dass wir dazu geboren sind, unseres Volkes und <strong>der</strong> Heiligen Stadt Zerstörung sehen<br />
und dazu stille sitzen zu müssen und die Feinde ihren Mutwillen treiben zu lassen!" Bewaffnet euch<br />
mit dem Eifer Gottes, liebe Brü<strong>der</strong>, gürtet eure Schwerter an eure Seiten, rüstet euch und seid<br />
Söhne des Gewaltigen! Besser ist es, im Kampfe zu sterben, als unser Volk und die Heiligen leiden<br />
zu sehen. Wer einen Eifer hat für das Gesetz Gottes, <strong>der</strong> schließe sich uns an. Wir wollen unsern<br />
Brü<strong>der</strong>n helfen. Ziehet aus, und <strong>der</strong> Herr wird mit euch sein. Wendet die Waffen, mit denen ihr in<br />
sträflicher Weise Bru<strong>der</strong>blut vergießt, gegen die Feinde des christlichen Namens und Glaubens. Die<br />
Diebe, Räuber, Brandstifter und Mör<strong>der</strong> werden das Reich Gottes nicht besitzen; erkauft euch mit<br />
wohlgefälligem Gehorsam die Gnade Gottes, dass er euch eure Sünden, mit denen ihr seinen Zorn<br />
erweckt habt, um solch frommer Werke und <strong>der</strong> vereinigten Fürbitten <strong>der</strong> Heiligen willen schnell<br />
vergebe. Wir aber erlassen durch die Barmherzigkeit Gottes und gestützt auf die heiligen Apostel<br />
Petrus und Paulus allen gläubigen Christen, die gegen die Heiden die Waffen nehmen und sich <strong>der</strong><br />
Last dieses Pilgerzuges unterziehen, alle die Strafen, welche die Kirche für ihre Sünden über sie<br />
verhängt hat. Und wenn einer dort in wahrer Buße fällt, so darf er fest glauben, dass ihm<br />
Vergebung seiner Sünden und die Frucht ewigen Lebens zuteil werden wird. Unterdessen aber<br />
betrachten wir diejenigen, welche im Glaubenseifer jenen Kampf auf sich nehmen wollen, als<br />
Kin<strong>der</strong> des wahren Gehorsams und stellen sie unter den Schutz <strong>der</strong> Kirche und <strong>der</strong> heiligen<br />
Apostel Petrus und Paulus; sie sollen vor je<strong>der</strong> Beunruhigung ihres Eigentums o<strong>der</strong> ihrer Personen<br />
gesichert sein."<br />
5.0.4 Der Verlauf des 1. Kreuzzuges<br />
Als Datum des Beginns wurde <strong>der</strong> 18.8.1096 – Mariä Himmelfahrt – festgelegt. Durch<br />
die Kreuzzugspredigt des Papstes veranlasst, brach eine unorganisierte Volksmasse in<br />
Richtung Palästina auf. Dieses Kreuzfahrerheer bestand in erster Linie aus einfachen<br />
Menschen, Bauern und ihren <strong>Familie</strong>n, weshalb man auch vom Volkskreuzzug spricht.<br />
Allerdings waren auch nie<strong>der</strong>er Adel und einzelne Ritter unter den Kreuzfahrern. Geführt<br />
wurde <strong>der</strong> Zug von Predigern wie Peter von Amiens. Seine ersten Opfer fand dieser<br />
voreilige Kreuzzug bereits in Ostfrankreich und im Rheinland, wo es unter Ennicho von<br />
Rheinlanden zu Massenmorden an <strong>der</strong> jüdischen Bevölkerung kam.<br />
Im selben Jahr formierte sich ein deutlich besser organisiertes und für damalige<br />
Verhältnisse sehr großes Kreuzfahrerheer, das in erster Linie aus Franzosen,<br />
französischen und süditalienischen Normannen, Flamen und Lothringern bestand.<br />
Anführer des Kreuzzuges waren Robert von <strong>der</strong> Normandie, Gottfried von Bouillon<br />
und weitere Angehörige des französischen und normannischen Adels. Päpstlicher<br />
Kreuzzugslegat war <strong>der</strong> Bischof von Le Puy. Man konnte sich nicht auf einen<br />
Oberbefehlshaber einigen, was im Verlaufe des Kreuzzuges zu diversen Konflikten führen<br />
sollte.<br />
Man hatte kaum eine Vorstellung von den geographischen Verhältnissen und wusste<br />
so gut wie nichts von den Gefahren, die unterwegs lauerten. Deshalb kamen die ersten<br />
Kreuzfahrer oft nicht sehr weit, einige wurden schon in Ungarn o<strong>der</strong> später von den<br />
Seldschuken „nie<strong>der</strong>gemacht“. Für die Teilnehmer des „Volkskreuzzuges“ bedeutete das<br />
also ein klägliches Ende, lediglich das Ritterheer – Gottfried von Bouillon - erreichte<br />
das Heilige Land.<br />
Das Kreuzritterheer brach in mehreren großen Zügen auf und vereinigte sich in<br />
Konstantinopel, wo im April 1097 die letzten Kreuzfahrer eintrafen. Der byzantinische<br />
Kaiser Alexios I. brachte den Kreuzfahrern großes Misstrauen entgegen, da unter ihnen<br />
viele süditalienische Normannen unter ihrem Führer Bohemund von Tarent († 1111),<br />
dem Sohn des Robert Guiscard, waren, denn diese hatten diverse Kriegszüge gegen<br />
das Byzantinische Reich unternommen. Zudem befürchtete Alexios, dass die Kreuzritter
52<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
ehemals byzantinisches Territorium für sich beanspruchen würden. Im Oktober des<br />
Jahres 1096 machte sich auch Raimund von Toulouse als ältester und reichster <strong>der</strong><br />
Kreuzritter auf den Weg nach Jerusalem. Er führte einen <strong>der</strong> Heereszüge des Kreuzzuges<br />
an, bestehend aus Südfranzosen, hauptsächlich Provenzalen und Burgun<strong>der</strong>n.<br />
Die Kreuzfahrer wurden nun nach Kleinasien verschifft, wo es schnell zu Kämpfen mit<br />
den Seldschuken kam. Im Juni wurde die wichtige Stadt Nicäa erobert. Während die<br />
Kreuzritter auf <strong>der</strong> einen Seite stürmten, hatten die Byzantiner auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite sich<br />
mit den Einwohnern verständigt, wodurch Nicäa sehr zum Ärger <strong>der</strong> Kreuzfahrer in<br />
byzantinische Hand fiel. Am 1. Juli schlugen die Kreuzfahrer ein Heer <strong>der</strong> Seldschuken<br />
in <strong>der</strong> Schlacht von Doryläum. Das christliche Heer bahnte sich nun unaufhaltsam einen<br />
Weg durch Kleinasien. Anfang Juni 1099 erreichten es Jerusalem. Dabei gab es<br />
unterwegs logistische Probleme, Nahrungs- und vor allem Wassermangel, die große Hitze<br />
und auftretende Seuchen demoralisierten die Angreifer. Es kam zu Kannibalismus.<br />
Raoul von Caen berichtete 1098:<br />
In Maara kochten unsere Leute die erwachsenen Heiden in Kesseln, zogen die Kin<strong>der</strong> auf<br />
Spieße und aßen sie geröstet.<br />
Am 7. Juni 1099 erreichten die Kreuzfahrer Jerusalem, das eigentlich ohne<br />
strategische Bedeutung war, da es im Landesinneren lag. Wie bei Antiochia begannen die<br />
Kreuzfahrer mit einer Belagerung, unter <strong>der</strong> sie aufgrund des Mangels an<br />
Nahrungsmitteln und Wasser in <strong>der</strong> Umgebung selbst wohl stärker litten, als die<br />
Bewohner <strong>der</strong> Stadt. Jerusalem war auf die Belagerung gut vorbereitet, die meisten<br />
christlichen Bewohner hatte <strong>der</strong> Statthalter aus <strong>der</strong> Stadt getrieben.<br />
Zufälligerweise erreichten kurz nach<br />
dem Angriff einige italienische Schiffe<br />
den Hafen von Jaffa, so dass die<br />
Kreuzfahrer sich für eine kurze Zeit<br />
versorgen konnten. Und aus dem Holz,<br />
das diese Schiffe mit sich führten,<br />
baute man Belagerungsmaschinen, mit<br />
denen man schließlich die Stadt<br />
erobern konnte. Nachdem die<br />
Kreuzfahrer die äußeren Mauern<br />
durchbrochen hatten und in die Stadt<br />
eingedrungen waren, wurde fast je<strong>der</strong><br />
Einwohner <strong>der</strong> Stadt im Laufe des<br />
Nachmittags, des Abends und des<br />
nächsten Morgens getötet, Muslime,<br />
Juden und die verbliebenen Christen<br />
ohne Unterschied. Nach einem Bericht<br />
in <strong>der</strong> Gesta Francorum "…war das<br />
Gemetzel so groß, dass unsere Männer<br />
in Blut bis zu ihren Knöcheln wateten...<br />
Belagerung Jerusalems 1099 und "..es ritten die Männer in Blut<br />
bis zu ihren Knien und ihrem Zaumzeug… ". Hier kam <strong>der</strong> seit 3 Jahren aufgestaute Frust<br />
<strong>der</strong> Kreuzzügler zum Ausbruch. Solche Massaker haben sich später aber nicht wie<strong>der</strong>holt.
5.1 Die Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kreuzzüge<br />
5.1.1 Italien<br />
53<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Das die Schiffe mit dem Bauholz für die Belagerungsmaschinen in Jaffa anlandeten,<br />
war beileibe kein Zufall. Für Italien war diese Zeit <strong>der</strong> Beginn eines tief greifenden<br />
Wandels seiner Rolle im östlichen Mittelmeerraum. Ab jetzt spielt Italien eine bedeutende<br />
Rolle bei den Handelsbeziehungen hierher, wobei die Pisaner und Genueser<br />
dominieren. Später werden es die Venezianer sein, die auch politisch – militärisch<br />
mächtiger werden.<br />
Die Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> europäischen Welt an <strong>der</strong> Schwelle zum 12. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
beschleunigen sich. Wir haben das am Beispiel <strong>der</strong> Stadtentwicklung gesehen und auch<br />
die Mobilität insgesamt wird größer. Gilt das im Grunde für alle europäischen Län<strong>der</strong>, so<br />
sind diese Verän<strong>der</strong>ungen in Italien doch am frühesten und am stärksten ausgebildet.<br />
In Italien gibt es bekanntlich keine Zentralgewalt (König / Kaiser). Im Norden haben<br />
die großen Städte das Sagen, in <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> Papst und die Kirche und im Süden die<br />
Normannen. Jetzt kommt die große Zeit <strong>der</strong><br />
Seestädte, die ein eigenes Profil entwickeln. Ihre Lage<br />
am Mittelmeer bildet dabei günstige Voraussetzungen<br />
und die Kreuzzüge geben zusätzliche Impulse. Außer<br />
Venedig weiten jetzt auch Pisa und Genua ihre<br />
Macht aus.<br />
Es wird von einer denkwürdigen Schiffsexpedition<br />
im Jahre 1087 von <strong>der</strong> Hafenstadt Bari aus berichtet.<br />
Dabei wurden die Gebeine des Heiligen Nikolaus<br />
von Myra nach Bari gebracht. Der Heilige ist seither<br />
in Italien auch als Nicola da Bari bekannt. Er ist <strong>der</strong><br />
Schutzpatron <strong>der</strong> Kaufleute.<br />
5.1.2 Die Italiener im 1. Kreuzzug<br />
Heiliger Nikolaus von Myra<br />
Wenn man in Pisa von <strong>der</strong><br />
Stadt kommend auf die „Piazza<br />
dei Miracoli“ – den Platz <strong>der</strong><br />
Wun<strong>der</strong> – tritt, beeindruckt das<br />
gewaltige Ensemble des<br />
Domes, des Turmes und des<br />
Baptisteriums. Alle drei<br />
Gebäude zeigen eine<br />
zeitgleiche Bauweise und sind,<br />
ganz aus Marmor gebaut,<br />
sichtbarer Ausdruck eines<br />
plötzlichen Reichtums <strong>der</strong><br />
Stadt. Denn diese hat den Bau<br />
veranlasst und bezahlt.<br />
Pisa tritt erst jetzt im 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t als Seehandels -<br />
macht auf den Plan.<br />
Kolonialisiert sogar die Inseln<br />
Elba, Korsika und Sardinien.<br />
Beim 1. Kreuzzug werden sie<br />
erst aktiv, als sich ein Erfolg des Pisa / Die Piazza dei Miracoli mit Baptisterium, Dom<br />
und Turm
54<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Unternehmens abzeichnet. Die Kreuzfahrer selbst hatten keine eigene Flotte. Und in<br />
Jerusalem ist für die Pisaner Kaufleute ausreichend Platz für ihre Aktivitäten. Sie finden<br />
ideale wirtschaftliche Verhältnisse für ihre Geschäfte vor. Ebenso die Genueser.<br />
Daimbert von Pisa († 1107) Erzbischof von Pisa, war <strong>der</strong> erste Lateinische Patriarch<br />
von Jerusalem nach dessen Eroberung während des Ersten Kreuzzugs. Daimbert<br />
erreichte das Heilige Land 1100 mit <strong>der</strong> pisanischen Flotte, die die Kreuzfahrer bei <strong>der</strong><br />
Belagerung <strong>der</strong> Küstenstädte unterstützen sollte. Daimbert wollte das Königreich<br />
Jerusalem zu einer <strong>Th</strong>eokratie machen, mit dem Papst an seiner Spitze und dem<br />
Patriarchen als seinem Stellvertreter. Daimbert blieb Patriarch bis zu seinem Tod 1107.<br />
Im Juni des Jahres 1100 landeten auch die ersten Schiffe aus Venedig an <strong>der</strong> Küste<br />
des Heiligen Landes. Venedig konnte in diesem Raum enorme wirtschaftliche Vorteile<br />
gewinnen. Seit sie ihre Flotte gegen die seldschukischen Türken eingesetzt hatten,<br />
gestand ihnen Kaiser Alexios I. 1081 ein Handelsabkommen zu, das ihnen das De-facto-<br />
Monopol im Byzantinischen Reich gab. Im Zuge <strong>der</strong> ersten Kreuzzüge und bedingt durch<br />
diese Handelsprivilegien, nahmen die Feindseligkeiten zwischen Venezianern und<br />
Byzantinern zu.<br />
Auch die Genueser errichteten kleine „Staaten im Staate“, mit eigenen Stadtvierteln<br />
und Kirchen. Ihre Privilegien werden in <strong>der</strong> Grabeskirche in goldenen Lettern<br />
eingemeißelt!<br />
5.1.3 Das urbane Italien<br />
Das Verhalten <strong>der</strong> Italiener muss man unter <strong>der</strong> Situation verstehen, dass für den<br />
Schiffsbau viel Kapital benötigt wurde. Die so erfolgreichen „Bauernhändler“ – also<br />
ehemalige Bauern, die jetzt Handel betreiben – lassen sich in den Städten nie<strong>der</strong>. Es<br />
kommt zur Einheirat in feudale <strong>Familie</strong>n. Das ist zwar für alle norditalienischen Städte,<br />
am stärksten aber für Venedig nachgewiesen.<br />
In Mitteleuropa bleibt die Trennung zwischen Adel und Bürgertum bestehen. In Italien<br />
dagegen werden Land und Stadt aufs engste miteinan<strong>der</strong> verflochten. Es entstehen die<br />
ersten Stadtstaaten. Darüber hat sich schon Otto von Freising gewun<strong>der</strong>t. Der<br />
Aufschwung des Städtewesens setzt in Italien also früher ein, als im übrigen Europa. Und<br />
damit auch eine urbane Kultur, wie z.B. das Schulwesen.<br />
In Bologna wird schon 1088 eine Rechtsschule gegründet, die später Universität wird.<br />
Die Universität Bologna war von Anfang an für Rechtswissenschaften berühmt. Im frühen<br />
Mittelalter waren die spätantiken Wissenschaften und das<br />
römische Recht fast in Vergessenheit geraten, und es wurde<br />
nur noch die kirchliche Rechtslehre weitergegeben. Diese war<br />
zum Teil sehr wi<strong>der</strong>sprüchlich, und so systematisierte <strong>der</strong><br />
Bologneser Magister Gratian die kirchlichen Rechtstexte in<br />
einer einheitlichen Rechtsammlung, dem Decretum Gratiani.<br />
Das spätantike römische Recht wurde jetzt neu gelesen und<br />
kommentiert. Daraus entwickelte sich die Schule des Rechts,<br />
die als Vorläufer <strong>der</strong> Universität angesehen werden kann.<br />
Die Digesten (von lat. digesta - "Geordnetes"), sind eine<br />
Zusammenstellung aus den Werken römischer Rechtsgelehrter;<br />
sie bilden den wichtigsten Teil unserer Überlieferung des Logo <strong>der</strong> Universität von<br />
Bologna<br />
römischen Rechts. Diese Handschrift ist bis auf eine Seite, die man im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t in<br />
Pisa wie<strong>der</strong> gefunden hat, verloren gegangen.
Das Genueser Stadtwappen<br />
5.1.4 Das kommunale Italien<br />
55<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Aber die erwähnte Stadtentwicklung reicht weiter, als zum<br />
Entstehen repräsentativer Bauten als äußeres Zeichen. Wie dem<br />
Pisaner Dom-Ensemble. O<strong>der</strong> dem erwähnten neuen Rechtsempfinden.<br />
Es entsteht vielmehr ein starkes Bürgerbewusstsein, mit<br />
lokalpatriotischen Schriften (Städtelob). Die Genueser eignen sich das<br />
„Rote Kreuz“ als Logo an. Und als Ausdruck eines geographischen<br />
Zusammengehörigkeitsgefühls entstehen Bezeichnungen wie Italici<br />
o<strong>der</strong> Italiniensis.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> urbanen Entwicklung ist das Entstehen <strong>der</strong> „Kommunen“ neu. Es<br />
entwickelt sich eine städtische Autonomie, die sich auf militärische und auf Handelsbezogene<br />
Angelegenheiten erstreckt. Das gibt es sonst noch nirgendwo und hier sind die<br />
Anfänge <strong>der</strong> Kommune sichtbar.<br />
Eine Oberschicht löst zunächst den Bischof als Herrscher in <strong>der</strong> Stadt ab und die<br />
Teilhabe an dieser Macht entwickelt sich dann weiter, indem gewählte Vertreter <strong>der</strong><br />
Bürger die Stadt repräsentieren. Der Begriff „Kommune“ hat ebenso eine Signalwirkung,<br />
wie das Wort „Konsul“, also Ratsherr. In diesen Städten bilden sich im Verlauf von nur 15<br />
Jahren solche „Bürgervertretungen“:<br />
In Pisa (), in Lucca (1087/88), in Asti (1095), in Mailand (1097) und in Genua (1098/99)<br />
.<br />
In diesen „Bürger- o<strong>der</strong> „Volksvertretungen“ beraten<br />
die Bürger einer Stadt gemeinsame Probleme. Darüber<br />
geben z.B. die „Genueser Annalen“ beson<strong>der</strong>s gut<br />
Auskunft. Hier schreibt <strong>der</strong> Chronist Caffaro († 1163/66 -<br />
she. Seite 55), <strong>der</strong> den 1. Kreuzzug mitgemacht hat, in<br />
den 1140-er Jahren eine erste Stadtchronik. Führende<br />
<strong>Familie</strong>n waren Grundbesitzer, Ree<strong>der</strong>, Kaufleute und<br />
Krieger. Diese saßen dann im „Parlamentum“, wie hier in<br />
Genua die Volksvertretung genannt wurde. Der Beginn<br />
je<strong>der</strong> Sitzung dieses Gremiums wurde durch das Läuten<br />
einer Glocke des Campanile (Bild links / San Lorenzo)<br />
angezeigt.<br />
Der Bischof wird zu einer „Figur am Rande“. Und<br />
natürlich beschränkt sich diese Entwicklung nicht auf<br />
Genua, son<strong>der</strong>n sie gilt für alle italienischen Städte. Die<br />
neuen Verhältnisse haben mit denen des Frühmittelalters<br />
nichts mehr gemeinsam.
56<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die ältesten Auskünfte über das abenteuerliche<br />
Seemannsleben, das sich im Laufe <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>te<br />
festigen sollte, stammen vom ersten Kreuzzug. Das<br />
historische Ereignis verwickelte die Camogliesi zwischen<br />
dem Dezember des Jahres 1096 und dem April des<br />
darauf folgenden Jahres, die voller religiöser Gefühle,<br />
aber auch entschlossen waren, sich eine führende Rolle<br />
unter den Handelshäfen <strong>der</strong> Levante-Küste zu erobern.<br />
Sie bestanden die Probe ehrenvoll, und während <strong>der</strong><br />
nachfolgenden Jahre eroberten sie gemeinsam mit den<br />
Genuesen Syrien, im Gefolge <strong>der</strong> Embriaci.<br />
Die Camogliesi kämpften auch gegen nähere Feinde,<br />
sie rivalisierten mit Genua um die Handelsspitzenstel -<br />
lung im Tyrrhenischen Meer. Der Annalenschreiber<br />
Caffaro erinnert, dass sie zu den 22.000 Menschen<br />
Annali di Caffaro ( 1099-1163) gehörten, die 1120 mit einer Flotte von über 100<br />
Schiffen zum Krieg gegen Pisa in See stachen, <strong>der</strong> nach dem von den Feldzügen nach Palästina<br />
durchgesetzten Waffenstillstand erneut ausgebrochen war.<br />
Als Vorwand für den Kampf diente eine Pfründe, die <strong>der</strong> Papst <strong>der</strong> toskanischen Stadt gewährte,<br />
die, nach Ansicht <strong>der</strong> Genueser, die Pisanische Macht in Korsika erhöht hätte.<br />
Die Ligurer gewannen und konnten nun die Insel noch besser für ihren Handel nutzen. Die<br />
Gewinne <strong>der</strong> kaufmännischen Tätigkeit hatten keine positive Auswirkung auf die Wirtschaft des<br />
Dorfes.<br />
Einige notarielle Dokumente vom Ende des 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts bestätigen die Aufmerksamkeit <strong>der</strong><br />
Camogliesi für die Schanze, die zum Lebensraum des Handels geworden war. Die Gegenwart des<br />
Hafens wird 1191 zum ersten Mal in einem vom Notar Guglielmo Cassinese erstellten Testament<br />
dokumentiert<br />
Vorlesung vom 3.2.2006<br />
5. Die Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kreuzzüge (Forts.)<br />
5.1.5 Spanien zwischen Kreuzzug, Reconquista und kulturellem Ausgleich<br />
Die Reconquista findet mit <strong>der</strong> Eroberung Toledos im Jahr 1085 ein vorläufiges Ende.<br />
In dieser Zeit waren extreme religiöse Einstellungen in Spanien die Ausnahme. Beide<br />
Religionen – Christen und Moslems – lebten relativ friedlich nebeneinan<strong>der</strong>, sodass die<br />
bestehenden Gegensätze nicht so deutlich wurden.<br />
Da erfolgt <strong>der</strong> Aufruf von Papst Urban II. (1088-99) die Stadt Tarragona zurück zu<br />
erobern. Und anstatt nach Jerusalem zu pilgern, solle Geld für <strong>der</strong>en Wie<strong>der</strong>aufbau<br />
gespendet werden. Auch dafür wurde <strong>der</strong> Erlass <strong>der</strong> Sünden versprochen, die<br />
Reconquista dem Kreuzzug praktisch gleichgestellt. Bei <strong>der</strong> Reconquista geht es ja um<br />
die Verteidigung gegen die Sarazenen, sie ist also Teil des Kampfes gegen die „Heiden“.<br />
Aber ein Zug nach Jerusalem war für die Teilnehmer attraktiver.<br />
Papst Gelasius II. (1118-19) versprach deshalb nur „bei<br />
persönlicher Teilnahme“ an <strong>der</strong> Rück-Eroberung <strong>der</strong> Stadt<br />
Saragossa auch die vollständige Vergebung <strong>der</strong> Sünden – auch<br />
hier wird <strong>der</strong> Kreuzzugsgedanke deutlich. Schon seit dem 8.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t gehörte Saragossa zum Kalifat von Córdoba und war<br />
ein Vorposten im Kampf gegen die christlichen Königreiche in<br />
Nordspanien. Erst 1118 konnte das christliche Königreich Aragón<br />
die Stadt von den Muslimen erobern und zur neuen Hauptstadt des<br />
Landes erheben. Papst Gelasius II.<br />
(1118-19)
57<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Das 902 von den Mauren eroberte Mallorca konnte von den Grafen von Barcelona für<br />
eine kurze Zeit zurückerobert werden, bevor es im 13. Jahrhun<strong>der</strong>t (1229) von den<br />
aragonischen Truppen unter Jaume I. im Rahmen <strong>der</strong> Reconquista erobert wird.<br />
Die Begegnung <strong>der</strong> unterschiedlichen Kulturen führt aber auch zu positiven<br />
Ergebnissen, indem es zum ersten Mal zu einer Vertiefung und Verflechtung bei<strong>der</strong><br />
Kulturen kommt. Ein intellektueller Austausch zwischen Muslimen und Christen erfolgt. In<br />
Toledo z.B. lebten Mudejares, Mozaraber und Juden zusammen. Die Verkehrsprache war<br />
das Arabische. Toledo wurde dann Ausgangspunkt für die Eroberungszüge <strong>der</strong><br />
Kastilianer.<br />
Exkurs:<br />
• Mudejares ist die Bezeichnung für Muslime, die im Verlauf <strong>der</strong> Reconquista unter<br />
die Herrschaft <strong>der</strong> christlichen Königreiche in Spanien geraten waren, jedoch ihre<br />
Religion weiter ausüben konnten; sich aber bald an ihre christliche Umgebung<br />
anpassten. Sie waren zwar rechtlich zweitklassige, aber wohlwollend behandelte<br />
Untertanen.<br />
• Als Mozaraber wurden Christen bezeichnet, die nach dem Zusammenbruch des<br />
Westgotenreichs unter muslimische Herrschaft gekommen waren und sich in <strong>der</strong><br />
äußeren Lebensform den Muslimen anpassten. Sie mussten Kopfsteuer bezahlen,<br />
lebten aber in eigenen Wohnvierteln mit eigener Rechtsprechung und Verwaltung.<br />
Die Arabisierung <strong>der</strong> Christen erfolgte vor allem in den Städten, wo viele Christen<br />
auch in <strong>der</strong> Verwaltung und den Finanzbehörden <strong>der</strong> Umayyaden tätig waren.<br />
Es setzt eine rege Übersetzungstätigkeit vom Arabischen ins<br />
Lateinische zwischen dem frühen 12. und dem 13 Jahrhun<strong>der</strong>t ein.<br />
Davon ist <strong>der</strong> gesamte Schatz <strong>der</strong> arabischen Überlieferungen<br />
betroffen: <strong>der</strong> Koran, sowie medizinische und astronomische<br />
Schriften. Auch antike Literatur wird übersetzt und so werden auch<br />
zum ersten Mal die Schriften des Aristoteles (384-22 v. Chr.) ins<br />
Lateinische übertragen und dadurch einer breiteren Öffentlichkeit<br />
bekannt gemacht. Dieser „universelle Denker“ gilt als <strong>der</strong> Auslöser<br />
einer „intellektuellen Revolution“ schlechthin. Er wurde kurz und<br />
bündig mit dem Namen „Philosophus“ apostrophiert.<br />
Auch Schriften über das römische Recht tauchen jetzt auf und<br />
Büste des Aristoteles so stehen auf einmal Informationsquellen mit einer ungeheuren<br />
Wissensmasse zur Verfügung, die intellektuelle Diskussionen geradezu herausfor<strong>der</strong>n.<br />
Die Gründungen <strong>der</strong> Universitäten von Bologna (gegr.1088) und Paris (gegr.1268)<br />
werden dadurch initiiert.<br />
Die Übersetzer selbst kommen aus fast allen Län<strong>der</strong>n Europas, aus Frankreich, Italien<br />
– hier wird sogar nach Regionen unterschieden - Deutschland und England. Der<br />
bekannteste ist Gerhard von Cremona († 1187). Über seine Herkunft und seinen<br />
Lebenslauf ist wenig bekannt. In Toledo gab es im 12. Jahrhun<strong>der</strong>t die berühmteste<br />
Übersetzerschule des mittelalterlichen Europa. Gerhard studierte Arabisch und war bald<br />
in <strong>der</strong> Lage, nicht nur den „Almagest“ ins Lateinische zu übersetzen. Am Domkapitel in<br />
Toledo arbeitete er dann 40 Jahre als Diakon und Lehrer.<br />
5.1.6 Wie<strong>der</strong>besiedlung und Stadt in <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> Reconquista<br />
Zwar gibt es jetzt viele Reisen und damit Ortsverän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Menschen, eine<br />
Massierung ist aber aus dem Süden (Andalusien) überliefert. Die Erklärung hierfür liegt<br />
darin, dass dieser Landstrich an <strong>der</strong> Küste liegt und damit günstige Verkehrsverbindun -<br />
gen aufweist. Der Norden und die Mitte Spaniens sind dagegen nur dünn besiedelt. Damit<br />
die Reconquista zum Erfolg geführt werden konnte, mussten also Menschen in diese<br />
Gebiete kommen.<br />
Alfons II. († 1157) nennt das Motiv – die Mauren sollten daran gehin<strong>der</strong>t werden, die<br />
gegen sie eroberten Orte wie<strong>der</strong> zu besetzen. Deshalb erhalten Siedler, die in diese<br />
Gebiete gehen, verschiedene Vorrechte. Und nach und nach nehmen die Ortschaften
58<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
städtischen Charakter an, beson<strong>der</strong>s im Gebiet zwischen den Flüssen Tajo und dem<br />
Duero.<br />
Mehr und mehr schalten sich die Stadtbewohner auch in die Belange ihrer Stadt ein. In<br />
schriftlichen Urkunden werden ihnen vom König bestimmte Vorrechte zugestanden. Im<br />
sog. „consego“, dem Rat sitzen nur Männer und nur solche, die Hausbesitzer sind! Denn<br />
nur diese sind Bürger, die an<strong>der</strong>en sind nur Einwohner einer Stadt. Und Adel, Klerus und<br />
Fremde gehören auch nicht dazu. Ein Glockenzeichen ruft auch hier den Rat zusammen,<br />
immer am Sonntag nach <strong>der</strong> Messe. Im Rat dürfen alle Mitglie<strong>der</strong> sprechen. Besprochen<br />
werden alle Angelegenheiten <strong>der</strong> Stadt, wie z.B. Marktregelungen usw.<br />
Eine Chronik des Klosters Sahagún,<br />
ursprünglich eine Gründung Clunys, beschreibt die<br />
Situation sehr gut. Alfons VI. hat die zunächst<br />
kleine Siedlung beson<strong>der</strong>s geför<strong>der</strong>t und es<br />
siedeln sich Bewohner aus Italien, Frankreich,<br />
England und Deutschland hier an, die Siedlung<br />
um das Kloster herum entwickelt sich zur Stadt.<br />
Zunächst müssen die neuen Bewohner aber<br />
noch eine jährliche Pacht an den Abt des Klosters<br />
zahlen und ihr Brot dort backen lassen. Auch<br />
gegen Bezahlung. Bis die Bürger ihr Brot selber<br />
backen – was ihnen per Urkunde erlaubt wurde -<br />
und die jährliche Zahlung „nicht mehr einsehen“.<br />
Es kommt in den Jahren zwischen 1110 und 1117<br />
zu Unruhen, weil man mit <strong>der</strong> Situation nicht<br />
mehr zufrieden ist. Und so zwingen die Bürger die<br />
Mönche, eine Verzichtserklärung zu unterschrei -<br />
ben.<br />
Allgemein wird mit wachsen<strong>der</strong> Bevölkerung<br />
auch die gesamte politische Situation infrage<br />
gestellt.<br />
Kloster Sahágun<br />
5.1.7 Die Anfänge Portugals<br />
Der Name Portugal entstammt dem Namen <strong>der</strong><br />
Siedlung Cale im Delta des Flusses Rio Douro. Als das<br />
heutige Portugal zum Römischen Imperium gehörte,<br />
wurde Cale ein wichtiger Hafen, in Latein Portus Cale.<br />
Im Mittelalter wurde Portus Cale zu Portucale, später<br />
Portugale, wobei dieses Wort im 7. und 8. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
nur die nördlichen Teile des Landes bezeichnete, also<br />
die Region zwischen den Flüssen Rio Douro und Rio<br />
Minho. Eine unbedeutende Grafschaft. An<strong>der</strong>erseits<br />
verkürzte sich <strong>der</strong> Name Portus Cale zu Porto, <strong>der</strong><br />
zweitwichtigsten Stadt, die sich deshalb voller Stolz als Das Wappen Portugals<br />
Namensgeber des Landes bezeichnet.<br />
Die Region hatte wegen ihrer Abgeschiedenheit kulturelle Eigentümlichkeiten, war<br />
mehr keltisch-iberisch als germanisch geprägt, auch mit sprachlich-dialektischen Eigen -<br />
heiten. Weshalb sich auch heute noch die portugiesische Sprache von <strong>der</strong> spanischen<br />
unterscheidet.<br />
Portugal wird als eigenständige Grafschaft bereits im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t gegründet, diese<br />
fällt 1093 an Heinrich von Burgund, den Stammvater <strong>der</strong> ersten portugiesischen<br />
Königsdynastie. Unter Heinrichs Sohn und Nachfolger Alfons I. erlangt das Land 1143<br />
seine Unabhängigkeit – portugiesische Adlige kämpfen gegen den Herrschaftsanspruch
59<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Kastiliens - und Alfons nimmt den Königstitel an. Die Burgun<strong>der</strong> herrschen bis 1383 in<br />
Portugal.<br />
5.2 Das römisch-deutsche Reich<br />
Das Regiment Heinrich IV. war auch nach seinem Gang nach Canossa noch nicht<br />
gesichert. Mit Rudolf von Rheinfelden (Schwaben) gab es einen Gegenkönig – den er<br />
zwar in <strong>der</strong> Schlacht von Hohenmölsen besiegen konnte und <strong>der</strong> an seiner<br />
Handverletzung starb – aber auch seine Söhne opponierten gegen ihn.<br />
Heinrich erlebte 1093 den Abfall seines Sohnes Konrad, <strong>der</strong> 1087 in Aachen zum König<br />
gekrönt worden war. 1098 hielt Heinrich eine Reichsversammlung in Mainz ab, die<br />
Konrad absetzte und den jüngeren Sohn Heinrich zum Nachfolger bestimmte, <strong>der</strong> 1099 in<br />
Aachen gekrönt wurde und als Heinrich V. in Mainz einzog. Unter trügerischen<br />
Bedingungen setzte <strong>der</strong> Sohn den Vater in <strong>der</strong> Burg Böckelheim an <strong>der</strong> Nahe gefangen.<br />
Dann zwang er ihn auf einem Reichstag zu Ingelheim am 31.12. 1105 zur Abdankung.<br />
Heinrich aber entkam nach Aachen, wandte sich an die Öffentlichkeit und gewann in<br />
Nie<strong>der</strong>lothringen eine große Anhängerschaft. Vor dem Entscheidungskampf starb<br />
Heinrich.<br />
5.2.1 Die Anfänge kommunaler Selbstorganisation in deutschen Städten<br />
Zum ersten Mal haben wir in dieser Zeit Einblick in die Entwicklung des städtischen<br />
Lebens. Es gibt erste Quellen über das Geschehen in den werdenden Städten, in denen<br />
sich erste Anzeichen einer Verwaltung zeigen. Ausführliche Informationen gibt es aus den<br />
Städten Köln und Worms. Beide Städte haben jüdische Gemeinden, beide liegen am<br />
Rhein und haben damit günstige Voraussetzungen für eine gute wirtschaftliche<br />
Entwicklung.<br />
Als nun <strong>der</strong> 23-jährige Heinrich IV. im Jahr 1073 krank nach Worms kommt – er war<br />
in die Sachsenkriege verwickelt und musste vor den erfolgreichen Sachsen fliehen –<br />
wurde er von den Bürgern begeistert empfangen - das Geschlecht <strong>der</strong> Salier kam ja aus<br />
dieser Gegend. Nachdem die Ritter aus <strong>der</strong> Stadt vertrieben worden waren, musste sogar<br />
<strong>der</strong> Bischof fliehen. Aus Dank werden die Wormser Bürger – und auch die Juden – mit<br />
einer Urkunde vom 18.Januar 1074 „von allen Abgaben befreit“.<br />
Das ist die erste Urkunde für die Bürger einer Stadt!<br />
Es ist anzunehmen, dass es vorher unter den Bürgern zu einer Meinungsbildung<br />
gekommen ist und diese Urkunde auch in Absprache mit den Bürgern erstellt wurde. Die<br />
alte Verbundenheit zum Saliergeschlecht, aber sicher auch die Wormser Fernhändler<br />
werden hier maßgeblichen Anteil gehabt haben. Bedeutet die Befreiung von Zollabgaben<br />
für sie doch eine substantielle Erleichterung.<br />
Die - zeitweise - Vertreibung eines Bischofs aus <strong>der</strong> Stadt<br />
bedeutet ein geradezu revolutionäres Ereignis. Und ein<br />
gleicher Fall ist aus Köln von Erzbischof Anno von Köln<br />
überliefert, hier aber nur zwischen Bischof und Bürgern, ohne<br />
König. Als Anno für seinen Freund, den Erzbischof von<br />
Münster, im Jahr 1074 eine Heimfahrtgelegenheit<br />
organisieren will und zu dem Zweck von einem Kaufmann im<br />
Kölner Hafen ein Schiff beschlagnahmen lässt, wi<strong>der</strong>setzt sich<br />
<strong>der</strong> Kaufmann dieser Beschlagnahmung. Schnell ist die ganze<br />
Stadt aufgebracht und man will gegen den ungeliebten<br />
Machthaber vorgehen. Anno zieht sich mit seinen Getreuen<br />
zurück und verschanzt sich im Dom.<br />
Die Menge tobt und unterdessen gelingt es Anno<br />
zusammen mit einigen Begleitern durch eine sog.<br />
„Katzenpforte“ in <strong>der</strong> Stadtmauer unentdeckt aus <strong>der</strong> Stadt<br />
Anno von Köln († 1075) zu fliehen und sich so vor <strong>der</strong> mordlustigen Bevölkerung in<br />
Sicherheit zu bringen. In den folgenden Tagen schart Anno bewaffnete Untertanen um<br />
sich und kehrt vier Tage später nach Köln zurück um die Stadt zu belagern. Angesichts
60<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
<strong>der</strong> Waffenkraft <strong>der</strong> Belagerer ergeben sich die Aufständischen jedoch rasch, öffnen die<br />
Stadttore und lassen den Erzbischof hinein. Anno for<strong>der</strong>t die Aufständischen auf, zu ihren<br />
Taten zu stehen und Buße zu tun, um Vergebung zu erlangen.<br />
Der Ursprung des Aufstandes liegt wohl in einem wachsenden Selbstbewusstsein <strong>der</strong><br />
Stadtbevölkerung sowie in <strong>der</strong> generellen Unzufriedenheit mit dem strengen Erzbischof.<br />
Aber man wollte wohl in erster Linie nur einen gerechteren Stadtherren einsetzen, nicht<br />
den alten ersetzen.<br />
5.2.2 Heinrich IV. nach Canossa<br />
Heinrich hat bekanntlich nicht nur mit seinen Söhnen, son<strong>der</strong>n auch mit den an<strong>der</strong>en<br />
Herzögen erhebliche Probleme. So stützt er seine Macht mehr und mehr auf die Ministe -<br />
rialen und auf einzelne Städte als Gegengewicht gegen die geistlichen und weltlichen<br />
Fürsten. Damit ist er auch einige Jahre erfolgreich, kann sogar am 6. 1080 Wibert von<br />
Ravenna zum Gegenpapst einsetzen. Der krönt ihn 1084 in Rom zum Kaiser und ein<br />
Jahr später stirbt sein großer Wi<strong>der</strong>sacher Gregor VII. Der macht ihm aber sogar nach<br />
seinem Tod noch zu schaffen.<br />
Mit dem Nachfolger Urban II. und dem Gegenpapst Clemens III. gibt es zwei<br />
„politische Lager“. 1090 befand sich Heinrich IV. auf einem zweiten Italienfeldzug,<br />
nachdem die Opposition im Reich zuvor fast vollständig zusammengebrochen war. Bis<br />
1092 vermochte sich Heinrich zu halten, erfuhr dann aber durch die Truppen Mathildes<br />
eine empfindliche Nie<strong>der</strong>lage bei Canossa, sodass Urban nun den Lombardischen<br />
Städtebund reaktivieren konnte: Mailand, Cremona, Lodi und Piacenza standen jetzt<br />
gegen den Kaiser. Eine einmalige Situation.<br />
Seit 1090 in Italien, erlebte Heinrich 1093 den Abfall<br />
seines Sohnes Konrad, <strong>der</strong> 1087 in Aachen zum König<br />
gekrönt worden war. 1098 hielt Heinrich eine<br />
Reichsversammlung in Mainz, die Konrad absetzte und<br />
den jüngeren Sohn Heinrich zum Nachfolger bestimmte,<br />
<strong>der</strong> 1099 in Aachen gekrönt wurde. Konrad starb 1101 in<br />
Florenz.<br />
In Deutschland gibt es mit den Zähringern, den<br />
Staufern und den Welfen im 12. Jahrhun<strong>der</strong>t drei große<br />
Adelsgeschlechter. 1074 hat Agnes, Heinrichs Tochter,<br />
den Grafen Friedrich von Staufen geheiratet, was<br />
später Grund war, den Anspruch auf die Macht im Reich<br />
für die Staufer zu beanspruchen.<br />
1104 kommt es zur endgültigen Entmachtung<br />
Heinrichs, als er bei <strong>der</strong> Enthauptung eines Grafen in<br />
Regensburg nicht eingreift. Sein 2. Sohn, Heinrich, <strong>der</strong><br />
seit 1099 Mitregent ist, fällt auch von ihm ab; er wird<br />
gefangen genommen, muss auf den <strong>Th</strong>ron verzichten,<br />
indem er die Reichsinsignien an seinen Sohn übergibt und<br />
stirbt nach seiner Flucht nach Lüttich dort. Da<br />
exkommuniziert, wird er zunächst an einem ungeweihten<br />
Ort begraben, sein Leichnam aber später in <strong>der</strong> Krypta<br />
des Speyrer Doms beigesetzt. Heinrich IV. übergibt die Reichs-<br />
insignien an seinen Sohn<br />
5.2.3 Heinrich V. und das Ende des Investiturstreits<br />
Der Beginn <strong>der</strong> Herrschaft von Heinrich V. (†1125) war geprägt von Eintracht mit den<br />
und Anerkennung durch die Herzöge und Reichsfürsten. Als er sich dieser Anerkennung<br />
gewiss war, stellte er sich gegen den Papst und setzte die antipäpstliche Reichspolitik<br />
seines Vaters fort. Die Bischofinvestitur z.B. war noch nicht geregelt, die nach den<br />
päpstlichen Vorstellungen nur durch das Domkapitel zu erfolgen hatte und es außerdem<br />
keine Simonie geben durfte.
61<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
In Frankreich und in England hatten die Könige auf das Investiturrecht verzichtet.<br />
Heinrich dagegen war noch nicht einverstanden mit <strong>der</strong> Trennung von Spiritualien und<br />
Regalien. 1122 kam es dann im Wormser Konkordat zu einem Ausgleich zwischen<br />
Heinrich und dem amtierenden Papst Calixt II.<br />
Vorlesung vom 10.2.2006<br />
Damit war <strong>der</strong> Investiturstreit beigelegt.<br />
5. Die Län<strong>der</strong> Europas im Zeitalter des ersten Kreuzzuges (Forts.)<br />
5.2 Frankreich<br />
Die Ereignisse von 1066 haben die Entwicklung sowohl in England wie in Frankreich<br />
auf Jahrhun<strong>der</strong>te bestimmt. So gibt es in beiden Län<strong>der</strong>n die gleiche Oberschicht; in<br />
Frankreich sind es die „Normannen“, in England die „Anglonormannen“. Wilhelm behält<br />
seine Besitzungen in <strong>der</strong> Normandie, betreibt von dort aus sogar eine aktive Politik. Bei<br />
seinen Nachfolgern ist das eine beson<strong>der</strong>e „Heiratspolitik“. Aus dieser Situation sind <strong>der</strong><br />
100-jährige Krieg und eine Johanna von Orleans zu erklären.<br />
Frankreich entsteht de facto aus dem Zerfall des Karolingerreiches und ab dem 11.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t erfolgt auch ein Bruch mit dem Osten, mit dem Frankenreich. Frankreich<br />
orientiert sich also nach Westen, hin zu England und das Verhältnis bei<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> war<br />
lange von dieser Vergangenheit geprägt.<br />
5.2.4 Die Anfänge <strong>der</strong> Normannen in England<br />
Das Heer, welches 1066 in Hastings gelandet ist, soll etwa 7000 Mann stark gewesen<br />
sein. Denen standen rund 1.5 Millionen alte Einwohner gegenüber – wie konnten sich die<br />
wenigen Normannen gegen diese Überzahl behaupten? Die Situation war zunächst sehr<br />
unsicher, als sich Wilhelm Weihnachten 1066 zum König wählen ließ. Aber er machte das<br />
insofern ganz geschickt, indem er die Zeremonie von 2 Bischöfen und in englischer und<br />
in französischer Sprache vornehmen ließ.<br />
Die Krönung erfolgte per Akklamation und wegen des<br />
anschließenden Geschreis <strong>der</strong> Menge dachte die Wache an<br />
einen Aufstand. Sie ließ zur Ablenkung kurzerhand einige<br />
Häuser zur Stadt hin anzünden. Darüber berichtet – mit<br />
einigem zeitlichen Abstand – <strong>der</strong> angelsächsisch –<br />
normannische Chronist Or<strong>der</strong>icus Vitalis († 1142).<br />
Wilhelms Nachfolger haben ausschließlich normannische<br />
Bischöfe berufen; bis zum Jahr 1133 ist kein angelsächsischer<br />
Bischof bekannt. Ebenso verfuhr man bei den Äbten. Wilhelm<br />
soll sogar die Klöster um ihr gespartes Geld „erleichtert“<br />
haben.<br />
Bei den Angelsachsen gab es keine Führungspersönlichkeit,<br />
deshalb gab es auch keinen Wi<strong>der</strong>stand gegen die<br />
Normannenherrschaft. Einigen Angelsachsen wurden sogar<br />
beson<strong>der</strong>e Privilegien eingeräumt und sie wurden in staatliche<br />
Führungspositionen berufen. Und damit so ruhig gestellt, dass<br />
Or<strong>der</strong>icus Vitalis Wilhelm mehr Zeit in <strong>der</strong> Normandie (11 Jahre), als in England<br />
(10 Jahre) verbringen konnte.<br />
Trotzdem stand die normannische Herrschaft bei Wilhelms Tod im Jahr 1087<br />
bei<strong>der</strong>seits des Kanals „auf wackligen Beinen“ (<strong>Behrmann</strong>). Wilhelm hatte zwei Reiche,<br />
aber drei Söhne. So teilt er dieses Reich in einen normannischen und einen englischen<br />
Teil auf. Der Nachfolger Wilhelms wurde 1087 sein jüngerer Sohn Wilhelm II., sein<br />
älterer Sohn Robert wurde Herzog <strong>der</strong> Normandie. Das zeigt die „Wertigkeit“ für<br />
Wilhelm – er sah sich immer mehr als Normannen, denn als „Englän<strong>der</strong>“. England war für<br />
ihn so etwas wie eine Kolonie.
62<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Wilhelms jüngster Sohn Heinrich wurde später ebenfalls noch König von England, da<br />
Wilhelm II. ohne einen Erben zu hinterlassen gestorben war. Wilhelm II. wurde während<br />
einer Jagd von einem Pfeil tödlich getroffen. Ob Heinrich da etwas nachgeholfen hat, ist<br />
nicht bekannt.<br />
Robert war ein kriegerischer Typ; er folgte dem Aufruf von Papst Urban II. zum<br />
Kreuzzug spontan. Wilhelm II. war dagegen eher ein Skeptiker und Freigeist.<br />
5.2.5 Die Verwaltung des anglo – normannischen Reiches<br />
Die Normannen bauen in England eine einzigartige Verwaltung auf, die in Europa<br />
nicht ihresgleichen hat. Wilhelm schafft sich große Unterstützung und die Position des<br />
englischen Königs ist einzigartig. Wie und warum – nun, er baut das Lehnswesen extrem<br />
stark aus und schafft eine Lehnsordnung reinerer Prägung, als sonst in Europa. Obwohl<br />
es auch vor 1066 hier schon „Gefolgschaftsbindungen“ gegeben hat, wird die Loyalität<br />
und Gefolgschaftstreue <strong>der</strong> Lehnsnehmer jetzt noch stärker. Wilhelms Bru<strong>der</strong>, <strong>der</strong> Bischof<br />
Odo von Canterbury, wird größter Landbesitzer.<br />
Die größte Masse <strong>der</strong> Lehnsnehmer bilden die Barone, die ihr Land dann als Lehen an<br />
kleinere Ritter weiter geben. Immerhin verlangte Wilhelm, dass ihm 6000 Ritter zur<br />
Verfügung zu stehen hatten. Dieses Lehnswesen garantierte ihm also militärische<br />
Handlungsfähigkeit.<br />
Aber <strong>der</strong> König besaß auch eine Zentralgewalt. Um die Ausdehnung seines<br />
Herrschaftsgebietes zu ermitteln, ließ er 1085 das Domesday Book anfertigen, eine<br />
Erfassung des gesamten Grundbesitzes in England. Er teilte das Land in Grafschaften auf,<br />
<strong>der</strong>en Verwaltung er seinen Anhängern überließ. Die heutige Einteilung Englands in<br />
Counties geht auf diese Verwaltungsreform zurück.<br />
Daneben wurde die Position des Sheriffs geschaffen, die auch königliche Beamte,<br />
aber kündbar waren. Sie und im Lande herumreisende Richter garantierten eine stete<br />
Präsenz <strong>der</strong> Zentralverwaltung bzw. des Königs. Außerdem entstanden um 1100 erste<br />
weitere Ämter im königlichen Haushalt, vor allem Exchequer (Schatzamt). Diese<br />
versammelten jedes Jahr zu Ostern die Sheriffs bei sich und sammelten <strong>der</strong>en<br />
Einnahmen ein. Indem die Beutel mit dem Geld auf ein schachbrettartig gemustertes<br />
Tuch gestellt wurden – auf jedes Feld eins – und <strong>der</strong> Ertrag dann in die sog. „pipe roll“<br />
eingetragen wurde. Ein Brauch, <strong>der</strong> bis ins frühe 19. Jahrhun<strong>der</strong>t fortgeführt worden ist.<br />
Die älteste erhaltene „pipe roll“ stammt aus dem Jahr 1130.<br />
5.2.6 Ein Kaufmann um 1100 / <strong>der</strong> heilige Goddrick<br />
Goddrick wurde 1069 in Norfolk geboren, war erst Bauer, später Kaufmann. Er<br />
pilgerte nach St. Andrews in Schottland und auch nach Rom. Reisen führten ihn nach<br />
Flan<strong>der</strong>n und nach Dänemark. Er kaufte sich Anteile an einem Handelsschiff und ist mit<br />
¼-tel am Gewinn beteiligt. Später nimmt er das Kreuz und pilgert nach Jerusalem und<br />
nach Santiago de Compostela. Auf diesen Wegen habe Gott ihn vor „Räubern und<br />
Teilhabern geschützt“ (<strong>Behrmann</strong>).<br />
5.2.7 Das französische Königtum im Übergang<br />
Von den französischen Königen des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts ist wenig zu berichten. Sie<br />
entstammen <strong>der</strong> <strong>Familie</strong> <strong>der</strong> Kapetinger und <strong>der</strong> König ist im Grund nur einer unter den<br />
Herzögen des Landes. Aber in 3-4 Generationen entwickelt sich die mächtigste Dynastie<br />
in Europa. Die gesicherte Erbfolge kann man hier als Begründung angeben. Zwischen den<br />
Jahren 1060 und 1180 erlebt Frankreich nur 3 Könige. In Deutschland sind es 5, mit den<br />
Gegenkönigen sogar 8.<br />
Man konnte die Krondomäne arrondieren und eine Schicht königstreuer Beamter bildet<br />
sich. So war <strong>der</strong> Abt Suger von St. Denis – zusammen mit Ludwig VI. erzogen – dessen
63<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
„rechte Hand“, sein Organisator, Ratgeber und Baumeister. Und Paris wird immer mehr<br />
zum bevorzugten Aufenthaltsort für den König.<br />
Nur die Präsenz des englischen Königs stört.<br />
5.2.8 Autobiographie und Stadtentwicklung bei Guibert von Nogent<br />
Guibert von Nogent (ca. 1055-1125), jüngster Sohn einer hochadligen <strong>Familie</strong> <strong>der</strong><br />
Pikardie, trat mit ungefähr 12 Jahren in das Kloster Saint-Germer-de Fly ein und wurde<br />
1104 Abt des Marienklosters Nogent-sous-Coucy.<br />
Seine Autobiographie De vita sua sive monodiae (1114-17 geschrieben) ist die<br />
erste umfassende Autobiographie, die uns aus <strong>der</strong> mittellateinischen<br />
Literatur überkommen ist, geschrieben im „Ich-Stil“ und in<br />
Anlehnung an Augustins „Confessiones“. Im dritten Buch erzählt er<br />
die Geschichte des Kommuneaufstandes und des Bischofsmordes von<br />
Laon, die sich zur Regionalgeschichte ausweitet und liefert eine Fülle<br />
an Detailinformationen.<br />
Der Bischof von Laon war seit dem 6. Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>der</strong> mächtigste<br />
Feudalherr <strong>der</strong> Region. Faktisch teilte er sich die Macht mit dem<br />
König. Im Jahr 1106 wurde <strong>der</strong> aus einer örtlichen Adelsfamilie stammende Wal<strong>der</strong>ich auf<br />
Betreiben König Philipp I. gegen den Kandidaten des Domkapitels zum Bischof von Laon<br />
gewählt. Dieses Fehlverhalten von Bischof und König bringt ihnen den Vorwurf <strong>der</strong><br />
Simonie ein. Trotzdem erklärt Papst Paschalis II. die Wahl für rechtmäßig.<br />
Im Jahr 1112 ließ Wal<strong>der</strong>ich den Kastellan Gerard von Quierzy unter Bruch des<br />
Gottesfrieden ermorden. Er selbst befindet sich auf einer Reise nach Rom und kann so<br />
jeden Verdacht von sich lenken. Die beiden Täter wurden aus <strong>der</strong> Stadt vertrieben und<br />
ihr Besitz beschlagnahmt. Spätestens jetzt zerfällt die Einwohnerschaft <strong>der</strong> Stadt in zwei<br />
Lager, wobei <strong>der</strong> Riss sich quer durch den Klerus, den Adel und die Bürgerschaft zieht.<br />
Wal<strong>der</strong>ich verzögerte nicht nur das Interdikt gegen die Mör<strong>der</strong>, seine Sympathisanten,<br />
son<strong>der</strong>n belegte die Rächer des Mordes sogar mit dem Bann. Der König hatte den Bischof<br />
<strong>der</strong> Mittäterschaft verdächtigt und alle Lebensmittelvorräte des Bischofspalastes<br />
konfiszieren lassen. Die Lage in <strong>der</strong> Stadt destabilisierte sich <strong>der</strong>art, dass niemand mehr<br />
seines Hab und Gutes sicher sein konnte.<br />
Ein Großteil <strong>der</strong> Laoner Bürger und <strong>der</strong> unabhängige Klerus hatten kurz vor <strong>der</strong><br />
Rückkehr des Bischofs aus Rom eine „Kommune“ („Dieses neuartige, scheußliche Wort“ –<br />
so <strong>der</strong> Bischof) gebildet. Dabei handelte es sich nicht um eine bürgerliche Gemeinde<br />
mo<strong>der</strong>ner Prägung, son<strong>der</strong>n um ein Schutzbündnis. Ein Freibrief von 1111 besiegelt das<br />
Bündnis.<br />
Dem Bischof genügen nun die ihm aus diesem Bündnis zufließenden Einnahmen nicht<br />
und er schröpft die Handwerker und Kaufleute, indem er Handelswaren und Naturalien<br />
mit min<strong>der</strong>wertigem Geld aus seiner Münze unterwertig bezahlen ließ. Die Stimmung<br />
heizte sich mehr und mehr auf und die Bürger rotteten sich zusammen. Am 25. April<br />
1112 drangen sie unter dem Ruf „Kommune, Kommune“ gegen den Bischofpalast vor.<br />
Der Bischof versteckte sich in den Gewölben des Domes in einem Fass, wurde aber<br />
trotzdem aufgespürt und mit einer Streitaxt erschlagen.<br />
5.2.9 Von Cluny nach Citeaux<br />
Die Anfänge <strong>der</strong> Zisterzienser / Bernhard von Clairveaux<br />
Die Kirche als Institution entwickelt sich weiter, das Mönchtum bildet sich – es gab<br />
also eigentlich immer so etwas wie eine Reform. Seit etwa 1100 kann man „von <strong>der</strong><br />
Kirche an sich“ sprechen (<strong>Behrmann</strong>). Beson<strong>der</strong>s zu nennen ist die cluniazensische<br />
Reform, eine vom burgundischen Benediktinerkloster Cluny ausgehende geistliche<br />
Reformbewegung des Hochmittelalters, die zuerst das Klosterleben und dann das<br />
Papsttum erfasste.
64<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Die Hauptgedanken <strong>der</strong> Reform waren:<br />
• strenge Beachtung <strong>der</strong> Benediktsregel<br />
• größte Gewissenhaftigkeit beim Opus Dei, den täglichen Gottesdiensten<br />
• Vertiefung <strong>der</strong> Frömmigkeit des einzelnen Mönches.<br />
Daneben standen eine Reform <strong>der</strong> Klosterwirtschaft und Loslösung <strong>der</strong> Klöster aus dem<br />
Herrschaftsanspruch <strong>der</strong> Bischöfe; die Klöster wurden direkt dem Schutz des Papstes<br />
unterstellt. Im Streit zwischen Kaiser und Papst (Investiturstreit) unterließ es Cluny,<br />
Partei zu ergreifen, stand aber in Fragen <strong>der</strong> Simonie und des Zölibats auf Seiten <strong>der</strong><br />
Reformpäpste.<br />
Ein „Leben in <strong>der</strong> Nachfolge Christi“ gefiel dem ortsansässigen Adel und <strong>der</strong> bedachte<br />
das Kloster mit großzügigen Landschenkungen.<br />
Robert von Molesme († 1111) stammte aus einem<br />
Adelsgeschlecht, wurde 16jährig Benediktinermönch,<br />
später Prior von Moutier-la-Celle, 1060 Abt in St-Michel-<br />
Tonnerre. Er gründete 1075 die Abtei Molesme. Er<br />
verließ Molesme infolge innerer Schwierigkeiten, um 1098<br />
das Reformkloster Citeaux zu stiften und dessen erster<br />
Abt zu werden. Von Citeaux ging 1115 durch Bernhard<br />
von Clairveaux († 1153) <strong>der</strong> Zisterzienserorden aus,<br />
Robert gilt deshalb als einer <strong>der</strong> Väter des Ordens.<br />
Bernhard wird nun die treibende Kraft für weitere<br />
Klosterneugründungen <strong>der</strong> Zisterzienser. Die seit <strong>der</strong> Mitte<br />
des 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts eine rasante Ausbreitung erfahren<br />
und zum wichtigsten Orden in Europa werden. Bernhard,<br />
eine charismatische Persönlichkeit, kann Kaiser Konrad<br />
II. zum Kreuzzug „überreden“.<br />
Die Zisterzienser sind zu „Agrarpionieren“ geworden<br />
(<strong>Behrmann</strong>), ihre Klöster gleichen sich alle und sie liegen<br />
Bernhard von Clairveaux auch alle in ähnlichen Landschaften. Die Ausbreitung des<br />
Ordens bringt es mit sich, dass er später zu reich wird!<br />
Fazit: Was bleibt vom 11. Jahrhun<strong>der</strong>t?<br />
Die betrachtete Zeit liegt jetzt rund 1000 Jahre zurück. Vieles Geschehen blieb nur<br />
Geschichte. So blieb z.B. „Canossa“ ohne Folgen und man muss sich fragen, ob wohl<br />
schon die nächste Generation überhaupt davon gewusst hat. Es steht zu vermuten, dass<br />
erst im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t dieser Vorgang einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde<br />
(Bismarck).<br />
Ebenso blieb die Säkularisation ohne Antwort <strong>der</strong> Kirche. Selbst die Reconquista hat<br />
kaum bleibende Verän<strong>der</strong>ungen bewirkt. Höchstens alte Formen getilgt o<strong>der</strong> überformt<br />
(Mesquita in Córdoba). Und die Kreuzzüge haben höchsten den wirtschaftlichen<br />
Aufschwung in Italien verstärkt.<br />
Fragt man nach den Gründen, so sind diese vielfältig. Die Unkenntnis <strong>der</strong> Verhältnisse<br />
z.B. im Osten lässt eine falsche Berichterstattung über die Seldschuken entstehen. Dann<br />
hat sich das Verhältnis von Kirche und Staat zugunsten des Staates verschoben. 1303<br />
konnte <strong>der</strong> französische König Philipp IV. noch den Papst Bonifaz VIII. gefangen setzen –<br />
hier wird die ganze Spannbreite <strong>der</strong> Möglichkeiten deutlich. Ein „Canossagang“ ist seit<br />
dem Spätmittelalter nicht mehr denkbar.<br />
Und natürlich beeinflusst die Kopplung von industrieller Entwicklung und Demokratie<br />
die Entwicklung entscheidend. Diese demokratischen Prozesse bringen neue<br />
Umgangsformen untereinan<strong>der</strong> mit sich.<br />
Die Ereignisse von 1066 haben über Jahrhun<strong>der</strong>te die Entwicklung überdauert. Evident<br />
(offenkundig) ist auch die Stadtentwicklung; heutige Stadtkerne haben sehr oft<br />
mittelalterliche Wurzeln. Fassbar bleiben auch die Kirchenbauten, die während <strong>der</strong><br />
„Romanik“ entstanden sind. Beispiele sind St. Michael in Hildesheim, <strong>der</strong> Speyrer und <strong>der</strong>
65<br />
Klaus <strong>Donndorf</strong>, Ostfeld 5, 59174 Kamen<br />
Europa im Aufbruch des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Dr. <strong>Th</strong>omas <strong>Behrmann</strong> / WS 2005 / 06<br />
Kölner Dom; Münsters Dom (unten) nicht zu vergessen. Auch die überkommenen<br />
Skulpturen und <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>schmuck übermitteln einen Eindruck vom Empfinden dieser<br />
Zeit.<br />
Ende <strong>der</strong> Vorlesung