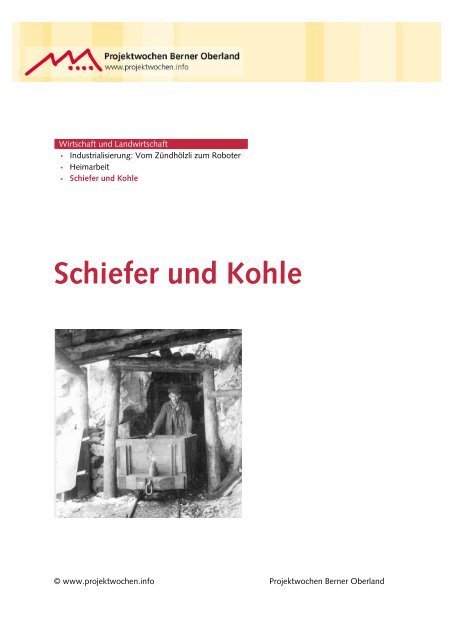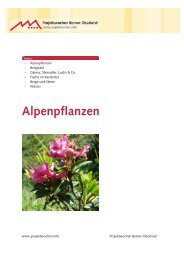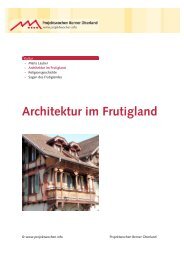Schiefer und Kohle - Projektwochen Berner Oberland
Schiefer und Kohle - Projektwochen Berner Oberland
Schiefer und Kohle - Projektwochen Berner Oberland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wirtschaft <strong>und</strong> Landwirtschaft<br />
• Industrialisierung: Vom Zündhölzli zum Roboter<br />
• Heimarbeit<br />
• <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong><br />
<strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong><br />
© www.projektwochen.info <strong>Projektwochen</strong> <strong>Berner</strong> <strong>Oberland</strong>
Bergbau<br />
Inhalt<br />
Bergbau im Engstligental <strong>und</strong> Kandertal<br />
Frutiger <strong>Schiefer</strong><br />
Dachschiefer in Mülenen<br />
Privater <strong>Schiefer</strong>abbau: Standorte<br />
<strong>Schiefer</strong>grube Gantenbach bis 1922<br />
<strong>Schiefer</strong>grube in der Wildi<br />
<strong>Schiefer</strong>leute<br />
Krankheiten<br />
<strong>Schiefer</strong>tafelfabrik Frutigen: Geschichte<br />
<strong>Kohle</strong>: Entstehung – Vorräte – Nutzung<br />
Verschiedene <strong>Kohle</strong>n<br />
<strong>Kohle</strong> in der Schweiz<br />
<strong>Kohle</strong> im Kandertal – Geschichte bis 1930<br />
<strong>Kohle</strong> im <strong>und</strong> nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
Lindi<br />
Horn<br />
Schlafegg<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 1
Bergbau<br />
Salpeter <strong>und</strong> Schwefel:<br />
Rohstoff für<br />
Schiesspulver<br />
<strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> im Frutigland<br />
1486 erhielten einige Leute das Recht „der Berg zu frutigen“ nach<br />
Mineralien abzusuchen. Doch ist weder über Personen, noch<br />
Suchorte <strong>und</strong> Erfolg etwas bekannt.<br />
Der Auftrag kam aus Bern an die einheimischen Bauern: sie sollten<br />
auf der Engstligenalp nach Gold, Silber, Kupfer, Mineralien <strong>und</strong> Salz<br />
suchen. Hinweise fehlen, ob diese Aktion erfolgreich war <strong>und</strong><br />
Bergbau ausgelöst hat.<br />
Mit dem Aufkommen der Schusswaffen brauchte man<br />
Schiesspulver. Bern wurde wegen seines qualitativ guten<br />
Bernpulvers benieden.<br />
Auch im Amt Frutigen grub man erfolgreich nach Salpeter. Im 17.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert versuchten fünf Unternehmer ihr Glück. Bereits 200<br />
Jahre später konnten 30 Männer ihre Familien vom Salpeterabbau<br />
ernähren. In Rinderwald findet man heute noch einen Ort mit<br />
Namen „Salpeterweidli“<br />
Schwefel war der zweite wichtige Rohstoff zur Herstellung von<br />
Pulver. Venner Willading eröffnete während des Dreissigjährigen<br />
Krieges in Krattigen eine Grube zur Schwefelgewinnung. Jährlich<br />
holte man bis zu 60 Zentner Schwefel aus dem Berg.<br />
Später wurde dieser Rohstoff auch im Ueschinental oberhalb von<br />
Kandersteg abgebaut.<br />
Bauern, Färber, Schuhmacher nutzten das durch die lange<br />
Verwitterung entstandene Vitriol als schwarze Farbe.<br />
„Der Schwefel, der aus den Läuterhafen gekommen, war ziemlich<br />
schön, so dass ich nicht glaube, dass jemals an einem Ort<br />
Schweffel gesehen oder gemacht worden, der diesen an Schönheit<br />
<strong>und</strong> Güte übertroffen.“<br />
Die weiten Transportwege <strong>und</strong> die geringe Seriosität des Betreibers<br />
führten zur Schliessung.<br />
Schwerzilöcher hinten im Ueschinental <strong>und</strong> das Spitzbüebi in<br />
Kandersteg zeugen noch vom Bergbau.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 2
Bergbau<br />
Schwerzilöcher im<br />
hinteren Ueschinental<br />
(Schwefel)<br />
Übersicht Geologie<br />
<strong>Schiefer</strong> Das Kander- <strong>und</strong> Engstligental ist geologisch ein interessantes <strong>und</strong><br />
vielfältiges Tal. <strong>Schiefer</strong> finden wir vor allem im Gestein der<br />
Niesenkette. Diese besteht vor allem aus mergligen Flysch-<br />
<strong>Schiefer</strong>n.<br />
Die <strong>Schiefer</strong>bänder reichen von Heustrich (700 m.ü.M.) bis zum<br />
Albristhorn (ca. 2700 m.ü.M.)<br />
Das Alter der <strong>Schiefer</strong> ist schwierig zu bestimmen, da darin kaum<br />
Fossilienabdrücke zu finden sind.<br />
Schreibschiefer Frutigschiefer ist ein Tonschiefer mit einem Karbongehalt von r<strong>und</strong><br />
57%. Die Spaltbarkeit ist hoch. Der <strong>Schiefer</strong> ist relativ weich <strong>und</strong><br />
schwer. Als Schreibschiefer wurde er in ganz Europa verwendet<br />
<strong>und</strong> geschätzt.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 3
Bergbau<br />
<strong>Schiefer</strong>grubenstandorte<br />
Dachschiefer Als Ersatz von Dachziegeln, deren Brennen sehr viel Holz<br />
verbrauchte, so dass dieses aus grosser Distanz hergebracht werden<br />
musste, deckte man die Dächer mit <strong>Schiefer</strong>platten.<br />
1786 befahl der Schlossherr von Spiez, von Erlach, in Mülenen<br />
Dachschiefer abzubauen. Er wollte damit sein Bootshaus decken.<br />
Trotz einem strengen Winter machte man mit diesem<br />
Bedachungsmaterial gute Erfahrungen.<br />
Zehn Jahre später bewilligte die <strong>Berner</strong> Regierung die Ausbeutung<br />
bei Mülenen. Rasch hatte man Erfolg: bis zu 15 Männer arbeiteten<br />
im Werk.<br />
Der Sturz des Alten Berns brachte die Ausbeutung zum Erliegen.<br />
Erst ab 1805 wurde im Klöpfligraben am Niesen in grösserem<br />
Umfang wieder Dachschiefer abgebaut.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 4
Bergbau<br />
Haus mit Steinplatten<br />
Frachtbrief<br />
„Der <strong>Schiefer</strong> ist graulich schwarz <strong>und</strong> enthält stets etwas Kalk, so<br />
dass er als thoniger Mergelschiefer betrachtet werden muss. Seine<br />
Festigkeit <strong>und</strong> Spaltbarkeit sind sehr verschieden. Zuweilen ist sein<br />
Zusammenhalt so locker, dass er in der Hand zerbröckelt <strong>und</strong> durch<br />
atmosphärische Zerstörung oder die Gewalt der Bergwasser zu<br />
Schuttgebirgen zerrieben wird. Derselbe lässt sich mit Vortheil als<br />
Dachschiefer benutzen <strong>und</strong> wird auch zu diesem Zwecke in<br />
mehreren Gruben ausgebeutet. Die zwei bedeutendsten, welche<br />
ein Dachschieferflöz von 6-8 fuss Mächtigkeit abbauen, befinden<br />
sich zu Mülenen an der südöstlichen Ecke des Niesen <strong>und</strong><br />
beschäftigen gegen 60 Arbeiter. Der Betrieb geschieht auf<br />
Rechnung des Staates.“<br />
Jährlich wurden über eine Million Dachziegel hergestellt. Dass diese<br />
Arbeit für das Tal von Bedeutung war zeigen die 800‘000<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 5
Bergbau<br />
ausbezahlten Taglöhne in den staatlichen Gruben.<br />
1832 mussten die Gruben bei Mülenen mangels Aufträgen erstmals<br />
geschlossen werden. Zudem gingen die abbauwürdigen<br />
Vorkommen zur Neige.<br />
Der Bau von Eisenbahnen in der Schweiz ermöglichte es, billigere<br />
Konkurrenzprodukte einzuführen. Doch gerade der Bau von<br />
Bahnhöfen verhalf den staatlichen <strong>Schiefer</strong>gruben wieder zu<br />
Aufträgen, denn viele Bahnhofdächer wurden mit <strong>Schiefer</strong>platten<br />
aus Mülenen gedeckt. Doch die stürmische Zeit der Bahnbauten<br />
war von kurzer Dauer.<br />
Sonderb<strong>und</strong>skrieg <strong>und</strong> Teuerung führten zum Einbruch der<br />
Verkäufe. Zudem merkte man, dass der weiche <strong>Schiefer</strong> aus dem<br />
Engstligental stark verwitterte <strong>und</strong> als Dachschiefer nicht besonders<br />
geeignet war.<br />
Ein starkes Erdbeben erschütterte 1855 weite Teile des <strong>Berner</strong><br />
<strong>Oberland</strong>es <strong>und</strong> verursachte den Einsturz mehrerer Stollen des<br />
<strong>Schiefer</strong>bergwerkes Mülenen.<br />
Man versuchte das Bergwerk noch zu retten. Die Konkurrenz aus<br />
dem Kanton Glarus <strong>und</strong> aus dem Ausland zwang die Betreiber von<br />
Mülenen trotz staatlicher Zuschüsse zum Aufgeben.<br />
1868 Wurde die Ausbeutung von Dachschiefer nach einem<br />
Beschluss des Grossen Rates definitiv eingestellt.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 6
Bergbau<br />
Niesenkette<br />
Der Abbau des „grauen<br />
Goldes“ lag in privaten<br />
Händen<br />
Privater <strong>Schiefer</strong>abbau<br />
1837/38, zehn Jahre nach dem Dorfbrand Frutigen, reisten aus<br />
dem Glarnerland die <strong>Schiefer</strong>tafel- <strong>und</strong> Griffelmacherfamilien Elmer<br />
<strong>und</strong> Marti ins Frutigland.<br />
Sie brachten Wissen <strong>und</strong> technische Fähigkeiten mit <strong>und</strong> trugen so<br />
zur erfolgreichen <strong>Schiefer</strong>ausbeutung in den Gräben des<br />
Engstligentales bei.<br />
Nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten konnte der<br />
Regierungsstatthalter 1853 freudig melden, dass der neue<br />
Erwerbszweig zu den lukrativen Beschäftigungen gezählt werden<br />
kann. Etwa 20 arme Haushaltungen beschäftigen sich damit. Der<br />
aus der Arbeit fliessende Verdienst ist gut, da die <strong>Schiefer</strong> guten<br />
Absatz finden. Ganze Fuder von Tafeln gehen hier wöchentlich fort,<br />
hauptsächlich nach den Kantonen Freiburg, Waadt, Genf <strong>und</strong><br />
Neuenburg.“<br />
Erfolge 1854 erreichte die Produktion 100'000 <strong>Schiefer</strong>tafeln, 450'000<br />
gefärbte <strong>und</strong> 550'000 ungefärbte Griffel. R<strong>und</strong> 80 Personen<br />
arbeiteten in den <strong>Schiefer</strong>stollen des Tales.<br />
1898 baute Hermann Moser in Kanderbrück die erste<br />
<strong>Schiefer</strong>tafelfabrik.<br />
Zuvor <strong>und</strong> auch weitgehend nachher wurden aber <strong>Schiefer</strong>tafeln<br />
<strong>und</strong> Griffel weitgehend in Heimarbeit verarbeitet.<br />
Von Frutigen kamen die Fabrikate in den Handel.<br />
Oberlehrer Johann Egger hatte in allen Kantonen Abnehmer dafür<br />
gef<strong>und</strong>en.<br />
Er versah als erster die <strong>Schiefer</strong>tafeln mit einer roten Lineatur. Die<br />
Tafeln wurden seinerzeit „Eggertafeln“ genannt.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 7
Bergbau<br />
<strong>Schiefer</strong>hütten<br />
Die Grubenbesitzer in den Spissen brachten die rohen, aber glatt<br />
geschabten <strong>Schiefer</strong> ins Dorf. Die Tafeln erhielten zuerst einen<br />
dünnen Überzug aus Gummilösung. Dann wurde unter<br />
Zuhilfenahme von Eisengittern die gewünschte Lineatur eingeritzt.<br />
Nachher wurde die ganze Tafel mit einer mennigroten Farbe<br />
überzogen. Nach deren Eintrocknen wurde sie in heissem Wasser<br />
abgewaschen. In den eingeritzten Rillen blieb nun die Farbe haften,<br />
währendem die Tafel ihre schwärzliche Farbe zurückerhielt. Die<br />
Rahmen wurden von Kleinbauern im Nebenerwerb zuhause<br />
hergestellt <strong>und</strong> dann den fertigen tafeln angefügt.“<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 8
Bergbau<br />
Lagerhäuser<br />
Die neue Spiez-Frutigen-Bahn erleichterte <strong>und</strong> verbilligte die<br />
Transporte.<br />
1911 wurden 233 Eisenbahnwagen <strong>Schiefer</strong>tafeln aus dem Tal<br />
geführt. 250 Arbeiter verdienten ihr Brot mit dem <strong>Schiefer</strong>.<br />
Während dem ersten Weltkrieg wurde die <strong>Schiefer</strong>ausbeutung<br />
eingestellt. Danach wurde aber wieder gearbeitet.<br />
1926 wurde die <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik Frutigen AG gegründet <strong>und</strong><br />
verlegte die Produktion 1937 nach Rybrügg. Die Gesellschaft baute<br />
<strong>Schiefer</strong> im Gantengraben <strong>und</strong> im Braatschi an Ried ab.<br />
Der zweite Weltkrieg brachte erneut einen Einbruch. Trotzdem<br />
gründeten Robert Haug <strong>und</strong> die Gebrüder Rhyner <strong>und</strong> Schmid die<br />
Belardoise <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik AG. Nach einem Aufschwung gingen<br />
die Exporte aber wieder zurück.<br />
1967 übernahm die <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik AG die Gruben von R. Haug<br />
in der Ladholzwildi. Der Niedergang in der einst bedeutenden<br />
Industrie war nicht aufzuhalten.1977 musste die letzte Grube<br />
geschlossen werden. <strong>Schiefer</strong>tafeln wurden in den Schulen nicht<br />
mehr gebraucht.<br />
In Rybrügg stellen wenige Arbeiter noch geringe Mengen von Jass-<br />
<strong>und</strong> Notiztafeln her. Natursteine werden zu Tischplatten <strong>und</strong><br />
Abdeckungen zugeschnitten.<br />
Werke Gantenbach<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 9
Bergbau<br />
Werk Gantenbach<br />
Während mehreren Jahrzehnten wurde in Gruben im Gantenbach<br />
<strong>Schiefer</strong> abgebaut. Die Gruben waren recht ergiebig <strong>und</strong> der<br />
<strong>Schiefer</strong> von hoher Qualität.<br />
Zum Aufschwung des <strong>Schiefer</strong>abbaus trug auch der Bau der Spiez-<br />
Frutigen-Bahn bei.<br />
Am guten Geschäft wollten nun auch Leute von ausserhalb des<br />
Tales teilhaben.<br />
Die <strong>Schiefer</strong>werker Emil Trummer, Steiner <strong>und</strong> Schmid <strong>und</strong> die<br />
Direktoren August Sidler <strong>und</strong> Ingenieur Paul Wiehn aus Zürich<br />
beauftragten den Konservator des Naturhistorischen Museums<br />
Bern, Herr Eduard Gerber, ein Gutachten zu den<br />
<strong>Schiefer</strong>vorkommen am Gantenbach, am Bräschgenbach <strong>und</strong> in den<br />
Gräben von Zwischenbäch zu erstellen.<br />
Nach einigen Begehungen fand Gerber aber, die Gruben seien<br />
primitiv <strong>und</strong> unzweckmässig.<br />
Er fand aber vier Bänder, die bergeinwärts führten mit <strong>Schiefer</strong> von<br />
guter Qualität. Diese eigneten sich für den Abbau.<br />
Der hier sich vorfindende <strong>Schiefer</strong> eignet sich ausgezeichnet zu<br />
Schreibtafeln, da er vor allem eine tiefschwarze Naturfarbe , wenig<br />
oder fast keine fremden, störenden Bestandteile wie Schwefelkies<br />
hat, sich in Platten sehr leicht <strong>und</strong> glatt spalten <strong>und</strong> infolge seines<br />
feinen Korns <strong>und</strong> bestgeeigneter Härte sich hervorragend<br />
schneiden, schleifen, schaben, polieren, überhaupt veredeln lässt.<br />
Ein gewisser Grad von Elastizität verhütet das leichte Brechen<br />
sowohl bei der Bearbeitung als beim Fertigfabrikat. Er besitzt also in<br />
weitestem Masse alle guten Eigenschaften, die ein<br />
Schreibtafelschiefer haben soll. Er eignet sich nicht zu Dachschiefer,<br />
weil der Gehalt an <strong>Kohle</strong>säure zu gross ist <strong>und</strong> die Verwitterung ihn<br />
aufblättert.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 10
Bergbau<br />
Grubengebäude<br />
Die <strong>Schiefer</strong>zone mit Zwischenlagerungen aus anderem Gestein<br />
hatte eine Mächtigkeit von r<strong>und</strong> vierzig Metern. Die Länge schätze<br />
er auf 7500m <strong>und</strong> die Breite auf 600m, wobei die Besitzungen am<br />
Gantenbach mitten in dieser Zone lagen. Gerber schätzte die<br />
Menge auf ein Volumen von 1’000’000 m³.<br />
Seine Schlussfolgerung erstaunt daher nicht, dass „ein<br />
hochrentables, sicheres Bergwerkunternehmen in unserem<br />
Vaterland entstehen wird, da ein vorzüglicher <strong>Schiefer</strong> in<br />
gewaltiger Menge auf viele Jahre hinaus vorhanden ist. Deshalb –<br />
Glück auf.“<br />
1907 wurde in Zürich die <strong>Schiefer</strong>bau AG gegründet mit einem<br />
Aktienkapital von 400'000 Franken, dies zu einer Zeit als<br />
Tageslöhne um die vier Franken ausbezahlt wurden. Mit Aussichten<br />
auf hohe Gewinne kaufte man die Besitzungen im Gantenbach.<br />
Von der geschätzten menge abbaubaren <strong>Schiefer</strong>s musste man mit<br />
Verlusten durch wilden <strong>Schiefer</strong> von 60% rechnen. Für einen<br />
Eisenbahnwagen von 10‘000 Kilo brauchte man 10 m³, oder<br />
26‘000 kg Rohschiefer. Der Verkaufspreis für eine Tonne Tafeln<br />
betrug 950 Franken.<br />
Mutig liessen die Investoren grosszügige Anlagen für den Abbau,<br />
die Verarbeitung <strong>und</strong> den Transport erstellen: eine Seilbahn mit<br />
Förderwagen, der <strong>Schiefer</strong>weg wurde verbreitert, Brücken <strong>und</strong> eine<br />
eigene Wasserversorgung mussten gebaut werden, <strong>und</strong> ein<br />
zweistöckiges Hauptgebäude wurde erstellt. Man konnte von<br />
einem industriellen betrieb sprechen.<br />
Das im Juni 1913 gegründete <strong>Schiefer</strong>tafel-Werk Frutigen<br />
übernahm die Anlagen. Die Firma arbeitet mit mässigem Erfolg. Um<br />
die Rentabilität zu steigern, versuchte man das <strong>Schiefer</strong>mehl<br />
„Grisin“ zu vertreiben. Diese sollte als Füllmaterial <strong>und</strong> bei der<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 11
Bergbau<br />
Grisin<br />
Herstellung von Dachpappe zum Einsatz kommen, ebenso in der<br />
Farbindustrie.<br />
Die Erwartungen der Besitzer erfüllten sich nicht <strong>und</strong> 1922 musste<br />
die Gesellschaft aufgelöst werden.<br />
<strong>Schiefer</strong>gruben in der Wildi<br />
Sie umfassten die Gruben Schwendi <strong>und</strong> Gräbli im Sackgraben<br />
zwischen Rinderwald <strong>und</strong> Ladholz.<br />
<strong>Schiefer</strong>leute<br />
Heinrich Pestalozzi hatte das Schreiben mit dem Griffel auf<br />
<strong>Schiefer</strong>tafeln empfohlen <strong>und</strong> damit der <strong>Schiefer</strong>ausbeutung in den<br />
Frutigspissen geebnet.<br />
Das weiche Rohmaterial stammte ausschliesslich aus diesen Gräben<br />
<strong>und</strong> Gruben. Mit der Empfehlung des Bernischen Regierungsrates<br />
von 1832 „einige h<strong>und</strong>ert <strong>Schiefer</strong>tafeln, vorzüglich für Schulen,<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 12
Bergbau<br />
<strong>Schiefer</strong>leute<br />
<strong>Schiefer</strong>leute<br />
fertigen zu lassen“ begann eine neue Zeit der <strong>Schiefer</strong>ausbeutung.<br />
Das Bergbaugesetz von 1834 verlangte keine behördliche<br />
Bewilligung für den <strong>Schiefer</strong>abbau. So konnten die Spisser-Bauern<br />
nach belieben nach <strong>Schiefer</strong>platten graben. Diese brachten sie nach<br />
Frutigen zu den Händlern. Diesen Verdienst verdankten sie auch<br />
den Griffelmacher-Familien Marti <strong>und</strong> Elmer, die 1837 nach<br />
Frutigen zogen.<br />
Mitte des 19. Jh. stockte der Absatz wegen der ausländischen<br />
Konkurrenz. Wiederum war es ein Glarner, Hilarius Rhyner, der den<br />
Frutigern zu neuem Aufschwung verhalf. Im Reisegepäck brachte er<br />
noch ein ansehnliches Sümmchen Geld mit. Er kannte zudem<br />
Adressen von K<strong>und</strong>en des Elmer <strong>Schiefer</strong>s. Zuerst betätigte er sich<br />
als Händler <strong>und</strong> Fuhrhalter <strong>und</strong> wurde erst später Grubenbesitzer.<br />
Die Firma lief unter dem Namen Gebrüder Rhyner AG <strong>und</strong> wurde<br />
von seinen Söhnen Gottlieb <strong>und</strong> Georg weitergeführt. Paul, Sohn<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 13
Bergbau<br />
Robert Haug<br />
Grubenbesitzer von<br />
1939 - 1967<br />
von Gottlieb leitete die Mechanisierung <strong>und</strong> die Elektrifizierung mit<br />
eigenem Strom in der Egerlen-Grube.<br />
Er starb 1968.<br />
Zu den Grubenbesitzern gehörten auch die Haugs. Robert Haug-<br />
Berger übernahm, 1939 die Grube in der Ladholzwildi von seinem<br />
Vater.1951 übernahm er auch noch die Gruben der Rhyners.<br />
Robert Haug wurde von den Grubenarbeitern geschätzt. Er setzte<br />
sich für diese ein. Mit dem Mechaniker Hans Wäfler entwickelte<br />
<strong>und</strong> konstruierte er eine Seilbahn. Dank dieser von der SUVA<br />
bewilligten Seilbahn mussten die Arbeiter nicht mehr durch<br />
lawinengefährderte Gräben zu Fuss zu den Arbeitsstellen gelangen.<br />
1967 übernahm die <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik Frutigen die <strong>Schiefer</strong>gruben<br />
Haug.<br />
1977 wurden im Engstligental die letzten <strong>Schiefer</strong>gruben<br />
geschlossen.<br />
Aus dem Vorrat stellt die <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik noch Jass- <strong>und</strong><br />
Notiztafeln her.<br />
Für bauliche Zwecke wird der härtere <strong>Schiefer</strong> aus Italien verwendet<br />
(Dächer, Tischplatten, Fensterbänke, Böden etc.).<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 14
Bergbau<br />
Mädchen<br />
Krankheiten<br />
Staublunge – Silikose Im Frutigbuch (Ausgabe 1938) wird das Thema nicht erwähnt Es<br />
steht nur „schwere Arbeitsunfälle kamen in unseren <strong>Schiefer</strong>gruben<br />
verhältnismässig selten vor.“<br />
1907 schlossen sich die 29 Grubenbesitzer zur Gründung einer<br />
„Unfallkasse der <strong>Schiefer</strong>brüche Frutigen“ zusammen. Durch die<br />
Gründung der obligatorischen Unfallversicherung wurde diese<br />
Selbstversicherung überflüssig<br />
Auch im neuen Frutigbuch von 1977 ist im Abschnitt<br />
<strong>Schiefer</strong>industrie nichts über die Staublungen-Krankheit zu finden.<br />
Heute kann man über <strong>Schiefer</strong>industrie <strong>und</strong> <strong>Schiefer</strong>abbau nicht<br />
schreiben, ohne das Thema Staublunge (Silikose)zu erwähnen.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 15
Bergbau<br />
Theo Bircher<br />
Für die Männer in den Spissen war die Arbeit in den Gruben ein<br />
notwendiger <strong>und</strong> willkommener Verdienst, um überhaupt existieren<br />
<strong>und</strong> in den Spissen bleiben zu können<br />
Leider haftete an diesem Verdienst eine schwere ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Schädigung: Staublunge.<br />
Dies bedeutete für manche den frühzeitigen Tod.<br />
Silikose ist seit 1932 versichert, aber wurde erst 1938 als<br />
Berufskrankheit anerkannt.<br />
Dies bedeutete, dass Betroffene eine bescheidene Rente<br />
zugesprochen erhielten.<br />
Die Mechanisierung in den Gruben verschlimmerte das Problem<br />
massiv. Familien mit kleinen Kindern verloren oft früh ihren Vater.<br />
Unter diesen Umständen darf man froh sein, dass die<br />
<strong>Schiefer</strong>gruben-Industrie aufgegeben wurde.<br />
Dankbar dürfen wir aber auch sein, dass heute noch ehemalige<br />
<strong>Schiefer</strong>arbeiter unter uns sind, die von der Krankheit verschont<br />
blieben <strong>und</strong> die von ihrer strengen Arbeit erzählen können.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 16
Bergbau<br />
Kurzgeschichte der<br />
<strong>Schiefer</strong>tafelfabrik<br />
Frutigen AG<br />
1898 Grossvater Johann Hermann Moser (1859–1924) gründet die<br />
erste <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik in Kanderbrück bei Frutigen.<br />
1926 Am 29. September wird im Büro der J.H. Moser AG Fabrik<br />
Kanderbrück die <strong>Schiefer</strong>tafelfabrik Frutigen AG gegründet.<br />
Erste Präsidentin ist Grossmutter Emilie Moser-Kambly (1871–<br />
1951). Sie <strong>und</strong> alle engeren Familienangehörigen sind Aktionäre.<br />
Direktor ist ein Onkel, Ernst Kaehr. Die Gesellschaft beutet<br />
Rohschiefer in den Gruben Heitleren im Gantengraben <strong>und</strong> im<br />
Braatschi an Ried aus.<br />
1937/38 Die Herstellung der <strong>Schiefer</strong>tafeln wird von Kanderbrück<br />
in die neue Fabrik an Rybrügg verlegt. Eigenes Kraftwerk.<br />
1944/45 In Frutigen werden zwei weitere Fabrik-Firmen gegründet:<br />
Die Belardoise <strong>Schiefer</strong>tafelfabrikation AG (Robert Haug) <strong>und</strong> die<br />
Ardosa AG (Gebr. Rhyner <strong>und</strong> Gebr. Schmid). Export von<br />
Rohschiefer <strong>und</strong> Fertigtafeln ins Ausland. Die beiden Betriebe gehen<br />
später ein.<br />
1945–60 Der Aufschwung hält an. Es werden jährlich ca. 500'000<br />
Tafeln fabriziert, mehr als die Hälfte geht ins Ausland. Um die 30<br />
Personen werden in der Fabrik beschäftigt. Mit der Zeit wird die<br />
Konkurrenz des portugiesischen <strong>und</strong> auch des italienischen <strong>Schiefer</strong>s<br />
spürbar; der Export geht zurück.<br />
1962 Am 18. April bricht bei einem Föhnsturm im Dachgeschoss<br />
Feuer aus, die Fabrik brennt vollständig aus. Ernst Kaehr tritt in den<br />
Ruhestand.<br />
Bernardo Moser übernimmt die Geschäftsführung <strong>und</strong> leitet den<br />
Wiederaufbau der Fabrik.<br />
1967 Unsere Firma wird Eigentümerin der <strong>Schiefer</strong>gruben von Haug<br />
in der Ladholzwildi.<br />
Die Schultafeln geraten mehr <strong>und</strong> mehr aus der Mode.<br />
1969 Verwalter wird Bernardo Moser.<br />
1973 Es sind noch 3 Frauen <strong>und</strong> 5 Männer an Rybrügg beschäftigt.<br />
1974 Ein neues Produkt wird aus der Taufe gehoben:<br />
Küchenabdeckungen aus Granit.<br />
Übergang von der <strong>Schiefer</strong>tafelfabrikation zum Natursteinbetrieb.<br />
1977 Schliessung der <strong>Schiefer</strong>gruben.<br />
Produktion von Tischplatten aus <strong>Schiefer</strong>, lmport von italienischem<br />
<strong>Schiefer</strong> aus der Gegend von Genua.<br />
Weiterentwicklung der Granit-Abdeckungen.<br />
Daneben Herstellung von Jass- <strong>und</strong> Notiztafeln.<br />
Der Betrieb wird mit neuen Maschinen <strong>und</strong> neuen elektrischen<br />
Installationen modernisiert.<br />
1984 Fritz Inniger wird Betriebsleiter <strong>und</strong> Vorarbeiter.<br />
1989/90 Automatisierung des Kleinkraftwerkes an der Kander.<br />
1996 Neuer Anbau an die Fabrik mit neuer Granitfräse.<br />
2001 Unsere Haupttätigkeit ist heute die Fabrikation von<br />
Küchenabdeckplatten<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 17
Bergbau<br />
<strong>Schiefer</strong>tafelfabrik<br />
Frutigen<br />
aus Granit.<br />
Wir stellen auch Tischplatten (r<strong>und</strong>e, drei-, vier- <strong>und</strong> achteckige,<br />
quadratische <strong>und</strong> rechteckige) her, aus Granit in diversen Farben.<br />
Dem <strong>Schiefer</strong> halten wir mit dem Handel von Bodenplatten <strong>und</strong><br />
Anschrifttafeln in verschiedenen Grössen <strong>und</strong> der Produktion von<br />
Jass- <strong>und</strong> Notiztafeln, Serviceplättli usw. nach wie vor die Treue.<br />
Alle Natursteine importieren wir aus Italien.<br />
In unserem Lager an Rybrügg können die K<strong>und</strong>en, Küchenschreiner<br />
<strong>und</strong> Bauherren die gewünschten Platten aussuchen.<br />
Wir beliefern hauptsächlich die Region <strong>Berner</strong> <strong>Oberland</strong>.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 18
Bergbau<br />
Maria Lauber<br />
<strong>Schiefer</strong> in der Literatur<br />
Wir finden verschiedene Schriftsteller <strong>und</strong> Schriftstellerinnen, die in<br />
ihren Werken vom Abbau des <strong>Schiefer</strong>s schreiben <strong>und</strong> sich mit dem<br />
Schicksal der Menschen beschäftigen.<br />
Sie schreibt in ihren Büchern eher wenig zum Thema <strong>Schiefer</strong>arbeit.<br />
- Im Büchlein über die Talschaft Frutigen „Unter dem gekrönten<br />
Adler“<br />
- Dr jung Schulmischter<br />
- Dr Käthe Bueb (hier erwähnt sie die <strong>Schiefer</strong>-Lunge)<br />
- Zwü Lüteni uf em Niese<br />
Maria Lauber ist ein spezielles Modul gewidmet.<br />
Frank Alfred Graber In seinem frühesten Werk Das Dorf am Niesen freut sich der<br />
Statterbub über das weiche Gestein.<br />
“Vergnügt stand es am Bachrandfels <strong>und</strong> bröckelte <strong>Schiefer</strong>. Der<br />
blauschwarze, glänzende Weichfels! Alle Leute müssten ihn lieb<br />
haben, dachte der Junge. Wohlig weich <strong>und</strong> w<strong>und</strong>erbar kühl fühlt<br />
er sich an. Man bricht ihn quer, spaltet ihn mit blosser Hand längs<br />
zu feinen Plättchen. Versonnen, ohne Eile geschieht das. Die festen<br />
Platten sucht man heraus <strong>und</strong> schleudert sie flachwegs in die<br />
sirrende Luft. Und man erschauert: das hat der Berg in seinem<br />
Innern geschaffen seit Jahrtausenden. Der geheimnisvolle,<br />
verschlossene Berg!“<br />
Josy Doyon Auch sie erzählt in ihren Geschichten von <strong>Schiefer</strong>, Arbeiten <strong>und</strong><br />
Gefahren.<br />
- Blumen für ein Sonntagskind<br />
- Graues Gold<br />
Im vergriffenen Buch Graues Gold schildert sie das Leben des<br />
Samuel Zurbrügg. Samuel gehörte zu der letzten Generation der<br />
Opfer der Bergwerke in den Spissen. Der Verlust des Augenlichts<br />
<strong>und</strong> die Beschreibung der Auswirkungen der Silikose für die ganze<br />
Familie zeigen uns die harten Seiten der damaligen Zeit, auch wenn<br />
diese Arbeit etwas Geld ins Tal brachte.<br />
Der dritte Sprengschuss erzählt von einem Unfall beim Sprengen im<br />
Stollen.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 19
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong><br />
In der Wildhorndecke finden wir kohleführende Schichten. Sie<br />
stammen aus der unteren Kreidezeit. Damals bildeten sich in den<br />
verkarsteten Kalklandschaften einzelne Niedermoore<br />
Die im warmen Klima wachsenden Pflanzen lieferten das<br />
Ausgangsmaterial für ein ungleichförmiges Gr<strong>und</strong>flöz von eher<br />
kleiner Mächtigkeit.<br />
Verschiedene <strong>Kohle</strong>n <strong>Schiefer</strong>kohle<br />
<strong>Schiefer</strong>kohle hat einen hohen Wassergehalt von 40 – 70 % <strong>und</strong><br />
muss getrocknet werden.<br />
Wird nur in Krisenzeiten abgebaut.<br />
Braunkohle<br />
Braunkohle hat einen geringen Wert. Der Feuchtigkeitsanteil<br />
beträgt ca. 45% Sie weist einen höheren Anteil von Schwefel auf<br />
als Steinkohle. Braunkohle ist wohl später entstanden als Steinkohle.<br />
Braunkohle wird im Ausland im Tagbau abgebaut <strong>und</strong> wird für die<br />
Stromerzeugung genutzt.<br />
Mit dem Eintreffen von ausländischer <strong>Kohle</strong> rentierten die Gruben<br />
im Kandertal nicht mehr.<br />
Steinkohle<br />
Steinkohle ist wertvollere <strong>Kohle</strong> mit höherem Heizwert. Sie liegt<br />
zwischen Schichten von Sedimenten (Ablagerungsgesteinen) <strong>und</strong><br />
wird unter Tag abgebaut.<br />
Anthrazit<br />
Anthrazit hat den höchsten Gehalt an <strong>Kohle</strong>stoff, somit auch den<br />
besten Heizwert. In der Schweiz wird Anthrazit vor allem im Wallis<br />
abgebaut.<br />
Graphit<br />
Graphit besteht aus reinem <strong>Kohle</strong>nstoff.<br />
Koks<br />
Wenn <strong>Kohle</strong> unter Luftabschluss erhitzt wird entsteht Koks. Dabei<br />
Entstehen ganz unterschiedliche Nebenprodukte. Daraus lassen sich<br />
verschiedenste Materialien herstellen: Farben, Frostschutz,<br />
Kunstfasern, Seifen, Kaugummi, Salben, Asphalt, Treibstoffe <strong>und</strong> so<br />
weiter.<br />
Mit der Verbreitung der Treibstoffe aus Erdöl hat die Bedeutung der<br />
<strong>Kohle</strong> abgenommen.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 20
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong>nhobel<br />
Die Entwicklung der Petrochemie mit umweltfre<strong>und</strong>licherer<br />
<strong>Kohle</strong>technik kann die <strong>Kohle</strong> als Brennstoff wieder aufwerten.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 21
Bergbau<br />
Weltverbrauch 2002<br />
Abbau unter Tag<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 22
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong>vorkommen in der<br />
Schweiz<br />
<strong>Kohle</strong> in der Schweiz<br />
Zwischen 1940 <strong>und</strong> 1947 wurden in der Schweiz 500'000 Tonnen<br />
Anthrazit, 410‘0000 Tonnen Braunkohle <strong>und</strong> 275'000 Tonnen<br />
<strong>Schiefer</strong>kohlen gefördert. Damit konnten 28% des Bedarfs an <strong>Kohle</strong><br />
für die Industrie gedeckt werden.<br />
Im <strong>Berner</strong> <strong>Oberland</strong> waren weitere Standorte bekannt. Die<br />
Abbaumengen waren aber gering.<br />
Boltigen, Erlenbach, Reichenbach i.K., Grüsisberg bei Thun,<br />
Stieglisberg, Hartlisberg <strong>und</strong> Bosbachgraben bei Steffisburg,<br />
Kratzbachschlucht <strong>und</strong> Losenegg bei Eriz.<br />
In Beatenberg <strong>und</strong> in Käpfnach bei Horgen sind einige Stollen des<br />
<strong>Kohle</strong>bergwerkes für Besucher geöffnet worden.<br />
<strong>Kohle</strong> im Kandertal - Geschichte bis 1930<br />
Seit 250 Jahren weiss man vom <strong>Kohle</strong>abbau im Kandertal. Mit<br />
Ausnahme der Jahre des 2. Weltkriegs war er aber nicht von<br />
Bedeutung.<br />
„Der Abbau des schwarzen Goldes“ brachte wenig Erfolge, aber<br />
viele Misserfolge.<br />
Ziegelhütten <strong>und</strong> Kalkbrennereien verschlangen im 17. Und 18. Jh.<br />
riesige Mengen von Holz.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 23
Bergbau<br />
Auch in den Staatswäldern von Frutigen wurde 1772 – 1778 bis zu<br />
6000 Klafter Holz geschlagen <strong>und</strong> ins Unterland geführt. Dieser<br />
Raubbau, auch in den Schutzwäldern, trieb die Holzpreise in die<br />
Höhe. Die Bernische Regierung setzte Prämien aus zur Findung von<br />
alternativen Energieträgern, vor allem <strong>Kohle</strong>.<br />
1759 reichte Johannes Klopfer von Frutigen bei der <strong>Berner</strong><br />
Regierung das erste nachweisbare Konzessionsbegehren zur<br />
Ausbeutung von <strong>Kohle</strong> am Mittelgrat (Elsighorn) ein.<br />
„Die ihm anvertrauten Patenten wurden in keinem Effect gesetzt.<br />
“So ging der Schürfschein 1765 an die beiden neuen Gesuchsteller<br />
aus Frutigen. Auch diese hatten keinen Erfolg, aber die <strong>Berner</strong><br />
Regierung wurde auf die <strong>Kohle</strong>vorkommen aufmerksam.<br />
1787 beschloss die <strong>Berner</strong> Regierung auf ein Gutachten des<br />
Bergverwalters Deggeler hin <strong>und</strong> nach Versuchen mit gef<strong>und</strong>ener<br />
<strong>Kohle</strong> ein „Hochobrigkeitliches Steinkohlebergwerk“ in<br />
Kandergr<strong>und</strong> zu errichten.<br />
Von der Schlafeggfluh berichtete Deggeler von einem fünf Fuss<br />
mächtigen Flöz. Auf der linken Talseite fand er an verschiedenen<br />
Orten <strong>Kohle</strong>spuren, auch bestehende Stollen. Es dürfte sich um<br />
frühere Abbaustellen gehandelt haben.<br />
Ein Bergknappe berichtete, dass dieses Flöz sich gänzlich auf den<br />
Kopf gestürzt <strong>und</strong> sein Fallendes in die Theuffe hinaf seine<br />
Verflechtung genommen <strong>und</strong> sich gegen die rechte Seite gestürzt.<br />
Die <strong>Kohle</strong>n in der Theuffe sollen durch Prob besser als die oberen<br />
gebrannt, aber doch keine Flammen gegeben haben.<br />
Zwischen 1787 – 1790 wurden gut 13'500 Zentner <strong>Kohle</strong><br />
gefördert, doch die schlechte Qualität, Misswirtschaft <strong>und</strong> hohe<br />
Transportkosten führten dazu, dass ein grosser Teil der<br />
<strong>Kohle</strong> im Tal liegen blieb. Die Staatskasse bezahlte für das<br />
unrentable Werk 4000 Kronen.<br />
In einem Gutachten an die Canzlei Bern wird die Qualität der<br />
Kandertaler <strong>Kohle</strong> nicht gerühmt. “Die Steinkohlen von Frutigen<br />
wo ich vergangenes Jahr gesehen zum Ziegelbrennen gebrauchen;<br />
waren nichts anderes als Taube Kohl, die man anderer Orten auf<br />
die halden stürzt.“<br />
Verschiedene Versuche wurden im folgenden Jahrh<strong>und</strong>ert gemacht,<br />
im Kandertal <strong>Kohle</strong> abzubauen, Schürfrechte erteilt, Gruben wieder<br />
eröffnet. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht, der Abbau<br />
erlosch wieder.<br />
1869 wurde im Auftrag der <strong>Kohle</strong>kommission der Schweizerischen<br />
Naturforschenden Gesellschaft die Möglichkeit der Kandergr<strong>und</strong>er<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 24
Bergbau<br />
Gruben begutachtet. Die Wirtschaftlichkeit der Ausbeutung wurde<br />
verneint, auch vom Geologen Hans Adrian. (Autor des Kapitels<br />
Geologie im Frutigbuch)<br />
Beim Bau der Lötschbergbahn fand man im B<strong>und</strong>erbach ob<br />
Kandergr<strong>und</strong> Steinkohle. Man förderte <strong>und</strong> verheizte 30 - 40<br />
Zentner davon.<br />
<strong>Kohle</strong> im <strong>und</strong> nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
Die <strong>Kohle</strong>n des Kandertals sind im Gestein der Wildhorndecke<br />
eingelagert <strong>und</strong> liegen an kaum zugänglichen Felshängen in 1200 -<br />
2000 m ü. M.<br />
Ein grosser Teil der <strong>Kohle</strong>vorkommen wurde in Verwerfungen<br />
zerhackt <strong>und</strong> bei der alpinen Deckenüberschiebung zerrieben,<br />
verschleppt <strong>und</strong> unter grossem Druck neu zusammengebacken.<br />
Kandertaler <strong>Kohle</strong> war hauptsächlich Braunkohle. In der Grube<br />
Schlafegg fand man abbauwürdige <strong>Kohle</strong>nmengen in Klüften von<br />
bis zu 8 m Mächtigkeit. Hier konnte in einer einzigen fast<br />
senkrechten Kluft r<strong>und</strong> 10'000 Tonnen <strong>Kohle</strong> gewonnen werden.<br />
Die Arbeit war aber wegen des komplizierten <strong>und</strong> schwierigen<br />
Geländes mühselig.<br />
Chemische Analysen ergaben einen hohen Schwefelgehalt meist an<br />
Pyrit geb<strong>und</strong>en. Die Pyrit- resp. Schwefelf<strong>und</strong>e im Sackgraben <strong>und</strong><br />
im Ueschinental bestätigen diese Aussagen. Die <strong>Kohle</strong> hatte einen<br />
tiefen Heizwert<br />
Der Mangel an Rohstoffen während des zweiten Weltkrieges<br />
brachte es, dass man sich der <strong>Kohle</strong>gruben erinnerte.<br />
Karl Iten, Vorarbeiter der Zündwarenfabrik, erhielt 1940 eine<br />
Konzession <strong>und</strong> begann mit dem Abbau in der Grube Lindi.<br />
Auf Initiative von Walter Gehring, Zündholzfabrikant, suchte <strong>und</strong><br />
fand man auch am Elsighorn <strong>Kohle</strong>. Hier wurden die grössten<br />
Mengen gefördert.<br />
Die günstigsten Prognosen erhielten aber die <strong>Kohle</strong>vorkommen von<br />
Schlafegg. Hier wurde bis zum Ende des Krieges <strong>Kohle</strong> abgebaut.<br />
Heute zeugen nur noch dürftige Spuren von der harten Arbeit der<br />
Bergleute von damals.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 25
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong>nblock<br />
Man hoffte auf noch mehr <strong>Kohle</strong> zu stossen <strong>und</strong> erweiterte 1943<br />
die Konzessionen um weitere Zonen um die bestehenden<br />
Bergwerke zu erschliessen.<br />
Die Kandergr<strong>und</strong>er Gruben lieferten während der Kriegsjahre<br />
immerhin einen Viertel der in der Schweiz geförderten Braunkohle.<br />
Diese wurde vor allem in Industriebetrieben verbrannt.<br />
Lindi<br />
Westseite des Kandertales, M<strong>und</strong>loch des Hauptstollens<br />
Koordinaten 616 570 / 153 940, Höhe 1286,03 m ü. M.<br />
Im Frühjahr 1939 erteilte die Bäuert Innerkandergr<strong>und</strong> Karl Iten die<br />
Bewilligung einen Sondierstollen zur Ausbeutung von <strong>Kohle</strong> in der<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 26
Bergbau<br />
Karl Iten<br />
Kandergr<strong>und</strong>erallmend zu bauen.<br />
Kurz vor Weihnachten fand sein Sohn bei den ersten Sprengungen<br />
<strong>Kohle</strong>stücke, welche er freudig ins Tal brachte.<br />
Der Arbeitgeber von Karl Iten, von Arx von der Tonwarenfabrik<br />
Holderbank, half Iten beim Erwerb einer Konzession <strong>und</strong> zusammen<br />
gründeten sie eine GmbH.<br />
Iten begann 1940 mit seinen Söhnen beim Walliser Stollen mit den<br />
Vorarbeiten. Mit bescheidenen Mitteln wurden bald die ersten<br />
<strong>Kohle</strong>n gefördert.<br />
Auf kaum begehbaren Wegen wurden Zement, Eisen, Werkzeuge<br />
von Einheimischen in Lasten von mehr als 50 kg zum<br />
Stolleneingang getragen. Dieser lag in der Nähe der Druckleitung<br />
des Elektrizitätswerks Kandergr<strong>und</strong>.<br />
Nun wurde nach Plänen des Grubenbesitzers eine 700 m lange<br />
Seilbahn erstellt, die auch Personen zur Verfügung stand.<br />
Das steile, exponierte Gelände erschwerte den Bau der Anlagen.<br />
Iten konnte sich aber schon nach kurzer Zeit über die ersten 400 kg<br />
<strong>Kohle</strong> freuen. Diese wurden in einem Transportkübel am Seil ins Tal<br />
spediert.<br />
Die Autorin dieses Textes erinnert sich noch, wie sie an den<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 27
Bergbau<br />
Grube mit Grubenh<strong>und</strong><br />
<strong>Kohle</strong>haufen <strong>und</strong> an der Seilbahnstation vorbeispazierte, um dem<br />
Vater in der BKW am Sonntag das Essen zu bringen oder im<br />
Frühling mit der Mutter auf den schwarzen Kegeln, wo der Schnee<br />
zuerst schmolz, Zytröseli (Huflattich) sammelte.<br />
Der Abbau erfolgte in 10-St<strong>und</strong>en-Schichten: Sprengen, mühsames<br />
Auspickeln, liegend, kniend, gebückt. Mit dem Rolli wurden ca.<br />
200 kg zu Tage gezogen <strong>und</strong> ins Tal befördert.<br />
Erleichterung brachte die Einführung von Kompressoren, die<br />
Abbaumenge wurde verdoppelt.<br />
Mangelnde Erfahrung, schlechte Qualität der <strong>Kohle</strong>, Reibereien<br />
zwischen Geldgeber <strong>und</strong> Betreiber zwang Iten zum Verkauf der<br />
Grube Lindi an die <strong>Kohle</strong>ngrube Kander – AG im Besitz der <strong>Kohle</strong>n -<br />
Union Geldner AG in Basel.<br />
In der Grube Lindi arbeiteten 60 – 70 Männer.<br />
In allen drei Gruben wurde Grubengas festgestellt. Lindi hatte<br />
Stickstoffwerte von fast 80 %. Das Methangas konnte sich in<br />
verlassenen Stollen zu gefährlichen Konzentrationen anreichern.<br />
Das Lüftungssystem war schlecht.<br />
Am 17. Juni 1943 kam es im Stollen zur Katastrophe: Das<br />
Grubengas explodierte. Drei Arbeiter fanden den Tod. Ein Teil des<br />
Stollens stürzte ein. Erst eine Gruppe der Luftschutzkompanie von<br />
Frutigen gelang es die Opfer zu bergen.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 28
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong>nproduktion<br />
Grube Lindi“<br />
Die Grube wurde im April 1946 geschlossen.<br />
Horn<br />
Westseite des Kandertales, M<strong>und</strong>loch des Hauptstollens<br />
Koordinaten 615 542 / 154 988, Höhe 1662,38 m ü. M.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 29
Bergbau<br />
Horn<br />
Die ersten <strong>Kohle</strong>f<strong>und</strong>e dürften an den Hängen des Elsighorns<br />
gemacht worden sein.<br />
Der Besitzer der Zündwarenfabrik Kandergr<strong>und</strong> AG, Herr Gehring,<br />
liess an den Hängen des Elsighorns nach <strong>Kohle</strong> suchen <strong>und</strong><br />
Schürfungen vornehmen.<br />
Bei Balmen <strong>und</strong> „Gygers Baracke“ liess er sogar einen<br />
Sondierstollen vorantreiben. Die Ergebnisse waren aber dürftig.<br />
Auf 1662 m ü. M. südwestlich der Alp Horn hoffte man auf bessere<br />
Vorkommen.<br />
Verwerfungen, eingelagerte Kalkblöcke, äusserst komplizierte<br />
Tektonik liessen die Geologen wenig günstige Prognosen abgeben.<br />
Trotzdem wurde mit dem Abbau begonnen. In den folgenden<br />
Jahren wurden hier die grössten Mengen dieses Rohstoffs<br />
ausgebeutet.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 30
Bergbau<br />
Sortieranlage<br />
<strong>Kohle</strong> wurde in einem ausgedehnten Stollennetz auf fünf Sohlen<br />
abgebaut. Diese waren mit Schrägstollen verb<strong>und</strong>en. 15 km Geleise<br />
wurden verlegt in den ausgedehnten unterirdischen Anlagen.<br />
Mit Sprengungen <strong>und</strong> mit Presslufthammer wurde die <strong>Kohle</strong> dem<br />
Berg abgerungen, in Wagen geschaufelt <strong>und</strong> ans Tageslicht<br />
befördert.<br />
Ein grosses Silo <strong>und</strong> zahlreiche Baracken mussten in unwegsamem<br />
<strong>und</strong> steilem Gelände auf Pfählen aufgestellt werden. Hier schliefen<br />
bis zu 128 Arbeiter, „duschten“ <strong>und</strong> assen in der Kantine.<br />
Eine Seilbahn wurde erstellt. Alle drei Minuten wurden ca. 800 kg<br />
<strong>Kohle</strong> von 1650 m.ü.M. zur Talstation befördert, wenige h<strong>und</strong>ert<br />
Meter nördlich des BKW – Maschinenhauses. Hier sortierten Frauen<br />
die <strong>Kohle</strong> am Fliessband. Anschliessend wurde die <strong>Kohle</strong> mit<br />
Lastwagen (z.T. noch Holzvergaser) zum Bahnhof Frutigen geführt.<br />
Kleinere Mengen brachte man mit Pferdewagen zum Bahnhof<br />
Kandergr<strong>und</strong>.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 31
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong>produktion Grube<br />
Horn<br />
80% der Industriekohle vom Horn wurde an die Firma Sandoz<br />
geliefert. Diese beteiligte sich seit 1945 an der Bergbau-Gesellschaft<br />
Kandergr<strong>und</strong> AG.<br />
1947 / 48 erreichte die Produktion ihren Höhepunkt: bis zu 2000<br />
Tonnen monatlich<br />
218 Leute fanden damals am Horn ihre Beschäftigung <strong>und</strong> damit<br />
ihr Auskommen.<br />
Schlafegg<br />
Ostseite des Kandertales, M<strong>und</strong>loch des Hauptstollens Koordinaten<br />
619 258 / 155 777,<br />
Höhe 1798,0 m. ü. M.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 32
Bergbau<br />
Karte der Grube<br />
Schlafegg<br />
Johann Deggeler, Bergverwalter, beschreibt 1787:“an der Schlaf-<br />
Egg-Fluh ein neues fünf Schuh mächtiges Flötz. Sie scheinen etwas<br />
wenigs fetter als die anderen, doch aber am Tag noch weich <strong>und</strong><br />
verwittert.“ Er glaubt, dass „dies Gebirg gänzlich zu Stein-<strong>Kohle</strong>n<br />
geneigt <strong>und</strong> auch durchspikt seie.“<br />
Am 30.12.41 las man in der Volkszeitung: “Eine dritte Grube auf<br />
der andern Talseite am Gerihorn, lenkt zur Zeit die<br />
Aufmerksamkeit auf sich. Es ist interessant zu erfahren, ob die<br />
Ausbeutung auch die Ausmassen derjenigen auf der andern<br />
Talseite zu erreichen vermag. Heute ist man hierüber noch völlig<br />
im Unklaren.“<br />
Die Grube wurde im Frühjahr 1946 infolge Erschöpfung<br />
geschlossen.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 33
Bergbau<br />
Auftrag – Saumtransporte (Schlafegg)<br />
Da sich die Versorgungslage weiter verschärfte, erinnerte man sich<br />
an die <strong>Kohle</strong>vorkommen im Kandertal.<br />
Ciba in Basel übernahm die Geschäftsleitung des neuen<br />
Konsortiums Bergwerk Schlafegg AG mit der Cellulosefabrik<br />
Attisholz, der Zuckerfabrik Aarberg <strong>und</strong> von Roll Eisenwerke in<br />
Gerlafingen.<br />
Ein Abbau auf 1800 m.ü.M. war mit Schwierigkeiten <strong>und</strong> Kosten<br />
verb<strong>und</strong>en. Man klärte ab, ob sich der Aufwand für den bau <strong>und</strong><br />
den betrieb der Transportanlagen <strong>und</strong> der Infrastruktur im<br />
exponierten Gelände lohnten.<br />
Von Geologen <strong>und</strong> Ingenieuren wurde ein positives Gutachten<br />
erstellt.<br />
Im Juni 1942 wurde die Bauleitung der erfahrenen Firma Zübelin<br />
AG in Basel übertragen.<br />
Herr Eduard Böhringer wurde als Betriebsleiter eingesetzt. Im<br />
Projekt Grube Schlafegg arbeiteten bis zu 120 Arbeiter.<br />
Herr Böhringer erinnert sich: “Da meine letzte Arbeit beim Bau der<br />
unterirdischen Kraftwerkzentrale Innertkirchen beendet war, erhielt<br />
ich von meinem Arbeitgeber den Auftrag zur Suche nach <strong>Kohle</strong> auf<br />
Schlafegg. Zusammen mit Herrn Müller stieg ich am 21. Juni 1942<br />
vom Bahnhof Kandergr<strong>und</strong> auf einem schmalen Weglein auf die<br />
hoch gelegene Alp unter den Flühen des Sattelhorns. Nun war es<br />
mit der Ruhe vorbei. Vom Industriekonsortium beauftragte<br />
Geologen hatten zuvor die Felsen nach möglichen <strong>Kohle</strong>nflötzen<br />
abgesucht. Auf einer Länge von ca. 400 m fanden sie ein schmales,<br />
schwarzes Band, das <strong>Kohle</strong> vermuten liess. Zusammen legten wir<br />
6 – 7 Stellen fest, wo mit einfachsten Mitteln nach <strong>Kohle</strong> gesucht<br />
werden sollte. Der Auftrag an den jungen Ingenieur lautete nun<br />
ganz schlicht: Arrangez-vous!<br />
Bei Familie Reichen in Kandergr<strong>und</strong>, wo sich auch die Post befand,<br />
wurde mir ein Zimmer angeboten. Ein Bauer konnte ab <strong>und</strong> zu sein<br />
Pferd für Transporte zur Verfügung stellen, doch diese Möglichkeit<br />
reichte bei weitem nicht aus, um die benötigten, umfangreichen<br />
Materialien nach Schlafegg transportieren zu können. So erschien<br />
es mir wie ein Geschenk des Himmels, als ich an einem Abend im<br />
Restaurant Alpenruh den Walliser Säumer Klopfenstein traf. Dieser<br />
bot sich an, täglich zwei Mal mit seinen Maultieren Material nach<br />
Schlafegg hinaufzubasten. Von Juli bis Oktober 1942 trugen nun 5<br />
– 7 Maultiere gemächlich auf den teilweise neu angelegten<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 34
Bergbau<br />
Transport eines<br />
Kompressorenteils<br />
Maultier<br />
Saumpfaden die schweren Lasten vom Bahnhof Kandergr<strong>und</strong><br />
hinauf unter die fast senkrecht abfallenden Felsen der<br />
Gerihornkette. Der zerlegte Kompressor, einfache Bohrwerkzeuge,<br />
die Esse <strong>und</strong> die Schmiedewerkzeuge, kleine Baracken, Büro- <strong>und</strong><br />
Wohnbaracke – <strong>und</strong> nicht zu vergessen das Wasser für sämtliche<br />
Bedürfnisse der Belegschaft – musste von den genügsamen Tieren<br />
ins Schutzgebiet der Gämsen getragen werden. Für den Transport<br />
von nicht weniger als 89 Tonnen Material konnte Klopfenstein der<br />
Firma Züblin pro Kg 25 Rp. Oder gut 23'000 Fr. in Rechnung<br />
stellen.“<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 35
Bergbau<br />
Suche – Schürfungen (Schlafegg)<br />
Zuerst musste man Such- <strong>und</strong> Schürfarbeiten in Angriff genommen<br />
werden. Im steilen, felsigen Gelände auf 1800 m.ü.M. forderte dies<br />
den Beteiligten alles ab: Vorsicht, Ausdauer, Krafteinsatz, Mut.<br />
An mehreren Schürfstellen suchte man nach Spuren von <strong>Kohle</strong>. Mit<br />
einfachsten Mitteln, einem kleinen Kompressor <strong>und</strong> Meisseln<br />
konnten nur 3-4 m tiefe Löcher in den Fels gebohrt werden. Die<br />
Brackwasserschicht (<strong>Kohle</strong> führende Kalkschicht) ruht auf einer<br />
Schicht Schrattenkalk aus der Kreidezeit <strong>und</strong> wird von einer harten<br />
Hohgantsandsteinschicht bedeckt.<br />
Die Sondierungen bestätigten zwar das Vorhandensein von <strong>Kohle</strong>,<br />
aber eine Abbauwürdigkeit konnten Geologen nicht mit Sicherheit<br />
voraussagen.<br />
Erschwert wurde die Sucharbeit durch die vielen Längs- <strong>und</strong><br />
Querbrüche.<br />
Da die Versorgung aus dem Ausland fast gänzlich zum Erliegen<br />
kam, stellten die vier Firmen weitere Mittel zur Verfügung für die<br />
folgenden grösseren Arbeiten.<br />
Als erstes sollte ein längerer Suchstollen in den Berg vorgetrieben<br />
werden.<br />
Mitte Juli 1942 stiess man mit dem Querstollen auf <strong>Kohle</strong>, aber nur<br />
eine geringe Menge. Nun wurde ein Rollstollen weiter ins<br />
Bergesinnere getrieben. Endlich konnte die erste <strong>Kohle</strong> gewonnen<br />
werden. Diese war aber mit schwarzem Gestein vermischt, was<br />
weitere Schwierigkeiten bereitete: Die <strong>Kohle</strong> musste von Hand<br />
aussortiert werden.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 36
Bergbau<br />
Skizze „Querschnitt“<br />
Hilfsseilbahn<br />
Seilbahnen (Schlafegg)<br />
Am 28. 9. 1942 begann man mit dem Bau eines weiteren<br />
Suchstollens auf 1797 m.ü.M. Nach etwa 40 m zeigte sich ein<br />
schwarzes Band, welches sich später zu einem eigentlichen<br />
<strong>Kohle</strong>flöz erweiterte. Es war eine Braunkohlekluft in einer<br />
Verwerfung. Der Abbau des Schwarzen Goldes könnte sich lohnen.<br />
Sofort musste das Transportproblem gelöst werden. Eine<br />
Hilfsseilbahn vom Bahnhof Kandergr<strong>und</strong> auf die Schlafegg musste<br />
erstellt werden, um Materialien für eine leistungsfähige<br />
Umlaufseilbahn zu transportieren. Rasch wurden Masten aus Holz<br />
aufgestellt, Metall war Mangelware. Ende Oktober konnte die<br />
Hilfsseilbahn in Betrieb genommen werden. Erste <strong>Kohle</strong>transporte in<br />
Säcken waren nun möglich.<br />
Gleichzeitig wurden umfangreiche Bau- <strong>und</strong> Installationsarbeiten<br />
begonnen: Baracken für die Arbeiter musste man an möglichst<br />
geschützter Stelle bauen, Magazine für Brennstoffe, Sprengstoffe,<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 37
Bergbau<br />
eine anständige Kantine, Lagerräume, Wasserreservoirs, Büros usw.<br />
all das harrte der Errichtung. Tonnenweise Stollen- <strong>und</strong><br />
Installationsmaterialien, Werkstücke mussten auf die Alp<br />
transportiert werden. Mit der Hilfsseilbahn waren jedoch<br />
Personentransporte untersagt.<br />
Zwischenfall ohne schlimme Folgen: Eine „Königsrolle“ riss das<br />
Zugseil, rollte talwärts <strong>und</strong> bohrte sich in den Boden.<br />
Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden.<br />
Technische Angaben Länge der Seilbahn 2'300 m<br />
Durchmesser Tragseil 17 mm<br />
Durchmesser Zugseil 10 mm<br />
Anzahl Holzstützen 10<br />
Tragkraft (Einzellast) 1'000 kg<br />
Grosse Umlaufseilbahn<br />
im Lehnherri<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 38
Bergbau<br />
Technische Angaben<br />
Talstation mit<br />
eigenem Geleise<br />
Länge der Seilbahn 2'280 m<br />
Höhenunterschied 914 m<br />
Grösste Spannweite zwischen den Stützen 1'340 m<br />
grösste Höhe über dem Boden 60 m<br />
Steigung max. 68 %<br />
Steigung min. 36 %<br />
Fahrgeschwindigkeit 2,25 m/Sek.<br />
Motor 85 PS<br />
Max. Leistung pro Std. 15 – 20 t <strong>Kohle</strong><br />
Fahrzeit 17 Min.<br />
Durchmesser Tragseil 28 mm<br />
Durchmesser Zugseil 17 mm<br />
Die Belegschaft hatte sich wegen Nachtschichten, Seilbahnbetrieb,<br />
Aussenbetrieb auf 120 Mann erhöht. Die Firma Züblin erweiterte<br />
die Betriebsleitung auf zwei Mann.<br />
Von einer eben beendeten Baustelle im Diemtigtal konnte die Firma<br />
Züblin die nicht mehr benötigte Bahn abbauen. Diese war für die<br />
Verhältnisse in Kandergr<strong>und</strong> bestens geeignet. Von Spezialisten<br />
wurden in kürzester Zeit die notwendigen Pläne für den Aufbau der<br />
grossen Seilbahn erstellt. Umgehend wurden die Arbeiten<br />
begonnen. Dank erfahrener Fachkräfte konnte das Projekt zügig<br />
vorangetrieben werden. Auf einer Länge von 600 m musste der<br />
Wald gerodet werden. Das Holz konnte man zum Bau der Stützen<br />
für die Bahn verwenden. Zusätzliches Holz konnte man in der<br />
Umgebung beschaffen. Für den Bau der Stationen <strong>und</strong> Masten<br />
wurden total 450 m³ verbraucht.<br />
Heute gibt es im Tal viele gut ausgebildete Zimmerleute <strong>und</strong><br />
Holzfacharbeiter. Damals brachte die Firma Züblin diese selbst nach<br />
Kandergr<strong>und</strong>. Zusätzliche Arbeitskräfte wurden eingestellt. Die<br />
Seilbahn-Talstation mit der mächtigen Siloanlage beeindruckte die<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 39
Bergbau<br />
<strong>Kohle</strong>nabbau / Stollen<br />
(Schlafegg)<br />
Bevölkerung <strong>und</strong> führte ihr vor Augen, wie gross die finanziellen<br />
Möglichkeiten des Konsortiums sein mussten. Anschlussgeleise<br />
beim Bahnhof sollten den direkten Verlad der <strong>Kohle</strong> ermöglichen.<br />
Gleichzeitig mussten 400 m³ Schutt <strong>und</strong> 500 m³ Fels abgetragen<br />
werden für den Bau der Bergstation mit einer weiteren Siloanlage.<br />
Holzkonstruktionen für die imposante Bergstation,<br />
20 weitere Gebäude für Schlafräume, Baracken, Werkstätten im<br />
lawinengefährderten Gelände zeugen von den Erwartungen, die<br />
durch den F<strong>und</strong> von <strong>Kohle</strong> geweckt wurden..<br />
Dies bestätigen die 700'000 Fr., die für den Bau der Infrastruktur<br />
ausgegeben wurden, bevor die erste <strong>Kohle</strong> mit der Umlaufbahn ins<br />
Tal befördert werden konnte.<br />
Als an Weihnachten 1942 die letzten Teile der Bahn montiert<br />
waren, lagen an Schlafegg schon mehr als 3 m Schnee. Nach<br />
Neujahr konnte man mit dem Transport der ersten grösseren<br />
<strong>Kohle</strong>nmengen beginnen.<br />
Die BKW erstellte eine elektrische Hochspannungsleitung von<br />
16'000 Volt von Kandergr<strong>und</strong> nach Schlafegg <strong>und</strong> eine<br />
Transformatorenstation. Für die Lokale Zuleitung zum Betrieb, der<br />
Seilbahn, der Baracken <strong>und</strong> der Stollenanlagen hatte die<br />
Bergwerksunternehmung zu sorgen.<br />
Heute w<strong>und</strong>ert man sich, dass die elektrischen Anlagen nach der<br />
Schliessung der <strong>Kohle</strong>gruben abgebaut wurden. Auch die übrigen<br />
Gebäude <strong>und</strong> die Seilbahn sind verschw<strong>und</strong>en.<br />
Ende September war man auf ein grösseres <strong>Kohle</strong>vorkommen<br />
gestossen. Man konnte weitere Arbeitskräfte einstellen. Leitende<br />
Funktionen übernahmen erfahrene Fachkräfte der Firma Züblin.<br />
Viele Arbeiter waren schon zuvor auf Baustellen tätig, wie z.B. beim<br />
Bau der Grimselkraftwerke. Die recht gut bezahlten Mineure<br />
stammten aus dem Wallis, dem Tessin oder aus dem Kanton<br />
Waadt. Hilfspersonal stammte aus dem Tal.<br />
Unregelmässiger Verlauf der Schichten, in der <strong>Kohle</strong> eingebettete<br />
Felsblöcke erschwerten den Abbau. Es galt mit viel Umsicht Unfälle<br />
zu vermeiden.<br />
Die Stollen <strong>und</strong> die Abbaufelder mussten gut belüftet werden. In<br />
harter Arbeit bauten die Mineure die Kanderkohle ab. Grosse<br />
Hohlräume wurden sogleich mit Ausbruchmaterial wieder<br />
aufgefüllt. In den Hauptstollen wurden Rollgeleise verlegt. Die<br />
Stollen wiesen nur ein geringes Gefälle auf. So konnten mit den<br />
Kipprollwagen bis kurz vor Ende der Grubentätigkeit mit<br />
menschlicher Kraft die <strong>Kohle</strong> in die Silos <strong>und</strong> das<br />
Felsausbruchmaterial auf die Schuttdeponie geführt werden. Erst in<br />
den letzten Monaten erleichterte eine kleine Lokomotive den<br />
Grubenarbeitern die Transporte.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 40
Bergbau<br />
Skizze Stollenanlage<br />
Zu Ehren des verstorbenen Leiters der CIBA wurde der senkrechte<br />
Schacht Cornu-Schacht genannt.<br />
Im Bergesinnern wurden weitere Roll- Sondier- <strong>und</strong><br />
Ventilationsstollen in verschiedenen Richtungen vorangetrieben.<br />
Auch mit geoelektrischen Messungen wollten die Fachleute auf die<br />
Spur des wertvollen Rohstoffes kommen. So entstand in drei Jahren<br />
ein Stollennetz von mehreren Kilometern Länge. Das System wurde<br />
von Herrn Böhringer genau vermessen <strong>und</strong> in Plänen festgehalten.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 41
Bergbau<br />
Eduard Böhringer war<br />
für die<br />
Stollenvermessung<br />
zuständig<br />
Um die gefürchteten Schlagwetter zu vermeiden, benutzte man die<br />
sogenannten Sicherheitslampen: Karbidlampen, deren Flamme von<br />
einem Drahtgitter überdeckt wurde. Beim Auftreten von<br />
Grubengasen wurde die Flamme länger. Aus ihrer Höhe liess sich<br />
der Gehalt an Luft erkennen. Wenn irgendwo neue Stollen errichtet<br />
wurden, war es gefährlich. Die Lüftung fehlte noch, Gase konnten<br />
sich in gefährlichem Ausmass anreichern. Auch in der Mine<br />
Schlafegg kam es durch Grubengase zu Unfällen mit schweren<br />
Verbrennungen, glücklicherweise nie mit tödlichen Folgen. Ursache<br />
war meist Nachlässigkeit der Mineure, wie sie im Umgang mit<br />
Gefahren vorkommen kann.<br />
Trotz grosser Anstrengungen konnten keine weiteren grossen<br />
Vorkommen gef<strong>und</strong>en werden wie beim Cornu-Schacht. Diese<br />
Kluft lieferte den grössten Teil der in Schlafegg gef<strong>und</strong>enen kohle.<br />
Die gewonnene <strong>Kohle</strong> war nicht für den Hausgebrauch vorgesehen.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 42
Bergbau<br />
Installation von<br />
Gleisanlagen<br />
Mit Seilzügen wurde<br />
die <strong>Kohle</strong> aus den<br />
engen Klüften<br />
gezogen<br />
Sie sollte in der Zuckerfabrik Aarberg <strong>und</strong> den Öfen der CIBA<br />
verbrannt werden <strong>und</strong> konnte darum unsortiert auf die Umlaufbahn<br />
verladen <strong>und</strong> von Kandergr<strong>und</strong> mit der Bahn verschickt werden.<br />
Die Stollen im verwitterten <strong>und</strong> oft brüchigen Gestein mussten gut<br />
gesichert werden. Das für diesen Zweck gebrauchte R<strong>und</strong>holz<br />
konnte im nahen Wald geschlagen werden.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 43
Bergbau<br />
Lagebesprechung<br />
vor Ort<br />
Arbeiter<br />
Bilder von Arbeitern aus<br />
verschiedenen Gruben<br />
(Die Bilder stammen<br />
aus im Tal)<br />
Unfälle<br />
Wir gedenken in einigen Bildern der Arbeiter, die mit viel<br />
Einsatz, in verschiedenen Berufen in einer für die meisten<br />
Menschen schwierigen Zeit zum Gelingen der Grubenwerke<br />
beitrugen.<br />
Leider ereigneten sich in den Bergwerken auch Unfälle, oft mit<br />
tragischen Folgen. Die Arbeit musste oft im Dunkeln oder bei<br />
ungenügender Beleuchtung verrichtet werden.<br />
Immer wieder gelangte man in unbekannte, neue Regionen der<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 44
Bergbau<br />
Zeitungsbericht vom<br />
4.8.1944<br />
Unterwelt <strong>und</strong> konnte den Verlauf der Gesteinsschicht nicht<br />
voraussehen.<br />
Der Bergdruck liess Stollenabschnitte einstürzen.<br />
Sicherheitsmassnahmen, wie wir sie heute kennen, gab es noch<br />
nicht. Sprengungen gehörten zum Alltag, mit den bekannten<br />
Risiken.<br />
Lange Arbeitszeiten unter Tag, oft unter ges<strong>und</strong>heitsschädigenden<br />
Bedingungen, gefährdeten die Arbeiter. In den <strong>Kohle</strong>bergwerken<br />
kam noch die Gefahr der Schlagwetter dazu.<br />
Dazu kamen die Risiken der Natur in den Bergen. Auf dem Weg zu<br />
den Gruben lauerten Gefahren, die man nicht immer abschätzen<br />
konnte: Lawinen, Steinschlag, Wasser<br />
Fehlende Arbeitsst<strong>und</strong>en wurden durch keine Versicherung<br />
gedeckt, grosse Familien waren mit geringen Löhnen zu ernähren,<br />
jeder Franken zählte.<br />
Gruben-Unglück. In der Nacht vom 31. Juli zum 1. August 1944<br />
verunglückte in der <strong>Kohle</strong>ngrube Kanderkohle AG Kandergr<strong>und</strong> an<br />
den Folgen einer <strong>Kohle</strong>ngasvergiftung der 39-jährige Familienvater<br />
Walter Messerschmidt, staatenloser Bergbauarbeiter. Er hinterlässt<br />
Frau <strong>und</strong> 1 Kind. Was uns besonders beeindruckt, ist folgendes:<br />
Walter Messerschmidt ist von Berlin nach Belgien, von dort nach<br />
Frankreich <strong>und</strong> schliesslich von Frankreich vor einem Jahr in die<br />
Schweiz geflüchtet. Mit Frau <strong>und</strong> Kind ist er mehrmals knapp dem<br />
Tode entgangen. Hier in der Schweiz nun, wo Messerschmidt die<br />
Sicherheit erlangt <strong>und</strong> Arbeit gef<strong>und</strong>en hatte, erreichte ihn ein<br />
Unfalltod. Walter Messerschmidt war ein vorbildlicher<br />
Familienvater. Sein sehr sympathisches Wesen war gepaart mit<br />
Liebe <strong>und</strong> grosser Klugheit. Aufrichtig <strong>und</strong> edel, wie selten jemand.<br />
Die Erde sei Dir leicht, Du lieber Heimatloser. Der Frau <strong>und</strong> dem<br />
Kind Messerschmidt unser aufrichtiges Beileid.<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 45
Bergbau<br />
Arbeitsvorschläge, Ideensammlung<br />
<strong>Schiefer</strong> Spaziere der Engstligen entlang, zum Beispiel im Gand oder bei der<br />
Hängebrücke <strong>und</strong> suche Steine. Findest du <strong>Schiefer</strong>steine?<br />
Beschreibe einen solchen Stein möglichst genau: Farbe,<br />
Beschaffenheit.<br />
Versuche einen Stein zu spalten.<br />
Nimm einen spitzen Stein oder anderen Gegenstand <strong>und</strong> schreibe,<br />
zeichne auf den <strong>Schiefer</strong>.<br />
Versuche einen <strong>Schiefer</strong> zu bearbeiten, schleifen, schneiden <strong>und</strong><br />
mache einen Holzrahmen darum. Jetzt hast du deine eigene Tafel.<br />
<strong>Kohle</strong> Spaziere von der BKW Kandergr<strong>und</strong> auf dem schmalen Strässlein<br />
ein paar Meter in Richtung Frutigen. Bald kommst du zu der Stelle,<br />
wo die frühere Seilbahnstation stand. Hier liegen noch <strong>Kohle</strong>reste<br />
herum.<br />
Beschreibe einen solchen <strong>Kohle</strong>nrest, verreibe ihn am Boden<br />
Am Grillplatz: Versuche aus einem Stück Holz „Holzkohle“ zu<br />
machen<br />
Geht in die Holz- <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong>nhandlung <strong>und</strong> lasst euch die<br />
verschiedenen <strong>Kohle</strong>arten zeigen.<br />
Wie schwer ist ein Stück Holz?<br />
Wie schwer ist ein gleich grosses Stück Holzkohle?<br />
Schwimmt Holz auf dem Wasser?<br />
Schwimmt <strong>Kohle</strong>?<br />
Versuche <strong>Kohle</strong> anzuzünden.<br />
Probiere es aus <strong>und</strong> schreibe auf, was du beobachtest.<br />
Nimm eine Karte <strong>und</strong> suche die Standorte von früheren Gruben.<br />
Anspruchsvoll: Bastle eine Transportseilbahn: Kiste, Rollen, Seile.<br />
(Beachte: Die ehemaligen Gruben sind nicht zugänglich!)<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 46
Bergbau<br />
<strong>Schiefer</strong><br />
<strong>Kohle</strong><br />
Ausflüge, Exkursionen, Besichtigungen<br />
Wanderung der Engstlige entlang zur Hängebrücke, auf der andern<br />
Seite zurück<br />
Spissenweg von Frutigen nach Adelboden oder umgekehrt<br />
Weg von Frutigen über Elsigbach nach Adelboden. Gute Aussicht<br />
auf die Spissen <strong>und</strong> das Gelände der früheren Gruben<br />
Besuch der Fabrik Natursteine Frutigen. Hier werden noch<br />
vereinzelt <strong>Schiefer</strong>tafeln (Jasstafeln) hergestellt.<br />
BLS-Weg von Kandersteg nach Kandergr<strong>und</strong> oder bis Frutigen<br />
Wanderung der Kander entlang Kandersteg – Frutigen oder<br />
umgekehrt auf der Seite der BKW<br />
Höhenweg Kiental-Ramslauenen-Schlafegg. Abstieg nach<br />
Kandergr<strong>und</strong> oder weiter nach Kandersteg. Auch umgekehrt<br />
möglich, oder einen Teil davon.<br />
Wanderung ins Ueschinental<br />
Weitere Ideen <strong>und</strong> genaue Angaben zu Zeitbedarf, Schwierigkeit.<br />
auf der Wanderkarte Frutigen:<br />
Frutigen. Vom Niesen bis Kandersteg <strong>und</strong> Adelboden, 1 : 25000<br />
mit Routenbeschreibungen<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 47
Bergbau<br />
Adressen<br />
Kulturgutstiftung Frutigland<br />
Verkehrsbüro Frutigen<br />
Verkehrsbüro Adelboden<br />
Verkehrsbüro Kandersteg<br />
Gemeindeverwaltungen<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 48
Bergbau<br />
Quellen<br />
Frutiger <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> Kandergr<strong>und</strong>er <strong>Kohle</strong><br />
Kulturstiftung Frutigland 2004<br />
Verfasser Benjamin Graf <strong>und</strong> Fritz Allenbach<br />
Frutigbuch<br />
Ausgabe 1977<br />
Verfasser Robert Werder<br />
Überarbeitet <strong>und</strong> ergänzt von HP. Bach<br />
Weitere Informationen <strong>und</strong> Zeitdokumente:<br />
<strong>Schiefer</strong>arbeiter erzählen<br />
Kulturstiftung Frutigland<br />
DVD<br />
11. November 2004 an der Ausstellung<br />
„Frutiger <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> Kandergr<strong>und</strong>er <strong>Kohle</strong>“<br />
Blicke in die Ausstellung<br />
Aufgenommen: Peter Allenbach Adelboden<br />
DVD<br />
19. November 2004<br />
Vortrag über die Spissen<br />
Ernst Ruch<br />
Aufgenommen: Fritz Inniger, Adelboden<br />
DVD<br />
Besuche in den <strong>Schiefer</strong>gruben 2006<br />
„I dr Wildi <strong>und</strong> Almi Ladholz“<br />
Hängebrücke Hohstalden<br />
Samis Redlifahrt Lintergrabe<br />
© www.projektwochen.info Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft / <strong>Schiefer</strong> <strong>und</strong> <strong>Kohle</strong> Seite 49