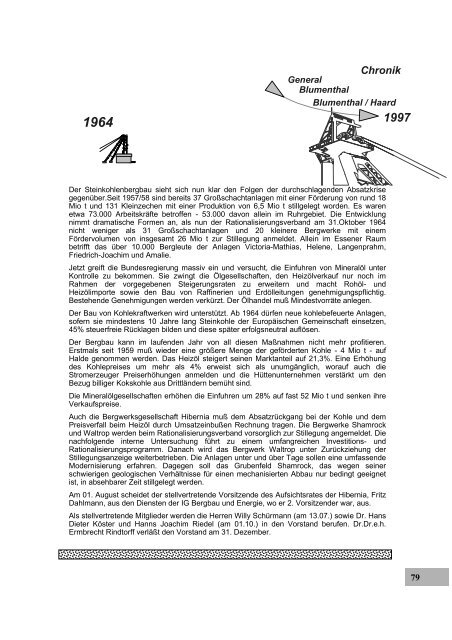1964 - RDB Recklinghausen
1964 - RDB Recklinghausen
1964 - RDB Recklinghausen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1964</strong><br />
Chronik<br />
General<br />
Blumenthal<br />
Blumenthal / Haard<br />
1997<br />
Der Steinkohlenbergbau sieht sich nun klar den Folgen der durchschlagenden Absatzkrise<br />
gegenüber.Seit 1957/58 sind bereits 37 Großschachtanlagen mit einer Förderung von rund 18<br />
Mio t und 131 Kleinzechen mit einer Produktion von 6,5 Mio t stillgelegt worden. Es waren<br />
etwa 73.000 Arbeitskräfte betroffen - 53.000 davon allein im Ruhrgebiet. Die Entwicklung<br />
nimmt dramatische Formen an, als nun der Rationalisierungsverband am 31.Oktober <strong>1964</strong><br />
nicht weniger als 31 Großschachtanlagen und 20 kleinere Bergwerke mit einem<br />
Fördervolumen von insgesamt 26 Mio t zur Stillegung anmeldet. Allein im Essener Raum<br />
betrifft das über 10.000 Bergleute der Anlagen Victoria-Mathias, Helene, Langenprahm,<br />
Friedrich-Joachim und Amalie.<br />
Jetzt greift die Bundesregierung massiv ein und versucht, die Einfuhren von Mineralöl unter<br />
Kontrolle zu bekommen. Sie zwingt die Ölgesellschaften, den Heizölverkauf nur noch im<br />
Rahmen der vorgegebenen Steigerungsraten zu erweitern und macht Rohöl- und<br />
Heizölimporte sowie den Bau von Raffinerien und Erdölleitungen genehmigungspflichtig.<br />
Bestehende Genehmigungen werden verkürzt. Der Ölhandel muß Mindestvorräte anlegen.<br />
Der Bau von Kohlekraftwerken wird unterstützt. Ab <strong>1964</strong> dürfen neue kohlebefeuerte Anlagen,<br />
sofern sie mindestens 10 Jahre lang Steinkohle der Europäischen Gemeinschaft einsetzen,<br />
45% steuerfreie Rücklagen bilden und diese später erfolgsneutral auflösen.<br />
Der Bergbau kann im laufenden Jahr von all diesen Maßnahmen nicht mehr profitieren.<br />
Erstmals seit 1959 muß wieder eine größere Menge der geförderten Kohle - 4 Mio t - auf<br />
Halde genommen werden. Das Heizöl steigert seinen Marktanteil auf 21,3%. Eine Erhöhung<br />
des Kohlepreises um mehr als 4% erweist sich als unumgänglich, worauf auch die<br />
Stromerzeuger Preiserhöhungen anmelden und die Hüttenunternehmen verstärkt um den<br />
Bezug billiger Kokskohle aus Drittländern bemüht sind.<br />
Die Mineralölgesellschaften erhöhen die Einfuhren um 28% auf fast 52 Mio t und senken ihre<br />
Verkaufspreise.<br />
Auch die Bergwerksgesellschaft Hibernia muß dem Absatzrückgang bei der Kohle und dem<br />
Preisverfall beim Heizöl durch Umsatzeinbußen Rechnung tragen. Die Bergwerke Shamrock<br />
und Waltrop werden beim Rationalisierungsverband vorsorglich zur Stillegung angemeldet. Die<br />
nachfolgende interne Untersuchung führt zu einem umfangreichen Investitions- und<br />
Rationalisierungsprogramm. Danach wird das Bergwerk Waltrop unter Zurückziehung der<br />
Stillegungsanzeige weiterbetrieben. Die Anlagen unter und über Tage sollen eine umfassende<br />
Modernisierung erfahren. Dagegen soll das Grubenfeld Shamrock, das wegen seiner<br />
schwierigen geologischen Verhältnisse für einen mechanisierten Abbau nur bedingt geeignet<br />
ist, in absehbarer Zeit stillgelegt werden.<br />
Am 01. August scheidet der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Hibernia, Fritz<br />
Dahlmann, aus den Diensten der IG Bergbau und Energie, wo er 2. Vorsitzender war, aus.<br />
Als stellvertretende Mitglieder werden die Herren Willy Schürmann (am 13.07.) sowie Dr. Hans<br />
Dieter Köster und Hanns Joachim Riedel (am 01.10.) in den Vorstand berufen. Dr.Dr.e.h.<br />
Ermbrecht Rindtorff verläßt den Vorstand am 31. Dezember.<br />
79
80<br />
Jahresübersicht <strong>1964</strong><br />
Kohlenförderung ges. tvF 1.613.710<br />
Tagesförderung tvF/d 6.183<br />
Leistung tvF/MS i.d. Gewinnung 15,192<br />
unter Tage 2,668<br />
gesamt 2,382<br />
Belegschaft Arbeiter unter Tage 2.612<br />
über Tage 707<br />
Angestellte 376<br />
Belegschaft gesamt 3.695<br />
Anzahl der Gewinnungsbetriebe 10,8<br />
Förderung je Abbaubetriebspunkt tvF/d 558<br />
Bergeanteil i.d. Rohförderung % 28,34<br />
Mittlerer Abbaufortschritt m/d 1,41<br />
Selbstkosten unter Tage DM/tvF 39,16<br />
über Tage DM/tvF 7,26<br />
Betriebskosten DM/tvF 51,16<br />
Kalk. Gesamtselbstkosten DM/tvF 59,37<br />
Kalk. Betriebsergebnis DM/tvF -2,67<br />
Vollhauerdurchschnittslohn DM/MS 36,09<br />
Unfälle unter Tage je 100.000 verf. Schichten 115<br />
Tödliche Unfälle 5<br />
Für das Bergwerk General Blumenthal<br />
fällt nun die Entscheidung über die<br />
weitere Zukunft: Im Grubenfeld<br />
Shamrock wird noch bis zur<br />
Fertigstellung einer Verbundanlage<br />
General Blumenthal/Shamrock Kohle<br />
abgebaut. Die in Schollen<br />
anstehenden steilgelagerten Vorräte<br />
auf Shamrock sind wirtschaftlich nicht<br />
gewinnbar. Im Gegensatz dazu sind im<br />
Grubenfeld General Blumenthal die<br />
zumeist flachgelagerten Flöze wenig<br />
gestört und bieten ausgezeichnete<br />
Chancen für einen mechanisierten<br />
Abbau über eine Dauer von mehr als<br />
einem halben Jahrhundert.<br />
Der Förderschacht 6 des Bergwerks<br />
General Blumenthal aber ist überaltert<br />
und hat mit einem Fördervolumen von<br />
etwa 6.500 tvF je Tag seine<br />
Leistungsgrenze erreicht. Seine<br />
Dampffördermaschinen stammen aus<br />
den Jahren 1907 und 1911 und hätten<br />
in nächster Zeit ersetzt werden<br />
müssen. Da die Kapazitäten in der<br />
Hauptstrecken- und Schachtförderung<br />
ausgefahren sind und Bunker fehlen,<br />
können Förderspitzen in den einzelnen<br />
Abbaurevieren nicht aufgefangen<br />
werden.<br />
Leistungs- und Förderabfall in der Gewinnung und ein erheblicher Schichtenaufwand in den<br />
rückwärtigen Diensten sind die Folge. Auch die Aufbereitungsanlage ist abgewirtschaftet und<br />
nicht in der Lage, eine höhere Förderung durchzusetzen. Das Bergwerk Shamrock 3/4<br />
hingegen verfügt über eine neue, leistungsfähige Aufbereitung und einen modernen<br />
Zentralschacht. So sollen die Tagesanlagen des Bergwerks Shamrock 3/4 weiter genutzt<br />
werden. Unter Tage wird eine etwa 9 km lange Strecke beide Bergwerke verbinden. Die<br />
gleiche Teufe der Hauptfördersohlen erleichtert die Aufgabe. Die Auffahrung ist umgehend in<br />
Angriff zu nehmen.<br />
Durch diesen Verbund wird es möglich, die Förderung aus den Blumenthal-Feldern gemäß der<br />
Planung auf 9.000 bis 10.000 tvF je Tag zu erhöhen und die Kohle auf Shamrock 3/4 zu Tage<br />
zu heben und aufzubereiten.<br />
Der Presse gegenüber hält sich der Vorstand noch bedeckt. So erklärt Bergass. a.D. Hawner<br />
am 27. Dezember, daß die Entscheidung, ob General Blumenthal zu einer<br />
Zentralschachtanlage ausgebaut werden oder aber ein Verbund mit dem Bergwerk Shamrock<br />
erfolgen soll, erst für Anfang 1965 zu erwarten sei. Das Bergwerk General Blumenthal sei eine<br />
Perle, die noch in der Muschel liege. Es sei an der Zeit, diese Muschel aufzubrechen.<br />
Das Bergwerk General Blumenthal indessen bereitet sich auf den Abbau der Flöze Karl 1,<br />
Dickebank, Wasserfall und Sonnenschein in den C-Feldern vor. Da der Schacht 3 bei 2 oder 3<br />
in den C-Feldern gleichzeitig laufenden Streben die erforderliche Wettermenge nicht bringen<br />
kann, muß ein neuer Einziehschacht vom Tage geteuft werden - der Schacht General<br />
Blumenthal 8. Bereits 1957 fand eine erste Begehung des späteren Schachtgeländes durch<br />
die Herren Bergwerksdirektor Kegel, Betriebsdirektor Weber, Markscheider Riedel und<br />
Wirtschaftsing. Wunsch statt. Ausgewählt wurde der Bereich zwischen der ehemaligen Ewald-<br />
Bahn und dem Silvert-Bach.
Ein Jahr später werden mit dem Vorstand Fragen der Großausrichtung und des Abteufens<br />
geklärt. Nach dem Erwerb des Grundstücks wird dann am 30. Januar 1960 der einen Monat<br />
vorher eingereichte Rahmenbetriebsplan vom Oberbergamt Dortmund zugelassen. Ab Ende<br />
März 1960 bringt die Firma C. Deilmann Bergbau GmbH, Bentheim, eine<br />
Untersuchungsbohrung bis auf eine Teufe von 601,7 m nieder. Diese zeigt, daß die Schichten<br />
des Turon bei 457 m Teufe beginnen. Der geplante Schacht muß also zumindest bis zu<br />
diesem Niveau im Gefrierverfahren niedergebracht werden. Die geologische Abteilung der<br />
Westfälischen Berggewerkschaftskasse in Bochum begleitet die Bohrarbeiten. Frau Dr. Dora<br />
Wolanski und Herr Dr. Schöne-Warnefeld werten die Ergebnisse aus. Obwohl der<br />
Schachtansatzpunkt im wasserreichsten Gebiet der gesamten Umgebung liegt, kann man sich<br />
zu einer Verlegung nicht entschließen. Dennoch wird die Deutsche Schachtbau- und<br />
Tiefbaugesellschaft in Lingen beauftragt, drei Bohrungen zur Ermittlung der Wasserzuläufe zu<br />
erstellen. Seit dem 17. April laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Abteufen. Die Firma<br />
Gewerkschaft Walter, Essen, erhält den Auftrag für das Abteufen des Schachtes. Diese<br />
überträgt ihrerseits einen Teil der Aufgaben an die Firma Heitkamp in Wanne-Eickel. Im<br />
August ist das Gefriermaschinenhaus fertig. Der Kranz der Gefrierbohrlöcher wird erstellt und<br />
am 13. Oktober beginnt man mit der Herstellung des Frostkörpers. Etwa 50.000 m3 <strong>1964</strong><br />
Deckgebirge sind von 9 Grad auf -15 Grad Celsius abzukühlen. Das ist bis zum 18. Dezember<br />
geschehen. Die Abteufarbeiten beginnen am 01. Dezember mit einem Bagger, dessen Wirken<br />
die erste Kalksandsteinschicht ein Ende setzt. Bis Ende des Jahres steht die Fördermaschine.<br />
Die Heizanlagen sowie Kauen und ein Teil der Bürobaracken werden in Betrieb genommen.<br />
Am Ende des Jahres sind 13,55 m geteuft.<br />
Das Bergwerk bringt seine Förderung im Berichtsjahr<br />
vor allem aus den Flözen Karl, Hugo, Katharina,<br />
Zollverein 1 und Röttgersbank sowie aus den<br />
steilgelagerten Betrieben der Flöze Dickebank und<br />
Sonnenschein.<br />
In der flachen Lagerung läuft ein Streb in Flöz<br />
Zollverein 4 an und wird nach nur 3 Monaten wieder<br />
gestundet.<br />
Aus vollmechanisierten Betrieben kommen nun schon<br />
77,33% der Gesamtförderung.<br />
In Flöz Karl 2 wird ein weiterer Streb mit dem<br />
Rahmenausbau der Firma Hemscheidt ausgerüstet.<br />
Erstmals steht die zentrale Pumpstation nicht im<br />
Bereich des Strebeingangs, sondern etwa 400 m<br />
zurück in der Bandstrecke. Erfolgreich ist der Einsatz<br />
eines überschweren Hobelkörpers im gleichen Streb,<br />
der nun das Klettern des Gewinnungsgerätes auf<br />
einen harten Liegendpacken verhindert.<br />
Mit den durch eine elektro-hydraulische Beienmatik<br />
angetriebenen Rammanlagen stellt sich eine neue<br />
Generation der Gewinnungsgeräte für die steile<br />
Lagerung vor. Es werden 3 dieser Anlagen beschafft<br />
und kommen in den Streben Röttgersbank und<br />
Wilhelm (Blindschacht 88) sowie Wilhelm<br />
(Blindschacht 77) zum Einsatz. Diese nun<br />
hochmechanisierten Steilstreben bringen jeweils eine<br />
tägliche Förderung von mehr als 1.200 tvF. Auch sind<br />
die Bergleute in diesen Betrieben mit ihren hohen<br />
Gedingelöhnen recht zufrieden.<br />
Die ersten als Kurvenförderer konzipierten<br />
Stegkettenförderer des Typs EKF 0, -geliefert von der<br />
Firma Halbach und Braun-, erscheinen unter Tage.<br />
Anlegung von Lehrlingen<br />
Ausbildung von Lehrlingen<br />
81
82<br />
Die DEMAG-Vortriebsmaschine VS 1 (Nashorn) fährt ein Aufhauen in Flöz Dickebank im 5.<br />
Querschlag unterhalb der 3. Sohle auf.<br />
Im Flözberg Röttgersbank westlich des 3. Querschlages läuft eine neuartige Schrapperwinde<br />
mit innenliegenden hydraulischen Trommelbremsen.<br />
Der Einbau einer Bandraffanlage der Firma Eickhoff in der Bandstrecke des Flözes Dickebank<br />
(Rev. 9) ermöglicht es, ein 1.000 m langes Band mit nur einem Antrieb zu betreiben.<br />
Das Bestreben, den Bergleuten lange Fußwege auch in gleislosen Strecken zu ersparen, führt<br />
zur Einführung der Fahrt auf den vorhandenen Förderbändern. Besondere<br />
Sicherheitsmaßnahmen sind vor allem an den Auf- und Absteigestellen zu treffen, bis in den<br />
Bandstrecken der Streben in den Flözen Karl 2 (Rev. 13) und Dickebank (Rev. 9) die<br />
Bandfahrt freigegeben werden kann.<br />
Erstmals wird auch in der 6. Richtstrecke auf der 3. Sohle eine Einschienenhängebahn zur<br />
Personenbeförderung hergerichtet.<br />
Gondel für den<br />
Personentransport<br />
mit der<br />
Einschienenhängebahn<br />
In der horizontalen Ausrichtung wird auf der 7. Sohle der 9. Querschlag nach Süden<br />
weitergetrieben. Mit dem Ziel, wie bei der Verbindung des 3. und 5. Querschlages einen<br />
Kreisverkehr in der Förderung möglich zu machen, beginnt die Unternehmerfirma Grüttner im<br />
Januar mit der Weiterauffahrung der 2. Richtstrecke - als Gegenort zum 9. Querschlag nach<br />
Süden.<br />
Auf der 9. Sohle erfolgt im Mai aus dem Blindschacht 952 heraus die Auffahrung des 5.<br />
Querschlages in Richtung Schacht 2. Der Querschlag soll die Vorräte oberhalb der 9. Sohle<br />
aufschließen und eine Wetter-, später auch eine Förderverbindung zum Schacht 2 herstellen.<br />
Im Oktober wird der Transportberg Flöz Katharina im 3. Querschlag mit der 7. Sohle<br />
durchschlägig.<br />
Die Erstellung der neuen Bergebrechanlage auf der 7. Sohle vom 4. Querschlag aus wird<br />
forciert. Das ist nötig, weil die nunmehr 11 Jahre alte Brechanlage auf der 3. Sohle an Schacht<br />
7 weitgehend abgewirtschaftet ist und vom Maschinenrevier nur unter erheblichem<br />
Reparaturaufwand und hohen Kosten betriebsfähig erhalten wird. Der Leiter der<br />
Maschinenabteilung, Obersteiger Walter Pothmann, hält es sogar für fraglich, ob die Zeit bis<br />
zur Fertigstellung der neuen Anlage noch überbrückt werden kann.
<strong>1964</strong><br />
Nun werden im September die Erweiterungsarbeiten im Maschinenbereich in Angriff<br />
genommen. Die Kosten für die maschinelle Einrichtung und den elektrischen Teil des Objekts<br />
liegen bei etwa 1.100.000 DM. Den Auftrag erhält am 28. Oktober die Westfälische<br />
Maschinenbau AG in Unna. Die neue Brechanlage soll bei einschichtigem Betrieb stündlich<br />
250 t Berge durchsetzen.<br />
Der Umbau im Schacht 3 geht zügig voran. Auf der 7. Sohle werden das erweiterte Füllort<br />
angesetzt und der Seilfahrtskeller hergestellt.<br />
In der Nacht zum 29. August muß der Hauptförderschacht 6 stillgelegt werden. Die Kante<br />
eines auf der 7. Sohle aufgeschobenen Förderwagens hat eine herausragende<br />
Spurlattenschraube erfaßt. Beim Treiben werden auf einen Abschnitt von etwa 130 m<br />
Spurlatten und Einstriche herausgerissen, bis der Korb steht. Der Anschläger Willi Büttner<br />
beweist viel Mut, als er trotz der herabfallenden Teile das am Schacht angebrachte Notsignal<br />
betätigt. Menschen kommen nicht zu Schaden. Ab 07. September läuft die Förderung wieder.<br />
Betroffene Bergleute erhalten ein Überbrückungsgeld.<br />
Nach dem Auslaufen der Zollverein-Streben im Bereich Schacht 2 zwischen der 2. und der 5.<br />
Sohle kann der Schacht 2 die gesamte Seilfahrt der Anlage 1/2/6 und einen Teil der<br />
Materialförderung übernehmen. Das bedeutet dringend nötige Entlastung für den<br />
Förderschacht 6. Voraussetzung dafür ist neben der Einbindung der Hauptförderung zur 7.<br />
Sohle die Einrichtung einer Nebenförderung von der 7. zur 9. Sohle.<br />
Über Tage wird durch den<br />
Bau einer geschlossenen<br />
Mannschaftsbrücke eine<br />
direkte Verbindung vom<br />
Schacht 2 zur Kaue<br />
geschaffen, die die oft<br />
naßgeschwitzten Bergleute<br />
vor Unbilden der Witterung<br />
schützt.<br />
Für den Tagesschacht 5<br />
kommt im Berichtsjahr das<br />
Ende. Am 05. Februar 1904<br />
begann das Abteufen. Bei<br />
einer Teufe von 540 m<br />
stellte man zunächst die<br />
Arbeiten ein und setzte<br />
dann 1914 den Schacht nur<br />
in den Maßen eines<br />
Blindschachtes von etwa<br />
5,0 x 2,5 m auf die<br />
Mannschaftsbrücke von der Kaue zum Schacht 2<br />
Endteufe von 640,1 m bis<br />
zur 5. Sohle durch.<br />
Während der Zeit des Abbaus der Flammkohlenflöze im Westfeld des Bergwerks diente der<br />
Schacht 5 als Abwetterschacht. Da eine Wiederaufnahme des Abbaus in diesem Bereich<br />
ausgeschlossen werden kann, entschließt man sich, den Schacht abzuwerfen und nach<br />
Ausrauben des noch verwendbaren Materials zu verfüllen. Vom Kraftwerk Buer bezieht man<br />
dazu etwa 15.000 t Granulatasche, die nicht zusammenbackt und gegebenenfalls wieder<br />
abgezogen werden kann, falls der Schacht einst doch wieder gebraucht werden sollte. Das<br />
würde aktuell, wenn eines Tages der Abbau der Vorräte im Niveau der 9. Sohle, bis zu der der<br />
Schacht dann noch abgeteuft werden müßte - zweckmäßigerweise vom Bergwerk Schlägel<br />
und Eisen aus - zur Debatte stünde. "Wir wollen unseren Nachkommen die Arbeit möglichst<br />
bequem machen", so Bergwerksdirektor Nehrdich am 10. Juni anläßlich einer Jubilarfeier. Am<br />
09. Dezember bringt ein Seilzug das Fördergerüst zum Fallen.<br />
83
84<br />
Beim Abteufen des Blindschachtes 751 sind<br />
im August die bergmännischen Arbeiten<br />
abgeschlossen.<br />
Der Blindschacht 331 soll vom Niveau Flöz<br />
Dickebank bis Flöz Sonnenschein<br />
weitergeteuft werden, um die Flöze Wasserfall<br />
und Sonnenschein aufzuschließen. Im<br />
März fällt der erste Abschlag.<br />
Die Gasabsaugung bringt im Berichtsjahr<br />
einen Gewinn von etwa 60.000 DM. Die<br />
Gaswirtschaft untersteht nun der<br />
Werksdirektion Energie, wie auch das<br />
Fernheizsystem, an das am 07. Dezember<br />
die Anlage 3/4 angeschlossen wird. Im<br />
Tagesbetrieb werden auf der Anlage 1/2/6 die<br />
werksinternen Straßen weiter ausgebaut.<br />
Hier beginnt man im Mai mit dem Abriß des<br />
alten Kesselhauses. Der Neubau des<br />
Gebäudes wird später einen Teil der<br />
Gasabsaugung und das Lager der<br />
Bohrabteilung aufnehmen. Der Holzplatz<br />
erhält eine neue Beleuchtungsanlage.<br />
Klimakammern verbessern die Arbeitsbedingungen<br />
der an Schacht 6 tätigen<br />
Fördermaschinisten.<br />
Auf Initiative der Westfälische Berggewerkschaftskasse<br />
erhalten französische<br />
Das fallende Fördergerüst des Schachtes 5<br />
Firmen die Möglichkeit, neue Verfahren zur<br />
Untersuchung oberflächennaher Schichten<br />
auf Wasserführung kennenzulernen. In dicht<br />
besiedelten Gebieten können Kenntnisse<br />
darüber wertvoll sein, aber auch beim<br />
Abteufen von Schächten. Die Versuche<br />
finden hinter Schacht 7 statt. Da die<br />
Meßgeräte gewisse Ähnlichkeit mit<br />
Geigerzählern haben, verbreitet sich das<br />
Gerücht, auf dem Gelände von General<br />
Blumenthal befänden sich radioaktive Stoffe<br />
oder es seien Schatzgräber am Werk.<br />
Natürlich ist die Presse sofort zur Stelle.<br />
Bergwerksdirektor<br />
Sachlage klar.<br />
Nehrdich stellt die<br />
Am 17. Februar protestiert die Belegschaft<br />
des Bergwerks gegen eine ab dem 01. Juli<br />
vorgesehene Mieterhöhung bei den<br />
Rechnungsführer Alfred Markötter sen.<br />
Werkswohnungen.<br />
Der Wohnungsbau läuft auf vollen Touren. Auf dem Kuniberg sind 60 Wohneinheiten im Bau.<br />
Am Schneewitchenring entstehen 56 Eigenheim-Wohneinheiten für Bergleute, von denen im<br />
Dezember 12 bezogen werden können. Auch für die Angestellten kann der Bedarf weiter<br />
reduziert werden. In der Sauerland- und Lipperlandstraße werden insgesamt 28 Wohnungen<br />
gebaut. Im Dezember können 12 Familien von Angestellten einziehen. An der<br />
Westerwaldstraße läuft der Bau von 12 Reiheneigenheimen.
<strong>1964</strong><br />
Für den Nachwuchs im Bergbau bringt das Jahr eine zusätzliche Aufstiegsmöglichkeit. Die<br />
Berggewerkschaftskasse Bochum gründet im März eine Fachschule für den<br />
Steinkohlenbergbau. Hier können Bergleute mit einer mindestens 4-jährigen Untertagepraxis<br />
in Abendschulkursen auf den Gebieten Bergbau-, Maschinen- oder Elektrotechnik in den<br />
Aufsichtsdienst überwechseln. Die Ausbildung ist auf 2 Semester angesetzt. Außerdem sollen<br />
die Bewerber vier Semester lang im wöchentlichen Wechsel zwischen Schule und Praxis<br />
ausgebildet werden. Vom Bergwerk General Blumenthal nehmen die ersten 6 Bergfachschüler<br />
dieses Angebot wahr.<br />
Das 1963 ins Leben gerufene Berufsfindungsjahr zeigt sich als Erfolg. Mehr als die Hälfte der<br />
Lehrlinge entschließt sich zu einer Ausbildung auf General Blumenthal, mehr als erwartet. Im<br />
Berichtsjahr läuft die Maßnahme mit 50 neuen Teilnehmern weiter. Der Vorstand genehmigt<br />
ein zusätzliches Jahr. Vier weitere Bergwerke im Ruhrgebiet übernehmen dieses<br />
Ausbildungssystem.<br />
Der ausgezeichnete Kenntnisstand der ausgebildeten Lehrlinge hat auch seinen Nachteil. Die<br />
umliegende Industrie wirbt kräftig ab - allen voran das Opel-Werk in Bochum, das hohe Löhne<br />
zahlt.<br />
Am 31. Juli geht der Tagesbetriebsführer Friedrich Rumberg in den Ruhestand. Erwin Löhken<br />
übernimmt ab dem 01. August die Leitung des Tagesbetriebes.<br />
An einem Magenleiden verstirbt am 23. November Rechnungsführer Alfred Markötter sen..<br />
Noch 1962 konnte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Nachfolger wird sein bisheriger<br />
Stellvertreter Josef Schardt.<br />
Dr.-Ing. Dietrich Ernst übergibt am 01. Dezember unter Beibehalt seines Geschäftsbereiches<br />
als Betriebsdirektor die Leitung der Stabsstelle an Dipl.-Ing. Dietrich Zimmermann. Die<br />
Abteilung Arbeitsplatzbewertung, Betriebsstudien und Gedingewesen liegt nun in den Händen<br />
von Fahrsteiger Josef Schmidt, der bis dahin in der Abteilung Mechanisierung tätig war.<br />
Am 31. Dezember wird Betriebsführer Dr.-Ing. Ulrich Klinge zur Hauptverwaltung, Abt. Technik<br />
unter Tage, versetzt.<br />
Am 30. Juli verstirbt der seit August 1961 im Ruhestand lebende Obersteiger Franz Monieta.<br />
Im Juli besucht Bundesschatzminister Dr. Werner Dollinger in Begleitung von Herren seines<br />
Ministeriums und der VEBA Kraftwerke einige Chemiebetriebe und Bergwerke im Revier. Auch<br />
das Bergwerk General Blumenthal steht auf dem Programm. Seine Meinung: "Ein Minister<br />
muß von seinen Schätzen etwas mehr wissen als nur Aktenkenntnisse". Er fährt mit dem<br />
“Bereisungswagen” in den Zechenbahnhof ein und nutzt die Zeit, die zum Umspannen der<br />
Lokomotive nötig ist, zu einem Gespräch mit Vorstandsmitglied Bergass. a.D. Hawner,<br />
Bergwerksdirektor Nehrdich und dem Vorsitzenden des Betriebsrats, Kastner.<br />
Bundesschatzminister Dr. Dollinger<br />
besucht das Bergwerk.<br />
v.l.: Betriebsratsvorsitzender Kastner,<br />
Minister Dr. Dollinger, Bergwerksdirektor<br />
Nehrdich, Bergass. a.D. Hawner<br />
85
86<br />
Der Oberbürgermeister der Stadt <strong>Recklinghausen</strong>, Heinrich Auge, informiert sich anläßlich<br />
einer Grubenfahrt mit den SPD-Kandidaten Frohne, Lichtenfeld und Masche über die Arbeit<br />
unter Tage. Bergwerksdirektor Nehrdich, Betriebsführer Spree und Betriebsratsvorsitzender<br />
Kastner begleiten den Besuch.<br />
Am 01. Mai feiert der Blumenthaler Werkschor unter Leitung von Studienrat Siegfried<br />
Jablonski sein 10-jähriges Bestehen. Bergwerksdirektor Nehrdich würdigt das Bestreben, das<br />
deutsche Liedgut zu pflegen. Der Vorsitzende des Blumenthaler Betriebsrates, Walter Kastner,<br />
bedankt sich für das Mitwirken des Chores bei Veranstaltungen des Bergwerks. Stadtdirektor<br />
Jäger übermittelt Grüße vom Rat und der Verwaltung der Stadt <strong>Recklinghausen</strong>. Der Chor hat<br />
oft bei Jubilarfeiern und anderen betrieblichen Veranstaltungen den festlichen Rahmen<br />
gegeben, aber auch bei Beerdigungen von Belegschaftsmitgliedern. Seit dem 01. Januar 1962<br />
ist er Mitglied des Deutschen Sängerbundes. Ein Treffen aller Hibernia-Chöre, an dem<br />
insgesamt über 700 Sänger teilnahmen, fand noch 1963 statt. Auch außerhalb des<br />
eigentlichen "Schachtsicherheitspfeilers" hat der nun etwa 50 Mann starke Chor in den<br />
vergangenen Jahren die Recklinghäuser Bürger mit seinem Gesang erfreut. Auch der Humor<br />
ist nie zu kurz gekommen. Am 20. Juli 1959 brachte die Recklinghäuser Zeitung das Bild eines<br />
"Adebar-Transports". Die Mitglieder des Chores erstanden damals einen Kinderwagen und<br />
brachten ihn traditionsgemäß zur Wohnung eines Sangesbruders, bei dem gerade Nachwuchs<br />
angekommen war. Ein Ständchen auf dem Marktplatz machte die Sache offiziell.<br />
Der Chronist erinnert sich noch gern daran, wenn sich zur Probe am Abend eines jeden<br />
Montags gegen Viertel vor acht im Rettungslager die Stimmen erhoben: "Grüß Gott, grüß Gott<br />
mit hellem Klang. Heil deutsches Wort und Sang".