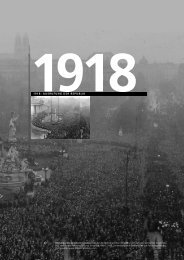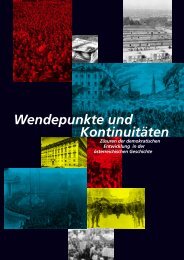Hrsg - Forum Politische Bildung
Hrsg - Forum Politische Bildung
Hrsg - Forum Politische Bildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WIEDER<br />
GUT<br />
MACHEN?<br />
ENTEIGNUNG ZWANGSARBEIT<br />
ÖSTERREICH 1938-1945/1945-1999<br />
ENTSCHÄDIGUNG RESTITUTION
WIEDER<br />
GUT<br />
MACHEN?<br />
ENTEIGNUNG ZWANGSARBEIT<br />
ÖSTERREICH 1938-1945/1945-1999<br />
ENTSCHÄDIGUNG RESTITUTION<br />
Herausgeber: <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong><br />
Konzeption und Textauswahl: Heidrun Schulze und Gudrun Wolfgruber<br />
Redaktion: Gertraud Diendorfer
Sonderband<br />
der Schriftenreihe Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong><br />
Herausgegeben vom <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong><br />
A-1050 Wien,<br />
Rechte Wienzeile 97<br />
Tel.: 0043/1/545 75 35-39<br />
Fax: 0043/1/548 06 66<br />
e-mail: dien@polbild.vienna.at<br />
Bestelladresse<br />
StudienVerlag<br />
Postfach 104,<br />
A-6010 Innsbruck<br />
Fax: 0512/39 50 45-15<br />
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme<br />
Wieder gut machen?<br />
Enteignung, Zwangsarbeit, Entschädigung, Restitution<br />
[hrsg. vom <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong>]. –<br />
Innsbruck; Wien: Studien-Verl., 1999<br />
(Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>; Sonderb.)<br />
ISBN 3-7065-1404-4<br />
Umschlag und grafisches Konzept: Thomas Kussin<br />
Grafische Ausführung: Rosmarie Ladner<br />
Lektorat: Helga Gibs<br />
Druck: Remaprint<br />
Printed in Austria 1999<br />
Trotz intensiver Bemühungen konnten bis jetzt nicht alle Inhaber von Text- und<br />
Bildrechten ausfindig gemacht werden. Für entsprechende Hinweise ist der Verlag<br />
dankbar. Sollten Urheberrechte verletzt worden sein, wird der Verlag nach Anmeldung<br />
berechtigter Ansprüche dies entgelten.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Inhalt<br />
4 Einleitung<br />
7 Enteignung<br />
8 Hans Witek: „Arisierungen“ in Wien.<br />
Aspekte nationalsozialistischer Enteignungspolitik<br />
1938–1940<br />
21 Jonny Moser: Die Zentralstelle für jüdische<br />
Auswanderung in Wien<br />
27 Georg Scheuer: Delogiert, deportiert, ermordet<br />
31 Abbildung: Ansuchen um eine<br />
Geschäftsübernahme<br />
33 Zwangsarbeit<br />
34 Ulrich Herbert: Zwangsarbeiter im<br />
„Dritten Reich“ – ein Überblick<br />
46 Interview mit Florian Freund:<br />
„Die Kriegswirtschaft wäre ohne<br />
ZwangsarbeiterInnen zusammengebrochen“<br />
55 Die vergessenen Opfer<br />
56 Brigitte Bailer-Galanda:<br />
Beinahe vergessene Opfer – Roma und Sinti<br />
63 Brigitte Bailer-Galanda: Vertrieben und<br />
nicht zurückgekehrt<br />
65 Wolfgang Neugebauer: Zum Umgang mit<br />
den Opfern der NS-Rassenhygiene nach 1945<br />
71 Jana Müller: Kinder und Jugendliche als<br />
Opfer der NS-Verfolgung<br />
75 Martina Scheitenberger, Martina Jung:<br />
Fürsorge – Arbeitshaus – KZ: Das Leben der<br />
Betty Voss<br />
81 Brigitte Bailer-Galanda: Die sogenannten<br />
„U-Boote“ – überlebt im Verborgenen<br />
85 Frauen im Widerstand<br />
86 Die Verfolgung der Zeugen und Zeuginnen<br />
Jehovas<br />
87 Die Verfolgung Homosexueller während des<br />
Nationalsozialismus<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
89 Rückstellung und Entschädigung<br />
90 Brigitte Bailer-Galanda: Die Opfergruppen und<br />
deren Entschädigung<br />
97 Erste Anlaufstellen/Maßnahmen für Opfer des<br />
Nationalsozialismus nach 1945<br />
98 Helga Embacher: Der Kampf um die rechtliche<br />
Anerkennung jüdischer Überlebender<br />
103 Brigitte Bailer-Galanda: „Ohne den Staat weiter<br />
damit zu belasten …“ Bemerkungen zur<br />
österreichischen Rückstellungsgesetzgebung<br />
113 Frank Stern: Rehabilitierung der Juden oder<br />
materielle Wiedergutmachung – ein Vergleich<br />
124 Interview mit Georg Graf: „Lücken in der<br />
Gesetzgebung“<br />
131 Der NS-Kunstraub<br />
132 Interview mit Hannah Lessing: „<br />
Bei uns werden alle berücksichtigt“<br />
134 Nationalfonds der Republik Österreich für<br />
Opfer des Nationalsozialismus<br />
139 Robert Knight: „Ich bin dafür, die Sache in<br />
die Länge zu ziehen“<br />
141 Historikerkommission<br />
Interviews mit:<br />
142 Clemens Jabloner:<br />
„Wir liefern historische Fakten“<br />
146 Karl Stuhlpfarrer: „Wir müssen tun, was schon<br />
vor 30 Jahren hätte geschehen sollen“<br />
151 Bertrand Perz: „Was jetzt passiert, wäre vor<br />
15 Jahren noch undenkbar gewesen“<br />
160 Die Archive öffnen sich: Die Erforschung der<br />
Firmen- und Bankengeschichte während<br />
der NS-Zeit<br />
161 Glossar<br />
178 Zeittafel<br />
180 Literatur zum Thema<br />
182 Internet-Adressen zum Thema
Einleitung<br />
„Wieder gut machen?“ – Der Titel der vorliegenden Publikation verweist auf die Problematik<br />
des Begriffs der „Wiedergutmachung“, also auf die prinzipielle Infragestellung der Möglichkeit,<br />
das während des Nationalsozialismus erlittene Leid, den Terror und die Verluste sowie<br />
psychische, physische und materielle Folgeschäden überhaupt „wiedergutmachen“ zu<br />
können. Wenn in den Jahrzehnten nach Ende der NS-Herrschaft und auch in der aktuellen<br />
Debatte von „Wiedergutmachung“ die Rede ist, so wird sie zudem meist eingeschränkt als<br />
finanzielle bzw. materielle Leistungen für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung verstanden.<br />
Die Notwendigkeit eines Bemühens um die moralische Rehabilitierung der Opfer,<br />
ihre Reintegration in und Unterstützung durch die österreichische Nachkriegsgesellschaft<br />
wurde und wird demgegenüber weitgehend in den Hintergrund auch der aktuellen Debatte<br />
über noch ausstehende Rückstellungen und Entschädigungen gerückt.<br />
Ursachen für die aktuelle Debatte gibt es mehrere. Zum einen gibt es bei den jüngeren<br />
Generationen eine größere Bereitschaft, sich mit dem Thema bzw. mit der eigenen Geschichte<br />
auseinanderzusetzen, was auch mit der Distanz der Generationen zum Nationalsozialismus<br />
zusammenhängt. Zum anderen gibt es in Europa und weltweit aufgrund der<br />
geänderten geopolitischen Situation seit längerem eine Diskussion über den Umgang mit<br />
dem Nationalsozialismus. Beschleunigt wurde die Diskussion durch die rechtliche Möglichkeit,<br />
in den USA Sammelklagen gegenüber Firmen oder Banken einzureichen. Voraussetzung<br />
ist eine Geschäftsverbindung mit den USA, ein Umstand, der angesichts der zunehmenden<br />
Globalisierung immer mehr gegeben ist und den Opfern eine Möglichkeit eröffnet,<br />
zu ihrem Recht zu kommen. Internationale Konferenzen wie die Londoner „Raubgoldkonferenz“<br />
(1997) und die Washingtoner Konferenz über „Vermögenswerte aus der Ära des<br />
Holocaust“ (1988) sowie die Einrichtung von Kommissionen wie der Bergier-Kommission in<br />
der Schweiz zeigten Wege auf, sich dem Erbe der eigenen Geschichte zu stellen. Im September<br />
1998 kam es auch in Österreich zum Beschluss, eine Historikerkommission einzurichten,<br />
die den Vermögensentzug und Vermögensvorenthalt auf dem Gebiet der Republik<br />
Österreich zwischen 1938 und 1945 und die Rückstellungs- und Entschädigungspraxis der<br />
Zweiten Republik untersuchen soll. Intention des vorliegenden Sonderbandes ist es nun, mit<br />
den ausgewählten Texten, mit Interviews mit Mitgliedern der Historikerkommission und Hintergrundinformationen<br />
eine Möglichkeit zu bieten, sich über die aktuellen Debatten hinaus<br />
eingehend mit den zur Diskussion gestellten Fragen auseinandersetzen, nachlesen und<br />
informieren zu können. Vor allem aber auch, um zu vermitteln, warum diese Debatte und<br />
warum konkrete Schritte notwendig und wichtig sind.<br />
Notwendig nicht nur, weil die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung mehr als fünfzig<br />
Jahre lang in ihrem Bemühen um Entschädigung und Rehabilitation überwiegend als BittstellerInnen<br />
behandelt oder überhaupt ignoriert wurden. So erhielten trotz zahlreicher Novellierungen<br />
des Opferfürsorgegesetzes sowie der Rückstellungsgesetze seit 1945 viele Opfergruppen<br />
bis zur Einrichtung des Nationalfonds der Republik Österreich im Jahr 1995 keine<br />
oder nur eine unzureichende materielle Entschädigung, manche sind bis heute von der<br />
Opferfürsorge nicht anerkannt. Diese Debatte ist aber auch wichtig für das gesellschaftliche<br />
Bewusstsein Österreichs, weil die verzögerte Rückstellungspraxis und die lückenhafte Opfer-<br />
4 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
fürsorgegesetzgebung nach 1945 ein eindrückliches Beispiel sind für den Umgang Österreichs<br />
mit seiner Vergangenheit während des Nationalsozialismus. Viele Bereiche der NS-<br />
Herrschaft, die gegenwärtig diskutiert und die auch in diesem Band thematisiert werden,<br />
wurden zudem jahrzehntelang verdrängt.<br />
Unser Themenschwerpunkt – Enteignung und Zwangsarbeit, rassistische, politische, religiöse<br />
Verfolgung während des Nationalsozialismus und die (nicht)erfolgte Rückstellung entzogenen<br />
Vermögens und Entschädigung der Opfer in Österreich nach 1945 – hat daher<br />
das Anliegen, nicht nur das Ausmaß der nationalsozialistischen Beraubung und Verfolgung,<br />
sondern auch Kontinuitäten von Denkmustern im Umgang mit den Opfern in der<br />
Zweiten Republik aufzuzeigen. So untersuchen einige der ausgewählten wissenschaftlichen<br />
Texte, Interviews und ZeitzeugInnenberichte die nationalsozialistische Praxis und die verschiedenen<br />
Aspekte von Zwangsenteignungen, die unterschiedlichen Dimensionen von<br />
Zwangsarbeit sowie die Erfahrungen der bislang „vergessenen Opfergruppen“, andere<br />
thematisieren die Haltung der Republik Österreich gegenüber den Betroffenen im Bereich<br />
der Opferfürsorge sowie in der Rückstellungspraxis. Ergänzt werden diese Texte durch<br />
Interviews mit ExpertInnen, die im Bereich der Wissenschaft bzw. in ihrer Berufspraxis mit<br />
diesen Fragestellungen konfrontiert sind.<br />
Zentrale Aspekte der gegenwärtigen Diskussion und des Forschungsstandes werden in Interviews<br />
mit Mitgliedern der Historikerkommission thematisiert. Dadurch soll der Hintergrund<br />
über das Wie und Warum der aktuellen Entwicklungen in Österreich, wie etwa die Einsetzung<br />
und die Arbeitsweise der von der Regierung beauftragten Historikerkommission<br />
nachvollziehbar werden. Ein Anhang in Form eines umfangreichen Glossars, einer Zeittafel,<br />
weiterführender Literaturhinweise und Internetadressen sollen den Charakter des Bandes als<br />
Nachschlagewerk unterstreichen.<br />
Wir haben uns für eine Zusammenstellung bereits publizierter Texte unter anderem deshalb<br />
entschieden, weil damit auch der bisherige Forschungsstand zu diesen Themen reflektiert<br />
werden soll; neue Forschungserkenntnisse sind allerdings in den nächsten Monaten und<br />
Jahren zu erwarten (siehe auch die Literaturhinweise auf demnächst erscheinende Publikationen<br />
im Anhang). Eine solche Zusammenstellung bringt allerdings auch editorische Probleme<br />
mit sich. Die ausgewählten Texte wurden vielfach durch Einleitungen oder Informationskästen<br />
bzw. Kommentare ergänzt, teilweise auch aktualisiert; so ist zum Beispiel der Beitrag von<br />
Wolfgang Neugebauer zum Opferfürsorgegesetz und den Sterilisationsopfern in Österreich<br />
fast zur Gänze neu geschrieben worden. Notwendige Erläuterungen und Anmerkungen wurden<br />
im Glossar dargestellt, daher ist in den Texten, wenn der jeweilige Begriff zum ersten<br />
Mal verwendet wird ein entsprechendes Verweiszeichen ➤ angebracht. Die alte Rechtschreibung<br />
wurde in den wieder abgedruckten Beiträgen beibehalten, ansonsten verwenden wir<br />
die neue Schreibweise; dies entspricht somit der gegenwärtigen Übergangsphase, in der sowohl<br />
die alte als auch die neue Rechtschreibung nebeneinander verwendet werden. Die<br />
Berücksichtigung der weiblichen und der männlichen Schreibweise konnte ebenfalls nicht<br />
bei allen Textstellen und in einer einheitlichen Form umgesetzt werden.<br />
Für die Unterstützung bei der Auswahl der Texte danken wir Mag. Elisabeth Morawek,<br />
Leiterin der Gruppe <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> des Bundesministeriums für Unterricht, und Mag.<br />
Sigrid Steininger, Gruppe <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> des Bundesministeriums für Unterricht. Besonderer<br />
Dank gilt weiters unseren InterviewpartnerInnen Dr. Florian Freund, Dr. Georg Graf,<br />
Mag. Hannah Lessing, Dr. Clemens Jabloner, Dr. Bertrand Perz und Dr. Karl Stuhlpfarrer für<br />
ihre Gesprächsbereitschaft, für Information und Beratung. Ferner danken wir für wertvolle<br />
Unterstützung und Informationen Mag. Gerlinde Affenzeller, Dr. Brigitte Bailer-Galanda vom<br />
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Mag. Eva Blimlinger, Forschungskoordinatorin<br />
der Historikerkommission, Staatsanwalt Mag. Peter Hadler vom Bundesministerium<br />
für Justiz, Stefan A. Lütgenau, DDr. Oliver Rathkolb und Theo Venus von der Stiftung<br />
Bruno Kreisky Archiv sowie Mag. Peter Schwarz von der Grünen <strong>Bildung</strong>swerkstatt.<br />
Gertraud Diendorfer, Heidrun Schulze, Gudrun Wolfgruber August 1999<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
5
„Arisierungen“<br />
Delogierungen<br />
Flucht und<br />
Vertreibung<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Enteignung<br />
Bereits in den ersten Tagen nationalsozialistischer Herrschaft in Österreich wurde mit umfangreichen<br />
Plünderungen, sog. „wilden ➤ Arisierungen“ von Besitz und Vermögen der<br />
jüdischen Bevölkerung durch selbsternannte ➤ „Ariseure“ begonnen. Mit der Schaffung der<br />
➤ „Vermögensverkehrsstelle“ als Kontroll- und Verwaltungsinstanz sollten die bereits durchgeführten<br />
Enteignungen im Nachhinein legalisiert sowie auch für weitere Vermögensentziehungen<br />
eine gesetzlich geregelte Basis geschaffen werden.<br />
Der einheitliche Gebrauch des nationalsozialistischen (deshalb wird er in dem vorliegenden<br />
Band unter Anführungszeichen gesetzt) Terminus „Arisierung“ für den gesamten Komplex der<br />
Zwangsenteignungen von jüdischem Eigentum und Vermögen suggeriert, es habe sich um eine<br />
einheitliche wirtschaftliche und gesetzlich geregelte Praxis gehandelt. Die vorliegenden<br />
Texte verweisen jedoch auf sehr unterschiedliche Praktiken, Intentionen, Interessen und Konsequenzen<br />
dieser systematischen Übernahme von jüdischem Eigentum. Dienten vor allem die<br />
„wilden Arisierungen“ der Bereicherung von Privatpersonen, so ist insgesamt das österreichische<br />
Modell nationalsozialistischer Enteignungspolitik als Verbindung von Antisemitismus und<br />
Wirtschaftspolitik zu begreifen. Neben der Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen von<br />
Großindustrie, Banken, Gewerbetreibenden und NS-Wirtschaftsplanern verfolgte die nationalsozialistische<br />
Enteignungspolitik auch die systematische Verdrängung der jüdischen Bevölkerung<br />
aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens und in letzter Konsequenz aus Österreich<br />
überhaupt. Der Erinnerungsbericht Georg Scheuers gibt ein drastisches Beispiel dafür, welche<br />
Folgen etwa die „Arisierung“ von Wohnungen durch die Außerkraftsetzung des Mieterschutzes<br />
für die jüdische Bevölkerung darstellte. Auf Wohnungskündigung folgte Zwangsumsiedlung,<br />
Delogierung und schließlich Flucht oder Deportation. Dass die Praxis der materiellen<br />
Bereicherung auch Hand in Hand ging mit Auswanderung und Deportation wird am Beispiel<br />
der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ deutlich. Diese sollte die lückenlose Erfassung<br />
des gesamten jüdischen Vermögens sicherstellen. Über die Verschaffung von Einreisemöglichkeiten<br />
in überseeische Staaten unter totalem Vermögensentzug wohlhabender Juden und Jüdinnen<br />
wurde zu Beginn des NS-Regimes in Österreich die „erwünschte“ Auswanderung mittelloser<br />
Juden und Jüdinnen ermöglicht. Über das entzogene Vermögen wurden auch spätere<br />
Deportationen in Konzentrationslager und damit die „Endlösung der Judenfrage“ mitfinanziert.<br />
Wieviel Vermögen tatsächlich geraubt und entzogen wurde, lässt sich vor allem aufgrund<br />
der in den ersten Monaten nach dem Anschluss in großem Ausmass durchgeführten<br />
„wilden Arisierungen“ nachträglich nur in Ansätzen erfassen und ist daher bislang kaum erforscht.<br />
Auch über den Umfang der Rückstellungen geraubten jüdischen Vermögens oder des<br />
Vermögens anderer während des Nationalsozialismus verfolgter Gruppen liegen noch keine<br />
genauen Zahlen vor. Die Erforschung des gesamten Komplexes des Vermögensentzugs in<br />
Österreich zwischen 1938 bis 1945 durch die eigens dafür eingesetzte Historikerkommission<br />
(s. Kapitel „Historikerkommission“) wird jedoch in den nächsten Jahren zu neuen Ergebnissen<br />
führen. Die folgenden Texte konzentrieren sich überwiegend auf die Darstellung von Zwangsenteignungen<br />
in Wien. Dies erklärt sich einerseits aus der Tatsache, dass der Großteil der<br />
österreichischen Juden und Jüdinnen in Wien wohnhaft war, und zum anderen aus dem Modellcharakter,<br />
den die rasche Durchführung von „Arisierungen“ in Wien insgesamt erlangte.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
7
„ARISIERUNGEN” IN WIEN. ASPEKTE NATIONALSOZIALISTISCHER ENTEIGNUNGSPOLITIK 1938-40<br />
HANS WITEK<br />
„Seit dem ‚Anschluß‘ herrscht offener Straßenterror. Rufe: ‚Juda verrecke!‘ und ‚Juden heraus!‘<br />
hallten vom ersten Tage an durch die Straßen. Bald begannen die Demolierungen und<br />
‚Requirierungen‘, d.h. Plünderungen jüdischer Geschäfte, die Erpressungen bei jüdischen<br />
Geschäfts- und Privatleuten. In den Läden erschienen vierzehn- bis fünfzehnjährige Burschen,<br />
von etwa 20- bis 25jährigen SS-Männern angeführt, und ‚requirierten‘ Lebensmittel,<br />
Schuhe, Anzüge, Stoffe usw. Häufig wurde die Beute mit Lastkraftwagen abtransportiert.<br />
Auf diese Weise wurden z.B. fast sämtliche jüdischen Geschäfte der Innenstadt (Kärntner<br />
Straße, Rotenturmstraße, Mariahilfer Straße, Am Graben usw.) heimgesucht. ‚Requiriert‘<br />
wurden u.a. bis auf geringfügige Reste die großen Lager der Firmen Krupnik, Kleiderhaus<br />
Gerstel, Teppichhaus Schein, Juwelengeschäft Scherr, Herrenkleidergeschäft Katz. Die Ausräumung<br />
des Warenhauses Schiffmann in der Taborstraße dauerte drei Tage. Arbeiter mit<br />
Hakenkreuzbinden leerten die Lager, Männer im Braunhemd hielten die neugierige Menge<br />
fern. Vor den jüdischen Läden, die trotz dieser Vorfälle offenzuhalten versuchten, brachte<br />
man Plakate an, schmierte Inschriften auf das Pflaster, überpinselte die Schaufensterscheiben<br />
mit gröbsten Beschimpfungen. Die Polizei versagte jeden Schutz.“ 1<br />
Mit diesen Worten beschreibt ein zeitgenössischer Bericht – „Der Terror gegen die Juden.<br />
Das Schreckensregiment in Österreich“ – die Wiener Judenverfolgungen in den ersten<br />
Monaten nationalsozialistischer Herrschaft 1938. Neben den Hinweisen, daß sich „kommissarische<br />
Verwalter“ Geschäfte und Betriebe jüdischer Eigentümer angeeignet hatten und<br />
eine staatliche ➤ „Arisierungszentrale“ errichtet wurde, heißt es im Bericht weiter:<br />
„Unter diesen Umständen zogen es natürlich viele jüdische Kaufleute vor, ihre Geschäfte<br />
so rasch als möglich und unter großen Verlusten zu verschleudern. Die ‚Arisierung‘ macht<br />
rasche Fortschritte. Von den in den ersten Wochen arisierten Unternehmen seien genannt:<br />
Wiens größtes Warenhaus ‚Gerngroß‘, Kaufhaus Herzmansky, die Strumpfwarenfirma<br />
Bernhard Schön, die 80 Läden in Wien unterhält, die Anker-Brotfabrik, die Glühbirnenfabriken<br />
Johann Kremenetzky und Albert Pregan. Seither sind Hunderte von jüdischen Geschäften<br />
‚in arische Hände‘ übergegangen.“ 2<br />
Diese Schilderungen verdeutlichen die politische und sozialökonomische Dynamik, den lokalen<br />
Kontext der wirtschaftlichen Enteignung des jüdischen Klein- und Großbürgertums in<br />
der Wiener Privatwirtschaft, 3 welche unmittelbar mit dem „Anschluß“ im März 1938 begann<br />
und innerhalb eines Jahres von den zuständigen lokalen Staats-, Partei- und Wirtschaftsstellen<br />
organisiert und durchgeführt wurde. Alle Einzelfirmen, Personen- und Kapitalgesellschaften<br />
der gewerblichen Wirtschaft, deren Eigentümer oder Anteilseigner Juden waren, wurden<br />
„zwangsarisiert“ oder liquidiert. Den betroffenen Industriellen, Unternehmern, Kaufleuten<br />
und Handwerkern raubten diese Zwangsverkäufe und -liquidierungen ihre Unternehmen. Die<br />
damit verbundene finanzielle Ausplünderung entzog ihnen die wirtschaftliche und soziale<br />
Basis und zwang viele – meist unter totalem Vermögensverlust – zur Auswanderung.<br />
Der Prozeß der „Entjudung der Wirtschaft“ umfaßte die Enteignung von gewerblichen Unternehmen,<br />
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Privatbanken, Haus- und Grundbesitz. 4<br />
Die antisemitische Personalpolitik im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft führte<br />
zur Entlassung von Beamten, Angestellten und Arbeitern; die rassistische Säuberung des industriellen<br />
Managementbereiches erzwang das berufliche Ende für Direktoren, Prokuristen,<br />
Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder in den Industrieunternehmen.<br />
„Auch aus den freien Berufen der Sparten Presse, Literatur, Theater, Film, Musik, bildende<br />
Künste, ebenso aus den Berufsorganisationen der Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte und Notare<br />
wurden alle Juden und ‚Mischlinge‘ bis Ende November 1938 restlos ausgeschieden<br />
und verloren damit ihre Approbationen zur Berufsausübung an ihre arischen Konkurrenten.“ 5<br />
In Wien lebte der größte Teil der österreichischen Juden – 170.000 Personen, 6 was 1938<br />
einem Anteil von zehn Prozent an der städtischen Gesamtbevölkerung entsprach; die<br />
jüdische Gemeinde Wiens war die größte des „Großdeutschen Reiches“. Früher als im<br />
8 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
sogenannten „Altreich“, bereits Anfang 1939, war die ökonomische Entrechtung und Enteignung<br />
der Wiener Juden praktisch beendet. Wiener „Spezialisten“ konnten weniger erfahrenen<br />
„reichsdeutschen Kollegen“ Hinweise für die praktische Durchführung dieses<br />
Raubzuges geben, Wien hatte in dieser Hinsicht Modellcharakter.<br />
Es stellt sich die Frage, wer die „Arisierungen“ in Wien durchführte, welche unterschiedlichen<br />
Interessen dabei im Spiel waren. Grundsätzlich können vier Interessensgruppen differenziert<br />
werden: Zum einen die „kleinen Ariseure“, die sofort persönliche Vorteile realisieren<br />
wollten; zweitens mittelständische Interessen, die auf Ausschaltung von Konkurrenten<br />
und Übernahme der besten Geschäfte und Betriebe zielten. Industrie und Banken, als dritte<br />
Interessensgruppe, verfolgten Besitzerweiterungsstrategien. Diese waren verbunden mit der<br />
von NS- und Wirtschaftsplanern angestrebten sozial- und wirtschaftspolitischen Strukturveränderung.<br />
Zwischen diesen Interessensgruppen bestand zwar der Minimalkonsens, daß<br />
die Juden aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen werden müssen, über die Frage der<br />
Durchführung der Enteignung kam es zu Konflikten.<br />
Gerhard Botz hat in seinen Forschungen zur NS-Sozialpolitik und Judenverfolgung in<br />
Wien 1938 7 unter anderem darauf hingewiesen, daß der Wiener Antisemitismus neben<br />
einer rassenideologischen auch eine ausgeprägte soziale und ökonomische Komponente<br />
hatte und die antijüdischen Verfolgungsmaßnahmen konkret mit materiellen Interessen der<br />
Täter verknüpft waren.<br />
„Die Aggressivität gegen ‚den‘ Juden bedurfte hier keiner besonderen ‚theoretischen‘ Überhöhung,<br />
versprach sie doch eine Erfüllung ganz konkreter Interessen: die Beseitigung des<br />
jüdischen Konkurrenten als Händler oder Warenhausbesitzer, als Rechtsanwalt oder Arzt,<br />
die Erlangung einer Wohnung oder eines wertvollen Möbelstückes etc. Diese Art von Antisemitismus<br />
verstand jeder, der sich von der ‚Judenhatz‘ einen materiellen Vorteil erhoffte.“ 8<br />
In Wien konnte das nationalsozialistische Regime an die politische Tradition des „Volksantisemitismus“<br />
anknüpfen, jenes virulenten, ökonomisch, kulturell und religiös begründeten<br />
Antisemitismus der Monarchie, der Ersten Republik und der austrofaschistischen Diktatur. 9<br />
Die in Wien für breite Teile der Bevölkerung vorhandenen sozialen und ökonomischen Probleme<br />
(Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, unrentable Handels- und Gewerbebetriebe etc.) versuchte<br />
das nationalsozialistische Regime durch ein Konzept der Enteignung und Vertreibung<br />
einer stigmatisierten Gruppe zu lösen. Aus der Strategie der Ausgrenzung folgten,<br />
nachdem die Auswanderung ab Herbst 1939 kaum mehr möglich war, Konzentration, Deportation<br />
und als letzter Schritt der industriell betriebene Massenmord an den Juden.<br />
Neben den unmittelbaren Interessen der „Ariseure“ läßt sich aus den überlieferten Akten<br />
auch die von NS- und Wirtschaftsplanern angestrebte sozial- und wirtschaftspolitische<br />
Strukturveränderung rekonstruieren. Staatliche Institutionen strebten an, daß „jüdisches Vermögen<br />
nicht einfach geraubt und übereignet“ wird, sondern daß „die Arisierung mit einem<br />
Modernisierungs- und Konzentrationsschub der rückständigen ‚ostmärkischen‘ Wirtschaft<br />
verknüpft“ 10 würde.<br />
Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Gesamtdarstellung über die Zerstörung der wirtschaftlichen<br />
Existenz der Wiener Juden in den Jahren 1938 bis 1940 und deren vielfältige<br />
Hintergründe. Bisher wurde diese Thematik nur partiell zum Gegenstand der Forschung gemacht.<br />
11 Firmengeschichtliche Darstellungen oder Branchenmonographien zur „Arisierungspolitik“<br />
liegen nur vereinzelt vor. 12<br />
Ausgehend von diesem Forschungsstand können im vorliegenden Beitrag nur die wichtigsten<br />
Aspekte der Interdependenz von Nationalsozialismus, Ökonomie und Judenverfolgung<br />
am Beispiel der antijüdischen Enteignungspolitik in der Wiener Privatwirtschaft 1938/39<br />
skizziert werden. Ziel dieses Beitrages ist es, die staatliche Organisierung der NS-Enteignungspolitik<br />
und ihre spezifisch österreichische Entwicklung zu zeigen (I); einen kurzen<br />
Überblick über die Methoden der Betriebsverwaltung und die Soziographie des „Kommissarsystems“<br />
zu geben (II); typische Merkmale parteipolitischer „NS-Wiedergutmachung“<br />
und protektionistischer Mittelstandspolitik herauszustellen (III); die Expansionsstrategien von<br />
Banken und Industrieunternehmen und deren Realisierungen im Prozeß der Enteignung der<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
9<br />
Hans Witek<br />
„Lösung“<br />
ökonomischer<br />
und sozialer<br />
Probleme durch<br />
Enteignung und<br />
Vertreibung
„Arisierungen“ in Wien<br />
Juden zu skizzieren (IV); strukturpolitische Folgen, Zweck und Praxis der Betriebsliquidierungen<br />
zu beschreiben (V). Die folgende deskriptiv-analytische Darstellung ist eine Vorarbeit<br />
zu einer größeren Studie zur nationalsozialistischen „Arisierungspolitik“ in Wien 1938 bis<br />
1945.<br />
I. Modell Wien: Organisierung der NS-Enteignungspolitik<br />
Die nationalsozialistische Politik der „Arisierung“ im Bereich der Privatwirtschaft bedeutete<br />
die Umstrukturierung der Eigentumsverhältnisse nach „rassischen“ Prinzipien. Industrie-, Handels-<br />
und Gewerbebetriebe, deren Eigentümer Juden waren oder an denen diese als Gesellschafter<br />
oder Aktionäre kapitalsmäßig beteiligt waren, wurden zwangsweise an „arische“<br />
Einzelpersonen, Firmen, Banken etc. übertragen. Die Verträge über Eigentumsübertragungen<br />
erfolgten häufig unter Druck bzw. unter Umständen, „die nur als direkte Nötigung bezeichnet<br />
werden können“. Eine freiwillige Übereinstimmung der Vertragspartner war unter diesen<br />
Voraussetzungen nicht gegeben. „Die Eigentumsübertragungen waren nichts anderes als ein<br />
Mittel der Enteignung zugunsten des Reiches oder der neuen Besitzer.“ 13<br />
Bei Industrie- und Großhandelsfirmen, größeren Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben<br />
wurden deren „Sach-“ und „Verkehrswert“ durch Wirtschaftsprüfungen, bei Kleinbetrieben<br />
durch Schätzgutachten festgestellt. Dem ursprünglichen Eigentümer wurde ein Kaufpreis<br />
zugestanden, „der erheblich unter dem Verkehrswert lag und zudem mit einer hohen<br />
Ausgleichsabgabe an den Staat verbunden war, so daß in der Regel weniger als die Hälfte<br />
des Betriebsvermögens vergütet wurde, der Staat aber von der Ausgleichsabgabe und der<br />
Käufer von der erheblichen Differenz zwischen Verkehrswert und Kaufpreis profitierten.“ 14<br />
Jedoch wurde der Kaufpreis nicht an die ehemaligen Besitzer ausbezahlt, sondern auf<br />
➤ Sperrkonten überwiesen. Aus diesen Sperrguthaben entnahm die Finanzverwaltung Abgaben<br />
für die ➤ „Reichsfluchtsteuer“, ➤ „Judenvermögensabgabe“ etc. „Für eine bescheidene<br />
Lebensführung und für die Ausreise“ 15 wurden den Enteigneten Beträge freigegeben.<br />
Zahlreiche staatliche Gesetze, Verordnungen und Erlässe – von der Ministerialbürokratie<br />
des Reichswirtschafts- und -innenministeriums und der ➤ Vierjahresplanbehörde konzipiert<br />
und erlassen – gaben der antijüdischen Enteignungspolitik ihre spezifische NS-Legalität und<br />
stellten eine Verletzung des bürgerlichen Eigentumsbegriffs dar. 16<br />
Von der im April 1938 verordneten Vermögensanmeldung 17 für Juden über die am 12.<br />
November 1938 erlassene ➤ „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen<br />
Wirtschaftsleben“ 18 bis zur ➤ „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ vom<br />
3. Dezember 1938 19 regelte die NS-Bürokratie die Enteignungspolitik. Dieses NS-Gesetzeswerk<br />
auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Vermögensrechtes war letztlich nichts<br />
anderes als eine Politik staatlich legalisierter Beraubung. 20 Neben der Privatwirtschaft und<br />
der NSDAP war es der NS-Staat, der aus der Enteignung der Klein- und Großunternehmen<br />
finanziellen Gewinn zog. 21<br />
Das „ostmärkische Modell“ der Enteignungspolitik war dieser reichsgesetzlichen Regelung<br />
1938 in vielen Bereichen vorausgeeilt und wurde zum Vorbild für „reichsdeutsche“<br />
Stellen. Die Zentralisierung der Enteignung und ihre verwaltungstechnische Organisation,<br />
die „kommissarische Verwaltung“ der Unternehmen, die finanzpolitische Durchführung der<br />
„Arisierung“, die Zwangsliquidierung der Geschäfte waren in der „Ostmark“ bereits die<br />
übliche Praxis der Enteignungspolitik, die erst Anfang Dezember 1938 für das gesamte<br />
Deutsche Reich vereinheitlicht wurde. 22<br />
„In dieser Entwicklung eines halben Jahres ist vieles komprimiert, was sich in Deutschland<br />
auf Jahre verteilte. Man verfuhr in Österreich 1938 so ‚großzügig‘, wie man es vielleicht in<br />
Deutschland 1933 getan hätte, wenn nicht die Rücksichtnahme auf das Ausland und das<br />
nationale Bürgertum nötig gewesen und andere Probleme vordringlicher erschienen wären.<br />
Insofern zeigt das österreichische Beispiel die Methoden nationalsozialistischer Machtergreifung<br />
– mindestens für den wirtschaftlichen Bereich – in ‚reinerer‘ Form als das deutsche.<br />
Im Verlauf weniger Monate hatte Österreich das Altreich in der praktischen Verdrängung<br />
10 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
der Juden aus der Wirtschaft mindestens eingeholt und in der Vorbereitung einer Zwangsarisierung<br />
überholt, was sich nach der ‚Kristallnacht‘ bestätigen sollte.“ 23<br />
Als staatliche Zentralinstanz der Enteignungspolitik wurde am 18. Mai 1938 im österreichischen<br />
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (ehemals Ministerium für Handel und Verkehr)<br />
die ➤ Vermögensverkehrsstelle (VVST) mit Hauptabteilungen für Wirtschaftssektoren, Finanzen<br />
und Planung gegründet. 24 Ihr oblag die Kontrolle und Gesamtorganisation der „Entjudung<br />
der Wirtschaft“. Sie bestellte die „Kommissare“, „Treuhänder“ und „Abwickler“ für<br />
die Unternehmen, koordinierte die gesamtwirtschaftliche Planungsarbeit der Enteignungen<br />
im Rahmen der strukturpolitischen Vorgaben, genehmigte die „Kaufverträge“, setzte die<br />
Kaufpreise für die zu „arisierenden“ Unternehmen nach Wirtschaftsprüfungs- und Schätzungsgutachten<br />
fest oder verordnete die Betriebsauflösung.<br />
Als Leiter wurde der „Staatskommissar in der Privatwirtschaft“, ➤ Dipl. Ing. Walter Rafelsberger,<br />
Gauwirtschaftsberater der Wiener NSDAP, bestellt. Auf dem Gebiet der Planung<br />
kooperierte die VVST mit der Abteilung III „Staat und Wirtschaft“ des Reichskommissars<br />
➤ Bürckel und den Abteilungen und Referaten des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit<br />
unter Leitung von ➤ Dr. Hans Fischböck.<br />
Von seiten der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft waren die zahlreichen „Arisierungskommissionen“<br />
der Fachverbände und -gruppen, Innungen, Zünfte und Gilden als<br />
Planungs-, Vorschlags- und Durchführungsstellen involviert; auf Parteiebene waren es die<br />
Gau- und Kreiswirtschaftsämter, die neben der politischen Beurteilung der „Ariseure“ auch<br />
lokale Aufsichts- und Organisationsarbeit leisteten.<br />
Koordinations- und Genehmigungsstelle war ausschließlich die VVST, die ab November<br />
1939 als „Abwicklungsstelle“ und später als „Referat III Entjudung“ bei der Reichsstatthalterei<br />
Wien bis zum Kriegsende 1945 weiterbestand. 25 Zahlreiche Beamte, Funktionäre der<br />
Partei und Wirtschaft, Vertreter der Innungen etc. bildeten jenen institutionellen Apparat,<br />
der sich im Zuge der Enteignungspolitik als Normen und Verfahrensweisen setzende Instanz<br />
in der Enteignung von Juden 1938/39 herauskristallisiert und gefestigt hatte. Innerhalb<br />
dieses Apparates war man sich zwar in der Zielvorstellung der totalen „Entjudung der<br />
Wiener Wirtschaft“ einig; über Ausmaß, Tempo und Methoden der Umverteilung kam es<br />
zwischen Staat, Partei und Privatwirtschaft zu Konflikten. Der Streit der Interessensgruppen<br />
hatte nicht nur einen machtpolitischen Charakter, sondern war auch untrennbar mit dem<br />
Kampf um den „Anteil an der Beute“ verbunden: Einem an strukturellen und volkswirtschaftlichen<br />
Kriterien orientierten Konzept der Bürckel-Behörde standen die von den lokalen NS-<br />
Führern vertretenen Versorgungsinteressen der ➤ „Alten Kämpfer“ und anderer NS-Anhänger<br />
gegenüber.<br />
Den hegemonialen Anspruch in der Enteignung hatten sich lokale Parteiorganisationen<br />
und Privatpersonen schon unmittelbar nach dem „Anschluß“ gesichert: Der exzessive Drang<br />
nach individueller Bereicherung bei der Vertreibung der Juden aus der Wirtschaft zwang<br />
Staatsstellen, durch nachträgliche Legalisierung die Dynamik zu kanalisieren. Die „Verstaatlichung“<br />
der Enteignung und jenes spezifische „ostmärkische“ Gesetzes- und Verordnungswerk<br />
für die Legitimierung der antijüdischen Wirtschaftspolitik war wesentlich durch diese<br />
„einheimische Anfangsoffensive“ determiniert.<br />
II. Methoden der Betriebsverwaltung und Soziographie der „Kommissare“<br />
„Jedenfalls, als ich meine Aufgabe hier übernahm, waren die Kommissare eingesetzt bzw.<br />
hatten sich zum großen Teil eingesetzt. Ich stand von vornherein dieser ganzen Situation<br />
mit einigem Mißtrauen gegenüber. (...) Es geht nicht an, daß hier eine neue Berufsgruppe<br />
entsteht, für die es in einem geordneten Wirtschaftsleben auf die Dauer keine Beschäftigung<br />
geben kann. Der eine oder andere dieser Kommissare hat bereits ‚Mein‘ und ‚Dein‘<br />
verwechselt. Dem Teil der Kommissare, der selbstlos und gewissenhaft seine Pflicht tat, spreche<br />
ich den Dank aus. (...) Wer versagte, hat seine Prüfung für Partei und Staat (...) nicht<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
11<br />
Hans Witek<br />
Die Vermögensverkehrsstelle<br />
–<br />
„Verstaatlichung“<br />
der Enteignung
„Wilde<br />
Arisierungen“<br />
„Arisierungen“ in Wien<br />
bestanden, und es wird jeden einzelnen dann die Maßnahme treffen, die es ihm verständlich<br />
macht, daß man Revolution in einem anständigen Staat nicht mit Rucksackspartakisten<br />
durchführt.“ 26<br />
Mit diesen Drohungen versuchte der „Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs<br />
mit dem Deutschen Reich“, Joseph Bürckel, Anfang Juli 1938 die unkontrollierte, individuelle<br />
Bereicherung am Eigentum von Juden zu beenden.<br />
Die Politik der Enteignung hatte in Wien mit der spontanen Aneignung von Geschäften<br />
und gewerblichen Betrieben durch sogenannte „wilde Kommissare“, deren Gesamtzahl anfänglich<br />
laut Fischböck rund 25.000 betragen haben soll, 27 begonnen. Angehörige lokaler<br />
Parteistellen, SA-Leute, Mitglieder der nationalsozialistischen Betriebsorganisationszellen,<br />
Kaufleute und Gewerbetreibende, die der NS-Handels- und Gewerbeorganisation angehörten,<br />
Angestellte und „Konjunkturritter“ hatten die Unternehmen besetzt, die Besitzer vertrieben<br />
oder deren geschäftlichen Einfluß beschränkt, ihre eigene politische und wirtschaftliche<br />
Macht gesichert und ihre materiellen Interessen befriedigt. Die jüdischen Eigentümer hatten<br />
somit keine Verfügungsgewalt über ihre Firmen. Im laufenden Prozeß der „Arisierung und<br />
Liquidierung“ war auch ihr geschäftlicher Verhandlungsspielraum eingeschränkt worden<br />
oder überhaupt nicht vorhanden.<br />
Staatlicherseits war man gezwungen, nachträglich dieses System der „kommissarischen<br />
Verwalter“ zu legalisieren. Durch Gesetze, Verordnungen und Erlässe versuchte man seit<br />
Ende März 1938 die „Kommissarswirtschaft“ zu kontrollieren. 28 Der ordnungsstaatlichen<br />
Politik mit gesamtwirtschaftlicher Ausrichtung gelang es nur langsam, der Selbstherrlichkeit<br />
der „Kommissare“ Grenzen zu ziehen, ein legales Bestellungsverfahren durchzusetzen,<br />
Kontrollinstanzen zu errichten und die Zahl der „wilden Kommissare“ durch Entlassung<br />
oder offizielle Weiterbestellung durch die VVST zu verringern.<br />
Aber auch die von der VVST bestellten „Betriebs- und Geschäftsführer“ waren in den<br />
ihnen anvertrauten Unternehmen kaum zu kontrollieren. Die gesetzlichen Richtlinien definierten<br />
zwar ihre Tätigkeit – Vorbereitung der „Arisierung“ oder Durchführung der<br />
Firmenauflösung –, aber ihre Sonderstellung ermöglichte nur zu oft eine Verknüpfung ihres<br />
Auftrages mit eigenen materiellen und sozialen Interessen.<br />
Viele der „kommissarischen Verwalter“ betrachteten ihre Stellung als reinen Versorgungsposten,<br />
als Möglichkeit, ihre ökonomische Situation rasch zu verbessern. Als „Alte Kämpfer“<br />
und „Illegale“ wurden sie von den diversen Parteistellen protegiert und für „kommissarische<br />
Verwaltungen“ bestimmt, wobei ihre fachliche Qualifikation nebensächlich war.<br />
Der Sozialtypus des „Kommissars“ in Wien läßt sich annäherungsweise folgendermaßen<br />
charakterisieren: Seine politische Zuverlässigkeit war durch die langjährige Zugehörigkeit<br />
zur Partei oder einer ihrer Organisationen unter Beweis gestellt; seiner sozialen Herkunft<br />
nach war er meist Angestellter oder kleiner Selbständiger, manchmal arbeitslos; fachlich<br />
war er größtenteils unqualifiziert und branchenfremd. Vorwiegend wurde er als „Kommissar“<br />
in Klein- und Mittelbetrieben, in Einzelhandelsgeschäften, seltener in Großunternehmen<br />
der Industrie und des Handels tätig. 29 Eine kleinere Gruppe von „Kommissaren“ rekrutierte<br />
sich aus Wirtschaftsfachmännern: Rechtsanwälte, Bankangestellte, Gewerbetreibende oder<br />
Kaufleute. Bei dieser Gruppe war die notwendige Qualifikation gegeben, politische Zuverlässigkeit<br />
verlangt, die Parteizugehörigkeit jedoch nicht unbedingt erforderlich.<br />
Vor allem ab Herbst 1938 versuchte die VVST das Kriterium der fachlichen Qualifikation<br />
bei der Kommissarsbestellung verstärkt zu berücksichtigen, nachdem den Organisationen<br />
der gewerblichen Wirtschaft (vor allem den Zünften und Innungen) ein Vorschlags- und<br />
Beurteilungsrecht bei der Bestellung durch die VVST eingeräumt wurde. Trotzdem blieb der<br />
kaufmännisch unfähige „Kommissar“ weiterhin der dominierende Verwalter.<br />
Das Spektrum seiner „Geschäftspraktiken“ reichte von Bestechlichkeit, Veruntreuung bis<br />
zur maßlosen persönlichen Bereicherung. Die nur gegen eine verschwindend kleine<br />
Gruppe dieser „neuen Wirtschaftsführer“ 1938/39 durchgeführten Verhaftungen und<br />
Gerichtsverfahren beweisen, daß die Kritik an korrupten „Kommissaren“ vor allem deklamatorischen<br />
Charakter hatte. 30<br />
12 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Die hohe Fluktuation der „Kommissare“ – oft hatten Geschäfte und Betriebe innerhalb<br />
weniger Monate mehrere verschiedene Verwalter – verweist auch auf Versuche staatlicher<br />
Stellen, unfähige und korrupte „Kommissare“ auszutauschen. Für die betroffenen Unternehmen<br />
bedeutete die Abfolge verschiedener „Kommissare“ meist einen beschleunigten<br />
Verbrauch der betrieblichen Ressourcen. In vielen Branchen verwaltete eine Person mehrere<br />
Betriebe. Dadurch war eine „ordentliche“ Geschäftsführung eher zufällig und führte tendenziell<br />
zu Geschäfts- und Betriebsauflösungen. Manche „Kommissare“ konnten sich, unterstützt<br />
von örtlichen Parteistellen, durch gleichzeitige Verwaltung mehrerer Betriebe zeitweise<br />
eine gewisse Branchen- und Lokalhegemonie sichern. 31<br />
Im Februar 1939 begann die VVST für die noch bestehenden industriellen Unternehmen<br />
und Großhandelsfirmen sogenannte „Treuhänder“ zu bestellen, welche deren „Arisierung“<br />
oder Auflösung vorbereiteten oder durchführten. Sowohl fachliche Qualifikation als auch<br />
politische Zuverlässigkeit versuchten die staatlichen Stellen dadurch zu erreichen, daß man<br />
die beruflichen Erfahrungen stärker als bei den „Kommissaren“ berücksichtigte. So wurden<br />
vor allem Rechtsanwälte, Bücherrevisoren, Wirtschaftsprüfer, Prokuristen und leitende Angestellte<br />
aus der Wirtschaft als „Treuhänder“ bestellt. Nur eine geringe Anzahl ehemaliger<br />
„kommissarischer Verwalter“ befand sich unter den ausgewählten „Treuhändern“.<br />
Für die Masse der zu bewältigenden Stillegungen im Handels- und Gewerbebereich<br />
berief man „Abwickler“ mit ähnlichem beruflichen Hintergrund. Die Kontinuität der<br />
„Mißwirtschaft“ zeigte sich aber auch bei den „Abwicklern“. Gerade die Tätigkeit der<br />
Betriebsliquidierung bot ausreichend Möglichkeiten, eigene Interessen zu verfolgen. Die<br />
Eigenmächtigkeiten der „Abwickler“ widersprachen der vorgesehenen staatlichen Konzeption<br />
der „bestmöglichen“ Verwertung der Warenlager und Betriebseinrichtungen.<br />
III. „Alte Kämpfer“ und „alter Mittelstand“<br />
Die Arisierungspraxis der VVST der ersten Monate war weniger gesamtwirtschaftlichen<br />
Intentionen verpflichtet als vielmehr parteipolitischem Protektionismus: Mittelständischen<br />
NSDAP-Mitgliedern, „besonders verdienten Parteigenossen“, „Alten Kämpfern“, meistens<br />
ohne finanzielle Mittel und fachliche Kompetenz, wurden im Sinne einer „Wiedergutmachung“<br />
(für „während der Systemzeit im Dienste der Bewegung erlittene Schäden“) Kleinbetriebe<br />
und Handelsgeschäfte zugewiesen.<br />
„Die alten Parteigenossen haben selbstverständlich meist kein Geld. Der Kaufpreis wird<br />
demnach kreditiert. Die Abtragung der Kaufschuld oder des in ihrer Höhe gewährten Kredits<br />
sowie etwaiger Zinsen geschieht in Raten aus den Betriebsmitteln (...) Weil nur schwer<br />
die künftige Entwicklung eines Unternehmens vorauszusehen ist, wird der Kaufpreis wohl<br />
regelmäßig möglichst niedrig bemessen. Der Unterschied gegenüber dem wirklichen Verkehrswert<br />
ist Schenkung, aber auch der Kaufpreis selbst trägt mehr oder minder den Charakter<br />
der Schenkung.“ 32<br />
Weiters finanzierten Kreditaktionen kapitalschwachen Gewerbe- und Handelstreibenden,<br />
vermögenslosen „Alten Kämpfern“ der NSDAP die „Arisierungen“. Im Zuge der Reichswirtschaftshilfe<br />
wurden „Arisierungskredite“ 33 gewährt; bis Ende 1938 wurden aus dem ➤ „Arisierungsfonds“<br />
der VVST, 1939 aus jenem der Kontrollbank finanzielle Zuschüsse für minderbemittelte<br />
Parteigenossen geleistet, 34 quasi nach dem Prinzip, „wonach also der Enteignete<br />
den Enteigner finanzieren half“. 35 Eine weitere Möglichkeit, „Kaufpreis“ und ➤ „Auflage“<br />
zu bezahlen, waren die von den Banken gewährten Privatkredite.<br />
Im folgenden sollen am Beispiel der „Arisierungen“ von Wiener Kinos einige politische<br />
und soziale Implikationen der NS-Enteignungspolitik, deren organisatorische und ökonomische<br />
Durchführung beschrieben werden.<br />
„Die Arisierungskommission im Kinotheaterfach“, die von der VVST, Bürckel-Behörde, NS-<br />
Betreuungsstelle und Reichsfilmkammer, Außenstelle Wien, gebildet wurde, vertrat „die Ansicht,<br />
daß das Abwandern jüdischer Kinotheaterbesitzer benützt werden muß, um einer<br />
Vielzahl von schwerstens geschädigten Parteigenossen eine Lebensmöglichkeit zu bieten“,<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
13<br />
Hans Witek<br />
„Wiedergutmachung“<br />
für<br />
„Alte Kämpfer“
Mittelständische<br />
Interessen<br />
„Arisierungen“ in Wien<br />
und faßte daher „die Arisierung als eine Sozialaktion auf“, wie es in einem Kommunique<br />
Anfang Sommer 1938 hieß. 36 Mit dieser an die Wiener Staats- und Parteistellen abgegebenen<br />
Erklärung wurde gegen die Absichten des „Reichstreuhänders für das Filmwesen“<br />
Stellung genommen. Er wollte mit der neu gegründeten „Ostmärkischen Filmtheater GmbH,<br />
Wien“ (vormals „KIBA GmbH“) ursprünglich sämtliche Kinobetriebe, die Juden gehört<br />
hatten, übernehmen; das wurde aber von der VVST verhindert. 37<br />
Bis Ende 1938 wurden von der „Arisierungskommission“ Eigentumsübertragungen bei<br />
ca. 90 Kinobetrieben mehrheitlich an Wiener NSDAP-Mitglieder bewilligt, von denen viele<br />
bereits als „kommissarische Verwalter“ der Filmtheater von der Reichsfilmkammer-Außenstelle<br />
Wien seit März 1938 eingesetzt worden waren.<br />
Die neuen Kinobesitzer waren in der Mehrzahl „Alte Kämpfer“, viele davon Teilnehmer<br />
am NS-Putsch 1934, „32 Anwärter auf den ➤ Blutorden und 17 Ehrenzeichenträger“, 38 denen<br />
im Rahmen der „NS-Wiedergutmachung“ 1938 materielle Existenzsicherung und sozialer<br />
Aufstieg gesichert wurde. Ihre Biographien waren geprägt von ökonomischen Krisen,<br />
Arbeitslosigkeit und sozialer Deklassierung, unter anderem auch als Folge ihrer NS-Parteiaktivitäten<br />
und deren gerichtlicher Verfolgung vor 1938. Ihre politische Laufbahn fand „Abschluß<br />
und Erfüllung in der durch Einfluß und Protektion der Partei erworbenen individuellen<br />
Reproduktionsbasis“. 39<br />
Jenen NS-Parteigenossen, „die über wenig oder gar kein Kapital und keinerlei fachliche<br />
Vorkenntnis“ 40 verfügten, wurden die Kaufpreise nach Schätzwerten des Betriebsinventars<br />
berechnet, die „Arisierungsauflage“ erlassen, den meisten „Juliputschisten“ wurde durch eine<br />
Kreditaktion aus dem „Arisierungsfonds“ der Kontrollbank die Übernahme und Weiterführung<br />
der Kinos ermöglicht. 41<br />
Ähnliche „Sozialprogramme“ im Sinne „nationalsozialistischer Wiedergutmachung“<br />
verwirklichten die lokalen Staats- und Parteistellen bei der „Arisierung“ der Trafiken und<br />
Lottokollekturen. Diese wurden an „Veteranen des Krieges der Arbeit und der Partei“ 42<br />
vergeben.<br />
Die Praxis der „Arisierung“ unter dem Vorzeichen der „Wiedergutmachung“ brachte den<br />
Nepotismus am deutlichsten zum Vorschein, „denn die Arisierung war ihrer Natur nach eine<br />
Quelle der Korruption“. 43 Bei der übergroßen Anzahl der NSDAP-Mitglieder und „Alten<br />
Kämpfer“, die ein gewerbliches Unternehmen „erwerben“ wollten, brauchte der einzelne<br />
Protektion und Bestechung zur Ausschaltung der „arischen“ Mitkonkurrenten. Das „Prinzip<br />
der politischen Klientel und Cliquen“ 44 war bei diesen „Arisierungstransaktionen“ dominierend.<br />
Nicht nur kleine Parteigenossen, sondern auch höchste Funktionäre bedienten sich<br />
dieses Prinzips. „Was sich jedoch ansonsten auf diesem Gebiet durch kleinere und größere<br />
Schiebungen und die bekannte ‚Wiener Freunderl- oder Vetternwirtschaft‘ getan hat, wird<br />
derzeit kaum durch SS-gerichtliche Untersuchung feststellbar sein“, befürchteten hohe Parteistellen.<br />
45 Auch in Berlin wußte man über die „Wiener Zustände“ Bescheid. Himmler schrieb<br />
im Herbst 1939 an ➤ Heydrich: „Außerdem müßten in Wien – am besten durch eine Kommission<br />
unter Führung eines höheren SS-Führers – die ganzen Arisierungsgeschäfte überholt<br />
und durchgesehen werden. Wir müssen nach Kriegsschluß – wenn der Krieg nicht zu lange<br />
dauert – ganz energisch durchgreifen.“ 46<br />
Eine äußerst effizient praktizierte Enteignungsmethode mit mittelständischer Konzeption<br />
war die Ausschaltung der Juden aus der Wiener Uhren- und Juwelenbranche. Planung und<br />
Durchführung der „Arisierung“, der Auflösung und der „kommissarischen Verwaltung“ der<br />
Gewerbebetriebe und Handelsgeschäfte dieses Wirtschaftszweiges wurden in engster Zusammenarbeit<br />
zwischen den zuständigen Fachorganisationen und der VVST organisiert.<br />
Schon unmittelbar nach dem „Anschluß“ war es durch Initiative der Innung zur Einsetzung<br />
von „wilden Kommissaren“ in vielen Geschäften gekommen. 47<br />
Zentrale Instanz der Enteignungspolitik war die „Arisierungsstelle der Wiener Zunft der Juweliere<br />
und Uhrmacher und der Gilde des Uhren- und Juwelenfaches“. Die VVST genehmigte<br />
als zuständige staatliche Behörde weitgehend die wirtschaftspolitischen Entscheidungen<br />
dieses Gremiums nachträglich. Von den ca. 700 bestehenden Einzelhandelsgeschäften und<br />
14 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Handwerksbetrieben wurde der Großteil aufgelöst. Zwecks Steuerung der Verwertung ihrer<br />
Liquidationsmassen wurde im Sommer 1938 die „Einkaufs- und Treuhandgenossenschaft für<br />
die Uhren- und Juwelenbranche“ gegründet, eine „im ganzen Deutschen Reich einzigartige<br />
Institution“. 48 Dem Vorstand und Aufsichtsrat dieser Genossenschaft gehörten mit Ausnahme<br />
eines Vertreters der VVST nur leitende Zunft- und Innungsfunktionäre an.<br />
„Die Genossenschaft setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Fachgruppen Juweliere<br />
und Uhrenhändler, von denen nur diejenigen aufgenommen werden, die politisch und<br />
charakterlich zuverlässig sind. An diese kann nach den Satzungen der Genossenschaft nur<br />
der Verkauf von Juwelen und Uhren aus jüdischem Besitz erfolgen.“ 49<br />
Im Frühjahr 1939 betrug der Mitgliederstand der Genossenschaft ca. 350 Juweliere und<br />
Uhrmacher, die sich durch Bezahlung einer Genossenschaftseinlage von 50 RM am Abverkauf<br />
der sichergestellten Warenlager etc. beteiligen konnten. 50<br />
Bei der „Arisierung“ der größten Unternehmen wurde eine Methode angewandt, die sich<br />
von der üblichen Praxis der VVST unterschied. Bei Geschäftsübernahme wurde „der Schätzwert<br />
des Unternehmens am Übernahmstag“ 51 als Kaufpreis festgesetzt. Als Schätzwert galt<br />
der Wert des Warenlagers und der Betriebseinrichtungen. So stellte der „Generalabwickler“<br />
für die Uhren- und Juwelenbranche im nachhinein folgendes fest: „Die Schätzungen der<br />
Waren wurden zum Liquidationswerte vorgenommen. Diese lagen mitunter sogar unter<br />
dem Materialwerte, was gerade in dieser Branche mit Hinblick auf die im Altreich<br />
bestehenden Preise als unrichtig bezeichnet werden muß.“ 52 War in anderen Branchen in<br />
der Regel zumindest der „Sachwert“ als „Kaufpreis“ vorgeschrieben, so zeigt diese Vorgangsweise,<br />
zu welchen Rahmenbedingungen in dieser Wirtschaftssparte „Geschäftsübernahmen“<br />
vorgenommen wurden.<br />
IV. Industrie und Banken<br />
Die ersten nach dem „Anschluß“ eingeleiteten „Arisierungen“ im großindustriellen Bereich<br />
wurden vom „Keppler-Büro“ getätigt. ➤ Göring bestellte Wilhelm Keppler am 19.3.1938<br />
zum „Reichsbeauftragten für Österreich“. Die Arisierungspolitik des „Keppler-Büros“ zwischen<br />
März und Juni 1938, das sich im Rahmen des ➤ Vierjahresplanes „nur mit der Arisierung<br />
von Großunternehmen“ 53 beschäftigte, diente der Befriedigung der Expansionsinteressen<br />
reichsdeutscher Industrieunternehmen. Die bedeutendsten Transaktionen dieses Büros<br />
waren die „Arisierung“ der „Hirtenberger Patronen- und Waffenfabrik“ durch Eingliederung<br />
in den Konzern der „Wilhelm Gustloff-Stiftung“ und die Ausgliederung der „Lenzinger<br />
Zellstoff und Papierfabrik AG“ aus dem „Bunzl und Biach-Konzern“ und deren „Arisierung“<br />
durch die „Thüringische Zellwolle AG“. 54<br />
Auch die Creditanstalt-Wiener Bankverein, um nur ein Beispiel aus dem Bereich der<br />
Großbanken zu nennen, führte „Arisierungen“ von Industrieunternehmen durch. So stellt ein<br />
Amtsvermerk der VVST fest: „Von den Aktien (der Schuhfabrik, d. V.) Del-Ka besitzen<br />
24,6 % Creditanstalt-Wr.Bankverein, 66,7 % hat Creditanstalt-Wr.Bankverein aus dem Besitz<br />
der jüdischen Familie Klausner treuhändig erworben.“ 55<br />
Die „Arisierungstätigkeit“ von Großbanken bestand aus Erwerbungen auf eigene Rechnung,<br />
der treuhändigen Verwaltung von Aktien, der Finanzierung von Käufen durch Gewährleistung<br />
von Krediten für ihre Kunden, der Bewertung von „Arisierungsobjekten“ sowie<br />
der Suche und Vermittlung von Partnern, die an Käufen interessiert waren.<br />
Auch private österreichische Firmen und Industrielle versuchten, am „Arisierungsmarkt“ ihre<br />
Geschäftsinteressen zu verwirklichen. Beispielhaft sei die „Arisierung“ der „Kuffnerschen<br />
Brauerei, Preßhefe- und Spiritusfabrik“ im April 1938 durch die „Harmersche Gutsinhabung<br />
und Spiritusfabrik-KG“ erwähnt, welche der Firma den auch heute noch bekannten<br />
Namen „Ottakringer Brauerei“ gab. 56<br />
Eine wichtige Rolle bei den „Arisierungen“ von Industriebetrieben nahm die seit 1941 bestehende<br />
„Österreichische Kontrollbank für Industrie und Handel“ ein. Im Oktober 1938<br />
wurde per Erlaß Fischböcks eine eigene „Arisierungsabteilung“ eingerichtet. 57 ➤ Walther<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
15<br />
Hans Witek
„Legalisierung“<br />
der Arisierungen<br />
„Arisierungen“ in Wien<br />
Kastner, österreichischer Beamter der Reichsstatthalterei, Beauftragter Fischböcks in der<br />
Kontrollbank und Leiter der „Arisierungsabteilung“, beschrieb rückblickend den Zweck dieser<br />
Maßnahmen:<br />
„Das Ziel war eindeutig: Der rein parteipolitisch ausgerichteten Arisierung durch die Vermögensverkehrsstelle,<br />
die Parteimitgliedern Unternehmungen zum Liquidationswert günstig<br />
zuschanzen wollte, sollte die Veräußerung von Großunternehmen entzogen werden. Für<br />
die Arisierung im Wege der Kontrollbank wurde der Grundsatz aufgestellt, daß zwar die<br />
jüdischen Veräußerer nur den Liquidationswert erhalten dürfen, da ihnen ja der weitere Betrieb<br />
ihres Unternehmens untersagt sei, die Erwerber jedoch den Verkehrswert zu zahlen<br />
haben. Die Differenz zwischen diesen Werten nach Abzug der Bankaufwendungen war an<br />
das Reich abzuführen.“ 58<br />
Bis Ende 1942 wurden 102 industrielle Großunternehmen und Großhandelsfirmen, die<br />
von der Abteilung treuhändig übernommen worden waren, an Einzelunternehmer, Firmen<br />
und Banken weiterverkauft, 59 darunter so bekannte Unternehmen wie die „Bunzl & Biach<br />
AG“ und die „Montana AG für Bergbau, Industrie und Handel“. Als das „Arisierungsgeschäft“<br />
beendet war, wurde die Kontrollbank Anfang 1943 von ihren Gesellschaftern (CA,<br />
Länderbank, E.v. Nicolai & Co.) aufgelöst. „Ich hatte Zweifel“, schreibt Kastner, „ob der Nationalsozialismus<br />
den Weltkrieg gewinnen werde, für den Fall seines schlechten Ausganges<br />
schien es aber zweckmäßig, die Kontrollbank nicht mehr als die für Arisierungen verantwortliche<br />
Rechtsperson aufrechtzuerhalten; ehemalige Gesellschafter konnten hierfür nicht in Anspruch<br />
genommen werden. (...) Die Abwicklung ergab einen Erlös, der das Grundkapital<br />
überstieg. Der Arisierungsauftrag hatte sich als Regieträger günstig ausgewirkt.“ 60<br />
Eine ähnliche „Sonderaufgabe“ hatte der „Wiener Giro- und Cassenverein“ 1938 von<br />
Bürckel, Fischböck und der VVST übertragen bekommen: die kollektive „kommissarische<br />
Verwaltung“ und die Auflösung von 77 kleinen und mittleren Privatbanken von insgesamt<br />
85 Firmen jüdischer Eigentümer. 61<br />
Die „Flurbereinigung bei den Privatbankhäusern“, 62 wie Fischböck die Liquidierung von 77<br />
Firmen und die damit verbundene Konzentration in diesem Sektor nannte, war Ende 1938<br />
abgeschlossen. „Arisiert“ wurden die finanz- und industriepolitisch wichtigsten Privatbankhäuser,<br />
darunter das „Bankhaus S.M. Rothschild“, das die Münchner Bank „Merck, Finck &<br />
Co.“ kommissarisch verwaltet und 1940 an die Firma „E.v.Nicolai & Co.“ weitergegeben<br />
hatte, 63 weiters das Wiener Privatbankhaus „Ephrussi & Co.“, das vom langjährigen Mitgesellschafter<br />
und Prokuristen der Firma, C.A. Steinhäusser, „arisiert“ wurde. 64<br />
V. Modernisierung durch Firmenauflösungen<br />
Bürckels ökonomischen und politischen Richtlinien in der Enteignungspolitik lagen verschiedene<br />
Motive zugrunde. In bürokratischer Hinsicht sollte die Ausschaltung der Juden aus der<br />
Privatwirtschaft nach staatlich verordneten Prinzipien erfolgen und die parteipolitischen und<br />
privaten „Einzelaktionen“ verboten, in volkswirtschaftlicher Hinsicht eine Modernisierung<br />
der Wiener Wirtschaftsstruktur im Zuge der Enteignung erreicht werden. Deswegen bestand<br />
die Planung, nur die „wertvollen“ Betriebe zu einem „angemessenen Kaufpreis“ in<br />
„arische“ Hände überzuleiten; zudem sollten die staatlichen Finanzbedürfnisse im Zuge der<br />
„Entjudung“ befriedigt und private „Arisierungsgewinne“ durch Auflagenzahlungen gemindert<br />
werden. Weiters sollte eine genaue Auswahl der Käufer nach fachlicher und politischer<br />
Qualifikation und nach Kreditbedürfnissen vorgenommen werden. 65<br />
Ein Ergebnis dieses Konzeptes resümierte Rafelsberger Anfang Februar 1939:<br />
„Die Strukturwandlungen in der gewerblichen Wirtschaft durch die Entjudung bedeuten<br />
einen Umschichtungsprozeß von ungeheurem Ausmaße … Der große Liquidationssatz und<br />
die Umlagerungen (Standortverlegungen im Zuge der Arisierung) beseitigen in vielen Sparten<br />
die Übersetzung restlos und schaffen in den übrigen bessere Bedingungen. Eine restlose<br />
Berufsbereinigung konnte nicht durchgeführt werden, da diese Planung den arischen Sektor<br />
in der Wirtschaft nicht erfassen konnte.<br />
16 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Für die Zukunft wurden durch die Planung zur Entjudung der gewerblichen Wirtschaft in<br />
der Ostmark Voraussetzungen geschaffen, die nach Überwindung der durch diese ungeheuere<br />
Umschichtung aufgetretenen Hemmnisse sicherlich auch wesentlich zur Stärkung der<br />
ostmärkischen Wirtschaft beitragen und somit der wirtschaftlichen Eingliederung der Ostmark<br />
in den großdeutschen Raum förderlich sind.“ 66<br />
Der Hinweis Rafelsbergers, daß eine restlose „Berufsbereinigung“ nicht durchgeführt werden<br />
konnte, da der „arische“ Sektor der Wirtschaft 1938/39 nicht miteinbezogen wurde,<br />
weist auf das übergeordnete Konzept der Modernisierung der Wiener Wirtschaftstruktur<br />
hin. Die Wiener Juden konnten aufgrund ihrer Stigmatisierung und Entrechtung am leichtesten<br />
aus dem Wirtschaftsleben ausgeschaltet werden. Das war jedoch nur der erste<br />
Schritt. 67<br />
Die nationalsozialistische Enteignungspolitik war daher im wesentlichen durch den Primat<br />
der Betriebsauflösung bestimmt. Die Stillegung der Klein- und Kleinstbetriebe in Handwerk<br />
und Einzelhandel 1938/39 konnte „einen Konzentrationsschub und eine Strukturverbesserung<br />
in der ohnehin gegenüber dem ‚Altreich‘ nachhinkenden Wirtschaft Wiens bewirken.“<br />
68<br />
Das Orientierungsmuster der staatlichen Enteignungsplanung war der mittlere, der „gesunde“,<br />
lebensfähige und „arisierungswürdige“ Betrieb, eine Vorstellung, die den Kleinbetrieb<br />
weitgehend ausschloß. Bis zu einem gewissen Grad entsprach diese Konzeption einer allgemeinen<br />
Mittelstandspolitik, welcher der Gedanke der Branchenbereinigung inhärent war. 69<br />
Die an der Gesamtplanung der Enteignung beteiligten Fachverbände und Organisationen<br />
der gewerblichen Wirtschaft drängten auf Ausschaltung der „jüdischen Konkurrenz“:<br />
„Das Bestreben der Innungen, Zünfte usw., aus Gründen der Beseitigung lästiger Konkurrenz<br />
die Auflösung jüdischer Geschäfte herbeizuführen, ist unverkennbar. Hier fehlt es<br />
BETRIEBSAUFLÖSUNGEN IN WIEN<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
17<br />
Hans Witek<br />
Gesamtstand davon Betriebe aufgelöst arisiert<br />
Betriebe 1938 von Juden<br />
Handwerk in Wien<br />
Glaser 549 58 51 7<br />
Schlosser 1.787 98 85 13<br />
Tischler 3.963 102 87 15<br />
Tapezierer 1.063 259 251 8<br />
Kleidermacher 13.434 1.797 1.681 116<br />
Schuhmacher 5.112 391 368 23<br />
Modewaren 3.413 1.093 938 155<br />
Bäcker 806 30 14 16<br />
Fotografen 822 182 143 39<br />
Baugewerbe 1.647 160 149 11<br />
Gast- und Schankgewerbe 7.970 1.119 852 267<br />
Mieder- und Wäscheerzeuger 4.769 1.571 1.449 122<br />
Einzelhandel in Wien<br />
Nahrungs- und Genußmittel 15.163 2.609 2.419 190<br />
Textil 3.642 2.630 2.163 467<br />
Möbel 313 159 107 52<br />
Eisenwaren 863 304 251 53<br />
Drogeriewaren 1.849 713 557 156<br />
Maschinen 187 68 54 14<br />
Papier- und Galanteriewaren 1.494 458 419 39<br />
Die folgende Statistik wurde zusammengestellt aus: AVA, Handelsministerium, Präs. Auskünfte 1938,<br />
Karton 710; und: Der Staatskommissar in der Privatwirtschaft, Bericht über die Entjudung der Ostmark,<br />
Wien 1.2.1939, s. 48f. (Die Statistik stellt eine Auswahl verschiedener Handwerks- und Einzelhandelsbranchen dar.)<br />
Oberstes Zíel:<br />
Betriebsauflösungen
Verbesserung der<br />
Wettbewerbschancen<br />
des<br />
„arischen“<br />
Kaufmanns<br />
„Arisierungen“ in Wien<br />
„ENTJUDUNG“ DER OSTMARK<br />
Handwerk Handel Industrie Privatbanken<br />
Betriebe jüdischer<br />
Eigentümer und Anteilseigner: 13.046 10.992 966 85<br />
„arisiert“ 1.689 1.870 719 8<br />
liquidiert 11.357 9.112 247 77<br />
an der Sachlichkeit des Urteils. Selbstverständlich sind manche Gewerbezweige weit<br />
überbesetzt, so daß Liquidierungen erheblichen Umfangs zwingend notwendig sind. Dieser<br />
Zustand darf aber nicht zur wahllosen Geschäftsauflösung führen.“ 70<br />
So schrieb Wagner, Generalreferent Bürckels bei der VVST, in einem Rechenschaftsbericht<br />
im Herbst 1938. „Jedenfalls treibt der Konkurrenzneid üble Blüten.“ 71<br />
Die Liquidierungspolitik der VVST kam den spezifischen mittelständischen Interessen entgegen.<br />
Die forcierte Verdrängung der Konkurrenten sollte die Wettbewerbschancen des<br />
„arischen“ Kaufmanns und Gewerbetreibenden, dessen eigene ökonomische Basis durch<br />
die Krise der dreißiger Jahre relativ instabil war, verbessern. Wenn ein Großteil der Gewerbetreibenden<br />
infolge Kapitalmangels selbst nicht mehr imstande war, seine wirtschaftliche<br />
Situation zu verbessern, so wollte man wenigstens die Konkurrenz beseitigt wissen.<br />
Der zeitliche und organisatorische Ablauf der Betriebsauflösungen variierte in seinem Umfang<br />
und seiner Intensität. Bedingt durch die Geschäftsplünderungen und „wilde Kommissarswirtschaft“<br />
fand die erste große Schließungsaktion im Frühjahr 1938 statt, von der ca.<br />
7000 Geschäfte betroffen waren. 72 Durch behördlichen Konzessionsentzug wurden im<br />
Spätsommer 1938 zahlreiche weitere Betriebe geschlossen. Die Anzahl der durch „kommissarische<br />
Verwalter“ durchgeführten Firmenliquidierungen bis zum November 1938 war<br />
relativ gering, ungefähr ein Fünftel von ca. 26.000 Betrieben. 73<br />
Die Geschäftsplünderungen während des ➤ Novemberpogroms 1938, des „Tages und<br />
der Nacht der langen Finger“, 74 waren der Auftakt zur massenweisen Schließung von Betrieben.<br />
Bis Kriegsausbruch im September 1939 war der Prozeß der Firmenstillegungen<br />
mehr oder weniger beendet.<br />
In Wien wurden über 80 % der Betriebe und Geschäfte, die Juden gehört hatten, liquidiert;<br />
den geringsten Teil an Auflösungen gab es im Bereich der Industrie (26 %), während<br />
der Handels- und der Handwerkssektor mit 83 % bzw. 87 % extrem hohe Schließungsraten<br />
aufwiesen. Im Privatbankbereich wurden 91 % der Firmen aufgelöst. 75 Differenziert man<br />
nach Branchen im Handwerk und Einzelhandel, so wird nach offiziellen NS-Statistiken das<br />
Ausmaß der Betriebsauflösungen deutlich sichtbar.<br />
An der Verwertung der Warenlager, Betriebseinrichtungen und freiwerdenden Geschäftsräume<br />
meldete die Privatwirtschaft nachdrückliches Interesse an. In der Regel wurden vom<br />
„Abwickler“ die Warenlager und sonstigen Vermögenswerte nach erfolgter Schätzung den<br />
einzelnen Fachgruppen der gewerblichen Wirtschaft angeboten, welche sie zu niedrigen<br />
Preisen an ihre Mitglieder weiterverkauften. 76 Eine andere Verwertungsart ermöglichte<br />
Kaufleuten und Unternehmen, bei günstigster Preislage direkt aus den Liquiditätsmassen<br />
Einkäufe für ihre Geschäfte und Betriebe zu tätigen. 77<br />
Schlußbemerkung<br />
Zusammengestellt nach: Der Staatskommissar in der Privatwirtschaft,<br />
Bericht über die Entjudung der Ostmark, Wien 1. 2. 1939, S. 10.<br />
Anläßlich einer Ausstellung der VVST im Sommer 1939 über die „Entjudung der ostmärkischen<br />
Wirtschaft“ präsentierte Rafelsberger die Ergebnisse des brutalen Vorgehens<br />
gegen die österreichischen Juden. Von ca. 26.000 Unternehmen waren rund 5000<br />
„arisiert“, über 21.000 zwangsweise aufgelöst worden. Die Interessensgruppen, die von<br />
18 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
1 Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands<br />
(SOPADE), 5. Jg. 1938, Nr. 7 (Juli 1938), Reprintausgabe, Salzhausen-Frankfurt/M.<br />
1980, S. 732 ff.; eine ähnliche Beschreibung<br />
der Plünderung der Textilfirma „Gebrüder Schiffmann“ findet sich<br />
bei G.E.R. Gedye, Die Bastionen fielen, Wien 1947, S. 291 f.; auch<br />
die anderen im Zitat erwähnten Geschäftsplünderungen lassen<br />
sich durch Akten belegen, vgl. Allgemeines Verwaltungsarchiv,<br />
Wien (in Hinkunft: AVA), Bestand Vermögensverkehrsstelle (in<br />
Hinkunft: VVST).<br />
2 Ebenda, S. 738.<br />
3 Zur Sozial- und Berufsstruktur der Wiener Juden gibt es bis heute<br />
keine Untersuchungen.<br />
4 Von insgesamt 56.000 Liegenschaften in Wien sollen ca. 8000 Juden<br />
gehört haben; wertmäßig sollen es 30 % gewesen sein. Vgl.<br />
Karl Schubert, Die Entjudung der ostmärkischen Wirtschaft und<br />
die Bemessung des Kaufpreises im Entjudungsverfahren, Welth.<br />
Diss., Wien 1940, S. 72 ff.<br />
5 Gerhard Botz, Stufen der Ausgliederung aus der Gesellschaft. Die<br />
österreichischen Juden vom „Anschluß“ zum „Holocaust“. In: Zeitgeschichte,<br />
14, H.9/10 (Juni/Juli 1987), S. 363.<br />
6 Vgl. Gerhard Botz, Stufen der Ausgliederung, a.a.O., S. 360<br />
7 Vgl. Gerhard Botz, Wohnungspolitik und Judendeportation in<br />
Wien 1938-1945: Zur Funktion des Antisemitismus als Ersatz nationalsozialistischer<br />
Sozialpolitik, Wien 1975; G. Botz, Wien vom<br />
„Anschluß“ zum Krieg: Nationalsozialistische Machtübernahme<br />
und politisch-soziale Umgestaltung am Beispiel der Stadt Wien<br />
1938/39, 2. Aufl., Wien 1980; vgl. Anm. 5.<br />
8 Gerhard Botz, Wohnungspolitik und Judendeportation, S. 124.<br />
9 Zur Tradition und Kontinuität des Wiener Antisemitismus vgl. Peter<br />
G. Pulzer, Die Entstehung des politischen Antisemitismus in<br />
Deutschland und Österreich 1867-1914, Gütersloh 1966; Karl<br />
Stuhlpfarrer, Antisemitismus, Rassenpolitik und Judenverfolgung<br />
in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg. In: Das österreichische<br />
Judentum: Voraussetzungen und Geschichte, Wien 1974, S. 141-<br />
164; Sylvia Maderegger, Die Juden im österreichischen Ständestaat<br />
1934-1938, Wien 1973.<br />
10 Susanne Heim, Götz Aly, Die Ökonomie der „Endlösung“. In:<br />
Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik,<br />
Bd. 5, Berlin 1987, S. 21.<br />
11 Zum Forschungsstand: Vgl. Gerhard Botz, „Arisierungen“ und nationalsozialistische<br />
Mittelstandspolitik in Wien 1938-1940. In: Wiener<br />
Geschichtsblätter, 29, 1 (1974), S. 122-136; G. Botz, Wien vom<br />
„Anschluß“ zum Krieg, a.a.O., S. 328-342; Georg Weis, Arisierungen<br />
in Wien. In: Wien 1938. Forschungen und Beiträge zur Wiener<br />
Stadtgeschichte, Wien 1978, Bd. 2, S. 183-190; Herbert Rosenkranz,<br />
Verfolgung und Selbstbehauptung. Die Juden in Österreich<br />
1938-1945, Wien 1978, S. 60-71, und S. 126 ff., S. 165 ff.; Lieselotte<br />
Wittek-Saltzberg, Die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der<br />
Okkupation Österreichs, phil. Diss. Wien 1970, S. 205-229; Helmut<br />
Genschel, Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten<br />
Reich, Göttingen 1966, S. 160-166; zeitgenössische antisemitische<br />
Darstellung: Karl Schubert, Die Entjudung der ostmärkischen<br />
Wirtschaft und die Bemessung des Kaufpreises im Entjudungsverfahren,<br />
Welth. Diss. Wien 1940.<br />
12 Zur Liquidierung der Fa. „Grande Distillerie Damase Hobe &<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
19<br />
Hans Witek<br />
den „Arisierungen“ und Stillegungen der Unternehmen profitierten, hatten ihre jeweiligen<br />
Ziele zumindest zum Teil erreicht: Die „kleinen Ariseure“ hatten sich bereichert, die mittelständischen<br />
Betriebe waren lästige Konkurrenz losgeworden und konnten ihre Warenlager<br />
billig aufstocken, Banken und Industrie ihre Expansionsbedürfnisse befriedigen und die NSund<br />
Wirtschaftsplaner ihr Konzept der Modernisierung durchführen.<br />
Aus: Emmerich Tálos u.a. (<strong>Hrsg</strong>.):<br />
NS-Herrschaft in Österreich, 1938-1945.<br />
Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1988, S. 199-216.<br />
Cie.A.G.“, Wien; vgl. die Fallstudie: Michael Margules, Aufstieg<br />
und Fall eines jüdischen Unternehmers in Wien, Diplomarbeit WU<br />
Wien 1984; zur „Arisierung“ im Verlagswesen und im Buchhandel<br />
vgl. Murray G. Hall, Österreichische Verlagsgeschichte 1918-1938,<br />
Bd. 1: Geschichte des österreichischen Verlagswesens, Wien 1985,<br />
S. 353-428.<br />
13 OMGUS. Ermittlungen gegen die Deutsche Bank 1946/47, übersetzt<br />
u. bearbeitet von der Dokumentationsstelle zur NS-Politik<br />
Hamburg, Nördlingen 1985, S. 165.<br />
14 Karl Stuhlpfarrer, Antisemitismus, Rassenpolitik und Judenverfolgung<br />
in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg. In: Das österreichische<br />
Judentum, <strong>Hrsg</strong>. Anna Drabek u. a., Wien-München 1974, S. 155.<br />
15 VVST, Karton 907, Rechtsakt 2231, Schreiben des Rechtsamts der<br />
VVST an die Kreisleitung der NSDAP Baden, 2.9.1938.<br />
16 Eine andere Position vertritt Jörg Friedrich: „Das Verbrechen des<br />
Raubes wird in einer Form abgewickelt, die den Eigentumsbegriff<br />
nicht beschädigt. Beschädigt werden sollen ja nur die jüdischen Eigentümer.“<br />
Jörg Friedrich, Normierung und Legalisierung staatlicher<br />
Kriminalität. Zu den Aufgaben der Justiz im Dritten Reich. In:<br />
Licht in den Schatten der Vergangenheit. Zur Enttabuisierung der<br />
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, hrsg. v. Jörg Friedrich, Jörg<br />
Wollenberg, Frankfurt/M., Berlin 1987, S. 58.<br />
17 „Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden“<br />
vom 26. 4. 1938, RGBL. I, 1938, S. 414 f.; jeder Jude mußte sein gesamtes<br />
Vermögen über 5000 RM anmelden und bewerten; weiters<br />
war jede Veräußerung und Verpachtung eines gewerblichen,<br />
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes genehmigungspflichtig,<br />
wenn ein Jude als Vertragsschließender beteiligt war. In Österreich<br />
war die VVST die Anmelde- und Genehmigungsbehörde.<br />
18 „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Deutschen<br />
Wirtschaftsleben“ vom 12.11.1938, RGBL I, 1938, S. 1580.<br />
19 „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ vom 3.<br />
12. 1938, RGBL. I, 1938, S. 1709.<br />
20 Vgl. A.J. van der Leeuw, Der Griff des Reiches nach dem Judenvermögen.<br />
In: Studies over Nederland in oorlogstijd, I, Gravenhage<br />
1972, S. 211-237.<br />
21 Vgl. Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden. Die<br />
Gesamtgeschichte des Holocaust, Berlin 1980, S. 97.<br />
22 Vgl. Verordnung v. 3.12.1938.<br />
23 Helmut Genschel, Die Verdrängung der Juden, S. 166.<br />
24 Vgl. Gesetzblatt f.d. Land Österreich, 1938, S. 406; Kundmachung<br />
des Reichsstatthalters über die Errichtung einer Vermögensverkehrsstelle,<br />
18. 5. 1938; AVA, Reichskommissar für die Wiedervereinigung<br />
Österreichs mit dem Deutschen Reich (in Hinkunft: Rk),<br />
Karton 73, Ordner 144, (2160/00, Bd. 2), Geschäftsverteilungsplan<br />
der VVST 1938.<br />
25 Vgl. AVA, VVST, Karton 1379, Ministerium f. Wirtschaft und Arbeit,<br />
Zl. I- 15.545-1939, Internes Schreiben vom 14.11.1939, Übertragung<br />
der Zuständigkeiten im Entjudungsverfahren; VVST, Karton<br />
1423, Schreiben von Dr. Kramer, Reichsstatthalterei Wien, an<br />
Reichswirtschaftsminister vom 19.6.1940.<br />
26 Wiener Zeitung, 3.6.1938, Nr. 181, S. 2.<br />
27 Vgl. Institut für Zeitgeschichte München, Dok. PS 1449, Protokoll<br />
einer Besprechung unter Görings Leitung im Reichsluftfahrtministerium,<br />
14.10.1938.
„Arisierungen“ in Wien<br />
28 Vgl. Jonny Moser, Das Unwesen der kommissarischen Leiter. Ein<br />
Teilaspekt der Arisierungsgeschichte in Wien und im Burgenland.<br />
In: Arbeiterbewegung, Faschismus, Nationalsozialismus, hrsg. v.<br />
Helmut Konrad u.a., Wien 1983, S. 90.<br />
29 Die zusammenfassende Charakterisierung des Sozialtypus der<br />
„Kommissare“ geht aus einer Unzahl von Akten der VVST hervor.<br />
30 Zu den wenigen Verhaftungen vgl. z.B. Bundesarchiv Koblenz, R<br />
58/1080, Tagesrapporte Gestapo Wien, Oktober 1938-Jänner 1939.<br />
31 Vgl. AVA, VVST, Karton 813, Bericht über die Tätigkeit des kommissarischen<br />
Verwalters L. Krabath, 6.2.1939; er verwaltete vier<br />
Textilfirmen in Wien I., Rudolfsplatz und Umgebung.<br />
32 AVA, VVST, Kt. 1408, Korrespondenz S-V, Aug. 1938-Juni 1940; Bericht<br />
über die Tätigkeit in der Ostmark von Reg. Rat. Wagner, 7. 9.<br />
1938, S. 7 f.<br />
33 Zur Reichswirtschaftshilfe vgl. Hans Kehrl, Krisenmanager im Dritten<br />
Reich, Düsseldorf 1973, S. 125 f.<br />
34 Vgl. AVA, Rk, Karton 74, Ordner 145, (2160/00/1) Beschlußprotokolle<br />
über die Beiratsitzungen der VVST vom 28.9.1938 und vom<br />
26.1.1939.<br />
35 Herbert Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung, a.a.O., S. 130.<br />
36 AVA, Rk, Kt. 74, Ordner 146, (2160/14/2), Kommunique der Arisierungskommission,<br />
7. Juli 1938.<br />
37 Vgl. allgemein zu diesen Eigentumsveränderungen in der österreichischen<br />
Filmwirtschaft: Bundesarchiv Koblenz, R 55/785, „Ostmärkische<br />
Filmtheater-Betriebsges.m.b.H.“: Übernahme von jüdischen<br />
Filmtheatern in der Ostmark.<br />
38 AVA, Rk, Kt. 74, Ordner 146, (2160/14/2), Schreiben der Reichsfilmkammer,<br />
Außenstelle Wien an Bürckel, 23.1.1939.<br />
39 Christoph Schmidt, Zu den Motiven „Alter Kämpfer“ in der<br />
NSDAP. In: Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte<br />
des Alltags unterm Nationalsozialismus, hrsg. von Detlev Peukert,<br />
Jürgen Reulecke, Wuppertal 1981, S. 42.<br />
40 Bundesarchiv Koblenz, R 55/785 fol. 23, Schreiben von Winkler an<br />
das Reichsministerium f. Volksaufklärung und Propaganda,<br />
23.8.1938.<br />
41 Vgl. AVA, VVST, Karton 1374, Zl. D 6, Schreiben der VVST (Abwicklungsstelle)<br />
an Reichsstatthalterei Wien, 1. 10. 1940: „Im Laufe<br />
des Jahres 1939 wurden von der Österreichischen Kontrollbank<br />
17 verdienten Parteigenossen (Angehörige der SS-Standarte 89)<br />
zum Zweck der Erwerbung von Lichtspieltheatern Kredite gewährt.“<br />
42 AVA, Rk, Karton 85, Ordner 167, (2205/15), Schreiben von Bürckel<br />
an Göring, 7.12.1938.<br />
43 Helmut Genschel, Die Verdrängung der Juden, a.a.O., S. 248.<br />
44 Hans Mommsen, Ausnahmezustand als Herrschaftstechnik des NS-<br />
Regimes. In: Hitler, Deutschland und die Mächte. Materialien zur<br />
Außenpolitik des Dritten Reiches, hrsg. v. Manfred Funke, Düsseldorf<br />
1977, S. 37.<br />
45 Berlin Document Center, Personalakt Josef Fitzthum; Schreiben<br />
von SS-Oberführer Kammerhofer an das SS-Gericht, 20.4.1940; Bericht<br />
von Tondock über die „Untersuchung sämtlicher in Wien von<br />
SS-Angehörigen durchgeführten Arisierungen“, 8.3.1940; etc.; zit.<br />
nach Radomir Luza, Österreich und die großdeutsche Idee in der<br />
NS-Zeit, Wien, Köln, Graz 1977, S. 143 (Anm. 16.).<br />
46 Bundesarchiv Koblenz, NS 19/807, Schreiben Himmlers an Heydrich,<br />
20.9.1939.<br />
47 Vgl. AVA, VVST, Karton 774, Zl. 3614-Abw/40, Aktenvermerk vom<br />
Beauftragten der VVST (Abwicklungsstelle), Arbeitsgruppe Abwicklung,<br />
24.6.1940.<br />
48 AVA, VVST, Karton 918, RA 8973, Geschäftsbericht der Einkaufsund<br />
Treuhandgenossenschaft für die Uhren- und Juwelenbranche,<br />
Wien I, über das Geschäftsjahr 1938, o. D.<br />
49 AVA, Rk, Karton 105, Ordner 207 (2237/13), Aktenvermerk Ass.<br />
Ernst vom 23.3.1939, betr. Tätigkeit der Einkaufs- und Treuhandgenossenschaft<br />
für die Uhren- und Juwelenbranche.<br />
50 AVA, VVST, Karton 918, RA 8973, Geschäftsbericht der Einkaufsund<br />
Treuhandgenossenschaft für die Uhren- und Juwelenbranche,<br />
Wien I, über das Geschäftsjahr 1938, o. D.<br />
51 AVA, VVST, Karton 918, RA 8973, Anweisung betreffend die Rege-<br />
lung von Kaufpreis und Auflage der Betriebe der Juweliere und<br />
Uhrmacher, von Rafelsberger, 15.3.1939.<br />
52 AVA, VVST, Karton 771, Zl. 52-Abw./1939, Bericht des Abwicklers<br />
für die jüdischen Einzelhandelsfirmen des Uhren- und Juwelenfaches<br />
an die VVST, 18.11.1939.<br />
53 AVA, VVST, Karton 768, WS 1182, Schreiben von Staatsrat Eberhardt<br />
(Mitarbeiter Kepplers) an W. Schwarz, 6.4.1938.<br />
54 Zur „Arisierung“ der Lenzinger Zellstoff- und Papierfabrik AG, vgl.<br />
Der Kampf um Lenzing. Arisierung – Konkurs – Sanierung, hrsg.<br />
von der Österreichischen Länderbank AG, Wien 1953, S. 3 f.; zur<br />
„Arisierung“ der Hirtenberger Patronen- und Waffenfabrik vgl.<br />
Franz Mathis, Big Business in Österreich. Österreichische Großunternehmungen<br />
in Kurzdarstellungen, Wien 1987, S. 148; Georg W.<br />
F. Hallgarten, Joachim Radkau, Deutsche Industrie und Politik von<br />
Bismarck bis in die Gegenwart, Frankfurt/M. 1986, S. 360.<br />
55 AVA, VVST, Karton 1365/ Mappe Entjudungsfälle A-Z, Amtsvermerk<br />
vom 27.11.1939.<br />
56 Vgl. AVA, VVST, Karton 648, St. 5092/ Band 2, Bericht der Deutschen<br />
Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung<br />
Wien über die bei der Aktiengesellschaft Ignaz Kuffner &<br />
Jakob Kuffner für Brauerei, Spiritus- und Preßhefe-Fabrikation<br />
Ottakring-Döbling, Wien XVI, vorgenommene Sonderprüfung,<br />
28.11.1938.<br />
57 Vgl. AVA, Rk, Karton 75, Ordner 148, (2165/2/9), Erlaß des<br />
Min.f.Wirt.u.Arb. an die Österreichische Kontrollbank für Industrie<br />
und Handel, 30.9.1938.<br />
58 Walther Kastner, Mein Leben kein Traum, Wien 1982, S. 108.<br />
59 Ebenda, S. 109.<br />
60 Ebenda, S. 116 f.<br />
61 Vgl. AVA, Rk, Karton 75, Ordner 148, (2165/2/5), Schreiben von<br />
Bürckel an Reichswirtschaftsminister Funk, 8.7.1939.<br />
62 Hans Fischböck, Das Bankwesen der Ostmark. In: Die Deutsche<br />
Volkswirtschaft, Jg. 1940, Nr. 12, S. 384.<br />
63 Neue Bankfirma übernimmt Rothschild Wien. In: Die Bank, 33. Jg.,<br />
3.4.1940, Heft 14, S. 223.<br />
64 Vgl. AVA, VVST, Karton 300, H. 5034, Schreiben Dr. Philippovich an<br />
Finanzamt Innere Stadt West, 12.2.1942.<br />
65 Vgl. Gerhard Botz, Wien vom „Anschluß“ zum Krieg, S. 331 ff.<br />
66 Der Staatskommissar in der Privatwirtschaft, Bericht über die Entjudung<br />
der Ostmark, Wien 1. 2. 1939, S. 21.<br />
67 Vgl. Heim/Aly, Die Ökonomie der „Endlösung“, a.a.O., S. 28 ff. Der<br />
Zugriff auf „arische“ Klein- und Mittelbetriebe war erst im Rahmen<br />
des kriegswirtschaftlichen Konzentrationsprozesses gegeben,<br />
als zahlreiche Betriebe geschlossen wurden, um Arbeitskräfte für<br />
Großunternehmen freizumachen.<br />
68 Gerhard Botz, Stufen der Ausgliederung der Juden, a.a.O., S. 365.<br />
69 Vgl. Ludolf Herbst, Der totale Krieg und die Ordnung der Wirtschaft.<br />
Die Kriegswirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie<br />
und Propaganda 1939-1945, Stuttgart 1982, S. 157.<br />
70 AVA, VVST, Karton 1408, Korrespondenz S-V (August 1938-Juni<br />
1940), Bericht über die Tätigkeit in der Ostmark ab 4. Juli 1938<br />
von Reg. Rat. Wagner, 7.9.1938, S. 13.<br />
71 Ebenda, S. 13.<br />
72 Vgl. AVA, VVST, Karton 1370, Mappe Mörixbauer, Anlage zu<br />
Schreiben des Stellvertretenden Gauleiters Scharizer an den Regierungspräsidenten<br />
Dr. Dellbrügge vom 25.4.1941.<br />
73 Vgl. AVA, Handelsministerium, Nachlaß Fischböck, Karton 734,<br />
Statistischer Bericht über die Tätigkeit der Vermögensverkehrsstelle<br />
vom 19.11.1938.<br />
74 Institut für Zeitgeschichte München, Nürnberger Dokument PS<br />
2237, Schreiben Bürckel an Göring vom 18.11.1938.<br />
75 Vgl. Der Staatskommissar in der Privatwirtschaft, Bericht über die<br />
Entjudung der Ostmark, Wien 1. 2. 1939, S. 10.<br />
76 Vgl. AVA, VVST, Karton 771, Abw./79/1939, Schreiben der Wirtschaftskammer<br />
Wien, Unterabteilung Einzelhandel an die Vermögensverkehrsstelle<br />
vom 17.5.1939; vgl. auch Beschwerde der Wirtschaftsgruppe<br />
Einzelhandel über die Tätigkeit der Abwickler vom<br />
9.5.1939.<br />
77 Vgl. AVA, VVST, Karton 911, R.A. 3319, Sammelakt.<br />
20 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
DIE ZENTRALSTELLE FÜR JÜDISCHE AUSWANDERUNG IN WIEN<br />
JONNY MOSER<br />
Die ➤ Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien wurde im August 1938 errichtet, 1<br />
sie sollte eine rationellere Enteignung der auswanderungswilligen Juden erbringen und deren<br />
Ausreiseabfertigung verkürzen. Die Zentralstelle besorgte und verschaffte keine Einreisegenehmigungen<br />
in andere Länder, wie sie auch keine Schiffskarten verkaufte; sie war<br />
realiter ein Paßamt, das sich mittels Abgaben von Juden selbst finanzierte. Die Zentralstelle<br />
für jüdische Auswanderung war im Rothschild-Palais, Wien IV, Prinz Eugen-Straße 22, heute<br />
Sitz der Arbeiterkammer für Wien, untergebracht.<br />
Der Gedanke zur Gründung eines solchen Amtes war ➤ Eichmann, dem Gründer und ersten<br />
Leiter der Zentralstelle, sogleich nach dem „Anschluß“ gekommen. Er war ein sehr ambitiöser<br />
SS-Führer und aufmerksamer Beobachter, der rasch erkannte, wie man mit brutaler<br />
Gewalt die Juden einschüchtern und andererseits durch schöne Versprechungen leicht erpressen<br />
konnte. Daneben hatte er die großen Möglichkeiten für eine schnellere Arisierung<br />
wahrgenommen, die sich aus der Finanzierungsmethode der ➤ Gildemeester-Auswanderungs-Hilfsaktion<br />
ergaben. Und Eichmann bemerkte die administrativen Schwierigkeiten bei<br />
der Paßbeschaffung der Juden, die sich einerseits für die Wiener Polizei ergaben, weil man<br />
den Juden ein separates Paßamt in Wien V, Wehrgasse, geschaffen hatte, das mit zu wenig<br />
Beamten bestückt war. Manche auswanderungswilligen Juden waren tage-, ja wochenlang<br />
angestellt, ehe sie ihre Ausreisepapiere erhielten. Alle diese Vorgänge unter ein Dach<br />
zu bringen, schien mit der Gründung der Zentralstelle für jüdische Auswanderung zu lösen<br />
zu sein.<br />
Dabei war Eichmann vom SD-Hauptamt lediglich nach Wien entsandt worden, um bei<br />
den jüdischen Organisationen Archive, Bibliotheken und anderes einschlägige Material<br />
über das Judentum und den Zionismus sicherzustellen. Eichmann war seit 1934 Referent in<br />
der Abteilung „Judenangelegenheiten“ – Kurzbezeichnung II 112 – im SD-Hauptamt in Berlin,<br />
im Range eines SS-Führers. Diese Abteilung befaßte sich zu dieser Zeit rein theoretisch<br />
mit dem Judentum und mit einer Lösung der „Judenfrage“ in Form der Auswanderung, die<br />
nach dem „Anschluß“ die Formen einer Vertreibung annahm. Als SD-Führer hatte Eichmann<br />
zur Zeit des „Anschlusses“ noch keine Exekutivgewalt bei der Vertreibung der Juden, diese<br />
lag bei den Leitern des Judenreferates der ➤ Gestapo. Allerdings fand Eichmann hier in<br />
Österreich freiere Betätigungsmöglichkeiten, zumal hier in Wien noch keine Kompetenzgrenzen<br />
fixiert worden waren und er zudem weder vom SD-Hauptamt noch vom Leiter des<br />
SD-Oberabschnitts Österreich, Franz Stahlecker, in irgendeiner Form behindert worden<br />
war.<br />
Eichmann kontaktierte fleißig seine früheren Kampfgefährten aus der illegalen Zeit, traf<br />
mit ihnen offiziell und gesellig zusammen und erhielt derart verhältnismäßig viele Informationen.<br />
Er stand in gutem Einvernehmen mit dem Judenreferat der Gestapo Wien und nahm<br />
an den Aktionen gegen die jüdischen Organisationen aktiv teil. Seine Informationen über<br />
das Judentum in Österreich, die er dem SD-Hauptamt übermittelte, erregten dort große Aufmerksamkeit,<br />
und die von ihm en masse nach Berlin gesandten Archivmaterialien gaben<br />
der Abteilung für Judenangelegenheiten nunmehr einen besseren Einblick in das Judentum<br />
und in den Zionismus. 2<br />
Bei der Hausdurchsuchung im ➤ Palästinaamt, 3 das die Agenden der ➤ Jewish Agency<br />
(politische Vertretung der Juden in Palästina) in Österreich wahrnahm und auch die Landeszentrale<br />
der zionistischen Verbände Österreichs beherbergte, ließ sich Eichmann die Vertreter<br />
der Zionisten Österreichs vorführen, um unter ihnen jenen auszuwählen, den er später<br />
mit der Leitung dieses Amtes betrauen wollte. Und am 18. März 1938 nahm Eichmann bei<br />
der Durchsuchung der Amtsräume der ➤ Israelitischen Kultusgemeinde in Wien teil. Bei<br />
dieser Aktion wurden auch zwei Zahlungsbelege über eine Wahlfondsspende in der Höhe<br />
von öS 800.000.- an die ➤ Vaterländische Front gefunden. Sie waren der formale Anlaß,<br />
das Präsidium der Israelitischen Kultusgemeinde Wien festzunehmen, die Amtsräume zu<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
21<br />
Raschere<br />
„Arisierung“ durch<br />
die Gildemeester-<br />
Auswanderungs-<br />
Hilfsaktion<br />
Terror und<br />
Schikanen, um<br />
Juden zur schnellerenAuswanderung<br />
zu zwingen
Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien<br />
schließen und jede Amtstätigkeit vorläufig zu untersagen. Der wahre Grund für diese Maßnahmen<br />
war jedoch einzig und allein, die führungs- und vertretungslos gewordenen Juden<br />
Wiens zu schikanieren und zu terrorisieren, um sie für eine schnellere Auswanderung gefügig<br />
zu machen.<br />
Aber Eichmann benützte das Auffinden der beiden Spendenbelege für die Durchführung<br />
der Schuschniggschen Volksbefragung am 13. März 1938 auch, um den Juden Wiens dieselbe<br />
Summe Geldes nochmals abzuverlangen: dieses Mal für die Volksabstimmung am<br />
10. April 1938. Diese Vorgangsweise brachte Eichmann viel Ansehen beim Reichskommissar<br />
für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, ➤ Joseph Bürckel, ein,<br />
sie wurde in den Wiener NS-Führungskreisen wie auch im SD-Hauptamt respektvoll registriert.<br />
Diese Wahlfondsspende der Israelitischen Kultusgemeinde Wien war für Schuschniggs<br />
beabsichtigte Volksbefragung aus tiefster österreichischer Überzeugung zur Verfügung<br />
gestellt worden. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Staatsrat<br />
Dr. Desider Friedmann, wurde am 10. März 1938 von ➤ Schuschnigg persönlich von seinem<br />
verzweifelten Entschluß, das Volk von Österreich am 13. März entscheiden zu lassen,<br />
unterrichtet. Als Vorsitzender des Verbandes der Israelitischen Kultusgemeinden Österreichs<br />
war sich Friedmann seiner Verantwortung für das Geschick der jüdischen Gemeinschaft in<br />
Österreich vollauf bewußt, zumal die angesetzte Volksbefragung den letzten Rettungsversuch<br />
für den Weiterbestand eines unabhängigen und freien Österreich darstellte. Welcher<br />
aufrechte Österreicher konnte zu diesem Zeitpunkt seine Hilfe versagen, wo zudem noch<br />
klar war, daß der Weiterbestand oder Fall Österreichs mit der Lebensfrage der Österreicher<br />
jüdischer Konfession engstens verbunden war.<br />
Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Dr. Desider Friedmann, und die<br />
Vizepräsidenten, Oberbaurat Ing. Robert Stricker wie der Rat der Stadt Wien, Dr. Jakob<br />
Ehrlich, wurden mit dem ersten Österreichertransport am 1. April 1938 in das Konzentrationslager<br />
Dachau verschickt. 4<br />
Der Amtsdirektor der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Dr. Josef Löwenherz, wurde<br />
von Eichmann zurückgehalten, er sollte nach Eichmanns Plan, wenn die Juden Wiens die<br />
strafweise verfügte Kontribution von 550.000 Reichsmark aufgebracht hatten, wieder in<br />
seine alte Position als Leiter der Kultusgemeinde eingesetzt werden.<br />
Am 8. April 1938 richteten Amtsvorstand Emil Engel und Oberrabbiner Dr. Israel Taglicht<br />
ein Schreiben an alle Kultussteuerträger der Gemeinde, worin sie auf die derzeitige prekäre<br />
finanzielle Lage der Kultusgemeinde hinwiesen und aufriefen, einen freiwilligen Zuschlag<br />
in der Höhe von mindestens 50 % der bisherigen Kultussteuer zu bezahlen, zumal die Kultusgemeinde<br />
den Betrag von RM 550.000,- aufzubringen habe, ehe die Kultusgemeinde ihre<br />
Amtstätigkeit wieder aufnehmen könne. Es sind „überaus ernste und unausweichliche<br />
Gründe“, die den Vorstand zu dieser Aufforderung an die Steuerträger zwängen, zumal<br />
„von deren Erfüllung das künftige Geschick der Gemeinde und ihrer Angehörigen entscheidend<br />
beeinflußt werden wird“. 5 Am Freitag, dem 15. April 1938, wurde von den Kanzeln<br />
aller Wiener Synagogen ein Aufruf des Oberrabbiners Dr. Taglicht verlesen, in dem er an<br />
die Gemeindemitglieder appellierte und „die Zahlung des geforderten Geldes als eine unabdingbare<br />
Notwendigkeit“, ja als eine „religiöse Pflicht“ bezeichnete. 6 Das westliche Ausland<br />
wußte ganz genau, daß diese Zahlung der Israelitischen Kultusgemeinde Wien an<br />
den Wahlfonds der Nationalsozialisten zu leisten war. 7 Und in einem Brief am 23. April<br />
1938 schreibt Eichmann an seinen Freund und Vorgesetzten Herbert Hagen: „Löwenherz<br />
ist enthaftet. Er und Dr. Rottenberg vom Palästinaamt bekamen von mir den Auftrag, bis<br />
zum 27. April ein genaues Aktionsprogramm betr. Kultusgemeinde und Zionistischen Landesverband<br />
für Österreich auszuarbeiten.“ Nebenbei bemerkte Eichmann: „RM 200.000,zahlten<br />
sie bereits. Engel muß weitere Eintreibungen vornehmen. ... Ende nächster Woche<br />
wird die Kultusgemeinde und darauf der zionistische Landesverband aufgemacht.“ 8<br />
Damit hatte Eichmann seiner Dienststelle vorgeführt, wie man mit Druck und Terror die<br />
„Judenfrage“ lösen sollte. Er hatte in Österreich auch allen Unterabschnitten des Sicherheitsdienstes<br />
wie auch den Referenten der Abteilung Juden einen Überblick über diese Materie<br />
22 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
gegeben. 9 Am 8. Mai 1938 meldet er seinem Freund Herbert Hagen nach Berlin: „Sämtliche<br />
jüdischen Organisationen in Österreich sind zur achttägigen Berichterstattung angehalten<br />
worden. Dieselben werden dem jeweiligen Sachbearbeiter II 112 übergeben. Am<br />
Freitag der nächsten Woche erscheint die erste Nummer der zionistischen Rundschau (…)<br />
und bin gerade bei der langweiligen Arbeit der Zensur. Die Zeitung geht Euch selbstverständlich<br />
auch zu. Es wird gewissermaßen ‚meine‘ Zeitung werden. Jedenfalls habe ich die<br />
Herrschaften auf Trab gebracht, was Du mir glauben kannst. Sie arbeiten derzeit auch<br />
schon sehr fleißig. Ich habe von der Kultusgemeinde (…) eine Auswanderungszahl von<br />
20.000 mittellosen Juden für die Zeit vom 1. April 1938 bis 1. Mai 1938 verlangt (…) Morgen<br />
kontrolliere ich wieder den Laden der Kultusgemeinde (…) Ich habe sie hier vollständig<br />
in der Hand, sie trauen sich keinen Schritt ohne vorherige Rückfrage bei mir zu machen.“ 10<br />
Über die Lage der Lösung der „Judenfrage“ in Österreich berichtete er Hagen: „Die Lage<br />
der Dinge ist jetzt folgende: Arisierung. Juden in der Wirtschaft usw. behandeln, laut Erlaß<br />
Gauleiter Bürckels. Das weitaus schwierigere Kapitel, die Juden zur Auswanderung zu<br />
bringen, ist Aufgabe des SD. Auf diese (…)“ ist alles ausgerichtet. Über seine persönliche<br />
Situation war er im unklaren. Er meinte „als Abteilungsleiter auf einen Unterabschnitt“ zu<br />
kommen, zumal die „Sache in Wien läuft“. Diese Arbeit hier zu verlassen, „täte mir ehrlich<br />
leid, zumal ich sie gerne machte“, schrieb er Hagen, „aber Du wirst ja verstehen, daß ich<br />
mit meinen 32 Jahren nicht gerne ‚zurückgehe‘.“ Und er hatte hier in Wien unter den NSund<br />
SD-Führern Fürsprecher: Er blieb also in Wien. 11<br />
In diesen Apriltagen 1938, als die Amtstätigkeit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien<br />
stillgelegt war und Eichmann seine Position im SD-Hauptamt festigte, bemühten sich verschiedene<br />
Personen jüdischer Abkunft, mit österreichischen Nationalsozialisten in Kontakt<br />
zu kommen, um ihnen einen für sie faszinierenden Plan zur Lösung der „Judenfrage“ in<br />
Österreich vorzutragen. Der Gedanke war der, die jüdische Auswanderung zu forcieren,<br />
indem man sich gleichzeitig des Vermögens der auswandernden Juden bemächtigen könne.<br />
Vermögenden Juden sollten Einreisemöglichkeiten in überseeische Staaten verschafft<br />
werden, worauf diese auf ihr gesamtes Vermögen zugunsten des Reichs verzichteten. Von<br />
diesem Vermögen sollten fünf bis zehn Prozent einem Fonds, dem Auswanderungsfonds<br />
zufließen, aus dem die Auswanderung mittelloser Juden bestritten würde. Eine Hilfsstelle<br />
unter der Leitung einer geeigneten Person sollte geschaffen werden. Und dieser Mann fand<br />
sich in der Person des Holländers Frank van Gheel Gildemeester, der sich immer schon<br />
humanitären Aufgaben gewidmet und während der Zeit des ➤ Ständestaates inhaftierte<br />
Nationalsozialisten betreut hatte. Über Mittelsmänner wurde dieser Plan dem Minister für<br />
Arbeit und Wirtschaft, ➤ Dr. Hans Fischböck, vorgelegt und von ihm gutgeheißen. Gildemeester<br />
nahm unter der Bezeichnung Gildemeester-Auswanderungs-Hilfsaktion im April<br />
1938 seine Arbeit auf. Zum Fondsführer des Auswanderungsfonds in der ➤ Vermögensverkehrsstelle<br />
des Ministeriums für Arbeit und Wirtschaft wurde SS-Obersturmführer Dkfm. Fritz<br />
Kraus bestellt. Als juristischer Berater fungierte Dr. Erich Rajakowitsch. 12<br />
Wie diese Ausreisebeschaffung und Enteignung vor sich ging, soll am Beispiel der Familie<br />
Kuffner aufgezeigt werden. Die Besitzer der Ottakringer Brauerei, Moritz und Stefan<br />
von Kuffner, waren unter dem Vorwand staatsfeindlicher Betätigung von der Gestapo festgenommen<br />
worden. Zur „Einstellung ihres Verfahrens“ kam es erst, als sie „das Einverständnis“<br />
schriftlich abgaben, 35 % ihres Vermögens, das nach den Feststellungen des „staatlichen<br />
Treuhänders“ 9 Millionen Reichsmark betrug, dem Reich zu übergeben. Ihre Bankguthaben,<br />
Anteilscheine, Gemäldegalerie und Sternwarte waren nach dem „Anschluß“ beschlagnahmt<br />
worden. Es wurde daher an Zahlungsstatt der „ganze immobile Kuffnersche<br />
Liegenschaftsbesitz“ im Werte von 2,5 Millionen Reichsmark übernommen. Als Empfänger<br />
dieses Liegenschaftsbesitzes wurde von der Gestapo der Auswanderungsfonds Wien nominiert.<br />
Nach der Bezahlung der ➤ Reichsfluchtsteuer und aller anderen Abgaben verblieb<br />
den Familienmitgliedern Kuffner lediglich ein namhafter Betrag auf einem ➤ Sperrkonto,<br />
über den sie jedoch nie verfügen konnten. Für eine Ausreisegenehmigung hatten sie auf all<br />
ihr Vermögen zu verzichten. 13<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
23<br />
Jonny Moser<br />
Ausreise<br />
unter<br />
Vermögensverzicht
Die Grenzen<br />
werden<br />
geschlossen<br />
Eichmanns Idee<br />
einer Zentralstelle<br />
für jüdische<br />
Auswanderung<br />
Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien<br />
Bis zum Sommer 1938 war Eichmanns Stellung in Österreich endgültig gefestigt. Er hatte<br />
die Finanzierung der Gildemeester-Hilfsaktion genau verfolgt und stand mit Dr. Rajakowitsch<br />
und Dkfm. Kraus in engem Kontakt. Er hatte die ungeheuren Anstrengungen der<br />
Israelitischen Kultusgemeinde gesehen, Einreisegenehmigungen von den amerikanischen<br />
Hilfsorganisationen zu erhalten, und erkannte die begrenzten Möglichkeiten einer Palästinaauswanderung<br />
aufgrund des englischen ➤ Weißbuches. Die Konferenz von Evian zur<br />
Lösung der Auswanderungsprobleme der jüdischen Flüchtlinge aus Österreich und Deutschland<br />
war gescheitert. So mancher lateinamerikanische Staat schloß erst jetzt seine Grenzen<br />
für Juden aus Österreich, und selbst die USA waren nicht geneigt, die deutsche Einwanderungsquote<br />
zu erhöhen. Die Schweiz schloß nun völlig ihre Grenzen gegenüber<br />
österreichischen Juden. Ja, mehr noch, sie nahm Kontakt mit ➤ Himmler auf, um sich vor<br />
weiteren jüdischen Einreisenden besser schützen zu können, und verlangte eine Kennzeichnung<br />
der Reisepässe der Juden mit einem „J“. Und in Wien ergaben sich infolge der einsetzenden<br />
antijüdischen Gesetzesflut, des Kennkartenzwangs und der Annahme des<br />
Zusatzvornamens „Israel“ oder „Sara“ für die Polizeiämter viele zusätzliche Belastungen.<br />
Zur Finanzierung der erhöhten Ansprüche an die Israelitische Kultusgemeinde Wien führte<br />
Eichmann auch ein Gespräch mit verantwortlichen Leuten der Reichsbank. Von den Geldern,<br />
die die ausländischen Hilfsorganisationen der Israelitischen Kultusgemeinde Wien<br />
zur Verfügung stellten, sollten Auswanderern die benötigten Devisen abgegeben werden,<br />
sie hatten jedoch dafür den doppelten Kurswert zu bezahlen. Dieses Agio kam der Kultusgemeinde<br />
zur Erfüllung ihrer vielfachen sozialen Aufgaben zugute. Die Idee einer zentralen<br />
Stelle, von der die jüdischen Auswanderer schneller abgefertigt werden könnten, beschäftigte<br />
Eichmann immer mehr. Die Finanzierung dieser Zentralstelle sollte in Form einer<br />
Auswanderungsabgabe erfolgen. Jeder auswandernde Jude hatte vor der Paßeinreichung<br />
seine Bemessungsgrundlage berechnen zu lassen, die zwischen einem und zehn Prozent<br />
des Vermögens betrug. Vermögenslose Juden hatten mindestens fünf Reichsmark zu bezahlen.<br />
Derart gelangte die Zentralstelle zu so vielen Geldern, daß sie später die Israelitische<br />
Kultusgemeinde damit subventionierte und die Kosten des Abtransportes der Juden in die<br />
Vernichtungslager bestritt. Allein 1939 gewährte die Zentralstelle für jüdische Auswanderung<br />
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien eine Subvention von RM 977.000,-. 14 Den<br />
Gedanken der Schaffung einer Zentralstelle für jüdische Auswanderung trug Eichmann<br />
schließlich seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Chef des SD-Oberabschnittes Österreich,<br />
Dr. Franz Stahlecker, vor und fand dessen Zustimmung. Auch ➤ Heydrich war dafür,<br />
wie auch die Stadt Wien und der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs<br />
mit dem Deutschen Reich diesem Plan zustimmten. Anfang August 1938 nahm die Zentralstelle<br />
für jüdische Auswanderung in Wien, die offiziell dem SD-Oberabschnitt Österreich<br />
unterstellt war, ihre Arbeit auf. 15<br />
Mit der Leitung der Zentralstelle für jüdische Auswanderung wurde Adolf Eichmann<br />
betraut, der sofort seine Männer hierher holte. Es waren dies Theodor Dannekker, Rolf und<br />
Hans Günther, Franz Novak, im Herbst 1938 wurde Alois Brunner eingestellt, ein Jahr<br />
später folgte ihm Anton Brunner. Mit der Arbeitsaufnahme der Zentralstelle für jüdische Auswanderung<br />
wurde mittels Druck und Einschüchterung die erzwungene Auswanderung von<br />
Juden wesentlich erhöht. Waren vom „Anschluß“ bis zum Juli 1938 rund 18.000 Juden vertrieben<br />
worden, so betrug diese Zahl für die Zeit August bis Oktober 1938 32.000, und<br />
bis zum Juli 1939 flüchteten weitere 54.000 Juden aus Österreich. Ende November 1939<br />
hatten insgesamt 126.445 Juden inklusive der im Oktober 1939 nach Nisko Deportierten<br />
Österreich verlassen. In diesen eineinhalb Jahren haben amerikanische jüdische Hilfsorganisationen<br />
1,6 Millionen Dollar für Auswanderungszwecke der Israelitischen Kultusgemeinde<br />
zur Verfügung gestellt. 16<br />
In einem Artikel „Die Judenfrage – ein brennendes Problem“ berichtete der „Völkische<br />
Beobachter“ (Wiener Ausgabe) am 13. Mai 1939, daß „nach zehnmonatiger Tätigkeit“<br />
die Zentralstelle für jüdische Auswanderung stolz darauf sein könne, „insgesamt 99.672<br />
Juden mosaischer Konfession“ zur Auswanderung gebracht zu haben.<br />
24 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung erregte schon sehr bald nach ihrer Gründung<br />
Aufmerksamkeit im Dritten Reich und genoß in NS-Kreisen größtes Ansehen. Bei der<br />
Sitzung im Reichsluftfahrtministerium am 12. November 1938, zwei Tage nach dem ➤ Novemberpogrom,<br />
berichte Heydrich, daß die Zentralstelle für jüdische Auswanderung aus<br />
„Österreich immerhin 50.000 Juden herausgebracht“ habe, „während im Altreich in der<br />
gleichen Zeit nur 19.000 Juden“ ausgewandert seien. Dazu meinte ➤ Göring hämisch:<br />
„Vor allen Dingen habt ihr mit den örtlichen Führern der grünen Grenze zusammengearbeitet.<br />
Das ist die Hauptsache.“ 17<br />
Und Ministerialrat Bernhard Lösener vom Reichsministerium des Inneren sprach anerkennende<br />
Worte über die Zentralstelle für jüdische Auswanderung. „Unter seiner (Eichmanns)<br />
Führung durchwanderte ich sämtliche Auswanderungseinrichtungen, die er in Wien<br />
geschaffen hatte. (…) Die Korridore vor den unterschiedlichen Büros (…) waren gedrängt<br />
voll von jüdischen Menschen (…) Frauen rissen ihre Kinder erschreckt beiseite, sobald sie<br />
Eichmann sahen, der unbekümmert wie auf leerer Straße dahinging und alles beiseite<br />
stieß, was da an menschlichem Unglück harrte (…) Im Büro der Synagogengemeinde (Kultusgemeinde)<br />
sprangen alle sofort hoch, als wir eintraten (…) Eichmann rief sie beim Namen<br />
auf, (…) gab ihre Aufgaben an,und sofort surrten sie wie dressierte Tiere ihre Angaben<br />
herunter. Der Ausdruck berechtigter Todesangst war auf jedem Gesicht zu lesen.“ 18<br />
Göring schien trotz seiner skeptischen Worte an Heydrich von der Leistung der Zentralstelle<br />
für jüdische Auswanderung in Wien überrascht und beeindruckt gewesen zu sein,<br />
denn am 24. Jänner 1939 erteilte er Heydrich den Auftrag, in Berlin eine „Reichszentrale<br />
für jüdische Auswanderung“ zu errichten. 19 Sie wurde erst im Herbst 1939 gegründet und<br />
im ➤ Reichssicherheitshauptamt eingebaut. Auch hier wurde Eichmann mit der Leitung betraut.<br />
Vorerst jedoch wurde am 26. Juli 1939 in Prag eine Zentralstelle für jüdische Auswanderung<br />
errichtet, die von Eichmann persönlich geleitet wurde. Und später, 1940, wurde<br />
nach der Besetzung der Niederlande selbst in Amsterdam eine Zentralstelle eingerichtet.<br />
Unstimmigkeiten bei der Erfassung von arbeitsfähigen Männern zwischen der Israelitischen<br />
Kultusgemeinde und der Gildemeester-Auswanderungs-Hilfsaktion führten im September<br />
1939 zu einer Registrierung aller in Österreich lebenden Juden im Sinne der ➤ Nürnberger<br />
Gesetze. Die erfaßten Personen mußten karteimäßig der Zentralstelle für jüdische<br />
Auswanderung übergeben werden und ständig à jour gehalten werden. Daneben wurde<br />
eine neuerliche Erfassung des jüdischen Vermögens bei den hier noch befindlichen Juden<br />
durchgeführt. 20 Damit war ein Weg aufgezeigt, den Eichmann und jede ihm unterstellte<br />
Stelle bei der Endlösung der „Judenfrage“ vorerst beschritt. Die Juden, einmal zahlen-,<br />
namens- und adressenmäßig erfaßt, ihre Vermögenswerte bekanntgegeben, waren leicht in<br />
Vernichtungslager abzutransportieren.<br />
In Österreich und in Mährisch-Ostrau versuchten Eichmann und Stahlecker auch die ersten<br />
Deportierungen, um Erfahrungen beim Abtransport größerer Menschenmengen zu bekommen.<br />
Während der Kämpfe in Polen, im September 1939, kamen sie auf den glorreichen<br />
Gedanken, selbst da ein Judenreservat einzurichten. Juden aus Wien und Mährisch-<br />
Ostrau wurden in je zwei Transporten dahin verschickt. Dafür wurde sogar in Mährisch-<br />
Ostrau kurzfristig eine Zentralstelle für jüdische Umsiedlung eingerichtet. Diese Art einer territorialen<br />
Lösung der „Judenfrage“ scheiterte an Hitlers Einspruch. Für ihn gab es nur eine<br />
Entfernung der Juden aus dem Dritten Reich oder deren Vernichtung.<br />
Mit der Ausweitung des Krieges verlor die Auswanderung der Juden immer mehr ihre Bedeutung.<br />
Nach dem Kommissarerlaß Hitlers im Juni 1941 21 erteilte Göring am 31. Juli<br />
1941 22 den Auftrag, die Endlösung der „Judenfrage“ in Angriff zu nehmen. Die Vernichtung<br />
der im Reich verbliebenen und der in den besetzten Gebieten befindlichen Juden war<br />
nun beschlossene Sache, die bei der berüchtigten ➤ „Wannsee-Konferenz“ 23 lediglich nur<br />
mehr die staatliche Administration in diesen Prozeß einbezog. Die Zentralstellen für jüdische<br />
Auswanderung waren ausersehen, die Deportationen in die ➤ Vernichtungslager<br />
durchzuführen. Aus den bei diesen Stellen aufliegenden Namenskarteien wurden die<br />
Deportationslisten zusammengestellt, und aus den bis 1941 eingehobenen, aber für jeden<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
25<br />
Jonny Moser<br />
Die Wiener<br />
Zentralstelle als<br />
Vorbild
Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien<br />
zur Deportation bestimmten Juden zu bezahlenden Auswanderungs- bzw. Abwanderungsabgaben<br />
wurden die Kosten für den Abtransport bestritten.<br />
Am Beispiel Wiens ersieht man, daß nach den großen Deportationsaktionen im Herbst<br />
1942 die Aufgaben der Zentralstelle erfüllt waren. Die Zentralstelle übersiedelte aus dem<br />
Rothschild-Palais in die jüdische Schule in Wien II, Castellezgasse 35, und wurde im März<br />
1943 aufgelöst. Die Agenden für die hier verbliebenen restlichen Juden wurden der Gestapo<br />
übergeben. Der letzte Leiter der Wiener Zentralstelle, Alois Brunner, wurde nach Saloniki<br />
abkommandiert, um die Deportierung der griechischen Juden zu organisieren. Die Abteilung<br />
Eichmanns im Reichssicherheitshauptamt und Eichmanns Handlanger wurden die Exekutoren<br />
des Genozids an den Juden Europas.<br />
1 Gerhard Botz: Wien vom „Anschluß“ zum Reich, Wien-München<br />
1978, S. 252f.<br />
2 Eichmann-Prozeß Jerusalem, Beweisdokument Nr. 1512; Herbert<br />
Rosenkranz: Verfolgung und Selbstbehauptung. Die Juden in<br />
Österreich 1938-1945, Wien - München 1978, S. 71.<br />
3 Jewish Telegraphic Agency: Bulletin 186 v. 14.3.1938 ; Rosenkranz<br />
(Anm. 2), S. 51.<br />
4 Rosenkranz (Anm. 2), S. 49.<br />
5 Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes: DÖW<br />
1972 Siehe auch: J. Moser: Das Schicksal der Wiener Juden in den<br />
März- und Apriltagen 1938, in: März 1938, Forschungen und<br />
Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte II, Wien 1978, S. 175.<br />
6 Widerstand und Verfolgung in Wien 1934-1945. <strong>Hrsg</strong>. Dokumentationsarchiv<br />
des Österreichischen Widerstandes, Bd. III, Wien<br />
1975, S. 229.<br />
7 J. Moser (Anm. 5), S. 176.<br />
8 Jewish Telegraphic Agency: Bd. IV, Nr. 16, 19.4.1938.<br />
9 Eichmann-Prozeß Jerusalem, Beweisdokument Nr. 1515.<br />
Aus: Kurt Schmidt/Robert Streibel (<strong>Hrsg</strong>.):<br />
Der Pogrom 1938. Judenverfolgung in Österreich und Deutschland,<br />
Picus Verlag, Wien 1990, S. 96–100<br />
10 ebenda, Beweisdokument Nr. 1169 und Nr. 1513.<br />
11 ebenda, Beweisdokument Nr. 1515.<br />
12 ebenda.<br />
13 Widerstand (Anm. 6), S. 235, Anm. 1.<br />
14 ebenda, S. 235f Allg.Verwaltungsarchiv, Rk 209 (2240/4).<br />
15 Report of the Vienna Jewish Community. <strong>Hrsg</strong>. Benjamin Murmelstein,<br />
Wien 1940, S. 140.<br />
16 Botz (Anm. 1), S. 252f.<br />
17 ebenda, S. 253f.<br />
18 Nürnberger Dokument PS 1816.<br />
19 Vierteljahreszeitschrift für Zeitgeschichte, Juli 1961, S. 292.<br />
20 Nürnberger Dokument PS 710.<br />
21 Jüdisches Nachrichtenblatt (Wien), 8. und 15.9.1939.<br />
22 H. Jacobsen, Kommissarerlaß und Massenexekution sowjetischer<br />
Kriegsgefangener, in: Anatomie des SS-Staates, dtv-Taschenbuchverlag,<br />
Nr. 463, München 1967, Bd. II, S. 143ff.<br />
23 Robert M. W. Kempner: Eichmann und Komplizen, Zürich – Stuttgart<br />
– Wien 1961, S. 126ff.<br />
26 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
DELOGIERT, DEPORTIERT, ERMORDET<br />
GEORG SCHEUER<br />
Meine Eltern Heinrich und Alice Scheuer wurden am 1. August 1938 wegen „nichtarischer“<br />
Herkunft aus ihrer Wohnung im Gemeindehaus Wien 3., Neulinggasse 39,<br />
delogiert, dann „umgesiedelt“ und schließlich 1942 deportiert und ermordet.<br />
Sie waren als junge Menschen zu Beginn des Jahrhunderts nach Wien gekommen,<br />
meine Mutter aus Temesvar und mein Vater aus Schaffa bei Znaim (Südmähren). Vor dem<br />
Ersten Weltkrieg hatten sie sich kennengelernt und geheiratet und wohnten bis 1925 im<br />
3. Bezirk, in einer „Zinskaserne“, Matthäusgasse 12 (Zimmer, Küche, Kabinett, Klo und<br />
Bassena am Gang mit anderen Wohnparteien). Hier wohnte schon meine Großmutter<br />
Rosa Scheuer mit ihren Kindern, hier kam ich 1915 zur Welt und verbrachte meine ersten<br />
zehn Lebensjahre.<br />
Mein Vater war seit 1908 Redakteur des „K. k. Telegrafenbüros“ – nach dem „Umsturz“<br />
„Amtliche Nachrichtenstelle“ – und somit Staatsangestellter. Ab 1918 waren meine Eltern<br />
Mitglieder der SDAPÖ. 1925 übersiedelten wir in den 7. Bezirk, Neustiftgasse 54. Die<br />
Wohnung war etwas größer, jedoch im obersten Stockwerk ohne Lift. 1931 bekamen wir<br />
nach längerer Wartezeit die Gemeindewohnung in der Neulinggasse, aus der wir dann<br />
1938 delogiert wurden. Zugleich wurde mein Vater nach dreißigjähriger Tätigkeit für den<br />
österreichischen Staat entschädigungslos „beurlaubt“.<br />
In der Neulinggasse wohnten wir zu viert, meine Eltern, meine Schwester und ich, sieben<br />
Jahre lang seit der Errichtung des Hauses. Es war 1930/31 unter dem Bürgermeister<br />
Karl Seitz gebaut worden. Amtsführender Stadtrat war damals ➤ Hugo Breitner für Finanzen<br />
und ➤ Anton Weber für Wohnungswesen. Die Wohnung bestand aus einem Wohnzimmer,<br />
einem Schlafzimmer, zwei Kabinetten und einer kleinen Küche, in der wir eine<br />
Duschnische eingebaut hatten, da ein Badezimmer nicht vorgesehen war. Vom Wohnzimmer<br />
ging ein kleiner Balkon auf den Innenhof. Ich sah meine Eltern 1938 zum letztenmal.<br />
Meinen Vater am 11. März, wenige Stunden vor dem Einmarsch der Hitlertruppen („Anschluß“).<br />
Er war damals 53 Jahre alt, ich 22. Ich war einige Wochen vorher, nach der<br />
von Bundeskanzler ➤ Schuschnigg verfügten politischen Generalamnestie, aus dem Zuchthaus<br />
Stein entlassen worden und in unsere Wohnung in die Neulinggasse 39 zurückgekehrt,<br />
wo ich im November 1936 wegen „roter“ Agitation und Propaganda verhaftet worden<br />
war. Ich war zu fünf Jahren Kerker verurteilt und am 19. Februar amnestiert und freigelassen<br />
worden. Mein Vater, der sich von mir politisch distanziert hatte, verhalf mir an<br />
jenem 11. März 1938 zu einer rechtzeitigen Ausreise, Emigration. Meine Mutter, sie war<br />
49 Jahre alt, begleitete mich mit einem letzten Autobus nach Znaim, wo uns die Nachricht<br />
vom soeben begonnenen Überfall der Hitlertruppen auf Österreich überrumpelte. Trotz<br />
dieses Ereignisses kehrte meine Mutter nach Wien in die Neulinggasse zurück. Beide Eltern<br />
waren überzeugt, daß ihnen als loyalen Staatsbürgern, meinem Vater insbesondere<br />
als loyalem Staatsbeamten unter drei Regimen (Monarchie, Republik, Ständestaat), „nichts<br />
passieren“ könne.<br />
Im Juni 1938 erhielt mein Vater von einem Ferdinand Holzer, Obermagistratsrat des nun<br />
von den Nazis verwalteten Wiener Magistrats, eine „Aufkündigung“, laut welcher unsere<br />
Wohnung bis spätestens 1. August 1938, 12 Uhr mittags, „geräumt zu übergeben“ war.<br />
Verzweifelt und vergeblich wehrten sich Heinrich und Alice Scheuer gegen das Unrecht.<br />
Mein Vater erhob am 29. Juni 1938 Einspruch gegen die Kündigung in einem Schreiben<br />
an die Nazibehörden (siehe Kasten S. 28).<br />
Er erhielt daraufhin am 7. Juli 1938 von der ➤ Magistratsabteilung 21 eine „Ladung“ zu<br />
einer „Verhandlung“ am 11. Juli 1938 im Zimmer 74, Verhandlungssaal VIII, 3. Stock, und<br />
am folgenden Tag einen schriftlichen Bescheid: „Kündigung ist nunmehr rechtskräftig.“ Die<br />
Wohnung wurde nun einem Michael Gilhofer neu vermietet.<br />
Die „arischen“ Nachbarn verhielten sich, nach Aussage meiner Schwester, die noch<br />
bis September 1938 in Wien weilte, zu diesen Vorgängen passiv, zum Teil jedoch<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
27<br />
Delogierung<br />
aufgrund<br />
„nichtarischer“<br />
Herkunft<br />
Vom Staat<br />
entschädigungslos<br />
„beurlaubt“<br />
Vergebliche<br />
Einsprüche gegen<br />
die „Kündigung“<br />
Passives Verhalten<br />
„arischer“ Nachbarn
Delogiert, deportiert, ermordet<br />
EINSPRUCH GEGEN DIE KÜNDIGUNG VOM 29.6.1938 AN DIE NAZIBEHÖRDE<br />
„Ich habe heute die gerichtliche Verständigung erhalten, daß ich meine<br />
Wohnung, 3., Neulinggasse 39, mit Ende Juli d. Js. zu räumen habe.<br />
Ich bitte um gütige Rücknahme der Kündigung u.zw. mit folgender<br />
Begründung.<br />
Seit meiner Kindheit wohne ich in Wien bzw. sind meine Eltern, Großeltern<br />
und Urgroßeltern nachweisbar in Österreich angesiedelt.<br />
Mit meinem 18. Lebensjahr trat ich in den Staatsdienst, Amtliche Nachrichtenstelle.<br />
Während des Krieges, den ich wegen meines gelähmten Beines nicht<br />
mitmachen konnte, war ich in der Redaktion der Amtlichen Nachrichtenstelle<br />
so wie andere Kollegen bei der damals besonders verantwortungsvollen Kriegsberichterstattung<br />
mittätig.<br />
Nach dem Kriege wurde ich Lokalberichterstatter und als solcher fast zwanzig<br />
Jahre Kommunalreferent der Gemeinde Wien für die Amtliche Nachrichtenstelle,<br />
also sowohl für den Staat als auch für die Stadt amtlich tätig, meine<br />
Pflichten stets korrekt und ordentlich erledigend.“<br />
In einem zweiten Absatz fügte Heinrich Scheuer hinzu:<br />
„Wenn es erlaubt ist, meine Bitte um Zurücknahme der Wohnungskündigung<br />
auch mit privaten Gründen zu unterstützen, so wäre es u.a. der Umstand,<br />
daß ich szt. 1931, als ich hier einzog, eine Mieterschutzwohnung, VII,<br />
Neustiftgasse 54, die sehr billig war, dem Wohnungsamt zur Verfügung stellte,<br />
daß ich gegenwärtig noch immer als aktiver, allerdings beurlaubter Staatsbeamter<br />
der in Liquidation befindlichen Amtlichen Nachrichtenstelle figuriere,<br />
da mein Personalakt zur Behandlung im Bureau des Herrn Staatssekretärs<br />
Dr. Wächter erliegt, daß ich also gar nicht weiß, wie sich mein künftiges<br />
Schicksal gestalten werde, welche Höhe die Pension haben wird, also auch<br />
nicht weiß, welche Wohnung ich mir werde nehmen können, wobei ja auch<br />
nur eine Mittelwohnung wie bisher und im 1. Stockwerke wegen meines<br />
Leidens in Betracht kommen kann, und ich ja noch für zwei unversorgte<br />
Kinder sorgen muß.<br />
Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, daß ich mich niemals politisch<br />
betätigt habe und daß ich mit meinen Berufskollegen aus allen Zeitungen<br />
ebenso gut ausgekommen bin wie hier im Hause mit allen Parteien, worüber<br />
ich jederzeit in der Lage wäre, dies bestätigen zu lassen.<br />
Aus all diesen Gründen wiederhole ich die Bitte, mein Ansuchen um<br />
Rücknahme der Wohnungsaufkündigung einer geneigten Befürwortung den<br />
in Betracht kommenden Stellen zu unterbreiten.“<br />
28 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
estürzt oder jedenfalls „korrekt“. Erwähnenswert ist eine Episode mit unserem damaligen<br />
Nachbarn H. Bujak. Er war bis 1934 Redakteur der „Arbeiter-Zeitung“ gewesen, stand<br />
dann den Revolutionären Sozialisten nahe, hatte aber auch Verbindung zu illegalen Nationalsozialisten.<br />
Er empfand den Sturz der ➤ Schuschnigg-Diktatur, die ihn brotlos gemacht<br />
hatte, als Befreiung, wurde vom Jubelrausch des „Anschlusses“ mitgerissen und versicherte<br />
seinem Journalistenkollegen Heinrich Scheuer, dem unter dem Schuschnigg-Regime der Titel<br />
eines „Regierungsrates“ verliehen worden war und der ihm, Bujak, in diesen vier Jahren<br />
Austrofaschismus gelegentlich Hilfe und Gelegenheitsarbeiten verschafft hatte, er,<br />
Heinrich Scheuer, habe nach dem neuen Regimewechsel 1938 nichts zu befürchten: Er,<br />
Bujak, habe Beziehungen zur illegalen NSDAP, und man könne auf seine Solidarität als<br />
Wohnnachbar und Journalistenkollege rechnen. Dies war meines Erachtens ehrlich gemeint<br />
und entsprach seinem Charakter, wie ich ihn in den vorhergehenden Jahren seit<br />
1934 kennengelernt hatte. Bujak war mutig, riskierte einiges im illegalen Untergrund gegen<br />
die Schuschnigg-Diktatur, und es zeugte auch von Mut, in den Tagen nach dem nazideutschen<br />
Einmarsch demonstrativ zum „Juden“ Scheuer rüberzukommen und diesem die<br />
Hand zu schütteln. Heinrich Scheuer war von dieser Demonstration offensichtlich einigermaßen<br />
überrascht und reagierte mit betonter Zurückhaltung. Er hatte das Ausmaß der nun<br />
hereinbrechenden Barbarei nicht vorhergesehen und war überfordert. Dies erklärt auch<br />
die Lähmung in den folgenden Monaten, in welchen nichts Wirksames unternommen wurde,<br />
um eine Ausreise zu bewerkstelligen.<br />
Meine Eltern mußten nun in eine winzige Wohnung im 5. Bezirk, Siebenbrunnengasse<br />
65, übersiedeln. Hier konnten sie nur 20 Monate bleiben, bis zum 2. Jänner 1940. Sie<br />
zogen dann in eine noch kleinere Wohnung im 3. Bezirk, Gärtnergasse 8. Hier war die<br />
Bleibe 18 Monate bis zum 30. Juni 1941. Schließlich wurden sie am 1. Juli 1941 in das<br />
Ghetto im 2. Bezirk, Czerningasse 12, gepfercht und nach zehn Monaten, am 20. Mai<br />
1942, nach Minsk deportiert und in der Nähe dieser Stadt, in Mali-Trostinetz ermordet.<br />
Ihre letzte Botschaft erreichte meine Schwester Rose Scheuer in London über das Internationale<br />
Rote Kreuz, datiert vom 24. Februar 1942, abgestempelt am 12. März.<br />
Von sechzig Mietparteien des Hauses wurden zwölf von den Nazibehörden als „nichtarisch“<br />
befunden. Alle mußten in den Monaten nach dem „Anschluß“ ihre Wohnung<br />
räumen.<br />
Als erster verließ Franz Beer (Stiege 4/Tür 15) im Mai 1938 seine Wohnung; sie wurde<br />
am 3. Juni einem Leopold Bauer neu vermietet.<br />
Der Buchsachverständige Jakob Antschel (Stg. 4/12) verwies in einem Beschwerdebrief<br />
auf seine alte, kranke Mutter und auf seinen Bruder Dr. Maximilian Antschel: „Er war Offizier,<br />
Frontkämpfer, kriegsverwundet und ausgezeichnet (Kriegsdekorationen) und ist an den<br />
Folgen des Krieges im Jahr 1931 gestorben.“ Es nützte ihm nichts. Seine Wohnung wurde<br />
am 1.10.1938 einem Kurt Marschelke übergeben.<br />
Dr. Eduard Eisler (Stg. 4/14) war Bundesbeamter, von ihm liegt kein Beschwerdebrief<br />
vor. Seine Wohnung bekam im August ein Rudolf Kosnar.<br />
Eduard Engel (Stg. 3/3) war Gewerkschaftssekretär. Er begnügte sich mit zwei Zeilen<br />
Einspruch. Seine Wohnung bekam im August ein Hubert Lusun.<br />
Dr. Hermann Gaschke (Stg. 1/6) war Rechtanwalt. Auch von ihm liegt kein Einspruch<br />
vor. Seine Wohnung bekam am 29. Juli ein Rudolf Wessely.<br />
Max Gewürz (Stg. 3/10) war Kaufmann. Er begnügte sich mit zwei Zeilen „Einwendungen“.<br />
Seine Wohnung bekam im November 1938 ein Dr. Karl Hofbauer.<br />
Olga Kleebinder (Stg. 1/3) war anscheinend ohne Beruf. Es liegt nichts Näheres vor,<br />
wer die Wohnung im Dezember bekam.<br />
Professor Oskar Kreisky (Stg. 1/7), ein Onkel des späteren Bundeskanzlers, bemühte den<br />
Rechtsanwalt Dr. Ignaz Berl und machte Einwendungen. Er mußte trotzdem im August ausziehen.<br />
Seine Wohnung bekam ein Johann Ableidinger.<br />
Der Bankbeamte Dr. Otto Mandl (Stg. 4/6) bat um „Erstreckung des Kündigungstermines<br />
auf Ende September“ und verwies auf seine beiden kleinen Kinder, vier Jahre und fünf<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
29<br />
Georg Scheuer<br />
Zwangsübersiedlung
Delogiert, deportiert, ermordet<br />
Wochen alt. Er hoffte, bis Ende September eine Ausreisemöglichkeit zu haben, und schrieb<br />
am 1. Juli 1938: „Mit den kleinen Kindern wäre ein Umzug für die Frist unseres hiesigen<br />
Aufenthaltes sehr schwierig und bitte ich daher um Verlängerung des Kündigungstermines.“<br />
Dennoch wurde die Kündigung am 30. Juli für den 1. August bestätigt. Die Wohnung bekam<br />
ein Hubert Lusun.<br />
Dr. Than (Stg. 4/5), ein Bankbeamter, bat, ihm die Wohnung wenigstens bis zum 30.<br />
September mit seinen Kindern zu belassen. Seine Frau, Anna Nicoletta Than, präsentiert<br />
sich als „Arierin“ und unterzeichnet „ergebenst“ mit „Heil Hitler!“<br />
„Ich bewohne mit meiner Familie die Wohnung Nr. 5 des städtischen Hauses 3. Bezirk,<br />
Neulinggasse 39, Stiege IV. Ich selbst bin Arierin, römisch-katholisch, meine Kinder, ein<br />
dreizehnjähriger Bub und ein siebenjähriges Mädchen, sind Mischlinge. Mit unserem Pensionseinkommen<br />
von Reichsmark 182,- monatlich ist es sehr schwer, bei Aufrechterhalten<br />
der Kündigung in der Zeit bis zum 31.7.38 eine andere Wohnung zu finden, und meine<br />
Lage ist dadurch noch besonders erschwert, daß ich einen Nervenzusammenbruch erlitten<br />
habe und infolge meines leidenden Zustandes (häufige Ohnmachtsanfälle) den Aufregungen<br />
einer Wohnungssuche und Übersiedlung nicht gewachsen bin.“ Sie wurde dennoch<br />
am 25. August gekündigt, die Wohnung bekam eine Katharina Schredt.<br />
Schließlich ersuchte auch Dr. Kolmann, Vertrauensarzt der Krankenkasse, vergeblich um<br />
„Aufschub“. Seine Wohnung bekam ein Alfred Lugner.<br />
Mit meinen Eltern Heinrich und Alice wurden damals ausnahmslos alle meine in Mitteleuropa<br />
verbliebenen Familienangehörigen von den Nazibehörden verhaftet, deportiert und<br />
ermordet. So Heinrichs Schwester Lina und deren Mann Hermann Hahn in Stockerau, seine<br />
Schwester Therese und deren Mann Moritz Kubin in Wien 7., Seidengasse, Heinrichs Bruder<br />
Julius Scheuer und Neffe Felix Hauser in Wien 3., Krieglergasse, Siegfried und Ernst<br />
Scheuer in Mähren. Sie alle wurden mit Millionen Schicksalsgenossen im „Holocaust“ der<br />
vierziger Jahre grausam vernichtet.<br />
Und nun die immer wiederkehrende bohrende Frage: Mußte das so ablaufen? Meine<br />
Mutter war nach dem „Anschluß“ im März 1938 mit mir bereits in der Tschechoslowakei.<br />
Sie mußte keineswegs in das Nazireich zurückkehren. Sie hätte ihren Mann nachkommen<br />
lassen können, wie ich es ihr in Znaim eindringlich riet, und mit ihm wie die beiden „Kinder“<br />
Georg und Rose den Nazischergen entrinnen können.<br />
Immer wieder hatte ich meinen Eltern damals und schon in den Jahren davor das Wesen<br />
des Faschismus und insbesondere des Nazifaschismus zu erklären versucht und ihnen<br />
prophezeit: „Sie werden euch ausrotten.“ Hitler war ja schon seit 1933 in Deutschland<br />
an der Macht und hatte seit 1924 in „Mein Kampf“ alles angekündigt. Tausendfach hatten<br />
wir die Sprechchöre gehört: „Juda verrecke!“ Meine Eltern hatten das nicht ernstgenommen.<br />
Meine Mahnungen und Warnungen wurden in den Wind geschlagen, als dummes Gerede<br />
eines 23jährigen „Weltfremden“ abgetan. Ich wurde als „Spinner“ ausgegrenzt. Meine<br />
Eltern, insbesondere mein Vater, vertrauten fest auf ihre „Bürgerrechte“, auf „Mieterschutz“,<br />
auf „Ersparnisse“ und auf „Pensionsansprüche“. Sie nahmen die offen und zynisch<br />
angekündigten Vernichtungspläne der Hitlerdiktatur nicht zur Kenntnis. Bis zur fristlosen Entlassung,<br />
Delogierung, Enteignung, Beraubung und Deportation. Es ist grausam, diesen Tatbestand<br />
auch 50 Jahre später festzuhalten. Aber es ist doch notwendig für die Nachgeborenen,<br />
einige Lehren daraus zu ziehen.<br />
Aus: Herbert Exenberger u.a.: Kündigungsgrund „Nichtarier“.<br />
Die Vertreibung jüdischer Mieter aus den Gemeindebauten in den Jahren 1938-1939.<br />
Picus Verlag, Wien 1996, S. 194 – 200.<br />
30 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
ANSUCHEN UM EINE GESCHÄFTSÜBERNAHME<br />
Hoch geehrter Herr Minister!<br />
Gestatten Sie, dass ich in nachfolgender Angelegenheit an Sie herantrete<br />
und um Ihre Unterstützung bitte.<br />
Ich bewerbe mich im Arisierungsweg um die Firma Adolf Huppert,<br />
I., Opernring 13 und lauft mein Gesuch (…) seit Wochen.<br />
Es hat noch ein zweiter Bewerber eingereicht.<br />
Dieses Geschäft soll die Basis für die Lebensexistenz meines Sohnes Hartmann<br />
Decker sein (ill. Pg.). [d. h. illegaler Parteigenosse]<br />
Sie, verehrter Herr Minister, kennen meine Lauterkeit, meine selbstlose<br />
Tätigkeit durch 25 Jahre für das österreichische Bekleidungsgewerbe und<br />
würden einige Wort von Ihrer Seite meinen Bestrebungen förderlich sein.<br />
Mein betont nationaler Standpunkt während meiner Handelskammertätigkeit<br />
(deutsch-österr. Ausschuss für Anschluss, resp. Zollunion) hat es mit sich<br />
gebracht, dass ich durch Schuschnigg und besonders Bürgermeister Schmitz<br />
zurückgestellt wurde und ich jede Mitarbeit einstellte.<br />
Bin Parteimitglied seit Mai 1938.<br />
Da in wenigen Tagen die Entscheidung in dieser Arisierungssache fallen muss,<br />
wollte ich sie bitten, mich gütigst zu empfangen.<br />
Heil Hitler!<br />
Ihr ergebener Carl Decker 1<br />
1 AVA, Handelsministerium, Präs., Auskünfte 1938,<br />
Karton 707, Zl. 2417 – 1938,<br />
Schreiben Kommerzialrat Carl Decker, 19.12.1938<br />
Aus: Hans Safrian, Hans Witek: Und keiner war dabei.<br />
Dokumente des alltäglichen Antisemitismus in Wien 1938.<br />
Picus Verlag, Wien 1988, S. 109f.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
31
Zwangsarbeit im „Dritten Reich“<br />
Ein Überblick<br />
Dimensionen der Zwangsarbeit<br />
in Österreich<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Zwangsarbeit<br />
Zwangsarbeit wurde während des Nationalsozialismus in fast allen Bereichen der deutschen<br />
und der österreichischen Wirtschaft, sowohl in den großen Betrieben der Rüstungsindustrie<br />
wie auch im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in kleineren Gewerbebetrieben, im<br />
Fremdenverkehr und in Haushalten geleistet.<br />
Obwohl die Bedeutung der Zwangsarbeit für die nationalsozialistische Wirtschafts- und<br />
Rüstungspolitik schon unmittelbar nach dem Krieg bekannt war, ist „Zwangsarbeit“ in der<br />
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Österreich erst in jüngster Zeit zum<br />
Thema geworden.<br />
Im gesamten Deutschen Reich waren es schätzungsweise mehr als 12 Millionen Menschen<br />
(siehe der Beitrag von Ulrich Herbert im vorliegenden Band), die – hauptsächlich<br />
zwischen 1939 und 1945 – zwangsweise zur Arbeit eingesetzt wurden. Zwangsarbeit<br />
wurde sowohl von Kriegsgefangenen, von zivilen ausländischen Arbeitskräften, von KZ-<br />
Häftlingen, von Roma und Sinti, ungarischen Juden und Jüdinnen und anderen diskriminierten<br />
und verfolgten Gruppen geleistet, von Männern ebenso wie von Frauen.<br />
Die Arbeits- und Lebensbedingungen der ZwangsarbeiterInnen waren sehr unterschiedlich,<br />
sowohl hinsichtlich ihres Status und ihres Einsatzbereiches als auch hinsichtlich ihrer<br />
nationalen Herkunft. Die zivilen ausländischen ZwangsarbeiterInnen etwa kamen aus mehr<br />
als zwanzig Ländern, darunter aus Polen, der damaligen Sowjetunion, Frankreich, Italien,<br />
Holland, Belgien, Griechenland. Die sogenannten „Westarbeiter“ und „Westarbeiterinnen“<br />
standen in der rassistischen Hierarchie der Nationalsozialisten an oberster Stelle, Polen<br />
und Polinnen, sogenannte „Ostarbeiter“ und „Ostarbeiterinnen“, Roma und Sinti, Juden<br />
und Jüdinnen am Ende dieser Hierarchie.<br />
Ulrich Herbert schildert in seinem Beitrag den Verlauf des Zwangsarbeitseinsatzes im<br />
Deutschen Reich im Zusammenhang mit den kriegswirtschaftlichen Überlegungen der<br />
Nationalsozialisten und geht dabei auch auf die unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbedingungen<br />
von ZwangsarbeiterInnen ein.<br />
Bis auf wenige Ausnahmen in Gestalt deutscher Firmen ist in Deutschland und Österreich<br />
bis heute keine Entschädigung für Zwangsarbeit geleistet worden, entsprechende Anträge<br />
ehemaliger ZwangsarbeiterInnen wurden auch von den Gerichten immer wieder abgelehnt.<br />
Erst in der jüngsten Vergangenheit hat das Thema eine größere Öffentlichkeit gefunden.<br />
Mehr als ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende zeichnet sich in beiden Ländern nun<br />
möglicherweise eine Lösung der Entschädigungsfrage ab. Diskutiert werden allerdings<br />
noch Höhe und Form der Auszahlungen und ob sich außer betroffenen Firmen auch der<br />
deutsche bzw. der österreichische Staat an der Einrichtung von Fonds beteiligt.<br />
Der Zeithistoriker Florian Freund skizziert im Interview die Dimension der Zwangsarbeit<br />
für Österreich daher sowohl in historischer Perspektive als auch hinsichtlich der aktuellen<br />
Debatte über Entschädigung für Zwangsarbeit.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
33
ZWANGSARBEITER IM „DRITTEN REICH“ – EIN ÜBERBLICK<br />
ULRICH HERBERT<br />
RüstungswirtschaftlicheVorbereitungen<br />
auf den<br />
Krieg – Mangel an<br />
Arbeitskräften<br />
Die Heranziehung von Millionen von Arbeitskräften zur Zwangsarbeit während des Zweiten<br />
Weltkrieges war eines der wesentlichen Kennzeichen nationalsozialistischer Arbeitspolitik<br />
– in Deutschland selbst wie im ganzen von den Deutschen besetzten Europa. Allerdings<br />
umfaßt der Begriff „Zwangsarbeiter“ eine Vielzahl von Personengruppen mit zum Teil sehr<br />
verschiedenen Arbeitsverhältnissen. Ihnen allen war gemeinsam, daß es ihnen verwehrt<br />
wurde, Arbeitsstelle und Arbeitgeber nach eigenem Willen auszusuchen oder zu verlassen<br />
und daß sie besonderen gesetzlichen oder sonstigen behördlichen Bestimmungen unterlagen,<br />
welche sie in der Regel besonders schlechten sozialen Bedingungen unterwarfen und<br />
ihnen rechtliche Einspruchsmöglichkeiten versagten. 1 Dabei ist der Begriff „Zwangsarbeit“<br />
vernünftigerweise deutlich abzusetzen von solchen Arbeitsverhältnissen, die zwar deutschen<br />
Reichsbürgern vorübergehend oder auf Dauer zugeordnet werden konnten, aber aufgrund<br />
der Gesamtwürdigung der Lebensumstände eher als Dienstverpflichtung denn als<br />
Zwangsarbeit zu bewerten sind – der Reichsarbeitsdienst etwa, die Dienstverpflichtung zum<br />
Bau der Autobahnen oder auch das „Landjahr“ für Mädchen.<br />
Es hat sich hierbei bewährt, drei große, in bezug auf Status, Art und Weise der Rekrutierung,<br />
soziale Lage, Rechtsgrundlage der Beschäftigung, Dauer und Umstände des Arbeitsverhältnisses<br />
sehr unterschiedliche große Gruppen voneinander zu unterscheiden:<br />
1. die ausländischen Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen, die zwischen<br />
1939 und 1945 zum Arbeitseinsatz nach Deutschland gebracht<br />
und im Volksmund „Fremdarbeiter“ genannt wurden; 2<br />
2. die Häftlinge der Konzentrationslager im Reichsgebiet sowie –<br />
in geringerem Umfang – in den besetzten Gebieten vor allem Osteuropas; 3<br />
3. die europäischen Juden, die in ihren Heimatländern, vor allem aber<br />
nach ihrer Deportation für kürzere oder längere Zeit Zwangsarbeiten<br />
verrichten mußten – in Gettos, Zwangsarbeitslagern oder KZ-Außenlagern. 4<br />
Nicht behandelt wird hier, abgesehen von den jüdischen Zwangsarbeitern, die Heranziehung<br />
von Bewohnern der von der Wehrmacht besetzten Länder zur Zwangsarbeit in diesen<br />
Ländern außerhalb der Konzentrationslager. Hierüber ist nicht nur der Forschungsstand ausgesprochen<br />
disparat, es werden in den verschiedenen Ländern auch ganz unterschiedliche<br />
Definitionen von „Zwangsarbeit“ verwendet, die von der zwangsweisen Arbeitsleistung in<br />
KZ-ähnlichen Lagern bis zur Dienstverpflichtung von Unterstützungsempfängern durch die<br />
einheimische Arbeitsverwaltung reichen.<br />
I.<br />
Der nationalsozialistische „Ausländereinsatz“ zwischen 1939 und 1945 stellt den größten<br />
Fall der massenhaften, zwangsweisen Verwendung von ausländischen Arbeitskräften in der<br />
Geschichte seit dem Ende der Sklaverei im 19. Jahrhundert dar. Im Spätsommer 1944 waren<br />
auf dem Gebiet des „Großdeutschen Reichs“ 7,6 Mio. ausländische Zivilarbeiter und<br />
Kriegsgefangene offiziell als beschäftigt gemeldet, die man größtenteils zwangsweise zum<br />
Arbeitseinsatz ins Reich gebracht hatte. Sie stellten damit zu diesem Zeitpunkt etwa ein<br />
Viertel aller in der gesamten Wirtschaft des Deutschen Reiches registrierten Arbeitskräfte.<br />
Gleichwohl war der „Ausländer-Einsatz“ von der nationalsozialistischen Führung vor<br />
Kriegsbeginn weder geplant noch vorbereitet worden.<br />
Bei den rüstungswirtschaftlichen Vorbereitungen Deutschlands auf den Krieg gab es drei<br />
große Engpässe – Devisen, bestimmte Rohstoffe und Arbeitskräfte. Für Devisen und Rohstoffe<br />
gab es eine Lösung: Nach dem Konzept der „Blitzkriege“ sollten die Ressourcen des<br />
Reiches sukzessive durch die Vorräte der zu erobernden Länder erweitert werden. Dieses<br />
34 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Konzept hatte sich in den Fällen Österreich und Tschechoslowakei bereits bewährt und sollte<br />
sich in den Jahren 1939 bis 1945 erneut bestätigen. Die Frage der Beschaffung von Arbeitskräften<br />
war schwieriger zu bewältigen, denn hier spielten außer wirtschaftlichen auch<br />
sicherheitspolizeiliche und vor allem weltanschauliche Faktoren eine Rolle. Etwa 1,2 Mio.<br />
Arbeitskräfte fehlten im „Großdeutschen Reich“, ein weiterer Anstieg dieses Bedarfs nach<br />
Beginn des Krieges war zu erwarten.<br />
Zwei Möglichkeiten standen zur Debatte: Entweder man beschäftigte – wie im Ersten<br />
Weltkrieg – deutsche Frauen in großem Umfang in der Wirtschaft, oder man importierte<br />
aus den zu erobernden Ländern Arbeitskräfte in großer Zahl. Beides aber stieß in der Regimeführung<br />
auf Ablehnung. Die Dienstverpflichtung deutscher Frauen während des Ersten<br />
Weltkriegs hatte zu erheblicher innenpolitischer Destabilisierung und Unzufriedenheit geführt;<br />
zudem hätte sie einen eklatanten Verstoß gegen das frauen- und sozialpolitische Konzept<br />
der Nationalsozialisten dargestellt. 5 Millionen von ausländischen Arbeitern, insbesondere<br />
von Polen, ins Reich zur Arbeit zu bringen, kollidierte vehement mit den völkischen<br />
Prinzipien des Nationalsozialismus, wonach auch eine massenhafte Beschäftigung von<br />
„Fremdvölkischen“ im Reich die „Blutreinheit“ des deutschen Volkes bedroht hätte.<br />
Die Entscheidung fiel erst nach Kriegsbeginn; im Vergleich zweier Übel schien der Ausländereinsatz<br />
gegenüber der Dienstverpflichtung deutscher Frauen das geringere zu sein,<br />
weil man hier die erwarteten Gefahren leichter repressiv eindämmen zu können glaubte.<br />
Die etwa 300.000 in deutsche Hand gefallenen polnischen Kriegsgefangenen wurden<br />
nun sehr schnell vorwiegend in landwirtschaftliche Betriebe zu Arbeit gebracht. Gleichzeitig<br />
begann eine Kampagne zur Anwerbung polnischer Arbeiter, die zunächst an die<br />
langen Traditionen der Beschäftigung polnischer Landarbeiter in Deutschland anknüpfte,<br />
aber nach kurzer Zeit zu immer schärferen Rekrutierungsmaßnahmen überging und seit<br />
dem Frühjahr 1940 in eine regelrechte Menschenjagd im sogenannten ➤ „Generalgouvernement“<br />
mündete, wo mit jahrgangsweisen Dienstverpflichtungen, kollektiven Repressionen,<br />
Razzien, Umstellungen von Kinos, Schulen oder Kirchen Arbeitskräfte eingefangen wurden.<br />
Bis zum Mai 1940 war auf diese Weise mehr als eine Million polnischer Arbeiter ins Reich<br />
gebracht worden.<br />
Gleichwohl empfand man den „Poleneinsatz“ in der Regimeführung nach wie vor als Verstoß<br />
gegen die „rassischen“ Prinzipien des Nationalsozialismus; den daraus erwachsenden<br />
„volkspolitischen Gefahren“, so ➤ Himmler im Februar 1940, sei mit entsprechend scharfen<br />
Maßnahmen entgegenzuwirken. Daraufhin wurde gegenüber den Polen ein umfangreiches<br />
System von repressiven Bestimmungen entwickelt: Sie mußten in Barackenanlagen wohnen,<br />
was sich allerdings auf dem Lande in der Praxis bald als undurchführbar erwies; sie erhielten<br />
geringere Löhne, durften öffentliche Einrichtungen (vom Schnellzug bis zur Badeanstalt)<br />
nicht benutzen, den deutschen Gottesdienst nicht besuchen; sie mußten länger arbeiten als<br />
Deutsche und waren verpflichtet, an der Kleidung ein Abzeichen – das „Polen-P“ – befestigt<br />
zu tragen. Kontakt zu Deutschen außerhalb der Arbeit war verboten, geschlechtlicher Umgang<br />
mit deutschen Frauen wurde mit öffentlicher Hinrichtung des beteiligten Polen geahndet.<br />
Um „das deutsche Blut zu schützen“, war zudem bestimmt worden, daß mindestens<br />
die Hälfte der zu rekrutierenden polnischen Zivilarbeiter Frauen zu sein hatten. 6<br />
Für die deutschen Behörden war der Modellversuch „Poleneinsatz“ insgesamt ein Erfolg:<br />
Es gelang sowohl, binnen kurzer Zeit eine große Zahl von polnischen Arbeitern gegen<br />
ihren Willen nach Deutschland zu bringen, als auch im Deutschen Reich eine nach „rassischen“<br />
Kriterien hierarchisierte Zweiklassengesellschaft zu installieren.<br />
Bereits im Mai 1940 aber war unübersehbar, daß auch die Rekrutierung der Polen den<br />
Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft nicht zu befriedigen vermochte. So wurden<br />
denn schon während und alsbald nach dem „Frankreichfeldzug“ etwas mehr als 1 Mio.<br />
französischer Kriegsgefangener als Arbeitskräfte ins Reich verbracht. Darüber hinaus begann<br />
in den verbündeten Ländern und besetzten Gebieten des Westens und Nordens eine<br />
verstärkte Arbeiter-Werbung. Auch für diese Gruppen wurden jeweils besondere, allerdings<br />
im Vergleich zu den Polen deutlich günstigere Vorschriften für Behandlung, Lohn, Unterkunft<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
35<br />
Ulrich Herbert<br />
Der „Poleneinsatz“<br />
als Modellfall
Vom „Blitzkrieg“<br />
zum<br />
Abnutzungskrieg<br />
Zwangsarbeitseinsatz<br />
zwischen<br />
rassistischer<br />
Ideologie und<br />
kriegswirtschaftlichen<br />
Zielen<br />
Zwangsarbeiter im „Dritten Reich“ – ein Überblick<br />
etc. erlassen, so daß ein vielfach gestaffeltes System der nationalen Hierarchisierung entstand,<br />
eine Stufenleiter, auf der die damals bereits so genannten „Gastarbeitnehmer“ aus<br />
dem verbündeten Italien zusammen mit den Arbeitern aus Nord- und Westeuropa oben und<br />
die Polen unten plaziert wurden. 7<br />
Der weit überwiegende Teil der ausländischen Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen der<br />
„Blitzkriegphase“ bis Sommer 1941 wurde in der Landwirtschaft beschäftigt. Bei den Industrieunternehmen<br />
spielten Ausländer zu dieser Zeit keine bedeutende Rolle; die Industrie<br />
setzte vielmehr darauf, bald nach Abschluß der „Blitzkriege“ ihre deutschen Arbeiter vom<br />
Militär zurückzuerhalten. Zugleich waren die ideologischen Vorbehalte gegen eine Ausweitung<br />
des Ausländereinsatzes bei Partei und Behörden so groß, daß festgelegt wurde, die<br />
Zahl der Ausländer auf dem Stand vom Frühjahr 1941 – knapp 3 Mio. – einzufrieren. Dieses<br />
Konzept ging so lange auf, wie die Strategie kurzer, umfassender Feldzüge eine Umstellung<br />
auf einen langen Abnutzungskrieg nicht erforderte.<br />
Seit dem Herbst 1941 aber entstand hier eine ganz neue Situation. Die deutschen Armeen<br />
hatten vor Moskau ihren ersten Rückschlag erlebt, von einem „Blitzkrieg“ konnte nicht mehr<br />
die Rede sein. Vielmehr mußte sich nun die deutsche Rüstungswirtschaft auf einen länger andauernden<br />
Abnutzungskrieg einstellen und ihre Kapazitäten erheblich vergrößern. Auch mit<br />
heimkehrenden Soldaten war nicht mehr zu rechnen – im Gegenteil: Eine massive Einberufungswelle<br />
erfaßte jetzt die Belegschaften der bis dahin geschützten Rüstungsbetriebe. Durch<br />
die nun einsetzenden intensiven Bemühungen um Arbeitskräfte aus den westeuropäischen<br />
Ländern allein waren aber diese Lücken nicht mehr zu schließen. Nur der Einsatz von Arbeitskräften<br />
aus der Sowjetunion konnte eine weitere, wirksame Entlastung bringen.<br />
Der Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegsgefangener oder Zivilarbeiter im Reich aber war<br />
vor Beginn des Krieges explizit ausgeschlossen worden. Dabei hatten sich nicht nur Parteiführung,<br />
➤ Reichssicherheitshauptamt und ➤ SS aus „rassischen“ und sicherheitspolitischen<br />
Gründen gegen jede Beschäftigung von Russen in Deutschland ausgesprochen. Vielmehr<br />
war die Siegesgewißheit im überwiegenden Teil der an der Vorbereitung des Krieges beteiligten<br />
Stellen der Regimeführung und der Wirtschaft so groß, daß ein solcher Einsatz von<br />
vornherein als nicht notwendig angesehen wurde, so daß anders als bei der Beschäftigung<br />
von Polen diesmal die ideologischen Prinzipien des Regimes durchschlugen. Darüber hinaus<br />
gab es auch in der deutschen Bevölkerung starke, durch die ersten Wochenschaubilder<br />
vom Krieg in der Sowjetunion noch verschärfte Vorbehalte gegen einen „Russeneinsatz“. 8<br />
Da also keine kriegswirtschaftliche Notwendigkeit ihrer Beschäftigung im Reich zu bestehen<br />
schien, wurden die Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in den Massenlagern im<br />
Hinterland der deutschen Ostfront ihrem Schicksal überlassen. Mehr als die Hälfte der 3,3<br />
Millionen bis Ende des Jahres 1941 in deutsche Hand geratenen sowjetischen Kriegsgefangenen<br />
verhungerte, erfror, starb vor Erschöpfung oder wurde umgebracht. Insgesamt kamen<br />
bis Kriegsende von den etwa 5,7 Mio. sowjetischen Kriegsgefangenen 3,5 Millionen<br />
in deutschem Gewahrsam ums Leben. 9<br />
Als sich aber seit dem Spätsommer 1941 und verstärkt dann im Winter dieses Jahres die<br />
militärische und damit auch die kriegswirtschaftliche Lage Deutschlands rapide wandelte,<br />
entstand erneut ein ökonomischer Druck zur Beschäftigung auch der sowjetischen Gefangenen,<br />
der sich im November in entsprechenden Befehlen äußerte. Die Initiative dazu ging<br />
diesmal von der Industrie, insbesondere vom Bergbau, aus, wo der Arbeitermangel bereits<br />
bedrohliche Formen angenommen hatte.<br />
Die überwiegende Mehrzahl der sowjetischen Gefangenen aber stand für einen Arbeitseinsatz<br />
gar nicht mehr zur Verfügung. Von den bis dahin mehr als 3 Mio. Gefangenen<br />
kamen bis März 1942 nur 160.000 zum Arbeitseinsatz ins Reich. Daher mußte nun auch<br />
hier in großem Stile auf die Rekrutierung sowjetischer Zivilarbeiter umgeschaltet werden.<br />
Die Beschaffung von so vielen Arbeitskräften in so kurzer Zeit wie möglich wurde zur<br />
vordringlichen Frage und zur Hauptaufgabe des im März neu eingesetzten „Generalbevollmächtigten<br />
für den Arbeitseinsatz“, ➤ Sauckel, der seine Aufgabe mit ebensoviel Effizienz<br />
wie schrankenloser Brutalität erfüllte. In knapp zweieinhalb Jahren wurden von den<br />
36 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Einsatzstäben der Wehrmacht und der deutschen Arbeitsämter 2,5 Mio. Zivilisten aus der<br />
Sowjetunion als Zwangsarbeiter ins Reich deportiert – 20.000 Menschen pro Woche.<br />
Parallel zu der Entwicklung bei Beginn des „Poleneinsatzes“ wurde auch dieser kriegswirtschaftlich<br />
motivierte Verstoß gegen die ideologischen Prinzipien des Nationalsozialismus<br />
durch ein System umfassender Repression und Diskriminierung der sowjetischen Zivilarbeiter<br />
kompensiert, das die Bestimmungen gegenüber den Polen an Radikalität allerdings<br />
noch weit übertraf.<br />
Innerhalb des Reiches hatte sich mittlerweile ein regelrechter Lagerkosmos herausgebildet;<br />
an jeder Ecke in den großen Städten wie auf dem Lande fanden sich Ausländerlager.<br />
Allein in einer Stadt wie Berlin gab es etwa 500, insgesamt mögen es im Reich mehr als<br />
20.000 gewesen sein, und etwa 500.000 Deutsche waren in verschiedenen Funktionen,<br />
vom Lagerleiter bis zum „Ausländerbeauftragten“ einer Fabrik, direkt in die Organisation<br />
des „Ausländereinsatzes“ einbezogen.<br />
Die Lebensbedingungen der einzelnen Ausländergruppen wurden durch eine strikte, bis<br />
in Kleinigkeiten reglementierte nationale Hierarchie differenziert. 10 Während die Arbeiter<br />
aus den besetzten Westgebieten und den sog. befreundeten Ländern zwar überwiegend in<br />
Lagern leben mußten, aber etwa dieselben Löhne und Lebensmittelrationen wie die Deutschen<br />
in vergleichbaren Stellungen erhielten und auch denselben Arbeitsbedingungen unterlagen,<br />
waren die Arbeiter aus dem Osten, vor allem die Russen, ganz erheblich schlechter<br />
gestellt. Die Rationen für die offiziell „Ostarbeiter“ genannten sowjetischen Zivilarbeiter<br />
fielen so gering aus, daß sie oft schon wenige Wochen nach ihrer Ankunft völlig unterernährt<br />
und arbeitsunfähig waren.<br />
Schon im Frühsommer 1942 berichteten zahlreiche Unternehmen, daß der „Russeneinsatz“<br />
ganz unwirtschaftlich sei, weil eine effektive Beschäftigung nicht nur eine bessere<br />
Verpflegung und ausreichende Ruhepausen, sondern auch dem Arbeitsvorgang entsprechende<br />
Anlernmaßnahmen für die Zwangsarbeiter voraussetze. Solche Maßnahmen hatten<br />
bei den französischen Kriegsgefangenen dazu geführt, daß die Arbeitsleistungen nach relativ<br />
kurzer Zeit beinahe das Niveau der deutschen Arbeiter erreichten. Die Lage vor allem<br />
der sowjetischen Zwangsarbeiter war allerdings von Betrieb zu Betrieb, von Lager zu Lager<br />
sehr unterschiedlich; in der Landwirtschaft ging es ihnen in der Regel erheblich besser<br />
als in der Industrie, und auch dort waren die Unterschiede in der Behandlung und der<br />
Ernährung eklatant, vor allem seit Ende 1942. Das aber verweist darauf, wie groß der<br />
Handlungs- und Ermessensspielraum des einzelnen Unternehmens war. Es kann überhaupt<br />
keine Rede davon sein, daß die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter<br />
aus dem Osten allein auf die bindenden Vorschriften der Behörden zurückzuführen gewesen<br />
seien.<br />
Zu wirksamen Verbesserungen der Lebensverhältnisse der „Ostarbeiter“ in breitem Maße<br />
kam es allerdings erst nach der Niederlage in Stalingrad Anfang 1943; eine umfassende<br />
Leistungssteigerungskampagne setzte ein, verbunden mit einer Bindung der Höhe der Lebensmittelration<br />
an die Arbeitsleistung, zugleich begannen umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen.<br />
Dadurch gelang es tatsächlich, die Arbeitsleistungen beträchtlich zu erhöhen.<br />
Eine qualifizierte Beschäftigung mußte aber auch zwangsläufig Auswirkungen auf das Verhältnis<br />
der deutschen zu den ausländischen Arbeitern haben. So war denn schon in den<br />
entsprechenden Vorschriften der Behörden alles getan worden, um die bevorzugte Stellung<br />
der deutschen Arbeiter gegenüber den Ausländern, insbesondere aber den Russen, in allen<br />
Bereichen durchzusetzen. Gegenüber den „Ostarbeitern“ hatten die Deutschen prinzipiell<br />
eine Vorgesetztenstellung, in manchen Betrieben erhielten die deutschen Arbeiter, die die<br />
„Ostarbeiter“ anlernen sollten, sogar die Funktion von Hilfspolizisten.<br />
Was nun die Löhne betrifft, so gab es hierbei grob gesprochen ein vierfach gestaffeltes System.<br />
Die zivilen Arbeitskräfte aus allen Ländern außer den ehemals polnischen und sowjetischen<br />
Gebieten erhielten die gleichen Löhne wie die deutschen Arbeiter bzw. Arbeiterinnen<br />
in vergleichbaren Funktionen – zumindest nominell. Es gibt vielfache Berichte darüber, daß<br />
dies in der Praxis nicht immer so gehandhabt wurde, wie von den Behörden vorgeschrieben.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
37<br />
Ulrich Herbert<br />
Arbeits- und<br />
Lebensbedingungen<br />
der ZwangsarbeiterInnen
Zwangsarbeiter im „Dritten Reich“ – ein Überblick<br />
Das aber soll hier unberücksichtigt bleiben. Nominell die gleichen Löhne sollten auch polnische<br />
Arbeiter erhalten, allerdings mußten sie eine besondere 15prozentige Steuer, die „Polen-Abgabe“,<br />
zahlen – übrigens von den deutschen Arbeitsbehörden mit der bemerkenswerten<br />
Begründung eingeführt, dies diene zum Ausgleich dafür, daß die Polen ja nicht wie die<br />
Deutschen zum Wehrdienst eingezogen würden. Die sowjetischen Arbeiter hingegen erhielten<br />
besonders festgelegte Löhne, die erheblich niedriger lagen als die der deutschen und anderen<br />
ausländischen Arbeiter – nominell etwa um 40 %, tatsächlich in den meisten Fällen<br />
wohl noch tiefer. Von vielen Betrieben ist zudem bekannt, daß sie gar keine Löhne an die sowjetischen<br />
Zivilarbeiter auszahlten und diese für „Zivilgefangene“ hielten.<br />
Der Ausländereinsatz gehörte in Deutschland mittlerweile wie selbstverständlich zum<br />
Kriegsalltag, und angesichts der eigenen Sorgen war für die meisten Deutschen das Schicksal<br />
der ausländischen Arbeiter von durchaus geringem Interesse. Im Sommer 1944 befanden<br />
sich 7,6 Mio. ausländische Arbeitskräfte auf Arbeitsstellen im Reich: 5,7 Mio. Zivilarbeiter<br />
und knapp 2 Mio. Kriegsgefangene. 2,8 Mio. von ihnen stammten aus der Sowjetunion,<br />
1,7 Mio. aus Polen, 1,3 Mio. aus Frankreich; insgesamt wurden zu dieser Zeit Menschen<br />
aus fast 20 europäischen Ländern im Reich zur Arbeit eingesetzt. Mehr als die Hälfte<br />
der polnischen und sowjetischen Zivilarbeiter waren Frauen, im Durchschnitt unter 20 Jahre<br />
alt – der durchschnittliche Zwangsarbeiter in Deutschland 1943 war eine 18jährige Schülerin<br />
aus Kiew. 26,5 % aller Beschäftigten im Reich waren damit Ausländer: in der Landwirtschaft<br />
46 %, in der Industrie knapp 40 %, in der engeren Rüstungsindustrie etwa 50 %, in<br />
einzelnen Betrieben mit hohem Anteil an Ungelernten bis zu 80 und 90 %. 11<br />
AUSLÄNDISCHE ARBEITSKRÄFTE IN DER DEUTSCHEN KRIEGSWIRTSCHAFT 1939 BIS 1944 12<br />
Landwirtschaft<br />
Alle nichtlandwirtschaftlichen<br />
Bereiche<br />
Gesamtwirtschaft<br />
Deutsche<br />
Zivile Ausländer<br />
Kriegsgefangene<br />
Ausländer insg.<br />
Ausl. in %<br />
aller Beschäftigten<br />
Deutsche<br />
Zivile Ausländer<br />
Kriegsgefangene<br />
Ausländer insg.<br />
Ausl. in %<br />
aller Beschäftigten<br />
Deutsche<br />
Zivile Ausländer<br />
Kriegsgefangene<br />
Ausländer insg.<br />
Ausl. in %<br />
aller Beschäftigten<br />
1939 1940 1941 1942 1943 1944<br />
10.732.000<br />
118.000<br />
—<br />
118.000<br />
1,1<br />
28.382.000<br />
183.000<br />
—<br />
183.000<br />
0,6<br />
39.114.000<br />
301.000<br />
—<br />
301.000<br />
0,8<br />
9.684.000<br />
412.000<br />
249.000<br />
661.000<br />
6,4<br />
25.207.000<br />
391.000<br />
99.000<br />
490.000<br />
1,9<br />
34.891.000<br />
803.000<br />
348.000<br />
1.151.000<br />
3,2<br />
8.939.000<br />
769.000<br />
642.000<br />
1.411.000<br />
13,6<br />
24.273.000<br />
984.000<br />
674.000<br />
1.659.000<br />
6,4<br />
33.212.000<br />
1.753.000<br />
1.316.000<br />
3.069.000<br />
8,5<br />
8.969.000<br />
1.170.000<br />
759.000<br />
1.929.000<br />
38 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
17,7<br />
22.568.000<br />
1.475.000<br />
730.000<br />
2.205.000<br />
8,9<br />
31.537.000<br />
2.645.000<br />
1.489.000<br />
4.134.000<br />
11.6<br />
8.743.000<br />
1.561.000<br />
609.000<br />
2.230.000<br />
20,3<br />
21.324.000<br />
3.276.000<br />
954.000<br />
4.230.000<br />
16,5<br />
30.067.000<br />
4.837.000<br />
1.623.000<br />
6.460.000<br />
17,7<br />
8.460.000<br />
1.767.000<br />
635.000<br />
2.402.000<br />
22,1<br />
20.144.000<br />
3.528.000<br />
1.196.000<br />
4.724.000<br />
18,9<br />
28.604.000<br />
5.295.000<br />
1.831.000<br />
7.126.000<br />
19,9<br />
Nach: Der Arbeitseinsatz im (Groß-) Deutschen Reich, Jgg. 1939–1944, Stichtag jew. 1.5. d.J.
Die Beschäftigung von ausländischen Zwangsarbeitern beschränkte sich durchaus nicht<br />
allein auf Großbetriebe, sondern erstreckte sich, von der Verwaltung abgesehen, auf die<br />
gesamte Wirtschaft – vom Kleinbauernhof über die Schlosserei mit sechs Arbeitern bis zur<br />
Reichsbahn, den Kommunen und den großen Rüstungsbetrieben, aber auch vielen privaten<br />
Haushalten, die eines der mehr als 200.000 überaus begehrten, weil billigen russischen<br />
Dienstmädchen im Haushalt einsetzten.<br />
II.<br />
Seit Anfang 1944 aber zeigte sich, daß selbst solche in der Tat erheblichen Zahlen für den<br />
Arbeiterbedarf insbesondere der großen Rüstungsprojekte des Reiches nicht mehr ausreichend<br />
waren, zumal infolge der militärischen Entwicklung die Arbeiterrekrutierung vor allem<br />
in der Sowjetunion zurückging und so die durch weitere Einberufungen immer größer<br />
werdenden Arbeitskräftelücken nicht mehr ausgefüllt werden konnten. Daraufhin wandte<br />
sich das Interesse zunehmend der einzigen Organisation zu, die noch über ein erhebliches<br />
Potential an Arbeitskräften verfügte: der SS und den ihr unterstellten Konzentrationslagern. 13<br />
In den ersten Kriegsjahren hatte der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen eine kriegswirtschaftliche<br />
Bedeutung nicht besessen. Zwar gab es bereits seit 1938 SS-eigene Wirtschaftsunternehmen<br />
– vor allem Steinbrüche, Ziegeleien und Ausbesserungswerkstätten –, und nahezu<br />
alle Häftlinge wurden in irgendeiner Form zur Zwangsarbeit herangezogen. Der Charakter<br />
der Arbeit als Strafe, „Erziehung“ oder „Rache“ blieb aber auch hier erhalten und<br />
nahm gegenüber den in der politischen und rassischen Hierarchie der Nazis besonders tief<br />
stehenden Gruppen bereits vor 1939 und verstärkt danach die Form der Vernichtung an.<br />
Durch die Gründung von SS-eigenen Betrieben wie den „Deutschen Ausrüstungswerken“<br />
und den „Deutschen Erd- und Steinwerken“ wurde zwar das Bestreben der SS sichtbar, die<br />
Konzentrationslager zunehmend auch als ökonomischen Faktor zu nutzen, in der Praxis<br />
aber blieb die wirtschaftliche Funktion der Zwangsarbeit der Häftlinge bis weit in die<br />
Kriegsjahre hinein den politischen Zielsetzungen der Lagerhaft untergeordnet. 14<br />
Nach dem militärischen Rückschlag an der Ostfront im Herbst 1941 und der damit verbundenen<br />
Umorganisation der deutschen Rüstungsindustrie auf die Notwendigkeiten eines<br />
langen Abnutzungskrieges wurden nun auch beim Reichsführer SS organisatorische Umstellungen<br />
vorgenommen, um die Produktion für die Rüstung – und nicht nur wie bisher in der<br />
Bauwirtschaft, der Baustoffgewinnung und der Militärausrüstung – in den Konzentrationslagern<br />
zur vorrangigen Aufgabe zu machen. Tatsächlich waren jedoch weder die Konzentrationslager<br />
auf eine solche rapide Umstellung eingerichtet noch reichte der wirtschaftliche<br />
Sachverstand in dem als neue Organisationszentrale der Konzentrationslager eingerichteten<br />
➤ „Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt“ der SS (WVHA) aus, um eine Rüstungsfertigung<br />
in großem Stile aus dem Boden zu stampfen. Zudem waren die KZ-Wachmannschaften<br />
selbst aufgrund der jahrelang geübten Praxis, daß ein Menschenleben im KZ nichts<br />
galt, nur schwer auf den Vorrang des Arbeitseinsatzes umzustellen. Das Wirtschafts- und<br />
Verwaltungshauptamt der SS machte im April 1942 allen KZ-Kommandanten den Arbeitseinsatz<br />
der KZ-Häftlinge zur Hauptaufgabe: Tatsächlich aber starben von den 95.000 registrierten<br />
KZ-Häftlingen des 2. Halbjahres 1942 57.503, also mehr als 60 %. Der Wert der<br />
KZ-Rüstungsproduktion im Jahre 1942 lag durchschnittlich bei etwa 0,002 % der Gesamtfertigung;<br />
für die gleiche Produktionsmenge bei der Karabinerfertigung benötigte ein Privatunternehmer<br />
nur 17 % der Arbeitskräfte wie der KZ-Betrieb Buchenwald. 15<br />
Erst im Frühjahr 1942 begann die SS damit, KZ-Häftlinge in umfangreicherem Maße für<br />
Rüstungszwecke einzusetzen, insbesondere beim Aufbau des IG-Farben-Werkes bei Auschwitz.<br />
16 Allerdings waren die Häftlinge hier zunächst nur bei den Bauarbeiten beschäftigt<br />
worden, während der Einsatz bei der Rüstungsfertigung erst ein Jahr später begann. Bei<br />
den Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Interessengruppen innerhalb der<br />
SS setzte sich der Gedanke der Strafe und Vernichtung gegenüber dem von Arbeit und<br />
Produktivität weiterhin durch – vor allem deshalb, weil durch die Massendeportation<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
39<br />
Ulrich Herbert<br />
„Vernichtung<br />
durch Arbeit“ –<br />
Zwangsarbeit von<br />
KZ-Häftlingen
Die SS „verleiht“<br />
KZ-Häftlinge an<br />
die Industrie<br />
Zwangsarbeiter im „Dritten Reich“ – ein Überblick<br />
sowjetischer Arbeitskräfte nach Deutschland, die zu dieser Zeit einsetzte, ein kriegswirtschaftlicher<br />
Druck zur Beschäftigung von Konzentrationslager-Häftlingen nicht entstand.<br />
Erst am 22. September 1942 entschied Hitler auf Vorschlag des Rüstungsministers Speer,<br />
daß die SS ihre KZ-Häftlinge fortan der Industrie leihweise zur Verfügung stellen und die<br />
Industrie ihrerseits die Häftlinge in den bestehenden Produktionsprozeß integrieren solle.<br />
Dadurch wurde hier das Prinzip der Ausleihe von KZ-Häftlingen an die Privatindustrie festgeschrieben,<br />
das von nun an den Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge bestimmen sollte. Seit<br />
dieser „Führerentscheidung“ wurde der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen innerhalb bestehender<br />
Industriebetriebe verstärkt; dazu meldeten die Privatunternehmen ihren Arbeitskräftebedarf<br />
beim WVHA, von wo aus Unterkünfte und Sicherheitsbedingungen überprüft<br />
und die Genehmigungen erteilt wurden. Dabei konnten in der Regel Firmenbeauftragte in<br />
den Lagern selbst die geeignet erscheinenden Häftlinge aussuchen. Anschließend wurden<br />
die Häftlinge in ein „Außenlager“ des Konzentrationslagers übergeführt, das meistens in<br />
unmittelbarer Nähe der Arbeitsstelle errichtet wurde. 17 Die Gebühren für die Überlassung<br />
der Häftlinge, die die Firmen an die SS zu zahlen hatten, betrugen pro Tag 6,- RM für<br />
Facharbeiter und 4,- RM für Hilfsarbeiter und Frauen. Gleichzeitig begannen auch die SSeigenen<br />
Wirtschaftsbetriebe im Reich verstärkt auf Rüstungsproduktion umzustellen; die<br />
Deutschen Ausrüstungswerke (DAW) produzierten seit Ende 1942 bereits zum überwiegenden<br />
Teil für rüstungs- und kriegswichtige Zwecke, vor allem Instandsetzungsarbeiten.<br />
Um den Rüstungseinsatz zu verstärken, lag das vorrangige Interesse des WVHA nur<br />
darin, die Zahl der Häftlinge in möglichst kurzer Zeit rigoros zu vergrößern. Die Belegstärke<br />
aller Konzentrationslager stieg von 110.000 (September 1942) in sieben Monaten<br />
auf 203.000 (April 1943). Im August 1944 war die Häftlingszahl bereits auf 524.268<br />
angewachsen, Anfang 1945 auf über 700.000. Die Todesraten der Häftlinge waren nach<br />
wie vor außerordentlich hoch und begannen erst seit dem Frühjahr 1943 zu sinken – von<br />
10 % im Dezember 1942 auf 2,8 % im April 1943. Da aber die Häftlingszahlen so stark<br />
gestiegen waren, sanken die absoluten Zahlen von Toten in weit geringerem Maße, als es<br />
die Prozentzahlen suggerieren. Von Januar bis August 1943 starben wiederum über<br />
60.000 Häftlinge in den Konzentrationslagern, die relative Sterblichkeit aber nahm ab.<br />
Dies zeigt, daß den erhöhten Anforderungen von seiten der privaten und der SS-Industrie<br />
stark erhöhte Einweisungszahlen entsprachen, nicht aber grundlegend veränderte Arbeitsund<br />
Lebensbedingungen der Häftlinge in den Lagern. 18<br />
Entsprechend lag die durchschnittliche Arbeitsfähigkeit – und damit die Lebensdauer –<br />
des einzelnen Häftlings 1943/44 zwischen einem und zwei Jahren; allerdings mit großen<br />
Unterschieden je nach Einsatzort und Gruppenzugehörigkeit der Häftlinge. Zur wirklichen<br />
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der KZ-Häftlinge kam es aber nur dann,<br />
wenn durch berufsqualifizierten Einsatz oder nach Anlernzeiten auf qualifizierten Arbeitsplätzen<br />
die Arbeitskraft des einzelnen nicht oder nur schwer ersetzbar wurde.<br />
Im Sommer 1943 waren von den 160.000 registrierten Gefangenen der WVHA-Lager etwa<br />
15 % bei der Lagerinstandhaltung beschäftigt und 22 % als arbeitsunfähig gemeldet. Die<br />
restlichen 63 %, also etwa 100.000, verteilten sich auf die Bauvorhaben der SS, die Wirtschaftsunternehmen<br />
der SS sowie die privaten Unternehmen. Noch für das Frühjahr 1944<br />
ging das Rüstungsministerium lediglich von 32.000 tatsächlich eingesetzten KZ-Häftlingen in<br />
der privaten Rüstungsindustrie im engeren Sinne aus. Am Ende des Jahres 1942 gab es innerhalb<br />
des Reichsgebiets 82 Außenlager der KZ, ein Jahr später 186. Im Sommer 1944 stieg<br />
diese Zahl auf 341, bis Januar 1945 auf 662. Da die Zahlenangaben der SS und des Speer-<br />
Ministeriums zum Teil stark voneinander abweichen, sind exakte Bestimmungen schwierig.<br />
III.<br />
Gegenüber den deutschen Juden ist der Übergang zur systematischen Zwangsarbeit mit<br />
dem Beginn des Jahres 1939 feststellbar. Juden, die Arbeitslosenunterstützung beantragten,<br />
wurden nach entsprechendem Erlaß der deutschen Arbeitsverwaltung seither im<br />
40 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
„geschlossenen Arbeitseinsatz“ als Hilfsarbeiter eingesetzt; bis zum Sommer 1939 wuchs<br />
die Zahl dieser – vorwiegend männlichen – jüdischen Zwangsarbeiter auf etwa 20.000<br />
an, die insbesondere bei Straßenbauarbeiten, bei Meliorations-, Kanal- und Talsperrenprojekten<br />
sowie auf Müllplätzen, nach Kriegsbeginn auch bei kurzfristigen Schneeräumungsoder<br />
Ernteaktionen eingesetzt wurden. Im Laufe des Jahres 1940 wurde die Verpflichtung<br />
zur Zwangsarbeit auf alle arbeitsfähigen deutschen Juden – Frauen wie Männer – ausgedehnt,<br />
unabhängig vom Empfang der Arbeitslosenunterstützung. Von nun an erfolgte der<br />
Einsatz vorwiegend in der Industrie. 19<br />
Spätestens seit dem Frühjahr 1941 aber konkurrierten die Bestrebungen zur Zwangsarbeit<br />
der deutschen Juden in Rüstungsunternehmen im Reichsgebiet mit dem Ziel der deutschen<br />
Führung, die Juden aus Deutschland zu deportieren.<br />
Auch für die – im Sommer 1941 etwa 50.000 – in Rüstungsbetrieben eingesetzten jüdischen<br />
Zwangsarbeiter boten die Arbeitsplätze, von denen viele als „rüstungswichtig“ eingestuft<br />
waren, keinen sicheren Schutz vor der Deportation, sondern lediglich eine nach der rüstungswirtschaftlichen<br />
Bedeutung ihrer Tätigkeit gestaffelte Verzögerung. Bemerkenswert<br />
war in diesem Zusammenhang, daß die Deportationen auch von in kriegswichtigen Betrieben<br />
beschäftigten Juden mit Hinweisen begründet wurden, es stünden schließlich genug Polen<br />
bzw. Ukrainer als Ersatz zur Verfügung – und dies war der letztlich ausschlaggebende<br />
Faktor bei der Entscheidung, die vorerst verschonten Berliner „Rüstungsjuden“ schließlich<br />
doch zu deportieren. Am 27. Februar 1943 wurden die Berliner jüdischen Rüstungsarbeiter<br />
an ihren Arbeitsplätzen ergriffen und zu den Deportationszügen gebracht. Ihre Arbeitsplätze<br />
in den Betrieben wurden durch ausländische Zivilarbeiter ersetzt. Am 5., 7. und 30.<br />
März wurden die ersten Transporte mit den Berliner „Rüstungsjuden“ in Auschwitz registriert.<br />
Von den 2757 deportierten Juden aus diesen Transporten wurden 1689 sofort umgebracht.<br />
Im Sommer 1943 gab es innerhalb Deutschlands – von wenigen Einzelfällen abgesehen<br />
– keine Juden und also auch keine jüdischen Zwangsarbeiter mehr.<br />
Ähnlich, wenngleich in zum Teil anderer zeitlicher Staffelung, entwickelte sich der<br />
Zwangsarbeitseinsatz in den von Deutschland besetzten Ländern insbesondere Osteuropas.<br />
Dies kann im einzelnen vor allem anhand des besetzten Polen nachvollzogen werden.<br />
Im sogenannten „Generalgouvernement“ wurde der jüdische Arbeitszwang bereits im<br />
Oktober 1939 verhängt. Danach mußten alle männlichen Juden zwischen 14 und 60 Jahren<br />
Zwangsarbeit in dafür einzurichtenden Zwangsarbeitslagern leisten. Es war Aufgabe der<br />
„Judenräte“, diese Arbeitskräfte entsprechend zu erfassen und einzuteilen. Einige Wochen<br />
später wurde der Arbeitszwang auch auf alle jüdischen Frauen im Alter zwischen 14 und<br />
60 Jahren ausgedehnt. 20<br />
Ursprünglich hatte allerdings die SS vorgesehen, alle Juden im „Generalgouvernement“<br />
in großen Zwangsarbeitslagern zur Arbeit einzusetzen. Allerdings waren so viele Juden de<br />
facto in freien Arbeitsverhältnissen tätig, daß eine schlagartige Umstellung auf Lagerhaft<br />
schon organisatorisch kaum möglich erschien. Jedoch sollte der jüdische „Arbeitseinsatz“<br />
zunehmend in Gettos konzentriert werden, deren Errichtung zu dieser Zeit noch nicht sehr<br />
weit vorangeschritten war.<br />
Etwas anders verlief die Entwicklung in denjenigen Teilen Polens, die ins Reichsgebiet eingegliedert<br />
worden waren. Hier gab es wegen der reichsrechtlichen Vorschriften keine generelle<br />
Regelung für die jüdische Zwangsarbeit. Die deutschen Maßnahmen zielten<br />
zunächst auf die „Verschiebung“ von Polen, Juden und Zigeunern ins „Generalgouvernement“<br />
zugunsten jener Volksdeutschen, die aus der Sowjetunion, Rumänien und anderen<br />
Regionen kommend im „Reich“ angesiedelt werden sollten. De facto aber wurde der im<br />
„Generalgouvernement“ geltende Arbeitszwang für Juden durch ortsgebundene Verfügungen<br />
auch in den annektierten Gebieten eingerichtet.<br />
Die Arbeitsverwaltung im „Generalgouvernement“ legte bereits im Sommer 1940 fest,<br />
daß jüdische Arbeitskräfte im freien Einsatz höchstens 80 % der üblichen Löhne erhalten<br />
sollten, die Polen für eine entsprechende Tätigkeit erhielten. Viele deutsche Unternehmen<br />
oder Institutionen entließen daraufhin ihre jüdischen Arbeitskräfte, denen sie zuvor oft<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
41<br />
Ulrich Herbert<br />
Der „geschlossene<br />
Arbeitseinsatz“<br />
jüdischer ZwangsarbeiterInnen<br />
Zwangsarbeit in<br />
den besetzten<br />
Gebieten Polens<br />
und der Sowjetunion
März 1942:<br />
Auflösung der<br />
Gettos und<br />
Deportation in<br />
Vernichtungslager<br />
Die letzte Phase<br />
des Krieges:<br />
Zwangsarbeit in<br />
unterirdischen<br />
Rüstungsbetrieben<br />
Zwangsarbeiter im „Dritten Reich“ – ein Überblick<br />
geringere oder gar keine Löhne bezahlt hatten. Das änderte sich aber mit dem Beginn der<br />
systematischen „Endlösung“. Die Flucht in die „Shops“ genannten Arbeitsstellen in den Gettos<br />
und die schreckliche Lage der jüdischen Arbeiter, die fürchten mußten, bei nicht genügenden<br />
Arbeitsleistungen deportiert und ermordet zu werden, machte sie als Arbeitskräfte<br />
zunehmend attraktiver. Die Einteilung in rüstungswichtige und weniger wichtige Fertigungsstätten<br />
wurde für die jüdischen Zwangsarbeiter immer mehr zur Entscheidung über Leben<br />
und Tod. 21<br />
Mit der Umstellung auf den Primat des Arbeitseinsatzes seit Anfang 1942 verschärften<br />
sich die Widersprüche: Im „Generalgouvernement“ begannen seit März 1942 die Auflösung<br />
der Gettos und die Deportationen der polnischen Juden in die ➤ Vernichtungslager.<br />
Ein Teil von ihnen jedoch wurde in besondere, den SS- und Polizeiführern unterstehende<br />
Arbeitslager gebracht, wo sie bei Bauvorhaben und in der Rüstungsproduktion eingesetzt<br />
wurden. 22 Dazu errichtete die SS in diesen Lagern eigene Wirtschaftsbetriebe, zum Teil aus<br />
den verlagerten Betriebsanlagen ehemals jüdischer Betriebe. Durch diese Maßnahmen kam<br />
es zu erheblichen Konflikten vor allem mit der an der Erhaltung „ihrer“ jüdischen Arbeitskräfte<br />
in den Gettowerkstätten interessierten Wehrmacht. Die SS war jedoch lediglich<br />
bereit, den Rüstungsbetrieben die jüdischen Arbeitskräfte vorerst zu belassen, wenn die<br />
Juden als KZ-Häftlinge unter der Regie der SS den Betrieben zum Arbeitseinsatz überlassen<br />
würden.<br />
Am 19. Juli 1942 ordnete Himmler an, alle polnischen Juden bis zum Ende des Jahres<br />
1942 zu ermorden. Nur solche Juden, die rüstungswichtige Zwangsarbeit verrichteten, sollten<br />
vorerst am Leben gelassen werden. Allerdings sollten solche Produktionsstätten sukzessive<br />
in SS-Regie übergehen und in Zwangsarbeitslagern zusammengefaßt werden.<br />
Daraufhin wurden von nun an Getto um Getto geräumt und die aufgebauten Produktionsstätten<br />
mit Zehntausenden von jüdischen Arbeitskräften stillgelegt, die Zwangsarbeiter in<br />
die Vernichtungslager deportiert und ermordet. Selbst die von der SS noch im März 1943<br />
aufgebaute „Ost-Industrie“, eine Dachgesellschaft, die die verschiedenen einzelnen Arbeitslager<br />
mit Rüstungsproduktion zusammenfaßte, wurde geschlossen, als diese Betriebe im<br />
Herbst 1943 gerade ihre Produktion aufgenommen hatten. Sämtliche hier beschäftigten<br />
17.000 Juden wurden aus den Fabriken herausgeholt und noch in den folgenden Tagen in<br />
der Nähe von Lublin erschossen. 23<br />
In den besetzten Gebieten der Sowjetunion war die Lage nicht anders. Nach der ersten<br />
Phase der Massenerschießungen in Sommer 1941 waren auch hier Juden in Arbeitskolonnen<br />
und Werkstätten beschäftigt worden. Aber auch in der Folgezeit und nach der kriegswirtschaftlichen<br />
Umstellung seit Anfang 1942 wurde die Praxis der Liquidationen ohne<br />
Rücksicht auf wirtschaftliche Belange fortgesetzt. 24<br />
Erst seit Anfang 1944, als gegenüber den Juden das politische Hauptziel des Nationalsozialismus<br />
erreicht war, kam es aufgrund des sich dramatisch verschärfenden Arbeitskräftemangels<br />
in der letzten Kriegsphase zu einer Änderung, und jüdische Häftlinge wurden<br />
auch im Reichsgebiet als Arbeitskräfte in SS-eigenen Betrieben, bei unterirdischen Betriebsverlagerungen<br />
und in Privatunternehmen, vor allem in der Großindustrie, eingesetzt. Bereits<br />
im August 1943 war in der Führungsspitze des Regimes die Entscheidung gefallen, die<br />
Herstellung der Raketenwaffe A 4, eine der sog. V-Waffen, mit Hilfe von KZ-Häftlingen in<br />
unterirdischer Produktion durchführen zu lassen. Seit dem Jahreswechsel 1943/44 wurde<br />
nun überall in Deutschland damit begonnen, rüstungswichtige Fertigungen in Untertagefabriken<br />
– meist Höhlen oder Bergstollen – zu verlagern, wo sie vor Bombenangriffen geschützt<br />
waren. Diese unter enormem Zeitdruck vorangetriebenen Projekte hatten schreckliche<br />
Auswirkungen für die hierbei eingesetzten KZ-Häftlinge. 25 Gerade in der Aufbauphase<br />
im Herbst und Winter 1943/44 waren die Todeszahlen immens. Leichte Ersetzbarkeit der<br />
Häftlinge bei technisch überwiegend einfachen, aber körperlich schweren Arbeiten, hoher<br />
Zeitdruck, mangelnde Ernährung und denkbar schlechte Lebensbedingungen waren die Ursachen<br />
für die hohen Todesraten, die erst zu sinken begannen, als das Wohnlager fertiggestellt<br />
und die Produktion aufgenommen worden war. Bis dahin jedoch waren die Häftlinge<br />
42 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
schon wenige Wochen nach ihrem Eintreffen „abgearbeitet“. Projekte dieser Art, zu denen<br />
Zehntausende, ja Hunderttausende von Arbeitskräften in drei Tagesschichten gebraucht<br />
wurden, waren nur noch mit KZ-Häftlingen durchführbar, denn allein die SS besaß noch Arbeitskraftreserven<br />
in solchen Größenordnungen. Aber auch die reichten zur Erfüllung der<br />
gestellten Aufgaben bald nicht mehr aus, so daß im Frühjahr 1944 der Arbeitseinsatz auch<br />
von Juden diskutiert wurde. Bis dahin war die Beschäftigung von Juden innerhalb des Reiches<br />
explizit verboten, schließlich galt es als Erfolg des Reichssicherheitshauptamtes der<br />
SS, das Reich „judenfrei“ gemacht zu haben. Nun aber änderte sich dies: Offenbar ausgehend<br />
von einer Anfrage der besonders im militärischen Bauwesen eingesetzten Organisation<br />
Todt bestimmte Hitler im April 1944, für Rüstungsverlagerung und Großbunkerbau seien<br />
„aus Ungarn die erforderlichen etwa 100.000 Mann durch Bereitstellung entsprechender<br />
Judenkontingente aufzubringen“. 26<br />
Den Deutschen waren durch die Besetzung Ungarns im März 1944 etwa 765.000 Juden<br />
in die Hände gefallen; am 15. April begann ihre Deportation, in deren Verlauf bis zum Juli<br />
etwa 458.000 ungarische Juden nach Auschwitz gebracht wurden. Von diesen wurden etwa<br />
350.000 Menschen sofort vergast und 108.000 besonders arbeitsfähig wirkende für<br />
den Arbeitseinsatz im „Reich“ aussortiert. Nachdem der Zufluß von „Fremdarbeitern“ mittlerweile<br />
beinahe ganz zum Versiegen gekommen war, hatten immer mehr Firmen im Reich<br />
bei den Arbeitsämtern, zum Teil auch direkt bei den Konzentrationslagern Häftlinge angefordert<br />
und waren nun auch einverstanden, jüdische Zwangsarbeiter aus der „Ungarnaktion“<br />
zu beschäftigen. Die aus Auschwitz kommenden Häftlinge, darunter sehr viele Frauen,<br />
wurden nun formal den Konzentrationslagern im „Reich“ unterstellt und auf die Firmen, die<br />
KZ-Arbeiter angefordert hatten, verteilt.<br />
Die Zahl der Arbeitskommandos der KZ-Stammlager wuchs seit dem Frühjahr 1944 rapide<br />
an, am Ende des Krieges existierten auf Reichsgebiet etwa 660 Außenlager; die Liste<br />
der deutschen Unternehmen, die solche KZ-Außenlager einrichteten und KZ-Häftlinge einsetzten,<br />
wurde immer länger und umfaßte Hunderte von renommierten Firmen. 27<br />
Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Häftlinge waren dabei in den verschiedenen Firmen<br />
sehr unterschiedlich. Insgesamt kann man – mit aller Vorsicht – jedoch davon ausgehen,<br />
daß diejenigen, die in der Produktion der Rüstungsbetriebe selbst beschäftigt wurden,<br />
erheblich größere Überlebenschancen besaßen als diejenigen Häftlinge, die in den großen<br />
Bauvorhaben und insbesondere beim Ausbau unterirdischer Produktionsstätten sowie bei<br />
der Fertigung in den Höhlen und Stollen nach der Betriebsverlagerung eingesetzt wurden.<br />
Insgesamt wird angesichts dieses knappen Überblicks deutlich, daß die deutsche Wirtschaft<br />
spätestens seit der Kriegswende im Winter 1941/42 alternativlos auf Zwangsarbeiter<br />
angewiesen war. Angesichts der erheblichen Fluktuation ist es vermutlich realistisch, von<br />
insgesamt etwa 9,5 bis 10 Millionen ausländischen Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen<br />
auszugehen, die für längere oder kürzere Zeit in Deutschland als Zwangsarbeiter eingesetzt<br />
wurden. Die höchste Zahl der gleichzeitig eingesetzten „Fremdarbeiter“ wurde im<br />
Sommer 1944 mit etwa 7,6 Millionen erreicht. Die Zahl der KZ-Häftlinge, die in Konzentrations-Stammlagern<br />
oder Außenlagern insgesamt zur Zwangsarbeit eingesetzt worden waren,<br />
ist seriös kaum schätzbar. Insgesamt sind zwischen 1939 und 1945 etwa 2,5 Millionen<br />
Häftlinge in Konzentrationslager des späteren Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts<br />
der SS eingeliefert worden; darunter etwa 15% Deutsche und 85 % Ausländer; eine seriöse<br />
Schätzung der Zahl der in diesen Jahren in den Lagern Gestorbenen geht von 836.000 bis<br />
995.000 Toten aus. Hierin sind die Lager Majdanek und Auschwitz nicht enthalten; in beiden<br />
Lagern zusammen ist die Zahl der Toten auf etwa 1,1 Millionen berechnet worden, von<br />
denen die weit überwiegende Mehrheit Juden waren. Unter den etwa 900.000 in den<br />
Konzentrationslagern im Reichsgebiet Gestorbenen dürfte die Zahl der Juden bei etwa<br />
300.000 bis 350.000 liegen; diejenige der Russen zwischen 200.000 und 250.000, die<br />
der Polen unter 100.000 – wobei es sich um grobe Schätzungen handelt. 28 Es ist davon<br />
auszugehen, daß nahezu jeder KZ-Häftling während seiner Haftzeit für kurze oder lange<br />
Zeit zur Zwangsarbeit eingesetzt worden ist, allerdings in sehr unterschiedlicher und sich<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
43<br />
Ulrich Herbert<br />
Ungarische Juden<br />
und Jüdinnen<br />
zwischen<br />
Zwangsarbeit und<br />
Vernichtung<br />
Der Zwangsarbeitseinsatz<br />
in<br />
Zahlen
Zwangsarbeiter im „Dritten Reich“ – ein Überblick<br />
wandelnder Weise. Von den etwa 200.000 Häftlingen im April 1943 dürfte noch weniger<br />
als die Hälfte im Rüstungsbereich eingesetzt gewesen sein. Am Ende des Jahres 1944 lag<br />
die Gesamtzahl der KZ-Häftlinge bei etwa 600.000, von denen 480.000 tatsächlich als<br />
„arbeitsfähig“ gemeldet waren. Nach Schätzungen des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts<br />
der SS wurden davon etwa 240.000 bei den unterirdischen Verlagerungen sowie<br />
bei den Bauvorhaben der Organisation Todt eingesetzt und ca. 230.000 in der Privatindustrie.<br />
29<br />
Die Zahl derjenigen Juden, die vor oder nach ihrer Deportation zur Zwangsarbeit herangezogen<br />
wurden, ist nicht mit hinreichender Genauigkeit zu schätzen; zumal dies in den<br />
einzelnen europäischen Ländern sehr unterschiedlich war. Im Sommer 1942 lag die Zahl<br />
der in den Gettos und Zwangsarbeitslagern eingepferchten polnischen Juden bei etwa 1,5<br />
Millionen; es ist gewiß nicht zu hoch gegriffen, wenn man davon ausgeht, daß von diesen<br />
mindestens die Hälfte für einige Zeit zur Zwangsarbeit eingesetzt worden ist. Erheblich geringer<br />
war der Anteil derjenigen, die aus den verschiedenen europäischen Ländern in die<br />
Lager des Ostens verschickt wurden und dort als „arbeitsfähig“ aussortiert worden waren;<br />
ebensowenig gibt es für die Gebiete der Sowjetunion Zahlen, die uns auch nur einen<br />
Annäherungswert ermöglichten.<br />
1 Im folgenden wird auf Einzelnachweise verzichtet, für detaillierte<br />
Belege verweise ich auf die Spezialliteratur. Zur ersten Information<br />
vgl. den Artikel „Zwangsarbeit“ in Yisrael Gutman u.a.<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung<br />
der europäischen Juden, 4 Bde., dt. Ausgabe Berlin 1993,<br />
Sp. 160-1644.<br />
2 Dazu ausführlich Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis<br />
des „Ausländereinsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten<br />
Reiches, Berlin, Bonn 1985; ders. (<strong>Hrsg</strong>.), Europa und der<br />
„Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und<br />
KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991; Walter Naasner,<br />
Neue Machtzentren in der deutschen Kriegswirtschaft 1942-<br />
1945. Die Wirtschaftsorganisation der SS, das Amt des Generalbevollmächtigten<br />
für den Arbeitseinsatz und das Reichsministerium<br />
für Bewaffnung und Munition/Reichsministerium für Rüstung<br />
und Kriegsproduktion im nationalsozialistischen Herrschaftssystem,<br />
Boppard 1994; Edward L. Homze, Foreign Labor in<br />
Nazi Germany, Princeton 1967; Literaturübersicht bei Hans-Ulrich<br />
Ludewig, Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg: Forschungsstand<br />
und Ergebnisse regionaler und lokaler Fallstudien, in: AfS<br />
31(1991), S. 558-577.<br />
3 Dazu jetzt grundlegend: Karin Orth, Das System der nationalsozialistischen<br />
Konzentrationslager, Hamburg 1999; sowie Ulrich<br />
Herbert/ Karin Orth/Christoph Dieckmann (<strong>Hrsg</strong>.), Die nationalsozialistischen<br />
Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur,<br />
Göttingen 1998; Yisrael Gutman/Avital Saf (<strong>Hrsg</strong>.), The Nazi Concentration<br />
Camps. Structure and Aims, The Image of the Prisoner,<br />
The Jews in the Camp, Proceedings of the fourth Yad Vashem<br />
International Historical Conference, Jerusalem 1980; Falk<br />
Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung<br />
und Vernichtung im Konzentrationslager, Hamburg 1978;<br />
Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager,<br />
Frankfurt 1993; Johannes Tuchel, „Arbeit“ in den Konzentrationslagern<br />
im Deutschen Reich 1933-1939, in: Rudolf G. Ardelt/Hans<br />
Hautmann (<strong>Hrsg</strong>.), Arbeiterschaft und Nationalsozialismus,<br />
Wien, Zürich 1990, S. 455-467; sowie die Beiträge in der Se-<br />
Aus: Klaus Barwig, Günter Saathoff, Nicole Weyde (<strong>Hrsg</strong>.):<br />
Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Rechtliche, historische und politische Aspekte,<br />
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden. Baden 1998, S. 17-32.<br />
rie „Dachauer Hefte“, Studien und Dokumente zur Geschichte<br />
der nationalsozialistischen Konzentrationslager, hg. v. Wolfgang<br />
Benz/Barbara Distel, München 1986 ff.; nach wie vor grundlegend,<br />
in vielem mittlerweile aber überholt ist Martin Broszat,<br />
Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945, in: Hans<br />
Buchheim u.a. (<strong>Hrsg</strong>.), Anatomie des SS-Staats, Gutachten des Instituts<br />
für Zeitgeschichte, Bd. 2, Olten u.a. 1965, S. 11-133.<br />
4 Ulrich Herbert, Arbeit und Vernichtung. Ökonomisches Interesse<br />
und Primat der „Weltanschauung“ im Nationalsozialismus, in:<br />
ders. (<strong>Hrsg</strong>.), Europa, S. 384-426; Götz Aly, „Endlösung“. Völkerverschiebung<br />
und der Mord an den europäischen Juden, Frankfurt<br />
1995; Thomas Sandkühler, „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord<br />
in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold<br />
Beitz 1941-1944, Bonn 1996; Dieter Pohl, Nationalsozialistische<br />
Judenverfolgung in Ostgalizien 1941-1944. Organisation und<br />
Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, München<br />
1996; ders., Von der „Judenpolitik“ zum Judenmord. Der Distrikt<br />
Lublin des Generalgouvernements 1939-1944, Frankfurt u.a.<br />
1993; Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf<br />
1972.<br />
5 Vgl. Rüdiger Hachtmann, Industriearbeiterinnen in der deutschen<br />
Kriegswirtschaft 1936-1944/45, in: Geschichte und Gesellschaft<br />
19 (1993) S. 332-366.<br />
6 Herbert, Fremdarbeiter, S. 67-95.<br />
7 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter, S. 96-131; zu den Italienern: Cesare<br />
Bermani/Sergio Bologna/Brunello Mantelli, Proletarier der „Achse“.<br />
Sozialgeschichte der italienischen Fremdarbeiter in NS-<br />
Deutschland 1937-1943; zu den Franzosen: Ulrich Herbert, Französische<br />
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter im deutschen Arbeitseinsatz<br />
1940-1942, in: La France et l´Allemagne en guerre. Sous la direction<br />
de Claude Carlier (et. al.), Paris 1990, S. 509-531; Bernd Zielinski,<br />
Staatskollaboration. Arbeitseinsatzpolitik in Frankreich unter<br />
deutscher Besatzung 1940-1944, Münster 1996; Yves Durand,<br />
Vichy und der Reichseinsatz, in: Herbert, Europa, S. 184-199; Yves<br />
Durand, La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les Stalags,<br />
les Oflags et les Kommandos 1939-1945, Paris 1987.<br />
44 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
8 Herbert, Fremdarbeiter, S. 132-189; ders., Zwangsarbeit in<br />
Deutschland: Sowjetische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene<br />
1941-1945, in: Peter Jahn/Reinhard Rürup (<strong>Hrsg</strong>.), Erobern und<br />
Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941-1945, Berlin<br />
1991, S. 106-130; sowie die Darstellung bei Barbara Hopmann/<br />
Mark Spoerer/ Birgit Weitz/Beate Brüninghaus, Zwangsarbeit bei<br />
Daimler-Benz, Stuttgart 1994; sowie Hans Mommsen/Manfred<br />
Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten<br />
Reich, Düsseldorf 1996.<br />
9 Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen<br />
Kriegsgefangenen 1941-1945, Stuttgart 1978; Alfred<br />
Streim, Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall<br />
Barbarossa“. Eine Dokumentation. Unter Berücksichtigung der<br />
Unterlagen deutscher Strafverfolgungsbehörden und der Materialien<br />
der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur<br />
Aufklärung von NS-Verbrechen. Heidelberg, Karlsruhe 1981; Karl<br />
Hüser/Reinhard Otto, Das Stammlager 326 (VI K) Senne 1941-<br />
1945. Sowjetische Kriegsgefangene als Opfer des nationalsozialistischen<br />
Weltanschauungskrieges, Bielefeld 1992.<br />
10 Zum Folgenden allg. Herbert, Fremdarbeiter, S. 190-236; Jill Stephenson,<br />
Triangle: Foreign Workers, German Civilians and the<br />
Nazi Regime. War and Society in Württemberg, 1939-1945, in:<br />
German Studies Review 15 (1992) S. 339-359; sowie v.a. die betriebsgeschichtlichen<br />
Untersuchungen Hopmann u.a., Zwangsarbeit<br />
bei Daimler-Benz; sowie Mommsen/Grieger, Volkswagenwerk;<br />
vgl. auch Klaus-Jürgen Siegfried, Das Leben der Zwangsarbeiter<br />
im Volkswagenwerk 1939-1945, Frankfurt/Main 1988;<br />
ders., Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit im Volkswagenwerk.<br />
Eine Dokumentation, Frankfurt/Main 1986; als Beispiel für<br />
die mittlerweile sehr umfangreiche regionalgeschichtliche Literatur<br />
vgl. Andreas Heusler, Zwangsarbeit in der Münchner Kriegswirtschaft<br />
1939-1945, München 1991.<br />
11 Vgl. Herbert, Fremdarbeiter, S. 269 ff.<br />
12 Nach: Der Arbeitseinsatz im (Groß-)Deutschen Reich, Jgg. 1939-<br />
1944, Stichtag jew. 1.5. d.J.<br />
13 Vgl. die Literaturhinweise in Fn. 2, sowie Johannes Tuchel, Die<br />
Inspektion der Konzentrationslager 1938-1945. Das System des<br />
Terrors. Eine Dokumentation, Berlin 1994; ders., Konzentrationslager.<br />
Organisationsgeschichte und Funktion der „Inspektion der<br />
Konzentrationslager“ 1934-1938, Boppard 1991; Klaus Drobisch/<br />
Günther Wieland, System der NS-Konzentrationslager 1933-1939,<br />
Berlin 1993; Gudrun Schwarz, Die nationalsozialistischen Lager,<br />
Frankfurt 1996; Hermann Kaienburg (<strong>Hrsg</strong>.), Konzentrationslager<br />
und deutsche Wirtschaft 1939-1945, Opladen 1996; ders.,<br />
„Vernichtung durch Arbeit“. Der Fall Neuengamme. Die Wirtschaftsbestrebungen<br />
der SS und ihre Auswirkungen auf die Existenzbedingungen<br />
der KZ-Gefangenen, Bonn 1990.<br />
14 Zum Folgenden v.a. Orth, System; Herbert/Orth/Dieckmann, Konzentrationslager,<br />
Kap. „Arbeit“.<br />
15 Vgl. Orth, System; Herbert, Arbeit und Vernichtung; darauf aufbauend,<br />
in der Interpretation aber einseitig Daniel Jonah Goldhagen,<br />
Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche<br />
und der Holocaust, dt. Ausgabe Berlin 1996, Kap. 10-12, S. 335-<br />
384.<br />
16 Vgl. Peter Hayes, Industry and Ideology. IG Farben in the Nazi<br />
Era, Cambridge/New York 1987; ders., Die IG Farben und die<br />
Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen im Werk Auschwitz, in: Kaienburg,<br />
Konzentrationslager, S. 129-148; Robert Jan van Pelt/Debórah<br />
Dwork, Auschwitz, 1270 to the present, New Haven 1996.<br />
17 Vgl. unter den zahlreichen Untersuchungen einzelner Konzentrationslager<br />
und Außenlager vor allem Florian Freund/Bertrand<br />
Perz, Das KZ in der Serbenhalle. Zur Kriegsindustrie in Wiener<br />
Neustadt, Wien 1987; Florian Freund, „Arbeitslager Zement“.<br />
Das Konzentrationslager Ebensee und die Raketenrüstung, Wien<br />
1989; Rainer Fröbe/Claus Füllberg-Stolberg u.a., Konzentrationslager<br />
in Hannover. KZ-Arbeit und Rüstungsindustrie in der<br />
Spätphase des Zweiten Weltkriegs, 2 Bde., Hildesheim 1986; Bertrand<br />
Perz, Projekt Quarz: Steyr-Daimler-Puch und das Konzentrationslager<br />
Melk, Wien 1991; Isabell Sprenger, Groß-Rosen. Ein<br />
Konzentrationslager in Schlesien, Köln u.a. 1996; Herwart Vor-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
45<br />
Ulrich Herbert<br />
länder (<strong>Hrsg</strong>.), Nationalsozialistische Konzentrationslager im<br />
Dienst der totalen Kriegsführung. Sieben württembergische<br />
Außenkommandos des Konzentrationslagers Natzweiler/Elsaß,<br />
Stuttgart 1978; Gerd Wysocki, Arbeit für den Krieg. Herrschaftsmechanismen<br />
in der Rüstungsindustrie des „Dritten Reiches“.<br />
Arbeitseinsatz, Sozialpolitik und staatspolizeiliche Repression<br />
bei den Reichswerken „Hermann Göring“ im Salzgitter-Gebiet<br />
1937/38 bis 1945, Braunschweig 1992; sowie Hopmann u.a.,<br />
Zwangsarbeit bei Daimler-Benz, und Mommsen/Grieger, Volkswagenwerk.<br />
18 Einzelnachweise bei Orth, System; Herbert, Arbeit und Vernichtung.<br />
19 Dazu grundlegend Wolf Gruner, Der geschlossene Arbeitseinsatz<br />
deutscher Juden: Zur Zwangsarbeit als Element der Verfolgung<br />
1938-1943, Berlin 1997.<br />
20 Vgl. Herbert, Arbeit und Vernichtung; Sandkühler, „Endlösung“;<br />
Pohl, Judenverfolgung in Ostgalizien; ders., Von der „Judenpolitik“<br />
zum Judenmord.<br />
21 Vgl. Florian Freund/ Bertrand Perz/Karl Stuhlpfarrer, Das Getto in<br />
Litzmannstadt (Lódz), in: „Unser einziger Weg ist Arbeit“: Das<br />
Getto in Lódz, 1940-1944. Ausstellungskatalog des Jüdischen<br />
Museums Frankfurt, Wien 1990, S. 17-31; Alfred Konieczny, Die<br />
Zwangsarbeit der Juden in Schlesien im Rahmen der „Organisation<br />
Schmelt“, in: Sozialpolitik und Judenvernichtung. Gibt es eine<br />
Ökonomie der Endlösung? (Beiträge zur nationalsozialistischen<br />
Gesundheits- und Sozialpolitik, 5), Berlin 1987, S. 91-110.<br />
Überblick über die neuere Holocaustforschung bei Ulrich Herbert<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-1945.<br />
Neuere Forschungen und Kontroversen, Frankfurt 1998.<br />
22 Vgl. Sandkühler, Das Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska,<br />
1941-1944, in: Herbert/Orth/Dieckmann (<strong>Hrsg</strong>.), Konzentrationslager.<br />
23 Helge Grabitz/Wolfgang Scheffler, Letzte Spuren. Ghetto Warschau,<br />
SS-Arbeitslager Trawniki, Aktion Erntefest. Fotos und Dokumente<br />
über Opfer des Endlösungswahns im Spiegel der historischen<br />
Ereignisse, Berlin 1988.<br />
24 Vgl. Christoph Dieckmann, Der Krieg und die Ermordung der litauischen<br />
Juden, in: Herbert (<strong>Hrsg</strong>.), Vernichtungspolitik, S. 292-<br />
329; Artikel „Zwangsarbeit“ in: Enzyklopädie des Holocaust, Sp.<br />
160-1644.<br />
25 Florian Freund, Die Entscheidung zum Einsatz von KZ-Häftlingen<br />
in der Raketenrüstung, in: Kaienburg, Konzentrationslager, S.<br />
61-76; ders., Arbeitslager Zement; Freund/Perz, Das KZ in der<br />
„Serbenhalle“; Rainer Fröbe, Der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen<br />
und die Perspektive der Industrie 1943-1945, in: Herbert<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Europa, S. 351-383; ders., „Wie bei den alten Ägyptern“.<br />
Die Verlegung des Daimler-Benz-Flugmotorenwerks Genshagen<br />
nach Obrigheim am Neckar 1944/45, in: Angelika Ebbinghaus<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Das Daimler-Benz-Buch. Ein Rüstungskonzern im „Tausendjährigen<br />
Reich“, Nördlingen 1987, S. 392-417; Rainer Eisfeld,<br />
Die unmenschliche Fabrik. V2-Produktion und KZ „Mittelbau-<br />
Dora“, Erfurt 1993; ders., Mondsüchtig. Wernher von Braun und<br />
die Geburt der Raumfahrt aus dem Geist der Barbarei, Reinbek<br />
1996; Jens-Christian Wagner, Das Außenlagersystem des KZ Mittelbau-Dora,<br />
in: Herbert/Orth/Dieckmann (<strong>Hrsg</strong>.), Konzentrationslager;<br />
Edith Raim, Die Dachauer KZ-Außenkommandos Kaufering<br />
und Mühldorf. Rüstungsbauten und Zwangsarbeit im letzten<br />
Kriegsjahr 1944/45, Landsberg am Lech 1992.<br />
26 Hitler am 6.7.1944, BA R 3/1509 (Besprechung mit Dorsch, Organisation<br />
Todt); vgl. Herbert, Arbeit und Vernichtung, S. 413.<br />
27 Vgl. die (unvollständigen) Übersichten bei Schwarz, Die nationalsozialistischen<br />
Lager; und Martin Weinmann (<strong>Hrsg</strong>.), Das nationalsozialistische<br />
Lagersystem (Catalogue of Camps and Prisons in<br />
Germany and German-Occupied Territories 1939-1945), Frankfurt<br />
am Main 1990.<br />
28 Orth, System, Kap. VII: „Bilanz der Opfer“; Wolfgang Benz<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Dimensionen des Völkermords. Die Zahl der jüdischen<br />
Opfer des Nationalsozialismus, München 1991.<br />
29 Aussage Pohl, 25. 8. 1947, Trials of War Criminals, Bd. 5, Washington<br />
1950, S. 445.
Interview mit Florian Freund<br />
„Die Kriegswirtschaft wäre ohne ZwangsarbeiterInnen<br />
zusammengebrochen“<br />
Wie viele ZwangsarbeiterInnen waren in Österreich während des Nationalsozialismus<br />
beschäftigt?<br />
Freund: Man muss hier zwischen verschiedenen Gruppen von ZwangsarbeiterInnen, die in<br />
Österreich beschäftigt waren, unterscheiden: Es gab österreichische Juden und Jüdinnen in<br />
Zwangsarbeitslagern von Ende 1938 bis 1941 und zum Teil auch bis 1945. Von dieser<br />
Art der Zwangsarbeit waren ca. 20.000 Personen betroffen, die zumeist in kleineren<br />
Lagern gearbeitet haben. Der größte Teil dieser Menschen wurde vermutlich in den Vernichtungslagern<br />
ermordet. Eine weitere Gruppe, die zur Zwangsarbeit herangezogen wurde,<br />
waren die österreichischen Roma und Sinti. Bisher habe ich 15 Lager von Roma und<br />
Sinti identifizieren können, in denen sie Zwangsarbeit, vor allem für Baufirmen, geleistet<br />
haben. Es wird aber noch einiger Forschungsanstrengungen bedürfen, um mehr herauszufinden.<br />
Darüber hinaus waren In- und AusländerInnen in sogenannten Arbeitserziehungslagern<br />
– auch dazu gibt es bis heute keine systematische Untersuchung. Die größte Gruppe<br />
von ZwangsarbeiterInnen waren zivile AusländerInnen, im Herbst 1944 waren es nach<br />
den offiziellen NS-Statistiken 580.000 Menschen. Zu den ZwangsarbeiterInnen zählten<br />
selbstverständlich auch KZ-Häftlinge, Ende 1944 waren es ca. 70.000 Menschen. Auch<br />
Justizhäftlinge, vor allem jene, die aus politischen Gründen inhaftiert waren, wurden zu<br />
Zwangsarbeit herangezogen. Hinzu kommen noch die Kriegsgefangenen verschiedener<br />
Nationalitäten, insbesondere aber die polnischen, sowjetischen und italienischen Kriegsgefangenen.<br />
Auch darüber liegt bisher keine Forschungsarbeit vor. Im Herbst 1944 waren<br />
es vermutlich einige 10.000 Kriegsgefangene, die als Zwangsarbeiter in Österreich eingesetzt<br />
wurden. Und schließlich sind hier die ca. 50.000 ungarischen Juden und Jüdinnen<br />
zu nennen, die vor allem beim Bau des sogenannten Südostwalls, aber auch in landwirtschaftlichen<br />
und gewerblichen Betrieben gearbeitet haben. Allein im damaligen Gau Niederdonau<br />
waren sie in 75 Lagern untergebracht und haben bei 250 verschiedenen Arbeitgebern<br />
Zwangsarbeit verrichtet, in Wien waren sie auf 67 verschiedene Lager aufgeteilt<br />
und haben in 105 Betrieben gearbeitet. Die Verhältnisse bei den ungarischen Juden und<br />
Jüdinnen waren zum Teil ganz katastrophal. Ein Beispiel ist das Lager Felixdorf, das Ende<br />
Dezember/Anfang Jänner 1945 eingerichtet wurde, dort verstarben 1865 von 2087 Gefangenen,<br />
die Todesursachen waren Unterernährung, Seuchen und Misshandlungen. Das<br />
ist eine Todesrate, die bei weitem über der eines „normalen“ Konzentrationslagers liegt,<br />
abgesehen natürlich von den Vernichtungslagern, in denen fast 100 Prozent der Häftlinge<br />
ermordet wurden. Ein großer Teil der zu Kriegsende noch lebenden ungarischen Juden<br />
und Jüdinnen wurde vor der Befreiung in Todesmärschen Richtung Mauthausen und von<br />
dort weiter nach Gunskirchen getrieben. In Gunskirchen wurden ca. 15.000 bis 18.000<br />
ungarische Juden und Jüdinnen von den Amerikanern befreit, die über die dort herrschenden<br />
Zustände völlig schockiert waren.<br />
Insgesamt muss man für den Herbst 1944 von einer Zahl von 700.000 Menschen ausgehen,<br />
die Zwangsarbeit geleistet haben. Das ist allerdings nur eine Gesamtzahl zu einem<br />
46 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
estimmten Zeitpunkt. Dabei ist noch nicht die Fluktuation berücksichtigt, die es bei allen<br />
Gruppen von ZwangsarbeiterInnen gegeben hat. Will man die Gesamtzahl der in Österreich<br />
beschäftigten ZwangsarbeiterInnen errechnen, so muß man zu den 700.000 im<br />
Herbst 1944 jene dazuzählen, die noch bis 1945 nach Österreich kamen, außerdem die<br />
Verstorbenen, Geflohenen oder auch jene, die in ihre Heimatländer zurückgeschickt wurden,<br />
weil sie krank wurden. Es wird noch eine wichtige Aufgabe der historischen Forschung<br />
sein, die Gesamtzahl zu ermitteln.<br />
Aus welchen Ländern stammten die zivilen ausländischen ZwangsarbeiterInnen?<br />
Die größte Gruppe, ungefähr 178.000 Menschen, waren sicherlich die sogenannten „Ostarbeiter“<br />
und „Ostarbeiterinnen“. Die Nationalsozialisten haben immer darauf geachtet,<br />
dass auch ein relativ hoher Anteil von Frauen mitdeportiert wird. Damit wollten sie erreichen,<br />
dass die Zwangsarbeiter unter sich bleiben und möglichst keine Kontakte der ausländischen<br />
Männer zu „deutschen“ Frauen entstehen. Aus diesem Grund hat man immer versucht,<br />
zwischen 30 und 50 Prozent Frauen zu deportieren. Diese Menschen stammten vor<br />
allem aus der Ukraine, aus Russland, zum Teil auch aus Polen und aus Weißrussland. Die<br />
genaue Herkunft lässt sich jedoch nach den NS-Statistiken nicht rekonstruieren, weil sie die<br />
Nationalität der sogenannten „OstarbeiterInnen“ nicht erfassten. Aus dem ➤ Generalgouvernement,<br />
also dem Teil Polens, der nicht in das Deutsche Reich eingegliedert wurde und der<br />
durch den Generalgouverneur Frank verwaltet war, und aus dem Bezirk Bialystok kamen<br />
am Stichtag 30. September 1944 106.000 Menschen, aus dem Protektorat Böhmen und<br />
Mähren, dem heutigen Tschechien, 61.000, außerdem waren zu diesem Zeitpunkt 57.000<br />
Franzosen und Französinnen, 49.000 ItalienerInnen, 33.000 JugoslawInnen und andere<br />
kleinere Nationalitätengruppen in Österreich. Aufschlußreich ist der Anteil ausländischer<br />
Arbeitskräfte an der Gesamtzahl der Arbeitskräfte, der während des Krieges stetig angestiegen<br />
ist. Berücksichtigt man nur die Zahl der zivilen AusländerInnen, waren es im Durchschnitt<br />
25 Prozent aller Beschäftigten. Berücksichtigt man alle Gruppen von ZwangsarbeiterInnen,<br />
kommt man auf ca. 30 bis 33 Prozent aller Beschäftigten, die am 30. September<br />
1944 zwangsweise zu Arbeit eingesetzt wurden. Die entsprechenden Zahlen für die in den<br />
einzelnen „Gauen“ eingesetzten zivilen ausländischen ZwangsarbeiterInnen sind für Niederdonau<br />
rund 32,3 Prozent, an zweiter Stelle lag die Steiermark mit 29,3 Prozent, danach<br />
Oberdonau mit 29,3 Prozent, Kärnten mit 28,7 Prozent, Salzburg mit 22,8 Prozent,<br />
Tirol-Vorarlberg mit 22,2 Prozent und Wien mit 16,7 Prozent. In diesen Zahlen sind Kriegsgefangene,<br />
KZ-Häftlinge, ungarische Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti und die anderen<br />
Gruppen von Zwangsarbeitskräften noch nicht enthalten. Die Verteilung der zivilen ausländischen<br />
Zwangsarbeitskräfte in den einzelnen „Gauen“ macht deutlich, wo die Schwerpunkte<br />
der Rüstungswirtschaft lagen und wo der größte Arbeitskräftemangel bestand. Daher<br />
muß man davon ausgehen, dass dort, wo es schon einen hohen Anteil von zivilen ausländischen<br />
Arbeitskräften gab, auch der Anteil von Kriegsgefangenen, KZ-Häftlingen usw.<br />
entsprechend höher war.<br />
In welchen Bereichen der österreichischen Wirtschaft wurden zivile und andere<br />
ZwangsarbeiterInnen eingesetzt?<br />
Von den zivilen AusländerInnen war der größte Teil, nämlich ca. 35 Prozent aller zivilen<br />
ausländischen Zwangsarbeitskräfte nach einer NS-Statistik vom 15. November 1943 in der<br />
Landwirtschaft eingesetzt, weiters in allen kriegs- bzw. rüstungsrelevanten Bereichen, das<br />
heißt im Maschinen-, Kessel-, Apparate- und Fahrzeugbau; darunter fallen Autofirmen ebenso<br />
wie die Luftfahrtindustrie, die Eisenbahnindustrie, das heißt die Lokomotivproduktion und<br />
ähnliches, mit einem Anteil von 13,5 Prozent aller zivilen AusländerInnen im November<br />
1943. Bau- und Nebengewerbe waren besonders wichtig, weil in der NS-Zeit sehr viele<br />
neue Fabriken, neue Kraftwerke usw. gebaut wurden. Dort gab es einen ganz besonders<br />
hohen Anteil von zivilen AusländerInnen und auch KZ-Häftlingen, für zivile ausländische<br />
Zwangsarbeitskräfte liegt die Zahl bei ca. 12,8 Prozent. In der Eisen-, Stahl- und Metallwa-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Florian Freund<br />
47
Zwangsarbeit in Österreich<br />
ZWANGSARBEITER UND ZWANGSARBEITERINNEN IN DER „OSTMARK“. EINE ÜBERSICHT 1<br />
Anzahl und Nationalität der zivilen AusländerInnen in der „Ostmark“<br />
25.4.1941<br />
10.7.1942<br />
15.11.1943<br />
30.9.1944<br />
25.4.1941<br />
10.7.1942<br />
15.11.1943<br />
30.9.1944<br />
25.4.1941<br />
10.7.1942<br />
15.11.1943<br />
30.9.1944<br />
Polen Italiener Jugoslawen Franzosen Ungarn Sowjets Protektorat<br />
40.928 15.298 20.594 589 8.258 538 n.erfaßt<br />
62.568 32.802 35.345 2.592 12.335 45.803 37.677<br />
97.382 17.800 35.131 62.303 12.018 153.310 66.553<br />
106.023 49.078 33.916 57.628 10.759 178.596 61.738<br />
Beschäftigte AusländerInnen in der Ostmark am 15.11.1943 2<br />
(incl. „OstarbeiterInnen“, ohne Kriegsgefangene, auf Grund der Arbeitsbuchstatistik)<br />
Wien<br />
Niederdonau<br />
Oberdonau<br />
Tirol/Vlbg<br />
Salzburg<br />
Kärnten<br />
Steiermark<br />
Gesamt:<br />
Slowaken Dänen Niederländer Belgier Griechen Rumänen Bulgaren<br />
22.180 575 895 926 n.erfaßt n.erfaßt 3.414<br />
23.799 444 2.096 2.467 n.erfaßt n.erfaßt n erfaßt<br />
n.erfaßt n.erfaßt 3.411 4.237 n.erfaßt n.erfaßt n.erfaßt<br />
13.213 415 3.651 17.949 10.481 2.978 6.221<br />
Schweizer Sonstige AusländerInnen in der<br />
„Ostmark“ gesamt<br />
684 13.851 12.8730<br />
n.erfaßt 44.536 30.2464<br />
n.erfaßt 75.445 52.7590<br />
861 27.133 58.0640<br />
InländerInnen AusländerInnen In- und<br />
AusländerInnen<br />
AusländerInnen in Prozent<br />
aller Beschäftigten<br />
600.710 114.730 715.440 16,04%<br />
345.298 147.500 492.798 29,93%<br />
245.827 88.483 334.310 26,47%<br />
113.702 28.118 141.820 19,83%<br />
62.049 16.819 78.868 21,33%<br />
97.932 30.837 128.769 23,95%<br />
242.448 86.431 328.879 26,28%<br />
1,707.966 512.918 2,220.884 23,10% 19,70%<br />
Beschäftigte AusländerInnen in der Ostmark am 30.9.1944 3<br />
(incl. „OstarbeiterInnen“, ohne Kriegsgefangene, auf Grund der Arbeitsbuchstatistik)<br />
Wien<br />
Niederdonau<br />
Oberdonau<br />
Tirol/Vlbg<br />
Salzburg<br />
Kärnten<br />
Steiermark<br />
Gesamt:<br />
InländerInnen AusländerInnen In- und<br />
AusländerInnen<br />
1 Statistik zusammengestellt nach: Der Arbeitseinsatz<br />
in der Ostmark (einschließlich der angegliederten sudetendeutschen<br />
Gebiete). Mitteilungen des Reichsarbeitsministeriums,<br />
Zweigstelle Österreich für Arbeitseinsatz<br />
und Arbeitslosenhilfe, Jg. 1939; Der Arbeit-<br />
AusländerInnen in Prozent<br />
aller Beschäftigten<br />
579.824 116.226 696.050 16,70%<br />
336.184 160.116 496.300 32,26%<br />
242.249 100.373 342.622 29,30%<br />
110.386 31.577 141.963 22,24%<br />
63.633 18.841 82.474 22,84%<br />
95.123 38.378 133.501 28,75%<br />
244.504 101.485 345.989 29,33%<br />
Deutsches<br />
Reich<br />
Deutsches<br />
Reich<br />
1,671.903 566.996 2,238.899 25,32% 20,5%<br />
seinsatz im Großdeutschen Reich, Jg. 1940–1944.<br />
2 Der Arbeitseinsatz im Großdeutschen Reich, Nr. 1,<br />
31.1.1944, S. 5 ff<br />
3 Der Arbeitseinsatz im Großdeutschen Reich, Nr. 9,<br />
30.9.1944, S. 8 ff. Quelle: Florian Freund<br />
48 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
enherstellung, also Kanonen-, Panzerfabrikation und ähnliches, waren 6 Prozent der zivilen<br />
AusländerInnen beschäftigt. In der Eisen- und Metallgewinnung – darunter fallen zum<br />
Beispiel die „Hermann Göring Werke“, aus denen nach 1945 die VOEST hervorgegangen<br />
ist, Böhler u.a. – waren es 3 Prozent, und bei der Reichsbahn, den heutigen ÖBB, waren zu<br />
diesem Zeitpunkt 15.355 zivile AusländerInnen beschäftigt, also fast 3 Prozent aller zivilen<br />
AusländerInnen. Zu diesem Zeitpunkt hat es etwa auch 8900 Dienstmädchen in Österreich<br />
gegeben, die Zwangsarbeiterinnen waren, was auch eine ganz beachtliche Zahl ist. Auch<br />
die Fremdenverkehrswirtschaft hat 7522 ZwangsarbeiterInnen beschäftigt, in erster Linie in<br />
den Gauen Tirol-Vorarlberg und Salzburg.<br />
Wieviele österreichische Firmen waren in die Zwangsarbeit involviert, welche<br />
ökonomische Bedeutung hatte die Zwangsarbeit für den Staat und<br />
für die einzelnen Firmen?<br />
Es haben praktisch alle für die Rüstungswirtschaft relevanten Firmen in der einen oder<br />
anderen Form ZwangsarbeiterInnen beschäftigt. So wäre zum Beispiel die gesamte Raketenrüstung,<br />
der Bau der sogenannten „Wunderwaffe“, ohne Zwangsarbeit, insbesondere<br />
KZ-Zwangsarbeit unmöglich gewesen. Führend bei der Beschäftigung von ZwangsarbeiterInnen<br />
war ganz sicher Steyr-Daimler-Puch. Wie mein Kollege Bertrand Perz erforscht hat,<br />
beschäftigte Steyr-Daimler-Puch im Herbst 1944 ca. 50.000 Personen, von denen der größte<br />
Teil zivile AusländerInnen waren. Zu diesen 50.000 sind zu diesem Zeitpunkt mindestens<br />
noch 20.000 bis 30.000 KZ-Häftlinge dazuzuzählen, die in den Statistiken üblicherweise<br />
nicht aufscheinen. Sie machten aber einen ganz erheblichen Anteil der Beschäftigten aus,<br />
die direkt oder indirekt für die Steyr-Daimler-Puch gearbeitet haben. Bei den Baufirmen ist<br />
es ganz ähnlich. Die Universale Bau AG zum Beispiel hat auch in großem Ausmaß KZ-Häftlinge<br />
beschäftigt, andere Baufirmen wiederum beschäftigten nur zivile AusländerInnen. Das<br />
war von Firma zu Firma immer wieder unterschiedlich, vor allem auf Grund der Bauprojekte,<br />
in die die Firmen involviert waren. Die Firmen selbst haben während der gesamten NS-<br />
Zeit sozusagen um Arbeitskräfte gerauft. Den meisten Privatfirmen war es vermutlich lieber,<br />
wenn es InländerInnen waren, weil sie sich dadurch die Probleme und Kosten ersparen<br />
konnten, die z.B. die Überwachung, Separierung, Ernährung der ZwangsarbeiterInnen und<br />
der Einfluß der SS bei der Beschäftigung von KZ-Häftlingen aus ihrer Sicht mit sich brachten.<br />
Aber inländische Arbeitskräfte hat es einfach nicht gegeben, weil ein großer Teil der<br />
Männer zur Wehrmacht eingezogen war und das NS-Regime die Erwerbsarbeit von Frauen<br />
nicht unbedingt forcieren wollte. Letztlich waren die ZwangsarbeiterInnen die einzige<br />
Möglichkeit, zusätzliche Arbeitskräfte zu bekommen, durch sie konnten die Firmen expandieren.<br />
Mehr Umsatz bedeutete mehr Gewinn, und ohne diese Arbeitskräfte hätten sie<br />
weder Umsatz noch Gewinn machen können. Zwangsarbeit hatte also eine ganz große<br />
Bedeutung für die einzelnen Firmen. Die gesamte Kriegswirtschaft wäre ohne den Einsatz<br />
von ZwangsarbeiterInnen spätestens Ende 1941 zusammengebrochen. Zu diesem Zeitpunkt<br />
hatten sich die ganzen ökonomischen Rahmenbedingungen auf Grund der Tatsache<br />
verändert, dass man die Wirtschaft auf einen lange dauernden Krieg umstellen musste.<br />
Insofern waren diese Menschen im wahrsten Sinne des Wortes gezwungen, zur Verlängerung<br />
des Krieges beizutragen.<br />
Wie viele dieser ehemaligen ZwangsarbeiterInnen leben heute noch?<br />
Wenn man eine Gesamtschätzung derer versucht, die heute noch leben, muss man sich an<br />
den Zahlen orientieren, die die „Vereinigung der durch das Dritte Reich geschädigten<br />
Polen“ durch sehr intensive Umfragen erhoben hat. Sie geht davon aus, dass heute noch<br />
ca. 25.000 Polen und Polinnen leben, die als KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, zivile AusländerInnen<br />
oder einer der anderen Gruppen zugehörig in irgendeiner Weise Zwangsarbeit<br />
in Österreich geleistet haben. Nimmt man an, dass bei anderen Nationalitäten die Überlebensrate<br />
ähnlich ist, dann kann man davon ausgehen, dass heute noch insgesamt ca.<br />
100.000 ehemalige ZwangsarbeiterInnen leben. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Florian Freund<br />
49
Zwangsarbeit in Österreich<br />
Lebenserwartung in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ganz unterschiedlich ist zur<br />
Lebenserwartung in Polen, und diese ist wiederum völlig unterschiedlich zur Lebenserwartung<br />
in den westlichen Industrieländern. Diese Zahl ist also nur eine grobe Schätzung. Wir<br />
wissen es noch nicht genau, und für die Frage der Entschädigungszahlungen ist es auch<br />
nicht das Hauptproblem, außer, dass man die Gesamtkosten noch nicht genau abschätzen<br />
kann. Aber wir wissen, unter welchen Bedingungen und unter welchem Grad von Zwang<br />
die einzelnen Gruppen von Betroffenen in Österreich Zwangsarbeit geleistet haben, das ist<br />
absolut eindeutig. Bei den zivilen AusländerInnen muss man differenzieren. Es sind nicht<br />
alle Nationalitäten gleich behandelt worden. Angehörige mit dem Deutschen Reich verbündeter<br />
Nationen wurden besser behandelt, zum Beispiel KroatInnen, oder, solange Italien<br />
mit dem Deutschen Reich verbündet war, auch die ItalienerInnen. Ab Herbst 1943, mit dem<br />
Abschluss eines Waffenstillstands zwischen Italien und den Alliierten, änderte sich das radikal,<br />
und die ItalienerInnen wurden danach ganz besonders diskriminiert. Die sogenannten<br />
„WestarbeiterInnen“, sprich HolländerInnen, Franzosen und Französinnen, ItalienerInnen,<br />
DänInnen wurden grundsätzlich wesentlich besser behandelt als die sogenannten „OstarbeiterInnen“<br />
oder Polen und Polinnen. Den Nationalsozialisten ist es gelungen, eine rassistisch<br />
hierarchisierte Gesellschaft aufzubauen, die im Sinne der Machthaber „sehr gut“<br />
funktioniert hat. Sie hat unter aktiver Beteiligung eines Teils der Bevölkerung funktioniert, zumindest<br />
aber unter Billigung einer Mehrheit, ohne dass es notwendig war, sich selbst daran<br />
zu aktiv zu beteiligen.<br />
Haben ehemalige ZwangsarbeiterInnen in Österreich bisher Entschädigung erhalten?<br />
Meines Wissens nicht. Es haben nur jene eine Entschädigung erhalten, die österreichische<br />
StaatsbürgerInnen waren. Sie haben ihre Haftzeiten entschädigt bekommen, nicht aber die<br />
Arbeitsleistung, die sie damals erbracht haben. Die zivilen AusländerInnen und auch alle<br />
anderen Gruppen wurden von österreichischer Seite weder für die Haftzeiten noch für die<br />
Arbeit entschädigt, die sie geleistet haben. Einige österreichische Firmen haben allerdings<br />
nun die Bereitschaft bekundet, den ehemals bei ihnen beschäftigten ZwangsarbeiterInnen<br />
eine Entschädigung zu zahlen.<br />
Warum und auf Grund welcher Rechtslage wurden sie bisher nicht entschädigt?<br />
Österreich hat sich erstens nie als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches gesehen, was<br />
formal auch dem Völkerrecht entspricht. Allerdings hat man auch keine moralische<br />
Verpflichtung gesehen, die wird erst jetzt, zumindest verbal, übernommen, weil auch der<br />
internationale Druck größer geworden ist. Ansonsten haben sich die Firmen ja nie rechtfertigen<br />
müssen. Ihre Antworten auf entsprechende Anfragen von ehemaligen ZwangsarbeiterInnen<br />
waren teilweise sehr zynisch. Zum Beispiel hat eine Baufirma auf die Anfrage<br />
eines KZ-Häftlings geantwortet: „Wir haben ohnehin für Ihre Arbeitskraft an die SS<br />
bezahlt, daher sehen wir uns außerstande, Ihnen etwas zu zahlen.“ So in dieser Art lauteten<br />
die Antworten von Firmen. Es hat im Grunde überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gegeben,<br />
weder bei den Firmen noch in der Öffentlichkeit. Und ich befürchte, auch bei der<br />
jetzigen Debatte wurde bisher viel zu wenig vermittelt, welches Unrecht diesen Menschen<br />
angetan wurde.<br />
Warum wird gerade jetzt die Frage nach der Verantwortung österreichischer Unternehmen<br />
und der Entschädigung von Zwangsarbeit gestellt?<br />
Ich glaube, dass hier mehrere Faktoren ganz wesentlich sind: Erstens einmal die völlig veränderte<br />
politische Situation in Europa durch das Ende des Kalten Krieges, durch die<br />
Ostöffnung, was ganz andere politische Kontakte möglich gemacht hat. Bis dahin lautete<br />
die Begründung ja immer: „Bis zu einem Friedensvertrag wird mit diesen Ländern über<br />
diese Fragen nicht verhandelt.“ Der zweite und meiner Meinung nach wichtigste Grund ist<br />
die Möglichkeit, die das amerikanische Recht geboten hat, mit sogenannten class actions,<br />
also ➤ Sammelklagen, gegen die Firmen vorzugehen. Das ist im Zusammenhang mit der<br />
50 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
internationalen Entwicklung der Globalisierung zu sehen. Es gibt kaum eine größere österreichische<br />
Firma, die nicht irgendetwas mit den USA zu tun hat. Sobald es eine Geschäftsverbindung<br />
gibt, kann eine solche Klage in den USA eingebracht werden. Das sind meiner<br />
Meinung nach die zentralen Gründe, warum die Entschädigungsfrage heute debattiert<br />
wird. Der letzte Grund ist auch im Zusammenhang mit dem Generationswechsel zu sehen.<br />
Die Kriegsgeneration ist heute in einem sehr hohen Alter, gleichzeitig ist aber eine jüngere<br />
Generation nachgekommen, die einfach sagt: „Das ist Unrecht, darüber muss man reden,<br />
und es muss – auch im Nachhinein und auch, wenn es nur symbolisch ist – entschädigt<br />
werden.“ Das ist eine, wenn man so will, „zornige“ jüngere Generation, die keine großen<br />
Rücksichten auf Empfindlichkeiten nimmt, auch nicht auf Empfindlichkeiten in Österreich.<br />
Ich glaube, diese Gründe haben eigentlich erst bewirkt, dass auch in Österreich langsam<br />
eine solche Diskussion vorankommt. Ich befürchte nur, vor den Wahlen im Herbst 1999<br />
wird in dieser Hinsicht nichts mehr passieren, und nach den Wahlen wird alles wieder<br />
offen sein.<br />
Einige österreichische Unternehmen haben nun Forschungsteams eingesetzt,<br />
die das Ausmaß von Vermögensentzug durch Zwangsarbeit erforschen sollen.<br />
Werden die Ergebnisse dieser Teams eine Grundlage für künftige<br />
Entschädigungsleistungen liefern?<br />
Genau darum geht es. Ich glaube, die klügeren Firmenmanagements haben erkannt, dass<br />
es besser ist, genau Bescheid zu wissen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Es<br />
muss garantiert sein, dass all diese Forschungsteams völlig unabhängig arbeiten und<br />
dass ihre Ergebnisse ohne jeden Eingriff, ohne jede Einflussnahme von Seiten der Firmen<br />
publiziert werden. Daher sind sehr interessante Ergebnisse zu erwarten. Für die Firmen<br />
geht es darum, in irgendeiner Weise mit dieser Situation umzugehen. Für die heutigen<br />
Firmen, zumindest für die großen Firmen, stellt sich das Problem, dass in der Regel der<br />
Imageschaden, der durch die langwierigen Diskussionen über diese Fragen entsteht, viel<br />
größer ist als das, was sie tatsächlich an Entschädigungen zahlen würden. Das ist das<br />
Hauptmotiv für die Firmen. Die großen Firmen müssten eigentlich Interesse an einer einvernehmlichen<br />
Regelung dieser Fragen haben. Aber einige Firmen stecken halt den Kopf<br />
in den Sand und lassen es auf Klagen ankommen. Das halte ich allerdings für keine sehr<br />
kluge Strategie.<br />
Welcher Unterschied besteht zwischen der von der Regierung eingesetzten<br />
Historikerkommission und den von Firmen finanzierten Forschungsteams?<br />
Zwischen den von Firmen finanzierten Forschungsteams und der Historikerkommission liegt<br />
der Unterschied in der Dimension. Die Untersuchungen zu einzelnen Firmen behandeln<br />
Spezialfragen, an deren Beispiel man allerdings sehr viel an allgemeinen Vorgängen auf<br />
diesem Gebiet aufzeigen kann. Die österreichische Historikerkommission muss demgegenüber<br />
sehr viel umfassender an die Frage herangehen, weil auch Vorgänge betroffen sind,<br />
mit denen die Firmen nur zum Teil etwas zu tun hatten, und die man in einem größeren<br />
Zusammenhang sehen muss. Das betrifft jede Form von „Arisierung“, Enteignung von<br />
Grundstücken, also Immobilien, Enteignung von betrieblichem Eigentum. Es betrifft genauso<br />
Berufsverbote, es betrifft die nationalen Minderheiten und deren teilweise oder völlige Enteignung,<br />
wie zum Beispiel die Roma und Sinti. In einem allgemeineren Sinn betrifft das<br />
auch die Zwangsarbeit. Von Seiten der Historikerkommission hat man ein Interesse daran,<br />
zum Beispiel das Thema Zwangsarbeit in der Landwirtschaft aufzuarbeiten, weil klar ist,<br />
dass kein noch so großer Gutsbetrieb ein eigenes Forschungsteam finanzieren kann. Das<br />
ist natürlich eine staatliche Angelegenheit, ebenso wie die Erhebung österreichweiter Zahlen,<br />
die Analyse der damaligen Rechtsvorschriften und ihrer Umsetzung. Daher ist es meines<br />
Erachtens absolut notwendig, die Frage der Zwangsarbeit im Rahmen der Historikerkommission<br />
zu untersuchen.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Florian Freund<br />
51
Zwangsarbeit in Österreich<br />
Befinden sich die Historikerkommission und die Forschungsteams nicht in einem<br />
Konflikt zwischen komplexen Erklärungsmodellen der historischen Forschung<br />
einerseits und andererseits der Erwartung der Öffentlichkeit, dass es klare,<br />
eindeutige Fakten und Zahlen geben wird?<br />
Ich glaube, man muss beides verbinden, und es ist auch die Aufgabe der HistorikerInnen,<br />
die für die Kommission arbeiten werden, dass sie sich eben nicht nur auf das eine oder<br />
auf das andere beschränken. Es ist eine klassisch historische Arbeit gefordert, wobei natürlich<br />
ein Schwerpunkt auf der Recherche von sogenannten Fakten liegen wird: Wie hoch<br />
war der Vermögensentzug da oder dort? Wie und wieviel wurde nach 1945 rückgestellt<br />
und entschädigt? Es geht also um die berühmten „W-Fragen“ – wer, wie, wo, was, wann,<br />
warum –, dazu gehören aber auch komplexe Analysen. Dieselben Fragen muss man für<br />
die Zweite Republik untersuchen. Und da gehört wiederum beides dazu: Auf der einen<br />
Seite steht die reine Faktizität – wieviel wurde denn eigentlich zurückgegeben? Und auf<br />
der anderen Seite die Erklärung, warum wurde was zurückgegeben oder nicht zurückgegeben,<br />
warum wurde entschädigt und warum nicht. Das sind alles Fragen, die man<br />
klären muss, und insofern findet diese Teilung zwischen Faktizität und Theorie eigentlich<br />
nicht statt. Es soll eine solide historische Arbeit geleistet werden. Es ist allerdings eine sehr<br />
eingeschränkte Fragestellung, die Frage des Vermögensentzugs ist nicht eine Geschichte<br />
des Nationalsozialismus in Österreich, sondern sie ist ein Teil dieser Geschichte. Und ich<br />
befürchte, dass alle anderen Bereiche der Geschichte des Nationalsozialismus in Österreich<br />
weiterhin eben nicht erforscht werden. Ich befürchte, dass man nach dem Endbericht<br />
der Historikerkommission erst recht keine Forschungsprojekte zum Thema Nationalsozialismus<br />
mehr fördern wird. Es gibt aber noch viele offene Fragen, z.B. ist die ganze NS-Täterseite<br />
noch nicht erforscht. Es gibt hunderte ganz wichtige Fragen, die international bereits<br />
diskutiert werden und die in Österreich seit Jahrzehnten in der Forschung blockiert sind,<br />
weil es dafür keine Finanzierung gibt und weil die Widerstände in der Politik in den<br />
letzten Jahrzehnten viel zu groß waren. Die Ausrede wird dann sein: „Jetzt haben wir eh<br />
schon so viel Geld in eine Historikerkommission investiert, jetzt muss einmal etwas anderes<br />
gemacht werden.“<br />
Gibt es in der Bundesrepublik Deutschland schon Modelle für Entschädigungen für<br />
ZwangsarbeiterInnen?<br />
Dort wird diese Frage schon wesentlich konkreter verhandelt als bei uns. In Deutschland<br />
sind zwei verschiedene Fonds in Diskussion, die man bis zum 1. September einrichten will.<br />
Ein Fonds soll von Firmen finanziert werden und ist für die Personen gedacht, die bei<br />
diesen Firmen Zwangsarbeit geleistet haben. Ein weiterer Fonds wird voraussichtlich von<br />
der deutschen Regierung eingerichtet für die ehemaligen ZwangsarbeiterInnen, für die<br />
keine Firmengelder vorhanden sind. Man verhandelt derzeit über die Höhe der Entschädigungssumme,<br />
die zwischen 5000 und 10.000 Mark liegen soll und die direkt an die<br />
ehemaligen ZwangsarbeiterInnen ausbezahlt werden wird. Es gibt allerdings noch eine<br />
Menge juridischer Probleme, weil die Firmen natürlich eine Konstruktion finden wollen, mit<br />
der sie künftigen Klagen entgehen können.<br />
Welche Möglichkeiten der finanziellen Entschädigung für Zwangsarbeiter –<br />
Individualentschädigung, Globalentschädigung, eine symbolische Summe oder die<br />
Auszahlung der Lohndifferenz – werden derzeit in Österreich diskutiert?<br />
Es kann letztendlich ja nur um symbolische Summen gehen. Wie will man etwa eine<br />
Zwangsarbeiterin entschädigen, die hier ein Kind bekommen hat, das ihr nach der Geburt<br />
weggenommen wurde, das man mit Absicht in sogenannten Kinderheimen für „Ostarbeiterinnen“<br />
verhungern oder sonst irgendwie zu Tode kommen hat lassen? Wie will man solche<br />
Dinge entschädigen? Es kann immer nur um symbolische Summen gehen. Und ich glaube,<br />
das sollte auf jeden Fall in Form einer Individualentschädigung geschehen, die direkt an<br />
die einzelnen Betroffenen geht. Stellen Sie sich einmal vor, was es für ehemalige Zwangs-<br />
52 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
arbeiterInnen bedeutet, die heute in der Ukraine, in Polen oder anderswo im Elend leben<br />
und fast keine Pensionen bekommen, wenn ihnen jetzt in Devisen eine bestimmte Summe<br />
ausbezahlt wird. Dann können sie wenigstens jetzt, im hohen Alter, vernünftig leben. Das<br />
sollte man auf jeden Fall machen und nicht zu lange warten, denn mit jeder Woche, die<br />
man noch wartet, sterben wieder einige. Diese Strategie, alles in die Länge zu ziehen,<br />
weil das billiger kommt – nach der alten Devise seit 1945, wie Robert Knight in seinem<br />
Buch „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen …“ bereits nachgewiesen hat –,<br />
empfinde ich als ziemlich schäbig.<br />
Dr. Florian Freund ist Historiker, Univ.Lektor am Institut für<br />
Zeitgeschichte der Universität Wien,<br />
Forschungsschwerpunkte: Kriegswirtschaft, Zwangsarbeit,<br />
Konzentrationslager, Verfolgung der österreichischen<br />
Roma und Sinti im Nationalsozialismus<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Florian Freund<br />
53
Roma und Sinti<br />
Sterilisationsopfer<br />
„Euthanasie“-Opfer<br />
„Asoziale“<br />
Leben im Verborgenen<br />
Frauen im Widerstand<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Die vergessenen Opfer<br />
Das folgende Kapitel umfaßt Texte, die sich mit jenen Gruppen von Opfern des Nationalsozialismus<br />
auseinandersetzen, deren Erfahrungen und Leid lange Jahre in Österreich<br />
tabuisiert wurden: die sogenannten U-Boote, Roma und Sinti sowie andere ethnische<br />
Minderheiten, ZeugInnen Jehovas, Homosexuelle, Vertriebene, Opfer von Sterilisation und<br />
➤ „Euthanasie“ sowie als „asozial“ Verfolgte.<br />
Diese Gruppen wurden sowohl aus sogenannten rassischen oder politischen, religiösen<br />
Gründen, aufgrund sexueller Orientierung oder „fehlender Anpassung“ diskriminiert und<br />
verfolgt. Als Grundlage für ihre Verfolgung, Vertreibung und Ermordung dienten die<br />
➤ „Nürnberger Rassengesetze“ von 1935, die 1938 auch für Österreich Gültigkeit erlangten,<br />
sowie die nationalsozialistische Erbgesundheitspolitik – am 1.1. 1940 trat in Österreich<br />
etwa das ➤ „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft.<br />
Die Biographie von Betty Voss verdeutlicht, welche entscheidende Rolle die Gesundheitsund<br />
Fürsorgeämter als verlängerter Arm der Verfolgungsbehörden einnahmen, bei der Initiierung<br />
von Entmündigungsverfahren und Zwangspsychiatrierung sowie der Einweisung in<br />
Arbeitshäuser und Konzentrationslager.<br />
Auch die Überstellung von Kindern und Jugendlichen in NS-Erziehungslager und NS-<br />
Erziehungsanstalten erfolgte vielfach durch Registratur und Beurteilung von Fürsorgerinnen.<br />
In welchem Ausmaß Kinder und Jugendliche in derartigen Einrichtungen zu sogenannten<br />
medizinischen Forschungszwecken herangezogen, Opfer von Zwangssterilisation und<br />
„Euthanasie“ wurden, belegen die leidvollen Erfahrungen der ehemaligen „Kinder vom<br />
Spiegelgrund“.<br />
Während einige Texte im nachfolgenden Kapitel die Verfolgung während des Nationalsozialismus<br />
untersuchen, liegt der Schwerpunkt anderer Darstellungen auf dem Umgang<br />
Österreichs mit den Opfern nach 1945. Diese Auswahl soll die Kontinuitäten von Vorurteilen<br />
und Ausgrenzung deutlich machen. Die Stigmatisierung von Roma und Sinti oder<br />
sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen als „asozial“ und „arbeitsscheu“ wie auch die<br />
Kriminalisierung von Homosexualität stellten keine nationalsozialistische Erfindung dar. Und<br />
auch die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung als Opfer nach 1945 erfolgte nicht aufgrund<br />
tatsächlicher Verfolgung und den psychischen und physischen Folgeschäden, sondern<br />
nach den weiterhin wirksamen Grundsätzen rassen- und erbbiologischer Ideologie der<br />
NS-Zeit. Die Geschichte der ➤ Opferfürsorgegesetzgebung (siehe viertes Kapitel) verdeutlicht<br />
dies eindrücklich.<br />
Über die Errichtung des ➤ Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus<br />
1995 wurden diese bislang in der Opferfürsorgegesetzgebung entweder unberücksichtigten<br />
oder in unzureichendem Ausmaß berücksichtigten Opfergruppen als solche<br />
anerkannt.<br />
Die folgenden Texte mögen das Ausmaß und die Konsequenzen der Verfolgung veranschaulichen<br />
sowie das vielfach fortgesetzte Leid der ehemaligen Opfer durch ihre<br />
langjährige Nichtanerkennung.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
55
BEINAHE VERGESSENE OPFER – ROMA UND SINTI<br />
BRIGITTE BAILER-GALANDA<br />
„Arbeitsscheu<br />
und asozial“<br />
„Lösung der<br />
Zigeunerfrage“ –<br />
Das Lager<br />
Lackenbach<br />
Die Verfolgung der Roma und Sinti durch das nationalsozialistische Regime wird bis heute<br />
von einer breiteren Öffentlichkeit kaum, von der zeitgeschichtlichen Forschung nur nach<br />
und nach zur Kenntnis genommen, 1 obschon das Vorgehen der nationalsozialistischen Verfolger<br />
gegen die österreichischen „Zigeuner“ 2 in seinen Grundzügen der Verfolgung der Juden<br />
gleicht. Sofort nach dem „Anschluß“ 1938 erfolgten Schulbesuchs- und Berufsverbote,<br />
aufgrund eines Runderlasses des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei Heinrich<br />
➤ Himmler wurden alle „Zigeuner“ durch die Polizeibehörden registriert. 1939 setzten die<br />
ersten umfangreichen Verhaftungsaktionen ein. Aufgrund einer Weisung des Reichskriminalamtes<br />
Berlin wurden Männer mit ihren Söhnen unter dem Vorwand, sie seien arbeitsscheu<br />
und daher „asozial“, in verschiedene Konzentrationslager gebracht. Diese Etikettierung als<br />
„arbeitsscheu und asozial“ bereitete den ehemaligen Häftlingen nach 1945 beträchtliche<br />
Schwierigkeiten mit den Opferfürsorgebehörden. Im Juni 1939 wurden 440 Frauen aus<br />
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ins neu errichtete Frauenkonzentrationslager<br />
Ravensbrück eingewiesen. 3 In den Konzentrationslagern wurden an den Roma und Sinti<br />
Zwangssterilisationen und medizinische Experimente vorgenommen, an deren physischen<br />
und psychischen Folgeschäden die Überlebenden bis heute leiden, 4 auch wenn die Gutachter<br />
in Opferfürsorgefällen dies nicht wahrhaben wollen. 5 Mit Runderlaß des ➤ Reichssicherheitshauptamtes<br />
vom 17. Oktober 1939 wurde angeordnet, daß die Roma und Sinti ihren<br />
Aufenthaltsort ab Ende Oktober ohne polizeiliche Erlaubnis nicht mehr verlassen durften. 6<br />
Ende 1940 wurde die Ausgrenzung und Gettoisierung in eigenen Lagern vollzogen – neben<br />
zahlreichen kleineren Lagern vor allem im burgenländischen ➤ Lackenbach und im Vorort<br />
der Stadt Salzburg, Maxglan. 7 Im November 1941 wurden 5007 österreichische „Zigeuner“,<br />
davon mehr als die Hälfte Kinder, ins Getto von Lodz deportiert und von dort aus wenig<br />
später in den Gaskammern von ➤ Chelmno (Kulmhof) getötet. 8 Im Frühjahr 1943 wurden<br />
tausende Roma und Sinti aus den von Deutschland besetzten Ländern, auch aus Österreich,<br />
ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert und dort in der Nacht vom 2. auf den 3. August<br />
1944 in den Gaskammern von Birkenau ermordet. 9 Zuvor, 1942, waren die im Burgenland<br />
seßhaft gewesenen Familien zum Verkauf ihrer Grundstücke und Häuser gezwungen<br />
worden, ihr Besitz wurde gleichsam ➤ „arisiert“, da – wie der Landrat in Oberwart in einem<br />
Rundschreiben feststellte – „mit einer weiteren Lösung der Zigeunerfrage zu rechnen“ sei. 10<br />
Einen besonderen Stellenwert im Kampf der Roma und Sinti um volle Anerkennung als<br />
Opfer des Nationalsozialismus nahm das burgenländische Lager Lackenbach ein. Offiziell<br />
am 23. November 1940 gegründet, 11 unterstand das Lager der Kriminalpolizeileitstelle<br />
Wien. Die Lagerleitung oblag gleichfalls Beamten der Kriminalpolizei, die jedoch „aufgrund<br />
ihrer Funktion einen SS-Rang hatten“. 12 Erster Kommandant war SS-Obersturmführer<br />
Kohlroß, er starb bei der 1942 in Lackenbach ausgebrochenen Flecktyphusepidemie, sein<br />
Stellvertreter war der später zur Waffen-SS einberufene Polizeibeamte Franz Langmüller,<br />
der 1948 von einem Wiener Volksgericht wegen „Quälerei und Mißhandlung der Lagerinsassen“<br />
verurteilt wurde. 13 Das Lager selbst war in einem größeren Meierhof untergebracht,<br />
die Häftlinge mußten anfänglich in Ställen und später in rasch errichteten Baracken<br />
hausen, wo keinerlei sanitäre Einrichtungen für die vielen hundert Menschen zur Verfügung<br />
standen. Die Ernährungssituation war katastrophal. Im Sommer 1941 war der Lagerbrunnen<br />
ausgeschöpft, die Inhaftierten mußten ihr Trinkwasser dem nahegelegenen Bach entnehmen.<br />
Der Flecktyphusepidemie 1942 fielen zahlreiche Lagerinsassen zum Opfer. Alle<br />
arbeitsfähigen Häftlinge, auch Kinder, wurden entweder an Bauern oder an Unternehmen<br />
als Arbeitskräfte vermietet oder mußten im Lager selbst diverse Arbeiten verrichten. Den<br />
Arbeitslohn erhielt die Lagerverwaltung, die davon den Insassen nur einen kleinen Teil als<br />
„Taschengeld“ ausbezahlte, der Rest wurde für „Verköstigung und Unterbringung“ abgezogen.<br />
Bei Verstößen gegen die Lagerordnung wurden verschiedene Strafen verhängt: Einzelhaft<br />
im „Bunker“, Prügel, strafweises Knien für die Kinder oder auch Essensentzug. Erst als<br />
56 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
SS-Untersturmführer Julius Brunner die Leitung des Lagers übernahm, wurde die Situation<br />
der Häftlinge etwas besser. 14<br />
Die Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie hatten nach 1945<br />
wieder mit denselben Vorurteilen und Vorbehalten zu kämpfen wie vor und während der<br />
NS-Zeit. Sie waren und blieben die „Fremden“, deren Kultur und Lebensweise man<br />
mißtrauisch und ablehnend gegenüberstand, die zu verstehen man sich – abseits romantischer<br />
Klischees – nicht die Mühe machte, obwohl zahlreiche Familien bereits seit mehreren<br />
Generationen beispielsweise im Burgenland ansässig gewesen waren. Nur die Hälfte bis<br />
zu zwei Drittel der Verschleppten kehrte im Burgenland in ihre Heimatgemeinden zurück. 15<br />
Ihre Familien- und Gruppenstrukturen, die in der Kultur der Roma und Sinti besondere Bedeutung<br />
besitzen, hatte der Nationalsozialismus in vielen Fällen zerstört. Bei den Behörden<br />
und Ämtern waren sie nach wie vor Diskriminierungen ausgesetzt, nicht einmal die Ausdrucksweise<br />
hatte sich seit der NS-Zeit wesentlich geändert. Aus der „Zigeunerplage“ war<br />
das „Zigeunerunwesen“ geworden. So stellte die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit<br />
in Wien 1948 fest, „daß das Zigeunerunwesen in einigen Gegenden des Bundesgebietes<br />
wieder im Zunehmen begriffen“ sei „und sich bereits unangenehm bemerkbar“<br />
mache. „Um auf die Bevölkerung Eindruck zu machen, sollen sich Zigeuner oftmals als KZler<br />
ausgeben. Soweit die Voraussetzungen nach der Ausländerpolizeiverordnung gegeben<br />
erscheinen und die Möglichkeit einer Außerlandschaffung besteht, wäre gegen lästige Zigeuner<br />
mit der Erlassung eines Aufenthaltsverbotes vorzugehen und ihre Außerlandschaffung<br />
durchzuführen.“ 16 Bereits Tobias Portschy, burgenländischer Landeshauptmann nach<br />
dem „Anschluß“, hatte 1938 die beste „Lösung der Zigeunerfrage“ in deren „freiwilliger<br />
Abwanderung ins Ausland“ gesehen. 17<br />
Bezeichnend für die Haltung von Gemeinden und Behörden gegenüber den zurückgekehrten<br />
Roma und Sinti ist folgender Fall: Der burgenländische Landarbeiter I. H. wurde bereits<br />
im Juli 1938 in ein Konzentrationslager gebracht. Sein bescheidenes Haus wurde niedergerissen,<br />
die Möbelstücke verschwanden, das übriggebliebene Baumaterial gleichfalls.<br />
Nach seiner Rückkehr verlangte H. von seiner Heimatgemeinde St. Margarethen im Wege<br />
der ➤ Rückstellungsgesetzgebung Ersatz für sein verlorengegangenes Eigentum. Sein Antrag<br />
wurde abgelehnt, in der Begründung des Rückstellungserkenntnisses wird ausgeführt: „Die<br />
Gemeinde St. Margarethen als Antragsgegnerin beantragt Abweisung des Rückstellungsantrages<br />
und wendet ein, daß der Antragsteller ein Haus nicht besaß, sondern nur eine primitive<br />
Unterkunft in einem Erdloch bzw. einer Bretterbude. Desgleichen hätte der Antragsteller<br />
niemals Möbel besessen. Außerdem sei die Aktion gegen die Zigeuner nicht von der Gemeinde<br />
St. Margarethen ausgegangen, sondern von einer Dienststelle der NSDAP. Schließlich<br />
hätte sich die Gemeinde aus dem Baumaterial des Antragstellers überhaupt nichts angeeignet.<br />
Außerdem sei dem Antragsteller von der Gemeinde eine Wohnung zur Verfügung<br />
gestellt worden. Richtig ist, daß Zigeuner zum Kreise der politisch verfolgten Personen<br />
zählen, und erwiesen ist, daß auch der Antragsteller aus der Zigeunersiedlung St. Margarethen<br />
von der ➤ SS in ein KZ verbracht wurde und daß bei dieser Verschleppung der Zigeuner<br />
die Siedlung in Brand aufging. (...) Durch die Auskunft des Amtes der burgenländischen<br />
Landesregierung steht fest, daß die in der Gemeinde St. Margarethen gegen Zigeuner<br />
getroffene Maßnahme keine Aktion seitens der Gemeinde darstellt, sondern auf Grund<br />
der Anordnungen übergeordneter Parteien oder staatlicher Dienststellen zurückzuführen<br />
sind. Durch die Aussage des Zeugen Paul Unger, der Bürgermeister bis zur Machtergreifung<br />
des NS in St. Margarethen gewesen ist, ist erwiesen, daß Antragsteller (sic!) nur eine Hütte<br />
hatte, die mit Holzläden bedeckt war. Durch diesen Zeugen ist aber auch erwiesen, daß<br />
das wenige Material, das nach dem Brand des Zigeunerlagers übrig blieb, von den Ortsbewohnern<br />
als Lohn für die Beseitigung des Lagers in Empfang genommen wurde. Weiters ist<br />
durch diesen Zeugen erwiesen, daß die Zigeuner eine Wohnungseinrichtung überhaupt<br />
nicht besaßen, in einem Bett schlief nur der Zigeunerprimas. Diese Aussage wird von dem<br />
Zeugen Karl Unger, der Bürgermeister während der nationalsozialistischen Aera gewesen<br />
ist, bestätigt. (...) Lediglich der Zeuge Michael Barta gibt in seiner Aussage als Zeuge an,<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
57<br />
Von der<br />
„Zigeunerplage“<br />
im NS zum<br />
„Zigeunerunwesen“<br />
nach 1945
Mangelnde<br />
Aufklärung und<br />
Angst vor<br />
Umgang mit den<br />
Behörden<br />
Beinahe vergessene Opfer – Roma und Sinti<br />
daß er dem Antragsteller ein Haus in der Größe von 4 mal 4 m aufbauen half.“ 18 Die in<br />
diesem Erkenntnis zum Ausdruck kommende offensichtlich hohe Glaubwürdigkeit, die Aussagen<br />
ehemaliger NS-Funktionäre seitens der Gerichte und Behörden der Zweiten Republik<br />
zugebilligt wurde, findet sich auch in den Beweiswürdigungen der Opferfürsorgebehörden.<br />
Viele der Roma und Sinti scheuten nach Kriegsende Bemühungen um Leistungen nach<br />
dem ➤ Opferfürsorgegesetz, da sie – wie Erika Thurner wohl zu Recht vermutet – den Umgang<br />
mit Behörden fürchteten. Andererseits muß berücksichtigt werden, daß das Opferfürsorgegesetz<br />
vorwiegend nur jenen Menschen bekannt war, die sich in einem der Opferverbände<br />
organisiert hatten oder über Kontakt zu einem solchen Verband verfügten. Außerhalb<br />
der Publikationen der Verbände wurde in den Medien nur wenig über die Gesetzgebung<br />
zugunsten der Opfer berichtet. So könnten zahlreiche Anträge von Sinti und Roma<br />
auch an mangelnder Information gescheitert sein. Doch jene, die den Gang zu den Behörden<br />
auf sich nahmen, sahen sich dort wieder mit Vorurteilen konfrontiert. So schreibt der<br />
„Neue Mahnruf“, der sich ab Beginn der fünfziger Jahre der Anliegen der „Zigeuner“ annahm,<br />
1953: „Die Zigeuner gelten als rassisch Verfolgte und haben daher den Anspruch<br />
darauf, genau so behandelt zu werden wie alle anderen Personen, die aufgrund der<br />
Opfer- und Entschädigungsgesetze irgendwelche Ansprüche stellen können. (...) Es sind uns<br />
aber Fälle bekannt, (...) wo manche Behörden glauben, mit unbegründeten Ausflüchten berechtigte<br />
Ansprüche von Zigeunern abtun zu können, oder die Unkenntnis dieser Personen<br />
dazu ausnützen, sie um Ansprüche bringen zu können.“ 19 Und als 1957 in Oberwart und<br />
Pinkafeld Informationsabende des ➤ KZ-Verbandes über die Opferfürsorgegesetzgebung<br />
stattfanden, mußte die Referentin „mit Erstaunen feststellen“, „daß die burgenländischen<br />
Kameraden, die Zigeuner sind, sehr niedrige Renten beziehen und nicht jene Leistungen<br />
gewährt werden, auf die nach dem Opferfürsorgegesetz Anspruch besteht“. 20 Auch im offiziellen<br />
Kommentar zum Opferfürsorgegesetz vom zuständigen Ministerialrat des Bundesministeriums<br />
für soziale Verwaltung, Dr. Burkhart Birti, findet sich im Stichwortverzeichnis<br />
kein Hinweis auf die „Zigeuner“, auch bei den allgemeinen Erläuterungen zum Personenkreis<br />
der „rassisch“ Verfolgten werden sie nicht erwähnt. Erst bei den Erläuterungen zur<br />
Haftentschädigung kommen auch die „Zigeuner“ vor, und es wird auf die oben erwähnten<br />
Runderlässe des Reichsführers SS und des ➤ Reichssicherheitshauptamtes verwiesen. 21<br />
Roma und Sinti, die außer in Lackenbach noch in anderen Konzentrationslagern inhaftiert<br />
gewesen waren, hatten bescheidene Chancen, einen ➤ Opferausweis oder eine ➤ Amtsbescheinigung<br />
nach Opferfürsorgegesetz zu erhalten, meist jedoch mußten sich diese Opfer<br />
der rassistischen Verfolgung mit einem für sie ziemlich nutzlosen Opferausweis begnügen –<br />
wie hätten sie einen Steuerabsetzbetrag nutzen sollen? Anträge auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung<br />
hingegen scheiterten sehr oft daran, daß das Lager Lackenbach nicht als<br />
Haftstätte gemäß Opferfürsorgegesetz anerkannt wurde. Bereits im November 1952 verfaßten<br />
ehemalige Häftlinge des Lagers eine Niederschrift über den Charakter des Lagers.<br />
Der KZ-Verband nahm sich in der Folge der Anliegen der ehemaligen Lackenbacher an. In<br />
einem Vermerk des Verbandes wurde darauf hingewiesen, daß die Opferfürsorgekommission<br />
sich in einer ihrer nächsten Sitzungen mit dem Problem befassen werde. „Von seiten unseres<br />
Verbandes wird alles unternommen werden, um die Anerkennung des Lagers Lackenbach<br />
durchzusetzen. Es ist uns aber bekannt, und das wollen wir nicht verschweigen, daß<br />
das Finanzministerium und das Sozialministerium gegen die Anerkennung des Lagers<br />
Lackenbach sind, da in diesem Lager vor allem Zigeuner in Haft waren und nach Meinung<br />
der beiden Ministerien die Zigeuner eigentlich nicht als Opfer der Verfolgung zu betrachten<br />
sind.“ 22 Diese übertrieben klingende Behauptung erfährt ihre Bestätigung jedoch in der<br />
Wortwahl eines Bescheides des Sozialministeriums, 23 mit dem der Antrag eines ehemaligen<br />
Lackenbacher Häftlings auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung abgelehnt worden war:<br />
„Was hingegen den vom Beschwerdeführer behaupteten Haftcharakter seiner Anhaltung im<br />
Lager Lackenbach betreffe, habe das belangte Bundesministerium durch Einsicht in die<br />
betreffenden Akten des Bundesministeriums für Inneres (Generaldirektion für die öffentliche<br />
Sicherheit) festgestellt, daß es sich im Falle des Beschwerdeführers keinesfalls um eine Haft<br />
58 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
im Sinne des Opferfürsorgegesetzes gehandelt haben könne. Insbesondere entspreche die<br />
Behauptung des Beschwerdeführers, daß das Lager Lackenbach der ➤ Gestapo unterstellt<br />
gewesen sei, nicht den Tatsachen. In Wahrheit habe es vielmehr der Kriminalpolizeileitstelle<br />
unterstanden. In diesem Lager seien hauptsächlich arbeitslos herumziehende Zigeuner, die<br />
eine Gefahr für das Eigentum dritter Personen darstellten, zusammengefaßt worden, um sie<br />
einer geregelten Arbeit zuführen zu können. Sie seien demnach nicht nach Art von Häftlingen<br />
festgehalten, sondern im Einverständnis mit dem Arbeitsamt den Landwirten zur<br />
Arbeitsleistung zugewiesen worden, wo man sie untertags verpflegt und im Stundenlohn<br />
entlohnt habe. (...) Die Ordnung im Lager sei durch Stammesgenossen (‚Zigeunerkönige‘)<br />
ausgeübt worden, welche die Lagerleitung (zwei Kriminalbeamte der Kripoleitstelle Wien)<br />
zu unterstützen hatten. (...) Lackenbach sei somit kein Konzentrationslager, sondern ein<br />
Arbeitslager gewesen.“ 24 Die hier vom Gerichtshof referierte Ausdrucksweise des Sozialministeriums<br />
ist insoferne mehr als bemerkenswert, als sie sich wörtlich mit der Denkschrift des<br />
burgenländischen Gauleiters Dr. Tobias Portschy über die Zigeunerfrage deckt. Portschy<br />
war darin nämlich zu dem Schluß gekommen: „In der großen Anzahl von fast 8000 Zigeunern<br />
als Nichtstuer, Arbeitsscheue, Lungerer und Verbrecher liegt die große Gefahr für die<br />
Sicherheit des Eigentums und für den wirtschaftlichen Bestand unserer Landgemeinden.“ 25<br />
Im Jahr 1958 kam die Frage nach dem Charakter des Lagers Lackenbach neuerlich vor<br />
den Verwaltungsgerichtshof, als ein ehemaliger Insasse des Lagers Lackenbach einen<br />
Bescheid des Amtes der burgenländischen Landesregierung anfocht. Der Beschwerdeführer<br />
hatte 1952 die Ausstellung einer Amtsbescheinigung beantragt, da er sich infolge der<br />
Haftbedingungen ein Herzleiden zugezogen hatte, „durch welches seine Arbeitsfähigkeit<br />
weitgehend herabgesetzt worden sei“. 26<br />
Dieser Antrag war abgelehnt worden, da „die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 lit. e OFG<br />
im Hinblick auf das Ausmaß der vorliegenden Gesundheitsschädigung nicht gegeben seien<br />
und die Anhaltung im ‚Arbeitslager Lackenbach‘ allein noch nicht anspruchsbegründend<br />
sei.“ 27 Aufgrund der Berufung des Beschwerdeführers wurde ein ausführliches Ermittlungsverfahren<br />
durchgeführt. Neben ehemaligen Insassen des Lagers wurden vor allem Lagerverantwortliche<br />
aus der NS-Zeit als Zeugen einvernommen: die Lagerbewachungsorgane Josef<br />
Leberl und Nikolaus Reinprecht, Josef Zenz, der für die Abrechnung der Arbeitsleistungen<br />
der Lagerinsassen verantwortlich gewesen war, Roman Neugebauer und Josef Hajek, die<br />
in der Lagerverwaltung tätig gewesen waren, Ignaz Schumeritsch, der für die „Durchführung<br />
eines Zigeunertransportes nach Lackenbach“ verantwortlich gewesen war, sowie<br />
der Lackenbacher Bürgermeister der NS-Zeit, Matthias Hlavin, und der damalige Landrat in<br />
Oberpullendorf, Dr. Friedrich Scheuerle. Außerdem berücksichtigte die Behörde das Strafverfahren<br />
gegen den ehemaligen stellvertretenden Lagerführer Langmüller und erhalten gebliebene<br />
Dokumente aus der NS-Zeit über das Lager. Letztendlich billigte die Behörde den<br />
Aussagen der Funktionäre der NS-Zeit höhere Glaubwürdigkeit zu als den ehemaligen<br />
Lagerinsassen. Insbesondere tauchte in den Aussagen der ehemaligen Lagerfunktionäre<br />
stets wieder die Behauptung auf, die Häftlinge hätten Urlaub beanspruchen können und<br />
sonntags zu Spaziergängen frei gehabt. Die ehemaligen Insassen des Lagers beschrieben<br />
diese Spaziergänge zwar als organisierte Märsche in den Wald zur Sammlung von Brennholz,<br />
28 doch das Argument des „Urlaubs“ wog in den Augen der Behörde schwer. Die<br />
Behörde kam zu dem Schluß: „Die belangte Behörde nahm aufgrund der Angaben der<br />
Zeugen Leberl, Neugebauer, Hajek und Hlavin als erwiesen an, daß die Lagerinsassen<br />
gelegentlich Urlaub und insbesondere an Sonntagen und nach der Arbeitszeit auch Ausgang<br />
erhielten, wobei sie Kinos und Bekannte besuchen konnten. Wohl seien die Angaben<br />
der ehemaligen Lagerinsassen über die Ausgangsmöglichkeiten vielfach widersprechend<br />
gewesen, auch habe der Zeuge R. (ehemals Bewachungsorgan) angegeben, daß es<br />
grundsätzlich keinen Ausgang oder Urlaub gegeben habe. Dem stünde aber die Aussage<br />
des Zeugen Neugebauer als ehemaligem Wirtschaftsführer im Lager gegenüber, der mit<br />
den Lagerverhältnissen aus eigener Wahrnehmung vertraut sei, weshalb im Hinblick auf<br />
die gleichlautenden Angaben der Zeugen Leberl, Hajek und Hlavin den Angaben des<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
59<br />
Lackenbach „nur“<br />
ein Arbeitslager?<br />
Die „Glaubwürdigkeit“<br />
ehemaliger<br />
NS-Funktionäre
Eingeschränkte<br />
Entschädigung für<br />
Sinti und Roma<br />
Beinahe vergessene Opfer – Roma und Sinti<br />
Zeugen Reinprecht keine entscheidende Bedeutung beigemessen werde. Die Glaubwürdigkeit<br />
der Aussagen der ehemaligen Lagerinsassen sei durch das persönliche Interesse an der<br />
Sache, welches auch Widersprüche mit den sonstigen Beweisergebnissen gezeitigt habe,<br />
gekennzeichnet, während gegen die Aussagen des Zeugen Neugebauer – derzeit im Ökonomiereferat<br />
der Polizeidirektion Wien tätig – keine solchen Bedenken bestünden.“ 29 Daß<br />
die ehemals für die Lagerverhältnisse Mitverantwortlichen gleichfalls schon aus Gründen<br />
der Schuldabwehr geneigt sein mußten, die Zustände in Lackenbach in möglichst positivem<br />
Licht erscheinen zu lassen, bedachte die Behörde offensichtlich nicht, während die Aussagen<br />
der ehemals betroffenen Roma und Sinti vorneweg als unglaubwürdig abgetan<br />
wurden. 30 Mit diesem Erkenntnis legte der Verwaltungsgerichtshof jedenfalls fest, daß es<br />
sich bei der „Anhaltung“ in Lackenbach keinesfalls um eine Haft gehandelt habe. 31 Daher<br />
konnten einerseits aufgrund von Anhaltungen in Lackenbach auftretende Gesundheitsschäden<br />
von den ehemals Inhaftierten nicht geltend gemacht werden – es war ihnen also auf<br />
diese Weise der Weg zu einer Amtsbescheinigung und damit zu Rentenfürsorge verschlossen<br />
–, andererseits konnten sie auch keine Haftentschädigung für die in Lackenbach zugebrachten<br />
Zeiten erhalten. Sie blieben von materiellen Leistungen des Opferfürsorgegesetzes<br />
bis auf weiteres ausgeschlossen. Erst die ➤ 12. Novelle 1961 sah Entschädigungen – die<br />
aber nur die Hälfte der Haftentschädigung ausmachten – für Freiheitsbeschränkungen vor.<br />
Unter diesem Begriff wurde dann auch das Lager Lackenbach subsumiert.<br />
Aufgrund der Nicht-Anerkennung des Lagers als Haftstätte kam es zu seltsamen Kapriolen<br />
der Behördenentscheidungen. Franz S. aus Klagenfurt hatte sich von November 1939 bis<br />
Mai 1945 als „Zigeuner“ in Haft befunden. In einem ersten Bescheid stellten die Kärntner<br />
Behörden fest, „daß die Anhaltung des Beschwerdeführers wegen mehrmaliger Übertretung<br />
des Verbotes des Umziehens nach Zigeunerart und nicht aus politischen bzw. rassischen<br />
Gründen erfolgt sei“. 32 Aufgrund seiner Berufung wurde Franz S. schließlich eine Entschädigung<br />
für die Zeit bis 30. September 1941 zuerkannt, für die Zeiten, die er in sogenannten<br />
„Zigeunerlagern“, darunter auch Lackenbach, zubringen hatte müssen, jedoch nicht – eine<br />
Entscheidung, die auch der Verwaltungsgerichtshof bestätigte. Folgt man dieser Logik, wäre<br />
Franz S. ab Oktober 1941 quasi frei gewesen, denn die Haft endete mit September 1941!<br />
Aufgrund langjähriger Bemühungen der Opferverbände und engagierter Historiker/innen<br />
wurde das Opferfürsorgegesetz 1988 dahingehend geändert, daß nunmehr die ehemaligen<br />
Insassen von Lackenbach auch eine Amtsbescheinigung, und damit Rentenfürsorge erhalten<br />
können: „Opfern der politischen Verfolgung (…), die eine Freiheitsbeschränkung in<br />
der Dauer von mindestens einem halben Jahr erlitten haben, ist an Stelle eines Opferausweises<br />
eine Amtsbescheinigung auszustellen.“ 33 Die Möglichkeit zur Erlangung eines Opferausweises<br />
infolge erlittener Freiheitsbeschränkungen war gleichfalls sehr spät in das<br />
Opferfürsorgegesetz aufgenommen worden, und zwar mit der 23. Novelle aus 1975. 34<br />
Doch nicht nur in der Bewertung des Charakters von Lackenbach wurden weiterwirkende<br />
Vorurteile der Beamten gegen Roma und Sinti deutlich. In manchen Fällen wurde sogar ihre<br />
Verfolgung aus Gründen der Abstammung und damit die Anerkennung als Opfer im Sinne<br />
des Opferfürsorgegesetzes verneint, wobei den „Zigeunern“ ihre auch vor 1938 an die<br />
herrschenden gesellschaftlichen Normen und bürgerlichen Vorstellungen nicht angepaßte<br />
Lebensweise zum Problem wurde. Zahlreiche Roma und Sinti waren wegen ihres nomadisierenden<br />
Lebens wegen Vagabondage, manche auch wegen geringfügigerer Eigentumsdelikte<br />
vorbestraft. Aus diesen Gründen waren Sinti und Roma in der nationalsozialistischen<br />
Zeit vielfach als sogenannte „Asoziale“ inhaftiert gewesen, und die Opferfürsorgebehörden<br />
schlossen sich in solchen Fällen dem von den Nationalsozialisten angeführten<br />
Haftgrund an oder interpretierten diesen in die Verfolgung der Roma und Sinti zurück. Als<br />
„Asoziale“ verfolgt gewesene Menschen haben jedoch bis heute (Stand: 1993) in Österreich<br />
keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Opferfürsorgegesetz. 35<br />
J. P. war von 1941 bis 1945 in Lackenbach inhaftiert gewesen und hatte sich dort ein<br />
Herzleiden, Rheumatismus und Erfrierungen zugezogen. Seine Anerkennung als Opfer<br />
nach dem Opferfürsorgegesetz wurde von der Bezirkshauptmannschaft Oberwart jedoch<br />
60 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
abgelehnt, „da der Beschwerdeführer bereits vor der Verschickung in ein Konzentrationslager<br />
(sic!) wegen Eigentumsdelikten und Vagabundage vorbestraft gewesen sei, weshalb<br />
angenommen werden müsse, daß die Inhaftierung nicht auf Grund der Abstammung allein<br />
erfolgte“. 36 J. P. betrieb nach dieser Ablehnung die Tilgung seiner Vorstrafen und stellte danach<br />
einen neuerlichen Antrag auf Ausstellung eines Opferausweises, der jedoch abermals<br />
zurückgewiesen wurde, da seine seinerzeitige Ablehnung nicht wegen der damals noch ungetilgten<br />
Vorstrafen erfolgt sei: „Es sei im Bescheid lediglich davon gesprochen worden,<br />
daß die Anhaltung des Berufungswerbers in Lackenbach im Hinblick auf seine Vorstrafen<br />
wegen Asozialität und nicht aus Abstammungsgründen erfolgt sein dürfte.“ 37 Der Verwaltungsgerichtshof<br />
schloß sich dieser Auffassung an und wiederholte die Argumentation der<br />
burgenländischen Behörden: „Auf diese Vorstrafen ist nur bei der Frage bedacht genommen<br />
worden, ob der Beschwerdeführer in der nationalsozialistischen Zeit aus rassischen<br />
Gründen oder aus Gründen seiner ‚asozialen Einstellung‘ in das Lager Lackenbach gebracht<br />
wurde. In Bezug auf diese Frage spielt die Tilgung der Strafen naturgemäß keine<br />
Rolle, weil es diesfalls auf die Verhältnisse in der nationalsozialistischen Zeit ankommt.“ 38 In<br />
einem anderen Fall hob der Verwaltungsgerichtshof einen Bescheid des Landeshauptmanns<br />
von Wien auf, worin die Wiener Behörden festgestellt hatten, auf Grund des Erlasses des<br />
Reichsführers SS aus dem Jahre 1939 seien nur asoziale Zigeuner verhaftet und deportiert<br />
worden. Die allgemeine Deportation von Zigeunern habe erst 1942 begonnen, so daß vorher<br />
keine zwingenden Gründe für ein Leben im Verborgenen gegeben gewesen seien und<br />
der Antrag (U-Boot Juni 1939 bis Juni 1942) habe abgewiesen werden müssen. 39<br />
Versuche einzelner Sinti und Roma, über die Geltendmachung einer Einkommensminderung<br />
einen Opferausweis zu erhalten, scheiterten an deren schlechten Einkommensverhältnissen<br />
vor der Verfolgung beziehungsweise an deren Ausnützung als billige, nicht der Sozialversicherung<br />
gemeldete Aushilfsarbeitskräfte. Frau A. H. aus Oberpullendorf beispielsweise<br />
war 1934 bis 1938 als Hilfskraft in einer Gastwirtschaft beschäftigt, verlor diesen<br />
Arbeitsplatz wegen „ihrer Zugehörigkeit zur Zigeunerrasse“. 40 In der Folge wurde sie zu<br />
keinem geregelten Arbeitsverhältnis mehr zugelassen „und habe daher durch mehr als<br />
sechs Jahre aus Gründen der Abstammung einen völligen Einkommensverlust erlitten.“ 41<br />
Trotz anderslautender Aussagen anderer Angestellter der Gastwirtschaft schenkten die<br />
Behörden den Angaben des Gastwirtes und dessen Gattin Glauben, die angaben, A. H.<br />
sei bei ihnen nur fallweise beschäftigt gewesen und das erst ab 1936, weshalb er sie nicht<br />
zur Sozialversicherung angemeldet haben. Die Möglichkeit, daß der ehemalige Arbeitgeber<br />
der A. H. sich mit diesen Angaben mögliche nachträgliche Schwierigkeiten mit der Sozialversicherung<br />
habe ersparen wollen, zogen weder die Behörde noch der Verwaltungsgerichtshof<br />
in Erwägung. Die Aussage angesehener Bürger wog vor dem Gericht einfach<br />
schwerer als die kleiner Angestellter oder gar einer „Zigeunerin“. Hier kam vermutlich zusätzlich<br />
der auch heute bekannte Umstand zum Tragen, daß Menschen aus niedrigen<br />
sozialen Schichten schwerer zu ihrem Recht kommen können als wohlhabende oder gebildete<br />
– ein Problem, das wohl sehr viele der Roma und Sinti bis heute betrifft.<br />
Auch zwangssterilisierte Roma und Sinti fanden keine Anerkennung ihres erlittenen<br />
Gesundheitsschadens. So stellte ein Wiener Amtsarzt fest: „Der somatische Schaden, der<br />
durch die Zwangssterilisation hervorgerufen wurde, ist geringfügig. Nach den Kriegsversehrtenstufen<br />
bedingt ja sogar der Verlust beider Hoden erst die Einstufung in die Versehrtenstufe<br />
II. Immerhin ist der soziale bzw. moralische Schaden für jemanden, der Wert<br />
darauf legt, eine Familie zu gründen, ein derartiger, daß er für die Zwecke der Erlangung<br />
des Opferausweises wohl der Versehrtenstufe III gleichgehalten werden könne. Doch muß<br />
von vornherein der Bewerber darauf aufmerksam gemacht werden, daß Opferrentenansprüche<br />
daraus sich bei der derzeitigen Gesetzeslage schwer ableiten ließen.“ 42 Der Betroffene<br />
J. H. erhielt einen Opferausweis, sein Antrag auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung<br />
wurde jedoch vom Bundesministerium für soziale Verwaltung abgelehnt. 43 Die aus einer<br />
zwangsweisen Unfruchtbarmachung für Roma und Sinti resultierenden schwerwiegenden<br />
sozialen und psychischen Probleme berücksichtigten die amtsärztlichen Gutachten nicht.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
61<br />
Die noch ausstehendeEntschädigung
Beinahe vergessene Opfer – Roma und Sinti<br />
Insgesamt konnte nur ein Bruchteil der rund 11.000 verfolgten Roma und Sinti Anerkennung<br />
als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung finden. Laut Burggasser betrug die<br />
Zahl der anerkannten Roma in Österreich nicht einmal ganz 1000 Personen! 44 Angst und<br />
Scheu der Betroffenen vor der Konfrontation mit den Behörden haben dazu ebenso beigetragen<br />
wie Kontinuität von Vorurteilen und die daraus resultierende, ablehnende Haltung<br />
der Behördenvertreter selbst.<br />
1 In diesem Zusammenhang muß auf die verdienstvolle Pionierarbeit<br />
durch Dr. Selma Steinmetz verwiesen werden, die wohl als erste<br />
in Österreich auf das Schicksal der Roma und Sinti in eigenen<br />
Arbeiten aufmerksam machte: Selma Steinmetz, Österreichs Zigeuner<br />
im NS-Staat, Wien 1966; dies., Die Zigeuner, in: Widerstand<br />
und Verfolgung im Burgenland 1934-1945, hsg. v. Dokumentationsarchiv<br />
des österreichischen Widerstandes, Wien 1979, S<br />
244ff. Seit Beginn der achtziger Jahre widmet sich vor allem Erika<br />
Thurner dieser Thematik: Erika Thurner, Nationalsozialismus und<br />
Zigeuner in Österreich, Salzburg 1983; dies., Kurzgeschichte des<br />
nationalsozialistischen Zigeunerlagers in Lackenbach (1940-1945),<br />
Eisenstadt 1984. Weiters erschienen einige Diplom- und Hausarbeiten<br />
zu diesem Thema: Claudia Mayerhofer, Die Zigeuner im<br />
Burgenland, Hausarbeit, Universität Wien 1977; Herbert Michael<br />
Burggasser, Österreichs Zigeuner – Schwerpunkt 1938 bis 1980. Ein<br />
Minderheitenproblem, Hausarbeit Universität Wien 1980/81.<br />
2 Der Begriff „Zigeuner“ wurde den Roma und Sinti von außen<br />
zugeschrieben und wird vielfach in negativer Konnotierung verwendet.<br />
Das Wort „Roma“ heißt einfach „Mensch“. In Österreich<br />
leben hauptsächlich die Stämme der Roma und Sinti.<br />
3 Steinmetz, Die Zigeuner, a. a. O., S. 249f.<br />
4 Thurner, Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich, a. a. O.,<br />
S. 215ff.<br />
5 Die Situation ist in der BRD keineswegs besser: Christiane Pross, Wiedergutmachung.<br />
Der Kleinkrieg gegen die Opfer, Frankfurt/Main<br />
1988, S 273f.; Helga und Hermann Fischer-Hübner (<strong>Hrsg</strong>.), Die Kehrseite<br />
der „Wiedergutmachung“, Gerlingen 1990, S 163.<br />
6 Erika Thurner, Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich, a.<br />
a. O., S. 20.<br />
7 Zur Geschichte des Lagers Maxglan siehe: Erika Thurner, Die Verfolgung<br />
der Zigeuner, in: Dokumentationsarchiv des österreichischen<br />
Widerstandes (Hsg.), Salzburg 1991, Bd. 2, S 474-521, bes.<br />
498ff.; Barbara Rieger, „Zigeunerleben“ in Salzburg 1930-1943. Die<br />
regionale Zigeunerverfolgung als Vorstufe zur planmäßigen Vernichtung<br />
in Auschwitz, unveröffentlichte Diplomarbeit an der geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Wien, Wien 1990.<br />
8 Vgl. „Unser einziger Weg ist Arbeit“. Das Ghetto in Lodz 1940-<br />
1944, eine Ausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt am<br />
Main, Wien 1990, S 186f.<br />
9 Vgl. Auschwitz, Geschichte und Wirklichkeit des Vernichtungslagers,<br />
o. Hsg., Reinbek 1980, S 133.<br />
10 DÖW Akt Nr. 11. 293.<br />
11 Die ersten Eintragungen ins „Lagertagebuch“ erfolgten erst im<br />
Jänner 1941. Steinmetz, Die Zigeuner, a. a.a O., S. 247.<br />
12 a. a. O.<br />
13 Vgl. dazu DÖW Akt Nr. 9626.<br />
14 Steinmetz, a. a. O., S 248.<br />
15 Thurner, Nationalsozialismus, a. a. O., S. 220.<br />
16 Rundschreiben des Bundesministeriums für Inneres, Generaldirektion<br />
für die öffentliche Sicherheit. Schreiben betreffend Zigeunerunwesen<br />
an alle Sicherheitsdirektionen und alle Bundespolizeibehörden,<br />
Zl. 84.426-4/48. Zitiert nach Thurner, a. a. O., Anhang XXVIII.<br />
17 Denkschrift von Dr. Tobias Portschy betreffend die Zigeunerfrage,<br />
August 1938, zitiert nach: Widerstand und Verfolgung im Burgenland,<br />
a. a. O., S. 257.<br />
18 Abschrift des Erkenntnisses der Rückstellungskommission beim<br />
Aus: Brigitte Bailer-Galanda: Wiedergutmachung kein Thema. Löcker Verlag, Wien 1993, S. 177-184.<br />
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien vom 16. 6. 195, Zl. 63 Rk<br />
1269/49. DÖW Akt Nr. 82.<br />
19 Der neue Mahnruf, Nr. 4, April 1953.<br />
20 Der neue Mahnruf. Nr. 7/8, Juli/August 1957.<br />
21 Das Opferfürsorgegesetz in seiner derzeitigen Fassung und sonstige<br />
Vorschriften des Fürsorgerechts für die Opfer des Kampfes für<br />
ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer der politischen<br />
Verfolgung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung<br />
des Verwaltungsgerichtshofes, erläutert von Dr. Burkhart<br />
Birkti, Sektionsrat im Bundesministerium für soziale Verwaltung,<br />
Wien 1958, S. 14, S. 215f.<br />
22 Niederschrift ehemaliger Häftlinge des Lagers Lackenbach vom<br />
30. 11. 1952, undatierter Vermerk des KZ-Verbandes „Lager Lackenbach“.<br />
DÖW Akt Nr. 82.<br />
23 Referiert im Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28. 1.<br />
1954, Zl. 3001/52-6.<br />
24 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes, a. a. O. Der Bescheid<br />
des BM für soziale Verwaltung wurde wohl gegen Rechtswidrigkeit<br />
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben,<br />
da die Behörde keine Erhebungen über die tatsächlichen Zustände<br />
im Lager gepflogen hatte.<br />
25 Zitiert nach: Widerstand und Verfolgung im Burgenland, a. a. O.,<br />
S. 256.<br />
26 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 27. 1. 1958, Zl.<br />
2060/55-3.<br />
27 a. a. O.<br />
28 Vgl. DÖW Akt Nr. 82.<br />
29 a. a. O.<br />
30 Ähnliche Probleme gab es auch bei der Anerkennung des Lagers<br />
Maxglan. Im Zuge eines Entschädigungsverfahrens in der Bundesrepublik<br />
Deutschland wurden die Antragsteller – ehemalige Insassen<br />
des Lagers Maxglan – infolge beschönigender österreichischer Darstellungen<br />
sogar wegen Meineids angeklagt. Im Zuge des Meineidsverfahrens<br />
stellte sich jedoch die Richtigkeit der Angaben der<br />
ehemaligen Häftlinge heraus. Vgl. dazu Rieger, a. a. O., S. 97-99.<br />
31 Vgl. dazu auch das spätere Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs<br />
vom 9. 6. 1964 zu zehn Beschwerden ehemaliger Insassen<br />
von Lackenbach, Zl. 2340 bis 2349/63.<br />
32 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 17. 4. 1958, Zl.<br />
1273/57-4.<br />
33 BGBl. Nr. 197/1988, in Kraft ab 1. 5. 1988.<br />
34 BGBl. Nr. 93/1975 vom 23. 1. 1975.<br />
35 Siehe dazu das Kapitel III. 5. c) in: Brigitte Bailer, Man nannte sie<br />
„asozial“, Wiedergutmachung kein Thema, Wien 1993, S. S 193-<br />
197.<br />
36 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 25. 3. 1954, Zl. 825/53-2.<br />
37 a. a. O.<br />
38 a. a. O.<br />
39 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 18.5.1966, Zl. 39/65-4.<br />
40 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 20.9.1966, Zl. 1703/64-6.<br />
41 a. a. O.<br />
42 DÖW Akt Nr. 20 000/h 568.<br />
43 Zur Problematik der Sterilisierungen siehe das Kapitel „Die Opfer<br />
der nationalsozialistischen Erbgesundheitspolitik“.<br />
44 Herbert Michael Burggasser, Österreichs Zigeuner – Schwerpunkt<br />
1938 bis 1980. Hausarbeit, Universität Wien 1980/81, S. 85.<br />
62 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
VERTRIEBEN UND NICHT ZURÜCKGEKEHRT<br />
BRIGITTE BAILER-GALANDA<br />
1<br />
Auch die Gruppe der jüdischen Vertriebenen zählt zu den „vergessenen Opfern“. Weder<br />
bemühte sich die Republik, die Vertriebenen nach Österreich zurückzuholen und sie willkommen<br />
zu heißen noch wurden sie in der ➤ Opferfürsorgegesetzgebung angemessen berücksichtigt.<br />
Den Wenigen, die nach 1945 nach Österreich zurückkehrten, wurde vielmehr vorgeworfen,<br />
während des Krieges im Ausland „gut gelebt“ zu haben. Die (Nicht-) Berücksichtigung<br />
dieser Gruppe im Opferfürsorgegesetz wird in mehreren Texten des vorliegenden Bandes<br />
behandelt. An dieser Stelle soll geschildert werden, welche Folgen Vertreibung und Exil<br />
tatsächlich für die Betroffenen hatten. Für eine ausführlichere Darstellung verweisen wir auf<br />
die Bücher „Wiedergutmachung kein Thema“ von Brigitte Bailer-Galanda sowie „Neubeginn<br />
ohne Illusionen. Juden in Österreich nach 1945“ von Helga Embacher (Wien 1995).<br />
Die Mehrheit der 1938/39 aus Österreich geflüchteten bzw. vertriebenen Menschen kehrte<br />
auch nach Kriegsende nicht mehr in die Heimat zurück, andere wieder konnten Verfolgung<br />
und Konzentrationslager überleben – oft als einzige ihrer Familie –, verließen jedoch nach<br />
der Befreiung Österreich oder kehrten gar nicht mehr hierher zurück. Den im Ausland<br />
lebenden Opfern wurden und werden in Österreich besonders massive Vorurteile entgegengebracht.<br />
Einerseits ließ man sie fühlen, daß ihre Rückkehr nicht eben erwünscht wäre, andererseits<br />
machte man ihnen im selben Atemzuge zum Vorwurf, daß sie eben nicht zurückgekehrt<br />
seien, ihre Heimat quasi im Stich gelassen hätten. Diese Argumentationslinie trat<br />
besonders deutlich in den fünfziger Jahren hervor, als das ➤ „Committee for Jewish Claims<br />
on Austria“ seine Verhandlungen um „Wiedergutmachung“ für diesen Personenkreis aufnahm<br />
und sich erste positive Verhandlungsergebnisse abzeichneten. Die in Österreich<br />
lebenden Opfer, die zu diesem Zeitpunkt gleichfalls noch keine Entschädigung 2 erhalten<br />
hatten, beobachteten den Fortgang der Kontakte der Bundesregierung mit dem „Claims<br />
Committee“ mit Mißtrauen. So schrieb das Organ der „ÖVP-Kameradschaft“ 1955: „Allerdings<br />
können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, daß hier mancher gar nicht mehr die<br />
Absicht hatte, österreichischen Boden zu betreten, seine Volksverbundenheit (!) also sehr<br />
problematisch war, und trotzdem fordert er heute von Österreich Wiedergutmachung. Wir<br />
können und wollen nun an der Tatsache der Wiedergutmachung für die Ausländer nichts<br />
geändert haben. Wir wollen aber und verlangen kategorisch, daß die in Österreich Befindlichen<br />
und durch die Wiedergutmachungsgesetzgebung noch nicht Erfaßten, nunmehr endlich<br />
auch zu einer Abfertigung bzw. Versorgung kommen.“ 3<br />
Diese Vorurteile gehen gänzlich an der subjektiven, aber auch objektiven Situation der<br />
Nicht-Rückkehrer vorbei. Viele von ihnen sind auf sehr irrationale Weise nach wie vor an<br />
Österreich gebunden, können jedoch nicht verwinden, was ihnen und ihrer Familie hier<br />
nach dem März 1938 angetan wurde: Sie fürchten den in Österreich nach wie vor vorhandenen<br />
Antisemitismus, sie ertragen die mit Österreich verbundenen Erinnerungen nur<br />
schwer. Trotzdem bleibt bei vielen dieser Menschen ein Gefühl der Entwurzelung, das eine<br />
ehemalige Österreicherin, die seit Jahrzehnten in den USA lebt, so beschrieb: „Ich bin heute<br />
eine Frau ohne Heimat.“ 4 Andere wieder treibt eine unbestimmte Sehnsucht regelmäßig<br />
nach Wien zurück, das sie jedoch wenige Wochen später ernüchtert wieder verlassen – bis<br />
zum nächsten Mal. 5 Eine als Jugendliche in das damalige Palästina geflüchtete Wienerin,<br />
die heute mit ihrem Gatten nach wie vor in Israel lebt, erklärte der Verfasserin weinend: Es<br />
sei schrecklich, in Wien sei alles vertraut, hier sei sie daheim, trotzdem könne sie hier nicht<br />
mehr leben.<br />
Diese Einzelschicksale werden auch von den mit Verfolgten befaßten Psychiatern und<br />
Psychotherapeuten bestätigt. So wie viele der Überlebenden des Holocaust leiden auch so<br />
manche der Nicht-Zurückgekehrten an „Überlebensschuld“, also unklaren Schuldgefühlen,<br />
vielleicht doch nicht alles versucht zu haben, Familienmitgliedern oder Freunden zur Flucht<br />
ins rettende Ausland zu helfen, oft auch ausgedrückt in der peinigenden Frage „Wieso<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
63
Vertrieben und nicht zurückgekehrt<br />
habe ich überlebt und die anderen nicht?“ Besonders „entwurzelte Verfolgte leiden unter<br />
ihrer unbefriedigenden Anpassung an die neue Umgebung, an ihrem niedrigen Sozialstatus<br />
und Lebensstandard, der an sich sogar höher sein kann als im Ursprungsland. Sie ziehen<br />
sich von ihrer Umgebung zurück, sind schlaflos, träumen von der Verfolgung und den<br />
getöteten Angehörigen, entwickeln eine Menge von psychosomatischen Beschwerden. (...)<br />
In einigen Fällen ist die reaktive Depression besonders gefärbt durch Schuldgefühle, die<br />
sich zwanghaft an bestimmte Erinnerungen aus der Verfolgungszeit knüpfen, z. B. an den<br />
Gedanken, für den Tod von Angehörigen verantwortlich zu sein.“ 6 Der deutsche Privatdozent<br />
Ulrich Venzlaff stellt fest: „Für die meisten bedeutete das Erlebnis jahrelanger Ächtung<br />
und Verfolgung oder der Entwurzelung durch Emigration eine einschneidende Kontinuitätsunterbrechung<br />
der Lebenslinie, einen nachhaltigen Bruch des seelischen Ordnungsgefüges.“<br />
7 Der bekannte US-Psychiater William G. Niederland berichtet über die Situation<br />
der Vertriebenen: „Wem trotz haarsträubender Schwierigkeiten die Beschaffung der erforderlichen<br />
Dokumente und die Flucht ins Ausland gelang, dem wurde die Beziehungslosigkeit<br />
zur sprach-, kultur- und wesensfremden Umgebung zu einer neuen seelischen Belastung.<br />
Langwährende Entwurzelungsdepressionen stellten sich ein, in deren Gefolge nicht<br />
wenige Selbstmord begingen. Viele andere kämpften Jahre hindurch mit Umstellungsdepressionen,<br />
die ihr Fußfassen in der fremden Umwelt weiter erschwerten und nicht selten<br />
die Gründung einer neuen Lebensexistenz unmöglich machten. Der soziale Abstieg, die<br />
Trennung von den Angehörigen, die Zerreißung enger Familienbande, das Gefühl der Heimatlosigkeit,<br />
die enormen Anpassungsschwierigkeiten innerer und äußerer Art, die keineswegs<br />
seltene Notwendigkeit, erstmals im Leben Wohlfahrtseinrichtungen in Anspruch zu<br />
nehmen und Almosenempfänger zu werden, schließlich das zunehmende Durchsickern von<br />
Nachrichten über Nazigreuel und den Verfolgungstod zurückgelassener naher Verwandter<br />
und Freunde – all dies verstärkte die Depressionen und Ängste in so erheblichem Maße,<br />
daß sich bei vielen der Ausgewanderten ernste Krankheitszustände seelischer und psychosomatischer<br />
(d. h. leibseelischer) Natur und Herkunft zu entwickeln begannen.“ 8 Die oft erst<br />
im Pensionsalter auftretenden seelischen Leiden der Überlebenden und Vertriebenen führten<br />
in Israel zur Gründung einer eigenen Institution „AMCHA“, die sich um therapeutische Hilfe<br />
für diese Menschen bemüht. 9<br />
Der durch die erzwungene Flucht oder „Auswanderung“ bedingte „Knick in der Lebenslinie“<br />
10 zieht die Folgen bis in die Gegenwart nach sich.<br />
1 Zu den sozialversicherungsrechtlichen Problemen der Vertriebenen<br />
siehe das Kapitel „Sozialversicherungsrechtliche Probleme“,<br />
in: Brigitte Bailer-Galanda, Wiedergutmachung kein Thema, Wien<br />
1993, S. 239-245.<br />
2 Mit Ausnahme der Haftentschädigung 1952.<br />
3 Der Freiheitskämpfer, Nr. 121, November 1952.<br />
4 Interview mit Frau M. S. DÖW-Projekt „Erzählte Geschichte“, Interviewabschrift<br />
Nr. 323. In diesem, aber auch in einer Reihe anderer<br />
Interviews kommt dieser Konflikt der Nicht-Rückkehrer<br />
zwischen emotionaler Bindung an die Heimat und Ängsten angesichts<br />
erlittene Traumata deutlich zum Ausdruck. Vgl. dazu: Dokumentationsarchiv<br />
des österreichischen Widerstandes (<strong>Hrsg</strong>.),<br />
Jüdische Schicksale, a. a. O., Kapitel „Leben nach dem Holocaust“.<br />
5 Kapitel „Leben nach dem Holocaust“, a. a. O.<br />
Aus: Brigitte Bailer-Galanda: Wiedergutmachung kein Thema,<br />
Löcker Verlag, Wien 1993, S. 157ff<br />
6 Vgl. Walter Ritter von Baeyer, Heinz Zäfner, Karl Peter Kisker,<br />
Psychiatrie der Verfolgten. Psychopathologische und gutachtliche<br />
Erfahrungen an Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung<br />
und vergleichbaren Extrembelastungen, Berlin-Göttingen-Heidelberg<br />
1964, S. 88.<br />
7 Zitiert nach:; William G. Niederland, Folgen der Verfolgung: Das<br />
Überlebenden-Syndrom Seelenmord, Frankfurt/M. 1980, S. 203.<br />
8 Niederland, a. a. O., S. 16.<br />
9 Vgl. die von Trautl Brandstaller gestaltete Dokumentation „Es vergißt<br />
sich nicht.“ Überlebende des Holocaust berichten, ORF 1990.<br />
AMCHA hat auch ein Komitee in Österreich, 1080 Wien, Lange<br />
Gasse 64/2/15.<br />
10 Helga und Hermann Fischer-Hübner (<strong>Hrsg</strong>.), Die Kehrseite der<br />
„Wiedergutmachung“. Das Leiden von NS-Verfolgten in den Entschädigungsverfahren,<br />
Gerlingen 1990.<br />
64 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
ZUM UMGANG MIT DEN OPFERN DER NS-RASSENHYGIENE NACH 1945<br />
WOLFGANG NEUGEBAUER<br />
1<br />
Rassenhygiene – Zwangssterilisierung – Euthanasie<br />
Nach den Rassenlehren der Nationalsozialisten waren nicht nur Juden, Roma und Sinti<br />
(„Zigeuner“) sowie andere „rassisch“ oder ethnisch bestimmte Minderheiten „minderwertig“<br />
und letztlich „lebensunwert“; im Interesse der Höherentwicklung der eigenen „Rasse“<br />
sollten auch die „Minderwertigen“ des eigenen Volkes „ausgemerzt“ werden. Die Theorien<br />
des Naturwissenschaftlers Charles Darwin vom Kampf ums Dasein und von der natürlichen<br />
Auslese, vom Durchsetzen des Stärkeren (Anpassungsfähigeren) gegen den Schwächeren<br />
wurden von Rassentheoretikern vom Tierreich auf die menschliche Gesellschaft übertragen.<br />
Dieser „Sozialdarwinismus“ wurde zu einem Hauptinhalt der nationalsozialistischen Weltanschauung<br />
und nach der Machtergreifung 1933 mit barbarischer Konsequenz in die<br />
Wirklichkeit umgesetzt. Für „unnütze Esser“ oder „Ballastexistenzen“ wie geistig oder körperlich<br />
Behinderte war im nationalsozialistischen Deutschland, das auch das menschliche<br />
Leben einer erbarmungslosen Kosten-Nutzen-Rechnung unterwarf, kein Platz. Die „Minderwertigen“<br />
sollten entweder durch Verhinderung der Fortpflanzung oder durch physische<br />
Vernichtung ausgeschaltet werden. Die erste systematisch geplante und durchgeführte<br />
Massenmordaktion des NS-Regimes richtete sich gegen die geistig und körperlich behinderten<br />
Menschen. 2<br />
Schon zu Beginn ihrer Herrschaft hatten die Nationalsozialisten mit dem Gesetz zur<br />
Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. 7. 1933 als erste „rassenhygienische“ Maßnahme<br />
die Zwangssterilisierung der „Erbkranken“ (Schwachsinn, Schizophrenie, manischdepressives<br />
Irresein, Fallsucht, Veitstanz, Blindheit, Taubheit, schwere körperliche Mißbildungen,<br />
schwerer Alkoholismus) eingeführt, und nach Pseudoverfahren vor „Erbgesundheitsgerichten“<br />
wurden an die 400.000 Menschen zwangsweise unfruchtbar gemacht.<br />
Mehr als 1 % der Betroffenen, mindestens 5000, davon 90 % Frauen, starben an den Folgen<br />
der Operation, die von den NS-Gesundheitsbehörden als harmloser Eingriff hingestellt<br />
wurde. 3 In Österreich, wo das Gesetz am 1. 1. 1940 in Kraft trat, wurden etwa 5000 Menschen<br />
zwangssterilisiert. 4<br />
Daß der Übergang von der „rassenbiologisch“ langfristig wirksam werdenden Zwangssterilisierung<br />
zur Ermordung im Jahr des Kriegsausbruchs 1939 erfolgte, war kein Zufall.<br />
Mit der Eliminierung der geistig und körperlich Behinderten sollte der in den Augen der<br />
Nazis vor sich gehenden „negativen Auslese“ durch den Krieg – Tod oder Verstümmelung<br />
der Gesunden, Überleben der Kranken – entgegengewirkt werden. Unmittelbarer Anlaß für<br />
die Massenmordaktion war die Notwendigkeit, Lazarettraum zu schaffen, Spitalspersonal<br />
freizustellen, Nahrungsmittel, Medikamente u. dgl. einzusparen, also die sozialen Kosten<br />
zugunsten der Kriegswirtschaft zu reduzieren. 5 So wurde etwa die der Stadt Wien gehörende<br />
Anstalt in Ybbs an der Donau nach dem Abtransport von über 2000 Patienten zur Vernichtung<br />
in ein militärisches Reservelazarett umgewandelt. 6<br />
Die Nationalsozialisten begannen die zu Unrecht ➤ „Euthanasie“ (griechisch: schöner<br />
Tod) oder „Gnadentod“ genannte Vernichtung des „lebensunwerten Lebens“ mit geistig<br />
und körperlich behinderten Kindern. Aufgrund eines Geheimerlasses des Reichsinnenministeriums<br />
vom 18. August 1939 mußten alle Hebammen und Ärzte solche Kinder bis zu<br />
drei (später: 17) Jahren den Gesundheitsämtern melden; nach einer (Pseudo-) „Begutachtung“<br />
erfolgte – vielfach unter Täuschung der Eltern oder mit Zwang – die Einlieferung<br />
der ausgesuchten Kinder in eine „Kinderfachabteilung“. In der in der Anstalt ➤ „Am<br />
Steinhof“ untergebrachten Kinderklinik ➤ „Am Spiegelgrund“ wurden einige hundert Kinder<br />
mittels Gift, Injektion oder Aushungern von Ärzten und Pflegepersonal umgebracht.<br />
Einzelne „Kinderfachabteilungen“ hatten Forschungsabteilungen, wo klinische Versuche,<br />
diagnostische Experimente und anatomische Forschungen durchgeführt wurden. Solche<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
65<br />
Realisierung<br />
sozialdarwinistischer<br />
Ideen<br />
Von der Zwangssterilisierung<br />
zur<br />
„Euthanasie”<br />
Die Kinderfachabteilung<br />
„Am<br />
Spiegelgrund”
Die Ermordung<br />
Geisteskranker<br />
Die „Liquidierung“<br />
sogenannter<br />
„Asozialer”<br />
Zum Umgang mit den Opfern der NS-Rassenhygiene nach 1945<br />
der ärztlichen Ethik zutiefst widersprechenden Aktivitäten dürften auch am „Spiegelgrund“<br />
stattgefunden haben.<br />
Kurze Zeit nach der Einführung der „Kindereuthanasie“ begann das NS-Regime aufgrund<br />
einer auf den 1. September 1939 rückdatierten „Ermächtigung“ des Führers Adolf Hitler,<br />
die keinerlei Gesetzeskraft oder Legalität hatte, mit der „Euthanasie“ der erwachsenen geistig<br />
und körperlich Behinderten. Im Rahmen dieser von der „Kanzlei des Führers“ organisierten<br />
Tötungsaktion (nach der Adresse Berlin, Tiergartenstraße 4 ➤ „T4“ genannt) wurde<br />
ein Großteil der Patienten der psychiatrischen Anstalten im Deutschen Reich in „Euthanasieanstalten“,<br />
u. a. nach Hartheim bei Eferding, abtransportiert und dort mit Giftgas getötet.<br />
Die Angehörigen der Opfer wurden mit verfälschten Briefen und Totenscheinen zu täuschen<br />
versucht. Vorher waren die Patienten von bezahlten „Gutachtern“, etwa 40-50, davon zwei<br />
aus Wien (Dr. Erwin Jekelius und Dr. Hans Bertha), im Wege einer Fragebogenauswertung<br />
für die „Euthanasie“ ausgewählt worden.<br />
Im Zuge der Aktion „T4“ wurden ca. 18.000 Insassen österreichischer Anstalten nach ➤<br />
Hartheim abtransportiert. Darunter waren auch Pfleglinge kleinerer Anstalten und – über<br />
den Kreis der psychisch Kranken weit hinaus – Insassen von Pflegeheimen und Altersheimen<br />
einbezogen.<br />
Mit Hitlers Befehl zum Abbruch der Aktion „T4“ vom 24. August 1941 kam die NS-<br />
Euthanasie jedoch keineswegs vollständig zum Erliegen. Die Kindereuthanasie wurde weitergeführt,<br />
und in den Euthanasie-Anstalten wurden Häftlinge aus den Konzentrationslagern<br />
vergast (Aktion 14f13). Als einzige Euthanasie-Anstalt blieb Hartheim, bis Dezember<br />
1944, weiter in Betrieb, unter anderem wurden dort geisteskranke „Ostarbeiter“ vergast,<br />
die keine Leistung mehr erbringen konnten.<br />
In den einzelnen Anstalten wurde die Ermordung von Geisteskranken durch Verhungern,<br />
Vergiften u. ä. fortgesetzt; vielfach entsprang diese der Initiative von Gauleitungen, Anstaltsleitungen<br />
oder einzelnen Ärzten. Ob eine zentrale Anweisung für diese ungeregelten<br />
Mordaktionen vorlag, ist nicht klar. Viktor Brack, einer der Hauptverantwortlichen für die<br />
„Euthanasie“-Aktion in der „Kanzlei des Führers“, prägte dafür die Bezeichnung „wilde<br />
Euthanasie“. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen geht hervor, daß seitens des Pflegepersonals<br />
zeitweise sogar mehr Patienten getötet wurden, als von oben angeordnet worden<br />
war. Der Gesichtspunkt der „Pflegeaufwendigkeit“ war dabei von entscheidender Bedeutung:<br />
Je mehr ein Patient die Pfleger in Anspruch nahm, desto größer war seine Aussicht<br />
auf Todesbeschleunigung.<br />
Verlegungstransporte zwischen einzelnen Anstalten dienten zur Verschleierung des<br />
raschen Sterbenlassens bzw. dessen Beschleunigung. Besonders gut dokumentiert ist das<br />
Schicksal der im August 1943 aus Hamburg nach „Steinhof“ gebrachten 228 Frauen<br />
und Mädchen, von denen 201 – meist nach beträchtlichen Gewichtsverlusten durch Hungern<br />
– umkamen. Zu den in Hartheim ermordeten 15.000 bis 18.000 ÖsterreicherInnen<br />
kommen also einige weitere tausend Patienten hinzu, die in den Anstalten selbst ums Leben<br />
gebracht wurden. Das heißt, daß die Größenordnung der österreichischen Euthanasieopfer<br />
bei mindestens 25.000 liegt.<br />
Die Absichten und Planungen der für die Gesundheits- und Sozialpolitik verantwortlichen<br />
NS-Funktionäre in Staat, Partei und SS gingen weit über „Erbkranke“, Geisteskranke und<br />
Behinderte hinaus; von den verbrecherischen Maßnahmen waren alle den Normen des<br />
NS-Regimes nicht entsprechenden Menschen bedroht, insbesondere alle jene, die keine<br />
Leistung für die „Volksgemeinschaft“ erbrachten oder erbringen konnten, die vom ökonomischen<br />
Standpunkt als „unnütze Esser“ angesehen wurden. 7 Vor allem dem Chef des ➤ SD<br />
und der Sipo Reinhard ➤ Heydrich, neben ➤ Himmler Hauptorganisator des NS-Terrors,<br />
ging es um die „Ausmerzung“ aller den NS-Normen nicht entsprechenden sozialen Randgruppen<br />
und Minderheiten im deutschen Herrschaftsbereich. In seinem Auftrag wurde ein<br />
„Gemeinschaftsfremdengesetz“ ausgearbeitet, in dem Zwangssterilisierung und Schutzhaft<br />
für alle in den Augen der Nazis als „asozial“ Eingestufte vorgesehen waren. Die Liquidierung<br />
der „Gemeinschaftsfremden“, dazu wurden u. a. „Arbeitsscheue“ und „gewohnheits-<br />
66 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
mäßige Schmarotzer“, „Landesverräter“, „Rassenschänder“, „sexuell Hemmungslose“, Süchtige,<br />
Trinker, Prostituierte, Abtreiberinnen, Straffällige gezählt, nach damaligen statistischen<br />
Berechnungen etwa 2 % der Bevölkerung (1,6 Millionen Menschen), wurde hinsichtlich der<br />
Jüngeren im Wege der „Kindereuthanasie“, die bis zum 17. Lebensjahr erstreckt wurde,<br />
betrieben, zum größeren Teil erfolgte sie durch den ➤ SS- und Polizeiapparat, d. h. durch<br />
Inhaftierung in Konzentrationslagern und „Vernichtung durch Arbeit“. 8<br />
Allein im Reichsgau Groß-Wien wurden im Zuge der 1939 begonnenen „Erbbiologischen<br />
Bestandsaufnahme“ 700.000 Personen als „asozial“ in Karteien erfaßt. Daß diese<br />
Menschen als zukünftige Opfer nationalsozialistischer Rassenpolitik ins Auge gefaßt waren,<br />
liegt in der Logik des NS-Systems. Manche Forscher (G. Aly, K. H. Roth, K. Dörner, D. Peukert)<br />
nehmen an, daß eine Art „Endlösung der sozialen Frage“, also eine Ausrottung der gesamten,<br />
als „minderwertig“ angesehenen Unterschichten der Gesellschaft, geplant war. Den<br />
mörderischen Ausmerzungstendenzen wurde vor allem mit der Hinaufsetzung der Altersgrenze<br />
bei der „Kindereuthanasie“ von drei auf 17 Jahre Rechnung getragen, wodurch<br />
auch die Einbeziehung von verwahrlosten und schwer erziehbaren Kindern ermöglicht<br />
wurde. „In der Tötungspraxis des ‚Reichsausschusses‘ spielten die Kriterien ‚soziales Verhalten‘<br />
und ‚allgemeine Lebensbewährung‘ von Anfang an eine entscheidende Rolle“,<br />
resümiert G. Aly. 9 Aus Schilderungen von Personen, die als Kinder oder Halbwüchsige den<br />
Aufenthalt in der Jugendfürsorgeanstalt „Am Spiegelgrund“ (Pavillons 17 und 18) überlebten,<br />
10 wissen wir, daß die Todesdrohung – ausgesprochen oder unausgesprochen –<br />
ständig im Raum stand. Zum einen gab es eine permanente Unterversorgung mit Nahrungsmitteln,<br />
die zu einer hohen Mortalitätsrate führte, 11 zum anderen hing über jedem Patienten<br />
das Damoklesschwert der „Euthanasierung“ durch Vergiften oder Abspritzen, die offenbar<br />
auch als schärfste Strafe im Falle von Widersetzlichkeiten zur Anwendung kam.<br />
Die Ausgrenzung der Opfer<br />
Der Umgang mit der NS-Euthanasie und das Schicksal der Täter und Opfer nach 1945<br />
sind eingebettet in die allgemeine gesellschaftliche und politische Entwicklung Nachkriegsösterreichs.<br />
In einer – freilich nur kurz währenden – antifaschistischen Periode 1945/46<br />
wurden NS-Täter, darunter auch einige Verantwortliche der NS-Euthanasie, konsequent zur<br />
Verantwortung gezogen.<br />
Der antifaschistische Geist von 1945 flaute bald ab. In der Weltpolitik beendete der<br />
Kalte Krieg zwischen Ost und West die Anti-Hitler-Koalition, Antikommunismus trat anstelle<br />
des Antifaschismus. Die Nationalsozialisten, die sich ja immer schon als die Vorkämpfer<br />
gegen den Bolschewismus aufgespielt hatten, wurden wieder aufgewertet. Die Maßnahmen<br />
zur Entnazifizierung und Strafverfolgung waren nicht mehr politisch opportun. In Österreich<br />
setzte ein Wettlauf aller Parteien um die ehemaligen Nationalsozialisten ein, die als<br />
Wähler und Parteimitglieder gebraucht wurden. Bald standen diesen die Führungspositionen<br />
wieder offen.<br />
Mehr als 690 000 Österreicher gehörten der NSDAP an; 1,2 Millionen Österreicher<br />
dienten in der deutschen Wehrmacht. Diese sogenannte Kriegsgeneration war zahlenmäßig<br />
weitaus stärker als die Widerstandskämpfer und die überlebenden oder aus dem<br />
Exil zurückgekehrten NS-Opfer und dominierte daher Politik und Gesellschaft in Nachkriegsösterreich.<br />
Das offizielle Österreich wies im Sinne der „Opfertheorie“ von Anfang an und bis zu<br />
Beginn der neunziger Jahre jede Schuld oder Mitverantwortung für die NS-Verbrechen von<br />
sich und sah daher auch keine Verpflichtung zur „Wiedergutmachung“. 12 Freiwillig habe<br />
es aber Österreich übernommen, für die Opfer des Kampfes für ein freies und demokratisches<br />
Österreich und der NS-Verfolgung (bzw. deren Angehörige oder Hinterbliebene) zu<br />
sorgen. 13 Diesem Geist entsprang 1947 das ➤ „Opferfürsorgegesetz“ (OFG), wobei der<br />
Kreis der anspruchsberechtigten Befürsorgten sehr eng gezogen und erst nach langwierigen<br />
Bemühungen erweitert wurde. Dabei wurde (und wird) zwischen „Opfern des<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Wolfgang Neugebauer<br />
67<br />
„Wiedergutmachung“?
Aussichtslose<br />
Anträge auf<br />
Opferfürsorge<br />
Zum Umgang mit den Opfern der NS-Rassenhygiene nach 1945<br />
Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich“ (§ 1, Abs.1), also Widerstandskämpfern,<br />
und „Opfern der politischen Verfolgung“ (§ 1, Abs. 2), das waren politisch, religiös,<br />
national oder rassisch Verfolgte, unterschieden, wobei letztere eindeutig schlechter gestellt<br />
wurden. 14<br />
Während für die Opfer der politischen und rassistischen Verfolgung sowohl in der Bundesrepublik<br />
Deutschland als auch in Österreich eine „Wiedergutmachung“ im Sinne einer<br />
bescheidenen finanziellen Abgeltung für Haftzeiten, wirtschaftliche Schäden, Gesundheitsschädigungen<br />
u. dgl. sowie einer Anerkennung von Rentenansprüchen u. a. erfolgte und<br />
damit auch eine gewisse politisch-moralische Anerkennung verbunden war, geschah für die<br />
Opfer der nazistischen Zwangssterilisierung und Euthanasie bis 1995 überhaupt nichts.<br />
Vom Gesetz war – zumindest nach Auffassung und in der Auslegung der zuständigen<br />
Behörden und Gerichte – nichts vorgesehen, und dennoch geltend gemachte Ansprüche<br />
wurden abgewiesen. Anerkennung und Entschädigung der Opfer der NS-Rassenhygiene<br />
standen nie zur Diskussion, da die Betroffenen bzw. deren Hinterbliebene keine Verbände<br />
wie die politisch und „rassisch“ Verfolgten hatten, die ihre Interessen dem Gesetzgeber und<br />
der Regierung gegenüber vertreten hätten. Gleiches gilt im übrigen auch für vom NS-Regime<br />
verfolgte Homosexuelle, sogenannte „Asoziale“ und Kriminelle, die in einer unserer<br />
Rechtsauffassung widersprechenden Weise hart bestraft wurden.<br />
Lediglich einzelne Opfer der NS-Zwangssterilisierung und -Euthanasie versuchten, trotz<br />
der nahezu aussichtslosen gesetzlichen Lage, Ansprüche bei den zuständigen Behörden<br />
vorzubringen. Das ➤ DÖW hat für das Bundesland Wien den Bestand der Opferfürsorgeakten<br />
in der ➤ Magistratsabteilung 12, in der Größenordnung von über 100.000 Akten,<br />
systematisch durchgearbeitet und darin etwa ein Dutzend Anträge von Sterilisierungs- und<br />
Euthanasieopfern (bzw. von deren Hinterbliebenen) gefunden. Diese Anträge wurden von<br />
den zuständigen Behörden, in erster Instanz der Landeshauptmann von Wien (MA 12), in<br />
zweiter Instanz das Sozialministerium, abgelehnt. 15 So heißt es in einem Bescheid des Sozialministeriums<br />
vom 26. Mai 1961, in der die Berufung der zwangssterilisierten Ludmilla<br />
D. gegen den ablehnenden Bescheid des Landeshauptmannes von Wien zurückgewiesen<br />
wurde:<br />
„Eine als Folge der im Jahre 1943 durchgeführten Sterilisierung eingetretene Gesundheitsschädigung<br />
hätte nur dann einen Anspruch nach dem Opferfürsorgegesetz begründet,<br />
wenn im konkreten Fall für die Anordnung dieser Operation nicht medizinische, sondern<br />
politische Gründe maßgebend gewesen wären. Für eine solche Ausnahme konnten im vorliegenden<br />
Fall keine Anhaltspunkte gefunden werden, /…/. Auf Grund der Krankengeschichte<br />
der Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien ‚Am Steinhof’ ist vielmehr anzunehmen,<br />
daß die Unfruchtbarmachung ausschließlich wegen der unheilbaren Krankheit der<br />
Berufungswerberin erfolgte.“ 16<br />
Im Lichte dieses Bescheides erscheint die nazistische Zwangssterilisierung nicht als eine<br />
konsequente Verwirklichung nationalsozialistischer rassenpolitischer und erbbiologischer<br />
Auffassungen, sondern als eine durchaus legale medizinische Maßnahme des damaligen<br />
Staates. Ein solches Verständnis steht freilich in eklatantem Widerspruch zu der im Zuge<br />
der Aufhebung nationalsozialistischer Vorschriften und Gesetze erfolgten Außerkrafttretung<br />
des ➤ „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ im Jahre 1945.<br />
In einem anderen Ablehnungsbescheid des Sozialministeriums vom 22. Dezember 1958<br />
wurde ausgeführt:<br />
„Es ist unbestritten, daß die Berufungswerberin vor ihrer Sterilisation weder politisch<br />
tätig war noch ihrer Religion, Abstammung oder Nationalität wegen von den nationalsozialistischen<br />
Behörden verfolgt worden ist. Sie wurde vielmehr anläßlich einer Einlieferung<br />
in eine Heil- und Pflegeanstalt auf Grund der damals geltenden Bestimmungen zur Verhütung<br />
erbkranken Nachwuchses sterilisiert. Es handelt sich um keine Verfolgungsmaßnahme<br />
im Sinn der angeführten Gesetzesstelle, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war.“ 17<br />
Nach diesen Grundsätzen wurde in allen ähnlich gearteten Fällen negativ für die Sterilisierungsopfer<br />
entschieden. Schließlich wurde zumindest in einem Fall das Verfahren vor<br />
68 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
den Verwaltungsgerichtshof gebracht. In einem Erkenntnis vom 21. Jänner 1964 wurde die<br />
Beschwerde des zwangssterilisierten Johann W. gegen einen ablehnenden Bescheid des<br />
Sozialministeriums als unbegründet abgewiesen und der schon dargelegten Rechtsauffassung<br />
des Sozialministeriums Recht gegeben.<br />
Auch jüdische Euthanasieopfer wurden nicht als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung<br />
anerkannt. So heißt es in einem Berufungsbescheid des Sozialministeriums vom 20. November<br />
1958 im Falle eines angeblich 1940 ins ➤ „Generalgouvernement“ verlegten Patienten<br />
der Anstalt „Am Steinhof“:<br />
„Bei der Schwere der Erkrankung und der festgestellten Diagnose ‚Progressive Paralyse<br />
und cavernöse Phthise’ kann ungeachtet des Fehlens einer Krankengeschichte und damit<br />
von Aufzeichnungen über das Fortschreiten der Krankheit nicht von einem Beweis in der<br />
Richtung gesprochen werden, daß der Tod des Opfers aus einer anderen Ursache als in<br />
dem schicksalsmäßigen Ablauf der festgestellten Leiden erfolgte.“ 18<br />
In diesem Fall wurden die Lügengespinste des nazistischen Euthanasieapparates, der<br />
eine Verlegung in das „Generalgouvernement“ vorgaukelte, für bare Münze genommen.<br />
Zu diesem Zeitpunkt gab es – wie ein Blick in die Fachliteratur gezeigt hätte – keine Judendeportationen,<br />
wohl aber Abtransporte von Geisteskranken. Mit an Sicherheit grenzender<br />
Wahrscheinlichkeit war der Betreffende in der Euthanasieanstalt Hartheim vergast worden.<br />
Aus diesen behördlichen und gerichtlichen Verfahren spricht ein völliges Unverständnis<br />
für eine ganze Gruppe von Opfern des Nationalsozialismus. Bei einer strengen Auslegung<br />
des damaligen Opferfürsorgegesetzes mag die Nichtberücksichtigung der Euthanasie- und<br />
Sterilisierungsopfer vielleicht juristisch richtig gewesen sein. Man hätte jedoch bei einigem<br />
guten Willen auch juristische Interpretationen finden können, die eine Einbeziehung dieser<br />
Opfer ermöglicht hätten.<br />
Späte Anerkennung<br />
Mit dem wachsenden Abstand von 1945 verlor die Kriegsgeneration aus biologischen<br />
Gründen an Bedeutung; für die nachwachsenden Generationen war die NS-Zeit kein Tabu<br />
mehr, sie wurden seit den siebziger Jahren in Schulen und Universitäten im Rahmen der Zeitgeschichte<br />
und <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong> mit NS-Verbrechen, mit NS-Opfern und -Gegnern konfrontiert.<br />
Nicht zuletzt hat auch die internationale Kontroverse um die Kriegsvergangenheit<br />
von Kurt Waldheim in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre in Österreich tiefgreifende Diskussionen<br />
und letztlich Veränderungen des historisch-politischen Bewußtseins herbeigeführt.<br />
Die Opfertheorie konnte nicht mehr aufrechterhalten werden; immer mehr setzte sich die Erkenntnis<br />
der Mitverantwortung der Österreicher für den Nationalsozialismus und dessen Verbrechen<br />
durch. Der offizielle Durchbruch erfolgte durch die von Bundeskanzler Vranitzky namens<br />
der Bundesregierung im Juni 1991 im Nationalrat abgegebene Erklärung.<br />
Diese Veränderungen im politisch-gesellschaftlichen Klima kamen letztlich auch den NS-<br />
Opfern zugute. Als ich im Zuge eines Referates für ein Symposium der Österreichischen<br />
Gesellschaft für Sozialanthropologie über Zwangssterilisierungen 1986 feststellen mußte,<br />
daß die Zwangssterilisierten und Euthanasieopfer nicht als NS-Opfer anerkannt werden, 19<br />
habe ich mich in der Folge mehrmals und vergeblich an das Sozialministerium, an den<br />
Bundeskanzler und an die Parlamentsklubs mit dem Ersuchen um Änderung dieses unhaltbaren<br />
Standpunktes gewandt und 1992 auch einen Vorschlag für eine Novellierung des<br />
Opferfürsorgegesetzes vorgelegt. Das Sozialministerium und leider auch die Verbände der<br />
NS-Opfer lehnten eine gesetzliche Änderung ab und verwiesen auf den Gnadenweg. 20<br />
Nach der Vranitzky-Erklärung von 1991 über die Mittäterschaft der Österreicher mußten<br />
im Bereich der NS-Opfer auch Taten folgen: 1995 wurde einstimmig im Nationalrat das<br />
Verfassungsgesetz über den ➤ Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus<br />
beschlossen, das erstmals auch die Opfer der rassenhygienischen Maßnahmen<br />
des NS-Regimes anerkannte. Nahezu zeitgleich wurde im Zuge einer Novellierung<br />
des Opferfürsorgegesetzes Behinderung als Verfolgungsgrund in das Gesetz auf-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Wolfgang Neugebauer<br />
69<br />
Ein Wandel im<br />
historischpolitischen<br />
Bewußtsein?<br />
Nationalfonds/<br />
Erweiterung des<br />
Opferfürsorgegesetzes<br />
1995
Zum Umgang mit den Opfern der NS-Rassenhygiene nach 1945<br />
genommen. 21 Doch auch danach wurden noch immer nicht alle Opfer des Nationalsozialismus<br />
als solche akzeptiert. Alois Kaufmann, der wie viele andere in der NS-Zeit als Kind<br />
am „Spiegelgrund“ unter menschenunwürdigen Verhältnissen interniert war und dessen<br />
Stigmatisierung als „Asozialer“ auch nach 1945 noch weiterwirkte, wurde zwar vom<br />
Nationalfonds als NS-Opfer anerkannt, von der Opferfürsorge blieb er weiter ausgeschlossen.<br />
Erst infolge der internationalen Diskussion über die NS-Medizin in Österreich<br />
und den Fall Gross, 22 die eine Bereinigung der österreichischen „Altlasten“ der Vergangenheitsbewältigung<br />
nötig machte, kamen die Kinder vom „Spiegelgrund“ zu ihrem Recht:<br />
Alois Kaufmann und andere wurden von der Opferfürsorgebehörde als NS-Opfer anerkannt.<br />
23 Bei den Homosexuellen konnte sich die Republik Österreich bis heute nicht zu<br />
diesem Schritt durchringen.<br />
1 Für Informationen und Beratung bin ich meiner Kollegin Mag. Dr.<br />
Brigitte Bailer dankbar; siehe zur Thematik grundlegend: Brigitte<br />
BAILER, Wiedergutmachung kein Thema. Österreich und die Opfer<br />
des Nationalsozialismus, Wien 1993; weiters: dies., Die Opfergruppen<br />
und deren Entschädigung. Referat bei der Enquete des Grünen<br />
Klubs im Parlament, 13. 6. 1997 (siehe nächstes Kapitel); Claudia<br />
Andrea SPRING, Verdrängte Überlebende. NS-Zwangssterilisationen<br />
und die legistische, medizinische und gesellschaftliche Ausgrenzung<br />
von zwangssterilisierten Menschen in der Zweiten Republik,<br />
Dipl. Arb. Universität Wien, 1999; nicht mehr auf dem aktuellen<br />
Stand: Wolfgang NEUGEBAUER, Das Opferfürsorgegesetz und die<br />
Sterilisationsopfer in Österreich, in: Dokumentationsarchiv des<br />
österreichischen Widerstandes (Hg.), Jahrbuch 1989, S. 144-150.<br />
2 Vgl. dazu u. a.: Hans-Walter SCHMUHL, Rassenhygiene, Nationalsozialismus,<br />
Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung<br />
„lebensunwerten Lebens“ 1890-1945, Göttingen 1987 (Kritische<br />
Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 75).<br />
3 Vgl. Gisela BOCK, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus.<br />
Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 1986 (Schriften<br />
des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung der<br />
Freien Universität Berlin, Bd. 48).<br />
4 Horst SEIDLER, The Viennese Reichserbgesundheitsgericht, Wien o.<br />
J., 7; Wolfgang NEUGEBAUER, Zwangssterilisierung und „Euthanasie“<br />
in Österreich 1940-1945, in: Zeitgeschichte, 1/2 (1992), 17 ff.<br />
5 Vgl. dazu u. a.: Gerhard BAADER, Die „Euthanasie“ im Dritten<br />
Reich, in: Gerhard BAADER/Ulrich SCHULZ (Hg.), Medizin und<br />
Nationalsozialismus. Tabuisierte Vergangenheit – Ungebrochene<br />
Tradition? , 3. Aufl., Frankfurt (Main) 1987.<br />
6 Wolfgang NEUGEBAUER, Von der Rassenhygiene zum Massenmord,<br />
in: Wien 1938, Wien 1988, 279.<br />
7 Siehe dazu u. a.: Wolfgang AYASS, „Asoziale“ im Nationalsozialismus,<br />
Stuttgart 1995; Hans-Uwe OTTO/Heinz SÜNKER (Hg.),<br />
Soziale Arbeit und Faschismus, Frankfurt am Main 1989; Klaus<br />
SCHERER, „Asozial“ im Dritten Reich. Die vergessenen Verfolgten,<br />
Münster 1990.<br />
8 Siehe dazu ausführlich: Karl-Heinz ROTH (Hg.), Erfassung zur Vernichtung.<br />
Von der Sozialhygiene zum „Gesetz über Sterbehilfe“,<br />
Berlin 1984.<br />
9 Götz ALY, Medizin gegen Unbrauchbare, in: Aussonderung und<br />
Tod. Die klinische Hinrichtung der Unbrauchbaren, Berlin 1985, 37.<br />
10 Siehe dazu: Alois KAUFMANN, Spiegelgrund Pavillon 18. Ein Kind<br />
im NS-Erziehungsheim, Wien 1993; DÖW E 17 792, Aktenvermerk<br />
von Rechtsanwalt Dr. Johannes Patzak über sein Gespräch mit<br />
Friedrich Zawrel in der Strafvollzugsanstalt Stein, 24. 4. 1979.<br />
11 Ausführlich dokumentiert bei: Michael WUNDER/Ingrid GENKEL/<br />
Harald JENNER, Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten<br />
mehr: Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Hamburg<br />
1987, 225 ff.<br />
12 Zur Problematik des Begriffs „Wiedergutmachung“ siehe: BAILER,<br />
Wiedergutmachung, 12 f.<br />
13 Maßnahmen der Republik Österreich zugunsten bestimmter<br />
politisch, religiös oder abstammungsmäßig Verfolgter seit 1945,<br />
hgg. vom Bundespressedienst, Wien 1988, 5 f.<br />
14 Siehe dazu allgemein: BAILER, Wiedergutmachung.<br />
15 NEUGEBAUER, a. a. O.<br />
16 a. a. O., 148.<br />
17 a. a. O.<br />
18 a. a. O., 149.<br />
19 a. a. O.<br />
20 Siehe die diesbezüglichen Korrespondenzen und Unterlagen im<br />
Besitz des Verfassers.<br />
21 Novelle des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. 433/1995; Bundesgesetz<br />
über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des<br />
Nationalsozialismus, BGBl. 432/95. Beide Gesetze wurden am 1. 6.<br />
1995 vom Nationalrat beschlossen.<br />
22 Die internationale Kritik an der Weiterverwendung des Pernkopf-<br />
Anatomieatlasses führte 1997/98 zu einer Untersuchung an der<br />
Wiener Universität; siehe dazu: Senatsprojekt der Universität<br />
Wien, Untersuchungen zur Anatomischen Wissenschaft in Wien<br />
1938-1945, Wien 1998. Gegen den in die Kindereuthanasie involvierten<br />
Arzt Dr. Heinrich Gross wurde aufgrund von 1995 und<br />
1997 erstatteten Anzeigen 1999 von der Staatsanwaltschaft Wien<br />
Anklage wegen Mordes erhoben.<br />
23 Anläßlich einer internationalen wissenschaftlichen Tagung zur<br />
NS-Euthanasie im Psychiatrischen Krankenhaus der Stadt Wien im<br />
Jänner 1998 wurden Gespräche mit dem zuständigen Wiener<br />
Stadtrat Dr. Sepp Rieder geführt, der eine humane Lösung der<br />
Rechtsproblematik ermöglichte.<br />
70 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
KINDER UND JUGENDLICHE ALS OPFER DER NS-VERFOLGUNG<br />
JANA MÜLLER<br />
Im NS-Staat wurden Kinder und Jugendliche systematisch im Sinne der nationalsozialistischen<br />
Ideologie erzogen, gedrillt, mit Sport „ertüchtigt“, in der Hitler-Jugend und im ➤ Bund<br />
Deutscher Mädel zusammengefaßt; die jüngeren waren ➤ „Jungmädel“ und „Pimpfe“. Es<br />
genügte nicht, deutsch und arisch zu sein. Sie wurden ständig beobachtet und auf ihren<br />
„Nutzen für die Volksgemeinschaft“ geprüft. Die arische Jugend hatte erbgesund und<br />
leistungsfähig, gehorsam und angepaßt zu sein. Rassenhygiene, Erbgesundheitspflege,<br />
eugenische Ausmerzung; der erbuntüchtige, minderwertige Mensch, ebenso der unangepaßte<br />
und gemeinschaftsfremde – das waren Schlagwörter und NS-Begriffe, die das<br />
Schicksal auch der Jungen und Jüngsten mitbestimmten.<br />
Kindereuthanasie<br />
Unabhängig von der ➤ Euthanasieaktion ➤ „T4“, 1 der Tötung von körperlich und geistig<br />
Behinderten durch Gas in sechs großen Tötungsanstalten (darunter ➤ Hartheim bei Linz),<br />
wurden im Rahmen der sogenannten Kindereuthanasie 2 mindestens 37 3 „Kinderfachabteilungen“<br />
eingerichtet. Sie unterstanden einem zuständigen „Reichsausschuß“; an diesen<br />
wurde von den Anstaltsärzten Meldung über von ihnen als „lebensunwert“ eingeschätzte<br />
Kinder („Reichsausschußkinder“) gemacht. Aus Berlin kam dann die Rückmeldung als<br />
Ermächtigung bzw. Weisung zur Tötung. Die „Todesbeschleunigungen“ erfolgten meist mit<br />
Medikamenten und durch Nahrungsentzug. In der „Ostmark“ gab es drei solche Kinderfachabteilungen:<br />
in Wien ➤ „Am Spiegelgrund“, in Graz-Feldhof und in Klagenfurt. 4<br />
NS-Erziehungsheime<br />
Kinder und Jugendliche mußten auch in ihrem Verhalten, ihrer Handlungsweise den Ansprüchen<br />
der NS-Ideologie entsprechen. Die geringsten Abweichungen wurden registriert.<br />
Wenn sie sich auflehnten, den Gehorsam verweigerten, wenn ein nicht entsprechender Lebenswandel<br />
vorlag, wurden sie als schwererziehbar, „asozial“ respektive „gemeinschaftsfremd“<br />
eingestuft und in NS-Erziehungsheime eingewiesen, ebenso Kinder von „Volksschädlingen“,<br />
von Regimegegnern, aus „desolaten“ Familien usw.<br />
Ein ganzes Netz von Kinder- und Jugendheimen, von Fürsorge- und Erziehungsanstalten<br />
überzog das Deutsche Reich. Schon bestehende Heime wurden übernommen, NS-Erziehung,<br />
Drill und harte Strafen eingeführt. Es kam auch zur Gründung neuer Anstalten wie<br />
z.B. des Erziehungsheimes am Wiener „Spiegelgrund“. Weitere, recht unterschiedliche Heime<br />
in Wien waren beispielsweise die „Juchgasse“ in Wien 3 oder die „Hohe Warte“; das<br />
Zentralkinderheim und die ➤ Kinderübernahmestelle (KÜST) in der Lustkandlgasse scheinen<br />
in den meisten Akten für den Raum Wien und darüber hinaus auf. Besonders die KÜST war<br />
„Schalt- und Verteilerstelle“.<br />
Für die Bundesländer sollen hier zwei Schicksale angeführt werden: In Kärnten wurde<br />
die elfjährige Hermine Obweger 5 ihren Eltern, die Zeugen Jehovas („Bibelforscher“ 6 )<br />
waren, weggenommen und in das NS-Umerziehungsheim Feldkirchen-Waiern eingewiesen.<br />
Nachdem es den Eltern immer wieder gelungen war, mit ihrer Tochter in Kontakt zu<br />
treten, wurde Hermine in ein weit entferntes Heim in München verlegt. In Oberösterreich<br />
waren für Evelin Dietrich 7 und ihre Geschwister das Waisenhaus Steyr, das Fürsorgeheim<br />
Gleink, das Heim Baumgartenberg (und Ende Februar 1945 sogar das inzwischen<br />
geleerte Schloß Hartheim, nachdem alle Spuren entfernt worden waren) Stationen ihres<br />
Leidensweges. Die Mutter war 1941 in das Frauen-KZ Ravensbrück gebracht worden,<br />
wegen abfälliger Bemerkungen über Hitler. An alle Aufenthalte hat Evelin traumatische<br />
Erinnerungen. (…)<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
71
Kinder und Jugendliche als Opfer der NS-Verfolgung<br />
Dr. Gross<br />
Dr. Heinrich Gross, einer der Euthanasieärzte in der Kinderklinik am Wiener „Spiegelgrund“,<br />
machte nach 1945 wissenschaftliche Karriere; die Gehirne der ermordeten Kinder<br />
waren für ihn Forschungsmaterial.<br />
Anfang der fünfziger Jahre war ein Gerichtsurteil gegen ihn aufgehoben und das Verfahren<br />
eingestellt worden. Jetzt beschäftigt Dr. Gross erneut die österreichische Justiz. Jahrzehntelang<br />
war er bei den Gerichten als vielbeschäftigter Gerichtsgutachter ein- und ausgegangen.<br />
Besonders in den letzten Monaten wurde über ihn und die Vorgänge am „Spiegelgrund“<br />
auch in internationalen Medien berichtet.<br />
In einem ZDF-Bericht vom November 1998, der in Deutschland Aufsehen erregte, kam<br />
auch Waltraud Häupl zu Wort. Sie hat ihre Schwester am „Spiegelgrund“ verloren. Erst<br />
1997 erfuhr sie von den tatsächlichen Hintergründen des Todes der vierjährigen Annemarie<br />
im Jahre 1942. Sie begann zu recherchieren und erhielt einen überraschend gut erhaltenen<br />
Akt. Es steht fest, daß das Kind zu jenen Opfern gehört, deren Gehirne als Präparate<br />
in der Pathologie des Psychiatrischen Krankenhauses noch heute gelagert sind.<br />
Der Akt ist von besonderer Dichte und Aussagekraft. Er enthält mehrfach Unterschriften<br />
von Dr. Gross und Dr. Illing sowie handschriftliche Vermerke von Dr. Gross. Sogar die Verabreichung<br />
von Luminal scheint einmal auf. Nach einem Krankenhausaufenthalt war vom<br />
Amtsarzt ein Gutachten erstellt worden. Aus diesem geht hervor: „ … kräftiges, aber kleines<br />
Kind – keine Mißbildungen – Rachitis in Heilung – aufmerksam – das untersuchte Kind<br />
eignet sich nicht zur Aufnahme in eine Anstalt für schwachsinnige Kinder – entwicklungsund<br />
erziehungsfähig – pflegebedürftig …“ Die vorgedruckte Frage „Schwachsinn?“ ist mit<br />
nein beantwortet.<br />
Das Kind wird am 6. 6. 1941 auf den „Spiegelgrund“ überstellt; nach der Aufnahme in<br />
der „Kinderfachabteilung“ wird es von Dr. Gross erneut untersucht und photographiert; in<br />
die Rubrik Diagnose wird Idiotie eingesetzt, Datum 6. 6. 1941. In der Kartei findet sich<br />
immerhin die Bestätigung, daß das Mädchen „gut entwickelt und gut genährt“ ist. Da<br />
sogar die Gewichtstabellen erhalten sind, ist systematische Unterernährung in der weiteren<br />
Folge nachweisbar. Tagesberichte schildern den späteren Zustand: „… das Kind schreit,<br />
näßt, spricht nicht, kann nicht gehen.“ Eine Eintragung fällt ganz aus diesem Rahmen,<br />
bringt Schimmer von Menschlichkeit, geschrieben von einer Schwester: „Nur sehr schwer<br />
ist dem Kinde ein Lächeln zu entlocken, umso mehr war ich erstaunt, als ich bei dem Spiel<br />
‚Patsch Handerl z’samm‘ ein herzliches Lachen erreichen konnte und merkte, daß es Freude<br />
am Spiel findet.“<br />
Am 26. 9. 1942 ist Annemarie tot. Eine Meldung war an den Reichsausschuß gegangen;<br />
die Rückmeldung aus Berlin war fast immer das Todesurteil. Die geschwächten Kinder<br />
wurden mit Luminal betäubt und der Kälte ausgesetzt, die Folge war der vermeintlich natürliche<br />
Tod durch Lungenentzündung. So auch bei Annemarie.<br />
Zum Minensuchen noch gebraucht<br />
Im Mai vergangenen Jahres erhielt Johann Gross eine Vorladung in das Landesgericht für<br />
Strafsachen Wien. In Anwesenheit eines Arztes wurde er ausführlich über Vorgänge<br />
befragt, die mehr als 50 Jahre zurückliegen. Es ging um die Voruntersuchung gegen Dr.<br />
Heinrich Gross.<br />
Johann G. besitzt ein außerordentlich gutes Erinnerungsvermögen. Auf Grund der Causa<br />
Dr. Gross, der vermehrten Berichterstattung in den Medien und durch Veranstaltungen und<br />
TV-Berichte über Themen wie „NS-Medizin“ oder „Vergessene NS-Opfer“ hat er sich mittlerweile<br />
seinen Erinnerungen gestellt und begonnen, sie niederzuschreiben.<br />
Johann G. ist 1930 in Wien geboren, sein Vater war Teilinvalide, die Mutter verließ die<br />
Familie. Er kam auf mehrere Pflegeplätze. Als er bei einer Pflegefamilie geborgen und<br />
glücklich ist, wird er vom Vater zurückgeholt, offenbar wegen des Kindergeldes. Der Vater<br />
72 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
ist Trinker und schlägt den Buben. In Pimpfuniform des ➤ Deutschen Jungvolks nimmt dieser<br />
von einer Sammelaktion Reißaus und fährt spontan mit der Sammelbüchse (er braucht Geld<br />
für Fahrt und Essen) zur geliebten Hedi-Tant‘ von der letzten Pflegestelle. Amtlich liest sich<br />
das so: „Ist mit der Sammelbüchse der NSV, die er erbrochen hat, nach St. Pölten durchgegangen<br />
und wurde von der Kripo interniert.“ Er ist nun nicht mehr würdig, das „Ehrenkleid<br />
der Jugend“ zu tragen, wird dem Zehnjährigen gesagt. Von da an ist sein Weg durch die<br />
NS-Erziehungsheime vorgezeichnet.<br />
Im Waisenhaus Mödling sind sadistische Erzieher am Werk, „Kleiderappelle“, „Nachtspiele“,<br />
Froschhüpfen, Robben, Drill und Schläge sind Alltag. Nach dem zweiten Fluchtversuch<br />
kommt es zu einem regelrechten Strafritual im leeren Schlafsaal, der Bub allein, die<br />
Erzieher zu viert. Im Juli 1941 wird er schließlich in das Erziehungsheim am „Spiegelgrund“<br />
überstellt. Im Anschluß an die Aufnahme lernt er Dr. Gross kennen, der u.a. seinen<br />
Kopf vermißt. Er sollte ihm in Zukunft noch oft begegnen. Schon durch die Namensgleichheit<br />
blieb „Dr. Gross“ für immer im Gedächtnis haften.<br />
Am „Spiegelgrund“ ist vieles anders. Nur Schwestern statt Erzieher, die Fenster sind vergittert<br />
und versperrt, auch jede Tür ist versperrt und muß immer erst geöffnet werden. Vieles<br />
geht fast lautlos und für ihn unheimlich vor sich. Besonders unwürdig ist das Klosett, mit<br />
einer Halbtür und somit einsehbar; jedes Mal mußte gemeldet werden, ob „klein“ oder<br />
„groß“ zu erwarten war … Es kommt laut Akt zur ersten Flucht vom „Spiegelgrund“ am<br />
16. 8. 1941. Er wird im Prater aufgegriffen und bereits nach zwei Tagen wieder zurückgebracht.<br />
Nach Schlägen von Dr. Krenek, dem Leiter des Erziehungsheimes, kommt er in<br />
eine Einzelzelle in seinem Pavillon (Nr.7). Die erste „Speiinjektion“ durch Dr. Gross folgt. Er<br />
glaubt tatsächlich, daß er stirbt, so schlimm ist es.<br />
Im Pavillon 13 gehen die Kinder zur Schule. Im Februar 1942 hatte Johann G. ein grausiges<br />
Erlebnis. Kurz vor dem Pavillon 13 (d.h. direkt neben dem „Todespavillon“ 15 – Anmerkung<br />
der Verf.) zog ein Hausarbeiter einen zweirädrigen Karren an den Schulkindern<br />
vorbei; darin lagen tote Kleinkinder, nackt und eigenartig verfärbt. Die Begleitschwester<br />
nahm kaltblütig das Entsetzen der Kinder zur Kenntnis. Offenbar bemühte man sich nicht<br />
um Geheimhaltung vor den Kindern, der Wagen war nicht einmal abgedeckt.<br />
Nach einer weiteren Flucht wird er in den sogenannten Strafpavillon 11 verlegt. Einmal<br />
wird er von vier Schwestern gleichzeitig verprügelt. In der Isolation des Kellers lernt er<br />
Jugendliche kennen, älter als er, die offenbar einiges hinter sich haben, darunter einer, der<br />
„lange Karl“, von dem er erfährt, daß es auch so etwas wie Auflehnung gegen Hitler gibt.<br />
Bald darauf ist der „lange Karl“ nicht mehr da.<br />
Immer wieder war Johann G. wochenlang im Keller, hinaus ging es nur zur Schule und<br />
zum Schlafen im ersten Stock. Von Nr. 11 konnte er den gegenüberliegenden Pavillon, der<br />
im ansteigenden Gelände höher gelegen war, sehr gut einsehen: Pavillon 17 der Euthanasieklinik.<br />
Oft sah er, wie die Bettchen mit den Kleinkindern über Nacht auf den Balkon gestellt<br />
wurden, der Kälte ausgesetzt, und hörte ihr Weinen und Wimmern. Er begriff nun,<br />
was sich hier abspielte. Den Leichenkarren sah er mindestens noch einmal.<br />
Einmal gelingt ihm sogar die Flucht aus der Einzelzelle. Es zieht ihn auf den Wiener<br />
Naschmarkt und mehrmals nach Hasenleiten (im 11. Bezirk) in eine Barackensiedlung mit<br />
„Randexistenzen“, für ihn sind es aber Lebenskünstler. Mit ihrer Hilfe verbringt er dort in<br />
der Umgebung sogar einige Wochen, seine längste Zeit in Freiheit (Frühjahr/Sommer<br />
1942). Nach Rückkehr auf den „Spiegelgrund“ bekam er weiterhin Injektionen in die<br />
Hand, Schwefelinjektionen in den Oberschenkel; diese brannten fürchterlich, lähmten<br />
teilweise und machten eine Fortbewegung unmöglich. Einmal bekam er kurz hintereinander<br />
beide, da war man zu viert gekommen, davon zwei Ärzte, davon einer wiederum Dr.<br />
Gross. Als nach der Injektion die Bewegungsstörung bereits einsetzte, meinte Dr. Gross zu<br />
ihm, er könne jedenfalls zum Minensuchen noch gebraucht werden.<br />
Johann G. dürfte zu den am häufigsten „entwichenen“ (Akt) Heiminsassen gehört haben.<br />
Das verschaffte ihm bei den anderen einen gewissen Bekanntheitsgrad und eine Art<br />
Respekt. Er galt auch als guter Schüler. Mit Dr. Gross verband ihn immer enger das gewis-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
73<br />
Jana Müller
Bestrafungsritual<br />
Kinder und Jugendliche als Opfer der NS-Verfolgung<br />
sermaßen gemeinsame Bestrafungsritual der Injektionen. Dr. Gross ist ihm unvergeßlich geblieben,<br />
und es könnte vermutet werden, daß auch umgekehrt dieser Heimbub dem NS-<br />
Arzt im Gedächtnis haften geblieben ist.<br />
Die (mit Mödling) insgesamt elf Fluchten waren nicht vorrangig Ausdruck eines „Wandertriebes“;<br />
es war vor allem eine Kampfansage, sein Krieg, wie er selbst es nennt, gegen das<br />
System, gegen die Demütigungen, von denen alle betroffen waren. Er verabscheute die<br />
kriecherische Haltung, die sich viele aneigneten, um durchzukommen. Es war der eiserne<br />
Wille, sich nicht brechen zu lassen.<br />
Zuletzt will Heimleiter Krenek ihn nicht mehr „haben“. Im Frühsommer 1943 kommt er<br />
zurück nach Mödling.<br />
Alfred Grasel, Johann Gross, Waltraud Häupl, Anna Maierhofer und Franz Pulkert konnten<br />
von der Verfasserin persönlich befragt werden. Das Gespräch mit Emil Blaschek führte<br />
Anna Maierhofer. Alle Zeitzeugen leben in Wien.<br />
1 Tarnbezeichnung für die beschriebene Euthanasieaktion nach der<br />
Zentrale in Berlin, Tiergartenstraße 4 (Kanzlei des Führers).<br />
2 Zielgruppe dieser speziellen Kindermordaktion waren Kinder,<br />
die sich nicht in Anstaltspflege befanden – denn diese wurden<br />
ohnehin im Zuge der Aktion „T4“ (...) erfaßt –, insbesondere<br />
Neugeborene. Durch einen geheimen Runderlaß des Reichsministeriums<br />
des Inneren vom 18. 8. 1939 (...) wurden alle Hebammen<br />
und Ärzte verpflichtet, in den Kliniken alle Neugeborenen<br />
mit schweren angeborenen Leiden (...) sowie alle Kinder bis zu<br />
drei Jahren mit diesen Leiden den zuständigen Gesundheitsämtern<br />
mittels eines Formblattes zu melden. In: Wolfgang Neugebauer,<br />
Die Klinik „Am Spiegelgrund“ 1940-1945 – Eine „Kinderfachabteilung“<br />
im Rahmen der NS-“Euthanasie“, in: Jahrbuch<br />
Aus: Betrifft Widerstand 43/2 1999, S. 4–13.<br />
des Vereins für Geschichte der Stadt Wien, Band 52/53, Wien<br />
1996/97, S. 293.<br />
3 Matthias Dahl, Endstation Spiegelgrund. Die Tötung behinderter<br />
Kinder während des Nationalsozialismus am Beispiel einer Kinderfachabteilung<br />
in Wien 1940-1945, Erasmus, Wien 1998, S. 32.<br />
4 Ebda., u.a. S. 29, 35, 41.<br />
5 Geschichte der Familie Obweger aus: Geschichtsarchiv der Zeugen<br />
Jehovas, Wien.<br />
6 Die Zeugen Jehovas, die 1931 diesen Namen annahmen, wurden<br />
in der NS-Zeit nach ihrer früheren Bezeichnung Erste oder Internationale<br />
Bibelforscher genannt.<br />
7 Walter Kohl, Die Pyramiden von Hartheim, Edition Geschichte der<br />
Heimat, Grünbach 1997, S. 390ff.<br />
74 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
FÜRSORGE – ARBEITSHAUS – KZ: DAS LEBEN DER BETTY VOSS<br />
MARTINA SCHEITENBERGER/MARTINA JUNG<br />
„Asozial“ 1<br />
Der Nationalsozialismus verfolgte jede Lebensäußerung, die nicht dem sogenannten<br />
„gesunden deutschen Volksempfinden“ entsprach. 2 Soziale bzw. kulturelle Verhaltensweisen,<br />
die von der Norm des nationalsozialistischen Gesellschaftsmodells abwichen, wurden<br />
von der Bevölkerung bereitwillig denunziert und von den dafür zuständigen Behörden<br />
kontrolliert und im Zweifelsfall korrigiert. Dazu griff das nationalsozialistische Regime auf<br />
die bestehenden Einrichtungen wie Gesundheits- und Sozialämter (Fürsorgeämter) zurück,<br />
die als verlängerter Arm der Verfolgungsbehörden weiter ausgebaut wurden. Diese Einrichtungen<br />
registrierten, erfaßten, beurteilten und gaben ihre Informationen an Polizei und<br />
Gerichte weiter. Die Beurteilungen von Fürsorgerinnen konnten zu Entmündigungen,<br />
Zwangssterilisation, Einweisungen in Arbeitshäuser und zu Konzentrationslagerhaft auf unbestimmte<br />
Zeit führen. Begriffe wie „asozial“ und „arbeitsscheu“ brandmarkten die Betroffenen,<br />
auch lange nach 1945.<br />
In der Mehrzahl waren die Menschen, die als asozial eingestuft wurden, arm und abhängig<br />
von staatlicher Unterstützung, viele von ihnen hatten keinen festen Wohnsitz. Zu ihnen<br />
zählten Bettler, Fürsorgeempfänger, Wohnungslose, Landstreicher, Alkoholiker, Straftäter,<br />
Homosexuelle, unterhaltssäumige Väter, Prostituierte und „Zigeuner“. 3 Sinti und Roma wurden<br />
auf Grund ihrer „zigeunerischen“ Lebensweise als „asozial“ eingestuft. 4 In den Konzentrationslagern<br />
wurden diesen Gruppen drei verschiedene Winkel zugeordnet, zum Teil<br />
willkürlich. Der schwarze Winkel mit einem A galt „Asozialen“, ein grüner Winkel „Kriminellen“,<br />
„männlichen Homosexuellen“ 5 wurde ein rosa Winkel zugewiesen.<br />
Die Definition des Begriffes „asozial“ war derart dehnbar, daß ein Heilbronner Obermedizinalrat<br />
als Frühsymptome eines „asozialen“ Verhaltens bei Jugendlichen beispielsweise<br />
Rauchen, Faulheit, Eigensinn, Trotz, Zerstörungslust, Schulschwänzen u.a. ansah. 6<br />
„Schließlich schien vielen gerade eine diffuse Kategorie geeignet, um im Namen des<br />
‚Volksempfindens‘ alles darin zu sammeln, das sie störte.“ 7 In einem Handbuch über Erbkrankheiten<br />
aus dem Jahre 1937 verstieg sich ein Verfasser zu der Idee, die Definition von<br />
„asozial“ dem „Volksempfinden“ überlassen zu wollen. 8 Ein Gesetz, das die Verfolgung und<br />
Inhaftierung von „Asozialen“ geregelt hätte, existierte nicht, jedoch wurden zahlreiche Erlässe<br />
und Verordnungen geschaffen, die der Verfolgung einen legalen Anstrich verliehen. 9<br />
Diese Politik führte im Nationalsozialismus nach Peukert „zur Ausblendung jeglicher Rechtsgarantie<br />
für Menschen mit abweichendem Verhalten“. Die Deklarierung als „asozial“ funktionierte<br />
als Vorstufe zu „ihrer Auslieferung an polizeiliche Allmacht, ja zur systematischen<br />
Ausrottung, und als Legitimation für die Mißhandlungen, Morde und die allgemein hohe<br />
Sterblichkeit in den Konzentrationslagern 10 “. Die Entwicklung dahin vollzog sich allmählich<br />
und begann nicht erst mit der Machtergreifung 1933. Schon zuvor wurden, verstärkt durch<br />
die ökonomische Krise in den zwanziger Jahren, vermehrt Stimmen laut, die in der Gruppe<br />
der „Unangepaßten“ eine Bedrohung sahen. 11 Die Argumentation, daß die Menschen nach<br />
ihrem Nutzen für die Gesellschaft beurteilt werden müßten, wurde im Laufe der dreißiger<br />
Jahre immer häufiger formuliert. Daraus wurde abgeleitet, daß Infektionskrankheiten wie<br />
Tuberkulose, die als Armenkrankheit galt, nicht als persönliches Leid für den Kranken,<br />
sondern als „volksschädigend“ anzusehen seien. 12 So konnte es einem Tuberkulosekranken<br />
passieren, daß er in eine Bewahranstalt zur Zwangsarbeit eingewiesen wurde. 13<br />
Durch die tatkräftige Mithilfe zahlreicher Wissenschaftler erhielten „Reaktionen der sozialen<br />
Mehrheit auf abweichendes Verhalten (...) ihre biologische Legitimation“, indem diese<br />
durch fragwürdige Untersuchungen nachzuweisen versuchten, daß das, „was Juden zu<br />
Juden mache“, „Geisteskranke zu Geisteskranken“, „Zigeuner zu Zigeunern“ und „Asoziale<br />
zu Asozialen“, in den Genen angelegt, erblich und somit unwiderruflich sei. 14 Jegliche<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
75<br />
Gesundheits- und<br />
Fürsorgeämter<br />
als verlängerter<br />
Arm der Verfolgungsbehörden
„Rassenhygiene“<br />
als Legitimation<br />
für Verfolgung<br />
und Vernichtung<br />
Die „totale Erfassung“<br />
durch<br />
Polizei, Gesundheits-<br />
und Sozialbehörden<br />
Fürsorge – Arbeitshaus – KZ: Das Leben der Betty Voss<br />
sozialen Aspekte wurden rigoros ausgeblendet oder verschleiert. Wissenschaftler machten<br />
sich daran, ganze Familien nach ihren Erbanlagen, etwa nach „asozialen Anlagen“ wie<br />
„Schwachsinnigkeit“, zu untersuchen. Rassenhygieniker, die auf eine lange Tradition zurückblicken<br />
konnten, lieferten im Nationalsozialismus die Argumente zu Verfolgung und Vernichtung<br />
von gesellschaftlichen Randgruppen. Ökonomische Ursachen für soziale Verelendung,<br />
die Tatsache, daß viele Menschen in der Zeit der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger<br />
Jahre arbeitslos geworden waren, wurden ausgeblendet. Vor allem nachdem die Nationalsozialisten<br />
das Problem der Arbeitslosigkeit nach der Machtergreifung mit Beschäftigungsprogrammen<br />
scheinbar gelöst hatten, wurden Fürsorgeempfänger für ihre Lage verantwortlich<br />
gemacht und ihnen persönliche Unfähigkeit nachgesagt. Argumentiert wurde in die<br />
Richtung, daß die sogenannten „Asozialen“ nicht imstande seien, ihr Leben eigenverantwortlich<br />
zu gestalten, und es entsprechend ihrer Veranlagung auch nie können würden. 15<br />
Das ➤ „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das 1934 in Kraft getreten<br />
war, bildete die logische Konsequenz aus dieser geistigen Haltung. Von dieser Zeit bis<br />
1945 sind auf Grund dieses Gesetzes etwa 400.000 Zwangssterilisationen durchgeführt<br />
worden. 16 Der angeblich nachgewiesene erblich veranlagte „Schwachsinn“ eines Menschen<br />
hatte eine Zwangssterilisation zur Folge. Diese „Diagnose“ führte zu den meisten<br />
Zwangssterilisationen. 17 Während „wertvolle Frauen“ aus „erbgesunden Familien“ eine<br />
Geburtenförderung erfahren sollten, setzte man bei den „minderwertigen Frauen“ ein<br />
Gebärverbot durch. Zudem verbot das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der<br />
deutschen Ehre“ von 1935 Ehe und Geschlechtsverkehr zwischen Deutschen und Juden.<br />
1942 wurde das Gesetz noch um den Begriff „Zigeuner“ erweitert. 18 Bereits 1933 wurden<br />
„sexuell Unangepaßte“, Prostituierte und Frauen, denen häufig wechselnder Geschlechtsverkehr<br />
nachgesagt wurde, registriert, verfolgt und später als „Asoziale“ in Konzentrationslager<br />
verschleppt. 19<br />
„Daß es dem Staat allein um Ordnung ging und nicht etwa um Moral, bewies sein zynisches<br />
Bestreben, Offiziere, Soldaten und sogar Zwangsarbeiter in den Konzentrationslagern<br />
kontrolliert mit Prostituierten zu ‚versorgen’. Faustregel eines KZ-Planers: zehn Frauen<br />
pro 3000 Arbeiter.“ 20<br />
Frauen konnten bereits in die Mühlen der Ermittlungsbehörden geraten, wenn ein Verdacht<br />
bestand, daß sie „eigene Wege gingen“ oder sich „auf Rummelplätzen herumtrieben“.<br />
21 In Ermangelung von Beweisen wurde im Sinne des „Volksganzen“ entschieden und<br />
nicht im Sinne der jeweiligen Person. 22 Eine „ordentliche Frau“ sollte einen „krisenanfälligen<br />
Gelegenheitsverbrecher“ durch ihren Einfluß wieder auf die rechte Bahn rücken können.<br />
War aber eine „liederliche Frau“ mit einem „willensschwachen Mann“ verheiratet, so<br />
konnte dieser Umstand nach dem Erbforscher Stumpfl „verheerende Auswirkungen auf den<br />
Lebensweg“ des Mannes haben. 23<br />
Angestrebt wurde eine totale Erfassung zur konsequenten Repression allen abweichenden<br />
Verhaltens in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Sexualität. Dazu dienten Gesetze,<br />
Erlasse und Verordnungen. Polizei, Gesundheits- und Sozialbehörden führten die „Maßgaben“<br />
aus, sie arbeiteten Hand in Hand und übertrafen zuweilen die verordneten Anforderungen.<br />
24<br />
Ein weiteres Zwangsmittel zur Erfassung waren Entmündigungsverfahren durch die Erbgesundheitsgerichte,<br />
die bei angeblich nachgewiesenem „Schwachsinn“ Eheverbot und<br />
Zwangssterilisation anordnen konnten. Die Sterilisationsverfahren galten vor allem Frauen,<br />
insbesondere unverheirateten Müttern mit mehr als einem Kind. 25 Der Sterilisation ging vielfach<br />
ein Entmündigungsverfahren voraus: „Das Verfahren war aus Sicht der Opfer nahezu<br />
aussichtslos: Fürsorgerinnen und Pflegeämter beantragten die Entmündigung bei den Amtsgerichten<br />
mit der Begründung, der Betroffene sei ‚nicht fähig’, den ‚Sinn der Unfruchtbarmachung‘<br />
zu erfassen.“ Daraufhin wurden amtliche Pfleger eingesetzt, die die Sterilisation<br />
ihrer Mündel beantragten. 26 Zur „Diagnose“ wurden „Intelligenzprüfbögen“ herangezogen,<br />
die Fragen wie „Was ist der Unterschied zwischen einer Leiter und einer Treppe?“, „Was<br />
ist Elektrizität?“ oder „Welche Schlacht hat Hindenburg geschlagen?“ enthielten. 27<br />
76 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Die Situation für angeblich „Asoziale“ verschärfte sich im Laufe der dreißiger Jahre bis<br />
hin zur Einweisung in ein Konzentrationslager auf unbestimmte Zeit. 1933 wurden große<br />
Bettlerrazzien organisiert, die noch kurzfristige Haftzeiten für die Festgenommenen zur Folge<br />
hatten. Es konnte zusätzlich zur Haftzeit eine Zwangseinweisung in ein Arbeitshaus erfolgen.<br />
Dort mußten die Inhaftierten in der Regel ein Jahr verbringen, wurden danach aber<br />
wieder auf freien Fuß gesetzt. Ab 1934 konnte die Arbeitshaushaft unbefristet verlängert<br />
werden, die Unterbringung war nun „tendenziell lebenslänglich“. 28 Frauen wurden vermehrt<br />
ab 1936 in Arbeitshäuser eingewiesen. Die Begründung war zumeist „sittlicher Verfall“, auf<br />
Grund dessen sie dem Staat finanziell zur Last fallen würden. Dabei konnte es sich lediglich<br />
um Krankenhauskosten zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten handeln. 29<br />
Im Zuge des Arbeitskräftemangels um 1937/38 strebte insbesondere die ➤ SS an, alle,<br />
die auffällig geworden waren, wenn nötig mit Gewalt zur Arbeit zu zwingen. Ein Erlaß<br />
über „die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei“ ebnete der SS den<br />
Weg, „Asoziale“ systematisch in Konzentrationslager zu verschleppen. Ab diesem Zeitpunkt<br />
hatten Polizei und ➤ Gestapo einen Zugriff auf angeblich „Arbeitsscheue“. Darauf<br />
folgten Verhaftungswellen durch die Gestapo, die besonders diejenigen zu fürchten hatten,<br />
die bereits in einem Arbeitshaus gewesen waren. Ihnen drohte eine Einweisung in ein KZ<br />
als „Vorbeugehaft“. 30<br />
Wie sich so eine Verkettung von Ereignissen abspielen konnte, verdeutlicht die Biographie<br />
von Betty Voss, die die Auswirkungen der verschärften Verfolgung von Armen und<br />
„Unangepaßten“ am eigenen Leibe zu spüren bekam.<br />
Betty Voss 31<br />
In einem kleinen Dorf bei Magdeburg wurde Betty Voss am 25.11.1911 geboren. Sie war<br />
die älteste von drei Geschwistern und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, ihre Mutter<br />
war Landarbeiterin.<br />
„Meine allererste Erinnerung an die Kindheit, da war ich fünf Jahre. Da war meine Mutter<br />
schwerkrank, und mein Vater hat im Steinbruch gearbeitet.“<br />
Betty Voss berichtet in einem Interview, daß ihr Vater im Streit seine kranke Frau stieß,<br />
daß diese fiel und an den Verletzungen starb. Das Gericht glaubte Betty Voss nicht, da sie<br />
noch ein Kind war, ihr Vater wurde freigesprochen. Er heiratete bald wieder. Unter der<br />
Stiefmutter, die die Kinder schlug, litt Betty Voss sehr.<br />
„(...) und in der Schule, da durften wir uns nicht ausziehen, wenn der Schularzt kam, da<br />
mußten wir sagen, wir sind gefallen!“<br />
Die Mißhandlungen ließen sich bei einer Reihenuntersuchung in der Schule nicht verheimlichen.<br />
Wegen Kindesmißhandlung bekam die Stiefmutter eine Haftstrafe von zwei Jahren.<br />
Nach deren Entlassung wurde die Situation für Betty Voss immer unerträglicher. Sie ging<br />
1925, nachdem sie die Schule absolviert hatte, für drei Jahre zu einem Verwandten nach<br />
Brandenburg, bei dem sie eine Ausbildung als Gärtnerin machte. Nach Abschluß der Ausbildung<br />
mußte sie zurück zu ihren Eltern. Das Verhältnis zwischen der Stiefmutter und Betty<br />
Voss war unverändert schlecht. Sie fühlte sich von ihrer Stiefmutter vollkommen ausgenutzt,<br />
weil sie beispielsweise ihren gesamten Lohn als Taglöhnerin zu Hause abzugeben hatte.<br />
Deshalb verließ sie heimlich ihr Elternhaus, obwohl sie noch nicht volljährig war, und begab<br />
sich auf Wanderschaft.<br />
„Ja, wir waren, ich war auf Tippelei, und im Frühjahr, im Sommer, habe ich mir beim<br />
Bauern Arbeit gesucht, da hab’ ich den ganzen Sommer gearbeitet, das Geld habe ich mir<br />
gespart, hab’ mir Zeug gekauft, und wenn es Herbst war, war nichts mehr zu machen, bin<br />
ich weiter getippelt.“<br />
In dieser Zeit freundete sie sich mit einem Landarbeiter an. Sie wurde schwanger. Noch<br />
vor der Geburt ihres Kindes ertrank ihr Freund in einem See. Auf Grund der Schwangerschaft<br />
konnte sie bald nicht mehr arbeiten, sie wanderte weiter in Richtung Norden und<br />
übernachtete in Obdachlosenheimen.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Martina Scheitenberger/Martina Jung<br />
77<br />
„Zwischenstation“<br />
Arbeitshaus<br />
Das Konzentrationslager<br />
als<br />
„Vorbeugehaft“<br />
Obdachlosenasyl<br />
– erste Kontakte<br />
mit der Fürsorge
Von der Zwangspsychiatrie<br />
ins<br />
Arbeitshaus<br />
Fürsorge – Arbeitshaus – KZ: Das Leben der Betty Voss<br />
„Ich bin ja immer in ein Obdachlosenasyl gegangen, ich bin nie in eine Herberge, wo<br />
Männer waren. Es gab da Herbergen, da konnten Männer und Frauen, ich bin immer in<br />
ein Obdachlosenasyl, da war ich am sichersten.“<br />
Das Kind bekam Betty Voss in einer Gefängniszelle in Berlin am Alexanderplatz. Da sie<br />
erst 20 Jahre alt war, schickte die Polizei sie zurück zu ihren Eltern, die sie als vermißt gemeldet<br />
hatten. Nach einem Jahr hielt es Betty Voss zu Hause nicht mehr aus und ging abermals<br />
auf Wanderschaft, diesmal nach Kiel.<br />
„Erstens mal hab’ ich gefragt, wo hier ’ne Unterkunft ist für Frauen, da hat man mir gesagt,<br />
in der Gartenstraße bei Schwester Therese, und da bin ich hin, anstandshalber, um<br />
nicht auf der Straße zu liegen und rumzutreiben (...) und gleich, oh die Therese, hat gleich<br />
telephoniert, nach dem Gesundheitsamt: ‚Hier ist jetzt wieder eine Neue gekommen, wo<br />
die herkommt, wissen wir nicht richtig (…).‘“<br />
Daraufhin mußte sich Betty Voss auf Veranlassung des Gesundheitsamtes untersuchen lassen.<br />
In dem Heim lernte sie ihren ersten Mann kennen, den sie 1933 heiratete. Sie bekam<br />
zwei weitere Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Familie lebte von der Unterstützung<br />
durch das Fürsorgeamt. Die Arbeitslosigkeit des Mannes, seine Alkoholprobleme und die<br />
permanenten Geldsorgen führten schnell zu Spannungen in der Ehe. Häufig mußte die Familie<br />
wegen ihrer Mietzahlungsrückstände die Wohnung wechseln. Betty Voss wusch für<br />
Frauen aus der Nachbarschaft Wäsche und ging zeitweilig betteln, obwohl das verboten<br />
war, um ihre Kinder zu ernähren.<br />
„Da war ich gezwungen von Haus zu Haus, von Treppe zu Treppe, mit einem Kind an<br />
der Hand und einem im Bauch betteln [zu] gehen.“<br />
Zweimal in der Woche kam ein Mann vom Fürsorgeamt und kontrollierte die häuslichen<br />
Verhältnisse. Bei einem dieser Besuche kam es zu einem Streit zwischen Betty Voss und<br />
ihrem Mann, der sie tätlich angriff. Der Fürsorger forderte sie danach auf, sich scheiden zu<br />
lassen. Sie weigerte sich. Kurze Zeit später bekam sie ihr drittes Kind. Als Betty Voss keine<br />
Möglichkeit mehr sah, ihre Kinder zu ernähren, gab sie die beiden größeren Kinder in ein<br />
katholisches Kinderheim. Obwohl sie regelmäßig Besuche im Heim machte, wurden die<br />
Kinder ohne Benachrichtigung der Mutter in ein anderes Heim überwiesen. Die Behörden<br />
leiteten ein Entmündigungsverfahren gegen Betty Voss ein. 1936 wurde sie entmündigt.<br />
Voraus gingen eine medizinische Untersuchung und ein „Intelligenztest“.<br />
„Professor Hallermann war in der Nervenklinik hier in Kiel der Höchste. Da hat er gesagt:<br />
‚Frau Diederich, was ist denn der Unterschied zwischen Treppe und Leiter?‘ Und ich sag:<br />
‚Aber Herr Doktor, auf der Leiter gehen Sie auf Sprossen und auf der Treppe auf Stufen.‘“<br />
Nach der medizinischen Untersuchung: „ (...) dann sag ich: ‚Na, Herr Professor, wie ist<br />
denn der Befund nach zwei Tage?‘ ‚Ach’, sagt der Kleine: ‚Da verstehst du nichts von, ist<br />
o.B.‘ ‚Ach ja’, sag ich, ‚ohne Befund, nich’!‘“<br />
Es folgte die Einweisung in eine Nervenklinik nach Schleswig, wo sie drei Jahre zwangsweise<br />
bleiben mußte.<br />
„Und der Oberarzt Dr. Krei ( in Schleswig, d.V.), der hat zu mir gesagt: ‚Laß dich scheiden<br />
von dem Mann!‘ (...) Wir haben menschlich gesprochen, wir beiden, und er wußte,<br />
mir fehlt nichts. Er hat gesagt, ihm sind die Hände gebunden, wenn’s nach ihm ginge, würde<br />
er mich rauslassen. Aber ich ginge gleich wieder nach Kiel, und dann würd‘ er sein Amt<br />
los, nich. So hat er mir das dann erzählt, und ich sag: ‚Und scheiden laß ich mir nicht!’“<br />
„Ach, und da hab ich dann gesessen bis 1939, fing dann der Krieg an. Da hab ich denn<br />
gesagt: ‚Nun wird es Zeit, (...) Herr Oberarzt, ich laß mich scheiden, dann bin ich frei!‘“<br />
1939 ließ sich Betty Voss von ihrem Mann, der inzwischen in Hannover wohnte, scheiden.<br />
Sie blieb weiter entmündigt und bekam deshalb nicht das Sorgerecht für ihre Kinder,<br />
die sie auf Veranlassung der Familie ihres Mannes nicht sehen durfte. Sie sollte gleich nach<br />
der Scheidung zurück in das Dorf fahren, aus dem sie stammte.<br />
„Ich fahr nicht nach Hause, ich fahr wieder nach Kiel, bin ich wieder in Kiel, sehen sie<br />
(vermutlich das Fürsorge- oder Gesundheitsamt, d.V.) mich wieder, ein Jahr Arbeitshaus,<br />
Glückstadt.“<br />
78 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Martina Scheitenberger/Martina Jung<br />
Nach ihrer Ankunft in Kiel geriet Betty Voss erneut in die Erfassungsmühlen der städtischen<br />
Behörden, die sie zu einem Jahr Arbeitshaus verurteilten. Nach ihrer Entlassung<br />
aus dem Arbeitshaus in Glückstadt arbeitete sie für längere Zeit bei einem Flugzeugersatzteilehersteller<br />
in der Rüstungsindustrie. Dort freundete sie sich mit einem holländischen<br />
Zwangsarbeiter an. Die Beziehung war sehr gefährlich, da jeglicher Kontakt zwischen<br />
Deutschen und Zwangsarbeitern streng untersagt war. Auf Grund der Meldung des Personalchefs<br />
der Fabrik, der insgesamt sieben Holländer und sieben Fabrikarbeiterinnen<br />
wegen unerlaubter Kontakte denunzierte, wurde Betty Voss gemeinsam mit den anderen<br />
verhaftet. Nach ein paar Tagen in einem Gefängnis brachte man sie mit den anderen<br />
sechs Frauen am 3. Februar in das Konzentrationslager Ravensbrück. Die Begründung für<br />
ihre Einweisung lautete „Herumtreiberei“. Ihr holländischer Freund wurde in das KZ<br />
Neuengamme verschleppt und dort getötet. An die Ankunft in Ravensbrück erinnert sich<br />
Betty Voss:<br />
„Da war’n Raum, da saß’n SS-Mann, so breitbeinig, ‚Wat bist du für eine?‘ ‚Deutsche.‘<br />
Klatsch, klatsch bumm, ha, ha, gleich rechts und links eine weg. (...) Da war so’n großer<br />
Baderaum und hinten da in dem anderen Raum, da schrien sie alle. Da hab’ ich mal um<br />
die Ecke geschielt, oh, da wurden die Haare abgeschnitten, alle, alle! Die haben mich dort<br />
entehrt, die haben mich entmündigt, die haben mir die Haare abgeschnitten, die haben mir<br />
doch entehrt da, die ganzen Jahr’ in Ravensbrück, und jetzt soll ich nichts dafür haben!“<br />
Im KZ wies man ihr die Häftlingskategorie „Asozial“ zu. Sie bekam einen schwarzen<br />
Winkel aus Stoff mit einem „A“ darauf und die Häftlingsnummer 16747. Die Lebensbedingungen<br />
waren katastrophal, täglich von Hunger begleitet.<br />
„Ich hab mal Weißkohl geklaut. Wir haben alle Hunger gehabt. Wir haben die ganze<br />
Woche nur Steckrüben in Wasser gekocht, kein Fleisch, wir haben keine Wurst, nichts, wir<br />
haben immer nur trockenes Brot, so’n Stück, das mußte reichen, den ganzen Tag. Und da<br />
kam denn ein Wagen mit Weißkohl. Und ich und noch eine mehr, ich sag: ‚Komm man<br />
Friedel, wir ducken uns, sind ja klein, da können sie nicht so sehen, wenn es ein bißchen<br />
schummrig ist!‘ Wir denn ruff auf den Auto. (...) Wir liefen da mit die Weißkohlköpfe los in<br />
unseren Block. Erst war ich in Block 19 und denn in Block 23. Und wie wir denn da reinkamen,<br />
oh, ach, die haben uns ja überfallen, der Weißkohl, der war im Nu weg, so roh.<br />
Und dann haben sie uns erwischt! Eine hat uns gesehen, und die hat uns verpfiffen. (...)<br />
Strafrapport, dann mußten wir vorne nach n’ Revier. (...) Dann kam’n wir unten nach dem<br />
Keller. Da war ein Holzblock, so ein schönes Ding, wissen Sie, haha! Und dann kriegten<br />
wir ’ne weiße Leinenhose, ’ne nasse an! Und dann: ‚Leg dich mal auf den Bock.‘ Mit Gummiknüppel!<br />
‚Zähle, zählst du die Schläge nicht, kriegst du einen mehr!‘“<br />
Mit ihr wurden medizinische Versuche durchgeführt, am Oberarm operierte man ihr einen<br />
Muskel heraus. Sie berichtet, daß ihr in Ravensbrück auch Mittel gespritzt wurden, die<br />
epileptische Anfälle hervorriefen.<br />
Betty Voss arbeitete in den verschiedenen Arbeitskommandos des KZ:<br />
„Und denn jedes Vierteljahr wurden 500 ausgesucht aus die Blocks. Ich habe mir ja<br />
gleich zur Arbeit, das hieß ja Arbeitsvermehrung, um sieben Uhr, (...) gemeldet. Ich hab’<br />
Straßenbau mitgemacht, ich hab’ die Küche rein mitgemacht, in de Schusterei mitgemacht,<br />
ich hab’ Bäume mitgefällt, ich hab’ Sand mitgeschaufelt, ich hab’ Leichen mit verbrannt, in<br />
unser eignes Krematorium.“<br />
Betty Voss war bis zur Befreiung des KZ durch die Russen in Ravensbrück. Mit einigen anderen<br />
Frauen aus ihrer Häftlingsbaracke verließ sie zu Fuß das KZ in Richtung Mecklenburg.<br />
„Ehe wir losgewandert sind, sind wir nach Oranienburg gegangen und haben uns einen<br />
Zettel geben lassen, daß wir gesessen haben da drin, von dann bis dann, nich, in Ravensbrück.“<br />
Im Berliner Rathaus gab sie den Schein ab, um Wiedergutmachungsansprüche geltend<br />
zu machen. Dort ging die Bescheinigung verloren.<br />
1946 heiratete Betty Voss ein zweites Mal. Die Ehe hielt jedoch nur kurz, da ihr Mann<br />
erkrankte und in eine Nervenklinik nach Schleswig eingeliefert wurde. Sie ließ sich bald<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
79<br />
„Unerlaubte<br />
Kontakte“<br />
führen ins Konzentrationslager<br />
Ravensbrück
Fürsorge – Arbeitshaus – KZ: Das Leben der Betty Voss<br />
darauf scheiden. Drei Jahre später lernte sie Herrn Voss kennen. Gemeinsam mit ihm setzte<br />
sie die Aufhebung ihrer Entmündigung von 1936 beim Vormundschaftsgericht durch.<br />
„Und dann hab ich gesagt: ‚Ich möchte‘ jetzt endlich wieder frei sein, ich bin so lange<br />
entehrt gewesen, von 1936 bis 1951, das ist ja wohl lange genug!‘ ‚Ja, woll’n wir mal<br />
gucken!‘ Ich sag: ‚Oder muß ich noch mal erzählen, was der Unterschied zwischen Treppe<br />
und Leiter (...)?’<br />
Das dauerte 14 Tage, da kriegte ich meinen Bescheid, die Entmündigung ist aufgehoben.<br />
Ich hab noch das Schreiben! Und 1951 haben wir geheiratet.“<br />
Ihre Kinder sah Betty Voss erst, als diese schon 18 und 19 Jahre alt waren. Das Verhältnis<br />
zu ihnen beurteilte Betty Voss als sehr gespannt. Sowohl Tochter als auch Sohn werfen<br />
der Mutter vor, daß sie in ein Heim mußten, und glauben nicht daran, daß ihre Mutter keine<br />
andere Möglichkeit sah. Am Stadtrand von Kiel lebte Betty Voss mit ihrem Mann in einer<br />
kleinen Laube. 1991 starb sie mit 80 Jahren.<br />
„Ich hab’ keine Worte mehr für die Menschen, ein Tier tut mir nichts, ein Tier belügt mir<br />
nicht, aber können Sie noch einem Menschen trauen? Vorne lachen sie und hinten kratzen<br />
sie, ja ist wahr, man muß ja Angst kriegen! – Nu ja – denkt von mir, was ihr wollt – ich<br />
weiß es nicht, was ihr denkt.“<br />
1 Die Verfolgtengruppe, die die Nationalsozialisten als „asozial“<br />
einstuften, wird in der Literatur zu den Konzentrationslagern<br />
häufig vernachlässigt oder nur am Rande erwähnt. Deshalb war es<br />
uns besonders wichtig, die Biographie einer Frau aufzunehmen,<br />
die als „Asoziale“ im KZ Ravensbrück inhaftiert war. Die der Biographie<br />
vorangestellte knappe Einführung soll hier lediglich einen<br />
Überblick über diese Gruppe geben.<br />
2 Vgl. Klaus Scherer: „Asozial“ im Dritten Reich. Die vergessenen<br />
Verfolgten. Münster 1990, S. 9.<br />
3 Vgl. Wolfgang Ayaß, Das Arbeitshaus Breitenau. Bettler, Landstreicher,<br />
Prostituierte, Zuhälter und Fürsorgeempfänger in der<br />
Korrektions- und Landarmenanstalt Breitenau (1874-1949). Kassel<br />
1992, S. 287. Siehe auch Scherer (1990), S. 50, 70.<br />
4 Vgl. Scherer (1990), S. 50.<br />
5 Männliche Homosexuelle wurden auf der Grundlage des § 175<br />
StGB verfolgt und im Konzentrationslager als eine spezifische Gruppe<br />
mit einem rosa Winkel „markiert“. Weibliche Homosexuelle fielen<br />
nicht unter dieses Gesetz. Trotzdem wurden auch sie verfolgt<br />
und in KZ verschleppt, „eine qualvolle Erfahrung, die der Mehrzahl<br />
lesbischer Frauen glücklicherweise erspart blieb“. Claudia Schoppmann:<br />
Nationalsozialistische Sexualpolitik und weibliche Homosexualität.<br />
Pfaffenweiler 1991, S. 223. Vgl. ebd., S. 5, 214-226.<br />
6 Vgl. Scherer (1990), S. 55.<br />
7 Ebd., S. 52.<br />
8 Ebd., S. 50.<br />
9 Vgl. Ayaß (1992), S. 266-282. Siehe auch Scherer (1990), S. 29-35.<br />
10 Detlef Peukert: Arbeitslager und Jugend-KZ: Die „Behandlung<br />
Gemeinschaftsfremder“ im Dritten Reich. In: Ders./Jürgen<br />
Reulecke (<strong>Hrsg</strong>.): Die Reihen fast geschlossen. Wuppertal 1981,<br />
S. 413.<br />
11 Vgl. Uwe Lohalm: Die Wohlfahrtskrise 1930-1933. Vom ökonomischen<br />
Notprogramm zur rassenhygienischen Neubestimmung. In:<br />
Frank Bojahr/Walter Johe/Uwe Lohalm (<strong>Hrsg</strong>.): Zivilisation und<br />
Aus: Claus Füllberg-Stolberg (<strong>Hrsg</strong>.):<br />
Frauen im Konzentrationslager, Bergen-Belsen, Ravensbrück,<br />
Edition Temmen, Bremen 1994, S. 299-305<br />
Barbarei. Die widersprüchlichen Potentiale der Moderne. Hamburg<br />
1991, S 193-225.<br />
12 Vgl. Scherer (1990), S. 20f.<br />
13 Vgl. ebd., S. 77.<br />
14 Ebd., S. 21.<br />
15 Vgl. ebd., S. 42, 63.<br />
16 Vgl. Schoppmann (1991), S.67. Vgl. auch Scherer (1990), S. 10, 27.<br />
17 Ebd., S. 68.<br />
18 Ebd., S. 29.<br />
19 Vgl. Gaby Zürn, A. ist ein Prostituiertentyp. Zur Ausgrenzung und<br />
Vernichtung von Prostituierten und moralisch nicht-angepaßten<br />
Frauen im nationalsozialistischen Hamburg. In: Verachtet – Verfolgt<br />
– Vernichtet. Zu den „vergessenen“ Opfern des NS-Regimes. Hg. v.<br />
der Projektgruppe für die „vergessenen“ Opfer des NS-Regimes.<br />
Hamburg 1988, S 128-151; S. 129. Siehe auch Scherer (1990), S. 81.<br />
20 Scherer (1990), S. 80. Vgl. auch den Beitrag von Schulz über Lagerbordelle:<br />
Christa Schulz, Weibliche Häftlinge aus Ravensbrück in<br />
Bordellen der Männerkonzentrationslager, S 135-146, in: Claus<br />
Füllberg-Stolberg u. a. (Hg.), Frauen in Konzentrationslagern: Bergen-Belsen,<br />
Ravensbrück, Bremen 1994.<br />
21 Scherer (1990), S. 85.<br />
22 Ebd.<br />
23 Ebd., S. 45.<br />
24 Vgl. Ayaß (1992), S. 291.<br />
25 Vgl. Scherer (1990), S. 47.<br />
26 Ebd., S. 95.<br />
27 Vgl. ebd., S. 97.<br />
28 Vgl. Ayaß (1992), S. 309.<br />
29 Vgl. ebd., S. 264-287.<br />
30 Vgl. ebd., S. 287-292.<br />
31 Die folgenden Angaben und Zitate sind dem Filmprotokoll<br />
„Schicksal bleibt stumm. Das Leben der Betty V.“ von Barbara von<br />
Poschinger entnommen.<br />
80 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
DIE SOGENANNTEN „U-BOOTE“ – ÜBERLEBT IM VERBORGENEN<br />
BRIGITTE BAILER-GALANDA<br />
Das Schicksal des jüdischen Mädchens Anne Frank, das mit seinen Eltern und Freunden<br />
der Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt lebte, bis die Untergetauchten im<br />
August 1944 verraten und verhaftet wurden, hat unzählige Leser in der ganzen Welt<br />
gerührt. Doch auch in Wien konnten zahlreiche von der Deportation bedrohte Menschen<br />
den Krieg als Untergetauchte, sogenannte „U-Boote“ überleben; ihre genaue Zahl konnte<br />
bisher nicht zuverlässig eruiert werden. 1 Sie organisierten sich nach 1945 kurzfristig im<br />
sogenannten „U-Boot-Verband“ mit Sitz in Wien IX, Universitätsstraße 8/3. 2 Sehr viele dieser<br />
Menschen hatten Jahre der Angst, oft eingeschlossen in winzigen Verstecken und zur<br />
allermöglichsten Geräuschlosigkeit, oft infolgedessen auch beinahe Bewegungslosigkeit<br />
verurteilt, hinter sich. 3 Nach der Befreiung 1945 gelang es ihnen nur mit Mühe, sich wieder<br />
an das normale Leben zu gewöhnen, Kontakt mit Menschen aufzunehmen. Sie trugen<br />
als Folge der ungeheuren Anspannung psychische Schäden davon, von denen sich manche<br />
auch später nicht mehr erholten. Herr N., der gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern<br />
und seinen Eltern als Kleinkind in einem Wiener Keller überleben konnte, beschreibt<br />
rückblickend seinen Vater bis 1938 als lebenstüchtigen Mann, dessen Tatkraft und Organisationstalent<br />
auch das Hauptverdienst für das Überleben der Familie in der NS-Zeit zukam.<br />
Nach der Befreiung 1945 war der Vater jedoch ein gebrochener Mann, der mit dem<br />
Leben nicht mehr fertig wurde und dann seinerseits nur mit Hilfe der halbwüchsigen Kinder<br />
und seiner schwerkranken Frau überleben konnte. 4<br />
Die Mehrheit dieser „U-Boote“ waren wohl jüdisch Verfolgte. Ab 1942/43 entzogen<br />
sich auch österreichische Wehrmachtsangehörige, oft aus politischen Gründen, dem weiteren<br />
Kriegsdienst und tauchten unter. Sie erlebten das Kriegsende – soferne sie nicht verraten<br />
wurden – in ihren Verstecken, andere wiederum schlossen sich Partisanenverbänden<br />
an. 5<br />
Das Opferfürsorgegesetz berücksichtigte das Leben im Verborgenen vor der ➤ 12. Novelle<br />
vom 22. März 1961 überhaupt nicht als eigenen anspruchsbegründenden Verfolgungstatbestand,<br />
obschon über die Tatsache des Lebens als „U-Boot“ bereits 1945 einiges bekannt<br />
war. So schrieb das „Neue Österreich“ im Mai 1945: „Doch nicht jedem lag es, sich<br />
wehrlos wie ein Stück Vieh zur Schlachtbank treiben zu lassen. Und nicht jeder wollte<br />
untätig zusehen, wie Freunde und Verwandte in den qualvollen Tod gehetzt wurden. Einige<br />
der Gezeichneten rafften ihren letzten Mut zusammen, besprachen sich mit hilfsbereiten<br />
Freunden und beschlossen, sich zu verstecken. Das waren dann die geheimnisvollen ‚Unterseeboote‘.<br />
Viele Hunderte gab es davon in Wien – natürlich nicht nur Juden, sondern auch<br />
aus politischen Gründen Verfolgte und Gefährdete.“ 6 Die Diktion des Artikels muß als bemerkenswert<br />
gesehen werden – wenn schon einmal jüdische Opfer vorkamen, schwächte<br />
man sofort ab.<br />
Bis zur 12. Novelle standen ehemaligen „U-Booten“ keine Ansprüche aufgrund des Opferfürsorgegesetzes<br />
offen, es sei denn, sie konnten eine Einkommensschädigung um mehr<br />
als die Hälfte für mindestens dreieinhalb Jahre nachweisen, was – wie oben gezeigt – nicht<br />
leicht war. In diesem Falle konnten sie zumindest einen ➤ Opferausweis erhalten, nicht jedoch<br />
die ➤ Amtsbescheinigung. Die 12. Novelle nahm das Leben im Verborgenen dann als<br />
entschädigungswürdigen Tatbestand in das Gesetz auf, wobei jedoch einfaches Untertauchen<br />
nicht ausreichend war – es mußte unter „menschenunwürdigen Bedingungen“ erfolgt<br />
sein, als ob ein Leben in der Illegalität nicht an sich schon menschenunwürdig genug wäre.<br />
In den Anweisungen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung an die Ämter der Landesregierungen<br />
für die Durchführung der 12. Novelle heißt es dazu: „Der Begriff des Lebens<br />
im Verborgenen unter menschenunwürdigen Bedingungen ist ein unbestimmter Rechtsbegriff,<br />
der sich in Form einer generellen Weisung nicht genau umschreiben läßt, so daß<br />
die entscheidende Behörde innerhalb des ihr gesetzlich zugestandenen Rahmens eine entsprechende<br />
Entscheidungsfreiheit hat. Es wird Sache der Behörde sein, in jedem einzelnen<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
81<br />
Kein<br />
Anspruch auf<br />
Opferfürsorge<br />
Was sind<br />
„menschenunwürdige<br />
Bedingungen“?
Die sogenannten „U-Boote“<br />
Falle nach Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes in freier<br />
Beweiswürdigung zu beurteilen, ob die beiden Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 lit. c<br />
OFG erfüllt sind. Der Begriff ‚Leben im Verborgenen‘ wird dahin auszulegen sein, daß darunter<br />
nicht nur ein Leben unter falschen Namen und Verstecken, sondern überhaupt ein<br />
Leben außerhalb der bürgerlichen Rechtsordnung zu verstehen sein wird. Das gleiche wird<br />
auch für die Tarnung oder Verheimlichung anderer für die Verfolgungsvorgänge wichtiger<br />
persönlicher Umstände wie z.B. Konfession und rassische Abstammung gelten. Das Tatbestandsmerkmal<br />
‚unter menschenunwürdigen Bedingungen’ wird vorliegen, wenn nach dem<br />
Verfolgten intensiv gefahndet wurde und er sich deshalb nur in wirklichen Verstecken aufhalten<br />
konnte und oft die Flucht ergreifen mußte. Ebenso wird als menschenunwürdig anzusehen<br />
sein, wenn z.B. ein Verfolgter durch erzwungene Tarnung seinen Beruf aufgeben und<br />
einen anderen Beruf unter erniedrigenden und vielleicht ungesunden Bedingungen ausüben<br />
mußte. Bei einem Leben in einem Versteck oder auf der Flucht (ständiges Wechseln des<br />
Aufenthaltes, ohne an einem Ort aus verfolgungsbedingten Gründen länger verweilen zu<br />
können) würden die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 lit. c OFG jedenfalls bejaht werden<br />
können.“ 7<br />
1965 sah sich das Bundesministerium für soziale Verwaltung genötigt, in einem Erlaß darauf<br />
hinzuweisen, daß „der Begriff ‚menschenunwürdige Bedingungen‘ vielfach zu eng ausgelegt<br />
wird“, und gesonderte neuerliche Erklärungen dazu zu liefern: „Der Verwaltungsgerichtshof<br />
hat dargelegt, daß unter ‚menschenunwürdig‘ nur etwas verstanden werden kann,<br />
was über die Verhältnisse eines im Verborgenen lebenden Menschen hinausgeht, und auch<br />
die Ansicht vertreten, daß es sich bei den menschenunwürdigen Bedingungen nicht um jene<br />
Schwierigkeiten handeln kann, die das Leben im Verborgenen zwangsläufig mit sich bringt;<br />
es müssen vielmehr noch besondere äußere Umstände hinzukommen, die das Leben im Verborgenen<br />
wesentlich erschweren, wie zum Beispiel das Leben in besonders unzulänglichen<br />
Unterkünften oder unter besonders ungünstigen Versorgungsverhältnissen.“ 8<br />
Im Klartext hieß dies, daß die über Jahre dauernde Angst vor Entdeckung, die Sorge um<br />
die Verwandten oder Freunde, die enormen psychischen Belastungen infolge vielleicht<br />
beengten Lebens auf kleinem Raum allein nicht „menschenunwürdig“ genug waren, um<br />
einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Opferfürsorgegesetz zu begründen, die<br />
öS 350,- pro Monat des Lebens im Verborgenen ausmachte. 9<br />
Die Behörden, aber auch der Verwaltungsgerichtshof beurteilten die Anträge der Opfer<br />
entsprechend den Durchführungsbestimmungen sehr engherzig. Der Wiener F. G. war im<br />
Juni 1942 in Wien festgenommen und in das Sammellager Kleine Sperlgasse 2a gebracht<br />
worden, von wo ihm jedoch die Flucht gelungen war. Bis Kriegsende hatte er unangemeldet<br />
in der Wohnung seiner späteren, nichtjüdischen Gattin gelebt. Nur zweimal hatte er<br />
es wegen eines Arztbesuches gewagt, die Wohnung zu verlassen. Das Amt der Wiener<br />
Landesregierung lehnte seinen Antrag auf Entschädigung mit der Begründung ab, daß er<br />
„sich während des gesamten Zeitraumes in der Wohnung seiner nichtjüdischen Frau aufgehalten<br />
und nur ganz selten in deren Begleitung das Haus verlassen habe“. 10 Das Bundesministerium<br />
für soziale Verwaltung korrigierte in diesem Fall im Berufungsverfahren die<br />
Wiener Opferfürsorgebehörden. 11<br />
In einem anderen Fall lehnte sogar der Verwaltungsgerichtshof die Beschwerde eines<br />
Mannes ab, der nach der Deportation seiner Mutter und seiner Schwester untergetaucht<br />
war, jedoch teilweise seinen Lebensunterhalt mit Schwarzarbeiten in der Wiener Markthalle<br />
hatte verdienen können: „Wie er (der Berufungswerber, Anm. der Verf.) bei seiner Einvernahme<br />
am 15. Juli 1959 selbst angeführt habe, habe er während seines Lebens im Verborgenen<br />
durch Schwarzarbeit bei Fleischhauern seinen Lebensunterhalt verdient. Aus den<br />
Angaben der Zeugen W. und D. gehe hervor, daß der Berufungswerber während der<br />
angeführten Zeit bei diesen Personen und bei anderen Bekannten in der Wohnung<br />
gewohnt hat. Aus seiner Beschäftigung müsse geschlossen werden, daß es ihm möglich<br />
war, ohne jeweilige Behinderung seine Unterkunft zu verlassen und sich zu seiner Arbeitsstätte<br />
zu begeben. Besondere äußere Umstände, die das Leben im Verborgenen<br />
82 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
wesentlich erschweren, wie z.B. das Leben in besonders unzulänglichen Unterkünften oder<br />
unter besonders ungünstigen Versorgungsverhältnissen, seien vom Berufungswerber nicht<br />
nachgewiesen worden. Daß er durch den Nichtbezug von Lebensmittelkarten Hunger<br />
gelitten und deswegen unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt habe, könne<br />
gleichfalls aufgrund seiner Angaben und der Angaben der Zeugen, daß die ihn verköstigt<br />
hätten, nicht als erwiesen angenommen werden. 12 Gleichfalls abgelehnt wurde die Beschwerde<br />
einer Wienerin, der es gelungen war, unter falscher Identität die NS-Herrschaft<br />
zu überleben. 13<br />
Die Bedeutung dieser Nicht-Anerkennung als Opfer beschreibt Herr N., bezugnehmend<br />
auf die verzweifelte Situation seines Vaters nach der Befreiung: „… aber richtig auf die<br />
Beine hat man niemandem geholfen. (…) Und was mein Vater eigentlich gebraucht hat,<br />
das war keine Wiedergutmachung, keine finanzielle Abgeltung. Er hat wieder respektiert<br />
werden wollen als Mensch, er hat dort weiter machen wollen, wo er im 38er Jahr aufgehört<br />
hat, aber das hat es natürlich nicht gegeben. (…) Aber man hätte ihm wenigstens<br />
das anerkennen sollen, daß er sieben Jahre seines Lebens praktisch in einem Kellerloch<br />
versteckt war, diskriminiert war, sein Leben bedroht war, und das hat man eigentlich bis<br />
zum Schluß nicht getan. (…) Wir haben dann nach Jahren, viele Jahre später, da war<br />
mein Vater schon tot, einen Opferausweis bekommen.“ 14<br />
Erst mit der 21. Novelle (!) zum Opferfürsorgegesetz vom 11. November 1970 wurde<br />
die Situation verbessert: Die Novelle sah die Zuerkennung eines Opferausweises für das<br />
Leben im Verborgenen vor, falls dieses Leben mindestens sechs Monate gedauert hatte<br />
und auf dem Gebiet der Republik Österreich stattfand. Bezüglich der finanziellen Entschädigung<br />
blieb jedoch alles beim Alten, hier blieb die Zusatzbedingung „unter<br />
menschenunwürdigen Bedingungen“ aufrecht. Der Abgeordnete Otto Skritek (SPÖ) verwies<br />
1970 bei seiner Rede im Nationalrat zu dieser Novelle darauf, „daß uns beim ‚Leben<br />
im Verborgenen‘ immer Anne Frank einfallen muss“. Der ➤ KZ-Verband setzte in seiner<br />
Pressekorrespondenz dazu: „Hohes Haus! Nach dem österreichischen Opferfürsorgegesetz<br />
würde man für dieses Leben einer Anne Frank in Amsterdam höchstens einen<br />
Opferausweis, aber für diesen Tatbestand keinerlei Entschädigung erhalten. Auch nicht<br />
nach dieser Novelle!“ 15<br />
In der am 26. April 1972 beschlossenen 22. Novelle wurde dann auch dieser Mißstand<br />
behoben. Einerseits wurde die Klausel „auf dem Gebiet der Republik Österreich“ aus der<br />
Anspruchsvoraussetzung für den Opferausweis gestrichen, ebenso die „menschenunwürdigen<br />
Bedingungen“ als Voraussetzung für die finanzielle Entschädigung. Skritek sagte dazu<br />
im Nationalrat: „Ich möchte dem Herrn Minister besonders auch dafür danken, daß er ein<br />
jahrelanges Anliegen betreffend die Bestimmungen bezüglich des Lebens im Verborgenen<br />
wesentlich verbessert hat; das ist bei Gewährung des Opferausweises die Streichung der<br />
Worte ‚Gebiet der Republik Österreich‘. Damit sind auch die besetzten Gebiete eingeschlossen,<br />
das heißt, daß Menschen, die damals aus Österreich flüchten mußten und in einem<br />
besetzten Gebiet im Verborgenen lebten, einen Opferausweis erhalten. Die zweite entscheidende<br />
Verbesserung betrifft die Streichung des Passus ‚menschenunwürdige Bedingungen‘<br />
gleichfalls für den Personenkreis, der im Verborgenen lebte, als Bedingung für die Entschädigung.<br />
Es handelt sich hier um ein Anliegen, das immer wieder vorgebracht wurde.<br />
Diese Frage wurde im Gesetz einschränkend behandelt, weil man fürchtete, daß eine Überprüfung<br />
schwer sei. Es ist klar, daß die Tatbestände heute natürlich auch nicht leicht feststellbar<br />
sind. Aber es ist doch sicherlich nicht möglich, daß man diesen Menschen nur deshalb<br />
etwas vorenthält, weil Österreich fast 25 Jahre gebraucht hat, ihnen einen gesetzlichen Anspruch<br />
zu geben, und dann natürlich die Prüfung etwas schwieriger ist.“ 16<br />
Nie geklärt werden kann wohl, wieviele der ehemaligen „U-Boote“ diese Gesetzesänderung<br />
überhaupt noch erlebten. Diese Geste des Gesetzgebers kam zu einem Zeitpunkt,<br />
wo mit wesentlichen Mehrkosten im Bereich der Opferfürsorge nicht mehr gerechnet<br />
zu werden brauchte. Vor allem hatten die 350 Schilling im Vergleich zu 1961 bereits beträchtlich<br />
infolge der jährlichen Inflationsrate an Geldwert eingebüßt. Die Behandlung die-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
83<br />
Finanzielle<br />
Entschädigung<br />
oder moralische<br />
Rehabilitierung<br />
der Opfer ?<br />
Langes Warten<br />
auf einen<br />
gesetzlichen<br />
Anspruch
Die sogenannten „U-Boote“<br />
ser Opfer, die zu einem großen Teil bereits seit 1945 in Österreich lebten, bedürftig waren<br />
und an schweren Folgen zu tragen hatten, mag als ein Beispiel für die Kleinlichkeit der Opferfürsorgegesetzgebung,<br />
aber auch der mit der Vollziehung befaßten Behörden gegenüber<br />
den Opfern stehen.<br />
1 Die Israelitische Kultusgemeinde Wien gab 1950 die Zahl der „U-<br />
Boote“, die die NS-Zeit in Wien hatten überleben können, mit 378<br />
Personen an, wobei hierbei wahrscheinlich nur Mitglieder der Kultusgemeinde<br />
berücksichtigt sind. Israelitische Kultusgemeinde,<br />
Statistik der insgesamt nach Wien zurückgekehrten Juden, von<br />
1945 bis 1950, Wien 1950, Institut für Zeitgeschichte, Wien, Nachlaß<br />
Albert Loewy; Gwyn Moser gibt die Zahl mit 619 an; dies., Jewish<br />
U-Boote in Austria 1938-1945, in: Simon Wiesenthal Center<br />
Annual, Volume 2, New York 1985, S. 55. Siehe auch: Brigitte Ungar-Klein,<br />
Bei Freunden untergetaucht – U-Boote in Wien, in: Kurt<br />
Schmid, Robert Streibel (<strong>Hrsg</strong>.), Der Pogrom 1938. Judenverfolgung<br />
in Österreich und Deutschland, Wien 1990, S. 87-92.<br />
2 Schreiben des „U-Boot-Verbandes“ an Ministerialrat Dr. Sobek,<br />
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Bestand<br />
KZ-Verband, Mappe Schriftwechsel. Die Mitgliederkartei des<br />
U-Boot-Verbandes befindet sich im Dokumentationsarchiv des<br />
österreichischen Widerstandes.<br />
3 Vgl. beispielsweise die Schilderungen in: Peter Kunze, Dorothea<br />
Neff, Mut zum Leben, Wien 1983.<br />
4 DÖW-Projekt „Erzählte Geschichte“, Interviewabschrift Nr. 647.<br />
5 Zu den in Südkärnten operierenden slowenischen Partisanen siehe<br />
unter anderem: Mirko Messner, Widerstand der Kärntner Slowenen,<br />
in: Spurensuche. Erzählte Geschichte der Kärntner Slowenen,<br />
hrsg. v. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes<br />
Aus: Brigitte Bailer-Galanda: Wiedergutmachung kein Thema.<br />
Löcker Verlag, Wien 1993, S. 145–149.<br />
et. al., Wien 1990 (Erzählte Geschichte. Berichte von Widerstandskämpfern<br />
und Verfolgten. Band 4: Kärntner Slowenen); Hanns<br />
Haas, Karl Stuhlpfarrer, Österreich und seine Slowenen, Wien 1977.<br />
6 Neues Österreich, 5. 5. 1945.<br />
7 Schreiben des Bundesministeriums für soziale Verwaltung an alle<br />
Ämter der Landesregierungen (OF-Referate) vom 18. 12. 1962, Zl.<br />
IV-105.047-20a/1962. DÖW Bibl. Nr. 1195.<br />
8 Der neue Mahnruf, Nr. 11, November 1965.<br />
9 Zum Vergleich: Das monatliche Durchschnittseinkommen eines Arbeiters<br />
betrug 1962 S 2420,-, das eines Angestellten oder Beamten<br />
S 3740,-, Wirtschaftsstatistisches Handbuch 1964, hrsg. v. der Kammer<br />
für Arbeiter und Angestellte Wien, Wien 1965, S. 217.<br />
10 Zitiert nach Bescheid des Bundesministeriums für soziale Verwaltung,<br />
Zl. IV-64.098-22/63. Privatbesitz Mag. Ungar-Klein.<br />
11 a. a. O.<br />
12 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 28. 6. 1967, Zl. 254/67-3.<br />
13 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 29. 5. 1968, Zl.<br />
365/68-3.<br />
14 Die Entschädigung nach der 12. Novelle hat Familie N. erhalten.<br />
DÖW-Projekt „Erzählte Geschichte“, Interviewabschrift Nr. 647.<br />
15 Pressekorrespondenz des Bundesverbandes österreichischer Widerstandskämpfer<br />
und Opfer des Faschismus (KZ-Verband), Nr. 6,<br />
12. 11. 1970.<br />
16 Zitiert nach: Der sozialistische Kämpfer, Nr. 5-6, Mai – Juni 1972.<br />
84 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
FRAUEN IM WIDERSTAND<br />
Während des Zweiten Weltkrieges entfaltete sich eine<br />
militärische und politische Kampfform in einem bis dahin<br />
in der Geschichte unbekannten Ausmaß: der Partisanenkrieg.<br />
Durch ihn gelang es, die Operationen der Deutschen<br />
Wehrmacht zu behindern, deren Truppenverbände<br />
im Hinterland zu binden sowie Kriegsmaterial und Stützpunkte<br />
der Nazis zu vernichten. (…) Zwei Partisanenverbände<br />
mit mehreren Bataillons formierten sich in<br />
Kärnten, während in der Steiermark bewaffnete Widerstandsgruppen<br />
im Industriegebiet um Leoben/Donawitz<br />
sowie – unabhängig davon – im Gebiet der Koralpe operierten.<br />
Darüber hinaus gab es Partisanengruppen in<br />
Österreich nur noch im Tiroler Ötztal und im Salzkammergut/Ausseerland.<br />
In Kärnten hatte sich vor allem die slowenische Bevölkerung<br />
der partisanischen Befreiungsbewegung angeschlossen.<br />
Unter der NS-Herrschaft wurde die bereits vor<br />
1938 ausgeprägt antislowenische Politik verschärft, die in<br />
der „Bereinigung der volkspolitischen Frage“ (➤ Himmler),<br />
d.h. in der physischen Vertreibung und Vernichtung<br />
der Kärntner Slowenen gipfeln sollte) (…) Mit der Einführung<br />
von Deutsch als Amtssprache, dem deutschsprachigen<br />
Unterricht an Kindergärten und Schulen, dem<br />
Berufsverbot für slowenische Beamte, Lehrer, Ärzte, für<br />
Teile der Priesterschaft leiteten die NS-Behörden die<br />
Germanisierung ein. Hatte bis dahin ein Großteil der Slowenen<br />
defensiv reagiert, so änderte sich diese Haltung,<br />
als im April 1942 einer Anordnung von Himmler zufolge<br />
(25.8.1941) die zwangsweise Massenaussiedelung der Slowenen<br />
begann. Nach einem festgeleten Plan wurde die<br />
➤ Gestapo beauftragt, die Betriebe und Bauernhöfe von<br />
Kärntner Slowenen zu beschlagnahmen, einen „freiwilligen“<br />
Verzicht auf ihr Eigentum zu verlangen oder sie mit<br />
ihrer Verschleppung ins KZ zu bestrafen. Als Tausende<br />
von ihnen in Lagern des „Altreichs“ verschwanden, sah<br />
sich die zurückgebliebene slowenische Bevölkerung veranlaßt,<br />
Widerstand zu leisten. Im April 1941 hatte sich in<br />
Slowenien/Jugoslawien als überparteiliche Organisation<br />
die Befreiungsfront OF (Osvobodilna Fronta) gebildet.<br />
Neben der Entfachung des Widerstandskampfes gehörte<br />
zu deren Aufgaben die politische Aufklärungsarbeit,<br />
Agitation und Propaganda sowie das Einfädeln von Verbindungen<br />
zur Bevölkerung. Immer mehr Kärntner Slowenen<br />
sympathisierten mit dieser Befreiungsbewegung,<br />
unterstützten sie tatkräftig oder gingen selbst zu den<br />
Partisanenverbänden über. (…)<br />
Die Taktik der Partisanen, zumeist Einheimische, mit den<br />
lokalen Gegebenheiten bestens vertraut, bestand darin,<br />
den zahlenmäßigen und militärisch überlegenen Feind<br />
im Schutz waldreicher und gebirgiger Gegenden durch<br />
blitzartige, oft zur gleichen Zeit mit kleineren Trupps<br />
durchgeführte Gefechte zu verwirren. Dadurch wurde<br />
der Gegner gezwungen, größere Einheiten von der Front<br />
abzuziehen oder neue Formationen in diesen Regionen<br />
aufzustellen. Die Ausbreitung der Partisanen, die im<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Frühjar 1944 die Drau überquert hatten und bis in die<br />
Nähe von Klagenfurt/Celovec vorgestoßen waren, gab<br />
Anlaß, das SS-Polizei-Regiment 13 nach Kärnten zu verlegen.<br />
Um die Partisanen von der Bevölkerung zu isolieren,<br />
hießen sie im NS-Sprachgebrauch „Banditen”. Bestimmte<br />
Regionen wurden zum „Bandenkampfgebiet“ erklärt. Im<br />
Leobner Raum brachte die Gestapo Steckbriefe der<br />
Widerstandskämpfer mit einem Kopfgeld von 10.000 RM<br />
an. Trotz dieser Maßnahmen halfen zunehmend mehr<br />
Menschen den Partisanen. In der Gegend von Eisenkappel/Z<br />
ˇ elezna Kapla war diese Unterstützung besonders<br />
hoch – nach Gendarmerieberichten 90 Prozent der ansässigen<br />
Bevölkerung.<br />
Ohne die Mithilfe von Frauen, welche die Basisarbeit<br />
leisteten, indem sie Nachrichten beschafften und die<br />
Versorgung sicherstellten, wäre jede Guerillabewegung<br />
von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Im<br />
Leobner Gebiet waren etliche Frauen in den Ämtern tätig<br />
und konnten aufgrund ihrer Informationen die Partisanen<br />
vor den Razzien der Gestapo und der ➤ SS rechtzeitig<br />
warnen. Mit der Gründung der antifaschistischen<br />
Frauenfront AFZˇ im März 1943 auf österreichischem<br />
Boden gelang es, weitere Aktivistinnen für den Widerstandskampf<br />
zu gewinnen und in die politische Arbeit<br />
einzubinden. (…)<br />
Aus: Karin Berger, Elisabeth Holzinger u.a. (<strong>Hrsg</strong>.):<br />
Der Himmel ist blau. Kann sein.<br />
Frauen im Widerstand Österreich 1938-1945,<br />
Edition Spuren promedia Verlag,<br />
Wien 1985, S. 162-163<br />
85
ZeugInnen Jehovas<br />
DIE VERFOLGUNG DER ZEUGEN UND ZEUGINNEN JEHOVAS<br />
Die Vereinigung der „Bibelforscher“ bzw. der „Zeugen<br />
Jehovas“, wie sie sich ab 1931 nannten, wurde in der<br />
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA gegründet.<br />
Mitte der Zwanziger Jahre gab es in Deutschland<br />
bereits über 20.000, in Österreich über 500 bekennende<br />
BibelforscherInnen. Die Bibelforscher-Vereinigung wurde<br />
zunächst vor allem von der Kirche, dann auch von völkischer<br />
und von nationalsozialistischer Seite vehement<br />
bekämpft. Kritisiert wurden vor allem folgende Grundzüge<br />
der Lehre: die Predigt vom nahenden „Untergang<br />
der alten Welt und der sie tragenden Mächte Politik,<br />
Kapital und Kirche“, die heftige Kritik an Papst und<br />
Kirche, die Lehre von der Gleichheit der Rassen, das<br />
Bekenntnis zur zionistischen Bewegung und die Feststellung,<br />
dass ChristInnen allein der göttlichen Obrigkeit und<br />
nicht den staatlichen Regierungsgewalten Gehorsam<br />
schuldeten. In einigen deutschen Bundesländern und<br />
auch in Österreich ging man bereits vor der NS-Machtübernahme<br />
vor. So wurden während des Austrofaschismus<br />
unter Dollfuß ihre Zeitschriften, u.a. „Der Wachtturm“,<br />
zensuriert, ➤ Schuschnigg ließ die ZeugInnen<br />
Jehovas am 17. Juni 1935 verbieten.<br />
Die Verfolgung der ZeugInnen Jehovas im<br />
Nationalsozialismus<br />
Bereits wenige Wochen nach der Machtübernahme der<br />
Nationalsozialisten in Deutschland wurden die ZeugInnen<br />
Jehovas in allen Bundesländern als erste Glaubensgemeinschaft<br />
verboten. Viele ZeugInnen führten jedoch<br />
ihre Versammlungen und „Haus-zu-Haus“-Missionen fort<br />
und widersetzten sich den nationalsozialistischen Vorschriften<br />
und Verhaltensregeln: So verweigerten sie den<br />
Hitlergruß, nahmen nicht an nationalsozialistischen<br />
„Wahlen“ und „Volksabstimmungen“ teil und verweigerten<br />
die Mitgliedschaft in NS-Zwangskörperschaften, etwa<br />
in der ➤ Deutschen Arbeitsfront (DAF), was für viele<br />
ZeugInnen zum Verlust ihres Arbeitsplatzes, ihrer Geschäfte<br />
und Wohnungen, zur Vernichtung ihrer gesamten<br />
wirtschaftlichen Existenz führte. Die im Staatsdienst<br />
beschäftigten ZeugInnen Jehovas wurden nach dem<br />
➤ „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“<br />
vom 7. April 1933 entlassen. Wenn ZeugInnen<br />
nicht bereit waren, ihre Kinder in die „Hitlerjugend“ zu<br />
geben, konnte das sogar zu Sorgerechtsentziehung und<br />
Abnahme der Kinder führen. Bei der Gestapo wurde<br />
1937 ein „Sonderreferat“ für das Vorgehen gegen die<br />
ZeugInnen eingerichtet, NS-Sondergerichte verurteilten<br />
in den sogenannten „Bibelforscherverfahren“ Tausende<br />
von ihnen zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen.<br />
Trotz der verschärften Repressionen setzten weit mehr als<br />
10.000 ZeugInnen Jehovas ihre Arbeit fort, indem sie ihre<br />
Strukturen den Bedingungen der Illegalität anpassten.<br />
Nach den im August und September 1936 stattfindenden<br />
Massenverhaftungen übernahmen verstärkt die weiblichen<br />
Mitglieder die Untergrundarbeit. Eine zweite<br />
86<br />
große Verhaftungswelle im Herbst 1937 führte schließlich<br />
zur Zerschlagung der Untergrundorganisation im „Altreich“.<br />
Die österreichischen ZeugInnen konnten ihre<br />
Missionsarbeit trotz mehrerer Verhaftungswellen noch bis<br />
Juni 1940 fortsetzen. Die Verhafteten wurden wegen<br />
„Zersetzung der Wehrkraft“ oder „Teilnahme an einer<br />
wehrfeindlichen Verbindung“ zu mehreren Jahren Gefängnis<br />
bzw. Zuchthaus verurteilt und kamen anschließend in<br />
ein Konzentrationslager. Zahlreiche ZeugInnen wurden<br />
aber auch ohne Gerichtsverfahren unmittelbar in ein KZ<br />
eingewiesen.<br />
ZeugInnen Jehovas in den Konzentrationslagern<br />
Die ZeugInnen Jehovas bildeten in den Konzentrationslagern<br />
eine geschlossene Gemeinschaft, die sich durch<br />
ihren Gruppenkodex und starken Zusammenhalt von anderen<br />
Häftlingsgruppen unterschied. Bis zu Kriegsbeginn<br />
stellten sie oftmals eine der größten Häftlingsgruppen<br />
dar. Sie waren v.a. anfangs Schikanen und Mißhandlungen<br />
durch das ➤ SS-Wachpersonal ausgesetzt. Im KZ<br />
Mauthausen starben im Winter 1939/40 mehr als 50 der<br />
damals inhaftierten 143 Zeugen Jehovas. Nach Kriegsbeginn<br />
und der Einweisung anderer Gruppen in die Konzentrationslager<br />
verbesserte sich ihre Situation. Da sie<br />
aus Glaubensgründen eine Flucht aus dem Lager prinzipiell<br />
ablehnten und die Arbeiten, die sich mit ihrem Glauben<br />
vereinbaren ließen, gewissenhaft verrichteten, wurden<br />
sie von der SS auch vermehrt in sogenannten „Vertrauensstellungen“<br />
eingesetzt.<br />
Von den 25.000 deutschen und österreichischen ZeugInnen<br />
Jehovas zu Beginn des Dritten Reiches wurden ungefähr<br />
10.000 inhaftiert, davon über 2000 in Konzentrationslagern.<br />
Die Zahl der Todesopfer liegt bei 1200.<br />
Damit wurden die ZeugInnen Jehovas von allen religiösweltanschaulichen<br />
Gruppen – nach den Angehörigen des<br />
jüdischen Glaubens – am härtesten verfolgt. Dennoch<br />
zählen sie zu den „vergessenen Opfern“, sie sind lange<br />
Zeit weder im bundesdeutschen noch im österreichischen<br />
Entschädigungsrecht als Verfolgte des Nationalsozialismus<br />
anerkannt worden. In Österreich haben sie durch<br />
den 1995, also 50 Jahre nach Kriegsende, geschaffenen<br />
➤ „Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus“<br />
einen Anspruch auf eine einmalige Entschädigung er<br />
halten.<br />
Heidrun Schulze<br />
Diese Zusammenfassung beruht wesentlich auf folgenden<br />
Artikeln: Detlef Garbe: Widerstand aus dem Glauben.<br />
Die Verfolgung der Zeugen Jehovas in Deutschland und<br />
Österreich unter nationalsozialistischer Herrschaft.<br />
Vortrag gehalten auf der Tagung „Zeugen Jehovas: Vergessene<br />
Opfer des Nationalsozialismus?“, Wien am 29.1.1998;<br />
Detlef Garbe: Kompromißlose Bekennerinnen. Selbstbehauptung<br />
und Verweigerung von Bibelforscherinnen, in:<br />
Christl Wickert (<strong>Hrsg</strong>.): Frauen gegen die Diktatur – Widerstand<br />
und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland,<br />
Edition Hentrich, Berlin 1995, S. 52-73.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Verfolgung, Ausgrenzung und Kriminalisierung von<br />
Männern und Frauen aufgrund sexueller gleichgeschlechtlicher<br />
Orientierung stellen keine Erfindung des<br />
Nationalsozialismus dar. Vielmehr lassen sich Kontinuitäten<br />
strafrechtlicher Verfolgung sowohl für die Zeit vor<br />
dem NS-Regime sowie lange Jahre danach, in Österreich<br />
bis 1994, auffinden.<br />
Während in Österreich nach dem Gesetz von 1852 für<br />
„Unzucht wider die Natur“ (§129) Personen beiderlei Geschlechts<br />
zu Strafen von ein bis fünf Jahren Kerker verurteilt<br />
wurden, so stand nach dem preußischen Strafgesetzbuch<br />
von 1851 explizit nur noch die widernatürliche Unzucht<br />
zwischen Männern unter Strafe (§143). In Deutschland<br />
ging der §143 bei Gründung des Deutschen Reiches<br />
1851 unverändert als § 175 in das neue Strafgesetzbuch<br />
ein und war auch nach der nationalsozialistischen Machtübernahme<br />
1933 weiterhin wirksam. In Österreich wurde<br />
auch nach dem Anschluss 1938 und trotz einer weitgehenden<br />
Vereinheitlichung von Strafrecht und Rechtsbestimmungen<br />
weiterhin sowohl männliche als auch<br />
weibliche Homosexualität unter Strafe gestellt.<br />
Obwohl die Strafverfolgung von Frauen (§129) in Österreich<br />
weiterhin wirksam war, waren Männer in weitaus<br />
stärkerem Maß einer Strafverfolgung ausgesetzt. Nach<br />
1938 nahm die Zahl der in Wien aufgrund ihrer Homosexualität<br />
verurteilten Männer um 40% zu, die der Frauen<br />
verdoppelte sich, blieb aber weit unter der Zahl der<br />
verurteilten Mörder. Die unterschiedliche Strafverfolgung<br />
erklärt sich aus den gültigen Interpretationen der<br />
Geschlechtscharaktere.<br />
Während bei homosexuellen Männern vor allem die Zeugungskraft<br />
vergeudet würde, so würden durch die weibliche<br />
Homosexualität eine Steigerung erwünschter Geburten<br />
und damit die bevölkerungspolitischen Intentionen<br />
nicht ernsthaft gefährdet. Hinzukommt, dass nach<br />
Auffassung der Juristen die männliche Sexualität (Penetration)<br />
als Norm gesetzt wurde.<br />
Als Instrument der Bekämpfung erwiesen sich neben den<br />
Justizbehörden vor allem SS und Polizei. Es blieb aber vielmehr<br />
im Ermessensspielraum der Gestapo, ob die Betreffenden<br />
dem Gericht übergeben, in „Schutzhaft“ genommen<br />
oder in ein Konzentrationslager eingewiesen wurden.<br />
Grundsätzlich fiel die Bekämpfung des „nichtpolitischen<br />
Verbrechertums“ der Kriminalpolizei zu, allerdings<br />
wurde in Berlin 1934 von der Gestapo ein eigenes Sonderdezernat<br />
„Homosexualität“ eingerichtet und 1936 eine<br />
„Reichszentrale für Bekämpfung der Homosexualität und<br />
Abtreibung“. Nach diesem Vorbild wurde auch bei der<br />
Wiener Gestapo ein Referat „Homosexualität und Abtreibung“<br />
eingerichtet. Die Aufgabe dieser Referate bestand<br />
vor allem in der Registrierung verdächtiger Personen.<br />
Trotz verschärfter Verfolgung war die Haltung der Nationalsozialisten<br />
zur Homosexualität von Widersprüchen geprägt,<br />
nicht zuletzt von taktischen Überlegungen bestimmt,<br />
und wurde in gewissen NS-Kreisen sogar toleriert<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
87<br />
Homosexuelle<br />
DIE VERFOLGUNG HOMOSEXUELLER WÄHREND DES NATIONALSOZIALISMUS<br />
oder ignoriert, wie etwa bei Ernst Röhm, SA-Stabschef<br />
und Vertrauter Hitlers. In der männerbündischen Welt<br />
der paramilitärischen Organisationen war latente oder<br />
offene Homosexualität durchaus nicht unbekannt.<br />
Unter der NS-Herrschaft wurden etwa 50.000 Männer<br />
wegen Vergehen gegen den §175 gerichtlich verurteilt.<br />
Die Zahl der aufgrund von Homosexualität in Konzentrationslagern<br />
internierten Personen ist nicht genau feststellbar,<br />
Schätzungen liegen bei etwa 5000 bis 15.000 Männern.<br />
In den Konzentrationslagern wurden männliche Homosexuelle<br />
als eigene Häftlingskategorie durch einen rosa<br />
Winkel gekennzeichnet. Für homosexuelle Frauen gab es<br />
keine derartige Kennzeichnung, vielfach wurden sie der<br />
Gruppe der sogenannten „Asozialen“ zugeordnet. Aus<br />
diesem Grund liegen keine Zahlen über aufgrund von Homosexualität<br />
in Konzentrationslagern inhaftierte Frauen<br />
vor, wie auch insgesamt weibliche Homosexualität wesentlich<br />
stärker im Verborgenen gelebt wurde als männliche.<br />
Viele der in den Lagern internierten Homosexuellen wurden<br />
ermordet. Jedoch kurz vor Kriegsende wurde ein Teil<br />
der männlichen Homosexuellen freigelassen und zum<br />
Frontdienst in der Wehrmacht eingezogen.<br />
Die Verfolgung von Homosexuellen blieb allerdings auf<br />
das Reich und die eingegliederten Gebiete beschränkt. Für<br />
ein Vorgehen gegen Homosexuelle in den besetzten<br />
Ländern gibt es keine Beweise, wie auch nicht von einer<br />
systematischen Ermordung dieser Bevölkerungsgruppe<br />
während des Nationalsozialismus gesprochen werden kann.<br />
Nach 1945 blieb die NS-Ideologie weiterhin wirksam, so<br />
dass auch in der Nachkriegszeit die Strafverfolgung noch<br />
intensiver war als in den Jahren der Ersten Republik. Die<br />
Kontinuität in der gesellschaftlichen Einstellung zu Homosexualität<br />
zeigt sich auch an der Entschädigungspraxis<br />
nach 1945.<br />
Sowohl in Österreich als auch in Deutschland wurde die<br />
Rechtmäßigkeit der strafrechtlichen Verfolgung Homosexueller<br />
nicht in Frage gestellt. Für die homosexuellen<br />
Opfer gab es bis in die neunziger Jahre weder eine ideelle<br />
noch eine finanzielle Entschädigung.<br />
Die Opferfürsorge schließt bis heute die Anerkennung<br />
Homosexueller aus.<br />
Seit 1995 besteht allerdings auch für diese so lange „vergessene“<br />
Opfergruppe die Möglichkeit, über den Nationalfonds<br />
der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus<br />
eine finanzielle Entschädigung zu erhalten.<br />
Gudrun Wolfgruber<br />
Diese Zusammenfassung beruht wesentlich auf folgenden<br />
Publikationen: Claudia Schoppmann: Verbotene Verhältnisse.<br />
Frauenliebe 1938-1945. Querverlag, Berlin 1999;<br />
Albert Müller/Christian Fleck: „Unzucht wider die Natur“.<br />
Gerichtliche Verfolgung der „Unzucht mit Personen gleichen<br />
Geschlechts“ in Österreich von den 1930er bis zu den 1950er<br />
Jahren. In: ÖZG 9, 1998, 3, S. 400-422; Eberhard Jäckel/Peter<br />
Longerich/Julius Schoeps (<strong>Hrsg</strong>.): Enzyklopädie des Holocaust.<br />
Die Verfolgung der europäischen Juden. 3 Bde., Piper, München/<br />
Zürich 1995, Bd. II, Homosexualität, S. 622-623.
Opferfürsorgegesetzgebung<br />
Die Israelitische Kultusgemeinde<br />
Rückstellungsgesetzgebung<br />
Vergleich Österreich-Deutschland<br />
Der Nationalfonds<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Rückstellung und Entschädigung<br />
In welchem Ausmaß den Opfern des Nationalsozialismus ihr zwischen 1938 und 1945<br />
entzogenes und geraubtes Vermögen nach 1945 rückgestellt wurde, welche Gruppen für<br />
ihre Verfolgung und Vertreibung entschädigt wurden und welche nicht, lässt sich heute noch<br />
nicht eindeutig beantworten. Dieser Themenkomplex ist jedoch Untersuchungsgegenstand<br />
der österreichischen Historikerkommission, so dass in den nächsten Jahren mit neuen<br />
Erkenntnissen zu rechnen ist.<br />
Beide Gesetzeskomplexe, sowohl die ➤ Rückstellungsgesetzgebung als auch das ➤ Opferfürsorgegesetz<br />
(OFG), das Entschädigungen für NS-Opfer primär nach dem Fürsorgeprinzip<br />
regelte, zeichnen sich durch eine unübersichtliche Vielzahl von Gesetzen und Gesetzesnovellen<br />
aus. Wichtig für die Einschätzung des tatsächlichen Ausmaßes der Rückstellungen<br />
und Entschädigungen ist aber auch die bis heute kaum beleuchtete Rechtsprechung in<br />
Fragen der Rückstellungen und der Entschädigungen, in der sich die Mängel und Lücken<br />
der Gesetzgebung oftmals nachteilig für die Interessen der AntragstellerInnen, also der<br />
Enteigneten und Verfolgten, auswirken.<br />
Das folgende Kapitel soll einen ersten Überblick über die Geschichte der Entschädigung<br />
und Rückstellung im innen- und außenpolitischen Kontext der Zweiten Republik bieten und<br />
die wichtigsten Aspekte der Gesetzgebung näher beleuchten. Brigitte Bailer-Galanda skizziert<br />
in zwei Beiträgen die Grundzüge einerseits des Opferfürsorgegesetzes, andererseits<br />
der Rückstellungsgesetzgebung und ihre jeweilige Praxis in der Zweiten Republik. Die Entstehungsgeschichte<br />
beider Gesetzeskomplexe, die zwar getrennt voneinander zu sehen<br />
sind, sich aber in bestimmten Bereichen überschneiden, illustriert vor dem Hintergrund der<br />
innenpolitischen Situation der ersten Nachkriegsjahrzehnte auch den Umgang Österreichs<br />
mit seiner Vergangenheit.<br />
Die Einrichtung des „Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus“<br />
im Jahr 1995 führte zu einer wesentlichen Erweiterung des Kreises anspruchsberechtigter<br />
Personen in der Entschädigungsfrage.<br />
Die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem OFG – etwa die Berücksichtigung der<br />
bislang „vergessenen Opfer“ (siehe dazu das vorhergehende Kapitel) –, die Ziele und<br />
Tätigkeitsfelder des Fonds, das Ausmaß der bisher erfolgten Entschädigungszahlungen u.a.<br />
werden in einem Gespräch mit Hannah Lessing, der Generalsekretärin des Nationalfonds,<br />
thematisiert.<br />
Georg Graf erläutert in einem Interview einige konkrete Probleme der komplexen Rückstellungsgesetzgebung<br />
und -praxis aus juristischer Perspektive.Welche Rolle die Aktivitäten<br />
der „Opferverbände“ und der ➤ Israelitischen Kultusgemeinde bezüglich Rückstellungen<br />
und Entschädigungen in den Nachkriegsjahrzehnten spielten, schildert Helga Embacher in<br />
ihrem Beitrag. Dabei wird deutlich, dass eine „Hierarchie der Opfergruppen“, wie sie letztlich<br />
im Opferfürsorgegesetz festgeschrieben wurde, auch von den einzelnen Opfervertretungen<br />
aufgegriffen wurde und zu erheblichen Konflikten zwischen ihnen führte.<br />
Der Aufsatz von Frank Stern widmet sich vor allem den außenpolitischen Faktoren bzw.<br />
der Rolle der internationalen Öffentlichkeit in der Frage der „Wiedergutmachung“ für NS-<br />
Opfer und zeichnet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des österreichischen und des<br />
bundesdeutschen Weges der „Wiedergutmachung“ nach.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
89
DIE OPFERGRUPPEN UND DEREN ENTSCHÄDIGUNG<br />
BRIGITTE BAILER-GALANDA<br />
Österreichische<br />
Staatsbürgerschaft<br />
als<br />
Voraussetzung<br />
Die nur sehr zögerlich und vorwiegend unter alliiertem bzw. internationalem Druck zu Stande<br />
gekommenen Maßnahmen der Republik Österreich zu Gunsten der Opfer des Nationalsozialismus<br />
waren und sind auf eine ganze Reihe gesetzlicher Bestimmungen aufgesplittert,<br />
wodurch es den Betroffenen sehr erschwert wurde, zu ihrem Recht zu gelangen. Gleichzeitig<br />
entschied sich der Gesetzgeber bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit gegen eine<br />
Gleichbehandlung aller NS-Opfer, wodurch es zu grundlegenden Ungleichbehandlungen<br />
und Diskriminierungen einer Gruppe von Verfolgten kam. 1<br />
Tatsächliche Entschädigung wurde nur in geringem Ausmaß geleistet; mit Ausnahme der<br />
➤ Rückstellungsgesetzgebung sahen alle anderen Maßnahmen der Republik nur Pauschalentschädigungen<br />
bis zu einer bestimmten Schadenshöhe und in Abhängigkeit vom Einkommen<br />
des Antragstellers vor. D.h. wer das Glück hatte, sich nach 1945 neuerlich eine gute<br />
Existenz aufzubauen zu können, wurde für seine Verluste in geringerem Ausmaß entschädigt<br />
als jemand, dem dies nicht gelungen war. Damit finden wir bei der Frage der materiellen<br />
Entschädigung (mit Ausnahme der Rückstellungsgesetzgebung) denselben prinzipiellen Fürsorgegedanken<br />
wie im ➤ Opferfürsorgegesetz, das Versorgungsrenten für in ihrer Erwerbsfähigkeit<br />
geschädigte Opfer vorsah. Dieser Grundzug der NS-Opfer-Gesetzgebung geht<br />
zurück auf die Position Österreichs, das Land – sich selbst pauschaliter als Opfer des NS-<br />
Regimes sehend – habe keine Verantwortung für die Verfolgung zu tragen und daher auch<br />
keinerlei Verpflichtung zur Entschädigung oder „Wiedergutmachung“. Nur Motive der<br />
humanitären Hilfe und soziale Überlegungen bewegten die Verantwortlichen, in Not geratenen<br />
Verfolgten Hilfestellung zu gewähren. So die offizielle Leseart. 2<br />
Probleme im Opferfürsorgegesetz<br />
Insbesondere das Opferfürsorgegesetz – neben den Rückstellungsgesetzen der zweite Eckpfeiler<br />
der so genannten „Wiedergutmachung“ 3 – sah eine Reihe von Trennlinien vor, nach<br />
denen die NS-Opfer geteilt wurden. Die wesentliche Linie verlief zwischen Noch- oder Wieder-Österreichern<br />
auf der einen und ehemaligen Österreichern auf der anderen Seite. Die<br />
Republik sah sich primär nur dazu veranlasst, für jene NS-Opfer zu sorgen, die nach wie<br />
vor die österreichische Staatsbürgerschaft besaßen und damit im Falle ihrer Mittellosigkeit<br />
oder Erwerbsunfähigkeit dem Staat ohnehin in der einen oder anderen Form zur Last fallen<br />
könnten. So können fortlaufende Rentenleistungen aus dem Opferfürsorgegesetz nur von<br />
Österreichern mit aufrechter österreichischer Staatsbürgerschaft bezogen werden. 4<br />
Menschen, die 1938 und danach aus Österreich flüchten mussten und anschließend eine<br />
andere Staatsbürgerschaft angenommen haben, bleiben bis heute von den wesentlichen<br />
Leistungen des Opferfürsorgegesetzes ausgeschlossen. Nur einzelne Entschädigungsleistungen<br />
(für Haft- bzw. Internierungszeiten, Leben im Verborgenen, Tragen des diskriminierenden<br />
Judensterns 5 ) können auch von ehemaligen Österreichern beansprucht werden. Die<br />
Höhe der Entschädigung ist seit Anfang der sechziger Jahre gleich geblieben: S 860,- pro<br />
Monat der Haft (entsprach damals der durchschnittlichen Invaliditätspension eines Arbeiters,<br />
lag aber deutlich unter der Alterspension, die sich für Arbeiter knapp über S 1.000,bewegte<br />
6 ), S 350,- pro Monat der „Freiheitsbeschränkung“ oder des Lebens im Verborgenen,<br />
S 6.000,- für mindestens 6 Monate Tragens des Judensterns. Weiters konnten sie aus<br />
den drei Hilfsfonds 7 Pauschalzahlungen im Falle von Berufs- und Einkommensschäden sowie<br />
einmalige Unterstützungszahlungen – abhängig von Alter und Gesundheitszustand –<br />
erhalten. 8 Wie weit diese Menschen in der Lage waren, ihre Existenz aus eigenem Erwerb<br />
zu sichern, interessierte Österreich nicht mehr. Diese Sicherung wurde und wird nur<br />
Menschen mit aufrechter österreichischer Staatsbürgerschaft zugestanden. Es dauerte darüber<br />
hinaus bis in die fünfziger Jahre, bis Pensionen – die auf Grund von vor 1938 erworbenen<br />
Versicherungszeiten angefallen waren – auch ins Ausland überwiesen wurden. 9<br />
90 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Wieweit diese restriktive Haltung gegenüber den Vertriebenen – meist mit abwertendem<br />
Unterton „Emigranten“ genannt – den beträchtlichen, dieser Verfolgtengruppe entgegengebrachten<br />
Vorurteilen oder schlicht Sparsamkeitserwägungen entsprach, ist auf Grund des<br />
derzeitigen Forschungsstandes nicht abzuschätzen. Jedenfalls war damit die zahlenmäßig<br />
größte Gruppe von Verfolgten weitgehend von Hilfe und Entschädigung ausgeschlossen,<br />
ebenso jene Überlebenden, die nach 1945 Österreich verlassen hatten, weil sie das Leben<br />
hier nicht mehr ertrugen. Die letzte Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz ermöglicht es<br />
ihnen nunmehr wohl, die österreichische Staatsbürgerschaft zusätzlich zu ihrer bisherigen<br />
wieder zu erwerben und auf diese Weise antragsberechtigt zu werden, 10 doch diese Maßnahme<br />
kommt äußerst spät. Die Republik musste nur mehr mit geringen daraus resultierenden<br />
Kosten rechnen.<br />
Eine weitere wesentliche Trennlinie verläuft zwischen den Opfern des politischen Widerstandes<br />
und jenen der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen. In der unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit war Unterstützung durch das Opferfürsorgegesetz ausschließlich Opfern des<br />
politischen Widerstandes vorbehalten, die Opfer der rassistischen Verfolgung blieben zur<br />
Gänze unberücksichtigt, außer es bestätigte ihnen jemand, sie seien vor 1938 politisch<br />
aktiv gewesen. 11 Mit dem 1947 verabschiedeten, in seinen Grundzügen bis heute geltenden<br />
neuen Opferfürsorgegesetz änderte sich diese Situation nur geringfügig. Eine Amtsbescheinigung<br />
– die alleine zum fortlaufenden Rentenbezug ermächtigt – war jenen vorbehalten,<br />
die für ein unabhängiges Österreich „mit der Waffe in der Hand gekämpft oder sich<br />
rückhaltlos in Wort oder Tat eingesetzt“ 12 hatten, d.h. de facto allen jenen, die aus<br />
„politischen“ Gründen inhaftiert worden oder sonst wie zu Schaden gekommen waren. Für<br />
die Verfolgungsopfer war nur ein ➤ Opferausweis vorgesehen, der abgesehen von einem<br />
geringfügigen Steuerfreibetrag kaum Vorteile für die Betroffenen brachte. Erst nach und<br />
nach, beginnend mit 1949, wurden auch die Verfolgungsopfer in den Kreis der Rentenanspruchsberechtigten<br />
aufgenommen, mussten jedoch bis in die sechziger Jahre hinauf<br />
schwereren Schaden als Widerstandskämpfer erlitten haben. 13 Die diskriminierende Unterscheidung<br />
➤ Amtsbescheinigung und Opferausweis besteht allerdings bis heute. So wurde<br />
zwar 1969 die erzwungene Flucht aus Österreich als Verfolgungstatbestand anerkannt,<br />
berechtigt allerdings ebenso wie das Überleben im Verborgenen nur zum Bezug eines<br />
Opferausweises. 14<br />
Aber auch der Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird in sich weiter kategorisiert.<br />
Für die Opferfürsorge zählt nur ausdrücklich politische Aktivität gegen den Nationalsozialismus<br />
als Widerstand. Vorgeblich unpolitische oppositionelle Handlungen, obgleich<br />
auch diese zu Inhaftierungen, KZ-Haft oder sogar Hinrichtung führen konnten, finden nur in<br />
engen Grenzen Berücksichtigung. Aus Mitmenschlichkeit gesetzte Hilfsmaßnahmen für Verfolgte<br />
etwa zählten nur dann als Widerstand, wenn zu den Verfolgten keine verwandtschaftlichen<br />
oder freundschaftlichen Bindungen bestanden, wie die aus solchen Gründen<br />
ins KZ Auschwitz verbrachte Ella Lingens erfahren musste. 15 Wurde jemand wegen abfälliger<br />
Äußerungen über das NS-Regime oder Abhörens ausländischer Sender verurteilt, musste<br />
er nach 1945 gegenüber der Behörde seine dahinter stehenden politischen Motive glaubhaft<br />
machen, wobei politisch meist im Sinne von parteipolitischer Orientierung begriffen<br />
wurde. Frauen, die wegen verbotenen Umgangs mit „Fremdarbeitern“ oder Kriegsgefangenen<br />
verurteilt wurden, gelten nicht als Widerstandskämpferinnen. 16<br />
Und auch ein Franz Jägerstätter wurde nicht als Opfer politischen Widerstandes anerkannt.<br />
17<br />
Wie insgesamt militärische Delikte – wie Fahnenflucht beispielsweise – nur selten im<br />
Sinne des OFG anerkannt wurden, da – so die Begründung der Behörden – Desertion in<br />
allen Armeen der Welt strafbar sei. Unberücksichtigt bleiben daher die historischen Gegebenheiten,<br />
wie die besondere Härte der nationalsozialistischen Militärgerichtsbarkeit, der<br />
Charakter des deutschen Angriffskrieges, etc. 18<br />
Ebenso erkannten Gesetzgeber und Behörden nicht alle vom NS-Staat Verfolgten als anspruchsberechtigt<br />
an. Die von den Nationalsozialisten gesetzten Stigmatisierungen wirkten<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
91<br />
Amtsbescheinigung<br />
versus<br />
Opferausweis<br />
Kontinuität von<br />
Stigmatisierungen
Benachteiligung<br />
unterer Einkommensschichten<br />
in<br />
der Rechtsdurchsetzungsfähigkeit<br />
Nur tatsächlich<br />
noch vorhandenes<br />
Gut kann rückgestellt<br />
werden<br />
Die Opfergruppen und deren Entschädigung<br />
nach 1945 in Entschädigungsfragen weiter. Trotzdem der rassistische Charakter der Verfolgung<br />
und Ermordung von Roma und Sinti 19 klar auf der Hand lag, wurden die Opfer der<br />
ersten Verhaftungswellen 1939 im Sinne des damals angegebenen Haftgrundes als angeblich<br />
wegen ihrer „kriminellen“ Neigungen Inhaftierte oftmals von den OF-Behörden abgelehnt.<br />
Insgesamt waren Roma und Sinti als Antragsteller mit einer starken Vorurteilskontinuität<br />
konfrontiert, wodurch eine Durchsetzung ihrer Ansprüche deutlich erschwert und<br />
oftmals verunmöglicht wurde. Diese jahrzehntelangen schlechten Erfahrungen führen dazu,<br />
dass überlebende Opfer aus diesem Kreis sich scheuen, neuerliche Anträge, z.B. an den<br />
➤ Nationalfonds, zu stellen und damit mögliche Entschädigungszahlungen versäumen. Auf<br />
diese Weise wirkt die Diskriminierung der letzten Jahrzehnte verhängnisvoll weiter.<br />
Bis 1995 waren drei Gruppen von Verfolgten gänzlich von jeder Entschädigungs- oder<br />
Hilfeleistung ausgeschlossen: 20<br />
die Opfer der nationalsozialistischen „Erbgesundheitsgesetze“, d.h. der Zwangssterilisierungen<br />
und der so genannten ➤ „Euthanasie“,<br />
die als sogenannte „Asoziale“ Verfolgten, d.h. mehrheitlich soziale Außenseiter bzw. Angehörige<br />
von Randgruppen, unangepasste Jugendliche etc.,<br />
wegen ihrer sexuellen Neigung verfolgte Homosexuelle.<br />
Deren Anerkennung als NS-Opfer standen weiterwirkende gesellschaftliche Vorurteile<br />
entgegen, die auch vor den Vertretern der übrigen Opfer nicht Halt machten. So wehrten<br />
sich die drei politischen Opferverbände stets gegen die Aufnahme dieses Personenkreises<br />
in das Opferfürsorgegesetz. Erst der Nationalfonds schuf hier eine Abhilfe. Nur leben<br />
heute nur mehr ganz wenige dieser ehemaligen Verfolgten oder aber haben nach Jahrzehnten<br />
der Ablehnung nicht den Mut oder die Energie, um eine Zahlung aus dem Fonds<br />
anzusuchen.<br />
Grundsätzlich anerkannten die OF-Behörden nach 1945 nicht den unterschiedlichen<br />
Charakter einer republikanischen Strafbestimmung und nationalsozialistischer Unrechtspflege.<br />
So wurde Homosexuellen unter Hinweis auf die bis in die siebziger Jahre geltende<br />
Strafbarkeit gleichgeschlechtlicher Beziehungen jede Entschädigung und auch die Anrechnung<br />
der Haftzeiten für die Pension verweigert. 21 Die als angeblich „asozial“ verfolgten<br />
Menschen sahen sich mit dem mehr oder weniger ausgesprochenen Vorwurf konfrontiert,<br />
ihre Inhaftierung wäre wohl zu Recht erfolgt; Sterilisierung wurde als nicht typisch nationalsozialistische,<br />
sondern medizinische Maßnahme klassifiziert.<br />
Doch auch für die anerkannten Gruppen saß der Teufel im Detail: Was hilft es jemandem,<br />
einen Steuerfreibetrag zu erhalten, der so wenig verdient, dass er beinahe keine<br />
Lohnsteuer zu zahlen braucht? Wie soll jemand einen Einkommensschaden, d.h. Minderung<br />
des Einkommens um mehr als die Hälfte, geltend machen, der vor seiner Verfolgung<br />
mehrheitlich unangemeldet gearbeitet hat? Wie soll ein burgenländischer Roma Ersatz für<br />
untergegangenen Hausrat erhalten, wenn die Behörde meint, die „Zigeuner“ hätten sowieso<br />
keine Möbel gehabt? Hier lag eine ganze Reihe von Fallstricken vor allem für Antragsteller<br />
aus den unteren Einkommensschichten bereit. Diese Gruppen waren und sind aber<br />
auch aus sozialen Gründen in ihrer Rechtsdurchsetzungsfähigkeit benachteiligt, da ihnen<br />
Informationen ebenso fehlen wie die Möglichkeit, rechtskundlichen Beistand zu finden. Dies<br />
ist aber wohl kein spezifisches Problem der Entschädigung, in diesem Fall jedoch besonders<br />
schmerzhaft für die Betroffenen.<br />
Die materielle Entschädigung<br />
Etwas anders, aber deshalb nicht weniger problematisch, war die Situation im Bereich der<br />
Entschädigung für entzogenes, d.h. geraubtes Eigentum. Hier herrschte der Grundsatz,<br />
dass dem Staat Österreich aus dieser Rückgängigmachung der Beraubungen 1938 und danach<br />
möglichst keine Kosten erwachsen dürften. 22 Damit war aber die Grenze der Rückstellung<br />
bereits abgesteckt. Rückgestellt werden konnte nur jener Besitz, der tatsächlich noch<br />
vorhanden war. Nun war jedoch nach dem „Anschluss“ die überwältigende Mehrheit der<br />
92 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
„arisierten“ Betriebe zuerst ausgeraubt und anschließend im Sinne einer „Strukturbereinigung<br />
der Wirtschaft“ liquidiert worden, 23 so dass für zahlreiche Geschädigte, vor allem<br />
ehemalige Kleingewerbetreibende oder Handwerker, eine Wiederherstellung ihrer Existenz<br />
im Wege der Rückstellung gar nicht in Frage kam. Erst 1958 konnten sie im Wege des<br />
➤ „Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetzes“ Pauschalentschädigungen für verloren<br />
gegangenen Hausrat und Geschäftseinrichtungen erhalten. Diese Entschädigung wurde<br />
jedoch nur bis zu einer bestimmten Höhe (Hausrat öS 15.000,-, Geschäftseinrichtungen<br />
öS 20.000,-, in besonderen Härtefällen bis öS 50.000,-) und in Abhängigkeit vom Einkommen<br />
zum Zeitpunkt der Antragstellung (ab einem Jahreseinkommen von öS 72.000,- entfiel<br />
die Entschädigung, das durchschnittliche Monatseinkommen eines Beamten betrug damals<br />
rund öS 3.000,-) ausbezahlt , 24 sodass auch in diesem Bereich Entschädigung in Abhängigkeit<br />
von sozialer Bedürftigkeit geleistet wurde. Drei Jahre später wurde der ➤ Abgeltungsfonds<br />
errichtet, der die Abgeltung verfolgungsbedingter Verluste von Bankkonti, Wertpapieren<br />
und Bargeld sowie Verluste infolge diskriminierender Abgaben vorsah (Judenvermögensabgabe,<br />
➤ Reichsfluchtsteuer). Kleinere Verluste wurden zur Gänze, größere mit<br />
48,5 %, jedoch mindestens mit öS 47.250,- entschädigt. 25 Zu diesem Fonds sowie zur<br />
12. Novelle des Opferfürsorgegesetzes hatte die BRD auf Grund des Abkommens von Bad<br />
➤ Kreuznach insgesamt 95 Millionen DM zugezahlt. 26<br />
Doch auch die Rückstellung noch vorhandenen Eigentums gestaltete sich problematisch,<br />
insbesondere im Rahmen der unmittelbaren Auseinandersetzung zwischen dem geschädigten<br />
Eigentümer und dem Inhaber des Eigentums nach 1945, wie sie im 3. Rückstellungsgesetz<br />
27 vorgesehen war. Der Beraubte befand sich von Anfang an in der ungünstigeren<br />
Position. Er war entweder mittellos oder krank aus dem Konzentrationslager zurückgekehrt,<br />
sah sich – im selteneren Fall – nach seiner Heimkehr aus dem Zufluchtsland vor der<br />
Notwendigkeit einer neuerlichen Existenzgründung oder musste seine Ansprüche vom Ausland<br />
aus durchzusetzen versuchen. Der gegenwärtige Inhaber, entweder der ➤ „Ariseur“<br />
selbst oder dessen Nachfolger, konnte demgegenüber auf ein Netz von Kontakten und<br />
meist auch ausreichend finanzielle Mittel zurückgreifen. Zurückgestellt musste nur werden,<br />
wenn das geraubte Eigentum nicht eine grundlegende Umgestaltung erfahren hatte, d.h.<br />
z.B. die Fabrik erneuert oder auf eine andere Produktion eingestellt worden war. Im<br />
Übrigen hatte in vielen Fällen der geschädigte Eigentümer den Kaufpreis von 1938<br />
zurückzuzahlen, von dem er allerdings nur in den seltensten Fällen tatsächlich etwas in die<br />
Hand bekommen hatte. Das Geld hatte auf ➤ Sperrkonten gelegt werden müssen, davon<br />
wurden ➤ Judenvermögensabgabe und ➤ Reichsfluchtsteuer abgezogen, Beträge, die in<br />
der Judikatur der Rückstellungskommissionen allerdings als im Sinne der Beraubten verwendet<br />
gewertet wurden. 28 Wollte nun der Rückstellungswerber seinen Betrieb oder sein<br />
Haus zurückhaben, musste er nicht selten sogar einen Kredit aufnehmen, um sein Eigentum<br />
quasi zurückkaufen zu können. 29 Es verwundert daher nicht, dass zahlreiche der Verfahren<br />
mit Vergleichen endeten, in denen die geschädigten Eigentümer mit Abschlagszahlungen<br />
abgefunden wurden. Als ein Beispiel kann das Bärental des FPÖ-Obmannes gelten.<br />
Dessen Besitzerin, eine nach 1945 in Israel lebende Frau aus Italien, war mit einigen<br />
Jahreserträgen abgefunden worden. 30<br />
Außerdem dauerten die Verfahren unverhältnismäßig lange. Im Oktober 1954 waren<br />
von insgesamt 34.539 angestrengten Rückstellungsverfahren noch 5181 Verfahren anhängig.<br />
31<br />
Während in den vierziger Jahren auch Rückstellungsgesetze für Patente, Firmennamen,<br />
Ansprüche aus Dienstverhältnissen in der Privatwirtschaft und für entzogenes Eigentum von<br />
juristischen Personen verabschiedet wurden, 32 gelangte das bereits im Dritten Rückstellungsgesetz<br />
vom Gesetzgeber versprochene Gesetz der Rückstellung von Miet- und Bestandsrechten,<br />
also angemieteten Geschäftslokalen und Wohnungen, nicht über das Planungsstadium<br />
hinaus. D.h. Heimkehrer mussten in Not- und Massenquartieren unterkommen (1953<br />
noch 800 Mitglieder der ➤ IKG 33 ), während in ihren ehemaligen Wohnungen nach wie vor<br />
die „Ariseure“ oder deren Familien saßen.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
93<br />
Beraubter contra<br />
„Ariseur“<br />
Unzureichende<br />
und unterlassene<br />
Entschädigung
Volle Entschädigung<br />
war die<br />
Ausnahme<br />
Die Opfergruppen und deren Entschädigung<br />
Das 1952 verabschiedete Beamtenentschädigungsgesetz sah Abgeltungszahlungen von<br />
entgangenen Gehältern öffentlich Bediensteter vor, das 1953 auch ehemalige ÖsterreicherInnen<br />
einbezog. Die Entschädigungszahlungen stellten jedoch nur einen Bruchteil<br />
des tatsächlich entgangenen Gehaltes dar. 34<br />
Nie entschädigt wurde die Arbeitsleistung der Zwangsarbeiter verschiedener Nationalitäten<br />
in der Privatwirtschaft und beim Aufbau der verstaatlichten Industrie. Vor allem die<br />
Linzer Betriebe VOEST und OMV (früher Chemie Linz) entstanden als „Hermann Göring-<br />
Werke“ vorwiegend durch die Arbeit von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen. 35 Während<br />
österreichische Häftlinge zumindest Anspruch nach OFG hatten, gingen die übrigen Sklavenarbeiter<br />
bislang leer aus.<br />
Überblick über die Entschädigungsleistungen Österreichs<br />
Die volle Entschädigung für erlittene Verluste stellte im Rahmen der österreichischen Gesetzgebung<br />
die absolute Ausnahme dar. Die meisten Leistungen waren mit einer Obergrenze<br />
limitiert und zusätzlich von der sozialen Situation der Betroffenen zum Zeitpunkt der Antragstellung,<br />
wie beispielsweise bei der Entschädigung für verlorenen Hausrat und Geschäftseinrichtungen.<br />
Ebenso wurden verlorene Bankkonti u.ä. im Falle größerer Verluste nicht einmal<br />
zur Hälfte ersetzt. Wohnungen wurden überhaupt nicht zurückgegeben, sonstiges<br />
Eigentum nur mit allen oben angeführten Einschränkungen der Rückstellungsgesetzgebung.<br />
Interessant in diesem Zusammenhang sind weiters die Leistungen für entgangenes Einkommen.<br />
Öffentlich Bediensteten wurden zwar die Verfolgungszeiten für die Vorrückung angerechnet,<br />
die Entschädigungsbeträge beliefen sich jedoch nur auf einen Bruchteil der tatsächlichen<br />
finanziellen Einbußen. Nach dem Opferfürsorgegesetz erhielten die NS-Opfer<br />
1961 im Falle einer Minderung des Einkommens um mindestens die Hälfte durch mindestens<br />
3,5 Jahre eine einmalige Zahlung von öS 10.000,-. 36 Vergleicht man das mit der Einkommenssituation<br />
von 1961, so waren das deutlich weniger als sieben Monate durchschnittlicher<br />
Pensionszahlung. Die durchschnittliche Alterspension eines Angestellten betrug<br />
damals öS 1.500,-. 37 Auf diese Entschädigung wurden aber noch alle anderen aus diesem<br />
Titel erhaltenen Zahlungen aus dem Beamtenentschädigungsgesetz und dem 7. Rückstellungsgesetz<br />
(Abfertigungen, Kündigungsentschädigungen oder Betriebspensionen aus der<br />
Privatwirtschaft) angerechnet, so dass man von einer Gesamtentschädigung für Einkommensverluste<br />
von maximal öS 10.000,- ausgehen kann.<br />
Für eine erzwungene Unterbrechung der Berufsausbildung wurden 1961 gleichfalls nur<br />
öS 6.000,- Pauschalentschädigung (also vier Monate durchschnittlicher Angestelltenpension)<br />
geleistet. 38 Die ➤ Hilfsfonds, die sozusagen die Opferfürsorgeleistungen für ehemalige<br />
ÖsterreicherInnen kompensieren sollten, sahen gleichfalls nur vergleichsweise geringe<br />
Entschädigungsbeträge vor. Aus dem ersten Hilfsfonds 1956 39 betrug die höchste<br />
Zahlung – d.h. für einen ehemaligen Verfolgten mit 70 % Minderung der Erwerbstätigkeit –<br />
öS 30.000,-, das waren zu jener Zeit 16 durchschnittliche Monatsgehälter eines Arbeiters.<br />
40 Der zweite Hilfsfonds zahlte in den sechziger Jahren rund öS 14.000,- pro Person für<br />
Berufs- und Ausbildungsschäden aus. 41<br />
Von einer tatsächlichen Entschädigung für das verlorene Einkommen kann also keinesfalls<br />
die Rede sein.<br />
Eine interessante Rechnung erstellte 1972 die Arbeitsgemeinschaft der Opferverbände,<br />
zu der sich Sozialdemokratische Freiheitskämpfer, ÖVP-Kameradschaft und ➤ KZ-Verband<br />
in den sechziger Jahren zusammengefunden haben. Die Arbeitsgemeinschaft forderte –<br />
ergebnislos – von der Bundesregierung eine Abgeltung für die verfolgungsbedingte Minderung<br />
der Lebensverdienstsumme. Ausgehend vom Ausgleichszulagenrichtsatz, also der<br />
Mindestpension, der damals öS 1.600,- pro Monat betrug, verlangten sie eine Entschädigung<br />
in der Höhe der Hälfte der Mindestpension pro Monat der Verfolgung. Für eine<br />
siebenjährige Verfolgung (1938–1945) wären dies 1972 öS 68.000,- gewesen. 42 Rechnet<br />
man dies auf heutige Werte um, so gelangt man zu folgendem Ergebnis: 1997 beträgt die<br />
94 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Mindestpension laut Auskunft der Pensionsversicherungsanstalt öS 7.887,- für eine Einzelperson.<br />
Unter Zugrundelegung der – allerdings bescheidenen – Forderung der Opferverbände<br />
beliefe sich heute eine Entschädigung für die Verluste in der Lebensverdienstsumme<br />
daher auf öS 331.254,-. Diese Summe relativiert wiederum die Auszahlungen nach dem<br />
Nationalfonds, wobei jedoch der Wert des Fonds, der erstmals beinahe alle Gruppen von<br />
Verfolgten umfasst, nicht geschmälert werden soll.<br />
Insgesamt hat die Republik Österreich nach offiziellen Angaben des Bundespressedienstes<br />
von 1945 bis 1988 rund 8 Milliarden Schilling, 43 unter Berücksichtigung des Nationalfonds<br />
und der weiteren Ausgaben der Opferfürsorge bis 1995 rund 11 Milliarden Schilling<br />
für Leistungen an die NS-Opfer aufgewendet. Diese Zahl inkludiert alle Zahlungen nach<br />
dem Opferfürsorgegesetz, die Hilfsfonds, das ➤ Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz<br />
und den Abgeltungsfonds. Abzuziehen sind davon die von der Bundesrepublik Deutschland<br />
eingebrachten 95 Millionen DM, also rund 600 Millionen Schilling nach damaligem Kurs.<br />
Nicht berücksichtigt in dieser Zahl sind außerordentliche Versorgungsgenüsse für Beamte<br />
(1988 rund 11 Millionen Schilling pro Jahr) sowie zusätzliche Leistungen für Verfolgte in<br />
der Pensionsversicherung, worüber jedoch – entgegen anders lautender Politikerbehauptungen<br />
– laut Auskunft des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger keine gesonderte<br />
Statistik verfügbar ist.<br />
Zusammenfassung<br />
Es kann also festgestellt werden, dass die Leistungen für die NS-Opfer weit hinter den<br />
tatsächlichen Verlusten zurückbleiben. Darüber hinaus bestehen bis heute Mängel in der<br />
Gesetzgebung, wie der erforderliche Nachweis der verfolgungsbedingten Kausalität eines<br />
Gesundheitsschadens, der den wenigen heute noch lebenden Opfern nach wie vor beträchtliche<br />
Hürden in den Weg legt. Außerdem gibt es nach wie vor eine Reihe von Verfolgten,<br />
deren Leiden in der NS-Zeit nicht als Verfolgung anerkannt werden bzw. die keinen<br />
Anspruch auf Entschädigung haben, wie beispielsweise die Deserteure aus der deutschen<br />
Wehrmacht oder die nichtösterreichischen Zwangsarbeiter.<br />
Doch nicht einmal Leistungen, die keine Kosten verursachen, wurden erbracht. Österreich<br />
hat die Opfer des Nationalsozialismus gnadenhalber wieder aufgenommen, nie jedoch<br />
tatsächliches Verständnis für die Situation der Überlebenden aufgebracht. Sie blieben<br />
außerhalb der Solidarität der Kriegsgeneration, deren Angehörige als Mitläufer, Sympathisanten,<br />
Angepasste das NS-Regime erlebten. Hier bliebe abseits aller materiellen Leistungen<br />
noch viel zu tun.<br />
1 Siehe dazu ausführlich: Brigitte Bailer, Wiedergutmachung kein<br />
Thema. Österreich und die Opfer des Nationalsozialismus, Wien<br />
1993.<br />
2 Diese Grundposition findet sich kontinuierlich seit 1945. Noch<br />
1988 wurde sie in einer offiziellen Darstellung vertreten: Bundespressedienst<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Maßnahmen der Republik Österreich zu Gunsten<br />
bestimmter politisch, religiös oder abstammungsmäßig Verfolgter<br />
seit 1945, Wien 1988 (Österreich Dokumentation).<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
Der vorliegende Text wurde von Brigitte Bailer-Galanda im Rahmen einer<br />
Enquete der GRÜNEN zum Thema „Die wirtschaftlichen Schäden der NS-Opfer“<br />
am 17. Juni 1997 im Parlament vorgetragen. Der Text dieses Referates wurde<br />
der Abteilung <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> des BMUK für die Dokumentation der<br />
Tagung der ZeitzeugInnen 1998 „1938–1998.<br />
Flucht – Migration – Asyl gestern und heute“ von Dr. Bailer-Galanda und<br />
dem Grünen Parlamentsklub zur Verfügung gestellt.<br />
Die bei der Enquete „Die wirtschaftlichen Schäden der NS-Opfer“<br />
gehaltenen Referate werden von den GRÜNEN und<br />
der GRÜNEN BILDUNGSWERKSTATT MINDERHEITEN publiziert und<br />
können auch über diese bezogen werden.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
95<br />
Mängel in der<br />
Gesetzgebung<br />
bestehen bis<br />
heute<br />
3 Der Begriff der Wiedergutmachung im Sinne von „wieder gut machen“<br />
wurde auch von deutschen Wissenschaftern in Frage gestellt:<br />
Siehe z. B. Rolf Theis, Wiedergutmachung zwischen Moral und Interesse.<br />
Eine kritische Bestandsaufnahme der deutsch-israelischen<br />
Regierungsverhandlungen, Frankfurt/M. 1989, S. 32; Ludolf Herbst,<br />
Einleitung, in ders., Constantin Goschler (<strong>Hrsg</strong>.), Wiedergutmachung<br />
in der Bundesrepublik Deutschland, München 1989 (Sondernummer<br />
Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte), S. 8 ff.
Die Opfergruppen und deren Entschädigung<br />
4 Bundesgesetz über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um ein<br />
freies, demokratisches Österreich und die Opfer politischer Verfolgungen<br />
(Opferfürsorgegesetz), BGBl. Nr. 183 vom 4.7.1947, § 1<br />
Abs. 4.<br />
5 §§ 13 c, 14 a, Opferfürsorgegesetz.<br />
6 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (<strong>Hrsg</strong>.), Wirtschaftsstatistisches<br />
Handbuch 1961, Wien 1962, S. 87.<br />
7 BGBl. Nr. 25 vom 18.1.1956; BGBl. Nr. 178 vom 13.6.1962; BGBl. Nr.<br />
714 vom 13.12.1976.<br />
8 Siehe dazu ausführlicher: Bailer, a. a. O., S. 157-163.<br />
9 BGBl. Nr. 97/1954, siehe dazu auch: Dietmar Walch, Die jüdischen<br />
Bemühungen um die materielle Wiedergutmachung durch die Republik<br />
Österreich, Wien 1971, S. 43 ff.; Bailer, a. a. O., S. 240 f.<br />
10 Diese Möglichkeit wurde im Herbst 1993 geschaffen: Die Furche,<br />
15.9.1994.<br />
11 1. Durchführungserlass Zl. IV-8840/16/46 zum Gesetz vom<br />
17.7.1945, StGBl. Nr. 90 und zur Verordnung des Staatsamtes für<br />
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Staatsamt für Finanzen<br />
vom 31.10.1945, BGBl. Nr. 34/1946 (Opferfürsorgeverordnung),<br />
Sonderabdruck aus Heft 1/2 der „Amtlichen Nachrichten<br />
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung“, S.4. Ausführlich:<br />
Bailer, a. a. O., S. 25 f.<br />
12 § 1 Abs. 1 Opferfürsorgegesetz.<br />
13 Bailer, a. a. O., S. 141-145.<br />
14 BGBl. Nr. 205 vom 22.5.1969.<br />
15 Bailer, a. a. O., S. 53 f.<br />
16 Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 22.2.1965, Zl. 687/64.<br />
17 DÖW Akt Nr. 13.454; Erna Putz, Franz Jägerstätter. „... besser die<br />
Hände als der Wille gefesselt ...“, Linz-Passau 1987 (2. Aufl.), S. 278.<br />
18 Bailer, a. a. O., S. 168.<br />
19 Siehe dazu ausführlich: Barbara Rieger, „Zigeunerleben“ in Salzburg<br />
1930-1943. Die regionale Zigeunerverfolgung als Vorstufe<br />
zur planmäßigen Vernichtung in Auschwitz, Diplomarbeit an der<br />
geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Wien<br />
1990; Erika Thurner, Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich,<br />
Salzburg 1983; Bailer, a. a. O., S. 176-184.<br />
20 Bailer, a. a. O., S. 185-197. Zur Situation der Opfer der nationalsozialistischen<br />
Rassenhygiene siehe auch Wolfgang Neugebauer, Das<br />
Opferfürsorgegesetz und die Sterilisationsopfer in Österreich, in:<br />
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (<strong>Hrsg</strong>.),<br />
Jahrbuch 1989, Wien 1989, S. 144-150.<br />
21 Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten Srb und Freunde<br />
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales betreffend die homosexuellen<br />
Opfer des Nationalsozialismus (Nr. 2474/J) vom<br />
12.9.1988, Zl. 10.009/168-4/88.<br />
22 Erläuternde Bemerkungen zu dem Gesetz über die Nichtigkeit<br />
von Vermögensentziehung (3. Rückstellungsgesetz), 45. Sitzung<br />
des Ministerrates, 12.11.1946. Archiv der Republik, BM für Unterricht,<br />
Ministerratsprotokolle, Karton 4.<br />
23 Gertraud Fuchs, Die Vermögensverkehrsstelle als Arisierungsbehörde<br />
jüdischer Betriebe, Diplomarbeit am Institut für Wirtschafts-<br />
und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien,<br />
Wien 1989, S. 166. Von den im Mai 1938 zum Zeitpunkt der Schaffung<br />
der Vermögensverkehrsstelle noch existierenden 26.000 jüdischen<br />
Betrieben waren nur 4353 zur Weiterführung vorgesehen.<br />
24 BGBl. Nr. 127 vom 25.6.1958.<br />
25 Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter,<br />
BGBl. Nr. 100 vom 22.3.1961.<br />
26 Das Kreuznacher Abkommen umfaßte zwei Teile. Der erste beinhaltete<br />
Zahlungen der BRD für die Eingliederung der so genannten<br />
„Volksdeutschen“ in Österreich, der zweite sah Zahlungen der<br />
BRD für die Maßnahmen zu Gunsten der NS-Opfer vor. Siehe dazu:<br />
Bailer, a.a. O., S. 96 ff. Der Text des Abkommens in BGBl. Nr.<br />
283 vom 28.9.1962.<br />
27 BGBl. Nr. 54/1947.<br />
28 Juristisch fundierte Kritik an dieser Praxis siehe: Georg Graf, Arisierung<br />
und keine Wiedergutmachung. Kritische Anmerkungen<br />
zur jüngeren österreichischen Rechtsgeschichte, in: P. Feyerabend,<br />
C. Wegeler (<strong>Hrsg</strong>.), Philosophie – Psychoanalyse – Emigration,<br />
Wien 1992, S. 73 ff.<br />
29 Vgl. Die Gemeinde, Nr. 2, März 1948.<br />
30 Profil, 9.6., 9.12.1986.<br />
31 Statistik über den Stand der Rückstellungsverfahren von Ende Oktober<br />
1954. Institut für Zeitgeschichte, Nachlaß Albert Löwy, Karton<br />
Rückstellung Statistiken.<br />
32 BGBl. 143/1947, 164/1949, 199/1949, 207/1949.<br />
33 Vereinigter Exekutivausschuss für jüdische Forderungen an Österreich,<br />
Memorandum über Ansprüche aus dem Titel entzogener<br />
Wohnungen, 1.7.1953. Institut für Zeitgeschichte der Universität<br />
Wien, Nachlaß Albert Löwy.<br />
34 ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten (<strong>Hrsg</strong>.), Die Wiedergutmachung.<br />
Werden und Ergebnis der Entschädigungsgesetze<br />
für politisch Verfolgte und gemaßregelte Beamte, Wien o.J.<br />
(1952).<br />
35 Florian Freund, Bertrand Perz, Fremdarbeiter und KZ-Häftlinge in<br />
der „Ostmark“, in: Ulrich Herbert (<strong>Hrsg</strong>.), Europa und der<br />
„Reichseinsatz“. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und<br />
KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991, S. 317-350.<br />
36 § 14 b Opferfürsorgegesetz. Die Höhe der Entschädigung blieb<br />
seither gleich, wurde also nicht valorisiert.<br />
37 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (<strong>Hrsg</strong>.), Wirtschaftsstatistisches<br />
Handbuch 1961, Wien 1962, S. 87.<br />
38 § 14 a Opferfürsorgegesetz. Siehe auch Anmerkung 36.<br />
39 BGBl. Nr. 25 vom 18.1.1956.<br />
40 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (<strong>Hrsg</strong>.), Wirtschaftsstatistisches<br />
Handbuch 1964, Wien 1964, S. 217.<br />
41 BGBl. Nr. 178 vom 13.6.1962.<br />
42 PKZ, Pressekorrespondenz des Bundesverbandes österreichischer<br />
Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus (KZ-Verband),<br />
Nr. 3, 1.9.1972. Der Text wurde gleich lautend im Sozialistischen<br />
Kämpfer (Bund Sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des<br />
Faschismus) sowie im Freiheitskämpfer (ÖVP-Kameradschaft der<br />
politisch Verfolgten) veröffentlicht.<br />
43 Errechnet anhand der Angaben in: Bundespressedienst, a.a.O.<br />
96 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
ERSTE ANLAUFSTELLEN/MASSNAHMEN FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS NACH 1945<br />
Die Zuständigkeit der im Folgenden aufgelisteten behördlichen<br />
Stellen als erste Anlaufstellen für Opfer des<br />
Nationalsozialismus richtet sich nach der Anerkennung<br />
der einzelnen Opfergruppen in der ➤ Opferfürsorgegesetzgebung<br />
(vgl. Bailer-Galanda in diesem Band, S. 90).<br />
Unmittelbar nach dem Kriegsende 1945 erfolgte von<br />
staatlicher Seite ausschließlich eine Anerkennung und<br />
Unterstützung der im Nationalsozialismus aus politischen<br />
Gründen verfolgten Opfer und WiderstandskämpferInnen.<br />
Den für Wien zuständigen Stellen und Ämtern des Magistrats<br />
der Stadt Wien entsprechen in den Bundesländern<br />
die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften und<br />
Sozialreferate der Bezirksämter der Länder.<br />
Als Soforthilfe wurden im Juli 1945 von der Magistratsabteilung<br />
MA X/1 der Stadt Wien (1946 nach Umstrukturierung<br />
des Wiener Magistrats ➤ MA 12, Amt für Erwachsenen-<br />
und Familienfürsorge) für RückkehrerInnen aus Konzentrationslagern<br />
an den Wiener Bahnhöfen eigene Fürsorgestellen<br />
errichtet. In Zusammenarbeit mit den unmittelbar<br />
nach dem Krieg eingerichteten Fürsorgekommissionen,<br />
in denen hauptsächlich ehrenamtliche FürsorgerInnen<br />
tätig waren, erfolgte durch Unterstützung ausländischer<br />
Hilfsorganisationen die medizinische Erstversorgung,<br />
die Vergabe von Lebensmitteln und Bekleidung. Die Unterbringung<br />
obdachloser Rückwanderer und Flüchtlinge<br />
erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Anstaltenamt der<br />
Stadt Wien (MA 17), zumeist in Obdachlosenasylen sowie<br />
Krankenhäusern. Im Juli 1945 wurde von der MA 12 eine<br />
eigene Betreuungsstelle für die HeimkehrerInnen aus<br />
Konzentrationslagern errichtet; im Oktober 1945 wurden<br />
in den Fürsorgeämtern der einzelnen Gemeindebezirke<br />
weitere Betreuungsstellen eröffnet. Gemäß des 1. Opferfürsorgegesetzes<br />
vom 17. Juli 1945 war eine Unterstützung<br />
nur „Opfern des Kampfes um ein freies und demokratisches<br />
Österreich“ vorbehalten. Die Unterstützung erfolgte<br />
in Form von einmaligen Geld- und Sachleistungen, in<br />
der Gewährung von Fürsorgedarlehen als einmalige Aufwendung<br />
zur Wiederherstellung wirtschaftlicher Selbständigkeit,<br />
vor allem für Angehörige der freien Berufe,<br />
wie Ärzte, Dentisten etc. Auch die Möglichkeit für den<br />
Erhalt einer Wohnung war an die Anerkennung nach<br />
dem Opferfürsorgegesetz geknüpft. Wohnungszuweisungen<br />
an obdachlose Opfer erfolgten über das Wohnungsamt<br />
➤ MA 52 der Stadt Wien. Die Richtlinien über<br />
Wohnungsanmeldung und Wohnungsvergabe vom<br />
25.4.1995 sahen eine Vergabe freier Wohnungen allerdings<br />
nur für Bombengeschädigte vor. Das Wohnungsanforderungsgesetz<br />
vom 1.9.1945 erweiterte die Gruppe<br />
der anspruchsberechtigten WohnungswerberInnen, allerdings<br />
nur auf die Gruppe der aus politischen Gründen im<br />
Nationalsozialismus Verfolgten. Nach dem 2. Opferfürsorgegesetz<br />
vom 2.9.1947 wurden entsprechend der Ausdehnung<br />
des Kreises fürsorgeanspruchsberechtigter Personen<br />
auch die Leistungen der MA 12 auf die Einrichtung<br />
von Rentenkommissionen, die Ausdehnung der Rentenfürsorge<br />
und die Erstellung von ➤ Amtsbescheinungen und<br />
➤ Opferausweisen erweitert. Im Wiener Wohnungsamt<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
wurde am 20.8.1947 ein eigenes Wiedergutmachungsreferat<br />
eröffnet, das die Zuteilung von Wohnungen für<br />
nach dem OFG anerkannte Opfer vorsah. Sowohl Erhalt<br />
einer Wohnung als auch der Erhalt eines Opferausweises<br />
oder einer Amtsbescheinigung (mit folgendem Anspruch<br />
auf eine Opferfürsorgerente) war von einem ärztlichen<br />
Gutachten durch das Wiener Gesundheitsamt (1945: MA<br />
II/2, 1946: ➤ MA 15) oder der Konstatierung sozialer<br />
Bedürftigkeit durch die MA 12 abhängig.<br />
Das Wiedergutmachungsreferat der ➤ Israelitischen<br />
Kultusgemeinde<br />
Wegen der Einschränkung der öffentlichen Opferfürsorge<br />
auf primär aus politischen Gründen Verfolgte, wandten<br />
sich nach dem Krieg die auf Grund ihrer Abstammung<br />
verfolgten Juden und Jüdinnen an die Israelitische<br />
Kultusgemeinde (IKG), die ein eigenes Wiedergutmachungsreferat<br />
zur Betreuung der jüdischen Opfer errichtet<br />
hatte und vor allem über ausländische Hilfsaktionen<br />
arbeitete (wie z.B. ➤ JOINT, ZWO-JA). In der IKG erfolgte<br />
die Registrierung der Gemeindemitglieder sowie die Ausgabe<br />
von Jointpaketen, die medizinische Versorgung, die<br />
Ausstellung von Deportationsbescheinigungen und Todeserklärungen<br />
für während des Nationalsozialismus umgekommene<br />
Gemeindemitglieder, die Ausstellung sonstiger<br />
Bestätigungen, die für Behörden und Ämter benötigt<br />
wurden. Weitere Aufgaben waren die Rückführung jüdischer<br />
EmigrantInnen aus den Emigrationsländern nach<br />
Österreich, die Beschaffung von Unterkünften und die<br />
Beratung für RückkehrerInnen, Hilfe und Beratung bei<br />
Wohnungs- und Arbeitssuche sowie die Unterbringung in<br />
den eigenen Rückkehrerheimen der IKG: Wien II, Tempelgasse<br />
3, und Wien II, Untere Augartenstraße 35. Ein internationaler<br />
Suchdienst forschte nach vermissten Personen<br />
im In- und Ausland. Das Wiedergutmachungsreferat der<br />
IKG war aber auch zuständig für Beratungen in allgemeinen<br />
Fragen der Wiedergutmachung, für die Erfassung des<br />
ehemals entzogenen jüdischen Vermögens in Österreich,<br />
für welches sich keine anspruchsberechtigten Personen<br />
gemeldet hatten, für die Rückerlangung des der IKG entzogenen<br />
Vermögens sowie jenes jüdischer Vereine und<br />
Stiftungen. Für Rückstellungsansprüche privater RückstellungswerberInnen<br />
war das Referat zwar nicht zuständig,<br />
allerdings wurden über das Rechtsreferat der IKG eigene<br />
Juristen zu Verfügung gestellt. Neben diesen Hilfsmaßnahmen<br />
lag eine weitere zentrale Aufgabe des Wiedergutmachungsreferates<br />
in der Planung und Forcierung<br />
der Opferfürsorgegesetzgebung sowie in der Zusammenarbeit<br />
mit den Stellen der öffentlichen Fürsorge.<br />
Heute sind folgende Stellen zuständig (eine Auswahl):<br />
• Opferfürsorgereferat des Sozialamtes der Stadt Wien –<br />
Magistratsabteilung MA 12: 1010 Wien, Schottenring 24<br />
• Opferfürsorgestellen in den Sozialämtern der Bezirkshauptmannschaften,<br />
Bezirksämter in den einzelnen Bundesländern<br />
• ➤ Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des<br />
Nationalsozialismus: 1010 Wien, Doblhoffgasse 3<br />
• Israelitische Kultusgemeinde: 1010 Wien, Seitenstettengasse 4<br />
97
DER KAMPF UM DIE RECHTLICHE ANERKENNUNG JÜDISCHER ÜBERLEBENDER<br />
HELGA EMBACHER<br />
Gründung des<br />
KZ-Verbandes<br />
Hierarchie der<br />
Opfergruppen<br />
Ende Mai 1945 wurde in Wien die ➤ „Volkssolidarität“ gegründet, eine von den drei Parteien<br />
(SPÖ, ÖVP, KPÖ) beschickte Fürsorgeinstitution zur Betreuung der ehemals politisch<br />
verfolgten Heimkehrer. „Nur“-Juden waren aber bis Anfang 1946 von dieser Betreuung<br />
ausgeschlossen. Daneben entstanden in ganz Österreich zahlreiche kleinere Hilfskomitees<br />
für politisch Verfolgte. In Wien rief Ministerialrat Dr. Franz Sobek den ➤ KZ-Verband, später<br />
➤ „Bund der politisch Verfolgten“, ins Leben. Sobek wurde noch vor Kriegsende aus dem<br />
KZ entlassen und gehörte der Widerstandsgruppe 05 an. Offiziell wurde der KZ-Verband<br />
im März 1946 gegründet und wie die „Volkssolidarität“ von den drei Parteien paritätisch<br />
beschickt. Der KZ-Verband verstand sich nicht mehr als karitative Hilfsorganisation, sondern<br />
als politisches Instrument, als Wächter über die Demokratie, wozu von den Widerstandskämpfern<br />
entsprechende Positionen im Staat angestrebt und besetzt werden sollten. 1 Manche<br />
stellten sich sogar eine Art „Kammer“, eine selbständige Macht im Staat vor. 2 Da der<br />
KZ-Verband eine politisch-moralische Instanz beim Wiederaufbau eines „Neuen Österreich“<br />
sein wollte, stand nur ehemaligen „politischen“ Häftlingen 3 die Mitgliedschaft offen.<br />
Ausgeschlossen waren somit Zigeuner, Homosexuelle, Kriminelle, die Gruppe der sogenannten<br />
„Asozialen“ und jene Juden, die „nur“ aufgrund ihrer Abstammung verfolgt worden<br />
waren. Damit reproduzierte der KZ-Verband das Vorurteil von den „kriminellen KZlern“<br />
und setzte auch die im KZ bestehende Hierarchie innerhalb der Häftlinge fort. Dies brachte<br />
ihm den Vorwurf ein, auch nach 1945 am ➤ „Arierparagraphen“ festzuhalten. 4 Beim „Jüdischen<br />
Komitee“ in Linz beschwerten sich 1947 auch jüdische Überlebende über diskriminierende<br />
Behandlungen beim Wiener „KZ-Verband“ in der Lothringerstraße.<br />
„Im KZ-Verband wollten wir Auskunft haben, ob man uns Hilfe oder Rat erteilen kann.<br />
Der dortige Leiter erklärte uns – es war im letzten Zimmer der Kanzlei –, daß man mit Geld<br />
alles erreichen könne. Er sagte uns außerdem, daß ein politischer Häftling, der für die Freiheit<br />
Österreichs gekämpft hat, ihm tausendmal lieber sei als ein jüdischer Häftling, der alles<br />
verloren hat.“ 5<br />
Am 10. Februar 1946 konstituierte sich das „Aktionskomitee der jüdischen KZler“, später<br />
„Verband der wegen ihrer Abstammung Verfolgten“, das bereits bei seiner Gründung<br />
1670 Mitglieder zählte. 6 Um die Anerkennung der jüdischen KZler als gleichberechtigte<br />
Opfer durchzusetzen, versuchte es unter der Leitung des Kommunisten Akim Lewit, 7 in den<br />
„Bundesverband“ aufgenommen zu werden. Die Aufnahme erfolgte bereits am 14. Februar<br />
1946 mit folgender Begründung: Da Juden wegen ihrer Abstammung verfolgt worden waren,<br />
hätten sie als politisch unzuverlässig gegolten und wären auch deshalb ins KZ gekommen.<br />
8 Um Österreichs Rolle als erstes Opfer Nazi-Deutschlands nicht zu gefährden, mußten<br />
„rassisch Verfolgte“ offensichtlich zu aktiven Gegnern des Nationalsozialismus umdefiniert<br />
werden. Dadurch konnten sie als Beweis eines österreichischen Widerstandes herangezogen<br />
werden, während gleichzeitig von der aktiven Rolle der ÖsterreicherInnen bei der Judenverfolgung<br />
abgelenkt wurde. 9 Als nächstes strebte die ➤ Israelitische Kultusgemeinde eine<br />
Reform des ➤ Opferfürsorgegesetzes an, da in der bis dahin gültigen Version in Punkt 21<br />
des Abschnittes 1 ausdrücklich erklärt wurde, daß „rassisch Verfolgte“, die den Nachweis<br />
eines aktiven Einsatzes für ein unabhängiges, demokratisches Österreich nicht aufbringen<br />
konnten, ebenso wie alle anderen passiv zu Schaden gekommenen Österreicher nicht<br />
berücksichtigt werden sollten und warten müßten, bis eine neue Regelung erfolgen würde. 10<br />
Das im Juli 1947 beschlossene und am 2. September 1947 in Kraft getretene neue Opferfürsorgegesetz<br />
erweiterte zwar den Kreis der Anspruchsberechtigten – auch die aufgrund<br />
von „Abstammung, Religion und Nationalität“ erfolgte Verfolgung fand Berücksichtigung –,<br />
doch wies es noch immer gravierende Mängel auf. So konnten Juden nur mittels einer<br />
Gefälligkeitsbestätigung des KZ-Verbandes eine Amtsbescheinigung erhalten, die wiederum<br />
als Voraussetzung zum Rentenbezug benötigt wurde. 11 Das „Jüdische Aktionskomitee“<br />
98 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
empfand es auch als eine besondere Demütigung, „daß ‚politische‘ Häftlinge von der Art<br />
des Auslandsradiohörers und unvorsichtigen Meckerers oder Bekämpfers der Arbeiterschaft<br />
im und nach dem Februar 1934 und schließlich ‚Erduldens‘ einer sechsmonatigen ‚schweren‘<br />
Haft in ➤ Wöllersdorf“ 12 als Opfer bzw. Widerstandskämpfer anerkannt wurden,<br />
während beispielsweise Sternenträgern* die Aufnahme in den „Bundesverband“ versagt<br />
blieb. (Anm. d. Red.: *Ab 1941 wurden Juden gezwungen, den gelben Stern zu tragen, was<br />
die Einhaltung der antijüdischen Gesetze, wie z. B. das Benützen öffentlicher Verkehrsmittel,<br />
das Betreten von Parkanlagen oder das Verlassen von Ghettos, garantierte. Erst 1961 erhielten<br />
„Sternenträger“ eine geringe Abgeltung für ihre Verfolgung.)<br />
„Warum wird von den Abstammungsverfolgten überhaupt politischer Einsatz verlangt?<br />
Wozu braucht ein abstammungsverfolgter KZler noch seine antifaschistische Gesinnung zu<br />
beweisen?“ 13<br />
Diese Frage stellte 1947 ein Referent bei einer Tagung des KZ-Verbandes in Graz.<br />
Weiters interpretierte er das bestehende Opferfürsorgegesetz als Fortsetzung der KZ-Hierarchie.<br />
Seiner Meinung nach wollte die ➤ SS durch das Lagersystem „… bei allen nichtjüdischen<br />
Lagerinsassen den Eindruck einprägen, daß alle Juden (...) untereinander gleich<br />
sind und eine Differenzierung nicht am Platz ist. Und die ➤ Gestapo hat dieses Ziel erreicht:<br />
bei apolitischen nichtjüdischen KZlern deswegen, weil dies den letzten gepaßt hat,<br />
bei den politisch bewußten aber auch aus dem Grunde, weil auch sie dem ehernen Naturgesetz<br />
unterlegen waren, wonach das Milieu den Menschen formt. Die Folge davon war,<br />
daß die sogenannten arischen Kameraden sich des Gefühls einer gewissen Überwertigkeit<br />
nicht entledigen konnten, dies auf Kosten der jüdischen, auch der sogenannten politischen<br />
KZler, die andauernd mit Minderwertigkeitskomplexen behaftet sein mußten. (...) Eine unsichtbare<br />
Mauer hat sich zwischen beiden künstlich aufgezogenen Welten aufgerichtet,<br />
eine Scheidemauer, die von Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Sachsenhausen usw. bis<br />
nach Wien ging. Und hinter dieser Mauer haben sich der KZ-Verband und die ‚Volkssolidarität‘<br />
etabliert, die jedem sogenannten ‚rassisch‘ Verfolgten Einlaß verwehrten, hingegen<br />
aber um so beflissener beim Spendensammeln im In- und Ausland auf den Solidaritätsgedanken<br />
aller Naziopfer pochten.“ 14<br />
Die Auflösung des KZ-Verbandes<br />
Im September 1946 vereinigten sich der KZ-Verband und zahlreiche, auch in den Bundesländern<br />
bereits vorhandene Komitees zur Betreuung der KZ-Überlebenden zum „Bund der<br />
politisch Verfolgten – Österreichischer Bundesverband“, weiterhin kurz „KZ-Verband“ genannt.<br />
Der Verband war ebenfalls überparteilich organisiert, und neben den Vertretern von<br />
SPÖ, ÖVP und KPÖ schienen auch Vertreter der sogenannten „Abstammungsverfolgten“<br />
auf. Aufgrund des vom Nationalrat beschlossenen Privilegierungsgesetzes galt der KZ-Verband<br />
als offizielle Interessenvertretung aller Opfer des Faschismus. Wie die Historikerin<br />
Brigitte Bailer aufzeigte, beabsichtigte Innenminister ➤ Oskar Helmer damit die Kontrolle<br />
der KZ-Verbände und letztendlich die Ausschaltung der Kommunisten. Doch auch dem<br />
„Bundesverband“ war kein langes Leben beschieden. Am 8. März 1948 löste Helmer mit<br />
Zustimmung der Regierungsparteien aus innenpolitischen Motiven den „Bund der politisch<br />
Verfolgten“ auf. 15 Da, gemessen an ihrer zahlenmäßigen Stärke, Kommunisten im<br />
Widerstand überrepräsentiert waren, übten sie auch im KZ-Verband dominierende Funktionen<br />
aus. Im November 1947 war mit ➤ Dr. Altmann aber der letzte Kommunist aus der<br />
Regierung ausgeschieden, und es mußte auf die KPÖ keine Rücksicht mehr genommen werden.<br />
Ein geeinter Verband von KZ-Überlebenden, der noch dazu für sich in Anspruch nehmen<br />
wollte, über die demokratische Entwicklung in Österreich zu wachen, hätte auch die<br />
Koalitionspolitik, in der es bereits um die Integration der ehemaligen Nationalsozialisten<br />
ging, in Frage gestellt.<br />
Offiziell wurde die Auflösung des KZ-Verbandes mit Unstimmigkeiten im Wiener KZ-Verband<br />
gerechtfertigt, doch für „einfache“ Mitglieder und auch für Funktionäre erfolgte die<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Helga Embacher<br />
99<br />
Konflikte<br />
zwischen<br />
„WiderstandskämpferInnen“<br />
und „rassisch<br />
Verfolgten“<br />
Parteipolitische<br />
Vereinnahmung<br />
des KZ-Verbandes
Ausgrenzung der<br />
jüdischen Opfer<br />
Der Kampf der Israelitischen Kultusgemeinde<br />
Auflösung vielfach unerwartet. ➤ Karl Mark, sozialistischer Abgeordneter und Generalsekretär<br />
des „Bundesverbandes“, berichtete über dessen unerwartetes Ende:<br />
„Im Februar 1948 kam ich zu dem Haus, in dem unser Büro untergebracht war. Einige<br />
Angestellte warteten schon davor. Ich hatte zwar meine Schlüssel, aber ich konnte nicht<br />
hinein. Mein Büro war versiegelt. Das war auf Anweisung von Oskar Helmer geschehen.<br />
Unter Mißachtung der gesetzlich fundierten Stellung des Bundes waren die Sekretariatsräume<br />
geschlossen worden und gleichzeitig jede weitere Tätigkeit unterbunden mit dem<br />
fadenscheinigen Hinweis auf einen möglichen kommunistischen Mißbrauch, natürlich aber<br />
wegen der von Helmers Linie abweichenden Haltung des Bundes. Diese Handlung setzte<br />
meiner Tätigkeit im Bund politisch Verfolgter ein unerwartetes Ende.“ 16<br />
Josef Ausweger, 17 ÖVP-Mitglied und Präsident des Salzburger KZ-Verbandes, betonte<br />
noch Ende März 1948 bei einer Versammlung, „daß gerade die Kommunisten sich im Lager<br />
vorbildlich verhalten haben“ und er weiterhin für einen überparteilichen Verband eintreten<br />
werde. 18 Noch am 13. März schrieb das „Demokratische Volksblatt“, das Organ<br />
der SPÖ Salzburg, „daß in Salzburg im Vergleich zu Wien in den Beschlüssen Einigkeit<br />
bestehe und keine politischen Differenzen vorhanden wären“. 19 Doch am 20. März riet<br />
das Blatt SPÖ-Mitgliedern dann vom Besuch der Veranstaltungen des KZ-Verbandes ab,<br />
denn „die Sozialisten würden die säuberliche Trennung von den Kommunisten, aber auch<br />
von jenen begrüßen, die seinerzeit wegen ihrer austrofaschistischen Tätigkeit verfolgt<br />
wurden“. 20<br />
Im Klima des Kalten Krieges vermochten sich die Überlebenden mit ihrem Wunsch nach<br />
einem überparteilichen Verband gegen den zentralistisch, ihrer Meinung nach sehr undemokratisch<br />
gefaßten Regierungsbeschluß nicht durchzusetzen. Letztendlich gründete jede<br />
Partei ihren eigenen KZ-Verband: die SPÖ den „Verband der sozialistischen Freiheitskämpfer“,<br />
die ÖVP die „Kameradschaft“, und der KPÖ blieb der KZ-Verband. Nur in Tirol wehrten<br />
sich die Überlebenden erfolgreich gegen eine Aufsplitterung. 21 Jüdische Überlebende,<br />
sofern sie keiner der drei Parteien beitreten wollten, blieben weiterhin unter sich. Der<br />
➤ „Neue Weg“ kritisierte nicht nur die Politik der Regierung, sondern auch die Politik des<br />
„Bundesverbandes“, in den Juden große Hoffnungen gesetzt hatten. 22 Daß ehemalige KZ-<br />
Häftlinge sich den Interessen der Parteien unterwarfen und den KZ-Verband zu einem „Veteranenverein“<br />
herabsinken ließen, löste beim Jüdischen Aktionskomitee „eine schwere Erbitterung“<br />
aus und das Gefühl, „als Juden als Paria“ behandelt worden zu sein. 23 Für den<br />
„Neuen Weg“ entstand der Eindruck, daß den politischen Funktionären des KZ-Verbandes<br />
nur an der Erfüllung ihrer Bedürfnisse gelegen war und sie in der Unterstützung der jüdischen<br />
Opfer versagt haben.<br />
„Die zurückkehrenden ‚politischen‘ KZler haben ihre verlorenen Stellen in Amt und Arbeit<br />
meist wiederbekommen, ja, dank ihrer Verbindung mit den politischen Parteien, bedeutend<br />
verbessert. Was sie sonst noch zu verlangen haben, war die Entschädigung für Haftzeit<br />
und sonstige Einbußen, war die Unterstützung der Hinterbliebenen von KZ-Kameraden und<br />
schließlich die Pflege der Kameradschaft, der Erinnerung an das gemeinsame Erlebnis im<br />
KZ. Diese bescheidenen Ziele entsprachen ganz dem Gedankengang und den Absichten<br />
der politischen Parteien. Nach ihrer Auffassung war die Hitler-Invasion ein bedauerliches,<br />
aber unvermeidliches Ereignis, die am Leben gebliebenen Opfer haben Anspruch auf<br />
Almosen in moderner Form, auf eine gewisse, nicht weitgehende wirtschaftliche Hilfe<br />
(früher einmal auf eine Werkelmannlizenz). Sonst sollten sie bei Heurigem und Wienermusik<br />
kameradschaftliche Geselligkeit pflegen, beim Begräbnis eines Kameraden mit der eigenen<br />
Fahne ausrücken usw. Das bedingte natürlich eine strenge Absonderung der Nazi-<br />
Opfer von den anderen Opfern.“ 24<br />
Bei vielen Überlebenden wirkte primär die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei und<br />
weniger die gemeinsame Lagererfahrung identitätsstiftend. Österreichische WiderstandskämpferInnen,<br />
unter ihnen auch viele jüdischer Herkunft, träumten im KZ vom Aufbau eines<br />
neuen Österreich, wozu sie sich nach ihrer Rückkehr auch tatkräftig zur Verfügung stellten.<br />
Auch sie akzeptierten die von den Alliierten und österreichischen Politikern entworfene<br />
100 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
These von Österreich als erstem Opfer Hitler-Deutschlands. Trotz zahlreicher Widersprüche<br />
übertrugen sie das eigene Leiden auf das der Nation. Als beispielsweise der Internationale<br />
KZ-Verband ankündigte, bei einer Tagung im Mai 1946 auch eine Resolution über die<br />
schleppend vor sich gehende Entnazifizierung und die Beteiligung von Österreichern am<br />
Nationalsozialismus zu fassen, zog der „Verband der politisch Verfolgten für Oberösterreich“<br />
seine angekündigte Teilnahme an der im Mai 1946 stattfindenden Tagung zurück.<br />
Auch das Innenministerium wollte die Tagung verbieten, die letztendlich mit Hilfe des<br />
oberösterreichischen Landeshauptmannes Gleißner doch noch durchgeführt werden konnte.<br />
Ministerialrat Franz Sobek empfand vor allem die Kritik an Österreichs Mitverantwortung<br />
am Nationalsozialismus und eine befürchtete Resolution an die UNO, in der vom Abzug<br />
der Besatzungssoldaten abgeraten werden sollte, als Provokation. Er bat daher den<br />
„Oberösterreichischen KZ-Verband um Bericht und um Vorschläge zu entsprechenden Maßnahmen<br />
gegen diese Leute, welche wahrscheinlich zum Großteil Kriminelle sind und in<br />
unserem Lande als Partisanen leben und unser Land im Ausland schwer diskriminieren“. 25<br />
Als Reaktion darauf warf Simon Wiesenthal, damals Funktionär des Internationalen KZ-<br />
Verbandes, dem österreichischen KZ-Verband vor, daß „der Ausländerhaß, welcher ein<br />
Bestandteil der Nazipropaganda war, in den Reihen des österreichischen KZ-Verbandes<br />
noch nicht ausgerottet zu sein scheint“. 26<br />
Alleingelassen im Kampf um die „Wiedergutmachung“, mußte die Israelitische Kultusgemeinde<br />
1949 auch den Ausschluß aus der Opferfürsorgekommission erleben. Bisher setzte<br />
sich diese Kommission aus Vertretern der drei Parteien und aus Vertretern der Israelitischen<br />
Kultusgemeinde oder „Abstammungsverfolgten“ zusammen, während bei der 1949 erfolgten<br />
Neubesetzung Sozialminister ➤ Karl Maisel, sozialistischer Abgeordneter und Buchenwald-Überlebender,<br />
anstelle der „Abstammungsverfolgten“ Vertreter der SPÖ nominierte.<br />
Wie der „Neue Weg“ kritisierte, wären diese „weder von den Abstammungsverfolgten auf<br />
demokratische Weise gewählt noch hierzu berufen worden und würden keinesfalls das Vertrauen<br />
der Gruppe genießen“. 27<br />
Im Kalten Krieg konnte die österreichische Regierung als anerkannter Partner der Westalliierten<br />
immer selbstbewußter agieren. Letzte Reste, die noch an Österreichs Mittäterrolle erinnerten,<br />
mußten entfernt werden. 1947 ➤ „arisierte“ das ➤ „Schwarze Kreuz“ in St. Florian<br />
in Oberösterreich den jüdischen Friedhof, indem es das jüdische Denkmal zerschlagen<br />
ließ. 28 Bereits 1946 machte Heinrich Sobek einen Vorschlag zur christlichen Vereinnahmung<br />
des ➤ Vernichtungslagers Mauthausen. Ein „überdimensionales, in der Nacht leuchtendes<br />
Kreuz“ sollte am höchsten Punkt des ehemaligen Lagers errichtet werden. 29 Auch als<br />
1952 an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen eine Gedenktafel enthüllt wurde, gedachte niemand<br />
der jüdischen Opfer, der größten Gruppe unter den Ermordeten. 30 1954 sollten laut<br />
einer Empfehlung des Innenministeriums die KZ-Friedhöfe in „Kriegerfriedhöfe“ umgewandelt<br />
und damit alle Opfer des Zweiten Weltkrieges auf dieselbe Stufe gestellt werden. 31 Im<br />
selben Jahr wurden in ➤ Ebensee jüdische Gräber exhumiert, und das dortige jüdische<br />
Denkmal mit der Aufschrift „Dem deutschen Volk zur ewigen Schande“ wurde in die Luft<br />
gesprengt, um den Fremdenverkehr nicht zu stören. 32 In Linz fühlten sich jüdische Überlebende<br />
verletzt, als der KZ-Verband 1955 bei einer von ihm organisierten Trauerfeier in<br />
Ebensee die Israelitische Kultusgemeinde Linz nicht eingeladen hatte, obwohl die Häftlinge<br />
im Konzentrationslager Ebensee großteils Juden waren. 33<br />
Der Konflikt zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde und den Lagergemeinschaften ist<br />
bis heute ungelöst. Noch im Februar 1995 mußte die „Gemeinde“ an einer Aussendung<br />
der „Österreichischen Lagergemeinschaft Auschwitz“ anläßlich des 50. Gedenktages der<br />
Befreiung kritisieren, daß von ermordeten Österreichern, unter anderem Politikern, Künstlern,<br />
Journalisten oder Heimwehrfunktionären, gesprochen wurde, das Wort Jude oder<br />
jüdisch aber peinlich vermieden wurde. 34<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Helga Embacher<br />
Aus: Helga Embacher: Neubeginn ohne Illusionen.<br />
Juden in Österreich nach 1945,<br />
Picus Verlag, Wien 1995, S. 104-111.<br />
101
Der Kampf der Israelitischen Kultusgemeinde<br />
1 Vgl. Salzburger Tagblatt. 18.1. 1946, S.6.<br />
2 Interview mit Josef Nischelwitzer. Klagenfurt 1987.<br />
3 Politisch Verfolgte trugen einen roten, Kriminelle einen grünen, sogenannte<br />
Asoziale einen schwarzen, Homosexuelle einen rosa und<br />
Bibelforscher einen lila Winkel. Juden mußten unter ihrem Winkel<br />
zudem ein gelbes Dreieck, das mit dem anderen Winkel einen Davidstern<br />
ergeben hat, tragen. Gruppen mit gleichartigen Winkeln<br />
bildeten aber keine homogene Gruppe. So wurden z. B. als politische<br />
Häftlinge nicht nur aktive Gegner des Nationalsozialismus eingeliefert<br />
– das Erzählen eines Witzes oder die Freundschaft mit einem<br />
„Fremdarbeiter“ konnten bereits KZ-Haft mit einem roten<br />
Winkel bedeuten. Langbein betonte auch, daß nicht alle „Roten“<br />
ihre Funktionen im Geiste der Kameradschaft ausgeübt und nicht<br />
alle „Grünen“ als Werkzeuge der SS gedient haben, vgl. Hermann<br />
Langbein, Menschen in Auschwitz, Berlin/Wien 1980, S. 29.<br />
4 Siehe Brief vom 8. Juni 1946 von Dipl.-Ing. Simon Wiesenthal an<br />
Dr. Sobek, S. W-C., M -9/10, Yad Vashem/Jerusalem.<br />
5 Beschwerdeprotokoll Linz am 1. 4. 1947, unterschrieben von Rosa<br />
Murlakow. S. W-C, M-9, 79a, Yad Vashem/Jerusalem.<br />
6 Vgl. Der neue Weg. Jüdisches Organ mit amtlichen Mitteilungen<br />
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (DNW), 5/6, 15. Februar<br />
1946.<br />
7 Akim Lewit überlebte als jüdischer Häftling Buchenwald und wurde<br />
auf der 1. Freien Versammlung der Österreicher ins Präsidium der<br />
Organisation der österreichischen Überlebenden gewählt. Vgl. Erich<br />
Fein/Karl Flanner, Rot-Weiß-Rot in Buchenwald, Wien 1987, S 246.<br />
8 DNW, 1,2/1946, S. 13.<br />
9 Siehe auch das „Rot-Weiß-Rot-Buch“. Gerechtigkeit für Österreich!<br />
Darstellungen. Dokumente und Nachweis zur Vorgeschichte<br />
und Geschichte der Okkupation Österreichs (nach amtlichen Quellen).<br />
1. Teil, Wien 1946. Das Buch stellt Österreich als Opfer des<br />
nationalsozialistischen Aggressors dar, während die Judenverfolgung<br />
verschwiegen wurde.<br />
10 Vgl. DNW, 6/Anfang April 1947, S. 6 und 21/Anfang November<br />
1948, S.3.<br />
11 Brigitte Bailer, Wiedergutmachung kein Thema. Österreich und<br />
die Opfer des Nationalsozialismus, Wien 1993, S. 143.<br />
12 DNW, 21/Anfang November 1948, S.3.<br />
13 DNW, 6/Anfang April 1947, S. 6.<br />
14 Ebd., 6/1947, S. 6ff.<br />
15 Vgl. Bailer, S. 45 ff.<br />
16 Karl Mark, 75 Jahre Roter Hund. Lebenserinnerungen, Wien/Köln<br />
1990, S. 169.<br />
17 Innerhalb der ÖVP war Ausweger u. a. auch wegen einer gegen<br />
ihn laufenden Pressekampagne, in der ihm Spendenleistungen an<br />
die KPÖ vorgeworfen worden waren, sehr umstritten. 1949 schien<br />
er als ÖVP-Mandatar im Landtag nicht mehr auf. Vgl. Dirninger<br />
Christian, Die Arbeitgebervertretung im Bundesland Salzburg.<br />
Festschrift für Rudolf Friese, Salzburg Dokumentation Nr. 84,<br />
Schriftenreihe des Landespressebüros, Salzburg 1984, S 83<br />
18 Salzburger Tagblatt, 24. März 1948, S.2.<br />
19 Demokratisches Volksblatt, 13. März 1948, S. 2.<br />
20 Ebd., 20. März 1948, S. 3.<br />
21 Interview mit Heinz Mayer, Präsident des Bundes der Opfer des<br />
politischen Freiheitskampfes in Tirol.<br />
22 Vgl. DNW, 5/Anfang März 1948, S. 12.<br />
23 Ebd., 21/Anfang November 1948, S. 3.<br />
24 Ebd.<br />
25 Brief vom 23. Mai 1946. Ministerialrat Dr. Franz Sobek an den Verband<br />
der politisch Verfolgten für Oberösterreich. S.W.C., M-9/10,<br />
Yad Vashem/Jerusalem.<br />
26 Brief vom 8. Juni 1946 von Dipl.-Ing. Simon Wiesenthal an Dr.<br />
Sobek. S.W.C., M-9/10.<br />
27 DNW, 18/Anfang Oktober 1949, S. 3.<br />
28 Vgl. Bekanntgabe des jüdischen KZ-Verbandes. S.W.C., M-9/83<br />
b/66 b sowie DNW, 22/Anfang Dezember 1947, S. 4.<br />
29 Wiener Zeitung, 21. Juni 1946.<br />
30 Vgl. Brief der Israelitischen Kultusgemeinde vom 9. Mai 1952,<br />
Archiv der IKG Wien.<br />
31 Vgl. Iskult, 35/1955, S. 12.<br />
32 Vgl. ebd., 23/1955, S. 19.<br />
33 Vgl. ebd., 35/1955.<br />
34 Die Gemeinde, 3. Februar 1995 – 3. Adar 5755, sowie 5. April 1995<br />
– 5. Nissan 5755.<br />
102 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
„OHNE DEN STAAT WEITER DAMIT ZU BELASTEN ...“<br />
BRIGITTE BAILER-GALANDA<br />
1<br />
Bemerkungen zur österreichischen Rückstellungsgesetzgebung<br />
Vorbemerkung<br />
Die sogenannte „Wiedergutmachung“ nationalsozialistischen Unrechts, im eigentlichen Wortsinn<br />
des „Wieder-gut-Machens“ unmöglich, 2 zerfällt in Österreich ebenso wie in der BRD in<br />
zwei große Bereiche: die in erster Linie der Sicherung einer Mindestexistenz der Opfer<br />
dienende Gesetzesmaterie (in Österreich ➤ Opferfürsorgegesetz, in der BRD ➤ Bundesentschädigungsgesetz)<br />
einerseits, und ➤ Gesetze zur Rückstellung entzogenen Eigentums und<br />
Vermögens andererseits. Zu beiden Bereichen liegt bereits eine Reihe deutscher Publikationen<br />
vor, während die österreichische Forschung erst am Anfang steht. 3 Der britische Historiker<br />
Robert Knight legte in seiner ausführlich kommentierten Edition von Auszügen der Kabinetts-<br />
und Ministerratsprotokolle der Nachkriegszeit eine erste, vor allem außenpolitische<br />
Faktoren berücksichtigende Übersicht zur Genese der Rückstellungsgesetze vor. 4 Der vorliegende<br />
Aufsatz versucht die innenpolitischen Gegebenheiten, die Desiderata der Rückstellungsgesetzgebung<br />
und die Auswirkung dieser Gesetze auf die Opfer in einem ersten<br />
Ansatz zu erhellen. Darüber hinaus wären weiterführende Forschungen zu diesem Themenkreis<br />
sehr wünschenswert.<br />
Die Rückstellungsgesetzgebung stellte – obschon eine ganze Reihe anderer Gruppen,<br />
nicht zuletzt auch die Kirchen von dieser Gesetzgebung betroffen waren – für die öffentliche<br />
Meinung ein vorwiegend jüdisches Problem dar, wodurch auch der vorliegende Aufsatz in<br />
erster Linie die Schwierigkeiten jüdischer Opfer, ihr Eigentum zurückzuerhalten, beleuchtet.<br />
Der nationalsozialistische Raubzug<br />
Plünderungen, Enteignungen und die durch nationalsozialistische Verordnungen geregelten<br />
Eigentumsentziehungen betrafen in erster Linie die aufgrund der ➤ Nürnberger Rassengesetze<br />
verfolgte Bevölkerung. 5 Zum Umfang dieser Beraubungen liegen einige von Vertretern<br />
der Opfer Anfang der fünfziger Jahre erstellte Statistiken vor, die den Wert des geraubten<br />
Eigentums und Vermögens mit rund 312 Millionen Dollar (780 Millionen Reichsmark) angaben,<br />
unter Einrechnung der Einkommensverluste ergab sich sogar ein Verlust von rund<br />
1,2 Milliarden Dollar. 6 Statistiken der ➤ Vermögensverkehrsstelle weisen ein aufgrund der<br />
Verordnung zur Anmeldung jüdischen Vermögens angemeldetes Vermögen von<br />
2.041,828.000 RM auf, jüdisches Betriebsvermögen umfaßte ca. 321 Millionen RM. 7 Die<br />
zur Eindämmung der unkontrollierten ➤ „Arisierungen“ und damit zur Sicherung der daraus<br />
resultierenden Gewinne für den NS-Staat im Mai 1938 geschaffene Vermögensverkehrsstelle<br />
übernahm in der Folge die Abwicklung der „ordnungsgemäßen“ „Arisierungen“. 8 Der<br />
überwiegende Teil der zu dieser Zeit noch bestehenden rund 26.000 jüdischen Betriebe<br />
wurde liquidiert, nur 4353 sollten weitergeführt werden. 9 Die in den Folgejahren verabschiedete<br />
Vielzahl antijüdischer Gesetze und Verordnungen beraubte die noch nicht geflüchteten<br />
Juden ihres gesamten Eigentums; selbst Radioapparate, Schiausrüstungen, Wollsachen,<br />
Elektrogeräte und anderes unterlagen nach und nach der Ablieferungspflicht. 10<br />
Unmittelbar nach dem „Anschluß“ erfolgte die Vertreibung der Juden aus ihren Wohnungen<br />
und deren zwangsweise Umsiedlung in Sammelwohnungen. Insgesamt wurden in<br />
Wien schon bis Ende 1938 rund 44.000 der 70.000 Wohnungen mit jüdischen Mietern<br />
auf diese Weise für „arische Volksgenossen“ frei gemacht. Gerhard Botz bezeichnet dies<br />
zu Recht als „Ersatz nationalsozialistischer Sozialpolitik“. 11<br />
Im Laufe der NS-Herrschaft wurden noch weitere Bevölkerungsgruppen bzw. Institutionen<br />
ihres Eigentums beraubt: politisch Verfolgte, Kärntner Slowenen, kirchliche Institutionen,<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
103<br />
Umfang der<br />
Beraubung
Gesetz über die<br />
„Erfassung<br />
arisierter<br />
Vermögen“<br />
Erstes Rückstellungsgesetz<br />
Zweites Rückstellungsgesetz<br />
„Ohne den Staat weiter damit zu belasten ...“<br />
aufgelöste Vereine, österreichische Unternehmen, aber auch der österreichische Staat infolge<br />
seines Untergangs 1938. Trotzdem geht es wohl an der historischen Realität vorbei,<br />
wenn der Abgeordnete Kolb im Nationalrat meinte, „erster Anspruchsberechtigter“ der<br />
Rückstellungsgesetzgebung sei „die Republik Österreich selber“. 12<br />
Die Anfänge der Rückstellungsgesetzgebung<br />
Alliierte Planungen hatten sich bereits während des Krieges mit der Frage des durch den<br />
nationalsozialistischen Staat entzogenen bzw. geraubten Eigentums befaßt. Die am 5. Jänner<br />
1943 verabschiedete ➤ „Londoner Deklaration“ erklärte alle unter nationalsozialistischer<br />
Besetzung erfolgten Enteignungen und scheinlegalen Vermögensübertragungen für<br />
ungültig. 13<br />
Obschon bereits Anfang Mai 1945 die Provisorische Staatsregierung ein ➤ „Gesetz über<br />
die Erfassung arisierter und anderer im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen<br />
Machtübernahme entzogener Vermögenschaften“ 14 verabschiedet hatte, war die Frage der<br />
individuellen Rückstellung entzogenen Eigentums innerhalb der politisch Verantwortlichen<br />
nicht unbestritten. Die Sozialdemokraten verknüpften die Frage der Rückstellungen sofort<br />
mit der Frage nach der Rückgabe des 1934 geraubten Vermögens ihrer Partei und der ihr<br />
angeschlossenen Organisationen und hatten gleichzeitig, wie übrigens auch die KPÖ, offensichtliche<br />
Reserven gegen die Restaurierung „kapitalistischer“ Vermögen. 15 Die Staatsregierung<br />
sah sich jedoch einerseits unter dem Druck des „Auslandes“, d. h. der Alliierten,<br />
die von Österreich entschiedenes Vorgehen gegen die ehemaligen Nationalsozialisten und<br />
zugunsten deren Opfer verlangten, andererseits aber stand sie auf dem Standpunkt, Österreich<br />
sei an den NS-Verbrechen unschuldig, habe daher keine Wiedergutmachung zu leisten<br />
– „Österreich hat aber nichts gut zu machen, weil es nichts verbrochen hat.“ 16 „Wiedergutmachung“<br />
durfte aus der Sicht der österreichischen Politiker möglichst keine Kosten<br />
verursachen. Dementsprechend entschloß man sich vorerst jene Fälle in Angriff zu nehmen,<br />
in denen Naturalrestitution möglich schien. 17<br />
Im Mai 1946 verabschiedete der Nationalrat das ➤ „Bundesgesetz über die Nichtigerklärung<br />
von Vermögensübertragungen, die während der deutschen Besetzung Österreichs<br />
erfolgt sind“ 18 , und erkannte damit die in der „Londoner Deklaration“ normierten Prinzipien<br />
an. Doch erst im Herbst 1946 folgte die Vermögensentziehungsanmeldeverordnung, die<br />
die tatsächliche Anmeldung entzogenen Vermögens bis November desselben Jahres vorsah;<br />
die Anmeldepflicht lag dabei beim derzeitigen Inhaber dieses Eigentums, also in vielen<br />
Fällen beim ➤ „Ariseur“. 19<br />
Relativ einfach zu erledigen waren jene Fälle, in denen Eigentum aufgrund nationalsozialistischer<br />
Gesetze, insbesondere der ➤ 11. und ➤ 13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz,<br />
und durch ➤ Gestapo-Maßnahmen entzogen worden war und sich nun in der<br />
Verwaltung der Republik befand. Diese Fälle regelte das am 26. Juli 1946 verabschiedete<br />
Erste ➤ Rückstellungsgesetz. 20 Damit hatte aber auch schon die für die österreichischen<br />
Maßnahmen zugunsten der NS-Opfer in der Folge typische Aufsplitterung in eine Reihe<br />
von Einzelgesetzen ihren Anfang genommen. 21 Dies erschwerte den Opfern selbst die<br />
Übersicht und damit die Durchsetzung ihrer berechtigten Forderungen deutlich. Es dauerte<br />
nochmals mehrere Monate, bis am 6. Februar 1947 der Nationalrat das Zweite Rückstellungsgesetz,<br />
betreffend die im Eigentum der Republik befindlichen entzogenen Vermögen,<br />
22 und das in der Folge wichtigste – und am heftigsten umstrittene – Dritte Rückstellungsgesetz,<br />
betreffend Rückstellung von in privater Hand befindlichen entzogenen Vermögen,<br />
23 verabschiedete. Wichtiger, wenn auch nicht unmittelbarer Pate für diese und die<br />
folgenden Gesetze war „das Ausland“; wie das für die Erfassung entzogener Vermögen<br />
geschaffene ➤ Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung im Vortrag<br />
für den Ministerrat zum Ersten Rückstellungsgesetz begründete, sollte dieses Gesetz<br />
verabschiedet werden, „um aber doch der Welt zu zeigen, daß seitens der Republik<br />
Österreich das, was möglich ist, getan wird.“ 24<br />
104 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Das Dritte Rückstellungsgesetz<br />
Dem Dritten Rückstellungsgesetz waren langwierige Diskussionen mit Vertretern der Opfer<br />
vorangegangen. Im Frühjahr 1946 wurde ein von der Rechtsanwaltskammer erstellter<br />
Entwurf veröffentlicht, der wegen deutlicher Bevorzugung der „Ariseure“ und Benachteiligung<br />
der Verfolgten auf die vehemente Kritik der ➤ Israelitischen Kultusgemeinde und des<br />
➤ „Österreichischen Bundesverbandes ehemals politisch verfolgter Antifaschisten“ stieß. 25<br />
Der im Herbst 1946 dem Ministerrat vorgelegte Gesetzesentwurf für das Dritte Rückstellungsgesetz<br />
wies gleichfalls beträchtliche Mängel auf, indem nach wie vor der „Ariseur“<br />
(im Gesetz „Erwerber“ genannt) gegenüber den Opfern (im Gesetz „geschädigter Eigentümer“)<br />
bessergestellt war. Im Ministerrat drängte Bundesminister Heinl auf eine baldige Beschlußfassung:<br />
„Wir können die Unterstützung des Auslandes nur finden, wenn dieses Gesetz<br />
in Kraft tritt.“ 26 Die Israelitische Kultusgemeinde und der „Österreichische Bundesverband<br />
ehemals politisch verfolgter Antifaschisten“ erarbeiteten ausführliche Stellungnahmen<br />
zum Entwurf, 27 die bereits auf Probleme hinwiesen, die später bei der Handhabung des<br />
Gesetzes auftraten, wie beispielsweise die Verpflichtung des Opfers, dem „Erwerber“ den<br />
➤ Kaufpreis wieder zurückzuzahlen.<br />
In der Realität der Jahre 1938/1939 hatte kaum ein geschädigter Eigentümer je den<br />
Kaufpreis tatsächlich erhalten, geschweige denn diesen auf seiner Flucht ins Ausland mitnehmen<br />
können. Diese Bestimmung wurde in der endgültigen Fassung wohl eingeschränkt,<br />
28 die grundlegende Bestimmung über Gegenleistungen an den Erwerber blieb jedoch<br />
erhalten.<br />
Weiters erhoben die Betroffenen Forderungen zur Lösung des drängenden Problems der<br />
enteigneten Wohnungen. Diesbezüglich vertröstete der Gesetzestext auf weitere, noch zu<br />
erlassende Regelungen. Einen wichtigen Punkt sahen die Opfer in der Schaffung eines<br />
„Wiedergutmachungsfonds“ aus dem erblos gebliebenen Vermögen – rund 65.000 Juden<br />
aus Österreich waren dem Holocaust zum Opfer gefallen. Das dann verabschiedete Gesetz<br />
stellte die Errichtung eines Fonds auf der Grundlage einer noch zu erarbeitenden gesetzlichen<br />
Bestimmung in Aussicht. Letzte Diskussionen über den Entwurf fanden im Rahmen<br />
einer Sachverständigenenquete am 23. Jänner 1947 im Nationalrat statt. 29<br />
Anläßlich der Beschlußfassung betonte der sozialistische Abgeordnete ➤ Dr. Tschadek<br />
(1949-1952 selbst Justizminister), daß Österreich keinerlei Verpflichtung für untergegangenes<br />
oder an das Deutsche Reich gefallenes Vermögen übernehmen könne. Im übrigen<br />
seien die meisten „Ariseure“ ohnehin „reichsdeutsche Geschäftsleute, reichsdeutsche<br />
Krämer“ gewesen, die 1938 nach Wien gekommen seien, „um hier die jüdischen Geschäfte<br />
um einen Pappenstiel zu übernehmen“. 30 Weiters wiederholte Tschadek nochmals<br />
jene Argumente zugunsten der „Erwerber“, die bereits im Vortrag an den Ministerrat im<br />
Oktober 1946 31 vorgebracht worden waren: Viele hätten ja nur auf Bitten der Verfolgten<br />
deren Eigentum übernommen, um ihnen den Weg ins rettende Ausland zu ermöglichen –<br />
eine Argumentation, die in den ab 1948 einsetzenden Angriffen der „Erwerber“ gegen<br />
das Dritte Rückstellungsgesetz in steter Regelmäßigkeit vorgebracht wurde. Insgesamt<br />
zeigten sich die Betroffenen mit dem Gesetzestext zufrieden, 32 die Legal Division bei den<br />
US-Besatzungsbehörden empfahl, dem Gesetz trotz nach wie vor bestehender Mängel<br />
nicht die Zustimmung zu verweigern. 33<br />
Bis 1949 wurden noch vier weitere, in der öffentlichen Diskussion nur wenig beachtete<br />
Rückstellungsgesetze verabschiedet:<br />
Viertes Rückstellungsgesetz zur Wiederherstellung gelöschter oder geänderter Firmen, 34<br />
Fünftes Rückstellungsgesetz zur Rückstellung entzogenen Vermögens juristischer Personen<br />
(Aktiengesellschaften, Genossenschaften u. a.), 35<br />
Sechstes Rückstellungsgesetz zur Rückstellung von Patenten, Marken und Musterrechten, 36<br />
Siebentes Rückstellungsgesetz zur Geltendmachung entzogener oder nicht erfüllter Ansprüche<br />
aus Dienstverhältnissen in der Privatwirtschaft. 37<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
105<br />
Mängel im<br />
Dritten Rückstellungsgesetz<br />
Das Problem der<br />
enteigneten<br />
Wohnungen
Benachteiligung<br />
der Geschädigten<br />
in der Rückstellungspraxis<br />
„Ohne den Staat weiter damit zu belasten ...“<br />
Das Dritte Rückstellungsgesetz in der Praxis 38<br />
Die Erleichterung der Verfolgtenverbände über die Verabschiedung des Dritten Rückstellungsgesetzes<br />
wich angesichts der Praxis der Rückstellungskommissionen, denen einzelne<br />
Bestimmungen beträchtlichen Ermessensspielraum einräumten, 39 bald der Enttäuschung und<br />
Ernüchterung: „Was wir bisher in legislativer Hinsicht erreicht haben, ist zweifellos als Erfolg<br />
zu buchen. Zu bemängeln ist aber die Art der Handhabung der an sich guten Gesetze,<br />
wogegen wir dauernd und mit unverminderter Kraft ankämpfen.“ 40<br />
Es häuften sich Klagen, daß die Rückstellungskommissionen im Zweifel zugunsten des Erwerbers,<br />
also in vielen Fällen des „Ariseurs“, und damit zu Lasten des Verfolgten entschieden.<br />
41 Noch vor der Beschlußfassung im Nationalrat hatten Vertreter des ➤ World Jewish<br />
Congress in einem Bericht an die US-Besatzungsmacht davor gewarnt, daß das Gesetz dazu<br />
neige, „to favor the interests of the present possessor over those of the legal owners“. 42<br />
Besonders die Praxis des mit der „Erfassung, Sicherung, Verwaltung und Verwertung von<br />
(„arisierten“, Anm. d. Verf.) Vermögenschaften und Vermögensrechten“ 43 betrauten Bundesministeriums<br />
für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung bot häufig Anlaß zu<br />
Kritik. Es mutet wie Zynismus an, daß gerade in diesem Ministerium überproportional viele<br />
Nationalsozialisten mit Sonderverträgen oder als Konsulenten eine Anstellung gefunden<br />
hatten. 44 Vielleicht deshalb entschied das Ministerium bei der Bestellung öffentlicher<br />
Verwalter für „arisiertes“ Eigentum oftmals zugunsten des „Ariseurs“, der damit bis zur Entscheidung<br />
der Rückstellungskommission die Verfügungsgewalt über das Eigentum des<br />
Verfolgten behielt. 45<br />
In diesem Zusammenhang ist den Beschwerden über die unverhältnismäßig lange Dauer<br />
der Rückstellungsverfahren, 46 die nur zu oft in unnotwendigen Behördenwegen und -schikanen<br />
begründet lagen, 47 besonderes Gewicht zuzumessen. Die geschädigten Eigentümer,<br />
oftmals selbst aufgrund der Verfolgung weitgehend mittellos, mußten infolgedessen unverhältnismäßig<br />
lange auf die Möglichkeit der Wiederaufrichtung ihrer Existenz warten und<br />
waren mit dem Risiko der Verschleppung oder Verschlechterung ihres Eigentums konfrontiert.<br />
48 Bis Ende Oktober 1954 waren von 34.539 bis dahin eingelangten Anträgen nach<br />
dem Dritten Rückstellungsgesetz nach wie vor 5181 anhängig. 49<br />
Eines der größten Probleme stellte jedoch eine Bestimmung des Dritten Rückstellungsgesetzes<br />
dar, die vorsah, daß der Verfolgte „als Gegenleistung das rückzustellen“ habe, „was er<br />
zu seiner freien Verfügung erhalten hat“. In jenen Fällen, in denen „bei einer Vermögensentziehung<br />
im übrigen die Regeln des redlichen Verkehrs eingehalten“ worden waren,<br />
konnte „die Rückstellungskommission nach billigem Ermessen (...) bestimmen, ob und welcher<br />
Teil des vom Erwerber bezahlten, vom Eigentümer aber nicht zur freien Verfügung erhaltenen<br />
Kaufpreises dem Erwerber vom geschädigten Eigentümer zu ersetzen ist.“ 50 Diese<br />
Bestimmung bedeutete in den meisten Fällen, daß der ehemals Verfolgte („geschädigte Eigentümer“)<br />
sein ihm zustehendes Eigentum de facto zurückkaufen mußte. Auch die Einschränkung<br />
der „freien Verfügung“, im Gesetz nicht näher definiert, wurde von den Rückstellungskommissionen<br />
unterschiedlich ausgelegt. In Einzelfällen wurde sogar angenommen,<br />
daß die vom Kaufpreis erlegte ➤ Reichsfluchtsteuer und Judenvermögensabgabe dem<br />
Verfolgten zugute gekommen und daher an den „Erwerber“ zurückzuzahlen sei! 51 In den allermeisten<br />
Fällen war der Kaufpreis auf einem ➤ Sperrkonto deponiert worden, von dem<br />
der Verfolgte monatlich nur einen geringen Betrag hatte beheben können. Bei der Ausreise<br />
waren nur 10 oder 20 Reichsmark als Bargeld mitzunehmen gestattet. Die auf den Konten<br />
liegenden Beträge fielen spätestens mit der ➤ 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz aus<br />
1941 an das Deutsche Reich. 52 Der österreichische Staat, der jede Verantwortung für die<br />
Verbrechen des NS-Regimes von sich wies, verweigerte über etliche Jahre die Entschädigung<br />
für diese diskriminierenden Abgaben. Den ehemaligen Verfolgten blieb also, wollten<br />
sie ihr Eigentum zurückerhalten, nur der Weg der Kreditaufnahme. 53 Konnte der Geschädigte<br />
den Kaufpreis nicht aufbringen, so forderte der „Erwerber“ den Verkauf des Eigentums,<br />
um den Kaufpreis zurückzuerhalten. Im Wege der öffentlichen Versteigerung erhielt auf<br />
106 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
diesem Weg der „Ariseur“ in vielen Fällen – entgegen der Absicht des Rückstellungsgesetzes<br />
– das „arisierte“ Eigentum wieder zurück. 54<br />
Eine weitere wesentliche Problematik ergab sich daraus, daß das Dritte Rückstellungsgesetz<br />
den aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch abgeleiteten Begriff des „redlichen Erwerbers“<br />
einführte, der die aus dem „arisierten“ Vermögen erwirtschafteten Gewinne einbehalten<br />
durfte. Da aber der erste „Erwerber“ zumeist wußte, daß er von einem unter Zwang handelnden<br />
Verfolgten kaufte, definierte das Gesetz den „redlichen“ Erwerb dahingehend,<br />
daß dafür zumindest die „Regeln des redlichen Verkehrs“ eingehalten worden waren. Graf<br />
meint dazu in seiner juristischen Kritik des Gesetzes, diese Bestimmung habe „ein paradoxes<br />
Flair, genauso als ob bei einem Banküberfall dann die Regeln des redlichen Verkehrs<br />
eingehalten wären, wenn der Bankräuber den Bankkassier nicht mit ‚Du‘, sondern<br />
höflich mit ‚Sie‘ anspricht.“ 55 In jedem Fall führte diese Bestimmung dazu, daß häufig der<br />
„Erwerber“ die Gewinne der letzten Jahre für sich behalten konnte.<br />
Eine Reihe von Ungerechtigkeiten bei der Durchführung des Rückstellungsgesetzes wären<br />
vermeidbar gewesen, hätte Österreich zumindest in jenen Fällen Zahlungen an die ehemals<br />
Verfolgten geleistet, in denen tatsächlich unschuldige „Erwerber“ (beispielsweise bei<br />
Weiterverkauf an Dritte oder in den Fällen der für die Anlage des Truppenübungsplatzes<br />
Allentsteig enteigneten Döllersheimer Bauern) vorhanden waren oder der Geschädigte aus<br />
anderen Gründen keine Rückstellung seines Eigentums erlangen konnte. Solche Zahlungen<br />
lehnte die Republik jedoch entschieden ab.<br />
Der Widerstand gegen das Dritte Rückstellungsgesetz und Novellierungsversuche 56<br />
Seitens der „Erwerber“, zumeist also der „Ariseure“ selbst, regte sich bereite 1948 heftiger<br />
Widerstand gegen das Gesetz. Sie konstituierten Ende 1948 einen ➤ „Verband der<br />
Rückstellungsbetroffenen“, der in einer eigenen Zeitschrift, „Unser Recht“, gegen die angeblichen<br />
Ungerechtigkeiten des Dritten Rückstellungsgesetzes mobilisierte. Aus Sicht der<br />
„Ariseure“ waren sie alle „redliche Erwerber“ gewesen, denen das Dritte Rückstellungsgesetz<br />
nicht den Schutz, der ihnen zukomme, gewähre. 57 Gleichzeitig begannen zu dieser<br />
Zeit bereits die Parlamentsparteien um die Stimmen der bei der Nationalratswahl 1949<br />
wieder wahlberechtigten Nationalsozialisten zu konkurrieren, so daß die „Rückstellungsbetroffenen“<br />
auf politische Unterstützung rechnen durften, die sich nach dem überraschenden<br />
Wahlerfolg des ➤ Verbandes der Unabhängigen (VdU) 1949 noch deutlich verstärkte,<br />
verstand sich doch der VdU als Vertretung der „Ehemaligen“ im Nationalrat. 58 Schützenhilfe<br />
erhielten „Rückstellungsbetroffene“ und VdU seit Ende 1948 seitens der ÖVP, die sich<br />
bekanntlich unmittelbar um die Stimmen der „Ehemaligen“ bemühte, während die SPÖ die<br />
Gründung des VdU als Sammelbecken für dieses Lager präferierte und letztlich auch<br />
durchsetzte.<br />
Im November 1948 berichtete die US-Legal Division von Bemühungen des Bundesministers<br />
für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung, ➤ Peter Krauland, 59 um eine Novellierung<br />
des Dritten Rückstellungsgesetzes, deren Absicht es sei, „to render that law largely<br />
inoperative and to legalize possession by the aryanizers of the property“. 60 Der Bericht<br />
führte zwei wesentliche Punkte der beabsichtigten Änderung an: Der erste zielte auf die<br />
Möglichkeit einer neuerlichen Verhandlung bereits erledigter Fälle zugunsten der „Ariseure“.<br />
Der zweite wollte all jenen, die Österreich nach dem „Anschluß“ verlassen hatten und nicht<br />
zurückgekehrt waren, die Rückstellung ihres Eigentums verweigern. Damit wäre die überwältigende<br />
Mehrheit aller Vertriebenen vom Dritten Rückstellungsgesetz ausgeschlossen<br />
worden. 61 Diese Bemühungen Kraulands dürften ebenso wie die im folgenden genannten<br />
Novellierungsversuche am Widerstand der US-Besatzungsmacht und wohl auch der Briten<br />
gescheitert sein. 62<br />
Vor und unmittelbar nach den Nationalratswahlen 1949 brachten Abgeordnete der<br />
ÖVP Anträge auf Novellierung des Dritten Rückstellungsgesetzes zugunsten der „Erwerber“<br />
ein, 63 deren Inhalt von den „Rückstellungsbetroffenen“ enthusiastisch begrüßt wurde. 64<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
107<br />
Der „redliche<br />
Erwerber“
Bundesgesetz<br />
über den<br />
„Härteausgleich“<br />
in Rückstellungsverfahren<br />
Bauern aus<br />
Döllersheim<br />
blieben entschädigungslos<br />
„Ohne den Staat weiter damit zu belasten ...“<br />
US-Hochkommissär Keyes wies in einem Brief an Bundeskanzler ➤ Figl im März 1950<br />
nachdrücklich darauf hin, daß die beabsichtigte Novellierung gegen den Artikel 44 des<br />
Entwurfes zum ➤ Staatsvertrag – Artikel 26 im Staatsvertrag 1955 – verstoße. 65 Außerdem<br />
verweigerte die SPÖ-Fraktion die Zustimmung zu dieser Novelle und schlug stattdessen<br />
die Schaffung eines „Härteausgleichs“ vor, der der „Bekämpfung und Beseitigung aller<br />
Härten, die auf Hitler und die Nazi zurückzuführen sind“, dienen sollte. 66 Noch in der letzten<br />
Sitzung des Nationalrates vor der Sommerpause brachten Abgeordnete der Regierungsparteien<br />
einen Antrag „betreffend ein Bundesgesetz über den Härteausgleich in<br />
Rückstellungsfällen und die Errichtung eines Härteausgleichsfonds“ ein. 67 Dieser Antrag<br />
vermischte die Interessen verschiedener Opfergruppen mit jenen der „Ariseure“. Während<br />
gegenüber dem Dritten Rückstellungsgesetz in Teil I und II des Entwurfs deutliche Verschlechterungen<br />
für die ehemals Verfolgten vorgesehen waren, 68 wurde in Teil III ein „Härteausgleich“<br />
u. a. für die „Erwerber“ vorgesehen, der unter anderem „gespeist werden<br />
soll aus dem erblosen Eigentum, einer Abgabe vom Erlös rückgestellten Eigentums, dessen<br />
Verkauf innerhalb eines fünfjährigen Zeitraumes nach der Rückstellung erfolgt“. 69 Aus diesem<br />
Fonds sollten neben Geschädigten, die ihre Ansprüche aufgrund des Dritten und Siebenten<br />
Rückstellungsgesetzes nicht geltend machen konnten, auch „bestimmte besonders<br />
berücksichtigungswürdige Gruppen rückstellungspflichtiger redlicher Erwerber“ entschädigt<br />
werden. Das hieß mit anderen Worten, daß sogenannte „redliche Erwerber“ „arisierten“<br />
Eigentums aus dem Eigentum der von den Nationalsozialisten ermordeten Juden entschädigt<br />
hätten werden sollen! Weiters sah der Entwurf die Auszahlung von Entschädigungen<br />
für erlittene Haftzeiten vor und stellte damit die Erfüllung einer langjährigen Forderung<br />
der Opferverbände in Aussicht. 70<br />
Die ➤ Israelitische Kultusgemeinde war nicht bereit, diesen neuerlichen Angriff auf die<br />
Rechte ihrer geschädigten Mitglieder hinzunehmen, und führte im Konzerthaus eine Protestversammlung<br />
durch; US-Hochkommissär Keyes machte Bundeskanzler Figl in einem Schreiben<br />
vom 1. September 1950 nachdrücklich darauf aufmerksam, daß dieser Entwurf sowohl<br />
der Londoner Deklaration als auch dem Entwurf des Staatsvertrages widersprach. 71<br />
Der Ministerrat beschloß am 5. September, den Antrag zurückzustellen. 72<br />
Doch die Frage einer Novellierung des Dritten Rückstellungsgesetzes blieb weiter auf der<br />
politischen Tagesordnung. 1952 unternahm die Bundesregierung einen neuerlichen Versuch.<br />
Am 17. Juli dieses Jahres beschloß der Nationalrat ein Bundesgesetz „über den Ausgleich<br />
von Härten in Rückstellungsfällen (Wiedererwerbsgesetz)“. 73 Der Text dieses Gesetzes<br />
war nach langwierigen Diskussionen aus dem Gesetzesentwurf 1950 hervorgegangen<br />
und sah unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit des Wiedererwerbs bereits rückgestellten<br />
„arisierten“ Eigentums durch den „Ariseur“ vor. Heftige Kritik rief die Bestimmung<br />
hervor, wonach bei Überschuldung des Eigentümers vor dem März 1938 keine Rückstellung<br />
zu erfolgen gehabt hätte und der „Ariseur“ daher bereits rückgestelltes Eigentum wiedererwerben<br />
hätte dürfen. 74 Angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Situation Österreichs<br />
im Jahr 1938 und der infolge der antijüdischen Maßnahmen und Plünderungen noch<br />
vor dem Verkauf ruinierten Geschäfte stellte diese Bestimmung eine dramatische Verschlechterung<br />
der Rückstellungsgesetzgebung dar.<br />
Das Exekutivkomitee des ➤ Alliierten Rates beeinspruchte dieses Gesetz in seiner Sitzung<br />
am 22. 8. 1952 einstimmig, so daß es keine Rechtskraft erlangte. 75 Damit war der letzte<br />
Versuch, die Bestimmungen des Dritten Rückstellungsgesetzes zu Lasten der ehemals Verfolgten<br />
zu unterlaufen, zu Fall gebracht worden. Entschädigungslos blieben damit aber<br />
auch jene Bauern aus Döllersheim, dem heutigen Truppenübungsplatz Allentsteig, die von<br />
NS-Behörden enteignet worden waren und die dafür „arisierten“ Grundbesitz erhalten hatten.<br />
Sie waren rückstellungspflichtig und zählten damit tatsächlich zu Verlierern der Gesetzgebung.<br />
Diese Notlage auf Kosten der ehemals Verfolgten lösen zu wollen, konnte allerdings<br />
nicht angehen. Hier wäre dem österreichischen Staat die Verpflichtung zugekommen,<br />
aus staatlichen Mitteln solche Härten zu beseitigen.<br />
108 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Die nicht erfolgte Rückstellung der Wohnungen 76<br />
Nach dem „Anschluß“ 1938 wurden allein in Wien rund 60.000 Mietwohnungen ihren jüdischen<br />
Besitzern entzogen, 77 zum Teil ohne formale Kündigung des Mietvertrages. Als<br />
nach Kriegsende Verfolgte aus Konzentrationslagern oder dem Ausland zurückkehrten, verfügten<br />
sie über keinen Rechtsanspruch, ihre Wohnungen wieder zurückzuerhalten. Im Wege<br />
des Wohnungsanforderungsgesetzes 78 in Verbindung mit dem Verbotsgesetz konnten<br />
Wohnungen von Nationalsozialisten beschlagnahmt und über das Wohnungsamt wieder<br />
vergeben werden. Angesichts des nahenden Kriegsendes waren zahlreiche Nationalsozialisten<br />
in den Westen geflüchtet, ihre leerstehenden Wohnungen wurden neuerlich vermietet.<br />
Doch diese in den ersten Nachkriegsmonaten erfolgten Einweisungen führten bald zu Konflikten<br />
mit den nationalsozialistischen Vormietern, da diese nur wenig später mit Hilfe der<br />
Gerichte, die die vorläufigen Einweisungen aus dem Jahr 1945 nicht anerkannten, die<br />
Delogierung des eingewiesenen Verfolgten erzielen konnten. In anderen Fällen wiederum<br />
konnte die Ehefrau des nationalsozialistischen Mieters nachweisen, nie Mitglied der NSDAP<br />
gewesen zu sein, und auf diese Weise die Kündigung des Opfers erreichen. 79 Anfang<br />
1950 sah sich Justizminister Tschadek jedenfalls veranlaßt, die Gerichte aufzufordern, die<br />
Delogierung von Opfern nicht länger zuzulassen. 80<br />
Bereits das Dritte Rückstellungsgesetz hatte eine Regelung für die Rückstellung entzogener<br />
Miet- und Bestandsrechte, wovon neben Wohnungen auch Geschäftslokale betroffen gewesen<br />
wären, in Aussicht gestellt. 81 Ein erster Entwurf kam 1947 über Ausschußberatungen<br />
nicht hinaus und wurde angesichts der nahenden Wahlen 1949 wieder fallengelassen. 82<br />
Obschon Bundeskanzler Figl von US-Hochkommissär Keyes mehrmals aufgefordert wurde,<br />
endlich ein Gesetz zur Wohnungsrückstellung zu verabschieden, 83 zeigte sich die Bundesregierung<br />
in dieser Frage unnachgiebig. Bundesminister Tschadek bezeichnete 1950 ein<br />
solches Gesetz als „eine absolute Gefahr“, da dadurch „eine unbedingte Beunruhigung<br />
unter der Bevölkerung entstehen“ würde. 84 Ein trotzdem in diesem Jahr dem Nationalrat zugegangener<br />
Entwurf wies zahlreiche Mängel und Einschränkungen auf, die von der Israelitischen<br />
Kultusgemeinde kritisiert wurden. 85 In der folgenden Gesetzgebungsperiode wurde<br />
ein neuerlicher, dem vorhergehenden ähnlicher und wiederum ungenügender Entwurf vorgelegt,<br />
86 der abermals nicht bis zur Behandlung im Nationalrat gedieh. Aufgrund dieses<br />
Zögerns der Bundesregierung, hier in der unmittelbaren Konkurrenzsituation zwischen Opfern<br />
und Tätern zugunsten der Opfer zu entscheiden, mußten zahlreiche mittellose Rückkehrer,<br />
so sie nicht anderwärts Wohnraum erhalten konnten, über Jahre hinweg in Massenquartieren<br />
und anderen unzureichenden Unterkünften leben, während die „Ariseure“ ihre<br />
ehemaligen Wohnungen nach wie vor innehatten. Ein Memorandum des ➤ „Claims Committee“<br />
wies 1953 darauf hin, daß nach wie vor 800 Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde<br />
in „unerträglichen Untermieten oder in Rückkehrerlagern oder sogar in Obdachlosenherbergen“<br />
leben mußten. 87 Der bereits erwähnte Jurist ➤ Dr. Walther Kastner, der nach<br />
eigenen Angaben selbst in einer vormals einem Juden gehörenden Wohnung lebte, 88 stellt<br />
als Begründung für die Nicht-Verabschiedung dieses Gesetzes fest: „Diese Regelung hätte<br />
der Interessenslage tatsächlich nicht entsprochen. Es ist zu bedenken, daß in Wien 1938<br />
fast 200.000 Juden gewohnt hatten, aber gegenwärtig nur etwa 7000 Juden wieder in<br />
Wien ansässig sind.“ 89 Wieviele aus Österreich vertriebene Menschen nicht zurückkehrten,<br />
weil sie keine Möglichkeit sahen, hier wieder Wohnung und Existenz zu finden, wird sich<br />
wohl nie feststellen lassen.<br />
Weitere Maßnahmen<br />
In der zweiten Hälfte der fünfziger und zu Anfang der sechziger Jahre wurde noch eine<br />
Reihe von Gesetzen zur Erfüllung offener Entschädigungsforderungen vom Nationalrat verabschiedet.<br />
Anlaß dazu waren unter anderem die seit 1953 laufenden Verhandlungen des<br />
„Committee for Jewish Claims on Austria“ mit der österreichischen Bundesregierung sowie<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
109<br />
Massenquartiere<br />
und<br />
unzureichende<br />
Unterkünfte
„Kriegs- und<br />
Verfolgungssachschädengesetz“<br />
Erfassung des<br />
„erblosen“<br />
Vermögens<br />
„Ohne den Staat weiter damit zu belasten ...“<br />
die Bestimmungen des Artikels 26 des Staatsvertrages, die die Republik zur Rückstellung<br />
entzogenen Eigentums verpflichteten. 90<br />
Das Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz 91 1958 sah teilweisen Ersatz für Hausrat<br />
und Wohnungseinrichtungen vor, die infolge von Kriegseinwirkungen oder politischer Verfolgung<br />
verloren gegangen waren. Entschädigung wurde aber nur bis zu einer gewissen<br />
Höhe und abhängig vom Jahreseinkommen des Geschädigten geleistet. Auf diese Weise<br />
war wiederum – so wie auch in der Opferfürsorgegesetzgebung und teilweise aufgrund<br />
der „Billigkeitserwägungen“ im Dritten Rückstellungsgesetz – eine Verschränkung von Entschädigung<br />
und sozialer Bedürftigkeit vorgenommen worden. Gleichfalls 1958 verabschiedete<br />
der Nationalrat das Gesetz zur Entschädigung für vom Deutschen Reich eingezogene<br />
Lebensversicherungen, dessen Anmeldefrist aber nur auf ein Jahr bemessen war, 92 so daß<br />
nicht in Österreich lebende Verfolgte oft erst zu spät davon erfuhren. 93<br />
Nachdem seit 1945 auf die Erfassung des erblos gebliebenen jüdischen Eigentums gedrängt<br />
worden war, die auch das Dritte Rückstellungsgesetz bereits in Aussicht gestellt<br />
hatte, wurde im Auffangorganisationsgesetz 94 die Gründung von ➤ Sammelstellen zur Erfassung<br />
des erblosen Vermögens ermordeter Juden und politisch Verfolgter bestimmt. 95<br />
Erst am 22. März 1961 verabschiedete der Nationalrat das Gesetz über den „Fonds zur<br />
Abgeltung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter“. 96 Mit Hilfe dieses Fonds sollten infolge<br />
nationalsozialistischer Verfolgung erlittene Verluste an Wertpapieren, Bankkonti und<br />
Bargeld sowie Verluste infolge erzwungener Entrichtung diskriminierender Abgaben und<br />
Steuern (Judenvermögensabgabe, Reichsfluchtsteuer) entschädigt werden. Kleinere Verluste<br />
wurden zu 100 %, größere mit 48,5 %, jedoch mindestens mit öS 47.250,- entschädigt. 97<br />
Zusammenfassung<br />
Da die Republik Österreich aus außenpolitischen Opportunitätserwägungen bis zur Regierungserklärung<br />
aus dem Juli 1991 98 jede Verantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes<br />
dem Deutschen Reich anlastete und für sich und seine Staatsbürger leugnete, wiesen die verantwortlichen<br />
Politiker seit Kriegsende jede Verpflichtung zu Entschädigungsleistungen und<br />
„Wiedergutmachung“ strikt von sich. Daher wurde auch die Rückstellungsgesetzgebung auf<br />
jene Schäden beschränkt, in denen eine Naturalrestitution möglich war. Vor allem im Dritten<br />
Rückstellungsgesetz war aber der Rückzug des Staates aus der Verantwortung in mehrfacher<br />
Hinsicht problematisch. Die Delegation an den unmittelbaren Konflikt zwischen dem „Erwerber“<br />
und dem ehemals Verfolgten bedingte in vielen Fällen per se bereits ein Ungleichgewicht:<br />
Der zurückgekehrte „geschädigte Eigentümer“ war in vielen Fällen mittellos, benötigte<br />
die Rückstellung zur Wiederaufrichtung seiner Existenz, verfügte jedoch gleichzeitig nicht<br />
über jenes Beziehungsnetz, das dem „Erwerber“ zur Verfügung stand, den Anwaltskosten<br />
und langwierige Verfahren lange nicht im selben Ausmaß belasteten. Darüber hinaus erzeugte<br />
die staatliche Absenz tatsächliche Ungerechtigkeiten für beide Seiten. Nicht mehr<br />
auffindbares entzogenes Eigentum wurde nicht ersetzt – oder erst in den späten fünfziger<br />
Jahren – , Käufer, die wirklich nicht über die Vorgeschichte ihres Besitzes informiert waren<br />
und diesen später rückstellen mußten, gingen manches Mal dann entschädigungslos aus,<br />
wie eben einige der aus dem Gebiet von Döllersheim abgesiedelten Bauern.<br />
1 Erläuternde Bemerkungen zu dem Gesetz über die Nichtigkeit<br />
von Vermögensentziehung (3. Rückstellungsgesetz), 45. Sitzung<br />
des Ministerrates, 12. 11. 1946. Archiv der Republik, BM für Unterricht,<br />
Ministerratsprotokolle, Karton 4.<br />
2 Zur Diskussion des Begriffes der „Wiedergutmachung“ siehe: Brigitte<br />
Bailer, Wiedergutmachung kein Thema. Österreich und die<br />
Aus: Zeitgeschichte, Nr.11/12, 1993, Studien Verlag, S. 367-381.<br />
Opfer des Nationalsozialismus, Wien 1993, S. 12 ff.<br />
3 Siehe dazu auch die Literaturdiskussion in Bailer, a. a. O., 14 ff. sowie<br />
Literaturverzeichnis.<br />
4 Robert Knight, „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen“.<br />
Die Wortprotokolle der österreichischen Bundesregierung von 1945<br />
bis 1952 über die Entschädigung der Juden, Frankfurt/M. 1988.<br />
110 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
5 Die „Nürnberger Gesetze“ betrafen neben den Mitgliedern der<br />
Kultusgemeinden auch zahlreiche Menschen, die selbst keine jüdische<br />
Identität mehr hatten, sowie sogenannte „Mischlinge“, mit<br />
Juden verheiratete Personen usw.<br />
6 Dr. F. R. Bienenfeld, Dr. C. Kapralik, Draft Memorandum on Losses<br />
of Austrian Jewry, 19. 5. 1953, Nachlaß Albert Loewy, Institut für<br />
Zeitgeschichte der Universität Wien. Dieselbe Summe nennt<br />
Gustav Jellinek, Die Geschichte der österreichischen Wiedergutmachung,<br />
in: Josef Fraenkel, The Jews of Austria. Essays on their<br />
Life, History and Destruction, London 1967, S. 396.<br />
7 Gertraud Fuchs, Die Vermögensverkehrsstelle als Arisierungsbehörde<br />
jüdischer Betriebe, Diplomarbeit am Institut für Wirtschafts-<br />
und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien,<br />
Wien 1989, S.18 ff., S. 166.<br />
8 Zur Geschichte der Vermögensverkehrsstelle und Durchführung<br />
der „Arisierungen“ siehe Gertraud Fuchs, a. a. O.<br />
9 a. a. O., S. 166.<br />
10 Siehe dazu unter anderen: Jonny Moser, Die Verfolgung der Juden,<br />
in: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Widerstand und Verfolgung in Wien 1934-1945, Wien 1975,<br />
Band 3, S. 195 ff.; Elisabeth Klamper, Die Situation der jüdischen<br />
Bevölkerung in Wien vom Ausbruch bis zum Ende des Krieges, in:<br />
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (<strong>Hrsg</strong>.),<br />
Jüdische Schicksale, Berichte von Verfolgten , Wien 1992, S. 164 ff.<br />
11 Gerhard Botz, Wohnungspolitik und Judendeportationen in Wien<br />
1938-1945. Zur Funktion des Antisemitismus als Ersatz nationalsozialistischer<br />
Sozialpolitik, Wien 1975, bes. S. 28; zur Vorgangsweise<br />
der Gemeinde Wien: Herbert Exenberger; Johann Koss, Brigitte<br />
Ungar-Klein, „Kündigungsgrund Nichtarier“. Aus- und Umsiedlungen<br />
jüdischer Mieter aus Wiener kommunalen Wohnbauten in<br />
den Jahren 1938/39, Projekt P 7835-HiS, Fonds zur Förderung der<br />
wissenschaftlichen Forschung. Wien 1992.<br />
12 Stenographisches Protokoll der 14. Sitzung des Nationalrates der<br />
Republik Österreich, V. Gesetzgebungsperiode, 15. 5. 1946.<br />
13 Knight, a. a. O., S. 263.<br />
14 StGBI. Nr. 10, 10. 5. 1945.<br />
15 Siehe beispielsweise Karl Renner in der 5. Kabinettsratssitzung<br />
vom 10. 5. 1945, zitiert in: Knight, a. a. O., S. 83; Dr. Alfred Migsch,<br />
Zur Versorgung der Opfer des Naziterrors. Es darf keine persönliche<br />
Bereicherung geben! Informationsdienst der Sozialistischen<br />
Partei Österreichs, Sondernummer vom 5. Juni 1945; Kommunistische<br />
Partei Österreichs (<strong>Hrsg</strong>.), Rothschild greift nach Österreich,<br />
o. J.<br />
16 Der Abgeordnete Kolb als Berichterstatter zum Nichtigerklärungsgesetz,<br />
stenographisches Protokoll der 14. Sitzung des Nationalrates<br />
der Republik Österreich, V. Gesetzgebungsperiode, 15. 5. 1946.<br />
17 Vgl. dazu das Memorandum der Staatskanzlei, Auswärtige Angelegenheiten:<br />
„Die außenpolitische und die völkerrechtliche Seite<br />
der Ersatzansprüche der jüdischen Naziopfer“, abgedruckt in<br />
Knight, a. a. O., insbes. S. 107.<br />
18 BGBI. 106/1946.<br />
19 Siehe dazu auch Gottfried Klein, 1938-1968. Dreißig Jahre: Vermögensentziehung<br />
und Rückstellung, in: Österreichische Juristenzeitung,<br />
24. Jahrgang, 11. Februar 1969. Zur Entwicklung aus der<br />
Sicht der Opfer siehe: Akim Lewit, Wiedergutmachung, in: Mahnruf<br />
für Freiheit und Menschenrecht. Organ des österreichischen<br />
Bundesverbandes ehemals politisch verfolgter Antifaschisten, Nr.<br />
1, 15. 11. 1946.<br />
20 BGBI. 156/1946; siehe zu dieser Entwicklung auch Der neue Weg,<br />
Nr. 41/42, 15. 11. 1946.<br />
21 In Deutschland waren sowohl Entschädigung als auch Rückstellung<br />
– dort „Rückerstattung“ – kompakter zusammengefaßt.<br />
22 Bundesgesetz über die Rückstellung entzogener Vermögen, die<br />
sich im Eigentum der Republik Österreich befinden, BGBI. 53/1947.<br />
23 Bundesgesetz über die Nichtigkeit von Vermögensentziehungen,<br />
BGBI. 54/1947.<br />
24 BM für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung, Vortrag an<br />
den Ministerrat über die Rückstellung entzogener Vermögen, die<br />
sich in Verwaltung des Bundes oder eines Bundeslandes befinden<br />
(1. Rückstellungsgesetz), ZI. 11.447-1/1946. Vorgelegt bei der 26.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Brigitte Bailer-Galanda<br />
Sitzung des Ministerrates am 18. 6. 1946. Archiv der Republik, BM<br />
für Unterricht, Ministerratsprotokolle, Karton 3.<br />
25 Der neue Weg, Nr. 13/14, 15. 4. 1946; Bericht des Präsidiums der<br />
Israelitischen Kultusgemeinde Wien über die Tätigkeit in den<br />
Jahren 1945-1948, Wien 1948, S. 21 f.; Mahnruf für Freiheit und<br />
Menschenrecht, Nr. 2, 31. 1. 1947. Zur Geschichte des damals überparteilichen<br />
Bundesverbandes siehe Bailer, a. a. O., S. 45-52.<br />
26 Knight, a. a. O., S. 153.<br />
27 Vgl. Der neue Weg, Nr. 41/42, 15. 11. 1946; Nr. 45/46, 15. 12. 1946,<br />
Nr. 2, Anfang Februar 1947; Schreiben Ministerialrat Dr. Franz<br />
Sobek namens der Rechtskommission des Bundesverbandes vom<br />
5. 12. 1946, Archiv der SPÖ, Korrespondenz des Bundes Sozialistischer<br />
Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus, Mappe I.<br />
28 Paragraph 6 Abs. 1.<br />
29 Bericht des Präsidiums der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, a.<br />
a. O., S. 22.<br />
30 Stenographisches Protokoll der 44. Sitzung des Nationalrates der<br />
Republik Österreich, V. Gesetzgebungsperiode, 6. 2. 1947.<br />
31 Vortrag für den Ministerrat zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes<br />
über die Nichtigkeit von Vermögensentziehungen (Drittes Rückstellungsgesetz),<br />
vorgelegt bei der 45. Sitzung des Ministerrates<br />
am 12. 11. 1946. Archiv der Republik, BM für Unterricht, Ministerratsprotokolle,<br />
Karton 4.<br />
32 Der neue Weg, Nr. 13, Mitte Juli 1948; Bericht des Präsidiums der<br />
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, a. a. O., S. 21 f.<br />
33 Draft reply to Cable Ref. No. 93346, 6 March 1947. Institut für<br />
Zeitgeschichte der Universität Wien, Nachlaß Albert Loewy, Karton<br />
Rückstellung 1947.<br />
34 BGBI. 143/1947.<br />
35 BGBI. 164/1949.<br />
36 BGBI. 199/1949.<br />
37 BGBI. 207/1949. Kurze, wenn auch mit Rücksicht auf die Biographie<br />
des Verfassers zu lesende Anmerkungen zu diesen und anderen<br />
Gesetzen finden sich in: Walther Kastner, Entziehung und<br />
Rückstellung, in: Nationalsozialismus und Recht. Rechtssetzung<br />
und Rechtswissenschaft in Österreich unter der Herrschaft des<br />
Nationalsozialismus, Wien 1990, S. 191-225. Zur Person Kastners<br />
siehe Fußnote 44.<br />
38 Eine ausführliche Dokumentation der Problematik muß einem<br />
größeren Forschungsprojekt vorbehalten bleiben.<br />
39 Beispielsweise bei der Entscheidung, welche Erträge aus dem „arisierten“<br />
Eigentum an die Verfolgten zurückzustellen seien und in<br />
welchen Fällen der Verfolgte den Kaufpreis an den Erwerber<br />
zurückzuzahlen habe.<br />
40 Bericht des Präsidiums der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, a.<br />
a. O., S. 21.<br />
41 Vgl. Dr. Rudolf Braun, Die Rückstellung in Gesetzgebung und Praxis,<br />
in: Die Gemeinde, Nr. 2, März 1949.<br />
42 Bericht von Abraham S. Hyman an The Commanding General,<br />
United States Forces, Austria, vom 4. 2. 1947. Institut für Zeitgeschichte<br />
der Universität Wien, Nachlaß Albert Loewy, Karton<br />
Rückstellung 1947.<br />
43 Bundesgesetz vom 1. Februar 1946 über die Errichtung eines Bundesministeriums<br />
für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung,<br />
BGBI. 56/1946.<br />
44 Stenographisches Protokoll der 97. Sitzung des Nationalrates der<br />
Republik Österreich, V. Gesetzgebungsperiode, 14. 12. 1948. Der<br />
kommunistische Abgeordnete Honner führte einige markante<br />
Fälle namentlich an. Auch Walther Kastner, als Prokurist der<br />
Kontrollbank für die „Arisierung“ von Großbetrieben zuständig<br />
gewesen, war nach dem Krieg als Fachmann für Rückstellungen<br />
ins Krauland-Ministerium geholt worden. Siehe dazu ausführlicher:<br />
Bailer, a. a. O., S. 259.<br />
45 Vgl. beispielsweise Der neue Weg, Nr. 15, Mitte August 1947; Nr.<br />
20, November 1947; Nr. 22, Anfang Dezember 1947; Weltenwende<br />
zu Vernunft und Menschlichkeit. Unabhängige demokratische<br />
Zeitschrift, Oktober 1948.<br />
46 Vgl. beispielsweise Der neue Weg, Nr. 23, Mitte Dezember 1947;<br />
Die Gemeinde, Nr. 2, März 1948; Der sozialistische Kämpfer, Nr.<br />
4/6, Juni 1950.<br />
111
„Ohne den Staat weiter damit zu belasten ...“<br />
47 Vgl. beispielsweise stenographisches Protokoll der 38. Sitzung des<br />
Nationalrates der Republik Österreich, VI. Gesetzgebungsperiode,<br />
8. 12. 1950. Der Abgeordnete Dr. Scheff (ÖVP) kritisierte die umständlichen<br />
Vorbedingungen für die Erlangung eines Auszuges<br />
aus dem Grundbuch, die die Dauer der Rückstellungsverfahren<br />
unnötig verlängerten.<br />
48 Dies kommt auch in Interviews mit Verfolgten oftmals zum Ausdruck.<br />
Vgl. das Interview mit „Otto Vogel“ in: Dokumentationsarchiv<br />
des österreichischen Widerstandes (<strong>Hrsg</strong>.), Jüdische Schicksale.<br />
Berichte von Verfolgten, S. 684 f.<br />
49 Statistik über den Stand der Rückstellungsverfahren von Ende Oktober<br />
1954. Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, Nachlaß<br />
Albert Loewy, Karton Rückstellung Statistiken.<br />
50 Paragraph 6 Abs. 1 in Verbindung mit Paragraph 5 Abs. 2 des 3.<br />
Rückstellungsgesetzes.<br />
51 Juristisch fundierte Kritik an dieser Praxis siehe: Georg Graf,<br />
Arisierung und keine Wiedergutmachung. Kritische Anmerkungen<br />
zur jüngeren österreichischen Rechtsgeschichte, in: P. Muhr,<br />
P. Feyerabend, C. Wegeler (<strong>Hrsg</strong>.), Philosophie – Psychoanalyse –<br />
Emigration, Wien 1992, S. 73 ff.<br />
52 Vgl. Fuchs, a. a. O., S. 201 ff.<br />
53 Vgl. Die Gemeinde, Nr. 2, März 1948.<br />
54 Bericht Dr. F. R. Bienenfeld vom Committee for Jewish Claims on<br />
Austria, o. D. (1953), 9. Institut für Zeitgeschichte der Universität<br />
Wien, Nachlaß Albert Loewy, ungeordneter Bestand.<br />
55 Graf, a. a. O., S. 72.<br />
56 Zu dieser Problematik siehe auch die Arbeit von Robert Knight, a.<br />
a. O.<br />
57 Vgl. beispielsweise „Wir klagen nicht an, sondern fordern Gerechtigkeit“,<br />
in: Unser Recht. Organ zur Wahrung der Interessen der<br />
Rückstellungs-Betroffenen, Nr. 4, 1. Jg., Dezember 1948.<br />
58 Vgl. dazu Bailer, a. a. O., S. 256 ff.<br />
59 Ab Sommer 1950 verdichteten sich die Gerüchte um Mißbrauch<br />
der Amtsgewalt und Parteienfinanzierung rund um Kraulands<br />
Tätigkeit, die zu seiner Verhaftung und mehreren Prozessen führten,<br />
wobei Krauland selbst freigesprochen, seine Mitarbeiter<br />
jedoch verurteilt wurden. Dokumentationsarchiv des österreichischen<br />
Widerstandes, Österreichische Gesellschaft für Quellenkunde<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Christlich-ständisch-autoritär. Mandatare im Ständestaat<br />
1934-1938, Wien 1991, S. 133.<br />
60 Vertraulicher Bericht der Legal Division, A. Loewy, H. L. Sultan,<br />
vom 17. 11. 1948. Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien,<br />
Nachlaß Albert Loewy, Karton Rückstellung 1949.<br />
61 a. a. O.<br />
62 Die Verifizierung dieser Vermutung bedingt noch weitergehende<br />
Archivrecherchen.<br />
63 Stenographisches Protokoll der 114. Sitzung des Nationalrates der<br />
Republik Österreich, V. Gesetzgebungsperiode, 22. 6. 1949; der 3.<br />
Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, VI. Gesetzgebungsperiode,<br />
23. 11. 1949. Der Entwurf sah beispielsweise vor,<br />
daß es nicht als Vermögensentziehung zu gelten habe, wenn der<br />
in jüdischem Besitz befindliche Betrieb bereits vor dem März 1938<br />
wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt hätte!<br />
64 Unser Recht, Folge 16, September 1949.<br />
65 Knight, a. a. O., S. 221 f.<br />
66 Der sozialistische Kämpfer, Nr. 7/8, Juli/August 1950.<br />
67 Stenographisches Protokoll der 30. Sitzung des Nationalrates der<br />
Republik Österreich, VI. Gesetzgebungsperiode, 14. 7. 1950. Zu<br />
den Details der Vorgangsweise siehe Knight, a. a. O., S. 227 f.<br />
Knight nennt irrtümlich den 13. 7. als Einbringungstag.<br />
68 Möglichkeit der Revision bereits erledigter Fälle, das Vorsehen einer<br />
Enteignungsmöglichkeit nach erfolgter Rückstellung u. a.<br />
Knight, a. a. O.; Der sozialistische Kämpfer, Folge 7/8 Juli/August<br />
1950.<br />
69 Der sozialistische Kämpfer, ebda.<br />
70 Zur Auseinandersetzung um die Haftentschädigung siehe Bailer,<br />
a. a. O., S. 62-77.<br />
71 Knight, a. a. O., S. 229 ff.<br />
72 Knight, a. a. O., S. 232 ff.<br />
73 Stenographisches Protokoll der 96. Sitzung des Nationalrates der<br />
Republik Österreich, VI. Gesetzgebungsperiode, 17. 7. 1952.<br />
74 Details finden sich: Stenographisches Protokoll der 96. Sitzung<br />
des Nationalrates, a. a. O., sowie Bericht (vermutlich der Legal<br />
Division) über Restitution Legislation in Austria, o. D., Institut für<br />
Zeitgeschichte der Universität Wien, Nachlaß Albert Loewy, ungeordneter<br />
Bestand.<br />
75 Vertraulicher Bericht The Problem of Internal Restitution, o. D.,<br />
Institut für Zeitgeschichte, a. a. O.<br />
76 Bei dieser Frage muß auch der Wert der Wohnungen mitberücksichtigt<br />
werden, den diese nach heutigen Maßstäben darstellen,<br />
sowie die Kosten, die den Verfolgten durch die neuerliche Notwendigkeit<br />
der Wohnraumbeschaffung nach 1945 erwuchsen.<br />
77 Siehe Fußnote 11.<br />
78 StGBI, 138/1945, vom 22. 8. 1945.<br />
79 Siehe dazu unter anderen: Der sozialistische Kämpfer, Nr. 7/8,<br />
Juli/August 1950.<br />
80 Neues Österreich, 19. 1. 1950.<br />
81 Paragraph 30 des 3. Rückstellungsgesetzes.<br />
82 Bericht der Legal Division „Present status of Restitution Legislation<br />
in Austria“ vom 27. 10. 1948. Institut für Zeitgeschichte der<br />
Universität Wien, Nachlaß Albert Loewy, ungeordneter Bestand.<br />
83 Knight, a. a. O., S. 215 ff., S. 221 f., S. 236 f.<br />
84 Knight, a. a. O., S. 233.<br />
85 Dr. Rudolf Braun, Das 8. Rückstellungsgesetz. Bemerkungen zur<br />
Regierungsvorlage. Institut für Zeitgeschichte der Universität<br />
Wien, Nachlaß Albert Loewy, ungeordneter Bestand. Das Rückstellungsgesetz<br />
für Miet- und Bestandsrechte wurde vorerst als<br />
5. Rückstellungsgesetz angekündigt, aufgrund des Aufschubs<br />
wäre es das 8. Rückstellungsgesetz gewesen.<br />
86 Schreiben des Rechtsbüros der Israelitischen Kultusgemeinde Wien<br />
an das Bundesministerium für soziale Verwaltung, 13. 10. 1953.<br />
Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, Nachlaß Albert<br />
Loewy, ungeordneter Bestand.<br />
87 Vereinigter Exekutivausschuß für jüdische Forderungen an Österreich,<br />
Memorandum über Ansprüche aus dem Titel entzogener<br />
Wohnungen, 1. 7. 1953. Institut für Zeitgeschichte der Universität<br />
Wien, Nachlaß Albert Loewy.<br />
88 Gespräch der Autorin mit Dr. Walther Kastner, Tonbandprotokoll<br />
im Privatbesitz von Dr. Gabriele Anderl.<br />
89 Walther Kastner, Entziehung und Rückstellung, in: U. Davy et al.<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Nationalsozialismus und Recht. Rechtssetzung und Rechtswissenschaft<br />
in Österreich unter der Herrschaft des Nationalsozialismus,<br />
Wien 1990, S. 196.<br />
90 Siehe dazu Dietmar Walch, Die jüdischen Bemühungen um die<br />
materielle Wiedergutmachung durch die Republik Österreich,<br />
Wien 1971; Bailer, a. a. O., S. 77-93.<br />
91 BGBI, 127/1958 vom 25. 6. 1958. Zur Vorgeschichte siehe Bailer, a.<br />
a. O., S. 83 ff.<br />
92 BGBI, 130/1958 vom 26. 6. 1958. Die Anmeldefrist endete mit 30.<br />
6. 1959.<br />
93 Vgl. Albert Sternfeld, Betrifft: Österreich. Von Österreich betroffen,<br />
Wien 1990, S. 206 ff.<br />
94 BGBI, Nr. 73/1957 vom 13. 3. 1957.<br />
95 Zur Tätigkeit der Sammelstellen siehe den Bericht von Dr. Georg<br />
Weis, Sammelstelle A, B. Schlußbericht (1957-1969); Walch, a. a.<br />
O., S. 111-138.<br />
96 BGBI, Nr. 100/1961 vom 22. 3. 1961.<br />
97 Maßnahmen der Republik Österreich zugunsten bestimmter<br />
politisch, religiös und abstammungsmäßig Verfolgter seit 1945,<br />
hrsg. v. Bundespressedienst, Wien 1986 (Österreich-Dokumentationen,<br />
9). Zur Vorgeschichte des Fonds siehe Bailer, a. a. O. Zum<br />
Vergleich des Geldwertes: die durchschnittliche Alterspension<br />
eines Angestellten betrug 1961 S 1500.-.<br />
98 Bundeskanzler Dr. Vranitzky erklärte vor dem Nationalrat, Österreich<br />
müsse sich „zur Mitverantwortung für das Leid, das zwar<br />
nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über<br />
andere Menschen und Völker gebracht haben“, bekennen. Zitiert<br />
nach: Salzburger Nachrichten, 9. 7. 1991.<br />
112 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
REHABILITIERUNG DER JUDEN ODER MATERIELLE WIEDERGUTMACHUNG – EIN VERGLEICH<br />
FRANK STERN<br />
Sechs Millionen Morde kann man nicht wiedergutmachen, Milliarden geraubten Vermögens<br />
nicht wirklich rückerstatten. Den Überlebenden ist nichts anzudienen, was ihrem Leben<br />
ohne Hitler, ohne den Nationalsozialismus, ohne das deutsche Gas entsprechen könnte.<br />
Insofern läuft der jahrzehntelange Disput über die sogenannte Wiedergutmachung im<br />
Widerspruch zu zahlreichen Veröffentlichungen auf eine einfache Tatsache hinaus: Es kann<br />
keine Wiedergutmachung für die Verbrechen des Dritten Reiches geben, genausowenig<br />
wie die Vertreibung der Juden aus Spanien vor fünfhundert Jahren, die das Schicksal der<br />
europäischen Judenheit für lange Jahrhunderte prägte, irgendwie durch nachträgliche Maßnahmen<br />
gelindert oder rückgängig gemacht werden könnte.<br />
Die Einzigartigkeit der Verbrechen Nazi-Deutschlands an den Juden Europas entzieht<br />
sich den vereinfachenden Kategorien juristischen Denkens. Ich möchte daher nicht den in<br />
der Bundesrepublik üblichen Aufzählungen, wieviel D-Mark denn nun schon seit 1952 an<br />
die Juden und den Staat Israel gezahlt worden seien, folgen oder den in Österreich<br />
üblichen Zahlenreihen, wieviel Rückstellungsanträgen denn nun entsprochen worden sei.<br />
Rückerstattung, Rückstellung und Entschädigungen sind nach 1945 in der Bundesrepublik<br />
Deutschland und in Österreich nur zum Teil und nur gegen große Widerstände erfolgt.<br />
Angesichts der historischen Dimensionen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik<br />
kann es hier bis heute nur materielle Annäherungen geben, und die Peinlichkeit von Argumentationsweisen,<br />
die Verfolgung, Raub und Massenmord mit Geldsummen aufrechnen,<br />
möchte ich dahingestellt sein lassen. Worum es mir geht, ist die Frage, warum es weder in<br />
der politischen Kultur Deutschlands noch der Österreichs nach 1945 etwas gegeben hat,<br />
was man über materielle Leistungen hinaus als umfassende Rehabilitierung der Juden<br />
bezeichnen kann.<br />
Betrachten wir zunächst Überlegungen, wie sie im Hinblick auf diesen Problemkomplex<br />
von jüdischer Seite seit Beginn der antijüdischen Politik des Dritten Reiches angestellt wurden.<br />
Daran anschließend möchte ich dann in zwei weiteren Punkten die konkrete Politik<br />
der Rückstellung/-erstattung und der Wiedergutmachung nach 1945 sowie die „Kehrseite<br />
der Wiedergutmachung“, die negativen individuellen Folgen für viele der Betroffenen, skizzieren.<br />
Dabei soll das Schwergewicht nicht auf den an Zahl zunehmenden Veröffentlichungen<br />
liegen, die mitunter minutiös den politischen, rechtlichen und diplomatischen Entscheidungsprozeß<br />
darstellen, der in der Bundesrepublik Deutschland im Unterschied zu Österreich<br />
bereits seit 1952 zu den sogenannten Wiedergutmachungsleistungen führte. Es ist oftmals<br />
ein Problem solcher entscheidungsorientierter Studien, daß sie weder die Konzeption<br />
der Wiedergutmachung in Frage stellen noch die politisch-kulturellen Bedingungen des Umgangs<br />
der Nachkriegsdeutschen und Nachkriegsösterreicher mit jüdischer Vergangenheit<br />
und Gegenwart berücksichtigen. 1<br />
Umfassende Rehabilitierung oder materielle Leistungen<br />
Fragen der Reparationen, der Rückstellung/-erstattung, der Wiedergutmachung waren von<br />
jüdischer Seite bereits vor 1939 Gegenstand von Überlegungen und wurden auf Treffen<br />
jüdischer Repräsentanten in den Kriegsjahren zunehmend thematisiert. 1943 publizierte<br />
Siegfried Moses, der 1949 der erste Staatskontrolleur (Ombudsmann) Israels wurde, eine<br />
Schrift unter dem Titel „Die Wiedergutmachungsforderungen der Juden“, in der er die politische<br />
Arbeit zur Einflußnahme auf die Gestaltung der Entschädigungsregelung als vordringlich<br />
bezeichnete. 2 Im Unterschied zu allen bekannten Formen von Wiedergutmachung<br />
handle es sich, so Siegfried Moses, um eine grundlegend neue Frage, die aus dem Charakter<br />
des Nationalsozialismus und daraus resultiere, daß es „ein Krieg der Demokratie gegen<br />
den Faschismus“ sei. 3<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
113
Das „Londoner<br />
Abkommen“ 1943<br />
„Wiedergutmachung“<br />
als<br />
Prüfstein für die<br />
Demokratisierung<br />
Wiedergutmachung – Ein Vergleich<br />
Die Alliierten und auch zahlreiche Exilregierungen beschäftigten sich mit der Frage des<br />
organisierten deutschen Raubzuges durch Europa. Rückerstattungen, Reparationen und Entschädigungen<br />
wurden in einem internationalen Abkommen Anfang 1943 in London zum<br />
Gegenstand gemacht und begleiteten die Zerschlagung des Nationalsozialismus und die<br />
Gestaltung der europäischen Nachkriegsordnung. Führende jüdische Persönlichkeiten<br />
brachten im internationalen Rahmen das jüdische Interesse an Rückstellung/-erstattung und<br />
Reparationen zum Ausdruck. In öffentlichen Aktivitäten und Kontakten zu alliierten und<br />
deutschen Organen der sich herausbildenden jüdischen Gemeinden und Organisationen<br />
war diese Frage ab 1945 ein ständiges, mit Vehemenz und Selbstverständlichkeit vorgetragenes<br />
Thema innerhalb der besetzten Reste des Dritten Reiches. Die deutschen und österreichischen<br />
Verwaltungsstellen sowie die Militärregierungen waren somit von Anfang an<br />
mit diesen Forderungen konfrontiert. Unterschiedliche Verordnungen und Gesetze wurden<br />
in den einzelnen Besatzungszonen erlassen, am weitestgehenden 1949 in der amerikanischen<br />
Zone in Deutschland, insgesamt aber ohne den berechtigten Forderungen der Juden<br />
in ausreichender Weise zu entsprechen. 4<br />
Typischerweise wurden diese Gesetze, auch auf Bundesebene, in den folgenden Jahrzehnten<br />
ständig verändert, tausende Verfolgte fielen immer wieder durch die Maschen<br />
dieser gesetzlichen Regelungen. In Österreich gab es noch zusätzliche Widerstände, da<br />
„gerade die zahlreichen Rückstellungen von österreichischen ➤ ‚Ariseuren‘ an ehemalige<br />
österreichische Juden die These der Opferrolle auf geradezu frappierende Weise widerlegen“<br />
mußten. 5 In den Nationalratsdebatten zum Rückstellungsgesetz war denn auch eher<br />
zu vernehmen, daß Österreich nichts gutzumachen habe, ja daß im Gegenteil an Österreich<br />
viel gutzumachen sei. Argumentationen, die in Deutschland vornehmlich aus dem<br />
nationalistisch-rechtsextremen Lager kamen, schienen in Österreich öffentlich konsensfähig. 6<br />
Im Oktober 1946 erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel mit dem Titel „Wo<br />
bleibt die Wiedergutmachung?“, in dem es unter anderem hieß:<br />
„Man sollte annehmen, daß die Wiedergutmachung an den von den Nazis seit 1933<br />
verfolgten Juden als eine der vordringlichsten inneren Pflichten jedes einzelnen Deutschen<br />
betrachtet wird. Leider aber ist es noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden, daß die<br />
Opfer des politischen und gleichzeitig auch wirtschaftlichen Terrors der Jahre 1933-1945<br />
entschädigt werden. (...) Für dieses Leid kann es eigentlich keine Wiedergutmachung<br />
geben. Aber selbst das Erreichbare, das Menschenmögliche – es wird unterlassen (...). Was<br />
aber niemals durch Beschlüsse der Staatsautorität allein erbracht werden kann, auch nicht<br />
durch ein Wiedergutmachungsgesetz, ist die psychologische Bereitwilligkeit des deutschen<br />
Durchschnittsmenschen zur Wiedergutmachung, in seinem Rahmen. Aber das Gefühl für<br />
die Pflicht zur Wiedergutmachung ist noch nicht geboren. (...) Hier mangelt es am sittlichen<br />
Gefühl, an dem aus dem Inneren kommenden Rechtsbewußtsein, zu sehr ist das Recht in<br />
den Jahren der Hitlerdiktatur gebeugt worden. Die Frage der Wiedergutmachung an den<br />
Juden wird zu einem tieferen deutschen Problem, nämlich, ob Deutschland wieder zu einem<br />
Rechtsstaat wird. (...) Deutschland bemüht sich, das Vertrauen der Welt wiederzugewinnen.<br />
Seine Bestrebungen zum wirtschaftlichen Neuaufbau nach einem totalen Zusammenbruch<br />
finden die Achtung der Umwelt. Wenn dieses zurückkehrende Vertrauen und die allmählich<br />
wiedergewonnene Achtung nicht beeinträchtigt, sondern zur Sympathie erhoben werden<br />
sollen, dann muß auch der Frage der Wiedergutmachung an den Juden viel größeres<br />
Augenmerk zugewendet werden als bisher. Nicht mit Unrecht darf man dieses Problem als<br />
den Prüfstein der deutschen Demokratie bezeichnen.“ 7<br />
Gegenüber allem späteren Verständnis von materieller Entschädigung und Wiedergutmachung<br />
ist die hier formulierte Position umfassender und grundsätzlicher. Der Inhalt<br />
dessen, was bis heute als Wiedergutmachung verstanden wird, ist nicht mit dem ursprünglich<br />
damit verbundenen Inhalt auf jüdischer Seite identisch. Wiedergutmachung war eine<br />
ethische, moralische, rechtliche, politische und materielle Forderung, die primär die umfassende<br />
Rehabilitierung der Juden in Deutschland zum Inhalt hatte. Die Wiedergutmachung,<br />
so verstanden, war von einer notwendigen grundlegenden Entnazifizierung und<br />
114 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Demokratisierung nicht zu trennen. Der ökonomische „Zeitgeist“, der bereits 1946 spürbar<br />
war, reduzierte diesen Kontext in den Jahren nach der Gründung der Bundesrepublik auf<br />
die materielle Seite zur moralischen Absicherung nicht etwa einer Rehabilitierung der<br />
Juden, sondern ganz im Gegenteil zur außenpolitischen Rehabilitierung der Deutschen,<br />
was ja ebenfalls in dem zitierten Artikel angeklungen war. Der Begriff Wiedergutmachung<br />
bezog sich in der deutschen Diskussion schnell auf eine außenpolitische Dimension, indem<br />
er materielle Leistungen an den Staat Israel einbezog und diese materielle Leistung mit<br />
einem Deutschland zu erteilenden moralischen Kredit verband.<br />
Dies war in Österreich so nicht der Fall. Im Nachkriegs-Österreich ging es um die „unmittelbare<br />
Abgeltung vermögenswerter Schäden aus der NS-Zeit, wie Rückgabe arisierten<br />
Eigentums, Abgeltung von Verdienst und ähnlichem“. 8 Daß hierbei außerordentlich restriktiv<br />
verfahren wurde, ja die Rückstellung faktisch immer weiter zurückgedrängt wurde, lag nicht<br />
zuletzt daran, daß die ersten ➤ Opferfürsorgegesetze von 1945 und 1947 Opfer des vornationalsozialistischen<br />
➤ Ständestaates und des Nationalsozialismus gleichsetzten, die besondere<br />
Rolle der antijüdischen Maßnahmen verkannten und eine besondere Verpflichtung<br />
gegenüber den Juden negierten. Im Herbst 1945 beklagten sich Wiener Juden, „daß sie<br />
als ➤ Displaced Persons in Wien leben mußten, während ihre eigenen Häuser und Wohnungen<br />
immer noch von Nazis bewohnt würden“. 9 Die österreichische Gesetzgebung bewegte<br />
sich insgesamt bis 1961 auf der Ebene der Entschädigungsgesetze der Bundesrepublik<br />
Deutschland. 10 Eine Mitschuld des österreichischen Volkes, aus der sich eine Pflicht zur<br />
Wiedergutmachung ergeben hätte, wurde definitiv abgelehnt. 11 Robert Knight faßt dies<br />
pointiert zusammen, wenn er betont: „Eine Bereitschaft, Wiedergutmachung zu zahlen, hätte<br />
die ‚Opferthese‘ des österreichischen Staates unterminiert.“ 12 Antisemitische Kontinuitäten,<br />
überwiegende Ablehnung der Rückerstattung jüdischen Eigentums und jüdischer Forderungen<br />
bei gleichzeitiger Verstaatlichung – wie es hieß – „herrenlosen Vermögens“ sowie die<br />
sich verändernden internationalen Konstellationen paarten sich mit innenpolitischem Druck.<br />
Bei den verschiedenen Gesetzen wurden nur allzuoft die Ariseure bevorzugt, wurde in den<br />
Debatten nicht selten die „relative Anständigkeit“ der österreichischen Nutznießer jüdischen<br />
Eigentums betont. 13 Von einer weiterzufassenden Wiedergutmachungs-Konzeption war hier<br />
überhaupt nicht die Rede. Diesen Bedeutungsunterschied gilt es, zunächst zu beachten.<br />
Rehabilitierung von Deutschland/Österreich und die Verschleppung kollektiver und<br />
individueller Entschädigung<br />
Der außenpolitische Berater und Vertraute Adenauers, Herbert Blankenhorn, berichtet, daß<br />
im Oktober/November 1949 Gespräche mit dem Kanzler stattgefunden hätten, „in<br />
welcher Weise es möglich sein würde, das Verhältnis des deutschen Volkes zum jüdischen<br />
Volk und zum Staat Israel auf eine neue Grundlage zu stellen“. 14 Blankenhorn betont, „daß<br />
der neue deutsche Staat in der Welt Vertrauen, Ansehen und Glaubwürdigkeit nur wiedergewinnen<br />
werde, wenn die Bundesregierung und das Bundesparlament (...) sich von der<br />
Vergangenheit distanziert und durch eine eindrucksvolle materielle Wiedergutmachungsleistung<br />
dazu beiträgt, das unglaubliche Ausmaß an erlittener materieller Not zu erleichtern.<br />
(...) Ein solcher Akt echter Wiedergutmachung sollte zur Überwindung der unvorstellbaren<br />
Bitternis dienen, die das nationalsozialistische Verbrechen bei den Juden in aller Welt und<br />
auch bei allen Gutgesinnten hervorgerufen hat. Er sollte ferner auch den Sinn haben, dem<br />
deutschen Volk die Furchtbarkeit der Vergangenheit und die Notwendigkeit einer radikalen<br />
Umkehr bewußt zu machen.“ 15<br />
Das Motiv materiellen Abgeltens der Verbrechen des Dritten Reiches ist mehr als deutlich.<br />
Zugleich konnte der Beraterstab des Bundeskanzlers hier bewußt an die Nöte des jungen<br />
israelischen Staates anknüpfen, der vor schwierigen ökonomischen und sicherheitspolitischen<br />
Problemen stand und an schnellen materiellen Hilfeleistungen interessiert war. Allerdings dauerte<br />
es zwei Jahre, bis zum September 1951, bis der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland<br />
diesen Willensakt vollzog. Nun könnte man sagen, daß es für die junge Republik<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
115<br />
Frank Stern
Erste Verhandlungen<br />
zwischen<br />
der BRD und<br />
Israel 1951 –<br />
„Globalentschädigung“<br />
Wiedergutmachung – Ein Vergleich<br />
zwischen November 1949 und September 1951 Wichtigeres gab als die Wiedergutmachung,<br />
daß der ökonomische und politische Aufstieg seine ersten Früchte bringen mußte, daß<br />
kein relevanter Druck in dieser Frage gegeben oder daß in der Bevölkerung keine ausreichende<br />
Basis für umfangreiche Wiedergutmachungsleistungen vorhanden war. Doch eine derartige<br />
Basis war auch 1951, während der Wiedergutmachungs-Verhandlungen, oder zum Zeitpunkt<br />
der Ratifizierung des ➤ Luxemburg-Abkommens 1952 nicht vorhanden. Wie ist also die<br />
zeitliche Verzögerung zwischen Adenauers allgemeiner Bereitschaftserklärung und der politischen<br />
Umsetzung zu erklären, will man nicht einzig und allein das Zögern der israelischen Regierung,<br />
in Verhandlungen mit der deutschen Regierung zu treten, als Grund anführen.<br />
Der erste Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, Hendrik van Dam,<br />
übermittelte im Sommer 1950 der israelischen Regierung ein Gutachten zum „Problem der<br />
Reparationen und Wiedergutmachung für Israel“, das zwar in der Folgezeit keine wichtige<br />
Rolle spielte, aber zentrale Aspekte der deutschen Situation und der zeitlichen Verzögerung<br />
charakterisierte:<br />
„Die ‚Wiedergutmachung‘ – bevor sie zu einem schwierigen Problem des Rechtes wird – ist<br />
ein Problem der Moral und der Politik. Das gilt für beide Teile, das deutsche Volk und das<br />
jüdische Volk. (...) Die Erkenntnis der moralischen Pflicht, die besonders in den ersten Jahren<br />
nach der Kapitulation empfunden wurde, besteht auch heute noch bei einer Anzahl maßgebender<br />
Deutscher. Jedoch wird die Neigung, hieraus Konsequenzen zu ziehen – vor allem<br />
durch die Schaffung der notwendigen Gesetzgebung –, schwächer und schwächer. Die Zeit<br />
arbeitet gegen die Wiedergutmachung, wie gegen die Verfolgung der Menschlichkeitsverbrecher<br />
und der Denazifizierung. Das in politische Handlung umzusetzende Gefühl der moralischen<br />
Verpflichtung erlahmt, wie auch die Besorgnis vor einer Kritik der Besatzungsmächte.<br />
Es bleiben im wesentlichen die realistischen Gedankengänge politischer und wirtschaftlicher<br />
Zweckmäßigkeit. (...) Der von politischen und wirtschaftlichen Motiven diktierte Wunsch, zu<br />
einer Bereinigung des Wiedergutmachungskomplexes zu kommen, die unliebsame Nazi-<br />
Erbschaft abzuschütteln, wird noch für eine beschränkte Zeitdauer eine Rolle spielen.“ 16<br />
Van Dam hob hervor, daß im Rahmen der politischen Entwicklung das Werben um die Deutschen,<br />
die zunehmende Übertragung von Funktionen an die Bundesrepublik und die Ablehnung<br />
jeglicher Einmischung von außen durch die Deutschen die Verhandlungsposition von Verfolgtenorganisationen<br />
schwächten. Die Ost-West-Konfrontation wurde in allen Fragen der Politik<br />
spürbar, in der Haltung gegenüber Deutschland vollzog sich ein Bedeutungswandel. Dennoch<br />
bestand die amerikanische Seite auf den moralischen Implikationen. Van Dam betonte:<br />
„Bei aller Würdigung der Konsequenzen der Politik der Westmächte gegenüber Deutschland<br />
(...) besteht dennoch ein Interesse der Vereinigten Staaten an der Durchführung der<br />
Wiedergutmachung, wie das auch vom ➤ Hohen Kommissar John McCloy wiederholt erwähnt<br />
wurde. Ferner ist ein gewisses Alibi der amerikanischen Politik für das Aufgeben der<br />
Denazifizierung und die Kollaborierung erwünscht. Ein derartiges Gegengewicht könnte<br />
die Wiedergutmachung, insbesondere aber die Reparationsleistung für Israel sein.“ 17<br />
Van Dam bezog sich auf wiederholte Äußerungen von McCloy, der 1950 die Wiedergutmachung<br />
als Prüfstein der Demokratie bezeichnet hatte. Ohne den amerikanischen Druck<br />
auf die deutsche Bundesregierung würde es wahrscheinlich eine im materiellen Sinne letztendlich<br />
positive Entscheidung nicht gegeben haben. Einen derartig relevanten Druck hat es<br />
von seiten der US-Behörden auf die österreichische Regierung nicht gegeben, obwohl der<br />
US-Hochkommissar in Österreich, Geoffrey Keyes, mehrfach in Briefen an Bundeskanzler<br />
➤ Leopold Figl das Problem der Rückerstattung und materiellen Absicherung der überlebenden<br />
Juden angesprochen hatte. In Zusammenhang mit dem Versuch der österreichischen<br />
Regierung, ein sogenanntes „Härteausgleichsgesetz“ zugunsten der Ariseure zu verabschieden,<br />
schrieb Keyes am 1. September 1950 u. a., daß die geplante Maßnahme „begründete<br />
Zweifel aufwirft, ob Ihre [die österreichische] Regierung sich der internationalen<br />
Reaktion bewußt ist, die durch solche Handlungen geschaffen wird. Sollten Sie sich dessen<br />
bewußt sein, so muß angenommen werden, daß Ihre Regierung an der Berichtigung der<br />
nationalsozialistischen Ungerechtigkeiten nicht mehr interessiert ist und nunmehr beabsichtigt,<br />
116 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
einiges von der guten Arbeit, die sie seit 1945 geschaffen hat, rückgängig zu machen.“ 18<br />
Daraufhin wurde der Gesetzesentwurf fallengelassen, eine umfassende Regelung kam<br />
dennoch nicht zustande. Erst mit dem ➤ Staatsvertrag 1955 wurde teilweise den individuellen<br />
Ansprüchen der Überlebenden und ihrer Kinder entsprochen. Man mag es als eine Spätwirkung<br />
des Anschlusses bezeichnen, daß nach einem völlig unzureichenden Beginn in Form<br />
eines Hilfsfonds umfassendere Zahlungen an einzelne Personen erst erfolgten, nachdem die<br />
Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Abkommens von Bad ➤ Kreuznach von<br />
1961 größere Summen in einen österreichischen „Wiedergutmachungstopf“ zu zahlen begann.<br />
Eine globale Regelung, die den Staat Israel miteingeschlossen hätte, gab es auch<br />
dann nicht. Der außenpolitische Druck, insbesondere von amerikanischer Seite, entsprach<br />
nicht dem auf die Bundesrepublik Deutschland, die sich der Wiedergutmachung als eines<br />
Instruments der Westintegration zu bedienen wußte. Abgesehen davon war Österreich<br />
auch nicht im selben Ausmaß wie die junge Bundesrepublik Deutschland in der Konfrontation<br />
mit dem Kommunismus als wichtiger europäischer Junior-Partner vorgesehen. Die USA<br />
und auch England und Frankreich machten sich für eine österreichische Wiedergutmachungsleistung<br />
unter anderem deshalb nicht stark, weil sie ein stabiles Österreich wollten,<br />
und die Sowjetunion ihrerseits war mehr an einem neutralen Österreich interessiert. 19<br />
Im Juni 1950 war der Korea-Krieg ausgebrochen, die Konfrontation zwischen Ost und<br />
West hatte sich verschärft. Adenauer, einen möglichen deutschen Militärbeitrag vor Augen,<br />
drängte in einem Aide-Mémoire an die Hohen Kommissare auf eine „Revision des Besatzungsstatuts“.<br />
20 Letztendlich ging es der Bundesregierung um die Überwindung des Potsdamer<br />
Abkommens und zunehmend um die Rehabilitierung für die durch die Entnazifizierung<br />
betroffenen Deutschen. Souveränität durch Westintegration und Wiederbewaffnung, was<br />
die Rehabilitierung der Wehrmacht einschloß, waren Kernpunkte sowohl des sich entwickelnden<br />
Nationalbewußtseins als auch der offiziellen Regierungspolitik.<br />
Zum Hintergrund des Problems der Wiedergutmachung gehört neben der außenpolitischen<br />
Dimension ebenso die innenpolitische Dynamik der Jahre 1948 bis 1952. Soziale<br />
Unsicherheit und über 1,5 Millionen Arbeitslose beschäftigten die Öffentlichkeit. ➤ Marshall-<br />
Plan und Umerziehung zur Demokratie bildeten eine merkwürdige Synthese im öffentlichen<br />
Bewußtsein. Weder in Deutschland noch in Österreich gehörte eine „jüdische Frage“ zu<br />
den zentralen Themen der Tagespolitik. In der Österreich-Politik der westlichen Alliierten<br />
herrschte spätestens seit 1946 die „Fiktion, daß alle Österreicher unschuldig waren“. 21 Und<br />
was konnte mithin von einem „Opfer Hitlers“ als Wiedergutmachung erwartet werden?<br />
Antisemitische Kontinuitäten und weit verbreitete Aversionen gegen die jüdischen Displaced<br />
Persons bestimmten die privaten und halb-öffentlichen Diskurse mehr als das von manchen<br />
Politikern – wobei dies in Deutschland eher der Fall war – zur Schau getragene schlechte<br />
Gewissen. Die materiellen Nöte waren bestimmend, nicht die Notwendigkeit, die ➤ Arisierung<br />
im Rahmen eines Programms umfassender Demokratisierung rückgängig zu machen<br />
oder gar globale Wiedergutmachung zu leisten.<br />
Ralf Dahrendorf sprach im Rückblick von der damit zusammenhängenden „Ökonomisierung<br />
der verhaltensleitenden Wertvorstellungen durch die ganze deutsche Gesellschaft“. 22<br />
McCloy bemerkte für die Monate nach der Gründung der Bundesrepublik 1949, daß die<br />
Bemühungen um eine Neuorientierung der Bevölkerung auf einige Schwierigkeiten, ja sogar<br />
Widerstand stießen. In Westdeutschland, so McCloy, wären Nationalismus und nationalistische<br />
Gruppen aktiver geworden als zur Zeit der Kontrolle durch die Militärregierung.<br />
In einer Rede in Washington, Januar 1950, summierte McCloy unter den wichtigsten Aufgaben<br />
amerikanischer Politik in Deutschland, darauf zu bestehen, „daß die Opfer Hitlers<br />
oder deren Erben gerecht und vorurteilslos behandelt werden“. Im Februar kam er in einer<br />
Rede in Stuttgart ausführlich auf diesen Punkt zu sprechen und betonte, daß das Unrecht an<br />
den Verfolgten „mit aller Gerechtigkeit anerkannt und vorbehaltlos in Ordnung gebracht<br />
werden“ müsse. 23 Dem entsprach auch die Haltung des US-Hochkommissars in Österreich.<br />
Zugleich ergaben Umfragen durch die amerikanische Hochkommission (HICOG) einige<br />
neue Fakten hinsichtlich vorhandener Vorurteile und nationalistischer Tendenzen. Betrachtet<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
117<br />
Frank Stern<br />
Ost-West-Konflikt<br />
Demokratisierung<br />
oder<br />
„Normalisierung“?
„Wiedergutmachung“<br />
an den<br />
ehemaligen<br />
Nationalsozialisten<br />
Ende des<br />
Besatzungsstatuts<br />
Wiedergutmachung – Ein Vergleich<br />
man einige der Umfrageergebnisse, so präsentiert sich folgendes Bild der öffentlichen<br />
Meinung in hiermit zusammenhängenden Fragen im Übergang zu den fünfziger Jahren:<br />
44 Prozent hielten einige Rassen für mehr geeignet zum Regieren als andere. 34 Prozent<br />
hielten einige Rassen für minderwertiger als andere. 28 Prozent meinten, daß ein Jude,<br />
dessen Eltern und Großeltern in Deutschland geboren und aufgewachsen waren, kein richtiger<br />
Deutscher sei. Die meisten Befragten, die eine deutsche Nationalität für Juden der<br />
dritten Generation ablehnten, waren unter dreißig, Flüchtlinge und Vertriebene, unregelmäßige<br />
Kirchgänger der katholischen und der protestantischen Konfession und hatten niedriges<br />
<strong>Bildung</strong>sniveau sowie geringen sozialen Status. 24<br />
Derartige Umfrageergebnisse stellten mithin eine eindrucksvolle Bestätigung der nach<br />
1949 zunächst vorhandenen Vermeidungsstrategie Adenauers und der österreichischen<br />
Regierung dar, nämlich das Thema Juden nicht zu einem innenpolitischen Topos zu machen,<br />
die Diskussion darüber eben eher „in die Länge zu ziehen“.<br />
Im Dezember 1950 erließ der Bundestag Richtlinien zum Abschluß der Entnazifizierung,<br />
in denen es hieß: „Die Beendigung der Entnazifizierung soll die Periode der schematischen<br />
Bewertung ganzer Personengruppen wegen ihrer Zugehörigkeit zu Organisationen oder<br />
Einrichtungen der nationalsozialistischen Herrschaft abschließen.“ 25<br />
Am 11. Mai 1951 beschloß der Bundestag das 131er Gesetz. Ca. 150.000 Beamte<br />
und Angestellte, ehemalige Wehrmachts- und Arbeitsdienstangehörige erhielten ihre vollen<br />
Versorgungsansprüche zurück und konnten erneut in den Staatsdienst eintreten. Bereits vorher<br />
war eine Lastenausgleichsregelung für die ca. 13 Millionen Vertriebenen beschlossen<br />
worden. Im Juni berichtete Die Welt von einem „Wettrennen um die Beendigung der Entnazifizierung“,<br />
26 in dem es um die Wiedereinsetzung von Beamten ging. Entnazifizierungsakten<br />
wurden symbolisch verbrannt, das große Aufatmen begann. In Österreich wiederum<br />
hatte man sich schon längst nonchalant von den alliierten Entnazifizierungsbestrebungen<br />
verabschiedet. Bereits 1948 waren die „minderbelasteten“ Nazis amnestiert worden. 27<br />
Lediglich die sowjetischen Besatzungsbehörden zeigten sich hier anfänglich hartnäckiger.<br />
Aber wie in Deutschland konnte man ja schlicht die Zone wechseln. Bei den Wahlen<br />
1948/49 in Westdeutschland und in Österreich ging es allen Parteien um die Stimmen der<br />
Ehemaligen. Die Entnazifizierung war definitiv gescheitert, die Integration der vormaligen<br />
Nazis in die beiden politischen Kulturen in vollem Gange. Kritik daran wurde zwar<br />
geäußert, blieb letztlich aber wirkungslos. Derartige Entwicklungen beschäftigten die internationale<br />
Presse, beeinflußten Publikationen und Diskussionen zur Frage der Wiedergutmachung,<br />
bestimmend war jedoch längst die Ost-West-Konfrontation geworden. Die ➤ Containment-Politik<br />
entpuppte sich letztlich auch als eine Politik des Containment der Entnazifizierung<br />
und in Österreich ebenfalls der Wiedergutmachung.<br />
Im März 1951 hatte die israelische Regierung in einer Note an die vier Siegermächte<br />
Wiedergutmachungs-Forderungen formuliert.<br />
Nach langem Zaudern erfolgte dann endlich die vielzitierte Erklärung des deutschen<br />
Bundeskanzlers vom 27. September 1951, in der er Verhandlungen mit Israel anbot. Zuvor<br />
hatten die Außenminister der drei Westmächte in Washington beschlossen, daß das Besatzungsstatut<br />
durch einen Generalvertrag abgelöst werden sollte, der parallel mit einem<br />
Vertrag über einen deutschen Verteidigungsbeitrag in Kraft treten sollte. Wenige Tage nach<br />
der Erklärung über die Bereitschaft zur Wiedergutmachung begannen die Verhandlungen<br />
zwischen Bundeskanzler und Hohen Kommissaren über das Ende des Besatzungsstatuts.<br />
Werfen wir einen Blick auf die Erklärung des deutschen Bundeskanzlers vom September<br />
1951. Sie liest sich in all ihrer Kühle und Nichtbetroffenheit wie eine Pflichtübung, eine Reaktion<br />
auf die außenpolitischen Erfordernisse, da – so Adenauer – in der „Weltöffentlichkeit“<br />
„Zweifel laut geworden“ seien, ob die Bundesrepublik „das Verhältnis der Juden zum deutschen<br />
Volke auf eine neue und gesunde Grundlage stellen“ wolle. Nicht etwa ein Schuldoder<br />
Verantwortungsbewußtsein, antisemitische Vorkommnisse und nationalistische Tendenzen<br />
bildeten den Auftakt der Erklärung, sondern außenpolitische Erwägungen. Adenauer<br />
zitierte als positiven Beleg für die „Einstellung der Bundesrepublik zu ihren jüdischen Staats-<br />
118 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
ürgern“ den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, nach dem jeder, „insbesondere jeder<br />
Staatsbeamte“, „jede Form rassischer Diskriminierung von sich zu weisen“ habe. Daß<br />
gerade zahlreiche ehemalige DPs staatenlos, mithin nicht Staatsbürger waren, blieb in allen<br />
späteren Würdigungen dieser Rede unbeachtet. Adenauer erklärte für die Bundesregierung<br />
die Bereitschaft, mit „Vertretern des Judentums und des Staates Israel (...) eine Lösung des<br />
materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen“. 28 Die Aussagen dieser Erklärung<br />
blieben relativ allgemein, dienten mehr der Exkulpierung der überwiegenden Mehrheit des<br />
deutschen Volkes als dem konkreten Bekenntnis einer Schuld oder Verantwortung. Vom Völkermord<br />
und seinen Folgen kein Wort, die begangenen Verbrechen haben kein Subjekt, sind<br />
allenfalls im Namen des deutschen Volkes begangen worden. Fehlende individuell Berechtigte<br />
auf der einen Seite, Kriegsopfer, Flüchtlinge, Vertriebene auf der anderen Seite. Derartige<br />
Redeformen wird man in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik finden. Liest man dagegen<br />
in den Bundestagsdebatten dieser Monate die außerordentlich konkreten Benennungen,<br />
wer welche Deutschen wo vertrieben hatte, wie es Flüchtlingen ging, vor allem aber<br />
welch grausames Schicksal die deutschen Kriegsgefangenen erlitten, so wird der distanzierte<br />
Charakter dieser Erklärung noch deutlicher. Diese Haltung deckte sich letztlich auch mit der<br />
politischen und emotionalen Distanz in den Aussagen österreichischer Politiker.<br />
So wie in der Phase unmittelbar nach dem Mai 1945 unter der Oberhoheit der Besatzungsmacht<br />
das Verhältnis von Deutschen und Juden und der Kampf gegen den Antisemitismus<br />
der Eingriffe von ➤ OMGUS bedurfte, existierte jetzt zwei Jahre nach der Gründung<br />
der Bundesrepublik und sechs Monate nach der Note der Regierung des Staates Israel über<br />
die Wiedergutmachung eine Art Moratorium zwischen Wiedergutmachungsfrage und<br />
Souveränität durch Westintegration.<br />
Eine analoge Entwicklung für Österreich ist nicht zu verzeichnen. Die Konzeption von<br />
Österreich als „erstes Opfer Hitlers“, der Konsens über Österreichs Neutralität und die Verhandlungen<br />
über den Staatsvertrag verschoben einen wie auch immer formulierten Anspruch<br />
der überlebenden Juden auf Rehabilitierung oder des Staates Israel auf Rückstellung/-erstattung<br />
und Wiedergutmachung in den Bereich der Bedeutungslosigkeit. Das<br />
österreichische schlechte Gewissen bedurfte keiner materiellen Tilgung, es war schlicht nicht<br />
vorhanden, da es politisch nicht erforderlich war. Als Antwort auf Forderungen internationaler<br />
jüdischer Organisationen nach dem Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland<br />
an Österreich antwortete die österreichische Regierung, Österreich sei als von Deutschen<br />
besetztes Land staatsrechtlich nicht zu Leistungen verpflichtet und trage auch keine moralische<br />
Verantwortung, da die Verbrechen an den Juden von den Deutschen ausgegangen<br />
seien. 29 Erst nach einigem Druck von seiten des State Department in Washington und des<br />
Foreign Office in London war die österreichische Regierung überhaupt zu Verhandlungen<br />
bereit. 30 Ein ➤ Committee for Jewish Claims on Austria wurde gegründet, aber Israel entzog<br />
sich 1952 diesen Verhandlungen mit der voreiligen Erklärung, es habe keine Forderungen<br />
gegenüber Österreich, und folgte damit der Politik der westlichen Alliierten. 31 Die Erwägungen<br />
in Washington hinsichtlich der perspektivischen Stellung Österreichs in der damit<br />
verbundenen Stabilität des Staates hatten sich durchgesetzt. Die These von „Österreich als<br />
erstem Opfer“ war international in diesem Fall bestimmender als der berechtigte Anspruch,<br />
den die Regierung des Staates Israel hätte geltend machen können. Zudem wollte die israelische<br />
Regierung offensichtlich nicht Probleme mit dem ökonomisch viel potenteren Vertragspartner<br />
Bundesrepublik schaffen, der ja mit dem Abkommen gerade eine generelle Verantwortung<br />
übernommen hatte. Dies alles schwächte die Position des Claims Committee.<br />
Nahum Goldmann berichtet, daß Bundeskanzler ➤ Julius Raab beim ersten Treffen mit Vertretern<br />
des Claims Committee schlicht feststellte, daß „sich die Juden und Österreich in der<br />
gleichen Lage befänden, beide seien Opfer des Nazismus“. 32<br />
Die Verhandlungen zogen sich zäh in die Länge, die Vorstellungen der österreichischen<br />
Regierung widersprachen den Forderungen des Claims Committee, 1956 wurde endlich<br />
ein Hilfsfonds zur Hilfeleistung für politisch Verfolgte, die im Ausland ihren Wohnsitz hatten,<br />
eingerichtet. Im Juni 1959 kündigte Österreich in einem Schreiben an England, Frankreich<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
119<br />
Frank Stern<br />
Die österreichische<br />
Opferthese und<br />
die Verhandlungen<br />
mit dem Claims<br />
Committee
„Wiedergutmachung“<br />
und<br />
Westintegration<br />
Wiedergutmachung – Ein Vergleich<br />
und die USA die Einrichtung eines Fonds für Opfer des Nazi-Regimes an, die aus religiösen<br />
oder rassischen Gründen verfolgt worden waren. Allerdings verabschiedete der Nationalrat<br />
kein entsprechendes Budget. 33 Erst 1961, als die Bundesrepublik Deutschland finanziell<br />
zu Hilfe eilte, erfolgte dies. Zahlungen an Israel hat es jedoch nicht gegeben.<br />
Die DDR als zweiter Nachfolgestaat des Dritten Reiches wiederum entzog sich nach anfänglichen,<br />
aber unzureichenden Angeboten jeglicher Verpflichtung einer Wiedergutmachung<br />
und beschränkte sich auf höhere Pensionen und individuelle Sonderleistungen für die<br />
Opfer des Faschismus. Auf die Forderungen Israels von 1951 hat die DDR nie reagiert. 34<br />
Vormals arisiertes Vermögen wurde im Rahmen der sozialistischen Gesellschaftspolitik verstaatlicht<br />
und bildet heute einen Kernpunkt der seit der Herstellung der Einheit Deutschlands<br />
neu aufbrechenden Wiedergutmachungsproblematik. Dabei geht es um das sogenannte<br />
dritte Drittel an Wiedergutmachung, das 1952 offen gelassen wurde.<br />
Am 10. September 1952 war das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland<br />
einerseits sowie dem Staat Israel und der ➤ Conference on Jewish Material Claims against<br />
Germany andererseits in Luxemburg unterzeichnet worden. 35 Die politische Funktion der<br />
„Vereinbarung mit dem Weltjudentum“ für Adenauer kommentiert dessen Biograph Hans-<br />
Peter Schwarz ironisch mit der Bemerkung: „Mit dem Heiligenschein des Wiedergutmachungsabkommens<br />
versehen, kann er sich im Frühjahr 1953 auf die ‚United States‘ begeben,<br />
um die erste Reise nach Amerika anzutreten.“ 36 Nach dem Selbstgefühl der Regierenden<br />
und auch der sozialdemokratischen Opposition hatte die Bundesrepublik die von US-<br />
Hochkommissar McCloy geforderte Feuerprobe bestanden. Die Wiedergutmachung und<br />
der Kalte Krieg ermöglichten die Westintegration.<br />
Für die Bundesrepublik Deutschland der fünfziger Jahre kann mithin als Motto der spätere<br />
ironische Titel eines Theaterstückes von Rolf Schneider gelten: „Wiedergutmachung oder<br />
Wie man einen verlorenen Krieg gewinnt.“ Nachsatz: Da Österreich ja keinen Krieg verloren<br />
zu haben scheint, benötigte es auch keine Wiedergutmachung zur Herstellung des<br />
internationalen moralischen Kredits. Das hier treffende Motto wurde vor einigen Jahren in<br />
einer ORF-Talkshow gegeben, als eine Beteiligte ausrief: „Wir sind alle unschuldige Täter.“ 37<br />
Spricht man im Rückblick über Wiedergutmachung und den Kontext materieller Leistungen<br />
gegenüber den Juden, so stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Wiedergutmachung<br />
in der Tat eine Abkehr von antisemitischen Traditionen und ein neues Verhältnis zu<br />
den Juden bedeutete, das auf einer unmißverständlichen Anerkennung der kollektiven<br />
Schuld und Verantwortung basierte. Anders gesagt, hatte sie im öffentlichen Bewußtsein<br />
der frühen fünfziger Jahre den Stellenwert, den sie Jahrzehnte später einzunehmen scheint?<br />
1951 führte HICOG eine Umfrage durch, mit der „German Opinions on Jewish Restitution<br />
and Some Associated Issues“ ermittelt wurden:<br />
„(...) a majority of the West German people disclaimed not only any general guilt for the<br />
misdeeds of the Third Reich, but also any general responsibility of the German citizenry for<br />
rectifying the wrongs that were committed in their name. (...) A large proportion of those who<br />
voiced support for Jewish aid (...) were revealed on attitude-test queries to possess distinctly<br />
unfavorable orientations toward the Jews. Taking the findings all together, the indication is<br />
inescapable that despite the two out of three who professed approval of Jewish restitution, the<br />
majority of West Germans appear to have the kind of adverse attitudes toward the Jews<br />
which either make them outright opponents of restitution, or if verbally approving, highly<br />
doubtful supporters of any measures that might be taken to actually implement such aid.“ 38<br />
Die Wiedergutmachungsdebatte war hinsichtlich der inneren Einstellung der Bevölkerung<br />
völlig konsequenzlos, bestätigte eher noch antisemitische Meinungen. Das wird durch die<br />
Antworten auf die auf S. 125 dargestellte Frage der HICOG-Umfrage aufschlußreich bestätigt.<br />
Weitere Umfrageergebnisse zeigten, daß die Zustimmung zur Unterstützung für Juden<br />
keine Garantie für fehlenden Antisemitismus war. Immer wieder stößt man bei der Auswertung<br />
solcher Umfragen, bei der Analyse von Reaktionen auf Juden betreffende Geschehnisse<br />
auf diesen Zusammenhang. Die pro-jüdischen und philosemitischen Erklärungen<br />
und Verhaltensweisen, soweit sie öffentlich sind, erfolgen oftmals über einer tieferen Schicht<br />
120 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
MEINUNGSUMFRAGE DES FEDERAL GOVERNMENT 39<br />
von Meinungen und Einstellungen, die ein Konglomerat von traditionellen und neuen antijüdischen<br />
oder antisemitischen Elementen darstellen. Das erklärt sowohl das Zögern der<br />
Bundesregierung zu Beginn ihrer ersten Legislaturperiode in dieser Grundfrage des westdeutschen<br />
Selbstverständnisses als auch die dann folgende Vehemenz, mit der von der<br />
Tribüne des Parlaments und für die internationale Öffentlichkeit, unter der oft Washington<br />
und das Judentum verstanden wurden, ein philosemitisches Bekenntnis abgelegt wurde. Im<br />
engeren Kreise sah das dann schon anders aus.<br />
In einer der Sitzungen auf höchster Regierungsebene in Bonn, die in der Regel von<br />
Adenauer geleitet wurden, bemerkte Bundesfinanzminister Fritz Schäffer (CSU): „Wenn die<br />
Juden Geld wollen, sollen es die Juden selbst aufbringen, indem sie eine ausländische Anleihe<br />
zeichnen.“ 40 Das „erste Opfer Hitlers“, die Republik Österreich, blickte hingegen eher nach<br />
Bonn, von wo die Millionen kommen sollten; vor der Frage jüdischen Eigentums stand die<br />
Frage deutschen Eigentums und der von den Deutschen ins Altreich heimgeführten österreichischen<br />
Werte. In völliger Verdrehung historischer Tatsachen wurde österreichisches Eigentum,<br />
das – der Opferthese folgend – deutsch geworden war, jetzt dem arisierten Eigentum gleichgesetzt.<br />
41 Damit erschien Österreich auch materiell als Opfer Hitlers. Wenn überhaupt, so<br />
dachte man in der Bevölkerung, war Wiedergutmachung an den Österreichern zu leisten.<br />
In Westdeutschland zeigte die Tatsache, daß allenfalls elf Prozent der Bundesbürger das<br />
Wiedergutmachungsabkommen befürworteten, ja 44 Prozent es rundheraus als überflüssig<br />
bezeichneten, daß hier nicht die Glaubwürdigkeit des neuen Deutschland, sondern einzig<br />
die der politischen Entscheidungsträger in einer zweifellos entscheidenden außenpolitischen<br />
Situation demonstriert worden war. 42 Diese außenpolitische Demonstration hatte<br />
jedoch ein innenpolitisch relativierendes Nachspiel. Als das Vertragswerk im Bundestag am<br />
18. März 1953 ratifiziert wurde, stimmten von 358 Abgeordneten 238 mit Ja, 34 mit<br />
Nein und 86 enthielten sich der Stimme. Die wesentliche Unterstützung erhielt die Gesetzesvorlage<br />
von der sozialdemokratischen Opposition, die geschlossen dafür stimmte, zahlreiche<br />
Abgeordnete der Regierungsparteien enthielten sich.<br />
Die Bindung der gesamten Wiedergutmachungsthematik an die sich aus dem Kalten Krieg<br />
ergebenden Bemühungen um eine Westintegration der Bundesrepublik fehlte in Österreich.<br />
Hier hatten, wie die von Robert Knight herausgegebenen Protokolle der Sitzungen des österreichischen<br />
Bundeskabinetts so eindrucksvoll zeigen, fehlende Sensibilität und antisemitische<br />
Kontinuität jegliche grundsätzliche Wiedergutmachungsregelung von vornherein verhindert.<br />
Die Betonung der Opferrolle Österreichs diente den Legitimationsbestrebungen des nachnationalsozialistischen<br />
Staates und mündete in den Versuch, „das Opfer der österreichischen<br />
Bevölkerung auf eine Ebene mit dem der Juden“ zu stellen. 43 Ein Schuldbekenntnis im<br />
Namen des österreichischen Volkes erfolgte erst zu Beginn der neunziger Jahre, nachdem<br />
Waldheim-Affäre und öffentliche – auch internationale – Entrüstung über den immer spürbarer<br />
werdenden Antisemitismus eine regierungsamtliche Reaktion erforderlich machten.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
121<br />
Frank Stern<br />
„As you know, the Federal Government is trying to provide for those who suffered damage through the war or<br />
the Third Reich. Which of these groups should, in your opinion, receive such help and which should not?“<br />
Should receive help Should not No opinion<br />
War-widows and orphans 96% 1% 3%<br />
People who suffered damage through bombing 93% 3% 4%<br />
Refugees and Expellees<br />
Relatives of people executed because of participation in<br />
90% 6% 4%<br />
attempt on Hitler’s life on July 20th, 1944 73% 13% 14%<br />
Jews who suffered through Third Reich and war 68% 21% 11%<br />
Quelle: HICIG, Report No. 113, 5.12.1951; vgl. Anna J. and Richard L. Merritt,<br />
Public Opinion in Semisovereign Germany. The HICOG Surveys, 1949–1955, Urbana 1980, S 146f.
Die Praxis der<br />
„Wiedergutmachung“<br />
Wiedergutmachung – Ein Vergleich<br />
Die „Kehrseite der Wiedergutmachung“<br />
Die geforderte Wiedergutmachung auf der Ebene der Rückerstattung und Entschädigung<br />
wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem komplizierten bürokratischen Zahlungsvorgang<br />
von seiten des Staates. Materielle Leistungen in diesem Rahmen halfen bei<br />
der Überwindung sozialer Nöte, auch die teilweise Rückgabe oder Entschädigung arisierten<br />
Besitzes ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Art und Weise der bürokratischen<br />
Abwicklung hatte aber auch – was hier nur angedeutet werden kann – ihre neuen jüdischen<br />
Opfer, die staatliche Bürokratie erneut ihre „Judenfrage“.<br />
Anträge wurden verschleppt, administrative Schikanen eingebaut, die den Antragstellern<br />
sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Last der Anspruchsbegründung und der<br />
konkreten Nachweise von Schäden auferlegten. Gesundheitsschäden, Minderung der<br />
Erwerbstätigkeit mußten mit Gutachten bewiesen werden, der bloße Aufenthalt in Konzentrations-<br />
und Arbeitslagern galt nicht als ausreichend. Die Kausalität hatten und haben die<br />
Betroffenen nachzuweisen. 44 Und darüber kann auch die nahezu unüberschaubare Fülle<br />
von Gesetzen und Gesetzesänderungen nicht hinwegtäuschen. Die zwei wichtigen Studien<br />
von Christian Pross und Helga und Hermann Fischer-Hübner beschreiben denn auch detailliert<br />
die „Kehrseite der Wiedergutmachung“ in der Bundesrepublik Deutschland, eben den<br />
„Kleinkrieg gegen die Opfer“.<br />
„Nach oft jahrelangem Spießrutenlauf zwischen Paragraphen, Vorschriften, Gutachten<br />
und Sachbearbeitern war mancher Verfolgte so eingeschüchtert, daß er sich mit jeder<br />
noch so dürftigen Abfindung zufriedengab.“ 45 Zu oft stand den „staatlichen Unrechtshandlungen<br />
und ihren unübersehbaren Folgen (...) eine die Höhe des Schadenausgleichs begrenzende<br />
gesetzliche Regelung gegenüber. Niemand konnte mit einem nahezu vollen<br />
Ausgleich des ihm angetanen staatlichen Unrechts rechnen, am wenigsten die, die persönliche<br />
Verluste und gesundheitliche Schäden erlitten hatten.“ Nicht wenige Antragsteller<br />
empfanden diese erneute „Behandlung“ durch die Nachfolgebehörden des Dritten Reiches<br />
als „Wiederholung des Verfolgungserlebnisses“. 46 Nicht selten waren die Beamten, Juristen,<br />
Ärzte und Gutachter „die gleichen, die vor 1945 auch in öffentlichen Behörden,<br />
Ämtern und Kliniken tätig waren. Die mit der Begutachtung beauftragten, teils beamteten<br />
Ärzte waren oft nicht unbeteiligt an ➤ Euthanasiemaßnahmen und Zwangssterilisationen.“<br />
Die Antragsteller waren entwürdigenden Prozeduren ausgesetzt, minutiöse Nachweise<br />
und Zeugen wurden verlangt, nicht wenige Überlebende resignierten oder durchlebten<br />
psychisch die Hölle der Lager erneut. Der Psychiater Kurt Eissler faßte dies 1963 in der<br />
Frage zusammen: „Die Ermordung von wievielen seiner Kinder muß ein Mensch symptomfrei<br />
ertragen können, um eine normale Konstitution zu haben?“ 47 Die Diskriminierung der<br />
Opfer wurde so mit anderen Mitteln fortgesetzt. Die Psychiaterin Barbara Vogt-Heyder<br />
beschreibt die bundesdeutsche Wiedergutmachungspraxis folgendermaßen: „Es kommt zu<br />
einer Neuauflage der Verfolgung. Opfer werden zu Bittstellern degradiert, und ihr schweres<br />
Verfolgungsschicksal wird nicht verstanden und daher auch nicht entsprechend gewichtet<br />
und gewürdigt.“ 48<br />
Ist die sogenannte Wiedergutmachung nun ein beendigtes Kapitel deutscher und österreichischer<br />
Zeitgeschichte? Die Antwort muß verneint werden. Es hat Jahre gedauert, bis<br />
schließlich überdeutlich geworden ist, daß eine Entschädigung für die Opfer des Nationalsozialismus<br />
noch lange nicht abzuschließen ist. Es sei nur an die Zehntausende zählenden<br />
Zwangsarbeiter des Dritten Reiches im Altreich oder in Österreich oder an die Sinti und<br />
Roma, die Homosexuellen und Zwangssterilisierten erinnert (...). 49 Die materiellen Schäden,<br />
die das Dritte Reich verursacht hat, sind nicht wiedergutzumachen, von den physischen und<br />
psychischen Schäden an den direkten Opfern und den Nachfolgeschäden auch an den<br />
Kindern der Überlebenden ganz zu schweigen.“ 50<br />
Eine umfassende moralische, gesellschaftliche und kulturelle Rehabilitierung der Juden hat<br />
es nach 1945 in keinem der drei Nachfolgestaaten des Dritten Reiches gegeben. Auch<br />
dies ein später Erfolg Hitlers?<br />
122 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
1 Vgl. u. a. Ludolf Herbst/Constantin Goschler (<strong>Hrsg</strong>.), Wiedergutmachung<br />
in der Bundesrepublik Deutschland, München 1989,<br />
darin insbesondere Walter Schwarz, Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen<br />
Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland.<br />
Ein Überblick, S. 33-54, sowie den eher den Charakter eine Debatte<br />
über Quellenauslegung tragenden Artikel: Kai von Jena, Versöhnung<br />
mit Israel? Die deutsch-israelischen Verhandlungen bis<br />
zum Wiedergutmachungsabkommen von 1952, in: Vierteljahrshefte<br />
für Zeitgeschichte 34 (1986), Heft 4, S. 457 f.; Constantin<br />
Goschler, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten<br />
des Nationalsozialismus 1945-1954, München 1992; Michael<br />
Wolffsohn, Die Wiedergutmachung und der Westen – Tatsachen<br />
und Legenden, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu Das<br />
Parlament, B 16-17/87, 18. 4. 1987, S. 19 f.; ders., Das deutsch-israelische<br />
Wiedergutmachungsabkommen von 1952 im internationalen<br />
Zusammenhang, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 36<br />
(1988), S. 691 f. Eine in aller Kürze ausgezeichnete Darstellung der<br />
amerikanischen Position findet sich bei Thomas Alan Schwartz,<br />
America’s Germany. John McCloy and the Federal Republic of Germany,<br />
Cambridge 1991, S. 175 f. Für Österreich vgl. Gustav Jelinek,<br />
Die Geschichte der österreichischen Wiedergutmachung, in: Josef<br />
Fraenkel (<strong>Hrsg</strong>.), The Jews of Austria: Essays on their Life, History,<br />
and Destruction, London 1967; Dietmar Walch, Die jüdischen<br />
Bemühungen um die materiellen Wiedergutmachungen durch die<br />
Republik Österreich (Veröffentlichungen des Historischen Instituts<br />
der Universität Salzburg 1), Wien 1971; Robert Knight, Restitution<br />
and Legitimacy in Post-War Austria 1945-1953, in: Leo Baeck Institute<br />
Yearbook XXXVI (1992), S. 413 f.<br />
2 Vgl. Rolf Vogel (<strong>Hrsg</strong>.), Der deutsch-israelische Dialog. Dokumentation<br />
eines erregenden Kapitels deutscher Außenpolitik. Teil 1,<br />
Politik, Bd. 1, München 1987, S. 3 f.<br />
3 Ebd., S. 12.<br />
4 Vgl. Walter Schwarz, Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen<br />
Unrechts, in: Herbst/Goschler, Wiedergutmachung in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, S. 33 f. sowie Hans-Dieter Kreikamp, Zur<br />
Entstehung des Entschädigungsgesetzes der amerikanischen Besatzungszone,<br />
in: ebd., S. 61 f.<br />
5 Robert Knight (<strong>Hrsg</strong>.), „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen“<br />
– Wortprotokolle der österreichischen Bundesregierung 1945-<br />
52 über die Entschädigung der Juden, Frankfurt/M. 1988, S. 43; vgl.<br />
auch Rudolf Bienenfeld, Restitution and Compensation in Austria,<br />
Association of Jewish Refugees in Great Britain, Bulletin VI, Dezember<br />
1952, S. 1 f.<br />
6 Vgl. Knight, „Ich bin dafür ...“, S. 44.<br />
7 Süddeutsche Zeitung, 11.10.1946.<br />
8 Vgl. den Beitrag von Brigitte Bailer-Galanda: Die Maßnahmen der<br />
Republik Österreich für die Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus-Wiedergutmachung.<br />
In: Sebastian Meissl u.a. (<strong>Hrsg</strong>.), verdrängte<br />
Schuld, verfehlte Sühne. Entnazifizierung in Österreich<br />
1945-1955, Wien 1986, S. 138. Zur Diskussion um den Begriff vgl.<br />
Yeshayahu A. Jelinek, Israel und die Anfänge der Shilumim, in:<br />
Herbst/Goschler, Wiedergutmachung in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, S. 119 f.<br />
9 Thomas Albrich, Exodus durch Österreich. Die jüdischen Flüchtlinge<br />
1945-1948, Innsbruck 1987, S. 94.<br />
10 Vgl. hierzu Brigitte Bailer, Gleiches Recht für alle? Die Behandlung<br />
von Opfern und Tätern des Nationalsozialismus durch die Republik<br />
Österreich, in: Rolf Steininger (<strong>Hrsg</strong>.), Der Umgang mit dem Holocaust.<br />
Europa – USA – Israel. Wien/Köln/Weimar 1994, S. 183-197.<br />
11 Vgl. hierzu Agnes Blänsdorf, Zur Konfrontation mit der NS-Vergangenheit<br />
in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich, in: Aus Politik<br />
und Zeitgeschichte, Beilage zu Das Parlament, B 16-17/87,<br />
18.4.1987, S. 15 f.<br />
12 Robert Knight, Restitution and Legitimacy in Post-War Austria<br />
1945-1953, in: Leo Baeck Institute Year Book XXXVI (1992), S. 416.<br />
13 Ebd., S. 426.<br />
14 Zit. n. Vogel, Der deutsch-israelische Dialog, S. 18 f.<br />
15 Herbert Blankenhorn, Verständnis und Verständigung. Blätter eines<br />
politischen Tagebuchs 1949-1979, Frankfurt/M. 1980, S. 138.<br />
16 Hendrik van Dam, zit. n. Vogel, Der deutsch-israelische Dialog, S.19f.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
123<br />
Frank Stern<br />
17 Ebd., S. 25.<br />
18 Zit. n. Knight, „Ich bin dafür ...“, S. 230.<br />
19 Vgl. Bruce F. Pauley, The USA and the Jewish Question in Austria, in:<br />
Leo Baeck Institute Year Book XXXVI (1992), S. 492.<br />
20 Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Aufstieg 1876-1952, Stuttgart<br />
1986, Seite 840.<br />
21 Der US-Diplomat Martin Herz, zit. n. Knight, „Ich bin dafür …“ S. 34.<br />
22 Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland,<br />
München 1965, S. 470 f.<br />
23 John McCloy, Ansprachen des amerikanischen Hochkommissars für<br />
Deutschland, Washington, D. C., 23. 1. 1950, Stuttgart, 6. 2. 1950.<br />
24 Vgl. HICOG, Information Services Division, Opinion Survey Report<br />
No. 1, 30. 12. 1949; vgl. Anna J. and Richard L. Merritt, Public<br />
Opinion in Semisovereign Germany. The HICOG Surveys, 1949-<br />
1955, Urbana 1980, S. 53 f.<br />
25 Zit. n. Klaus-Jörg Ruhl (<strong>Hrsg</strong>.), „Mein Gott, was soll aus Deutschland<br />
werden?“ Die Adenauer-Ära 1949-1963, München 1985, S. 334.<br />
26 Die Welt, 14. 6. 1951.<br />
27 Vgl. Knight, „Ich bin dafür ...“, S. 50.<br />
28 Verhandlungen des Deutschen Bundestages. Stenografische<br />
Berichte. 1. Wahlperiode 1949-1953, Bonn 1949 f., S. 6697 f.<br />
29 Vgl. Blänsdorf, S. 15, hier zit. n. Jelinek, S. 395 f.<br />
30 Vgl. Pauley, S. 492.<br />
31 Vgl. Nana Sagi, German Reparations. A History of the Negotiations,<br />
Jerusalem 1980, S. 205.<br />
32 Nahum Goldmann, Mein Leben als deutscher Jude, Frankfurt/M.<br />
1980, S. 449.<br />
33 Vgl. Sagi, S. 211.<br />
34 Vgl. hierzu Angelika Timm, Der Streit um Restitution und Wiedergutmachung<br />
in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, in:<br />
Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart (1992), Heft 10/11;<br />
Blänsdorf, S. 16 f.<br />
35 Vgl. Ron Zweig, German Reparations and the Jewish World: A<br />
History of the Claims Conference, London 1987.<br />
36 Hans-Peter Schwarz, S. 905.<br />
37 Vgl. Ruth Wodak/Peter Nowak/Johanna Pelikan/Helmut Gruber/<br />
Rudolf de Cillia/Richard Mitten, „Wir sind alle unschuldige Täter“ –<br />
Diskurshistorische Studien zum Nachkriegsantisemitismus, Frankfurt/M.<br />
1990, S. 266.<br />
38 HICOG, Report No. 113, 5. 12. 1951; Vgl. Merritt, S. 146f.<br />
39 Quelle: HICOG, Information Services Division, Opinion Survey<br />
Report No. 113, 5. 12. 1951, NA.Rg. 260.<br />
40 Zit. n. Jena, S. 472.<br />
41 Vgl. Knight, „Post-War ...“, S. 424.<br />
42 Vgl. Norbert Frei, Die deutsche Wiedergutmachungspolitik<br />
gegenüber Israel im Urteil der öffentlichen Meinung der USA, in:<br />
Herbst/Goschler, Wiedergutmachung in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, S. 215-230; Wolffsohn, Globalentschädigung für Israel<br />
und die Juden? Adenauer und die Opposition in der Bundesregierung,<br />
in: ebd., S. 161-190.<br />
43 Vgl. Knight, „Ich bin dafür ...“, S. 58.<br />
44 Vgl. Brigitte Bailer-Galanda, Maßnahmen S. 144<br />
45 Christian Pross, Wiedergutmachung. Der Kleinkrieg gegen die Opfer,<br />
Frankfurt/M. 1988, S. 294.<br />
46 Helga und Hermann Fischer-Hübner (<strong>Hrsg</strong>.), Die Kehrseite der<br />
„Wiedergutmachung“. Das Leiden von NS-Verfolgten in den Entschädigungsverfahren,<br />
Gerlingen 1990, S. 31.<br />
47 So der Titel seines Aufsatzes in: Psyche 17 (1963), S. 241 f., Nachdruck<br />
in: Hans M. Lohmann (<strong>Hrsg</strong>.), Psychoanalyse und Nationalsozialismus.<br />
Beiträge zur Bearbeitung eines unbewältigten Traumas,<br />
Frankfurt/M. 1984.<br />
48 Barbara Vogt-Heyder, Einige Gedanken zur deutschen Wiedergutmachung,<br />
in: Dierk Jülich (<strong>Hrsg</strong>.), Geschichte als Trauma. Festschrift<br />
für Hans Keilson zu seinem 80. Geburtstag, Frankfurt/M. 1990, S. 65.<br />
49 Vgl. hierzu Wiedergutmachung und Entschädigung für nationalsozialistisches<br />
Unrecht. Öffentliche Anhörung des Innenausschusses<br />
des deutschen Bundestages am 24. Juni 1987, Bonn 1987.<br />
50 Vgl. William G. Niederland, Folgen der Verfolgung: Das Überlebenden-Syndrom,<br />
Frankfurt/M. 1980.<br />
Aus: Frank Stern, Rehabilitierung der Juden oder materielle Wiedergutmachung – ein Vergleich, in: Rolf Steininger<br />
(<strong>Hrsg</strong>.), Der Umgang mit dem Holocaust. Europa – Israel – USA, Böhlau Verlag, Wien 1994, S. 167-182.
Interview mit Georg Graf<br />
„Lücken in der Gesetzgebung“<br />
In welchem Ausmaß wurden bisher Fragen zu Enteignung und Rückstellung in<br />
Österreich erforscht?<br />
Graf: Die Fragen sind in sehr unterschiedlichem Ausmaß erforscht worden. Es hat in den<br />
letzten Jahren sehr viel an historischer Forschung zu diesem Thema stattgefunden, die juristische<br />
Aufarbeitung der Gerichtsverfahren, die nach 1945 stattgefunden haben, steht<br />
aber zu einem Großteil noch aus.<br />
Aus welchen Gründen haben sich RechtshistorikerInnen bisher so wenig mit dem<br />
Thema Enteignung – Rückstellung befaßt?<br />
Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich nicht konkret beantworten kann. Sicherlich war<br />
es so, dass in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg viele Leute teilweise selbst von dieser<br />
Thematik betroffen waren und daher kein sonderliches Interesse daran hatten sich damit zu<br />
befassen. Irgendwie war man froh, dass die Sache „vorbei“ ist, und hat daher auch kaum<br />
wissenschaftlichen Ehrgeiz entwickelt.<br />
Bestand im Fall von allgemeinen Kriegsschäden, also von Bombenopfern,<br />
von Plünderungen, Vertreibungen ein Anspruch auf Entschädigung?<br />
Ja, es gab eigene Gesetze, wie zum Beispiel das ➤ „Kriegs- und Verfolgungs-Sachschädengesetz“<br />
(KVSG) vom 25. Juni 1958 über die Gewährung von Entschädigungen für durch<br />
Kriegseinwirkung oder durch politische Verfolgung erlittene Schäden an Hausrat und an zur<br />
Berufsausübung erforderlichen Gegenständen. Dieses Gesetz behandelte NS-Opfer und<br />
Kriegsopfer grundsätzlich gleich. Allerdings waren Personen, die über ein Jahreseinkommen<br />
von mehr als öS 72.000 verfügten, von Ansprüchen nach dem KSVG ausgeschlossen.<br />
Insofern galt hier ebenso wie im ➤ Opferfürsorgegesetz (OFG) das Fürsorge- und nicht das<br />
Entschädigungsprinzip.<br />
Lässt sich auch etwas über die Praxis sagen? Wurde das Gesetz auch in Anspruch<br />
genommen, wurden Ansprüche gestellt?<br />
Es wurden Ansprüche gestellt, aber wie die konkrete Praxis ausgesehen hat, das wird einer<br />
der Punkte sein, zu denen die Historikerkommission nähere Aufschlüsse oder nähere<br />
Erkenntnisse erarbeiten wird.<br />
Angesichts der Geschichte der Rückstellungen in der Zweiten Republik lässt sich<br />
eindeutig ein Widerspruch zwischen der Aktivität des Gesetzgebers, d.h. der<br />
Verabschiedung einer Vielzahl einschlägiger Gesetze, und den darauf basierenden<br />
Behördenentscheidungen, die eher auf eine Unterbindung und Erschwernis<br />
tatsächlicher Rückstellungen hinweisen, feststellen. Woraus erklärt sich diese<br />
Diskrepanz zwischen Gesetz und Praxis, worin liegt diese begründet?<br />
Dafür sind sehr viele Faktoren maßgebend. Zu differenzieren ist zwischen dem Bereich der<br />
124 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
genuinen Rückstellung, das heißt Fällen, in denen sich zwei Privatpersonen gegenübergestanden<br />
haben, und dem Bereich, den man eher mit dem Begriff der Entschädigung bezeichnen<br />
könnte, zum Beispiel im Bereich des Sozialversicherungsrechts. Bei Letztgenannten war<br />
es so, dass interessanter Weise die befassten Behörden oftmals die Einstellung vertreten haben,<br />
möglichst wenig bezahlen zu wollen. Da ist ein Sparsamkeitsgrundsatz in ganz absurdem<br />
Kontext verwendet worden. Was die Rückstellungen betrifft, muss man sagen, dass bereits<br />
die Gesetze selber Anlaß für Probleme gegeben haben. Es sind doch einige Fragen offengeblieben,<br />
die sich der Gesetzgeber hätte überlegen müssen. Einige Fragen sind im Gesetz<br />
nicht gelöst gewesen und in der Folge haben dann die Richter oftmals Entscheidungen getroffen,<br />
die für den Rückstellungspflichtigen günstiger als für den Rückstellungswerber waren. 1<br />
Betrachtet man die Praxis, lässt sich dann tatsächlich von Rückstellungen sprechen ?<br />
Ja, sicherlich. Wenn man sich die veröffentlichte Judikatur anschaut, wenn man mit Anwälten<br />
spricht, die damals involviert waren, haben natürlich Rückstellungen stattgefunden. Die<br />
Frage ist nur, ob in dem Ausmaß, in dem Vermögensentziehungen stattgefunden haben,<br />
wirklich auch Rückstellungen erfolgt sind oder ob es da Diskrepanzen gibt.<br />
Worin liegt der Unterschied zwischen den ersten beiden Rückstellungsgesetzen vom<br />
26.7.1946 und 6.2.1947 und dem 3. Rückstellungsgesetz vom Herbst 1947, das das<br />
wichtigste, aber gleichzeitig auch das umstrittenste war?<br />
Das ist eigentlich ein technischer Unterschied gewesen. Das 1. Rückstellungsgesetz regelte<br />
jene Fälle, in denen Eigentum durch das Deutsche Reich aufgrund typischer nationalsozialistischer<br />
Gesetze, wie zum Beispiel der ➤ 11. und ➤ 13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz,<br />
entzogen worden war und sich nun in der Verwaltung der Republik Österreich befand. Das<br />
2. Rückstellungsgesetz regelte Fälle entzogenen Eigentums, das sich nunmehr aufgrund Verfalls<br />
im Eigentum der Republik befand. Im 3. Rückstellungsgesetz, das war quasi das Generalrückstellungsgesetz,<br />
sind auch jene Sachen erfasst worden, die jetzt Privatpersonen innegehabt<br />
haben, das betraf etwa die ganzen entzogenen Unternehmen, und deswegen war<br />
es das Gesetz, zu dem es dann die meisten Verfahren gegeben hat. Noch ein Unterschied<br />
ist vielleicht für Nichtjuristen interessant: Beim 1. und 2. Rückstellungsgesetz hat die Rückstellung<br />
in Verwaltungsverfahren stattgefunden, das heißt, man hat sich an die Verwaltungsbehörde<br />
gewandt. Daher waren die Verfahren problemloser als die nach dem 3. Rückstellungsgesetz,<br />
weil jene vor Gericht abgewickelt wurden. Man hat wirklich gegen denjenigen,<br />
der „arisiert“, also Vermögen entzogen hat oder das entzogene Vermögen in seinem<br />
Besitz gehabt hat, prozessieren müssen. Denn nach der Vermögensentziehungsanmeldeverordnung<br />
vom Herbst 1946 war jemand auch zur Vermögensanmeldung verpflichtet, der<br />
nicht direkt Vermögen entzogen, sondern von jemandem käuflich erworben hat, der seinerseits<br />
das Vermögen entzogen hat.<br />
Ein Grundsatz des 3. Rückstellungsgesetzes lautete, dass die Rückstellung zwischen<br />
zwei Privaten nicht zu Lasten des Staates gehen dürfe. Hat dieser Rückzug des<br />
Staates, etwa mit der Begründung, nicht Rechtsnachfolger des NS-Staates zu sein,<br />
die Möglichkeit der Rückstellung in der Praxis erschwert?<br />
Ja, weil dadurch bestimmte Probleme, die durch die Mitwirkung des Staates leichter lösbar<br />
gewesen wären, nur sehr schwer lösbar geworden sind, vor allem in den häufigsten Fällen<br />
von Vermögensentzug, in denen der Käufer nicht über direkte Gewaltanwendung den Besitz<br />
erzwungen hat, sondern bei denen ein Vertrag abgeschlossen wurde und der Käufer<br />
viel zu wenig bezahlt hat. Der Verkäufer hat meistens einen Großteil des Geldes gar nicht<br />
gesehen, weil dieser vom Deutschen Reich unter den verschiedensten Titeln, wie z.B.<br />
➤ Reichsfluchtsteuer und Sühneabgabe eingezogen wurde; das war Geld, das an den<br />
Staat geflossen ist. Und jetzt hat sich bei der Rückabwicklung natürlich die Frage gestellt,<br />
wer den Schaden dieses verlorenen Geldes trägt. Der Staat hat sich dafür nicht verantwortlich<br />
erklärt, und so blieb nichts anderes übrig, als entweder dem Rückstellungswerber die<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Georg Graf<br />
125
Lücken in der Gesetzgebung<br />
Kosten aufzuerlegen oder dem Rückstellungspflichtigen. Eigentlich ungerecht, weil der<br />
➤ „Ariseur“ hat ja bezahlt, aber der Rückstellungswerber hat das Geld nie gesehen; in diesen<br />
Fällen wäre sicher die Lösung leichter gewesen, wenn der Staat etwas bezahlt hätte.<br />
Wie hat das dann in der Praxis ausgesehen, zu welchen Lasten ist es<br />
in der Regel gegangen?<br />
Das ist relativ uneinheitlich gehandhabt worden. Ich habe mir die veröffentlichte Judikatur<br />
einmal angesehen, da haben sich eigentlich Entscheidungen in beide Richtungen gefunden.<br />
Es hat welche gegeben, die eher den Rückstellungspflichtigen belastet haben, aber natürlich<br />
auch eine Reihe von Entscheidungen, die zu Lasten der Rückstellungswerber gegangen<br />
sind.<br />
Zum Zweck der Rückstellungen wurden eigene Kommissionen eingesetzt.<br />
Wann und von wem wurden diese Kommissionen eingesetzt?<br />
Welche Kommissionen gab es, und wie haben sie gearbeitet?<br />
Bezüglich des 3. Rückstellungsgesetzes war das Verfahren dreistufig aufgebaut, das heißt,<br />
es hat eine erste, zweite und dritte Instanz gegeben. Die dritte Instanz war die oberste<br />
Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof, und dadurch waren die Rückstellungsverfahren<br />
dem normalen Ablauf eines Zivilverfahrens wirklich sehr angenähert, weil es dort<br />
auch dieses dreistufige Verfahren gibt. Im Gesetz selber hat es Regeln gegeben, die eine<br />
bestimmte Anzahl von Richtern, aber auch Laienrichter vorgesehen haben. Man hat sich also<br />
um eine halbwegs ausgewogene Besetzung bemüht, doch es hat dann auch immer wieder<br />
Streitigkeiten darüber gegeben. Das wird auch einer der Punkte sein, den die Historikerkommission<br />
näher untersuchen wird.<br />
Auf welcher Rechtsgrundlage sind diese Kommissionen verfahren?<br />
Die Rechtsgrundlage waren teilweise die Rückstellungsgesetze und sonst subsidiär die allgemeinen<br />
Bestimmungen des österreichischen Außerstreitrechts.<br />
Gab es personelle, strukturelle und organisatorische Kontinuitäten zwischen einerseits<br />
den einst zuständigen Behörden für die Enteignung und den mit der Rückstellung<br />
betrauten Stellen nach 1945, wenn man etwa an die ➤ Vermögensverkehrsstelle<br />
denkt, diverse Magistratsabteilungen oder das ➤ Krauland-Ministerium?<br />
Das ist eine Frage, für deren Beantwortung sicher primär Historiker zuständig sind. Es gibt<br />
aber einen sehr prominenten Fall, der diese Kontinuitäten recht gut verdeutlicht: Walther<br />
➤ Kastner, der nach 1938 für die ➤ „Arisierungen“ in der Kontrollbank zuständig war und<br />
nach 1945 in Form eines Konsulentenvertrages für das Krauland-Ministerium gearbeitet<br />
hat. Die Pikanterie, die dann noch dazukommt, liegt allerdings darin, dass im Rahmen<br />
einer großen Veranstaltung der Universität Wien Ende der achtziger Jahre, zu „Recht im<br />
Nationalsozialismus“ Walther Kastner eingeladen wurde, einen Beitrag über Rückstellung<br />
und Arisierung zu verfassen. Er hat dann natürlich ein sehr positives Bild gezeichnet. Das<br />
ist ein Einzelfall, und man darf von Einzelfällen nicht generalisieren, aber wie ich von Kollegen<br />
gehört habe, hat es mehrere solche Fälle gegeben.<br />
Betrachtet man die Details der Rückstellungspraxis: Wie wurde zum Beispiel bei<br />
Firmen, die in ehemals jüdischem Besitz standen, verfahren? Die einen wurden<br />
„arisiert“, ein Großteil wurde liquidiert oder durch stillen Boykott lahmgelegt,<br />
aufgelöst. Gab es in solchen Fällen Entschädigungszahlungen?<br />
Nein, das war ja eines der Probleme. Der Grundsatz der Rückstellungsverfahren war, daß<br />
eben das, was heute noch vorhanden ist, zurückgegeben werden muss. Aber bei jüdischen<br />
Unternehmen, bei denen die „Ariseure“ eine Stillegung oder Auflösung oftmals sinnvoller<br />
fanden, etwa zur Ausschaltung der Konkurrenz, war nichts da, was zurückgegeben hätte<br />
werden können. Da hat keine Rückstellung stattgefunden.<br />
126 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Gab es in solchen Fällen Anträge von ehemaligen BesitzerInnen, die dann<br />
abschlägig beurteilt wurden?<br />
Nach der Logik der Gesetze konnten eigentlich gar keine Anträge mehr gestellt werden.<br />
Man musste erst jemanden finden, der die Sache, die einem entzogen worden war, innegehabt<br />
hat, und den konnte man dann klagen. Der Inhalt der Klage war, das zurückzugeben,<br />
was entzogen worden war. Das hat in den Fällen nicht gegriffen, in denen Unternehmen<br />
nicht mehr da waren. Daher gab es gar niemanden mehr, an den sich ein jetzt möglicherweise<br />
aus dem Exil Zurückgekehrter hätte wenden können. Da hätte es nur über staatliche<br />
Entschädigungszahlungen Abhilfe gegeben, aber die hat es in diesen Fällen nicht gegeben.<br />
Wie wurde mit Gewinnen aus „arisierten“ und weitergeführten Betrieben verfahren?<br />
An und für sich waren diese Gewinne herauszugeben, aber die Rechtsprechung hat schon<br />
aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwischen sogenannten „redlichen“ und „unredlichen Ariseuren“<br />
differenziert. Zur Erklärung, was diese Unterscheidung bedeutet: Der „redliche Ariseur“<br />
war nach der Rechtsprechung der, der ein Vermögen in einer Weise entzogen hat,<br />
das ihn rückstellungspflichtig machte, der aber sonst die Regeln des „redlichen Verkehrs“,<br />
wie es im Gesetz formuliert wurde, eingehalten hat. Die Gerichte haben darunter verstanden,<br />
dass der ehemalige Käufer ungefähr einen damals marktüblichen Preis bezahlt hat,<br />
wobei der marktübliche Preis natürlich auch keine objektive Größe darstellte. Oder ob der<br />
Käufer vielleicht vom Verkäufer frei ausgesucht und ihm nicht aufgezwungen wurde. Das<br />
waren die Zugänge, mit denen man hier operiert hat, und wenn jemand in diesem Sinn<br />
„redlich“ war, dann durfte er die Gewinne behalten.<br />
Und wie sah das in der Praxis der Rückstellungen aus, gab es den Verfahren zufolge<br />
überwiegend „redliche“ Erwerber, oder war das nur ein geringer Teil?<br />
Darüber werden sich erst Aussagen treffen lassen, wenn wir die Akten wirklich untersucht<br />
haben. Denn bisher lässt sich nur die veröffentlichte Judikatur beurteilen, aber die wird<br />
oder wurde ja deswegen veröffentlicht, weil es da um Fälle gegangen ist, die schwierige<br />
Rechtsfragen behandelt haben. Das ist aber nicht repräsentativ für die Frage, wie viele<br />
waren „redliche“, wie viele waren „unredliche“ Erwerber. Man wird sich wirklich die Verfahren<br />
ansehen müssen, soweit sie noch dokumentiert sind.<br />
Wie wurde in Bezug auf die Rückstellung von Wohnungen und die Aberkennung<br />
des Mietrechtes verfahren? Es hat ja sehr lange Zeit keine entsprechende Regelung<br />
für Wohnungsrückstellungen gegeben. Worin liegen die Gründe dafür?<br />
Da hat es nie eine Regelung gegeben. Es war so, dass die Regierung zwar einen Gesetzesentwurf<br />
erstellt hat, der das Problem dieser entzogenen Mietrechte regeln sollte, nur hat<br />
man sich dann nicht getraut oder ganz bewusst nicht dazu entschlossen, dieses Gesetz<br />
auch durchzubringen. Denn das Problem lag darin, dass in den Wohnungen jetzt natürlich<br />
wieder Leute wohnten, die man hätte hinauswerfen müssen. Das war ganz einfach ein zu<br />
heißes Eisen, und daher ist hier keinerlei Wiedergutmachung oder Rückstellung erfolgt. Das<br />
betrifft das Problem der Mietrechte. Wenn jemand natürlich eine Eigentumswohnung besessen<br />
hat oder ein Haus, das konnte er schon zurückbekommen. Aber wenn die Mietrechte<br />
entzogen waren, dafür hat es keine gesetzliche Regelung gegeben. Das ist besonders tragisch<br />
oder sagen wir besonders schwierig, weil in Österreich die Position des Mieters eine<br />
sehr starke ist. Nach dem Mietrechtsgesetz ist man in Österreich fast unkündbar und hat einen<br />
starken Schutz, was die Höhe des Mietzinses betrifft. Der Verlust solcher Mietrechte ist<br />
daher für die betroffenen Leute schon schwerwiegend gewesen.<br />
Sachwerte, Wohnungseinrichtungen, Schmuck – wurde das zurückgestellt?<br />
Für die Praxis der Rückstellung stellte es ein enormes Problem dar, dass die Sachen nicht mehr<br />
vorhanden oder nicht mehr auffindbar waren. Das heißt, da war auch wieder niemand zu finden,<br />
der sie innegehabt hat, und aus diesem Grund ist dann oftmals keine Rückstellung erfolgt.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Georg Graf<br />
127
Lücken in der Gesetzgebung<br />
Wie wurde in Fällen von Vermögensentzug aufgrund sogenannter<br />
„wilder Arisierungen“ verfahren?<br />
Die „wilden Arisierungen“ sind an und für sich auch wie andere Vermögensentziehungen<br />
behandelt worden, nur bestand das Problem natürlich darin, dass hier oftmals die Beweislage<br />
eine schlechtere war.<br />
Noch einmal eine Frage zur Rückstellung von Betrieben: Wurde der Betrieb in der<br />
Regel zurückgestellt, oder haben sich ehemaliger „Verkäufer“ und „Käufer“ auf<br />
eine finanzielle Summe geeinigt? Ist eine Entschädigung in Form von<br />
Geldzahlungen geleistet worden, oder ging es tatsächlich um die Rückstellungen<br />
an den ursprünglichen Besitzer?<br />
Dazu muss man etwas weiter ausholen. Das 3. Rückstellungsgesetz hat die Möglichkeit vorgesehen,<br />
dass dann, wenn das Unternehmen sehr verändert wurde, der Anspruch des Rückstellungswerbers<br />
nur ein Geldanspruch sein konnte. Das heißt, dass er Anspruch auf eine<br />
Entschädigung, aber nicht auf das Unternehmen selbst hatte. Jetzt war es natürlich eine<br />
große Frage, und dazu gibt es auch einiges an Judikatur, wann das Unternehmen so verändert<br />
worden ist, dass es nicht mehr in natura zurückgestellt werden musste. Davon zu unterscheiden<br />
ist ein anderer Punkt: In vielen Fällen war es für den Rückstellungswerber natürlich<br />
vernünftiger, zum Beispiel wenn er nicht nach Österreich zurückkehren wollte, einen Vergleich<br />
zu schließen und quasi eine Zahlung entgegenzunehmen. Doch inwieweit oder in<br />
welchem Umfang Verfahren auf diese Weise durch Vergleich abgeschlossen wurden, wird<br />
auch ein Punkt sein, der in der Historikerkommission genauer untersucht werden wird.<br />
Der Terminus „redlicher Erwerb“ wurde bereits erwähnt, aber auch der Terminus der<br />
„freien Verfügung“ kommt in Rückstellungsprozessen immer wieder vor.<br />
Was ist darunter zu verstehen?<br />
Vor allem ist es um das Problem gegangen, das wir schon angesprochen haben, nämlich um<br />
die Frage der Gelder, die dem NS-Staat zugeflossen sind, wie beispielsweise Sühneabgabe<br />
oder Reichsfluchtsteuer. Nach der Regelung zum Beispiel des 3. Rückstellungsgesetzes musste<br />
der Rückstellungswerber nur jene Gelder zurückstellen, die ihm zur „freien Verfügung“ überlassen<br />
wurden. Der Begriff der „freien Verfügung“ bezieht sich rein formal darauf, ob der Erwerber<br />
den Kaufpreis zu irgendeinem Zeitpunkt bar auf die Hand erhalten hat; ob der danach<br />
faktisch frei darüber verfügen konnte, wurde als irrelevant angesehen. Jetzt hätte man<br />
das natürlich so deuten können, dass wenn sich der NS-Staat das Geld geholt hat, der heutige<br />
Rückstellungswerber es nicht zur freien Verfügung bekommen hat. Da haben die Gerichte<br />
eine gewisse Tendenz entwickelt, den Begriff „freie Verfügung“ sehr liberal auszulegen, und<br />
es gibt Entscheidungen, denen zufolge Gelder, die sich der NS-Staat sofort als Reichsfluchtsteuer<br />
geholt hat, insofern zur freien Verfügung standen, als damit eine sichere Flucht ins<br />
Ausland ermöglicht wurde. Das waren teilweise sehr zynische Argumentationen, aber man<br />
wird sich anschauen müssen, inwieweit das repräsentative Entscheidungen sind.<br />
Und was passiert in eindeutig nachgewiesenen Fällen von Enteignungen, wenn<br />
aber der enteignete Besitzer zum Beispiel nicht mehr lebt, an wen ging dann das<br />
geraubte Vermögen? Konnten die neuen Besitzer oder die Enteigner dann das<br />
Vermögen legal behalten oder illegal durch Unterlassen von Selbstanzeige?<br />
Naja, es ist so, dass auch die Erben rückstellungsberechtigt, also rückforderungsberechtigt<br />
waren, allerdings nicht alle Erben. Die Menge der Personen, die nach österreichischem<br />
ABGB erbberechtigt wären, ist größer als die, die nach dem 3. Rückstellungsgesetz anspruchsberechtigt<br />
waren. Um ein Beispiel zu geben: Ein Onkel des Erblassers ist nach ABGB<br />
berechtigt, nach dem 3. Rückstellungsgesetz konnte er jedoch nur unter der Voraussetzung<br />
Ansprüche geltend machen, wenn er in der Hausgemeinschaft des Erblassers lebte. Aber es<br />
war doch ein recht weiter Kreis Anspruchsberechtigter, so dass mit dem Tod desjenigen,<br />
dem Vermögen entzogen wurde, die Frage der Rückstellung nicht beendet war. Das Problem<br />
128 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
war natürlich, dass die Erben oftmals nicht auffindbar waren bzw. nicht gewusst haben,<br />
dass hier wirklich Ansprüche zu stellen wären. Bezüglich solcher Vermögenschaften hat es<br />
an und für sich gesetzliche Regelungen gegeben. Es ist vorgesehen gewesen, dass entzogenes<br />
Vermögen, das nicht zurückbegehrt wurde, in einen Fonds, zu den sogenannten ➤ Sammelstellen<br />
kommt. Diese Sammelstellen sind in den fünfziger Jahren eingerichtet worden, um<br />
das gesamte Sammelstellenvermögen, das nicht beansprucht wurde, auf bedürftige Opfer<br />
des Nationalsozialismus aufzuteilen. Das Problem oder die große Frage ist, inwieweit<br />
tatsächlich alles entzogene und nicht zurückreklamierte Vermögen dort gelandet ist.<br />
Und was passierte dann mit sogenanntem „erblosen“ Vermögen?<br />
Idealerweise ist es zu den Sammelstellen gekommen und dann verteilt worden, das heißt,<br />
das Vermögen wurde verwertet, und die Gelder sind dann ausbezahlt worden. Da hat es<br />
ganz genaue Regelungen gegeben, wie etwa das ➤ 4. Rückstellungsgesetz vom Mai 1961<br />
über die Erhebung von Ansprüchen der Auffangorganisationen auf Rückstellung von Vermögen<br />
nach der Rückstellungsgesetzgebung. In diesem Gesetz wurden den Sammelstellen<br />
die Berechtigung gegeben, Ansprüche nach der Rückstellungsgesetzgebung, die von den<br />
Betroffenen bisher nicht erhoben worden waren, geltend zu machen. Besonders wichtig ist<br />
das Auffangorganisationsgesetz, weil aufgrund dieses Gesetzes die Sammelstellen gegründet<br />
wurden, die wiederum auf eine Verpflichtung im ➤ Staatsvertrag zurückgeführt wurden.<br />
Weiters gab es das Gesetz über die Aufteilung der Mittel der Sammelstellen von 1962 und<br />
schließlich das Sammelstellenabgeltungsgesetz aus 1966. Der Gesetzgeber war da nicht<br />
unaktiv.<br />
Wie umfangreich ist die Rückstellungsgesetzgebung, wie viele Gesetze sind es circa,<br />
und in welchem Zeitraum sind sie verabschiedet worden?<br />
Rückstellungsgesetze im engen Sinn gab es sieben Stück, aber wenn man alle Gesetze, die<br />
in diesem Umfeld angesiedelt sind, zusammenzählt, wird man auf – ich würde sagen – 40<br />
bis 50 Gesetze kommen. Im Arbeitsprogramm der Historikerkommission haben wir versucht,<br />
das möglichst umfassend darzustellen. Die Gesetzgebung reicht größtenteils bis in<br />
die sechziger Jahre zurück. Es gibt aber auch noch entsprechende Gesetze aus den neunziger<br />
Jahren, zum Beispiel das ➤ Bundesgesetz vom 4.12.1998 über die Rückgabe von<br />
Kunstgegenständen aus den österreichischen Bundesmuseen. Bestimmte Probleme wurden<br />
eigentlich erst jetzt geregelt.<br />
Angaben über das Ausmaß der Vermögensentziehung während des Nationalsozialismus<br />
sind meistens sehr vage oder differieren sehr stark. Lassen sich zum<br />
heutigen Zeitpunkt eindeutige Aussagen treffen, oder sind erst die Ergebnisse der<br />
Historikerkommission abzuwarten?<br />
Die Historiker operieren mit Zahlen, die aber wirklich nur ganz grobe Schätzungen darstellen<br />
und furchtbar weit auseinander liegen. Eines der Ziele der Historikerkommission ist es,<br />
hier zu genaueren Zahlen zu kommen. Ob das möglich sein wird, wird man sehen, weil<br />
sich sehr schwierige Bewertungsfragen stellen. Ich muss sagen, ich glaube, dass man eher<br />
skeptisch sein muss, dass man wirklich zu absoluten Zahlen wird kommen können.<br />
Welche anderen gesellschaftlichen Gruppen, außer der jüdischen, wurden in<br />
der NS-Zeit noch systematisch enteignet? Wurden sie in der Rückstellungsgesetzgebung<br />
berücksichtigt?<br />
Ja, es hat andere Gruppen gegeben, beispielsweise politisch Verfolgte. Die Rückstellungsgesetze<br />
haben für alle gegolten. Das heißt für alle, denen Vermögen entzogen wurde, insoweit<br />
hat es hier eine Gleichbehandlung gegeben. Es wird interessant sein, einmal näher zu untersuchen,<br />
ob vielleicht bestimmte Gruppen ihre Sachen schneller zurückbekommen haben als<br />
andere. Beispielsweise hat die katholische Kirche, der ja auch sehr viel entzogen wurde, ihre<br />
Sachen sehr schnell zurückbekommen.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Georg Graf<br />
129
Lücken in der Gesetzgebung<br />
Lässt sich aufgrund der heutigen Aktenlage ein einigermaßen vollständiges Bild der<br />
Enteignungen und Rückstellungen von der Historikerkommission erforschen?<br />
Wir sind optimistisch, dass das mit Hilfe moderner Forschungsmethoden möglich sein wird,<br />
obwohl Akten, zum Beispiel Rückstellungsakten, in gewissem Umfang vernichtet wurden. Es<br />
hat vielfach das Bewusstsein gefehlt, dass es sich um sehr wichtige Akten handelt, man hat<br />
diese aufgrund von Platzmangel vernichtet, skartiert.<br />
Die Aktenlage konzentriert sich auf Wien, oder wird man in anderen Bundesländern<br />
auch suchen müssen?<br />
Man wird überall suchen. Es gibt auch in den anderen Bundesländern Akten, aber der<br />
Großteil des Vermögensentzugs hat sich in Wien abgespielt. Das dürften ungefähr 90 %<br />
gewesen sein.<br />
Lässt sich ungefähr sagen, welcher Prozentsatz von Akten skartiert wurde?<br />
Das lässt sich noch nicht abschätzen. Das wird ein Aufgabengebiet der Historikerkommission<br />
sein.<br />
Univ.-Prof. Dr. Georg Graf, Jurist, ist Professor am Institut für<br />
österreichisches und europäisches Privatrecht an der Universität Salzburg<br />
und ständiger Experte der Historikerkommission.<br />
1 Vgl. Erika Weinzierl, Oliver Rathkolb/Siegfried Mattl/Rudolf E.<br />
Ardelt: Richter und Gesellschaftspolitik. Symposion, Justiz und<br />
Zeitgeschichte am 12./13. Oktober 1995 in Wien. Studienverlag,<br />
Innsbruck 1997 (= Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann<br />
Instituts für Geschichte und Gesellschaft Band 28).<br />
130 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
DER NS-KUNSTRAUB<br />
Der<br />
Mauerbachfonds<br />
Während des Nationalsozialismus wurden rund 8000<br />
Objekte, vorwiegend Kunstgegenstände, Bilder, Plastiken,<br />
Möbel, Teppiche und Geschirr aus jüdischem<br />
Privatbesitz geraubt, deren frühere BesitzerInnen<br />
bzw. ihre Nachkommen nach dem Krieg nicht mehr<br />
eruiert werden konnten.<br />
1956 hatten die Alliierten in Österreich sichergestellte<br />
Kulturgüter der österreichischen Regierung mit der<br />
Auflage übergeben, deren EigentümerInnen oder<br />
ErbInnen ausfindig zu machen. Seither wurden rund<br />
10.000 Objekte zurückerstattet.<br />
Die restlichen 8000 Objekte wurden in der Kartause<br />
Mauerbach untergebracht. Die Kartause, die nach<br />
1945 als Obdachlosenasyl diente, wurde 1961 nach der<br />
Auflösung des unter Kaiser Joseph II. gegründeten<br />
Religionsfonds der Republik Österreich übereignet. Ab<br />
1979 übernahm die Bundesgebäudeverwaltung die<br />
bauliche Umgestaltung und Verwaltung. Seit 1994 ist<br />
das Bundesdenkmalamt einziger Gebäudenutzer.<br />
Aufgrund des von 1995 novellierten 2. Kunst- und<br />
Kulturbereinigungsgesetzes wurde die ➤ Israelitische<br />
Kultusgemeinde Österreich Eigentümerin des „Mauerbach-Schatzes“.<br />
Dieser wurde am 29. und 30. Oktober 1996 im Museum<br />
für angewandte Kunst in Wien durch das Auktionshaus<br />
Christie’s versteigert.<br />
Rund 155 Millionen Schilling wurden bei dieser<br />
Auktion ersteigert. Dieser Erlös wird nun vom Bundesverband<br />
der Israelitischen Kultusgemeinden<br />
Österreichs, der Arbeitsgemeinschaft der Opfer- und<br />
➤ KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs<br />
an bedürftige Opfer des Nationalsozialismus und<br />
deren Hinterbliebene verteilt. Davon wurden 12%<br />
zur Verteilung an nicht-jüdische Opfer des NS-Regimes<br />
übernommen, unter der Voraussetzung, dass diese<br />
Personen bisher keine Leistungen aus dem Nationalfonds<br />
der Republik Österreich erhalten haben. Die<br />
verbleibenden 88% wurden dem Zweck der Unterstützung<br />
bedürftiger jüdischer Überlebender im Inund<br />
Ausland gewidmet. Für diese Personen stellen<br />
bereits von der Republik Österreich erhaltene Leistungen<br />
keinen Ausschließungsgrund für eine Berücksichtigung<br />
dar, ebensowenig die Zuerkennung<br />
einer Leistung durch den Nationalfonds.<br />
Unter dem Namen „Mauerbach-Fonds“ wird der für<br />
bedürftige jüdische Überlebende und ihre Nachkommen<br />
bestimmte Erlös von einem Steering Committee<br />
verwaltet, dem Vertreter des Central Committee of<br />
Jews from Austria in Israel, des ➤ Committee for<br />
Jewish Claims on Austria, der ➤ World Jewish Restitution<br />
Organisation und des ➤ World Jewish Congress<br />
angehören.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Die Geschichte<br />
enteigneter Kunstgegenstände<br />
Die Beschlagnahme zweier Bilder von Egon Schiele<br />
während einer Ausstellung der Sammlung Leopold<br />
Anfang Jänner 1998 in New York mit dem Verdacht<br />
auf „Raubgut“ löste in Österreich eine heftige Debatte<br />
über den Verbleib von Kunstwerken, die zwischen<br />
1938 und 1945 enteignet worden waren, in<br />
österreichischen Museen aus.<br />
Es wurde rasch deutlich, dass sich trotz der in der unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit erlassenen Rückstellungsgesetze<br />
und auch teilweise erfolgter Rückstellungen<br />
heute noch immer viele während der NS-Zeit enteignete<br />
Kunstgegenstände im Besitz österreichischer<br />
Bundesmuseen befinden.<br />
Um zu klären, auf welchem Weg diese Kunstschätze in<br />
den Besitz des Bundes gelangten und wer die rechtmäßigen<br />
BesitzerInnen dieser Objekte sind, wurde von<br />
der Bundesministerin für Unterricht und kulturelle<br />
Angelegenheiten Elisabeth Gehrer im Februar 1998<br />
eine Kommission für Provenienzforschung im Bundesdenkmalamt<br />
und in den Bundesmuseen eingerichtet.<br />
Diese Kommission begann in den folgenden Monaten<br />
mit der Feststellung der Herkunft mehrerer<br />
tausend Kunstgegenstände in den österreichischen<br />
Bundesmuseen.<br />
Ein im Dezember 1998 erlassenes Bundesgesetz sollte<br />
die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den österreichischen<br />
Bundesmuseen und Sammlungen regeln,<br />
die entweder „im Zuge von Verfahren nach dem Ausfuhrverbotsgesetz<br />
zurückbehalten wurden und als<br />
‚Schenkungen‘ oder ‚Widmungen‘ in den Besitz der<br />
österreichischen Museen und Sammlungen eingegangen<br />
sind“, oder die „zwar rechtmäßig in das<br />
Eigentum des Bundes gelangt sind, jedoch zuvor<br />
Gegenstand eines Rechtsgeschäftes gewesen sind, das<br />
nach den Bestimmungen des so genannten Nichtigkeitsgesetzes<br />
aus dem Jahre 1946 nichtig ist“, bzw.<br />
„die trotz Durchführung von Rückstellungen nicht an<br />
die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger<br />
von Todes wegen zurückgegeben werden<br />
konnten und als herrenloses Gut in das Eigentum des<br />
Bundes übergegangen sind“.<br />
Im Dezember 1998 wurde außerdem ein Rückgabe-<br />
Beirat eingesetzt, der den Wirtschaftsminister, den<br />
Verteidigungsminister und die Kulturministerin in der<br />
Frage der Rückstellung von Kunstobjekten an rechtmäßige<br />
BesitzerInnen bzw. deren ErbInnen zu beraten<br />
hat.<br />
Im Februar 1999 legte der Beirat einen ersten Bericht<br />
vor über im Bundesbesitz befindliche Kunstschätze der<br />
Rothschild-Sammlung, die in der Folge zurückgestellt<br />
wurden. Weitere Rückstellungen enteigneter Kunstobjekte<br />
sollen noch im Laufe des Jahres 1999 erfolgen.<br />
131
Interview mit Hannah Lessing<br />
„Bei uns werden alle berücksichtigt“<br />
Wie ist die Gründung des ➤ Nationalfonds zustande gekommen, auf wessen<br />
Initiative und Betreiben hin?<br />
Lessing: Geredet hat man schon lange darüber, aber plötzlich ist alles sehr rasch ins Laufen<br />
gekommen. In einem Club 2, 1988, hat ➤ Albert Sternfeld gemeint, dass wir in zehn Jahren<br />
immer noch kein Resultat haben werden. Man hat schon damals dauernd danach gefragt,<br />
wann jetzt endlich etwas passiert. 1991 hat Franz Vranitzky in einer Rede von geplanten<br />
Aktivitäten gesprochen, die Grünen haben 1992, 1993 ebenfalls Forderungen in dieser<br />
Richtung gestellt. Sicher ist Sternfeld ein Faktor und ebenfalls die Friedensinitiative von<br />
➤ Döllersheim, als man überlegt hat, wie es zu bewerkstelligen ist, dass man einfach allen<br />
Opfern irgendwie hilft. Warum es dann plötzlich wirklich zu der Fünf-Parteien-Einigung gekommen<br />
ist, ist relativ unklar. Aber es waren dann im Parlament alle so weit, dass sie gesagt<br />
haben, jetzt machen wir das. Es haben sich nur die Grünen wegen der gesetzlich festgesetzten<br />
Höhe der Summe, die ausbezahlt werden soll, nicht einverstanden erklärt. Hinzu<br />
kam noch, dass die Präambel zum Gesetz, in der die Mitschuld der Österreicher an NS-<br />
Verbrechen anerkannt wurde, abgelehnt worden ist, hauptsächlich von der ÖVP.<br />
Worin liegen die Zielsetzungen und zentralen Aufgaben des Fonds?<br />
Durch die Errichtung des Nationalfonds soll die moralische Mitverantwortung und das Leid,<br />
das den Menschen in Österreich durch den Nationalsozialismus zugefügt wurde, anerkannt<br />
werden und den Opfern in besonderer Weise Hilfe zukommen, wobei wir natürlich wissen,<br />
dass das zugefügte Leid nicht wieder gut gemacht werden kann. Das ist wirklich eine der<br />
Hauptzielsetzungen des Fonds. Aus der Sicht der Mitarbeiter des Fonds war neben der materiellen<br />
Geste, die uns vom Gesetz vorgegeben ist, entscheidend, dass dieser Versöhnungsversuch<br />
wesentlich stärker im Vordergrund steht. Darum der Parteienverkehr, die Möglichkeit, bei<br />
uns zu reden, zu weinen, zu brüllen, zu schreien, die Möglichkeit, uns immer anzutreffen, telefonisch,<br />
per Fax, persönlich. Ich habe auf meinen Dienstreisen Kontakt mit den Menschen<br />
gesucht, bei Veranstaltungen mit mehr als 700 Leuten, das ist wirklich wichtig für uns. Ich<br />
sag’s auch immer wieder in Vorträgen, dass ich meine, dass der Fonds von unserer Seite, von<br />
den Mitarbeitern und auch nach der Auffassung von Nationalratspräsident Fischer, ein Versuch<br />
der Versöhnung ist. Und wir sind wirklich jeden Tag erstaunt, wie gut unsere Arbeit ankommt,<br />
wie die Leute reagieren, dass sie froh sind, dass man überhaupt mit ihnen spricht! Es<br />
ist beschämend, aber so ist es. Und auf dieser Basis arbeiten wir heute weiter.<br />
Für welche Opfergruppen ist der Fonds zuständig und für welche nicht?<br />
Einerseits gibt es das Gesetz, das 70.000 Schilling pro Person für alle Opfer des Nationalsozialismus<br />
vorsieht, und andererseits, was aus diesem Gesetz gemacht worden ist auf der<br />
menschlichen Ebene: der Versuch der Versöhnung, Brücken zu schlagen, den Leuten wirklich<br />
zeigen, dass wir da sind, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen. Im Gegensatz zur ➤ MA<br />
12 1 sind bei uns alle Opfergruppen berücksichtigt, d.h. auch die Homosexuellen, die Zeu-<br />
132 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
gen Jehovas und die sogenannten „Asozialen“. Das sind die großen Gruppen, die bei der<br />
MA 12 nicht berücksichtigt sind. Bei den „Asozialen“ haben wir z.B. einen sehr schönen Erfolg<br />
gehabt: Wir haben im Nationalfonds die ehemaligen „Kinder vom ➤ Spiegelgrund” 2<br />
anerkannt. Sie sind dann in der Folge auch von der MA 12 anerkannt worden. Diese Kinder<br />
bekommen heute eine Opferrente. Das einzige Problem, das ich noch sehe, ist, dass die<br />
Opfer vielleicht noch nicht wirklich realisiert haben, ist, dass sie in der Opferfürsorge weiterhin<br />
nicht unter dem anerkannt sind, als was sie damals verfolgt wurden, nämlich als sogenannte<br />
„Asoziale“. Sie wurden jetzt unter die Gruppe der Behinderten gefaßt, was wirklich<br />
absurd ist. Sie sind vielleicht behindert aus diesen „Heimen“ herausgekommen, nachdem sie<br />
z.B. mit Schwefel gespritzt worden sind, aber sie sind damals als „Asoziale“ verfolgt und interniert<br />
worden. Ich weiß, dass es immer wieder an verschiedenen Opfervertretungen scheitert;<br />
besonders die Freiheitskämpfer sagen, „Asoziale sind eben Verbrecher“. Es ist ein Faktum,<br />
dass zwischen den Opfergruppen immer wieder solche Streitigkeiten bestehen, und ich<br />
versuche mich so wenig wie möglich einzumischen. Aber in puncto Recht muß hier einfach<br />
etwas geschehen. Hier geht es um wirkliche Opfer, die in Kinder-KZs waren. Denen muss<br />
man helfen, und jetzt haben die meisten eben eine Opferrente. Das sind Opferrenten für Invalidität<br />
etc. Sie haben nicht nur die ➤ Amtsbescheinigung 3 für Emigration oder für Verfolgung,<br />
sondern es wurde anerkannt, dass der Spiegelgrund einem KZ gleichzustellen ist. Das<br />
ist zwar wenig, trotzdem haben sie jetzt teilweise wirklich eine wesentliche Verbesserung ihrer<br />
Lebensqualität. Viele dieser Menschen haben es nie geschafft, ein wirkliches Leben aufzubauen,<br />
viele von ihnen waren später HilfsarbeiterInnen, sind heute fast alle MindestrentnerInnen.<br />
Ein weiterer Unterschied ist, dass die MA 12 die Witwen von Opfern immer schon<br />
anerkannt hat. Wir haben das erst vor zwei Jahren gemacht, weil es bei uns immer es hieß:<br />
nur direkt Betroffene. Ich habe das immer ein bißchen seltsam gefunden, denn ich möchte<br />
nicht wissen, wie das ist, in einem kleinen Dorf zu leben, wenn der Mann damals etwa als<br />
Widerstandskämpfer hingerichtet wurde und keine Lebensmittelkarten da waren. Aber im<br />
Allgemeinen ist es eher so, dass bei uns mehr anerkannt ist als bei der MA 12. Das sind<br />
ganz zwei verschiedene Einrichtungen. In der MA 12 bekommen erstens nur österreichische<br />
Staatsbürger einen ➤ Opferausweis oder eine Amtsbescheinigung, und nur Amtsbescheinigungsbesitzer<br />
bekommen eine Opferrente. Die Opferfürsorge hat mehr als 40 Novellen erlebt,<br />
z.B. waren ➤ Shanghai und Mauritius lange Zeit nicht als ➤ Getto anerkannt usw. Das<br />
Opferfürsorgegesetz ist ja immer stückerlweise erweitert worden.<br />
Wer leistet die Arbeit des Fonds? Wie sieht die personelle Zusammensetzung aus?<br />
Repräsentiert wird der Fonds von einem Kuratorium, das sind 21 Mitglieder, dem u.a. die<br />
drei Nationalratspräsidenten, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Außenminister, VertreterInnen<br />
der einzelnen Parlamentsfraktionen und anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen,<br />
kulturellen und wissenschaftlichen Lebens Österreichs angehören, sowie VertreterInnen<br />
der betroffenen Opfer (u.a. Erika Weinzierl, Paul Grosz, ehemaliger Präsident der Israelitischen<br />
Kultusgemeinde, Superintendentin Gertraud Knoll und Weihbischof Helmut Krätzl).<br />
Das Personal besteht aus einer Generalsekretärin, zwei Referentinnen, einer Juristin, einer<br />
Büroleiterin, die das Sekretariat mit drei Sekretärinnen leitet, und sechs WerkstudentInnen.<br />
Ihre Aufgabe liegt im Parteienverkehr sowie in der Bearbeitung und Prüfung der Fragebögen,<br />
die ich dann nur mehr überblicksmäßig kontrollieren muss.<br />
Wie macht sich der Fonds seiner Zielgruppe bekannt, im In- und Ausland?<br />
Wir haben keine Inserate geschaltet, sondern zum Glück in den Medien sehr gute Verbündete<br />
gefunden, es ist ja auch unter Anführungszeichen eine „schöne Geschichte, weil wir<br />
sind sehr stolz auf das, was wir tun“ – spät, aber doch. Ich war viel im Fernsehen, und es<br />
stand auch viel in den Zeitungen. Immer wieder zu bestimmten Anlässen, z.B. am 5. Mai,<br />
aus Anlass des „Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer<br />
des Nationalsozialismus“. Immer wieder haben sich dann doch ehemalige Opfer gemeldet.<br />
Einerseits, weil sie vorher von uns nicht gewusst haben, oder andererseits, weil sie bisher<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Hannah Lessing<br />
133
Bei uns werden alle berücksichtigt<br />
NATIONALFONDS DER REPUBLIK ÖSTERREICH FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS<br />
Am 1. Juni 1995 wurde im Nationalrat das Bundesgesetz<br />
über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer<br />
des Nationalsozialismus verabschiedet.<br />
Repräsentiert wird der Nationalfonds von einem 21köpfigen<br />
Kuratorium, dem u.a. die drei Nationalratspräsidenten,<br />
der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Außenminister,<br />
Vertreter der einzelnen Parlamentsfraktionen<br />
und anerkannte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen,<br />
kulturellen und wissenschaftlichen Leben sowie VertreterInnen<br />
der Betroffenen angehören.<br />
Zur Generalsekretärin des Fonds wurde Frau Mag. Hannah<br />
Lessing ernannt, die in Zusammenarbeit mit weiteren<br />
acht MitarbeiterInnen und mehreren WerkstudentInnen<br />
die Aufgaben des Fonds, wie Bearbeitung der Anträge,<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Personenverkehr, Recherche etc.,<br />
durchführt.<br />
Das Ziel des Fonds liegt darin, die moralische Mitverantwortung<br />
Österreichs an den nationalsozialistischen<br />
Verbrechen anzuerkennen und die besondere Verantwortung<br />
gegenüber den Opfern zum Ausdruck zu bringen.<br />
Somit sind die Leistungen des Fonds vor allem auch als<br />
moralische Geste zu verstehen.<br />
Die Leistungen des Fonds – primär einmalige Geldleistungen<br />
zwischen 70.000 und 210.000 Schilling – werden<br />
insbesondere an Personen im In- und Ausland vergeben,<br />
die bisher keine oder nur eine völlig unzureichende<br />
Leistung durch die Opferfürsorge erhalten, die in besonderer<br />
Weise der Hilfe bedürfen oder bei denen eine<br />
Unterstützung aufgrund ihrer Lebenssituation, z.B. bei<br />
Krankheit, gerechtfertigt erscheint. Dazu gehören Personen,<br />
die aus politischen Gründen, aus Gründen der<br />
Abstammung, Religion, Nationalität, der sexuellen Orientierung,<br />
aufgrund einer körperlichen oder geistigen<br />
Behinderung oder aufgrund des Vorwurfes der sogenannten<br />
„Asozialität“ verfolgt wurden, die auf andere<br />
Weise Opfer typisch nationalsozialistischen Unrechts<br />
geworden sind oder das Land verlassen haben, um einer<br />
solchen Verfolgung durch das nationalsozialistische<br />
Regime zu entgehen.<br />
Bis 31. Dezember 1998 erfolgten rund 25.000 Auszahlungen<br />
an Opfer des Nationalsozialismus oder deren<br />
Hinterbliebene.<br />
Weiters kann der Fonds auch Projekte unterstützen,<br />
die den Opfern des Nationalsozialismus zugute kommen<br />
oder der wissenschaftlichen Erforschung des Nationalsozialismus<br />
und des Schicksals seiner Opfer dienen, an<br />
das nationalsozialistische Unrecht erinnern oder das<br />
Andenken der Opfer wahren.<br />
nicht wollten oder kein Interesse hatten, doch dann haben sie sich trotzdem dafür entschieden.<br />
Im Ausland haben wir uns durch meine Reisen bekannt gemacht. Ich war bis jetzt in<br />
Australien, Amerika, Israel, Frankreich und England. Da habe ich auch sehr viele Pressekonferenzen<br />
und Fernsehinterviews gegeben. In Israel war es ein Vorteil, dass ich Hebräisch<br />
spreche und daher auch die Menschen überzeugen konnte, dass man uns „vertrauen“<br />
kann. Die Vertrauensbasis ist für uns sehr wichtig.<br />
Gibt es eine Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländischen<br />
Organisationen und Verbänden?<br />
Ja, einerseits natürlich mit den Vertretungsbehörden, Botschaften und Konsulate helfen uns<br />
sehr. Zu manchen Ländern ist der Kontakt besonders intensiv, zum Beispiel zu England und<br />
zu Israel. Dort gibt es auch eine gute Sozialabteilung, und die kümmern sich um Staatsbürgerschaften<br />
und Pensionen und sind wirklich sehr bemüht, Amerika auch, also zu den drei<br />
großen Ländern, wo heute noch viele betroffene Menschen leben. Im Inland arbeiten wir mit<br />
allen Opfervertretungen zusammen, eben mit den verschiedenen Roma-Organisationen, mit<br />
den ➤ KZ-Verbänden und Freiheitskämpfer-Verbänden, mit der ➤ Kultusgemeinde, mit den<br />
ZeugInnen Jehovas usw. Wir sind natürlich sehr intensiv mit den verschiedenen Ämtern in<br />
Kontakt, mit der ➤ MA 61, 4 ➤ MA 8 5 und MA 12, die die Vorakten haben. Die Opfer sind<br />
aber auch untereinander anscheinend sehr in Kontakt. Gerade in Südamerika haben wir eigentlich<br />
kaum recherchieren müssen, wir haben gleich am Anfang enorm viele Anfragen bekommen.<br />
Die Frage ist jetzt, ob wir glauben, dass noch irgendwo jemand sitzt, den wir nicht<br />
gefunden haben. Wir haben aber etwa in Argentinien z.B. 400 Antragsteller, sie sind sowohl<br />
über die Botschaften als auch über die jüdischen Kultusgemeinden organisiert, es sind<br />
ja hauptsächlich jüdische Opfer im Ausland. Dort wüssten die Konsulate und die Botschaften<br />
vermutlich, wenn sie jemanden noch nicht gefunden hätten. Ein Land, das problematisch ist,<br />
ist höchstwahrscheinlich England, weil dort zum Teil viele sehr kleine Kinder mit Kindertransporten<br />
hinübergekommen sind, die ihre Eltern im KZ verloren haben und von englischen<br />
Familien aufgenommen wurden. Sie haben ihre österreichischen und ihre jüdischen Wurzeln<br />
134 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
verloren. Sie werden sich in keiner jüdischen Zeitung angesprochen fühlen und erkennen,<br />
dass es jetzt einen Fonds gibt, der für sie zuständig ist. Es kommt darauf an, in welchem<br />
Bewusstsein diese Kinder aufgewachsen sind und ob sie von ihren Pflegeeltern darüber informiert<br />
wurden, dass sie jüdische Kinder sind, die geflohen und eigentlich Österreicher sind.<br />
Wie man sie erreichen könnte, weiß ich bis heute nicht. Wir werden sicher jetzt einmal versuchen,<br />
mit der Pensionsversicherung Listen zu vergleichen. Wir haben jetzt noch AntragstellerInnen<br />
dazu bekommen, weil sich manche aufgrund des ➤ Mauerbach-Fonds an die Kultusgemeinde<br />
gewendet haben, die bisher bei uns nicht erfasst waren. Wir haben sie dann angeschrieben<br />
und gefragt, ob wir ihnen irgendwelche Unterlagen zukommen lassen können<br />
usw. Da versuchen wir wirklich auch weiterhin aktiv zu bleiben.<br />
Wie viele Anträge sind pro Jahr vom zur Verfügung stehenden Personal zu bearbeiten?<br />
Im ersten Jahr, im Oktober 95, da haben wir 200 Anträge bearbeitet, aber im nächsten<br />
Jahr waren es über 8000, je nach Budget eben. Im 96er Jahr haben wir 600 Millionen voll<br />
ausgeschöpft mit über 8000 Anträgen, im 97er Jahr ebenfalls, 1998 haben wir 500 Millionen<br />
voll ausgeschöpft. Das waren 7000 Anträge.<br />
Wie sieht der Kontakt zwischen den AntragstellerInnen und dem Fonds aus?<br />
In den ersten Monaten haben wir zwei volle Postsäcke pro Tag erhalten – zehn Kilo schwer.<br />
Wir haben an die 200 bis 300 Anträge pro Tag hereinbekommen. Daher haben wir im ersten<br />
Monat auch überhaupt niemandem bestätigen können, dass sein Antrag da ist. Wir haben<br />
von acht Uhr früh bis zwei Uhr nachts durchgearbeitet, weil wir auch nicht bereit waren,<br />
jede Woche nur 100 Fragebögen auszuschicken. Wir hatten am Anfang 10.000 Adressen,<br />
und an die haben wir innerhalb von einer Woche alle Fragebögen geschickt. Und so sind<br />
sie dann auch zurückgekommen. Im ersten Jahr ein geringer Teil, 1996 und 1997 waren<br />
dann die intensivsten Jahre. Das Geld ist aber trotzdem auch so bemessen worden, dass<br />
man überlegt hat: Wie viele MitarbeiterInnen gibt es, wie viele Anträge könnt ihr bewältigen<br />
bei dieser MitarbeiterInnenzahl? Wissend, dass wir nicht zwei Milliarden innerhalb eines<br />
Jahres bekommen werden, hat man es einfach vernünftig aufgeteilt. 600 Millionen pro Jahr<br />
ist nicht wenig. 1998 waren es 500 Millionen, und jetzt sind es 150 Millionen, weil natürlich<br />
weniger Anträge eintreffen. Nochmals zurück zum Kontakt mit den AntragstellerInnen:<br />
Wie gesagt, je nachdem, wo sie leben oder ob sie gerade in Wien auf Urlaub sind, können<br />
sie hierher kommen, viermal in der Woche von 9 bis 12, Montag bis Donnerstag. Meistens<br />
erzählen sie einfach ihre Geschichte, der Fragebogen ist ja relativ schnell ausgefüllt, aber<br />
wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute dann doch sehr gern eine halbe<br />
Stunde bis Stunde einfach reden. Sie wollen reden, und sie kommen auch immer wieder, der<br />
Kontakt ist rege. Diese Menschen brauchen einfach eine Anlaufstelle für ihre Sorgen, und wir<br />
waren eben die erste Anlaufstelle, und wir sind bereit, diese Menschen mit all ihren Sorgen<br />
und Krankheiten einfach so zu nehmen, wie sie sind, und wirklich da zu sein für sie. Denn<br />
dieser Kontakt macht den Unterschied. Wir wollen jetzt z.B. eine Aktion starten, dass wir in<br />
jedem Fragebogen die letzte Wohnadresse raussuchen, den Betroffenen dieses Haus fotografieren<br />
und das Foto schicken. Ich weiss, dass viele Leute immer noch von ihrem alten Haus<br />
träumen. Es sind einfach so kleine Sachen, die kosten nicht viel, sind kein großer, nur ein<br />
bißchen Mehraufwand und wieder eine Kontaktaufnahme. Wir sehen oft, dass Menschen,<br />
denen wir geschrieben haben, sehr positiv reagieren und sich freuen, dass es nicht nur mit<br />
den 70.000 Schilling endet, sondern, dass wir sie weiter informieren. Das ist der Kontakt,<br />
der meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Wir sind natürlich auch öfter damit konfrontiert,<br />
dass wir etwas ausgelöst haben, das wir nicht kontrollieren und schon gar nicht heilen<br />
können. In solchen Fällen versuchen wir irgendwie, die Leute dazu zu überreden, sich im<br />
➤ ESRA 6 oder im PSD 7 zu organisieren. Denn manchmal gibt es wirklich Zusammenbrüche.<br />
ESRA ist für uns eine sehr wichtige Institution. Dort besteht die Möglichkeit zu Einzel- oder<br />
Gruppentherapie auf Krankenschein, und es gibt mittlerweile eine eigene Gruppe für die<br />
„Kinder vom Spiegelgrund“; wir machen dort auch unsere Supervision.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Hannah Lessing<br />
135
Bei uns werden alle berücksichtigt<br />
Wie erfolgen Antragstellung auf etwaige Entschädigungszahlungen (Betreuung,<br />
Fristen, Verfahrensdauer) und deren Bearbeitung?<br />
Der Fragebogen ist relativ einfach auszufüllen. Die Betreuung erfolgt wie gesagt im Parteienverkehr<br />
oder telefonisch oder andernfalls durch die Botschaften oder Konsulate, die auch beim<br />
Ausfüllen helfen. Einreichfristen gibt es keine. Die Verfahrensdauer hängt vom Alter und vom<br />
Krankheitszustand der Antragsteller ab. Wir haben bis jetzt nach Altersgruppen ausbezahlt,<br />
d.h. wenn zum Beispiel jetzt, wo wir den Geburtsjahrgang 1942 auszahlen, ein/e 1917 Geborene/r<br />
einreicht, wird sein/ihr Antrag natürlich sofort bearbeitet. Wenn wir alle Unterlagen<br />
haben, wird er/sie in der nächsten Komiteesitzung bearbeitet. Komiteesitzungen gibt’s im Prinzip<br />
alle sechs Wochen, und dann dauert es meistens aufgrund der langwierigen Bankwege<br />
noch einmal acht Wochen, bis der/die Antragsteller/in sein/ihr Geld erhält. Prinzipiell kann<br />
die Frist jedoch sehr kurz sein. Aber es kann auch sein, dass ein/e 1944 Geborene/r im Dezember<br />
1995 bei uns eingereicht hat, der/die gesund ist und kein Sozialfall und daher nicht<br />
vorzuziehen ist. Er/sie kommt eben erst jetzt an die Reihe. Die Verfahrensdauer kann also datumabhängig<br />
sein oder auch nicht, je nachdem, ob wir die entsprechenden Dokumente finden.<br />
Wir haben teilweise Fälle, die seit einem Jahr in der Recherche sind. Das betrifft Menschen,<br />
die überhaupt keine Dokumente mehr haben, die aus Dörfern stammen, wo alle Archive<br />
zerstört worden sind, wo wir einfach nach Anhaltspunkten suchen, um diese Geschichte<br />
plausibel zu rekonstruieren. Einen Fall, der nicht durchgehend dokumentierbar ist, versuchen<br />
wir über intensive Recherchen zumindest plausibel zu machen. Falls kein Amt mehr Unterlagen<br />
zur Verfügung hat, geben wir nicht auf, sondern wir machen die absurdesten Recherchen und<br />
suchen mit den Antragstellern zusammen nach Anhaltspunkten, wo wir weitersuchen könnten.<br />
Ein Beispiel für ausgefallene Recherchen: Wir konnten anhand der Jahrbücher des Wiener Eislaufvereins<br />
nachweisen, dass eine Dame damals dort aktives Mitglied war, also auch ihren<br />
Wohnsitz in Wien hatte. Wir akzeptieren aber auch Straßenbahnkarten, die manche aufgehoben<br />
haben. Es sind hauptsächlich WerkstudentInnen, die diese Recherchen machen.<br />
Worin liegen die speziellen Probleme in der Praxis der Bearbeitung von Anträgen?<br />
Wenn ein/e Antragsteller/in auch nach mehrmaligen Rückfragen nicht bereit ist, uns mit Anhaltspunkten<br />
irgendwie entgegenzukommen, dann lehnen wir das nach einem Jahr oder<br />
zwei Jahren ab. Manchmal kann eine Recherche schon ein, zwei Jahre laufen. Aber<br />
irgendwann einmal muss der Akt fertig gemacht werden, weil es auch keinen Sinn hat,<br />
wenn wir einfach keine Anhaltspunkte finden. Wir brauchen zum Beispiel den Namen der<br />
Eltern oder den genauen Geburtsort, damit wir uns an die entsprechenden Archive wenden<br />
können. Wenn man uns keine Geburtsdaten und Namen gibt, können wir nichts machen.<br />
Und das ist nicht böswillig, wir können es einfach nicht. Schwierig ist es auch, wenn die Leute<br />
zu alt oder zu krank sind oder sich nicht mehr erinnern können. Ihre Kinder sind aber meistens<br />
sehr kooperativ. Häufig genügen auch zwei Zeugenaussagen, um eine Darstellung<br />
plausibel zu machen. Es ist aber manchmal wirklich schwierig, denn wenn jemand 95 Jahre<br />
alt ist, ist auch die Anzahl an ZeugInnen schon sehr gering. Aber es ist nicht so, dass wir in<br />
solchen Fällen prinzipiell ablehnen oder abgelehnt haben. Von insgesamt 28.000 eingereichten<br />
Anträgen wurden bis jetzt 1600 abgelehnt. Wobei sehr viele dieser Ablehnungen<br />
daraus resultieren, dass die Antragsteller gar nicht anspruchsberechtigt sind, wie jemand,<br />
der/die 1965 geboren ist und mit Spätfolgen argumentiert, oder ein Wehrmachtssoldat, der<br />
meint, er sei ein Opfer gewesen, oder jemand, dem man 1942 sein Motorrad geklaut hat.<br />
Wird bei Zahlungen zwischen einzelnen Opfergruppen unterschieden?<br />
Bei uns gibt es keine Unterscheidung zwischen den Opfergruppen. Bei mir gibt es kein rotes<br />
J, keinen schwarzen oder roten Winkel. 70.000 Schilling für jeden, und wer Sozialfall ist,<br />
kann bis zum Dreifachen bekommen. Der Sinn des Nationalfonds war, dass man dieses Mal<br />
gesagt hat, es soll eine Direkthilfe sein, und daher ist das Geld nicht für Organisationen bestimmt.<br />
Es wird zwar durch Projekte, die wir unterstützen, auch etwas an Organisationen gezahlt,<br />
aber prinzipiell galt immer die Maxime der Individualzahlungen. Und ich glaube, auch<br />
136 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
deswegen ist der Fonds so gut angekommen, weil das die erste Organisation ist, die wirklich<br />
Individualzahlungen macht, wo das Geld wirklich zum Opfer direkt aufs Konto kommt. Österreich<br />
hat zwar viele Projekte unterstützt, in Israel Altersheime ausgebaut usw., aber das kam<br />
nicht den einzelnen Opfern zugute. Wir haben aber von Anfang an wirklich immer betont,<br />
dass es eine symbolische Geste für alle Opfer sein soll. Wir bewerten kein Leid, das ist auch<br />
nicht möglich, etwa jenes derer, die im KZ waren, derer, die jetzt wieder die österreichische<br />
Staatsbürgerschaft erhalten haben, die durch die Amtsbestätigung ihr Leid bescheinigt bekommen<br />
haben. Also ich finde es fürchterlich, und ich glaube auch nicht, dass man etwas<br />
machen kann. Es ist nämlich aufgrund der Erfahrung, die wir hier gemacht haben, öfter zu<br />
sehen gewesen, dass jemand, der das KZ zum Beispiel überlebt hat, recht gut damit umgehen<br />
kann und eigentlich dadurch sehr stark geworden ist, dass aber andere Menschen an<br />
der Emigration zerbrochen sind. Man kann einfach nicht beurteilen, wer mehr gelitten hat.<br />
Wie sieht das Verhältnis zwischen den Antragstellungen und den<br />
tatsächlichen Zahlungen aus?<br />
Insgesamt sind ca. 28.000 Fragebögen eingelangt, Zahlungen sind bis 25. April ca.<br />
25.881 erfolgt. Ja, wir haben 30.000 Adressen im Computer. Es passiert auch, dass sich<br />
einige Leute gemeldet haben, die keinen Anspruch haben, das wird sich erst herausstellen.<br />
Wir sammeln einfach Adressen und bekommen immer wieder neue Namen.<br />
Wie viele Opfer konnten bisher erfasst werden, wie viele Opfer sind Ihrer Einschätzung<br />
nach noch nicht vom Fonds erfasst? In welchem Ausmaß sind die Anträge<br />
in den Jahren seit der Gründung des Nationalfonds 1995 zurückgegangen?<br />
Erstens besteht die Frage, wen definieren wir jetzt als Opfer, welche Gruppen sind bisher<br />
noch nicht berücksichtigt, welche sind noch nicht vom Gesetz gedeckt? Zum Beispiel gibt es<br />
eine benachteiligte Gruppe, die wir vielleicht jetzt aufnehmen werden: alle aus Deutschland<br />
Geflohenen, die 1933 nach Österreich gekommen sind. Sie waren deutsche Staatsbürger,<br />
sind in ein deutschsprachiges Land geflohen und 1938 weiter vertrieben worden.<br />
Diese Gruppe ist weder bei uns erfasst noch in der deutschen Opferfürsorge. Aber es ist<br />
fast unmöglich einzuschätzen, wieviele dieser Menschen noch nicht erfasst sind. Einerseits<br />
jene, die noch nicht vom Nationalfonds wissen, das, glaube ich, sind aber eher wenige, jene,<br />
die nicht wollen, das sind sicher noch ein paar, aber auch nicht viele, weil wir sehr viel<br />
Überzeugungsarbeit geleistet haben. Wir haben uns nicht einfach damit zufriedengegeben<br />
– „wer sich nicht meldet, will nicht“ –, sondern wir haben wirklich Aufrufe gemacht. Auch<br />
im Fernsehen über „Hallo Austria, hallo Vienna“, dreimal bis jetzt. Wie viele nach dem<br />
Gesetz Anspruchsberechtigte gar nicht eingereicht haben, ist relativ unklar, aber wir schätzen,<br />
dass es so um die 1000 sind. Wir haben am Anfang Hunderte von Anträgen pro Tag<br />
erhalten, jetzt sind es ca. 20 in der Woche, das ist aber nicht wenig. Auch in Österreich<br />
haben sich jetzt noch sehr viele Hinterbliebene gemeldet.<br />
Wie sind die Zahlungen des Fonds zu verstehen, als Entschädigungsleistung, als<br />
Wiedergutmachung, als fürsorgerische Maßnahme, als „moralische Geste“,<br />
als „Tropfen auf dem heißen Stein“?<br />
In unseren Papieren, Vorträgen usw. wird nie von Wiedergutmachung oder Entschädigung<br />
gesprochen. Es ist eine symbolische, moralische Geste der Republik. Wir waren immer ehrlich<br />
und haben gesagt, es ist nicht als Entschädigung oder als Wiedergutmachung zu<br />
sehen, weil auch nichts wieder gut gemacht werden kann und weil auch eine Million mir<br />
meine Großmutter nicht aus Auschwitz zurückbringt. Es war das, was zu der Zeit an Budgetmitteln<br />
möglich war, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihnen doch<br />
ein wenig zu helfen. Es gibt wirklich genügend Menschen, für die 70.000 Schilling wahnsinnig<br />
viel Geld ist. Und wenn jemand wirklich sozial bedürftig ist – wie zum Beispiel ein<br />
Mann, der viele Jahre querschnittgelähmt ist, in einem Haus wohnt, in dem es keinen Aufzug<br />
gibt, und jetzt sind in Israel die Betreuungsstunden zurückgeschnitten worden und er<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Hannah Lessing<br />
137
Bei uns werden alle berücksichtigt<br />
wird nicht mehr betreut, er sitzt jetzt einfach nur mehr in seiner Wohnung und kann sich mit<br />
dem, was er hat, keine Hilfe leisten –, jetzt unterstützen wir ihn als Sozialfall, um irgendwie<br />
den Bau eines Aufzuges zu ermöglichen. Wenn ein Aufzug dort ist, dann ist seine Lebensqualität<br />
um 1000 Prozent gestiegen. Das sind eben die Sachen, die wir versuchen. Das ist<br />
dann schon mehr als eine moralische Geste, aber es ist auf keinen Fall Wiedergutmachung<br />
oder Entschädigung. Und natürlich ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt,<br />
zu welchen Ergebnissen höchstwahrscheinlich die Historikerkommission kommen<br />
wird, bezüglich dessen, was alles geraubt worden ist.<br />
Wird der Nationalfonds in Zukunft mögliche Zahlungen an ehemalige ZwangsarbeiterInnen<br />
übernehmen?<br />
Alles ist startbereit. Ich habe hier bereits Adressen von fast allen Überlebenden in Russland,<br />
mit Angaben der Bauern, wo sie gearbeitet haben, von wann bis wann etc. Natürlich bin<br />
ich mit der Organisation in der Russischen Föderation in Kontakt, ebenso mit der Ukraine.<br />
Es ist uns jetzt mit Hilfe der Grünen und der Liberalen gelungen, das Gesetz zu ändern, so<br />
dass wir von jedem Rechtsträger Geld annehmen dürfen, ohne vertraglich verpflichtet zu<br />
sein, nur an die jeweiligen Opfergruppen, die er mir definiert, auszuzahlen. Allerdings<br />
wird das unter Umständen Einzel- oder ➤ Sammelklagen gegen diese Firmen nicht verhindern<br />
können. Das ist meiner Meinung nach der größte Problempunkt. Ein weiterer entscheidender<br />
Grund für die Verzögerung liegt auch darin, dass jetzt Wahlzeit (Herbst 1999) ist.<br />
Es ist nicht sehr populär, in Zeiten von Sparpaketen Milliarden von Schillingen an frühere<br />
Zwangsarbeiter zu zahlen. Meiner Meinung nach wird die Regierung trotzdem einen<br />
Großteil dessen zahlen müssen. Die Firmen werden nicht bis zu fünf Milliarden aufbringen<br />
können. Ich rechne mit über 100.000 Überlebenden. Wenn jeder 35.000 Schilling<br />
bekommt, dann haben wir 3,5 Milliarden, mit administrativen Kosten usw. kommen wir auf<br />
4 Milliarden. Ich glaube nicht, dass die großen Firmen das allein aufbringen können. Die<br />
kleinen Firmen schon gar nicht, es darf nicht existenzbedrohend sein für eine Firma, das<br />
Ganze hat keinen Sinn, wenn dann Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen.<br />
Ein Großteil der ZwangsarbeiterInnen war in der Landwirtschaft tätig,<br />
wer zahlt für diesen Bereich?<br />
Zwar laufen die Klagen über die Landwirtschaftskammer, aber trotzdem wird der Staat<br />
zahlen müssen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Bremsfaktor. Ich versuche das jetzt in<br />
der Öffentlichkeit so darzustellen, dass es kein Wahlkampfthema sein müsste, wenn man den<br />
Fonds mit dieser Gesetzesänderung den Firmen als Instrument der Verteilung anbietet. Dann<br />
wäre schon einmal ein Anfang gemacht. Ich kann die Schuld einer Firma nicht bemessem<br />
und ich werde das auch nicht tun. Ich werde jedes Geld annehmen, und da bin ich mir nicht<br />
zu schade und sage einfach: „Danke schön, ich werde es verteilen.“ Weil jeder Groschen,<br />
den wir erhalten, kommt den Opfern zugute. Ob das jetzt die Schuld der Firma wett macht,<br />
ist für mich nicht so wichtig. Der Fonds ist ein reines Verteilungsinstrument und eine Anlaufstelle<br />
für die Opfer. Und je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich den Opfern helfen.<br />
1 Magistratsabteilung 12: Sozialamt der Stadt Wien, inkl. Opferfürsorgereferat;<br />
in den Bundesländern liegt die Zuständigkeit bei<br />
den Sozialreferaten der einzelnen Bezirkshauptmannschaften bzw.<br />
der Bezirksämtern; die Tätigkeit sowohl der MA 12 als auch der Sozialreferate<br />
der Länder basiert auf dem Opferfürsorgegesetz.<br />
2 „Am Spiegelgrund”: Auf dem Gelände der Heil- und Pflegeanstalt<br />
„Am Steinhof“ waren während der NS-Zeit drei Einrichtungen zur<br />
Internierung von Kindern und Jugendlichen untergebracht; siehe<br />
dazu den Artikel von Jana Müller, „Kinder und Jugendliche als<br />
Opfer der NS-Verfolgung“, in diesem Band.<br />
3 Vgl. den Text von Brigitte Bailer-Galanda, „Die Maßnahmen der Re-<br />
Mag. Hannah Lessing ist Generalsekretärin des<br />
„Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus“<br />
publik Österreich für die Widerstandskämpfer und Opfer des<br />
Faschismus – Wiedergutmachung“, in diesem Band.<br />
4 Magistratsabteilung 61: Staatsbürgerschafts- und Personenstandsangelegenheiten.<br />
5 Magistratsabteilung 8: Wiener Stadt- und Landesarchiv.<br />
6 ESRA: Initiative zur psychosozialen, sozialtherapeutischen und soziokulturellen<br />
Integration; ein Beratungs- und Behandlungszentrum für<br />
psychosoziale Probleme und Krankheitsbilder, die durch das Holocaustbzw.<br />
Entwurzelungs-Syndrom bedingt sind. Ambulanz/Beratung: 1020<br />
Wien, Tempelgasse 5 A; Tageszentrum: 1020 Wien, Haidgasse 1.<br />
7 PSD: Psychosozialer Dienst der Stadt Wien.<br />
138 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
„ICH BIN DAFÜR, DIE SACHE IN DIE LÄNGE ZU ZIEHEN“<br />
ROBERT KNIGHT<br />
Auszug aus dem Protokoll der 132. Ministerratssitzung<br />
vom 9. November 1948 (unter Verschluß<br />
gehalten): Fonds aus erblosem Vermögen<br />
Punkt 12 der TO, lit. a): Fonds für Judenvermögen.<br />
BM Dr. Zimmermann berichtet anhand der Beilage C<br />
über das Begehren amerikanischer Kreise nach Schaffung<br />
eines Fonds für verarmte jüdische Rückwanderer.<br />
BK: „Wer will das Wort?”<br />
BM Kraus: „Im Vortrag steht, daß ungeachtet der<br />
nach der Verfassung geltenden Gleichberechtigung<br />
diese Maßnahmen gelten sollen. Ich weiß aber nicht,<br />
wie gerade jetzt eine Rasse besondere Privilegien bekommen<br />
soll. Andere, die nicht weggingen, bekommen<br />
keine Unterstützung, die Juden aber sollen eine<br />
solche erhalten. Ich weiß, daß die Landwirtschaft bereits<br />
im Jahre 46 ein großes Aufbaugesetz sich geschaffen<br />
hat. Da aber die Juden Mittel und Fonds bekommen<br />
sollen, die wir selbst nicht bekommen, ist die<br />
Verwirklichung dieser Gesetze bis jetzt noch nicht<br />
möglich gewesen. 1 Wichtige Aufgaben wie Instandsetzungen<br />
von Schulen und Spitälern usw. können wir<br />
nicht aufgeben. Ich stimme diesem beabsichtigten<br />
Projekt nicht zu.”<br />
BM Übeleis: „Die Bundesbahnen haben 82 Mill. unbezahlte<br />
Rechnungen liegen.” 2<br />
BM Dr. Krauland: „In Wien leben derzeit 9000 Juden.<br />
Ihre Lage ist ärmlich. Die Angelegenheit ist außerdem<br />
auch als staatspolitische zu werten. Daß ihnen geholfen<br />
werden soll, soll nicht bestritten bleiben, wenn es<br />
notwendig ist. Man muß aber auch auf den Eindruck<br />
im In- und Ausland rechnen. Man muß auch mit dem<br />
Einfluß der Juden in Amerika rechnen, und dieser Einfluß<br />
oder Eindruck muß erwogen werden. Ich will mit<br />
meinen Ausführungen nur das Bild ergänzen.”<br />
BM Dr. Kolb: „Von dem Reichtum hat Österreich<br />
nichts und das Unrecht, das den Juden zugefügt wurde,<br />
hat Österreich nicht zugefügt. Österreich und das<br />
Großdeutsche Reich, das ist ein Unterschied.” 3<br />
➤ BM Helmer: „Was den Juden weggenommen wurde,<br />
kann man nicht auf die Plattform ‚Großdeutsches<br />
Reich‘ bringen. Ein Großteil fällt schon auf einen Teil<br />
unserer lieben Mitbürger zurück. Das ist eine Feststellung,<br />
die den Tatsachen entspricht. Aber auf der anderen<br />
Seite muß ich sagen, daß das, was im Antrag steht,<br />
richtig ist. Ich sehe überall nur jüdische Ausbreitung<br />
wie bei der Ärzteschaft, beim Handel vor allem in Wien.<br />
Eine Separataktion kann man aber nicht durchführen.<br />
Die Sache ist aber auch eine politische. Auch den Nazis<br />
ist im Jahre 1945 alles weggenommen worden, und wir<br />
sehen jetzt Verhältnisse, daß sogar der nat. soz. Akademiker<br />
auf dem Oberbau arbeiten muß.”<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Aus den Ministerratsprotokollen 1945–1952<br />
BM Dr. Krauland: „Morgen fährt ➤ Trobe nach Amerika,<br />
und da heißt es, was soll geschehen, welche Antwort<br />
erhält er?”<br />
BM Helmer: „Wir leben nicht mehr im Jahre 1945. Die<br />
Engländer bekämpfen jetzt die Juden; die Amerikaner<br />
haben auch ihre Verpflichtungen nicht eingehalten.<br />
Schon die Grausamkeiten der Juden im Palästina-<br />
Krieg haben ihr Echo gefunden. Der Trobe ist auch<br />
mit Vorsicht zu genießen. Ich wäre dafür, daß man die<br />
Sache in die Länge zieht. Bedenken Sie, so müßte<br />
man ihm sagen, wir müssen auf verschiedene Dinge<br />
Rücksicht nehmen. Es gibt schon Leute, die das verstehen.<br />
Die Juden werden das selbst verstehen, da sie<br />
im klaren darüber sind, daß viele gegen sie Stellung<br />
nehmen. Man sollte ihm ganz einfach sagen, wir werden<br />
schon schauen.”<br />
BM Dr. Krauland: „Der gleiche Antrag wurde schon<br />
vor 1/2 Jahr eingebracht.”<br />
BK: „Dem Antrag wird die Zustimmung im Ministerrat<br />
nicht gegeben. Es ist schwer, woher wir die Mittel aufbringen<br />
sollen. Im Parlament den Antrag vorzubringen,<br />
hätte nur innen- und außenpolitische Schwierigkeiten<br />
zur Folge. Außerdem würde hier ein Gegensatz,<br />
eine schwere Lage zu den Nationalsozialisten<br />
geschaffen werden. Auch ein Nein können wir uns<br />
heute nicht leisten. Wir müssen sagen, daß wir momentan<br />
in Budgetberatungen stecken. Wir erklären,<br />
lassen Sie uns Zeit, damit wir unser Budget in Ordnung<br />
bringen und sehen, wo und wie wir Ihnen<br />
helfen können. Diese Erklärung können wir Trobe<br />
geben, und dann muß man schauen, ob wir nicht in<br />
Amerika mehr Mittel aufbringen können.”<br />
Aus: Robert Knight: „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu<br />
ziehen.“ Die Wortprotokolle der österreichischen<br />
Bundesregierung 1945–1952 über die Entschädigung der Juden,<br />
Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1988, S. 195–202<br />
1 Vgl. BGBl. Nr. 175 vom 26. Juli 1946 über Beihilfen zum Wiederaufbau<br />
kriegsbeschädigter land- und forstwirtschaftlicher<br />
Betriebe (Landwirtschaftliches Wiederaufbaugesetz).<br />
Außer dem von Trobe erwähnten Betrag von 400.000 Schilling<br />
ist dem Autor keine weitere finanzielle Unterstützung<br />
der Kultusgemeinde durch die Regierung bekannt.<br />
2 Der Budgetvoranschlag vom 27. Oktober sah Ausgaben von<br />
6.089,422.100 Schilling und Einnahmen von 6.090,789.900<br />
vor, so daß ein kleiner Überschuß von 1,347.800 Schilling<br />
aufschien. Der außerordentliche Aufwand für Wiederaufbau<br />
und Investitionen umfaßte Ausgaben von 1.422,250.300<br />
Schilling. Aus dem ERP Counterpart Fonds wurden für die<br />
erste Jahreshälfte 1949 1,7 Milliarden Schilling bereitgestellt,<br />
u. a. für die Elektrifizierung und andere Investitionen<br />
der Bundesbahn eine Zuwendung von 218,930.000 Schilling.<br />
3 Vgl. Kolbs Rede im Nationalrat zum Nichtigkeitserklärungsgesetz<br />
vom 15. Mai 1946.<br />
139
Interviews mit<br />
Mitgliedern der<br />
Historikerkommission<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Historikerkommission<br />
Im Herbst 1998 wurde vom Bundeskanzler, dem Vizekanzler, den Präsidenten des Bundesrats<br />
und des Nationalrats eine Kommission eingesetzt mit dem Mandat, den Vermögensentzug<br />
auf dem Gebiet der Republik Österreich während der NS-Zeit sowie Rückstellungen bzw.<br />
Entschädigungen der Republik Österreich seit 1945 zu untersuchen. Damit reagierte die<br />
österreichische Regierung auf in- und ausländische Forderungen nach einer vollständigen Aufklärung<br />
über den tatsächlichen Umfang der Beraubung verschiedener Bevölkerungsgruppen,<br />
insbesondere aber der jüdischen Bevölkerung, durch das nationalsozialistische Regime in<br />
Österreich und über das Ausmaß und die Praxis der Rückstellungen in der Zweiten Republik.<br />
Die seit dem Herbst 1996 durch ➤ Sammelklagen aus den USA geweckte internationale<br />
Aufmerksamkeit bezüglich der Rolle zunächst der schweizerischen, dann auch der deutschen<br />
und der österreichischen Banken im Umgang mit ➤ „Raubgold“ und sogenannten<br />
„nachrichtenlosen“ Bankkonten sowie der Konflikt um die rechtmäßigen EigentümerInnen<br />
von Gemälden und anderen Kunstobjekten, die sich heute im Eigentum der Republik Österreich<br />
befinden, haben wesentlich dazu beigetragen, dass nun verschiedene staatliche Institutionen<br />
ihre Vergangenheit im Zusammenhang mit diesen Fragen erforschen lassen. So<br />
überprüft etwa die Anfang 1998 beim Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten<br />
eingerichtete ➤ Kommission für Provenienzforschung die tatsächliche Herkunft<br />
von in Bundesmuseen befindlichen Objekten; einige Objekte bzw. Teile von Sammlungen<br />
wurden bereits an ihre rechtmäßigen BesitzerInnen bzw. ErbInnen zurückgestellt.<br />
Neben der Frage des Vermögensentzugs durch die Enteignung von Firmen, Geschäften,<br />
Wohnungen, Mobiliar, durch den Einzug von Bankkonten, den Verfall von Versicherungsund<br />
Pensionsleistungen etc. wird von der Kommission auch das Ausmaß der während des<br />
Nationalsozialismus zum größten Teil von zivilen AusländerInnen geleisteten Zwangsarbeit<br />
untersucht. Auch einige österreichische Unternehmen haben zur Untersuchung ihrer Firmengeschichte<br />
zwischen 1938 und 1945 Forschungsteams beauftragt.<br />
Die österreichische Historikerkommission besteht aus sechs Mitgliedern und drei ständigen<br />
ExpertInnen: ao. Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner, Mag. Dr. Brigitte Bailer-Galanda,<br />
Gen.-Dir. Hon.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky, Dr. Bertrand Perz, ao. Univ.-Prof. Dr. Roman<br />
Sandgruber, Dr. Robert Knight, ao. Univ.-Prof. Dr. Georg Graf, o. Univ.-Prof. Dr. Karl Stuhlpfarrer,<br />
Prof. DDr. h.c. Alice Teichova. Rund zwanzig wissenschaftliche MitarbeiterInnen<br />
werden für die konkrete Forschungsarbeit der nächsten zwei Jahre hinzugezogen.<br />
Obwohl die Einsetzung einer Historikerkommission von vielen Seiten als notwendiger<br />
Schritt zur vollständigen Aufklärung des Vermögensentzugs begrüßt wurde, hat sie aber<br />
auch Kritik hervorgerufen, etwa hinsichtlich der Gewährleistung der Unabhängigkeit ihrer<br />
Forschung und hinsichtlich dessen, ob konkrete Rückstellungen und Entschädigungen an die<br />
Opfer von den Ergebnissen der wissenschaftlichen Erforschung abhängig gemacht – und<br />
damit wieder um ein paar Jahre verzögert – werden sollen.<br />
In Interviews mit Clemens Jabloner, dem Vorsitzenden der Historikerkommission, Bertrand<br />
Perz, einem Mitglied der Kommission, und Karl Stuhlpfarrer, einem der drei ständigen ExpertInnen<br />
der Kommission, sollen sowohl die Aufgaben und Zielsetzungen der Historikerkommission<br />
dargestellt als auch die Problematik solcher Kommissionen diskutiert werden.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
141
Interview mit Clemens Jabloner<br />
„Wir liefern historische Fakten“<br />
Warum werden in Österreich heute – mehr als 50 Jahre nach dem Ende der<br />
nationalsozialistischen Herrschaft – Fragen um Rückstellungen und Entschädigungsleistungen<br />
öffentlich diskutiert?<br />
Jabloner: Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es eine Bewusstseinsänderung, zumindest<br />
bei den meinungsbildenden Schichten in Österreich. Man will, dass das Land<br />
möglichst unbelastet von seiner Vergangenheit in das nächste Jahrhundert gehen kann.<br />
Außerdem gibt es neu erschlossene Quellen, ein neues Interesse an zeitgeschichtlicher<br />
Forschung, und es gibt eine geänderte Einstellung auch bei den Opfergruppen. Insbesondere<br />
bei den vertriebenen und ausgeraubten Juden war es so, dass sie nach dem<br />
Krieg oft einfach froh waren, überlebt zu haben, oder mit Österreich überhaupt nichts zu<br />
tun haben wollten. Es ist jetzt erst die nächste Generation, die sich hier stärker artikulieren<br />
kann.<br />
Warum wurde die Historikerkommission eingesetzt?<br />
Das Ziel der Historikerkommission ist es, den gesamten Komplex Vermögensentzug auf dem<br />
Gebiet der Republik Österreich während der NS-Zeit sowie Rückstellungen bzw. Entschädigungen<br />
sowie wirtschaftliche und soziale Leistungen der Republik Österreich ab 1945 zu<br />
erforschen und darüber zu berichten. Im Wesentlichen sind das drei große Themenbereiche,<br />
nämlich die Formen der Beraubung, besonders die ➤ „Arisierung“ zwischen 1938 und<br />
1945, zweitens das Rückstellungswesen, also die Frage, was die Republik Österreich nach<br />
1945 getan hat, um die Opfer zu entschädigen oder Vermögen rückzustellen, und drittens<br />
als eigener Themenkomplex die Problematik der Zwangsarbeiter.<br />
Um welche Opfergruppen geht es, wer war davon betroffen?<br />
Die Opfergruppen sind vielfältiger, als es zunächst scheinen mag. Es sind in erster Linie die<br />
Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti, es sind die Slowenen und Sloweninnen in Österreich,<br />
aber auch die Angehörigen bestimmter religiöser Gruppen wie die Zeugen Jehovas, Homosexuelle<br />
und weitere Gruppen, die ich jetzt vielleicht nicht vorstellig genannt habe, und<br />
die Zwangsarbeiter.<br />
Werden auch die „TäterInnen“, das heißt diejenigen, die vom Vermögensentzug<br />
profitiert oder ihn durchgeführt haben, Gegenstand der Forschung sein?<br />
Man muß klarstellen, dass die Historikerkommission kein Gericht ist. Sie untersucht nicht<br />
Einzelfälle in dem Sinn, dass am Ende ein gerichtliches Urteil steht. Sie wird sich aber sehr<br />
wohl auch mit der Frage auseinanderzusetzen haben, wer denn die Profiteure dieser Entzugsmaßnahmen<br />
waren, und wieviel von diesem Vermögen heute noch in den Händen der<br />
Profiteure oder eben ihrer Nachfolger ist.<br />
142 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Wie sieht die Aktenlage aus, nachdem ja in den vergangenen Jahren beispielsweise<br />
bei den zuständigen Gerichten Rückstellungsakten teilweise skartiert,<br />
also vernichtet worden sind?<br />
Ja, die Archivlage ist unübersichtlich. Das heißt, der erste Schritt des Forschungsprojekts besteht<br />
darin, zunächst einmal den Zustand und die Vollständigkeit der Archive zu überprüfen.<br />
Es kann durchaus sein, dass Gerichtsakten schon skartiert sind, besonders aus dem<br />
Oberlandesgerichtssprengel Wien. Man wird erst sehen, ob es noch genug Akten gibt;<br />
man kann aber zum Beispiel auch über sekundäre Quellen, etwa über Rechtsanwaltskanzleien,<br />
an Akten herankommen.<br />
Wie ist der Archivzugang der Mitglieder und MitarbeiterInnen der Historikerkommission<br />
auf Länder- und Bundesebene geregelt?<br />
Auf Bundesebene ist der Zugang zum Staatsarchiv voll gewährleistet, und das wird auch in<br />
einem Gesetz Niederschlag finden, dem Bundesarchivgesetz. 1 Wir sind davon geleitet,<br />
dass bei allen anderen öffentlichen Archiven, besonders bei den Ländern und Städten, gleiche<br />
Einsichtsmöglichkeiten bestehen werden. Ein gewisses Problem sind private Archive.<br />
Hier überlegen wir uns vor allem, diese Archive, beispielsweise Firmenarchive, Bankenarchive<br />
etc., besser unter Schutz zu stellen, damit keine Akten vernichtet werden können. 2<br />
Wir gehen aber grundsätzlich davon aus, dass man uns doch sehr entgegenkommen wird.<br />
Für uns ist es auch wichtig, dass in vielen privaten Bereichen ja komplementäre historische<br />
Forschungen schon in Gang sind. Das entbindet uns zwar nicht von der Verpflichtung zu<br />
forschen, aber wir können zunächst diese Forschungsergebnisse überprüfen, und wenn sie<br />
wissenschaftlich in Ordnung sind, kann man auf sie verweisen.<br />
Wo bestehen forschungsmäßig die größten Lücken?<br />
Das kann ich als Nichthistoriker nicht beantworten, weil es bereits Teil der wissenschaftlichen<br />
Arbeit ist, sich darüber einen Überblick zu verschaffen. Was man erst nach und nach<br />
erkennt, ist, in welcher Weise das Naziregime auch ein wirtschaftliches Unternehmen war.<br />
Diese Zusammenhänge sind nie richtig in den Blickpunkt gekommen. Der relativ kompliziert<br />
organisierte Raub, die Ausbeutung – das soll durch die Forschungsarbeit der Historikerkommission<br />
klarer werden.<br />
Worin liegt der Unterschied zwischen der Historikerkommission und den von<br />
Ministerien oder Firmen eingesetzten Forschungsteams?<br />
Die Historikerkommission hat einen sehr umfassenden Auftrag, der gewissermaßen alles<br />
überwölbt. Die ➤ Provenienzkommission im Unterrichtsministerium beschäftigt sich im Speziellen<br />
mit Bildern, das Dorotheum beschäftigt sich mit seiner eigenen Geschichte, die Postsparkasse<br />
mit ihrer usw. Wir haben vor allem auch in den Blick zu nehmen, wie die Rechtslage<br />
nach 1945 in Österreich war. Uns interessieren weniger spektakuläre Einzelfälle, so<br />
interessant und wichtig sie auch sein mögen, sondern uns interessiert der Blick auf den kleinen<br />
Mann, auf die kleine Frau, auf die vielen Namenlosen, die das wenige, was sie hatten,<br />
verloren haben und denen das dann nicht zurückgegeben wurde. Das ist eine andere<br />
Art des Zugangs als der Zugang, das Schicksal eines berühmten Gemäldes zu erforschen.<br />
Von Seiten der Politik ist mit dem Forschungsauftrag die Erwartung verbunden,<br />
dass damit konkrete Entscheidungsgrundlagen für noch ausstehende<br />
Rückstellungen und Entschädigungen geschaffen werden.<br />
Das ist eine sehr ambivalente Sache. Die Historikerkommission bewegt sich auf einem<br />
schmalen Grat. Man muss vor allem dem Vorwurf von Opferseite begegnen, ein weiteres<br />
Instrument zur Verzögerung zu sein. Viele der Betroffenen sind ja schon sehr alt. Ich kann<br />
nur bei jeder sich bietenden Gelegenheit betonen, dass man, um rechtspolitische Schritte<br />
zu setzen, nicht die Ergebnisse der Historikerkommission abwarten muss. Natürlich wird<br />
sich danach ein vollständigeres Bild ergeben, wird man manches sehen, was man jetzt<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Clemens Jabloner<br />
143
Wir liefern historische Fakten<br />
noch nicht sieht. Aber vieles weiß man auch jetzt schon, als Beispiel haben wir immer die<br />
Frage der Zwangsarbeit genannt. Es gibt aktuelle Forderungen, zum Beispiel des polnischen<br />
Zwangsarbeiterverbandes, und denen könnte man entsprechen, ohne dass man jetzt<br />
die letzten Details weiß. Zumindest steht die Historikerkommission dem nicht entgegen. Wie<br />
auch umgekehrt wir nicht von unserem Forschungsauftrag entbunden sind, wenn irgendwo<br />
eine Vereinbarung über Entschädigungszahlungen erfolgt. Hier muss eine genaue Trennlinie<br />
zwischen wissenschaftlicher Forschung und politischem Handeln gezogen werden.<br />
Konkrete Entschädigungen hängen also nicht vom Endbericht der<br />
Historikerkommission ab?<br />
Nicht in dem Sinne, dass die politische Ebene sagen könnte, wir tun jetzt bis zum Jahr<br />
2002 nichts und warten die Ergebnisse der Kommission ab. Es gibt kein Hindernis, in einen<br />
ernsthaften Dialog mit den Opfergruppen einzutreten. Aber mit dem Endbericht der Kommission<br />
werden wir ein sicherlich klareres, vollständigeres Bild über den Vermögensentzug<br />
und das Ausmaß von Rückstellungen und Entschädigungen in Österreich erhalten.<br />
Sie haben bereits betont, dass die Rolle der Historikerkommission nicht die eines<br />
Gerichts ist. Aber werden nicht trotzdem finanzielle Entschädigungen anhand des<br />
Endberichts der Kommission diskutiert werden?<br />
Nein, das wird überhaupt nicht diskutiert, sondern wir liefern historische Fakten, die bis zu<br />
einem gewissen Grad für sich sprechen, und können damit vielleicht Entscheidungsprozesse<br />
in Gang setzen. Aber es gehört nicht zu unserer Aufgabe, irgendwelche Empfehlungen<br />
abzugeben.<br />
Wie sehen Sie die Rolle der politisch Verantwortlichen in Fragen der Rückstellung<br />
und Entschädigung?<br />
Ich glaube, dass im Augenblick ein aufgeschlossenes Klima herrscht, dass das Interesse der<br />
politischen Ebene nicht bloß ein vorgespiegeltes ist, um Zeit zu gewinnen, sondern ernst gemeint<br />
ist. Wenn ich nicht dieses Gefühl gehabt hätte, hätte ich den Vorsitz in der Historikerkommission<br />
auch nicht übernommen.<br />
Kann man trotzdem von einem Spannungsfeld von Politik, Rechtsprechung und<br />
historischer Forschung sprechen?<br />
Rechtsprechung spielt hier weniger eine Rolle, weil es die heute in diesem Bereich nicht<br />
gibt. Aber es gibt sicher ein Spannungsverhältnis zwischen politischer Entscheidung und<br />
historischer Forschung und ein gewisses Dilemma, aus dem ich auch nicht heraushelfen<br />
kann. Ich weiß, dass viele Opfer alt sind und auf die Klärung dieser Fragen warten. Wir<br />
haben aber als wissenschaftliche Kommission einen gewissen Standard einzuhalten, und<br />
gerade wenn ein so großer Themenkomplex bearbeitet werden soll, dauert das eine gewisse<br />
Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein gewisses Dilemma, mit dem<br />
man leben muss.<br />
Wann soll der Endbericht der Kommission vorliegen?<br />
Er soll im Laufe des Jahres 2002 vorliegen, das heißt die Forschungen werden im Jahr<br />
2001 fertig sein, und das Jahr 2002 dient dann der redaktionellen Bearbeitung und der<br />
Abgabe des Endberichts. Die reine Forschungsdauer ist ca. zweieinhalb Jahre, was ohnehin<br />
nicht lang ist.<br />
Kann man dann mit Vorliegen des Endberichts davon sprechen, dass die historische<br />
Forschung zu diesem Themenkomplex abgeschlossen sein wird?<br />
Das kann man in keiner Weise sagen. Der Forschungsgegenstand ist so weit gefasst, dass<br />
auch die Historikerkommission eine wohlbegründete, aber letztlich auch pragmatische Entscheidung<br />
treffen musste und muss zugunsten gewisser Schwerpunkte. Es kann nicht alles<br />
144 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
und es kann nicht alles gleich tiefgehend erforscht werden. Auch nach der Historikerkommission<br />
wird es genug Raum geben für die historische Forschung. Außerdem ist die<br />
Kommission auf den Vermögensaspekt beschränkt, wir beschäftigen uns also zum Beispiel<br />
nicht mit der Frage der Gewaltausübung und nicht mit der Diskriminierung als solcher.<br />
Welche Folgen wird Ihrer Meinung nach die Arbeit der Historikerkommission haben<br />
– sowohl für die Opfer als auch im Umgang mit der Vergangenheit, mit der NS-Zeit?<br />
Ich denke, dass wir vor allem einen Beitrag zur Aufklärung und zur Information leisten. Ich<br />
erhoffe mir, dass daraus dann auch etwas gemacht wird, zum Beispiel für die Schulen, und<br />
dass Akzente gesetzt werden für die zukünftige historische Forschung. Das sind die zentralen<br />
Punkte. Die rechtliche Ebene ist dann eine Frage der Politik. Ich denke, die Fakten<br />
werden für sich sprechen und werden – wenn das auch entsprechend medial aufbereitet<br />
wird – eine Zugkraft haben.<br />
1 Das Interview mit ao. Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner wurde im Mai<br />
1999, noch vor der Behandlung der Gesetzes- bzw. Novellierungsvorschläge<br />
im Nationalrat geführt. Die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes<br />
[Bundesgesetz vom 25. September 1923, BGBl. Nr. 533/1923,<br />
betreffend Beschränkungen in der Verfügung über Gegenstände von<br />
geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung (Denkmalschutzgesetz<br />
– DMSG) in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr.<br />
92/1959 (EGVG-Novelle), 167/1978, 406/1988 und 473/1900] wurde am<br />
18. Juni 1999 mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ in dritter Lesung angenommen<br />
und liegt derzeit im Bundesrat zur Beschlussfassung. Das<br />
Bundesarchivgesetz wurde am 13. Juli 1999 mit den Stimmen aller<br />
Parteien im Nationalrat beschlossen und liegt derzeit ebenfalls im<br />
Bundesrat zur Beschlußssfassung. Im Bundesarchivgesetz wird erstmals<br />
die Archivierung von und der Zugang zu Archivgut des Bundes<br />
per Gesetz geregelt. Der Zugang ist künftig 30 Jahre nach der letzten<br />
Bearbeitung der Akten möglich, in Ausnahmefällen nach 50 Jahren.<br />
Dies gilt grundsätzlich auch für Akten von Unternehmen mit<br />
mindestens 50%iger Bundesbeteiligung. Die Archivierung und der<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Clemens Jabloner<br />
Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner ist Präsident<br />
des Verwaltungsgerichtshofes und Vorsitzender<br />
der Historikerkommission<br />
Zugang zu Archivgut bezüglich Landes-, Gemeinde- und Privatarchiven<br />
wird durch dieses Gesetz jedoch nicht geregelt.<br />
2 In der Novelle zum Denkmalschutzgesetz war es für die Historikerkommission<br />
zentral, dass durch Verordnung – und nicht wie bisher<br />
nur durch Bescheid – bestimmte Archivalien vorläufig unter Denkmalschutz<br />
gestellt und daher nicht vernichtet werden können. Diese<br />
Art der Unterschutzstellung darf nur für Archivalien erfolgen, die<br />
bei Unternehmungen zu Zeiten angefallen sind, in denen diesen<br />
Unternehmungen aufgrund Anzahl und/oder Art der Beschäftigten,<br />
Umfang und/oder Art der Geschäftstätigkeit oder Beteiligung der<br />
öffentlichen Hand besondere politische oder wirtschaftliche Bedeutung<br />
zukam und das Vorliegen der für die Unterschutzstellung erforderlichen<br />
Fakten aufgrund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes<br />
zumindest wahrscheinlich ist. Das öffentliche Interesse an<br />
der Erhaltung dieser Archivalien gilt solange als gegeben, als das<br />
Österreichische Staatsarchiv nicht auf Antrag einer Partei oder von<br />
Amtswegen eine bescheidmäßige Entscheidung über das tatsächliche<br />
Vorliegen des öffentlichen Interesses getroffen hat.<br />
145
Interview mit Karl Stuhlpfarrer<br />
„Wir müssen tun, was schon vor 30 Jahren hätte<br />
geschehen sollen“<br />
Warum werden in Österreich heute – mehr als 50 Jahre nach Ende der<br />
nationalsozialistischen Herrschaft – wieder Diskussionen über Entschädigung und<br />
Rückstellungen für NS-Opfer geführt?<br />
Stuhlpfarrer: Erstens, weil nicht alles rückgestellt und in vielen Bereichen nicht entschädigt<br />
wurde – die Mietenfrage 1 ist dafür ein klassisches Beispiel. Zweitens sind diese Fragen<br />
nicht vollständig aufgearbeitet worden, und jede Generation wirft die alten Fragen, die<br />
nicht aufgearbeitet wurden, noch einmal auf.<br />
Lassen sich die von den Regierungen bzw. Unternehmen Österreichs,<br />
der Schweiz und Deutschlands eingesetzten Kommissionen und Forschungsteams<br />
in ihrem Auftrag und in ihrer Arbeitsweise vergleichen, oder bestehen<br />
national große Unterschiede?<br />
Ein Unterschied ist, dass diese drei Staaten in unterschiedlicher Weise in den Massenmord<br />
und die Beraubung von Juden und Angehörigen anderer Völker verwickelt waren. Der zweite<br />
Unterschied ist, dass die historischen Ereignisse, die historischen Tatsachen in diesen drei<br />
Ländern, wenn wir die DDR einmal beiseite lassen, in unterschiedlicher Weise geschichtskulturell<br />
verarbeitet worden sind, am intensivsten und mit den einträglichsten Wirkungen in<br />
der Bundesrepublik Deutschland, sehr viel zögerlicher und lückenhafter in Österreich und in<br />
der Schweiz, dort wurde die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit auch durch Mythenbildung<br />
verhindert: in Österreich durch den Opfermythos, in der Schweiz durch den Neutralitätsmythos.<br />
Und das Dritte ist, dass die schweizerische und die österreichische Historikerkommission<br />
ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Die österreichische Kommission hat<br />
eine sehr präzise und sehr eng gestellte Aufgabe. Die Schweiz hat zwar einen spezifischen<br />
Ausgangspunkt, nämlich die Frage des ➤ Raubgoldes, gewählt. Darüber hinaus hat die<br />
Schweizer Kommission aber den Auftrag, sozusagen den Gesamtkomplex der Geschichte<br />
der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs und während der Nazi-Deutschland-Periode<br />
aufzuarbeiten und dazu Stellung zu nehmen. Das halte ich für eine wichtige Sache – das ist<br />
in Österreich nicht geschehen, es bleibt hier für die Forschung also noch vieles offen.<br />
Der Auftrag an die österreichische Historikerkommission lautet, den Vermögensentzug<br />
in Österreich während der NS-Zeit und Rückstellungen und Entschädigungen nach<br />
1945 zu untersuchen. Welche Opfergruppen waren davon betroffen?<br />
Es geht hauptsächlich um die jüdische Bevölkerung, die in Österreich gelebt hat, die als<br />
jüdische Bevölkerung durch die ➤ Nürnberger Rassengesetze kategorisiert wurde, und es<br />
geht um die Zwangsarbeiter. Das sind die beiden wichtigsten Gruppen, auch in der Anzahl<br />
der betroffenen leidtragenden Personen. Dann geht es um kleinere Gruppen, die mehr oder<br />
weniger stark betroffen sind. Eine relativ kleinere Gruppe ist zum Beispiel die slowenische<br />
in Kärnten. Eine andere Gruppe, die auch relativ klein, aber besonders stark betroffen ist,<br />
sind zum Beispiel die Roma.<br />
146 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Warum wurden andere Gruppen von Geschädigten des Nationalsozialismus bzw.<br />
des Zweiten Weltkriegs, zum Beispiel Bombenopfer oder die als Folge des Krieges<br />
Vertriebenen, nicht in den Arbeitsauftrag der Kommission einbezogen?<br />
Die Vertriebenen und die deutsch- und anderssprachigen Minderheiten hauptsächlich aus<br />
den nord- und südosteuropäischen Nachbarstaaten Österreichs sind im Auftrag der Historikerkommission<br />
nicht enthalten, da er sich auf den Vermögensentzug in Österreich beschränkt.<br />
Er bezieht sich nicht auf den Vermögensentzug heute in Österreich lebender Personen,<br />
die außerhalb Österreichs durch Einwirkung der Nationalsozialisten Vermögensverluste<br />
erlitten haben. Deswegen ist die Frage der deutschsprachigen Minderheiten, die<br />
aus den nord- und südosteuropäischen Nachbarstaaten Österreichs geflüchtet sind oder<br />
vertrieben wurden – entweder noch von der ➤ SS oder dann nach Kriegsende von den<br />
neuen Regimes in den ostmitteleuropäischen Ländern –, eine Frage, die vor allem in diesen<br />
Ländern diskutiert werden sollte und muss. Das heißt nicht, dass das nicht Gegenstand der<br />
historischen Forschung sein soll, aber es ist nicht Gegenstand des Auftrags der österreichischen<br />
Historikerkommission.<br />
Hatten Bombenopfer und Vertriebene in Österreich Anspruch auf Entschädigung?<br />
Was die Vertriebenen betrifft, ist das Grundproblem ein staats- und völkerrechtliches. Die<br />
österreichische Bundesregierung ist jetzt bereit, Mitverantwortung von Österreichern an<br />
NS-Verbrechen anzuerkennen. Sie ist jedoch nicht bereit, die seit 1945 eingenommene<br />
Position aufzugeben, dass Österreich ab März 1938 als Staat nicht mehr existiert hat und<br />
als solcher auch nicht am Krieg beteiligt war. Deswegen ist die Frage der Entschädigung<br />
von Vertriebenen nicht Gegenstand der Überlegungen der Republik Österreich und ihrer<br />
Repräsentanten. Seit 1945 ist viel dazu gesagt worden, um diesen Standpunkt zu untermauern.<br />
Man könnte auch einiges dagegen sagen, besonders was die Bundesländer<br />
betrifft, die sich ja nicht – mit Ausnahme des Burgenlands und Vorarlbergs 2 – aufgelöst<br />
haben. Die Frage der Vermögensverluste der deutsch- und anderssprachigen Vertriebenen<br />
muß in einer anderen Weise diskutiert werden. Diese Frage kann man nicht an Österreich<br />
adressieren. Bei der Historikerkommission geht es darum – und das ist die Hauptsache –,<br />
wo die Vermögen geraubt worden sind. Das ist zum größten Teil eben hier in Österreich,<br />
das heißt auf dem Gebiet des heutigen Österreich, und hier wiederum vor allem in Wien.<br />
Das ist das Zentrum der Problematik, und das muss zuerst und in aller Intensität bearbeitet<br />
werden – ohne dass man das andere vergisst. Das zweite ist die Frage der Bombenopfer.<br />
Das ist ein schwieriges Problem, weil sich Bomben nicht um Schuldige und Unschuldige<br />
kümmern, nicht um Kollaborateure und um Widerstandskämpfer, um das breiteste Spektrum<br />
zu nennen. Bombenschäden sind eine Kriegsfolge, die nicht aus einer direkten, intentionalen<br />
Aktion des Naziregimes entstanden ist. Mittelbar natürlich schon, indem das Naziregime<br />
auf Kriege angewiesen war und durch den Krieg die Bomben evoziert hat. Es ist aber<br />
keine direkte Aktion, wie etwa die Enteignungsaktion des Naziregimes als Staat, oder<br />
auch das, was als geduldete Aktion unmittelbar nach der NS-Machtübernahme in Österreich<br />
im März 1938 geschehen ist. Das heißt nicht, dass man das nicht untersuchen soll,<br />
jedoch nicht im Rahmen dieses Auftrags der Historikerkommission. Ein drittes Problem sind<br />
die deutsch- und anderssprachigen Umsiedler im weitesten Sinn, z. B. jeden aus Südtirol.<br />
Da ist es schon schwierig festzustellen, wo der Vermögensentzug stattgefunden hat, ob im<br />
Ausland oder in Österreich. Auch das ist ein wichtiges, aber kein prioritäres Problem. Wir<br />
haben eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Kapazität an Forschern, eine bestimmte Summe<br />
Geld. Da muss man ganz einfach eine Reihung treffen: Das Vorrangige macht man zuerst<br />
und das andere, wie ich hoffe, danach.<br />
Sie sind ständiger Experte der Historikerkommission. Was heißt das, und was ist<br />
Ihre Aufgabe in der Kommission?<br />
Ich möchte zunächst deutlich sagen, dass ich hier nicht für die Historikerkommission<br />
spreche, sondern nur für mich persönlich. Ich gehe davon aus, dass ein Widerspruch<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Karl Stuhlpfarrer<br />
147
Was schon vor 30 Jahren hätte geschehen sollen<br />
bestand zwischen der Auffassung der Auftraggeber, die Zahl der Kommissionsmitglieder<br />
auf sechs zu beschränken, und der Notwendigkeit, ein breiteres Forschungsfeld abzudecken.<br />
Deswegen war die Historikerkommission der Auffassung, dass drei Experten hinzugezogen<br />
werden sollen – und das sind ein Jurist, eine Wirtschaftshistorikerin und ich.<br />
Ich habe im Wesentlichen über drei Themen gearbeitet, die sich direkt mit den Forschungsfragen<br />
der Kommission beschäftigen. Das eine ist die Frage der Verfolgung und<br />
Entrechtung der Juden, dann über die Kärntner Slowenen und über die Umsiedlung der<br />
Südtiroler.<br />
Was sind die Ziele, was ist das Erkenntnisinteresse der Kommission? Geht es in<br />
erster Linie darum, den Umfang von Vermögensentziehung und Rückstellung zu<br />
erfassen? Geht es um die Analyse des nationalsozialistischen Systems der<br />
Bereicherung, oder geht es um die Perspektive der Opfer?<br />
Hier gibt es zwei wichtige Aspekte. Der eine ist, den Umfang des Raubs festzustellen, wer<br />
beraubt worden ist und durch wen, und schließlich auch festzustellen, ob die Rückgabe<br />
des geraubten Vermögens oder die Entschädigung für alle diese Gruppen gleichmäßig<br />
oder unterschiedlich gehandhabt wurde. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Erkenntnisziel.<br />
Das ist auch wichtig für die Einschätzung der gesellschaftlichen Situation von Beginn an<br />
durch die ganze Zweite Republik. Und das Zweite ist meiner Meinung nach das Vermittlungsinteresse<br />
der Historikerkommission, und nicht nur der Kommission, sondern aller<br />
Historiker, die zu diesem Themenbereich arbeiten. Das ist, wenn man so will, ein aufklärerischer<br />
Impetus: Deutlich zu machen, oder um es einmal umgekehrt zu sagen, unmöglich<br />
zu machen zu leugnen, dass die nationalsozialistische Beraubung und die Verzögerungen<br />
und Ungerechtigkeiten bei der Restitution geschehen sind. Das ist ja noch<br />
immer nicht Allgemeingut, das ist in der österreichischen Geschichtskultur bislang nicht<br />
verankert. Diese Geschichtskultur oder dieses kollektive Geschichtsbewusstsein zu verändern,<br />
ist immer auch eine Aufgabe der Geschichtswissenschaft und ihrer Vermittlungsanstrengungen.<br />
Die Historikerkommission hat zunächst den Auftrag, den Themenkomplex<br />
Vermögensentzug, Zwangsarbeit, Rückstellung und Entschädigung zu erforschen.<br />
Es gibt von Seiten der Politik darüber hinaus die Erwartung, dass sie damit konkrete<br />
und endgültige Entscheidungsgrundlagen für ausstehende Rückstellungen und<br />
Entschädigungen schaffen könnte. Kann und will die Kommission das?<br />
Die Historikerkommission wird keine Einzelfälle untersuchen, und wenn, nehmen wir an, die<br />
Republik Österreich beispielsweise die Zwangsarbeiter entschädigen will, so würde ich<br />
sagen, soll sie einen Gesetzesvorschlag als Regierungsvorlage oder Initiativantrag ins Parlament<br />
einbringen, in dem steht: Jeder, der Zwangsarbeit geleistet hat, ist zu entschädigen.<br />
Dann geht es um die Definition dessen, was Zwangsarbeit heißt, um den Nachweis, dass<br />
es in Österreich geschehen ist, und um die Summe, die bezahlt werden soll. Dafür braucht<br />
man keine Historikerkommission, sondern so etwas wie eine Organisation, die das überprüft<br />
und auszahlt.<br />
Konkrete Rückstellungen und Entschädigungen werden also nicht von den<br />
HistorikerInnen bzw. von der Forschung der Historikerkommission abhängen?<br />
Nicht als Einzelfälle. Aber es ist sicher eine Aufgabe der Historikerkommission, zur Frage<br />
der Zwangsarbeiter zu differenzieren, was als Zwangsarbeit gewertet werden kann und<br />
muss. Es wird auch ihre Aufgabe sein, in den einzelnen Projekten festzustellen, wie die<br />
realen Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Arbeiter und Arbeiterinnen etwa in der<br />
Industrie oder in der Landwirtschaft waren, und das wird sicher einen Beitrag zur<br />
Entschädigungsfrage leisten. Aber von Seiten der Politik die grundsätzliche Bereitschaft auszudrücken:<br />
„Wir sind bereit, diesen Menschen eine Entschädigung zu zahlen“, das ist<br />
immer möglich. Und das sollte auch möglichst bald geschehen.<br />
148 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Wie sehen Sie die Rolle der politisch Verantwortlichen im Zusammenhang mit<br />
Rückstellungen und Entschädigungszahlungen?<br />
Das hängt davon ab, wie sie agieren. Wenn sie rückstellen und entschädigen, sehe ich ihre<br />
Rolle positiv. Wenn sie es nicht vollständig tun, dann tun sie das, was die Republik seit<br />
1945 getan hat.<br />
Wie verortet sich die Historikerkommission in dem Spannungsfeld – einerseits<br />
wissenschaftliche Forschung, andererseits ein politischer Auftrag? Entsteht daraus<br />
nicht auch für die HistorikerInnen eine problematische Situation?<br />
Als Wissenschaftler sehe ich das Problem in zwei Dingen. Das eine ist, dass die Kommission<br />
missbraucht werden kann, um etwas zu verzögern. Dagegen hat sich die Kommission<br />
aber immer explizit ausgesprochen. Das zweite ist, dass die Frage der Analyse der NS-<br />
Periode in Österreich und ihres Fortwirkens nach 1945 natürlich in diesem eng gefassten<br />
Forschungsauftrag nur teilweise dargestellt werden kann. Die Frage der Partizipation der<br />
Österreicher, des Landes, die Frage der Transformation der Gesellschaft, der Fortdauer der<br />
Ideologie wird nicht direkt durch die Kommission bearbeitet, ist aber mindestens ebenso<br />
wichtig. Das ist kein Vorwurf – weder an die Kommission noch an die Auftraggeber. Ich<br />
begreife diese Kommission wirklich als Chance, wichtige Fragen zu bearbeiten. Die Möglichkeit,<br />
dass sie von Politikern in anderer Weise instrumentalisiert werden kann, besteht<br />
wie bei allen anderen Kommissionen und Unternehmungen dieser Art auch. Das eine ist<br />
die Hinausschiebestrategie, das zweite ist, dass man sagt, es ist einseitig, weil es eben<br />
primär die Vermögensverluste von Juden nach den Nürnberger Rassengesetzen betrifft. Das<br />
dritte ist, dass es als Alibi für das Ausland benützt wird nach dem Motto: „Wir tun eh alles.<br />
Wir haben jetzt eine Historikerkommission eingesetzt, und das genügt schon.“ So wie das<br />
auch immer wieder im Laufe der Zeit nach 1945 passiert ist. Aber mit dem Risiko arbeitet<br />
man immer. Wir haben ja jahrzehntelang unter forschungsmäßig schlechten Bedingungen<br />
gearbeitet, und damals hat uns niemand zugehört. Zum Beispiel, als ich 1974 in dem Sammelband<br />
über das historische Judentum meinen ersten Artikel zu dieser Frage publiziert habe,<br />
3 da gab es eine große Pressekonferenz, ein riesiges Interesse, und das hat, glaube ich,<br />
drei Tage gedauert, und dann war Schluss. Obwohl dieses Buch als Antwort auf eine Serie<br />
in der Kronen Zeitung gedacht war, die Viktor Reimann geschrieben hat. Das war auch der<br />
Grund, warum die Pressekonferenz so groß war, darüber hinaus war das öffentliche Interesse<br />
aber praktisch gleich Null. Und dann kam die Fernsehserie „Holocaust“, und es gab<br />
wieder ein riesiges Interesse und große Emotionen, aber das dauerte nicht lange. Dann<br />
kam das Gedenkjahr 1988 mit vielen Veranstaltungen und Diskussionen – da war das<br />
öffentliche Interesse schon etwas größer und ausdauernder. Man muss es also immer wiederholen,<br />
man muss repetitiv vorgehen, wie Lernprozesse eben sind. Und manchmal wird<br />
es gehört und manchmal nicht. Jetzt gibt es eine Chance, dass viel gehört wird, und diese<br />
Chance muss man nützen.<br />
Wie unabhängig können Kommissionen sein, die von der Regierung oder auch<br />
von Firmen, von Banken und Konzernen eingesetzt werden? Können daraus<br />
nicht auch Loyalitätskonflikte für die ForscherInnen entstehen?<br />
Bei Firmen weiß ich es nicht oder noch nicht. Bei der Historikerkommission habe ich jedenfalls<br />
nicht größere Probleme mit Loyalitätskonflikten als als pragmatisierter Beamter oder<br />
Universitätsprofessor. Und die habe ich bis jetzt immer ganz gut ausgehalten. Es hat mir<br />
auch niemand etwas getan. Man kann in diesem Land kontrovers sein, ohne dass einem<br />
gleich irgendetwas Dramatisches passiert. Das Übliche, was einem passieren kann, ist,<br />
dass man nicht gehört wird. Nicht einmal ignorieren – das ist die Strategie des Landes<br />
Österreich.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Karl Stuhlpfarrer<br />
149
Was schon vor 30 Jahren hätte geschehen sollen<br />
Welche Konsequenzen ergeben sich für die historische Forschung aus der<br />
gegenwärtigen „Konjunktur“ der Zeitgeschichte durch die Einsetzung von<br />
Kommissionen und Forschungsteams und durch den gestiegenen<br />
Einfluss auf aktuelle gesellschaftspolitische Debatten?<br />
Das sehe ich nicht nur positiv, denn das Geld, das jetzt in diese Kommission und, wie ich<br />
schon oft genug gesagt habe, mit gutem Grund hineingeht, das fehlt woanders. Es werden<br />
jetzt nicht mehr Zeitgeschichteprojekte gefördert werden als vorher. Der zweite Punkt ist,<br />
dass durch die Aufgabenstellung ein bestimmtes Paradigma der Forschung forciert wird,<br />
und alle anderen müssen sich sehr viel mehr anstrengen, um Fundraising zu betreiben und<br />
Ähnliches. Es hat schon auch eine starke Sogwirkung, die andere Bereiche, also ich möchte<br />
nicht sagen: schädigt, aber zumindest die notwendige Förderung verlangsamt.<br />
Könnte man jetzt zugespitzt fragen: Wird die historische Forschung durch diese<br />
Kommissionen monopolisiert und institutionalisiert?<br />
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt genügend Leute, die nicht in der Kommission sind, und<br />
sogar die, die in der Kommission sind, arbeiten nicht nur an diesen Fragen weiter. Ich selbst<br />
beschränke mich in meiner Forschung und Lehre in der Zukunft nicht nur auf den Gegenstand<br />
des Auftrags der Kommission. Ich gebe zu, es wird ein gewisser Druck – also ich rede jetzt<br />
von mir als Person – auf mir liegen, die Gewichtung zugunsten dieses einen Feldes zu verlagern.<br />
Es gibt aber genügend andere Leute, die auf anderen Feldern weiter arbeiten. Was ich<br />
mir wünsche, ist, dass diese Leute gute Projekte kriegen, dass diejenigen, die im Ministerium<br />
und anderswo dafür zuständig sind, begreifen, dass Zeitgeschichte etwas kostet. Vor allem<br />
dann, wenn man die neuen Medien – ein Feld, das ich für mindestens ebenso wichtig halte –<br />
berücksichtigt. Für mich ist das Dramatische, dass wir in der Situation sind, etwas machen zu<br />
müssen, was schon vor 30 Jahren hätte geschehen sollen und hätte geschehen können, und<br />
was damals nicht geschehen ist. Wir müssen etwas nachholen, und das lastet auf uns. Deswegen<br />
können wir andere Dinge nicht tun, die wir heute tun könnten, wenn das andere schon<br />
geschehen wäre. Aber trotzdem muss es getan werden. Dieser time lag ist aber nicht nur ein<br />
Problem der Forschung, sondern der Entwicklung des gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins.<br />
Welche Auswirkungen werden Ihrer Meinung nach die Arbeiten der<br />
Historikerkommission auf den Umgang mit der Vergangenheit, auf das kollektive<br />
Geschichtsbewusstsein und auf der anderen Seite für die Opfer des<br />
Nationalsozialismus haben?<br />
Was die Leidtragenden betrifft, hoffe ich, dass sie endlich ihre Vermögen restituiert bekommen,<br />
und dass sie entschädigt werden, auch wenn das nicht alles ist. Was die Historiker betrifft,<br />
hoffe ich, dass es nicht dabei bleibt, dass sie einen Endbericht schreiben, ihn publizieren<br />
und sich dann verabschieden, sondern dass sie dann mit der Arbeit beginnen, die ebenso<br />
wichtig ist, nämlich mit der Vermittlungsarbeit. Das läuft über die Medien und über die Institutionen<br />
der Sozialisation, also von der Schule über die Erwachsenenbildung, Lehrerfortbildung<br />
usw. Und das ist ein langer und anstrengender Prozess. Aber ich bin zuversichtlich, dass das<br />
gelingen wird, die Situation ist heute ja schon viel besser als vor zehn Jahren.<br />
1 Zur Frage der noch während der NS-Zeit gekündigten jüdischen<br />
MieterInnen und der nach 1945 nicht rückgestellten Mietwohnungen<br />
siehe Kapitel 1 und 4.<br />
2 Im Zuge der Umstrukturierung der Verwaltung Österreichs nach<br />
dem Anschluss im März 1938 wurden in der „Ostmark“ sieben<br />
Reichsgaue errichtet, die mit wenigen Ausnahmen im Wesentlichen<br />
den Grenzen der bisherigen Bundesländer entsprachen: Das<br />
Burgenland wurde geteilt, das nördliche Burgenland wurde in den<br />
Gau „Niederdonau“, das südliche Burgenland in den Gau „Steier-<br />
Univ.-Prof. Dr. Karl Stuhlpfarrer ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte der<br />
Universität Wien und ständiger Experte der Historikerkommission.<br />
mark“ eingegliedert. Die Bundesländer Tirol und Vorarlberg wurden<br />
zum Gau „Tirol-Vorarlberg“ zusammengefasst. Der Gau „Niederdonau“<br />
umfasste gegenüber dem Bundesland Niederösterreich<br />
zusätzlich Teile der besetzten südmährischen Gebiete, jedoch nicht<br />
Wien.<br />
3 Karl Stuhlpfarrer, Antisemitismus, Rassenpolitik und Judenverfolgung<br />
in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg, in: Das österreichische<br />
Judentum. Voraussetzungen und Geschichte, red. v.<br />
Nikolaus Vielmetti, Wien/München 1974, S. 141-164.<br />
150 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
„Was jetzt passiert, wäre vor 15 Jahren noch<br />
undenkbar gewesen“<br />
Interview mit Bertrand Perz<br />
Warum werden in Österreich heute, mehr als 50 Jahre nach Ende der<br />
nationalsozialistischen Herrschaft, wieder Diskussionen um Entschädigungen<br />
und Rückstellungen geführt?<br />
Perz: Das hat viele Faktoren, innen- und außenpolitische und zeitliche, etwa die Generationenabfolge<br />
und damit verbunden die Nähe oder Distanz der Generationen zum Nationalsozialismus.<br />
Zur Vorgeschichte der Historikerkommission hat sicher sehr stark eine internationale<br />
Entwicklung außerhalb Österreichs beigetragen.Es gibt in Europa seit längerem eine<br />
Diskussion über den Umgang mit dem Nationalsozialismus. Dazu kommt, dass seit 1989<br />
diese Diskussion nicht mehr entlang des Ost-West-Konflikts abläuft, sondern dass man jetzt<br />
offener diskutiert über Kollaboration, über den Umgang der einzelnen Staaten, seien es besetzte,<br />
neutrale oder am Nationalsozialismus beteiligte Länder, mit den jeweils involvierten<br />
gesellschaftlichen Gruppen nach 1945. Das heißt, sowohl mit den Kollaborateuren als<br />
auch mit den Leuten, die im Widerstand waren, und mit den Leuten, denen ihr Vermögen<br />
geraubt wurde. Diese europaweite Diskussion, für die die Schweiz in den letzten Jahren ein<br />
Paradebeispiel ist durch die Einsetzung von Historikerkommissionen und durch hitzige<br />
öffentliche Debatten über ihre Vergangenheit, hängt auch mit den ➤ Sammelklagen zusammen.<br />
Dieses Rechtsinstrument, das es seit den sechziger Jahren in den Vereinigten Staaten<br />
gibt und das die Möglichkeit bietet, dass mehrere Dutzend oder hunderte Personen eine<br />
gemeinsame Klage einreichen können, wird seit zwei oder drei Jahren auf den Bereich der<br />
Entschädigung für Holocaust-Opfer angewandt. Die Sammelklagen haben die generelle<br />
Tendenz, nämlich die historische Debatte auf eine Rechtsfrage und auf eine ökonomische<br />
Frage zu verschieben, enorm beschleunigt. Die ökonomische Frage bzw. der ökonomische<br />
Druck mittels Rechtsstreit hat eine Debatte über die NS-Vergangenheit in einer Weise<br />
erzwungen, wie sie vorher nie stattgefunden hat. Es gab sie zwar, aber sie war nie so tiefgehend,<br />
hat selten so weite Kreise der Gesellschaft erfasst wie jetzt. Der zweite Faktor ist<br />
ein innenpolitischer: Im Fall der Historikerkommission war es so, dass die ➤ Israelitische<br />
Kultusgemeinde eine Kommission zur Untersuchung der Enteignungen und Rückstellungen<br />
gefordert und dabei aber sehr vorsichtig agiert hat, indem sie gesagt hat, es geht nicht um<br />
Geld, sondern um Bewusstmachung. Und diese Forderung nach Aufklärung in Kombination<br />
mit der für die Regierung sich überschlagenden Entwicklung seit dem Sommer 1998, als<br />
plötzlich Sammelklagen gegen eine Reihe von österreichischen Unternehmen gerichtet<br />
wurden, hat eine enorme Dynamik bekommen. Das sind auslösende Faktoren, aber natürlich<br />
stellt sich heute überhaupt die Frage des Verhältnisses zum Nationalsozialismus. Die<br />
Generation, die jetzt klagt, sind Leute, die schon sehr alt sind, die nicht mehr beruflich aktiv<br />
oder politische Entscheidungsträger, sondern die in Pension sind. Ich denke, das ist jetzt die<br />
letzte Debatte, bevor es ein rein historisches Ereignis wird, bevor niemand mehr lebt, der<br />
den Nationalsozialismus bewusst oder aktiv erlebt hat. Und schließlich gibt es auch eine<br />
Dynamik, die aus den Reaktionen der jeweils betroffenen Länder entsteht und wie dieses<br />
Thema dort diskutiert wird, das hat natürlich einen Verstärkungseffekt.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
151
Vor 15 Jahren noch undenkbar<br />
Warum wurde die Historikerkommission eingesetzt?<br />
Wie die Entscheidungsbildung in der Regierung und im Parlament im Detail verlaufen ist,<br />
weiß ich nicht. Mit ausschlaggebend war sicherlich auch, dass die beklagten Unternehmen<br />
zu den größten österreichischen Unternehmen gehören wie die VOEST oder die Bank Austria.<br />
Und da es bei den eingeklagten Summen nicht um Kleinigkeiten geht, waren vermutlich<br />
die Regierung und auch das Parlament, im Wesentlichen SPÖ und ÖVP, der Meinung,<br />
dass man hier etwas tun muss. Dazu kam noch die Frage der Entschädigung für Zwangsarbeiter,<br />
vor allem ein polnischer Verband ehemaliger Zwangsarbeiter ist 1998 in dieser<br />
Frage aktiv geworden. Und man hat dann einfach geschaut, wie andere Länder mit diesen<br />
Forderungen umgehen. Ich glaube, es hätte in Österreich keine Historikerkommission gegeben,<br />
wenn es nicht in der Schweiz schon vorher eine solche Kommission gegeben hätte.<br />
Da hat man gesehen, welche Möglichkeiten der Schadensbegrenzung es gibt, die Schweiz<br />
war quasi dafür das Vorbild. Im November oder Dezember 1997 fand außerdem statt, die<br />
➤ Londoner „Raubgold-Konferenz“, auf der schon eine Reihe involvierter Staaten Bericht<br />
erstattet haben über ihre Rolle beim Handel mit Raubgold. Auch Österreich ist dort aufgetreten,<br />
hatte aber noch keinen Bericht vorzulegen. Im Dezember 1998 fand dann die<br />
➤ Washingtoner Konferenz über geraubtes Gut bezüglich des Holocaust – „Holocaust Era<br />
Assets“ – statt, und dort legten ungefähr 40 oder 50 Staaten Berichte vor. Das hat eine<br />
enorme Dynamik bekommen, die auch mit den Sammelklagen zu tun hat und mit der Rolle<br />
der Vereinigten Staaten in diesem ganzen Prozess, die manche Staaten loben, manche<br />
tadeln, aber immer positiv verstärkend nach dem Motto „Alle sollen jetzt etwas tun, ihre<br />
Vergangenheit aufarbeiten“. Auch in anderen Ländern gibt es inzwischen die Überlegung,<br />
diese Fragen durch Kommissionen zu regeln und zu hoffen, dass die Kommissionen ein<br />
Stück weit auch die Politik entlasten im Sinne von „Man tut ja etwas, und man gibt die<br />
notwendige Expertise in Auftrag.“ Ich denke, diese internationale Dynamik hat auch für die<br />
österreichische Entscheidung bezüglich einer Historikerkommission eine große Rolle<br />
gespielt.<br />
Welche Bedeutung hat der Status einer Kommission auf ihr Mandat und auf ihre<br />
Kompetenzen im Vergleich zu herkömmlichen Forschungsprojekten?<br />
Bei herkömmlichen Forschungsprojekten muss man grundsätzlich zwischen einer Antragsund<br />
einer Auftragsforschung unterscheiden. Die Arbeit der Kommission fällt in den Bereich<br />
von Auftragsforschung, wenn man das Ganze jetzt nur auf der Forschungsebene sieht. Der<br />
Unterschied zur herkömmlichen Forschung ist natürlich groß, Forschungen im historischen<br />
Bereich sind letztlich immer an Universitäten oder ähnliche Forschungsinstitutionen angebunden<br />
und in der Regel Antragsforschungen, also selbst konzipierte und eingereichte<br />
Projekte. Der zentrale Punkt bei der Antragsforschung ist die Einreichung und die Genehmigung<br />
des Projektes, das Endergebnis ist zunächst vergleichsweise weniger wichtig, à la<br />
longue natürlich schon. Bei einer Historikerkommission ist das Ergebnis alles, eine Kommission<br />
wird zu einem bestimmten, klar definierten Ziel eingesetzt. Das ist reine Auftragsforschung.<br />
Ein zweiter, vielleicht noch wichtigerer Punkt ist das Verhältnis von Auftraggebern<br />
und Auftragnehmern. Man muss dabei zwischen verschiedenen Kommissionen unterscheiden.<br />
Es gibt, auch in anderen Ländern, Kommissionen, die von Regierungen eingesetzt sind<br />
oder von Parlamenten, es gibt aber wesentlich mehr Kommissionen, die von Firmen oder<br />
von privaten Rechtsträgern eingesetzt werden, die speziell für diese Rechtsträger forschen.<br />
Bezüglich der Frage der Abhängigkeit kann man natürlich sagen, dass jede Institution, die<br />
eine Kommission einsetzt, damit bestimmte Interessen verbindet, das ist klar. Die Frage ist<br />
nur, welche Interessen das konkret sind und was das für den Erkenntnisprozess der jeweiligen<br />
Kommission oder des Untersuchungsteams bedeutet. Da gibt es Unterschiede in Bezug<br />
auf das Naheverhältnis zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern, auf die Frage von<br />
Abgrenzung, Freiheit, Spielräumen. Wenn wir eine Firma nehmen wie zum Beispiel die<br />
Deutsche Bank oder eine andere Bank, die Historiker beauftragt, ihre Firmengeschichte<br />
unter einem bestimmten Aspekt zu untersuchen, dann will sie damit natürlich einerseits eine<br />
152 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Art Expertise haben und wissen, was damals wirklich geschehen ist, – woher sollen die heutigen<br />
Vorstandsmitglieder einer Bank das auch wissen? Dann geht es bei Unternehmen auch<br />
sehr stark um Imagefragen, das gilt für die deutschen Unternehmen wie für die schweizerischen<br />
und auch für die österreichischen, die Forschungsteams eingesetzt haben. Ein Problem<br />
dabei ist, dass in dem Moment diejenigen, die diese Fragen erforschen, das sind in<br />
erster Linie Historiker, aber auch Ökonomen und Juristen, enorm aufgewertet werden, weil<br />
sie jetzt gefragt sind. Gleichzeitig kann es dann aber sehr schnell wieder eine Abwertung<br />
der historischen Forschung geben, wenn eine Firma sagt: „Das Wichtigste für uns ist, dass<br />
es nicht zu einem Prozess kommt, weil wir den nicht durchstehen.“ Ein Prozess dauert unter<br />
Umständen fünf Jahre, das wäre für das Image eines Unternehmens so schädlich, dass nicht<br />
der Prozess und die eventuellen Zahlungen das Problem sind, sondern der drohende Imageverlust.<br />
Daher versuchen manche Firmen jetzt, sich bereits im Vorfeld eines solchen Verfahrens<br />
zu vergleichen, ohne die historischen Ergebnisse abzuwarten. Die Rechtsabteilungen<br />
sind gezwungen zu verhandeln, während gleichzeitig noch historische Untersuchungen<br />
laufen. Auf dieser Ebene gibt es also sofort wieder die Entwertung der historischen Forschung,<br />
sie ist quasi nur auf einer Imageebene wichtig. Trotzdem ist es meiner Meinung<br />
nach gut, dass die historischen Fakten auf den Tisch kommen. Das andere Problem ist die<br />
Frage der Abhängigkeit. In dem Moment, wo eine Firma beklagt ist, ist das, was ein Team<br />
von geschichtswissenschaftlich ausgebildeten Leuten herausfindet, unmittelbar rechtsrelevant.<br />
Als der „Goldbericht“, ein Zwischenbericht der ➤ Bergier-Kommission, veröffentlicht<br />
wurde, hat sofort am nächsten Tag, ich glaube, es war Ed Fagan oder ein anderer Anwalt,<br />
die Schweizer Nationalbank geklagt. In dem Moment ist man als Historiker natürlich nicht<br />
mehr außerhalb dieses politischen Spiels, auch wenn man versucht, draußen zu bleiben. Es<br />
könnte zum Beispiel durchaus sein, dass eine Firma sagt, sie möchte, dass ein Bericht erst<br />
zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Damit muss man dann als Wissenschaftler<br />
in irgendeiner Weise umgehen. Andererseits ist es auch ganz interessant zu beobachten,<br />
dass die Firmen, vor allem die deutschen Firmen in der Regel sehr renommierte Wissenschaftler<br />
für diese Projekte engagieren, vor dem Hintergrund der Imageüberlegung, dass es<br />
nämlich überhaupt nichts nützt, jemanden die Untersuchung machen zu lassen, der nur in<br />
den Verdacht kommt, er könnte von der Firma abhängig sein, denn das wäre rausgeschmissenes<br />
Geld. Es geht also vielfach gar nicht um die unmittelbare Rechtsrelevanz, sondern es<br />
geht vor allem um das Image. Und da ist es sehr wichtig zu signalisieren, dass man unabhängig<br />
forscht. Auf der Ebene von Regierungskommissionen ist das ein bisschen anders.<br />
Die Schweiz hat zum Beispiel eine Kommission, die relativ unabhängig ist. Sie hat einen<br />
großen Spielraum, weil es ein eigenes Gesetz gibt für diese Kommission und weil der<br />
Rechtsrahmen so gesteckt ist, dass sie mehr oder weniger unabhängig von den Auftraggebern<br />
agieren kann. Das heißt natürlich nicht, dass es von den Auftraggebern her nicht<br />
auch Überlegungen geben wird, wie man möglichen Schaden von der Schweiz abwälzen<br />
kann. Aber unmittelbar auf die Forschungsergebnisse der Kommission hat die Bundesversammlung<br />
keinen Einfluss.<br />
Sie sind nicht nur Mitglied der österreichischen Historikerkommission, sondern auch<br />
Mitarbeiter der Bergier-Kommission. Welche Unterschiede gibt es zwischen den von<br />
den Regierungen der Schweiz bzw. Österreichs eingesetzten Historikerkommissionen?<br />
Wenn man die Historikerkommissionen in der Schweiz und in Österreich vergleicht, dann<br />
ist sicher der auffälligste Unterschied, dass in der Schweiz die Kommission anders entstanden<br />
ist als in Österreich. Das hat viele Gründe, zum einen gab es einen enormen Schock, in<br />
der Schweiz, weil sie von ihrem Selbstverständnis her mit dem Nationalsozialismus nichts<br />
zu tun hatte und plötzlich, auch von innen her, so massiv mit diesen Fragen konfrontiert<br />
wurde. Die Schweiz wurde in einem unheimlichen Tempo von der Geschichte eingeholt,<br />
wenngleich man auch sagen muss, dass die Schweiz schon in den letzten zehn Jahren begonnen<br />
hat, intensiver über ihr Selbstbild zu diskutieren. Aber der Schock war sicher groß,<br />
und das ist auch mit als Grund anzusehen für die weitreichenden Kompetenzen, die der<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Bertrand Perz<br />
153
Vor 15 Jahren noch undenkbar<br />
Bergier-Kommission per Gesetz eingeräumt wurden, zum Beispiel im uneingeschränkten Zugang<br />
zu allen Archiven, auch zu Privatarchiven, was ja rechtlich nicht ganz einfach ist.<br />
Außerdem gibt es in der Schweiz einen klaren Auftraggeber: die Bundesversammlung, also<br />
das Parlament. In Österreich ist der Auftraggeber demgegenüber ein kompliziertes Zwitterwesen<br />
zwischen Parlament und Regierung, bzw. Kanzler, Vizekanzler, Präsident des Nationalrates,<br />
Präsident des Bundesrates – also eine komplizierte Konstruktion, die im Parlament<br />
budgetiert wird, gleichzeitig sind die Auftraggeber aber zum Teil in der Regierung. Außerdem<br />
gibt es keine eigene gesetzliche Regelung für die Kommission, sondern quasi nur ein<br />
Mandat von Seiten der Auftraggeber. Wenn man das Procedere mit der Schweiz vergleicht,<br />
ist die Position der Kommission also etwas unklarer. Die Frage, wie abhängig eine<br />
solche Kommission von den Auftraggebern ist, ist deshalb auch sofort gestellt worden.<br />
Wenn man zum Beispiel das Schweizer Modell gewählt hätte, wäre eine derartige Diskussion<br />
vermeidbar gewesen.<br />
Wie lassen sich die beiden Kommissionen in Bezug auf den<br />
Forschungsauftrag vergleichen?<br />
Als Mitarbeiter der Bergier-Kommission darf ich laut Vertrag über die Kommission keine<br />
Auskünfte geben. Das heißt, ich darf zur Bergier-Kommission nicht öffentlich Stellung nehmen,<br />
weder zu ihrer internen Gebarung noch zu ihren Aktivitäten. Daran sieht man auch<br />
schon das Verhältnis von Kommissionen und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass<br />
nämlich die Kommissionen versuchen, nach außen ein einheitliches Gesamtbild zu zeigen.<br />
Im Unterschied zur „normalen“ historischen Forschung, wo man in Eigenverantwortung<br />
publiziert und an die Öffentlichkeit geht und die Ergebnisse auf Tagungen präsentiert, ist in<br />
diesem Fall der Forschungs- und Publikationsprozess sehr institutionalisiert. Das ist auch<br />
verständlich, weil die Idee bzw. das Ziel ja die Beantwortung bestimmter vorgegebener<br />
Fragen ist, und man kann diese Fragen intern nicht wirklich ausdiskutieren, wenn man<br />
dabei sofort ständig von den Medien widergespiegelt wird. Damit käme man sofort auf<br />
eine Ebene der Verbreitung von Informationen, die viel zu schnell ist für das wissenschaftliche<br />
Arbeiten.<br />
Trotzdem kann ich etwas zum Unterschied der beiden Kommissionen sagen. Der offensichtlichste<br />
Unterschied ist die historische Ausgangssituation der beiden Länder, die Schweiz<br />
war in der NS-Zeit ein neutraler Staat, aber auch eine zentrale Finanz- und Rüstungswirtschaftsdrehscheibe<br />
für das Dritte Reich und insoweit in seinen wirtschaftlichen Beziehungen<br />
für den ganzen europäischen Raum, aber auch für den Handel mit den Alliierten, für die<br />
Nachrichtenflüsse der Alliierten etc. in der NS-Zeit massgeblich. Daher ist das Forschungsfeld<br />
der Kommission in der Schweiz so angelegt, dass es letztlich um diese internationalen<br />
Beziehungen geht, mit dem Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Beziehungen der<br />
Schweiz zum Dritten Reich. Das ist sehr komplex, weil die Kapitalflüsse, der Goldhandel<br />
etwa, zwischen den Alliierten und den Achsenmächten verlief. Dazu gehören auch Devisengeschäfte<br />
zwischen den neutralen und den nichtneutralen Ländern, und alles, was im<br />
weiteren Sinne noch damit zusammenhängt, etwa die Flüchtlingspolitik der Schweiz, weil<br />
daran auch wieder Geldfragen hängen, z.B. Lösegelderpressungen, wenn man Juden aus<br />
dem Dritten Reich hat ausreisen lassen und dafür hohe Beträge in Devisen wollte. All diese<br />
Dinge sind großteils über die Schweiz abgewickelt worden, und insofern ist das Untersuchungsfeld<br />
der Schweizer Kommission sehr weit gefasst.<br />
Die österreichische Situation stellt sich demgegenüber ganz anders dar. Hier geht es ja<br />
nicht unmittelbar um die Frage der Involvierung Österreichs in das Dritte Reich, die ist ja<br />
offensichtlich, sondern es geht ganz stark um die Frage, wie in der Nachkriegszeit mit<br />
dem, was in der NS-Zeit passiert ist, umgegangen wurde. Die Frage des Umgangs nach<br />
1945 verweist aber natürlich auch auf die Zeit davor. Man muss feststellen, was nach wie<br />
vor ausgeblendet wird, zuwenig bewusst ist bzw. von der Forschung bislang nicht bearbeitet<br />
worden ist. Der Hauptansatz ist die Geschichte der Zweiten Republik, und die NS-<br />
Zeit ist die Voraussetzung, um sie zu verstehen. Das ist einerseits eine eingeschränktere<br />
154 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Fragestellung, weil es ja „nur“ um Vermögensentzug im ganz strengen Sinne geht, gleichzeitig<br />
ist es ein enorm weites Feld, weil damit wiederum sehr vieles zusammenhängt. Das<br />
Problem dabei ist, dass die ganze Frage des Vermögensentzugs auf dem Gebiet der Republik<br />
Österreich von einem sozusagen „virtuellen Raum“ ausgeht, da Österreich als Staat damals<br />
nicht existiert hat, im Unterschied zur Schweiz, die ein klar definierter Nationalstaat<br />
mit klaren Grenzen war, die sich seitdem nicht geändert haben. Allein diese Abgrenzungsgeschichte<br />
ist sehr kompliziert.<br />
Die zentralen Fragestellungen der beiden Kommissionen sind also in diesem Sinne sehr unterschiedlich,<br />
letztlich geht es bei beiden aber ganz stark um ökonomische Perspektiven.<br />
Die Umrechnung der NS-Zeit in Geldwerte – also was ist verloren gegangen, was wurde<br />
jemandem genommen, was wurde nicht zurückgegeben – ist sicher eine neue Tendenz in<br />
der historischen Forschung und im öffentlichen Interesse an der NS-Zeit. Es ist interessant,<br />
dass das jetzt nach 50 Jahren das Hauptthema ist – forschungspolitisch muss man ja immer<br />
auch fragen, was mit dieser eingeschränkten Fragestellung eigentlich verdeckt wird und<br />
was nicht gefragt wird.<br />
Steht die österreichische Historikerkommission vor bestimmten Problemen, sei es<br />
die begrenzte zeitliche Dauer der Forschung oder auch der Archivzugang?<br />
Die begrenzte zeitliche Forschungsdauer haben wir uns selbst gewählt. Es ist sinnvoll, auch<br />
in der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und der Auftraggeber, so etwas nicht zu lange<br />
hinzuziehen. Es gibt ja daneben auch noch die normalen Forschungseinrichtungen, und die<br />
sollen weiterhin ihre Forschungen machen. Die Kommission kann nicht Ersatz für die Forschungseinrichtungen<br />
eines Landes werden, sondern sie kann nur auf einer bestimmten Ebene<br />
versuchen, bestimmte Fragestellungen zu beantworten. Sie kann nicht die Untersuchung<br />
aller möglichen Phänomene leisten, die sicherlich auch zu untersuchen wären, sondern sie<br />
kann einzelne Fallstudien machen und einen Überblick über bestimmte Problemkomplexe<br />
geben. Beispielsweise können wir nicht alle ➤ „Arisierungsfälle“, die es in Österreich gab,<br />
untersuchen, was ja manchmal ein bisschen die Erwartung an die Kommission ist.<br />
Ein zentrales Problem unserer Arbeit ist vielmehr die Archivsituation, weil zwar geregelt ist,<br />
dass auf der Ebene der Bundesarchive alle Materialien, die wir brauchen, einsehbar sind.<br />
Auf der Ebene der Länder wird das vermutlich auch ohne Probleme gehen, soweit der momentane<br />
Stand ist, vielleicht wird es mit dem einen oder anderen Bundesland etwas schwieriger<br />
sein, aber grundsätzlich wird es gehen. Das Problem sind vielmehr die privaten Archive,<br />
im Bereich der ➤ „Arisierung“ sind das zum Beispiel die Archive der Großbanken, die<br />
dabei eine maßgebliche Rolle gespielt haben, also CA und Länderbank, die jetzt im Besitz<br />
der Bank Austria sind. Wie weit da Bereitschaft besteht, uns Zugang zu ihren Akten zu gewähren,<br />
ist noch nicht klar. Ebenso bei den Sozialversicherungen, da geht es zum Beispiel<br />
um Sozialversicherungsdaten der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, usw. Da sind<br />
wir momentan vom guten Willen dieser Unternehmen abhängig, im Gegensatz zur<br />
Schweiz, wo der Zugang eben gesetzlich gewährleistet ist. Das andere Problem, das man<br />
natürlich in der Zeitgeschichtsforschung immer hat, ist, dass viele Akten weg sind, dass sich<br />
jetzt zum Beispiel herausstellt, dass ein ganz erheblicher Teil der Akten der Rückstellungskommissionen<br />
weggeworfen wurde, bis in die jüngste Zeit herauf. Das ist schon ein gravierendes<br />
Problem von der Aktenlage her. In anderen Bereichen wird es dagegen nicht so<br />
schwierig sein, etwa festzustellen, wie viele Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen hat<br />
es wo gegeben, das lässt sich alles eruieren. Bei Fallstudien kann es allerdings auch Probleme<br />
geben mit der Aktenlage in lokalen und regionalen Archiven.<br />
Wie geht man im Forschungsprozess mit der lückenhaften Quellenlage, z.B. bei<br />
Rückstellungsakten, um?<br />
Das kann ich im Detail noch nicht sagen. Die Rückstellungsfrage ist auch nicht mein Arbeitsfeld,<br />
dazu gibt es innerhalb der Kommission andere Experten und Expertinnen. Aber<br />
grundsätzlich muss man natürlich viel Phantasie aufwenden, wie man trotz des Fehlens von<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Bertrand Perz<br />
155
Vor 15 Jahren noch undenkbar<br />
Unterlagen über Einzelfälle zu Gesamteinschätzungen kommen kann. Man muss zum Beispiel<br />
nach Ersatzdaten suchen, wenn ich die Unterlagen der Rückstellungskommissionen<br />
nicht habe, wird eine Analyse der konkreten Rückstellungspraxis in den Verfahren aber<br />
trotzdem schwierig sein. Das heißt, wir werden auch vor der Situation stehen, dass bestimmte<br />
Fragen zwar vielleicht von den Randbereichen her, etwa durch das Archiv eines<br />
beteiligten Anwalts, zu beleuchten sind, aber nicht von den zentralen Institutionen her. Das<br />
kann durchaus passieren, und das wäre ja auch ein Ergebnis. Ich halte es aber grundsätzlich<br />
für wichtig, dass jetzt eine Diskussion über das Archivgesetz in Gang gekommen ist<br />
und dass es eine Sensibilisierung gibt hinsichtlich des Umgangs mit Archivmaterial, dass<br />
z.B. private Archive ihre Akten nicht einfach wegwerfen dürfen. Über das Bundesarchivgesetz<br />
werden erstmals klare Abgaberegelungen für Akten geschaffen, die es ja bis jetzt<br />
nicht gab. Die Ministerien konnten mit ihren Akten ja mehr oder weniger nach eigenem<br />
Gutdünken verfahren. Diese Fragen werden jetzt etwas besser geregelt, was ansich dem<br />
normalen Standard eines demokratischen Rechtsstaates entspricht. Die Archivierung von<br />
Behördenvorgängen hat ja letztlich mit Fragen der Demokratie und des Rechtsstaates zu<br />
tun. Das gilt nicht nur für die NS-Zeit, sondern es geht grundsätzlich darum, dass auch<br />
Vorgänge der Nachkriegszeit und auch das, was gegenwärtig passiert, systematisch dokumentiert<br />
wird, damit später bei politischen Diskussionen über bestimmte Phasen der jüngeren<br />
Zeit anhand von Akten und anderen Quellen auch klare Urteile, Perspektiven etc.<br />
entwickelt werden können. Das halte ich für ganz wesentlich.<br />
Worin liegt das spezifische Erkenntnisinteresse der Historikerkommission?<br />
Geht es primär darum, den Umfang von Vermögensentzug und Rückstellungen zu<br />
erfassen, oder geht es auch um eine Analyse des nationalsozialistischen Systems der<br />
Bereicherung oder um die Perspektive der Opfer?<br />
Der Auftrag der Kommission ist auf der einen Seite relativ offen. Es geht um den gesamten<br />
Vermögensentzug auf dem Gebiet der Republik Österreich, das umfasst auch den Vermögensvorenthalt,<br />
d.h. Lohnvorenthalt gegenüber Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen,<br />
und Entschädigung und Rückstellung. Es ist eine Frage der Interpretation, was das im<br />
Konkreten bedeutet. Wenn man es von der Diskussion im Vorfeld der Kommission aus betrachtet,<br />
stand auf der politischen Ebene sicher ganz stark im Vordergrund, dass man eine<br />
Expertise zur Frage der „Arisierungen“ und der Zwangsarbeit wollte. Interessant ist, dass<br />
man das nicht explizit in den Auftrag hineingeschrieben hat, vermutlich gab es da eine<br />
gewisse Scheu zu schreiben, dass man wissen will, was Juden und in Österreich weggenommen<br />
worden ist. Man hat stattdessen eine sehr neutrale Formulierung gewählt. Insoweit<br />
war es für die Kommissionsmitglieder eine sehr ungewohnte Situation, dass die Politik<br />
einen Rahmen vorgibt, der eigentlich sehr viel Interpretationsspielraum läßt. Den „gesamten<br />
Vermögensentzug“ zu untersuchen, ist natürlich enorm komplex, und daher ging es uns<br />
hauptsächlich darum, die Grenzen dieses Themenkomplexes festzulegen, diese Frage von<br />
den Grenzen her zu diskutieren. Fällt zum Beispiel auch ein Raubüberfall im Nationalsozialismus<br />
unter „Vermögensentzug“? Wie definiert man die territorialen Grenzen des „Gebietes<br />
der Republik Österreich“? Was ist zum Beispiel, wenn jemand mit einem Teil seines<br />
Geldes nach Prag flüchtete, dort von der ➤ Gestapo verhaftet und ihm das Geld dort abgenommen<br />
wurde, und er wurde vielleicht sogar wieder nach Österreich deportiert oder<br />
auch nicht. War das Vermögensentzug in Österreich oder nicht? Was ist, wenn Österreicher<br />
den Freihafen von Triest ausgeräumt und die Waren nach Österreich gebracht<br />
haben, war das Vermögensentzug in Österreich oder nicht? Man kann also viele thematische<br />
Grenzen diskutieren. Ein anderer Punkt ist, dass man viel über den Charakter des<br />
NS-Systems wissen muss, um die Komplexität der Beraubungsvorgänge überhaupt zu verstehen.<br />
Ich muss natürlich auch wissen, wie der Handlungsspielraum und der Erwartungshorizont<br />
der potentiellen Opfer gegenüber der Beraubung war. Wie haben sie sich verhalten,<br />
was wurde ihnen dann weggenommen und in welcher Weise? Zum Beispiel die Frage<br />
der Entscheidung österreichischer Juden, zu emigrieren oder nicht, bei der ➤ Vermögens-<br />
156 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
verkehrsstelle oder dann später bei der ➤ Zentralstelle für jüdische Auswanderung das<br />
ganze Vermögen anzugeben oder zu sagen, „Ich gebe nicht das ganze Vermögen an,<br />
riskiere aber, dass ich nicht ausreisen darf, weil die NS-Behörden vermuten, ich habe<br />
noch irgendwo was versteckt, und das rücke ich nicht heraus. Kann auch sein, ich habe<br />
nichts mehr, aber das glauben sie mir nicht.“ Diese Überlegungen – wie verhalte ich mich,<br />
wann gehe ich, wann ist der richtige Zeitpunkt, oder schicke ich nur meine Kinder ins Ausland<br />
und bleibe selbst da? – hängen in hohem Maße von der Einschätzung des Charakters<br />
des NS-Regimes durch die Opfer selbst ab. Das heißt, die Perspektive der Opfer und<br />
ihre Erfahrungen spielen eine wesentliche Rolle zum Verständnis bestimmter Vorgänge der<br />
Beraubung. Denn die Beraubungsinstitutionen entwickelten zwar einen systematischen<br />
Plan der völligen Beraubung der jüdischen Bevölkerung, aber sie „reagierten“ natürlich<br />
auch auf das Verhalten ihrer potentiellen Opfer, die beiden Seiten sind verschränkt miteinander.<br />
Das gilt ein Stück weit auch für die Zwangsarbeit, wenn vielleicht auch nicht in<br />
dem starken Ausmaß, aber wenn man etwa die Reaktion des Regimes auf Schwangerschaften<br />
der „Ostarbeiterinnen“, nämlich die Einrichtung von „Ostarbeiterinnen-Entbindungsheimen“<br />
betrachtet, oder die Frage von sexuellen Kontakten zwischen Deutschen<br />
und Ausländern, also die sogenannten „Rassenschande“-Geschichten, Arbeitsflucht, Verweigerung,<br />
bei all diesen Fragen müssen immer auch die Erfahrungen und Reaktionen der<br />
Betroffenen berücksichtigt werden und wie wiederum NS-Behörden auf das Verhalten der<br />
Betroffenen reagierten. Das hat aber seine Grenzen, wir schreiben nicht die NS-Geschichte<br />
im Sinne einer Systemanalyse und auch keine Erfahrungsgeschichte der Betroffenen in der<br />
NS-Zeit. Vom Auftrag der Kommission her steht im Vordergrund die Frage, was wurde den<br />
Leuten in welcher Weise weggenommen, und welche Form von Zwang wurde auf sie ausgeübt?<br />
Die Idee der Auftraggeber der Kommission ist sicherlich, ein relativ umfassendes<br />
Bild auch von den Größenordnungen des Vermögensentzugs und der Zwangsarbeit zu<br />
vermitteln. Es geht primär um „handfeste“ Daten, festzustellen, es gab so und so viele<br />
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, so und so viele leben wahrscheinlich noch,<br />
und was das bedeutet.<br />
Was sagen Sie zu der von manchen Kollegen und Kolleginnen geäußerten Kritik,<br />
solche Kommissionen würden nur positivistische Geschichtsschreibung 1 betreiben?<br />
Ich stimme der Ansicht zu, dass die Projekte der Kommission methodisch nicht speziell innovativ<br />
sind, das ist aber auch nicht die Idee einer Kommissionsarbeit. Das ist ähnlich wie bei<br />
Gerichtsgutachten. Wenn man Gerichtsgutachten erstellt, dann geht es nicht um methodisch<br />
innovative Verfahren, sondern da geht es darum, mit den vorhandenen methodischen und<br />
theoretischen Möglichkeiten unter bestimmten Voraussetzungen bestimmte Fragen zu beantworten.<br />
Dass das zum Teil auch dem Vorwurf entspricht, positivistisch zu sein, verstehe ich<br />
ein Stück weit. Natürlich läßt die Fragestellung nach dem Vermögensentzug für einen<br />
großen Teil der Fragen, die in der Zeitgeschichtsforschung auch gestellt werden, keinen<br />
Platz, aber es ist eben schwierig, von der Politik zu erwarten, dass die Fragen noch einmal<br />
anders gestellt werden. Das bedeutet ja nicht, dass man methodisch vollkommen naiv an<br />
die Dinge herangehen muss.<br />
Wozu werden die Ergebnisse, die im Rahmen der Historikerkommission erarbeitet<br />
werden, letztlich dienen? Werden sie eine Grundlage für Entschädigungszahlungen<br />
und Rückstellungen sein?<br />
Von den vier Auftraggebern, also Bundeskanzler, Vizekanzler, Bundes- und Nationalratspräsident,<br />
her ist es sicher stark als politische Handlungsanleitung oder als Legitimation für<br />
politisches Handeln intendiert. Man will eine Expertise haben, die politisches Handeln legitimiert,<br />
um nach außen zu vertreten, warum man dieses und jenes tut. Es geht aber auch<br />
um eine Bewusstmachung bestimmter Vorgänge, die in Österreich während des Nationalsozialismus<br />
passiert sind, und die meines Erachtens nach viel zuwenig aufgearbeitet sind.<br />
Es gibt immerhin bis heute kein Standardwerk und nicht einmal einen ordentlichen<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Bertrand Perz<br />
157
vor 15 Jahren noch undenkbar<br />
Überblick über das Thema „Arisierung“ in Österreich. Ein Problem in diesem Zusammenhang<br />
ist aber die Frage, ob die Kommission ein Alibi ist, um politisches Handeln zu verzögern,<br />
bis der Endbericht der Kommission vorliegt. Ein Stück weit haben Kommissionen<br />
natürlich diesen Verzögerungseffekt. In dem Moment, wo ich eine Kommission beauftrage,<br />
kann man ja auf der politischen Ebene sagen: „Wir tun ja etwas. Man kann uns nicht vorwerfen,<br />
wir tun nichts, es passiert ja eh was.“ Für mich war es deshalb ganz wichtig, und<br />
das war auch in der Kommission die Meinung, explizit zu sagen, die Regierung, aber<br />
auch das Parlament können vom jetzigen Kenntnisstand her schon bestimmte Dinge machen,<br />
zum Beispiel überlegen, einen Fonds für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen<br />
einzurichten, und sie können auch beginnen, an bestimmte Gruppen, wo die Sachlage<br />
eindeutig ist, zu zahlen. Wenn wir draufkommen, man will jetzt drei Jahre überhaupt<br />
nichts machen, und die Kommission ist nur dazu da, das drei Jahre lang hinauszuzögern,<br />
dann wird es natürlich ziemlich schwierig für uns. In dem Fall müsste man sich überlegen,<br />
ob man diese Arbeit weiter macht. Ich würde aber sagen, realistischerweise kann man<br />
solche Entscheidungen vor den Nationalratswahlen im Oktober 1999 nicht erwarten, weil<br />
diese wahrscheinlich eher von den Intervallen unmittelbar bevorstehender Wahlen abhängen<br />
als von der Frage der Finanzierbarkeit von Entschädigungen. Für die Politik sind diese<br />
Milliarden ja nicht ein Problem als Summe an sich.<br />
Welche Konsequenzen ergeben sich Ihrer Meinung nach aus der gegenwärtigen<br />
Konjunktur der Zeitgeschichte, etwa durch den steigenden Einfluss von<br />
Kommissionen, einerseits auf den Forschungsbereich und andererseits auf<br />
gesellschaftlicher Ebene?<br />
Für die Forschung unmittelbar ist es so, dass mehr Geld da ist als sonst, jetzt speziell für die<br />
Zeitgeschichte. Langfristig besteht aber das Problem und die Gefahr, dass man nach dieser<br />
Kommission sagt, jetzt haben wir so viel Geld für die NS-Forschung ausgegeben, jetzt ist<br />
Schluss. Das hängt ein bisschen mit der Verwechslung von Kommission und Gericht zusammen,<br />
dass also die öffentlichen Zuschreibungen ganz stark dahin gehen, es handle sich<br />
hier sozusagen um ein Gerichtsverfahren mit einem abschließenden Urteil. Die Geschichtswissenschaft<br />
will ja gerade nicht diesen Abschluss, sondern entwirft eine von vielen möglichen<br />
Perspektiven auf Vergangenheit. Das Gericht will demgegenüber aber den Abschluss<br />
mit einem klaren Urteil und Konsequenzen. Das Urteil soll eindeutig sein und eben keine<br />
anderen Perspektiven erlauben. Und diese Verwechslung zwischen Gericht und Geschichtswissenschaft<br />
kann auch dazu führen, dass man dann sagt: „Jetzt haben wir das eh erledigt,<br />
das ist jetzt festgeschrieben, und alle anderen Perspektiven sind sowieso nicht wichtig<br />
in Bezug auf den Nationalsozialismus, das fördern wir nicht mehr.“<br />
Die Folgen für das kollektive Bewusstsein sind schwer einzuschätzen. Wenn man sich zum<br />
Beispiel die Entwicklung in der Schweiz anschaut, kann man pessimistisch sein und sagen,<br />
durch die Bergier-Kommission und durch die Volcker-Kommission gab es ein massives<br />
Ansteigen des Antisemitismus, zumindest der öffentlichen antisemitischen Äußerungen mit den<br />
klassischen Zuschreibungen: „Die Juden wollen unser Geld“, „die Ostküste“ oder die ganzen<br />
Klischees, die dann immer kommen. Welche langfristigen Folgen das hat, ist wirklich schwer<br />
zu sagen. Ein anderer Aspekt ist, dass diese ganze Debatte in der Schweiz in gewisser<br />
Weise auch ein Ende dieser Schweiz-Zentriertheit befördert. Die Schweiz ist nicht mehr der<br />
Sonderfall in der europäischen Landschaft, als der sie sich selbst jahrzehntelang gesehen hat.<br />
Wie das in Österreich sein wird, ist schwer zu sagen. Ich finde es zumindest erstaunlich, dass<br />
man mit der Einrichtung der Historikerkommission schon relativ weit weg ist vom langjährigen<br />
offiziellen Opfermythos Österreichs. Was jetzt passiert, dass zum Beispiel über Zahlungen<br />
öffentlich zumindest nachgedacht wird, das wäre vor 15 Jahren noch undenkbar gewesen.<br />
Ob das politisch und gesellschaftlich in Österreich langfristig mehr Bewusstsein schafft in<br />
Bezug auf die Vergangenheit, lässt sich noch nicht abschätzen. Das kann man zwar hoffen,<br />
aber wenn man manche Reaktionen sieht, die auf die Frage der finanziellen Entschädigung<br />
oder der Rückstellungen kommen, muss man da trotzdem auch skeptisch bleiben.<br />
158 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Welche Bedeutung kann Ihrer Meinung nach die Arbeit der Historikerkommission<br />
für die Opfer des Nationalsozialismus, für die Leidtragenden haben?<br />
Das ist schwer zu sagen, weil es für einzelne Opfergruppen und für einzelne Personen<br />
sicher sehr unterschiedlich ist. Es gibt einerseits die Gruppe von Personen, die nie etwas<br />
bekommen hat und die auch auf Grund ihrer jetzigen sozioökonomischen Situation froh ist,<br />
irgendwas zu bekommen und die es vielleicht wie ein unerwartetes „Geschenk“ sieht, jetzt<br />
nach so vielen Jahren doch noch so etwas wie eine Entschädigung zu bekommen. Es gibt<br />
aber auch Gruppen, für die der finanzielle Aspekt nicht wichtig ist, sondern die das als<br />
symbolische Anerkennung sehen. Andere fühlen sich aber auch verhöhnt durch diese Überlegungen<br />
– „Wieviel ist an wen zu zahlen?“ –, weil ihr Leid ja nicht wieder gut zu machen,<br />
nicht mit einer bestimmten Summe zu entschädigen ist. Und es gibt sicher auch Leute, die<br />
nicht an diese Vergangenheit erinnert werden wollen und deshalb nichts mehr damit zu tun<br />
haben wollen. Insofern kann man nicht pauschal von den Konsequenzen für die Opfer des<br />
Nationalsozialismus sprechen. Grundsätzlich geht es bei der ganzen Diskussion aber nicht<br />
um „Gnadenakte“ der Republik oder der Firmen. Einerseits geht es um Rechtsansprüche<br />
von Menschen, denen etwas weggenommen bzw. vorenthalten wurde, andererseits um<br />
eine Entschädigung für den Zwang und das ihnen zugefügte Leid.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Interview mit Bertrand Perz<br />
Dr. Bertrand Perz ist Univ.-Lektor am<br />
Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und<br />
Mitglied der Historikerkommission<br />
1 Mit dieser Kritik ist eine Geschichtsschreibung gemeint,<br />
die sich in erster Linie auf das Sammeln und Beschreiben<br />
von Quellen/Daten beschränkt, ohne die Auswahl der Daten<br />
und die Daten selbst kritisch zu hinterfragen.<br />
159
DIE ARCHIVE ÖFFNEN SICH<br />
Die Erforschung der Firmen- und Bankengeschichte<br />
während der NS-Zeit<br />
Neben der Historikerkommission haben mittlerweile<br />
auch einige österreichische Unternehmen mit der Erforschung<br />
ihrer Vergangenheit während der NS-Zeit begonnen.<br />
Österreichische Banken wie die P.S.K. und die Erste<br />
Bank haben Forschungsteams beauftragt, die Konten<br />
und Depots ehemaliger jüdischer KundInnen ausfindig<br />
zu machen. Unternehmen wie die VA Stahl und VA Tech<br />
als Nachfolgefirmen der verstaatlichten Industrie lassen<br />
die Geschichte der „Hermann-Göring-Werke“, aus denen<br />
die VOEST nach 1945 hervorgingen, und der bei ihnen<br />
beschäftigten ZwangsarbeiterInnen erforschen, ebenso<br />
zum Beispiel der Verbund und die Lenzing AG.<br />
Einige Unternehmen haben auf die Ankündigung von<br />
Sammelklagen hin eine baldige Entschädigungsregelung<br />
für ehemalige ZwangsarbeiterInnen in Aussicht gestellt<br />
bzw. versucht, auf dem Weg des Vergleichs eine Lösung<br />
mit den Betroffenen zu finden.<br />
Dass für die Unternehmen die wissenschaftliche Erforschung<br />
der Firmengeschichte in der NS-Zeit eng mit konkreten<br />
Zahlungen an die Opfer und deren Hinterbliebene<br />
verknüpft ist, zeigt sich am Beispiel der P.S.K., deren<br />
Forschungsprojekt schon relativ weit fortgeschritten ist:<br />
Im März 1998 wurde vom Vorstand der P.S.K. ein Historikerteam<br />
unter der Leitung von Univ.-Doz. DDr. Oliver<br />
Rathkolb eingesetzt, das eine umfassende Dokumentation<br />
erstellen sollte als mögliche Entscheidungsgrundlage<br />
für freiwillige Kompensationen für ehemalige KundInnen<br />
bzw. deren Nachkommen. Im Oktober 1998 wurde<br />
ein erster Zwischenbericht im Internet veröffentlicht<br />
(➤ Internet-Adressen S. 182), in dem die Unternehmensgeschichte<br />
des „Postsparkassenamts“ zwischen 1938 und<br />
1945 und die nationalsozialistische Praxis der Vermögensberaubung<br />
und -kontrolle dargestellt wird.<br />
Die Veröffentlichung einer Liste von rund 7000 namentlich<br />
aufgeführten Scheckkonten, Sparbüchern, Wertpapierdepots,<br />
die vom NS-Regime geplündert und kontrolliert<br />
wurden, soll zur Ausforschung von Anspruchsberechtigten<br />
führen. Bis jetzt wurden ca. 2000 Anträge<br />
von Nachkommen oder anderen Verwandten der ehemaligen<br />
jüdischen KundInnen gestellt. Diese Anträge<br />
werden ebenfalls vom Forschungsteam bearbeitet:<br />
Scheckkonten und andere Vermögenswerte beim ehemaligen<br />
„Postsparkassenamt“ werden den AntragstellerInnen<br />
zugeordnet und die Höhe der Beträge sowohl<br />
im März 1938 als auch im April 1945 recherchiert.<br />
Um die de facto Enteignung zu verschleiern, plünderten<br />
die NS-Behörden die Konten jüdischer Kunden nicht vollständig,<br />
sondern beließen kleine Restbeträge.<br />
Die P.S.K. zahlt an berechtigte AntragstellerInnen, das<br />
heißt Nachkommen oder andere Verwandte, einen Betrag<br />
in der Höhe des Kontostandes von April 1945 aus,<br />
zumindest aber öS 1200.<br />
Diese Auszahlungen sind in den Fällen, in denen die<br />
Recherche abgeschlossen ist, bereits erfolgt.<br />
Bis Ende 1999 sollen ein Endbericht und außerdem eine<br />
umfassende Datenbank über die Konten, Sparbücher,<br />
Depots und Schrankfächer und biographischen Daten<br />
der vorwiegend jüdischen Opfer der nationalsozialistischen<br />
Beraubung erstellt werden.<br />
160 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Glossar<br />
Abgeltungsfondsgesetz<br />
Das am 22. März 1961 erlassene Bundesgesetz,<br />
womit Bundesmittel zur<br />
<strong>Bildung</strong> eines Fonds zur Abgeltung<br />
von Vermögensverlusten politisch<br />
Verfolgter zur Verfügung gestellt<br />
werden, war aufgrund der Forderungen<br />
des ➤ Claims Committee und einer<br />
Bestimmung des Staatsvertrages<br />
erlassen worden, konnte jedoch erst<br />
nach Abschluß des ➤ Kreuznacher<br />
Abkommens mit der BRD im Juni<br />
1961 in Kraft treten, weil es an die finanzielle<br />
Beteiligung der BRD geknüpft<br />
worden war. Anspruchsberechtigt<br />
waren „rassisch“ oder religiös<br />
Verfolgte für erlittene Vermögensverluste<br />
an Bankkonten, Bargeld,<br />
Zahlungen diskriminierender<br />
Abgaben ( ➤ Reichsfluchtsteuer u.a.).<br />
Kleinere Vermögensverluste (bis zu<br />
47.250 Schilling) wurden zu 100 %<br />
entschädigt, größere mit 48,5%, aber<br />
mind. mit 47.250 Schilling.<br />
Alliierter Rat<br />
bzw. Alliierter Kontrollrat: In Deutschland<br />
und in Österreich gebildetes Organ<br />
der Besatzungsmächte. In Österreich<br />
wurde der Alliierte Rat auf der<br />
Grundlage des am 4. Juli 1945 von<br />
den Alliierten in London beschlossenen<br />
1. Kontrollabkommens über<br />
Österreich am 9. Juli 1945 eingerichtet.<br />
Der Rat, bestehend aus vier ➤<br />
Hochkommissaren, übte oberste Regierungsgewalt<br />
aus. Entscheidungen<br />
mussten einstimmig getroffen werden,<br />
jede Besatzungsmacht hatte Vetorecht.<br />
Der Rat legte in der Deklaration<br />
vom 9. Juli auch die Besatzungszonen<br />
fest. Das 2. Kontrollabkommen<br />
über Österreich vom 28. Juni<br />
1946 räumte der Provisorischen Regierung<br />
größere Kompetenzen ein,<br />
regelte den freizügigen Reiseverkehr<br />
zwischen den Zonen und erlaubte<br />
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen<br />
zu Regierungen der Vereinten<br />
Nationen.<br />
Alte Kämpfer<br />
Viele der sogenannten „alten<br />
Kämpfer“ waren Soldaten, die sich<br />
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs<br />
Frontkämpferverbänden und<br />
später der NSDAP anschlossen. Als illegale<br />
Parteigenossen nahmen viele<br />
der „alten Kämpfer“ am nationalsozialistischen<br />
Juliputsch 1934 teil. Die<br />
Übernahme nationalsozialistischer<br />
Herrschaft in Österreich stellte für<br />
die vielfach arbeitslosen und von sozialer<br />
Deklassierung bedrohten, bis<br />
1938 auch gerichtlich verfolgten illegalen<br />
Nationalsozialisten die Möglichkeit<br />
dar, über Protektion durch<br />
die Partei zu Ansehen und Vermögen<br />
zu gelangen. Sie wurden etwa<br />
bei ➤ „Arisierungen“ protegiert, in<br />
der Gewährung von „Arisierungsdarlehen“<br />
sowie in der Zuweisung von<br />
Kleinbetrieben und Handelsgesellschaften.<br />
Viele der „Alten Kämpfer“<br />
bereicherten sich als ➤ „Ariseure“.<br />
Altmann, Karl (1904 –1960)<br />
KPÖ-Politiker, 1945–1947 Bundesminister<br />
für Elektrifizierung und Energiewirtschaft,<br />
schied als letzter kommunistischer<br />
Politiker aus der Regierung<br />
aus.<br />
Am Spiegelgrund<br />
Auf dem Gelände der Heil- und Pflegeanstalt<br />
➤ „Am Steinhof“ in Wien<br />
befanden sich in der NS-Zeit drei<br />
Einrichtungen, in denen Kinder und<br />
Jugendliche interniert wurden: eine<br />
Kinderfachabteilung, eine Jugenderziehungsanstalt<br />
und eine Arbeitsanstalt<br />
für „asoziale“ Mädchen und<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Frauen. 1940–1942 standen die<br />
Kinderfachabteilung (am 24. 7.1940<br />
eröffnet) und das Jugenderziehungsheim<br />
unter dem Namen „Wiener<br />
städtische Jugendfürsorgeanstalt<br />
Am Spiegelgrund“ in einer administrativen<br />
Einheit. 1942 erfolgte<br />
die Trennung in die „Heilpädagogische<br />
Klinik Am Spiegelgrund/Wiener<br />
Nervenklinik für Kinder“ und das<br />
„Wiener städtische Erziehungsheim<br />
Am Spiegelgrund“. Viele der inhaftierten<br />
Kinder und Jugendlichen<br />
wurden Opfer medizinischer Versuche,<br />
von Vergiftung, ➤„Euthanasie“<br />
und Zwangssterilisation.<br />
Am Steinhof<br />
1907 eröffnete „Landes- und Pflegeanstalt<br />
für Geistes- und Nervenkranke<br />
für Wien und Niederösterreich“<br />
im 14. Wiener Gemeindebezirk. Sie<br />
war damals die größte psychiatrische<br />
Anstalt Europas und erlangte aufgrund<br />
der modernen architektonischen<br />
Gestaltung Vorzeigecharakter.<br />
Die bauliche Struktur in Form einzelner<br />
Pavillons bestimmte das pflegerische<br />
Konzept. Die gesamte Anlage<br />
umfaßte drei Anstaltsbereiche: eine<br />
Heilanstalt, eine Pflegeanstalt sowie<br />
ein Sanatorium. Das Sanatorium<br />
wurde 1921 in eine Lungenheilstätte<br />
umgewandelt. In der NS-Zeit wurden<br />
die PatientInnen vielfach Opfer der<br />
➤ Euthanasieaktion „T4“.<br />
Amtsbescheinigung<br />
Nach dem ➤ Opferfürsorgegesetz<br />
wurde die Amtsbescheinigung jenen<br />
Opfern des Nationalsozialismus ausgestellt,<br />
die aufgrund von Gutachten<br />
der zuständigen behördlichen Sozialund<br />
Gesundheitsämter als fürsorgebedürftig<br />
anerkannt wurden. Primär<br />
war jedoch nach 1945 nur politischen<br />
161
Glossar<br />
Opfern des Nationalsozialismus der<br />
Erhalt einer Amtsbescheinigung vorbehalten.<br />
Der Besitz einer Amtsbescheinigung<br />
ermöglichte den Bezug<br />
einer Opferrente. ➤ Opferausweis.<br />
Arierparagraph<br />
1933 erlassene Bestimmung, die die<br />
Mitgliedschaft von „Nichtariern“,<br />
das heißt Juden und Jüdinnen, Sinti<br />
und Roma und anderen Gruppen, in<br />
deutschen Parteien, Verbänden, Vereinen<br />
etc. verbot. Vorläufer der ➤<br />
Nürnberger Rassengesetze.<br />
Ariseur<br />
Die unmittelbar nach dem Anschluss<br />
einsetzenden spontanen Enteignungen,<br />
die sogenannten „wilden Arisierungen“<br />
von Geschäften und gewerblichen<br />
Betrieben wurden durch<br />
vielfach selbsternannte „Kommissare“<br />
begonnen. Die planmäßige<br />
Durchführung der Enteignungen<br />
sollten die Praxis der „wilden Arisierungen“<br />
im Nachhinein legalisieren<br />
und künftig kontrollieren. Die ➤ Vermögensverkehrsstelle<br />
(VVST) bestellte<br />
neue, eigens dafür ausgewählte<br />
„kommissarische Verwalter“.<br />
Ab Februar 1939 setzte die VVST für<br />
die noch bestehenden jüdischen<br />
Unternehmen sogenannte „Treuhänder“<br />
ein, um deren ➤ „Arisierung“<br />
oder Auflösung vorzubereiten. Für<br />
die zahlreichen Stillegungen von Betrieben<br />
im Handels- und Gewerbebereich<br />
berief die VVST sog. „Abwickler“.<br />
Die Misswirtschaft der frühen<br />
„wilden Arisierungen“ zeigte sich<br />
auch bei den „Abwicklern“, zumal<br />
die Betriebsliquidierungen vielfach<br />
die Möglichkeiten zu eigener Bereicherung<br />
boten.<br />
Arisierung<br />
Der Terminus „Arisierung“ bezeichnet<br />
die Enteignung der gesamten<br />
jüdischen Bevölkerung. Nach planlosen,<br />
gesetzlich nicht geregelten<br />
„wilden Arisierungen“ unmittelbar<br />
nach der nationalsozialistischen<br />
Machtübernahme erfolgte die systematische<br />
Enteignung von Geschäften<br />
und Firmen über Zwangsverkauf, Betriebsstillegungen<br />
oder den Entzug<br />
von Gewerbekonzessionen durch die<br />
Nationalsozialisten. Neben dem Ziel<br />
der Verdrängung der Juden und Jüdinnen<br />
aus der Wirtschaft sollte über<br />
die Enteignung von Häusern, Wohnungen,<br />
Grundstücken, Wertpapieren<br />
und Privatvermögen auch die systematische<br />
Verdrängung der jüdischen<br />
Bevölkerung aus allen Bereichen<br />
des öffentlichen Lebens forciert<br />
werden.<br />
Arisierungsauflage<br />
Der ➤ „Ariseur“ hatte neben dem<br />
festgesetzten ➤ Kaufpreis an den<br />
Staat eine „Arisierungsauflage“ als<br />
Prämie für die günstigen Kaufbedingungen<br />
zu entrichten.<br />
Arisierungsfonds<br />
Zur Unterstützung nationalsozialistischer<br />
Kaufwerber von zur „Arisierung“<br />
bestimmten Geschäfte und Betrieben<br />
wurde ein Fonds gegründet,<br />
der den KaufwerberInnen „Arisierungskredite“<br />
genehmigte. Finanziert<br />
wurden diese Kredite aus den Gewinnen<br />
bereits enteigneten jüdischen<br />
Vermögens, durch die Differenz zwischen<br />
dem tatsächlichen ➤ Sachwert<br />
eines Betriebes und dem Verkaufswert,<br />
der dafür bezahlt wurde.<br />
Auschwitz-Erlass<br />
Befehl Heinrich Himmlers vom 16.<br />
Dez. 1942, alle „Zigeuner“, die sich<br />
noch im „Reich“ befanden, in das<br />
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau<br />
zu deportieren und dort zu<br />
ermorden. Ausgenommen werden<br />
sollten davon die wenigen als „reinrassig“<br />
(„arisch“) klassifizierten „Zigeuner“,<br />
sozial angepasst lebende<br />
„Zigeuner“ und jene, die kriegswichtig<br />
waren, entweder in der Wehrmacht<br />
oder als ZwangsarbeiterInnen<br />
in der Rüstungsindustrie. Sie sollten<br />
jedoch zwangssterilisiert werden.<br />
Bergier-Kommission<br />
Die „Unabhängige Expertenkommission<br />
Schweiz – Zweiter Weltkrieg“<br />
wurde im Dezember 1996 von der<br />
Bundesversammlung (dem Parlament)<br />
der Schweiz eingesetzt mit<br />
dem Auftrag, „Umfang und Schicksal<br />
der vor, während und unmittelbar<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg in die<br />
Schweiz gelangten Vermögenswerte“<br />
zu untersuchen. Das betrifft u.a.<br />
den Goldhandel, Verflechtungen<br />
schweizerischer Industrie- und Handelsunternehmen<br />
mit der nationalsozialistischen<br />
Wirtschaft und die<br />
schweizerische Flüchtlingspolitik.<br />
Den Vorsitz der Kommission führt<br />
der Schweizer Wirtschaftshistoriker<br />
Jean-François Bergier, neben vier<br />
weiteren schweizerischen Mitgliedern<br />
sind auch die internationalen<br />
ExpertInnen Sybil Milton, Saul Friedlaender,<br />
Wladyslaw Bartoszewski<br />
und Harold James Mitglieder der<br />
Kommission. Die Kommission hat<br />
weitreichende Befugnisse, etwa uneingeschränkten<br />
Aktenzugang zu<br />
sämtlichen öffentlichen und privaten<br />
Archiven in der Schweiz.<br />
Blutorden<br />
Dieser Orden, die höchste Auszeichnung<br />
im NS-Staat, wurde ab 1933<br />
verliehen, zunächst nur an Teilnehmer<br />
des Hitler-Putsches 1923, ab<br />
1938 auch an andere Parteimitglieder,<br />
die für ihre Beteiligung an der<br />
Bewegung zumindest eine Gefängnisstrafe<br />
erhalten hatten.<br />
Breitner, Hugo (1873–1946)<br />
Finanzstadtrat im Roten Wien. Breitner<br />
entwickelte eine eigene Finanzund<br />
Steuerpolitik, um ein von der sozialdemokratischen<br />
Stadtverwaltung<br />
entwickeltes umfassendes Sozialprogramm<br />
sicherzustellen. Die Maßnahmen<br />
lagen in der Umwandlung von<br />
fixen indirekten Steuern in direkte<br />
Steuern nach sozialen Gesichtspunkten,<br />
einem weitgehenden Verzicht<br />
auf staatliche Kreditnahme, einer sozial<br />
gerechten Wohnbausteuer zur<br />
Entlastung proletarischer und kleinbürgerlicher<br />
Schichten, der Einführung<br />
diverser Luxussteuern und dem<br />
Verzicht auf Profit bei städtischen<br />
Betrieben und Unternehmungen.<br />
Bund der politisch Verfolgten –<br />
Österreichischer Bundesverband<br />
Im September 1946 schlossen sich<br />
der ➤ KZ-Verband und zahlreiche,<br />
auch in den Bundesländern tätige<br />
Komitees zur Betreuung der KZ-<br />
Überlebenden zum „Bund der politisch<br />
Verfolgten“ zusammen. Vertreten<br />
waren Mitglieder der SPÖ, der<br />
ÖVP, der KPÖ und auch die sogenannten<br />
„Abstammungsverfolgten“.<br />
Der „Bund politisch Verfolgter“ galt<br />
als offizielle Interessenvertretung<br />
aller Opfer des Nationalsozialismus.<br />
Am 8. März 1948 löste Innenminister<br />
➤ Oskar Helmer den „Bund“ mit<br />
162 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Zustimmung der Regierungsparteien<br />
auf. In der Folge entstanden drei<br />
parteinahe Organisationen der politisch<br />
Verfolgten.<br />
Bund Deutscher Mädel<br />
Ab 1930 eigene Organisation der<br />
➤ Hitlerjugend (HJ) für 14- bis<br />
21-jährige Mädchen, wobei die 17bis<br />
21-jährigen in der angegliederten<br />
Organisation „Glaube und Schönheit“<br />
erfasst waren. Der BDM diente<br />
der sportlichen Ertüchtigung sowie<br />
der ideologischen Schulung der<br />
Mädchen zu künftigen Müttern<br />
einer „genetisch gesunden“ Nachkommenschaft.<br />
Bundesentschädigungsgesetz (BEG)<br />
Das BEG der Bundesrepublik<br />
Deutschland wurde 1953 zunächst als<br />
Bundesergänzungsgesetz erlassen,<br />
eine aufgrund erheblicher Mängel<br />
notwendige Novellierung führte<br />
1956 zum eigentlichen Bundesentschädigungsgesetz.Entschädigungsberechtigt<br />
sind nach dem BEG die<br />
aus Gründen politischer Gegnerschaft,<br />
der Rasse, des Glaubens oder<br />
der Weltanschauung Verfolgten des<br />
Nationalsozialismus. Wesentliche<br />
Unterschiede zur österreichischen<br />
➤ Opferfürsorgegesetzgebung sind<br />
der Entschädigungs- und nicht der<br />
Fürsorgegrundsatz, Entschädigung in<br />
Form von Renten, wobei auch ein<br />
Großteil der Vertriebenen Anspruch<br />
auf Renten hat, während die aus<br />
Österreich Vertriebenen nur einmalige<br />
Zahlungen aus den ➤ Hilfsfonds<br />
erhielten. Insgesamt waren im Vergleich<br />
zu Österreich mehr Opfer anspruchsberechtigt,<br />
und sie erhielten<br />
auch höhere Entschädigungen. Allerdings<br />
sind auch die Regelungen des<br />
BEG sehr kompliziert und wurden<br />
teilweise heftig kritisiert, z.B. dass<br />
sich die Höhe der Rentenbezüge<br />
nach dem früheren Einkommen der<br />
Opfer richtete. Anträge konnten zudem<br />
nur bis zum 31.12. 1969 gestellt<br />
werden, seitdem sind nur einmalige<br />
Entschädigungszahlungen aus dem<br />
1980 geschaffenen Härtefonds möglich.<br />
Ähnlich wie im österreichischen<br />
OFG wurden einige Gruppen von<br />
Verfolgten im BEG benachteiligt, wie<br />
etwa Roma und Sinti, oder überhaupt<br />
davon ausgenommen wie<br />
Homosexuelle, Zwangssterilisierte,<br />
„Euthanasieopfer“, „Asoziale“ und<br />
kommunistische WiderstandskämpferInnen,<br />
die nach 1945 in der KPD<br />
aktiv waren. Keine Entschädigung haben<br />
außerdem osteuropäische Überlebende<br />
erhalten, sofern sie nicht bis<br />
Ende 1965 in ein nichtkommunistisches<br />
Land emigrierten. Die große<br />
Gruppe der ausländischen ZwangsarbeiterInnen<br />
ist nach dem BEG ebenfalls<br />
nicht anspruchsberechtigt.<br />
Bundesgesetz über die Nichtigkeit von<br />
Rechtsgeschäften und sonstigen<br />
Rechtshandlungen, die während der<br />
deutschen Besetzung Österreichs<br />
erfolgt sind<br />
Das Gesetz vom 15. Mai 1946 erkannte<br />
gemäß der ➤ Londoner Deklaration<br />
von 1943 alle Rechtsgeschäfte<br />
und Rechtshandlungen bezüglich<br />
Vermögensentzug und Entzug<br />
von Vermögensrechten, die<br />
während der deutschen Besetzung<br />
Österreichs ohne die „innere Zustimmung“<br />
der Leidtragenden erfolgten,<br />
als nichtig. Die Geltendmachung der<br />
Ansprüche der Leidtragenden sollte<br />
in späteren Verordnungen geregelt<br />
werden. ➤ Rückstellungsgesetze.<br />
Bundesgesetz über die Rückgabe<br />
von Kunstgegenständen aus den<br />
österreichischen Bundesmuseen<br />
und Sammlungen<br />
Am 4. Dezember 1998 beschlossenes<br />
Gesetz, das die Rückgabe von Kunstund<br />
Kulturgegenständen regelt, die<br />
„im Zuge von Verfahren nach dem<br />
Ausfuhrverbotsgesetz zurückbehalten<br />
wurden und als ‚Schenkungen‘<br />
oder ‚Widmungen‘ in den Besitz der<br />
österreichischen Museen und Sammlungen<br />
eingegangen sind“, die zwar<br />
rechtmäßig in den Besitz der Museen<br />
gelangten, die aber vorher „Gegenstand<br />
eines Rechtsgeschäftes gewesen<br />
sind, das nach den Bestimmungen<br />
des so genannten Nichtigkeitsgesetzes<br />
aus dem Jahre 1946 nichtig<br />
ist“, und „Kunst- und Kulturgegenstände,<br />
die trotz Durchführung von<br />
Rückstellungen nicht an die ursprünglichen<br />
Eigentümer oder deren<br />
Rechtsnachfolger von Todes wegen<br />
zurückgegeben werden konnten und<br />
als herrenloses Gut in das Eigentum<br />
des Bundes übergegangen sind“.<br />
Ferner wurde die Einsetzung eines<br />
Rückgabe-Beirats veranlasst.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
163<br />
Glossar<br />
Bundesministerium für Vermögenssicherung<br />
und Wirtschaftsplanung<br />
➤ Krauland-Ministerium.<br />
Bürckel, Josef<br />
Gauleiter von Rheinland-Pfalz (später<br />
Westmark), wurde am 13. März<br />
1938 zum „Reichskommissar für die<br />
Wiedervereinigung Österreichs mit<br />
dem Deutschen Reich“ ernannt (bis<br />
31. März 1940), gleichzeitig ab Mai<br />
1939 „Reichsstatthalter der Ostmark“<br />
und Gauleiter von Wien. Am<br />
2. August 1940 wurde er Leiter der<br />
Zivilverwaltung in Lothringen. Sein<br />
Nachfolger wurde Baldur von Schirach<br />
(ab 1931 Reichsjugendführer<br />
der HJ).<br />
Chelmno (Kulmhof)<br />
In diesem Ort war das erste nationalsozialistische<br />
Vernichtungslager und<br />
wurde als Zentrum für die Ermordung<br />
der Juden und Jüdinnen des 70<br />
km entfernten Gettos von Lodz konzipiert.<br />
Nach heutigen Schätzungen<br />
wurden im Lager Chelmno 152.000<br />
bis zu 300.000 Menschen ermordet,<br />
darunter Juden und Jüdinnen aus<br />
den Gemeinden der Umgebung, deportierte<br />
Juden und Jüdinnen aus<br />
Österreich, Deutschland, der Tschechoslowakei<br />
sowie ab 1942 polnische<br />
und sowjetische Kriegsgefangene.<br />
Claims Committee<br />
„Committee for Jewish Claims on<br />
Austria“, eine 1952 in New York gegründete<br />
Dachorganisation der 23<br />
Organisationen der ➤ Claims Conference<br />
und der Organisation vertriebener<br />
österreichischer Juden und<br />
Jüdinnen, dem „ World Council of<br />
Jews from Austria“. Das Claims Committee<br />
setzte im Mai 1953 einen Exekutivausschuss<br />
unter Vorsitz von ➤<br />
Nahum Goldmann ein, der die Verhandlungen<br />
mit der österreichischen<br />
Regierung führen sollte. Die zentralen<br />
Forderungen des Claims Committee<br />
waren die Beseitigung der Diskriminierung<br />
der vertriebenen jüdischen<br />
Bevölkerung, die individuelle<br />
Entschädigung für erlittene Vermögensverluste,<br />
Regelungen bezüglich<br />
des „erblosen Vermögens“ und der<br />
spezifischen Forderungen der ➤ Israelitischen<br />
Kultusgemeinde. Die Verhandlungen<br />
begannen Ende Juni 1953<br />
und zogen sich mit verschiedenen
Zwischenergebnissen bis 1960/61 hin.<br />
Ein Ergebnis der jahrelangen Verhandlungen<br />
– die Ansprüche auf Entschädigung<br />
und Vermögensrückstellung<br />
wurden bereits im Artikel 26<br />
des ➤ Staatsvertrages festgehalten –<br />
war die Einrichtung von ➤ Sammelstellen<br />
zur Erfassung des „erblosen<br />
Vermögens“ und die Einrichtung<br />
eines ➤ Hilfsfonds.<br />
Claims Conference<br />
„Conference on Jewish Material<br />
Claims Against Germany“, am 26.<br />
Oktober 1951 in New York gegründete<br />
Dachorganisation verschiedener<br />
internationaler jüdischer Organisationen,<br />
die unter dem Vorsitz<br />
des WJC-Präsidenten ➤ Nahum Goldmann<br />
in den Jahren 1951/52 mit der<br />
bundesdeutschen Regierung Verhandlungen<br />
über Entschädigungszahlungen<br />
an Israel und an einzelne<br />
Opfer der NS-Verfolgung führte. Die<br />
Verhandlungen führten zum ➤ Luxemburger<br />
Abkommen vom 10. September<br />
1952. Seitdem besteht die<br />
Claims Conference als Organisation<br />
zur Sicherung von Geldern für die<br />
Rehabilitation und Umsiedlung jüdischer<br />
Opfer des Naziterrors. Die<br />
Claims Conference ist Mitglied der<br />
1992 gegründeten ➤ World Jewish<br />
Restitution Organization.<br />
Class Action<br />
➤ Sammelklage.<br />
Glossar<br />
Containment-Politik<br />
Eindämmungspolitik, 1946/47 vom<br />
amerikanischen Diplomaten und<br />
Berater G. F. Kennan entworfene<br />
außenpolitische Strategie gegen die<br />
Ausdehnung des sowjetischen Einflussbereiches<br />
durch westliche Bündnispolitik,<br />
Militär- und Wirtschaftshilfe,<br />
z.B. durch das Europäische<br />
Wiederaufbau-Programm (ERP) und<br />
die NATO.<br />
Deutsche Arbeitsfront (DAF)<br />
Am 10. Mai 1933 nach dem Verbot<br />
der Gewerkschaften gegründete<br />
Einheitsorganisation „aller schaffenden<br />
Deutschen“. Der Zusammenschluss<br />
von ArbeiterInnen, Angestellten<br />
und UnternehmerInnen in<br />
einer einzigen Organisation sollte<br />
eine reibungslose Umsetzung nationalsozialistischer<br />
Wirtschaftspolitik<br />
und eine bessere Kontrolle über den<br />
gesamten Produktionsprozess gewährleisten.<br />
Aufgrund ihrer hohen<br />
Mitgliederzahl (ca. 23 Mio. Mitglieder)<br />
und der Mitgliedsbeiträge<br />
konnte die DAF unter dem Reichsleiter<br />
Robert Ley auch eine Reihe von<br />
Wirtschaftsunternehmen, u.a. Wohnungsbau-<br />
und Siedlungsgesellschaften,<br />
Banken, Versicherungen, Druckereien,<br />
finanzieren.<br />
Deutsches Jungvolk<br />
Das DJ als Teilorganisation der ➤ Hitlerjugend<br />
(HJ) erfasste die zehn- bis<br />
14-jährigen Buben. Der Eintritt in<br />
den DJ erfolgte schuljahrgangsweise<br />
am Geburtstag Hitlers. Nach der Beendigung<br />
ihrer Dienstzeit im DJ wurden<br />
die Buben (wiederum an Hitlers<br />
Geburtstag) in die eigentliche HJ<br />
überwiesen.<br />
Displaced Persons (DPs)<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg befanden<br />
sich ca. 10 Millionen Menschen<br />
auf der Flucht bzw. außerhalb ihrer<br />
Heimatländer, z.B. in den befreiten<br />
Konzentrationslagern; sie wurden<br />
als Displaced Persons bezeichnet. In<br />
Österreich waren es etwa eine Million<br />
fremdsprachige und ca. 600.000<br />
deutschsprachige DPs, darunter die<br />
Überlebenden der Konzentrationslager,<br />
die ausländischen ZwangsarbeiterInnen<br />
und die aus ihren Ländern<br />
vertriebenen und geflüchteten Menschen.<br />
Sie wurden in großen Lagern<br />
untergebracht. Für die meisten DPs,<br />
auch für die jüdischen Überlebenden,<br />
waren die alliierten Besatzungsmächte<br />
und die ➤ UNRRA zuständig,<br />
die die Versorgung und Vorbereitung<br />
der Repatriierung der DPs<br />
übernahmen. Für deutschsprachige<br />
DPs waren österreichische Behörden<br />
verantwortlich.<br />
Dokumentationsarchiv des österreichischen<br />
Widerstandes (DÖW)<br />
Das DÖW ist ein Archiv, dessen<br />
Schwerpunkte auf Widerstand und<br />
Verfolgung 1934–1945, Exil, NS-Verbrechen<br />
(insbesondere Holocaust)<br />
sowie Rechtsextremismus nach 1945<br />
liegen. Weiters ist das DÖW auch eine<br />
Forschungseinrichtung für Projekte<br />
zu den genannten Schwerpunkten.<br />
Neben der Zusammenarbeit<br />
mit universitären und außeruni-<br />
versitären Forschungseinrichtungen,<br />
HistorikerInnen, ZeitzeugInnen,<br />
Schulen, Bereichen der Erwachsenenbildung<br />
sowie der Veranstaltung<br />
von Tagungen, Symposien, Ausstellungen<br />
und der Publikation einer<br />
eigenen Zeitschrift und Schriftenreihe<br />
hat das DÖW auch eine demokratiepolitische<br />
Funktion.<br />
Döllersheim<br />
Zum Zwecke der Landbeschaffung<br />
für einen eigenen Truppenübungsplatz<br />
wurde im Dezember 1938 mit<br />
der Entsiedelung von Ortschaften<br />
um das Gebiet von Döllersheim in<br />
Niederösterreich begonnen. Im Auftrag<br />
der „Deutschen Ansiedlungsgesellschaft“<br />
sollten den ca. 7000<br />
AussiedlerInnen als Entschädigung<br />
neue Wirtschaftshöfe in der Umgebung,<br />
aber auch in anderen Reichsgebieten<br />
zugeteilt werden. Nach<br />
dem Krieg wurde der Truppenübungsplatz<br />
als deutsches Eigentum<br />
angesehen und besetzt. Nach<br />
dem Abzug der Alliierten aus Niederösterreich<br />
forderten viele der<br />
ehemals Ausgesiedelten entweder<br />
eine Entschädigung oder die Möglichkeit,<br />
wieder zurückzukehren.<br />
Die Rückstellungsfrage war insofern<br />
problematisch, als es unterschiedliche<br />
Gruppen von ehemaligen Eigentümern<br />
gab: Familien, die sich<br />
1938 geweigert hatten, ihren Besitz<br />
zu verkaufen, die keinen Kaufvertrag<br />
unterzeichneten und daher<br />
zwangsenteignet und vertrieben<br />
wurden. Eine andere Gruppe ehemaliger<br />
DöllersheimerInnen hatte<br />
1938 unter Druck dem Verkauf zugestimmt,<br />
war aber mit „arisiertem“<br />
Besitz entschädigt worden,<br />
der inzwischen zurückerstattet werden<br />
musste. Andere Döllersheimer<br />
erhielten Besitz in Südböhmen und<br />
Südmähren und wurden nach<br />
Kriegsende von dort vertrieben.<br />
Nach langen Verhandlungen über<br />
eine landwirtschaftliche Nutzung<br />
des Truppenübungsplatzes sowie eine<br />
Rückkehr der AussiedlerInnen<br />
ging der Truppenübungsplatz in<br />
den Besitz des österreichischen Bundesheeres<br />
über.<br />
Ebensee<br />
Das Konzentrationslager Ebensee<br />
wurde am 18. November 1943 als<br />
164 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Außenlager des Konzentrationslagers<br />
Mauthausen in Oberösterreich<br />
errichtet, um KZ-Häftlinge beim Bau<br />
von Tunnels für die geplante unterirdische<br />
Verlagerung einer Raketenversuchsanlage<br />
als Zwangsarbeitskräfte<br />
einzusetzen. Die Häftlinge<br />
kamen u.a. aus der Sowjetunion,<br />
aus Polen, Ungarn, Jugoslawien,<br />
Frankreich, Belgien, Luxemburg. Die<br />
ersten jüdischen Häftlinge kamen<br />
im Juni 1944 nach Ebensee, ihre<br />
Zahl nahm mit mehreren Gefangenentransporten<br />
Anfang 1945 weiter<br />
zu. Sie hatten schlechtere Lebensbedingungen<br />
als andere Häftlinge und<br />
daher auch eine höhere Todesrate.<br />
Die Forcierung des Tunnelausbaus<br />
und die damit verbundene Überbelegung<br />
des Lagers führten zu einer<br />
wesentlichen Verschlechterung der<br />
Bedingungen im Lager, allein im<br />
April 1945 starben über 3000 Häftlinge.<br />
Am 5. Mai verließen der Lagerkommandant<br />
und die SS-Wachmannschaften<br />
Ebensee, ihr Versuch,<br />
zuvor die noch lebenden Häftlinge<br />
durch einen Sprengsatz im Tunnel<br />
umzubringen, schlug fehl, da sich<br />
die Häftlinge weigerten, in den Tunnel<br />
zu gehen. Das Lager Ebensee<br />
wurde am 6. Mai von amerikanischen<br />
Truppen befreit.<br />
Eichmann, Adolf (1906–1962)<br />
Bereits zu Zeiten des Verbots der Nationalsozialisten<br />
in Österreich schloß<br />
sich Eichmann 1933 der „Österreichischen<br />
Legion“, einer Einheit der ➤<br />
SS für emigrierte Nationalsozialisten<br />
in Bayern, an. Nach militärischer<br />
Ausbildung versah er seinen Dienst<br />
im Lager Dachau. Eichmann war im<br />
Wesentlichen für die Vertreibung<br />
der Juden und Jüdinnen aus Europa<br />
zuständig. Über die Gründung der<br />
➤ „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“<br />
in Wien im August 1938<br />
wickelten Eichmann und sein Büro<br />
die Auswanderung der Juden und<br />
Jüdinnen aus Europa ab. Entscheidende<br />
Schritte lagen in der Verschlechterung<br />
der wirtschaftlichen Lage für<br />
die jüdische Bevölkerung, zunehmenden<br />
Terroraktionen sowie der<br />
Kontrolle der jüdischen Gemeinden<br />
durch erzwungene Zusammenarbeit.<br />
Nach dem Wiener Vorbild wurden<br />
weitere Auswanderungsstellen in<br />
Böhmen und Mähren, Prag und<br />
Berlin gegründet. 1939 wurde Eichmann<br />
Leiter des „Umsiedlerreferates“<br />
in der ➤ Gestapo und spielte in<br />
der Folgezeit eine zentrale Rolle bei<br />
der Vertreibung der Juden und Jüdinnen<br />
aus Polen. Nach dem Auswanderungsverbot<br />
für Juden und<br />
Jüdinnen 1941 übernahm Eichmanns<br />
Büro die Organisation der Deportationen<br />
in polnische Vernichtungslager.<br />
Nach dem Krieg floh er mit Hilfe<br />
des Vatikans nach Argentinien, wo<br />
er 1960 vom israelischen Geheimdienst<br />
aufgegriffen wurde. Nach einem<br />
Prozess in Jerusalem wurde<br />
Eichmann am 1. 6.1962 gehängt.<br />
ESRA<br />
Initiative zur psychosozialen, sozialtherapeutischen<br />
und soziokulturellen<br />
Integration. ESRA ist ein Behandlungs-<br />
und Beratungszentrum<br />
für Menschen mit psychosozialen<br />
Problemen und Krankheitsbildern,<br />
die durch Erlebnisse während des<br />
Holocaust sowie durch Entwurzelung<br />
aufgrund von Flucht und Vertreibung<br />
bedingt sind. Opfer des Nationalsozialismus<br />
haben die Möglichkeit<br />
zu Einzel- und Gruppentherapien,<br />
ambulanter Beratung, medizinischer<br />
und psychologischer Betreuung.<br />
Euthanasie<br />
Auf der Basis der ➤„Nürnberger<br />
Rassengesetze“ sowie des ➤ „Gesetzes<br />
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“<br />
wurde von den Nationalsozialisten<br />
ein eigenes Programm<br />
zur Vernichtung, wie sie es nannten,<br />
„lebensunwertem Leben“ ausgearbeitet.<br />
Der Begriff „lebensunwertes<br />
Leben“ war ein sehr breit gefächerter:<br />
Er inkludierte geistig oder körperlich<br />
behinderte Kinder und Erwachsene,<br />
politische GegnerInnen,<br />
sogenannte „Asoziale“ und „Arbeitsscheue“;<br />
all jene, die dem Ideal<br />
der „deutschen Herrenrasse“ nicht<br />
entsprachen, wurden in eigenen Anstalten<br />
interniert, zwangssterilisiert<br />
oder in Konzentrationslager deportiert.<br />
Ab 1939 wurde in eigenen<br />
Euthanasieanstalten mit der Tötung<br />
geistig und körperlich behinderter<br />
Kinder begonnen. Später folgte die<br />
unter „Sterbehilfe“ getarnte Tötung<br />
von InsassInnen von Heil- und Pflegeanstalten<br />
mittels Injektionen,<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Giftspritzen, aber auch durch Gas.<br />
Insgesamt wurden etwa 30 „Kinderfachabteilungen“<br />
geschaffen, wie<br />
etwa ➤ „Am Spiegelgrund“ in Wien,<br />
aber auch ehemalige Heil- und Pflegeanstalten<br />
wurden zu Euthanasieanstalten<br />
umfunktioniert, wie etwa<br />
➤ Hartheim bei Linz.<br />
Euthanasieaktion „T4“<br />
Im Oktober 1939 befahl Hitler<br />
die Ausweitung der „Euthanasie-Aktion“<br />
auf InsassInnen von Heil- und<br />
Pflegeanstalten im gesamten Reichsgebiet.<br />
Das Programm wurde unter<br />
der Bezeichnung „T4“ weitergeführt,<br />
benannt nach der Berliner<br />
Adresse Tiergartenstraße 4, wo die<br />
Zentrale untergebracht war. Insgesamt<br />
existierten sechs T4-Anstalten:<br />
Grafenegg in Württemberg, Brandenburg<br />
und ➤ Hartheim bei Linz ab<br />
Jänner 1940, Sonnenstein bei Pirna<br />
seit April 1940, Bernburg an der Saale<br />
ab September 1940 und Hadamar<br />
bei Limburg ab Jänner 1941. Die PatientInnen<br />
dieser Anstalten wurden<br />
in Gaskammern mittels Kohlenmonoxid<br />
ermordet. Offiziell wurde nach<br />
Bekanntwerden das T4-Programm<br />
am 3.8.1941 eingestellt. Die Ermordung<br />
durch Gas wurde nun von den<br />
T4-Spezialisten in den ➤ Vernichtungslagern<br />
realisiert. Die Ermordung<br />
der HeiminsassInnen wurde aber<br />
auch nach der offiziellen Beendigung<br />
dezentral weitergeführt bzw. wurden<br />
viele der InsassInnen in Vernichtungslager<br />
deportiert und ermordet.<br />
Figl, Leopold (1902–1965)<br />
ÖVP-Politiker, war von 1938–1943 im<br />
KZ Dachau und 1944–1945 im KZ<br />
Mauthausen inhaftiert, 1945 Landeshauptmann<br />
von Niederösterreich,<br />
Mitbegründer der ÖVP, Staatssekretär<br />
der Provisorischen Regierung<br />
unter Karl Renner, 1945–1953 Bundeskanzler,<br />
1953–1959 Bundesminister<br />
für Äußeres, Mitunterzeichner<br />
des Staatsvertrages, 1959–1961<br />
Erster Präsident des Nationalrats,<br />
1962–1965 Landeshauptmann von<br />
Niederösterreich.<br />
Fischböck, Hans<br />
Nach dem „Anschluss“ im März 1938<br />
Leiter des Ministeriums für Wirtschaft<br />
und Arbeit (ehemals Ministerium<br />
für Handel und Vekehr).<br />
165<br />
Glossar
Glossar<br />
Die Abteilungen und Referate des<br />
Ministeriums arbeiteten eng mit<br />
der ➤ Vermögensverkehrsstelle<br />
(VVST) zusammen und wirkten an<br />
der Planung der Ausschaltung der<br />
jüdischen Bevölkerung aus der<br />
österreichischen Wirtschaft entscheidend<br />
mit.<br />
Generalamnestie für ehemalige<br />
NationalsozialistInnen<br />
Das vom ➤ Verband der Rückstellungsbetroffenen<br />
heftig geforderte<br />
Gesetz wurde am 14. März 1957 erlassen.<br />
Damit wurden u.a. das<br />
Kriegsverbrechergesetz und noch<br />
bestehende Berufsverbote für ehemalige<br />
NationalsozialistInnen aufgehoben<br />
und die Rückgabe von beschlagnahmten<br />
Kleingärten und<br />
Möbeln möglich. NS-Opfer, die diese<br />
Kleingärten und Möbel – gegen eine<br />
Miete – von der Stadt Wien bekommen<br />
hatten, mussten sie nun<br />
wieder zurückgeben oder an die<br />
ehemaligen NationalsozialistInnen<br />
eine Ablöse zahlen.<br />
Generalgouvernement<br />
Das „Generalgouvernement für die<br />
besetzten polnischen Gebiete“ wurde<br />
am 26. Oktober 1939 als eigenständiges<br />
Verwaltungsgebiet errichtet<br />
und umfasste die Teile Polens, die<br />
von Deutschland besetzt, aber nicht<br />
unmittelbar dem „Reich“ angeschlossen<br />
worden waren. Generalgouverneur<br />
war Hans Frank. Das Generalgouvernement<br />
war in die Distrikte<br />
Krakau, Warschau, Radom und Lublin<br />
unterteilt. Im Sommer 1941, bei Beginn<br />
des Angriffs auf die Sowjetunion,<br />
kam der Distrikt Galizien hinzu.<br />
Insgesamt lebten im Generalgouvernement<br />
zu diesem Zeitpunkt ca. 17<br />
Millionen Menschen. Polen wurde<br />
von den Nationalsozialisten als Arbeitskräftereservoir<br />
des Reiches betrachtet,<br />
zahlreiche Zwangsarbeitslager<br />
wurden errichtet, in denen insbesondere<br />
auch die jüdische Bevölkerung<br />
Zwangsarbeit leisten musste.<br />
Gesetz über die Bestellung von<br />
öffentlichen Verwaltern und<br />
Aufsichtspersonen<br />
Das Gesetz vom 10. Mai 1945 regelte<br />
die Einsetzung von Verwaltern für<br />
öffentliche Unternehmen, die Gegenstand<br />
von Rückstellungsverfah-<br />
ren wurden, durch das Bundesministerium<br />
für Vermögenssicherung und<br />
Wirtschaftsplanung ➤ Krauland-Ministerium.<br />
Gesetz über die Erfassung „arisierter“<br />
und anderer im Zusammenhang mit<br />
der nationalsozialistischen Machtübernahme<br />
entzogener Vermögenschaften<br />
Das erste für Fragen der Rückstellungen<br />
wichtige Gesetz wurde bereits<br />
am 10. Mai 1945 erlassen. In § 2<br />
wurde festgelegt, dass die Anmeldung<br />
entzogenen Vermögens durch<br />
die derzeitigen BesitzerInnen, also<br />
in vielen Fällen durch die ➤ „Ariseure“<br />
selbst, zu erfolgen hatte. Zwar<br />
war die Nichtanmeldung strafbar,<br />
dennoch war diese Anmelderegelung<br />
für die enteigneten Opfer<br />
zweifellos problematisch. Die Verordnung<br />
zur eigentlichen Umsetzung<br />
dieses Gesetzes wurde erst<br />
ein Jahr später, erlassen.<br />
Gesetz zur „Verhütung erbkranken<br />
Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933<br />
Dieses Gesetz, das in Österreich am<br />
1.1.1940 in Kraft trat, bildete die<br />
Grundlage für die vom NS-Regime<br />
durchgeführte Zwangssterilisierung<br />
von sogenannten „Erbkranken“ (geistig<br />
behinderte, schizophrene, an<br />
Epilepsie leidende, blinde und gehörlose<br />
oder schwer körperlich behinderte<br />
Menschen, aber auch Alkoholiker).<br />
Gesetz zur Wiederherstellung des<br />
Berufsbeamtentums<br />
Aufgrund des Gesetzes vom 7. April<br />
1933 konnten „nichtarische“, v.a.<br />
jüdische, und „politisch unzuverlässige“<br />
BeamtInnen, z.B. ZeugInnen<br />
Jehovas, aus dem Staatsdienst entlassen<br />
werden.<br />
Gestapo<br />
Von den Nationalsozialisten errichtete<br />
„Geheime Staatspolizei“, die<br />
zunächst nur in Preußen, später im<br />
ganzen Reichsgebiet eingesetzt wurde.<br />
1933 erfolgte die offizielle Gründung,<br />
und ➤ Hermann Göring übernahm<br />
als Chef der politischen Polizei<br />
die Zuständigkeit für die Staatspolizei.<br />
1934 wurden innerhalb der Gestapo<br />
eigene Judenreferate gegründet.<br />
Im Laufe der NS-Herrschaft erlangte<br />
die Gestapo immer stärkeren<br />
Einfluss und erweiterte systematisch<br />
ihre Handlungsspielräume. Die primäre<br />
Aufgabe lag in der Überwachung,<br />
Kontrolle und Ausforschung<br />
politischer GegnerInnen des NS-Regimes,<br />
demzufolge auch Kontrolle<br />
über die Polizei und Organisation<br />
der Konzentrationslager sowie Organisation<br />
von Terroraktionen gegen<br />
Juden und Jüdinnen und andere<br />
„Staatsfeinde“. 1939 wurde die Gestapo<br />
mit der Sicherheitspolizei (Sipo),<br />
dem ➤ Sicherheitsdienst (SD)<br />
zum ➤ Reichssicherheitshauptamt<br />
(RSHA) zusammengeschlossen, auch<br />
die Grenzpolizei wurde ihrer Leitung<br />
unterstellt. Sie übernahm entscheidende<br />
Funktionen bei der<br />
„Endlösung“ der Judenfrage. Die<br />
Gestapo operierte ohne gesetzliche<br />
Basis und Verordnungen, sondern<br />
führte ihre Maßnahmen im Zuge des<br />
NS-Gesamtauftrags durch.<br />
Getto<br />
Ursprünglich ein Stadtteil oder eine<br />
Straße, in der ausschließlich Juden<br />
und Jüdinnen wohnten. Dieser Bereich<br />
war von anderen Teilen einer<br />
Stadt abgegrenzt. Der Ausdruck<br />
„Getto“ wurde in Venedig geprägt,<br />
wo 1516 die jüdische Bevölkerung<br />
gezwungen war, in ein abgeschlossenes<br />
Viertel, das „Getto Nuovo“, zu<br />
ziehen. Ziel war es, die Kontakte<br />
zwischen Juden und Christen und<br />
deren ökonomische Aktivitäten einzuschränken.<br />
Davon zu unterscheiden<br />
sind allerdings die nationalsozialistischen<br />
Gettos in besetzten Gebieten,<br />
die nicht als Wohngebiete konzipiert<br />
wurden, sondern als Übergangsstadium<br />
im Verlauf der „Endlösung<br />
der Judenfrage“. Juden und<br />
Jüdinnen wurden wie in Lagern interniert,<br />
bewacht und vom NS-Regime<br />
in ihren Lebensgewohnheiten<br />
kontrolliert und dominiert. Nach<br />
Kriegsbeginn wurden in den größten<br />
Städten Osteuropas Gettos errichtet,<br />
als Übergang bis zur Deportation in<br />
Konzentrationslager. Die meisten BewohnerInnen<br />
der Gettos wurden in<br />
Vernichtungslagern ermordet, nur<br />
ein kleiner Teil kam während der<br />
Endphase des Krieges in Konzentrations-<br />
oder Arbeitslager.<br />
Gildemeester-Auswanderungs-<br />
Hilfsaktion<br />
Über die Möglichkeit der Ausreisebe-<br />
166 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
schaffung für die wohlhabende jüdische<br />
Bevölkerung sollte gleichzeitig<br />
deren Enteignung und Verdrängung<br />
aus dem Wirtschaftsleben forciert<br />
werden. Durch die Ausreisebewilligung<br />
unter totalem Vermögensverlust<br />
wurde gleichzeitig auch die Ausreise<br />
mittelloser Juden und Jüdinnen<br />
finanziert. Im April 1938 begann der<br />
Holländer Frank van Gheel Gildemeester<br />
mit der Organisierung der Auswanderungsaktionen.<br />
Nach diesem<br />
Vorbild gründete ➤ Adolf Eichmann<br />
im August 1938 die ➤ „Zentralstelle<br />
für jüdische Auswanderung“.<br />
Goldmann, Nahum (1894–1982)<br />
Geboren in Litauen, kam 1900 mit<br />
seinem Eltern nach Deutschland, wo<br />
er Rechts-, Geschichtswissenschaften<br />
und Philosophie studierte, seit 1918<br />
in der zionistischen Bewegung tätig,<br />
ab 1929 Herausgeber der „Enzyklopaedia<br />
Judaica“. 1933 Emigration,<br />
1935–1940 Vertreter der ➤ Jewish<br />
Agency beim Völkerbund in<br />
Genf, 1949–1978 Präsident des<br />
➤ World Jewish Congress und in den<br />
fünfziger Jahren Vorsitzender der<br />
➤ Claims Conference und des<br />
➤ Claims Committee.<br />
Göring, Hermann (1893–1956)<br />
Schloss sich bereits 1922 der NSDAP<br />
an und wurde noch im selben Jahr<br />
Chef der SA. Nach der Beteiligung<br />
am missglückten Novemberputsch<br />
der Nationalsozialisten 1923 floh er<br />
nach Österreich, wo er sich bis 1927<br />
aufhielt. 1928 wurde er Abgeordneter<br />
der NSDAP im Deutschen Reichstag,<br />
1932 Reichstagspräsident,<br />
Reichskommissar für Luftfahrt und<br />
das preußische Innenministerium. Im<br />
April 1933 stieg er zum Ministerpräsidenten<br />
und Innenminister Preußens<br />
auf. Göring war aktiv am Aufbau der<br />
➤ Gestapo beteiligt sowie Oberbefehlshaber<br />
der Luftwaffe. 1936 übernahm<br />
er die Verantwortung für die<br />
wirtschaftliche Planung des „Reiches“,<br />
den sog. ➤ Vierjahresplan.<br />
1939 wurde er von Hitler zu seinem<br />
Stellvertreter ernannt und ein Jahr<br />
später zum Reichsmarschall des<br />
Großdeutschen Reiches erhoben. Als<br />
Zuständiger für die Wirtschaft des<br />
Landes war er maßgeblich für die Beschlagnahmung<br />
jüdischen Vermögens<br />
sowie die geplante ➤ „Arisie-<br />
rung“ verantwortlich. Er gründete<br />
die ➤ „Reichszentrale für jüdische<br />
Auswanderung“ 1939 in Berlin nach<br />
dem Vorbild ➤ Eichmanns in Wien<br />
sowie eine Treuhandstelle zur Verwaltung<br />
entzogenen jüdischen Vermögens.<br />
Wegen Niederlagen der<br />
Luftwaffe und zunehmenden Differenzen<br />
zu Hitler wurde Göring gegen<br />
Ende des Krieges aus allen<br />
Ämtern und aus der NSDAP ausgeschlossen.<br />
Er wurde bei Prozessen<br />
gegen Hauptkriegsverbrecher vor<br />
dem Internationalen Militärtribunal<br />
in Nürnberg zum Tode verurteilt.<br />
Am Tag vor der Hinrichtung, am<br />
15.10.1946, vergiftete er sich.<br />
Haager Landkriegsordnung (LKO)<br />
1907 erlassenes, zum internationalen<br />
Völkergewohnheitsrecht zählendes<br />
Recht, das auch für das Deutsche<br />
Reich bis 1939 Geltung hatte. Die<br />
LKO legt unter anderem die Behandlung<br />
von Kriegsgefangenen im<br />
Kriegsfall fest und garantiert der Bevölkerung<br />
eines besetzten Gebietes<br />
eine Reihe von Rechten, z. B. den<br />
Schutz des Privateigentums, Verbot<br />
der Deportation der Bevölkerung<br />
und Verbot der Zwangsarbeit.<br />
Hartheim<br />
1889 von Fürst Camillo Heinrich Starhemberg<br />
gegründetes Asyl für „arme<br />
Schwach- und Blödsinnige“. Ab Februar<br />
1940 wurde die „Kinder- und<br />
Pflegeanstalt Hartheim“ in der Nähe<br />
von Linz in das ➤ Euthanasieprogramm<br />
„T4“ der Nationalsozialisten<br />
aufgenommen, und es wurde mit der<br />
Tötung von geistig oder körperlich<br />
behinderten Kindern begonnen.<br />
Aber auch als „asozial“ deklarierte<br />
Personen sowie andere InsassInnen<br />
von Heil- und Pflegeanstalten, etwa<br />
vom ➤ „Steinhof“ in Wien, und ausgesonderte<br />
Häftlinge des KZs Mauthausen<br />
wurden nach Hartheim gebracht<br />
und mittels Giftgas getötet<br />
und im Krematorium verbrannt.<br />
Helmer, Oskar (1887–1963)<br />
SPÖ-Politiker, 1945–1959 Innenminister<br />
und stellvertretender Vorsitzender<br />
der SPÖ.<br />
Heydrich, Reinhard (1904–1942)<br />
Chef der Sicherheitspolizei (Sipo)<br />
und des SD, später des Reichssicher-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
heitshauptamtes (RSHA). Er war eine<br />
Schlüsselfigur bei der Planung und<br />
Durchführung der antijüdischen Politik<br />
der Nationalsozialisten, ab 1934<br />
Leiter der Gestapo in Preußen und<br />
des SD, wo er eigene „Referate für<br />
Judenangelegenheiten“ errichtete.<br />
Auf der Basis von ➤ Gestapo und ➤<br />
RSHA wurde er zum Vollstrecker der<br />
nationalsozialistischen Judenpolitik.<br />
Der Befehl zur Konzentrierung der<br />
polnischen Juden und Jüdinnen und<br />
die Errichtung von Judenräten 1939<br />
erfolgte durch ihn. Weiters befehligte<br />
er Massendeportationen und Pogrome.<br />
Ob die Durchführung der<br />
„Endlösung“ auch auf einen Befehl<br />
Heydrichs zurückzuführen ist, ist umstritten.<br />
1941 wurde er stellvertretender<br />
Reichsprotektor des Protektorats<br />
Böhmen und Mähren. Er starb 1942<br />
bei einem Anschlag tschechischer<br />
WiderstandskämpferInnen in Prag.<br />
Hilfsfonds<br />
Der „Fonds zur Hilfeleistung an politisch<br />
Verfolgte, die ihren Wohnsitz<br />
und ständigen Aufenthalt im Ausland<br />
haben“ wurde am 18. Jänner<br />
1956 beschlossen. Seine Einrichtung<br />
war im Wesentlichen ein Ergebnis<br />
der Verhandlungen des Claims Committee<br />
mit der österreichischen Bundesregierung.<br />
Der mit 550 Mio.<br />
Schilling (zahlbar in elf Jahresraten<br />
ab 1955) dotierte Fonds sollte den<br />
Opfern der nationalsozialistischen<br />
Verfolgung zugute kommen, die<br />
im bisherigen Opferfürsorgegesetz<br />
noch nicht berücksichtigt worden<br />
waren, v.a. den jüdischen Vertriebenen.<br />
Weitere Voraussetzung für eine<br />
einmalige Zuerkennung von<br />
5000 bis 30.000 Schilling – je nach<br />
Schwere der Verfolgung bzw. der<br />
gesundheitlichen Schäden – waren<br />
der Besitz der österreichischen<br />
Staatsbürgerschaft am 13. März<br />
1938 bzw. der mindestens zehnjährige<br />
ständige Wohnsitz in Österreich<br />
vor dem 13. März 1938 und<br />
die Antragstellung binnen eines<br />
Jahres bis zum 11. Juni 1957. Der<br />
Fonds konnte seine Auszahlungen<br />
an ca. 30.000 AntragstellerInnen bereits<br />
1962 abschließen bzw. wurde<br />
nach der Ausweitung und Aufstockung<br />
als „Neuer Hilfsfonds“<br />
gemäß dem ➤ Kreuznacher Abkommen<br />
bis 1964 weitergeführt.<br />
167<br />
Glossar
Glossar<br />
Himmler, Heinrich (1900–1945)<br />
Reichsführer SS, Chef der ➤ Gestapo<br />
und der Waffen SS, Reichsinnenminister<br />
von 1934-45. Er trat bereits in<br />
den frühen zwanziger Jahren in die<br />
➤ SS ein, wurde 1929 deren Leiter<br />
und 1934 stellvertretender Chef der<br />
Gestapo. Als Reichsführer SS und<br />
Chef der deutschen Polizei übte er<br />
Kontrolle über die gesamte Polizei<br />
aus und erlangte Macht zum Ausbau<br />
des Polizeiapparates und des Systems<br />
der Konzentrationslager. In seiner<br />
Funktion als „Reichskommissar für<br />
die Festigung des deutschen Volkstums“<br />
1939 war er maßgeblich an<br />
Plänen für die Vernichtung der jüdischen<br />
Bevölkerung sowie an der<br />
Neuordnung des deutschen „Lebensraumes“,<br />
etwa durch Umsiedlungsaktionen<br />
im besetzten Polen, beteiligt.<br />
Nach der Übernahme des Postens<br />
des Chefs der Sicherheitspolizei<br />
und des SD nach ➤ Heydrichs Tod<br />
1942 war er maßgeblicher Motor in<br />
der Durchführung der „Endlösung“.<br />
Seine Stellung als Reichsinnenminister<br />
1943 und als Befehlshaber des<br />
Ersatzheeres 1944 verweisen auf seinen<br />
zunehmenden Machtzuwachs.<br />
Das Vertuschen des Massenmords sowie<br />
der Befehl zu seiner Einstellung<br />
im November 1944 sollte erste Friedensverhandlungen<br />
Himmlers mit<br />
den Alliierten ermöglichen. Infolgedessen<br />
wurde er von Hitler aller Ämter<br />
enthoben. Nach dem Krieg versuchte<br />
er unter falschem Namen zu<br />
flüchten und wurde von britischen<br />
Soldaten gefasst. Am 23.5. beging er<br />
Selbstmord, noch bevor er als Hauptkriegsverbrecher<br />
vor Gericht gestellt<br />
werden konnte.<br />
Hitlerjugend<br />
a) Jugendorganisation der NSDAP,<br />
entstanden 1926 aus dem „Jungsturm<br />
Adolf Hitler“, einem 1922 gegründeten<br />
Ableger der SA. Die HJ<br />
war zunächst nur für Knaben, ab<br />
1928 auch für Mädchen zugelassen.<br />
Als Reichsjugendführer übernahm<br />
Baldur von Schirach 1931 den<br />
reichseinheitlichen Befehl über die<br />
Organisation der NS-Jugendverbände.<br />
Die Organisationsstruktur<br />
der HJ folgte dem militärischem<br />
Muster sowie der Ausrichtung nach<br />
einem hierarchischen Führer-Gefolgschaftsprinzip.<br />
Eingeteilt wur-<br />
den die verschiedenen Organisationen<br />
einerseits nach Geschlecht und<br />
Alter und andererseits je nach<br />
Größe in Schar, Gefolgschaft,<br />
Stamm und Bann. Durch Auflösung<br />
und Verbot aller anderen Jugendverbände<br />
– die katholischen Jugendorganisationen<br />
waren bis 1938 zugelassen<br />
– wurde die NS-Jugendarbeit<br />
1936 monopolisiert. Disziplinierung,<br />
körperliche Ertüchtigung sowie<br />
die Aufzucht einer „Menschenreserve“<br />
nach rassenpolitischen Kriterien<br />
waren die Erziehungsziele<br />
der HJ. b) Die HJ umfaßte als Teilorganisation<br />
der NS-Jugendverbände<br />
die 14- bis 18-jährigen Burschen.<br />
Mit 18 Jahren wurden diese in die<br />
Partei bzw. ihre Gliederungen überwiesen<br />
oder nach einem Jahr<br />
„Reichsarbeitsdienst“ in die Wehrmacht<br />
übernommen.<br />
Hochkommissar/Hoher Kommissar<br />
Ab Juli 1945 stellten die vier Oberbefehlshaber<br />
der Besatzungsmächte<br />
USA, UdSSR, Großbritannien und<br />
Frankreich als Hochkommissare den<br />
➤ Alliierten (Kontroll-)Rat in Österreich.<br />
Dieser trat unter wechselndem<br />
Vorsitz monatlich in Wien zusammen.<br />
International Refugee Organization<br />
(IRO)<br />
Die internationale Flüchtlingsorganisation<br />
übernahm am 1. Juli 1947 die<br />
Aufsichtsfunktion der ➤ UNRRA bezüglich<br />
der ➤Displaced Persons, verwaltete<br />
Spenden und organisierte<br />
die Versorgung der DPs und ihre Ansiedlung<br />
in alten und neuen Heimatländern.<br />
Israelitische Kultusgemeinde (Wien)<br />
Im Staatsgrundgesetz von 1867 wurde<br />
den jüdischen BürgerInnen erstmals<br />
volle Glaubens- und Gewissensfreiheit<br />
gewährt. Zu den Hauptaufgaben<br />
der Kultusgemeinde zählten<br />
religiöse und kulturelle Belange, die<br />
Errichtung und Erhaltung von Synagogen,<br />
die Versorgung Alter und<br />
Kranker. Dafür erhielt sie das Recht,<br />
von ihren Mitgliedern Steuern und<br />
Gebühren einzuheben. Nach dem<br />
Anschluss vom 12. März 1938 wurde<br />
die Kultusgemeinde aufgelöst. Im<br />
Mai 1938 wurde sie wiedergegründet,<br />
war aber unmittelbar der SS<br />
und der Gestapo unterstellt. Mit der<br />
Gründung der ➤ „Zentralstelle für<br />
jüdische Auswanderung“ wurde die<br />
IKG massiv für die Zwecke der ➤ SS<br />
missbraucht. Am 1. November 1942<br />
wurde die IKG durch den „Ältestenrat“<br />
ersetzt. Vor 1938 hatte die IKG<br />
Wien 200.000 Mitglieder, nach 1945<br />
lebten in Wien weniger als 5000 Juden<br />
und Jüdinnen. 1945 wurde die<br />
IKG rekonstituiert, bis 1949 wuchs<br />
die Mitgliederzahl auf ca. 11.000 an.<br />
Die IKG richtete verschiedene Stellen<br />
für die überlebenden Opfer des<br />
Nationalsozialismus ein, u.a. ein<br />
Wohnungs-, ein Wanderungs-, ein<br />
Gesundheits- und ein Wiedergutmachungsreferat.<br />
Jewish Agency (JA)<br />
Seit 1948 JA für Israel. Die JA wurde<br />
1921 als Organisation der Zionistischen<br />
Weltorganisation (ZWO) gegründet,<br />
1929 durch die Aufnahme<br />
von Nichtzionisten erweitert. Die JA<br />
verstand sich als Interessenvertretung<br />
der in Palästina lebenden Juden<br />
bei der britischen Mandatsregierung<br />
und vor dem Völkerbund,<br />
ab 1947 vor den Vereinten Nationen.<br />
Waren bereits ab 1933 viele Juden<br />
und Jüdinnen überwiegend aus<br />
Ost-, Südost- und Mitteleuropa in<br />
Palästina eingewandert, so versuchte<br />
die JA später über private Spenden,<br />
Spenden von landwirtschaftlichen<br />
Siedlungen und Institutionen<br />
Rettungsmaßnahmen für verfolgte<br />
europäische Juden und Jüdinnen zu<br />
finanzieren. Ihre Tätigkeit reichte<br />
über die Erstellung von Einreisevisa<br />
für jüdische Kinder aus besetzten<br />
Ländern Europas und die Finanzierung<br />
von Transporten bis zu ersten<br />
finanziellen Unterstützungen für ImmigrantInnen.<br />
Allerdings stellte die<br />
von den Briten festgesetzte Einwanderungsquote<br />
(➤ englisches Weißbuch)<br />
eine erhebliche Einschränkung<br />
für die Aufnahme von Verfolgten<br />
dar. Nach der Gründung Israels (15.<br />
Mai 1948) wurde die JA in Zusammenarbeit<br />
mit der ZWO zum Bindeglied<br />
zwischen Israel und den in<br />
der Diaspora lebenden Juden und<br />
Jüdinnen. Die ZWO-JA leistete finanzielle<br />
Unterstützung und förderte<br />
die soziale Integration, errichtete<br />
Aufnahmelager und hebräische<br />
Schulen etc. Im In- und Ausland bie-<br />
168 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
tet die ZWO-JA zahlreiche Kulturund<br />
<strong>Bildung</strong>sprogramme für Juden<br />
und Jüdinnen in der Diaspora an.<br />
Joint Distribution Committee (JDC)<br />
Eigentlich „American Jewish Joint<br />
Distribution Committee“, kurz<br />
„Joint“ genannt. Die Organisation<br />
wurde 1914 als überseeische Wohlfahrtsorganisation<br />
gegründet und<br />
konzentrierte sich ab 1933 auf die<br />
Unterstützung der jüdischen Bevölkerung<br />
in Deutschland und in den<br />
von Deutschland besetzten Gebieten<br />
Ost- und Westeuropas, etwa<br />
durch Spenden für Kranken- und<br />
Waisenhäuser, Nahrungsmittel, für<br />
die Emigration und zum Teil auch<br />
für den bewaffneten jüdischen Widerstand.<br />
Nach dem Krieg war das<br />
JDC die wichtigste jüdische Hilfsorganisation<br />
für jüdische Überlebende.<br />
Es betreute die jüdischen ➤ Displaced<br />
Persons (DPs) in den Lagern<br />
in Deutschland, Österreich und anderen<br />
europäischen Ländern, finanzierte<br />
Nahrungsmittel, Kleidung,<br />
Berufsausbildung und organisierte<br />
nach der Ausrufung des Staates Israel<br />
im Mai 1948 den Transport jüdischer<br />
AuswanderInnen. Das JDC<br />
nahm auch an der ➤ Claims Conference<br />
und dem ➤ Claims Committee<br />
teil.<br />
Judenvermögensabgabe<br />
Nach der im April 1938 verordneten<br />
Vermögensanmeldung für Juden<br />
und Jüdinnen betreffend Vermögenswerte<br />
über 5000 RM mussten<br />
20 % des angemeldeten Vermögens<br />
als von den Nazis so genannte Judenvermögensabgabe<br />
an den NS-<br />
Staat gezahlt werden.<br />
Jungmädel (JM)<br />
Teilorganisation in der ➤ HJ für zehnbis<br />
14-jährige Mädchen, deren Organisation<br />
der des ➤ DJ (Deutsches<br />
Jungvolk) parallel lief.<br />
Kastner, Walther (1902–1994)<br />
Jurist, während der NS-Zeit u.a. in<br />
der Österr. Kontrollbank tätig und<br />
zuständig für Fragen im Zusammenhang<br />
mit ➤ „Arisierungen“, nach<br />
dem Krieg von Bundesminister Krauland<br />
als Berater für das ➤ Ministerium<br />
für Vermögenssicherung und<br />
Wirtschaftsplanung engagiert.<br />
Kaufpreis<br />
Durch Prüfung der ➤ Vermögensverkehrsstelle<br />
festgesetzter Preis für<br />
den „Kauf“ jüdischer Geschäfte, der<br />
dem/der ursprünglichen EigentümerIn<br />
zugestanden wurde. Dieser lag<br />
allerdings erheblich unter dem Verkehrswert<br />
und wurde auf Sperrkonten<br />
eingezahlt, d.h. die festgesetzte<br />
Summe stand den ehemaligen EigentümerInnen<br />
nicht zu Verfügung.<br />
Kinderübernahmsstelle (KÜST)<br />
Die KÜST wurde 1925 im Rahmen eines<br />
groß angelegten Ausbaus der<br />
Kinder- und Jugendfürsorge auf Initiative<br />
Julius Tandlers gegründet.<br />
Die KÜST war eine zentrale Schaltstelle<br />
im Rahmen der Wiener Jugendfürsorge.<br />
Neben der Registrierung<br />
aller der Fürsorge unterstellten<br />
Kinder und Jugendlichen diente die<br />
Anstalt als Heim zur vorübergehenden<br />
Unterbringung von Kindern, die<br />
aus ihren Familien entfernt wurden.<br />
Die Unterbringung einer psychologischen<br />
Beobachtungsstation als<br />
Außenstelle der Kinderpsychologischen<br />
Forschungsstelle Universität<br />
Wien führte zu einer engen Zusammenarbeit<br />
zwischen Fürsorge und<br />
psychologischer Wissenschaft. 1940<br />
wurde die Beobachtungsstelle auf<br />
den ➤ „Spiegelgrund“ verlegt.<br />
Kommission für Provenienzforschung<br />
Anfang 1998 von Kulturministerin<br />
Elisabeth Gehrer eingesetzte Arbeitsgruppe<br />
im Bundesdenkmalamt und<br />
in den Bundesmuseen, die die Herkunft<br />
der in österreichischen<br />
Bundesmuseen befindlichen geraubten<br />
Kunstgegenstände erforschen<br />
soll. ➤ Bundesgesetz über die Rückgabe<br />
von Kunstgegenständen aus<br />
den österreichischen Bundesmuseen<br />
und Sammlungen.<br />
Krauland-Ministerium<br />
Das „Bundesministerium für Vermögenssicherung<br />
und Wirtschaftsplanung“<br />
unter dem zuständigen Minister<br />
Dr. Peter Krauland wurde 1945<br />
eingerichtet und hatte u.a. die Aufgabe<br />
der Erfassung, Sicherung, Verwaltung<br />
und Verwertung ehemaligen<br />
NS-Vermögens und „arisierten“<br />
Vermögens. Dazu gehörte die Bestellung<br />
von öffentlichen Verwaltern,<br />
deren Aufgabe es war, bis zur<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Klärung der Rückstellungsverfahren<br />
die Vermögen zu verwalten und danach<br />
deren Übergabe zu organisieren.<br />
Krauland und einigen seiner<br />
Mitarbeiter wurde Ende der vierziger<br />
Jahre vorgeworfen, Rückstellungen<br />
zu hintertreiben bzw. sich selbst<br />
zu bereichern, was 1954 zum sogenannten<br />
„Krauland-Prozess“ führte.<br />
Das Ministerium selbst wurde im Anschluss<br />
an die Neuwahlen 1949 aufgelöst,<br />
die Agenden der noch offenen<br />
Rückstellungsfälle wurden dem<br />
Bundesministerium für Finanzen<br />
übertragen.<br />
Kreuznacher Abkommen<br />
Der „Vertrag zwischen der Republik<br />
Österreich und der Bundesrepublik<br />
Deutschland zur Regelung von Schäden<br />
der Vertriebenen, Umsiedler und<br />
Verfolgten, über weitere finanzielle<br />
Fragen und Fragen aus dem sozialen<br />
Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag)“<br />
wurde im Juni 1961 zwischen<br />
den beiden Staaten abgeschlossen.<br />
Er sah u. a. vor, dass Österreich<br />
die nach 1945 Vertriebenen<br />
und UmsiedlerInnen deutscher Sprache<br />
den österreichischen StaatsbürgerInnen<br />
im österreichischen<br />
➤ Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz<br />
gleichstellte. Dafür<br />
leistete die Bundesrepublik Deutschland<br />
an Österreich eine Zahlung von<br />
125 Mio. DM. In der Frage der Entschädigung<br />
wurde die finanzielle<br />
Beteiligung der Bundesrepublik mit<br />
95 Mio. DM am „Fonds zur Abgeltung<br />
von Vermögensverlusten politisch<br />
Verfolgter“ (➤ Abgeltungsfonds)<br />
und am „Hilfsfonds zur Hilfeleistung<br />
an politisch Verfolgte, die<br />
ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt<br />
im Ausland haben“ (➤ Hilfsfonds)<br />
festgelegt.<br />
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz<br />
(KVSG)<br />
Bundesgesetz vom 25. Juni 1958<br />
über die Gewährung von Entschädigungen<br />
für durch Kriegseinwirkung<br />
oder durch politische Verfolgung erlittene<br />
Schäden an Hausrat und an<br />
zur Berufsausübung erforderlichen<br />
Gegenständen. Dieses Gesetz behandelte<br />
NS-Opfer und Kriegsopfer<br />
grundsätzlich gleich. Allerdings waren<br />
Personen, die über ein Jahreseinkommen<br />
von mehr als 72.000 Schil-<br />
169<br />
Glossar
Glossar<br />
ling verfügten, von Ansprüchen nach<br />
dem KVSG ausgeschlossen. Insofern<br />
galt hier ebenso wie im ➤ Opferfürsorgegesetz<br />
das Fürsorge- und nicht<br />
das Entschädigungsprinzip.<br />
KZ-Verband<br />
Der Verband wurde im März 1946<br />
von Ministerialrat Dr. Franz Sobek<br />
in Wien gegründet und von den<br />
drei Parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ paritätisch<br />
beschickt. Später wurde er<br />
in ➤ „Bund der politisch Verfolgten“<br />
umbenannt. Die Mitgliedschaft<br />
stand zunächst nur den ehemaligen<br />
„politischen“ Häftlingen<br />
offen. Dem Selbstverständnis nach<br />
war er keine karitative, sondern in<br />
erster Linie eine politische Organisation,<br />
deren Ziel es war, die Demokratie<br />
in Österreich langfristig zu<br />
festigen und dazu ehemalige Widerstandskämpfer<br />
in entsprechende<br />
politische Positionen zu bringen.<br />
Der KZ-Verband stellte auch Bestätigungen<br />
aus, mit der ehemalige Verfolgte<br />
bei den entsprechenden Fürsorgestellen<br />
eine ➤ Amtsbescheinigung<br />
erhalten konnten.<br />
Lager Lackenbach<br />
Das burgenländische Lager wurde<br />
am 23.11.1940 errichtet und unterstand<br />
der Kriminalpolizeistelle Wien.<br />
Das Lager war vorwiegend zur Internierung<br />
als „asozial“ verfolgter Roma<br />
und Sinti errichtet worden. Die<br />
arbeitsfähigen Häftlinge, darunter<br />
auch Kinder, wurden an Bauern der<br />
Umgebung oder an Unternehmen<br />
als Arbeitskräfte vermietet. Die Unterbringung<br />
der Lagerhäftlinge erfolgte<br />
unter katastrophalen hygienischen<br />
Bedingungen, weshalb viele<br />
der Internierten 1942 einer Flecktyphusepidemie<br />
zum Opfer fielen. Die<br />
Wirksamkeit von Vorurteilen gegen<br />
Roma und Sinti auch nach 1945 erschwerte<br />
deren Anerkennung in der<br />
➤ Opferfürsorgegesetzgebung, und<br />
auch das Lager Lackenbach wurde<br />
lange Zeit nicht als Konzentrationslager<br />
anerkannt, sondern als „Arbeitslager“<br />
bezeichnet.<br />
Londoner Deklaration<br />
„Inter-allied Declaration Against Acts<br />
of Dispossession Committed in Territories<br />
Under Enemy Occupation or<br />
Control“. Die Deklaration wurde am<br />
5. Jänner 1943 von 17 Regierungen<br />
und dem französischen Nationalkomitee<br />
unterzeichnet. Mit dieser Erklärung<br />
behielten sich die Alliierten<br />
das Recht vor, Übertragungen von<br />
Vermögen, Rechten und Interessen,<br />
die in Ländern unter deutscher Besetzung<br />
oder in mit dem Deutschen<br />
Reich verbündeten Ländern vorgenommen<br />
worden waren, für nichtig<br />
zu erklären. Gemeint waren in erster<br />
Linie die von den Nationalsozialisten<br />
durchgeführten ➤ „Arisierungen“<br />
und Geschäftsliquidierungen.<br />
Londoner „Raubgoldkonferenz“<br />
An der Konferenz, die unter dem Patronat<br />
der von den USA, Großbritannien<br />
und Frankreich 1946 eingesetzten<br />
„Tripartite Gold Commission“ zur<br />
Rückgabe des „Nazi-Goldes“ an seine<br />
rechtmäßigen BesitzerInnen stand,<br />
nahmen Anfang Dezember 1997 VertreterInnen<br />
von Regierungen, Staatsbanken<br />
und Opfergruppen aus 41<br />
Ländern teil. Ziel der Konferenz war<br />
es, Herkunft und Verbleib des Nazi-<br />
Raubgoldes sowie die bisher erfolgten<br />
Kompensationszahlungen an die<br />
Opfer zu klären und über weitere<br />
Entschädigungen zu diskutieren.<br />
Londoner Schuldenabkommen<br />
Das am 27. Februar 1953 unterzeichnete<br />
Abkommen über deutsche<br />
Auslandsschulden war Ergebnis<br />
der Londoner Schuldenkonferenz<br />
1952, an der neben der Bundesrepublik<br />
Deutschland u.a. Belgien, Dänemark,<br />
Frankreich, Griechenland,<br />
Italien, Jugoslawien, Schweden, die<br />
Schweiz, die USA teilnahmen. Das<br />
Schuldenabkommen stellte die endgültige<br />
Regelung der Reparationsfrage<br />
bis zum Abschluß eines Friedensvertrages<br />
zurück. Dazu heißt es<br />
in Artikel 5, Abs. 2: „Eine Prüfung<br />
der aus dem Zweiten Weltkrieg<br />
herrührenden Forderungen von<br />
Staaten, die sich mit Deutschland im<br />
Kriegszustand befanden, oder deren<br />
Gebiet von Deutschland besetzt<br />
war, und von Staatsangehörigen<br />
dieser Staaten gegen das Reich und<br />
im Auftrag des Reichs handelnde<br />
Personen (...) wird bis zur endgültigen<br />
Regelung der Reparationsfrage<br />
zurückgestellt.“ Ein formeller Friedensvertrag<br />
wurde bis heute nicht<br />
abgeschlossen, die ursprüngliche Idee<br />
des ➤ Zwei-Plus-Vier-Vertrags als Friedensvertrag<br />
wurde nicht realisiert.<br />
Luxemburger Abkommen<br />
Das am 10. September 1952 zwischen<br />
der Bundesrepublik Deutschland<br />
und Israel getroffene „Wiedergutmachungsabkommen“<br />
war das<br />
Ergebnis der zweijährigen Verhandlungen<br />
der ➤ „Claims Conference“<br />
mit der deutschen Bundesregierung.<br />
Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtete<br />
sich, 822 Mio. US-Dollar<br />
Entschädigung in zwölf Jahren zu<br />
zahlen, davon 715 Mio. für Aufbauleistungen<br />
an den Staat Israel und<br />
107 Mio. für Opfer des Nationalsozialismus<br />
weltweit. Dieses Geld verwaltete<br />
die „Claims Conference“.<br />
Magistratsabteilung – MA 12<br />
Ab 1946 Magistratsabteilung für<br />
Erwachsenen- und Familienfürsorge,<br />
ehemaliges „Amt für Wohlfahrtspflege“<br />
der Stadt Wien (MA X/1),<br />
heute Sozialamt der Stadt Wien, inkl.<br />
Opferfürsorgereferat.<br />
Magistratsabteilung – MA 15<br />
Gesundheitsamt der Stadt Wien,<br />
nach 1945 für die Erstellung von medizinischen<br />
Gutachten im Rahmen<br />
der Opferfürsorge zuständig.<br />
Magistratsabteilung – MA 21<br />
1938 Wohnungsamt der Gemeinde<br />
Wien.<br />
Magistratsabteilung – MA 52<br />
Wohnungsamt der Gemeinde Wien,<br />
im Rahmen dessen 1947 ein eigenes<br />
„Wiedergutmachungsreferat“ errichtet<br />
wurde. Die Vergabe von Gemeindewohnungen<br />
erfolgte über ein<br />
Punktesystem, entsprechend der Bedürftigkeit<br />
der AntragstellerInnen.<br />
Magistratsabteilung – MA 61<br />
Amt der Stadt Wien für Staatsbürgerschafts-<br />
und Personenstandsangelegenheiten.<br />
Magistratsabteilung – MA 8<br />
Stadt- und Landesarchiv der Stadt<br />
Wien im Wiener Rathaus.<br />
Maisel, Karl (1890–1982)<br />
Überlebender des KZ Buchenwald,<br />
SPÖ-Politiker, 1945–1956 Bundesminister<br />
für soziale Verwaltung, 1948–59<br />
170 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Vizepräsident des ÖGB, 1956–1964<br />
Präsident der Arbeiterkammer Wien.<br />
Mark, Karl (1900–1991)<br />
SPÖ-Politiker, im Ständestaat und<br />
während des Nationalsozialismus<br />
verfolgt und verhaftet, 1945–1966<br />
Nationalratsabgeordneter, Generalsekretär<br />
des „Bundesverbandes politisch<br />
Verfolgter“.<br />
Marshall-Plan<br />
Das amerikanische Hilfsprogramm für<br />
Europa (ERP – European Recovery Program),<br />
benannt nach dem amerikanischen<br />
Außenminister George Marshall,<br />
wurde am 3.4.1948 vom US-<br />
Kongress verabschiedet und wegen<br />
der Ablehnung der Mitarbeit von<br />
Seiten der Ostblockländer auf 18<br />
westliche europäische Länder beschränkt,<br />
darunter auch die Bundesrepublik<br />
Deutschland und Österreich.<br />
Die Marshallplan-Hilfe wurde als<br />
Hilfe zur Selbsthilfe verstanden, die<br />
teilnehmenden Länder verpflichteten<br />
sich zur Produktionssteigerung, Stabilisierung<br />
der Währung, Liberalisierung<br />
des Handels. Sie umfasste Kredite<br />
und Sachlieferungen, v. a. in Form<br />
von Geschenken von Lebensmitteln<br />
und Rohstoffen, die im Inland zu<br />
Marktpreisen verkauft werden sollten,<br />
der Erlös floss in einen eigenen<br />
Fonds, aus dem wiederum günstige<br />
Kredite für die heimische Wirtschaft<br />
gewährt werden konnten. Westeuropa<br />
erhielt bis Ende 1951 von den USA<br />
insgesamt etwa 13 Mrd. Dollar.<br />
Mauerbach-Fonds<br />
Der Fonds wurde aufgrund des<br />
„2. Kunst- und Kulturbereinigungsgesetzes<br />
über die Herausgabe und<br />
Verwertung ehemals herrenlosen<br />
Kunst- und Kulturgutes, das sich im<br />
Eigentum des Bundes befindet“ vom<br />
13. Dezember 1985 errichtet. Der<br />
Fonds verwaltet den Erlös einer Auktion<br />
vom Herbst 1996 von in der NS-<br />
Zeit geraubten Kunstwerken, deren<br />
BesitzerInnen nicht mehr eruiert<br />
werden konnten. Die eingenommene<br />
Summe wird an bedürftige Opfer<br />
des Nationalsozialismus und deren<br />
Hinterbliebene verteilt.<br />
Mauritius<br />
Inselstaat im Indischen Ozean, rund<br />
800 km östl. von Madagaskar. Im<br />
Zweiten Weltkrieg wurden von der<br />
britischen Besatzungsmacht jüdische<br />
„illegale“ ImmigrantInnen aus der<br />
Tschechoslowakei, aus Danzig und<br />
Wien nach Mauritius deportiert. 212<br />
Männer wurden zu den britischen<br />
Streitkräften eingezogen, der Rest<br />
der Flüchtlinge in einem Gefängnisgebäude<br />
und Baracken untergebracht.<br />
Die Flüchtlinge wurden<br />
durch jüdische Organisationen und<br />
die ➤ Jewish Agency (JA) unterstützt.<br />
Das Hauptziel der Flüchtlinge<br />
lag in der Rückkehr nach Palästina,<br />
wohin nach der Entlassung am<br />
12.8.1945 ein Großteil immigrierte.<br />
Moskauer Deklaration<br />
Die Moskauer Deklaration der drei<br />
Alliierten USA, UdSSR und Großbritannien<br />
vom 1. November 1943 hielt<br />
bezüglich Österreich fest, dass es<br />
„das erste freie Land“ gewesen sei,<br />
das der „Angriffspolitik Hitlers zum<br />
Opfer“ fiel, dass die Besetzung<br />
Österreichs durch Deutschland am<br />
13. März 1938 „null und nichtig“ sei<br />
und dass nach dem Krieg „ein freies<br />
unabhängiges Österreich wiederhergestellt“<br />
werden solle. Gleichzeitig<br />
wurde Österreich in der Deklaration<br />
aber auch daran erinnert, dass es seiner<br />
Verantwortung für „die Teilnahme<br />
am Kriege an der Seite Hitler-<br />
Deutschlands“ nicht entrinnen könne.<br />
Von der österreichischen Nachkriegspolitik<br />
wurden jedoch vor allem<br />
die „Opfer- und Nichtigkeitserklärungen“<br />
der Deklaration als wesentlich<br />
betrachtet. Sie dienten als<br />
Stichworte für die Aufrechterhaltung<br />
des Opfermythos und für die Verhandlungsposition<br />
Österreichs bezüglich<br />
des ➤ Staatsvertrags. Die<br />
Formulierung von der Mitverantwortung<br />
Österreichs wurde demgegenüber<br />
auf Betreiben der österreichischen<br />
Regierung vor Unterzeichnung<br />
des Staatsvertrags aus der Präambel<br />
gestrichen.<br />
Nationalfonds der Republik Österreich<br />
für die Opfer des Nationalsozialismus<br />
Der Nationalfonds wurde auf Nationalratsbeschluss<br />
im Juni 1995 gegründet.<br />
Seit Oktober 1995 widmet<br />
sich der Fonds der Unterstützung jener<br />
Menschen, die aus politischen<br />
Gründen, Gründen der Abstammung,<br />
Religion, Nationalität, sexuel-<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
len Orientierung, aufgrund einer<br />
körperlichen oder geistigen Behinderung<br />
oder des Vorwurfs sogenannter<br />
„Asozialität“ Opfer nationalsozialistischer<br />
Verfolgung wurden. Neben<br />
der einmaligen Auszahlung von Unterstützungsbeträgen<br />
liegt das<br />
Hauptanliegen des Fonds vor allem<br />
in einer symbolischen Geste. Die Leistungen<br />
des Fonds richten sich an<br />
Personen, die bisher keine oder völlig<br />
unzureichende Leistungen durch<br />
die ➤ Opferfürsorge erhalten haben,<br />
in irgendeiner Weise bedürftig sind<br />
oder bei denen aufgrund ihrer gegenwärtigen<br />
Lebenssituation eine<br />
Unterstützung gerechtfertigt erscheint.<br />
Neben der Durchführung<br />
und Verwaltung steht der Fonds in<br />
enger Zusammenarbeit mit behördlichen<br />
Stellen und diversen Opferverbänden<br />
im In- und Ausland, um<br />
möglichst viele anspruchsberechtigte<br />
Personen erreichen zu können.<br />
Der neue Weg<br />
Jüdische Zeitung „mit amtlichen<br />
Mitteilungen der Israelitischen Kultusgemeinde<br />
Wien“, erschien von<br />
1946–1949.<br />
Novemberpogrom<br />
Die „Reichskristallnacht“ vom 9./10.<br />
November 1938 in ganz Deutschland<br />
und Österreich bildete einen Höhepunkt<br />
antijüdischer Angriffe durch<br />
die gesamte NSDAP. Vielfach wird<br />
der Pogrom als spontaner Ausbruch<br />
des Volkszorns dargestellt, doch erfolgte<br />
er auf einen Aufruf Goebbels‘<br />
zu Aktionen gegen Juden und Jüdinnen.<br />
Die Zerschlagung von Schaufenstern<br />
jüdischer Geschäfte, die Zerstörung<br />
und Niederbrennung von Synagogen,<br />
die Plünderung jüdischer<br />
Geschäfte waren nur der Auftakt zu<br />
einer weiteren Folge von Terrormaßnahmen<br />
gegen die jüdische Bevölkerung.<br />
In Österreich begannen die antijüdischen<br />
Ausschreitungen erst am<br />
frühen Morgen des 10.11.1938. Insgesamt<br />
wurden im Anschluss an den<br />
Pogrom 30.000 Juden und Jüdinnen<br />
in Konzentrationslager gebracht, aus<br />
Österreich wurden 4600 Juden und<br />
Jüdinnen nach Dachau deportiert.<br />
12. Novelle zum Opferfürsorgegesetz<br />
Die am 22. März 1961 erlassene Novelle<br />
stellte eine wesentliche Erwei-<br />
171<br />
Glossar
Glossar<br />
terung des Kreises der anspruchsberechtigten<br />
Opfer dar: Erstmals wurden<br />
auch für Aufenthalte im Getto<br />
oder Internierungslager, für die Verpflichtung<br />
zum Tragen des Judensternes<br />
und für den Verlust von Einkommen<br />
und Unterbrechung von<br />
Berufsausbildungen – letztgenanntes<br />
galt allerdings nur für österreichische<br />
StaatsbürgerInnen – Entschädigungen<br />
gezahlt.<br />
Nürnberger Rassengesetze<br />
Am 15. September 1935 wurden in<br />
Nürnberg auf einer Sondersitzung<br />
des Reichsparteitags zwei Verfassungsgesetze<br />
verkündet, die die Basis<br />
für den völligen Ausschluss der jüdischen<br />
Bevölkerung aus dem öffentlichen<br />
Leben und für die nachfolgende<br />
antijüdische Politik bildeten. Das<br />
„Gesetz zum Schutz des deutschen<br />
Blutes und der deutschen Ehre“<br />
verbot u.a. Eheschließungen und<br />
außerehelichen Verkehr zwischen<br />
Juden/Jüdinnen und Deutschen. Das<br />
„Reichsbürgergesetz“ legte fest, dass<br />
nur Deutsche oder Personen mit „artverwandtem<br />
Blut“ Bürger des Reichs<br />
seien. Durch diese Gesetze verloren<br />
die jüdische und andere „nichtdeutsche“<br />
Bevölkerungsgruppen, v.a.<br />
auch Roma und Sinti, ihre politischen<br />
Rechte. Aufgrund des „Reichsbürgergesetzes“<br />
wurden zwischen November<br />
1935 und Juli 1943 13 weitere<br />
Verordnungen u.a. über Berufsverbote<br />
für die jüdische Bevölkerung,<br />
Kennzeichnungspflicht jüdischer Geschäfte,<br />
Verfall jüdischen Vermögens<br />
an das Deutsche Reich, erlassen. Die<br />
sogenannten „Nürnberger Rassengesetze“<br />
erhielten am 28. Mai 1938<br />
auch für Österreich Gültigkeit. Die 9.<br />
Verordnung zum „Reichsbürgergesetz“<br />
vom 5. Mai 1939 führte eine<br />
Reihe weiterer antijüdischer Gesetze<br />
in Österreich ein. Wichtig im Sinne einer<br />
nachträglichen „Legalisierung“<br />
und gleichzeitig der totalen Beraubung<br />
der jüdischen Bevölkerung<br />
durch das nationalsozialistische Regime<br />
waren die ➤ 11. und die ➤ 13.<br />
Verordnung zum Reichsbürgergesetz.<br />
OMGUS<br />
Office of the Military Government<br />
for Germany, US-Zone of Occupation/<br />
Control, Berlin; amerikanische Militärregierung<br />
in Deutschland<br />
Opferausweis<br />
Nach dem ➤ Opferfürsorgegesetz<br />
anerkannte Opfer des Nationalsozialismus<br />
erhielten über ein durch die<br />
Gesundheits- und Sozialämter erstelltes<br />
Gutachten die Möglichkeit zum<br />
Erhalt eines Opferausweises. BesitzerInnen<br />
eines solchen Ausweises sollten<br />
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche<br />
von den behördlichen Stellen<br />
bevorzugt behandelt werden. Durch<br />
die Ausgabe etwa von Fahrausweisen<br />
und steuerliche Begünstigungen<br />
sollten die AusweisbesitzerInnen finanziell<br />
unterstützt werden. Der Besitz<br />
eines Opferausweises bedeutete<br />
aber keinen Anspruch auf eine Opferrente.<br />
➤ Amtsbescheinigung.<br />
Opferfürsorgegesetz (OFG)<br />
Das erste Opferfürsorgegesetz wurde<br />
am 17. Juli 1945 beschlossen, als<br />
Opfer wurden zunächst nur österreichischeWiderstandskämpferInnen<br />
angesehen, denen bei sozialer<br />
Bedürftigkeit und gesundheitlichen<br />
Schäden bestimmte Fürsorgemaßnahmen,<br />
Vergünstigungen bzw.<br />
Renten zuerkannt wurden. Opfer<br />
rassistischer Verfolgung blieben<br />
vom OFG ausgeschlossen, sofern sie<br />
keinen Nachweis eines aktiven Einsatzes<br />
gegen das NS-Regime erbringen<br />
konnten. Das zweite OFG von<br />
1947 sah auch Fürsorgemaßnahmen<br />
für Opfer rassistischer Verfolgung<br />
vor, anspruchsberechtigt waren aber<br />
allgemein nur österreichische<br />
StaatsbürgerInnen (also nicht die<br />
Vielzahl der Vertriebenen, die eine<br />
andere Staatsbürgerschaft angenommen<br />
hatten), die mindestens<br />
sechs Monate Haft in einem KZ oder<br />
ein Jahr Haft in einem Gefängnis<br />
o.ä. nachweisen konnten. Zahlreiche<br />
Novellen erweiterten langsam<br />
den Kreis der Anspruchsberechtigten,<br />
z.B. wurde in der 7. Novelle<br />
1952 erstmals nicht nur Fürsorge,<br />
sondern eine Haftentschädigung<br />
pro Monat gewährt, die 8. Novelle<br />
1953 machte die Haftentschädigung<br />
nicht mehr vom Besitz der österreichischen<br />
Staatsbürgerschaft abhängig,<br />
die ➤ 12. Novelle stellte<br />
noch einmal eine Erweiterung des<br />
Kreises anspruchsberechtigter Personen<br />
dar. Dennoch wies das OFG weiterhin<br />
viele Mängel und Ungerechtigkeiten<br />
auf, oftmals war es<br />
schwer, die Nachweise erlittener<br />
Verfolgung zu erbringen. Zudem<br />
blieben viele Gruppen nach wie vor<br />
ausgeschlossen: Nicht anspruchsberechtigt<br />
waren Roma und Sinti (teilweise),<br />
Homosexuelle, sogenannte<br />
„Asoziale“, „Euthanasie“-Opfer und<br />
andere Gruppen. Sie erhielten erst<br />
durch den 1995 geschaffenen ➤ Nationalfonds<br />
eine Entschädigung,<br />
ebenso wie die jüdischen Vertriebenen,<br />
die bis dahin nur teilweise<br />
und sehr gering entschädigt worden<br />
waren.<br />
Palästina-Amt<br />
Auswanderungs-Organisation der ➤<br />
Jewish Agency in Deutschland, die<br />
ausschließlich die Auswanderung der<br />
jüdischen Bevölkerung nach Palästina<br />
durchführte. Das Palästina-Amt<br />
kümmerte sich um die nötigen Visa<br />
und den Transport der EmigrantInnen.<br />
Nach dem Novemberpogrom<br />
1938 wurde das Amt unter stärkere<br />
Kontrolle gestellt, konnte aber noch<br />
bis Frühjahr 1941 weitgehend eigenständig<br />
arbeiten.<br />
Potsdamer Abkommen<br />
Das von den drei alliierten Mächten<br />
in Berlin am 2. August 1945 unterzeichnete<br />
Abkommen regelte u.a.<br />
die militärische Besetzung Deutschlands<br />
und Österreichs, Entmilitarisierung,<br />
Entnazifizierung, Verfolgung<br />
von Kriegsverbrechern, Reparationszahlungen<br />
und die alliierte<br />
Kontrolle der deutschen und österreichischen<br />
Wirtschaft. Gemäß dem<br />
Abkommen konnte jede Besatzungsmacht<br />
ihre Reparationsansprüche<br />
nur aus der von ihr besetzten<br />
Zone befriedigen. Während die<br />
Westmächte gegenüber Österreich<br />
auf ihre Ansprüche mit Ausnahme<br />
des „deutschen Eigentums“ verzichteten,<br />
übernahm die USIA („Verwaltung<br />
des sowjetischen Vermögens<br />
in Österreich“) innerhalb der von<br />
ihr besetzten Zone fast die gesamte<br />
Erdölindustrie und die DDSG<br />
(Donaudampfschiffahrtsgesellschaf),<br />
ca. 300 Industriebetriebe, 150.000<br />
ha Grundbesitz, Gewerbe- und Handelsbetriebe.<br />
Gemäß dem Staatsvertrag<br />
wurden diese Vermögenswerte<br />
später gegen eine Ablöse von 150<br />
Mio. Dollar an Österreich übergeben.<br />
172 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Raab, Julius (1891–1964)<br />
ÖVP-Politiker, 1927–1934 Abgeordneter<br />
des Nationalrats, nö. Heimwehrführer,<br />
1938 Handels- und Verkehrsminister,<br />
nach 1945 Mitbegründer<br />
der ÖVP und von 1952– 1960<br />
ihr Bundesparteiobmann, 1953–1961<br />
Bundeskanzler, Mitverhandler des<br />
Staatsvertrags, Präsident der Bundeswirtschaftskammer,Mitbegründer<br />
der Sozialpartnerschaft.<br />
Rafelsberger, Walter<br />
„Staatskommissar in der Privatwirtschaft“<br />
und Gauwirtschaftsberater.<br />
Im Mai 1938 wurde er als Leiter der<br />
➤ Vermögensverkehrsstelle (VVST)<br />
zur planmäßigen Durchführung und<br />
Organisierung der Zwangsenteignungen<br />
eingesetzt.<br />
Raubgold<br />
Bezeichnet das Gold, das der jüdischen<br />
Bevölkerung und anderen<br />
Gruppen, wie etwa den Sinti und<br />
Roma, während der NS-Zeit geraubt<br />
wurde, u.a. durch Enteignung von<br />
jüdischen Banken und Einziehung<br />
von deren Vermögen, und durch das<br />
den Ermordeten in den Konzentrationslagern<br />
herausgebrochene Zahngold,<br />
das in andere Goldbestände<br />
eingeschmolzen wurde und so in<br />
den internationalen Goldhandel<br />
gelangte. ➤ Bergier-Kommission; ➤<br />
Londoner „Raubgoldkonferenz“.<br />
Reichseinheitliche Verordnung gegen<br />
die „Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe“<br />
vom 22. 4. 1938 und Verordnung<br />
über die Anmeldung jüdischen<br />
Vermögens vom 26. 4. 1938<br />
Beide Verordnungen bildeten die legistische<br />
Grundlage für die Zwangsenteignung<br />
jüdischen Besitzes und<br />
Vermögens.<br />
Reichsfluchtsteuer<br />
Betrag, der von Juden und Jüdinnen<br />
für die Genehmigung der Ausreise<br />
zu zahlen war. Die Reichsfluchtsteuer<br />
wurde von der NS-Finanzverwaltung<br />
von den jüdischen ➤ Sperrkonten<br />
abgezogen.<br />
Reichssicherheits-Hauptamt (RSHA)<br />
Am 27. September 1939 wurden die<br />
zentralen Ämter der Sicherheitspolizei<br />
(die 1936 aus ➤ Gestapo und Kripo<br />
neu organisiert worden war) und<br />
des Sicherheitsdienstes der ➤ SS zum<br />
RSHA zusammengefaßt. Chef des<br />
RSHA wurde der bisherige Chef des<br />
SD ➤ Reinhard Heydrich. Sein Nachfolger<br />
ab Anfang 1943 war der<br />
Österreicher Ernst Kaltenbrunner.<br />
Das RSHA war hauptverantwortlich<br />
für Verfolgungen und Massenmorde,<br />
die Deportation hunderttausender<br />
Juden und Jüdinnen in die ➤ Vernichtungslager.<br />
Rückstellungsgesetze<br />
Die wichtigsten Gesetze zur Umsetzung<br />
des ➤ Bundesgesetzes über die<br />
Nichtigkeit von Rechtsgeschäften<br />
sind das 1., das 2. und insbesondere<br />
das 3. Rückstellungsgesetz (RG). Das<br />
1. RG vom 26. Juli 1946 betraf das<br />
vom Deutschen Reich entzogene und<br />
nach 1945 in der Verwaltung der Republik<br />
Österreich oder der Bundesländer<br />
befindliche Vermögen, das<br />
2. RG vom 6. Februar 1947 behandelte<br />
das im Eigentum der Republik befindliche<br />
entzogene Vermögen und<br />
das 3. RG vom 6. Februar 1947 das in<br />
privatem Besitz befindliche, zwischen<br />
1938 und 1945 entzogene Vermögen,<br />
und jene Fälle, die nicht<br />
durch das 1. und 2. RG geregelt werden<br />
konnten. Der größte Teil der<br />
Rückstellungsverfahren fiel unter das<br />
3. RG. Weitere Rückstellungsgesetze<br />
regelten die Rückstellung entzogener<br />
Rechte, z.B. Gewerberechte, Ansprüche<br />
aus Dienstverhältnissen u.ä.<br />
4. Rückstellungsanspruchsgesetz<br />
„Bundesgesetz über die Erhebung<br />
von Ansprüchen der Auffangorganisationen<br />
auf Rückstellung von Vermögen<br />
nach den ➤ Rückstellungsgesetzen“<br />
vom Mai 1961. In diesem Gesetz<br />
wurde den ➤ Sammelstellen die<br />
Berechtigung gegeben, Ansprüche<br />
nach der Rückstellung, die von den<br />
Berechtigten bisher nicht erhoben<br />
worden waren, geltend zu machen.<br />
Sach- und Verkehrswert<br />
In der Arisierungspraxis wurde von<br />
einer Treuhandstelle (bei Objekten<br />
über einem Wert von 100.000 RM<br />
durch eine „Kontrollbank“) ein Betrieb<br />
zu einem Sachwert angekauft,<br />
der nur einen Bruchteil des realen<br />
Wertes darstellte. Der Weiterverkauf<br />
an „arische“ KäuferInnen erfolgte<br />
zum deutlich höheren Verkaufswert.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Sammelklage<br />
Nach amerikanischem Recht können<br />
Forderungen zahlreicher Personen<br />
als „Klagen im Gruppeninteresse“<br />
(sogenannten „class actions“) geltend<br />
gemacht werden. Dieses Rechtsinstrument<br />
dient der Bündelung der<br />
Interessen vieler Einzelner und der<br />
Vermeidung möglicherweise widersprüchlicher<br />
Urteile in inhaltlich<br />
gleich gelagerten Prozessen. Eine<br />
Sammelklage kann von einzelnen<br />
„class representatives“ stellvertretend<br />
für die anderen Mitglieder der<br />
Gruppe eingebracht werden, u.a.<br />
wenn die Anzahl der Betroffenen<br />
genügend groß ist, ihre Ansprüche in<br />
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht<br />
ähnlich gelagert sind, die von den<br />
„class representatives“ erhobenen<br />
Ansprüche für die ganze „class“ typisch<br />
sind und sie konkrete Gründe<br />
für eine „class action“ anführen können.<br />
Im Einzelfall entscheidet der<br />
Richter über die Zulässigkeit einer<br />
„class action“. Für „class members“<br />
ist das rechtliche Urteil bindend, im<br />
Falle eines gewonnenen Prozesses<br />
wird die Summe nach Abzug der Anwaltskosten<br />
quotenmäßig auf die<br />
„class members“ verteilt.<br />
Sammelstellen<br />
Die Erfassung des „erblosen Vermögens“<br />
und seine Verwendung für<br />
die Opfer des Nationalsozialismus<br />
war eine wichtige Frage in den Verhandlungen<br />
des ➤ Claims Committee<br />
und der österreichischen Bundesregierung<br />
und wurde im Artikel<br />
26, § 2 des ➤ Staatsvertrags geregelt.<br />
Entsprechend wurde am 13.<br />
März 1957 das sogenannte „Auffangorganisationsgesetz“<br />
erlassen,<br />
das die Einrichtung zweier Sammelstellen<br />
für „erbloses jüdisches“ bzw.<br />
(A) „erbloses nichtjüdisches Vermögen“<br />
(B) vorsah. Der zwischen 1938<br />
und 1945 erfolgte Transfer in Österreich<br />
entzogenen Vermögens nach<br />
Deutschland wurde im ➤ Kreuznacher<br />
Abkommen mit einer von<br />
der BRD zu zahlenden Pauschalsumme<br />
von 6 Mio. DM geregelt. Das<br />
von beiden Sammelstellen insgesamt<br />
erfasste Vermögen (ca. 180<br />
Mio. Schilling) wurde nach einem<br />
Gesetz vom 5. April 1962 zu 80 %<br />
auf Sammelstelle A, zu 20 % auf<br />
Sammelstelle B aufgeteilt und an in<br />
173<br />
Glossar
Glossar<br />
Österreich lebende individuelle AntragstellerInnen<br />
und gemeinnützige<br />
Organisationen ausgezahlt.<br />
Sauckel, Fritz (1894–1946)<br />
wurde 1923 Mitglied der NSDAP und<br />
der SA, 1927 Gauleiter von Thüringen.<br />
Im März 1942 wurde Sauckel<br />
zum „Generalbevollmächtigten für<br />
den Arbeitseinsatz“ ernannt. Er war<br />
verantwortlich für die Deportation<br />
von Millionen Menschen für den<br />
Zwangsarbeitseinsatz im „Deutschen<br />
Reich“. 1946 wurde er vom Nürnberger<br />
Militärgerichtshof zum Tode verurteilt<br />
und gehängt.<br />
Schuschnigg, Kurt<br />
Der christlichsoziale Politiker wurde<br />
nach der Ermordung von Engelbert<br />
Dollfuß im Juli 1934 Bundeskanzler.<br />
Er versuchte die Prinzipien des<br />
➤ Ständestaates zu verwirklichen, innenpolitisch<br />
drängte er den starken<br />
Einfluß der Heimwehren zurück,<br />
außenpolitisch konnte er dem Druck<br />
des nationalsozialistischen Deutschen<br />
Reiches wenig entgegensetzen.<br />
Schwarzes Kreuz, Österreichisches<br />
(ÖSK)<br />
1919 gegründete Kriegsgräberfürsorge.<br />
Seine Aufgaben sind die Errichtung<br />
und Erhaltung von Soldatengräbern<br />
der Angehörigen aller<br />
Nationen, von Gräbern ziviler Opfer<br />
des Bombenkriegs, der politischen<br />
Verfolgung und von Flüchtlingen.<br />
Das ÖSK wird fast ausschließlich über<br />
Spenden finanziert.<br />
SD<br />
Sicherheitsdienst des Reichsführers<br />
➤ SS. Der SD war der Nachrichtendienst<br />
der NSDAP und eine wichtige<br />
Institution bei der Durchführung der<br />
„Endlösung“. Der SD wurde 1931<br />
von ➤ Heinrich Himmler errichtet,<br />
die Leitung unterstand ➤ Reinhard<br />
Heydrich. Seine Aufgabe lag in der<br />
Überwachung von „Feinden der<br />
Partei“. 1934 wurde der SD zum<br />
einzigen Geheimdienst der NSDAP<br />
erklärt. Während der ➤ Gestapo<br />
primär Exekutivaufgaben zukamen,<br />
konzentrierte sich der SD auf die Formulierung<br />
der politischen und ideologischen<br />
Zielsetzungen der SS. Die<br />
SD-Führung versuchte auch über<br />
Auslandsspionage Kontrolle über<br />
den militärischen Nachrichtendienst,<br />
die sog. „Abwehr“ zu erhalten. Im<br />
September 1939 wurden unter Oberbefehl<br />
Heydrichs Gestapo und SD mit<br />
der Gründung des ➤ Reichssicherheitshauptamtes<br />
(RSHA) vereinigt.<br />
Shanghai<br />
War bereits vor dem Zweiten Weltkrieg<br />
ein chinesischer Hafen mit<br />
mehr als vier Mio. EinwohnerInnen.<br />
Die internationalen Niederlassungen<br />
in Shanghai wurden von elf Ländern,<br />
darunter die USA, Großbritannien<br />
und Japan, verwaltet. Nach dem<br />
➤ Novemberpogrom 1938 bot<br />
Shanghai zahlreichen Emigranten Zuflucht.<br />
Shanghai war weltweit der<br />
einzige Ort, zu dem man ohne Visum<br />
oder offizielle Dokumente gelangen<br />
konnte. Mit Hilfe zweier bereits<br />
bestehender jüdischer Gemeinden in<br />
Shanghai und des amerikanisch-jüdischen<br />
➤ „Joint“-Distribution Committee<br />
wurden zwei große Flüchtlingslager<br />
für 3000 Personen errichtet.<br />
Nach anfänglicher Integration<br />
und auch der wirtschaftlichen Etablierung<br />
verschlechterten sich mit dem<br />
Krieg im Pazifik auch die Lebensbedingungen<br />
der Flüchtlinge, zumal die<br />
amerikanische Regierung private Unterstützungen<br />
und Zuschüsse durch<br />
den „Joint“ verbot. Im Februar 1943<br />
wurde von den Japanern ein Lager<br />
nach nationalsozialistischem Vorbild,<br />
der sogenannte „Sperrbezirk“, errichtet.<br />
Nach dem Krieg ging die<br />
Hälfte der in Shanghai lebenden<br />
Flüchtlinge nach Israel. Nach Wien<br />
kehrten am 12.4.1949 269 ehemalige<br />
Flüchtlinge zurück.<br />
Sperrkonto<br />
Der Kaufpreis, den ehemalige EigentümerInnen<br />
„arisierter“ Betriebe<br />
zugestanden bekamen, wurde jedoch<br />
nicht an diese ausbezahlt.<br />
Stattdessen wurde der Betrag auf<br />
ein Sperrkonto überwiesen, auf das<br />
der/die ehemalige BesitzerIn keinen<br />
Zugriff hatte. Von diesen Sperrkonten<br />
entnahm die NS-Finanzverwaltung<br />
Abgaben, wie etwa die ➤<br />
Reichsfluchtsteuer und die Judenvermögensabgabe<br />
( ➤ Sühneleistung).<br />
SS<br />
„Schutzstaffel“; als Polizeitruppe der<br />
NSDAP und später Elitegarde des na-<br />
tionalsozialistischen Regimes war die<br />
SS das Hauptinstrument zur Ausübung<br />
von Terror, Massenmorden und<br />
„Germanisierung“. Die 1925 gebildete<br />
Schutzstaffel war zunächst als Hitlers<br />
Leibgarde zuständig für Schutzund<br />
Sicherheitsaufgaben. Chef der<br />
SS war ab 1929 ➤ Heinrich Himmler<br />
(ab 1936 auch Chef der deutschen<br />
Polizei). Die Waffen-SS, eine militärische<br />
Einheit der SS, führte während<br />
des Krieges an der Front Massenerschießungen<br />
und Tötungen in Gaswägen<br />
durch. Ihr unterstanden auch<br />
die Konzentrationslager. Die Waffen-<br />
SS, eine militärische Einheit der SS,<br />
führte während des Krieges an der<br />
Front Massenerschießungen und Tötung<br />
in Gaswägen durch.<br />
Staatsvertrag<br />
Der am 15. Mai 1955 von der Sowjetunion,<br />
Großbritannien, den USA,<br />
Frankreich und Österreich unterzeichnete<br />
„Staatsvertrag betreffend<br />
die Wiederherstellung eines unabhängigen<br />
und demokratischen<br />
Österreich“ behandelt im Artikel 26<br />
die Ansprüche von Opfern nationalsozialistischer<br />
Verfolgung auf Vermögensrückstellung<br />
und Wiederherstellung<br />
ihrer Rechte bzw. auf Entschädigung,<br />
falls eine Rückstellung<br />
nicht möglich ist. Über die Interpretation<br />
dieses Artikels gingen aber in<br />
den folgenden Jahren die Meinungen<br />
zwischen der österreichischen<br />
Regierung und den Organisationen<br />
der Überlebenden auseinander.<br />
Außerdem wurde im Staatsvertrag<br />
festgelegt, dass das „erblose Vermögen“<br />
zur Unterstützung der Opfer<br />
der NS-Verfolgung verwendet werden<br />
solle. ➤ Sammelstellen.<br />
Ständestaat<br />
Bezeichnung für die ständisch autoritäre<br />
Staatsform Österreichs zwischen<br />
1934 und 1938. Nach der Ausschaltung<br />
des Parlaments durch Bundeskanzler<br />
Engelbert Dollfuß im<br />
März 1933 wurden die demokratischen<br />
Einrichtungen der Verfassung<br />
schrittweise demontiert. Die Basis<br />
des Ständestaates bildete eine berufsständische<br />
Verfassung und ein<br />
Einparteiensystem, das weitgehend<br />
von Mitgliedern der Christlichsozialen<br />
Partei und der Heimwehr getragen<br />
wurde.<br />
174 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Sternfeld, Albert<br />
1925 in Wien geboren, kam er 1938<br />
mit einem Kindertransport nach England,<br />
diente als junger Mann bei der<br />
britischen und bei der israelischen<br />
Luftwaffe, war danach im Versicherungswesen<br />
tätig. Sternfeld kehrte<br />
1966 nach Österreich zurück. Seitdem<br />
setzt er sich für die Entschädigung<br />
und Rehabilitierung der aus Österreich<br />
vertriebenen jüdischen Bevölkerung<br />
ein. 1992 entwarf Sternfeld im<br />
Auftrag der ➤ Israelitischen Kultusgemeinde<br />
einen „Lösungsplan“ zum<br />
Thema Entschädigung, der u.a. eine<br />
einmalige individuelle Zahlung für<br />
alle Naziopfer und die Einrichtung<br />
eines „Solidaritätsfonds für Vertriebene“<br />
vorsah. Sternfelds Idee des<br />
Solidaritätsfonds wurde – in eingeschränkter<br />
Form – Grundlage für die<br />
Errichtung des ➤ „Nationalfonds für<br />
die Opfer des Nationalsozialismus“<br />
im Juni 1995.<br />
Stiftung „Polnisch-Deutsche<br />
Aussöhnung“<br />
Die Stiftung wurde entsprechend einer<br />
Vereinbarung zwischen der polnischen<br />
und der bundesdeutschen<br />
Regierung am 16. Oktober 1991 in<br />
Polen gegründet. Ziel der Stiftung<br />
ist es, eine von der Bundesrepublik<br />
zugestandene einmalige humanitäre<br />
Zahlung von 500 Mio. DM (in drei<br />
Teilzahlungen) an besonders betroffene<br />
polnische Opfer des Nationalsozialismus<br />
zu verteilen. Darunter<br />
fallen ehemalige KZ-, Gefängnis-,<br />
Getto-Häftlinge, Häftlinge der sogenannten<br />
Polenlager, ZwangsarbeiterInnen,<br />
Waisenkinder, die zur<br />
Zwangsarbeit gezwungen wurden,<br />
Personen, die als Kinder verfolgt, in<br />
KZs oder im Deutschen Reich von<br />
ZwangsarbeiterInnen geboren wurden.<br />
Der überwiegende Teil der<br />
Summe wurde bereits an ca.<br />
530.000 AntragstellerInnen in Form<br />
einmaliger und individueller Zahlungen<br />
von ca. 500-700 DM ausgezahlt.<br />
Auch in Russland, Weißrussland<br />
und der Ukraine wurden inzwischen<br />
Stiftungen für „Verständigung<br />
und Aussöhnung“ eingerichtet,<br />
die in ähnlicher Weise arbeiten.<br />
Eine notwendige eigene Regelung<br />
für die baltischen Länder und<br />
Moldawien steht noch aus.<br />
Trobe, Harold<br />
Direktor des ➤ Joint Distribution<br />
Committee. 1948 untersuchte er die<br />
finanzielle und organisatorische Situation<br />
der ➤ Israelitischen Kultusgemeinde<br />
Wien und schlug vor, dass<br />
die Regierung der IKG ein Darlehen<br />
von 25 Mio. Schilling zum Auf- und<br />
Ausbau verschiedener Fürsorgeeinrichtungen<br />
geben solle.<br />
Tschadek, Otto (1904–1969)<br />
SPÖ-Politiker, 1934 verhaftet, 1949–<br />
1952 und 1956–1960 Bundesminister<br />
für Justiz, 1960–1969 stellvertretender<br />
Landeshauptmann von Niederösterreich.<br />
UNRRA<br />
United Nations Relief and Rehabilitation<br />
Administration. Die UN-Behörde<br />
für Flüchtlinge und Staatsangehörige<br />
der Alliierten in den befreiten Ländern<br />
Europas und des Fernen Ostens<br />
wurde am 9. November von 44 Staaten<br />
der Vereinten Nationen gegründet.<br />
Ihre Aufgabe war Hilfe für wirtschaftlich<br />
notleidende Länder und<br />
die Betreuung und Rückführung von<br />
➤ Displaced Persons nach dem Krieg.<br />
Die UNRRA unterstand dem jeweiligen<br />
alliierten Militärkommando und<br />
war im Wesentlichen verantwortlich<br />
für die Verwaltung der Lager, die medizinische<br />
und soziale Versorgung,<br />
die Organisation kultureller Aktivitäten<br />
und beruflicher Weiterbildung.<br />
Ihr unterstanden auch andere Wohlfahrtsorganisationen<br />
wie z.B. der ➤<br />
Joint. 1947 übernahm die ➤ IRO die<br />
Betreuung und Rückführung bzw.<br />
Emigration der Flüchtlinge. Die Büros<br />
der UNRRA in den europäischen Ländern<br />
wurden Ende 1948 geschlossen.<br />
Vaterländische Front<br />
1933 von Engelbert Dollfuß als Sammelbewegung<br />
aller „vaterlandstreuen“<br />
ÖsterreicherInnen gegründet.<br />
Nach dem Verbot aller anderen politischen<br />
Parteien hatte die Vaterländische<br />
Front (VF) eine politische Monopolstellung<br />
inne. Sie war in eine Zivil-<br />
und eine Wehrfront gegliedert.<br />
Entgegen den Bestrebungen von<br />
Dollfuß wurde die Vaterländische<br />
Front jedoch keine Massenbewegung<br />
und konnte die politischen<br />
GegnerInnen des ➤ Ständestaates<br />
nicht für sich gewinnen.<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Verband der Rückstellungsbetroffenen<br />
Der Verband wurde Ende 1948 gegründet,<br />
politisch unterstützt vom<br />
VdU. Der Verband wandte sich vor<br />
allem gegen das 3. Rückstellungsgesetz<br />
und verlangte für die Verluste,<br />
die den heutigen BesitzerInnen<br />
durch die Rückstellung entstehen<br />
würden, die Schaffung eines Ausgleichsfonds.<br />
Verband der Unabhängigen (VdU)<br />
1949 in Salzburg gegründet, Sammelbecken<br />
für ehemalige Nationalsozialisten,<br />
Heimatvertriebene,<br />
Heimkehrer, politisch Unzufriedene.<br />
Erreichte bei den Wahlen 1949 auf<br />
Anhieb knapp 12% der WählerInnenstimmen.<br />
Der VdU ging später in<br />
der 1956 gegründeten FPÖ auf.<br />
Vermögensverkehrsstelle (VVST)<br />
Die VVST wurde am 18. Mai 1938 im<br />
österreichischen Ministerium für Arbeit<br />
und Wirtschaft gegründet. Ihr<br />
oblagen die Kontrolle und die Gesamtorganisation<br />
der Zwangsenteignungen.<br />
Sie war neben der Bestellung<br />
von Treuhändern, Kommissaren<br />
und Abwicklern für Unternehmen<br />
für die Koordination der gesamtwirtschaftlichen<br />
Planung zuständig.<br />
Sie kontrollierte Kaufverträge, setzte<br />
den Kaufpreis für zur ➤ „Arisierung“<br />
bestimmte Unternehmen fest<br />
und verordnete die Liquidierung<br />
von Betrieben. Die VVST kooperierte<br />
mit Referaten des Ministeriums für<br />
Arbeit und Wirtschaft, mit NS-Wirtschaftsstellen<br />
der gewerblichen<br />
Wirtschaft, mit gewerblichen Fachverbänden<br />
und der NSDAP. Nachdem<br />
ein Großteil der jüdischen Unternehmen<br />
bereits „arisiert“ oder<br />
aufgelöst worden war, wurde die<br />
VVST 1939 zur „Abwicklerstelle“ für<br />
die Auflösung der restlichen Betriebe<br />
im Handels- und Gewerbebereich.<br />
Als „Referat III Entjudung“ der<br />
Reichsstatthalterei Wien bestand die<br />
VVST bis Kriegsende weiter.<br />
Vernichtungslager<br />
In den sogenannten Vernichtungslagern<br />
im besetzten Polen – Auschwitz-Birkenau<br />
(das teilweise auch ein<br />
Konzentrationslager war), Chelmno,<br />
Belzec, Sobibor, Treblinka – wurden<br />
ab Ende 1941 alle ankommenden<br />
Häftlinge im Rahmen der „Endlö-<br />
175<br />
Glossar
Glossar<br />
sung der Judenfrage“ in den Gaskammern<br />
ermordet. In Konzentrationslagern<br />
wurden v.a. die noch arbeitsfähigen<br />
Häftlinge nicht sofort in<br />
die Gaskammern geschickt, sondern<br />
zunächst zur Arbeit in SS-Betrieben<br />
und in Industrieunternehmen herangezogen<br />
bzw. in andere Lager weiter<br />
deportiert.<br />
Verordnung über den Einsatz des<br />
jüdischen Vermögens<br />
Die Verordnung vom 3. Dezember<br />
1938 legalisierte und reglementierte<br />
im Nachhinein die Praxis der wilden<br />
➤ „Arisierungen“. Sie regelte u.a. die<br />
Zwangsveräußerung bzw. Zwangsliquidierung<br />
von in jüdischem Besitz<br />
befindlichen Gewerbe-, land- und<br />
forstwirtschaftlichen Betrieben, die<br />
Einsetzung von Treuhändern, den<br />
Verlust der Verfügungsrechte des Inhabers<br />
und seine Pflicht, die Kosten<br />
für die treuhänderische Verwaltung<br />
zu tragen.<br />
Verordnung zur Ausschaltung der<br />
Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben<br />
Diese Verordnung wurde am 12. November<br />
1938, also zwei Tage nach<br />
dem ➤ Novemberpogrom vom 9./10.<br />
November, der sogenannten „Reichskristallnacht“<br />
erlassen. Sie erweiterte<br />
die bereits erlassenen Berufsverbote<br />
für Juden und Jüdinnen, wie<br />
etwa das ➤ Gesetz zur Wiederherstellung<br />
des Berufsbeamtentums<br />
vom 7. April 1933, nun durch das<br />
Verbot der Führung von Gewerbebetrieben<br />
und Handelsgeschäften,<br />
der Ausübung der Funktion eines<br />
leitenden Angestellten oder Betriebsführers.<br />
11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz<br />
Die 11. Verordnung vom 25. November<br />
1941 besagte, dass Juden und<br />
Jüdinnen, die sich im Ausland aufhielten,<br />
ihre deutsche Staatsangehörigkeit<br />
verlieren und staatenlos<br />
werden sollten und dass ihr gesamtes<br />
Vermögen an das Reich fallen<br />
sollte. Das betraf nach einem zusätzlichen<br />
Runderlass auch die zukünftig<br />
in die besetzten Gebiete, in Gettos<br />
und Konzentrationslager deportierten<br />
Juden und Jüdinnen.<br />
13. Verordnung zum Reichsbürgergesetz<br />
Die 13. Verordnung vom 1. Juli 1943<br />
bestimmte, dass „strafbare Handlungen“<br />
von Juden und Jüdinnen von<br />
der Polizei geahndet würden und<br />
dass das gesamte Vermögen von Juden<br />
und Jüdinnen nach ihrem Tod an<br />
das Reich verfiel. Die Vermögensklausel<br />
legalisierte (nachträglich) den<br />
völligen Vermögensentzug der jüdischen<br />
Bevölkerung, die sich unter<br />
Umständen noch im Reich selbst befand.<br />
Vierjahresplan<br />
Am 9. 9. 1936 verkündete Adolf Hitler<br />
einen Wirtschaftsplan, der auf die<br />
Intensivierung der Wirtschaftsproduktion<br />
für den Krieg abzielte. Die<br />
deutsche Wirtschaft sollte unabhängig<br />
von Rohstofflieferungen des Auslandes<br />
werden. Mit dem „Anschluss“<br />
im März 1938 galt die Verwirklichung<br />
des Vierjahresplanes auch für<br />
Österreich.<br />
Volcker-Kommission<br />
Aufgrund eines Memorandums zwischen<br />
der Schweizerischen Bankiervereinigung,<br />
der ➤ WJRO und dem<br />
➤ WJC wurde im Mai 1996 ein „Unabhängiges<br />
Personenkomitee“ („Independent<br />
Committee of Eminent<br />
Persons“) unter dem Vorsitz des<br />
amerikanischen Bankexperten Paul<br />
A. Volcker eingerichtet. Ziel des<br />
Komitees ist die Erfassung der nachrichtenlosen<br />
Bankkonten und anderer<br />
Vermögen von Opfern des<br />
Nationalsozialismus bei Schweizer<br />
Banken. In Zusammenarbeit mit dem<br />
Volcker-Komitee veröffentlichte die<br />
Bankiervereinigung die bereits bekannten<br />
nachrichtenlosen Bankkonten<br />
in internationalen Zeitungen<br />
und im Internet mit einem Aufruf an<br />
die möglichen BesitzerInnen bzw.<br />
ErbInnen der BesitzerInnen.<br />
Volkssolidarität<br />
Ende Mai/Anfang Juni 1945 in Wien<br />
von ÖVP, SPÖ und KPÖ gegründete<br />
überparteiliche Fürsorgeinstitution<br />
zur Betreuung der politisch verfolgten<br />
Opfer. Die Mittel wurden v.a.<br />
durch Spenden aufgebracht. Bis Anfang<br />
1946 waren Juden und Jüdinnen<br />
von der Betreuung ausgeschlossen.<br />
Der 17. Juni 1945 wurde zum „Tag<br />
der Volkssolidarität“ erklärt, Haussammlungen<br />
wurden durchgeführt,<br />
Veranstaltungen und Gedenkfeiern<br />
sollten den Widerstandskampf und<br />
die Leiden der KZ-Opfer würdigen.<br />
Wannsee-Konferenz<br />
Am 20. Jänner 1942 wurde in Berlin-<br />
Wannsee die Durchführung und Koordination<br />
der „Endlösung“ besprochen.<br />
Die Konferenz unter Teilnahme<br />
➤ Adolf Eichmanns, ➤ Heinrich<br />
Himmlers (Leiter des ➤ Reichssicherheitshauptamtes<br />
RSHA) und vieler<br />
anderer prominenter NS-Politiker<br />
markierte einen Wendepunkt in der<br />
nationalsozialistischen Judenpolitik,<br />
den Übergang zu systematischem<br />
Massenmord.<br />
Washingtoner Konferenz über<br />
„Vermögenswerte aus der Ära des<br />
Holocaust“<br />
An der Anfang Dezember 1998 stattgefundenen<br />
Konferenz über „Holocaust<br />
Era Assets“ nahmen Delegationen<br />
aus 44 Ländern teil. Während<br />
bezüglich ➤ Raubgold und entzogenen<br />
Versicherungswerten keine Einigung<br />
erzielt werden konnte, wurden<br />
zum Thema Raubkunst elf Prinzipien<br />
für die Restitution von Kunstwerken<br />
festgelegt. Weitere Schwerpunkte<br />
waren die Verständigung über die<br />
Grundsätze der „Holocaust-Erziehung“,<br />
des Umgangs mit der NS-Vergangenheit<br />
und die historische Vermittlung.<br />
Weber, Anton (1878–1950)<br />
Stadtrat für Sozialpolitik und Wohnungswesen<br />
der Gemeinde Wien in<br />
der Ersten Republik.<br />
Weißbuch, englisches<br />
White Paper of 1939 (auch bekannt<br />
unter dem Namen MacDonald Weißbuch<br />
nach dem britischen Kolonialminister<br />
Malcolm MacDonald). Das<br />
Weißbuch enthielt die Richtlinien<br />
der britischen Palästina-Politik und<br />
wurde am 17. Mai 1939 veröffentlicht.<br />
Auf Protest der Bevölkerung<br />
Palästinas gegen die zunehmende<br />
Zahl jüdischer Einwanderer seit 1933<br />
wurde deren Zahl für einen Zeitraum<br />
von fünf Jahren auf 15.000 begrenzt.<br />
Die weitere Einwanderung sollte von<br />
der Zustimmung der Araber abhängig<br />
gemacht werden. Die Richtlinien<br />
176 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
sahen auch eine Beschränkung jüdischen<br />
Landbesitzes vor.<br />
Wirtschafts-Verwaltungs-Hauptamt<br />
(WVHA SS)<br />
Die Zentralbehörde für wirtschaftliche<br />
Tätigkeiten der ➤ SS wurde am<br />
1. Februar 1942 eingerichtet. Dem<br />
WVHA SS wurde auch die Verwaltung<br />
der Konzentrationslager übertragen,<br />
um eine effiziente Organisation<br />
des Zwangsarbeitseinsatzes und<br />
die Kontrolle über die wirtschaftliche<br />
Ausbeutung von KZ-Häftlingen v.a.<br />
in der Rüstungsindustrie zu gewährleisten.<br />
Firmen, die KZ-Häftlinge als<br />
ZwangsarbeiterInnen beschäftigen<br />
wollten, mussten beim WVHA SS einen<br />
Antrag stellen.<br />
Wohnungsanforderungsgesetz vom<br />
1.9.1945<br />
Entsprechend der ➤ Opferfürsorgegesetzgebung<br />
wurde eine Wohnungsvergabe<br />
an den Opferstatus<br />
gekoppelt. Die Vergabe erfolgte<br />
über ein Punktesystem. Je nach sozialer,<br />
finanzieller Bedürftigkeit und<br />
nach der Anerkennung im OFG wurden<br />
Punkte verteilt. Aus politischen<br />
Gründen verfolgte Opfer des Nationalsozialismus<br />
erhielten die höchste<br />
Punktezahl.<br />
Wöllersdorf 1933–1938<br />
Austrofaschistisches Anhaltelager in<br />
Niederösterreich, in dem Sozialisten<br />
und Nationalsozialisten inhaftiert<br />
wurden.<br />
World Jewish Congress (WJC)<br />
Der WJC wurde – nach mehreren<br />
Vorläuferkonferenzen ab 1919 – als<br />
internationale Dachorganisation jüdischer<br />
Gemeinden und Organisationen<br />
1936 in Genf von Rabbi Dr. Stephen<br />
Wise (Präsident des WJC von<br />
1936-1949) und ➤ Dr. Nahum Goldmann<br />
(Präsident des WJC von 1949-<br />
1977) gegründet. Während des Nationalsozialismus<br />
konzentrierte sich<br />
der WJC auf die finanzielle und organisatorische<br />
Unterstützung der jüdischen<br />
Bevölkerung in Europa. Er<br />
organisierte die Emigration europäischer<br />
Juden und Jüdinnen und Aufbauprogramme,<br />
vertrat die Interessen<br />
der jüdischen Überlebenden bei<br />
Friedensverhandlungen und setzte<br />
sich für die Verfolgung von NS-<br />
Kriegsverbrechern ein. Unter Goldmann<br />
spielte der WJC eine entscheidende<br />
Rolle in der Vorbereitung von<br />
Reparations- und Rückstellungsverhandlungen<br />
mit der Bundesrepublik<br />
Deutschland in den fünfziger Jahren.<br />
In den neunziger Jahren setzte sich<br />
der WJC in verschiedenen europäischen<br />
Ländern für die Rückstellung<br />
entzogenen jüdischen Vermögens<br />
ein, inzwischen wurden mehr als 20<br />
Kommissionen zur Erforschung des<br />
Umgangs mit jüdischem Vermögen<br />
während der NS-Zeit von verschiedenen<br />
Regierungen eingesetzt. Dem<br />
WJC gehören heute mehr als 100<br />
Vereinigungen jüdischer Gemeinden<br />
und Organisationen an, darunter<br />
World Zionist Organization, ➤ Jewish<br />
Agency, ➤ American Jewish Joint<br />
Distribution Committee, B’nai B’rith<br />
und Organisationen der Überlebenden<br />
des Holocaust. Sitz des WJC ist<br />
New York.<br />
World Jewish Restitution Organization<br />
(WJRO)<br />
Die WJRO wurde 1992 als Dachorganisation<br />
für Fragen der Restitution<br />
von während der NS-Zeit entzogenem<br />
Vermögen gegründet. Ihr<br />
gehören unter anderem der ➤ World<br />
Jewish Congress, B’nai B’rith, die<br />
➤ Jewish Agency und verschiedene<br />
Vereinigungen von Holocaust-Überlebenden<br />
an. Die WJRO engagiert<br />
sich sowohl in ost- als auch in westeuropäischen<br />
Staaten. Im Mai 1996<br />
unterzeichnete die Schweizerische<br />
Bankiervereinigung ein Abkommen<br />
mit dem WJC und der WJRO über<br />
die Einrichtung einer gemeinsamen<br />
Kommission, der sogenannten<br />
➤„Volcker-Kommission“, zur Erfassung<br />
der nachrichtenlosen Bankkonten<br />
bei schweizerischen Banken.<br />
Zentralstelle für jüdische Auswanderung<br />
Die in Wien im August 1938 unter<br />
der Leitung ➤ Adolf Eichmanns errichtete<br />
„Zentralstelle für jüdische<br />
Auswanderung“ organisierte die systematische<br />
Vertreibung der jüdischen<br />
Bevölkerung. Über die Forcierung<br />
der Auswanderung sollte<br />
gleichzeitig die Enteignung der auswandernden<br />
Juden und Jüdinnen<br />
vollzogen werden. Unter totalem<br />
Vermögensverzicht zugunsten des<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
„Reiches“ sollten vermögenden Juden<br />
und Jüdinnen Einreisemöglichkeiten<br />
in überseeische Staaten verschafft<br />
werden. 5 bis 10% des enteigneten<br />
Vermögens wurden in einem<br />
Auswanderungsfonds gesammelt,<br />
aus dem die Auswanderung<br />
mittelloser Juden und Jüdinnen finanziert<br />
werden sollte. Nach dem<br />
am 31. Juli 1941 verhängten Auswanderungsverbot<br />
war die Zentralstelle<br />
für Deportationen in ➤ Vernichtungslager<br />
zuständig. Aus dem<br />
bis 1941 eingenommenen Vermögen,<br />
das zur weiteren Finanzierung<br />
der Auswanderung mittelloser Juden<br />
und Jüdinnen vorgesehen war, wurden<br />
nun die Kosten für ihren Abtransport<br />
bestritten.<br />
Zwei-Plus-Vier-Vertrag<br />
Der am 12. Sep. 1990 in Moskau von<br />
den Außenministern der Bundesrepublik<br />
Deutschland, der Deutschen<br />
Demokratischen Republik, Frankreichs,<br />
Großbritanniens, der Sowjetunion<br />
und der USA unterzeichnete<br />
„Vertrag über die abschließende<br />
Regelung in bezug auf Deutschland“<br />
regelt die Wiedervereinigung Deutschlands,<br />
seine Grenzen, die Größe der<br />
Bundeswehr, den Abzug der sowjetischen<br />
Streitkräfte und die Bündniszugehörigkeit.<br />
Das ursprüngliche Ziel,<br />
das auch im ➤ Londoner Schuldenabkommen<br />
von 1953 angekündigt<br />
worden war, nämlich ein Friedensvertrag,<br />
wurde mit dem Zwei-Plus-<br />
Vier-Vertrag nicht erreicht. Daher<br />
wurde auch die Frage der Reparationszahlungen<br />
und der Entschädigungen<br />
für Zwangsarbeit, die für die<br />
deutsche Bundesregierung Teil von<br />
Reparationszahlungen wären, nicht<br />
endgültig geregelt.<br />
Das Glossar wurde teilweise unter<br />
Bezugnahme auf folgende Nachschlage- und<br />
Standardwerke erstellt: Wolfgang Benz/<br />
Hermann Graml/Hermann Weiß (<strong>Hrsg</strong>.):<br />
Enzyklopädie des Nationalsozialismus, DTV,<br />
München 1998, 2. Aufl.; Brockhaus-Enzyklopädie<br />
in 24 Bänden, Mannheim 1990, 19. völlig<br />
neubearb. Aufl.; Israel Gutman/Eberhard<br />
Jäckel/Peter Longerich/Julius H. Schoeps<br />
(<strong>Hrsg</strong>.): Enzyklopädie des Holocaust.<br />
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen<br />
Juden, Piper Verlag, München 1998,<br />
2. Aufl.; Raul Hilberg: Die Vernichtung der<br />
europäischen Juden, Fischer TB Verlag,<br />
Frankfurt/M. 1990; Österreich-Lexikon in<br />
2 Bänden, hrsg. v. Richard u. Maria Bamberger/<br />
Ernst Bruckmüller/Karl Gutkas/Christian<br />
Brandstätter Verlag, Wien 1995.<br />
177<br />
Glossar
Zeittafel<br />
Wichtige Gesetze und Entwicklungen im<br />
Bereich der Rückstellung und Entschädigung<br />
Mai 1945<br />
Einrichtung des Bundesministeriums<br />
für Vermögenssicherung und<br />
Wirtschaftsplanung<br />
Ab Mai 1945<br />
Einsetzung von Fürsorgekommissionen,<br />
die die Fürsorge für<br />
Kriegs- und KZ-HeimkehrerInnen<br />
übernehmen.<br />
8. Mai 1945<br />
Verbotsgesetz: Verbot der NSDAP<br />
und ihrer Wehrverbände. Das Vermögen<br />
der NSDAP-Organisation<br />
fällt an Österreich<br />
10. Mai 1945<br />
Gesetz über die Erfassung<br />
➤ arisierter und anderer im Zusammenhang<br />
mit der nationalsozialistischen<br />
Machtübernahme<br />
entzogener Vermögenschaften<br />
Mai 1945<br />
Gesetz über die Bestellung von<br />
öffentlichen Verwaltern und<br />
öffentlichen Aufsichtspersonen<br />
26. Juni 1945<br />
Kriegsverbrechergesetz:<br />
Bestrafung von Taten wider die<br />
Menschlichkeit, das Kriegs- und<br />
Völkerrecht bei Einziehung des<br />
gesamten Vermögens im Falle<br />
einer Verurteilung<br />
17. Juli 1945<br />
➤ Gesetz über die Fürsorge für<br />
die Opfer des Kampfes um ein<br />
freies, demokratisches Österreich<br />
(1. Opferfürsorgegesetz), aufgrund<br />
dieses Gesetzes Gründung<br />
eigener Betreuungs- und Unterbringungsstellen<br />
der MA X/1<br />
(Amt für Wohlfahrtspflege, ab<br />
1946: ➤ MA 12) für HeimkehrerInnen<br />
aus Konzentrationslagern<br />
1. September 1945<br />
Wohnungsanforderungsgesetz<br />
15. Mai 1946<br />
Bundesgesetz (BG) über die<br />
Nichtigkeit von Rechtsgeschäften<br />
und sonstigen Rechtshandlungen,<br />
die während der deutschen Besetzung<br />
Österreichs erfolgt sind<br />
16. Mai 1946<br />
Gemeinderatsbeschluss über die<br />
Neuorganisation der Fürsorgeämter:<br />
Jeder Gemeindebezirk<br />
erhält ein eigenes Fürsorgeamt<br />
26. Juli 1946<br />
BG über die ➤ Rückstellung<br />
entzogener Vermögen, die sich<br />
in Verwaltung des Bundes oder<br />
der Bundesländer befinden<br />
(1. Rückstellungsgesetz)<br />
6. Februar 1947<br />
BG über die Rückstellung<br />
entzogener Vermögen, die<br />
sich im Eigentum der Republik<br />
Österreich befinden<br />
(2. Rückstellungsgesetz)<br />
6. Februar 1947<br />
BG über die Nichtigkeit von<br />
Vermögensentziehungen<br />
(3. Rückstellungsgesetz)<br />
21. Mai 1947<br />
BG betreffend die unter nationalsozialistischem<br />
Zwang geänderten<br />
oder gelöschten Firmennamen<br />
(4. Rückstellungsgesetz)<br />
20. August 1947<br />
Im Wiener Wohnungsamt<br />
(➤ MA 52) wird ein Wiedergutmachungsreferat<br />
eingerichtet<br />
September 1947<br />
2. Opferfürsorgegesetz<br />
22. Juni 1949<br />
BG über die Rückstellung entzogenen<br />
Vermögens juristischer<br />
Personen des Wirtschaftslebens,<br />
die ihre Rechtspersönlichkeit<br />
unter nationalsozialistischem<br />
Zwang verloren haben<br />
(5. Rückstellungsgesetz)<br />
30. Juni 1949<br />
BG über die Rückstellung<br />
gewerblicher Schutzrechte<br />
(6. Rückstellungsgesetz)<br />
14. Juli 1949<br />
BG über die Geltendmachung<br />
entzogener oder nicht<br />
erfüllter Ansprüche aus<br />
Dienstverhältnissen in der<br />
Privatwirtschaft (7. Rückstellungsgesetz)<br />
10. September 1952<br />
Luxemburger Abkommen<br />
zwischen der Bundesrepublik<br />
Deutschland und Israel<br />
Ende Juni 1953<br />
Beginn der Verhandlungen<br />
zwischen dem ➤ Claims<br />
Committee und der österreichischen<br />
Bundesregierung über<br />
Entschädigungszahlungen<br />
29. Juni 1956<br />
➤ Bundesentschädigungsgesetz<br />
der Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
13. März 1957<br />
Gesetz über die Schaffung von<br />
Auffangorganisationen<br />
(Sammelstellen) gemäß Artikel<br />
26 § 2 des Staatsvertrages<br />
178 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
14. März 1957<br />
Generalamnestie für ehemalige<br />
NationalsozialistInnen<br />
25. Juni 1958<br />
Bundesgesetz über die Gewährung<br />
von Entschädigungen für durch<br />
Kriegseinwirkung oder durch<br />
politische Verfolgung erlittene<br />
Schäden an Hausrat und an zur<br />
Berufsausübung erforderlichen<br />
Gegenständen (Kriegs- und<br />
Verfolgungssachschädengesetz –<br />
KVSG)<br />
26. Juni 1958<br />
Versicherungsentschädigungsgesetz<br />
betreffend die Regelung<br />
vom Deutschen Reiche eingezogener<br />
Ansprüche aus Lebensversicherungen<br />
22. März 1961<br />
Bundesgesetz, womit Bundesmittel<br />
zur <strong>Bildung</strong> eines Fonds<br />
zur Abgeltung von Vermögensverlusten<br />
politisch Verfolgter<br />
zur Verfügung gestellt werden<br />
(Abgeltungsfondsgesetz)<br />
22. März 1961<br />
➤ 12. Novelle zum<br />
Opferfürsorgegesetz<br />
Juni 1961<br />
➤ Kreuznacher Abkommen<br />
zwischen der Republik Österreich<br />
und der Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
5. April 1962<br />
Gesetz über die Aufteilung der<br />
Mittel der ➤ „Sammelstellen“<br />
27. Juni 1969<br />
1. Kunst- und Kulturbereinigungsgesetz<br />
über die<br />
Bereinigung der Eigentumsverhältnisse<br />
des im Gewahrsam<br />
des Bundesdenkmalamtes befindlichen<br />
Kunst- und Kulturgutes<br />
13. Dezember 1985<br />
2. Kunst- und Kulturbereinigungsgesetz<br />
über die Herausgabe<br />
und Verwertung ehemals<br />
herrenlosen Kunst- und Kulturgutes,<br />
das sich im Eigentum des<br />
Bundes befindet<br />
1. Juni 1995<br />
Bundesgesetz zur Einrichtung<br />
des ➤ Nationalfonds der Republik<br />
Österreich für die Opfer des<br />
Nationalsozialismus<br />
Ende Oktober 1996<br />
Die Versteigerung der Sammlung<br />
Mauerbach bringt 122 Mio. Schil-<br />
ling Nettoerlös, der in einen<br />
Fonds zur Entschädigung von<br />
sozial bedürftigen NS-Opfern<br />
und deren Hinterbliebenen<br />
fließt<br />
30. November – 2. Dezember 1997<br />
➤ Londoner „Raubgold-Konferenz“<br />
über die Herkunft und<br />
den Verbleib des „Nazi-Raubgoldes“<br />
und den Umfang der<br />
bisher erfolgten Rückstellung<br />
Ende Dezember 1997/<br />
Anfang Jänner 1998<br />
Bei einer Ausstellung der Sammlung<br />
Leopold in New York<br />
werden zwei Schiele-Bilder<br />
unter dem Verdacht auf Raubkunst<br />
beschlagnahmt<br />
Mitte Jänner 1998<br />
Elisabeth Gehrer, Bundesministerin<br />
für Unterricht und kulturelle<br />
Angelegenheiten und zuständig<br />
für fast alle Bundesmuseen sowie<br />
das Denkmalamt, erteilt die<br />
mündliche Weisung, sämtliche<br />
Materialien über die Nazi- und<br />
Nachkriegszeit zu sichten. Beschluß<br />
der <strong>Bildung</strong> einer Kommission<br />
für Provenienzforschung<br />
13. März 1998<br />
Erste Sitzung der Kommission für<br />
Provenienzforschung<br />
März 1998<br />
Die österreichische P.S.K. beauftragt<br />
ein Historikerteam, den<br />
Vermögensentzug jüdischer<br />
KundInnen im „Postsparkassenamt“<br />
zu untersuchen<br />
August 1998<br />
Der US-Anwalt Ed Fagan kündigt<br />
mögliche Sammelklagen gegen<br />
österreichische Banken an<br />
29. September 1998<br />
Beschluss der Einsetzung einer<br />
Historikerkommission, die den<br />
Vermögensentzug und Vermögensvorenthalt<br />
auf dem Gebiet<br />
der Republik Österreich zwischen<br />
1938 und 1945 und die Rückstellungs-<br />
und Entschädigungspraxis<br />
der Zweiten Republik untersuchen<br />
soll<br />
30. September 1998<br />
Die „Vereinigung der durch das<br />
Dritte Reich geschädigten Polen“<br />
fordert von Österreich eine Entschädigung<br />
für die ehemaligen<br />
polnischen ZwangsarbeiterInnen<br />
in der „Ostmark“<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Oktober 1998<br />
Ed Fagan kündigt eine Sammelklage<br />
ehemaliger ZwangsarbeiterInnen<br />
gegen die VOEST Alpine<br />
Stahl und gegen Steyr-Daimler-<br />
Puch an<br />
November 1998<br />
Die VOEST-Alpine Stahl (VA Stahl)<br />
beauftragt ein Forschungsteam<br />
mit der Untersuchung der<br />
Zwangsarbeits-Problematik und<br />
der Unternehmensgeschichte<br />
während der NS-Zeit<br />
30. November – 2. Dezember 1998<br />
➤ Washingtoner Konferenz über<br />
„Vermögenswerte aus der Ära<br />
des Holocaust“ beschließt elf<br />
Prinzipien zur Rückstellung von<br />
Raubkunst<br />
4. Dezember 1998<br />
Bundesgesetz über die Rückgabe<br />
von Kunstgegenständen aus den<br />
österreichischen Bundesmuseen<br />
und Sammlungen<br />
9. Dezember 1998<br />
Einrichtung eines Rückgabe-<br />
Beirats für Kunstgegenstände,<br />
der nichtrückgestellte Objekte an<br />
die rechtmäßigen BesitzerInnen<br />
rückstellen soll<br />
20. Mai 1999<br />
Der Gemeinderat der Stadt Wien<br />
beschließt die Einrichtung einer<br />
eigenen Kommission, die über die<br />
Rückgabe von „arisierten“ und<br />
heute im Besitz der Stadt befindlichen<br />
Kunst- und Kulturgegenständen<br />
beraten soll<br />
1. Juli 1999<br />
Der Bundesverband der Israelitischen<br />
Kultusgemeinden<br />
Österreichs richtet eine Anlaufstelle<br />
für jüdische Opfer des<br />
Nationalsozialismus und deren<br />
Angehörige ein. Geplant ist<br />
die Erfassung geraubten und<br />
entzogenen Vermögens in einer<br />
Datenbank<br />
Juli 1999<br />
Versteigerung der aus österreichischen<br />
Bundesmuseen<br />
rückgestellten Gegenstände<br />
der Sammlung Rothschild in<br />
London<br />
179<br />
Zeittafel
Literatur zum Thema<br />
Alfred Ableitinger/Siegfried Beer/Eduard G.<br />
Staudinger (<strong>Hrsg</strong>.), Österreich unter alliierter Besatzung<br />
1945–1955, Böhlau Verlag, Wien 1998<br />
Thomas Albrich, Brichah. Fluchtwege durch<br />
Österreich, Campus Verlag, Frankfurt/M. 1997<br />
Gabriele Anderl/Hubertus Czernin,<br />
Das veruntreute Erbe. Der Kunstraub der Zweiten<br />
Republik, Molden Verlag, Wien 1998<br />
Gabriele Anderl/Walter Manoschek,<br />
Gescheiterte Flucht. Der jüdische „Kladovo-Transport”<br />
auf dem Weg nach Palästina 1939–1942,<br />
Döcker Verlag, Wien 1993<br />
Wolfgang Ayass, „Asoziale” im Nationalsozialismus,<br />
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1995<br />
Avraham Barkai, Das Wirtschaftssystem des<br />
Nationalsozialismus, Fischer TB Verlag,<br />
Frankfurt/M. 1998<br />
Peter Böhmer, Wer konnte, griff zu. „Arisierte”<br />
Güter und NS-Vermögen im Krauland-Ministerium<br />
(1945–1949), Böhlau Verlag, Wien 1999<br />
Hubertus Czernin, Die Auslöschung.<br />
Der Fall Thorsch, Molden Verlag, Wien 1998<br />
Fallstudie der Enteignung des Bankhauses Thorsch<br />
Matthias Dahl, Endstation Spiegelgrund.<br />
Die Tötung behinderter Kinder während des Nationalsozialismus<br />
am Beispiel einer Kinderfachabteilung in<br />
Wien 1940–1945, Edition Erasmus, Wien 1998<br />
Dokumentationsarchiv des österreichischen<br />
Widerstandes (<strong>Hrsg</strong>.), Erzählte Geschichte.<br />
Berichte von Männern und Frauen in Widerstand und<br />
Verfolgung, Österreichischer Bundesverlag, Wien,<br />
Band 1: Arbeiterbewegung, 1985, Band 2:<br />
Katholiken, Konservative, Legitimisten, 1992,<br />
Band 3: Jüdische Schicksale. Berichte von Verfolgten,<br />
1992<br />
Helga Embacher/Margit Reiter, Gratwanderungen.<br />
Die Beziehungen zwischen Österreich und Israel im<br />
Schatten der Vergangenheit, Picus Verlag,<br />
Wien 1998<br />
Helga und Hermann Fischer-Hübner, Die Kehrseite<br />
der „Wiedergutmachung”. Das Leiden von NS-<br />
Verfolgten in den Entschädigungsverfahren,<br />
Bleicher Verlag, Gerlingen 1990<br />
Hans Frankenthal, Verweigerte Rückkehr.<br />
Erfahrungen nach dem Judenmord, Fischer TB Verlag,<br />
Frankfurt/M. 1999<br />
Erinnerungen eines ehemaligen jüdischen Zwangsarbeiters<br />
an Verfolgung und Nachkriegszeit in<br />
Deutschland<br />
Florian Freund, Arbeitslager Zement.<br />
Das Konzentrationslager Ebensee und die<br />
Raketenrüstung, Döcker Verlag, Wien 1991,<br />
2. Aufl.<br />
Florian Freund/Bertrand Perz: Das KZ in der<br />
Serbenhalle. Zur Kriegsindustrie in Wiener Neustadt,<br />
Döcker Verlag, Wien 1988<br />
Grüner Parlamentsklub (<strong>Hrsg</strong>.), Die wirtschaftlichen<br />
Schäden der jüdischen Bevölkerung während des<br />
Nationalsozialismus, erscheint voraussichtlich im<br />
Herbst 1999<br />
Alois Kaufmann, Spiegelgrund Pavillon 18. Ein Kind<br />
im NS-Erziehungsheim, Döcker Verlag, Wien 1993<br />
Ernst Klee, „Euthanasie” im NS-Staat.<br />
Die Vernichtung „lebensunwerten” Lebens,<br />
Fischer TB Verlag, Frankfurt/M. 1997<br />
180 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Robert Knight (<strong>Hrsg</strong>.), „Ich bin dafür, die Sache in<br />
die Länge zu ziehen”. Wortprotokolle der<br />
österreichischen Bundesregierung von 1945-1952<br />
über die Entschädigung der Juden, Athenäum Verlag,<br />
Frankfurt/M. 1988, vergriffen; erscheint voraussichtlich<br />
im Herbst 1999 als korrigierte Neuauflage<br />
im Böhlau Verlag, Wien<br />
Walter Kohl, Die Pyramiden von Hartheim.<br />
„Euthanasie” in Oberösterreich, Edition der Heimat,<br />
Grünbach 1997<br />
Wolfgang Kos (<strong>Hrsg</strong>.), Inventur 45/55.<br />
Österreich im ersten Jahrzehnt der Zweiten Republik,<br />
Sonderzahl Verlag, Wien 1996<br />
Jonny Moser, Demographie der jüdischen<br />
Bevölkerung Österreichs 1938–1945, DÖW,<br />
Wien 1999<br />
Christine Oertel, Juden auf der Flucht durch Austria.<br />
Jüdische Displaced Persons in der US-Besatzungszone<br />
Österreichs, Eichbauer Verlag, Wien 1999<br />
Bertrand Perz, Projekt Quarz. Steyr-Daimler-Puch<br />
und das Konzentrationslager Melk, Döcker Verlag,<br />
Wien 1991<br />
Romani Rose (<strong>Hrsg</strong>.), „Den Rauch hatten wir täglich<br />
vor Augen”. Der nationalsozialistische Völkermord<br />
an den Sinti und Roma, Wunderhorn Verlag,<br />
Heidelberg 1998<br />
Margarethe Ruff, Um ihre Jugend betrogen.<br />
Ukrainische Zwangsarbeiter/innen in Vorarlberg<br />
1942-1945, Vorarlberger Autoren Gesellschaft,<br />
Bregenz 1997, 2. aktual. Aufl.<br />
Claudia Schoppmann, Verbotene Verhältnisse.<br />
Frauenliebe 1938–1945, Querverlag,<br />
Berlin 1999<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999<br />
Margarete Schütte-Lihotzky, Erinnerungen aus<br />
dem Widerstand. Das kämpferische Leben einer<br />
Architektin von 1938–1945, Promedia Verlag,<br />
Wien, Neuauflage 1998<br />
Friedrich Stadler/Peter Weibel (<strong>Hrsg</strong>.), Vertreibung<br />
der Vernunft. The Cultural Exodus from Austria,<br />
Springer Verlag, Wien/New York 1995,<br />
2. erweiterte Aufl.<br />
Ingrid Strobl, Die Angst kam erst danach.<br />
Jüdische Frauen im Widerstand 1939–1945,<br />
Fischer TB, Frankfurt/M. 1998<br />
Ingrid Strobl, „Sag nie, du gehst den letzten Weg”.<br />
Frauen im bewaffneten Widerstand gegen<br />
Faschismus und deutsche Besatzung,<br />
Fischer TB Verlag, Frankfurt/M. 1995<br />
Szabolcs Szita, Verschleppt, verhungert, vernichtet.<br />
Die Deportation von ungarischen Juden auf das<br />
Gebiet des annektierten Österreich 1944–1945,<br />
Eichbauer Verlag, Wien 1999<br />
Emmerich Tálos/Wolfgang Neugebauer/Ernst<br />
Hanisch (<strong>Hrsg</strong>.), NS-Herrschaft in Österreich 1938–<br />
1945, Verlag für Gesellschaftskritik,<br />
Wien 1988, vergriffen; eine völlig überarbeitete und<br />
erweiterte Neuauflage erscheint voraussichtlich im<br />
Frühjahr 2000<br />
Wolfgang Wippermann, Wie die Zigeuner.<br />
Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich,<br />
Verlag Elefanten Press, Berlin 1997<br />
Leon Zelman, Ein Leben nach dem Überleben,<br />
aufgezeichnet von Armin Thurnher,<br />
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1995<br />
181
Internet-Adressen<br />
www.derstandard.at<br />
Im Standard-Archiv findet man unter den Stichworten<br />
„Rückstellung“, „Raubkunst“ u. a. aktuelle Informationen<br />
und Artikelserien z.B. zum NS-Kunstraub.<br />
www.nzz.ch/online/02-dossiers<br />
Die Dossiers der Neuen Zürcher Zeitung bieten<br />
eingehende Informationen über die Einsetzung und<br />
Arbeit der Bergier-Kommission, die Schweiz im<br />
Zweiten Weltkrieg etc.<br />
www.historikerkommission.gv.at<br />
Die Homepage der Österreichischen Historikerkommission<br />
informiert über das Arbeitsprogramm der<br />
Kommission, über die Mitglieder der Kommission und<br />
den aktuellen Tätigkeitsstand.<br />
www.uek.ch<br />
Auf der Homepage der „Unabhängigen Expertenkommission<br />
Schweiz – Zweiter Weltkrieg“ können<br />
Informationen zum Arbeitsprogramm, den Mitgliedern<br />
und die ersten Zwischenberichte abgerufen<br />
werden.<br />
www.wiesenthal.com<br />
Die Homepage des Simon Wiesenthal Centers in<br />
Los Angeles bietet u.a. eine Online-Tour durch das<br />
Museum der Toleranz in L.A. und ein Multimedia<br />
Learning Center mit Zeitungsartikeln, Bibliographien,<br />
Glossar und einer Liste grundsätzlicher Fragen zum<br />
Holocaust (in Englisch). Außerdem steht ein umfangreiches<br />
Online-Archiv von Originaldokumenten<br />
aus der NS-Zeit zur Verfügung.<br />
www.ushmm.org<br />
Das Holocaust Memorial Museum bietet eine<br />
Lernseite zum Thema Holocaust mit Begriffserklärungen<br />
und gibt Informationen zu den aktuellen Tätigkeiten<br />
mehrerer Dutzend Länder, darunter Österreich,<br />
bezüglich der Frage geraubter Vermögen von<br />
Holocaust-Opfern.<br />
www.state.gov/www/regions/eur/holocaust/<br />
hcac.html<br />
Dokumentiert den Verlauf der Washingtoner<br />
Konferenz über die „Vermögen der Holocaust-Ära“<br />
mit Länderberichten, Entschließungen u.a.<br />
user.berlin.de/˜berliner.geschichtswerkstatt<br />
Die Homepage eines Projekts über Zwangsarbeit in<br />
Deutschland bietet Literaturhinweise, ein Archiv<br />
von Biographien ehemaliger ZwangsarbeiterInnen,<br />
einen Pressespiegel zum Thema Entschädigung<br />
für Zwangsarbeit und Links zu zahlreichen Gedenkstätten<br />
in Deutschland.<br />
www.psk.co.at/report<br />
Auf der Homepage der P.S.K. ist der erste<br />
Zwischenbericht des Projekts zur Erfassung der<br />
Vermögenswerte jüdischer KlientInnen der<br />
österreichischen Postsparkasse abrufbar.<br />
www.hagalil.com<br />
Nachrichten aktuell – Judentum in Mitteleuropa.<br />
Bietet Hinweise auf kulturelle Veranstaltungen,<br />
Links zu aktuellen Zeitungsberichten und<br />
Berichte aus einzelnen Ländern, darunter aus<br />
Österreich.<br />
members.vienna.at/kreisky/naziartloot<br />
Auf der Homepage des Kreisky-Archivs kann<br />
man einen Artikel zum „NS-Kunstraub in Österreich“<br />
und eine Liste von während der NS-Zeit enteigneten<br />
Kunstobjekten abrufen, die bis heute verschollen<br />
sind.<br />
www.gruene.at<br />
Unter dem Stichwort „Kunstraub“ kann man die<br />
parlamentarische Anfrage der Grünen zur Herkunft<br />
von 241 enteigneten Kunstobjekten, die sich<br />
im Besitz der Österreichischen Bundesmuseen<br />
befinden, abrufen, und deren Beantwortung durch<br />
Bundesministerin Gehrer.<br />
182 <strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong><br />
Nr. 1 Osteuropa im Wandel (vergriffen)<br />
Nr. 2 Flucht und Migration<br />
Die neue Völkerwanderung (vergriffen)<br />
Nr. 3 Wir und die anderen<br />
Zur Konstruktion von Nation und Identität (vergriffen)<br />
Nr. 4 EG-Europa<br />
Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge, 1992<br />
Nr. 5 Mehr Europa?<br />
Zwischen Integration und Renationalisierung, 1993<br />
Nr. 6 Veränderung im Osten<br />
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 1993<br />
Nr. 7 Demokratie in der Krise?<br />
Zum politischen System Österreichs, 1994<br />
Nr. 8 ARBEITS-LOS<br />
Veränderungen und Probleme in der Arbeitswelt,1994<br />
Nr. 9 Jugend heute<br />
Politikverständnis, Werthaltungen, Lebensrealitäten, 1995<br />
Nr. 10 <strong>Politische</strong> Macht und Kontrolle. 1995/96<br />
Nr. 11 Politik und Ökonomie<br />
Wirtschaftspolitische Handlungsspielräume Österreichs, 1996<br />
Nr. 12 <strong>Bildung</strong> – ein Wert?<br />
Österreich im internationalen Vergleich, 1997<br />
Nr. 13 Institutionen im Wandel 1997<br />
Sonderband Wendepunkte und Kontinuitäten<br />
Zäsuren der demokratischen Entwicklung in der österreichischen Geschichte<br />
Nr. 14 Sozialpolitik im internationalen Vergleich 1998<br />
Nr. 15 EU wird Europa?<br />
Erweiterung – Vertiefung – Verfestigung 1998<br />
Sonderband Justiz – Recht – Staat 1999<br />
Sonderband Wieder gut machen?<br />
Enteignung, Zwangsarbeit, Entschädigung und Restitution 1999<br />
Thema des nächsten Heftes<br />
Nr. 16 Politik und neue Medien<br />
Bestelladresse<br />
➤ StudienVerlag<br />
Amraser Straße 118, Postfach 104,<br />
A-6010 Innsbruck<br />
Tel.: 0512/39 50 45, Fax: 0512/39 50 45-15,<br />
E-Mail: Studienverlag@magnet.at<br />
➤ Bestelladresse für LehrerInnen<br />
(mit Schulstempel):<br />
BMUK, Abteilung <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong><br />
Minoritenplatz 5<br />
A-1014 Wien<br />
<strong>Forum</strong> <strong>Politische</strong> <strong>Bildung</strong> (Hg.): „Wieder gut machen?“ Enteignung, Zwangsarbeit,<br />
Entschädigung, Restitution. Österreich 1938–1945/1945–1999<br />
Sonderband der Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>, Innsbruck–Wien–Bozen 1999
WIEDER<br />
GUT<br />
MACHEN?<br />
STUDIENVerlag<br />
Innsbruck-Wien<br />
ISBN 3-7065-1404-4<br />
ENTEIGNUNG<br />
ZWANGSARBEIT<br />
DIE VERGESSENEN OPFER<br />
RÜCKSTELLUNG UND ENTSCHÄDIGUNG<br />
HISTORIKERKOMMISSION<br />
GLOSSAR<br />
ZEITTAFEL<br />
LITERATUR ZUM THEMA<br />
INTERNET-ADRESSEN ZUM THEMA<br />
forumpolitischebildung (Hg.) Sonderband der Schriftenreihe Informationen zur <strong>Politische</strong>n <strong>Bildung</strong>