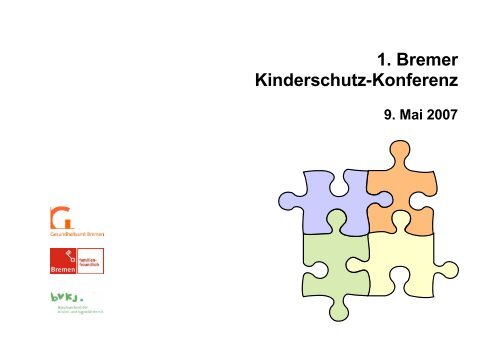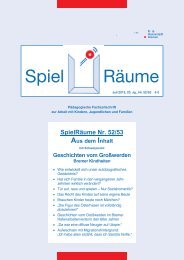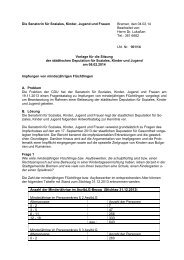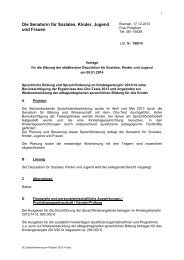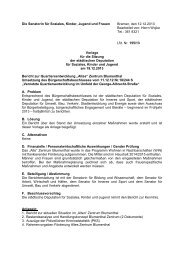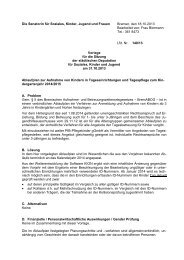Dokumentation zur 1. Bremer Kinderschutzkonferenz 2007
Dokumentation zur 1. Bremer Kinderschutzkonferenz 2007
Dokumentation zur 1. Bremer Kinderschutzkonferenz 2007
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong><br />
Kinderschutz-Konferenz<br />
9. Mai <strong>2007</strong>
Impressum<br />
Veranstalter/Herausgeber:<br />
Freies Hansestadt Bremen<br />
Amt für Soziale Dienste Bremen in Kooperation mit<br />
dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales,<br />
dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Bremen e. V. und<br />
dem Gesundheitsamt Bremen<br />
Anschrift:<br />
Amt für Soziale Dienste<br />
Abt. Junge Menschen / Herbert Holakovsky<br />
Contrescarpe 73 / 28195 Bremen<br />
E-Mail: Herbert.Holakovsky@afsd.bremen.de<br />
Vorankündigung:<br />
2. <strong>Bremer</strong> Kinderschutz-Konferenz<br />
Mittwoch, 14. November <strong>2007</strong><br />
12:00 bis 18:00 Uhr<br />
im Haus der Bürgerschaft
Inhalt<br />
S. 2 Vorwort<br />
Barbara Hellbach (Referatsleiterin Erziehungs- und Eingliederungshilfen bei der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales)<br />
S. 4 Tagungsprogramm<br />
S. 5 Grußworte<br />
Ingelore Rosenkötter (Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales)<br />
Dr. med. Stefan Trapp (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Bremen e.V.)<br />
Frank Nerz (Stellv. Leiter des Amtes für Soziale Dienste Bremen AfSD)<br />
S. 10 Dr. med. Eberhard Motzkau (Ärztliche Kinderschutzambulanz am Ev. Krankenhaus Düsseldorf)<br />
Vernachlässigung und Missbrauch an Kindern wahrnehmen und erkennen<br />
S. 19 Dr. med. Hans-Iko Huppertz (Prof. Hess Kinderklinik, Bremen)<br />
Praktischer Kinderschutz aus Sicht der <strong>Bremer</strong> Kinderärzte<br />
S. 27 Dr. med. Heidrun Gitter (Klinikum Bremen-Mitte)<br />
Kinderchirurgie - Wie kann ich Kindesvernachlässigung erkennen?<br />
S. 36 Prof. Dr. med. Eberhard Schulz (Uni-Klinik Freiburg, Ärztlicher Direktor der Abt. für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter)<br />
Früherkennung - Frühzeitiges Erkennen von Risiken der sozialen Entwicklung<br />
S. 37 Prof. Dr. Dr. hc. Reinhard Wiesner (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ)<br />
Kinderschutz und Jugendhilfe<br />
S. 45 Kerstin Reiners (Sozial-Zentrum Mitte/Östliche Vorstadt/Findorff, Bremen)<br />
Ambulanter Sozialdienst - Beispiele der Fallbearbeitung<br />
S. 47 Sabine Heinke (Amtsgericht Bremen, Familiengericht)<br />
Kinderschutz aus Sicht des Familiengerichts / Anlage: Sorgerechtsentziehungsbeschluss<br />
S. 57 Prof. Dr. Ekke Dahle (Fachbereichssprecher Polizeivollzugsdienst, Fachgebiet: Kriminalwissenschaften/Schwerpunkte Strafrecht und Kriminologie)<br />
Kindeswohlgefährdung aus Sicht der Polizei<br />
S. 61 Thomas Kothe (Polizeioberkommissar, Kontaktpolizist Bremen Kattenturm)<br />
Fallbeispiele sozial-familiärer Notlagen aus Sicht der Polizei<br />
S. 65 Eberhard Zimmermann (Leiter der Sozialpädiatrischen Abteilung, Gesundheitsamt Bremen)<br />
'Gesund ins Leben' - Präventive Gesundheitssicherung von Risikofamilien durch das Gesundheitsamt<br />
S. 74 Herbert Holakovsky (Referatsleiter Erzieherische Hilfen im Amt für Soziale Dienste Bremen)<br />
Kinderschutz aus Sicht des Amtes für Soziale Dienste<br />
S. 77 Teilnehmer/innen-Liste<br />
<strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong> Mai <strong>2007</strong> 1
Barbara Hellbach<br />
Referatsleiterin Erziehungs- und Eingliederungshilfen bei der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales<br />
E-Mail: Barbara.Hellbach@soziales.bremen.de Tel.: (0421) 361-6727<br />
<strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
Gemeinsam auf dem Weg zu einer gelingenden Interdisziplinären Zusammenarbeit im Kinderschutz<br />
Die Forderung nach einer qualitativ verbesserten und verbindlichen<br />
interdisziplinären, einrichtungs- und hilfesystemübergreifenden Zusammenarbeit<br />
im Kinderschutz ist ein Fachstandard, über dessen<br />
fachpolitische Reklamation wir uns in gemeinsamen Veranstaltungen<br />
wie dieser <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong> schnell einig sind.<br />
Die Realität: Es gibt einerseits langjährige gute und tragfähige Kooperationsnetzwerke.<br />
Die Praxis der Zusammenarbeit stellt jedoch andererseits<br />
alle Beteiligten in Jugend-, Gesundheitshilfe, Schule, Polizei,<br />
Justiz, bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und bei anderen<br />
Kooperationspartnern vor deutliche Herausforderungen, oft auch vor<br />
Überforderung und Hilflosigkeit:<br />
• wer macht was,<br />
• wer ist zuständig und wie weit,<br />
• wer trägt welche Verantwortung,<br />
• wie finden wir gemeinsame Deutungen und Gefährdungseinschätzungen,<br />
• wie hoch setzen wir Interventionsschwellen an,<br />
• wo ist Datenschutz ein Hindernis bei der gemeinsamen Problembewältigung,<br />
• wo ist er unabdingbar notwendig, um überhaupt Zugang zu Familien<br />
zu finden und Vertrauen herzustellen,<br />
• wann darf und wann muss gehandelt werden,<br />
• wann steht Kinderschutz unabweisbar vor elterlichen Rechten und<br />
Pflichten,<br />
• wann bestehen (noch) oder wieder Chancen für eine (Re-) Stabilisierung<br />
oder erstmalige Herstellung elterlicher Erziehungskompetenz<br />
und Sorgerechtsfähigkeit.<br />
Die Entwicklung gemeinsamer Sichtweisen und Deutungsmuster zu<br />
Interventionsschwellen, das Herstellen einvernehmlicher Fachstandards<br />
zu Fragen fachlicher Kompetenz, das Herstellen einer verlässlichen<br />
Kooperationsstruktur und abgestimmter Verfahren, der Aufbau<br />
einer tragfähigen Vertrauenskultur wie das dazu erforderliche Wachsen<br />
wechselseitiger fachlicher und persönlicher Wertschätzung über<br />
professionelle Grenzen hinweg gelingt bei unterschiedlichen Rollen<br />
und Funktionen nicht quasi automatisch, sondern ist unstrittig gemeinsame<br />
Zielsetzung und Aufgabe, aber auch eine personelle Ressourcen<br />
bindende Netzwerkarbeit.<br />
Die <strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong> hat bei allen unseren Kooperationspartnern<br />
eine hohe Resonanz gefunden und damit einen wichtigen<br />
Auftakt geleistet zu dem, was ein tragfähiges "<strong>Bremer</strong> Bündnis für<br />
Kinderschutz und frühe Prävention" zukünftig leisten soll.<br />
Ein gemeinsames lokales Netzwerk erfordert wechselseitigen Wissens-<br />
und Kompetenztransfer <strong>zur</strong> besseren Diagnostik und Hilfepla-
nung wie auch <strong>zur</strong> Qualitätssicherung und Qualitätsweiterentwicklung<br />
von Hilfen, <strong>zur</strong> fachlichen Standardisierung und Anwendung von Hilfen,<br />
Programmen und Maßnahmen auf dem Stand neuester fachwissenschaftlicher<br />
Kenntnisse, Methoden und rechtlicher Rahmenbedingungen<br />
gemeinsamen Handelns, d.h. unter idealtypischen Gelingensbedingungen.<br />
Es erfordert ebenso die gemeinsame kritische wie kreativ-konstruktive<br />
Reflexion realer Fallverläufe unter konkreten Handlungsmöglichkeiten<br />
unter echten alltäglichen Arbeitsbedingungen.<br />
Die Tagung hat beides in den Fokus der Diskussion gestellt und daher<br />
in besonderer Weise dazu beigetragen, Fachwissen zu aktualisieren<br />
und interdisziplinär zu erweitern, ohne von der notwendigerweise oft<br />
pragmatisch geprägten Alltagspraxis abzuheben. Ich betrachte dies als<br />
ein gutes Ergebnis und eine gute Basis für eine zukünftig noch besser<br />
gelingende Zusammenarbeit, die sich eben nicht nur auf Fachtagungen,<br />
sondern jeden Tag aufs Neue unter belasteten und belastenden<br />
Bedingungen "in den Höhen und Tiefen" des Alltags beweisen muss.<br />
Ich danke allen Beteiligten und bin zuversichtlich, dass wir auf unserer<br />
geplanten 2. <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong> bereits über weitere erfolgreiche<br />
Schritte auf dem gemeinsamen Weg berichten können.
<strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
Mittwoch, 9. Mai <strong>2007</strong><br />
Moderner Kinderschutz ist grundsätzlich auf Hilfe<br />
orientiert, klientenfreundlich und partnerschaftlich<br />
ausgerichtet. Durch ihn wird versucht, die Lebensbedingungen<br />
von Kindern und Familien positiv zu verändern,<br />
indem er die Eigenkräfte der Familien stärkt,<br />
soziale Konflikte und Notlagen erkennt und konkret<br />
Hilfe leistet. Insoweit ist Kinderschutz partnerschaftliche<br />
Aktion im Gemeinwesen <strong>zur</strong> Schaffung einer<br />
kinderfreundlichen Kultur des Aufwachsens. Kinderschutz<br />
ist Familienschutz und als solcher Garant des<br />
Kindeswohls.<br />
Er hat somit eine doppelte Aufgabe:<br />
• Familien zu unterstützen, Kindern und Eltern zu<br />
helfen (Hilfefunktion)<br />
• Für den Fall, dass Eltern nicht in der Lage oder<br />
bereit sind, ihr Kind vor einer Gefährdung zu<br />
schützen, sichern die Fachkräfte des Kinderschutzes<br />
stellvertretend das Wohl der Kinder. In<br />
Wahrnehmung ihres öffentlichen Wächteramtes<br />
(Garantenpflicht) engagieren sich die Fachkräfte<br />
des Jugendamtes im Interesse der Wahrnehmung<br />
dieser Rechte.<br />
Das gesunde Aufwachsen von Kindern und der<br />
Schutz vor Gefährdungen ist nicht nur ein "Gebot der<br />
Menschlichkeit“, sondern auch Ausdruck gesamtgesellschaftlicher<br />
Verantwortung. Wir alle - und dazu<br />
zählen alle gesellschaftlichen Kräfte - müssen eine<br />
Kultur des Hinschauens entwickeln und nicht die des<br />
Wegschauens.<br />
Ein erster Schritt soll mit der <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
vollzogen werden. Experten der unterschiedlichen<br />
Berufsfelder im Bereich der Jugend- und<br />
öffentlichen Gesundheitshilfe, niedergelassene und<br />
klinisch tätige Kinder- und Jugendärzte sowie die<br />
Justiz bringen ihr Expertentum und ihre Erwartungen<br />
an einen modernen Kinderschutz ein mit dem Ziel,<br />
Risiken rechtzeitig zu erkennen, die Kooperation der<br />
unterschiedlichen Fachdisziplinen zu verbessern und<br />
Netzwerke in den Sozialräumen zu knüpfen.<br />
Insoweit richtet sich die Konferenz an die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes,<br />
der öffentlichen und Freien Jugendhilfe, an<br />
die Kinder- und Jugendärzte in Klinik und Praxis, an<br />
die Politik und weitere gesellschaftliche Kräfte.<br />
Programm<br />
10:00 Uhr<br />
Eröffnung und Grußworte<br />
Ingelore Rosenkötter (Senatorin für Arbeit,<br />
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales)<br />
Dr. med. Stefan Trapp (Berufsverband der Kinder-<br />
und Jugendärzte Bremen e.V.)<br />
Frank Nerz (Amt für Soziale Dienste Bremen)<br />
Eberhard Zimmermann (Gesundheitsamt Bremen)<br />
10:30 Uhr<br />
Vernachlässigung und Missbrauch an<br />
Kindern wahrnehmen und erkennen<br />
Dr. med. Eberhard Motzkau (Ärztliche Kinderschutzambulanz<br />
Düsseldorf)<br />
11:30 Uhr<br />
Praktischer Kinderschutz aus Sicht der<br />
<strong>Bremer</strong> Kinder- und Jugendärzte<br />
Prof. Dr. med. Hans-Iko Huppertz (Prof.-Hess-<br />
Kinderklinik Bremen)<br />
12:00 Uhr<br />
Kinderchirurgie - Wie kann ich Kindesvernachlässigung<br />
erkennen?<br />
Dr. med. Heidrun Gitter (Klinikum Bremen-Mitte)<br />
12:30 Uhr<br />
Früherkennung - Frühzeitiges Erkennen von<br />
Risiken der sozialen Entwicklung<br />
Prof. Dr. med. Eberhard Schulz (Uni-Klinik<br />
Freiburg)<br />
13:15<br />
Mittagspause<br />
14:15 Uhr<br />
Kinderschutz und Jugendhilfe<br />
Prof. Dr. Dr. hc. Reinhard Wiesner (Bundesministerium<br />
für Familie, Senioren, Frauen und<br />
Jugend)<br />
15:15 Uhr<br />
Ambulanter Sozialdienst - Beispiele der<br />
Fallbearbeitung<br />
Kerstin Reiners (Amt f. Soziale Dienste Bremen)<br />
15:35 Uhr<br />
Kinderschutz aus Sicht des Familiengerichts<br />
Sabine Heinke (Familiengericht Bremen)<br />
16:00 Uhr Kaffeepause<br />
16:20 Uhr<br />
Kindeswohlgefährdung aus Sicht der Polizei<br />
Prof. Dr. Ekke Dahle (Hochschule für öffentliche<br />
Verwaltung Bremen)<br />
16:50 Uhr<br />
Fallbeispiele sozial-familiärer Notlagen aus<br />
Sicht der Polizei<br />
Thomas Kothe (Polizei Bremen)<br />
17:10 Uhr<br />
'Gesund ins Leben' - Präventive Gesundheitssicherung<br />
von Risikofamilien durch das<br />
Gesundheitsamt<br />
Eberhard Zimmermann (Gesundheitsamt Bremen)<br />
17:40 Uhr<br />
Kinderschutz aus Sicht des Jugendamtes<br />
Herbert Holakovsky (Amt für Soziale Dienste)<br />
18:00 Uhr Schlussworte<br />
Nach jedem Beitrag ist Raum für Nachfragen<br />
und Diskussion.
Ingelore Rosenkötter<br />
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales<br />
Grußwort<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen interdisziplinären<br />
<strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong>.<br />
Der unmittelbare Anlass zu dieser <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
ist sicherlich der tragische Tod des zweieinhalbjährigen<br />
Kevin im Oktober des vergangenen Jahres. Ob Kevin in Bremen,<br />
Jessica aus Hamburg oder Jaqueline aus Hessen - diese<br />
Schicksale haben viele Namen.<br />
Sie weisen auf die Notwendigkeit hin, die Sensibilität und die<br />
Wahrnehmung für alle Belange der Kinder zu erhöhen und zu<br />
stärken.<br />
Der Schutz vor Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern<br />
ist eine komplexe Aufgabe, bei der verschiedene Institutionen<br />
und verschiedene Professionen abgestimmt zusammen<br />
wirken müssen.<br />
Wie komplex sich dieser Sachverhalt darstellt, wird vielleicht<br />
auch an dem Umstand deutlich, dass die Ursache für Misshandlung<br />
und Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen<br />
nicht nur dem individuellen Versagen der Familien angelastet<br />
werden kann. Wir müssen hier auch die Rahmenbedingungen<br />
in den Blick nehmen und die Familien vor diesem<br />
Hintergrund stärken.<br />
Deshalb gehört zu der fachpolitischen Offensive auch die generelle<br />
Verbesserung der Lebensbedingungen. Mit der Auftaktveranstaltung<br />
Ende letzten Jahres wurde die Initiative <strong>zur</strong><br />
Entwicklung "Integrierter Handlungsstrategien für Quartiere<br />
mit besonderen Förderbedarfen" ergriffen. Unter der Zielsetzung<br />
übergreifender politischer Strategien erscheint es ratsam,<br />
mit erhöhter Aufmerksamkeit fallübergreifende Handlungskonzepte<br />
aufzubauen.<br />
Wir beschäftigen uns aktuell mit vielfältigen Lösungsmöglichkeiten<br />
und Alternativen zu den Verfahrensabläufen, Strukturen<br />
und Ausstattungen im Bereich der Jugendhilfe. Dazu hat auch<br />
der Untersuchungsausschuss in seiner umfangreichen Untersuchung<br />
und dem nun vorliegenden Bericht beigetragen. Ferner<br />
hat sowohl die städtische Deputation als auch der JHA ein<br />
umfangreiches Maßnahmepaket auf den Weg gebracht. Dies<br />
gilt es nunmehr auch finanziell abzusichern.<br />
Die Jugendministerkonferenz machte zuletzt darauf aufmerksam,<br />
dass "die professionelle Kompetenz der beteiligten<br />
Fachkräfte nicht selten an Grenzen stößt, was zu Unsicherheit<br />
im Umgang mit besonderen Risiko- und Gefährdungssituationen<br />
und zu Fehleinschätzungen der rechtlichen Möglichkeiten<br />
<strong>zur</strong> Sicherung des Kindeswohls im Verhältnis zum Elternrecht<br />
führt. Hier macht sich bemerkbar, dass eine gezielte Unterstützung<br />
und Begleitung der Fachkräfte nicht in allen Fällen<br />
als Regel vorhanden sind".
Heute soll mit dieser Veranstaltung dazu beitragen werden,<br />
diese Lücke zu schließen.<br />
Im Wissen um die vielfältigen und tagtäglichen Belastungen,<br />
Erwartungen und Anstrengungen besonders in den Bereichen<br />
der Jugendhilfe und der Gesundheitsdienste ist der Kinderschutz<br />
eine Herausforderung von großer Dimension.<br />
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Akteuren vor Ort,<br />
gebührt an dieser Stelle unsere besondere Anerkennung.<br />
Qualität ist im Dialog zu entwickeln. Das war das herausgearbeitete<br />
Ergebnis auf dem Fachtag "Kindeswohlsicherung" im<br />
Januar dieses Jahres. Dazu soll auch diese Konferenz zum<br />
Schutz der Kinder in unserer Stadt - zum Schutz vor Misshandlungen,<br />
Gewaltanwendungen und Vernachlässigungen<br />
beitragen.<br />
Wir sind uns sicherlich darüber einig, dass nicht alle notwendigen<br />
und einzubeziehende Felder auf dieser ersten Konferenz<br />
abgebildet sind. Dies würde den heute vorgesehen dichten<br />
Rahmen sprengen.<br />
Angesprochen werden heute nicht die vielfältigen Hilfen <strong>zur</strong><br />
Erziehung, die Angebote der freien Träger, die Rolle der Kindertagesbetreuung,<br />
der Schulen, der Familienbildung und des<br />
Strafrechts.<br />
Ich gehe aber davon aus, dass diese Felder in einem weiteren<br />
Diskurs bearbeitet und präzisiert werden und dass sich die<br />
Erkenntnis weiterhin durchsetzt, dass solche Verbundsysteme<br />
zugunsten von Kindern und Jugendlichen zwingend notwendig<br />
und unentbehrlich sind.<br />
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung.<br />
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. Stefan Trapp<br />
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., Vorsitzender des Landesverbandes Bremen<br />
Grußwort<br />
Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Ich bedanke und freue mich, Sie hier heute <strong>zur</strong> Ersten <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
im Namen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte<br />
begrüßen zu dürfen.<br />
Alle, die wir hier zusammengekommen sind, haben täglich mit Kindern<br />
und Jugendlichen zu tun – vielen, die glücklich und ungefährdet aufwachsen,<br />
aber auch häufig mit Kindern, deren Lebensbedingungen<br />
schwierig sind oder auch gefährlich. Wir sehen in dieser Arbeit die<br />
Chancen und Ressourcen der Kinder – und erleben oft, wie diese aufgebraucht<br />
und zu häufig zu verpassten Chancen werden.<br />
Wir alle bemühen uns, gefährdeten Kindern und Jugendlichen und ihren<br />
Familien beizustehen – teilweise mit erheblichem eigenem Engagement.<br />
Auch das gern gebrauchte Stichwort „Vernetzung“ ist ja nicht neu für<br />
uns. Dennoch kennen wir alle das Scheitern vieler Bemühungen, erleben<br />
das "Ins-Leere-Laufen".<br />
Allerdings habe ich persönlich das Gefühl, dass in Folge der schrecklichen<br />
Ereignisse des letzten Jahres viele Beteiligte sich neu auf- und<br />
zusammenraufen!<br />
Hier sehe ich eine Chance unserer heutigen Konferenz: Dass wir gemeinsam<br />
– zunächst – Strategien entwickeln, akut gefährdeten Kindern<br />
wirksam zu helfen. Ansätze sind gemacht, die wir weiter entwickeln<br />
können.<br />
Meine große Hoffnung ist es aber, dass wir über diese Akuthilfe hinaus<br />
Signale an die Politik und die Öffentlichkeit senden, dass viele Kinder,<br />
Jugendliche und ihre Familien unsere Unterstützung brauchen.<br />
Junge Menschen sind die Zukunft unserer Gesellschaft – sie haben ein<br />
Recht, glücklich, ungefährdet und mit allen Chancen aufzuwachsen.<br />
Dieses Ziel erreicht man nicht mit Einzelaktionen und nicht mit Lippenbekenntnissen!<br />
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir eine interessante und ertragreiche<br />
Tagung!
Frank Nerz<br />
Stellvertretender Leiter des Amtes für Soziale Dienste Bremen<br />
Grußwort<br />
Kinderschutz aus Sicht des Jugendamtes<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen interdisziplinären<br />
<strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong>.<br />
Die Wahrnehmung des Wächteramtes und des Kinderschutzes war<br />
und ist weiterhin eine der wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe.<br />
Dieser Aufgabe stellen sich die Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter des Amtes für Soziale Dienste tagtäglich und ich freue<br />
mich, dass Sie Frau Senatorin diese wichtige und zugleich schwierige<br />
Aufgabe bei unterschiedlichen Gelegenheiten und auch heute so wertschätzend<br />
in Ihrer Begrüßung aufgegriffen haben. Die Aufgabe des<br />
Kinderschutzes liegt aber nicht nur in der ausschließlichen Zuständigkeit<br />
des Staates, sondern ist eine Aufgabe aller gesellschaftlicher Kräfte<br />
dieser Stadt und dieses Landes und liegt damit auch in der Verantwortung<br />
des Gemeinwesen.<br />
In den Kindern sind die Zukunftschancen des einzelnen und der Gesellschaft<br />
gegenwärtig. Das Wohl des Kindes entscheidet deshalb<br />
zugleich über das individuelle Schicksal wie über die gesamtgesellschaftliche<br />
Entwicklung.<br />
Staat und Gesellschaft, Parlamente, Regierungen, Kommunen und<br />
freie gesellschaftliche Kräfte sind daher aufgerufen, die Lebensbedin-<br />
gungen von Kindern zu verbessern. In allen Bereichen des gesellschaftlichen<br />
Lebens müssen Fortschritte zu mehr Kinderfreundlichkeit<br />
erreicht werden - bei der finanziellen Sicherung von Familien mit Kindern,<br />
im Wohnungsbau, in der Familienerziehung, in Kindertageseinrichtungen,<br />
Schule, Jugendarbeit und Ausbildung und in vielen anderen<br />
Bereichen mehr.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Soziale Dienste<br />
sind tagtäglich in der Verantwortung im Sinne des Kinderschutzes eine<br />
Doppelrolle zwischen Hilfe und Kontrolle wahrzunehmen. Sie bewegen<br />
sich in einem sensiblen Dreieck, das durch die Pole Elternverantwortung<br />
- Rechte des Kindes - Aufgaben des Staates markiert wird.<br />
Hierzu bedarf es eines verantwortungsvollen Umgangs und einer<br />
qualifizierten fachlich fundierten Einschätzung der Gefährdungssituation<br />
des Kindes sowie einer Beurteilung im Hinblick auf die Fähigkeit<br />
und Bereitschaft der Eltern bzw. des verantwortlichen Elternteils, diese<br />
abzuwenden.<br />
Neben den an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellten Qualitätsanforderungen<br />
und den fachlichen Rahmenbedingungen bedarf es<br />
hierzu auch der strukturellen verbesserten Rahmenbedingungen und<br />
damit ausreichender personeller Ressourcen. Darüber hinaus erscheint<br />
es mir besonders wichtig zu sein, sozialraumbezogene Netzwerke<br />
bzw. Frühwarnsysteme zu entwickeln und fachlich zu pflegen.
Ich sehe in der heutigen Veranstaltungen auch unter Berücksichtigung<br />
der großen Resonanz einen wichtigen Meilenstein <strong>zur</strong> Erreichung<br />
dieses Zieles.<br />
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Soziale Dienste<br />
erwarten, dass - neben der Wertschätzung ihrer Arbeit - die Politik die<br />
strukturellen Rahmenbedingungen für die Arbeit der öffentlichen und<br />
freien Jugendhilfe so gestaltet, dass eine effektive risikominimierende<br />
Kinderschutzarbeit in der Breite möglich ist.<br />
Nach Professor Wolff versucht moderner Kinderschutz, die Lebensbedingungen<br />
von Kindern und Familien positiv zu verändern, indem er<br />
die Eigenkräfte der Familien stärkt, soziale Konflikte und Notlagen erkennt<br />
und konkret Hilfe leistet. Er formuliert weiter "Kinderschutz ist<br />
partnerschaftliche Aktion im Gemeinwesen <strong>zur</strong> Schaffung einer kinderfreundlichen<br />
Kultur des Aufwachsens. Kinderschutz ist Familienschutz<br />
und als solcher Garant des Kindeswohls.“<br />
In diesem Sinne wünsche ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern<br />
der <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong> einen anregenden erkenntnisreichen<br />
Tag und verbinde damit die Hoffnung, dass wir in dieser Stadt<br />
gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften eine Kultur des Hinschauens<br />
und nicht die des Wegschauens stärken, damit Kinder zu<br />
ihrem Recht kommen und Familien die Unterstützung erhalten, um sie<br />
zu befähigen, den Kinderschutz selbst wahrnehmen zu können.<br />
Und mit Blick auf den kommenden Sonntag wünsche ich mir, dass die<br />
Politik über alle Fraktionsgrenzen hinaus hier in Bremen die Rahmenbedingungen<br />
und damit die Ressourcenausstattung im Sinne eines<br />
starken Kinderschutzes schafft.<br />
Geben Sie uns die Rahmenbedingungen! Wir werden gemeinsam -<br />
Professionelle und Familien - diesen Rahmen verantwortlich füllen.
Vernachlässigung und<br />
Missbrauch an Kindern<br />
wahrnehmen und<br />
erkennen<br />
<strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
9. Mai <strong>2007</strong><br />
Eberhard Motzkau<br />
Ärztliche KinderschutzAmbulanz am Evangelischen<br />
Krankenhaus Düsseldorf<br />
Evangelisches<br />
Krankenhaus<br />
Düsseldorf
Vernachlässigung<br />
Definition<br />
� Unterlassen fürsorglichen Handelns für<br />
physische/psychische Versorgung<br />
� durch Eltern oder Betreuer<br />
� aktiv/passiv, zu wenig Einsicht/Wissen<br />
� nachhaltiges Nichtberücksichtigen,<br />
Missachten, Versagen der Lebensbedürfnisse<br />
> chron. Unterversorgung<br />
� >Entwicklungsschäden (körperl., geistig,<br />
seelisch) oder Tod<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Grundbedürfnisse<br />
� Befriedigung der phys. Bedürfnisse<br />
� Schutz vor äußeren Einwirkungen und<br />
Krankheiten<br />
Dr. E. Motzkau 2<br />
� Ermöglichen einer kindgemäßen Entwicklung in<br />
Sicherheit<br />
� Soziale Bindungen<br />
� Seelische + körperliche Wertschätzung<br />
� Angemessene Anregung / Förderung<br />
� Aufbau eines eigenen funktionellen Selbst-<br />
Konzeptes / Identitätsbildung<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 3<br />
� Ressourcen<br />
� Stärken/Fähigkeiten<br />
� Individuelle Situation<br />
� Realitäten subjektiv<br />
� Komplexität macht<br />
hilflos<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Die Balance!<br />
� Schwächen<br />
� Defizite/Unkenntnis<br />
� Verallgemeinerung<br />
� Hypothesenbildung!<br />
� „Verstehen von<br />
Gesetzmäßigkeiten“<br />
Dr. E. Motzkau 4<br />
Elemente der Vernachlässigung<br />
Abhängigkeit<br />
� Ohnmacht - Allmacht<br />
� Suchtstrukturen<br />
� Nichts – Alles – nie genug, keine Zufriedenheit, keine<br />
eigenen Wünsche, aber illusionäre Realität<br />
� Angst vor Verzicht und Bedürfnisaufschub<br />
� Kein Gefühl für Persönlichkeitsgrenzen, Verstrickung,<br />
das Kind sorgt für das Selbstgefühl der Eltern,<br />
„Rollenumkehr“<br />
� Ruhe = Tod = Verlust >> Angst<br />
Dr. E. Motzkau 5
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Elemente der Vernachlässigung<br />
Infantile Persönlichkeit<br />
� Vermeiden von Verantwortung<br />
� Kein (stabiles) Selbstkonzept<br />
� Kind wird nicht als eigenständige Person<br />
wahrgenommen sondern als Selbst-anteil oder als<br />
Repräsentant einer anderen Person<br />
� Fehlende Steuerung<br />
� Hohe Stressanfälligkeit<br />
� Grenzenlose Bedürftigkeit<br />
� illusionäre Autarkie<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 6<br />
Elemente der Vernachlässigung<br />
Entwertung<br />
� Keine Selbstliebe, keine Selbstachtung<br />
� Schwache Liebe zu den Kindern, eher<br />
projektive Erwartungen und Bestätigung bei<br />
Erfüllung<br />
� Keine eigenen Selbstwertkategorien, nur<br />
orientiert an Anderen<br />
� Keine Erfahrung mit Selbstwirksamkeit<br />
� Gefühl von Bedeutungslosigkeit<br />
� Abwehr von Bedürftigkeit und Trauer<br />
� Neid auf Versorgung der Kinder durch Andere<br />
Dr. E. Motzkau 7<br />
Elemente der Vernachlässigung<br />
Narzisstische Wut<br />
� Aggressionsbereitschaft oder<br />
� Opferbereitschaft<br />
� Entwertung Anderer<br />
� Inszenierung der eigenen Ohnmacht<br />
und Schuldzuweisung nach außen<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 8<br />
Elemente der Vernachlässigung<br />
Abspaltung/Verleugnung<br />
� Verkennen der kindlichen Bedürfnisse<br />
� Empathiemangel<br />
� Misstrauen<br />
� Fehlende Kontinuität:<br />
� Nur „gut“: anwesend, gewährend<br />
� Nur „schlecht“: abwesend, versagend<br />
Dr. E. Motzkau 9
Hoch-Risikofaktoren bei<br />
Säuglingen und Kleinkindern<br />
� Sehr niedriges Geburtsgewicht < 1500 g<br />
� Postpartale Depression der Mutter<br />
� Drogenabusus der Mutter<br />
� Unerwünschte Schwangerschaft<br />
� Sehr junge Mütter<br />
� Broken-home Erfahrung, Heimaufenthalte,<br />
eigene Misshandlungserfahrung<br />
der Eltern<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 10<br />
Vernachlässigung<br />
Bindung und Bedeutung von Bindung<br />
� Bindung meist unsicher-ambivalent (C)<br />
� bei zusätzlicher Traumatisierung<br />
desorientierte / desorganisierte Muster (D)<br />
� Mütter selbst verstrickt, entwertet/<br />
traumatisiert in der Herk. - Familie<br />
� „Arbeitsmodelle“ inkohärent<br />
� ( Idealisierung, Wut, Abhängigkeit )<br />
� mütterliches Verh.: unvorhersehbar,<br />
narzißtisch, vernachlässigend<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 11<br />
Vernachlässigung<br />
Bindungsorganisation<br />
� Keine Kommunikation von Gefühlen<br />
� fehlende Gefühlseinschätzung<br />
� bei Stress wechselnde Strategie:<br />
� aggressiv-abwehrend / fordernd-klammernd<br />
� In eigenen Beziehungen:<br />
� Idealisierung von Partnern<br />
� Nähe / Distanz-Problem<br />
� Selbstbild: negativ,vage, unrealistisch<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 12<br />
Resilienz<br />
und Risiko-Belastung<br />
� Resilienz = Fähigkeit,<br />
� Entwicklungsrisiken zu mindern/<br />
kompensieren,<br />
� neg. äußere Einflüsse zu überwinden<br />
� <strong>zur</strong> Aneignung gesundheitsförderlicher<br />
Kompetenzen<br />
Dr. E. Motzkau 13
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Schutzfaktoren bei<br />
Risikobelastung<br />
� Eigenschaften des Kindes, die pos.<br />
Reaktionen im soz. Umfeld auslösen<br />
� günstiges Temperament, Anpassungsfähigkeit,<br />
Intelligenz, weibliches Geschlecht<br />
� Emot. Bindungen und Sozialisierungspraktiken<br />
> Vertrauen, Selbstständigkeit,<br />
Initiative<br />
� Frühe Interaktion, pos. Bindungsbeziehung,<br />
Erfahrung gelungener Bewältigung!<br />
� Externale Unterstützungssysteme<br />
Vernachlässigung<br />
Generationendynamik Großeltern<br />
„Unser gutes Kind“<br />
Angst<br />
Abhängigkeit<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Idealisierung<br />
Dr. E. Motzkau 14<br />
Desintegration Desintegration<br />
Elternteil<br />
„Retten“<br />
Verantwortung<br />
Kompetenz<br />
Empathie?<br />
Ambivalenz<br />
Konkurrenz<br />
Vernachlässigung<br />
Kind<br />
Verleugnung, Abspaltung<br />
Ablehnung<br />
Entwertung<br />
Neid<br />
„Das schwierige Kind“<br />
Neg. Selbstwert<br />
Wut<br />
Sehnsucht<br />
Abhängigkeit<br />
„Scheitern“<br />
Dr. E. Motzkau 15<br />
Vernachlässigung<br />
Generationendynamik II<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Kind<br />
Verantwortung<br />
Zuwendung<br />
Loyalitätskonflikt<br />
„Eltern“<br />
Großeltern<br />
Neid, Enttäuschung, Misstrauen<br />
„Geschwister“<br />
Konkurrenz<br />
Entwertung<br />
Verleugnung, Abspaltung<br />
Elternteil<br />
Dr. E. Motzkau 16<br />
„Beziehungsspiele“ in<br />
Vernachlässigungsfamilien<br />
� Das Geschwister-Spiel<br />
� Jetzt bist Du mal dran, sind ja auch Deine Kinder!<br />
� Das Jugendlichen-Ambivalenzspiel<br />
� Seht her. Eltern, ich habe von Euch nicht gelernt, Kinder<br />
zu versorgen. Jetzt geschieht es Euch Recht, dass ich<br />
meine Kinder schlecht versorge!<br />
� Das Wohngemeinschafts – Spiel<br />
� Hier holt sich jeder, was er braucht. Wer sich nicht<br />
meldet, kriegt nichts.<br />
Dr. E. Motzkau 17
„Beziehungsspiele“ in<br />
Vernachlässigungsfamilien<br />
� Der Traum vom Leben – Mir darf es<br />
nicht gut gehen<br />
� Mir könnte es so gut gehen, wenn ich Euch Kinder nicht<br />
hätte. Wie konnte ich nur auf den/die..... hereinfallen?<br />
Alles ist möglich, morgen fängt mein Glück an!<br />
� Das „als – ob – Spiel“<br />
� Ist alles nicht so schlimm, war schon mal schlimmer.<br />
Wenn das hier vorbei ist werden unsere Wünsche wahr –<br />
sind es ja schon.<br />
� „Staatsanwalt“, „Verteidiger“<br />
� Projektion von Anklage/Rechtfertigung<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Vernachlässigung<br />
- mögliche Auswirkungen<br />
� Körperlich:<br />
Dr. E. Motzkau 18<br />
� Tod, Untergewicht, Übergewicht, Minderwuchs,<br />
Mangelkrankheiten, Kr.- Anfälligkeit/auffällige Resistenz,<br />
verzögerte motorische Entwicklung, Hyperaktivität, Herz-<br />
Kreislauferkrankungen<br />
� Kognitiv:<br />
� Störungen der Sprachentwicklung und der Sprachfunktion,<br />
Leitsymptom verz. Sprachentwicklung!<br />
Intelligenzminderung, (Ausbleiben von synaptischen<br />
Vernetzungen, Abbau von Neuronen.)<br />
� Sozial:<br />
� Störung von Kontakt und Nähe-/Distanzregulierung,<br />
Aggression, wenig Konfliktlösungsstrategien, Misstrauen,<br />
Entwertung, Grenzüberschreitung/Überanpassung<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 19<br />
Vernachlässigung<br />
- mögliche Auswirkungen<br />
� Psychisch:<br />
� Hospitalismus, „Regulationsstörungen“,<br />
Bindungsstörung, depressive Persönlichkeitsentwicklung,<br />
Störg. der Symbolbildung und der<br />
Phantasietätigkeit, Identitätsstörung, geringer Selbstwert,<br />
Störung der Selbst-wahrnehmung u. des Selbstbildes,<br />
verm. Schmerzwahrnehmung, Unfallneigung,<br />
Selbstverletzung, Störg. der Impulskontrolle, emot.<br />
Störung, vermindertes Neugierverhalten, Borderline -<br />
Störung, erhöhtes Risiko für Alkoholabusus (X 7,4),<br />
Drogenmissbrauch (X 10,3), Suizid (X 12,2)<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Familiendynamik bei<br />
Vernachlässigung<br />
Dr. E. Motzkau 20<br />
� Oft eigene Vernachlässigungserfahrung der<br />
Eltern, geringer Selbstwert, Fehlen von<br />
Zuversicht und Selbstwirksamkeitserfahrung<br />
� Enge Verstrickung und Konkurrenz zu<br />
Großelterngeneration<br />
� fehlende Selbst- und Fremdwahrnehmung<br />
(v.a. für Bedürfnisse der Kinder)<br />
� theoretisches Wissen und Vorstellungen über<br />
Versorgung sind vorhanden, aber innere<br />
Modelle und Erfahrungen sind blass oder<br />
fehlen<br />
� Misstrauen nach außen, Abwehr<br />
Dr. E. Motzkau 21
Vernachlässigung<br />
Helferdynamik<br />
� Übertragung und Gegenübertragung:<br />
� Ohnmacht, Hilflosigkeit<br />
� Resignation, Hoffnungslosigkeit,<br />
� Gleichgültigkeit,<br />
� Ablehnung, Lästigkeit, Unlust<br />
� Wut<br />
� Ekel<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Vernachlässigung<br />
Fallen für Helfersysteme<br />
� Konkurrenz, Machtkampf, Entwertung<br />
� Isolierung, Tabuisierung<br />
� Unklarheit, Strukturlosigkeit<br />
� Ressourcenverleugnung<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 22<br />
� Vergessen, Lähmung, Abschieben<br />
� Überfordern mit Anforderung +Verantwortung<br />
� Überfordern mit Überversorgung<br />
� Umzingeln mit Hilfen<br />
� Nicht - Wahrnehmen<br />
Dr. E. Motzkau 23<br />
Kooperationshindernisse<br />
mit Familien bei<br />
früher Intervention und Hilfe<br />
� Problembeschreibung> Entwertung<br />
� Mißtrauen: Hilfe> feindl. Machtausübung<br />
� Inkonstanz in Kompetenz und Verantwortung<br />
� Identifikation mit neg. Anteilen> Kritik und<br />
projektive Schuldvorwürfe<br />
� Angst vor Stetigkeit in Beziehungen<br />
� Gefahr des Abbruchs> zentrale Verantwortung!<br />
� Balance von Hilfe und Kontrolle<br />
� Balance Hilfe für Eltern und Kindeswohl<br />
� Elternverantwortung Machtoptionen der Hilfen<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Sexuelle Gewalt<br />
Diagnostische Ebenen<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 24<br />
� Körperlich<br />
� kindergynäkologische U.<br />
� ganzkörperliche Inspektion<br />
� Sicherung/Untersuchung von Kleidung<br />
� Abstriche, Schwangerschaftsdiagnostik<br />
� Psychologisch/Kinderpsychiatrisch<br />
� traumaspezifisch<br />
� allgemeine Psychodiagnostik<br />
� Familiendiagnostik<br />
Dr. E. Motzkau 25
Sexuelle Gewalt<br />
Psychodynamik<br />
� Opfer<br />
� übernehmen Verantwortung<br />
� Schuldgefühle, Selbstzweifel, -entwertung<br />
� Angst, Scham, Ekel<br />
� Hilflosigkeit, Resignation, Passivität<br />
� Abspaltung, Dissoziation, Verdrängung<br />
� Wut, ungesteuerte Aggression<br />
� Blockierung, Isolation<br />
� Gegenübertragung berücksichtigen!<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 26<br />
Sexuelle Gewalt,<br />
Symptomatik, Initialwirkungen<br />
� Unangemessenes Sexualverhalten:<br />
� Exzessive sex. Neugier, frühe sexuelle<br />
Beziehungen, offenes Masturbieren,<br />
Exhibitionismus, sexualisiertes Verhalten<br />
� Somatische/psychosomatische Folgen<br />
� Verletzungen anal, genital, oral;<br />
Schwangerschaft, Vener. Erkrankung,<br />
� Schmerzen, Atembeschwerden,<br />
Essstörung, Schlafstörung, Obstipation,<br />
Enuresis, Enkopresis<br />
Dr. E. Motzkau 27<br />
Sexuelle Gewalt<br />
Symptomatik, Initialwirkungen<br />
(nach Browne und Finkelhor, (1986)<br />
� Emotional:<br />
� Ängste, PTBS, Depression, niedriger<br />
Selbstwert, Suizidalität, Schuld- + Schamgefühle,<br />
aggr. Ausagieren, selbstschädigendes<br />
Verhalten, Suchtverhalten<br />
� Sozialverhalten:<br />
� Weglaufen, Schul- + Leistungsschwierigkeiten,<br />
Rückzug, Hyperaktivität,<br />
Aggression und Vandalismus, Delinquenz<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Sexuelle Gewalt<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 28<br />
Häufigste Symptome nach sex. Gewalterfahrung<br />
� Vorschulalter<br />
� Angst, Albträume, sexualisiertes Spiel,<br />
Aggression, Rückzug, Regression<br />
� Schulalter<br />
� Probleme mit Leistung, Konzentration und<br />
Gedächtnis, Hyperaktivität, Aggression,<br />
Regressives Verhalten<br />
� Jugendliche<br />
� Depression, Isolation, Suizidalität,<br />
Selbstbeschädigung, Somatisierung,<br />
Delinquenz, Weglaufen, Drogen, Prostitution<br />
Dr. E. Motzkau 29
Sexuelle Gewalt<br />
Langzeitfolgen<br />
� Emotional und kognitiv:<br />
� Depression, Angstsymptomatik,<br />
Schamgefühle, Kontaktstörung,<br />
Selbstverletzung, Suizidalität, neg.<br />
Selbstbild und Selbstwert, Schuldgefühl<br />
für alle neg.. Ereignisse,<br />
ext.Kontrollüberzeugung bei positiven<br />
Ereignissen,<br />
� niedrige Selbstwirksamkeitserwartung<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Sexuelle Gewalt<br />
Langzeitfolgen<br />
� Psychiatrisch<br />
Montag, 23. Juli <strong>2007</strong><br />
Dr. E. Motzkau 30<br />
� PTBS, Amnesien, Dissoziation, Borderline-<br />
Störung., Multiple Pers.-Störung.,<br />
Suchterkrankungen,<br />
� Psychosomatisch<br />
� Schlafstörung, Essstörung, Schmerzsymptome,<br />
umschriebene Psychosomatische<br />
Krankheitsbilder, sex. Funktionsstörungen<br />
� Sozial<br />
� Reviktimisierung, Misstrauen, Anpassung,<br />
Prostitution<br />
Dr. E. Motzkau 31
Praktischer Kinderschutz<br />
aus der Sicht der <strong>Bremer</strong><br />
Kinder- und Jugendärzte<br />
Prof. Dr. med. Hans-Iko Huppertz<br />
Prof.-Hess-Kinderklinik<br />
Klinikum Bremen-Mitte<br />
Sankt-Jürgen-Strasse<br />
Bremen
• Alkohol<br />
• Allergien<br />
• Autoabgase<br />
• Drogen<br />
• Elektrosmog<br />
• Entführung<br />
• Fernsehen<br />
• Gewalt<br />
Gefahren für Kinder<br />
• Internet<br />
• Intoxikationen<br />
• Lärm<br />
• Missbrauch<br />
• Passivrauchen<br />
• Radioaktive Strahlung<br />
• Überernährung<br />
• Ultraviolette Strahlung<br />
• Verkehrsunfälle<br />
Internationale Gefahren für<br />
Kinder<br />
• Kinderarbeit<br />
• Kinderprostitution<br />
•Migration<br />
• Kinderhandel<br />
• Brutalisierung<br />
• Diskriminierung<br />
Kinderrechtskonvention der<br />
UNO 1989: 10 Grundrechte<br />
<strong>1.</strong> Recht auf<br />
Gleichbehandlung<br />
2. Recht auf Namen und<br />
Nationalität<br />
3. Recht auf Gesundheit<br />
4. Recht auf Bildung und<br />
Ausbildung<br />
5. Recht auf Freizeit und<br />
Spielen<br />
6. Recht auf Information<br />
und Kommunikation<br />
7. Recht auf Privatsphäre,<br />
Erziehung im Sinne von<br />
Gleichberechtigung und<br />
Frieden<br />
8. Recht auf Hilfe in Not<br />
9. Recht auf Familie<br />
10. Recht auf Betreuung bei<br />
Behinderung<br />
Kinderrechtskonvention<br />
• Von Deutschland nur unter Vorbehalt<br />
ratifiziert: das Ausländerrecht hat Vorrang<br />
vor diesen Rechten<br />
• Kinder sitzen nur in Deutschland in<br />
Abschiebehaft
Recht auf Ausbildung der<br />
Kinderkonvention (4)<br />
• Abgelehnte, geduldete Asylbewerber-<br />
Familie aus dem Libanon<br />
• 17 Jahre alter Sohn, seit 7 Jahren in<br />
Deutschland, mit Realschulabschluss<br />
• Darf keine Lehrstelle annehmen, hängt statt<br />
dessen mit „Kollegen“ am Bahnhof rum<br />
⇒ Interpretationsmöglichkeit: Staatlich<br />
verordnete Verletzung der<br />
Chancengleichheit<br />
Recht auf Bildung (4), Freizeit (5)<br />
und Hilfe bei Behinderung (10)<br />
• 12 Jahre alter verhaltensauffälliger Junge<br />
• Wegen Aggressivität laut Schulbehörde nur 3<br />
Stunden pro Tag morgens beschulbar<br />
• Keine Hausaufgaben, keine Noten<br />
• Allein erziehende Mutter arbeitet bis 17 Uhr<br />
• Junge verbringt seine Tage vor dem Fernseher<br />
⇒ Interpretationsmöglichkeit: Der Staat entzieht<br />
sich der allgemeinen Schulpflicht,<br />
Vernachlässigung („Neglect“)<br />
Recht auf Gesundheit (3) und<br />
Schutz vor Grausamkeit und<br />
Vernachlässigung (8)<br />
• Eltern verweigern ihren Kindern die<br />
Masernimpfung aus ideologischen Gründen<br />
und feiern „Masernparties“<br />
• Freude über Rekonvaleszenz nach 1 Woche<br />
mit hohem Fieber und schwerer Erkrankung<br />
• Pneumonie, Enzephalitis (1:<strong>1.</strong>000), Subakut<br />
sklerosierende Panenzephalitis (SSPE;<br />
1:10.000)<br />
Beispiele von Zielgruppen für<br />
Verbesserungsmöglichkeiten des<br />
Kinderschutzes<br />
• Kinder mit Migrationshintergrund<br />
• Kinder mit Leistungseinschränkungen und<br />
Verhaltensauffälligkeit<br />
• Kinder mit medizinischer Unterversorgung
Wünsche der <strong>Bremer</strong> Kinderund<br />
Jugendärzte im Interesse des<br />
Kindeswohles:<br />
Gute, vertrauensvolle<br />
Zusammenarbeit mit dem<br />
Jugendamt / Amt für soziale<br />
Dienste !<br />
Selbstverständnis der Kinderärzte<br />
• Kinderärzte kennen und berücksichtigen die<br />
soziale Situation ihrer Patienten im<br />
Zusammenhang von Krankheit und Gesundheit<br />
• Kinderärzte verstehen sich als die natürlichen<br />
Anwälte der Interessen des Kindes, fast immer mit<br />
den Eltern gegen Kassen, Bürokratie, Schule, etc.<br />
• Manchmal Abwägung Interesse der Eltern und<br />
Interesse des Kindes<br />
• Extrem selten, aber möglich: Schutz des Kindes<br />
vor den Eltern<br />
Battered Child Syndrome<br />
• Kempe 1962<br />
• Non-accidental trauma<br />
• Niedergelassener Kinderarzt hat Verdacht<br />
• Einweisung ins Kinderkrankenhaus<br />
• Mitteilung an das Jugendamt<br />
• Vernachlässigung (Neglect), Sexueller<br />
Missbrauch, Münchhausen-by-proxy-<br />
Syndrom<br />
Basisüberlegungen für die Zusammenarbeit<br />
von Kinderärzten und Jugendamt<br />
• Gemeinsame Anstrengungen <strong>zur</strong> richtigen<br />
Erkennung von Misshandlung,<br />
Vernachlässigung und Missbrauch<br />
• Gegenseitige Information bei der Betreuung<br />
von Index-Kind, Eltern und Geschwistern<br />
• Rekonstruktion der Familie (gegen Chaos,<br />
Gewalt) hat Vorrang (Alternative Heim:<br />
Abwägen Partizipation versus Intervention)
Hypothetischer Beispielfall: 6<br />
Monate alter Säugling<br />
• Bei U5 (6 Monate) wundert sich der Kinderarzt<br />
über un<strong>zur</strong>eichenden Gewichtszuwachs und<br />
schlechten Pflegezustand<br />
• Mutter lehnt Einweisung in Kinderklinik ab, aber<br />
verspricht, in 1 Woche <strong>zur</strong> Gewichtskontrolle<br />
wiederzukommen<br />
• Kinderarzt ruft Jugendamt an, ob Familie bekannt<br />
sei: er spricht auf Anrufbeantworter<br />
• Bei Wiedervorstellung keine Rückmeldung des<br />
Jugendamtes, aber leichter Gewichtszuwachs<br />
Fortsetzung des Falles: jetzt 7<br />
Monate alter Säugling<br />
• Kind wird mit schwerer Entwässerung,<br />
Übersäuerung und Übersalzung bei seit 1 Woche<br />
bestehendem Erbrechen und Durchfall<br />
notfallmäßig in die Kinderklinik aufgenommen<br />
• Trotz Intensivtherapie Hirnüberwässerung mit ⇒<br />
4 Wochen Intensivstation, später werden kognitive<br />
Defizite festgestellt<br />
• Ursache: Vernachlässigung des Kindes<br />
Retrospektive<br />
• Allein erziehende Mutter bei Jugendamt<br />
bekannt<br />
• 1 Kind in Pflege, 1 Kind bei der Großmutter<br />
• Grund der Fremdplazierung:<br />
Vernachlässigung mit Unterernährung<br />
Information<br />
• Fester Ansprechpartner<br />
• Telefon mit Anrufbeantworter<br />
• Zeitnahe Rückmeldung erbeten an<br />
Kinderkrankenhaus und niedergelassenen<br />
Kinderarzt!
Umgang mit Auflagen des<br />
Jugendamtes<br />
• Partnerschaft mit Eltern: gemeinsames<br />
Interesse des Kindeswohles<br />
• Autorität des Amtes bewahren!<br />
• Umgang mit schwierigen, Gewalt<br />
ausstrahlenden Eltern (Regeln!)<br />
• Konsequenz, Transparenz und<br />
Berechenbarkeit der Entscheidungen des<br />
Jugendamtes<br />
• Vertrag einhalten!<br />
Hypothetischer Fall eines 6<br />
Wochen alten Frühgeborenen<br />
• Mehrere Sozialarbeiter, Drogenhelfer, und andere<br />
sollen entscheiden, ob ein Frühgeborenes nach 6<br />
Wochen stationärer Drogenentwöhnung zu seiner<br />
Mutter nach Hause entlassen werden kann oder in<br />
eine Pflegefamilie kommt („Helferkonferenz“)<br />
• Sitzung in Gegenwart der Mutter, des Vaters und<br />
der mütterlichen Großmutter<br />
• Entscheidung für die häusliche Versorgung durch<br />
die Mutter auch zu ihrer eigenen Stabilisierung<br />
unter Auflagen (Gewicht 4500g)<br />
Fortsetzung Fall<br />
• Keine Rückmeldung<br />
• Einlieferung auf Intensivstation im Alter<br />
von 5 Monaten (Gewicht 4500g) mit<br />
Atemstillstand, Blausucht und Schläfrigkeit<br />
• Lichtstarre Pupillen,<br />
Schnittbilduntersuchung:<br />
Hirnüberwässerung, multiple Einblutungen:<br />
Schütteltrauma<br />
• Tod trotz Intensivtherapie<br />
Verantwortung für das Kind<br />
• Persönliche Verantwortung des Mitarbeiters<br />
des Jugendamtes<br />
• Helferkonferenz in Gegenwart der Eltern?<br />
• Kind kein Therapeutikum!<br />
• Spezielle Problematik drogenabhängiger<br />
Eltern
Aktuelle Entwicklung<br />
• Kinder- und Jugendärzte Bremens wiesen<br />
auf die Möglichkeit hin, die<br />
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zu<br />
verbessern<br />
• Gemeinsame Konferenz nach Absprache<br />
am 12. Dezember 2006<br />
• Vom Jugendamt betriebene Veränderungen<br />
günstig<br />
• Probleme mit administrativen Mitteln<br />
alleine nicht zu lösen<br />
Mögliche weitere Aspekte<br />
• Familiengericht<br />
• Mögliche Anzeige („Rollenunklarheit“)<br />
• Organisation des Jugendamtes (6<br />
Sozialzentren (alle sozialen Leistungen);<br />
fachliche Hierarchie; eigenes Budget)<br />
• Verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen<br />
Wünsche der Kinder- und<br />
Jugendärzte an das Jugendamt<br />
• Zeitnahe Rückmeldung<br />
• Verantwortung<br />
• Verträge und Konsequenzen<br />
• Objektive Helferkonferenz im Interesse des<br />
Kindes<br />
• Kind kein „Therapeutikum“<br />
Fortsetzung der Zusammenarbeit<br />
mit dem Jugendamt<br />
• Angebot der Mitwirkung, z.B. durch<br />
regelmäßige Vorstellungen und<br />
Untersuchungen durch die <strong>Bremer</strong><br />
Kinderärzte<br />
• Fortbildung der Kinderärzte und<br />
Sozialarbeiter in der Erkennung von<br />
Misshandlung und Vernachlässigung<br />
• Weitere gemeinsame Konferenzen?
Hypothetischer Fall: 2 Kinder<br />
• 2 Kinder (4 und 2 Jahre) werden mit<br />
Rauchvergiftung ins Kinderkrankenhaus<br />
eingeliefert<br />
• 20-jährige allein erziehende Mutter war auf<br />
Freimarkt; Kinder allein zu Hause, haben<br />
Herd angestellt, Zimmerbrand<br />
• Nachbarn: immer Krach, Chaos und Dreck:<br />
Unglück war vorherzusehen!<br />
• Schlussfolgerung?<br />
Kinderschutz alleine durch<br />
staatliche Maßnahmen?<br />
• Staatliche (bürokratische) Maßnahmen, Geld,<br />
mehr Mitarbeiter alleine können<br />
Kindesmisshandlung nicht verhindern<br />
• Gesellschaftlicher Wandel notwendig<br />
• Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft und des<br />
einzelnen<br />
• Heute: der Bürger beobachtet etwas, das auf<br />
Kindesmisshandlung hindeuten könnte ⇒<br />
Wegschauen oder Melden und dann Abwenden,<br />
statt Hilfe<br />
Verbesserung des Schicksals der<br />
uns anvertrauten Kinder<br />
• Verbesserung der Zusammenarbeit<br />
Jugendamt – Kinderärzte<br />
• Gegenseitige zeitnahe Information<br />
• Nutzung der Expertise des<br />
Kinderkrankenhauses (Krisenintervention,<br />
Beurteilung)<br />
• Nutzung von Vertrauen und Expertise des<br />
niedergelassenen Kinderarztes
Kindesmisshandlung:<br />
Erkennen - verhindern<br />
Dr. Heidrun Gitter<br />
Kinderchirurgische Klinik<br />
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Klinikum Bremen-Mitte
Formen der Kindesmisshandlung<br />
• Physisch: unplausible Verletzungen<br />
• Sexuell: Alle Aktivitäten mit dem Kind, die der<br />
sexuellen Befriedigung des/r Täters/in dienen<br />
• Psychisch: Zurückweisung, Abwerten, fehlende<br />
emotionale Zuwendung<br />
• Vernachlässigung: häufigste Form von Untergewicht<br />
bei jungen Kindern ist vernachlässigte Ernährung;<br />
mangelnder Schutz vor Unfällen<br />
• „Münchhausen-by-Proxy“-Syndrom<br />
Kindesmisshandlung-Prävalenz<br />
• Häufigkeit unklar, hohe Dunkelziffer, fließende<br />
Übergänge; 1: 100 – 1: 1000 Kinder/Jahr<br />
• Ca. 10 % der Verletzungen bei Kindern unter 5 Jahren,<br />
die in einer Notfallambulanz vorgestellt werden<br />
• Ca. 15 % der thermischen Verletzungen<br />
• Ca. 50 % der Frakturen bei Kindern unter 1 Jahr<br />
• USA: ca 58 % Vernachlässigung, ca 21 % Phys.<br />
Misshandlung, ca 11% sex. Missbrauch (Anteile unter<br />
allen gemeldeten bestätigten Misshandlungsfällen)<br />
• Misshandler: 62 % weibl., sex.Missbraucher meist männl.<br />
Kindesmisshandlung-Risikoprofile<br />
• Fehlende Eltern-Kind-Bindung (Frühgeburten,<br />
Krankheiten des Neugeborenen z.B.)<br />
• Chron. Erkrankung / Behinderung des Kindes<br />
• Drogenabhängigkeit der Eltern<br />
• Soziale Stressfaktoren wie Arbeitslosigkeit<br />
• Junge Eltern /alleinerziehende Mutter<br />
• Falsche Erwartungen, Unwissen<br />
• Gewalterfahrung, Missbrauchserfahrung in der Familie<br />
⇒Risikokonstellationen wahrnehmen<br />
Kindesmisshandlung-physisch<br />
• Verletzungshergang ist unplausibel, passt nicht <strong>zur</strong><br />
Verletzung<br />
• Unterschiedlich alte Verletzungen (blaue Flecken etc)<br />
• Verspätetes Aufsuchen medizinischer Hilfe<br />
• Auffällige Form von Hautverletzungen<br />
• Symmetrische Verletzungen, beidseitige Verletzungen<br />
• Verletzungen an eigentlich „geschützten“ Stellen (nicht<br />
dort, wo Knochen dicht unter der Haut), z.B. Gesäß,<br />
Rücken, „Abwehrverletzungen“, „Hutkrempenregel“<br />
• Über 70% der misshandelten Kinder haben<br />
Hautverletzungen (Blutergüsse etc)
• Typ.<br />
Misshandlungsverletzungen<br />
• Akzidentelle<br />
Verletzungen<br />
• Misshandlung<br />
versus akzidentell<br />
am Kopf
Kindesmisshandlung-Frakturen<br />
• Frakturen unterschiedlichen Alters (radiologische Zeichen<br />
„ corner sign“)<br />
• Multiple Rippenfrakturen, insbesondere bei kleinen<br />
Kindern<br />
• Frakturen, die nicht zum geschilderten Hergang oder<br />
Entwicklungszustand des Kindes passen (Frakturen an<br />
den Beinen bei noch nicht gehfähigen Kindern z.B.)<br />
• Beckenfrakturen ohne signifikante Gewalteinwirkung<br />
durch „bekannten“ Unfall
Kindesmisshandlung-thermisch<br />
• Verbrühungen / Verbrennungen machen ca 10 % der<br />
physischen Misshandlungsfälle aus, insbesondere im<br />
Kleinkindalter ( wo auch akzidentelle thermische<br />
Verletzungen häufig sind)<br />
• Zigarettenbrandwunden (typ. „ausgestanzte“ runde Form)<br />
• Eintauchverbrühungen (Verbrühungsmuster!)<br />
• Natürlicherweise reflektorisches „Wegziehen“ – fehlt bei<br />
Zwang / Gewaltanwendung<br />
• Entwicklungszustand/Fähigkeiten des Kindes passen<br />
nicht zum geschilderten Hergang<br />
Kindesmisshandlung-innere Organe<br />
• Verletzungen der Bauchorgane sind sehr gefährlich, sie<br />
sind die zweithäufigste Todesursache bei misshandelten<br />
Kindern<br />
• Wegen der weichen Bauchwand können äußere<br />
Verletzungsanzeichen an der Haut fehlen<br />
• Erbrechen, gespannter Bauch, Schmerzen, Schock
Kindesmisshandlung-“shaken baby“<br />
• Die häufigste Todesursache bei Kindesmisshandlung ist<br />
das zugefügte SHT – häufig Schütteltrauma<br />
• Schwere neurologische Zeichen führen <strong>zur</strong><br />
Krankenhausaufnahme<br />
• Diskreter: Lethargie, Erbrechen, Irritabilität,<br />
Entwicklungsverzögerung<br />
• MRT / CCT / Augenhintergrundsuntersuchung (retinale<br />
Blutungen, in 85 % der „shaken babies“)<br />
• Schwere Blutungen, Gefäßzerreißungen,<br />
Hirngewebsschäden<br />
• ⇒ Aufklärung: Kein Schütteln <strong>zur</strong> „Beruhigung“ des<br />
Kindes oder aus anderen Gründen!
Kindesmisshandlung-sex. Missbrauch<br />
• Sehr hohe Dunkelziffer (m. bes. unterschätzt?)<br />
• Missbraucher meist männl. und aus dem<br />
familiären Umfeld<br />
• Missbrauch beginnt mit der Auswahl des<br />
verletzbaren und verfügbaren Kindes<br />
(Behinderung, geringes Selbstbewusstsein, fehlender Schutz,<br />
familiäre Gelegenheit, Gehorsamsstrukturen, Vertrauensbruch,<br />
Missbrauchserfahrung bei der Mutter)<br />
• Ca 1/3 < 6 J, 1/3 6-12 J.,1/3 12-18 J<br />
Kindesmisshandlung-sex. Missbrauch<br />
• Offenbarung an Mutter/Bekannte<br />
• Verhaltensänderung (Kindergarten, Schule)<br />
• Altersinadäquates sex. Wissen und Verhalten<br />
• Bauchschmerzen, Einnässen, HWIs, Obstipation<br />
• Schwere psychopathol. Symptome<br />
(Selbstverletzung, Suizidalität, Essstörungen,<br />
Substanzmissbrauch, multiple Persönlichkeit)<br />
⇒ „ungutem Gefühl“ nachgehen, „Helferkonferenz“!<br />
Kindesmisshandlung-sex. Missbrauch<br />
• Dringliche med. Untersuchung i.d.R. nur geboten<br />
bei V.a. behandlungspflichtigen Verletzungen u.<br />
Erkrankungen und wenn Übergriff < 72 h<br />
(Beweissicherung)<br />
• Retraumatisierung vermeiden, keine neuerliche<br />
Missachtung der Selbstbestimmung<br />
• Erfahrene Untersucher, Standardisiertes<br />
Vorgehen, Spurensicherung, <strong>Dokumentation</strong>,<br />
• Untersuchung auch für Sicherheit von Kind/Eltern<br />
• Ggf. Narkoseuntersuchung<br />
Kindesmisshandlung-sex. Missbrauch<br />
• Beweisende Untersuchungsbefunde sind selten<br />
• Normalbefunde schließen sex. Missbrauch nicht<br />
aus!<br />
• Auch vaginale Penetration ohne nachweisbare<br />
(Hymenal-)Verletzung möglich!<br />
• Schleimhautwunden/oberflächl. Wunden können<br />
rasch und ohne nachweisbare Residuen abheilen<br />
• Falsche Anschuldigungen durch die Kinder sind<br />
selten (cave: Sorgerechtskonflikte, Probleme erw. Kinder)
Kindesmisshandlung-Vernachlässigung<br />
• Gedeihstörung / Unterernährung / Fehlernährung<br />
(Rasche Gewichtszunahme bei unlimitierter Fütterung in<br />
der Klinik z.B.)<br />
• Mangelnde Körperhygiene / Gesundheitsvorsorge<br />
(Evidenz, dass U-Unters. präventiv f. Misshandlung/deren Folgen?,<br />
fehlende etablierte Rückmeldung Arzt-Amt, fehlende lokale<br />
Auswertung von Entwicklungsverläufen/ Begleitforschung)<br />
• Entwicklungsverzögerung<br />
• Verminderter Mutter-(Vater-)Kind-Kontakt<br />
(Interaktion,Zuwendung, Ansprache, Spielen,<br />
Körperkontakt)<br />
• Ablehnung, Abwerten des Kindes<br />
Kindesmisshandlung-Vernachlässigung<br />
• Fließende Übergänge zum „Normalen“<br />
• Einflussmöglichkeiten?<br />
• Diese Kinder brauchen Kinderkrippen und<br />
Kindergärten<br />
• Zusammenarbeit mit den Kinderärzten (Auf<br />
Einhaltung der U-Unters. achten ist besser als<br />
Meldepflicht!, „gelbes Heft“ ansehen!)<br />
• Elternrecht – Elternpflicht - Kindesrecht<br />
Kindesmisshandlung-Fallbeispiel 1<br />
• Mit 1 ½ J stat wg OS-Fraktur („Treppensturz“),<br />
multiple Hämatome („von der älteren 4j Schwester<br />
verursacht“), jüngere Schwester als Säugling stat.<br />
wg. Schädelfraktur,v.a. „battered child“, AfSD<br />
involviert,Tagespflege<br />
• Mit 2 J stat. bei V.a. „battered child“ mit supracond.<br />
Humerusfraktur, multiple Hämatome,<br />
Entwicklungsverzögerung (Sprache!),<br />
Unfallhergang verschieden geschildert, zeitl.<br />
verzögerter Arztkontakt, Tagespflege<br />
unregelmäßig, Sorgerechtsentzug<br />
Kindesmisshandlung – Fallbeispiel 2<br />
• Wohnungsaufbruch bei schreiendem Kleinkind, 22<br />
Mon alter Junge in kühlen nassen Kleidern im<br />
Schock hilflos alleine vorgefunden mit Verbrühungen<br />
ca 40 % KO tief II° insbes. Beine, Arme , etwas auch<br />
Rumpf, auffälliges Verletzungsmuster und<br />
Aussparungen durch Bekleidungsschutz. Kind war<br />
vom Vater betreut, Mutter seit ca 1 Wo nicht mehr<br />
zugegen gewesen (war auf Besuch in ihrem<br />
Heimatland)<br />
• Gerichtsverhandlung, intensive Betreuung, derzeit ist<br />
das Kind bei der jetzt reiferen Mutter<br />
• Nach der Geburt bereits erster „Jugendamtskontakt“,<br />
Entzug (?) durch Umzug
Kindesmisshandlung-Prävention<br />
• Hinsehen – Nachfragen - dokumentieren<br />
• Risiken wahrnehmen – Verdacht aussprechen<br />
• Zweitmeinung – Supervision – Teamkultur<br />
• Niemals dran gewöhnen<br />
• Eigene Überforderung wahrnehmen und anzeigen<br />
(dürfen), Mängel benennen (dürfen), Fehlerkultur<br />
• Respekt – Offenheit - Ehrlichkeit<br />
• Hilfen anbieten aber Mithilfe einfordern<br />
• Vernetze Strukturen (Helfer, Ärzte, ÖGD, Schulen,<br />
Kindergärten, Polizei, Rechtsberatung ...)<br />
• Begleitforschung
Prof. Dr. med. Eberhard Schulz<br />
Uni-Klinik Freiburg, Ärztlicher Direktor der Abt. für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter<br />
Früherkennung - Frühzeitiges Erkennen von Risiken der sozialen Entwicklung<br />
Der Beitrag von Prof. Dr. med. Eberhard Schulz war bis <strong>zur</strong> Drucklegung nicht verfügbar und wird ggf. in der <strong>Dokumentation</strong> <strong>zur</strong> 2. <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
veröffentlicht.
Reinhard Wiesner<br />
Kinderschutz und Jugendhilfe<br />
<strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
9. Mai <strong>2007</strong>
Der mehrdimensionale Auftrag der Jugendhilfe<br />
„Die strukturelle Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle“<br />
• Der Auftrag nach § 1 Abs. 3 SGB VIII<br />
„Jugendhilfe soll <strong>zur</strong> Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere<br />
<strong>1.</strong> junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und<br />
dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,<br />
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und<br />
unterstützen,<br />
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,<br />
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre<br />
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu<br />
schaffen.“<br />
• Kinderschutz ist deshalb immer schon ein zentraler Auftrag der<br />
Kinder- und Jugendhilfe<br />
Kinderschutz umfasst.....<br />
ein breites Spektrum von Maßnahmen<br />
• von primärer Prävention (Aufklärung,<br />
Information, Beratung über Pflege und Erziehung)<br />
• über sekundäre Prävention (Unterstützung von<br />
Eltern in belastenden Lebenssituationen, die<br />
spezifische Risiken für Kinder bergen)<br />
• bis <strong>zur</strong> Intervention bei akuter<br />
Kindeswohlgefährdung<br />
Zugang, Kooperation und Verweisung<br />
zwischen den Systemen<br />
• Gesellschaftliche Akzeptanz von ärztlicher Hilfe<br />
• Gesellschaftliche Stigmatisierung von „Hilfe“<br />
durch das Jugendamt (strukturelle Ambivalenz<br />
von Hilfe und Kontrolle)<br />
• Das Gesundheitssystem als Türöffner<br />
• Weitergabe von Daten und Vertrauensverhältnis<br />
Das Instrumentarium des SGB VIII<br />
vor dem Hintergrund von Art. 6 GG (1)<br />
• Der Schutz des Kindes vor Gefahren für ihr Wohl ist Teil der<br />
elterlichen Erziehungsverantwortung nach Art. 6 Abs.2 Satz 1 GG<br />
• Die primäre Aufgabe des Staates ist es, die Eltern bei der<br />
Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen<br />
• Ist das Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährdet und<br />
sind die Eltern nicht bereit oder in der Lage, die Gefährdung<br />
abzuwenden bzw. an der Abwendung mitzuwirken,<br />
so hat „der Staat“ die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des<br />
Kindes (durch rechtsverbindliche Einflussnahme auf die elterliche<br />
Erziehungsverantwortung) zu treffen<br />
• Adressaten, Aufgaben und Befugnisse sind gesetzlich geregelt (SGB<br />
VIII, BGB)
Das Instrumentarium des SGB VIII<br />
vor dem Hintergrund von Art. 6 GG (2)<br />
Das SGB VIII verpflichtet die Jugendämter<br />
• <strong>zur</strong> Gewährung von Hilfen <strong>zur</strong> Erziehung , wenn die<br />
Voraussetzungen des § 27 gegeben sind und die Eltern einverstanden<br />
sind<br />
• <strong>zur</strong> Anrufung des Familiengerichts, wenn die Gefährdung des<br />
Kindeswohls nicht durch Hilfen an die Eltern abgewendet werden<br />
kann<br />
• <strong>zur</strong> Inobhutnahme des Kindes oder Jugendlichen, wenn eine<br />
dringende Gefahr die Inobhutnahme erfordert und eine<br />
familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden<br />
kann.<br />
Kooperation mit den Eltern<br />
als Basis des Hilfeprozesses<br />
• Das Jugendamt gewährt Hilfen,<br />
– dabei nimmt es die Eltern in die Pflicht<br />
– trifft mit ihnen Vereinbarungen über die Ausgestaltung<br />
der Hilfe (Schutzkonzept)<br />
– zeigt die Konsequenzen mangelnder Kooperation auf<br />
– ist fachlich auf ein Mindestmaß von Kooperation mit<br />
den Eltern und dem Kind/ Jugendlichen angewiesen<br />
– kann die Inanspruchnahme von Hilfen durch die Eltern<br />
aber rechtlich nicht erzwingen<br />
Kooperation von<br />
Jugendamt und Gericht (1)<br />
• Das Familiengericht hat die Pflicht,<br />
eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden,<br />
wenn die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind,<br />
an der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken<br />
• Seine Maßnahmen reichen von Ge- und Verboten<br />
an die Eltern bis zum (teilweisen) Entzug der<br />
elterlichen Sorge<br />
• Diskutiert wird eine Konkretisierung des<br />
Maßnahmenrepertoires in § 1666 BGB<br />
Kooperation von<br />
Jugendamt und Gericht (2)<br />
• Das Jugendamt ruft das Gericht (erst) an,<br />
wenn es sein Handlungspotential<br />
ausgeschöpft hat<br />
• Trifft das Gericht keine Maßnahmen, so<br />
bleibt das gefährdete Kind schutzlos<br />
• Notwendig ist daher eine<br />
Verantwortungsgemeinschaft zwischen<br />
Jugendamt und Gericht
Besserer Schutz von Kindern und Jugendlichen<br />
vor Gefahren für ihr Wohl<br />
als Schwerpunkt<br />
des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes<br />
• Konkretisierung des Schutzauftrags des Jugendamts bei<br />
Kindeswohlgefährdung (§ 8a)<br />
• Systematische Neuordnung der Inobhutnahme (§ 42)<br />
• Versagung der Betriebserlaubnis für Einrichtungen<br />
fundamentalistischer Träger (§ 45)<br />
• Erweiterte Befugnis <strong>zur</strong> Erhebung und Weitergabe von Daten bei<br />
Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (§§ 64, 65)<br />
• Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit<br />
bestimmten Vorstrafen (§ 72 a)<br />
Konkretisierung und Strukturierung<br />
des Schutzauftrags –<br />
Der Hintergrund (1)<br />
• Dramatische Fälle von Kindesmisshandlung und<br />
Kindesvernachlässigung<br />
• Strafverfahren gegen Fachkräfte der Jugendhilfe<br />
wegen Verletzung der Garantenpflicht<br />
• Unsicherheiten und Missverständnisse im<br />
Zusammenhang mit der Dienstleistungsdebatte<br />
• Die Rechtsprechung des BGH <strong>zur</strong> Amtshaftung<br />
bei Amtspflichtverletzung im Jugendamt<br />
Konkretisierung und Strukturierung<br />
des Schutzauftrags –<br />
Der Hintergrund (1)<br />
• Dramatische Fälle von Kindesmisshandlung und<br />
Kindesvernachlässigung<br />
• Strafverfahren gegen Fachkräfte der Jugendhilfe<br />
wegen Verletzung der Garantenpflicht<br />
• Unsicherheiten und Missverständnisse im<br />
Zusammenhang mit der Dienstleistungsdebatte<br />
• Die Rechtsprechung des BGH <strong>zur</strong> Amtshaftung<br />
bei Amtspflichtverletzung im Jugendamt<br />
Konkretisierung des Schutzauftrags – Der<br />
Hintergrund (2)<br />
• Das Jugendamt „zwischen“ den<br />
Forderungen nach<br />
– effektivem Kindesschutz und<br />
– Achtung der Elternautonomie<br />
• Die Entwicklung von Verfahrensstandards<br />
in der Praxis
„Helfen mit Risiko“<br />
• „Kinder schützen- Eltern unterstützen“<br />
• Der Zugang zu den Eltern als Schlüssel für<br />
die Hilfe für das Kind<br />
• Das Gefährdungsrisiko für das Kind und die<br />
Schutzpflicht des Staates<br />
Konzeption der Regelung in § 8a<br />
• (Reaktive) Informationsgewinnung und<br />
Gefährdungseinschätzung als Aufgabe des<br />
Jugendamts<br />
• Beteiligung des Kindes oder Jugendlichen und der<br />
Personensorgeberechtigten<br />
• Wahrnehmung des Schutzauftrags durch die<br />
Leistungserbringer<br />
• Reaktionsalternativen des Jugendamts in eigener<br />
Kompetenz<br />
• Einschaltung anderer Stellen<br />
„Gewichtige Anhaltspunkte“<br />
• Funktion: Eingangsschwelle für die<br />
Wahrnehmung des Schutzauftrags<br />
• Definition: „Konkrete Hinweise, ernst zu<br />
nehmende Vermutungen“<br />
• Prozesscharakter der Klärung von Gefährdungen<br />
• Je höher die Eingangsschwelle<br />
– Umso weniger „Fälle“<br />
– Umso größer die Gefahr, weniger sichtbare Anzeichen<br />
zu übersehen<br />
Optionen<br />
• Intensiveres Raster und häufiger „blinder<br />
Alarm“<br />
oder<br />
• Konzentration auf markante Fälle und<br />
Gefahr der Ignoranz weniger eindeutiger<br />
Hinweise
Zentrale Anforderungen an die<br />
Umsetzung des Schutzauftrages<br />
• „Wahrnehmen – Deuten - Urteilen - Handeln“<br />
• Etablierung eines Verfahrens im Jugendamt über<br />
den Umgang mit Meldungen<br />
• Qualifizierung der Fachkräfte in der<br />
Gefährdungseinschätzung und Entwicklung von<br />
Arbeitshilfen (Beobachtungskatalogen)<br />
• <strong>Dokumentation</strong> der Verfahrenschritte im<br />
Einzelfall<br />
• Monitoring und Fehleranalyse<br />
Indikatoren für eine<br />
Kindeswohlgefährdung<br />
• Die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung ist<br />
keine Tatsachenbeschreibung, sondern eine<br />
zwangsläufig hypothetische (Risiko)Einschätzung<br />
auf der Grundlage relevanter Informationen<br />
• Es gibt kein gesichertes System von Indikatoren<br />
• Anhaltspunkte beim Kind<br />
• Anhaltspunkte im sozialen Bezugssystem<br />
• Anhaltspunkte für eine mangelnde Fähigkeit/<br />
Bereitschaft der Eltern <strong>zur</strong> Mitwirkung<br />
Einbeziehung der Leistungserbringer (§ 8a Abs. 2)<br />
• Adressaten: alle Leistungserbringer nach dem SGB VIII<br />
• Instrument: Vereinbarung<br />
• Inhalt:<br />
– Eigenverantwortliche Abschätzung des Gefährdungsrisikos<br />
– Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, von denen eine eine<br />
insoweit erfahrene Fachkraft sein muss<br />
– Einbeziehung der Personensorgeberechtigten sowie des Kindes<br />
oder Jugendlichen<br />
– Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfe bei den Eltern<br />
– Information des Jugendamts, wenn<br />
• die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind, Hilfe in Anspruch zu<br />
nehmen<br />
• die angenommene Hilfe nicht ausreicht<br />
• Die Ausgestaltung der Vereinbarung muss dem jeweiligen<br />
Leistungsprofil der Einrichtung/ des Dienstes Rechnung<br />
tragen<br />
Fachkräfte als Akteure des Schutzauftrags<br />
nach § 8a<br />
• Die Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a ist<br />
Aufgabe von Fachkräften<br />
• Maßgeblich ist die Definition der Fachkraft in § 72 SGB<br />
VIII<br />
• Unerheblich ist das Beschäftigungsverhältnis<br />
• „Erfahrene“ Fachkräfte i.S. von § 8 a Abs.2 sind solche,<br />
die über spezifische Kompetenzen <strong>zur</strong><br />
Gefährdungseinschätzung verfügen<br />
• Diese können je nach Leistungsprofil der Einrichtung/ des<br />
Dienstes dort tätig sein oder müssen von außen<br />
hinzugezogen werden
Beteiligung von Vormund/ Pfleger<br />
• Ist für das Kind bereits ein Vormund oder Pfleger bestellt,<br />
so ist er (vom ASD/ RSD) unverzüglich über<br />
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu<br />
informieren und in die Risikoabschätzung<br />
einzubeziehen (§ 8a Abs.1 Satz 2)<br />
• Alle weiteren Entscheidungen über die Abwendung einer<br />
Kindeswohlgefährdung hat der Vormund oder Pfleger<br />
eigenverantwortlich zu treffen (sofern nicht er selbst das<br />
Kindeswohl gefährdet und <strong>zur</strong> Abwendung nicht bereit<br />
oder in der Lage ist)<br />
• Eine Anrufung des FamG ist in der Regel nicht<br />
erforderlich, weil der Vormund personensorgeberechtigt ist<br />
Sozialdatenschutz und<br />
Kindeswohlgefährdung<br />
• Datenschutz als zentraler fachlicher Standard<br />
• Informationelle Selbstbestimmung und<br />
fremdnütziges Elternrecht<br />
• Informationsverschaffung bei dritten Personen<br />
• Weitergabe anvertrauter Daten <strong>zur</strong><br />
Risikoeinschätzung<br />
–im Fachteam<br />
– bei Wechsel der Fachkraft<br />
– bei Wechsel der örtl. Zuständigkeit<br />
Informationsverschaffung<br />
bei dritten Personen (§ 62 Abs. 3)<br />
• Ist die Erhebung von Sozialdaten bei den Eltern<br />
nicht möglich,<br />
– weil die Eltern sich weigern, an der Risikoeinschätzung<br />
mitzuwirken<br />
– weil bei einer Erhebung der Geheimhaltungsdruck auf<br />
das Kind erhöht würde<br />
so dürfen Sozialdaten auch bei dritten Personen<br />
(z.B. Nachbarn, Erzieherin im Kindergarten)<br />
erhoben werden<br />
Weitergabe anvertrauter Daten<br />
(§ 65 Abs.1)<br />
• Befugnis <strong>zur</strong> Weitergabe anvertrauter Daten<br />
<strong>zur</strong> Abschätzung des Gefährdungsrisikos<br />
– an die hinzugezogenen Fachkräfte <strong>zur</strong><br />
Abschätzung des Gefährdungsrisikos (Nr.4)<br />
– an die neu zuständige Fachkraft<br />
• nach Wechsel der Fallzuständigkeit im Jugendamt<br />
(Nr.3 Alt.1)<br />
• nach Wechsel der örtl. Zuständigkeit (Nr. 3 Alt.2)
Arbeitshilfen (1)<br />
• Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht –<br />
DIJuF (Hrsg.): Verantwortlich handeln- Schutz und Hilfe<br />
bei Kindeswohlgefährdung – Saarbrücker Memorandum –<br />
Köln 2004<br />
• Deutsches Jugendinstitut (DJI): Handbuch<br />
Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und<br />
Allgemeiner Sozialer Dienste (ASD) – www.dji/asd.de<br />
• Institut für soziale Arbeit (ISA): Der Schutzauftrag bei<br />
Kindeswohlgefährdung –Arbeitshilfe <strong>zur</strong> Kooperation<br />
zwischen Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe<br />
(Stand März 2006)<br />
Arbeitshilfen (2)<br />
• Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke)<br />
Kindesschutz und Beratung, Empfehlungen <strong>zur</strong> Umsetzung des<br />
Schutzauftrags, Fürth 2006<br />
• Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge<br />
– Empfehlungen <strong>zur</strong> Umsetzung des § 8a SGB VIII: NDV 2006, 494<br />
– Empfehlungen <strong>zur</strong> Umsetzung des § 72 a SGB VIII (Stand 26.5.2006)<br />
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter<br />
(www.bagljae.de)<br />
– Hinweise <strong>zur</strong> Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII<br />
– Hinweise <strong>zur</strong> Eignungsüberprüfung von Fachkräften der Kinder- und<br />
Jugendhilfe nach § 72 a SGB VIII<br />
Arbeitshilfen (3)<br />
• Jordan, Erwin (Hrsg.):<br />
Kindeswohlgefährdung- Rechtliche Neuregelungen und<br />
Konsequenten für den Schutzauftrag der Kinder- und<br />
Jugendhilfe - Weinheim und München 2006<br />
• Bundesministerium der Justiz (bmj.bund.de)<br />
Arbeitsgruppe „Familiengerichtliche Maßnahmen bei<br />
Gefährdung des Kindeswohls“<br />
Abschlussbericht vom 17.1<strong>1.</strong>2006<br />
Arbeitshilfen (4)<br />
• IKK-Nachrichten Heft 1-2/ 2006<br />
§ 8a SGB VIII<br />
Herausforderungen bei der Umsetzung<br />
Themenheft mit Beiträgen von<br />
R.Wiesner, G. Schindler, H.Kindler/ S.Lillig,<br />
R. Schone, K.Theißen,St. Rietmann, Chr. Gerber,<br />
C. Bundschuh, I. Johns
Ambulanter Sozialdienst<br />
Beispiel der Fallbearbeitung<br />
Eine junge Frau (19 Jahre)<br />
verlässt im Streit ihr<br />
Elternhaus. Später bemerkt<br />
sie, dass sie schwanger ist.<br />
Der Sozialdienst Junge<br />
Menschen wird zuständig.<br />
Eine Einbindung in eine<br />
Mutter-Kind Einrichtung<br />
scheitert. Ebenso eine<br />
Unterstützung der werdende<br />
Mutter über eine Intensive<br />
Sozialpädagogische<br />
Einzelmaßnahme. Die<br />
Begleitung der jungen Frau in<br />
der eigenen Wohnung wird<br />
zunächst durch den<br />
Sozialdienst sichergestellt.<br />
Später wird eine<br />
Familienhebamme eingesetzt,<br />
die angenommen wird.<br />
Kerstin Reiners<br />
ISE<br />
SDJM<br />
<strong>Kinderschutzkonferenz</strong> Mai <strong>2007</strong> Ambulanter Sozialdienst – Kerstin Reiners 2<br />
M&K<br />
Das Kind (hier Ole) wird<br />
geboren und nach kurzer Zeit<br />
wird eine mehrfach<br />
Schwerstbehinderung<br />
diagnostiziert. Oles<br />
gesundheitliche Situation ist<br />
instabil und bedarf großer<br />
Fürsorge. In der Folgezeit<br />
wird er häufig stationär in der<br />
Kinderklinik aufgenommen.<br />
Nachdem die<br />
Familienhebamme nach<br />
einem Jahr ihr Tätigkeit in<br />
dieser Familie beendet, droht<br />
das empfindliche System<br />
zusammenzubrechen.<br />
Als die junge Mutter ein<br />
weiteres Kind bekommt, wird<br />
ein Sozialpädagogische<br />
Familienhilfe eingesetzt.<br />
SDJM<br />
<strong>Kinderschutzkonferenz</strong> Mai <strong>2007</strong> Ambulanter Sozialdienst – Kerstin Reiners 3<br />
Durch die schwere<br />
Behinderung von Ole, die<br />
damit verbundene ärztliche<br />
Versorgung und<br />
therapeutische Einbindung,<br />
sowie durch die notwendige<br />
Unterstützung und Kontrolle<br />
des Sozialdienstes Junger<br />
Menschen sind effektive<br />
Kooperationen, also eine<br />
Vernetzung aller beteiligten<br />
Professionen unumgänglich.<br />
Die Sozialpädagogische<br />
Familienhilfe wird nach zwei<br />
Jahren beendet, da die im<br />
Hilfeplan formulierten Ziele<br />
erreicht sind. Kurze Zeit<br />
danach kippt das<br />
Familiensystem erneut.<br />
<strong>Kinderschutzkonferenz</strong> Mai <strong>2007</strong> Ambulanter Sozialdienst – Kerstin Reiners 4<br />
SpFH<br />
SpFH<br />
SDJM
Ole wurde von seiner Mutter<br />
aufgrund seiner gesundheitlich<br />
schlechten Situation erneut in<br />
die Kinderklinik gebracht. Der<br />
behandelnde Arzt wollte nach<br />
der Stabilisierung eine<br />
Entlassung <strong>zur</strong> Mutter nicht<br />
verantworten. Es wurden in<br />
Kooperationsgesprächen<br />
mehrer Hilfemöglichkeiten<br />
besprochen: das Ergebnis war<br />
die vorübergehende stationäre<br />
Heimaufnahme von Ole. Da<br />
eine Rückführung in die Familie<br />
eine Perspektive der Hilfe sein<br />
sollte, kam eine auswärtige<br />
Unterbringung nicht in Betracht.<br />
In den in Frage kommenden<br />
Einrichtungen war nicht sofort<br />
ein Platz frei. Es kam <strong>zur</strong><br />
Verzögerung bei der<br />
Unterbringung, dies erforderte<br />
eine gute Kommunikation der<br />
beteiligten Fachkräfte.<br />
<strong>Kinderschutzkonferenz</strong> Mai <strong>2007</strong> Ambulanter Sozialdienst – Kerstin Reiners 5<br />
An diesem Fall wird<br />
deutlich, wie wichtig ein<br />
engmaschige Vernetzung<br />
und eine gute Kooperation<br />
mit Fallkonferenzen ist.<br />
Weiter ist erkennbar, dass<br />
an einigen Punkten ein<br />
Umdenken bzw. ein<br />
veränderter Blickwinkel<br />
notwendig ist, um eine<br />
Gesamtsituation neu zu<br />
beurteilen.<br />
SDJM<br />
<strong>Kinderschutzkonferenz</strong> Mai <strong>2007</strong> Ambulanter Sozialdienst – Kerstin Reiners 6<br />
SDJM
Sabine Heinke<br />
Richterin am Amtsgericht/Familiengericht Bremen<br />
Sabine.Heinke@Amtsgericht.Bremen.de; Tel. (0421) 361-4256<br />
Kinderschutz aus Sicht des Familiengerichts<br />
Zuständigkeit des Familiengerichts<br />
- Sorgerechtsentziehungsverfahren, §§ 1666, 1666a BGB<br />
Überprüfungs- und Ermahnungsverfahren, § 8a SGB VIII<br />
- Unterbringung Minderjähriger in geschlossener Einrichtung,<br />
§ 1631b BGB<br />
- Herausnahme aus der Pflegefamilie, § 1632 Abs. 4 BGB<br />
- Regelungen nach dem Tod/Erkrankung eines Elternteils,<br />
§ 1680 BGB<br />
- Untersagung von Kontakt, § 1632 Abs. 1 BGB<br />
- Sorgerechtsregelung zwischen streitenden Eltern, Umgangsrechte<br />
verschiedener Erwachsener mit dem Kind<br />
Wer kann sich an den Familienrichter wenden?<br />
Jeder, der meint, dass ein Kind gefährdet sein könnte.<br />
Kein Antragserfordernis, keine Formalvorgaben, außer Zivilcourage.<br />
Was versteht der Familienrichter unter Kindeswohlgefährdung<br />
?<br />
Grundsätzlich jede Gefährdung des körperlichen, geistigen und seelischen<br />
Wohls eines Kindes.<br />
- Auffälligkeiten beim Kind<br />
- Fehlhaltungen bei den Eltern<br />
Standardsituationen: Entwicklungsverzögerungen, Lernschwierigkeiten,<br />
unregelmäßiger Schulbesuch, Aggressivität, Depressivität,<br />
körperliche Auffälligkeiten beim Kind, Hunger, Zeichen von<br />
Mangelernährung, zuweilen auch Überernährung, vernachlässigte<br />
äußere Erscheinung, Äußerungen des Kindes<br />
Eltern: Alkohol-, Drogen- und/oder Tablettenkonsum, Partnerschaftsproblematik,<br />
Partnerschaftsgewalt, psychische Erkrankung,<br />
wechselnde Partner, wirtschaftliche Probleme, Leistungsstress,<br />
häufige Wohnungswechsel, sonstige Stressfaktoren (Krankheiten,<br />
Behinderungen, Todesfälle, Krisen)<br />
Es kommt nicht darauf an, ob die Eltern an der krisenhaften Entwicklung<br />
Schuld tragen. Es kommt allein darauf an, dass und wie<br />
sich das Verhalten belastend und schädigend auf die Kinder auswirkt<br />
oder voraussichtlich auswirken wird.
Was tut der Richter?<br />
Der Richter braucht ein Vorverständnis über die Gefährlichkeit von<br />
Situationen und Verhaltenweisen. Er ist Jurist, braucht folglich Hinweise<br />
der Fachleute.<br />
Der Richter<br />
- führt Ermittlungen durch (hat dafür kein Hilfspersonal), Ziel<br />
der Ermittlungen: Klärung der Gefährdungslage<br />
- ergreift Sicherheitsmaßnahmen<br />
- überprüft und diskutiert Abhilfemöglichkeiten mit den Eltern<br />
und den Hilfeleistern<br />
- vereinbart Kontrollen<br />
- ändert vormals getroffene Entscheidungen, wenn die Tatsachenlage<br />
sich ändert.<br />
Die Fragen, die immer wieder gestellt werden müssen:<br />
- Was ist mit dem Kind? Wie gefährdet ist sein Wohl?<br />
- Ist damit zu rechnen, dass die Eltern ihr Verhalten ändern<br />
können?<br />
- Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?<br />
- Kann dies dem Kind zugemutet werden?<br />
- Was passiert, wenn die Eltern voraussichtlich ihr Verhalten<br />
nicht ändern werden?<br />
Zur Klärung hat der Richter verschiedene Möglichkeiten:<br />
- Anhörung von Kind und Eltern<br />
- Hausbesuche<br />
- Ärztliche/psychiatrische Untersuchungen<br />
- Befragungen von Zeugen<br />
- Beziehen von Akten und Unterlagen<br />
- Schweigepflicht<br />
Es besteht keine Pflicht von Eltern (und Kindern), an Untersuchungen<br />
aller Art mitzuwirken, hier ist Einverständnis erforderlich (z.B.<br />
Drogentest nur einvernehmlich).<br />
Wenn das Einverständnis nicht erteilt wird, muss der Richter sich<br />
Indizien zusammen suchen - über den Drogenkonsum beispielsweise<br />
- und die Weigerung der Eltern/des Elternteils wertend berücksichtigen.<br />
Das Gericht trifft Entscheidungen, die rechtliche Auswirkungen haben.<br />
- Vorläufige Anordnungen, Herausnahme der Kinder<br />
- Sorgerechtsentzug<br />
- Bestellung eines (Amts)vormundes<br />
Das Gericht ist nicht Fachbehörde, sondern Rechtsdurchsetzungsinstanz.<br />
In Bremen gibt es seit Anfang <strong>2007</strong> die schon mehrfach geforderte<br />
richterliche Sonderzuständigkeit für Sorgerechtsentziehungsverfahren<br />
und vergleichbare Verfahren. Zwei Richterinnen (Abteilung 61<br />
und 67) sind für diese Verfahren ausschließlich zuständig, es sei<br />
denn, die Sorgerechtsüberprüfung erfolgt im Rahmen eines Scheidungsverfahrens,<br />
dann ist der für das Scheidungsverfahren der<br />
Eltern zuständige Richter auch für das Sorgerechtsentziehungsverfahren<br />
zuständig.
etr. mdj. K. M., geb. am 03.10.2004 und<br />
S. M., geb. am 0<strong>1.</strong>12.2005<br />
Amt für Soziale Dienste, Sozialdienst Junge Menschen -<br />
Jugendamt Bremen<br />
Antragsteller<br />
gegen<br />
1) B. M., geb. am 20.09.1986, F.-Str., Bremen<br />
2) A. L., O-Straße, Bremen<br />
Verfahrensbevollm.: für Antragsgegnerin zu 1:<br />
RAe X, Bremen,<br />
Verfahrensbevollm.: für Antragsgegner zu 2:<br />
RAe Y, Bremen,<br />
Beteiligt:<br />
Amt für Soziale Dienste, Amtsvormundschaft<br />
AMTSGERICHT BREMEN<br />
Beschluss (*)<br />
Mutter/Antragsgegnerin<br />
Antragsgegner/Beteiligter<br />
In der Familiensache<br />
I. Die Verfahren 61 F ... (Entziehung der elterlichen Sorge<br />
betr. mdj. K. M.) und 61 F ... (Entziehung der elterlichen<br />
Sorge betr. mdj. S. M.) werden zu gemeinsamer Entscheidung<br />
verbunden.<br />
II. Das Sorgerecht für den am 03.10.2004 geborenen K. M.<br />
wird den Eltern entzogen, zugleich wird der Mutter das Sorgerecht<br />
für die am 0<strong>1.</strong>12.2005 geborene S. M. entzogen.<br />
III. Für beide Kinder wird eine Vormundschaft eingerichtet.<br />
IV. Zum Vormund wird jeweils das Jugendamt Bremen bestellt.<br />
V. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben;<br />
außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.<br />
VI. Der Gegenstandswert wird auf 6.000 EUR festgesetzt.<br />
(*) Sorgerechtsentziehungsbeschluss: Anlage zum Vortrag von Sabine Heinke,<br />
Richterin am Amtsgericht/Familiengericht Bremen, auf der <strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
am 9. Mai <strong>2007</strong>.<br />
Der Beschluss weist aus, was das Gericht prüfen muss, welche Fakten es gesammelt<br />
hat und wie es die Abwägung der einzelnen Risikofaktoren vornimmt.
Gründe:<br />
I. Frau M. und Herr L. sind nicht miteinander verheiratet. Sie sind die<br />
Eltern des Kindes K., geboren am 03.10.2004. Sie haben für dieses<br />
Kind im Mai 2005 eine Sorgeerklärung gem. § 1626a BGB abgegeben.<br />
Frau M. lebte mit dem Baby K. zunächst bei ihrer eigenen Mutter in<br />
einer 2-Zimmer-Wohnung mit 3 Erwachsenen. Zunächst wurde eine<br />
Familienhelfermaßnahme eingerichtet, um die Mutter bei der Versorgung<br />
des Kindes zu unterstützen. Im November 2004 verließ sie mit<br />
dem Baby die Wohnung ihrer Mutter und zog zu den Eltern des Kindesvaters,<br />
wo sie bis Dezember blieb. Dort „flog sie“ nach ihren eigenen<br />
Worten nach kurzer Zeit „raus“. Da sie eine Unterkunft nicht hatte,<br />
ließ sie sich vom Jugendamt schließlich dazu bewegen, zum<br />
02.02.2005 mit K. in eine Mutter-Kind-Einrichtung umzuziehen, in der<br />
Zwischenzeit hatte sie noch einmal Unterkunft bei ihrer Mutter gefunden,<br />
die als Alkoholikerin bekannt ist.<br />
Die Betreuung in der Mutter-Kind-Einrichtung wurde mit 24 Stunden<br />
wöchentlich durchgeführt, gestaltete sich aber von Anfang an schwierig,<br />
weil Frau M. die Hilfsmaßnahmen als Kontrolle empfand und dies<br />
auch äußerte. Wie sich aus dem Bericht der Mutter-Kind-Einrichtung<br />
ergibt, war die Mutter nicht in der Lage, K. richtig zu füttern und zu versorgen,<br />
im Einzelnen hat sie ihm zu wenig und nicht altersgerechte<br />
Nahrung gegeben, sie hat ihm, einem nur wenige Monate alten Kind,<br />
allein die Flasche überlassen, so dass er nicht ausreichend trinken<br />
konnte und außerdem die Gefahr bestand, dass er sich verschluckt<br />
und erstickt, sie hat sich dem Kind nicht gewidmet, hat es oft ins Bett<br />
gelegt, sie war nicht in der Lage, ihren Tagesablauf auf den des Kindes<br />
einzustellen, sie war nicht in der Lage, ihr Geld so einzuteilen,<br />
dass sie für K. auch am Monatsende noch Nahrung hatte. Hilfestellung<br />
in Bezug auf das Haushalten lehnte sie als Kontrolle ab. K. war nicht<br />
witterungsgemäß gekleidet, sie achtete nicht auf die Sicherheit des<br />
Kindes, so dass er beispielsweise vom Bett fiel. Frau M. fühlte sich oft<br />
überfordert und war nicht bereit, sich auf die Bedürfnisse des Kindes<br />
nach Zuwendung einzustellen, auch konnte sie nicht altersangemessen<br />
mit ihm spielen. Wenn er schrie, steckte sie ihn ins Bett, um ihn<br />
erklärtermaßen vor ihren eigenen Wutausbrüchen zu schützen.<br />
Herr L. besuchte die Mutter der Mutter-Kind-Einrichtung, bekam aber<br />
Hausverbot, weil er sich nicht an die Hausordnung hielt. Zwischen ihm<br />
und Frau M. kam es nach den Schilderungen der Mitbewohner wiederholt<br />
zu lautstarken, teils gewalttätigen Auseinandersetzungen, Frau<br />
M. trug Verletzungen davon. Es wurde auf ihre Initiative hin begleiteter<br />
Umgang installiert.<br />
Am Wochenende 20./2<strong>1.</strong>02.2005 muss es zu einer Misshandlung des<br />
Kindes gekommen sein, wobei nicht geklärt werden konnte, wer das<br />
Kind misshandelt hat und wie die näheren Umstände waren. Am<br />
22.02. entdeckten die Mitarbeiterinnen der Mutter-Kind-Einrichtung<br />
mehrere Hämatome an K.s Gesäß und Oberschenkel, die die Mutter<br />
bis dahin nicht bemerkt haben wollte. Anlässlich eines Impftermins am<br />
23.02.2005 hat Frau M. sodann den Kinderarzt auf die Hämatome<br />
aufmerksam gemacht, die K. hatte und deren Herkunft sie sich nicht<br />
erklären konnte. Der Arzt stellte bei dem zum damaligen Zeitpunkt 4,5<br />
Monate alten Kind auf der rechten Gesäßhälfte ein handflächengroßes<br />
massives Hämatom fest, am rechten Oberschenkel ein etwa 6 x 6 cm<br />
großes Hämatom und auf der linken Gesäßhälfte ein ca. 5 x 5 cm großes<br />
Hämatom, allesamt mehrere Tage alt. Der Arzt hat sich dahin geäußert,<br />
dass die festgestellten Hämatome auf massive Gewalteinwirkung,<br />
allenfalls auf einen Unfall <strong>zur</strong>ückzuführen seien. Von einem Unfall,<br />
den K. gehabt haben könnte, berichtet die Mutter nichts.<br />
Sie erklärt, dass ein Bekannter einige Zeit mit dem Kind allein gewesen<br />
ist und dieser das Kind geschlagen haben könnte.<br />
Der Vater hat am 20.04.2005 über seinen Anwalt dem Jugendamt<br />
mitteilen lassen, Frau M. habe K. um Weihnachten 2004 zweimal auf<br />
den Bauch gehauen, auch habe sie das Kind wiederholt durchgeschüttelt,<br />
wenn es geschrieen habe. Er berichtet von wechselnden Männer-
eziehungen der Mutter, Anfang April hatte er sich bereits an das Jugendamt<br />
gewendet und erklärt, er habe Bedenken, ob K. bei der Mutter<br />
ausreichend versorgt werde.<br />
Am 26.04.2005 verlässt Frau M. mit K. die Mutter-Kind-Einrichtung,<br />
weil sie wieder „frei“ sein wolle. K. wird vom Jugendamt in Obhut genommen<br />
und in einer Übergangspflegestelle untergebracht, die damals<br />
noch allein sorgeberechtigte Mutter stimmt dem zunächst zu.<br />
Zuvor hatten die Mitarbeiterinnen der Einrichtung mitgeteilt, dass sie<br />
trotz verstärkter Kontrolle nicht für die Sicherheit von K. einstehen<br />
könnten. K. ist zum Zeitpunkt der Inobhutnahme gesund, aber ungepflegt.<br />
Die Kindesmutter erklärte in der Folge, sie habe eine Wohnung in der<br />
G.-Straße angemietet, in der sie gemeinsam mit dem Vater des Kindes<br />
und dem Kind wohnen wolle.<br />
Der Vater erklärte in etwa zeitgleich, er habe sich einer anderen Frau<br />
zugewandt, Frau W.. Er wolle zu ihr und ihrem Kind nach Delmenhorst<br />
ziehen und könne und wolle K. dann zu sich nehmen. Frau W. könne<br />
K. dann betreuen, während er tagsüber berufstätig sei. Von Frau M.<br />
habe er sich getrennt.<br />
Frau W. wird zu diesem Zeitpunkt von einer Familienhebamme unterstützt,<br />
es besteht auch eine Familienhelfermaßnahme. Frau W. leidet<br />
nach eigenen Angaben an einem Hirntumor. Frau W. ihrerseits teilt<br />
dem Jugendamt im Juli 2005 mit, dass sie die Beziehung zu Herrn L.<br />
beendet habe.<br />
Herr L. zog demzufolge nicht nach Delmenhorst, sondern suchte gemeinsam<br />
mit Frau M., die erneut schwanger war, eine Wohnung, die<br />
sie schließlich in Bremen-Nord fanden.<br />
Die Eltern besuchten K. in dieser Zeit erst in den Räumen des Jugendamtes,<br />
dann im Rahmen eines begleiteten Umgangs in den<br />
Räumlichkeiten des Trägers. Auf ihren Wunsch hin wurde der Besuchstermin<br />
nach Weihnachten in ihrer Wohnung in Bremen-Nord<br />
durchgeführt. Die Begleiterin stellte bei dieser Gelegenheit fest, dass<br />
das Kinderzimmer nicht eingerichtet, sondern mit Abfall und nicht benötigten<br />
Gegenständen voll gestellt war. Die Wohnung habe sich in<br />
einem chaotischen Zustand befunden und sei wegen diverser Gefahrenquellen<br />
für den Aufenthalt eines (Klein)kindes nicht geeignet gewesen.<br />
Diese Wohnung ist zwischenzeitlich bereits wieder aufgegeben,<br />
Herr L. wohnt wieder bei seinen Eltern.<br />
Am 0<strong>1.</strong>12.2006 wurde Frau M. von ihrer Tochter S. entbunden. Vater<br />
des Kindes soll Herr L. sein, die Vaterschaft ist bislang aber weder<br />
anerkannt noch festgestellt (Anmerkung: Das Vaterschaftsfeststellungsverfahren<br />
läuft, Vater und Mutter sind <strong>zur</strong> Probenentnahme nicht<br />
erschienen). Die Mitarbeiter der Entbindungsklinik informierten das<br />
Jugendamt darüber, dass die Mutter mit S. nicht angemessen umgehe.<br />
Das Gericht hat auf Antrag des Jugendamtes der Mutter u.a. das Aufenthaltsbestimmungsrecht<br />
und die Gesundheitsfürsorge entzogen. S.<br />
wurde in die gleiche Pflegestelle gegeben, in der K. bereits versorgt<br />
wurde. Über Weihnachten musste S. in die Intensivstation gebracht<br />
werden. Sie hatte plötzlich einen Pulsschlag von über 200 pro Minute<br />
und nahm keine Flüssigkeit mehr auf. Die Pflegeeltern haben sie dann<br />
schnell ins Krankenhaus gebracht. Die nachfolgenden Untersuchungen<br />
haben ergeben, dass das Kind wohl eine Verengung in einem der<br />
zum Herzen führenden Blutgefäße hat. Bei dieser Gelegenheit stellte<br />
sich im Übrigen heraus, dass S. nicht krankenversichert war, weil die<br />
Eltern sie nicht angemeldet hatten; auch war die Geburt noch nicht<br />
beurkundet worden. Diese Beurkundung und Versicherung wurden<br />
dann von dem vom Gericht entsprechend eingesetzten Amtsvormund<br />
in die Wege geleitet.<br />
Das Jugendamt beantragt, den Eltern bzw. der Mutter das Sorgerecht<br />
für K. und S. zu entziehen.
Die Eltern wenden sich gegen diese Anträge. Sie möchten, dass ihre<br />
Kinder bei ihnen leben und begehren zugleich die Aufhebung der gerichtlichen<br />
Eilmaßnahmen.<br />
Das Gericht hat die Eltern und das Jugendamt angehört, die Zeugin<br />
W. und die Mitarbeiterin der Mutter-Kind-Einrichtung, Frau C. Vernommen<br />
sowie ein psychologisches Sachverständigengutachten eingeholt.<br />
Wegen des Vorbringens der Beteiligten wird auf die <strong>zur</strong> Akte<br />
gereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsniederschriften<br />
Bezug genommen. Die Ausführungen der Sachverständigen finden<br />
sich in ihrem schriftlichen Gutachten und in der Sitzungsniederschrift.<br />
Auf die vom Jugendamt vorgelegten Berichte wird ebenfalls Bezug<br />
genommen.<br />
II. Den Kindeseltern ist das Sorgerecht für K. zu entziehen, denn das<br />
körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes ist durch Vernachlässigung<br />
des Kindes und durch unverschuldetes Versagen der Eltern<br />
gefährdet. Die Eltern sind nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden.<br />
Auch öffentliche Hilfen reichen nicht aus, um die Eltern hierzu in die<br />
Lage zu versetzen, §§ 1666, 1666a BGB. Das gleiche gilt in Bezug auf<br />
S., wobei hier allein die Mutter Sorgerechtsinhaberin ist. Eine Bestellung<br />
von Herrn L. als Vormund gem. § 1680 Abs. 3 BGB scheitert bereits<br />
an der fehlenden Vaterschaftsanerkennung; sie ist aber auch<br />
deshalb ausgeschlossen, weil Herr L. genauso wie Frau M. nicht als<br />
erziehungsfähig anzusehen ist.<br />
<strong>1.</strong> Die Gefährdung von K. ergibt sich aus Folgendem:<br />
a) Das körperliche Wohl des Kindes wird in verschiedener Weise beeinträchtigt:<br />
K. ist im Februar 2005 misshandelt worden. Die Hämatome<br />
auf beiden Gesäßhälften und am Oberschenkel lassen sich schon<br />
kaum durch einen Sturz erklären, denn man stürzt nicht zugleich auf<br />
zwei gegenüber liegende Körperhälften. Vielmehr muss das Kind gewaltsamen<br />
Handlungen von Erwachsenen ausgesetzt gewesen sein.<br />
Dies war entweder die Mutter selbst oder aber ein Dritter, vor dem sie<br />
das Kind nicht geschützt hat.<br />
Nach Angaben des Vaters schüttelt die Mutter das Kind, für einen<br />
Säugling schlicht lebensgefährlich, genauso wie der Umstand, dass<br />
die Mutter den Säugling allein gelassen hat, obwohl er sich schon auf<br />
die Seite drehen konnte, in der Folge fiel er vom Bett, zum Glück, ohne<br />
sich zu verletzen.<br />
Beim Fotografieren des Kindes anlässlich der Besuche ließ die Mutter<br />
K. so knapp an der Tischkante sitzen, dass die Besuchsbegleiterin sich<br />
zum Einschreiten veranlasst sah, damit das Kind nicht vom Tisch fiel.<br />
In der Wohnung in Bremen-Nord waren während des Besuches von K.<br />
gefährliche Gegenstände in dessen Reichweite (Besteck, Essensreste,<br />
Meerschweinchenkot), so dass Verletzungs- und/oder Infektionsgefahr<br />
bestand. Frau M. ist mit der Haushaltführung überfordert, sie kann es<br />
offensichtlich nicht. Die Mutter-Kind-Einrichtung stellte fest, dass sich<br />
ihre Wohnung fast durchgängig in einem unordentlichen und dreckigen<br />
Zustand befindet. Das wird auch für die Wohnung in Bremen-Nord<br />
berichtet, sowohl von der Sachverständigen wie von der Besuchsbegleiterin.<br />
Die Ernährung des Kindes war nicht altersgemäß und nicht ausreichend.<br />
Frau C. berichtet, dass der Junge nicht die empfohlene Nahrung<br />
bekam, dass die Mutter mit den Milchpackungen 5 Tage reichte,<br />
obwohl diese nur für 2,5 Tage bemessen gewesen seien, auch habe<br />
sie angegeben, dass der Junge bei ihrer Mutter Gulasch zu essen<br />
bekomme (mit 5 Monaten) und sie selbst fütterte ihn mit Keksen und<br />
Schokolade, was für ein fünf Monate altes Kind keine verdauliche Nahrung<br />
ist.<br />
Außerdem ließ sie ihn mit der Flasche allein. Ein fünf Monate altes<br />
Kind kann aber selbst die Flasche nicht zielgerichtet halten, er bekommt<br />
also keine Nahrung. Außerdem kann er sich, wenn ihm dies
zuweilen doch gelingt, beim Trinken verschlucken und ersticken. Die in<br />
ihrem Handeln liegende Gefahr sah die Mutter nicht und war auch<br />
Ratschlägen nicht zugänglich.<br />
Ärztliche Vorgaben <strong>zur</strong> Behandlung von Erkrankungen – Eisenmangel<br />
und Bindehautentzündung – hielt die Mutter nicht ein.<br />
Die Mutter ist auch nicht in der Lage, ihr Geld einzuteilen, so dass sie<br />
gegen Ende des Monats für K. kein Essen mehr kaufen konnte. Sie<br />
achtet auch nicht darauf, dass die Grundbedürfnisse – Wohnen, Strom<br />
– etc. gedeckt sind, teilweise war sie obdachlos.<br />
Aus dem zuvor Geschilderten ergibt sich, dass K.s körperliche Unversehrtheit<br />
und seine Gesundheit, aber auch seine körperliche Entwicklung<br />
überhaupt, durch das Verhalten der Mutter gefährdet werden.<br />
b) Das seelische Wohl des Kindes wird dadurch gefährdet, dass die<br />
Mutter keine Bindung zu ihm hat und der Junge umgekehrt auch keine<br />
sichere Bindung <strong>zur</strong> Mutter. Der Mutter fehlt es an Empathie. Die Mitarbeiter<br />
der Mutter-Kind-Einrichtung, die Umgangsbegleiterin, die<br />
Sachverständige berichten übereinstimmend, dass die Mutter nur<br />
höchst selbst Blickkontakt zu K. aufnimmt und sich ihm auch körperlich<br />
nicht zuwendet, vielmehr die Notwendigkeit körperlicher Zuwendung<br />
als Zumutung oder zu schwer abwehrt. Hierbei mag allerdings eine<br />
Rolle spielen, dass Frau M. klein gewachsen und zierlich ist, was sie<br />
allerdings nicht hindert, sich mit Gleichaltrigen körperliche Auseinandersetzungen<br />
und Kämpfe zu liefern, wie aus ihrem Aufenthalt in der<br />
Mutter-Kind-Einrichtung berichtet wird.<br />
Sie hat kein Gespür für die Bedürfnisse eines noch kleinen Kindes. Es<br />
wird verschiedentlich berichtet, dass sie von K., der noch keiner Sprache<br />
mächtig ist, verlangte, zu gehorchen. Die Mutter-Kind-Einrichtung<br />
teilt mit, dass die Mutter vergeblich versucht, das schreiende Kind zu<br />
beruhigen und ihn dann beschimpft mit dem Satz: „Du verarschst mich<br />
nur“. Der Kinderarzt teilt mit, dass die Mutter ihm berichte, dass sie<br />
Pamperswindeln zusammenknüllt und massiv auf ihre Hand schlägt,<br />
damit K. vor Schreck seine Schreiattacken beende, er sei aber nicht<br />
immer einsichtig (!). Zum damaligen Zeitpunkt war K. knapp 5 Monate<br />
alt, einsichtig konnte er also unter keinen Umständen sein. Frau W.,<br />
die die Mutter ebenfalls mit K. zusammen erlebt hat, berichtet, dass sie<br />
dem Kind ärgerliche Vorhaltungen gemacht habe, als es, wie Säuglinge<br />
es nun mal tun, nach dem Essen gespuckt habe, etwa derart, er<br />
solle doch einmal sehen, was er da angerichtet habe. Er spucke nur,<br />
um sie zu ärgern.<br />
Die Mutter versuchte im Übrigen, das Kind an andere Personen abzugeben,<br />
wenn sie mit ihm nicht <strong>zur</strong>echt kommt. Dies berichtet auch<br />
der Vater über seinen Anwalt, des gleichen berichtet er, das Kind werde<br />
permanent angeschrieen.<br />
c) Das geistige Wohl wird gefährdet, weil der Junge keine Anregung<br />
erhält und seine Möglichkeiten nicht entwickelt und ausgeschöpft werden.<br />
Er erfährt keine Ansprache, keine Zuwendung, Spiele werden,<br />
wie von der Sachverständigen beobachtet, auf die Interessen der Eltern<br />
ausgerichtet, nicht am Kind und dessen Bedürfnis, die Welt zu<br />
erkunden und Lernerfolge zu erzielen. K. verfügt sehr wohl über Fähigkeiten,<br />
Durchhaltevermögen, Neugier, um ausreichend zu lernen.<br />
Wie die Sachverständige festgestellt hat, verhält er sich auch entsprechend<br />
in entsprechend förderlicher Umwelt. In der Gegenwart der Eltern<br />
hingegen wird er inaktiv und zieht sich <strong>zur</strong>ück. Auf sie macht er<br />
den Eindruck eines bereits traumatisierten, weil nicht wahrgenommenen<br />
und nicht geförderten Kindes, so dass es sich hier nicht um die<br />
Frage gradueller Erziehungsunterschiede handelt, sondern um die<br />
Befriedigung von Grundbedürfnissen des Kindes.<br />
Das geschilderte Verhalten der Mutter ist teils als Missbrauch der elterlichen<br />
Sorge zu kennzeichnen, jedenfalls dann, wenn sie K. körperlich<br />
misshandelt, durch Schläge oder auch Schütteln. Hat sie ihn nicht<br />
misshandelt, sondern Dritten die Möglichkeit eröffnet, dies zu tun, liegt<br />
hierin ein Versagen, wie auch sonst in ihrer Unfähigkeit, die kindlichen
Bedürfnisse nach Nähe und Zuwendung, aber auch nach zuverlässiger<br />
Versorgung zu erkennen und ihrer fehlenden Bereitschaft, diese<br />
Bedürfnisse auch zu befriedigen. Auch ihre Unfähigkeit, ihr Lebensumfeld<br />
und ihren Lebensrhythmus auf die Bedürfnisse des Kindes einzustellen,<br />
muss als Versagen angesehen werden, teilweise wird man es<br />
auch als Vernachlässigung begreifen können.<br />
2. Der Junge hat nach den Feststellungen der Sachverständigen auch<br />
keine Bindung an den Vater. Der Vater ist zwar der Auffassung, er<br />
könne mit dem Kind besser umgehen als die Mutter, dabei handelt es<br />
sich nach Überzeugung des Gerichts allerdings nur um graduelle Unterschiede.<br />
Der Vater ist gar nicht bereit und hat auch nicht das Ziel, den Jungen<br />
selbst zu versorgen, sondern will den Jungen aktuell von der Mutter<br />
versorgen lassen. Er selbst versteht sich offenbar eher als Kontrolleur<br />
mütterlicher Sorgeausübung. Dabei verkennt er, wie die Sachverständige<br />
auch ausführt, dass die Mutter <strong>zur</strong> Versorgung des Kindes nicht in<br />
der Lage ist und dass sie vor allem aufgrund ihrer biografischen Vorgaben<br />
und persönlichen Einschränkungen auch nicht in der Lage ist zu<br />
lernen. Insbesondere wird sie ihre Fähigkeit, dem Kind mit Empathie<br />
und Einfühlungsvermögen zu begegnen und ihrerseits sich selbst mit<br />
der nötigen Selbstkritik, auf absehbare Zeit nicht entwickeln können,<br />
wenn überhaupt. Seine Einschätzung, Frau M. habe sich entwickelt<br />
und gewandelt, geht völlig an der Realität vorbei. Die Sichtweise des<br />
Vaters ist hier nicht von den Bedürfnissen des Kindes geprägt, sondern<br />
von der Dynamik seiner Auseinandersetzungen mit der Kindesmutter.<br />
Verstehen sich die Eltern gerade als Paar, wird das Verhalten<br />
der Mutter vom Vater gerechtfertigt und beschönigt, im Stadium des<br />
Streites oder der Trennung hingegen werden die Versäumnisse und<br />
Untiefen in der mütterlichen Erziehungshaltung kritisiert und veröffentlicht.<br />
Dass es für das Kind darauf ankommt, dass mütterliches Fehlverhalten<br />
sofort bemerkt und abgestellt wird, jedenfalls dann, wenn es<br />
teilweise so gefährlich ist, wie vorliegend, ist dem Kindesvater offenbar<br />
nicht klar. Wenn der Vater das Kind der Mutter überlässt, was erklär-<br />
termaßen sein Plan ist, kann er für die Unversehrtheit des Kindes nicht<br />
eintreten, er kann es vor der Mutter und ihrer Unbeherrschtheit und<br />
Unfähigkeit nicht schützen. Auch Herr L. hat sich letztlich nicht darum<br />
gekümmert zu erfahren, woher K. die großen Hämatome hatte, die im<br />
Februar 2005 festgestellt wurden.<br />
Strategien, wie er etwa dafür sorgen kann, dass K. das Richtige und<br />
ausreichend zu essen bekommt, hat er nicht. Seine Interventionen<br />
scheinen sich, auch nach seinen Schilderungen, auf den Vorhalt von<br />
Fehlverhalten zu beschränken. Auch erkennt er selbst mögliche Gefahrenquellen<br />
im Haushalt nicht.<br />
Auch ihm fehlt es letztlich an der Fähigkeit, sich in das Kind hineinzuversetzen,<br />
die von der Sachverständigen geschilderten und analysierten<br />
Spielsequenzen zeigen deutlich, dass es dem Vater hier an Gespür<br />
mangelt. Dies mag allein nicht die Erziehungsunfähigkeit begründen;<br />
wenn allerdings schwerpunktmäßig eine erkennbar nicht erziehungsgeeignete<br />
Mutter das Kind versorgen soll, ist das Kind existentiell<br />
darauf angewiesen, dass sein anderer Elternteil hoch sensibel,<br />
wachsam und handlungsfähig ist. Daran mangelt es aber beim Kindesvater.<br />
Letztlich zeigen seine in jeder Verhandlung unterschiedlichen, also<br />
spätestens vierteljährlich, wenn nicht monatlich wechselnden Pläne für<br />
Wohnen, Beziehung, berufliche Zukunft, dass der Vater weder Stabilität<br />
noch Kontinuität bieten kann und auch von daher dem Kind keine<br />
kindgerechte Versorgung wird zuteil werden lassen.<br />
Auch sein Plan, K. einer fast fremden Person zu überlassen, die ihrerseits<br />
hoch belastet ist durch Krankheit und Versorgung eines Kleinkindes<br />
lässt erkennen, dass der Vater die nötige Stabilität der Lebensverhältnisse<br />
und des Beziehungsgefüges für K. nicht herstellen und sicherstellen<br />
kann. Das Hin und Her in der Beziehung <strong>zur</strong> Mutter, die<br />
Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen, die das Kind dann eben-
falls miterleben würde, stellen eine weitere vom Vater ausgehende<br />
Gefahrenquelle dar.<br />
Schließlich sind auch deshalb Zweifel an der Erziehungsfähigkeit des<br />
Vaters angezeigt, weil auch er letztlich aus familiären Verhältnissen<br />
stammt, in denen er nicht die Chance hatte zu lernen, was Kinder an<br />
Zuwendung und Stabilität benötigen. Dies hat er in der Anhörung<br />
durch das Gericht deutlich werden lassen, wenn er erklärt, seine Mutter<br />
könne nichts dafür, dass ihr erstes (?) Kind gestorben sei, denn das<br />
liege daran, dass der Vater der Mutter der Vater dieses Kindes gewesen<br />
sei, ohne auch nur im Mindesten erkennen zu lassen, dass es sich<br />
beim Inzest nicht gerade um eine förderungswürdige Familienstruktur<br />
handelt. Das Ausmaß der familiären Dysfunktion in der Herkunftsfamilie<br />
ist ihm, wie der Mutter auch, nicht deutlich. Gerade dies bedingt<br />
aber die fehlende Sensibilität für die Bedürfnisse des eigenen Kindes.<br />
Auch war er nicht einmal in der Lage zu erkennen, dass K. in der Tat,<br />
wie die Sachverständige auch geschildert hat, aktiv den Blickkontakt<br />
vermieden hat, als der Vater sich ihm während des Besuches zuwandte.<br />
Die vom Vater vorgespielte Videosequenz zeigte dies sehr deutlich,<br />
der Junge wandte immer wieder den Kopf weg, und zwar nicht, um<br />
gleich wieder her zu gucken und zu schäkern, wie Kleinkinder dies tun,<br />
sondern, um auf Dauer wegzugucken und nicht Kontakt aufzunehmen.<br />
Der Vater konnte selbst beim Vorspielen des von ihm selbst aufgenommenen<br />
Videos dies nicht sehen und wahrnehmen, ein deutlicher<br />
Beleg dafür, dass auch der Vater seinen Sohn nicht versteht und dessen<br />
Bedürfnisse letztlich nicht oder nicht zutreffend interpretiert.<br />
3. Mutter wie Vater sind nicht bereit und nicht in der Lage, die Gefahren,<br />
die durch ihr Verhalten für den Jungen gesetzt werden, abzuwenden.<br />
Ihnen fehlt, wie ausgeführt, die Fähigkeit, die Bedürfnisse ihres<br />
Kindes zu erkennen und sie als unterschiedlich von ihren eigenen zu<br />
begreifen und ihnen nachzukommen. Mutter, aber auch Vater, wie die<br />
Sachverständige beobachtet hat, haben keine Vorstellung davon, was<br />
ein Kind im Alter von K. (Säugling, jetzt Kleinkind) an Fähigkeiten ü-<br />
berhaupt haben kann. Sie wenden sich an das Kind auf einer Erwachsenenebene<br />
(Mutter zum Kinderarzt: K. sei nicht immer einsichtig; Vater<br />
zu K.: Der Papa verreist für 1 Monat mit dem Flugzeug). Frau M. ist<br />
nicht bereit, Hilfen anzunehmen und dazu zu lernen, dies empfindet sie<br />
als Einschränkung ihrer Freiheit. Möglicherweise fehlen ihr hierzu einfach<br />
auch die nötigen Kapazitäten, worauf der Umstand, dass bei ihr<br />
als Kind eine Alkoholembryopathie festgestellt wurde, zumindest hinweist.<br />
Sie empfindet Hilfestellungen als Kontrolle, äußert dies auch<br />
freimütig. Als nötige Stufe zu besseren Fähigkeiten kann sie Hilfestellungen<br />
nicht erkennen.<br />
Zudem hat sie die Haltung, dass die Anforderungen der Kinderversorgung<br />
ihr Mühe machen, ihr Opfer abverlangen und dass sie dies dem<br />
Kind letztlich zum Vorwurf macht. Genau diese Haltung aber ist ein<br />
großer Gefährdungsfaktor für Kinder, denn die Hilfsbedürftigkeit in allem<br />
ist gerade untrennbar mit dem Stadium der frühen Kindheit verbunden.<br />
Dem Kind dies zum Vorwurf zu machen, setzt im Verhalten<br />
der Eltern die Grenzen für aggressives Verhalten deutlich herab.<br />
Die Mutter wiederholt im Übrigen die bei K. gemachten Fehler bei S.,<br />
wenn sie auch hier nicht bereit ist, die Ratschläge für das gefahrfreie<br />
Füttern zu befolgen.<br />
Der Vater ist letztlich auch nicht bereit, Hilfen zu akzeptieren, wenn er<br />
darauf hinweist, dass nicht er ein Problem habe, sondern das Jugendamt,<br />
das ihn fälschlich für erziehungsunfähig halte.<br />
4. Es ist auch nicht möglich, die Defizite im elterlichen Erziehungsverhalten<br />
durch öffentliche Hilfen zu beseitigen. Dies ist in Bezug auf Frau<br />
M.s Verhalten gegenüber K. ausführlich versucht worden durch Familienhelfermaßnahmen,<br />
durch den Einsatz von 4 mal soviel Stundenkapazität<br />
wie üblich in der Mutter-Kind-Einrichtung, ohne dass nennenswerte,<br />
vor allem aber, ohne dass dauerhafte Veränderungen im Verhalten<br />
der Mutter herbeigeführt werden konnten. Kleinschrittige Verhaltensvorgaben,<br />
wöchentliche Gespräche mit dem Sozialdienst haben
nicht dazu geführt, dass die Mutter in irgendeiner Weise ihr Verhalten<br />
geändert hätte. Ihr Umgang mit K. während der Besuche zeigt, dass<br />
sie letztlich keine größere Bereitschaft gewonnen hat, sich auf das<br />
Kind einzustellen. Ihre letztlich völlige Weigerung oder auch fehlende<br />
Möglichkeit dazu zu lernen lässt öffentliche Hilfen als wenig Erfolg versprechend<br />
erscheinen. Alle Hilfen müssen darauf ausgerichtet sein,<br />
Eltern in die Lage zu versetzen, das in ihrem Verhalten liegende Gefahrpotential<br />
für ihr Kind zu erkennen und wirksam gegen zu steuern.<br />
Diese Chance besteht vorliegend nicht, weder bei der Mutter, noch<br />
beim Vater.<br />
Daher ist beiden Eltern das Sorgerecht für K. zu entziehen, §§ 1666,<br />
1666a BGB. Das umfasst auch die Vermögenssorge, denn weder Vater<br />
noch Mutter sind in der Lage, eigenständig finanziell ihr Leben zu<br />
gestalten.<br />
5. In Bezug auf die Tochter S. ist festzustellen, dass diese durch ihre<br />
instabile körperliche Konstitution noch intensivere und aufmerksamere<br />
Betreuung benötigt als ihr Bruder K. Wenn die Eltern aber schon nicht<br />
in der Lage sind, ein relativ unkompliziertes, weil letztlich körperlich<br />
und auch geistig gesundes Kind zu versorgen, sind sie erst recht nicht<br />
in der Lage, ein Kind zu betreuen, das noch höhere Anforderungen an<br />
sie stellt, das noch mehr Aufmerksamkeit, Empathie und mehr Opferbereitschaft<br />
verlangt. Wenn sie sich in Anwesenheit des Arztes dahin<br />
äußert, S. solle aufhören zu schreien, sie würde sie sonst ersäufen,<br />
zeigt sich dies auch hier deutlich. Für Frau M. sind die Anforderungen,<br />
die die Versorgung eines hilflosen Kindes an sie stellt, schlicht zu viel.<br />
Ihrer mehrfach geäußerten angeblichen Fähigkeit, sie habe sich aber<br />
im Griff, ist nicht zu trauen. Dagegen sprechen schon die Schilderungen<br />
des Vaters, aber auch der Zeugin W..<br />
Ihre fehlende Bereitschaft zu lernen und Hilfen zu akzeptieren, ist für<br />
ein körperlich geschwächtes Kind wie S. noch bedrohlicher. Es gibt<br />
daher keine Möglichkeit, die Mutter hier „probieren“ zu lassen, ob sie<br />
nun vielleicht mit ihrer Tochter besser <strong>zur</strong>echt kommt als mit ihrem<br />
Sohn.<br />
Der Mutter ist daher auch für S. das Sorgerecht zu entziehen, §§ 1666,<br />
1666a BGB.<br />
Herr L. steht als Vater noch nicht fest, auch gibt es für S. keine Sorgeerklärung,<br />
so dass § 1680 Abs. 3 BGB keine Anwendung findet. Trotzdem<br />
ist zu prüfen, ob er, wie eine andere dritte Person, als Vormund in<br />
Betracht käme. Dies ist jedoch aus den bereits oben geschilderten<br />
Gründen, die auch für eine Erziehungsunfähigkeit des Vaters sprechen,<br />
nicht der Fall. Auch der Umstand, dass S. weder beim Standesamt<br />
noch bei der Krankenkasse gemeldet war, obwohl der Vater als<br />
Arbeitsloser sicher ausreichend Zeit und Gelegenheit gehabt hätte,<br />
dies zu erledigen, lässt erkennen, dass er für eine solche Aufgabe<br />
nicht geeignet ist. Außerdem fehlt es an der nötigen Bereitschaft <strong>zur</strong><br />
Kooperation mit dem Jugendamt, so dass er auch aus diesem Grunde<br />
als Rechtsvertreter im Interesse des Kindes ausscheidet.<br />
6. Da die Eltern resp. die Mutter nicht mehr Inhaber der elterlichen<br />
Sorge sind, muss für die Kinder ein Vormund bestellt werden, §§<br />
1773ff. BGB. Zum Vormund ist das Jugendamt zu bestellen, § 1791b<br />
BGB, da geeignete Einzelpersonen nicht benannt wurden.<br />
7. Die Kostenregelung basiert auf § 13a FGG, die Wertfestsetzung auf<br />
§ 30 Abs. 2 KostO.<br />
Bremen, den 28.04.2006<br />
gez. Heinke<br />
Richterin am Amtsgericht
Prof. Ekke Dahle<br />
Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖV), Bremen, Ekke.Dahle@HFOEV.Bremen.de<br />
Kindeswohlgefährdung aus der Sicht der Polizei<br />
Gliederung<br />
<strong>1.</strong> Themeneingrenzung zum Begriff<br />
„Kindeswohlgefährdung“<br />
2. Gesamtbild Bremen/BRD (Polizeiliche Kriminalstatistik)<br />
3. Polizeiliche Aufgaben und Mittel<br />
3.1 Gefahrenabwehr<br />
3.2 Strafverfolgung<br />
4. Exkurs:<br />
Schweigepflicht von Ärzten/Zeugnisverweigerungsrechte<br />
<strong>1.</strong> Themeneingrenzung<br />
zum Begriff "Kindeswohlgefährdung"<br />
- Eltern, Familie, Pflegefamilien (auch Geschwister)<br />
- andere Erwachsene (z.B. Erzieher, auch Fremde)<br />
- Mitschüler (Mobbing, Abziehen)<br />
- Peer Groups (Cliquen, Banden)<br />
§ 174 StGB: Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen<br />
I Wer sexuelle Handlungen<br />
<strong>1.</strong> an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm <strong>zur</strong> Erziehung,<br />
<strong>zur</strong> Ausbildung oder <strong>zur</strong> Betreuung in der Lebensführung<br />
anvertraut ist,<br />
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm <strong>zur</strong> Erziehung,<br />
<strong>zur</strong> Ausbildung oder <strong>zur</strong> Betreuung in der Lebensführung<br />
anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder<br />
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch<br />
einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-,<br />
Dienst- der Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit<br />
oder<br />
3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder<br />
angenommenen Kind<br />
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen<br />
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren<br />
bestraft.<br />
§ 225 StGB: Misshandlung von Schutzbefohlenen<br />
I Wer eine Person unter achtzehn Jahren (...), die<br />
<strong>1.</strong> seiner Fürsorge oder Obhut untersteht,<br />
2. seinem Hausstand angehört,
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen<br />
worden oder<br />
4. ihm im Rahmen eines Dienst oder Arbeitsverhältnisses<br />
untergeordnet ist,<br />
quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung<br />
seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit<br />
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn<br />
Jahren bestraft.<br />
II (...)<br />
III Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen,<br />
wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in<br />
die Gefahr<br />
<strong>1.</strong> des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung<br />
oder<br />
2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen<br />
Entwicklung bringt.<br />
2. Gesamtbild Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)<br />
Land Bremen 2005<br />
DELIKT ANZAHL FÄLLE AUFGEKLÄRTE<br />
FÄLLE<br />
SEXUELLER MISSBRAUCH<br />
VON SCHUTZBEFOHLENEN<br />
KINDERN, § 174 STGB<br />
SEXUELLER MISSRAUCH<br />
VON KINDERN, §§ 176 FF<br />
STGB<br />
MISSHANDLUNG VON<br />
SCHUTZBEFOHLENEN KIN-<br />
DERN, § 225 STGB<br />
VERLETZUNG DER FÜR-<br />
SORGE- ODER ERZIE-<br />
HUNGSPFLICHT, § 171<br />
STGB<br />
3 3<br />
100%<br />
149<br />
107<br />
7<strong>1.</strong>8%<br />
29 29<br />
100%<br />
9 9<br />
100%<br />
Bundesrepublik Deutschland 2005<br />
DELIKT<br />
SEXUELLER MISSBRAUCH<br />
VON SCHUTZBEFOHLENEN<br />
KINDERN § 174 STGB<br />
SEXUELLER MISSBRAUCH<br />
VON KINDERN, §§ 176 FF<br />
STGB<br />
MISSHANDLUNG VON<br />
SCHUTZBEFOHLENEN KIN-<br />
DERN, § 225 STGB<br />
VERLETZUNG DER FÜR-<br />
SORGE- OD. ERZIEHUNGS-<br />
PFLICHT § 171 STGB<br />
ANZAHL<br />
FÄLLE STEIGE-<br />
RUNGSRATE<br />
ZU 2004<br />
ERMITTELTE TAT-<br />
VERDÄCHTIGE<br />
3<br />
95<br />
31<br />
796 - 17,3% 96,9%<br />
13962 - 8,5% 81,7%<br />
2905 - 0,4% 97,6%<br />
1178 0,7% 97,5%<br />
9<br />
AUFKLÄRUNGS-<br />
QUOTE
Probleme der Erkenntnisgewinnung durch PKS:<br />
Dunkelfeld<br />
Zahl aller begangenen Straftaten<br />
(nicht zu ermitteln)<br />
- Delikt muss überhaupt<br />
erkennbar sein<br />
- Delikt muss von jemandem<br />
bemerkt werden<br />
- Delikt muss <strong>zur</strong> Kenntnis<br />
der Polizei / Staatsanwaltschaft<br />
gelangen<br />
Wirkliche Kriminalitätsentwicklung<br />
3. Polizeiliche Aufgaben<br />
Gefahrenabwehr<br />
Bremisches Polizeigesetz<br />
- Abwehr von Gefahren<br />
für die öffentliche<br />
Sicherheit<br />
- Ziel: "Problembereinigung"<br />
- eher zukunftsbezogen<br />
- richterliche Kontrolle<br />
Hellfeld<br />
Zahl der Straftaten, die der Polizei<br />
bekannt werden<br />
- Anzeigeverhalten<br />
- Polizeiliche Kontrolle<br />
- Änderungen des Strafrechts<br />
- Echte Kriminalitätsänderung<br />
Vermeintliche Kriminalitätsentwicklung<br />
durch Aufmerksamkeit in den<br />
Medien<br />
Strafverfolgung<br />
Strafprozessordnung<br />
- Ermittlung verfahrensbezogener<br />
Informationen<br />
- Hauptverhandlung vor dem<br />
zuständigen Gericht<br />
- Vergangenheitsbezogen (Rekonstruktion<br />
des Geschehenen)<br />
- Richterliche Entscheidung<br />
3.1 Gefahrenabwehr<br />
- Informationserhebung und Informationsverarbeitung<br />
- Sonstige Maßnahmen<br />
3.2 Strafverfolgung<br />
� Befragung und Auskunftspflicht § 13 BremPolG<br />
� Datenerhebung, §§ 27, 28 BremPolG<br />
� Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener<br />
Daten, §§ 36a, 36b BremPolG<br />
� Datenübermittlung bei erheblicher sozialer Notlage,<br />
§ 36f Abs.1 BremPolG<br />
� Platzverweisung, § 14 BremPolG<br />
� Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot<br />
zum Schutz vor häuslicher Gewalt, § 14a Brem-<br />
PolG<br />
� Gewahrsam, § 15 BremPolG<br />
� Durchsuchung von Personen, Sachen und<br />
Wohnungen, §§ 19, 20, 21 BremPolG<br />
� Sicherstellung, § 23 BremPolG<br />
� Unmittelbarer Zwang, §§ 41 ff BremPolG<br />
• Körperliche Gewalt<br />
• Hilfsmittel der körperlichen Gewalt<br />
• Fesselung<br />
• Schusswaffengebrauch<br />
- Beweisführung durch Informationserhebung<br />
� Sachverständige<br />
� Augenschein<br />
� Urkunden<br />
� Zeugen<br />
� Aussage des Beschuldigten
- Beweissichernde Maßnahmen<br />
- Körperliche Untersuchung des Beschuldigten § 81a<br />
StPO<br />
- Körperliche Untersuchung von anderen Personen §<br />
81c StPO<br />
- Beschlagnahme von Beweismitteln<br />
- Durchsuchung von Personen und Sachen, §§ 102 ff<br />
StPO<br />
- Einschränkungen der Beweisführung<br />
- Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörigen, § 52<br />
StPO<br />
- Zeugnisverweigerungsrecht bestimmter Berufsgruppen,<br />
§ 53 StPO<br />
- Untersuchungsverweigerungsrecht, § 81c Abs.3<br />
StPO<br />
4. Schweigepflicht/Zeugnisverweigerungsrecht der Ärzte<br />
3.1 Schweigepflicht gem. § 202 StGB<br />
3.2 Zeugnisverweigerungsrecht/Zeugnisverweigerungspflicht<br />
nach § 53 Abs.1 Nr. 3, Abs.2; 53a StPO
Thomas Kothe<br />
Polizeioberkommissar, Kontaktpolizist (KoP) Kattenturm<br />
E-Mail: Thomas.Kothe@Polizei.Bremen.de, Tel.: (0421) 361-17219<br />
Fallbeispiele sozial-familiärer Notlagen aus Sicht der Polizei<br />
Seit über sieben Jahren bin ich nun Kontaktpolizist - KoP - und war<br />
vorher fast 20 Jahre im Streifendienst des Polizeireviers Kattenturm.<br />
Ich arbeite eher kleinräumig in dem Ortsteil Kattenturm, einem Teil des<br />
Revierbereichs und bin dadurch dort, wo die Menschen leben. Der<br />
Stadtteil Kattenturm gilt als ein sozialer Brennpunkt, in dem meine Arbeit<br />
nicht ganz einfach ist.<br />
Als KoP kann ich mir meinen Dienst so einteilen, wie es mein Bezirk<br />
erfordert. Mein Zuständigkeitsbereich zieht sich durch alle soziale<br />
Schichten und Altersgruppen des Stadtteils. Bedingt durch meine lange<br />
Dienstzeit am Revier kenne ich manche Eltern schon seit ihrer<br />
Kindheit.<br />
Ich besuche regelmäßig Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen.<br />
Besonders an Schulen fällt es auf, dass ich dort gerne gesehen<br />
werde und sogar regelmäßige Sprechstunden habe, Unterrichtsprojekte<br />
begleite, Lehrer/innen und Eltern berate und vieles mehr. Es<br />
existiert eine sehr positive Vernetzung zwischen den im Stadtteil arbeitenden<br />
Menschen. Auch dadurch habe ich einen tiefen Einblick in die<br />
Strukturen der Problemfamilien, die diese Probleme manchmal schon<br />
in der dritten Generation haben.<br />
In den meisten Fällen handelt es sich bei den von mir festgestellten<br />
Notlagen nicht um die dramatischen Ereignisse oder Vorfälle, die<br />
durch die Presse gehen, sondern um langfristige familiäre soziale<br />
Probleme von Kindern, die aber von den Folgen her oftmals genauso<br />
schlimm sind.<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gerade als Kontaktpolizist, auf<br />
solche Notlagen aufmerksam zu werden, die ich hier exemplarisch an<br />
drei völlig unterschiedlichen Fallbeispielen darstellen möchte.<br />
Normenverdeutlichende Gespräche<br />
Vor einigen Jahren wurde nach einem Modelversuch im <strong>Bremer</strong> Westen<br />
das Projekt 'Normenverdeutlichende Gespräche' bei straffällig gewordenen<br />
Kinder flächendeckend in Bremen eingeführt.<br />
Bisher war es so: Wird ein Kind beim Ladendiebstahl erwischt, so bekommen<br />
die Eltern nach einigen Wochen einen schriftlichen Einstellungsbescheid,<br />
auf dem unter Nennung der entsprechenden Paragraphen<br />
erklärt wird, dass das Verfahren gegen das Kind eingestellt worden<br />
ist. Dann nimmt man rasch seine StPO <strong>zur</strong> Hand und schaut nach,<br />
was unter dem Paragraphen steht: Kinder sind strafunmündig. Eine<br />
weitere Reaktion des Staates erfolgte in der Regel nicht.<br />
Bei diesem Projekt kommt nun der zuständige KoP auf den Plan und<br />
sucht die Familie dieses Kindes in Uniform zuhause auf, um zusammen<br />
mit dem Kind über die begangene Straftat zu sprechen und um
ihnen das Unrecht der Tat deutlich zu machen. Er berät die Eltern und<br />
macht Hilfsangebote, falls erforderlich. Danach fertigt er über diesen<br />
Besuch einen Bericht mit einer entsprechenden Prognose an, der auch<br />
dem AfsD zugeleitet wird.<br />
Nach diesen Gesprächen hatte man beim Modelversuch eine deutlich<br />
geringere Rückfallquote festgestellt.<br />
Zu diesen Gesprächen könnte ich über eine Vielzahl von Einzelfällen<br />
sprechen, bei denen mein Einschreiten letztendlich dazu geführt hat,<br />
dass die Erziehungsberechtigten überhaupt auf die Idee gekommen<br />
sind, professionelle Hilfe zu suchen und auch anzunehmen.<br />
Exemplarisch möchte ich einen Fall herausgreifen: Ein 10jähriger Junge<br />
hatte einen Ladendiebstahl begangen und ich erhielt den Vorgang<br />
auf den Schreibtisch. Die Familie war mir noch nicht häufiger aufgefallen.<br />
Es handelte sich um eine allein erziehende Mutter mit zwei Jungen,<br />
10 und 13 Jahre. Als ich mich zu einem Termin verabredete,<br />
konnte ich schon nach dem ersten Eindruck wahrnehmen, dass die<br />
Mutter mit der Erziehung und dem Haushalt völlig überfordert ist.<br />
Bei der Mutter handelt es sich um eine sehr einfache Frau, die es mit<br />
der Ordnung und Sauberkeit nicht so genau nahm. Sie hatte finanzielle<br />
Probleme und war stark übergewichtig. Ihre eigene Lage und Hilflosigkeit<br />
stellte sie ihren Jungen als negatives Beispiel dar, mit der Bemerkung:<br />
"Wenn ihr nicht fleißig in der Schule seid, werdet ihr so wie ich."<br />
Auch eine vordergründig tolerante Erlaubnis, der 13jährige dürfe in<br />
seinem Zimmer rauchen - und dort steht dann tatsächlich auch ein<br />
prall gefüllter Aschenbecher - ist sicherlich nicht ganz altersgerecht.<br />
Das ist nicht die richtige Form der Erziehung von Jungen in dem Alter,<br />
denn eigentlich sollte man ihnen das Richtige vorleben. Leider konnte<br />
man nicht einmal einen gewissen Ansatz oder Versuch sehen, ihr Leben<br />
in den Griff zu bekommen. Ihre Möglichkeiten waren eben be-<br />
grenzt, und vermutlich ist es auch ohne fremde Hilfe zu diesem Zeitpunkt<br />
nicht mehr zu schaffen.<br />
Leider ist der Leidensdruck in diesem Stadium noch immer nicht groß<br />
genug, um fremde Hilfe zu wollen. Als dann in diesem Fall schließlich<br />
noch massive Schulprobleme dazu kommen und ich mich mehrfach<br />
mit ihr über die Probleme unterhalte, ist es dann doch soweit, dass<br />
Hilfe beim AfsD gesucht wird: Eine Familienhelferin kümmert sich um<br />
die Familie - und alles wird gut !? - Natürlich nicht sofort, sondern es<br />
verbessern sich viele Dinge. Sofort ist augenscheinlich, dass besonders<br />
der Jüngste nicht immer so schmuddelig aussieht und der Schulbesuch<br />
regelmäßig wird. Auch im Zusammenhang mit Straftaten fallen<br />
die Jungen nicht mehr auf. Bleibt nur zu hoffen, dass sie "noch mal die<br />
Kurve bekommen haben".<br />
Mama, was machen die Arbeiter da?<br />
Vor einigen Jahren wurden bei uns an der Dienststelle die Fenster<br />
erneuert. Ich verließ zu Fuß gerade die Wache und konnte eine Frau<br />
mit ihren Zwillingen beobachten. Einer der beiden Jungen fragte seine<br />
Mutter, was die Arbeiter dort machen würden. Die 'erschöpfende' Auskunft<br />
der Mutter lautete: "Die arbeiten da".<br />
Mir waren die zu diesem Zeitpunkt ungefähr 6jährigen Zwillinge bekannt,<br />
und sie waren auch schon aufgefallen. Von dem beschriebenen<br />
Eltern-Kind-Dialog war ich jedoch ziemlich erschüttert, und einige Dinge<br />
wurden mir dann später aber sehr klar. Besonders in den folgenden<br />
Jahren, in denen es immer wieder Vorfälle gab, bei denen man die<br />
Hände über den Kopf schlägt, was sie sich nun wieder ausgedacht<br />
hatten.<br />
Die Zwillinge sind Kinder von sehr einfachen Eltern, die auch noch<br />
getrennt sind. Der Vater ist ein Waffennarr und versucht sich gegenüber<br />
seinen Kindern auf diese Art beliebt zu machen. Da wird den Kindern<br />
auch schon einmal eine Luftpistole überlassen, die sie dann mit in
die Schule nehmen. Glücklicherweise wird die Pistole schnell von der<br />
Lehrerin gesehen, bevor etwas passiert und dann sichergestellt. Sie<br />
ging jedoch zuerst davon aus, dass es sich um eine Spielzeugpistole<br />
handelt.<br />
Inzwischen weiß man, wie enorm wichtig die ersten Lebensjahre von<br />
Kindern sind, weil sie in der Zeit unglaublich aufnahmefähig sind. Umso<br />
erschreckender ist die Gewissheit, dass diese Zwillinge in einer<br />
geistig und emotionalen Verarmung aufwachsen. Das kann auch später<br />
keine Schule ausgleichen, weil sie auf einen gewissen Grundstock<br />
aufbaut, der bei den beiden einfach nicht vorhanden ist. Das wenige<br />
Wissen erhalten sie aus den natürlich frühzeitig <strong>zur</strong> Verfügung stehenden<br />
elektronischen Medien. Ein Fernsehgerät steht ohne jede Kontrolle<br />
im Kinderzimmer. Die Auswirkungen sind gravierend, wie ich an<br />
einigen Beispielen aufzeigen möchte:<br />
• Mit Freunden werden Enteneier zerschlagen und Enten getötet.<br />
• Sie begehen Straftaten wie Körperverletzung, Bedrohungen,<br />
Sachbeschädigungen, Ladendiebstahl, Spendenbetrug, Brandstiftung,<br />
Trickdiebstahl, Automatenaufbruch, Einbrüche in Geschäfte<br />
usw.. Die einzelnen Straftaten zu schildern, würde den Rahmen<br />
dieser Veranstaltung sprengen. Dabei muss man einfach sehen,<br />
dass es sich hier um Kinder handelt, die noch strafunmündig sind.<br />
• Noch im letzten Jahr gab es eine Zeit, in der ich die beiden Jungen<br />
täglich durchsucht hatte und ihnen jeweils Feuerzeuge oder Messer<br />
abnahm, die sie angeblich gerade gefunden hatten. Das hatte<br />
ich mit der Mutter so abgesprochen und wurde ihr auch jeweils<br />
mitgeteilt.<br />
• Durch ihre sehr einfache Denkstruktur haben sie eine unglaublich<br />
einfache Logik <strong>zur</strong> Beurteilung von Zusammenhängen. Als ein Kripobeamter<br />
bei einer Befragung nach einem Einbruch auch eine<br />
erkennungsdienstliche Behandlung mit der Abnahme von Fingerabdrücken<br />
ankündigt, kam die Entgegnung von einem der Jungen:<br />
"Wenn ich mir die Fingerkuppen abschneide, bringt das doch gar<br />
nichts!"<br />
Natürlich ist in dieser Familie frühzeitig eine Familienhilfe vom AfsD<br />
eingesetzt. Wegen der schwierigen Aufgabe und der letztendlich mangelnden<br />
Mitarbeit der Eltern wechseln die Familienhelfer häufiger.<br />
Einer weitergehenden Maßnahme, wie einer Fremdplatzierung stimmen<br />
die Eltern nicht zu. Zu dieser Einsicht zu gelangen bedeutet auch,<br />
zuzugeben, es selbst nicht zu schaffen.<br />
Der Vater versucht deshalb, die Erziehung selbst in die Hand zu nehmen.<br />
Die Zwillinge lebten mit ihrem Vater in seiner 10 m² Parzelle. Als<br />
ich mir bei einem Gespräch nach einem erneuten Einbruchsversuch<br />
der beiden Jungen einen Überblick über die Wohnverhältnisse verschaffte,<br />
fiel mir dazu nur eines ein: So kann man keine 12jährigen<br />
Jungen aufwachsen lassen. Das AfsD erhielt von mir Kenntnis von<br />
meinen Beobachtungen und beendete diesen Zustand dann bald.<br />
Nachdem dann auch eine potentielle Drogengefährdung durch Cannabis,<br />
Probleme in der Schule, Gefahr schwerster Schäden durch den<br />
Versuch, ihre ehemalige Grundschule anzuzünden, Einbruch in die<br />
elterliche Wohnung, dazu kam, wurde der 'Leidensdruck' auf die Eltern<br />
so groß, dass sie schließlich einer Fremdplatzierung zustimmten, die<br />
nun noch andauert.<br />
Tiere und Kinder<br />
Wie so häufig kam dieser Anruf an einem Freitag gegen 15:00 Uhr und<br />
es ist dann nur noch selten jemand in anderen Behörden zu erreichen.<br />
Bezüglich des Jugendamtes hat sich das aber inzwischen geändert.<br />
Vom für Tierschutz und Lebensmittelüberwachung zuständigen Veterinär<br />
bekamen wir folgendes <strong>zur</strong> Kenntnis:
Eine nicht näher bekannte Frau hatte sich eine Mietwohnung angesehen<br />
und dann einer Dame vom Tierschutzverein Bremen von den<br />
schlimmen Zuständen berichtet. In dieser Wohnung wohnte eine Frau<br />
mit 4 Kindern und vielen Tieren (2 Hunde, Katzen, Kleintiere und<br />
mehr). Die Kinder sollen dort zwischen Müll und Kot hausen. Die Frau<br />
vom Tierschutzverein forderte die Anruferin auf, dem Veterinär und<br />
Jugendamt Details zukommen zu lassen. Das geschah aber nicht und<br />
nun meldet sich die Frau vom Tierschutz beim Veterinär und der wiederum<br />
meldet es per Fax und telefonisch dem zuständigen Revier.<br />
Erstaunlich und erschreckend zugleich ist, dass man sich zuerst um<br />
die Tiere Sorgen machte und deshalb jemanden benachrichtigt, der für<br />
die Tiere zuständig wäre.<br />
Recherchen am Revier ergaben, dass dort eine Mutter mit ihren 4 Kindern<br />
wohnt: 1, 5, 10 und 14 Jahre). Für die ältesten Kinder ist die Mutter<br />
allein und für die jüngsten ist der getrennt lebende Vater mit erziehungsberechtigt.<br />
Mit in der Wohnung wohnt der neue Lebensgefährte<br />
der Mutter.<br />
Vom Revier wurde dann ein Funkstreifenwagen eingesetzt, um die<br />
Wohnung in Bezug auf mögliche Gesundheitsschäden der Kinder,<br />
sowie der Unterbringung der Tiere im Haus zu prüfen.<br />
Die angetroffenen Kinder waren sauber gekleidet , wiesen keine äußeren<br />
Verletzungen auf und machten einen normalen Eindruck auf die<br />
Kollegen. Die Kinder lebten auf jeden Fall in keinem verwahrlosten<br />
Zustand. Von den einschreitenden Beamten wurden die hygienischen<br />
Verhältnisse als 'nicht gerade optimal' bezeichnet.<br />
Im Haus befanden sich folgende Tiere: 2 frei laufende Hunde und 2<br />
Katzen, 1 größerer Papagei im Käfig, 1 Beo im Käfig, 1 Tausendfüßler<br />
im Käfig sowie eine Würgeschlange in einem Terrarium. Ob eine artgerechte<br />
Haltung der Tiere vorliegt, besonders bei den Exoten, vermochten<br />
die Beamten abschließend nicht zu beurteilen.<br />
Eine Prüfung durch die zuständigen Behörden erscheint auf jeden Fall<br />
zwingend notwendig.<br />
Das Jugendamt und der Veterinärdienst erhalten von dem Vorfall<br />
Kenntnis und bearbeiten es in eigener Zuständigkeit.<br />
In diesem Fall erhielt das Jugendamt von den Lebensumständen der<br />
Kinder erst Kenntnis, weil sich jemand um die Tiere Gedanken machte.<br />
Diese Wertung muss in den Köpfen unserer Gesellschaft noch verändert<br />
werden – Kinder zuerst!!
Präventive Gesundheitssicherung<br />
für Risikofamilien durch das<br />
Gesundheitsamt<br />
Eberhard Zimmermann<br />
Sozialpädiatrische Abteilung<br />
Gesundheitsamt Bremen<br />
<strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
09.05.<strong>2007</strong> Bremen
Präventive Gesundheitssicherung für<br />
Risikofamilien durch das Gesundheitsamt<br />
-- <strong>Bremer</strong> Familienhebammen<br />
-- TippTapp – Gesund ins Leben<br />
-- Bremisches Kindeswohlgesetz<br />
Perinatalstudie Niedersachsen<br />
und Bremen 1983<br />
• Die fetoinfantile Mortalität ist immer noch sehr ausgeprägt<br />
mit den Lebensumständen der schwangeren<br />
Frauen bzw. der Mütter verknüpft.<br />
• Die Lebensumstände der Schwangeren und der<br />
Mütter sind vielfach den Ärzten nicht bekannt,<br />
soziale Risiken werden häufig nicht beachtet ...<br />
• Schwangere mit Risiken werden nicht häufiger oder<br />
intensiver versorgt als Schwangere ohne Risiken.<br />
• Soziale Risikogruppen ... werden schlechter versorgt<br />
als Frauen aus höheren Sozialschichten ... (Collatz u.<br />
Rhode, 1986).<br />
3<br />
Erstes Modellprojekt<br />
„Aktion Familien-Hebamme“<br />
Der erste Modellversuch konzentrierte sich u.a. auf die<br />
Ziele:<br />
• Alle Frauen möglichst umfassend und ihre jeweils<br />
konkrete Lebenswirklichkeit berücksichtigend zu<br />
beraten,<br />
• Frauen mit bestimmten sozialen und medizinischen<br />
Risiken besonders intensiv und kontinuierlich zu<br />
betreuen,<br />
• Eine enge Zusammenarbeit mit allen an der Versorgung<br />
beteiligten sozialen und medizinischen Institutionen zu<br />
verwirklichen (Collatz u. Rhode, 1986)<br />
Zweites Modellprojekt „Familien-<br />
Hebammen an Krankenhäusern“<br />
In dem zweiten, 1983 installierten Modellprojekt<br />
• wurden die Familien-Hebammen an den<br />
kommunalen Krankenanstalten in Bremen und<br />
<strong>Bremer</strong>haven angestellt.<br />
• Ein Viertel ihrer Arbeitszeit leisteten die Familien-<br />
Hebammen im Stationsdienst der geburtshilflichen<br />
oder pädiatrischen Kliniken ab.<br />
• Der Ansatz, flächendeckend bei allen Familien mit<br />
Neugeborenen eine Erstberatung durchzuführen,<br />
wurde verlassen.<br />
4<br />
5
Die „ABM-Phase“<br />
• Als Option auf eine dauerhafte Fortführung wurden<br />
zehn ABM-Stellen bereit gestellt.<br />
• Erste, noch vorläufige Anbindung an das<br />
Gesundheitsamt.<br />
• Familien-Hebammen sind nicht mehr Angestellte der<br />
kommunalen Krankenhäuser.<br />
• Jedoch weiterhin, zunächst regelmäßig, später nach<br />
Bedarf „Sozialmedizinische Visite“ auf den<br />
geburtshilflichen Stationen und in den Kinderkliniken.<br />
Die sozialmedizinische Visite<br />
verfolgt die Ziele:<br />
• Neues Stationspersonal mit Existenz und Auftrag der<br />
Familien-Hebammen bekannt zu machen.<br />
• Die Kenntnis der Indikatoren, die eine Betreuung<br />
durch die Familien-Hebammen sinnvoll erscheinen<br />
lassen, zu aktualisieren.<br />
• Und ggf. mit stationären Schwangeren oder Müttern<br />
im Wochenbett Kontakt aufzunehmen.<br />
6<br />
7<br />
Indikatoren <strong>zur</strong><br />
Familien-Hebammen-Betreuung<br />
• Schwerwiegende familiäre Probleme<br />
• Schwierige materielle Situation<br />
• Unklare ausländerrechtliche Situation<br />
• Seelische Störung / Sucht<br />
• Chronische Krankheit / Behinderung<br />
• Minderjährigkeit / Multiparität<br />
• Extrem Frühgeborene und Mehrlingsgeburten<br />
• Versorgungsinkompetenz / Analphabetismus<br />
• Gestörte Mutter-Kinder-Interaktion<br />
• Mißhandlungs- / Vernachlässigungsanamnese<br />
• Bereits fremdplatziertes Kind<br />
Familien-Hebammen am Gesundheitsamt<br />
Bremen (Stadt)<br />
Seit Juli 1988 sind die Familien-Hebammen fester Bestandteil des<br />
Dienstleistungsangebots des Gesundheitsamtes.<br />
• 5,5 Planstellen (560.000 Einwohner).<br />
• Je <strong>zur</strong> Hälfte Hebammen und Kinderkrankenschwestern.<br />
• Vor 25 Jahren unter 10, heute über 150 freiberufliche<br />
Hebammen.<br />
• Fortschreitende und sich fixierende Verelendung sozial<br />
benachteiligter Familien.<br />
• Deutliche Zunahme drogenabhängiger und psychisch<br />
auffälliger / kranker Schwangerer.<br />
Neu !!! 1 zusätzliche Planstelle ab 0<strong>1.</strong>06.<strong>2007</strong><br />
8<br />
9
Wege in die Betreuung<br />
Familien-Hebammen 2003<br />
Meldung | Freq Percent (n=166)<br />
-------------+----------------<br />
Selbst | 68 4<strong>1.</strong>0%<br />
Vermittlung | 98 59.0%<br />
-------------+----------------<br />
Betreuung |<br />
(n=166)<br />
-------------+----------------<br />
Erste | 142 85.5%<br />
Zweite | 24 14.5%<br />
-------------+----------------<br />
Erstbesuch |<br />
-------------+----------------<br />
Vor Geburt | 77 47.0%<br />
Nach Geburt | 87 53.0%<br />
-------------+----------------<br />
(n=164)<br />
Klientel bei Betreuungsaufnahme<br />
Familien-Hebammen 2003<br />
Alter d. Mutter | Freq Percent (n=166)<br />
----------------+----------------<br />
UNTER20 | 44 26.5%<br />
20bis34 | 100 60.2%<br />
UEBER34 | 22 13.3%<br />
----------------+----------------<br />
Nationalität | (n=165)<br />
----------------+----------------<br />
Deutsch | 121 73.3%<br />
Türkisch | 5 3.0%<br />
Sonstige | 39 23.6%<br />
----------------+----------------<br />
10<br />
11<br />
Führende Thematik in der Betreuung<br />
Familien-Hebammen 2003<br />
Sonstiges<br />
Materielle Situation<br />
Lebensweise Klientin<br />
Gesundheit Klientin<br />
Gesundheit Kind<br />
Fam. Beziehungsgefüge<br />
Versorgungskompetenz<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4,8<br />
5,4<br />
10,2<br />
12,0<br />
12,0<br />
15,7<br />
31,9<br />
0 5 10 15 20 25 30 35<br />
Beendigung der Betreuung durch (n=166)<br />
Klientin<br />
26,5%<br />
Ortswechsel<br />
6,6%<br />
Hebamme<br />
66,9%<br />
12<br />
13
Gründe für Beendigung der Betreuung<br />
Grund |bei bei<br />
|Initiat. Initiat.<br />
|Hebamme Klientin Gesamt<br />
|(n=111) (n=44) (n=155)<br />
-----------------+---------------------------<br />
Problem gelöst | 8.1% 18.2% 1<strong>1.</strong>0%<br />
Problem im Griff |16.2% 15.9% 16.1%<br />
Hilfe greift | 9.9% 4.5% 8.4%<br />
Ablehnung | 6.3% 54.5% 20.0%<br />
Sonstige |16.2% 6.8% 13.6%<br />
Kind 1 Jahr |43.2% 0.0% 3<strong>1.</strong>0%<br />
-----------------+---------------------------<br />
Anzahl der Hausbesuche<br />
Betreuungsaufnahmen 2003 (n=162)<br />
Fälle<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1<br />
4<br />
7<br />
10<br />
13<br />
16<br />
19<br />
22<br />
25<br />
28<br />
31<br />
34<br />
Hausbesuche<br />
37<br />
40<br />
43<br />
46<br />
49<br />
14<br />
15<br />
Dauer der Betreuung in Monaten<br />
Betreuungsaufnahmen 2003 (n=150)<br />
Fälle<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
Dauer der Betreuung in Monaten<br />
Systemberatung und Vernetzungsarbeit<br />
Familien-Hebammen<br />
• AK 0-3-Jährige Jugend-, Familien-, Gesundheitshilfe<br />
• Treffen von Gesundheitsdienstleistern in HB-Nord, HB-Süd,<br />
HB-Ost, HB-Mitte-West<br />
• AK Schwangere in Not (Beratung im Kontext Abtreibung)<br />
• AK Minderjährige Schwangere und Mütter (Schulabschluss)<br />
• AK postpartale Depression<br />
• Forum Frauengesundheit<br />
• AK Kinder psychisch kranker Eltern<br />
• AK Kinder drogenabhängiger Eltern<br />
• AK Kindesmißhandlung-/Vernachlässigung<br />
• AK Migration<br />
16<br />
17
Rahmenbedingungen erfolgreicher<br />
Gesundheitsarbeit mit benachteiligten<br />
Zielgruppen<br />
• Klare Aufgabenstellung und gesicherte<br />
Ressourcen für das Arbeitsfeld<br />
• Ein funktionierendes Regelversorgungssystem<br />
• Netzwerke <strong>zur</strong> Rekrutierung der Klienten.<br />
• Zuverlässige Kooperationspartner bei<br />
krisenhaften Entwicklungen<br />
Präventive Gesundheitssicherung für<br />
Risikofamilien durch das Gesundheitsamt<br />
-- <strong>Bremer</strong> Familienhebammen<br />
-- TippTapp - Gesund ins Leben<br />
-- Bremisches Kindeswohlgesetz<br />
18<br />
TippTapp – Gesund ins Leben<br />
ist ein<br />
sozialindexgestütztes, sozialraumbezogenes<br />
Flächenkonzept der Frühprävention<br />
mit den Elementen:<br />
• Vorausschauende Beratung<br />
• Soziale Vernetzung im Wohnquartier<br />
• Screening auf Kindeswohlgefährdung<br />
TippTapp – Gesund ins Leben<br />
Vorgehensweise:<br />
Die Eltern erhalten nach der Geburt sowie im Alter des Kindes<br />
von 6 und 12 Monaten Beratung durch eine Kinderkrankenschwester<br />
im Rahmen eines angekündigten Hausbesuchs.<br />
Zur Einschätzung des kindlichen Versorgungsniveaus wird ein<br />
Gefährdungs- und Beobachtungsbogen eingesetzt.<br />
Der Arbeitsansatz soll als Gemeinschaftsprojekt der Familienhebammen<br />
und der Stadtteilteams des Kinder- und Jugend -<br />
gesundheitsdienstes des Gesundheitsamtes durchgeführt<br />
werden.<br />
Einbezogen werden die 13 sozial benachteiligsten Ortsteile<br />
Bremens. Damit werden etwa 25% der Säuglinge eines<br />
Geburtsjahrgangs und deren Eltern erreicht.
TippTapp – Gesund ins Leben<br />
In das Besuchsprogramm einbezogene Ortsteile<br />
Rang Ortsteil Geburten/Jahr<br />
1 373 Tenever 130<br />
2 442 Gröpelingen 105<br />
3 443 Ohlenhof 89<br />
4 441 Lindenhof 76<br />
5 112 Bahnhofsvorstadt 35<br />
6 212 Hohentor 42<br />
7 242 Sodenmatt 74<br />
8 522 Grohn 46<br />
9 332 Neue Vahr Nord 94<br />
10 218 Huckelriede 66<br />
11 533 Lüssum-Bockhorn 115<br />
12 233 Kattenturm 131<br />
13 383 Hemelingen 113 gesamt 1117<br />
TippTapp – Gesund ins Leben<br />
Ziele des Projekts<br />
im Bereich Beratung:<br />
Individuelle Beratung zu Bedürfnissen des<br />
Kindes im jeweiligen Alter<br />
Hinführung an die einschlägigen Netzwerke<br />
des jeweiligen Wohnquartiers<br />
Motivation <strong>zur</strong> Teilnahme an den Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen<br />
TippTapp – Gesund ins Leben<br />
Ziele des Projekts<br />
im Bereich Screening:<br />
Einschätzung der Familiensituation und des<br />
weiteren Entwicklungsumfelds des Kindes im<br />
Hinblick auf langfristige Beratungs- bzw.<br />
Unterstützungsbedarfe<br />
Bei Bedarf verbindliche Aktivierung der<br />
Regelunterstützungssysteme, ggf. Einleitung<br />
von Maßnahmen <strong>zur</strong> Sicherung des Kindeswohls<br />
TippTapp – Gesund ins Leben<br />
Zusammenfassung<br />
• Das Projekt stellt einen vergleichsweise kostengünstigen<br />
Beratungsansatz im Hochrisikomilieu dar, obwohl das Projekt<br />
primär aufsuchend arbeitet.<br />
• Es schließt eine Lücke im Bereich der Erkennung jugendhilferelevanter<br />
Problemlagen und deren Zuweisung an<br />
etablierte Angebote der Jugend- und Gesundheitshilfe.<br />
• Es erfüllt die Türöffnerfunktion, die im aktuellen Jugendhilfediskurs<br />
den elternseitig meist positiv bewerteten<br />
Gesundheitsberatungsangeboten zugeschrieben wird.<br />
• Übereinstimmung mit den Vorgaben der Obersten Landesjugendund<br />
Gesundheitsbehörden: Vorhandene Strukturen müssen<br />
effektiver genutzt, „Gehstrukturen“ für bestimmte Zielgruppen<br />
verstärkt und Hilfen für junge Familien besser vernetzt werden.
Präventive Gesundheitssicherung für<br />
Risikofamilien durch das Gesundheitsamt<br />
-- <strong>Bremer</strong> Familienhebammen<br />
-- TippTapp - Gesund ins Leben<br />
-- Bremisches Kindeswohlgesetz<br />
Beteiligung* des Einschulungsjahrganges<br />
2006 in Bremen an den Früherkennungsuntersuchungen<br />
für Kinder<br />
bezogen auf die Kinder, die ihr Vorsorgeheft vorgelegt<br />
haben (3909 von 4529 = 86,3 Prozent)<br />
Unter- Untersuchungs- Beteiligungsuchung<br />
zeitraum in Prozent<br />
U2 03. bis 10. L.-Tag 97,0<br />
U3 04. bis 06. Woche 96,9<br />
U4 03. bis 04. Monat 96,3<br />
U5 06. bis 07. Monat 94,4<br />
U6 10. bis 12. Monat 94,3<br />
U7 2<strong>1.</strong> bis 24. Monat 91,8<br />
U8 3,5 bis 04 Jahre 87,6<br />
U9 5,0 bis 5,25 Jahre 84,9<br />
Kindeswohlgesetz<br />
§ 14a Früherkennungsuntersuchungen für Kinder<br />
(1) Das zuständige Gesundheitsamt lädt die gesetzliche<br />
Vetreterin ... jedes Kindes, dessen Früherkennungsuntersuchung<br />
U4 bis U9 ... bevorsteht, <strong>zur</strong> Teilnahme<br />
des Kindes an der jeweiligen Früherkennungsuntersuchung<br />
... schriftlich ein.<br />
(3) Das Gesundheitsamt stellt fest, für welche ...<br />
eingeladenen Kinder die Rückmeldung durch eine<br />
niedergelassene Ärztin ... innerhalb einer angemessenen<br />
Frist nach der Einladung nicht vorliegt.<br />
Soweit ... keine Rückmeldung vorliegt, erinnert das<br />
Gesundheitsamt zeitnah ... an die Durchführung ...<br />
Kindeswohlgesetz<br />
§ 14a Früherkennungsuntersuchungen für Kinder<br />
(4) Erhält das Gesundheitsamt auch nach der Erinnerung<br />
... keine Rückmeldung ... über die Durchführung der<br />
Früherkennungsuntersuchung ... nimmt das Gesundheitsamt<br />
gezielt Kontakt mit der gesetzlichen Vertreterin<br />
... auf und bietet ... einen Hausbesuch und gleichzeitig<br />
die Durchführung der Früherkennungsuntersuchung<br />
... an.<br />
(5) Wird die Durchführung der Früherkennungsuntersuchung<br />
... ohne hinreichende und nachgewiesene<br />
Gründe abgelehnt, teilt das Gesundheitsamt dies<br />
unverzüglich dem Jugendamt mit.
Kindeswohlgesetz<br />
Fragen<br />
• Ermöglicht die gegenwärtige zeitliche Abfolge der Früherkennungsuntersuchungen<br />
Kindeswohlgefährdungen im Kleinkindesalter zu<br />
erkennen ?<br />
• Sind die Früherkennungsuntersuchungen überhaupt der geeignete<br />
Ansatz zuverlässig Kindeswohlgefährdungen zu diagnostizieren ?<br />
• Wird das sogenannte „Tracking“ überwiegend fehlenden Mitteilungen<br />
über durchgeführte Früherkennungsuntersuchungen oder<br />
doch vornehmlich versäumten Terminen gelten ?<br />
• Ist der Imageschaden der Behörden bei unbegründetem Nachfragen<br />
wegen versäumter U-Termine nicht größer als der mögliche<br />
Benefit durch frühzeitige Interventionen ?<br />
• Rechtfertigt der Nutzen der Maßnahme insgesamt den erheblichen<br />
bürokratischen Aufwand ?<br />
Ich danke für<br />
Ihre Aufmerksamkeit !<br />
Eberhard Zimmermann<br />
Sozialpädiatrische Abteilung<br />
Gesundheitsamt Bremen<br />
Tel. 0421/ 361-6229<br />
Fax: 0421/ 361-15600<br />
eberhard.zimmermann@<br />
gesundheitsamt.bremen.de<br />
31
Herbert Holakovsky<br />
Referatsleiter Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfen, Familienrechtshilfen, SGB IX beim Amt für Soziale Dienste Bremen<br />
E-Mail: herbert.holakovsky@afsd.bremen.de<br />
Kinderschutz verbessern: Fachpolitische Eckpunkte <strong>zur</strong> Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung<br />
von Fachstandards im Rahmen der Fortschreibung des ASD Konzeptes<br />
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche<br />
davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch<br />
elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung Schaden erleiden.<br />
Bereits § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII nennt den Schutz von Kindern<br />
und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl als Ziel der Kinder- und<br />
Jugendhilfe.<br />
Vor dem Hintergrund der primären elterlichen Erziehungsverantwortung<br />
(Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) bedeutet dies, dass das Instrumentarium<br />
der öffentlichen Jugendhilfe nicht nur auf Hilfen beschränkt sein<br />
kann, über deren Inanspruchnahme die Eltern entscheiden können,<br />
sondern auch Befugnisse zum Schutz von Kindern umfassen muss,<br />
die mit Eingriffen in die Rechtsposition (der Eltern) verbunden sind und<br />
damit nicht den Kriterien von Sozialleistungen entsprechen. Scheitern<br />
Beratung und Unterstützung, so ist das Jugendamt verpflichtet, von<br />
Amts wegen und ggf. ohne Zustimmung der Eltern Maßnahmen zum<br />
Schutz des Kindes zu ergreifen oder zu initiieren, die aus der Perspektive<br />
der Eltern als Entlastung, aber auch als Eingriff oder Kontrolle<br />
empfunden werden. Durch die von der Kinder- und Jugendhilfe wahrzunehmende<br />
Garantenstellung für Kinder und Jugendliche unterscheidet<br />
sie sich von allen anderen Sozialleistungsträgern.<br />
In den verschiedenen Fachvorträgen haben wir heute viel über die<br />
Lebensrealitäten vernachlässigter Kinder erfahren, gespiegelt durch<br />
den Blick verschiedener Fachdisziplinen sowie über die Inhalte des<br />
„Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung“ durch den neu eingefügten<br />
§ 8a SGB VIII.<br />
Immer wieder wurde in unterschiedlicher Weise deutlich wie wichtig<br />
das frühzeitige Erkennen von Entwicklungsrisiken ist und das fachlich<br />
adäquate Reagieren darauf. Daraus lässt sich m.E. sehr anschaulich<br />
ableiten, dass erst im Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen<br />
sich das Gefährdungsrisiko am ehesten einschätzen, erkennen und<br />
bewerten lässt und die notwendigen Handlungsstrategien mit einem<br />
höheren Grad an Sicherheit und Verbindlichkeit operrationalisiert werden<br />
können.<br />
Unbestritten kommt den staatlichen Stellen und insbesondere dem<br />
Jugendamt bei dieser Aufgabenstellung eine Schlüsselrolle zu, da die<br />
Garantenstellung für die Kindeswohlsicherung letztlich in der Verantwortung<br />
des Staates (Wächteramt) liegt.<br />
Insoweit liegt es nahe nunmehr auch die Qualitätsentwicklung und<br />
Qualitätssicherung sowie die Handlungsstrategien des Jugendamtes in<br />
den Blick zu nehmen.<br />
Ich will mich zu diesem Zeitpunkt auf die wesentlichen Aspekte beschränken.
<strong>1.</strong> Verbesserung der Erreichbarkeit des Jugendamtes durch<br />
Einrichtung eines kommunalen Kinder- und Jugendnotdienstes<br />
Bereits zum 0<strong>1.</strong>02.<strong>2007</strong> ist ein Kinder- und Jugendschutztelefon<br />
gesamtstädtisch eingerichtet worden. Seit dieser Zeit ist sichergestellt,<br />
dass über die zentrale Telefonnummer 6 99 11 33 täglich „rund um die<br />
Uhr“ eine im Kinderschutz erfahrene Fachkraft erreichbar ist, um eine<br />
telefonische Erstberatung durchzuführen. Von Montag bis Freitag in<br />
der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr erfolgt die Beratung durch die Fachkraft<br />
des Jugendamtes. Krisenmeldungen werden unmittelbar an das<br />
zuständige Sozialzentrum weitergeleitet. Durch eine verbindliche Anwesenheitsregelung<br />
ist in den sechs Sozialzentren sichergestellt, dass<br />
jeweils ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin des ambulanten Sozialdienstes<br />
Junge Menschen erreichbar ist, um der Krisenmeldung unmittelbar<br />
selber nachzugehen oder um die Mitteilung an die zuständige<br />
sozialpädagogische Fachkraft <strong>zur</strong> Überprüfung zu übergeben. Da die<br />
Einschätzung des Gefährdungsrisikos durch das Zusammenwirken<br />
mehrerer Kinderschutzfachkräfte notwendig ist wird in naher Zukunft<br />
der Aufbau eines so genannter „Hintergrunddienstes“ im Sinne einer<br />
Rufbereitschaft mit - in der Wahrnehmung des Kinderschutzes erfahrenen<br />
Fachkräften - angestrebt. Um das Fachwissen der freien Träger<br />
zu nutzen, wird dieser Hintergrunddienst in Kooperation mit den freien<br />
Trägern aufgebaut und eingerichtet. Damit soll in dieser Stadt sichergestellt<br />
werden, dass für Familien und Kinder in akuter Not die Jugendhilfe<br />
rund um die Uhr erreichbar ist.<br />
2. Fortbildung und Qualifizierung - Personalentwicklung<br />
Die Wahrnehmung des Kinderschutzes durch den Träger der öffentlichen<br />
Jugendhilfe gehörte bisher und gehört auch zukünftig zu seinen<br />
Kernaufgaben. Mit der Verstärkung ökonomischer Ungleichheitsverhältnisse<br />
und konfliktreicher Familienbeziehungen wachsen auch die<br />
Gefährdungen von Kindern zumal in sozialbenachteiligten Gebieten.<br />
Ausgehend von der Veränderungen und Entwicklungen und aufgrund<br />
der Garantenstellung des Jugendamtes insbesondere vor dem Hintergrund<br />
der Präzisierungen durch den § 8a SGB VIII, wird noch in diesem<br />
Jahr ein umfassender Qualitätsentwicklungsprozess für den am-<br />
bulanten Sozialdienst Junge Menschen eingeleitet, mit dem eine<br />
Qualifizierung im Bereich des Kindesschutzes einhergehen.<br />
Eine im Rahmen eines Fachtages im Januar <strong>2007</strong> durchgeführte Bedarfsanalyse<br />
ist zum Anlass genommen worden, Herrn Prof. Wolff mit<br />
der Entwicklung eines Curriculums <strong>zur</strong> Qualitätsentwicklung im Kontext<br />
Kinderschutz zu beauftragen.<br />
Folgende Grundkurse/Fachseminare sind demnach vorgesehen:<br />
3. „Methoden der Risikoeinschätzung bei Kindesmisshandlung und<br />
Vernachlässigung“<br />
4. „Grundkurs: Kindesmisshandlung und Vernachlässigung – Erkennen<br />
und Verstehen, Eingreifen und Helfen“<br />
5. „Qualitätssicherung und Risikomanagement in der Kinderschutzarbeit<br />
– Das <strong>Bremer</strong> Konzept“<br />
6. „Die Zusammenarbeit im Kinderschutz fördern – ein Netzwerk der<br />
Hilfe aufbauen“<br />
Insbesondere mit der letzt benannten Qualifizierungsmaßnahme ist<br />
vorgesehen <strong>zur</strong> Aktivierung der gesellschaftlichen gemeinwesenorientierten<br />
Kräfte in der Stadtgemeinde Bremen die Entwicklung von<br />
Netzwerken zu fördern und das gesellschaftliche Bewusstein für die<br />
Wahrnehmung des Kinderschutzes zu erweitern.<br />
Mit der heutigen <strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong> ist uns gemeinsam<br />
ein eindrucksvoller erster Schritt gelungen.<br />
3. Sicherstellung von Supervision<br />
Die Tätigkeiten innerhalb des Jugendamtes mit den Aufgaben der Beratung<br />
und Unterstützung von Personensorgeberechtigten sowie der<br />
Einleitung, Begleitung und Überprüfung von Maßnahmen und ggf. der<br />
Entwicklung passgenauer Hilfen stellt besondere Herausforderungen<br />
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses insbesondere auch<br />
aufgrund des „doppelten Mandats“ - Beratung und Unterstützung so-
wie ggf. sofortiges Eingreifen und Herausnahme zum Schutz von Kindern<br />
und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII. Zur Bewältigung dieser<br />
komplexen Arbeitsprozesse wird zukünftig eine regelmäßige Teamsupervision<br />
angeboten. Darüber hinaus soll aufgrund zunehmender<br />
komplexer Einzelfälle, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeiten für<br />
Einzelsupervision <strong>zur</strong> Verfügung gestellt werden.<br />
4. Handlungsleitfaden <strong>zur</strong> Umsetzung des § 8a SGB VIII im<br />
Ambulanten Sozialdienst Junge Menschen<br />
Mit der Einführung des § 8a SGB VIII sind die Aufgaben und das<br />
Verfahren des Kindesschutzes für die freien Träger und den öffentlichen<br />
Jugendhilfeträger präzisiert worden. In einem Handlungsleitfaden<br />
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und zusätzlich<br />
durch eine Vereinbarung, die zwischen dem öffentlichen Jugendhilfeträger<br />
und den freien Trägern der Jugendhilfe gemäß § 8a SGB VIII<br />
abgeschlossen werden soll, soll die Wahrnehmung des Kindesschutzes<br />
auch durch die freien Träger sichergestellt bzw. die Sicherstellung<br />
optimiert und das Meldeverfahren von Kindeswohlgefährdungen an<br />
das Jugendamt entsprechend standardisiert werden. In diesem Kontext<br />
liegen standardisierte Indikations-, Schutz- und <strong>Dokumentation</strong>sbögen<br />
vor, die von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und<br />
Sozialplanung Bremen e.V. (GISS) im Rahmen einer Evaluation mit<br />
den freien Trägern entwickelt worden sind.<br />
<strong>1.</strong> Nachqualifizierung des Casemangement durch systematische<br />
Verankerung von Hausbesuchen sowie dem Instrumentarium<br />
der Kollegialen Beratung und interdisziplinärer Fallkonferenzen<br />
2. Stärkere Verzahnung der Angebotsstrukturen - im Rahmen der<br />
Frühprävention - vor Ort - Schaffung von Frühwarnsystemen<br />
Netzwerken unter Einbeziehung der Häuser der Familie, der<br />
Erziehungsberatungsstellen, der Frühberatung, Kindertagesheime<br />
und des öffentlichen Gesundheitswesen sowie der niedergelassenen<br />
Kinderärzte.<br />
3. Bedarfsgerechte personelle Ausstattung der öffentlichen Jugendhilfe<br />
<strong>zur</strong> Wahrnehmung der Aufgaben des Kinderschutzes.<br />
Der Jugendhilfeausschuss / die städtische Deputation für Soziales,<br />
Jugend, Senioren und Ausländerintegration hat sich mit der Neujustierung<br />
der öffentliche Jugendhilfe in seiner Sitzung am 17. April bzw. 19.<br />
April <strong>2007</strong> fachpolitisch auseinandergesetzt und die eingeleitete Entwicklung<br />
einhellig begrüßt. Dabei war unverkennbar, dass auch die<br />
Politik die Notwendigkeit sieht, den Ressourcenrahmen den notwendigen<br />
Anforderungen anzupassen und die in den letzten Jahren entstandene<br />
Schieflage zugunsten der Kinder und deren Familien positiv<br />
zu verändern.<br />
Gleichwohl darf nicht verkannt werden und ich zitiere hier Prof. Dr.<br />
Wolff aus einem Artikel "Inwiefern können Fachkräfte des Sozialen<br />
Dienstes durch ihr Handeln Kindern schaden bzw. <strong>zur</strong> Kindeswohlgefährdung<br />
beitragen?“: der allgemeine Sozialdienst des Jugendamtes<br />
ist ein Arbeitsfeld mit einem hohen Sicherheitsrisiko, besteht doch die<br />
Aufgabe dieser öffentlichen Kinderschutz-Organisation geradezu darin,<br />
mit verbindlichem Auftrag in Extremsituationen einzugreifen, die weder<br />
zuverlässig vorauszusehen noch sicher zu kontrollieren sind. Familien,<br />
zumal in lebensgeschichtlichen Krisen, sind nämlich lebende, sich<br />
selbst reproduzierende Systeme, deren Bewegungen man zwar wahrnehmen<br />
und beeinflussen, aber nicht ausrechnen, messen, oder in<br />
den Griff bekommen kann. Insofern geht es in der Praxis des ASD der<br />
immerhin einen institutionellen Rahmen mit Richtlinien und Regelungen<br />
aber zugleich lebendige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (lebende<br />
Personensysteme) hat, die keine Maschinen sind und die es in ihrem<br />
organisierten Miteinander immer wieder mit spontan sich ergebenden<br />
Chaotisierungen zu tun haben, grundsätzlich darum, dass Unerwartete<br />
zu managen. Kinderschutz hat es mit komplexen, dynamischen - d.h.<br />
nicht trivialen - Extremsituationen zu tun und ist selbst komplex."
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der <strong>1.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>Kinderschutzkonferenz</strong><br />
Adam Annelie HdF Vegesack<br />
Ahlers Sandra AfSD SZ 04<br />
Ahrens Monika Kinder- u. Jugendges.dienst<br />
Allison Gerhild Hans-Wendt-Stiftung<br />
Apel Friederike St. Petri Kinder u. Jugendhilfe<br />
Assouroko Anke Kinder u. Jugendschutztelefon, Kinderschutzbund<br />
Balle Ingrid Amt f. Jugend u. Familie, <strong>Bremer</strong>haven<br />
Balser Ulrike comeback GmbH<br />
Bankowski Sabine Amt f. Jugend u. Familie, <strong>Bremer</strong>haven<br />
Bargen Dorothea von AfSD SZ 01<br />
Bargfrede Stefanie Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Becker Angelika Kinder- u. Jugendges.dienst<br />
Berauer Brigitte SOS Kinder- u. Jugendhilfe<br />
Bergmann-Klee Martina Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Beyersmann Inge Familienzentrum Hemelingen, Frühberatung<br />
Blandow Dorothea AfSD<br />
Blumenberg Anja AfSD STL JM, SZ 02<br />
Bock-Mathiaszyk Klaus AfSD SZ 03<br />
Bodhammer Robert SPI Kinderzentrum<br />
Bohne Jennifer <strong>Bremer</strong> Familienkrisendienst<br />
Böseler Annika AfSD SZ 03<br />
Braaksma Susanne Gesundheitsamt KIPSY<br />
Brandt Petra VAJA e. V.<br />
Brennecke Petra AfSD SZ 05<br />
Brünjes Heike AfSD SZ 01<br />
Bücken Michael Caritas Bremen<br />
Bücker Heike Kath. Gemeindeverband<br />
Burggraf Viktoria AfSD EB SZ 02<br />
Bury Carola Arbeitnehmerkammer<br />
Christoph Caritas Bremen<br />
Crasemann, Dr. Hendrik Kinderärztliche Gemeinschaftspaxis<br />
Crueger Jens<br />
Dahle, Prof. Dr. Ekke Hochschule f. öffentliche Verwaltung<br />
Damke Petra Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Dauer Sieglinde AfSD SZ 02<br />
Denker Vanessa AfSD SZ 06<br />
Diener Rolf AfSD SZL 06<br />
Dierks-Baumann Gisela AfSD SZ 02<br />
Dietzmann Nicole AfSD Steuerungsstelle<br />
Ebend Claudia Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Eckelmann Dagmar Kindertagesstätte<br />
Egbers Kathrin Magistrat <strong>Bremer</strong>haven<br />
Egmont, Dr. Conradi Kinderarzt<br />
Ehmann Claudia Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Ehmke Matthias AfSD SZ 01<br />
Ernst-Pawlik Ernst AfSD SZL 05<br />
Eschke Elke Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Essmann Siegfried AfSD SZL S 3<br />
Evers Helma HdF Vahr<br />
Evers Hagret Kita Jaburgstr.<br />
Ewert Paul-Thomas Fachstelle f. Gewaltprävention<br />
Falke Regina SfAFGJS<br />
Fetchenhauer Mathias AfSD SZ 05<br />
Fiegen Anne-Meike AfSD<br />
Filter Jaona Klinikum Bremen-Mitte<br />
Fixsen-von Cleve Uta<br />
Floemer Carsten DRK Jugendhilfe Kleine Marsch<br />
Franzky-Witte Claudia Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Frick Waltraud Kath. Gemeindeverband<br />
Friedrich Günter AfSD SZ 06<br />
Fröhlich-Heidenreich Frau Hermann Hildebrand Haus<br />
Gaida Joachim comeback GmbH<br />
Garbe Beate AfSD SZL 01<br />
Geppert Nicole AfSD SZ 1<br />
Gitter, Dr. med. Heidrun Klinikum Bremen Mitte<br />
Gremerich Ingeborg PiB<br />
Greve, Dr. Axel<br />
Gros-Uhlenberg Lisa Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Grünewald Kristin Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Gschwendtner Franziska Caritas Bremen<br />
Günther Jörn KBO<br />
Haas Monika Kinder u. Jugendges.dienst
Häger Marion Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Hamann Björn AfJ e.V. Jugendwohnhaus<br />
Hamann Ann-Kathrin Stadtteilprojekt Huchting<br />
Hansen-Crasemann, Dr. Martina Kinderärztliche Gemeinschaftspaxis<br />
Harm Vera<br />
Heinke Sabine Familiengericht Bremen<br />
Heinrich Sonja AfSD FA 2<br />
Heinze Heike GA Bremen<br />
Heitmann Gisela Ambulante Drogenhilfe<br />
Heitmann Gundula Hans-Wendt-Stiftung<br />
Hellbach Barbara S.f.AFGJS<br />
Helmers Karen HdF Hemelingen<br />
Hempel Ulrike AfSD FA 2<br />
Hennigsen Silke Ev. Kindertagesheim<br />
Herzog, Dr. Brigitte Kinderarztpraxis<br />
Heuer Denise Bürgerzentrum Vahr<br />
Hillebrand-Stein Marita Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Hoffer Antje GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Hoffmann Silvia AfSD SZ 03<br />
Holakovsky Herbert AfSD FA 2<br />
Holschen Maria Amt für Jugend u. Familie <strong>Bremer</strong>haven<br />
Homberg Dirk AfSD SZ 01<br />
Höppner Silke AfSD<br />
Hornkohl Christiane Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Horstkotte Elisabeth Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Hottmann Christine Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Hübotter Imke GA Bremen<br />
Hüller Michael Amt f. Jugend u. Familie <strong>Bremer</strong>haven<br />
Huppertz, Prof. Dr. med. Hans-Ilko Prof.-Hess-Kinderklinik Bremen<br />
Ihle Christiane Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Ihlo-Griese Inge HdF Obervieland<br />
Jahn Marina Verbund <strong>Bremer</strong> Kindergruppen e. V.<br />
Jähn Kristina Kriz e. V.<br />
Jakob Christine Kita Pastorenweg<br />
Jakobs Irmgard Kindertagesstätte St. Hedwig<br />
Janssen Julia HdF Hemelingen<br />
Janssen Karin Mutter-Kind-Haus Bethanien<br />
Järleby Karin Hans-Wendt-Stiftung<br />
Jelinek Heiko EB Mitte<br />
Jeschke Regina KITA<br />
Jörn-Tryggve Günther Klinikum Bremen-Ost<br />
Jung-Schneider Julia Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Kahmann Beate Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Kastendiek Barbara Kita Hohentor<br />
Keil Margit PiB<br />
Kessenich-Reiss Edna Heilpraktikerin<br />
Kette, Dr. Stefan niedergelassener Kinder u.Jugendpsychiater<br />
Klahr Roland Afj-ev.<br />
Kleen Christiane Kath. Gemeindeverband<br />
Klein-Ellinghaus Funda GA Bremen<br />
Kleine-Tebbe Maren Schattenriss e. V.<br />
Kleinschmidt Michael Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Kleinschmidt-Ratz Jutta Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Klene Gerda Kath. Gemeindeverband<br />
Kludt-Rathjen Petra Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Knappe Werner AfSD<br />
Knoop Christiane Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Kobbe Kirsten AfSD SZ 01<br />
Koopmann Christina AWO Bremen<br />
Kothe Thomas Polizei Bremen<br />
Kramer Birgit Hans-Wendt-Stiftung<br />
Kreienborg Kirsten Kath.Gemeindeverband<br />
Krumbholz Monika PiB<br />
Krüner-Reuß Ilka HDF Lüssum<br />
Kruse-Johannes Elisabeth SKF Kinder-Krippe<br />
Küfe Bianca AfSD<br />
Kunze Sabine GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Lahann Hans-Jürgen Hans-Wendt-Stiftung<br />
Lammers Heike Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Lang Peter AfSD<br />
Laxa-Zimmermann Bärbel Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Lehmann Steffi Kita Hohentor<br />
Lettau Simone Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Lindenberg Andrea Mutter-Kind-Haus Bethanien<br />
Lindhorst Andreas Hans-Wendt-Stiftung<br />
Lippmann Petra Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Loos Rosemarie AfSD<br />
Lorenz, Dr. Alfred GA Bremen Kipsy
Loschky Anne AfSD EB SZ 02<br />
Louis-Hodde Petra Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Mahnken Regina AfSD SZ 06<br />
Mehr, Dr. Burkhard Klinikum Bremen-Mitte, Kinderzentrum<br />
Meier Christine Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Meinrenken, Dr. Wolfgang Berufsverband d. Kinder und Jugendärzte Bremen e. V.<br />
Meyerhoff Tina HdF Hemelingen<br />
Meyer-Wiedemann Hubert AfSD Qualifizierung<br />
Mick-Pratska Marion HdF Mitte<br />
Mohr-Lüllmann Rita<br />
Möklmann Heike Klinikum Bremen-Mitte, Kinderzentrum<br />
Mosler Marion AWO Bremen<br />
Motzkau, Dr. med. Eberhard Ärztliche Kinderschutzambulanz, Düsseldorf<br />
Mpinazes Lena AfSD FA 2<br />
Mumme Inga AfSD SZ 02<br />
Nahnsen Yvonne AfSD SZ 02<br />
Navel Frank Lerncauch<br />
Nerz Conny HdF Hemelingen<br />
Nerz Frank AfSD AL/V<br />
Ney Claudia AfSD SZ 02<br />
Nölke-Hartz Birgit AfSD EB West<br />
Nolle Isa Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.<br />
Ogon Renate AfSD SZ 06<br />
Ohlebusch Heike Mädchenhaus Bremen e.V.<br />
Oltmanns Heidrun GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Ostermann Joachim S.f.AFGJS, LJA<br />
Ottem Susanne GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Otto Doris Heinrich-von-Zütphen-Haus<br />
Paeplow Heike Klinikum Links d.Weser, Sozialdienst<br />
Palinski Astrid GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Pape Herr Hermann Hildebrand Haus<br />
Pawlik Dagmar AfSD SZ 05<br />
Peters Caritas Bremen<br />
Pietsch-Kavurmaci Doris Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Ploghöft Ute SfAFGJS<br />
Pörksen Marianne Drogenberatungsstelle Mitte<br />
Porrath, Dr. Kerstin Kinderklinik Links der Weser<br />
Prüser Kathrin AfSD<br />
Purnhagen Irmtraut HdF Osterholz<br />
Quellhorst Michaela Kindertagesstätte St. Hedwig<br />
Ramirez Chavez Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Raub Barbara Kinderärztin<br />
Rehmstedt Kerstin AfJ e. V. Jugendhilfe<br />
Rehwinkel Evelyn GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Rein Bernd S.f.AFGJS<br />
Reincke Antje Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Reiners Kerstin AfSD SZ 03<br />
Reinhardt Monika Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Rexin Holger Kriz e. V.<br />
Ribbentrop, Dr. Christian Klinikum Bremen-Nord<br />
Richter Joachim St. Petri Kinder u. Jugendhilfe<br />
Riehm Rüdiger St. Theresienhaus<br />
Riekers Cindy Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Rodolph Sabine Kriz e. V.<br />
Roepke Linda St. Johannis Kinder u. Jugendhilfe<br />
Roger Wolfram Schubertstr.7 28209 Bremen<br />
Rohn Anja Jugendamt <strong>Bremer</strong>haven<br />
Rosenkötter Ingelore Senatorin für AFGJS<br />
Rudolph Anne Praxis Dr. Deetz<br />
Russ Inga AfJ e.V. Jugendwohnhaus<br />
Sadowski Gabriele Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Salata Anna JHW Delmenhorst<br />
Sander, Dr. Ute GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Schäfer Bernd AfSD Amtsvormundsch.<br />
Schafstädt Klaus AfSD<br />
Scheland-Büttner Gudrun Kita Osterhop<br />
Scherf Monika AfSD<br />
Schilling Viviane AfSD Amtsvormundsch.<br />
Schlottmann Christine Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Schmidt Reinhard AOK Bremen/<strong>Bremer</strong>haven<br />
Schmidt Frank GA Bremen, Drogenhilfe<br />
Schmidt Jan Reisende Werkschule Scholen<br />
Schmidt-Bojahr Elke GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Schmitz Maria-<br />
Elisabeth<br />
Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Schoppe Gabi AfSD FA 2<br />
Schröder Hilke Psychotherapeutenkammer Bremen<br />
Schulmann Ute Soz. Dienste der Justiz HB-Nord
Schulte Erika AfSD SZ 02<br />
Schulz, Prof. Dr. med. Eberhard Uni-Klinik Freiburg<br />
Schulze Rudolf PiB<br />
Schwarz, Dr. Michael S.f.AFGJS, LJA<br />
Schwarze Christa HdF Obervieland<br />
Schweppe Georg Schule an der Fritz-Gansberg-Str.<br />
Schwert-Jeger Jochen AfJ e. V.<br />
Senft Sandra AfSD Amtsvormundsch.<br />
Setzepfand-Olliges Bettina Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Sextro Ralf AfSD Amtsvormundsch.<br />
Sickinger Fridolin AfSD<br />
Sinsch Anja Amt f. Jugend u. Familie <strong>Bremer</strong>haven<br />
Soppa Rieke<br />
Speckels-Hüll Anneliese BEKLV<br />
Spies Carsten Deutscher Kinderschutzbund, LV Bremen<br />
Spöttel Mathias <strong>Bremer</strong> Familienkrisendienst<br />
Stapke Thomas effect GmbH<br />
Steffen Ino GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Steffen Katrin comeback GmbH<br />
Stege Monika Kita Schwedenhaus<br />
Steging-Lüken Johanne HdF Vegesack<br />
Stemmer Ilkona Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Steuber Christian Kinderklinik Links der Weser<br />
Stöer Martina GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Stütz Sabrina AfSD SZ 02<br />
Tautkus Regina AfSD FA 2<br />
Teebken Anke DPWV<br />
Tegtmeier Heike AfSD SZ 05<br />
Theis Jela AfSD SZ 02<br />
Theuerkauf Hartmut AfSD SZ 05<br />
Thiel-Falk Brigitte Kita Betty Gleim Haus<br />
Thießen Kirsten Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Thim Anja Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Trapp, Dr. med. Stefan Berufsverband d. Kinder und Jugendärzte Bremen e. V.<br />
Tretter Susanne Ev. Kinderhaus Schnecke<br />
Tryborczyk Dunja Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Tümmel Gisbert AfSD<br />
Vogelsang Hildegard Kita Waller Park<br />
Voßmeyer Angelika Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Wahlers, Dr. Dirk-Hinrich Facharzt f. Kinderheilkunde<br />
Wardin Elke HdF Mitte<br />
Warna Martina Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Warnecke Liselotte Ev. Kirchengemeinde, KTH in der Neuen Vahr<br />
Wattenberg Agnes Landesverband Ev. Kindertagesstätten<br />
Weber, Dr. Dagmar Arztpraxis<br />
Wedlich Ingrid Schattenriss e. V.<br />
Wegner-Echtermann Hermann Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Wekerle Emma AfSD SZ 02<br />
Wellbrock Astrid HdF Osterholz<br />
Wetzel Katin AWO Bremen<br />
Wetzel Ursula Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Wichert-Wilde Adelheid Sprachheilkindergarten Nienburg<br />
Wichmann Ute Kinder u. Jugendges.dienst<br />
Wiechmann Sandra HdF Vegesack<br />
Wiechmann Daniele Lebenhilfe Bremen e. V.<br />
Wiesner, Prof. Dr. Dr. hc. Reinhard BM f. Familie, Senioren, Frauen u. Jugend<br />
Wilde Eberhard EB Nord<br />
Wilke Ursula KTH St. Markus-Gemeinde<br />
Witte-Soppa Birgit AfSD SZ 03<br />
Witting Marcus AfSD SZ 02<br />
Wojtowicz Brunhilde GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Wührmann Peter AfSD SZ 04<br />
Zand Atessa AfSD<br />
Ziegler Gerd AfJ e.V. Jugendwohnhaus<br />
Zielinski Christine GA <strong>Bremer</strong>haven<br />
Zimberlin Tina AfSD<br />
Zimmermann Eberhard GA Bremen Kinder u. Jugendgesundheitsdienst<br />
Zockoll Bettina HdF Osterholz<br />
zu Klampen Miriam Bürgerzentrum Vahr<br />
Zywica Maria Kinder u. Jugendges.dienst