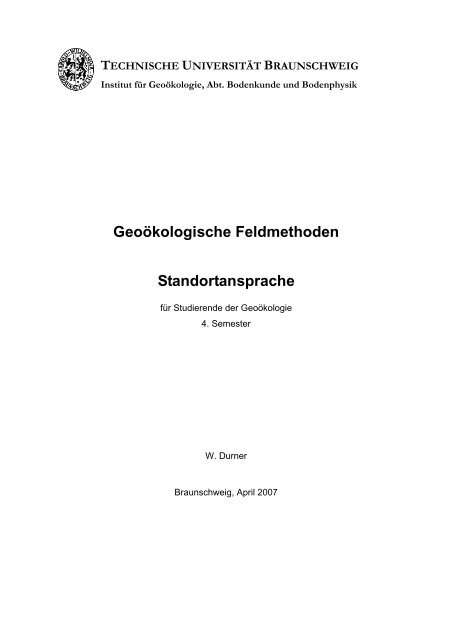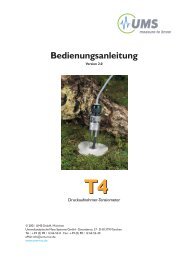Geoökologische Feldmethoden Standortansprache
Geoökologische Feldmethoden Standortansprache
Geoökologische Feldmethoden Standortansprache
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG<br />
Institut für Geoökologie, Abt. Bodenkunde und Bodenphysik<br />
<strong>Geoökologische</strong> <strong>Feldmethoden</strong><br />
<strong>Standortansprache</strong><br />
für Studierende der Geoökologie<br />
4. Semester<br />
W. Durner<br />
Braunschweig, April 2007
ii Ringinfiltration<br />
Durner, W. (2007): <strong>Standortansprache</strong>. Skript. Institut für Geoökologie, Abteilung Bodenkunde und<br />
Bodenphysik, TU Braunschweig, 11 Seiten.
1 Einleitung<br />
Im Rahmen der <strong>Geoökologische</strong>n <strong>Feldmethoden</strong> werden Sie an einem Geländetag am<br />
Standort Schunterau, in Braunschweig, Messungen zur Bestimmung von Größen des<br />
Bodenwasserhaushaltes durchführen. Die Versuchsfläche befindet sich auf einem ehemaligen<br />
Industriestandort.<br />
Zur Messung der hydraulischen Leitfähigkeit von Böden werden zwei Feld-Messverfahren in<br />
Form von Infiltrationsversuchen angewandt. Die Messungen werden ergänzt durch<br />
Aufnahmen des oberflächennahen Wassergehalts mit der TDR-Messtechnik und durch die<br />
Aufnahme von Messprofilen zur Erkundung des Untergrundes mit Hilfe geophysikalischer<br />
Methoden.<br />
Es werden vier Gruppen gebildet, die im Laufe des Tages alle Versuche an verschiedenen<br />
Teilgebieten des Standortes durchführen.
4 Ringinfiltration<br />
2 Standortbeschreibung<br />
Die Untersuchungen sollen in der Nähe des Zusammenflusses zwischen Schunter und Wabe<br />
stattfinden. Abb. 1 zeigt eine Luftbildaufnahme des Standortes. Es handelt sich um eine<br />
Brachfläche im unmittelbaren und angrenzenden Auenbereich. Vermutlich handelt es sich um<br />
eine ehemals teilweise bebaute Fläche, die nach der Räumung nun der natürlichen Sukzession<br />
unterliegt. Wir erwarten einen lockeren, stark von verschiedenen Gräsern durchwurzelten<br />
Boden. Die Vegetation besteht vor allem aus Süßgräsern, Brennesseln und Taubnesseln.<br />
Vereinzelt kommen junge Birken, Weissdorn, Rosenbüsche und Flieder vor.<br />
Zwischen den Gruppen sollen offensichtlich unterschiedliche Bereiche des Standortes, die in<br />
sich eine gewisse Homogenität aufweisen, ausgewiesen und in Hinblick auf Standort-<br />
eigenschaften, vegetation und Böden charakterisiert werden.<br />
Abb. 1: Luftaufnahme des Untersuchungsgebietes. Es wird im Norden und Nordwesten<br />
begrenzt durch den Fuß-Verbindungsweg zwischen Ottenroder Straße und Kehrbeeke,<br />
im Süden durch die Schunter, und am östlichen Rand durch eine Bahntrasse. Am<br />
oberen Bildrand ist das Gebäude der Diakonie Braunschweig zu erkennen.
Bodenansprache (Texturbestimmung) 5<br />
3 Bodenansprache (Texturbestimmung)<br />
Im Rahmen der Feldmethoen haben Sie bereits gelernt, wie Bodenaufnahmen gemacht<br />
werden. Für die bodenhydrologischen Untersuchungen sollen Sie, basierend auf einem<br />
Pürckhauereinschlag sowie auf einer kleinen Profilgrube, eine rdimentäre Bodenaufnahme<br />
machen und insbesondere für das untersuchte Bodenprofil mit Hilfe der Fingerprobe die<br />
Textur bestimmen. Sie benötigen diese Information unter anderem für die Abschätzung der<br />
hydraulischen Eigenschaften mit dem Neuronale Netz-Programm ROSETTA (im Rahmen der<br />
LV Modellierung II im sechsten Semester). Den Skelettanteil (in Gew. %) bestimmen Sie<br />
nach Schätzung im Gelände sowie über die Siebung des Bodens. Grundlage der Fingerprobe<br />
bilden die Ausführungen in der Bodenkundlichen Kartieranleitung (AG Boden, 1994; Kapitel<br />
5.8.14.2), die nachfolgend rezitiert sind. Auslassungen sind durch „[...]“ angezeigt,<br />
Einfügungen sind kursiv gesetzt.<br />
3.1 Bodenart 1<br />
„Mit der Bodenart wird die Korngrößenzusammensetzung des mineralischen Bodenmaterials<br />
gekennzeichnet. Die Korngrößenanteile werden im Labor nach DIN 19683 Teil 2<br />
(Dispergierung mit Natriumpyrophosphat und Humuszerstörung) festgestellt. Im Gelände<br />
bestimmt man die Bodenart durch die Fingerprobe und nach sichtbaren Merkmalen [...].<br />
Kornfraktionen<br />
Bei der Kennzeichnung der Bodenart wird zwischen den Kornfraktionen des Feinbodens<br />
(Korndurchmesser < 2 mm) und des Grobbodens (∅ > 2 mm) unterschieden. Häufig wird für<br />
Grobboden synonym der Begriff Bodenskelett verwendet.<br />
Definition der Bodenarten des Feinbodens<br />
Für die Definition der einzelnen Bodenarten des Feinbodens sind die drei Fraktionen Sand,<br />
Schluff und Ton maßgebend. Nach dem Vorherrschen der einen oder anderen Fraktion<br />
werden Sande, Schluffe und Tone unterschieden. Hinzu kommen [...] die Lehme als Sand-<br />
Schluff-Tongemische, die in ihren Eigenschaften zwischen den drei erstgenannten<br />
1 Der Text dieses Kapitels ist ein wortgetreuer Auszug aus Bodenk. Kartieranleitung, AG Boden, 1994, Kap.<br />
5.8.2.14.
6 Ringinfiltration<br />
Bodenarten stehen. Die Bezeichnung "Lehm" wird nur für Dreikorngemenge verwendet, bei<br />
denen die Fraktionen Sand, Schluff und Ton in deutlich erkennbaren und fühlbaren<br />
Gemengeanteilen auftreten.<br />
Die Bodenarten werden eingeteilt in Bodenartenhauptgruppen, Bodenartengruppen, und<br />
-untergruppen. Die Bodenartenuntergruppen, ihre Kurzzeichen und die Grenzwerte ihrer<br />
Fraktionsanteile werden in Tabelle 26 [in AG Boden(1994); Im Skript: Tab. 1] und in einem<br />
rechtwinkligen Dreiecksdiagramm (Abb. 2) dargestellt.<br />
Aus dem Diagramm kann bei bekannten prozentualen Anteilen der Kornfraktionen Schluff<br />
und Ton die entsprechende Bodenart ermittelt werden.<br />
Die Kurzzeichen der Bodenartenuntergruppen bestehen aus einem Großbuchstaben und einem<br />
nachgestellten Kleinbuchstaben sowie meist einer Kennziffer (2 = schwach, 3 = mittel, 4 =<br />
stark) bzw. einem zweiten Kleinbuchstaben.<br />
Tab. 1: Kornfraktionen des Feinbodens (Faksimile der Tab. 24 aus AG Boden, 1994).
Bodenansprache (Texturbestimmung) 7<br />
Abb. 2: Diagramm der Bodenartenuntergruppen des Feinbodens (aus AG Boden, 1994).<br />
3.2 Bodenartenansprache im Gelände<br />
Die Bestimmung der Bodenartenuntergruppe des mineralischen Feinbodens im Gelände<br />
erfolgt durch die Fingerprobe. Das Bodenmaterial wird dabei zwischen Daumen und<br />
Zeigefinger gerieben und geknetet. Körnigkeit, Bindigkeit und Formbarkeit des Materials<br />
können mit ausreichender Sicherheit am schwach feuchten Bodenmaterial festgestellt werden.<br />
Tabelle 1.2 und 1.3 geben die Definition der Bindigkeits- und Formbarkeitsstufen. Die<br />
Bodenartenuntergruppen des Feinbodens können nach Tabelle 29 der Kartieranleitung (=Tab.<br />
1.4) bestimmt werden. Die Mitnahme von Wasser zum Befeuchten trockener Böden ist<br />
zweckmäßig. Hinweise auf weitere fühl- und sichtbare Merkmale sowie Eigenschaften der<br />
Fraktionen des Feinbodens bei unterschiedlichen Mengenanteilen gibt ebenfalls Tabelle 29.<br />
Für die Unterteilung der Sandfraktion können Messlupen verwendet werden.
8 Ringinfiltration<br />
Tab. 2: Definition der Bindigkeitsstufen (aus Bodenkundl. Kartieranleitung, AG Boden, 1994)<br />
Kennzeichnung<br />
der Stufen<br />
Zusammenhalt der<br />
Bodenprobe<br />
Bezeichnung/Kennzeichnung<br />
0 kein sofort<br />
zerbröselt/zerbricht<br />
1 sehr gering sehr leicht<br />
2 gering leicht<br />
3 mittel nicht<br />
4 stark nicht<br />
5 sehr stark nicht<br />
Tab. 3: Definition der Formbarkeitsstufen (aus Bodenkundl. Kartieranleitung, AG Boden,<br />
1994).<br />
Ausrollbarkeit: Bewertung der Ausrollbarkeit einer Probe bis auf halbe<br />
Bleistiftstärke<br />
0 Probe nicht ausrollbar; zerbröckelt beim Versuch<br />
1 nicht auf halbe Bleistiftstärke ausrollbar, da die Probe<br />
vorher reißt und bricht<br />
2 Ausrollen auf halbe Bleistiftstärke schwierig, da die Probe<br />
starke Neigung zum Reißen und Brechen aufweist<br />
3 ohne größere Schwierigkeiten auf halbe Bleistiftstärke<br />
ausrollbar, da die Probe nur noch schwach reißt oder<br />
bricht<br />
4 leicht auf halbe Bleistiftstärke ausrollbar, da die Probe<br />
nicht reißt oder bricht<br />
5 auf dünner als halbe Bleistiftstärke ausrollbar
Bodenansprache (Texturbestimmung) 9<br />
Tab. 4: Schlüssel zur Bestimmung der Bodenarten des Feinbodens im Gelände mittels<br />
Fingerprobe (Faksimile der Tabelle 29 der Bodenkundlichen Kartieranleitung)
10 Ringinfiltration<br />
Tab. 4 – Fortsetzung.
Literatur 11<br />
4 Aufgaben<br />
Für die Standorte des Praktikum sollen folgende Untersuchungen erfolgen:<br />
1. Einmessung und allgemeine Charakterisierung<br />
• Stecken Sie ein Gebiet ab, in dem Sie mit ihrer Gruppe ihre Untersuchungen<br />
durchführen wollen<br />
• Ermitteln Sie die allgemeinen Standorteigenschaften ihres Teilgebietes (Klima,<br />
Vegetation, Bewirtschaftung, Exposition, Bodentyp, Wasserversorgung,<br />
Luftversorgung, Nährstoffversorgung)<br />
2. Profilansprache ca. 0-20 cm<br />
• Erstellung eines kleinen oberflächennahen Profils<br />
• Einteilung des Profils in Horizonte<br />
• Ansprache der Humusform<br />
• Ansprache der einzelnen Horizonte (Bodenart, Bodenstruktur, Bodenfeuchte,<br />
Bodendichte, Bodenfarbe, Humusgehalt).<br />
3. Profilansprache ca. 20-100 cm<br />
• Pürckhauerbeprobung bis ca. 100 cm Tiefe<br />
• Einteilung des Profils in Horizonte<br />
• Ansprache der einzelnen Horizonte<br />
• Bestimmung der Bodenart der Horizonte mit Fingerprobe<br />
4. Fingerprobe zur Körnungsbestimmung<br />
• Stellen Sie die Bodenunterart nach Tabelle 29 der Bodenkundlichen<br />
Kartieranleitung fest (z.B. Su2).<br />
• Lesen Sie aus dem Körnungsdreieck für die bestimmte Bodenart die<br />
Zusammensetzung in den Grundkörnungen Sand (%), Schluff (%), und Ton<br />
(%) ab. Geben sie sinnvolle Bandbreiten für diese Anteile an.<br />
5 Literatur<br />
AG Boden. 1994. Bodenkundliche Kartieranleitung, 4. Auflage. Schweizerbart'sche<br />
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.