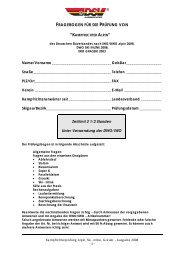Fragenkatalog Alpin Saison 2009/10
Fragenkatalog Alpin Saison 2009/10
Fragenkatalog Alpin Saison 2009/10
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Fragenkatalog</strong> <strong>Alpin</strong> <strong>Saison</strong> <strong>2009</strong>/<strong>10</strong><br />
1. Warum benötigt ein Skilehrer Wissen über die Bewegungslehre für den Skiunterricht<br />
(1) Weil das methodische Vorgehen unmittelbar von der Bewegungslehre und der darauf<br />
aufbauenden Bewegungsbeurteilung beeinflusst ist.<br />
(2) Damit der Skilehrer seinen Schülern detaillierte und komplizierte Bewegungsbeschreibungen<br />
geben kann.<br />
(3) Damit er seine eigenen Bewegungen analysieren und beurteilen kann.<br />
(4) Damit Teilaspekte der Bewegung und deren Auswirkungen besser beobachtet werden können.<br />
2. Welchen Charakter sollte eine Bewegungsbeschreibung aufweisen<br />
(1) Sie sollte alle Details der Bewegung beinhalten.<br />
(2) Sie sollte einen zeitlichen Rahmen von 5 Sekunden nicht überschreiten.<br />
(3) Sie sollte kurz und präzise sein.<br />
(4) Sie sollte die zentralen Bewegungsaktionen enthalten.<br />
(5) Sie sollte mehrmals wiederholt werden, damit sie sich besser einprägt.<br />
3. Welche Zielsetzungen werden mit den 7 Lernschritten im Lehrplan verfolgt <br />
(1) Sie geben konkrete Hilfe für Übungsleiter und Skilehrer.<br />
(2) Vorgabe eines strikten Konzeptes, an das sich jeder Skilehrer halten soll.<br />
(3) Aufzeigen eines praxisbewährten Lehrweges im Sinne eines roten Fadens.<br />
(4) Normierung und Vereinheitlichung des Skiunterrichts im DSV.<br />
4. Welchen Rechtscharakter haben die FIS-Regeln für Schneesportler<br />
(1) Sie haben Gesetzteskraft.<br />
(2) Sie sind unverbindliche Empfehlungen.<br />
(3) Sie haben keine Gesetzeskraft, werden aber bei der Beurteilung von zivil- und strafrechtlichen<br />
Haftungsfragen zugrundegelegt.<br />
(4) Sie sind als Spielregeln für Schneesportler zu verstehen.<br />
5. Kommunikation: Welche Aussagen sind richtig <br />
(1) Skikursteilnehmer achten unbewußt auf nonverbale Signale.<br />
(2) Wer laut redet, sendet keine nonverbalen Signale.<br />
(3) Verbale Aussagen und nonverbale Signale sind immer im Einklang.<br />
(4) Unsicherheit verrät sich durch Körpersprache und Stimme.<br />
(5) Stehen verbale und nonverbale Signale konträr zueinander, vertraut der Empfänger eher den<br />
nonverbalen Signalen.<br />
6. Welche Funktionen haben Platten, welche im Ski- bzw. Bindungssystem integriert sind<br />
(1) Dämpfung der Schwingungen und damit Erhöhung der Laufruhe des Ski.<br />
(2) Verlängerung des Hebels beim Kanten.<br />
(3) Versteifung des Ski damit größere Kräfte aufgenommen werden können.<br />
(4) Erhaltung der natürlichen Biegelinie des Ski.<br />
(5) Verbesserung der Übertragung von Drehimpulsen.<br />
- 1 -
7. Wie wird ein Skilehrer seiner Sorgfalts- und Aufsichtspflicht gerecht<br />
(1) Durch einen einmaligen Hinweis auf mögliche Gefahren.<br />
(2) Durch ständige Überwachung der Schüler.<br />
(3) Durch vorsorgliche Belehrungen und Warnungen.<br />
(4) Durch sofortiges Eingreifen, falls erforderlich.<br />
(5) Durch eigenes vorbildhaftes Verhalten.<br />
8. Welche Grundsätze gelten bei der Aufgabenstellung<br />
(1) Möglichst viele verschiedene Aufgabenstellungen.<br />
(2) Die Aufgabenstellung ist unabhängig von Schnee und Gelände.<br />
(3) Die Aufgaben sollen Bezug zum Lernziel, zur Gruppe und zur Situation haben.<br />
(4) Die Aufgabenstellung sollte variiert werden.<br />
9. Welches ist die wesentliche Funktion für das Skifahren <br />
(1) Kanten<br />
(2) Gleiten<br />
(3) Belasten<br />
(4) Drehen<br />
(5) Umkanten<br />
<strong>10</strong>. Welche unterrichtsorganisatorische Maßnahme eignet sich, um die Selbstständigkeit der Schüler<br />
zu fördern <br />
(1) Skilehrerdemonstration<br />
(2) Einzelkorrektur<br />
(3) Situationslernen<br />
(4) induktives Verfahren<br />
(5) deduktives Verfahren<br />
11. Erkläre die Begriffe „Ganzheitsmethode“ und „Teilmethode“. (2 Punkte)<br />
12. Nenne 4 Beispiele in welchen durch den alpinen Skilauf/Skitourismus Umweltprobleme entstehen<br />
können. (4 Punkte)<br />
13. Nenne 4 Stichpunkte, welche für einen strukturierten Lehrweg im Skiunterricht von Bedeutung sind<br />
(methodische Grundsätze). (4 Punkte)<br />
14. Beschreibe kurz die Vorgehensweise beim Unterrichten. (4 Punkte)<br />
15. Nenne 3 Aspekte, welche für den Ablauf und die Gestaltung eines Skikurstages – aus<br />
organisatorischer Sicht – wichtig sind. (3 Punkte)<br />
16. Nenne 4 Bewegungen durch welche die Ski gekantet werden können. (4 Punkte)<br />
- 2 -
17. Nenne mögliche Übungsschwerpunkte im Bereich Stabilisierens/Festigen des Pflugbogens. (3<br />
Punkte)<br />
18. Nenne sechs allgemeingültige Grundmerkmale, die für gutes Skifahren von zentraler Bedeutung<br />
sind. (6 Punkte)<br />
19. Mit welchen methodischen Hilfsmitteln kann ein Skischüler in seinem Lernprozess unterstützt<br />
werden. (3 Punkte)<br />
20. Es gibt 2 Einstellmethoden, nach denen der richtige Z-Wert am Ski eingestellt werden kann. Nenne<br />
eine Methode und die dazugehörigen Kriterien auf deren Grundlage die Einstellung erfolgt. (4<br />
Punkte)<br />
21. Nenne mindestens 3 verschiedene Korrekturmöglichkeiten. (3 Punkte)<br />
22. Welche Funktionen haben Platten, welche im Ski- bzw. Bindungssystem integriert sind<br />
(1) Dämpfung der Schwingungen und damit Erhöhung der Laufruhe des Ski.<br />
(2) Verlängerung des Hebels beim Kanten.<br />
(3) Versteifung des Ski damit größere Kräfte aufgenommen werden können.<br />
(4) Erhaltung der natürlichen Biegelinie des Ski.<br />
(5) Verbesserung der Übertragung von Drehimpulsen.<br />
23. Welchen Rechtscharakter haben die FIS-Regeln für Schneesportler<br />
(1) Sie haben Gesetzeskraft.<br />
(2) Sie sind unverbindliche Empfehlungen.<br />
(3) Sie haben keine Gesetzeskraft, werden aber bei der Beurteilung von zivil- und strafrechtlichen<br />
Haftungsfragen zugrunde gelegt.<br />
(4) Sie sind als Spielregeln für Schneesportler zu verstehen.<br />
24. Wie wird ein Skilehrer seiner Sorgfalts- und Aufsichtspflicht gerecht<br />
(1) Durch einen einmaligen Hinweis auf mögliche Gefahren.<br />
(2) Durch ständige Überwachung der Schüler.<br />
(3) Durch vorsorgliche Belehrungen und Warnungen.<br />
(4) Durch sofortiges Eingreifen, falls erforderlich.<br />
(5) Durch eigenes vorbildhaftes Verhalten.<br />
25. Warum benötigt ein Skilehrer Wissen über die Bewegungslehre für den Skiunterricht<br />
(1) Weil das methodische Vorgehen unmittelbar von der Bewegungslehre und der darauf<br />
aufbauenden Bewegungsbeurteilung beeinflusst ist.<br />
(2) Damit der Skilehrer seinen Schülern detaillierte und komplizierte Bewegungsbeschreibungen<br />
geben kann.<br />
(3) Damit er seine eigenen Bewegungen analysieren und beurteilen kann.<br />
(4) Damit Teilaspekte der Bewegung und deren Auswirkungen besser beobachtet werden können.<br />
- 3 -
26. Welchen Charakter sollte eine Bewegungsbeschreibung aufweisen<br />
(1) Sie sollte alle Details der Bewegung beinhalten.<br />
(2) Sie sollte einen zeitlichen Rahmen von 5 Sekunden nicht überschreiten.<br />
(3) Sie sollte kurz und präzise sein.<br />
(4) Sie sollte die zentralen Bewegungsaktionen enthalten.<br />
(5) Sie sollte mehrmals wiederholt werden, damit sie sich besser einprägt.<br />
27. Welche Grundsätze gelten bei der Aufgabenstellung<br />
(1) Möglichst viele verschiedene Aufgabenstellungen.<br />
(2) Die Aufgabenstellung ist unabhängig von Schnee und Gelände.<br />
(3) Die Aufgaben sollen Bezug zum Lernziel, zur Gruppe und zur Situation haben.<br />
(4) Die Aufgabenstellung sollte variiert werden.<br />
28. Kommunikation: Welche Aussagen sind richtig<br />
(1) Skikursteilnehmer achten unbewusst auf nonverbale Signale.<br />
(2) Wer laut redet, sendet keine nonverbalen Signale.<br />
(3) Verbale Aussagen und nonverbale Signale sind immer im Einklang.<br />
(4) Unsicherheit verrät sich durch Körpersprache und Stimme.<br />
(5) Stehen verbale und nonverbale Signale konträr zueinander, vertraut der Empfänger eher den<br />
nonverbalen Signalen.<br />
29. Welche unterrichtsorganisatorische Maßnahme eignet sich, um die Selbstständigkeit der Schüler<br />
zu fördern<br />
(1) Skilehrerdemonstration<br />
(2) Einzelkorrektur<br />
(3) Situationslernen<br />
(4) induktives Verfahren<br />
(5) deduktives Verfahren<br />
30. Welche Zielsetzungen werden mit den 7 Lernschritten im Lehrplan verfolgt<br />
(1) Sie geben konkrete Hilfe für Übungsleiter und Skilehrer.<br />
(2) Vorgabe eines strikten Konzeptes, an das sich jeder Skilehrer halten soll.<br />
(3) Aufzeigen eines praxisbewährten Lehrweges im Sinne eines roten Fadens.<br />
(4) Normierung und Vereinheitlichung des Skiunterrichts im DSV.<br />
31. Welches ist die wesentliche Funktion für das Skifahren<br />
(1) Kanten<br />
(2) Gleiten<br />
(3) Belasten<br />
(4) Drehen<br />
(5) Umkanten<br />
32. Beschreibe kurz die Vorgehensweise beim Unterrichten. (4 Punkte)<br />
33. Nenne 3 Aspekte, welche für den Ablauf und die Gestaltung eines Skikurstages – aus<br />
organisatorischer Sicht – wichtig sind. (3 Punkte)<br />
- 4 -
34. Nenne 4 Stichpunkte, welche für einen strukturierten Lehrweg im Skiunterricht von Bedeutung sind<br />
(methodische Grundsätze). (4 Punkte)<br />
35. Erkläre die Begriffe „Ganzheitsmethode“ und „Teilmethode“. (2 Punkte)<br />
36. Nenne mögliche Übungsschwerpunkte im Bereich Stabilisierens/Festigen des Pflugbogens. (3<br />
Punkte)<br />
37. Nenne sechs Grundmerkmale, die für gutes Skifahren von zentraler Bedeutung sind. (6 Punkte)<br />
38. Nenne 4 Beispiele in welchen durch den alpinen Skilauf/Skitourismus Umweltprobleme entstehen<br />
können. (4 Punkte)<br />
39. Es gibt 2 Einstellmethoden, nach denen der richtige Z-Wert am Ski eingestellt werden kann. Nenne<br />
eine Methode und die dazugehörigen Kriterien auf deren Grundlage die Einstellung erfolgt. (4<br />
Punkte)<br />
40. Nenne 4 Bewegungen durch welche die Ski gekantet werden können. (4 Punkte)<br />
41. Nenne mindestens 3 verschiedene Korrekturmöglichkeiten. (3 Punkte)<br />
42. Mit welchen methodischen Hilfsmitteln kann ein Skischüler in seinem Lernprozess unterstützt<br />
werden. (3 Punkte)<br />
43. Welche Begriffe definieren die Bewegungsspielräume <br />
(1) Intensität, Timing<br />
(2) Gelände, Schnee<br />
(3) Bewegungsumfang, Bewegungsrichtung<br />
(4) Koordinative Fertigkeiten<br />
44. Biomechanik : Welche der folgenden Aussagen sind richtig<br />
(1) Die Normalkraft ist von der Hangneigung unabhängig.<br />
(2) Die Gewichtskraft wird in Hangabtriebskraft und Normalkraft zerlegt.<br />
(3) Die Zentrifugalkraft wirkt auf Körper, die sich auf einer gekrümmten Bahn bewegen.<br />
(4) Die Zentrifugalkraft ist vom Kurvenradius abhängig.<br />
(5) Die Zentrifugalkraft ist von der Kurvengeschwindigkeit unabhängig.<br />
45. Wie lässt sich der Druck zwischen Ski und Schnee erhöhen<br />
(1) Durch Abbremsen einer Tiefbewegung oder Beschleunigung einer Hochbewegung<br />
(2) Durch Abbremsen einer Hochbewegung oder Beschleunigung einer Tiefbewegung.<br />
(3) Erhöhen der Kurvenkrümmung<br />
- 5 -
(4) Wechsel von der ein- zur beidbeinigen Belastung<br />
(5) Wechsel von der gekanteten zur flachen Skiführung<br />
46. Welche Aussagen sind in Bezug auf die Merkmale für hochwertiges Kurvenfahren richtig <br />
(1) Die Merkmale sind Orientierungshilfen für das Vorgehen im Skiunterricht.<br />
(2) Nur im Zusammenspiel aller Merkmale ergeben sich hochwertige Kurven.<br />
(3) Die Merkmale gelten nur für gute, sportliche Skifahrer.<br />
(4) Die Merkmale haben in allen Könnensstufen und bei allen Fahrformen Gültigkeit.<br />
47. Welche unterrichtsorganisatorische Maßnahme eignet sich, um die Selbstständigkeit der Schüler<br />
zu fördern <br />
(1) Skilehrerdemonstrationen<br />
(2) Einzelkorrektur<br />
(3) Situationslernen<br />
(4) induktives Verfahren<br />
(5) deduktives Verfahren<br />
48. Welche Grundsätze gelten für Korrekturen <br />
(1) Die Korrektur sollte positiv formuliert werden.<br />
(2) Möglichst alle Fehler sind anzusprechen, um dem Schüler eine realistische Einschätzung<br />
seiner Leistung zu ermöglichen.<br />
(3) Nur der Hauptfehler sollte angesprochen werden.<br />
(4) Die Korrektur sollte möglichst schnell nach dem Versuch erfolgen.<br />
49. Lawinenkunde : Welche Aussagen sind richtig <br />
(1) Die größte Lawinengefahr besteht bei einer Hangneigung zwischen 29 und 49 Grad.<br />
(2) Abfahrten im Wald könne auf Grund dessen schützender Wirkung als sicher angenommen werden.<br />
(3) 70 % aller Lawinenunfälle erfolgen in Hängen mit südwestlicher Exposition.<br />
(4) Eine Schneeprofiluntersuchung lässt keine Aussagen über die Festigkeit eines gesamten Hanges zu.<br />
50. Lawinenkunde : Welche Aussagen sind richtig <br />
(1) Sind bereits Spuren in einem hang, so ist dieser als sicher anzunehmen.<br />
(2) Rücken und Grade sind bei der Routenwahl gegenüber Rinnen und Gräben vorzuziehen.<br />
(3) Starker Wind hat keinen Einfluss auf die Lawinengefahr.<br />
(4) Hauptursache der Lawinengefahr ist Neuschnee mit Windeinfluss.<br />
51. Definiere anhand einer Skizze die Begriffe Kurvenwechsel, Kurvenbahn,<br />
Körperschwerpunktbahn, und Kurvenwinkel. (4 Punkte)<br />
52. Durch welche Bewegungen bzw. Aktionen kann die Funktion Belasten beim<br />
Kurvenfahren verändert werden (3Punkte)<br />
53. Nenne sechs Kräfte, die auf einen Skifahrer während des Kurvenfahrens wirken.<br />
- 6 -
54. Nenne sechs allgemeingültige Merkmale, mit denen qualitativ hochwertiges Kurvenfahren<br />
beschrieben werden kann.<br />
55. Welche Fragen müssen bei der Situationsanalyse zu Beginn eines Skiunterrichts beantwortet<br />
werden<br />
56. Grenze den Mechanismus des Kantens aus dem ganzen Bein und den Mechanismus des<br />
knieorientierten Kantens anhand von Vor- und Nachteilen in bestimmten Situationen (Fahrform,<br />
Gelände ….) gegeneinander ab.<br />
57. Nenne mindestens zwei Aktionen, die zum Drehen führen.<br />
58. Nenne mindestens drei Situationen, die eine Vertikalbewegung erfordern können.<br />
59. Beschreibe die Aktionen (Fahrempfindungen) des Kurvenwechsels bei geschnittenen mittleren<br />
Radien.<br />
60. Nenne vier Übungen, mit denen Schwächen oder Fehler im Bereich des Belastens behoben<br />
werden können.<br />
61. Nenne zwei „ Knackpunkte „ beim Abbau der Pflugstellung und zugehörige methodische Hilfen<br />
bzw. Aufgabenstellungen.<br />
62. Beschreibe wie das Erlernen des Fahrens in Buckelpisten methodisch aufgebaut werden kann.<br />
- 7 -