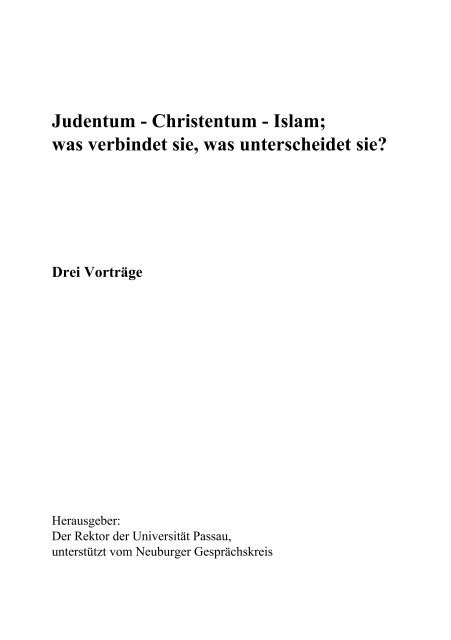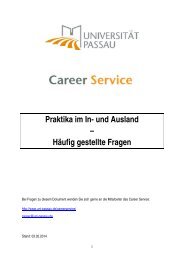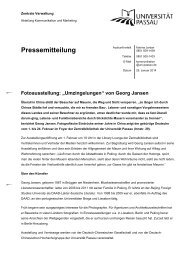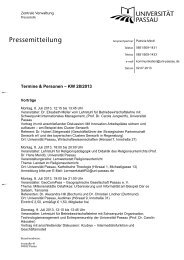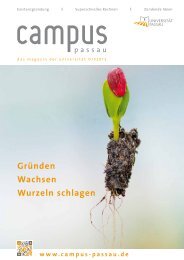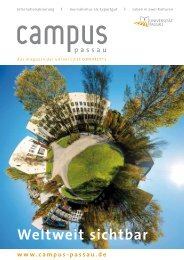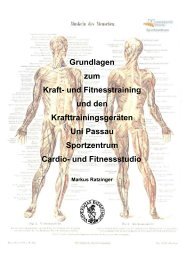Judentum - Christentum - Islam; was verbindet ... - Universität Passau
Judentum - Christentum - Islam; was verbindet ... - Universität Passau
Judentum - Christentum - Islam; was verbindet ... - Universität Passau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Judentum</strong> - <strong>Christentum</strong> - <strong>Islam</strong>;<br />
<strong>was</strong> <strong>verbindet</strong> sie, <strong>was</strong> unterscheidet sie?<br />
Drei Vorträge<br />
Herausgeber:<br />
Der Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong>,<br />
unterstützt vom Neuburger Gesprächskreis
© 2003<br />
Herausgeber: Der Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong>,<br />
unterstützt vom Neuburger Gesprächskreis<br />
Redaktion: Patricia Mindl, <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong><br />
Foto: Karin Hölzlwimmer, <strong>Passau</strong><br />
Druck: Druckerei Ostler, <strong>Passau</strong><br />
<strong>Judentum</strong> - <strong>Christentum</strong> - <strong>Islam</strong>;<br />
<strong>was</strong> <strong>verbindet</strong> sie, <strong>was</strong> unterscheidet sie?<br />
Drei Vorträge
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 7<br />
Vorträge:<br />
Professor Dr. Michael Wolffsohn<br />
Geschichte als Falle.<br />
Deutschland und die jüdische Welt 11<br />
Professor Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth Felcht<br />
<strong>Judentum</strong> - <strong>Christentum</strong> - <strong>Islam</strong>;<br />
<strong>was</strong> <strong>verbindet</strong> sie, <strong>was</strong> unterscheidet sie?<br />
Erörterung des Themas aus der Perspektive eines<br />
gobal agierenden Chemieunternehmens 21<br />
Professorin Dr. Martha Zechmeister-Machhart<br />
Dialog zwischen Christen und Muslimen.<br />
‚Multireligiöse Schummelei oder Beitrag zu einer<br />
humaneren Welt?‘ 29<br />
Seite
Professor Dr. Walter Schweitzer<br />
Rektor der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong><br />
Vorwort<br />
Am 12. und 13. Juli 2002 fand das 21. Jahressymposion des Neuburger Gesprächskreises<br />
Wissenschaft und Praxis an der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong> e. V. unter dem<br />
Thema „<strong>Judentum</strong> – <strong>Christentum</strong> – <strong>Islam</strong>; <strong>was</strong> <strong>verbindet</strong> sie, <strong>was</strong> unterscheidet<br />
sie?“ an der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong> statt.<br />
Zu diesem Thema referierten Professor Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Frühwald,<br />
Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Ludwig-<br />
Maximilians-<strong>Universität</strong> München, Präsident der Alexander von Humboldt-<br />
Stiftung („Die Familie der monotheistischen Religionen. Zum Toleranz-Begriff<br />
Gotthold Ephraim Lessings“), Professor Dr. Michael Wolffsohn, <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
für Neuere Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der internationalen<br />
Beziehungen an der <strong>Universität</strong> der Bundeswehr München („Geschichte als<br />
Falle. Deutschland und die jüdische Welt“), Professor Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth<br />
Felcht, Vorsitzender des Vorstands der Degussa AG, Düsseldorf („Erörterung des<br />
Themas aus der Perspektive eines global agierenden Chemieunternehmens“),<br />
Professorin Dr. Martha Zechmeister-Machhart, Professur für Fundamentaltheologie<br />
an der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong> („Dialog zwischen Christen und Muslimen. ‚Multireligiöse<br />
Schummelei’ oder Beitrag zu einer humaneren Welt?“), Klaus Werndl,<br />
Botschafter a. D., Stephanskirchen („Die Thematik aus politisch-diplomatischer<br />
Sicht“) und Professor Dr. Bassam Tibi, Leiter der Abteilung für Internationale<br />
Beziehungen am Seminar für Politikwissenschaft an der Georg-August-<strong>Universität</strong><br />
zu Göttingen („Vom religiösen Anspruch auf das Absolute zum religiösen<br />
Pluralismus“).<br />
Die Diskussionsleitung am Freitag und Samstag einschließlich der Podiumsdiskussion<br />
lag in den Händen von Sigmund Gottlieb, Chefredakteur des Bayerischen<br />
Fernsehens.<br />
Aus unterschiedlichen Gründen konnte uns jedoch leider nur ein Teil der Referenten<br />
ihren Vortrag zur Veröffentlichung überlassen. Es können daher nur drei<br />
Vorträge in diesem Heft publiziert werden, für deren Überlassung ich mich bei<br />
den Autoren herzlich bedanken möchte.<br />
<strong>Passau</strong>, im Juni 2003 Rektor Professor Dr. Walter Schweitzer<br />
7
Ein Teil der Referenten der Tagung (v. l.): Professor Dr. Michael Wolffsohn, Professor<br />
Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth Felcht, Professor Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang<br />
Frühwald, Botschafter a. D. Klaus Werndl mit Chefredakteur Sigmund Gottlieb<br />
und Rektor Professor Dr. Walter Schweitzer. Es fehlen Professorin Dr. Martha<br />
Zechmeister-Machhart und Professor Dr. Bassam Tibi.<br />
Während der Podiumsdiskussion am 1. Tag der Veranstaltung (v. l.): Professor<br />
Wolffsohn, Professor Tibi, Chefredakteur Gottlieb und Professor Frühwald ...<br />
und am 2. Tag (v. l.): Professorin Zechmeister-Machhart, Chefredakteur Gottlieb,<br />
Professor Tibi und Botschafter a. D. Werndl.
Professor Dr. Michael Wolffsohn<br />
Professor Dr. Michael Wolffsohn<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor für Neuere Geschichte unter besonderer Berücksichtigung<br />
der internationalen Beziehungen an der <strong>Universität</strong> der Bundeswehr<br />
München<br />
Geschichte als Falle.<br />
Deutschland und die jüdische Welt<br />
Deutschland und die jüdische Welt haben die jeweils richtigen „Lehren aus der Geschichte“<br />
gezogen. Gerade deshalb kommen sie nicht zueinander. Sie entwickeln<br />
sich voneinander weg. Sie werden möglicherweise sogar gegeneinander geraten,<br />
weil sie in die Falle der Geschichte, genauer: der Erinnerung an Geschichte, an die<br />
nationalsozialistische Zeitgeschichte, an den Holocaust, getappt sind. Das ist meine<br />
These.<br />
Auf den ersten Blick scheint der Brückenschlag zwischen Deutschland und der jüdischen<br />
Welt, also Israel und der jüdischen Diaspora, gelungen.<br />
Intensiver denn je sind die deutsch-israelischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft,<br />
Gesellschaft, Kultur und nicht zuletzt auf militärischem Gebiet. Nach den USA ist<br />
Deutschland Israels wichtigster - und, von gewöhnlichen Krächen oder Krisen abgesehen,<br />
zuverlässigster - Partner. Diese gute Tradition der Bonner Republik wird auf<br />
absehbare Zeit auch jede Koalition der Berliner Republik fortsetzen.<br />
Zu den Diasporajuden scheint sich Deutschlands Verhältnis ebenfalls entkrampft<br />
zu haben. Wer könnte noch die Ehrungen aufzählen, die bundesdeutsche Politiker<br />
fast aller Parteien von diasporajüdischen Organisationen erhielten und erhalten?<br />
Jüdische Delegationen der verschiedensten Staaten bereisen Deutschland intensiver<br />
und freudiger denn je, und das politisch so wichtige American Jewish Committee hat<br />
im Februar 1998 in Berlin sogar ein Büro eröffnet. Nur wenige Prominente dieses<br />
Landes blieben der Einweihungsfeier fern.<br />
Der erste Blick ermutigt. Wer hinter die Kulissen schaut, sieht die „Zeichen an der<br />
Wand“.<br />
Deutschland und der Jüdische Staat<br />
Weniger ungetrübt als auf der Parteien- und Regierungsebene ist das Verhältnis der<br />
deutschen und israelischen Öffentlichkeit zueinander. Die historisch-psychologische<br />
„Chemie“ zwischen beiden Bevölkerungen stimmt nicht.<br />
„Israel? Nein Danke!“ Das ist, trotz aller amtlichen Jubel- und Grußbotschaften zum<br />
fünfzigsten Jubiläum des Jüdischen Staates, die Einstellung der meisten Bundesbürger.<br />
Wer es nicht glaubt, prüfe die Umfragen. Die Daten, die ich in der 1996 erschie-<br />
11
nenen fünften Aufl age meines Buches „Israel: Geschichte, Politik, Gesellschaft,<br />
Wirtschaft“ ausführlich präsentiere und interpretiere, zeigen seit 1981 ständig,<br />
dass Israel zu den in Deutschland unbeliebtesten Staaten zählt und die Israelis die<br />
ungeliebten Juden sind. 1 Dass ich 1998 mein neuestes Israelbuch „Die ungeliebten<br />
Juden“ nannte, ist deshalb keine Provokation, sondern eine sachliche Feststellung. 2<br />
Im Mai 1981 hatte Israels Ministerpräsident Menachem Begin Bundeskanzler Helmut<br />
Schmidt sowie „die Deutschen“ insgesamt für den Holocaust verantwortlich<br />
gemacht. Begins Wiederentdeckung der These deutscher Kollektivschuld war nicht<br />
unbedingt als Liebeserklärung gedacht, <strong>was</strong> die bundesdeutsche Öffentlichkeit registrierte<br />
und mit Liebesentzug honorierte. Diese innere Entfernung der deutschen<br />
Öffentlichkeit zu Israel blieb, von wenigen zyklischen Schwankungen abgesehen,<br />
dauerhaft.<br />
Beweist die Israel-Distanz der Deutschen „Antisemitismus“? Mitnichten. Denn<br />
ebenso deut lich dokumentieren die Befragungen der Bundesbürger, dass der<br />
Antisemitis mus in Deutschland niedriger als in den meisten westlichen Staaten ist,<br />
von den osteuropäischen ganz zu schweigen.<br />
Israel-Distanz oder Israel-Kritik ist also keineswegs automatisch „Antisemitismus“,<br />
zumal manche Deutsche Judenliebe geradezu hingebungsvoll zelebrieren. Für diese<br />
Landsleute gilt der Satz: Ohne Juden wissen viele Gute Deutsche nicht, <strong>was</strong> sie denken<br />
dürfen sollen. Sie haben eben die „Lehren aus der Geschichte gezogen“.<br />
Weshalb stimmt trotzdem die politische Chemie zwischen Deutschen und Israelis<br />
nicht? Wegen und nicht trotz der „Lehren aus der Geschichte“.<br />
Deutsche und Israelis haben aus derselben Geschichte, dem Holocaust, ganz<br />
und gar unterschiedliche „Lehren“ gezogen. Jede ist an sich richtig, aber für den<br />
anderen nicht nachvollziehbar - wegen der geschichtlichen Lehren. Vier Beispiele<br />
verdeutlichen die geschichtlich bedingte Entfremdung zwischen Deutschen und<br />
Israelis.<br />
- Das erste Beispiel: Die Mehrheit der Israelis hat zu Nation und Nationalstaat ein<br />
völlig ungebrochenes Verhält nis. Nationalismus ist in Israel eine Selbstverständlichkeit,<br />
in Deutschland vielen, nein, den meisten eine Unerträglichkeit.<br />
Gerade weil die jüdische Nation seit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre<br />
70 unserer Zeitrechnung keinen Staat mehr hatte, war sie knapp zweitausend<br />
Jahre sozusagen vogelfrei, wurde sie verfolgt, verfemt und vernichtet; besonders<br />
zwischen 1933 und 1945, in der Epoche des Holocaust. Dass die meisten Israelis<br />
diese „Lehre aus der Geschichte“ gezogen haben, kann und darf nicht überraschen.<br />
So wenig wie die Tatsache, dass die meisten Deutschen heute schon beim<br />
Begriff „Nation“ historische Gänsehaut bekommen. Sie erinnern sich genau, wie<br />
schnell und heftig aus der deutschen Nation die deutsche Aggression wurde, die<br />
unter Hitler schließlich zur „Deutschen Katastrophe“ (Friedrich Meinecke) führte,<br />
die freilich nicht nur auf Deutschland und Deutsche begrenzt blieb.<br />
Beim Nachdenken über die Geschichte ihrer jeweiligen Nation haben Israelis und<br />
Deutsche die für sie richtigen Schlüsse gezogen. Zueinander fi nden können sie<br />
nicht - wegen der Geschichte. Beide haben jene Vergangenheit bewältigt, wobei<br />
die Bewältigung sie heute ebenso trennt wie das schreckliche Gestern.<br />
- Das zweite Beispiel: Religion ist in Israel mit Politik äußerst eng verfl ochten. In<br />
Deutschland gehört die Trennung von Kirche und Staat zu den eisernen Grundsätzen<br />
des Gemeinwesens.<br />
Selbst in der bundesdeutschen Frühzeit war die Bindung und Verbindung zwischen<br />
Religion (sprich: Katholizismus) und Politik (sprich: CDU/CSU) nie so fest<br />
wie in Israel. Mehr noch: In Israel wurde der religiös-politische Komplex immer<br />
mächtiger. So mächtig, dass der ehemalige Oberbürgermeister von Tel-Aviv, Roni<br />
Milo, im Mai 1998 davor warnte, Israel drohe das jüdische Gegenstück zum islamistischen<br />
Iran und Tel-Aviv das jüdische Pendant zu Teheran zu werden.<br />
Die Macht des religiös-politischen Komplexes hängt in Israel nicht zuletzt damit<br />
zusammen, dass sich dieses Gemeinwesen als „jüdischer Staat“ versteht. Und das<br />
bedeutet: Ganz ohne jüdische Religion gibt es weder ein <strong>Judentum</strong> noch einen<br />
jüdischen Staat. Das wiederum erklärt die strukturelle Schwächung des laizistischen<br />
Lagers in Israel, dessen 1999 vom Volk direkt gewählter Ministerpräsident<br />
Barak schon ein Jahr später an eben dieser Macht scheiterte.<br />
Solange und weil sich Israel als „jüdischer Staat“ versteht, wird die Abgrenzung<br />
von Nichtjuden betont; auch von den Nichtjuden im eigenen Staat, also den Palästinensern,<br />
die zwar gleichberechtigt, doch normativ Bürger zweiter Klasse sind.<br />
Dass Israel der Staat von Juden, für Juden und durch Juden sein soll, mag im<br />
Ausland gefallen oder nicht. Verstehen kann man es nur historisch.<br />
Außen- und regionalpolitisch ist die betonte Abgrenzung zu den Nichtjuden ebenfalls<br />
folgenreich: Sie stärkt tendenziell und wiederum strukturell die israelischen<br />
„Hardliner“, die „Falken“, im Konfl ikt mit den Palästinensern im Besonderen und<br />
den Arabern im Allgemeinen.<br />
Im außenpolitisch tendenziell und strukturell eher taubenhaft-sanften Deutschland<br />
sind gerade diese israelischen „Falken“ höchst unbeliebt. Dass „Falken“, ob<br />
jüdisch-israelisch oder nicht, in Deutschland eher unpopulär sind, kann und muss<br />
man auch historisch erklären.<br />
Wer wollte „die Deutschen“ anklagen, weil und dass sie inzwischen eher taubenhaft-sanft<br />
sind? Kaum jemand. Zurecht. Wegen der Geschichte.<br />
Wer will es umgekehrt den jüdischen Israelis vorwerfen, dass sie nach zweitausend<br />
Jahren nichtfriedlicher Koexistenz mit nichtjüdischen Nachbarn nur unter<br />
12 13
Juden bleiben wollen? So gesehen, haben die israelisch-jüdischen Falken die<br />
richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen.<br />
Sind diese historisch richtigen Lehren aber auch die politisch richtigen? Zweifel<br />
sind erlaubt, denn diese richtigen Lehren aus der unfriedlichen Vergangenheit<br />
verbauen möglicherweise die Zukunft für ein friedliches und heute mögliches<br />
Nebeneinander von Juden und Nichtjuden in der Nahostregion. Das genau erhoffen<br />
sich die meisten Deutschen, die - wegen der Geschichte - so glücklich über die<br />
Sicherung des Friedens in ihrer europäischen Region sind.<br />
- Das dritte Beispiel: Die Bindung der Israelis zum „Land Israel“, zum Boden ihres<br />
Nationalstaates, ist tief verwurzelt. Sie war - zunächst - defensiv und ebenfalls<br />
Reaktion auf die 2000-jährige Trennung von Volk und Land.<br />
In Deutschland denken aufgeklärte Menschen bei der Verbindung von Volk und<br />
Land an die „Blut-und-Boden“-Ideologie der Nationalso zia listen. Deutschland<br />
als „der Deutschen Land“, das klingt in deutschen Ohren wieder wie eine historische<br />
Ungeheuerlichkeit. „Eretz Israel“, das Land Israel und das Land Israel dem<br />
Volk Israel - das ist in Israel, auch unter politischen „Tauben“, eine Selbstverständlichkeit.<br />
Ist Geschichte, ist Erinnerung also auch hier eine politische Falle? Darüber kann<br />
man streiten. Nicht darüber, dass die Geschichte Deutsche und Israelis politisch<br />
mehr denn je trennt - wegen und nicht trotz der Erinnerung.<br />
- Das vierte Beispiel: Deutsche und Israelis haben völlig entgegengesetzte Einstellungen<br />
zu politischer Gewalt und zum Krieg als Mittel der Politik.<br />
„Die Deutschen“, das „Volk der Täter“, haben Gewalt und Krieg abgeschworen.<br />
„Nie wieder Täter!“ sagen sie „wegen der Vergangenheit“. Ebenfalls „wegen der<br />
Vergangenheit“ halten „die Israelis“, das „Volk der Opfer“, Gewalt sowie Krieg<br />
durchaus für legitim. Sie sagen: „Nie wieder Opfer!“ auch „wegen der Vergangenheit“.<br />
In Israel schlägt man lieber einmal zu viel, zu früh und zu heftig als gar nicht zu<br />
- wegen der Geschichte. Als Falle der Geschichte hat es die Öffentlichkeit Israels<br />
bislang nicht betrachtet. Das ist ihr gutes Recht, und es ist historisch verständlich.<br />
Wurde dadurch aber Israels Politik unbeabsichtigt, doch geradezu unvermeidlich<br />
nicht strukturell friedensunfähig? Erwies sich Geschichte nicht als Geschichtsfalle?<br />
Wer im palästinensisch-arabischen Mitbürger und Nachbarn, historisch<br />
verständlich, nicht nur den Gegner, sondern den möglichen Feind, gar Todfeind,<br />
einen „neuen Hitler“, und in jedem Waffengang oder Terrorakt, historisch ebenfalls<br />
verständlich, einen neuen „Holocaust“ sieht, übersieht auch Friedenschancen;<br />
übersieht, dass die Geschichte nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich<br />
weitergegangen und anders, trotz allem sogar besser geworden ist.<br />
Genau diese Frage haben sich Jitzchak Rabin und Schimon Peres gestellt. Sie<br />
erkannten, dass Geschichte für Israel zu einer politischen Falle geworden war.<br />
Deshalb fanden sie den Mut zu einer neuen Politik. Ihr Ziel: Der Ausbruch aus<br />
der Geschichtsfalle. Die neuen Antworten, die Rabin und Peres und ihr Israel auf<br />
die Fragen der jüdisch-israelischen Geschichte gaben, ähnelten erstmals ziemlich<br />
genau den Antworten, die das neue Deutschland der Bundesrepublik auf die Fragen<br />
der deutschen Geschichte gab und gibt.<br />
Es war deshalb folgerichtig, dass gerade diese beiden Politiker auch zur Bundesrepublik<br />
Deutschland ein pragmatisches Verhältnis suchten und fanden - ohne<br />
jemals Geschichte, Zeitgeschichte und Erinnerung verdrängen zu wollen. Sie<br />
hoben die Ausschließlichkeit von Holocaust-Geschichte und Erinnerung auf<br />
und ergänzten sie durch partnerschaftliche Politik zu Palästinensern, anderen<br />
Arabern, Deutschen und Nichtjuden überhaupt. Im Rahmen seiner visionären<br />
und die Geschichte entfl echtenden (nicht verdrängenden!) Politik hatte Peres als<br />
Außenminister und Ministerpräsident in den Jahren 1995/96 sogar daran gedacht,<br />
den seinerzeit greifbaren Frieden mit Syrien durch die Stationierung deutscher<br />
Soldaten auf den Golanhöhen abzusichern. Mit Hilfe der US-Streitkräfte sowie<br />
der Bundeswehr sollte Israel aus der friedens- und geschichtspolitischen Falle<br />
befreit werden.<br />
Um gute Kontakte zu Deutschland bemühte sich auch Ex-Ministerpräsident<br />
Benjamin Netanjahu. Doch anders als seine beiden Vorgänger Rabin und Peres,<br />
haben sich Netanjahu, seine Koalition und seine Wähler grundsätzlich weit mehr<br />
als Politiker und Anhänger der Arbeitspartei und der Linksliberalen im Netz der<br />
Geschichte verfangen. Das gilt für den Begriff der Nation, das Gewicht der Religion,<br />
die Verbindung von Volk und Land sowie die Anwendung von Gewalt<br />
in der Politik. Es gilt für die Wahrnehmung einer grundsätzlich feindlichen und<br />
zu einem „neuen Holocaust“ bereiten Umwelt, die Juden als Juden überall und<br />
immer verfolgt und in der Arafat Hitler und „die Palästinenser“ „die Deutschen“<br />
als „Todfeinde“ ablösten. Es überrascht nicht, dass in der Regierungszeit des nationalistisch-religiösen<br />
Lagers der Holocaust auch das Geschichtsbild der Israelis<br />
seit 1977 immer nachhaltiger prägte. 3<br />
Rabin, Peres und Barak repräsentierten - auch in ihrem einstweiligen Scheitern<br />
- ein Neues Israel; immerhin stellt es knapp fünfzig Prozent der Wähler. Dieses<br />
Neue Israel ist nicht von der Geschichte losgelöst, doch nicht an ihr allein fi xiert.<br />
Das Israel des „nationalistisch-religiösen“ steckt in der Geschichtsfalle. Nur mit<br />
dem Neuen Israel wird es für das Neue Deutschland, die Bundesrepublik, langfristig<br />
gute Beziehungen geben. Das Israel Begins, Schamirs, Netanjahus und<br />
Scharons gefährdet sowohl die Möglichkeit nahöstlicher Friedenspolitik als auch<br />
eine entspannte Europa- und Deutschlandpolitik.<br />
14 15
Deutsche und Israelis haben diese Vergangenheit „bewältigt“. Gerade deshalb<br />
sind sie heute so weit voneinander entfernt.<br />
Deutschland und die jüdische Diaspora<br />
Schauen wir auf Deutschlands Verhältnis zur Diaspora, den außerhalb Israels lebenden<br />
Juden. Die nichtreligiösen Diasporajuden (und das sind die meisten) führen ein<br />
jüdisches Dasein ohne jüdisches Sein, also eine tragisch absurde Existenz. Es sind<br />
Juden ohne <strong>Judentum</strong>. Sie möchten gerne Juden sein und sind deshalb Möchtegern-<br />
Juden. Inhaltlich ausfüllen können sie es nicht, weil sie als moderne Menschen nicht<br />
glauben können. Ohne glauben zu können, sind sie nicht religiös und als areligiöse<br />
Möchtegern-Juden sind sie Juden ohne <strong>Judentum</strong>.<br />
Traditionell stand das <strong>Judentum</strong> auf zwei Beinen: der Religion und der rund 4000jährigen<br />
Geschichte. Das religiöse Standbein haben die meisten Juden (wie Nichtjuden)<br />
amputiert. Höchst ens zehn Prozent aller Diasporajuden sind heute „religiös“. In<br />
Israel sind es dreißig bis vierzig Prozent. Das wissen wir aus Umfragen. 4<br />
Im Jüdischen Staat tobt der Religionspolitik wegen eine Art Kulturkampf. Doch<br />
er ändert nichts daran, dass auch die nichtreligiösen Israelis Bürger eines jüdisch<br />
geprägten und prägenden Staates sind. Ihre Identität bleibt, selbst in der anti-orthodoxen<br />
Verneinung der Religiosität, jüdisch.<br />
Was macht nichtreligiöse Diasporajuden zu Juden? Nichts. Die jüdische Geschichte,<br />
könnte man entgegnen. Im Prinzip ja, doch auch in ihrem Verhältnis zur Geschichte<br />
sind Diasporajuden nicht anders als Nichtjuden: Die meisten kennen bestenfalls die<br />
jüngste Geschichte, die Zeitgeschichte. An ihr orientieren sie sich, hier sind sie „betroffen“.<br />
Dass in der jüdischen Zeitgeschichte der Holocaust sachlich und seelisch dominiert,<br />
ist eine natürliche Reaktion. Die Refl exion darüber ist natürlich. Sie ist auch notwendig.<br />
Die fast vollständige Exklusivität der Zeitgeschichte presst jedoch viertausend Jahre<br />
jüdischer Geschichte auf die zwölf schrecklichsten zusammen: auf die NS-Zeit von<br />
1933 bis 1945. Nach dem ersten, religiösen Standbein wurde also auch das zweite<br />
Standbein jüdischen Seins - das historische - amputiert.<br />
Wieder ist ein Gegenargument denkbar: Das zweite Bein sei durch die Gründung<br />
und Geschichte des Jüdischen Staates, Israels also, verlängert worden. Die zeitgeschichtliche<br />
Holocaust-Orientierung und Holocaustfi xierung werden durch den<br />
„Israelismus“ der Diasporajuden ergänzt.<br />
Das Argument stößt ins Leere, denn Israelismus außerhalb Israels ist eine Absurdität.<br />
Diasporajuden sind natürlich Bürger ihres jeweiligen Staates, nicht Israels.<br />
Das Interesse der Diasporajuden an Israel hat außerdem dramatisch abgenommen.<br />
Eine Studie ergab Anfang der 90er Jahre, dass nur 43 Prozent der britischen Juden<br />
sich Israel „sehr eng verbunden“ fühlen. In den USA sind es 67 Prozent. 5<br />
Aufschlussreicher als Meinungen sind Handlungen: Messbar ist hier die größer<br />
gewordene Distanz zu Israel auch an den zurückgehenden Spenden, besonders der<br />
US-Juden. In den 60er Jahren überwiesen sie siebzig Prozent aller gesammelten<br />
Gelder nach Israel, sie behielten dreißig Prozent. Heute ist es genau umgekehrt. 6<br />
Nur 12 Prozent ihrer Sammelgelder überwiesen Mitte der 90er Jahre britische Juden<br />
nach Israel. 7<br />
Wieder ein Gegenargument: Diasporajüdische Einrichtungen sind bekanntlich<br />
seit Jahren Zielscheibe des arabisch-islamischen Terrorismus und damit ein Nebenschauplatz<br />
des Nahostkonfl iktes. Diasporajuden und Israel seien ineinander<br />
verzahnt. Gewiss, doch wieder prägt allein die jüdische Situation das jüdische Sein<br />
der Diasporajuden - und wieder ist es eine negative Fremdbestimmung: durch die<br />
Feinde Israels.<br />
Israelismus, die Israelorientierung der Diasporajuden, hat auch aus nahostpolitischen<br />
Gründen abgenommen: Die innerisraelische Polarisierung über die Palästinenserpolitik<br />
spaltet seit 1967 (Eroberungen im Sechstagekrieg) und noch mehr seit 1977<br />
(Amtsantritt Menachem Begins) auch die jüdische Diaspora. Ministerpräsident Benjamin<br />
Netanjahu setzte seit 1996 jene Tradition Begins eifrigst fort. Baraks Politik<br />
spaltete 1999/2000 die Diaspora in die umgekehrte Richtung.<br />
Die nichtreligiösen Diasporajuden haben keine eigenständigen jüdischen Inhalte<br />
mehr. Sie sind negativ fremdbestimmt. Die politischen Aktionismen des deutschjüdischen<br />
„Zentralrats“, „Jüdischen Weltkongresses“, antideutsche Anzeigen des<br />
„American Jewish Committee“ in der „New York Times“ am 8. Mai 1998 oder auch<br />
Klagen gegen die „Allianz“-Versicherung, die Deutsche oder Dresdner Bank und<br />
andere deutsche Unternehmen waren und sind kein Ersatz für fehlende Inhalte. Sie<br />
überdecken nur das Nichts; selbst da, wo sie inhaltlich gerechtfertigt sind. Das Entschädigungsproblem<br />
jener Firmen ist ohnehin weitgehend gelöst und verschwindet<br />
von der Tagesordnung, das diasporajüdische Nichts bleibt.<br />
Früher war Antisemitismus die tödliche Gefahr für uns Juden, heute scheint Toleranz<br />
die existentielle, nichtphysische Gefahr für das <strong>Judentum</strong>. Früher haben Antisemitismus<br />
und Verfolgung die Abkehr der Juden vom <strong>Judentum</strong> verhindert und<br />
die Umkehr zu ihm gefördert. Gewiss, der Antisemitismus ist nicht verschwunden,<br />
aber anders als einst, ist er eine Minderheitsideologie in der nichtjüdischen Umwelt.<br />
Der Antisemitismus führte in Tod und Jenseits, die Toleranz ins jüdische Nichts im<br />
Diesseits. Was Hitlers „Endlösung“ nicht schaffte, vollbringt die Toleranz. Sie wirkt<br />
als sanfte „Endlösung“ der Judenfrage in der Diaspora.<br />
Toleranz aber wollen wir, brauchen wir. Folglich benötigen wir eine neue Überlebensstrategie.<br />
Israel, die Religion oder das Nichts. Das ist die Kurzformel jüdischen Seins heute.<br />
In „Meine Juden - Eure Juden“, erschienen 1997, habe ich sie näher erläutert. 8 Es<br />
gehört zur tragischen Absurdität diasporajüdischer Existenz, dass allein der Holo-<br />
16 17
caust für die nichtreligiösen Diasporajuden das jüdische Nichts ausfüllt und somit als<br />
einziger Stifter jüdischer Identität bleibt.<br />
Diese Holocaust-Fixierung der nichtreligiösen, also der meisten Diasporajuden<br />
hat weitreichende Folgen für das Verhältnis zu Deutschland: Sie nehmen das neue<br />
Deutschland der Bundesrepublik eigentlich immer noch als das alte, nationalsozialistische<br />
und strukturell judenmörderische wahr. Das ist kein Antigermanismus oder<br />
Deutschenhass, sondern die verzweifelte und verständliche Suche nach jüdischer<br />
Identität. Sie wird die Atmosphäre zwischen Deutschland und der jüdischen Diaspora,<br />
vornehmlich in den USA, vergiften. Als Wähler und besonders als Wahlkampfspender<br />
werden die amerikanischen Juden umworben. Deshalb sind sie, besonders<br />
bei den „Demokraten“ einfl ussreich. Folgenreich, das heißt negativ, wird das Verhältnis<br />
der amerikanischen Juden zu Deutschland daher auch für die deutsch-amerikanischen<br />
Beziehungen insgesamt sein; erst recht für die deutsch-israelischen.<br />
Vor allem Amerikas nichtreligiöse Juden werden unter den geschilderten Voraussetzungen<br />
somit zunehmend ein Störfaktor der israelisch-deutschen Beziehungen.<br />
Ihre Suche nach jüdischer Identität über die ausschließliche Holocaust-Geschichtsfi<br />
xierung treibt somit indirekt und direkt einen Keil zwischen Israel und seinen<br />
zweitwichtigsten Partner, Deutschland. Der Jüdische Staat könnte auf diese Weise<br />
das ungewollte Opfer diasporajüdischer Identitätssuche werden. Das wollen die US-<br />
Juden natürlich nicht, aber sie bewirken es. Die rein nahostpolitischen Konsequenzen<br />
liegen ebenfalls auf der Hand: Die Holocaustfi xierung der US-Juden bestärkt<br />
geschichtsgefesselte Israelis und erschwert den Friedensprozess.<br />
„Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“, sagten die talmudischen Weisen.<br />
Sie meinten dabei natürlich die Erlösung der Täter und ihrer Nachfahren. Die Opfer<br />
und deren Nachkommen haben weniger Erinnerungs- als vielmehr Trauerarbeit zu<br />
leisten. „Jede Trauer hat ihr Maß“, sagten die talmudischen Weisen an die Hinterbliebenen<br />
gerichtet:<br />
- „Und Rabbi Jehuda sagte, Raw habe gesagt: Jeder, der sich wegen seines Toten<br />
über die Maßen mit Schmerz belastet, der weint noch über einen anderen Toten.<br />
Eine Frau in der Nachbarschaft Raw Hunas hatte sieben Söhne. Einer von ihnen<br />
starb, und sie beweinte ihn übermäßig. Da schickte Raw Huna zu ihr: So sollst du<br />
nicht tun! Aber sie beachtete ihn nicht. Da schickte er zu ihr: Wenn du gehorchst,<br />
ist‘s gut, wenn aber nicht, so bereite die Totenausstattung für einen anderen<br />
(Sohn)! Da starb er. So starben sie alle. Zuletzt sagte er zu ihr: Stümperst du schon<br />
an deiner eigenen Totenausstattung herum? Da starb sie.“ 9<br />
Erinnerung als alleinige Geschichtsfi xierung kann eine politische Falle sein.<br />
(Footnotes)<br />
1 Michael Wolffsohn: Israel: Geschichte, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, 5. Aufl age,<br />
Opladen: Leske & Budrich 1996, besonders Seiten 237ff.<br />
2 Michael Wolffsohn: Die ungeliebten Juden. Israel: Legenden und Geschichte,<br />
München - Zürich: Diana Verlag 1998.<br />
3 Vgl. dazu die Daten in Yair Oron: Sehut jehudit-israelit, (hebr.: Jüdisch-israelische<br />
Identität), Tel-Aviv: Sifrijat Hapoalim 1993, besonders Seiten 71ff und<br />
94ff.<br />
4 Daten in: Wolffsohn: Israel, besonders S. 178ff und 343ff.<br />
5 Barry Kosmin u. a.: The attachement of British Jews to Israel, London: Institute<br />
for Jewish Policy Reserach 1997, S. 6.<br />
6 1996 wurden in Los Angeles 41 Mio $ gesammelt, davon wurden 13 Mio $ nach<br />
Israel geschickt, also rund 32 % (Stimme Israels, 3. 11. 1997, 9 Uhr MEZ Nachrichten).<br />
Vgl. auch Wolffsohn: Israel, S. 223ff.<br />
7 Kosmin, a. a. O., S. 14.<br />
8 Michael Wolffsohn: Meine Juden - Eure Juden, München - Zürich: Piper 1997, S.<br />
108ff.<br />
9 Moed Qatan, Folie 27b, in: Der Babylonische Talmud, Band IV, neu übertragen<br />
von Lazarus Goldschmidt, Frankfurt am Main: Jüdischer Verlag 1996 (Nachdruck<br />
zweite Aufl age, Berlin: Jüdischer Verlag 1967), S. 226. Der eher textgemäßen<br />
und auch schöneren Übersetzung wegen zitiert aus Der Babylonische Talmud.<br />
Ausgewählt, übersetzt und erklärt von Reinhold Mayer, 4. überarbeitete Aufl age,<br />
München: Goldmann Verlag 1963, S. 536.<br />
In: Michael Wolfsohn, Thomas Brechenmacher, Hg., Geschichte als Falle.<br />
Deutschland und die jüdische Welt, München, ars una 2001.<br />
18 19
Professor Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth Felcht<br />
Professor Dr. Dr. h. c. Utz-Hellmuth Felcht<br />
Vorsitzender des Vorstands der Degussa AG, Düsseldorf<br />
<strong>Judentum</strong> - <strong>Christentum</strong> – <strong>Islam</strong>;<br />
<strong>was</strong> <strong>verbindet</strong> sie, <strong>was</strong> unterscheidet sie?<br />
Erörterung des Themas aus der Perspektive eines global agierenden<br />
Chemieunternehmens<br />
Meine sehr verehrten Damen und Herren,<br />
es ist mir eine große Ehre, heute in diesem illustren Kreise die Sichtweise eines<br />
Unternehmens darzulegen. Gerne, Herr Professor Schweitzer, habe ich Ihre<br />
Einladung für die heutige Veranstaltung angenommen.<br />
Wir bei Degussa sind, wie alle Unternehmer, angetreten, ein erfolgreiches<br />
Unternehmen aufzubauen und zukunftsorientiert weiter zu entwickeln. Wir<br />
wollen und werden dies im Kontext der Gesellschaft tun.<br />
Wir sind nicht nur ein weltweit tätiges, sondern auch ein multinationales<br />
Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern und noch mehr Kunden auf allen<br />
Kontinenten und in den unterschiedlichsten Kulturkreisen.<br />
Hieraus leiten wir Pfl ichten und Rechte ab, die wir im Sinne eines „Corporate<br />
Citizen“ wahrnehmen. Die Degussa ist mehr als nur Steueraufkommen und<br />
Arbeitsplätze – das ist heute ja schon eine Menge – die Degussa versteht sich als<br />
Teil der Gesellschaft, gleich wo wir uns wirtschaftlich betätigen.<br />
Die Degussa, auf die ich mich heute beziehe, ist erst im Februar vergangenen<br />
Jahres geschaffen worden. Sie setzt sich im Wesentlichen aus der früheren<br />
Degussa – der ehemaligen Deutschen Gold und Silber Scheideanstalt –, der<br />
SKW Trostberg, der Hüls AG, der TH Goldschmidt AG und der britischen<br />
Laporte plc. zusammen. Jede dieser Vorläufergesellschaften blickt auf eine lange<br />
Unternehmensgeschichte zurück. Die Anfänge der alten Degussa wie der TH<br />
Goldschmidt liegen in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Laporte und SKW<br />
Trostberg sind um die Jahrhundertwende entstanden, und die frühere Hüls AG<br />
stammt aus den 30er Jahren.<br />
Diese Vorläufergesellschaften haben wir mit ihrer jeweils sehr spezifi schen Geschichte<br />
und Unternehmenskultur zur neuen Degussa zusammengeführt. Vieles,<br />
<strong>was</strong> da an Traditionen wie auch an traditionellen Tätigkeitsfeldern aus den Vor-<br />
21
läufern vorhanden war, haben wir zu Gunsten einer völlig neuen Unternehmenskultur<br />
und unternehmerischen Ausrichtung über Bord geworfen.<br />
Heute ist unser Unternehmen das drittgrößte deutsche Chemieunternehmen.<br />
Weltweit liegt Degussa an siebter Stelle. Wir sind ein weltweit aktives Unternehmen<br />
mit einer konsequenten strategischen Ausrichtung auf die Spezialchemie. In<br />
diesem Segment sind wir weltweit die unumstrittene Nummer 1 und verfügen in<br />
bereits 85 % unserer geschäftlichen Aktivitäten über eine führende Marktposition.<br />
In dreifacher Hinsicht sind wir ein hoch innovatives Unternehmen. Innovativ im<br />
Hinblick auf unser strategisches Geschäftsmodell der klaren Konzentration auf<br />
unsere Kernmärkte, unser dezentrales Organisationsmodell sowie unser Selbstverständnis<br />
als Corporate Citizen.<br />
Zu diesem Selbstverständnis gehört auch, dass wir uns bei aller Neuausrichtung<br />
des Unternehmens uneingeschränkt zu unserer historischen Verantwortung<br />
bekennen, die wir von den Vorläufergesellschaften übernommen haben. Insbesondere<br />
gilt dies natürlich bezogen auf das, <strong>was</strong> unter dem Namen der Vorläufergesellschaften<br />
an unermesslichem Leid und Unrecht während der Naziherrschaft<br />
geschehen ist. Wir können und wir wollen uns dieser Verantwortung nicht entziehen.<br />
Mit der neuen Degussa sind wir aber angetreten, jeden Tag weltweit unter Beweis<br />
zu stellen, dass unsere neue Degussa auch in dieser Hinsicht ein völlig neues<br />
Unternehmen ist.<br />
Degussa ist heute ein Unternehmen, bei dem Respekt, Toleranz und Integration<br />
an vorderster Stelle stehen.<br />
Gestützt werden diese Grundprinzipien durch unsere Philosophie „so dezentral<br />
wie möglich, so zentral wie nötig“. Diese bestimmt unmittelbar unser Organisationsmodell.<br />
Sie trägt der Notwendigkeit Rechnung, im intensiven Wettbewerb der<br />
internationalen Spezialchemie nah an den Märkten zu sein. Nur so können wir<br />
schnell operieren und nur so können wir auch den kulturellen Unterschieden, die<br />
unsere Märkte weltweit prägen, gerecht werden.<br />
Unsere 23 Geschäftsbereiche agieren weltweit an über 300 Produktionsstandorten<br />
und einer Vielzahl weiterer Vertriebsstandorte als „Unternehmen im Unternehmen“.<br />
Die Degussa ist heute mit ihren Produkten in praktisch allen Staaten<br />
dieser Welt präsent. Für den fl ächendeckenden Erfolg ist es zwingend notwendig,<br />
dass wir uns den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anpassen. Unsere dezentrale<br />
Organisation ist dabei von unschätzbarem Wert. Unser jeweiliges Handeln und<br />
Auftreten als Degussa bestimmt sich durch Menschen vor Ort, ist auf die örtlichen<br />
Gegebenheiten ausgerichtet.<br />
Dies hat viele Facetten, von denen ich Ihnen die wesentlichen kurz erläutern<br />
möchte.<br />
Unsere Produkte orientieren sich grundsätzlich an den Bedürfnissen unserer<br />
Märkte und unserer Kunden gemäß dem Grundsatz „Think global, act local“. Wir<br />
befi nden uns dabei in bester Gesellschaft.<br />
Ein nach Außen hin scheinbar monolithischer Konzern wie Coca Cola verfolgt<br />
bei näherer Betrachtung exakt diese Strategie. Dosen und Flaschen seines bekanntesten<br />
Getränks sind sowohl hinsichtlich der Form, wie auch der farblichen<br />
Gestaltung weltweit einheitlich, und auch in diesen Dosen und Flaschen ist jeweils<br />
eine dunkelbraune Flüssigkeit, die auf einer einheitlichen Grundrezeptur<br />
basiert. Bei genauerer Analyse aber ist festzustellen, dass etwa der Zuckergehalt<br />
oder die Intensität der Kohlensäure von Land zu Land deutlich variieren. Hier<br />
fi nden die geschmacklichen Präferenzen der Konsumenten in den einzelnen<br />
Ländern ihre Berücksichtigung – sprich der Kunde mit seinem auch kulturell<br />
bedingten Verhalten ist eindeutig der König.<br />
In gleicher Weise stellen wir uns auf unsere Kunden und Märkte ein. Im Nahrungsmittelbereich<br />
etwa produzieren wir koschere Aminosäuren insbesondere für<br />
den US-amerikanischen und den israelischen Markt. Gelatine, ein Produkt, von<br />
dem wir uns erst kürzlich getrennt haben, haben wir für verschiedene Kulturkreise<br />
aus unterschiedlichen tierischen Quellen hergestellt.<br />
Das Verhältnis zu unseren Kunden ist geprägt durch den Respekt von ihrer kulturellen<br />
und religiösen Herkunft. Unser primäres Ziel als Unternehmen ist es<br />
selbstverständlich, am Schluss immer zu einem Vertragsabschluss zu kommen,<br />
einen Kunden zu gewinnen oder zu halten. Dafür müssen wir ihn zu allererst von<br />
den Vorteilen unserer Produkte überzeugen. Von besonderer Bedeutung ist aber<br />
auch der Weg, wie wir zum Ziel gelangen. Geschäftliche Verhandlungen in New<br />
York, in Kairo oder in Peking laufen nach völlig unterschiedlichen Grundmustern<br />
ab. Sie sind geprägt durch eine Vielzahl kultureller und religiöser Besonderheiten,<br />
denen wir Rechnung tragen müssen. Am besten gelingt uns dies dort, wo wir auf<br />
Mitarbeiter vertrauen, die in der jeweiligen Gesellschaft, in dem jeweiligen Kulturkreis<br />
fest verankert sind. Dies sind im Regelfall einheimische Mitarbeiter.<br />
Unsere Mitarbeiter sind weltweit unser wichtigstes Kapital. Sie sind es, die forschen,<br />
neue Produkte entwickeln, produzieren und – im täglichen Wettstreit um<br />
den Kunden – verkaufen. Ihnen gilt daher unsere primäre Aufmerksamkeit.<br />
22 23
Wir haben über 50.000 Mitarbeiter auf allen Kontinenten unserer Erde. Knapp<br />
50 % davon arbeiten außerhalb Westeuropas. Wir sind angetreten mit der neuen<br />
Degussa, alle Mitarbeiter ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit<br />
in einem Unternehmen zu integrieren. Dazu gehört auch, dass heute<br />
bereits Brasilianer in Südafrika, Iren in Saudi Arabien oder Jordanier in Frankfurt<br />
arbeiten und das wir diesen länder- und kulturübergreifenden Austausch weiter<br />
forcieren werden.<br />
Um dieses Zusammenwachsen der Mitarbeiter aller Konzerngesellschaften weltweit<br />
zur neuen Degussa zu fördern, haben wir unter Einbeziehung vieler Mitarbeiter<br />
eine Vision, Mission und Leitlinien für unser Unternehmen entwickelt. Sie<br />
sollen uns gemeinsame Richtschnur für das tägliche Miteinander sein, schreiben<br />
unsere gemeinsamen Ziele fest und beschreiben die Standards für den Umgang<br />
mit Kunden, Lieferanten und Nachbarn. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei<br />
um folgende Grundsätze:<br />
- Wir handeln sozial und ethisch verantwortlich.<br />
- Wir richten uns nach den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung und den Maßstäben<br />
von Responsible Care.<br />
- Wir begegnen allen Menschen mit Respekt, unabhängig von Kultur, Geschlecht,<br />
Nationalität und Herkunft.<br />
- Respekt vor unterschiedlichen Meinungen, Fairness und Berechenbarkeit prägen<br />
unseren Umgang miteinander.<br />
- Offenheit, Aufrichtigkeit und uneingeschränkter Informationsaustausch bestimmen<br />
unser Verhalten.<br />
- Wir verstehen uns als lernende Organisation, fördern persönliche Weiterentwicklung<br />
und unterstützen das Arbeiten in Teams.<br />
Jeder einzelne Bereich im Unternehmen ist aufgefordert, diese Grundsätze seinen<br />
Anforderungen gemäß umzusetzen. Dieser Prozess ist derzeit in vollem Gange.<br />
An allen Standorten arbeiten unsere Mitarbeiter in Teams an der Konkretisierung<br />
dieser „Unternehmensverfassung“. Ein weiterer Meilenstein in diesem Prozess ist<br />
eine Mitarbeiterbefragung zur Stimmungslage im Konzern, die wir Anfang des<br />
Jahres gestartet haben. Die Ergebnisse ermöglichen es uns, nunmehr ganz gezielt<br />
und spezifi sch weitere Veränderungsprozesse anzustoßen.<br />
Unser Ziel ist es, alle Mitarbeiter für Degussa, für unser Geschäft, unsere Produkte<br />
und unsere Unternehmenskultur zu begeistern.<br />
Wir bieten damit unseren Mitarbeitern sehr viel:<br />
- Wir bieten ihnen einen langfristig verlässlichen, kalkulierbaren Rahmen.<br />
- Wir bieten ihnen die Möglichkeit der berufl ichen Entfaltung und Entwicklung.<br />
- Wir bieten ihnen ein angemessenes Gehalt und eine soziale Sicherung.<br />
Auf der anderen Seite fordern wir auch viel von unseren Mitarbeitern:<br />
- Wir fordern hohes Engagement und Bestleistungen.<br />
- Und wir verpfl ichten unsere Mitarbeiter auf die obengenannten Grundprinzipien<br />
und werden diese auch konsequent einfordern.<br />
Das Wertegerüst, das wir uns erarbeitet haben, hilft uns auch, die Gratwanderung<br />
zwischen Anpassung und Anbiederung vor Ort zu bewältigen. Fairness, Offenheit<br />
und Berechenbarkeit im Innenverhältnis wie nach Außen sind nicht mit Bestechung<br />
oder Bestechlichkeit zu vereinen. Responsible Care bedeutet auch, dass<br />
wir nicht jedes Produkt an jeden Kunden liefern. Gerade in der Spezialchemie<br />
ist dies von großer Bedeutung. Viele unserer Produkte haben vielfältige Verwendungszwecke.<br />
Etliche davon sind auch militärischer Art.<br />
Ich möchte dies kurz an einem Beispiel erläutern:<br />
Guanidinnitrat etwa ist ein Produkt, welches zur Herstellung von Treibsätzen für<br />
Airbags eingesetzt wird. Gleichzeitig ist es ein Produkt, das in der Wehrtechnik<br />
zum Einsatz kommt.<br />
In allen diesen Fällen sehen wir es als unsere Pfl icht an, die endgültige Verwendung<br />
unserer Produkte sorgfältig zu prüfen. Lieber lehnen wir einen Auftrag ab,<br />
als dass das Produkt in die falschen Hände gelangt.<br />
Wir sind ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland und wollen dies auch bleiben.<br />
Unser Wertegerüst, die Freiräume, die wir innerhalb unserer Organisation defi -<br />
niert haben, aber auch die Grenzen, die ich Ihnen gerade aufgezeigt habe, sind<br />
geprägt von liberalen, christlichen Wertvorstellungen und der Möglichkeit der<br />
individuellen Verantwortlichkeit. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass<br />
wir eine Balance gefunden haben, die es uns ermöglicht, unterschiedlichste Kulturen<br />
und Traditionen zu integrieren. Zugute kommt uns dabei sicherlich, dass die<br />
drei monotheistischen Weltreligionen, die Gegenstand der heutigen Veranstaltung<br />
sind, viele gemeinsame Wurzeln haben.<br />
Zugute kommt uns aber auch, dass die internationalen wirtschaftlichen Verfl<br />
echtungen – Stichwort Globalisierung – in den letzten Jahrzehnten die Durchdringung<br />
wirtschaftlicher Interessen weltweit gefördert haben. Wir sind ein<br />
Wirtschaftsunternehmen, welches diesen Prozess mitgestaltet hat und von ihm<br />
auch profi tiert. Wir profi tieren aber nicht nur im Sinne von Umsatz und Gewinn,<br />
sondern wir profi tieren auch davon, dass wir über das wirtschaftliche Interesse<br />
24 25
mit unseren Mitarbeitern und unseren Kunden an einem Strang ziehen können.<br />
Uns vereint ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten.<br />
Wenn ich unter diesem Aspekt das derzeitige Spannungsfeld zwischen <strong>Judentum</strong>,<br />
<strong>Christentum</strong> und <strong>Islam</strong> betrachte, so habe ich den Eindruck, dass die Wurzeln<br />
der derzeit im Namen der Religionen gewalttätigen Auseinandersetzungen nur<br />
bedingt auf religiöse Differenzen und ihre Ausstrahlung in die jeweiligen Gesellschaften<br />
zurückzuführen sind.<br />
Eine der wesentlichen Ursachen aus meiner Sicht sind die sozialen Spannungen,<br />
das Wohlstandsgefälle, das hier auf engem Raum innerhalb einzelner Gesellschaften<br />
existiert. Weitere Vorraussetzungen dafür sind, dass die einzelnen sozialen<br />
Gruppen unterschiedliche Religionszugehörigkeiten aufweisen.<br />
Als prägnantes Beispiel müssen wir uns nur Nordirland anschauen. Hier geht<br />
es nur vordergründig um den Konfl ikt zwischen Protestanten und Katholiken.<br />
Im Kern geht es um den Konfl ikt zwischen den armen Katholiken, die – extrem<br />
ausgedrückt – nichts zu verlieren haben, und den reichen Protestanten, die alles<br />
zu verteidigen haben – Wohlstand, Reichtum und damit auch Macht. Die Religionszugehörigkeit<br />
ist damit nur ein Vehikel, mit dem suggeriert wird, dass hier ein<br />
Kampf für eine scheinbar höhere, bessere Sache geführt wird. Die Gefühle, die<br />
dabei angesprochen werden, sind auf der einen Seite die Ohnmacht angesichts der<br />
eigenen Schwäche und auf der anderen Seite die existenzielle Angst um den Verlust<br />
des Erreichten. Dieses ist das Grundmuster, nach dem Extremisten jeglicher<br />
Couleur ihre Anhänger um sich scharen.<br />
Ein Ausweg aus derartigen Konfl ikten erscheint mir nur möglich, wenn es gelingt,<br />
eine sogenannte Win-Win Situation herzustellen. Unter wirtschaftlichen<br />
Aspekten heißt dies im Idealfall:<br />
Wir müssen die soziale Schere schließen, indem wir den einen eine belastbare<br />
Perspektive auf ein wirtschaftlich besseres Leben eröffnen ohne den anderen et<strong>was</strong><br />
substanziell zu nehmen. Wer seine eigene wirtschaftliche Perspektive sieht,<br />
der läuft nicht mehr blind jedem Rattenfänger hinterher. Gleiches gilt für den, der<br />
nicht mehr ständig in der Angst lebt, das Erreichte zu verlieren.<br />
Der Schlüssel hierfür ist nicht die Umverteilung und auch nicht die großzügige<br />
Unterstützung durch Dritte. Die Lösung liegt allein in der wirtschaftlichen Entwicklung.<br />
Sie erst eröffnet die Spielräume für einen sozialen Ausgleich.<br />
Dies ist ein langwieriger Prozess. Er erfordert viel Geduld und Engagement. Seitens<br />
der Politik wie seitens der Unternehmen.<br />
Das Dilemma, das ich dabei heute sehe, ist folgendes:<br />
1. Frieden und ein wenigstens rudimentär funktionierendes Gemeinwesen sind unabdingbare<br />
Grundlage für substanzielle Investitionen, ohne die wirtschaftliches<br />
Wachstum nicht möglich ist.<br />
2. Wirtschaftliches Wachstum, das sich auf alle Bevölkerungsgruppen und -schichten<br />
verteilt, gräbt dem Extremismus das Wasser ab.<br />
Aus dieser Perspektive haben diejenigen, die unter dem Deckmantel ihrer Religion<br />
rund um den Globus brutale, blutige Auseinandersetzungen führen, jedes<br />
Interesse, diese weiter zu schüren. Sie haben es in der Hand, die wirtschaftliche<br />
Entwicklung zu verhindern und damit ihre Gefolgschaft und Macht auszubauen.<br />
Diesen Teufelskreis müssen wir gemeinsam durchbrechen.<br />
Ohne ein konzertiertes Gegensteuern der Staatengemeinschaft laufen wir Gefahr,<br />
dass sich die bestehenden Konfl ikte aus ihrem bisher überwiegend regional fokussierten<br />
Kontext lösen und weitere geographische Kreise ziehen. Der 11. September<br />
hat uns dies schmerzhaft vor Augen geführt.<br />
Meine sehr verehrten Damen und Herren,<br />
meine Überlegungen fokussieren sich klar auf den wirtschaftlichen Aspekt und<br />
die wirtschaftlichen Hintergründe aktueller Konfl ikte, die das Bild des Verhältnisses<br />
zwischen den drei Religionsgemeinschaften derzeit prägen. Auch wenn ich<br />
der Nachkriegsgeneration angehöre, ist mir als Deutscher stets bewusst, dass die<br />
historischen Erfahrungen im Verhältnis der drei Religionsgemeinschaften tiefe<br />
Spuren hinterlassen haben. Mein Beitrag zur heutigen Veranstaltung sollte aber<br />
die Sicht des Unternehmers sein: orientiert an wirtschaftlichen Fragestellungen<br />
und den Blick nach vorn gewandt.<br />
Ich bin davon überzeugt, dass die Erfahrungen des globalen Mikrokosmos<br />
Degussa wertvolle Gedankenanstöße leisten können. Und ich sehe es als meine<br />
Aufgabe, als die Aufgabe der Degussa, an der Gestaltung einer friedlichen<br />
Weltgemeinschaft, die auf den Grundfesten der Toleranz und des gegenseitigen<br />
Respekts basiert, mit zu gestalten. Eine derartige Weltgemeinschaft ist der Idealzustand<br />
eines global agierenden Wirtschaftsunternehmens, welches im Gegenzug<br />
die Entwicklung dahin nachhaltig unterstützen kann.<br />
Vielen Dank<br />
26 27
Professorin Dr. Martha Zechmeister-Machhart<br />
Professorin Dr. Martha Zechmeister-Machhart<br />
Professur für Fundamentaltheologie an der <strong>Universität</strong> <strong>Passau</strong><br />
Dialog zwischen Christen und Muslimen.<br />
‚Mulitreligiöse Schummelei oder Beitrag zu einer humaneren<br />
Welt?‘<br />
Seit dem 11. September 2001 ist das Interesse am „interreligiösen Dialog“ zwischen<br />
Christen und Muslimen sowie die öffentliche Resonanz auf diesbezügliche<br />
Veranstaltungen jäh emporgeschnellt. Was das Nachrichtenmagazin „Der<br />
Spiegel“ so im Dezember 2001 konstatiert hat, gilt noch immer. Und es steht<br />
auch noch immer als Provokation im Raum, <strong>was</strong> damals unter der Überschrift<br />
„Der verlogene Dialog“ weiter ausgeführt wurde:<br />
Gutmeinende Christenmenschen würden den Dialog als Allheilmittel anpreisen<br />
und eifrig nach dem Guten im Glauben der anderen, der Muslime, suchen.<br />
Aus Angst, sich gegenüber der fremden Religion als intolerant zu zeigen<br />
oder des Fremdenhasses verdächtigt zu werden, fehle ihnen jedoch der Mut,<br />
die kritischen Punkte offen und konkret beim Namen zu nennen. Eilfertig<br />
würden sie versichern, dass der <strong>Islam</strong> mit Terrorismus nicht das Geringste zu<br />
tun habe – und gebetsmühlenartig schärfen sie die Unterscheidung zwischen<br />
<strong>Islam</strong> und <strong>Islam</strong>ismus ein. Sie würden die christlichen Missetaten vergangener<br />
Jahrhunderte geradezu lustvoll bekennen – und zugleich den <strong>Islam</strong> als eine im<br />
Grunde tolerante Religion preisen. Kurz gefasst: Durch die Naivität deutscher<br />
christlicher Gutmenschen sei der interreligiöse Dialog zu einer groß angelegten<br />
„mulitreligiösen Schummelei“ verkommen. Bundesinnenminister Otto Schily<br />
fühlte sich angesichts dieser Diagnose veranlasst, sich um die Kirchen zu sorgen,<br />
die ihm „nicht immer die Kraft zu haben scheinen, die geistige Auseinandersetzung<br />
mit dem <strong>Islam</strong> zu bestehen.“ 1<br />
Und Alice Schwarzer schreibt in ihrem im Frühjahr 2002 erschienenen Büchlein<br />
„Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz“: „Der deutsche Protestantismus<br />
scheint für geißelnde Selbstverleugnung und adorierende Fremdenliebe ein<br />
besonderer Nährboden zu sein.“ 2<br />
Im Folgenden versuche ich aus der Perspektive der christlichen Theologin über<br />
Bedingungen einer authentischen Begegnung mit dem <strong>Islam</strong> zu refl ektieren. Dabei<br />
begreife ich christliche Identität allerdings wesentlich aus ihrer dialektischen<br />
29
Beziehung zu ihrer älteren jüdischen Schwester. Mein Ausgangspunkt ist die<br />
soeben angesprochene Kritik an der Naivität christlicher Dialogbemühungen, die<br />
in der deutschen Öffentlichkeit gegenwärtig am pointiertesten von Bassam Tibi<br />
zum Ausdruck gebracht wird. Auch der genannte Spiegelartikel beruft sich auf ihn.<br />
Seine Stimme ist schon deshalb besonders interessant, weil ihm als Moslem wohl<br />
kaum vorgeworfen werden kann, er würde ein „Feindbild <strong>Islam</strong>“ beschwören. Die<br />
Naivitäten des christlichen Gegenübers deckt er vielmehr aus der muslimischen<br />
Innenperspektive auf. Seine in zahlreichen Buchveröffentlichungen vertretenen<br />
Argumente hat er Ende Mai in der Wochenzeitung „Die Zeit“ auf den Punkt<br />
gebracht. Der Titel seiner Ausführungen lautet: „Selig sind die Belogenen.“ 3<br />
Ich greife die These Bassam Tibis heraus, die mich bei der Lektüre seiner Texte<br />
zu meinen Überlegungen provoziert hat. Tibi stellt es mit aller wünschenswerten<br />
Deutlichkeit heraus: Bieder-korrekte Dialogchristen würden den Muslimen<br />
eine gemeinsame Basis unterstellen – von der sich diese jedoch höchstens aus<br />
taktischen Gründen nicht distanzieren. Die Christen bewegen sich auf dem Boden<br />
einer kulturell und religiös pluralistischen, demokratischen Gesellschaftsordnung<br />
– und verstehen unter Dialog den diskursiven Austausch gleichberechtigter<br />
Partner, der die reziproke Anerkennung der Standpunkte voraussetzt. Die<br />
Muslime dagegen – und zwar nicht bloß die <strong>Islam</strong>isten, sondern auch die Vertreter<br />
des orthodoxen <strong>Islam</strong> – seien noch längst nicht in dieser pluralistischen Moderne<br />
angelangt. Überzeugt von der Überlegenheit, ja der göttlichen Absolutheit<br />
ihrer eigenen Anschauungen, ist das, <strong>was</strong> die Christen als Dialog bezeichnen,<br />
für sie konsequenterweise höchstens die Gelegenheit zur Missionierung der<br />
Ungläubigen.<br />
Nicht um den <strong>Islam</strong> aus Europa auszugrenzen, deckt Bassam Tibi dies auf,<br />
sondern im Gegenteil, um dem Euro-<strong>Islam</strong> den Weg zu bereiten. Er hält es für<br />
durchaus möglich, muslimische und europäische Identität ohne Schizophrenie<br />
miteinander zu vereinen, gibt jedoch klare Kriterien für einen solchen Euro-<br />
<strong>Islam</strong>, der erst noch auf den Weg zu bringen wäre, an. Tibi wörtlich: „Eine<br />
erfolgversprechende Lösung kann nur darin bestehen, den <strong>Islam</strong> von seinem<br />
universalistischen Absolutheitsanspruch zu befreien und ihn an die pluralistische<br />
europäische Moderne anzupassen. ... Es geht darum, die Religion des <strong>Islam</strong>s nur<br />
im Rahmen eines religiösen Pluralismus zuzulassen. Religiöser Absolutismus<br />
und missionierende Einstellungen müssen zugunsten der Loyalität gegenüber<br />
der säkularen Zivilgesellschaft und pluralistischer Demokratie aufgegeben werden.“<br />
4<br />
Was provoziert mich nun als Theologin an Bassam Tibis These? Wenn ich dies<br />
im Folgenden zu formulieren versuche, so wird es zugegebenermaßen – um der<br />
Deutlichkeit und Kürze willen – überspitzt ausfallen. Denn zunächst frage ich mich,<br />
ob denn überhaupt das <strong>Christentum</strong>, dort wo es noch authentisch bei sich selbst<br />
ist, die Kriterien erfüllt und erfüllen kann, die Tibi für die Europa-Tauglichkeit<br />
des <strong>Islam</strong> aufstellt. Tibi scheint dies selbstverständlich vorauszusetzen. Es mag<br />
ja durchaus sein, dass das <strong>Christentum</strong> und seine theologische Refl exion sich<br />
weithin so anschmiegsam und modernitätsverträglich erwiesen haben, wie dies die<br />
Kriterien Tibis als wünschenswert erscheinen lassen. Können aber die Religionen<br />
– zumindest die monotheistischen –, dort wo sie sich noch nicht längst, sich selbst<br />
relativierend, aufgegeben haben, der pluralistischen Gesellschaft die Provokation<br />
und die Irritation des Absoluten ersparen? Können sie denn, ohne sich selbst zu<br />
verraten, sich wirklich von ihrem universalen Anspruch verabschieden? Können<br />
sie sich schließlich wirklich ohne Duckmauserei und Selbstverkrümmung von<br />
ihrer „missionierenden Einstellung“ lösen, d. h. von ihrer Überzeugung, ihnen sei<br />
eine heilsrelevante Botschaft für alle Menschen anvertraut, die es auch an diese<br />
weiterzugeben, d. h. zu verkünden gilt?<br />
Die Muslime glauben noch immer, dass ihre Religion wahr ist. Und eben dies<br />
würde sie von den Christen unterscheiden. Zu diesem Schluss kommt Hans-<br />
Peter Raddatz in seinem Buch „Von Gott zu Allah? <strong>Christentum</strong> und <strong>Islam</strong> in<br />
der liberalen Fortschrittsgesellschaft“ 5 . Er hält es, in Klammern bemerkt, für<br />
eine Naivität der Mulitkulturalisten zu glauben, überzeugte Muslime könnten ihr<br />
integralistisches Religionsmodell unter dem Einfl uss pluralistischer Demokratie<br />
aufgeben. Raddatz ist also äußerst skeptisch, <strong>was</strong> die Chancen für einen Euro-<br />
<strong>Islam</strong> betrifft.<br />
Meine Frage – penetrant zugespitzt – nochmals wiederholt: Können die, die<br />
sich zu einer monotheistischen Religion bekennen, den Anspruch der einen und<br />
unbedingten Wahrheit getrost fahren lassen – und friedlich und sanft in einer<br />
pluralen, mulitkulturellen und multireligiösen Landschaft untertauchen?<br />
An meiner Insistenz merken Sie, dass ich geneigt bin, diese Fragen mit einem<br />
entschiedenen Nein zu beantworten. Damit möchte ich jedoch gewiss nicht die<br />
Differenz verwischen: Zwischen einerseits einer Religion, die sich, im Falle des<br />
<strong>Christentum</strong>s, irreversibel dem Experiment der Aufklärung ausgeliefert hat – und<br />
andererseits einer Religion, die, im Falle des <strong>Islam</strong>, in ihrer Mehrheit noch vor<br />
der Entscheidung steht, ob sie sich überhaupt in Richtung pluralistischer Moderne<br />
aufmachen oder ob sie in ihrer Abschottung verharren wird. Die Differenz darf<br />
nicht verwischt werden: Zwischen einerseits einer Religion, die schmerzlich<br />
gelernt hat, sich vom Anspruch auf politische Macht zu lösen und sich in ein<br />
kritisches Verhältnis zur eigenen Gewaltgeschichte zu setzen – und andererseits<br />
30 31
einer Religion, in der die Mehrheit ihrer Gläubigen theokratische Verhältnisse<br />
durchaus für wünschenswert erachtet; Verhältnisse in denen die religiösen<br />
Autoritäten mit den politisch und gesellschaftlich dominierenden Instanzen in<br />
eins fallen.<br />
Schon gar nicht möchte ich bestreiten, sondern mich im Gegenteil entschieden<br />
diesem Standpunkt anschließen, dass auf dem Boden demokratischer Zivilisation<br />
nur eine Religion akzeptiert werden darf, die bedingungslos und vollständig auf<br />
jede physische und psychische Gewalt zur Durchsetzung ihres Wahrheitsanspruchs<br />
verzichtet hat. Die Fähigkeit, konkurrierende Glaubensüberzeugungen und<br />
Wahrheitsbehauptungen respektvoll wahrzunehmen und sich argumentativ zu<br />
ihnen in Beziehung zu setzen, ist die Mindestanforderung, die eine demokratische<br />
Gesellschaft den von ihr akzeptierten Religionen abzuverlangen hat.<br />
Was ich jedoch sehr wohl möchte, ist, nochmals genauer zusehen, <strong>was</strong> das<br />
Verhältnis von monotheistischen Religionen zu den sogenannten „Werten der<br />
demokratischen Zivilisation“ betrifft. Jürgen Habermas hat in seiner Rede zur<br />
Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels dazu mit einer<br />
Analyse überrascht, die sich deutlich von seinen früheren Ausführungen abhebt<br />
– oder diese zumindest entscheidend weiterentwickelt. 6 Auch schon früher wusste<br />
Habermas darum, dass das, <strong>was</strong> wir als modernes Europa bezeichnen, wesentlich<br />
als säkulares Erbe der jüdisch-christlichen Tradition zu begreifen ist. Da auch die<br />
Überlieferungsleistung des <strong>Islam</strong> mitzubedenken ist, die das antike-griechische<br />
Erbe dem Vergessen entrissen hat, so sind alle drei monotheistischen Religionen<br />
tief in die europäischen Fundamente eingelassen.<br />
Die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer<br />
Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, von<br />
Demokratie und Menschenrechten begreift Habermas als die Übersetzung des<br />
religiösen Erbes in universale, diskursiv vermittelbare Vernunftkategorien. Beim<br />
Habermas vergangener Jahrzehnte konnte es jedoch so scheinen, als wäre diese<br />
Übersetzungsarbeit früher oder später erledigt – als käme irgendwann der Punkt,<br />
an dem das „semantische Potential“ der Religion defi nitiv ausgeschöpft wäre.<br />
Diese aber würde dann wie eine ausgebrannte Raketenstufe überfl üssig geworden<br />
sein.<br />
Beim Habermas der Friedenspreisrede klingt dies deutlich anders. Es mag<br />
sein, dass ihn der Schock des 11. Septembers 2001, der Schock, dass die<br />
Religion in ihrer archaischen und gewalttätigen Form unvermutet in die<br />
säkulare Gesellschaft eingebrochen ist, zu seiner Wortschöpfung von der „postsäkularen<br />
Gesellschaft“ getrieben hat. Sie weist aber auch auf et<strong>was</strong> hin, <strong>was</strong> in<br />
den früheren Texten Habermas’ so nicht deutlich geworden ist: Nicht nur den<br />
Glaubenden ist zugemutet, ihre religiösen Überzeugungen in säkulare Sprache<br />
zu übersetzen, wenn sie in demokratischer Öffentlichkeit gehört werden und in<br />
ihren Argumenten Zustimmung erfahren will. Sondern es gilt auch, dass sich die<br />
säkulare Gesellschaft nur dann nicht von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung<br />
abschneidet, wenn sie sich ein Gefühl für die Artikulationskraft religiöser Sprache<br />
bewahrt. Religion wäre so nicht irgendwann überholt, „aufgehoben“, – sondern<br />
die demokratische Ordnung wäre um der von ihr verteidigten Werte, wie z. B. der<br />
gleichen Würde und Rechte aller Menschen, willen auf den bleibenden kritischen<br />
Widerstand der Religion verwiesen.<br />
Lassen Sie mich nochmals zu meiner These zurückkehren: Religion, die<br />
nicht längst sich selbst relativierend aufgegeben hat, vermag der pluralen,<br />
demokratischen Öffentlichkeit nicht die Provokation und Irritation des Absoluten<br />
zu ersparen. Und ich würde jetzt hinzufügen: Es geht dabei nicht bloß um den<br />
Selbstbehauptungsrefl ex der Religion, genauer gesagt der christlichen Religion,<br />
sondern um den Bestand oder Untergang dessen, worauf die demokratische<br />
Ordnung letztlich baut: auf Humanität und Menschenwürde. Die Provokation<br />
des Absoluten vermag die monotheistische Tradition der (post-)modernen Welt<br />
nur um den Preis zu ersparen, dass in der Konsequenz auch aus der Rede von<br />
Humanität und Menschenwürde jeder substantielle Gehalt ausgetrieben wird.<br />
Der, der m. E. diese Zusammenhänge – in der Negativität der Kritik – am<br />
schärfsten diagnostiziert, ist Friedrich Nietzsche. Für ihn ist der Atheismus derer,<br />
die glauben, man bräuchte nur Gott loszuwerden, damit der Mensch sich frei und<br />
aufrecht erheben könne, eine Naivität. Mit dem Tod des christlichen Gottes ist für<br />
ihn auch der uns bekannte Mensch unausweichlich in den Strudel des Untergangs<br />
gezogen. „Das größte neuere Ereignis, – dass ‚Gott tot ist’, dass der Glaube an<br />
den christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist – beginnt bereits seine ersten<br />
Schatten über Europa zu werfen.“ Für die, deren Augen stark und fein genug sind,<br />
erscheint „unsre alte Welt täglich abendlicher, misstrauischer, fremder, älter“. Nur<br />
wenige vermögen zu erkennen, „<strong>was</strong> Alles, nachdem dieser Glaube untergraben<br />
ist, nunmehr einfallen muss, weil es auf ihm gebaut, an ihn gelehnt, in ihn<br />
hineingewachsen war: zum Beispiel unsre ganze europäische Moral“. 7<br />
Nietzsche hat keinerlei Zutrauen in die säkulare, von ihren religiösen Wurzeln<br />
abgeschnittene Gestalt der Humanität. Der französische postmoderne Philosoph,<br />
Michel Foucault, formuliert dieselbe Einsicht im letzten Satz der „Archäologie<br />
des Wissens“ folgendermaßen: „Es mag durchaus sein, dass ihr Gott unter dem<br />
Gewicht all dessen, <strong>was</strong> ihr gesagt habt, getötet habt. Denkt aber nicht, dass ihr<br />
aus all dem, <strong>was</strong> ihr sagt, einen Menschen macht, der länger lebt als er.“ 8<br />
32 33
Was ist nun die Konsequenz aus dem bisher Gesagten für den interreligiösen<br />
Dialog: Bereuen es glaubende Christen schon längst, sich dem Experiment der<br />
Aufklärung ausgesetzt zu haben, weil sie aus diesem Experiment zumindest im<br />
europäischen Raum als bloße gesellschaftliche Marginalie hervorgegangen sind?<br />
Möchten die geistig und moralisch erschöpften europäischen Christen sich dem<br />
<strong>Islam</strong> anbiedern, um aus seiner Vitalität neue Lebensgeister zu beziehen? Oder<br />
möchten sie gerade das Gegenteil: sich fundamentalistisch sowohl gegen die<br />
Usurpation durch das Fremde, wie auch gegen weitere säkulare Zersetzung zur<br />
Wehr setzen?<br />
Wofür ich klar plädiere, ist die Ökumene der monotheistischen Religionen.<br />
Gewiss nicht im Sinn „interreligiöser Schmusestunden“, die Bassam Tibi zu<br />
Recht für entbehrlich erachtet. Auch nicht im Sinne einer Ökumene des kleinsten<br />
gemeinsamen Nenners, der harmlos naiv eine Familienähnlichkeit der sogenannten<br />
abrahamitischen Religionen voraussetzt – und alles, <strong>was</strong> das Unterscheidende des<br />
Eigenen wie das Befremdliche des Anderen ausmacht, verschämt unter den Tisch<br />
wischt. Wofür ich plädiere ist eine dialektische Ökumene, die sich gerade der<br />
Differenz, dem Anderssein des Anderen aussetzt – und das Eigene unverstellt<br />
und unverkürzt zumutet. Es geht darum, sich ein differenziertes theologisches<br />
und historisches Wissen über den jeweils anderen anzueignen – und es geht um<br />
eine Ökumene, in der offensiv und produktiv um das gestritten wird, <strong>was</strong> den<br />
Wesenskern des Monotheismus ausmacht. Worum es in diesem Streit zu gehen<br />
hat, möchte ich abschließend am zentralen Punkt andeuten.<br />
„Es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist der Gesandte Gottes“, lautet<br />
das Glaubensbekenntnis der Moslems. „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus<br />
Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen<br />
Götter haben“ (Ex 20,2 f; Dt 5,6 f), lautet das erste Gebot der Juden und Christen.<br />
Die göttliche Einheit und Einzigkeit ist allen drei Religionen gleichermaßen<br />
heilig. Dass auch das christologische und trinitarische Dogma der Christen nur<br />
dann recht ausgelegt wird, wenn es den Monotheismus nicht relativiert und<br />
aufweicht, sondern allererst einschärft, kann ich hier nur behaupten und nicht<br />
erläutern.<br />
Das Bekenntnis zur göttlichen Einheit und Einzigkeit trägt in sich schon den<br />
universalen Anspruch der monotheistischen Religionen. Gott ist entweder der Gott<br />
aller Menschen, oder er ist nicht Gott. Ein Gott, der nur für eine Teilwirklichkeit<br />
oder nur für eine partikuläre Menschengruppe zuständig wäre, kann im Sinne<br />
der monotheistischen Religionen niemals als Gott angerufen, sondern höchstens<br />
als Götze entlarvt werden. Zu streiten bleibt freilich, wie ein solcher universaler<br />
Anspruch zu verwirklichen ist, wie sich denn das Bekenntnis zu Gott, der der Gott<br />
aller Menschen ist, zu vollziehen hat.<br />
In der Heiligen Schrift der Juden und Christen wird das erste Gebot, „Du sollst<br />
keine anderen Götter neben mir haben“, eingeleitet mit dem Satz „Ich bin<br />
Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“. Das<br />
Bekenntnis zum Einzigen geht in eins mit der Befreiung von allen Mächten und<br />
Gewalten, die den Menschen offen und despotisch – oder dumpf und unbewusst<br />
– beherrschen. Die innerste Aussage des biblischen Monotheismus lautet: Nichts<br />
soll über den Menschen versklavend dominieren. Er ist per se die Relativierung<br />
aller falschen Absolutheitsansprüche. Und dieses Kriterium der Befreiung darf<br />
auch nicht im Dialog mit dem <strong>Islam</strong> preisgegeben werden.<br />
Damit komme ich nochmals zum Kernpunkt unserer Überlegungen zurück:<br />
zum Verhältnis von Monotheismus und Demokratie, um das es gerade in einem<br />
aufrichtigen Dialog mit dem <strong>Islam</strong> zu streiten gilt. Ausgehend von Nietzsche zieht<br />
sich durch die europäische Geistesgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte die<br />
radikale Antithese, das große Lob des Polytheismus. Odo Marquard hat es klassisch<br />
zum Ausdruck gebracht9 , von Richard Rorty wird es gegenwärtig fortgesetzt. Der<br />
Monotheismus vergewaltige die Menschen unter das Diktat der einen Norm und<br />
der einen nicht-perspektivischen Wahrheit. Nur wenn wir uns davon entschieden<br />
lossagten, könnten wir die Vision der Griechen wiedergewinnen, in der „der<br />
eine Gott nicht die Leugnung oder Lästerung des anderen Gottes“ war. Und<br />
nur unter einem solchen Himmel würde sich der Raum eröffnen, in dem das<br />
Individuum frei atmen könne und in dem es „zur größtmöglichen Vielfalt frei<br />
gewählter Lebensweisen ermutigt“ werde. Nur wenn wir uns entschieden von<br />
allen Ansprüchen auf Einzigkeit und Ausschließlichkeit verabschiedeten, sei<br />
eine tragfähige soziale Ordnung in einer pluralen Gesellschaft, wie auch eine<br />
Friedensordnung in einer multikulturellen Welt, möglich. 10<br />
Dieses Lob des Polytheismus im Namen einer pluralen, demokratischen<br />
Weltordnung beruft sich auf Nietzsche. Ich denke, letztlich nicht zu Recht.<br />
Denn wiederum erweist sich Nietzsche m. E. im Sarkasmus seiner Kritik als<br />
der schärfere Diagnostiker. Für ihn, den Demokratieverächter, muss nicht der<br />
Monotheismus um der Demokratie willen beseitigt werden, sondern er verachtet<br />
den Monotheismus gerade umgekehrt deshalb, weil er in ihm den maßgeblichen<br />
Inspirator der demokratisch-egalitären Ideale der Aufklärung diagnostiziert.<br />
In der Fröhlichen Wissenschaft bezeichnet Nietzsche den Monotheismus, also<br />
den Glauben „an einen Normalgott, neben dem es nur noch falsche Lügengötter<br />
gibt“, als die „starre Konsequenz der Lehre vom Einen Normalmenschen“ 11 .<br />
34 35
Und im Nachlass von 1885/86 lässt er seiner Verachtung freien Lauf, wenn<br />
er formuliert, dass „das <strong>Christentum</strong>, als plebejisches Ideal, mit seiner Moral<br />
auf Schädigung der stärkeren höher gearteten männlicheren Typen hinausläuft<br />
und einen Herdenart-Menschen begünstigt: dass es eine Vorbereitung der<br />
demokratischen Denkweise ist“. 12<br />
In Umkehrung derer, die glauben, das Lob des Polytheismus um der Demokratie<br />
anstimmen zu müssen, möchte ich deshalb formulieren: Das ist der Wesenskern<br />
der monotheistischen Religionen, der im Gespräch mit dem <strong>Islam</strong> geltend<br />
gemacht werden muss: Es ist gerade das Bekenntnis zum einen und einzigen<br />
Gott, dass den Himmel offen hält, unter dem sich der Mensch frei und aufrecht<br />
erheben kann – und unter dem es möglich wird, Pluralität und Verschiedenheit<br />
anzuerkennen und zu bejahen. Damit aber verbietet sich jede, auch jede religiös<br />
motivierte, autoritäre Herrschaft des Menschen über den Menschen. Glaubwürdig<br />
vertreten kann man eine solche Option tatsächlich nur im kritischen Wissen um<br />
die schreckliche Geschichte des Missbrauchs des Monotheismus zur Legitimation<br />
von Herrschaftsansprüchen – und zwar sowohl auf christlicher, wie auch auf<br />
muslimischer Seite.<br />
Könnte aber damit der aufrichtige Dialog von Christen mit Muslimen nicht doch<br />
entscheidend mehr leisten, als ihm „Der Spiegel“ und Konsorten zuzutrauen<br />
scheinen – nämlich die verlogene multireligiöse Schummelei? Könnte nicht<br />
gerade der aufrechte Dialog unter den monotheistischen Religionen zur<br />
entscheidenden Vermittlungsleistung werden, die für die Muslime, ohne dass<br />
diese sich selbst aufgeben und verraten müssten, die Brücke in ein demokratisches<br />
Europa schlägt?<br />
(Footnotes)<br />
1 Der Spiegel, 17. Dez. 2001, Der verlogene Dialog.<br />
2 A. Schwarzer, Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz, Köln 2002, 15.<br />
3 Die Zeit, Nr. 23/2002, 31.5.2002.<br />
4 B. Tibi, Selig sind die Belogenen, in: Die Zeit, Nr. 23/2002, 9.<br />
5 H.-P. Raddatz: Von Gott zu Allah? <strong>Christentum</strong> und <strong>Islam</strong> in der liberalen Fortschrittsgesellschaft,<br />
München 2001.<br />
6 J. Habermas, Glaube und Wissen. Friedenspreis des deutschen Buchhandels,<br />
Frankfurt a. M., 2001.<br />
7 F. Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, Nr. 343.<br />
8 M. Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt 1973, 301.<br />
9 O. Marquard, Lob des Polytheismus, in: H. J. Höhn (Hg.), Krise der Immanenz.<br />
Religion an den Grenzen der Moderne, Frankfurt 1996, 154-173.<br />
10 R. Rorty, Ein Prophet der Vielfalt, in: Die Zeit, Nr. 35/2000, 41.<br />
11 Fröhliche Wissenschaft, Nr. 143.<br />
12 F. Nietzsche, KSA Bd.12, 155.<br />
36 37