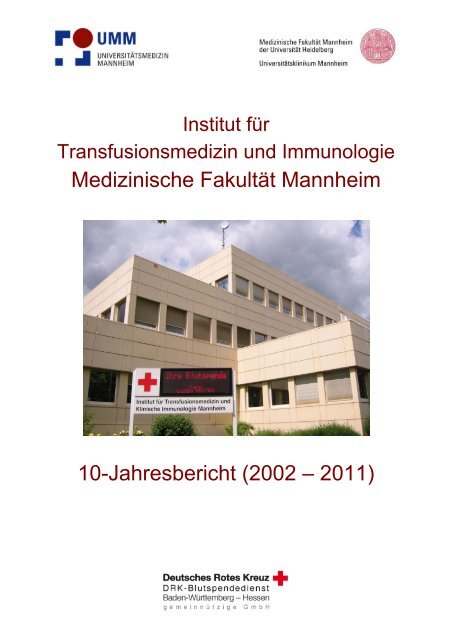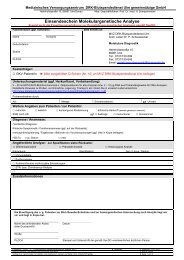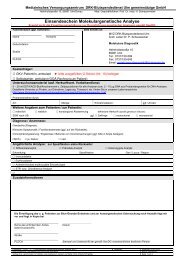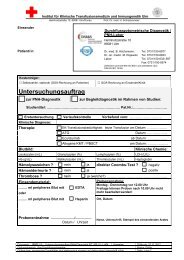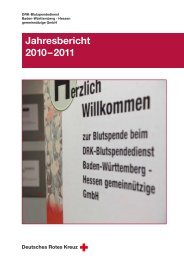10-Jahresbericht des Instituts (2002-2011) - Medizinische Fakultät ...
10-Jahresbericht des Instituts (2002-2011) - Medizinische Fakultät ...
10-Jahresbericht des Instituts (2002-2011) - Medizinische Fakultät ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut für<br />
Transfusionsmedizin und Immunologie<br />
<strong>Medizinische</strong> Fakultät Mannheim<br />
<strong>10</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> (<strong>2002</strong> – <strong>2011</strong>)
1 VORWORT 1<br />
2 DIE STANDORTE 2<br />
2.1 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE <strong>10</strong>7: BLUTSPENDEZENTRALE 2<br />
2.2 BLUTBANK 3<br />
2.3 CENTRUM FÜR BIOMEDIZIN UND MEDIZINTECHNIK MANNHEIM (CBTM) 4<br />
2.3.1 FORSCHUNGSLABORE IN DEN RÄUMEN DES CBTM 4<br />
2.3.2 FLOWCORE MANNHEIM : CELL SORTING CORE FACILITY 5<br />
3 FORSCHUNG 7<br />
3.1 DIE FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE 7<br />
3.1.1 ZELL- UND IMMUNTHERAPIE 7<br />
3.1.2 THROMBOZYTENIMMUNOLOGIE 29<br />
3.1.3 SICHERHEIT DER HÄMOTHERAPIE 36<br />
3.2 DRITTMITTEL 55<br />
3.2.1 ÖFFENTLICHE DRITTMITTEL 55<br />
3.2.2 INDUSTRIEMITTEL 56<br />
3.3 AUSGERICHTETE KONGRESSE 57<br />
3.3.1 37. JAHRESKONGRESS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TRANSFUSIONSMEDIZIN UND<br />
IMMUNHÄMATOLOGIE E.V. 57<br />
3.3.2 3. INTERNATIONALER WORKSHOP: MULTIPOTENT STROMAL CELLS (MSCS) FOR<br />
REGENERATIVE MEDICINE AND IMMUNE REGULATION 59<br />
3.3.3 BSD FORSCHUNGSSEMINAR 2006 61<br />
3.3.4 BSD FORSCHUNGSSEMINAR <strong>2011</strong> 66<br />
3.4 VERÖFFENTLICHUNGEN 69<br />
3.4.1 PUBLIKATIONSTATISTIK 69<br />
3.4.2 VERÖFFENTLICHUNGEN 69<br />
4 LEHRE 84<br />
4.1 LEHRE IN DER KLINISCHEN MEDIZIN (<strong>2002</strong> – 20<strong>10</strong>) 84<br />
4.2 LEHRE IM REFORMSTUDIENGANG MARECUM 85<br />
4.3 LEHRE IM MASTER-STUDIENGANG „TRANSLATIONAL MEDICAL RESEARCH“ 90<br />
4.4 LEHRE IN DER MTA-AUSBILDUNG 91<br />
4.5 TOPLAB - KOMPETENZ IM LABOR 93<br />
4.6 BACHELOR-, MASTER- UND DIPLOMARBEITEN, PROMOTIONEN 94<br />
4.7 HABILITATIONEN 96<br />
4.8 BERUFUNGEN 96<br />
4.9 PREISE/AUSZEICHNUNGEN 97<br />
5 PATIENTENVERSORGUNG 98<br />
5.1 BLUTSPENDE 98<br />
5.1.1 SPENDEABTEILUNG IM INSTITUT 98<br />
5.1.2 ENTNAHMETEAMS UND EXTERNE SPENDETERMINE <strong>10</strong>1<br />
2
5.1.3 BLUTPRÄPARATE UND IHRE HERSTELLUNG <strong>10</strong>5<br />
5.1.4 LAGERUNG UND VERTRIEB VON BLUTPRÄPARATEN <strong>10</strong>6<br />
5.2 STAMMZELLSPENDE- UND TRANSPLANTATION <strong>10</strong>8<br />
5.2.1 KNOCHENMARKSPENDEDATEI RHEIN-NECKAR/DEUTSCHE STAMMZELLSPENDERDATEI <strong>10</strong>8<br />
5.2.2 NABELSCHNURBLUTBANK MANNHEIM 1<strong>10</strong><br />
5.2.3 KNOCHENBANK 114<br />
5.3 LABORDIAGNOSTIK 116<br />
5.3.1 LEISTUNGSKATALOG LABORDIAGNOSTIK 116<br />
5.3.2 BLUTBANK UND IMMUNHÄMATOLOGIE 118<br />
5.3.3 THROMBOZYTENIMMUNOLOGIE 121<br />
5.3.4 HLA-LABOR 124<br />
5.3.5 INFEKTIONSSEROLOGIE 129<br />
5.3.6 QUALITÄTSKONTROLLE 131<br />
5.4 WEITERE LEISTUNGEN DES INSTITUTS 137<br />
5.4.1 REISEMEDIZINISCHE IMPFAMBULANZ 137<br />
5.4.2 EXTERNE TRANSFUSIONSVERANTWORTLICHE 138<br />
5.4.3 FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG ZUR QUALIFIKATION ALS<br />
TRANSFUSIONSVERANTWORTLICHE/R UND TRANSFUSIONSBEAUFTRAGTE/R 140<br />
5.4.4 EXTERNE IMMUNHÄMATOLOGISCHE LABORLEITUNG 141<br />
5.4.5 ABSTAMMUNGSBEGUTACHTUNG 141<br />
6 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 143<br />
3
Vorwort___________________________________________________________________<br />
1 Vorwort<br />
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
zum Sommersemester 2012 jährt sich die Gründung <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für Transfusionsmedizin<br />
und Immunologie an der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg zum<br />
<strong>10</strong>. Male. Aus diesem Anlass wurde dieser Bericht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> erstellt. Die dargelegten Aktivitäten in Forschung, Lehre und Krankenversorgung<br />
unterstreichen die hohe Motivations- und Leistungsbereitschaft aller Kollegen.<br />
Seit mehr als fünf Jahrzehnten versorgt der DRK-<br />
Blutspendedienst die Krankenhäuser und medizinischen<br />
Einrichtungen Baden-Württembergs und Hessen mit<br />
Blutpräparaten. Schon früh suchte der DRK-<br />
Blutspendedienst die Anbindung an universitäre<br />
Einrichtungen zur akademischen Weiterentwicklung der<br />
Transfusionsmedizin in Forschung und Lehre. In den<br />
1980-iger Jahre wurde zur Sicherung der Blutversorgung im<br />
Rhein-Neckar-Gebiet die Blutspendezentrale1 Mannheim<br />
gegründet und damit die bereits 1seit den 1950-iger Jahren<br />
vorhandene Blutbank am Klinikum Mannheim integriert. Ziel<br />
war eine institutionelle Kooperation mit der <strong>Medizinische</strong>n<br />
Fakultät durch Einrichtung eines Lehrstuhls auf dem Gebiet<br />
der Transfusionsmedizin und Immunologie. Dieser wurde<br />
im Jahre 1999 erstmals berufen und in <strong>2002</strong> erfolgte die<br />
Gründung <strong>des</strong> gleichnamigen universitären <strong>Instituts</strong>.<br />
Seither hat sich das Institut in Forschung und Lehre rasant<br />
entwickelt und es erfolgte der Aufbau vielfältiger Kooperationen auf Grundlage einer solide in<br />
der Krankenversorgung verankerten transfusionsmedizinischen Einrichtung. Dieser Erfolg<br />
wäre nicht möglich gewesen ohne den engagierten Einsatz aller Mitarbeiter. Diese haben<br />
sich vorbildlich für eine umfassende, jederzeitige universitäre Transfusionsmedizin auf<br />
höchstem Niveau gemeinsam stark gemacht.<br />
Die Entwicklung wäre jedoch ohne Unterstützung von außen nicht möglich gewesen. Mein<br />
besonderer Dank gilt <strong>des</strong>halb allen Kooperationspartnern an der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät<br />
Mannheim, an der Universität Heidelberg, am Deutschen Krebsforschungszentrum, an der<br />
Hochschule Mannheim und an nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen. Die<br />
Vielzahl der Projekte wäre nicht realisierbar gewesen ohne die nachhaltige Unterstützung<br />
durch die Geschäftsführung <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg - Hessen und<br />
durch die Kooperation mit den Instituten in Frankfurt, Ulm und Baden-Baden. Nicht zuletzt<br />
danken wir der Universität Heidelberg, dem Bun<strong>des</strong>ministerium für Bildung und Forschung,<br />
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Europäischen Union, der Josè-Carreras<br />
Leukämie-Stiftung, der Bill und Melinda Gates-Stiftung und der forschenden Industrie für die<br />
finanzielle Unterstützung im Rahmen der vielfältigen wissenschaftlichen Kooperationen..<br />
Mannheim, im April 2012<br />
Prof. Dr. Harald Klüter<br />
Direktor <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für<br />
Transfusionsmedizin und Immunologie<br />
1
Die Standorte_______________________________________________________________<br />
2 Die Standorte<br />
2.1 Friedrich-Ebert-Strasse <strong>10</strong>7: Blutspendezentrale<br />
Das Institut in Mannheim versorgt das Universitätsklinikum Mannheim in allen<br />
transfusionsmedizinischen Belangen sowie über 25 Krankenhäuser im Norden Baden-<br />
Württembergs und im Rhein-Neckar-Raum mit Blutprodukten. Der Hauptstandort <strong>des</strong><br />
<strong>Instituts</strong> ist die Blutspendezentrale in der Friedrich-Ebert-Strasse <strong>10</strong>7. Hier werden alle<br />
gängigen Verfahren der Blut- und Plasmaspende, einschließlich Blutstammzellgewinnung<br />
und Eigenblutspende angeboten.<br />
Am Institut wurden ein GMP-Reinraum sowie neue Laborräume eingerichtet. Hier finden sich<br />
aich ein Großteil der Laborräume und der Forschungslabore. Die Forschungsschwerpunkte<br />
umfassen die Zell- und Immuntherapie, die Thrombozytenimmunologie, sowie die Sicherheit<br />
der Hämotherapie.<br />
2
Die Standorte_______________________________________________________________<br />
2.2 Blutbank<br />
Die Blutbank ist zentral im Bereich <strong>des</strong> Gelän<strong>des</strong> der Universitätsmedizin Mannheim<br />
Der Laborbereich der immunhämatologischen Diagnostik befindet sich seit dem Jahr 2001<br />
komplett auf dem Gelände <strong>des</strong> Universitätsklinikums Mannheim, nachdem im genannten<br />
Jahr auch das immunhämatologische Referenzlabor vom Institut Mannheim auf das<br />
Klinikgelände umgezogen ist. Gemeinsam mit dem Bereich der Thrombozytenimmunologie,<br />
der 2004 ins Universitätsklinikum Mannheim verlagert wurde, befinden sich unsere Labore<br />
somit in der unmittelbaren Nähe zu allen Bettenstationen, den Ambulanzbereichen sowie der<br />
Notaufnahme und bilden zusammen eine Einheit.<br />
Im kommenden Jahr steht im Rahmen der Fertigstellung <strong>des</strong> Neubaus <strong>des</strong> OP-Traktes und<br />
<strong>des</strong> anschließenden Umbaus der Notaufnahme in Haus 2 ein vorübergehender Wechsel der<br />
Räumlichkeiten der Blutbank in Haus 26 an. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Blutbank<br />
wieder an ihren ursprünglichen Platz in Haus 2 zurückkehren, so dass sich dann die<br />
Einrichtungen der Notfallversorgung inklusive OP-Trakt und Notaufnahme in enger<br />
räumlicher Nähe befinden werden.<br />
3
Die Standorte_______________________________________________________________<br />
2.3 Centrum für Biomedizin und Medizintechnik Mannheim (CBTM)<br />
2006 erfolgte durch die Einrichtung <strong>des</strong> Reformstudiengangs MaReCuM die Umwandlung in<br />
die Vollfakultät <strong>Medizinische</strong> Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. In diesem Zuge<br />
wurde 2008 das Forschungszentrum „Centrum für Biomedizin und Medizintechnik Mannheim<br />
(CBTM)“ von den ersten Arbeitsgruppen der vorklinischen Professoren, Stiftungsprofessoren<br />
und kooptierten klinikassoziierten Arbeitsgruppen bezogen. Die <strong>Medizinische</strong> Fakultät<br />
Mannheim konzipierte das Novum, die klassischen vorklinischen Disziplinen Anatomie,<br />
Physiologie und Biochemie im CBTM als übergreifende interdisziplinäre Forschungsbereiche<br />
zu organisieren. Entsprechend der Schwerpunkte der Fakultät sind im CBTM für die<br />
biomedizinische Grundlagenforschung die Forschungsbereiche Vaskuläre Biologie,<br />
Molekulare Onkologie, Neurobiologie und Medizintechnik repräsentiert.<br />
Die etwa 20 Forschergruppen werden unterstützt durch ein umfangreiches Netz von Core<br />
Facilities, unter anderem die Flow Core, die durch das Institut für Transfusionsmedizin und<br />
Immunologie etabliert wurde und durch Frau PD Dr. Karen Bieback geleitet wird (siehe<br />
unten).<br />
2.3.1 Forschungslabore in den Räumen <strong>des</strong> CBTM<br />
Dem Forschungsbereich Zell- und Immuntherapie stehen in der Ludolf-Krehl Str. 13- 17 zwei<br />
Forschungslabore zur Verfügung. Während das erste Labor für Zellkulturarbeiten ausgelegt<br />
ist, können im zweiten Labor molekularbiologische Analysen durchgeführt werden. Hierfür<br />
steht neben konventioneller PCR auch ein Light Cycler 480 für die quantitative PCR zur<br />
Verfügung. Weiterhin ist das Labor ausgestattet für die immunhistochemische, immunfluoreszenz-basierte<br />
und Western-Blot Analytik.<br />
4
Die Standorte_______________________________________________________________<br />
Maximilian Nick, Andrea Hecker, Ursula Kraneburg, Dirk Stobbe,<br />
Cora Ecker, Mandy Schwalbe, Sven Kinzebach<br />
2.3.2 FlowCore Mannheim : Cell Sorting Core Facility<br />
Die Core Facility FlowCore Mannheim wurde 2007 mittels<br />
durch das Institut eingeworbener HBFG-Fördermittel (HBFG<br />
125/698-1 in Höhe von 427.000€) initiiert.<br />
Sie ist Teil <strong>des</strong> Zentrums für Biomedizin und Medizintechnik<br />
Mannheim CBTM und bietet WissenschaftlerInnen die<br />
Möglichkeit zur Zellsortierung (Cell Sorting) sowie zur<br />
Durchführung durchflusszytometrischer Analysen. Die Core<br />
Facility ist mit einem Durchflusszytometer, dem BD FACS Canto II für Analysezwecke, und<br />
dem High Speed Cell Sorter BD FACS Aria I ausgestattet.<br />
5
Die Standorte_______________________________________________________________<br />
Der BD FACS Canto II ist ein mit 2 Lasern ausgestattetes Analysegerät, mit welchem<br />
simultan bis zu 6 Fluorochrome in einem Mehrfarbexperiment gemessen werden können.<br />
Nach einer Einführung durch den Operator der FlowCore Mannheim, können die Nutzer<br />
selbstständig am Gerät arbeiten.<br />
BD FACS Canto II<br />
Der Cell Sorter BD FACS Aria I wird durch den Operator bedient, dadurch ist eine<br />
Terminvereinbarung notwendig.<br />
Das Gerät ist mit 3 Lasern ausgestattet, dadurch ist eine Messung von bis zu 9<br />
Fluorochromen gleichzeitig in einem Mehrfarbexperiment möglich. Es können bis zu 20.000<br />
Zellen pro Sekunde sortiert werden. In einem Sortiervorgang können bis zu 4 Populationen<br />
sortiert oder Lochplatten beschickt werden. Cell Sorting dient der Anreicherung von Zellen,<br />
für weitere Experimente oder als Vorbereitung für Klonierung durch Einzelzellablage. Durch<br />
aseptisches Sortieren können die Zellen in Kultur gebracht werden.<br />
BD FACS Aria I<br />
Melanie Grassl, Stefanie Uhlig<br />
Die Core Facility Mannheim hilft bei der Planung und Durchführung von Experimenten sowie<br />
bei der Analyse der erhaltenen Daten.<br />
http://www.ma.uni-heidelberg.de/ag/cf_facs/index.html<br />
6
Forschung_________________________________________________________________<br />
3 Forschung<br />
3.1 Die Forschungsschwerpunkte<br />
Die Forschungsaktivitäten <strong>des</strong> Institutes sind aufgegliedert in drei Schwerpunktthemen:<br />
• Zell- und Immuntherapie<br />
• Thrombozyten-Immunologie<br />
• Sicherheit der Hämotherapie<br />
In den Forschungsschwerpunkt Zell- und Immuntherapie fallen die Aktivitäten der<br />
Arbeitsgruppe um Frau PD Dr. Karen Bieback, die <strong>2002</strong> als PostDoc in der Arbeitsgruppe<br />
von Herrn Professor Dr. Hermann Eichler begonnen und diese 2005 übernommen hat.<br />
Forschungsprojekte von Dr. Nguyen und Dr. Dugrillon fallen ebenfalls in diesen Bereich. Seit<br />
2009 ergänzen auch Projekte von Dr. Gero Hütter diesen Forschungsbreich.<br />
Der Forschungsbereich Thrombozyten-Immunologie wird durch Herrn Professor Dr. Peter<br />
Bugert geleitet.<br />
Der Forschungsbereich Sicherheit der Hämotherapie umfasst Projekte die geleitet werden<br />
durch Frau PD Dr. Karin Janetzko und Herrn PD Dr. Michael Müller-Steinhardt.<br />
3.1.1 Zell- und Immuntherapie<br />
Arbeitsgruppe Karen Bieback<br />
Die Arbeitsgruppe fokussiert sich auf die Untersuchung<br />
von unterschiedlichen humanen Stamm- und<br />
Vorläuferzellpopulationen. Wir untersuchen insbesondere<br />
hämatopoetische, endotheliale und mesenchymale<br />
Stamm- bzw. Vorläuferzellen aus Nabelschnurblut,<br />
Knochenmark und Lipoaspirat.<br />
Mesenchymale Stammzellen (MSC) sind adulte<br />
Stammzellen und können aus unterschiedlichen Geweben<br />
gewonnen werden. Sie sind multipotent, unterstützen die<br />
Hämatopoese, sind nicht immunogen und weisen ausgeprägte immunregulatorische<br />
Aktivitäten auf. Darüber hinaus belegen neuere Daten, dass MSC eine Vielzahl proregenerativer<br />
Faktoren sezernieren.<br />
Die ursprünglichste und am besten charakterisierte Quelle für MSC ist Knochenmark (bone<br />
marrow, BM). Neuere und weniger gut charakterisierte alternative Quellen sind z. B.<br />
Nabelschnurblut (cord blood, CB) und Fettgewebe (adipose tissue, AT). Zentrales Thema<br />
7
Forschung_________________________________________________________________<br />
<strong>des</strong> Projektes ist die vergleichende Analyse der MSC aus den drei unterschiedlichen<br />
Quellen. Hierbei werden z.B. Profile der Gen- und Proteinexpression undifferenzierter MSC<br />
erstellt, um idealerweise einen Marker identifizieren zu können, der die prospektive Isolation<br />
von MSC erlaubt.<br />
Die Sicherheit der Therapie mit MSC ist ein weiterer wichtiger Punkt unserer Analysen.<br />
Daher wurden in den vergangenen Jahren sensitive Testsysteme entwickelt, um z. B. eine<br />
Kontamination mit Mykoplasmen im Verlauf der Expansionskultur zu überprüfen. Darüber<br />
hinaus analysieren wir derzeit, ob die Langzeitkultur negative Effekte auf die Qualität der<br />
MSC hat. Daher überprüfen wir das Seneszenzverhalten, die Verkürzung der Telomerlängen<br />
und die mögliche Expression von Telomerase als Anzeichen einer spontanen<br />
Transformation/Immortalisierung der Zellen in Kultur.<br />
Mesenchymale Stammzellen verfügen über ein weites Differenzierungspotential.<br />
Daher sind sie attraktive Kandidaten für zell-basierte Ansätze insbesondere <strong>des</strong> Tissue Engineerings.<br />
Die Sicherheit der Therapie mit MSC ist ein weiterer wichtiger Punkt unserer Analysen.<br />
Daher wurden in den vergangenen Jahren sensitive Testsysteme entwickelt, um z.B. eine<br />
Kontamination mit Mykoplasmen zu überprüfen. Darüber hinaus analysieren wir derzeit, ob<br />
die Langzeitkultur negative Effekte auf die Qualität der MSC hat.<br />
In den vergangenen Jahren konnten wir feststellen, dass sich MSC aus Knochenmark,<br />
Fettgewebe und Nabelschnurblut funktionell relativ wenig unterscheiden. Sie zeichnen sich<br />
durch Expansions- und Differenzierungsfähigkeit aus. Unterschiedlich sind jedoch die<br />
Frequenzen der MSC in den einzelnen Geweben. Lipoaspirat, basierend auf unseren<br />
Erfahrungen, enthält MSC in höchster Frequenz, gefolgt von Knochenmark und weit<br />
abgeschlagen von Nabelschnurblut. Nabelschnurblut-MSC fallen weiterhin auf durch ein<br />
fehlen<strong>des</strong>, bis stark eingeschränktes adipogenes Differenzierungspotential. Molekulare<br />
8
Forschung_________________________________________________________________<br />
Analysen deuten darauf hin, dass hier ein essentieller Schritt in der Differenzierungskaskade<br />
blockiert scheint und dass das Nabelschnurblutplasma hier eine inhibitorische Funktion<br />
übernimmt.<br />
Unterstützt durch Kooperationspartner (Dr. U. Gößler, HNO-Klinik der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät<br />
Mannheim und Dr. C. Götting <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, Herz<br />
und Diabeteszentrum NRW, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bad<br />
Oeynhausen) konnten wir Einblicke in der Regulation der chondrogenen<br />
Differenzierungskaskade gewinnen.<br />
In einem Kooperationsprojekt mit der Augenklinik <strong>des</strong> Universitätsklinikums Mannheim (Dr.<br />
S. Kühl, Dr. U. Voßmerbäumer) entwickelten wir Protokolle, die eine gerichtete<br />
Differenzierung humaner MSC aus dem Lipoaspirat in retinales Pigmentepitehl erlauben.<br />
Diese Zellen sind als Folge der altersbedingten Makuladegeneration nicht mehr<br />
funktionsfähig, so dass die Patienten erblinden.<br />
9
Forschung_________________________________________________________________<br />
Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter, Doktoranden, Diplomanden und Masterstudenten<br />
der Arbeitsgruppe Bieback<br />
Andrea Hecker<br />
Anne Klein<br />
Asli Kocaömer<br />
Birthe Lauer<br />
Charlotte Kleinmann<br />
Christian Kessler<br />
Cora Ecker<br />
Dirk Hofmeister<br />
Dirk Stobbe<br />
Florian Lorenz<br />
Irena Brinkmann<br />
Johann Teplygin<br />
Katja Kraushaar<br />
Katrin Ferlik<br />
Lena Dreher<br />
Mandy Schwalbe<br />
Marianna Karagianni<br />
Matheus Cieszynski<br />
Matthias Vogg<br />
Maximilian Nick<br />
Melanie Grassl<br />
Mina Zeinali<br />
Minna Hapalahti<br />
Stephan Gerodez<br />
Stefanie Uhlig<br />
Susanne Elvers-Hornung<br />
Susanne Kern<br />
Sven Kinzebach<br />
Torsten J. Schulze<br />
Ursula Kraneburg<br />
Viet Anh Thu Ha<br />
<strong>10</strong>
Forschung_________________________________________________________________<br />
Susanne Elvers-Hornung, Matthias Vogg, Viet Anh-Thu Ha, Marianna Karagianni, Johann Teplygin,<br />
Mara Vinci, Peter Vajkoczy, Monika Latta, Gabi Rink, Michael Korbus, Birthe Lauer, Sandra Kühl,<br />
Susanne Kern, Karen Bieback, Andrea Hecker, Melanie Grassl, Mandy Schwalbe, Irena Brinkmann,<br />
Sven Kinzebach, Cora Ecker, Stefanie Uhlig<br />
11
Forschung_________________________________________________________________<br />
Asli Kocaömer, Stefan Gerodez, Christian Kessler, Zhenia, Harald Klüter, Peter Bugert, Kathrin Ferlik,<br />
Marie Goldner, Steffi Brechtel<br />
12
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Humane Alternativen für die Kultur von mesenchymalen<br />
stromalen Zellen<br />
Im Hinblick auf die therapeutische/klinische Anwendung von MSC spielt der Zusatz<br />
im Medium eine wichtige Rolle. In den meisten Protokollen wird fetales Kälberserum (FCS)<br />
dem Kulturmedium zugesetzt. FCS stellt jedoch ein potentielles Risiko für Infektionen und<br />
immunologische Reaktionen dar und wird daher von den regulatorischen Aufsichtsbehörden<br />
als kritisch eingestuft. Aus diesem Grund entwickelten wir standardisierte Isolations- und<br />
Expansionsprotokolle für MSC aus verschiedenen Quellen/Geweben, welche kein FCS<br />
beinhalten und somit eine Good Manufacturing Practice (GMP) konforme Produktion<br />
ermöglichen.<br />
Als geeignete Alternativen zu FCS haben wir humane, aus Blutspenden gewonnene<br />
Faktoren wie Serum oder Thrombozyten ausgewählt und deren Wirkung auf MSC getestet.<br />
Für MSC aus Lipoaspirat erwies sich gepooltes humanes Serum der Blutgruppe AB (HS) als<br />
beste Alternative zu FCS. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei MSC aus Knochenmark<br />
gepooltes humanes Thrombozytenlysat (phPL) als guter Ersatz zu FCS (Bieback/Hecker et<br />
al). Interessanterweise ergaben unterschiedliche Präparationstechniken, um die<br />
Wachstumsfaktoren aus den Thrombozyten frei zu setzen, biologisch sehr unterschiedliche<br />
Ergebnisse: Thrombin-aktiviertes Plättchenreleasat in Plasma (tPRP) hatte deutlich<br />
geringere proliferationsfördernde Wirkung auf MSC aus Knochenmark, als das über<br />
Einfrieren/Auftauen generierte Plättchenlysat pHPL.<br />
Obwohl MSC, die mit alternativen Zusätzen kultiviert wurden, keine veränderten Qualitäten<br />
aufwiesen, zeigten sich dennoch Unterschiede in Bezug auf die Morphologie und Adhäsion.<br />
Eine differentielle Genexpressionsanalyse mit Hilfe der Microarray Technologie ergab, dass<br />
von 34.039 Genen <strong>10</strong>2 Gene differentiell exprimiert<br />
wurden. Davon zeigten allein 90 Gene aus den Gruppen<br />
„Zellentwicklung und Differenzierung“, „Extrazelluläre<br />
Matrix, Adhäsion und Migration“ und<br />
„Signaltransduktion, Zell-Zell-Interaktion“ in FCS eine<br />
höhere Expression im Vergleich zu HS oder tPRP.<br />
Im Hinblick auf die genetische Stabilität der Zellen<br />
konnten wir zeigen, dass eine Langzeitkultur der MSC in<br />
HS keine negativen Effekte auf die Qualität hat, im<br />
Vergleich zu MSC die mit FCS kultiviert wurden. Auch<br />
ein Risiko der malignen Entartung konnten wir in<br />
unseren Versuchen ausschließen.<br />
13
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Differenzierung von MSC in Adipozyten, Osteozyten und<br />
Chondrozyten - Etablierung von qualitativen und quantitativen Nachweismethoden<br />
Mesenchymale stromale Zellen zeichnen sich neben der Plastikadhärenz, einem<br />
speziellen Immunphänotyp (Expression von CD73, CD90 und CD<strong>10</strong>5 und fehlender<br />
Expression der hämatopoetischen Marker CD3, CD19, CD45 und HLA-DR) dadurch aus,<br />
dass sie in min<strong>des</strong>tens die drei Linien Knochen, Knorpel und Fett differenzierbar sind.<br />
Lediglich MSC aus Nabelschnurblut scheint die Kapazität in Adipozyten, d.h. Fettgewebe zu<br />
differenzieren zu fehlen.<br />
Da die Fähigkeit der MSC in verschiedene mesoderme Gewebe zu differenzieren als eines<br />
der bedeutendsten Qualitätsmerkmale gilt, haben wir verschiedene Testsysteme entwickelt,<br />
um den Erfolg einer Differenzierung nachzuweisen. Es ist notwendig die Differenzierbarkeit<br />
qualitativ und quantitativ untersuchen zu können. Die Stimulierung der Adipogenese und der<br />
Osteogenese findet durch spezielle Differenzierungsmedien in einer Monolayerkultur statt.<br />
Die chondrogene Differenzierung erfolgt mit Differenzierungsmedium als Mikromassenkultur<br />
im 15ml Falcon-Röhrchen. Standardmäßig wird der Erfolg der Differenzierung mit<br />
histochemischen Färbungen überprüft. Klassisch wird das adipogene Potential von MSC<br />
nach Induktion über das Sichtbarmachen von Fettvakuolen mittels Ölrot nachgewiesen. Die<br />
osteogene Differenzierung wird deutlich, wenn man Calciumphosphat über die von Kossa-<br />
Färbung nachweist. In der sogenannten Micomassenkultur entstehen unter geeigneten<br />
Bedingungen Mini-Knorpel, bei denen der Cryoschnitt eine rot-orange Safranin-O Färbung<br />
zeigt.<br />
A<br />
B<br />
C<br />
A: von Kossa Färbung nach osteogener Differenzierung, Calciumphosphat ist schwarz gefärbt. B:<br />
Ölrot färbt die Fettvakuolen rot an. C: Safranin O färbt die bei der Chondrogenese entstanden<br />
Proteoglykane orange.<br />
Ein Nachteil der histochemischen Färbungen ist die rein qualitative Aussage. Unterschiede<br />
im Differenzierungspotentialzwischen MSC aus versiedenen Quellen oder von<br />
verschiedenen Spendern lassen sich nicht eindeutig erkennen. Ergänzend haben wir daher<br />
quantitative Nachweissysteme etabliert. Osteogen induzierte MSC werden lysiert und mittels<br />
Photometrie der Calciumgehalt bestimmt. Als Nachweis für die Adipogenese lysieren wir<br />
MSC und bestimmen den Triglyzeridgehalt am Photometer.<br />
14
Forschung_________________________________________________________________<br />
A<br />
4,5<br />
4<br />
CALCIUM<br />
LA 22 FCS p1<br />
induced<br />
B<br />
<strong>10</strong>0<br />
90<br />
Triglyzeride<br />
LA22 FCS p1<br />
induced<br />
mg/dl<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
LA 22 FCS<br />
LA 22 FCS<br />
p1uninduced<br />
LA 22 FCS p4<br />
induced<br />
LA 22 FCS p4<br />
uninduced<br />
LA 22 FCS p7<br />
induced<br />
LA 22 FCS p7<br />
uninduced<br />
mg/dl<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
<strong>10</strong><br />
0<br />
LA22 FCS<br />
LA22 FCS p1<br />
uninduced<br />
LA22 FCS p4<br />
induced<br />
LA22 FCS p4<br />
uninduced<br />
LA22 FCS p7<br />
induced<br />
LA22 FCS p7<br />
uninduced<br />
Grafik A zeigt die Calciumkonzentration in mg/dl, hellblau dargestellt sind die induzierten MSC,<br />
dunkelblau dargestellt sind die entsprechenden nicht differenzierten MSC. Grafik B zeigt den<br />
Triglyzerid-Gehalt in mg/dl, die hellblauen Balken zeigen die TG- Menge adipogen induzierter<br />
Zellen, die dunkelblauen Balken entsprechen den nicht differenzierten MSC.<br />
Das Vorhandensein bedeutender Differenzierungsproteine können wir mit<br />
immunhistochemischen Färbungen zeigen.<br />
A B C<br />
:<br />
A: Färbung zeigt in grün die Perilipin-Expression um die Fettvakuolen von adipogen differenzierten<br />
MSC; Kerne sind in blau gegen gefärbt; B: Aggrecan-Expression in rot zum Nachweis der<br />
chondrogenen Differenzierung, Kerne sind in blau zu sehen; C: Nachweis von Collagen II in<br />
chondrogen induzierten MSC, Kerne in blau dargestellt.<br />
Entsprechend wurde die Expression der Differenzierungsmarker auf mRNA-Ebene mit RTqPCR<br />
nachgewiesen.<br />
A<br />
osteogene Differenzierung<br />
B<br />
adipogene Differenzierung<br />
20<br />
7<br />
18<br />
16<br />
6<br />
relative expression<br />
14<br />
12<br />
<strong>10</strong><br />
8<br />
6<br />
relative Expression<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
4<br />
2<br />
0<br />
OCAL<br />
OPON<br />
1<br />
0<br />
ADFP PPARy ADPQ Perilipin<br />
A: relative Expression osteogener Marker in verschiedenen Spendern, Osteocalcin (OCAL) und<br />
Osteopontin (OPON). B: Adipophillin- (ADFP), PPARy-, Adiponectin- (ADPQ) und Perilipin-Expression<br />
in adipogen induzierten MSC.<br />
15
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Genexpressionsprofil und Engraftment-Kapazität kryokonservierter<br />
hämatopoetischer Stammzellen aus GMP-konform prozessierten<br />
Nabelschnurblut-Transplantaten<br />
Gefördert durch die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.<br />
Der klinische Erfolg bei der Anwendung von hämatopoetischen Stammzell-Transplantaten<br />
aus Nabelschnurblut (synonym: Plazentarestblut) wird unter anderem ganz wesentlich von<br />
der Qualität <strong>des</strong> Transplantates beeinflusst. Dabei können sich verschiedenste Faktoren<br />
während der Sammlung, Volumenreduzierung und der nach dem Auftauen erforderlichen<br />
Prozessierung auf die klinische Wirksamkeit <strong>des</strong> Präparates auswirken. Optimierte<br />
Prozessierungstechniken der getauten Zellsuspension stellen daher eine<br />
Grundvoraussetzung für weitergehende Manipulationen der hämatopoetischen Zellen dar,<br />
wie etwa die Durchführung von Protokollen zur ex vivo-Expansion.<br />
Die Entwicklung von Methoden zur Isolierung von CD34+ Zellen aus volumenreduzierten,<br />
kryokonservierten Nabelschnurblut-Transplantaten für eine nachfolgende Weiterverarbeitung<br />
wird aktuell intensiv beforscht. Dennoch sind die bislang publizierten Daten über die<br />
Auswirkungen einer Prozessierung kryokonservierter Stammzell-Präparate aus<br />
Plazentarestblut noch sehr lückenhaft und teilweise widersprüchlich. Da Plazentarestblut<br />
eine limitierte absolute Zahl an transplantierbaren Stammzellen enthält, ist es für die<br />
Anwendung bei erwachsenen Patienten zudem essentiell, ein verbessertes Engraftment-<br />
Verhalten von Plazentarestblut-Transplantaten nach Übertragung auf den Patienten zu<br />
erreichen. Eines der Ziele <strong>des</strong> bearbeiteten Projekts bestand somit darin, ein verbessertes<br />
Engraftment der hämatopoetischen Stammzellen durch die Cotransplantation mit<br />
mesenchymal stromalen Zellen zu untersuchen.<br />
Im ersten Teilprojekt, bearbeitet von Stephan Gerodez, wurden die Auswirkung GMPkonformer<br />
Präparationstechniken auf den Gehalt sehr unreifer Blutstammzellen, der SCIDrepopulierenden<br />
Zellen, bei getauten Nabelschnurblut-Transplantaten quantitativ bestimmt.<br />
Insgesamt wurden die Ergebnisse zwar durch eine nicht voll befriedigende Reinheit der<br />
selektierten CD34+ Zellpopulation beeinflusst; dennoch zeichnet sich ab, dass eine<br />
Immunselektion hämatopoetischer Stammzellen aus getauten Nabelschnurblut-<br />
Transplantaten prinzipiell zu einer Abreicherung SCID-repopulierender Zellen und damit zu<br />
einer Beeinträchtigung <strong>des</strong> Engaftmentpotentials führt.<br />
Im zweiten Teilprojekt wurde von Ayse Günaydin untersucht, ob sich das<br />
Genexpressionsprofil von CD34+ Zellen nach einer ex vivo-Expansionskultur von dem Profil<br />
nicht-expandierter CD34+ Zellen unterscheidet. Eine Expansion zielt darauf ab, den<br />
Gesamtgehalt <strong>des</strong> Transplantats an frühen Vorläuferzellen zu vermehren, um so ein<br />
16
Forschung_________________________________________________________________<br />
schnelleres Anwachsen sowie und eine rasche Rekonstitution <strong>des</strong> hämatopoetischen<br />
Systems zu erreichen. Im Rahmen unserer Experimente<br />
konnte durch die Erstellung eines vergleichenden<br />
Genexpressionsprofils von CD34+ Zellen vor und nach<br />
einer definierten Expansionskultur eine Aktivierung<br />
metabolischer Prozesse in den Zellen nachgewiesen<br />
werden, wobei unter anderem Zellzyklus-assoziierte Gene<br />
unter den Expansionsbedingungen hochreguliert werden.<br />
Zudem zeigte sich die mRNA solcher Gene als verstärkt<br />
exprimiert, die eine Rolle bei der hämatopoetischen Differenzierung der expandierten<br />
Stammzellen spielen. Diese Daten auf der Ebene der Genexpression deuten darauf hin,<br />
dass durch sich mit Hilfe der verwendeten Expansionskultur die Stammzellen tatsächlich in<br />
Vorläuferzellen differenzieren lassen, die bereits einer hämatopoetischen Linie zugeordnet<br />
sind.<br />
Im dritten Teilprojekt, bearbeitet durch Christian Kessler, sind wir der Frage nachgegangen,<br />
ob das Engraftmentpotential hämatopoetischer Stammzellen aus Nabelschnurblut durch eine<br />
Cotransplantation syngener mesenchymal stromaler Zellen positiv beeinflusst werden kann.<br />
Während einige Publikationen zeigen, das MSC aus allogenem Knochenmark oder fetalem<br />
Lungengewebe tatsächlich einen supportiven Einfluss auf das hämatopoetische Engraftment<br />
ausüben, konnten wir dies für aus syngenem Nabelschnurblut isolierte MCSs nicht<br />
bestätigen. Allerdings zeigte sich in den von uns durchgeführten Experimenten eine<br />
erhebliche Streuung der Engraftment-Rate zwischen den einzelnen Experimenten. Daher<br />
müssen weiterführende Untersuchungen klären, ob sich Nabelschnurblut-MSC in dieser<br />
Eigenschaft tatsächlich signifikant von MSC aus humanem Knochenmark unterscheiden.<br />
Forschungsprojekt: OSTEOCORD Bone from Blood: Optimised isolation,<br />
characterisation and osteogenic induction of mesenchymal stem cells from umbilical<br />
cord blood<br />
Gefördert durch das 6. Rahmenprogramm der EU<br />
Für die Heilung ausgedehnter Knochendefekte stellt das Tissue Engineering einen<br />
erfolgversprechenden Ansatz dar. Die für das Tissue Engineering von Knochen<br />
einzusetzenden Zellen sollten neben ihrer Immunkompatibilität einfach und in ausreichenden<br />
Mengen isolierbar, sowie in der Lage sein, den osteogenen Phänotyp auszubilden. Aufgrund<br />
ihres Differenzierungspotenzials sowie der im Gegensatz zu bereits differenzierten Zellen<br />
(Osteoblasten) hohen Proliferationskapazität in vitro sind mesenchymale Stammzellen<br />
(MSC) für diesen Ansatz attraktiver. Ziel <strong>des</strong> von der europäischen Union geförderten<br />
17
Forschung_________________________________________________________________<br />
Verbundprojektes, ist es mesenchymale Stammzellen (MSC) aus dem humanen<br />
Nabelschnurblut zu isolieren, zu expandieren und insbesondere ihr osteogenes<br />
Differenzierungspotential zu evaluieren, um ihre Eignung für den therapeutischen<br />
Knochenersatz zu evaluieren.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Konsortiums wurden verschiedene Projekte verfolgt: 1. Die Etablierung einer<br />
Nabelschnurblut-MSC Bank, um Zellen in ausreichender und definierter Qualität und<br />
Quantität den Verbundpartner zur Verfügung zu stellen. Der erste Anspruch war hier,<br />
ausreichend MSC-Kulturen aus Nabelschnurblut zu etablieren. Dies wird durch die äußerst<br />
geringe Frequenz von MSC im Nabelschnurblut limitiert. Von etablierten Kulturen wurde eine<br />
Master- und Working Zellbank etabliert, bei der wenige Aliquots der MSC in früher Passage<br />
kryokonserviert wurden. Anschließend erfolgte eine Qualitätskontrolle: Sterilität, Phänotyp,<br />
Immunphänotyp, Expansionspotential und Differenzierungspotential in die adipo- und<br />
osteogene Linie. Zellen der Working Zellbank wurden den Partnern für weiterführende<br />
Experimente zur Verfügung gestellt. Als Kontrollen wurden auch MSC aus Knochenmark und<br />
Lipoaspirat verschickt, die ebenfalls in Form einer Zellbank archiviert vorliegen.<br />
2. Mesenchymale Stammzellen werden als hypoimmunogen und immunsuppressiv<br />
beschrieben. Dies impliziert, dass MSC möglicherweise ohne Immunsuppression allogen<br />
transplantiert werden können. Wir haben Methoden etabliert, um die immunsuppressive<br />
Wirkung von MSC auf die mitogen-stimulierte Proliferation von T-Zellen quantitativ zu<br />
untersuchen. Hierfür wurde die T-Zellproliferation mittels Phytohämagglutinin stimuliert. In<br />
Anwesenheit von MSC ist die Proliferation jedoch dosisabhängig deutlich reduziert, einen<br />
immunsuppressiven Effekt der MSC belegend.<br />
3. Der translationelle Ansatz <strong>des</strong> Projektes beinhaltet auch scale-up Prozeduren und die<br />
Etablierung GMP-konformer Herstellungsprozesse. In einem ersten Schritt wurden SOPs für<br />
die Isolation und Expansion von MSC erstellt. In einem zweiten Schritt erfolgte die<br />
Evaluierung FCS-freier Expansionsmedien supplementiert durch humane alternative<br />
Komponenten (siehe separates Kapitel).<br />
18
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Standardisierung für die Regenerative Medizin (START- MSC 1 +<br />
2): Etablierung einer Stammzellbank mesenchymaler Stammzellen aus<br />
Nabelschnurblut und Entwicklung GMP-konformer Prozessierungstechniken<br />
Gefördert durch das Bun<strong>des</strong>ministerium für Bildung und Forschung<br />
H. Klüter, A.D. Ho, H. Lannert, N. Brousos, A.M. Müller, G. Bruder, K. Bieback,<br />
A.Hecker, W. Franke, M. Karagianni, N. Ma, D. Besser, T. Redmer<br />
Das Fehlen international gültiger Standards und Protokollen, die der „Guten<br />
Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Practice, GMP) entsprechen, erscheint als die<br />
größte Hürde bei der Umsetzung experimenteller Ergebnisse in klinische Applikationen.<br />
Daher ist es das Ziel <strong>des</strong> Konsortiums START-MSC Standards und Richtlinien zu definieren,<br />
die erstens eine standardisierte Gewinnung von MSC und daraus abgeleiteter Hepatozyten<br />
und Kardiomyozyten ermöglichen und zweitens eine systematische Charakterisierung dieser<br />
Zellen im Vergleich zu MSC aus Knochenmark und reifen Hepatozyten und Kardiomyozyten<br />
erlauben.<br />
Um diese Ziele zu erreichen, wurde eine Stammzellbank aus Nabelschnurblut (cord blood,<br />
CB) abgeleiteten MSC aufgebaut. Die Grundlage hierfür ist eine standardisierte Isolation,<br />
Expansion und Qualitätskontrolle dieser Zellen. Anschließend wurden sie in Kooperation mit<br />
den Verbundpartnern im Vergleich mit MSC aus Knochenmark und Fettgewebe systematisch<br />
charakterisiert.<br />
19
Forschung_________________________________________________________________<br />
Die klinische Relevanz und die Perspektive einer klinischen Anwendbarkeit erfordert die<br />
Entwicklung standardisierter und validierter Protokolle. Da es derzeit weltweit jedoch kein<br />
etabliertes, validiertes robustes System für die Isolation und Expansion von MSC gibt, das<br />
frei ist von bovinem Serum (FBS), wurde eine Vielzahl humaner Blutprodukt-abgeleiteter<br />
Komponenten auf Ihre Eignung, MSC zu isolieren und zu expandieren, untersucht. Der<br />
Ersatz xenogener Faktoren, insbesondere <strong>des</strong> FBS, sehen wir als eine Grundvoraussetzung<br />
für eine zukünftige klinische Anwendung gemäß internationaler GMP-Standards an.<br />
Basierend auf den Vorarbeiten <strong>des</strong> ersten Verbundprojektes, wird auch in der zweiten<br />
Förderperiode das Ziel verfolgt, Standards und Richtlinien zu definieren, die erstens auf einer<br />
systematischen Charakterisierung dieser Zellen, gewonnen aus unterschiedlichen Geweben,<br />
und Vergleichen mit pluripotenten Stammzellen (iP-MSC) basieren und zweitens eine<br />
standardisierte Produktion von MSC ermöglichen. Wie bereits in der ersten Förderperiode,<br />
werden MSC aus Knochenmark (BM), Lipoaspirat (AT) und Nabelschnurblut (CB) mittels<br />
standardisierter Protokolle isoliert, expandiert und grundlegend charakterisiert. Diese Zellen<br />
werden den Beteiligten zur weiterführenden Charakterisierung zur Verfügung gestellt.<br />
In einem weiteren Projekt werden die molekularen Grundlagen für die beobachteten<br />
Unterschiede im Differenzierungspotential von CB-MSC und AT/BM-MSC näher untersucht.<br />
Die Vorarbeiten zeigten ein verstärktes osteogenes, aber stark reduziertes adipogenes<br />
Differenzierungspotential der CB-MSC. Mitursächlich scheint die Expression <strong>des</strong><br />
Adipogenese inhibierenden Faktors Pref-1 (Preadipocyte Factor 1), der in CB-MSC verstärkt<br />
exprimiert ist.<br />
Aufbauend auf den Vorarbeiten werden im dritten Projekt GMP-konforme<br />
Prozessierungstechniken weiter optimiert. Hier werden auch iP-MSC und MSC-<br />
Untergruppen berücksichtigt. Die Optimierung der Prozessierungsschritte beinhaltet die<br />
Entnahme der Gewebe, die Isolation der MSC, die Expansion der MSC mit alternativen<br />
Supplementen zu fötalem Kälberserum, Kryokonservierung und die Optimierung und<br />
Standardisierung von Qualitätskontrolluntersuchungen.<br />
Für die Stammzellbank wurden MSC unter standardisierten Bedingungen aus humanem<br />
Nabelschnurblut isoliert, expandiert und grundlegend charakterisiert. Im Rahmen der<br />
Qualitätskontrolle erfolgte eine durchflusszytometrische Charakterisierung der<br />
Markerexpression, um eine Kontamination mit hämatopoetischen und/oder endothelialen<br />
Zellen auszuschließen. Das Differenzierungspotential wurde anhand von in vitro<br />
Differenzierungstesten in die osteogene, adipogene und chondrogene Richtung quantifiziert.<br />
Von allen MSC-Chargen erfolgte eine Überprüfung auf Sterilität und Kontrolle auf<br />
Mykoplasmenkontamination. Im Anschluss an die Qualitätsüberprüfung wurden diese Zellen<br />
20
Forschung_________________________________________________________________<br />
kryokonserviert und entsprechende Aliquots wurden den Partnern über den gesamten<br />
Verlauf der Projektphase zur Verfügung gestellt.<br />
Bovines Serum, das derzeit noch als essentielle Komponente von MSC Isolations- und<br />
Expansionsmedien gilt, wurde durch humane alternative Supplemente ersetzt, um<br />
internationalen GMP-Standards konforme Verfahren zur Isolation und Expansion zu<br />
entwickeln. Ergebnisse an MSC aus Lipoaspirat zeigten, dass sowohl humanes Serum als<br />
auch thrombin-aktiviertes plättchenreiches Plasma in der Lage sind, die Isolation und<br />
Expansion von MSC zu gewährleisten. Die Expansion von Lipoaspirat-MSC wurde durch die<br />
alternativen humanen Zusätze gegenüber bovinem Serum als Vergleich sogar signifikant<br />
erhöht, ohne die Differenzierbarkeit zu beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei<br />
MSC aus Knochenmark keine gesteigerte Proliferation. Hier erwiesen sich humanes AB-<br />
Serum und thrombin-aktiviertes plättchenreiches Plasma als gleichwertig zu FCS. Humanes<br />
Plättchenlysat jedoch hatte einen eindeutig wachstumsstimulierenden Effekt, ohne das<br />
Differenzierungspotential zu beeinträchtigen. Dies deutet darauf hin, dass MSC aus<br />
unterschiedlichen Gewebsquellen unterschiedliche Susceptibilität gegenüber<br />
wachstumsfördernden Faktoren zeigen. Diese zu identifizieren wird das Ziel weiterführender<br />
Studien sein.<br />
Forschungsprojekt: CASCADE - Etablierung GMP-konformer Herstellungsprotokolle<br />
für die Isolation und Expansion Mesenchymal Stromaler Zellen<br />
Gefördert durch das 7. Rahmenprogramm der EU<br />
CASCADE „Cultivated Adult Stem Cells as Alternative for Damaged tissuE“ ist ein<br />
Konsortium, gefördert durch das 7. Rahmenprogramm der Europäischen Union. Es verfolgt<br />
das Ziel, Prozesse zu entwickeln, die der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing<br />
Practice, GMP) entsprechen, um Mesenchymale Stromale Zellen (MSCs) für klinische<br />
Anwendungen zu generieren. Diese GMP-produzierten MSC, bzw. daraus abgeleitete<br />
Zellprodukte, werden experimentell auf ihre therapeutische Wirkung in Modellen für Haut und<br />
Cornea-Erkrankungen untersucht. Als Konsortium vernetzt CASCADE öffentliche und private<br />
Institutionen mit kleinen/mittleren Unternehmen und vereint so Expertise und Know-how der<br />
Grundlagen mit translationaler und klinischer Forschung im Bereich Stammzellen und<br />
Zelltherapie.<br />
Ausgehend von etablierten Prozessen werden innerhalb <strong>des</strong> Konsortiums, basierend auf der<br />
Expertise der jeweiligen Partner, innovative Technologien entwickelt. Die Frage, ob MSC für<br />
eine individualisierte Therapie oder aber für mehrere Patienten angewendet werden können,<br />
wird untersucht. Humane MSC werden mittels GMP konformer Techniken aus<br />
21
Forschung_________________________________________________________________<br />
unterschiedlichen Geweben isoliert: Knochenmark, Fettgewebe, Nabelschnurblut und<br />
Amnionmembran. In Mannheim fokussieren wir uns auf Zellen aus menschlichem<br />
Fettgewebe und Nabelschnurblut. Die Zellen werden unter Zusatz von humanen<br />
Blutkomponenten (Serum bzw. Plättchenlysat) kultiviert, um so den xenogenen Zusatz<br />
fetales Kälberserum zu ersetzen. Da der Einfluss dieser Zellkulturzusätze auf die Qualität der<br />
Zellen groß ist, vergleichen wir die funktionellen Eigenschaften der Zellen, um sicher zu<br />
stellen, dass es zu keinen qualitativen Einbussen kommt.<br />
Die biologischen Eigenschaften werden anschließend in vitro und in unterschiedlichen<br />
tierexperimentellen Modellen evaluiert, um auch die immunologischen Konsequenzen einer<br />
Transplantation zu untersuchen. Zusätzlich wird der Aspekt der Produktsicherheit zu einem<br />
zentralen und wichtigen Punkt der Analysen. CASCADE fokussiert darauf, Standards zu<br />
etablieren, die alle relevanten Schritte im MSC-Produktionsprozess kontrollieren, um so die<br />
maximal mögliche Sicherheit bei der klinischen Anwendung zu gewährleisten. In direkter<br />
Kooperation mit klinischen Experten, unter Berücksichtigung der in vitro und in vivo<br />
Ergebnisse, werden die Spezifikationen für MSC als Zelltherapeutika optimiert, um klinische<br />
Protokolle für MSC-basierte Therapien, z. B. in der Wundheilung, zu definieren. Darüber<br />
hinaus erfolgt eine kontinuierliche Reflexion der ethischen und rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen, die bei einer zelltherapeutischen Anwendung zu berücksichtigen sind.<br />
Unsere Arbeitsgruppe verfolgt in diesem Konsortium vor allem das Ziel, die GMP-konforme<br />
Prozessierungstechniken für Fettgewebs-abgeleitete MSC zu etablieren. In diesem<br />
Zusammenhang wurde in mehreren Studien die Eignung humaner Alternativsupplemente<br />
evaluiert, um das xenogene Supplement Kälberserum zu ersetzen. Humane Blutprodukte<br />
eignen sich hier aufgrund der jahrelangen klinischen Erfahrung und der etablierten<br />
Qualitätskontrolle in den Einrichtungen <strong>des</strong> Blutspendedienstes. Wir konnten zeigen, dass<br />
sich gepooltes humanes AB-Serum und gepooltes humanes Plättchenlysat als Supplement<br />
für die Isolation und Expansion von MSC aus Fettgewebe und Knochenmark eignen. Die<br />
bisherigen Untersuchungen zeigen keine gravierenden Effekte auf die Qualität der MSC.<br />
Dies wird noch in weiterführenden Studien detaillierter untersucht um Risiken zu minimieren.<br />
Neben den Zellkulturmedien optimieren wir Entnahme- und Prozessierungstechniken, um<br />
einen GMP-konformen Herstellungsprozess zu etablieren.<br />
22
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Isolation und Charakterisierung endothelialer Vorläuferzellen aus<br />
Nabelschnurblut, Subprojekt <strong>des</strong> Teilprojektes C3 „Analysis of the multistep nature of<br />
homing and incorporation of circulating progenitor cells during tumor angiogenesis“<br />
Gefördert durch die Deutsche Forschungs Gemeinschaft: TR-SFB 23<br />
Das SFB-Projekt startete unter der Leitung von Prof. Dr. med. Peter Vajkcozy und<br />
Prof. Dr. med. Harald Klüter mit dem Titel: „Analysis of the multistep nature of homing and<br />
incorporation of circulating progenitor cells during tumor angiogenesis“<br />
ECFC (Endothelial Colony Forming Cells) entwickeln sich aus Stammzellen, ursprünglich<br />
aus dem Knochenmark, und zirkulieren im peripheren Blut in einer Konzentration von etwa<br />
0,001%. In der Annahme, dass sich größere Mengen dieser Zellen im Nabelschnurblut<br />
finden, haben wir mittels Dichtegradient und anschließender Aufkonzentrierung durch MACS<br />
(Magnetic Cell Sorting) CD34+ Vorläuferzellen aus nicht für die allogene<br />
Nabelschnurblutbank geeigneten Präparaten gewonnen und in Kultur gebracht.<br />
Die daraus gewachsenen jungen Endothelzellen wurden mit durchfluss-zytometrischen<br />
Messungen und Immunfluoreszenzfärbungen charakterisiert und in funktionellen Assays<br />
mit HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) als ausgereifte Endothelzellen<br />
verglichen.<br />
In vitro Gefäßbildung (oben) und Nachweis der Expression von von-Willebrand-Faktor (links) und<br />
Bindung von Low Density Lipoprotein (rechts) von Endothelial Colony Forming Cells isoliert aus<br />
dem humanen Nabelschnurblut.<br />
23
Forschung_________________________________________________________________<br />
In den Experimenten wurde das Adhäsions-, Transmigrations- und Gefäßbildungsverhalten<br />
unter Tumorbedingungen verglichen. Obgleich zellmorphologisch keine Unterschiede<br />
zwischen ECFC und HUVEC erkennbar waren, stellten sich die ECFC in den funktionellen<br />
Versuchen als aktiver heraus. Unter Flussbedingungen in vitro zeigten ECFC eine bessere<br />
Anheftung als HUVEC. In diesen Adhäsionsversuchen wurde ein Endothel-Monolayer mit<br />
TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor) stimuliert, um einen Tumor zu simulieren.<br />
In vivo wurden injizierte ECFC von zuvor induzierten Tumoren stärker angelockt als HUVEC<br />
und wir haben nur mit ECFCs einen deutlichen Einbau in dort neu gebildete Gefäße<br />
gefunden. In gesunden Mäusen, denen Gelkissen mit Sphäroiden der jeweiligen Zellart unter<br />
die Haut gespritzt wurden, war kein Unterschied in der Gefäßbildung zwischen ECFCs und<br />
HUVEC zu sehen.<br />
Zusammengefasst sehen wir ECFCs als mögliche Therapiehilfe bei Gefäßneubildung nach<br />
Ischämie oder Infarkt an. In der Tumorbehandlung könnten sie ein Transportmittel für die<br />
Einschleusung von Wirkstoffen sein, welche zum Beispiel die Gefäßneubildung in Tumoren<br />
verhindern.<br />
Susanne Elvers-Hornung, Karen Bieback, Mara Vinci<br />
bei der Verleihung der Doktorwürde an Frau Dr. sc. hum. Mara Vinci<br />
24
Forschung_________________________________________________________________<br />
Arbeitgruppe Gero Huetter<br />
Forschungsprojekt: Genetische Faktoren der GvHD<br />
Der Erfolg einer Stammzelltransplantation kann durch unterschiedliche Faktoren geschmälert<br />
werden. Hierzu gehören in erster Linie die akute und chronische Graft vs. Host Erkrankung<br />
(GvHD), die infektiösen Komplikationen als Folge der Immunsuppression und schließlich<br />
durch das Risiko eines Rezidives der Grunderkrankung. Für das Auftreten eines<br />
therapieassoziierten Ereignisses sind inzwischen verschiedene Faktoren identifiziert worden,<br />
die in erster Linie den Empfänger betreffen. Der Einfluss genetischer Faktoren von Seiten<br />
<strong>des</strong> Spenders im Hinblick auf den Ausgang einer Stammzelltransplantation ist bisher nicht<br />
hinreichend geklärt.<br />
Ziel der Arbeitsgruppe ist es Faktoren auf der Spenderseite zu identifizieren, die einen<br />
(positiven oder negativen) Einfluss auf den Verlauf einer allogenen Stammzelltransplantation<br />
haben können. In diesem Zusammenhang sind in der Vergangenheit immer mehr die<br />
Chemokinen wie etwa die CCR5-delta32 Deletion in den Blickpunkt gerückt. Vor allem auch<br />
<strong>des</strong>wegen, da einige sich bereits medikamentös beeinflussen lassen und somit potentielle<br />
Ziele eine optimierten medikamentösen Begleittherapie während der<br />
Stammzellltransplantation darstellen. Darüber hinaus könnte durch Identifizierung<br />
unabhängiger Risikofaktoren auf der Spenderseite zukünftig die Spenderauswahl über die<br />
derzeit etablierten Parameter hinaus erfolgen, um so den günstigsten Spender für eine<br />
personalisierte Stammzelltherapie zu identifizieren.<br />
Die Auswirkung der CCR5-delta32 Deletion wurde mit Hilfe von Gen Array Chips an<br />
gesunden Probanten untersucht. Ziel war es eine mögliche Koregulation anderer GvHDkritischer<br />
Gene zu detektieren, die eine Erklärung für die Protektion der Mutation bei<br />
Spendern und Empfängern von allogenen Grafts erklären können.<br />
25
Forschung_________________________________________________________________<br />
Differenzielle mRNA Expression in zwei Gruppen von CCR5 Wildtyp (WT) und<br />
heterozygoten CCR5-delta32 Trägern (CCR5-d32).<br />
Dabei konnte gezeigt werden, dass CD30L in der Gruppe heterzygoter CCR5-delta32 träger<br />
vermehrt exprimiert wurde. CD30L ist bereits vorbeschrieben als kritischer Faktor in der<br />
Ausprägung der akuten GvHD und spielt auch eine Rolle in der negativen Regulation für die<br />
für die GvHD kritischen Treg T-Zellen. Im Weiteren sollen potentiell Koregulationen der<br />
CCR5-delat32 Deletion untersucht, quantifiziert und in Bezug zu den immunologischen<br />
Phänomenen gesetzt werden.<br />
Forschungsprojekt: CCR5 Spendersreening<br />
Gefördert durch die Bill & Melinda Gates Stiftung<br />
In zahlreichen Studien konnte ein Zusammenhang zwischen dem Polymorphismus für den<br />
CCR5 Gen-Lokus und der Anfälligkeit für eine HIV-Infektion belegen. Am besten untersucht<br />
ist dabei die 32 Basenpaar lange Deletion im CCR5 Gen (CCR5-delta32) die einen<br />
26
Forschung_________________________________________________________________<br />
vorzeitigen Stopp in der Translation bewirkt. Die Häufigkeit <strong>des</strong> Allels ist geographisch stark<br />
unterschiedlich und beträgt in Mitteleuropa etwa <strong>10</strong>% was zu einer Frequenz von 1% für<br />
homozygote Träger führt. Die regionale Verteilung deutet daher darauf hin, dass die CCR5-<br />
delta32 Mutation einen positiven Selektionsfaktor darstellt.<br />
Individuen die homozygot für die CCR5-delta32 Mutation sind, bilden überhaupt keinen<br />
CCR5 Rezeptor und sind damit im höchsten Maße resistent gegen eine HIV-Infektion.<br />
Ausnahmen sind seltene Infektion durch Virus-Stämme, die den CXCR4 Rezeptor für den<br />
Zelleintritt benutzen. Heterozygote Personen zeigen einer erhöhte Resistenz und im Falle<br />
einer Infektion ist der klinische Verlauf geprägt durch eine geringere Viruslast und ein<br />
langsameres Fortschreiten in Richtung <strong>des</strong> Immundefekt-Syndroms (im Durchschnitt<br />
Verlängerung um 2-3 Jahre).<br />
Am Bespiel der ersten erfolgreichen Stammzelltherapie bei einem HIV infizierten Patienten<br />
mit HIV resistenten hämatopoetischen Stammzellen konnte das Potential einer<br />
individualisierten Therapie gezeigt werden.<br />
Ziel der Arbeitsgruppe ist es präemptiv an einer möglichst großen Zahl von<br />
stammzellspendern bzw. Nabelschnurstammzellpräparate eine CCR5 Genotypisierung<br />
vorzunehmen um zukünftigen potentiellen Stammzellempfängern mit einer HIV-Infektion ein<br />
entsprechen<strong>des</strong> Transplantat anbieten zu können. Derzeit sind bereits über 3200<br />
Genotypisierung durchgeführt worden, Die Allelfrequenz der delta32 Deletion war in diesem<br />
Kollektiv mit 11,5% ungewöhnlich hoch.<br />
Gero Hütter, Susanne Elvers-Hornung<br />
27
Forschung_________________________________________________________________<br />
Arbeitsgruppe Xuan Duc Nguyen<br />
Forschungsprojekt: Dendritische Zellen<br />
Dendritische Zellen sind effektive Antigen-präsentierende Zellen <strong>des</strong> lymphatischen und<br />
nicht-lymphatischen Gewebes. Sie gehören zu den potentesten Initiatoren der adaptiven<br />
Immunantwort, insbesondere bei der Einleitung von primären Antigen-spezifischen<br />
Immunreaktionen, in denen native T-Zellen stimuliert werden. Diese Eigenschaft macht sie<br />
für den Einsatz in der Immuntherapie von Tumorerkrankungen interessant. Es gibt jedoch<br />
auch Subpopulationen von DC, die T-Zellen hemmen oder tolerieren. Ziele <strong>des</strong> Projektes<br />
liegen darin, dendritische Zellen aus Monozyten (CD14-positive Zellen) oder Stammzellen<br />
(CD34-positive Zellen) aus Nabelschnurblut zu generieren und immunphänotypisch,<br />
funktionell und molekularbiologisch zu vergleichen. Zur exakten Quantifizierung der<br />
Stimulation der T-Zell Proliferation wurde ein neues Testsystem basierend auf<br />
durchflußzytometrischer Bestimmung etabliert. Hierbei zeigte sich, dass sich je nach<br />
Ausgangszelle unterschiedliche Dendritische Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften<br />
entwickeln.<br />
Xuan Duc Nguyen, Alex Dugrillon<br />
28
Forschung_________________________________________________________________<br />
3.1.2 Thrombozytenimmunologie<br />
Im Jahr 2000 wurde die Arbeitsgruppe zunächst unter der Bezeichung<br />
und dem Arbeitsschwerpunkt „Thrombozytenimmunologie“ gegründet.<br />
Die Arbeitsgruppe wird von Prof. (apl) Dr. rer. nat. Peter Bugert<br />
geleitet, der sich 2004 über das Thema „Die Rolle der Thrombozyten<br />
bei inflammatorischen Prozessen“ an der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät<br />
Mannheim habilitiert hat. Nachdem sich der Arbeitsschwerpunkt<br />
zunehmend in Richtung grundlegender Fragestellungen der<br />
Thrombozytenfunktion gewandelt hat, trägt die Arbeitsgruppe seit<br />
<strong>2011</strong> die Bezeichnung „Thrombozytenbiologie“.<br />
Zur Arbeitsgruppe gehören die technischen Assistentinnen Frau Gabi Rink (MTA,<br />
Gruppenleitung) und Frau Katharina Kemp (BTA). Seit 2006 ist Frau Dr. Angelika Schedel<br />
als Wissenschaftlerin zuständig für die Entwicklung und Koordination der<br />
Forschungsprojekte auf dem Gebiet der neuronalen Rezeptoren bei Thrombozyten. Im<br />
Zeitraum <strong>2002</strong> bis <strong>2011</strong> haben insgesamt zehn Medinizinstudenten eine experimentelle<br />
Doktorarbeit abgeschlossen. Neun weitere Medizinstudenten arbeiteten Ende <strong>2011</strong> noch an<br />
ihren Forschungsprojekten oder waren mit der schriftlichen Ausarbeitung ihrer Doktorarbeit<br />
befasst. Mehrere Studenten verschiedener Fachhochschulen haben bei uns Diplom-,<br />
Bachelor- oder Semesterarbeiten angefertigt. Außerdem waren Wissenschaftler aus anderen<br />
Instituten zur Durchführung von Kooperationsprojekten zu Gast. Einige der<br />
Forschungsprojekte werden im Folgenden kurz dargestellt.<br />
29
Forschung_________________________________________________________________<br />
Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der AG Thrombozytenbiologie<br />
30
Ausgerichtete<br />
Kongresse_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Molekulare Grundlagen <strong>des</strong> Aspirin-like Defekts<br />
Gefördert durch die Deutsche Forschungs Gemeinschaft: BU 1795/3<br />
Der Aspirin-like Defekt (ALD) ist eine erbliche Funktionsstörung der Thrombozyten. Die<br />
Folgen sind meist milde Blutungsneigungen. In der Labordiagnostik ist der ALD in erster<br />
Linie durch eine gestörte Thrombozytenaggregation nach Arachidonsäure-Induktion zu<br />
erkennen. Aus diesem Grund wird der zugrundeliegende Defekt wird im Bereich <strong>des</strong><br />
thrombozytären Arachidonsäure-Stoffwechsels vermutet, wodurch das Erscheinungsbild <strong>des</strong><br />
ALD der aggregationshemmenden Wirkung von Acetylsalicylsäure (Aspirin ® ) ähnelt. Ziel<br />
dieses Forschungsprojektes in Kooperation mit der Universitätskinderklinik Dresden und mit<br />
finanzieller Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, war die<br />
Charakterisierung der molekularen Grundlagen <strong>des</strong> ALD. Die in Dresden gesammelten und<br />
phänotypisch charakterisierten Patientenproben wurden in der AG Thrombozytenbiologie in<br />
Zusammenarbeit mit Gastwissenschaftlerinnen aus Dresden Nina Rolf und Josephine Tauer<br />
auf DNA-, RNA- und Protein-Ebene analysiert. Einen wesentlichen<br />
Beitrag hat Iris Klaus in ihrer Doktorarbeit durch die DNA-<br />
Sequenzierung der Gene <strong>des</strong> Arachidonsäurestoffwechsels bei ALD-<br />
Patienten und Kontrollen geleistet. Ein Vergleich der Thrombozyten-<br />
Transkriptome von ALD-Patienten und gesunden Familienangehörigen<br />
zeigte eine verminderte Expression <strong>des</strong> Thromboxanrezeptors, der bei<br />
der Thromobzytenaktivierung eine entscheidende Rolle spielt. Die<br />
Ursache <strong>des</strong> ALD könnte also in einer verminderten<br />
Rezeptorexpression liegen.<br />
Forschungsprojekt: Funktionelle und molekulare Charakterisierung von CD40L<br />
Frau Kathrin Stamer hat dieses Projekt im Rahmen ihrer Doktorarbeit<br />
bearbeitet. Ziel <strong>des</strong> Projekts war die Charakterisierung von CD40L in<br />
Patienten mit thromboembolischen Komplikationen oder chronisch<br />
inflammatorischem Zustand (akuter Herzinfarkt, Herzflimmern, KHK,<br />
Schlaganfall, Lupus Anticoagulant) und in gesunden Kontrollen. Dies<br />
beinhaltete: 1) Exon-Resequenzierung der kodierenden Bereiche und<br />
<strong>des</strong> Promotors in ausgewählten Patienten und Kontrollen; 2) PCRbasierte<br />
Typisierung der gefundenen SNPs in allen Patienten und<br />
Kontrollen; 3) Analyse <strong>des</strong> STR-Polymorphismus in der 3’-Region <strong>des</strong> CD40L-Gens; 4)<br />
Messung der aktivierungsabhängigen CD40L Expression bei Thrombozyten von Patienten<br />
und Kontrollen mittels Durchflußzytometrie. Es konnte ein signifikanter Zusammenhang <strong>des</strong><br />
STR-Polymorphismus mit arteriellen Thrombosen bei Lupus Anticoagulant Patienten<br />
gefunden werden.<br />
31
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Mutationsanalyse <strong>des</strong> Na + -Kanals SCN5A bei Herzinfarkt-<br />
Patienten<br />
Der plötzliche Herztod verurschat durch Kammerflimmern im Rahmen eines Herzinfarktes ist<br />
die häufigste To<strong>des</strong>ursache in westlichen Gesellschaften. Genetische Risikofaktoren werden<br />
bei den Mechanismen der Arteriosklerose, Entzündung und Thrombozytenaktivierung<br />
vermutet. In Kooperation mit der I. Med. Klinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM)<br />
wurden in der Vergangenheit bereits einige Kandidatengene bei Patienten mit<br />
Kammerflimmern molekular charakterisiert. Im vorliegenden Projekt wurde der Herzmuskelspezifische<br />
Na+-Kanal, der vom SCN5A Gen kodiert wird, bei einer<br />
Auswahl gut charakterisierter Patienten untersucht. Zusätzlich zur<br />
Sequenzierung wurde das sogenannte High Resolution Melting (HRM)<br />
Verfahren am LightCycler 480 System angewendet. Tim Boehringer<br />
hat dieses Projekt im Rahmen seiner medizinischen Doktorarbeit an<br />
Patientenproben aus der I. Med. Klinik und an Kontrollproben<br />
(gesunde Blutspender) aus unserem Institut durchgeführt. Die<br />
experimentellen Arbeiten sind gerade abgeschlossen und die<br />
statistische Auswertung der Ergebnisse steht noch aus.<br />
Forschungsprojekt: Expression der Brain-Type Creatinkinase (CKBE) in<br />
Thrombozyten<br />
Die Creatinkinase (CK) ist ein Enzym, das vor allem in Nerven- (Brain-Type) und in<br />
Muskelgeweben (Muscle-Type) vorkommt und der Regeneration von ATP dient. Das<br />
funktionelle Enzym ist ein Dimer, das je nach Gewebe als Isoenzym vorkommt: CK-BB<br />
(neuronal), CK-MM (muskulär) oder auch als CK-MB im Blutplasma. Bei Zustand nach<br />
Herzinfark stellt eine erhöhte CK-MB Aktivität im Plasma einen wichtigen diagnostischen<br />
Parameter dar. Die ektopische Expression der Brain-Type Creatinkinase (CKBE), also die<br />
genetisch verursachte Expression <strong>des</strong> CKB-Gens in einem dafür untypischen Gewebe,<br />
wurde erstmals 1978 in einer italienischen Familie beschrieben. Bei CKBE-Probanden<br />
werden in erster Linie in Thrombozyten hohe CK-Aktivitäten<br />
beobachtet. In Zusammenarbeit mit Prof. Arnold (Uniklink Freiburg),<br />
der Blutproben von CKBE-Probanden beschaffte, wurde im Rahmen<br />
dieses Projekts durch die Arbeiten von Katharina Kemp gezeigt,<br />
dass Thrombozyten von CKBE-Probanden über eine hohe CK-<br />
Aktivität verfügen, die vom CK-BB Isoenzym herrührt. Diese erhöhte<br />
CK-Aktivität in Thrombozyten resultiert aus einer transkriptionellen<br />
Genaktivierung, deren molekulare Ursache aber bislang noch nicht<br />
geklärt werden konnte.<br />
32
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Charakterisierung neuronaler Rezeptoren bei Thrombozyten<br />
RNA- und Protein-Analysen haben gezeigt,<br />
dass Plättchen auch über acetylcholinerge<br />
Rezeptorsysteme (AChR) verfügen. Laut<br />
RNA-Daten sind die Varianten 4, 7, ß1 und<br />
ß2 exprimiert. Ziel <strong>des</strong> Projekts war die<br />
Charakterisierung der AChR Expression bei<br />
Plättchen und deren Vorläuferzellen mittels<br />
Durchflusszytometrie und Westernblot unter<br />
Anwendung spezifischer Antikörper gegen die<br />
Varianten 4, 7, ß1 und ß2. Auf funktioneller Ebene wurde geprüft, wie sich der Ligand<br />
Acetylcholin und andere cholinerge Substanzen auf die Plättchen-Aktivierung bzw. -<br />
Aggregation auswirkt. Durch die Arbeiten von Angelika Schedel (siehe linkes Bild) und<br />
Sophia Thornton (siehe rechtes Bild) konnte erstmals gezeigt werden, dass Thrombozyten<br />
und deren Vorläuferzellen über funktionelle cholinerge Rezeptoren verfügen.<br />
Forschungsprojekt: Cholinergen Signaltransduktionsmechanismen in der<br />
Megakaryopoese<br />
Gefördert durch die Stiftung Transfusionsmedizin und Immunhämatologie<br />
Wie beschrieben konnten Acetylcholinrezeptoren bei Thrombozyten<br />
und deren Vorläuferzellen nachgewiesen werden. Bekanntermaßen<br />
sind die Acetylcholinrezeptoren mit unterschiedlichen<br />
Signaltransduktions-mechanismen verknüpft, an denen Ca 2+ Ionen,<br />
die Proteinkinase C und auch die Januskinase 2 beteiligt sind. Ziel<br />
dieses Projektes ist die Charakterisierung der Ca 2+ - und der<br />
PKC/JAK2-abhängigen Signaltransduktion im verschiedenen<br />
Zellstadien der Megakaryopoese. Sabrina Besenfelder hat im<br />
Rahmen ihrer Masterarbeit (Studiengang „Translational Medical Research“ an der<br />
<strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim) zunächst die methodischen Grundlagen zur<br />
Quantifizierung der PKC-Phosphorylierung erarbeitet. Sie konnte bereits erste Hinweise auf<br />
eine PKC-Aktivierung durch cholinerge Substanzen in megakaryozytären Zelllinien erhalten.<br />
Frau Besenfelder wird als medizinische Doktorandin dieses Projekt durch Fragestellungen<br />
hinsichtlich Genregulation ergänzen und weiter bearbeiten.<br />
33
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Megakaryopoese aus Nabelschnurblut-Vorläuferzellen<br />
Gefördert durch die Stiftung Transfusionsmedizin und Immunhämatologie<br />
Wesentliche Arbeiten der letzten Jahre in der AG<br />
Thrombozytenbiologie drehen sich um die molekulare und<br />
funktionelle Charakterisierung cholinerger Rezeptoren an<br />
Thrombozyten megakaryozytären Zellen. Die Verwendung<br />
etablierter Zelllinien führte zu ersten wichtigen Erkenntnissen.<br />
Zelllinien sind jedoch in mehrerer Hinsicht nur bedingt mit den<br />
Zellen in vivo vergleichbar. Daher wurde im vorliegenden Projekt die<br />
Megakaryopoese aus Nabelschnurblut-Vorläuferzellen etabliert.<br />
Dies beinhaltete auch die Charakterisierung der Zellen anhand<br />
charakteristischer CD-Marker mittels Durchflusszytometrie. Dazu hat Florian Lorenz im<br />
Rahmen seiner Masterarbeit (Studiengang „Translational Medical Research“ an der<br />
<strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim) in Zusammenarbeit mit der Core Facility<br />
„Durchflusszytometrie und Zellsortierung“ ein Marker-Panel ausgearbeitet und validiert, das<br />
eine Messung der Zelldifferenzierung und anderer Charaktersitika mit geringen Zellzahlen<br />
ermöglicht. Mit der Etablierung der Megakaryopoese aus Nabelschnurblut-Vorläuferzellen<br />
hat Herr Lorenz den Grundstein gelegt für seine medizinische Doktorarbeit, in der er die<br />
Einflüsse cholinerger Substanzen auf die Megakaryopoese untersuchen soll.<br />
Forschungsprojekt: Thrombozytenfunktion bei Rauchern und neuropsychiatrischen<br />
Patienten<br />
Wir konnten bereits zeigen, dass Thrombozyten über nikotinische<br />
Acetylcholinrezeptoren verfügen, die für die Thrombozytenfunktion<br />
eine Rolle spielen. Sowohl Nikotin als auch verschiedene<br />
pharmakologische Substanzen, die bei der Pharmakotherapie<br />
neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen eingesetzt werden<br />
und spezifisch auf diese Rezeptoren wirken, könnten eine direkte<br />
oder indirekte Wirkung auf Thrombozyten haben. Die experimentelle<br />
Doktorarbeit von Anip Sarin befasst sich mit der<br />
Thrombozytenfunktion bei Rauchern und bei Patienten mit verschiedenen neuropsychiatrischen<br />
Erkrankungen (Alzheimer, Deppression, Schizophrenie). Durch die Messung<br />
verschiedener Laborparameter, wie z.B. Thrombozytenzahl, MPV und Aggregation im<br />
Vollblut, werden mögliche Veränderungen <strong>des</strong> cholinergen Systems bei Thrombozyten<br />
untersucht. Zusätzlich sollen auch molekulare Analysen zur Expression cholinerger<br />
Rezeptoren durchgeführt werden.<br />
34
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Cholinerge Komponenten in Zellen der Megakaryopoese<br />
Der nikotinische Acetylcholinrezeptor 7 (nAChR7) ist als ligandengesteuerter Ca 2+ -Kanal<br />
für die Thrombozytenfunktion von Bedeutung. Des Weiteren fanden wir eindeutige Hinweise,<br />
dass cholinerge Rezeptoren auch in die Bildung von Thrombozyten involviert sind. Neben<br />
der α7 Untereinheit scheinen auch die α4β2-Untereinheiten eine Rolle zu spielen. Das<br />
Vorhandensein der α4- und β2-Untereinheiten wurde bereits mit<br />
Hilfe der quantitativen RealTime PCR bestätigt. Ziel dieses Projekts<br />
ist die funktionelle Bedeutung weiterer Komponenten <strong>des</strong><br />
cholinergen Systems für die Megakaryopoese zu klären. Dazu<br />
sollen die Acetylcholinesterase (AChE), Cholinacetyltransferase<br />
(ChAT), der Cholintransporter (SLC5A7) und das Acetylcholin (ACh)<br />
verschiedenen Zellstadien der Megakaryopoese identifiziert werden.<br />
Ende <strong>2011</strong> hat Kerstin Kaiser in ihrer Doktorarbeit damit<br />
begonnen die entsprechenden experimentellen Arbeiten<br />
durchzuführen. Sie verwendet zunächst etablierte megakaryozytäre<br />
Zelllinien (Meg-01, Dami, M-07, CMK), um die Ergebnisse dann mit Megakaryozyten aus<br />
Nabelschnurblut-Vorläuferzellen zu vergleichen.<br />
Forschungsprojekt: Elektrophysiologische Untersuchungen an megakaryozytären<br />
Zellen<br />
Die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren nAChRa7 und nAChRa4b2 konnten an<br />
megakaryozytären Zellen nachgewiesen werden. Diese Rezeptoren stellen ligandengesteuerte<br />
Ionenkanäle dar, die sowohl für den Calcium-Einstrom als<br />
auch für das Membranpotential der Zellen von Bedeutung sein<br />
könnten. Entsprechende elektrophysiologische Untersuchungen<br />
mittels Patch-Clamp und Einzelzell-Calciumimaging sollen Hinweise<br />
über diese Vorgänge liefern. Julian Starigk hat Ende <strong>2011</strong> mit seiner<br />
experimentellen Doktorarbeit begonnen und wird in Kooperation mit<br />
der Arbeitsgruppe von Prof. Schubert (Kardiovaskuläre Physiologie)<br />
am CBTM die elektrophysiologischen Messungen an<br />
megakaryozytären Zellen durchgeführen. Vorgesehen sind Messungen spezifischer<br />
Ionenströme und <strong>des</strong> Membranpotentials unter dem Einfluss von Agonisten und<br />
Antagonisten der cholinergen Rezeptoren.<br />
35
Forschung_________________________________________________________________<br />
3.1.3 Sicherheit der Hämotherapie<br />
Arbeitgruppe Peter Bugert „Molekulare Immunhämatologie“<br />
Im Forschungsschwerpunkt „Sicherheit der Hämotherapie“ befasst sich die Arbeitsgruppe<br />
„Molekulare Immunhämatologie“ unter der Leitung von Prof. (apl) Dr. rer. nat. Peter Bugert<br />
mit der molekulargenetischen Charakterisierung serologisch auffälliger Phänotypen in den<br />
ABO- und RHCE-Blutgruppensystemen. Dabei handelt es sich sowohl um die schwache<br />
Expression der Antigene (Aweak, Bweak, etc.) als auch um seltene Antigene (JAHK, JAL,<br />
etc.). Entsprechende Proben werden in den immunhämatologischen Referenzlaboren der<br />
Kooperationspartner identifiziert und zur molekularen Analyse nach<br />
Mannheim geleitet. Neben der Gensequenzierung werden auf der<br />
Basis der identifizierten Mutationen auch PCR-Systeme zum<br />
gezielten Mutationsnachweis entwickelt. Zweiter Arbeitsschwerpunkt<br />
ist die Etablierung von Genotypisierungsverfahren für seltene und für<br />
hochfrequente Blutgruppenantigene. Diese Verfahren können sowohl<br />
im Bereich Patientendiagnostik als auch zur Spendertypisierung<br />
eingesetzt werden. Die Laborarbeiten im Bereich Molekulare<br />
Immunhämatologie werden hauptverantwortlich von Gabi Rink<br />
durchgeführt.<br />
Forschungsprojekt: Molekulare Grundlage abgeschwächter AB0-Antigene<br />
Neben den Hauptantigenen A1, A2, B und 0 im AB0-Blutgruppensystem können auch<br />
abgeschwächte Antigeneigenschaften serologisch als A3, Ael, Ax oder Aweak sowie B3, Bel,<br />
Bx oder Bweak nachgewiesen werden. Die molekulare Ursache abgeschwächter Antigene<br />
ist sehr heterogen und deutet auf eine signifikante Polymorphie <strong>des</strong> AB0-Genortes hin. Ziel<br />
<strong>des</strong> Projektes ist die molekulare Charakterisierung <strong>des</strong> AB0-Gens bei Individuen (Patienten<br />
oder Blutspendern) mit abgeschwächten Antigeneigenschaften. Im Abgleich mit den<br />
bekannten Genvarianten, die in einer Web-basierten Datenbank (dbRBC) hinterlegt sind, soll<br />
im Einzelfall die Genotyp-Phänotyp-Korrelation geprüft werden. Insgesamt kann dadurch die<br />
Diagnostik solcher Proben verbessert werden, wobei die klinische Relevanz noch unklar ist.<br />
Seit Projektbeginn im Jahr 2005 wurden insgesamt 355 Proben analysiert, die im Rahmen<br />
der routineserologischen Testung auffällig waren. Bei 278 Proben (78,3 %) waren die<br />
Isoagglutinine signifikant abgeschwächt oder fehlten vollständig. Die molekulargenetische<br />
Analyse <strong>des</strong> ABO- Gens ergab bei 166 dieser Proben das Vorliegen eines nicht-deletionalen<br />
0-Allels (003 oder Aw08). Die übrigen Proben zeigten keine Auffälligkeit im AB0-Gen. Hier ist<br />
die Ursache der abgeschwächten oder fehlenden Isoagglutinine unklar. Bei 77 der 355<br />
Proben (21,7 %) wurde eine abgeschwächte Antigenexpression festgestellt. Die<br />
36
Forschung_________________________________________________________________<br />
molekulargenetische AB0-Analyse zeigte bei 38 Proben das Vorliegen einer Punktmutation<br />
an. In den meisten Fällen handelte es sich um die Allele Ax01, Ax03, Aw04, Aw06, Aw13<br />
oder B(A)03. Neben diesen bekannten Allelen konnten auch 4 neue Allele (Aw15, Bw20,<br />
Bw21, 061) nachgewiesen werden.<br />
Forschungsprojekt: Molekulare Grundlage seltener und schwacher RH-Antigene<br />
Das Projekt befasst sich mit der systematischen serologischen und molekulargenetischen<br />
Charakterisierung der Blutgruppenantigene, die mit dem RhCE-System assoziiert sind.<br />
Dabei werden einerseits die molekularen Grundlagen seltener Antigene, wie z. B. JAHK,<br />
JAL, etc.untersucht. Andererseits werden die molekularen Ursachen quantitativer<br />
Änderungen der RhCE-Antigenexpression durch DNA-Sequenzierung <strong>des</strong> RHCE-Gens<br />
bestimmt.<br />
Seit Projektbeginn in 2005 wurden insgesamt 241 Proben, die zuvor auf der Basis<br />
serologischer Untersuchungen in den Instituten Baden-Baden, Ulm und Frankfurt sowie bei<br />
den Kooperationspartnern in Bristol und Bern ausgewählt wurden, in die<br />
molekulargenetischen Analysen eingeschlossen. Bei 152 der 241 Proben (63,1 %) war der<br />
serologische Phänotyp auf einzelne Punktmutationen im RHCE-Gen zurückzuführen. Diese<br />
Missense Mutationen führen im kodierten Protein zu einzelnen Aminosäureaustauschen und<br />
damit vermutlich zur Veränderung der Antigenstruktur <strong>des</strong> RHCE-Proteins. Bei 39 von 241<br />
Proben (16,2 %) konnten RHCE-RHD-Hybridgene festgestellt werden. Weitere 4 Proben<br />
(1,7 %) zeigten Sequenzauffälligkeiten im RHCE-Promotor. Bei den übrigen 34 Proben<br />
(14,1 %) konnten keine Veränderungen im RHCE-Gen nachgewiesen werden. Hier bleibt die<br />
molekulare Ursache <strong>des</strong> Phänotyps unklar. Für die schnelle Mutationsanalyse wurden<br />
Multiplex PCR-Verfahren entwickelt, die einen gezielten Nachweis verschiedener<br />
Punktmutationen ermöglichen. Die ständige Weiterentwicklung der Verfahren erlaubt in<br />
Zukunft schneller und kostengünstiger die molekulargenetischen Befunde bei Blutspendern<br />
oder Patienten mit auffälligem RhCE-Phänotyp zu erheben.<br />
Forschungsprojekt: Etablierung einer Biobank für die Forschung<br />
Biobanken sind Sammlungen biologischer Materialien und der zum jeweiligen<br />
Probenspender gehörenden persönlichen und medizinischen Daten. Die Wichtigkeit von<br />
Biobanken für die effektive Durchführung verschiedenster Studien ist weitgehend anerkannt.<br />
Bereits 2004 wurde am ITI eine anonymisierte DNA-Bank gesunder Blutspender aufgebaut.<br />
Die DNA-Bank beinhaltet 1.344 Proben gesunder Blutspender im Alter von 18 bis 68 Jahren<br />
und einer 1:1 Geschlechtsverteilung. Die von der Ethikkommission der <strong>Medizinische</strong>n<br />
Fakultät Mannheim genehmigte DNA-Bank wurde zunächst in Kooperation mit der Abteilung<br />
molekulare Epidemiologie am DKFZ Heidelberg etabliert. Mittlerweile werden die DNA-<br />
37
Forschung_________________________________________________________________<br />
Proben als Vergleichskollektiv für verschiedenste epigenetische Fall-Kontroll-Studien<br />
herangezogen. Bislang sind über 30 Originalarbeiten unter Beteiligung der DNA-Bank<br />
erschienen.<br />
Die Biobank stellt die Fortentwicklung der DNA-Bank dar und soll unter Berücksichtigung<br />
ethischer, rechtlicher und sozialer Aspekte am ITI etabliert werden. Als potentielle<br />
Teilnehmer an der Biobank sollen Blutspender im Rahmen von Blutspendeaktionen direkt<br />
angesprochen werden. Die unterschiedlichen Biomaterialien könnten dann aus den<br />
jeweiligen Vollblutspenden gewonnen und am ITI eingelagert werden. Die Grundlagen und<br />
organisatorischen Rahmenbedingungen der Biobank wurden seit 2007 unter Beteiligung von<br />
Prof. (em) Dr. med. Ordinarius Wilhelm Kriz und Prof. (apl) Dr. rer. nat. Peter Bugert<br />
erarbeitet. Zentrales Element ist die organisatorische Grundstruktur der Biobank (siehe<br />
Abbildung).<br />
Konzeptionelles Organigramm der Biobank für die Forschung am ITI<br />
Das Konzept beinhaltet folgende Rahmenbedingungen:<br />
1. Es werden Blutspender als potentielle Teilnehmer im Rahmen von<br />
Blutspendeaktionen <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen<br />
gGmbH angesprochen. Das Einzugsgebiet ist demnach regional begrenzt und<br />
umfasst den Raum Südwest-Deutschland.<br />
38
Forschung_________________________________________________________________<br />
2. Die zu archivierenden Biomaterialien umfassen DNA, Plasma, Serum sowie vitale<br />
Blutzellen und werden aus Vollblutspenden gewonnen.<br />
3. Spender sollen neben der medizinischen Anamnese auch Angaben über<br />
Lebensumstände und –gewohnheiten machen. Die Daten werden in entsprechend<br />
abgesicherten Datenbanken registriert.<br />
4. Die Weitergabe der Proben und Daten von der Biobank an Dritte<br />
(Forschungseinrichtungen) erfolgt in pseudonymisierter Form, um im Bedarfsfall eine<br />
erneute Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Spender durch die Biobank zu<br />
ermöglichen.<br />
5. Eine unabhängige Ethikkommission dient als Überwachungsorgan, das die<br />
Einhaltung der ethischen und rechtlichen Vorgaben beim Austausch von Proben und<br />
Daten kontrolliert.<br />
6. Zum Zweck <strong>des</strong> Informationsaustauschs zwischen Biobank, Spendern und<br />
Wissenschaftlern soll eine Internetplattform aufgebaut werden.<br />
7. Zur finanziellen Unterstützung der Biobank soll eine Teilkostenübernahme seitens der<br />
Forschungseinrichtungen für den Erhalt von Proben und Daten erfolgen.<br />
Öffentliche Forschungseinrichtungen können Proben und Daten mit geringer<br />
Kostenbeteiligung erhalten und werden aufgefordert, ihre wissenschaftlich erhobenen Daten<br />
in die Datenbank der Biobank einzupflegen. Private/kommerzielle Einrichtungen zahlen für<br />
den Proben- und Datenerhalt höhere Beiträge (Kostenerstattung), werden aber nicht zur<br />
Datenrückmeldung verpflichtet. Sollten Überschüsse erwirtschaftet werden, könnte ein Fond<br />
eingerichtet werden, der zur Forschungsförderung eingesetzt werden könnte.<br />
Das Konzept der Biobank soll in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Dabei stehen<br />
die Klärung juristischer und ethischer Fragen, insbesondere die Aufklärung und das<br />
schriftliche Einverständnis der Spender, im Vordergrund.<br />
39
Forschung_________________________________________________________________<br />
Arbeitsgruppe Karin Janetzko:<br />
Pathogeninaktivierung von Blutkomponenten<br />
Der Forschungsschwerpunkt „Sicherheit in der Hämotherapie“ ist seit 2000 in unserem<br />
Institut etabliert. Die Thematik der Pathogeninaktivierung, die die photochemische<br />
Pathogeninaktivierung von Thrombozytenkonzentraten unter Verwendung <strong>des</strong><br />
INTERCEPT Blood-Systems aber auch die Behandlung mit Riboflavin und Licht umfasst,<br />
wurde durch Frau PD Dr. Janetzko bearbeitet.<br />
Das photochemische Pathogeninaktivierungsverfahren basiert darauf, dass<br />
Thrombozytenkonzentrate mit dem Psoralen Amotosalen (= S-59) versetzt werden. Durch<br />
anschließende UVA Bestrahlung kommt es zu einer irreversiblen Kreuzvernetzungen<br />
zwischen dem Amotosalen und dem Genom potentiell kontaminierender Erreger, was eine<br />
Replikation der Pathogene verhindert. Bei diesen Pathogenen kann es sich um Viren,<br />
Bakterien, Protozoen oder auch Leukozyten handeln. Bevor das Thrombozytenkonzentrat<br />
anschließend für die Transfusion zur Verfügung steht, wird in einem Adsorptionsschritt das<br />
restliche Amotosalen sowie die durch die Bestrahlung entstandenen Photoprodukte<br />
abgereichert.<br />
In ersten Studien wurden gepaarte Lagerungsuntersuchungen von behandelten versus<br />
unbehandelten Thrombozytenkonzentraten durchgeführt, mit dem Ziel, Erfahrungen im<br />
Umgang mit der Technologie zu sammeln aber auch, um die Thrombozytenqualität in-vitro<br />
zu beurteilen. Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Aktivierung der Thrombozyten durch<br />
den Adsorptionsschritt, was dazu führte, dass die Adsorptionsmatrix <strong>des</strong> Systems optimiert<br />
wurde.<br />
In einer weitergehenden Studie konnten wir zeigen, dass zeitliche Unterschiede der<br />
einzelnen Behandlungsschritte keinen Einfluss auf die Thrombozytenqualität in-vitro hatten,<br />
so dass bei der routinemäßigen Herstellung der Präparate eine große zeitliche Flexibilität<br />
gegeben ist.<br />
40
Forschung_________________________________________________________________<br />
Additivlösung<br />
Thrombozytenkonzentrat<br />
Bestrahlungsbeutel<br />
Adsorptions-<br />
Beutel mit<br />
Matrix<br />
Lagerungsbeutel<br />
Bestrahlungsgerät<br />
Das INTERCEPT Blood-System zur Behandlung von Trombozytenkonzentraten<br />
Zur Beurteilung der klinischen Effizienz photochemisch behandelter Thrombozytenkonzentrate<br />
haben wir im Weiteren eine multizentrische, randomisierte Doppelblindstudie an<br />
hämato-onkologischen Patienten durchgeführt. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass das „count<br />
increment“ und „correct count increment“ nach Transfusion behandelter<br />
Thombozytenapheresekonzentrate etwas niedriger lag im Vergleich zur Gabe unbehandelter<br />
Standardapheresepräparate, dass aber im Hinblick auf das klinische „Out-come“ beide<br />
Präparate vergleichbar waren. Der Zugewinn an Sicherheit durch die photochemische<br />
Behandlung geht jedoch mit einem Thrombozytenverlust von bis zu 30% einher.<br />
Eine weitere Frage beschäftigte sich mit einer möglichen Qualitätskontrolle, die die Effizient<br />
dieses Verfahrens dokumentiert. Nachdem wir gezeigt haben, dass statistisch gesehen in<br />
der thrombozytären, mitochondralen (mt)DNA ca. alle 270 bp eine Kreuzvernetzung mit dem<br />
Amotosalen auftritt, konnten wir unter Verwendung der mtDNA ein PCR-Verfahren<br />
etablieren, durch dass die Effizienz der Pathogeninaktivierung nachgewiesen werden kann.<br />
Das System besteht zum einen aus einem DNA-Fragment, dass klein genug ist, um<br />
unabhängig von der photochemischen Behandlung in der PCR amplifiziert zu werden.<br />
Dieses Fragment dient als interne Kontrolle zum Nachweis einer korrekten PCR. Zum<br />
anderen haben wir ein DNA-Fragment ausgewählt, dass groß genug ist, damit<br />
Kreuzvernetzungen zwischen Genom und Amotosalen stattfinden. Diese Kreuzvernetzungen<br />
bedingen eine Inhibition der PCR, so dass die korrekt stattgefundene photochemische<br />
Behandlung nachgewiesen wird.<br />
41
Forschung_________________________________________________________________<br />
vor PCT<br />
nach PCT<br />
Großes Fragment<br />
Kleines Fragment<br />
Es konnte gezeigt werden, dass eine qualitative Auswertung der PCR Ergebnisse mittels<br />
Agarosegelelektrophorese bzw. eine quantitative Auswertung mittels Bioanalyser ist möglich<br />
ist.<br />
P<br />
Inaktivierungsfaktor:<br />
P<br />
P2 : P1<br />
P2 : P1<br />
P<br />
P<br />
Nach PCT<br />
Kleines Fragment<br />
Großes Fragment<br />
Vor PCT<br />
Der Cut off Wert (Inaktivierungsfaktor) berechnet aus der „area under the curve“ der beiden<br />
Fragmente vor und nach der photochemischen Behandlung zeigt jedoch eine große<br />
Streubreite. Sofern pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentraten für die Versorgung von<br />
Patienten in der Routine hergestellt werden, muss diese Nachweismethode optimiert<br />
werden.<br />
2006 konnte eine Kooperation mit der Firma Caridian, ehemals Navigant, aufgebaut werden,<br />
die ebenfalls eine Technologie zur Pathogeninaktivierung von Thrombozytenkonzentraten<br />
entwickelt hat.<br />
Das Verfahren basiert darauf, dass Thrombozytenkonzentrate mit Riboflavin (Vitamin B 2)<br />
versetzt werden. Durch anschließende Bestrahlung mit Licht der Wellenlänge 265-317 nm<br />
wird das Riboflavin aktiviert. Aufgrund <strong>des</strong> Energietransfers von Riboflavin auf ein<br />
Sauerstoffmolekül kommt es zur Entstehung von Sauerstoffradikalen, die Lipide, Proteine<br />
42
Forschung_________________________________________________________________<br />
und DNA/RNA-Basen oxidieren und damit irreversibel schädigen. Andererseits kommt es<br />
durch direkten Elektronentransfer von Riboflavin auf das Genom bzw. andere zelluläre<br />
Strukturen zu einer Zellschädigung. Auch die Lichtabsorption allein bewirkt eine<br />
Zellschädigung. Die Schädigung ist nicht selektiv und trifft sowohl Viren, Bakterien,<br />
Protozoen als auch Leukozyten und Thrombozyten. Da Riboflavin und seine durch die<br />
Bestrahlung entstandenen Photoprodukte (Lumichrome) auch Bestandteile der Nahrung<br />
sind, werden diese Komponenten als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Eine<br />
Abreicherung der Substanzen vor der Transfusion <strong>des</strong> Thrombozytenkonzentrates ist<br />
<strong>des</strong>halb nicht erforderlich.<br />
Zugabe der<br />
Riboflavinlösung<br />
Bestrahlung<br />
ca. 6-<strong>10</strong> Min<br />
Transfusion<br />
Um die Thrombozytenqualität in-vitro beurteilen zu können, führten wir gepaarte<br />
Lagerungsuntersuchungen mit behandelten und unbehandelten Thrombozytenapheresekonzentraten<br />
durchgeführt.<br />
Dabei unterschieden sich die Herstellungsmodalitäten einerseits in der unterschiedlich<br />
langen initialen Lagerungszeit der Thrombozytenkonzentrate vor der Pathogeninaktivierung,<br />
die entweder 2 Stunden nach der Herstellung bzw. am Tag 1 nach Herstellung durchgeführt<br />
wurde.<br />
Andererseits wurden die Thrombozyten zu <strong>10</strong>0% in autologem Plasma bzw. in einem<br />
Gemisch aus autologem Plasma und Additvlösung (SSP+) gelagert.<br />
Die Ergebnisse zeigten, dass die Behandlung mit Riboflavin/Licht im Vergleich zu den<br />
unbehandelten Produkten ab Tag 3 der Lagerung zu einem gesteigerten Zellmetabolismus,<br />
einem verstärken pH-Wert Abfall und einer Aktivierung der Thrombozyten führte. Diese<br />
Ergebnisse waren unabhängig von der Dauer der initialen Ruhephase.<br />
43
Forschung_________________________________________________________________<br />
Die Lagerung in einem Gemisch aus Plasma/SSP+ führte lediglich zu einer Stabilisierung<br />
<strong>des</strong> ph-Wertes auf einem höheren Niveau.<br />
Es stellte sich die Frage, ob möglicherweise diese Beobachtungen auch im Zusammenhang<br />
mit der Art <strong>des</strong> Aphereseverfahrens stehen könnten. Um dieser Frage nachzugehen, führten<br />
wir Untersuchungen an behandelten und nicht behandelten Thrombozytenapheresekonzentraten<br />
durch, die zum einen mit der AMICUS zum anderen mit der TRIMA gesammelt<br />
wurden. Es zeigt sich jedoch, dass die Beobachtungen unabhängig von den Herstellungsmodalitäten<br />
waren.<br />
Ausgehend von dem für das INTERCEPT Blood-System konzipierten<br />
Qualitätskontrollverfahren stellte sich die Frage, ob auch die Effizienz der<br />
Riboflavin/Lichtbehandlung über die PCR-Testung unter Verwendung der mtDNA<br />
nachgewiesen werden kann.<br />
Multiplex-PCR<br />
Agarose-Gel<br />
M V N<br />
3.859 bp<br />
968 bp<br />
M: Marker<br />
V: TK vor Behandlung<br />
N: TK nach Behandlung<br />
162 bp<br />
Wir konnten zeigen, dass auch dieses Pathogeninaktivierungsverfahren zu Kreuzvernetzung<br />
in der mtDNA führte, die mit dem Ausbleiben der Amplifikation einher gingen. Allerdings war<br />
ein deutlich größeres Basenpaarfragment von größer 3000 bp für den Nachweis erforderlich.<br />
Die Entwicklung einer Multiplex-PCR mit einem Fragment von ca. <strong>10</strong>00 bp und einem mit ca.<br />
4000 bp ermöglicht einen Einsatz dieser Testung sowohl für die Pathogeninaktivierung unter<br />
Verwendung von Amotosale/UVA-Licht als auch Riboflavin/Licht in einem Ansatz.<br />
Die Auswertung kann zum einen über Agarosegel zum anderen aber auch mittels<br />
Bioanalyser erfolgen.<br />
44
Forschung_________________________________________________________________<br />
162<br />
TK vor Behandlung<br />
968<br />
3.859 bp<br />
162<br />
TK nach Behandlung<br />
968<br />
3.859 bp<br />
Für 2012 besteht eine Studienkooperation mit dem Plasmazentrum Neckarau. In einer<br />
gemeinsamen Studie – individualiserte Plasmaspende Immunstatus, Hämostase und IgG-<br />
Subklassen (IPS-IHS), wird der Einfluss unterschiedlicher Plasmaspendefrequenzen auf den<br />
Spender untersucht.<br />
Es gibt 3 Gruppen von Spendern, bei denen zum Studienbeginn, nach ca. 6 und 12 Monaten<br />
der Immunstatus, die Gerinnungsfaktoren II, VIII und XIII sowie Albumin, Gesamteiweiß, IgG<br />
und die IgG-Subklassen bestimmt werden sollen. Diese 3 Gruppen gliedern sich in eine<br />
Kontrollgruppe bestehend aus Blutspendern und in je eine Gruppe von Plasmaspendern, die<br />
mit einer Frequenz von maximal 45 bzw. von maximal <strong>10</strong>4 mal pro Jahr Plasma spenden.<br />
Kooperationspartner<br />
Externer Kooperationspartner war bis zum Jahr 2005 die Firma Baxter/CERUS, die das<br />
INTERCEPT Blood-System entwickelt und in Deutschland vertrieben hat. Im Rahmen<br />
unterschiedlicher Fragestellungen bestand darüber hinaus zeitweise eine Kooperation mit<br />
Herrn Prof. Hastka von der III. <strong>Medizinische</strong>n Klinik <strong>des</strong> Universitätsklinikums Mannheim, mit<br />
Herrn PD. Dr. Lösel aus der Abteilung für klinische Pharmakologie <strong>des</strong> Universitätsklinikums<br />
Mannheim sowie mit Herrn Dr. Montag vom Paul-Ehrlich-Institut.<br />
45
Forschung_________________________________________________________________<br />
Externer Kooperationspartner war von 2007 bis 2009 die Firma Caridian, ehemals Navigant,<br />
die das Pathogenaktivierungsverfahren Riboflavin/Licht entwickelt und in Deutschland<br />
vertrieben hat.<br />
Intern waren bei allen Projekten Mitarbeiter aus den Abteilungen Blutspende, Produktion<br />
sowie Qualitätskontrolle involviert. Seit 2003 hat sich darüber hinaus eine interne<br />
Kooperation mit der Abteilung für Molekularbiologie, Leitung Herr Prof Dr. Bugert, gebildet. In<br />
den Jahren 2003 und 2004 gehörten der Arbeitsgruppe eine Biologin (Postdoc, 0,5%) sowie<br />
eine MTA (20 Wochenstunden) an. Ab April 2007 ist in diesem Bereich 1 MTA tätig, die auch<br />
in Forschungsaufgaben der Abteilung für Molekularbiologie eingebunden ist.<br />
Arbeitsgruppe Xuan Duc Nguyen<br />
Forschungsprojekt: Automatisiertes Screeningverfahren zum Nachweis<br />
granulozytärer Antikörper<br />
Granulozytäre Antikörper können schwerwiegende<br />
Transfusionsreaktionen wie z. B. die Transfusionsassoziierte<br />
Lungeninsuffizienz (TRALI) verursachen. Somit kommt dem<br />
Vorhandensein von granulozytären Antikörpern in den Blutprodukten,<br />
wie z. B. Plasmen eine grosse Bedeutung zu. Die Untersuchung einer<br />
hohen Anzahl von Blutprodukten auf granulozytäre Antikörper mit den<br />
bisherigen Verfahren GIFT und GAT (GAT) ist aufgrund <strong>des</strong> hohen<br />
Zeitaufwan<strong>des</strong> und der Notwendigkeit von großer Menge an Testzellen<br />
nicht möglich.<br />
In der täglichen Routine wurde bereits das Verfahren Flow GIFT (flow cytometric granulocyte<br />
immunofluorescence) zur schnellen Detektion von granulozytären Antikörpern mittels<br />
Durchflusszytometrie etabliert. Um die Abarbeitung der Proben zu standardisieren und<br />
rationalisieren, wird in dem vorliegenden Projekt die Untersuchung der granulozytären<br />
Antikörpern mittels automatisiertem Flow-GIFT durchgeführt.<br />
Ziel dieses Projektes liegt darin, über 14.000 Blutproben von Spenderinnen mit und ohne<br />
Schwangerschaftsanamnese sowie männlichen Spendern auf granulozytäre und HLA-Klasse<br />
I und II Antikörper zu untersuchen. Hierbei sollen die Praktikabilität <strong>des</strong> automatisierten<br />
Verfahren bezüglich <strong>des</strong> Prozeßablaufes für den Einsatz in der Routine in großem Umfang<br />
der Spenderuntersuchung wie auch Informationen über Frequenz der granulozytären und<br />
HLA-Klasse I und II Antikörpern bei den Blutspendern/Innen gewonnen werden.<br />
14343 Seren von Spenderinnen mit und ohne Schwangerschaftsanamnese (n=6974, 48,7%)<br />
sowie männlichen Spendern (n=7369, 51,3%) wurden mittels automatisierten Flow-GIFTs<br />
46
Forschung_________________________________________________________________<br />
untersucht. 29,3% der untersuchten Spenderinnen hatten eine positive<br />
Schwangerschaftsanamnese. HLA Antikörper wurden mit einem kommerziellen ELISA-<br />
Verfahren untersucht. In 924 (21,9%) von 4212 Spenderinnen mit positiver<br />
Schwangerschaftsanamnese konnten Antikörper gegen HNA-Merkmale (n= 62; 1,5%), HLA<br />
Klasse I und/ oder II (n= 862; 20,4%) nachgewiesen werden. In 3,5% (n= 96) von 2762<br />
Spenderinnen mit negativer Schwangerschaftsanamnese wurden Antikörper gegen HNA-<br />
Merkmale (n=13; 0,47%) und HLA Klasse I und/ oder II (n= 83; 3%) nachgewiesen. In 2,1%<br />
(n= 154) von 7369 männlichen Spendern konnten auch Antikörper gegen HNA-Merkmale<br />
(n=45; 0,6%) und HLA Klasse I und/ oder II (n= <strong>10</strong>9; 1,4%) nachgewiesen werden.<br />
antibodies<br />
against<br />
females with history of<br />
pregnancy (n= 4212) [%]<br />
females without history of<br />
pregnancy (n= 2762) [%]<br />
males<br />
(n= 7369) [%]<br />
HLA class I <strong>10</strong>.3 2.0 0.7<br />
HLA class II 4.9 0.8 0.6<br />
HLA class I<br />
and II<br />
5.3 0.18 0.1<br />
HNA 1.5 0.47 0.6<br />
Total 21.9 3.5 2.1<br />
HNA-antibody<br />
specificities<br />
females with history of<br />
pregnancy (n=)<br />
females without history of<br />
pregnancy (n=)<br />
males<br />
(n=)<br />
HNA-1a 9 3 6<br />
HNA-1b 8 2 1<br />
HNA 2a 9 4 <strong>10</strong><br />
HNA-3a 12 - -<br />
CD16 <strong>10</strong> 3 <strong>10</strong><br />
CD32 3 - 3<br />
CD11a 2 - 2<br />
unknown 9 1 13<br />
HNA-1a 9 3 6<br />
47
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Screening auf TRALI-assoziierte Antikörper bei der Versorgung<br />
mit Granulozytenpräparaten<br />
TRALI kann durch Anti-HLA-Klasse II und Anti-HNA-Antikörper ausgelöst werden. Patienten<br />
in der neutropenen Sepsis, die mit Granulozytenpräparaten versorgt werden bis sie wieder<br />
eine eigene Granulopoese aufweisen, können unter der Gabe von Granulozytenpräparaten<br />
gegen HLA-Klasse II und HNA-Merkmale immunisieren.<br />
Jeder Patient wird daher initial und in zwei wöchentlichen Abständen unter Versorgung mit<br />
Granulozytenpräparaten mittels Flow-GIFT, HLA-Antikörperassays bzw. SASGA auf das<br />
Vorliegen von antileukozytären Antikörpern untersucht. Zur weiteren Absicherung wird vor<br />
Gabe eines Granulozytenpräparates mit jedem neuen Spender, aber min<strong>des</strong>tens einmal<br />
innerhalb von zwei Wochen, ein Crossmatch mittels Flow-GIFT durchgeführt.<br />
Bei der bisherigen Gabe von ca 140 Granulozytenpräparaten wurden keine<br />
schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen berichtet. Ein Patient verstarb bislang unter<br />
der Therapie, allerdings im Rahmen der Schwere der Grunderkrankung ohne Assoziation zur<br />
Versorgung mit Granulozyten.<br />
Ziel der Studie ist das Auftreten von antileukozytären Antikörpern unter der Therapie mit<br />
Granulzytenpräparaten zu untersuchen. Mit dem vorliegenden Verfahren war es möglich<br />
sogar multiple HLA-Klasse I und II immunisierte Patienten mit Crossmatch negativen<br />
Granulozytenkonzentraten zu versorgen.<br />
Bislang gefundene Antikörper-Spezifitäten bei mit Granulozytenpräparaten versorgten Patienten.<br />
Patient HLA I Ab HLA II Ab Flow GIFT SASGA Abs<br />
27 Pat negative negative negative n.a. none<br />
2 Pat positive negative negative n.a. Anti-A2<br />
1 Pat positive negative negative n.a. Anti-A29<br />
1 Pat negative positive positive negative Anti-DR 7, 8, 52<br />
2 Pat negative negative positive negative none<br />
1 Pat positive positive positive negative Anti-A3, 24 B 7, 18<br />
Anti-DR 7, 8, 12, 53<br />
48
Forschung_________________________________________________________________<br />
Forschungsprojekt: Spenderstudien als Beitrag zur Versorgungsforschung<br />
Seit 2009 wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Public Health (Leiter Prof. Dr. J.<br />
Fischer) in Zusammenarbeit zwischen PD Dr. M. Müller-Steinhardt und Christian<br />
Weidmann ein neues Gebiet der Versorgungsforschung erschlossen.<br />
Vor dem Hintergrund <strong>des</strong> rapiden medizinischen Fortschritts und den<br />
damit einhergehenden Veränderungen im Gesundheitswesen haben<br />
in den letzten Jahren sowohl die Bun<strong>des</strong>ärztekammer als auch die<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft die Bedeutung der<br />
Versorgungsforschung betont. Die Versorgungsforschung versucht zu<br />
beschreiben, wie Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung<br />
erhalten, wie diese Versorgung organisiert ist, was sie kostet und<br />
welche Ergebnisse sie hervorbringt. Ziel ist es hierbei, effektive Ansätze zu finden, die<br />
bestmögliche Resultate liefern und die Sicherheit der Patienten erhöhen. Blutpräparate sind<br />
inzwischen ein integraler Bestandteil der medizinischen Versorgung. Da sich die Herstellung<br />
künstlicher Blutbestandteile jedoch nach wie vor als sehr schwierig erweist, beruht die<br />
Gewinnung von Blutpräparaten auf freiwilligen Blutspendern. Das Forschungsprojekt<br />
versucht daher in verschiedenen Auswertungsschritten eine detaillierte Beschreibung der<br />
Spender <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes, um zu verstehen, wie auch in den kommenden<br />
Jahren eine Versorgung der Bevölkerung mit Blutpräparaten gewährleistet werden kann.<br />
Demographischer Wand und seine Bedeutung für die Blutspende<br />
Gegenwärtig vollzieht sich in vielen wesentlichen Industrieländern ein demographischer<br />
Wandel durch sinkende Geburtenzahlen auf der einen Seite und eine steigende<br />
Lebenserwartung auf der anderen Seite. Diese „Überalterung der Gesellschaft“ führt auch zu<br />
einem Anstieg von transfusionsbedürftigen Erkrankungen. Darüber hinaus ist ein ständig<br />
steigender Bedarf an Blutprodukten, vor allem durch die Fortschritte im Bereich der<br />
Hämatoonkologie und der steigenden Zahl von allogenen Stammzelltransplantationen zu<br />
verzeichnen. Um die Versorgung der Bevölkerung mit Blutprodukten auch in den nächsten<br />
Jahrzehnten sicher stellen zu können, wird es daher eine Herausforderung sein, bei einer<br />
Abnahme der potenziell spendefähigen Bevölkerung und einem gleichzeitig steigenden<br />
Bedarf an Blutprodukten ausreichend Blutpräparate bereitstellen zu können.<br />
Wie ungünstig sich die demografischen Veränderungen auf die Blutversorgung auswirken<br />
werden, haben zuvor bereits andere Arbeitsgruppen für Nordost-Deutschland geschildert. In<br />
einer Replikation dieser Schätzungen für Baden-Württemberg mit Hilfe von Spenderdaten<br />
<strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes und Verbrauchsangaben <strong>des</strong> Klinikums Mannheim konnte<br />
gezeigt werden, dass sich auch für Baden-Württemberg eine rückläufige Prognose für das<br />
Spendeaufkommen bei einem gleichzeitig ansteigenden Bedarf abzeichnet. Diese<br />
49
Forschung_________________________________________________________________<br />
Entwicklungen fallen deutlich schwächer aus als in Mecklenburg-Vorpommern, wo zusätzlich<br />
starke Abwanderungstendenzen zu erkennen sind. Spätestens ab dem Jahr 2025, wenn die<br />
sogenannten babyboomer-Jahrgänge langsam aus dem spendefähigen Alter austreten,<br />
werden sich aber auch in Baden-Württemberg Angebot und Nachfrage nach Blutpräparaten<br />
entgegengesetzt entwickeln. Dadurch werden weitaus stärkere Anstrengungen nötig sein,<br />
um über ausreichend Blut zu verfügen.<br />
Um auf diesen demographischen Wandel in der Bevölkerung zu reagieren, hat der DRK<br />
Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen im Jahr 2009 das maximale Spendealter für<br />
Vollblutspenden von 68 auf 70 Jahren angehoben. Im Rahmen einer Beobachtungsstudie<br />
über 2 Jahre wurde analysiert, ob diese Vorgehensweise geeignet ist, um einem möglichen<br />
Mangel an Blutprodukten zu begegnen und um sicherzustellen, dass sie für die betroffenen<br />
Blutspender sicher- und risikofrei ist. Im Zeitraum von März 2009 bis Februar <strong>2011</strong> wurde<br />
daher der Anteil an Blutspenden von 69- und 70jährigen Blutspendern untersucht und es<br />
wurde die Rate der unerwünschten Nebenwirkungen bei der Vollblutspende näher analysiert.<br />
Im Rahmen der Aktion „Zu fit um aufzuhören“ reagierten insgesamt 32,5 % aller<br />
angeschriebenen Blutspender über 68 und spendeten weiter Blut. Bemerkenswerterweise<br />
war die mittlere jährliche Spendefrequenz sowohl bei männlichen wie auch bei weiblichen<br />
Blutspendern im Alter von 70 Jahren signifikant erhöht. Wir fanden für beide Geschlechter<br />
eine positive Korrelation mit dem steigenden Spendealter (siehe auch Abbildung 1). Je höher<br />
das Spendealter <strong>des</strong>to höher auch die mittlere jährliche Spendefrequenz. Bei Analyse der<br />
Nebenwirkungsraten konnten wir demgegenüber feststellen, dass die Häufigkeit von<br />
Spendezwischenfällen bei Mehrfachspendern mit steigendem Alter abnimmt (Tabelle 1).<br />
Aus den vorliegenden Daten lässt sich eine sehr hohe Motivation zur Vollblutspende<br />
ableiten. Wir erkennen bei 69- und 70jährigen männlichen und weiblichen Blutspendern die<br />
höchsten mittleren jährlichen Blutspendefrequenzen (siehe Abbildung 1). Gleichzeitig zeigt<br />
die Analyse der Spenderzwischenfälle, dass insbesondere ältere Spender sehr wenig<br />
Zwischenfälle haben und somit die Spende von 69- und 70jährigen Blutspendern als sicher<br />
gelten kann. Möglicherweise spielt die große Erfahrung von Blutspendern in diesem Alter<br />
dabei eine entscheidende Rolle. Zusammengefasst erscheint die Strategie, das<br />
Blutspenderalter auf 70 Jahre anzuheben, geeignet dem demographischen Wandel und<br />
seiner Bedeutung für die Blutspende in der Bun<strong>des</strong>republik Deutschland zu begegnen.<br />
Neben den demografischen Prognosen lag ein weiterer Schwerpunkt der Spenderstudien auf<br />
der Beschreibung und Erklärung der erheblichen regionalen Unterschiede in der<br />
Blutspendebereitschaft. Hierbei konnten wir einige Gemeinsamkeiten zwischen den<br />
Gemeinden mit sehr hohen und sehr niedrigen Spenderanteilen erkennen. Die Ergebnisse<br />
50
Forschung_________________________________________________________________<br />
unterstreichen die Bedeutung eines adäquaten Spendeangebotes und belegen, wie wichtig<br />
die vielen mobilen Spendetermine <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes sind.<br />
Tabelle 1<br />
Spendenzwischenfälle von Mehrfachspendern (Vollblut) differenziert nach Alter und Geschlecht<br />
Alter Jahre 18-29 30-39 40-49 50-59 60-65 66-68 69-70<br />
Zwischenfälle<br />
(Gesamt)<br />
Männer 1.<strong>10</strong><br />
(65,599)<br />
0.47<br />
(63,996)<br />
0.35<br />
(129,488)<br />
0.23<br />
(<strong>10</strong>0,709)<br />
0.18<br />
(38,509)<br />
0.12<br />
(16,675)<br />
0<br />
(4,371)<br />
Frauen 1.80<br />
0.77<br />
0.56<br />
0.94<br />
0.75<br />
1.05<br />
1.12<br />
(61,141)<br />
(46,540)<br />
(89,255)<br />
(62,926)<br />
(21,455)<br />
(7,594)<br />
(1,790)<br />
Systemische<br />
Reaktionen<br />
Männer 0.99<br />
(65,599)<br />
0.38<br />
(63,996)<br />
0.29<br />
(129,488)<br />
0.12<br />
(<strong>10</strong>0,709)<br />
0.<strong>10</strong><br />
(38,509)<br />
0.12<br />
(16,675)<br />
0<br />
(4,371)<br />
Frauen 1.47<br />
0.54<br />
0.48<br />
0.83<br />
0.65<br />
0.79<br />
1.12<br />
(61,141)<br />
(46,540)<br />
(89,255)<br />
(62,926)<br />
(21,455)<br />
(7,594)<br />
(1,790)<br />
Nebenwirkungsarten<br />
Gefäßverletzung 20 12 11 15 5 1 0<br />
Nervenverletzung 13 8 5 3 0 1 0<br />
Andere lokale Reaktionen 1 0 1 0 0 1 0<br />
Systemische Reaktion<br />
(Synkope)<br />
Andere systemische<br />
Reaktionen<br />
153 46 78 65 19 8 2<br />
26 7 15 12 0 0 1<br />
Spendenzwischenfälle von Mehrfachspendern (Vollblut) zwischen dem 1.7.2009 und 30.6.20<strong>10</strong>.<br />
Die Zwischenfallraten sind pro 1,000 Vollblutspenden nach Geschlecht und Alter differenziert (95%<br />
CI), [Gesamtzahl der Vollblutspenden in der entsprechenden Gruppe]. Gesamtzahl der<br />
unterschiedlichen Nebenwirkungsarten pro Altersgruppe. Mehr als ein Reaktionstyp pro<br />
Vollblutspende ist möglich.<br />
Schließlich wurde untersucht, unter welchen Bedingungen aus Erstspendern regelmäßige<br />
Spender werden, die dem Blutspende über mehrere Jahre treu bleiben. Aus den Berichten<br />
ausländischer Spendedienste und aus <strong>des</strong>kriptiven Auswertungen unserer<br />
Spenderdatenbank wussten wir, dass bedauerlicherweise nur relativ wenige Erstspender<br />
tatsächlich regelmäßig wiederkehren. Mit Hilfe einer umfangreichen schriftlichen Befragung<br />
wurden jene Spender näher beschrieben, die auch vier Jahre nach ihrer Erstspende noch<br />
aktiv waren. So waren dies vor allem sehr junge Erstspender und Erstspender im<br />
fortgeschrittenen Alter, Erwerbstätige sowie Spender, die in ihrem Freun<strong>des</strong>- und<br />
51
Forschung_________________________________________________________________<br />
Bekanntenkreis Kontakt zu anderen Spendern hatten. Eine schnelle Rückkehr im Anschluss<br />
an die Erstspende erwies sich ebenfalls als vorteilhaft für die längerfristige Spenderbindung.<br />
Nicht mehr aktiv waren dagegen vor allem Spender, die zwischenzeitlich umgezogen sind,<br />
die mit ihrem letzten Spendeerlebnis unzufrieden waren oder die von körperlichen<br />
Beeinträchtigungen im Anschluss an die Spende berichteten. Diese Charakterisierungen<br />
spiegeln sich auch in den Aussagen der inaktiven Spender zu den Gründen ihrer<br />
ausbleibenden Rückkehr: Hier wurden am häufigsten medizinische Gründe, Umzüge und<br />
Auslandreisen genannt.<br />
mittlere Spendehäufigkeit<br />
[pro Jahr]<br />
3,00<br />
2,75<br />
2,50<br />
a<br />
Frauen Männer<br />
2,25<br />
2,00<br />
1,75<br />
1,50<br />
1,25<br />
1,00<br />
0,75<br />
0,50<br />
0,25<br />
0,00<br />
3,00<br />
2,75<br />
2,50<br />
2,25<br />
2,00<br />
1,75<br />
1,50<br />
1,25<br />
1,00<br />
0,75<br />
0,50<br />
0,25<br />
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70<br />
b<br />
0,00<br />
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70<br />
Alter [Jahr]<br />
Mittlere Spendehäufigkeit pro Vollblutspender pro Jahr für die entsprechende Altersgruppe<br />
[Lebensjahr] für männliche (a) und weibliche Spender (b).<br />
52
Forschung_________________________________________________________________<br />
Arbeitsgruppe Christian Weidmann<br />
Forschungsprojekt: Spenderstudien als Beitrag zur Versorgungsforschung<br />
Vor dem Hintergrund <strong>des</strong> rapiden medizinischen Fortschritts und den<br />
damit einhergehenden Kostensteigerungen im Gesundheitswesen<br />
haben in den letzten Jahren sowohl die Bun<strong>des</strong>ärztekammer als auch<br />
die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Bedeutung der<br />
Versorgungsforschung betont. Die Versorgungsforschung versucht zu<br />
beschreiben, wie Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung<br />
erhalten, wie diese Versorgung organisiert ist, was sie kostet und<br />
welche Ergebnisse sie hervorbringt. Ziel ist es hierbei, effektive<br />
Ansätze zu finden, die bestmögliche Resultate liefern und die Sicherheit der Patienten<br />
erhöhen. Blutpräparate sind inzwischen ein integraler Bestandteil der medizinischen<br />
Versorgung. Da sich die Herstellung künstlicher Blutbestandteile jedoch nach wie vor als<br />
sehr schwierig erweist, beruht die Gewinnung von Blutpräparaten auf freiwilligen<br />
Blutspendern. Das Forschungsprojekt versucht daher in verschiedenen<br />
Auswertungsschritten eine detaillierte Beschreibung der Spender <strong>des</strong> DRK-<br />
Blutspendedienstes, um zu verstehen, wie auch in den kommenden Jahren eine Versorgung<br />
der Bevölkerung mit Blutpräparaten gewährleistet werden kann.<br />
Wie ungünstig sich die demografischen Veränderungen auf die Blutversorgung auswirken<br />
werden, haben zuvor bereits andere Arbeitsgruppen für Nordost-Deutschland geschildert. In<br />
einer Replikation dieser Schätzungen für Baden-Württemberg mit Hilfe von Spenderdaten<br />
<strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes und Verbrauchsangaben <strong>des</strong> Klinikums Mannheim konnten wir<br />
zeigen, dass sich auch für Baden-Württemberg eine rückläufige Prognose für das<br />
Spendeaufkommen bei einem gleichzeitig ansteigenden Bedarf abzeichnet. Diese<br />
Entwicklungen fallen deutlich schwächer aus als in Mecklenburg-Vorpommern, wo zusätzlich<br />
starke Abwanderungstendenzen zu erkennen sind. Spätestens ab dem Jahr 2025, wenn die<br />
sogenannten babyboomer-Jahrgänge langsam aus dem spendefähigen Alter austreten,<br />
werden sich aber auch in Baden-Württemberg Angebot und Nachfrage nach Blutpräparaten<br />
entgegengesetzt entwickeln. Dadurch werden weitaus stärkere Anstrengungen nötig sein,<br />
um über ausreichend Blut zu verfügen.<br />
Neben diesen demografischen Prognosen lag ein weiterer Schwerpunkt unserer<br />
Spenderstudien auf der Beschreibung und Erklärung der erheblichen regionalen<br />
Unterschiede in der Blutspendebereitschaft. Hierbei konnten wir einige Gemeinsamkeiten<br />
zwischen den Gemeinden mit sehr hohen und sehr niedrigen Spenderanteilen erkennen:<br />
besonders viele Spender fanden wir in sehr jungen Gemeinden mit einer hohen<br />
Wahlbeteiligung und einem dichten Angebot an Blutspendeterminen. Nur wenige Spender<br />
53
Forschung_________________________________________________________________<br />
gab es dagegen in sehr großen Gemeinden mit einem hohen Altersdurchschnitt, einer hohen<br />
Arbeitslosigkeit und vielen Migranten. Die hohe Erklärungskraft der Termindichte, die wir in<br />
diesem Zusammenhang feststellen konnten, unterstreicht die Bedeutung eines adäquaten<br />
Spendeangebotes und belegt, wie wichtig die vielen mobilen Spendetermine <strong>des</strong> DRK-<br />
Blutspendedienstes sind.<br />
Schließlich haben wir uns den Erstspenderjahrgang <strong>des</strong> Jahres 2005 etwas genauer<br />
angeschaut, um zu klären, unter welchen Bedingungen aus Erstspendern regelmäßige<br />
Spender werden, die dem DRK-Blutspendedienst über mehrere Jahre treu bleiben. Aus den<br />
Berichten ausländischer Spendedienste und aus <strong>des</strong>kriptiven Auswertungen unserer<br />
Spenderdatenbank wussten wir, dass bedauerlicherweise nur relativ wenige Erstspender<br />
tatsächlich regelmäßig wiederkehren. Mit Hilfe einer umfangreichen schriftlichen Befragung,<br />
die wir mit tatkräftiger Unterstützung der Spenderhotline durchgeführt haben, konnten wir<br />
jene Spender näher beschreiben, die auch vier Jahre nach ihrer Erstspende noch aktiv<br />
waren. So waren dies vor allem sehr junge Erstspender und Erstspender im<br />
fortgeschrittenen Alter, Erwerbstätige sowie Spender, die in ihrem Freun<strong>des</strong>- und<br />
Bekanntenkreis Kontakt zu anderen Spendern hatten. Eine schnelle Rückkehr im Anschluss<br />
an die Erstspende erwies sich ebenfalls als vorteilhaft für die längerfristige Spenderbindung.<br />
Nicht mehr aktiv waren dagegen vor allem Spender, die zwischenzeitlich umgezogen sind,<br />
die mit ihrem letzten Spendeerlebnis unzufrieden waren oder die von körperlichen<br />
Beeinträchtigungen im Anschluss an die Spende berichteten. Diese Charakterisierungen<br />
spiegeln sich auch in den Aussagen der inaktiven Spender zu den Gründen ihrer<br />
ausbleibenden Rückkehr: Hier wurden am häufigsten medizinische Gründe, Umzüge und<br />
Auslandreisen genannt.<br />
Neben dieser umfangreichen Befragung konnten wir zwei ergänzende Erhebungen<br />
durchführen, die wir momentan noch auswerten. Erstens haben wir den zuvor eingesetzten<br />
Fragebogen auch an entschädigte Spender aus Heidelberg und Tübingen geschickt, um zu<br />
prüfen, ob sich die oben beschriebenen Zusammenhänge auch in dieser speziellen Gruppe<br />
abzeichnen oder es durch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung zu Unterschieden in<br />
der Spenderbindung kommt. Zweitens haben wir im Rahmen der Einführung <strong>des</strong><br />
bun<strong>des</strong>einheitlichen Spenderfragebogens eine Spenderbefragung durchgeführt, um mehr<br />
darüber zu erfahren, wie die Spender <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes die verschiedenen<br />
Dimensionen <strong>des</strong> Fragebogens wahrgenommen haben. Das Forschungsprojekt zu<br />
Spenderstudien ist daher noch nicht abgeschlossen. Angesichts der deutlichen<br />
demografischen Veränderungen, die auf uns zukommen werden, sind wir davon überzeugt,<br />
dass derartige Spenderstudien zukünftig noch wichtiger werden und einen Beitrag leisten<br />
könnten, damit auch weiterhin jeder Patient die optimale Versorgung mit Blutpräparaten<br />
erhalten kann.<br />
54
Forschung_________________________________________________________________<br />
3.2 Drittmittel<br />
3.2.1 Öffentliche Drittmittel<br />
Laufzeit Projektnummer Förderinstituti<br />
on<br />
01.09.2003 –<br />
31.8.2005<br />
01.09.2005 –<br />
31.12.2012<br />
01.09.2005 –<br />
31.08.2009<br />
01.01.2006 -<br />
31.03.2009<br />
2006<br />
01.07.2006 –<br />
31.03.20<strong>10</strong><br />
01.01.2009 –<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
04/<strong>2011</strong>-04/2013<br />
DJCLS-R03/18<br />
01GN0531<br />
01GN0939<br />
START-MSC 1+2<br />
TR 23/1 TP:C02<br />
Transregio-SFB<br />
LSHB-CT-2005-018999<br />
Osteocord “Bone from Blood”<br />
HBFG 125/698-1<br />
FACS-ARIA I<br />
BU 1795/3-1 und /3-2:<br />
Charakterisierung der molekularen<br />
Grundlagen <strong>des</strong> Aspirin-like<br />
Defekts bei pädiatrischen<br />
Patienten und deren Familien<br />
223236<br />
CASCADE<br />
OPP<strong>10</strong>33364<br />
CCR5 Datei Screening<br />
Jose-Carreras<br />
Leukämie-<br />
Stiftung e.V.<br />
BMBF<br />
Fördersumme<br />
(Institut)<br />
278.480 €<br />
150.000 €<br />
241.023 €<br />
DFG 337.200 €<br />
EU 380.040 €<br />
HBFG 427.000 €<br />
DFG 156.000 €<br />
EU 146.400 €<br />
Bill & Melinda<br />
Gates<br />
foundation<br />
70.000 €<br />
2.186.143 €<br />
55
Forschung_________________________________________________________________<br />
3.2.2 Industriemittel<br />
Laufzeit Projektnummer Förderinstituti<br />
on<br />
<strong>2002</strong> - 2006<br />
2007 - 2009<br />
Einführung und Validierung der<br />
Pathogeninaktivierung<br />
Pathogeninaktivierung von<br />
Thrombozytenkonzentraten unter<br />
Verwendung der Mirasol-<br />
Technologie<br />
Fördersumme<br />
(Institut)<br />
Fa. Cerus 130.800 €<br />
Fa. Caridian<br />
BCT<br />
81.000 €<br />
211.800 €<br />
56
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
3.3 Ausgerichtete Kongresse<br />
3.3.1 37. Jahreskongress Deutsche Gesellschaft für<br />
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie e.V.<br />
57
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
58
Ausgerichtete Kongresse ______________________________________________<br />
3.3.2 3. Internationaler Workshop: Multipotent Stromal Cells (MSCs)<br />
for Regenerative Medicine and Immune Regulation<br />
2009 haben Frau Dr. Bieback aus dem Institut<br />
Mannheim und Herr Dr. Henschler aus dem dem<br />
Institut Frankfurt den 3. Internationalen MSc<br />
Workshop organisiert. Den mehr als 150<br />
internationalen Teilnehmern wurde ein informatives<br />
Programm geboten: von der Biologie der MSC bis zu<br />
ihrem klinischen Potential. Ergänzt wurden die<br />
Vorträge durch eine hochkarätige Postersitzung, bei<br />
der aktuelle Forschungsthemen intensiv und sehr<br />
kosntruktiv erörtert wurden. Hier gab sich<br />
Gelegenheit zum intensiven wissenschaftlichen<br />
Austausch, während das anschließende Dinner<br />
Gelegenheit bot, Kontakte zu intensivieren.<br />
59
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
Dirk Strunk, Karen Bieback, Tomo Saric, Karin Tarte, Luc Sensebe, Hermann Eichler,<br />
Moustapha Kassem, Francesco Dazzi, Hubert Schrezenmeier, Darwin Prockop,<br />
Mandy Schwalbe, Torsten J. Schulze; Marianna Karagianni,<br />
Massimo Dominici, Reinhard Henschler<br />
60
Ausgerichtete Kongresse ______________________________________________<br />
3.3.3 BSD Forschungsseminar 2006<br />
Forschungssemminar 2006 <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes<br />
Baden-Württemberg – Hessen – gGmbH<br />
Karlsruhe 17. – 18.11.2006<br />
Freitag 17.11.2006<br />
09:00 – 09:30 H. Klüter Begrüßung und Einführung in das<br />
Forschungsseminar<br />
09:30 - <strong>10</strong>:45<br />
Sitzung: Hämotherapie – Sicherheit von Blutprodukten (HT) Chair: H.<br />
Klüter<br />
09:30 – 09:50 H. Schrezenmeier Ulm Bakterielle Kontamination von<br />
Thrombozytenkonzentraten (BacT-Alert-<br />
Studie)<br />
09:50 – <strong>10</strong>:05 K. Janetzko Mannheim Nachweis der photochemischen<br />
Pathogeninaktivierung mittels PCR und<br />
Bioanalyse<br />
<strong>10</strong>:05 – <strong>10</strong>:25 M. Schmidt Frankfurt Neue Entwicklungen in der Virusdiagnostik<br />
<strong>10</strong>:25 – <strong>10</strong>:45 C. Seidl Frankfurt EUBIS, ein Projekt zur Harmonisierung von<br />
Qualität und Sicherheit von Blutkomponenten<br />
im Rahmen der Europäische Directiven<br />
<strong>10</strong>:45 – 11:15 Kaffee - Pause<br />
11:15 – 12:45 Sitzung: Transplantationsimmunologie (TI) Chair: C. Seidl<br />
11:15 – 11:45 J. Mytilineos Ulm Zytokin SNP-Diagnostik: 1. Luminex<br />
„FlexMap Carboxy Bead“ Technologie 2.<br />
Zytokinpolymorphismen in der<br />
Stammzelltransplantation<br />
11:45 – 12:00 C. Seidl Frankfurt NK-Zellrezeptorpolymorphismen<br />
12:00 – 12:15 M. Müller-Steinhardt IL6-Promotor-Polymorphismen<br />
Mannheim<br />
12:15 – 12:30 K. Hirv Ulm Die Häufigkeit und Charakterisierung neuer<br />
HLA-Allele<br />
12:30 – 12:45 Marx Ulm Linienspezifische STR-basierte<br />
Chimärismusanalyse nach allogener<br />
Stammzelltransplantation<br />
12:45 – 13:45 Mittagspause<br />
13:45 – 15:45 Sitzung: Stammzelltransplantation und experimentelle Zelltherapie (ST)<br />
Chair: H. Schrezenmeier<br />
13:45 – 14:30 Herr Koglin Tübingen Herstellungserlaubnis für Zelltherapeutika<br />
und Gewebezubereitungen<br />
61
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
14:30 – 14:45 H. Schrezenmeier Ulm Tätigkeitsbericht der AG Mesenchymale<br />
Stammzellen<br />
14:45 – 15:00 M. Wiesneth Ulm Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte der<br />
Arbeitsgruppe<br />
15:00 – 15:15 K. Bieback Mannheim Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte der<br />
Arbeitsgruppe<br />
15:15 – 15:30 R. Henschler Frankfurt Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte der<br />
Arbeitsgruppe<br />
15:30 – 15:45 T. Tonn Frankfurt Zelltherapie-Projekte in klinischer<br />
Anwendung<br />
15:45 – 16:00 R. Schäfer Tübingen MSC-labeling, kardiomyogene Diff. von MSC<br />
16:00 – 17:30 Kaffee und Posterbegehung (ST)<br />
E. Deak<br />
Frankfurt<br />
C. Ströbele<br />
Frankfurt<br />
B. Rüster<br />
Frankfurt<br />
R. Richter<br />
Frankfurt<br />
M. Waidmann<br />
Tübingen<br />
S. Elvers-<br />
Hornung<br />
Mannheim<br />
S. Kern<br />
Mannheim<br />
A. Kocaömer<br />
Mannheim<br />
A.T. Ha<br />
Mannheim<br />
V. Mailänder<br />
Ulm<br />
V. Mailänder<br />
Ulm<br />
M. Rojewski,<br />
Ulm<br />
Rolle von Stammzellen in der Tumorangiogenese<br />
Erythropoetische Differenzierung hämatopoetischer Stammzellen<br />
Mausmodelle der Leukämie<br />
Mechanismen <strong>des</strong> Homings mesenchymaler Stammzellen<br />
Isolation und Herstellung von Langerhans’schen Inseln<br />
Endothelvorläuferzellen aus Nabelschnurblut<br />
Charakterisierung mesenchymaler Stammzellen nach Langzeitkultur<br />
Humane Alternativen zu FCS bei der Isolation und Expansion von MSC<br />
Analyse differentieller Gen- und Proteinexpression in MSC<br />
Markierung von (Stamm-) Zelltherapeutika<br />
Immunsuppressive Eigenschaften von mesenchymalen Stammzellen<br />
„Ex-vivo“ Expansion von MSC<br />
M. Rojewski<br />
Ulm<br />
Hocheffiziente genetische Markierung humaner hämatopoetischer und<br />
mesenchymaler Stammzellen mit mRNA-Transfer<br />
17:30 – 18:00 H. Schrezenmeier Ulm Zusammenfassung und Ausblick (ST)<br />
Stammzellforschung im BSD: status quo et<br />
quo vadis<br />
18:30 Aben<strong>des</strong>sen und Weinprobe in Pleisweiler (Abfahrt mit dem Bus)<br />
62
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
Samstag 18.11.2006<br />
09:00 - <strong>10</strong>:00 Sitzung: Gentherapie angeborener Erkrankungen <strong>des</strong> Blutes (GT)<br />
Immundefekte (ID) Chair: S. Meuer<br />
09:00 – 09:20 K. Schwarz Ulm Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte<br />
der Arbeitsgruppe<br />
09:20 – 09:40 T. Tonn Frankfurt Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte der<br />
Arbeitsgruppe<br />
09:40 – <strong>10</strong>:00 J. Schüttrumpf Frankfurt Gentherapie für Hämophilie<br />
<strong>10</strong>:00 - 11:20 Sitzung: Hämostaseologie (HS) Chair: T. Tonn<br />
<strong>10</strong>:00 – <strong>10</strong>:20 R. Großmann Frankfurt Thrombozyten: Ihre Rolle in Hämostase und<br />
Inflammation<br />
<strong>10</strong>:20 – <strong>10</strong>:40 C. Geisen Frankfurt Neue Aspekte zur Molekulargenetik der<br />
Gerinnung und <strong>des</strong> Vitamin K-Stoffwechsels<br />
<strong>10</strong>:40 – 11:00 P. Bugert Mannheim Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte der<br />
Arbeitsgruppe<br />
11:00 – 11:20 A. Schedel Mannheim Molekulare Charakterisierung <strong>des</strong> Aspirin-like<br />
Defekts bei pädiatrischen Patienten und<br />
deren Familien<br />
11:20 – 13:30 Lunch und Posterbegehung (GT, ID, HS)<br />
F. Radecke<br />
Ulm<br />
D. Niewolik<br />
Ulm<br />
S. Roth<br />
Frankfurt<br />
K. Sittinger<br />
Frankfurt<br />
A. Schedel<br />
Mannheim<br />
K. Stamer<br />
Mannheim<br />
I. Klaus<br />
Mannheim<br />
N. Kollinger<br />
Mannheim<br />
G. Rink<br />
Mannheim<br />
Olignukleotid-vermittelte Gen-Korrektur in Gegenwart eines definierten DNA-<br />
Doppelstrang-Bruches<br />
Two DNA-PKcs dependent mo<strong>des</strong> in the activation of Artemis<br />
endonucleolytic features<br />
Optimierung der rekombinanten Faktor VIII – Produktion<br />
Combined Coagulation Factor Deficiency<br />
Dopamine is a co-activator for platelet adhesion to collagen and acts via D2-<br />
like-receptors<br />
Charakterisierung <strong>des</strong> CD40L Gens bei Patienten mit Lupus Antikoagulanz<br />
Sequenzanalyse von Genen <strong>des</strong> Arachidonsäure-Stoffwechsels<br />
Pränatale HPA–Genotypisierung aus maternalem Plasma<br />
Seltene Varianten im ABO-Blutgruppensystem: Genotyp-Phänotyp-<br />
Korrelation<br />
13:30 – 15:00 Sitzung: Immunhämatologie (IH) Chair: E. Richter<br />
13:30 – 13:50 P. Bugert Mannheim Tätigkeitsbericht AG Molekulare Diagnostik<br />
63
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
13:50 – 14:<strong>10</strong> W. A. Flegel Ulm Übersicht: aktuelle Forschungsprojekte der<br />
Arbeitsgruppe<br />
14:<strong>10</strong> – 14:25 I. von Zabern Ulm RHD Genträger unter D negativen<br />
Blutspendern: Bedeutung für die Routine im<br />
Blutspendedienst<br />
14:25 – 14:45 E. A. Scharberg Baden-<br />
Baden<br />
Serologie und molekulare Grundlagen neuer<br />
RH-Varianten<br />
14:45 – 15:00 C. Geisen Frankfurt Leistungsbewertung eines neuen „Lateral-<br />
Flow-Assays“ (MDmulticard) zur<br />
Blutgruppenbestimmung<br />
15:00 H. Klüter Abschluss Resumée<br />
64
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
65
Ausgerichtete Kongresse ______________________________________________<br />
3.3.4 BSD Forschungsseminar <strong>2011</strong><br />
BSD Forschungssemminar <strong>2011</strong><br />
<strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen – gGmbH<br />
Lohr am Main, 17.-19. November<br />
Tagungshotel Franziskushöhe<br />
Programmübersicht<br />
Donnerstag 17.11.<strong>2011</strong><br />
ab 18:30<br />
individuelle Anreise<br />
Möglichkeit zum gemeinsamen Aben<strong>des</strong>sen (Vesperbuffet)<br />
Freitag 18.11.<strong>2011</strong><br />
09:00 – 09:45 Begrüßung und Einführung<br />
09:00 – 09:15<br />
H. Klüter<br />
H. Schrezenmeier<br />
Begrüßung<br />
09:15 – 09:30 R. Henschler Vorstellung <strong>des</strong> Forschungsberichts<br />
09:30 – 09:45 P. Bugert Einführung in das Programm <strong>des</strong> Forschungsseminars<br />
Forschungsschwerpunkt Transplantationsmedizin und Immungenetik<br />
Vorsitz: G. Hütter, T. Giese<br />
09:45 – <strong>10</strong>:45 Berichte aus den Arbeitsgruppen<br />
<strong>10</strong>:45 – 11.30 Kaffeepause mit Postersession<br />
Forschungsschwerpunkt Qualitätssicherung in der Blutversorgung<br />
Vorsitz: G. Siegel, J. Schüttrumpf<br />
09:45 – <strong>10</strong>:45 Berichte aus den Arbeitsgruppen<br />
12:30 – 13:30 Mittagessen<br />
Forschungsschwerpunkt Molekulare Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie<br />
Vorsitz: H. Bönig, P. Bugert<br />
13:30 – 15:00 Berichte aus den Arbeitsgruppen<br />
15:00 – 15:45 Doktorandensymposium<br />
66
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
15:45 – 17:00 Kaffeepause mit Postersession<br />
Forschungsschwerpunkt Stammzellen und Zelltherapie<br />
Vorsitz: M. Wiesneth, M. Müller-Steinhardt<br />
17:00 -19:15 Berichte aus den Arbeitsgruppen<br />
Ab 19:30<br />
Aben<strong>des</strong>sen und Abendprogramm<br />
Samstag 19.11.<strong>2011</strong><br />
Forschungsschwerpunkt Stammzellen und Zelltherapie<br />
Vorsitz: K. Schwarz, K. Bieback<br />
08:30 – <strong>10</strong>:00 Doktorandensymposium (Teil 1)<br />
<strong>10</strong>:00 – <strong>10</strong>:45 Kaffeepause mit Postersession<br />
<strong>10</strong>:45 – 11:45 Doktorandensymposium (Teil 2)<br />
09:00 – 09:45 Begrüßung und Einführung<br />
11:45 – 12:30 K. Schilling INNOVECTIS GmbH: Umgang mit und Schutz von<br />
Erfindungen<br />
12:30 – 13:00 Prof. Klüter Abschlußdiskussion<br />
67
Ausgerichtete Kongresse______________________________________________________<br />
<strong>10</strong>5 Teilnehmer aus den Instituten Baden-Baden, Dresden, Frankfurt, Heidelberg,<br />
Mannheim, Tübingen, Ulm.<br />
54 Beiträge (davon 17 Posterpräsentationen) über Forschungsprojekte in den vier<br />
Forschungsschwerpunkten <strong>des</strong> BSD.<br />
68
Veröffentlichungen ______________________________________________<br />
3.4 Veröffentlichungen<br />
3.4.1 Publikationstatistik<br />
Die Publikationsleistung der Mitarbeiter wird anhand von Bewertungszahlen, die aus dem<br />
jeweiligen Impact Factor der Zeitschrift, der Rangfolge und Anzahl der Autoren und der Art<br />
der Publikation kalkuliert wird, berechnet. Über die Jahre 2000 bis <strong>2011</strong> zeichnete sich als<br />
Trend eine kontinuierliche Zunahme der Publikationen, insbesondere aber der Qualität der<br />
Publikationen, ab.<br />
3.4.2 Veröffentlichungen<br />
Originalarbeiten<br />
Ahmad-Nejad P, Denz C, Zimmer W, Wacker J, Bugert P, Weiss C, Quintel M, Neumaier M.<br />
The presence of functionally relevant toll-like receptor polymorphisms does not significantly<br />
correlate with development or outcome of sepsis. Genet Test Mol Biomarkers.15(9):645-51.<br />
(<strong>2011</strong>)<br />
Allers K, Hütter G, Hofmann J, Loddenkemper C, Rieger K, Thiel E, Schneider T. Evidence<br />
for the cure of HIV infection by CCR5∆32/∆32 stem cell transplantation. Blood 117(<strong>10</strong>):2791-<br />
9. (<strong>2011</strong>)<br />
Ambruso DR, Thurman G, Tran K, Marschner S, Gathof B, Janetzko K, Goodrich RP.<br />
Generation of neutrophil priming activity by cell-containing blood components treated with<br />
69
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
pathogen reduction technology and stored in platelet additive solutions. Transfusion.<br />
51(6):1220-7 (<strong>2011</strong>).<br />
Amouyel P, Arveiler D, Boekholdt SM, Braund P, Bruse P, Bumpstead SJ, Bugert P,<br />
Cambien F, Danesh J, Deloukas P, Döhring A, Ducimetière P, Dunn RM, El Mokhtari NE,<br />
Erdmann J, Evans A, Ewels P, Ferrières J, Fischer M, Frossard P, Garner S, Gieger C, Gohri<br />
MJR, Goodall AH, Götz A, Hall A, Hardwick R, Haukijärvi A, Hengstenberg C, Illig T,<br />
Karvanen J, Kastelein J, Kee F, Khaw KT, Klüter H, Koenig IR, Kuulasmaa K, Laiho P, Luc<br />
G, März W, McGinnis R, McLaren W, Meisinger C, Morrison C, Ou X, Ouwehand WH,<br />
Preuss M, Proust C, Ravindrarajah R, Renner W, Rice K, Ruidavets JB, Saleheen D,<br />
Salomaa V, Samani NJ, Sandhu MS, Schäfer AS, Scholz M, Schreiber S, Schunkert H,<br />
Silander K, Singh R, Soranzo N, Stark K, Stegmayr B, Stephens J, Thompson J, Tiret L, Trip<br />
MD, van der Schoot E, Virtamo J, Wareham NJ, Wichmann EH, Wiklund PG, Wright B,<br />
Ziegler A, Zwaginga JJ: Large scale association analysis of novel genetic loci for coronary<br />
artery disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 29: 774-780 (2009).<br />
Angstmann M, Brinkmann I, Bieback K, Breitkreutz D, Maercker C. Monitoring human<br />
mesenchymal stromal cell differentiation by electrochemical impedance sensing.<br />
Cytotherapy. 13(9):<strong>10</strong>74-89 (<strong>2011</strong>).<br />
Backhaus, J; Mueller, R; Formanski, N; Szlama, N; Meerpohl, HG; Eidt, M; Bugert, P :<br />
Diagnosis of breast cancer with infrared spectroscopy from serum samples. VIBRATIONAL<br />
SPECTROSCOPY. 52 (2): 173-177 (20<strong>10</strong>).<br />
Beck C, Nguyen XD, Klüter H, Eichler H: Effect of recombinant human deoxyribonuclease<br />
on the expression of cell adhesion molecules of thawed and processed cord blood<br />
hematopoietic progenitors. Eur J Haematol 70:136-142 (2003)<br />
Bhatti, FA; Uddin, M; Ahmed, A; Bugert, P. Human platelet antigen polymorphisms (HPA-1,-<br />
2,-3,-4,-5 and-15) in major ethnic groups of Pakistan. TRANSFUSION MEDICINE. 20 (2): 78-<br />
87 (20<strong>10</strong>).<br />
Bieback K, Hecker A, Kocaömer A, Lannert H, Schallmoser K, Strunk D, Klüter H: Human<br />
Alternatives to Fetal Bovine Serum for the Expansion of Mesenchymal Stromal Cells from<br />
Bone Marrow. Stem Cells. 27: 2331-2341 (2009).<br />
Bieback K, Kern S, Klüter H, Eichler H: Evaluation of Critical Parameters for Efficient<br />
Isolation of Mesenchymal Stem Cells from Umbilical Cord Blood. Stem Cells. 22: 625-634<br />
(2004).<br />
Bieback, K; Ha, VAT; Hecker, A; Grassl, M; Kinzebach, S; Solz, H; Sticht, C; Klüter, H;<br />
Bugert, P. Altered Gene Expression in Human Adipose Stem Cells Cultured with Fetal<br />
Bovine Serum Compared to Human Supplements. TISSUE ENGINEERING PART A. 16<br />
(11): 3467-3484 (20<strong>10</strong>).<br />
Bruchmüller I, Janetzko K, Bugert P, Mayaudon V, Corash L, Lin L, Klüter H: Polymerase<br />
chain reaction inhibition assay documenting the Amotosalen based Photochemical Pathogen<br />
Inactivation process of platelet concentrates. Transfusion. 45; 1464-1472 (2005).<br />
Bruchmüller I, Lösel R, Bugert P, Corash L, Lin L, Klüter H, Janetzko K: Effect of<br />
photochemical psoralen treatment on mitochondrial DNA in platelets. Platelets. 16: 441-445<br />
(2005).<br />
Buchweitz O, Matthias S, Müller-Steinhardt M, Malik E: Laparoscopy in patients over 60<br />
years old: a prospective, randomized evaluation of laparoscopic versus open adnexectomy.<br />
Am J Obstet Gynecol. 193: 1364-1368 (2005).<br />
Bugert P, Dugrillon A, Günaydin A, Eichler H, Klüter H: Messenger RNA Profiling of<br />
Human Platelets by Microarray Hybridization. Thromb Haemost. 90:738-748 (2003)<br />
Bugert P, Elmas E, Stach K, Weiss C, Kälsch T, Dobrev D, Borggrefe M. No evidence for an<br />
association between the rs2824292 variant at chromosome 21q21 and ventricular fibrillation<br />
70
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
during acute myocardial infarction in a German population. Clin Chem Lab Med. 49(7):1237-<br />
9 (<strong>2011</strong>).<br />
Bugert P, Hoffmann M, Winkelmann B, Vosberg M, Jahn J, Entelmann M, Katus H, März W,<br />
MansmannU, Boehm B, Goerg S, Klüter H: The variable number of tandem repeat<br />
polymorphism in the P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) gene is not associated with<br />
coronary heart disease. J Mol Med. 81:495-501 (2003)<br />
Bugert P, Lese A, Meckies J, Zieger W, Eichler H, Klüter H: Optimized sensitivity of allelespecific<br />
PCR for prenatal typing of human platelet alloantigen single nucleotide<br />
polymorphisms. Biotechniques. 35:170-174 (2003)<br />
Bugert P, McBride S, Smith G, Dugrillon A, Klüter H, Ouwehand WH, Metcalfe P:<br />
Microarray based genotyping for blood groups; comparison of gene array and nuclease<br />
assay techniques using HPA as a model. Transfusion. 45; 654-659 (2005).<br />
Bugert P, Pabinger I, Stamer K, Vormittag R, Skeate RC, Wahi MM, Panzer S: The risk for<br />
thromboembolic disease in lupus anticoagulant patients due to pathways involving P-Selectin<br />
and CD154. Thromb Haemost. 97: 573-580 (2007).<br />
Bugert P, Scharberg EA, Geisen C, von Zabern I, Flegel WA: RhCE protein variants in<br />
South-western Germany detected by serological routine testing. Transfusion. 49: 1793-1802<br />
(2009).<br />
Bugert P, Scharberg EA, Janetzko K, Rink G, Panter K, Richter E, Klüter H: A novel<br />
variant B allele of the ABO blood group gene associated with lack of B antigen expression.<br />
Transfusion Med Immunother. 35: 319-323 (2008).<br />
Bugert P, Vosberg M, Entelmann M, Jahn J, Katus HA, Klüter H: Polymorphisms in the P-<br />
selectin (CD62P) and P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) genes and coronary heart<br />
disease. Clin Chem Lab Med. 42: 997-<strong>10</strong>04 (2004).<br />
Bugert, P; Nguyen, XD; Klüter, H; Panzer, S Frequency of glycoprotein IIIa gene variants<br />
that cause HPA-1 genotyping discrepancies. VOX SANGUINIS. 99 (3): 299-300 (20<strong>10</strong>).<br />
Burwinkel B, Wirtenberger M, Klaes R, Schmutzler R, Grzybowska E, Försti A, Frank B,<br />
Bermejo JL, Bugert P, Wappenschmidt B, Butkiewicz D, Pamula J, Pekala W, Zientek H,<br />
Mielzynska D, Siwinska E, Bartram CR, Hemminki K: Association of NCOA3 (AIB1)<br />
polymorphisms with familial breast cancer. Clin Cancer Res. 11: 2169-2174 (2005).<br />
Butterworth AS, Braund PS, Farrall M, Hardwick RJ, Saleheen D, Peden JF, Soranzo N,<br />
Chambers JC, Sivapalaratnam S, Kleber ME, Keating B, Qasim A, Klopp N, Erdmann J,<br />
Assimes TL, Ball SG, Balmforth AJ, Barnes TA, Basart A, Baumert J, Bezzina CR,<br />
Boerwinkle E, Boehm BO, Brocheton J, Bugert P, Cambien F, Clarke R, Codd V, Collins R,<br />
Couper D, Cupples LA, de Jong JS, Ejebe K, Elbers CC, Elliott P, Fornage M, Franzosi MG,<br />
Frossard P, Garner S, Goel A, Goodall AH, Hengstenberg C, Hunt SE, Kastelein JJP,<br />
Klungel OH, Klüter H, Koch K, Konig IR, Kooner AS, Laaksonen R, Lathrop M, Li M, Linsel-<br />
Nitschke P, Liu K, McPherson R, Musameh MD, Musani S, Nelson CP, O’Donnell CJ, Ongen<br />
H, Papanicolaou G, Peters A, Peters BJM, Potter S, Psaty BM, Qu L, Rader DJ, Rasheed A,<br />
Rice C, Scott J, Seedorf U, Sehmi JS, Sotoodehnia N, Stark K, Stephens J, van der Schoot<br />
CE, van der Schouw YT, Thorsteinsdottir U, Tomaszewski M, van der Harst P, Vasan RS,<br />
Wilde AAM, Willenborg C, Winkelmann BR, Zaidi M, Zhang W, Ziegler A, de Bakker PIW,<br />
Koenig W, Marz W, Trip MD, Reilly MP, Kathiresan S, Schunkert H, Hamsten A, Hall AS,<br />
Kooner JS, Thompson SG, Thompson JR, Deloukas P, Ouwehand WH, Watkins H, Danesh<br />
J, Samani NJ. Large-scale gene-centric analysis identifies novel variants for coronary artery<br />
disease. PLoS Genet. 7(9):e<strong>10</strong>02260 (<strong>2011</strong>).<br />
Catucci, I; Yang, RX; Verderio, P; Pizzamiglio, S; Heesen, L; Hemminki, K; Sutter, C;<br />
Wappenschmidt, B; Dick, M; Arnold, N; Bugert, P; Niederacher, D; Meindl, A; Schmutzler,<br />
RK; Bartram, CC; Ficarazzi, F; Tizzoni, L; Zaffaroni, D; Manoukian, S; Barile, M; Pierotti, MA;<br />
Radice, P; Burwinkel, B; Peterlongo, P. Evaluation of SNPs in miR-146a, miR196a2 and<br />
71
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
miR-499 as Low-penetrance Alleles in German and Italian Familial Breast Cancer Cases.<br />
HUMAN MUTATION, 31 (1): (20<strong>10</strong>).<br />
Christiansen JF, Hartwig D, Bechtel JF, Klüter H, Sievers H, Schönbeck U, Bartels C:<br />
Diseased vein grafts express elevated inflammatory cytokine levels compared with<br />
atherosclerotic coronary arteries. Ann Thorac Surg. 77:1575-1579 (2004).<br />
Doss F, Menard J, Hauschild M, Kreutzer HJ, Mittlmeier T, Müller-Steinhardt M, Müller B:<br />
Elevated IL-6 levels in the synovial fluid of osteoarthritis patients stem from plasma cells.<br />
Scand J Rheumatol. 36 : 136-139 (2007).<br />
Dugrillon A, Eichler H, Kern S, Klüter H: Autologous concentrated platelet-rich plasma<br />
(cPRP) for the local application in bone regeneration. Int J Oral Maxillofac Surg. 31:615-619<br />
(<strong>2002</strong>).<br />
Dugrillon A, Eichler H, Kern S, Klüter H: Herstellung von konzentriertem Plättchen-reichem<br />
Plasma (cPRP) für die oralchirurgische Augmentation. Dtsch Zahnärztl Z. 57:186-187 (<strong>2002</strong>).<br />
Eichler H, Beck C, Bernhard F, Bugert P, Klüter H: Use of recombinant human DNase for<br />
processing of a thawed umbilical cord blood transplant in a patient with relapsed acute<br />
lymphoblastic leukemia. Ann Hematol. 81:170-173 (<strong>2002</strong>).<br />
Eichler H, Beck C, Schröder B, Nguyen XD, Klüter H: Nonobese diabetic-severe combined<br />
immunodeficient mice transplantation of volume-reduced and thawed umbilical cord blood<br />
transplants following closed-system immunomagnetic cell selection. Transfusion. 42:1285-<br />
1292 (<strong>2002</strong>).<br />
Eichler H, Kern S, Beck C, Zieger W, Klüter H: Engraftment capacity of umbilical cord<br />
blood cells processed by either whole blood preparation or filtration. Stem Cells. 21:208-216<br />
(2003)<br />
Eichler H, Lese A, Meckies J, Zieger W, Klüter H, Bugert P: Prenatal HLA genotyping of<br />
uncultured amniotic fluid samples contaminated with maternal blood. Am J Obstet Gynecol.<br />
186:1366-1371 (<strong>2002</strong>).<br />
Eichler H, Nguyen XD (Co-Erstautor), Roelen D, Celluzzi CM, McKenna D, Pamphilon D,<br />
Blair A, Read EJ, Takahashi TA, Szczepiorkowski ZM; Biomedical Excellence for Safer<br />
Transfusion Collaborative: Multicenter study on in vitro characterization of dendritic cells.<br />
Cytotherapy;<strong>10</strong>:21-29 (2008).<br />
Eichler H, Seetharaman S, Latta M, Kurtz JW, Moroff G & the Biomedical Excellence for<br />
Safer Transfusion (BEST) Collaborative: Comparison of total nucleated cell measurements of<br />
UC blood samples using two hematology analyzers. Cytotherapy. 6:457-464 (2004).<br />
Elmas, E; Bugert, P; Popp, T; Lang, S; Weiss, C; Behnes, M; Borggrefe, M; Kalsch, T. The<br />
P-Selectin Gene Polymorphism Val168Met: A Novel Risk Marker for the Occurrence of<br />
Primary Ventricular Fibrillation During Acute Myocardial Infarction. JOURNAL OF<br />
CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY. 21 (11): 1260-1265 (20<strong>10</strong>).<br />
Erdmann J, Großhennig A, Braund PS, König IR, Hengstenberg C, Hall AS, Linsel-Nitschke<br />
P, Kathiresan S, Wright B, Trégouët D-A, Cambien F, Bruse P, Aherrahrou Z, Wagner A,<br />
Stark K, Schwartz SM, Salomaa V, Elosua R, Melander O, Voight BF, O'Donnell CJ,<br />
Peltonen L, Siscovick D, Altshuler D, Merlini PA, Flora Peyvandi F, Bernardinelli L, Ardissino<br />
D, Schillert A, Blankenberg S, Schnabel R, Wild P, Schwarz DF, Tiret L, Perret C, Schreiber<br />
S, El Mokhtari NE, Schäfer A, März W, Renner W, Bugert P, Klüter H, Schrezenmeir J,<br />
Rubin D, Ball SS, Balmforth AJ, Wichmann H-E, Meitinger T, Fischer M, Meisinger C,<br />
Baumert J, Peters A, Ouwehand W, Italian Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular<br />
Biology Working Group*, Myocardial Infarction Genetics Consortium*, Wellcome Trust Case<br />
Control Consortium*, Cardiogenics Consortium*, Deloukas P, Thompson JR, Ziegler A,<br />
Samani NJ, Schunkert H: Novel susceptibility locus for coronary artery disease on<br />
chromosome 3q22.3. Nat Genet. 41: 280-282 (2009).<br />
72
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Fatar M, Stroick M, Griebe M, Marwedel I, Kern S, Bieback K, Giesel FL, Zechmann C,<br />
Kreisel S, Vollmar F, Alonso A, Back W, Meairs S, Hennerici MG: Lipoaspirate-derived adult<br />
mesenchymal stem cells improve functional outcome during intracerebral hemorrhage by<br />
proliferation of endogenous progenitor cells stem cells in intracerebral hemorrhages.<br />
Neurosci Lett. 443(3):174-8 (2008).<br />
Fatar M, Stroick M, Steffens M, Senn E, Reuter B, Bukow S, Griebe M, Alonso A, Lichtner P,<br />
Bugert P, Meitinger T, Wienker TF, Hennerici MG: Single-Nucleotide Polymorphisms of<br />
MMP-2 Gene in Stroke Subtypes. Cerebrovasc Dis. 26: 113-119 (2008).<br />
Feldmann RE Jr, Bieback K, Maurer MH, Kalenka A, Burgers HF, Gross B, Hunzinger C,<br />
Klüter H, Kuschinsky W, Eichler H: Stem cell proteomes: a profile of human mesenchymal<br />
stem cells derived from umbilical cord blood. Electrophoresis. 26: 2749-2758 (2005).<br />
Findeisen P, Kloor M, Merx S, Sutter C, Woerner SM, Dostmann N, Benner A, Dondog B,<br />
Pawlita M, Dippold W, Wagner R, Gebert J, von Knebel Doeberitz M: T25 repeat in the 3'<br />
untranslated region of the CASP2 gene: a sensitive and specific marker for microsatellite<br />
instability in colorectal cancer. Cancer Res. 65: 8072-8078 (2005).<br />
Fink T, Sedlaczek H, Nguyen D, Blau W, Jackisch C: Lebensbedrohliche intrakranielle<br />
Blutung in der 28. Schwangerschaftswoche als Folge einer Autoimmunthrombozytopenie –<br />
Ein Fallbericht. Geburtsh Frauenheilk. 67: 1–5 (2007).<br />
Frank B, Bermejo JL, Hemminki K, Sutter C, Wappenschmidt B, Meindl A, Kiechle M, Bugert<br />
P, Schmutzler RK, Bartram CR, Burwinkel B: Copy number variant in the candidate tumor<br />
suppressor gene MTUS1 and familial breast cancer risk. Carcinogenesis. 28: 1442-1445<br />
(2007).<br />
Frank B, Hemminki K, Bermejo JL, Klaes R, Bugert P, Wappenschmidt B, Schmutzler RK,<br />
Burwinkel B: TP53 binding protein variants and breast cancer risk: a case-control study.<br />
Breast Cancer Res. 7: R502-505 (2005).<br />
Frank B, Hemminki K, Meindl A, Wappenschmidt B, Sutter C, Kiechle M, Bugert P,<br />
Schmutzler RK, Bartram CR, Burwinkel B. PRIP1 (BACH1) variants and familial breast<br />
cancer risk: a case-control study. BMC Cancer. 7: 83 (2007).<br />
Frank B, Hemminki K, Shanmugam K, Meindl A, Klaes R, Schmutzler RK, Wappenschmidt<br />
B, Bugert P, Bartram CR, Burwinkel B: Association of death receptor 4 haplotype 626C-<br />
683C with an increased breast cancer risk. Carcinogenesis. 26: 1975-1977 (2005).<br />
Frank B, Hemminki K, Wirtenberger M, Bugert P, Klaes R, Schmutzler RK, Wappenschmidt<br />
B, Bartram CR, Burwinkel B: The rare ERBB2 variant Ile654Val is associated with an<br />
increased familial breast cancer risk. Carcinogenesis. 26: 643-647 (2005).<br />
Frank B, Rigas SH, Bermejo JL, Wiestler M, Wagner K, Hemminki K, Reed MW, Sutter C,<br />
Wappenschmidt B, Balasubramanian SP, Meindl A, Kiechle M, Bugert P, Schmutzler RK,<br />
Bartram CR, Justenhoven C, Ko YD, Bruning T, Brauch H, Hamann U, Pharoah PP, Dunning<br />
AM, Pooley KA, Easton DF, Cox A, Burwinkel B: The CASP8 -652 6N del promoter<br />
polymorphism and breast cancer risk: a multicenter study. Breast Cancer Res Treat. 111:<br />
139-144 (2008).<br />
Frank B, Wiestler M, Kropp S, Hemminki K, Spurdle AB, Sutter C, Wappenschmidt B, Chen<br />
X, Beesley J, Hopper JL; Australian Breast Cancer Family Study Investigators, Meindl A,<br />
Kiechle M, Slanger T, Bugert P, Schmutzler RK, Bartram CR, Flesch-Janys D,<br />
Mutschelknauss E, Ashton K, Salazar R, Webb E, Hamann U, Brauch H, Justenhoven C, Ko<br />
YD, Brüning T, Silva Idos S, Johnson N, Pharoah PP, Dunning AM, Pooley KA, Chang-<br />
Claude J, Easton DF, Peto J, Houlston R; Gene Environment Interaction and Breast Cancer<br />
in Germany Group, Kathleen Cuningham Foundation Consortium for Research into Familial<br />
Breast Cancer Investigators, Australian Ovarian Cancer Study Management Group,<br />
Chenevix-Trench G, Fletcher O, Burwinkel B: Association of a common AKAP9 variant with<br />
breast cancer risk: a collaborative analysis. J Natl Cancer Inst. <strong>10</strong>0: 437-442 (2008).<br />
73
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Furlani D, Ugurlucan M, Ong L, Bieback K, Pittermann E, Westien I, Wang W, Yerebakan C,<br />
Li W, Gaebel R, Li RK, Vollmar B, Steinhoff G, Ma N: Is the intravascular administration of<br />
mesenchymal stem cells safe Mesenchymal stem cells and intravital microscopy. Microvasc<br />
Res. 77: 370-376 (2009).<br />
Gaebel R, Furlani D, Sorg H, Polchow B, Frank J, Bieback K, Wang W, Klopsch C, Ong LL,<br />
Li W, Ma N, Steinhoff G. Cell origin of human mesenchymal stem cells determines a different<br />
healing performance in cardiac regeneration. PLoS One. ;6(2):e15652 (<strong>2011</strong>).<br />
Germeyer A, Sharkey AM, Prasadajudio M, Sherwin R, Moffett A, Bieback K, Clausmeyer S,<br />
Masters L, Popovici RM, Hess AP, Strowitzki T, von Wolff M: Paracrine effects of uterine<br />
leucocytes on gene expression of human uterine stromal fibroblasts. Mol Hum Reprod.<br />
15:39-48 (2009).<br />
Goessler UR, Bieback K, Bugert P, Naim R, Schäfer C, Sadick H, Hörmann K, Riedel F:<br />
Human chondrocytes differentially express matrix modulators during in vitro expansion for<br />
tissue engineering. Int J Mol Med. 16: 509-514 (2005).<br />
Goessler UR, Bugert P, Bieback K, Baisch A, Sadick H, Klüter H, Hörmann K, Riedel F:<br />
Expression of collagen and fiber-associated proteins in human septal cartilage during in vitro<br />
dedifferentiation. Int J Mol Med. 14:<strong>10</strong>15-<strong>10</strong>22 (2004).<br />
Goessler UR, Bugert P, Bieback K, Deml M, Sadick H, Hörmann K, Riedel F: In-vitro<br />
analysis of the expression of TGFß-superfamily members during chondrogenic differentiation<br />
of mesenchymal stem cells and chondrocytes during dedifferentiation in cell culture. Cell Mol<br />
Biol Let. <strong>10</strong>; 345-362 (2005).<br />
Goessler UR, Bugert P, Bieback K, Huber K, Fleischer LI, Hörmann K, Riedel F: Differential<br />
modulation of integrin expression in chondrocytes during expansion for tissue engineering. In<br />
Vivo. 19; 501-507 (2005).<br />
Goessler UR, Bugert P, Bieback K, Sadick H, Verse T, Baisch A, Hörmann K, Riedel F: In<br />
vitro analysis of matrix proteins and growth factors in dedifferentiating human chondrocytes<br />
for tissue-engineered cartilage. Acta Otolaryngol. 125; 647-653 (2005).<br />
Goessler UR, Bugert P, Bieback K, Stern-Straeter J, Bran G, Hörmann K, Riedel F: Integrin<br />
expression in stem cells from bone marrow and adipose tissue during chondrogenic<br />
differentiation. Int J Mol Med. 21: 271-279 (2008).<br />
Goessler UR, Bugert P, Bieback K, Stern-Straeter J, Bran G, Sadick H, Hörmann K, Riedel<br />
F: In vitro-analysis of integrin-expression in stem-cells from bone marrow and cord blood<br />
during chondrogenic differentiation. J Cell Mol Med. 13: 1175-1184 (2009).<br />
Goessler, UR; Bugert, P; Kassner, S; Stern-Straeter, J; Bran, G; Sadick, H; Hormann, K;<br />
Riedel, F. In vitro analysis of radiation-induced dermal wounds. OTOLARYNGOLOGY-HEAD<br />
AND NECK SURGERY. 142 (6): 845-850 JUN 20<strong>10</strong>.<br />
Haas SL, Weiß C, Bugert P, Gundt J, Witt H, Singer MV, Berg T, Böcker U: Interleukin 18<br />
promoter variants (-137G>C and 607C>A) in patients with chronic hepatitis C: association<br />
with treatment response. J Clin Immunol 29: 620-628 (2009).<br />
Haas, SL; Muller, R; Fernan<strong>des</strong>, A; Dzeyk-Boycheva,; Wurl, S; Hohmann, J; Hemberger, S;<br />
Elmas, E; Bruckmann, M; Bugert, P; Backhaus, J. Spectroscopic Diagnosis of Myocardial<br />
Infarction and Heart Failure by Fourier Transform Infrared Spectroscopy in Serum Samples.<br />
APPLIED SPECTROSCOPY. 64 (3): 262-267 (20<strong>10</strong>).<br />
Härtel C, Adam N, Strunk T, Temming P, Müller-Steinhardt M, Schultz C.: Cytokine<br />
responses correlate differentially with age in infancy and early childhood. Clin Exp Immunol.<br />
142: 446-453 (2005).<br />
Härtel C, Rupp J, Iblher P, Puzik A, Osthues I, Schultz C, Müller-Steinhardt M:<br />
Immunomodulatory effects of Sanglifehrin A in the innate and acquired immune response of<br />
neonatal whole blood cells. Immunobiol. 214: 235-243 (2009).<br />
74
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Hintze C, Ströbele C, Rüster B, Göttig S, Bugert P, Seifried E, Henschler R: Erythrocytic<br />
precursor cells show potent shear stress resistant adhesion and home to hematopoietic<br />
tissue in vivo. Transfusion 49: 2122-2130. (2009).<br />
Hofer S, Rosenhagen C, Nakamura H, Yodoi J, Bopp C, Zimmermann JB, Goebel M,<br />
Schemmer P, Hoffmann K, Schulze-Osthoff K, Breitkreutz R, Weigand MA: Thioredoxin in<br />
human and experimental sepsis. Crit Care Med 37. 2155-2159 (2009).<br />
Hoffmann MM, Bugert P, Seelhorst U, Wellnitz B, Winkelmann BR, Boehm BO, März W: The<br />
–50G>T polymorphism of the CYP2J2 gene in coronary heart disease: the Ludwigshafen<br />
Risk and Cardiovascular Health Study. Clin Chem. 53: 539-540 (2007).<br />
Hofheinz RD, Nguyen XD, Buchheidt D, Kerowgan M, Hehlmann R, Hochhaus A: Two<br />
potential mechanisms of oxaliplatin-induced haemolytic anaemia in a single patient. Cancer<br />
Chemother Pharmacol 53.276-277 (2004).<br />
Hourfar MK, Walch LA, Geusendamm G, Dengler T, Janetzko K, Gubbe K, Frank K, Karl A,<br />
Löhr M, Sireis W, Seifried E, Schmidt M: Sensitivity and specificity of Anti-HBc screening<br />
assays – which assay is best for blood donor screening Int J Lab Hematol. 31: 649-56<br />
(2009).<br />
Hustinx H, Poole J, Bugert P, Gowland P, Still F, Fontana S, Scharberg EA, Tilley L, Daniels<br />
G, Niederhauser C: Molecular basis of the Rh antigen RH48 (JAL). Vox Sang. 96: 234-239<br />
(2009).<br />
Hütter G, Allers K, Schneider T. The additional use of viral entry inhibitors during autologous<br />
hematopoietic stem cell transplantation in patients with non-Hodgkin lymphoma and HIV-1<br />
infection. Biol Blood Marrow Transplant.. 17(4):586-7 (<strong>2011</strong>).<br />
Hütter G, Ganepola S, Thiel E, Blau IW: Correlation between the incidence of nosocomial<br />
aspergillosis and room reconstruction of a haematological ward. J Infect Prevent. <strong>10</strong>:198-203<br />
(2009).<br />
Hütter G, Kaiser M, Neumann M, Mossner M, Nowak D, Baldus CD, Gökbuget N, Hoelzer D,<br />
Thiel E, Hofmann WK. Epigenetic regulation of PAX5 expression in acute T-cell<br />
lymphoblastic leukemia. Leuk Res. 35(5):614-9 (<strong>2011</strong>).<br />
Hütter G, Letsch A, Nowak D, Poland J, Sinha P, Thiel E, Hofmann WK: High correlation of<br />
the proteome patterns in bone marrow and peripheral blood blast cells in patients with acute<br />
myeloid leukemia. J Transl Med. 7: 7 (2009).<br />
Hütter G, Neumann M, Nowak D, Klein S, Klüter H, Hofmann WK. The effect of the CCR5-<br />
delta32 deletion on global gene expression considering immune response and inflammation.<br />
J Inflamm (Lond). 8:29 (<strong>2011</strong>).<br />
Hütter G, Nowak D, Mossner M, Ganepola S, Müßig A, Allers K, Schneider T, Hofmann J,<br />
Kücherer C, Blau O, Blau IW, Hofmann WK, Thiel E: Long-Term Control of HIV by CCR5<br />
Delta32/Delta32 Stem-Cell Transplantation. N Engl J Med. 360: 692-698 (2009).<br />
Hütter G, Schulze TJ, Kopp HG, Klüter H: Granulozytenpräparate in der Versorgung von<br />
Patienten mit septischer Granulomatose. Transfusionsmedizin <strong>2011</strong> 1: 22-24<br />
Hütter G, Thiel E. Allogeneic transplantation of CCR5-deficient progenitor cells in a patient<br />
with HIV infection: an update after 3 years and the search for patient no. 2. AIDS. 25(2):273-<br />
4 (<strong>2011</strong>).<br />
Janetzko K, Bugert P. Pathogen Reduction in Blood Products: What's Behind These<br />
Techniques Transfus Med Hemother.;38(1):5-6 (<strong>2011</strong>).<br />
Janetzko K, Cazenave JP, Klüter H, Kientz D, Michel M, Beris P, Lioure B, Hastka J,<br />
Marblie S, Mayaudon V, Lin L, Lin JS, Conlan MG, Flament J: Therapeutic efficacy and<br />
safety of photochemically treated apheresis platelets processed with an optimized integrated<br />
set. Transfusion. 45: 1443-1452 (2005).<br />
75
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Janetzko K, Hinz K, Marschner S, Goodrich R, Klüter H: Evaluation of different<br />
preparations procedures of pathogen reduction technology (Mirasol®) treated platelets<br />
collected by plateletpheresis. Transfus Med Hemother. 36: 309-317 (2009).<br />
Janetzko K, Hinz K, Marschner S, Goodrich R, Klüter H: Pathogen reduction technology<br />
(Mirasol®) treated single donor platelets resuspended in a mixture of autologous plasma and<br />
PAS. Vox Sang. 97: 234-239 (2009).<br />
Janetzko K, Klinger M, Lin L, Mayaudon V, Eichler H, Klüter H: Storage characteristics of<br />
split double-dose platelet concentrates derived from apheresis and treated with amotosalen<br />
hydrochloride and UVA light for pathogen inactivation. Infus Ther Transfus Med. 29:193-198<br />
(<strong>2002</strong>).<br />
Janetzko K, Klüter H, van Waeg G, Eichler H: Fully automated processing of buffy-coatderived<br />
pooled platelet concentrates. Transfusion. 44:<strong>10</strong>52-<strong>10</strong>58 (2004).<br />
Janetzko K, Lin L, Eichler H, Mayaudon V, Flament J, Klüter H: Implementation of the<br />
INTERCEPT blood system for platelets into routine blood bank manufacturing procedures:<br />
evaluation of apheresis platelets. Vox Sang. 86:239-245 (2004).<br />
Jonas JB, Dugrillon A, Klüter H, Kamppeter B: Subconjunctival injection of autologous<br />
platelet concentrate as treatment of overfiltrating filtering bleb. Journal of Glaucoma. 12:57-<br />
58 (2003)<br />
Jöst H, Bürck-Kammerer S, Hütter G, Lattwein E, Lederer S, Litzba N, Bock-Hensley O,<br />
Emmerich P, Günther S, Becker N, Niedrig M, Schmidt-Chanasit J. Medical importance of<br />
Sindbis virus in south-west Germany. J Clin Virol. 52(3):278-9 (<strong>2011</strong>).<br />
Kälsch T, Elmas E, Nguyen XD, Grebert N, Wolpert C, Klüter H, Borggrefe M, Haase KK,<br />
Dempfle CE: Enhanced coagulation activation by in vitro lipopolysaccharide-challenge in<br />
patients with ventricular fibrillation complicating acute myocardial infarction. J Cardiovascular<br />
Electrophysiol. 16:1-6 (2005).<br />
Kälsch T, Elmas E, Nguyen XD, Kralev S, Leweling H, Klüter H, Dempfle CE, Borggrefe M:<br />
Effects of alimentary lipemia and inflammation on platelet CD40-ligand. Thromb Res.<br />
120:703-8 (2007).<br />
Kälsch T, Elmas E, Nguyen XD, Leweling H, Klüter H, Borggrefe M, Dempfle CE:<br />
Alimentary lipemia enhances procoagulatory effects of inflammation in patients with a history<br />
of acute myocardial infarction complicated by ventricular fibrillation. Int J Cardiol. 123:131-7<br />
(2008).<br />
Kälsch T, Elmas E, Nguyen XD, Suvajac N, Klüter H, Borggrefe M, Dempfle CE: Endotoxininduced<br />
effects on platelets and monocytes in an in vivo model of inflammation. Basic Res<br />
Cardiol. <strong>10</strong>2: 460-466 (2007).<br />
Kissel K, Scheffler S, Kerowgan M, Bux J: Molecular basis of NB1 (HNA-2a, CD177)<br />
deficiency. Blood. 99:4231-4233 (<strong>2002</strong>).<br />
Kleber, ME; Renner, W Grammer, TB ; Linsel-Nitschke, P; Boehm, BO; Winkelmann, BR ;<br />
Bugert, P; Hoffmann, MM; Marz, W. Association of the single nucleotide polymorphism<br />
rs599839 in the vicinity of the sortilin 1 gene with LDL and triglyceride metabolism, coronary<br />
heart disease and myocardial infarction The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health<br />
Study. ATHEROSCLEROSIS. 209 (2): 492-497 (20<strong>10</strong>).<br />
Kocaoemer A, Kern S, Klüter H, Bieback K. Human AB serum and thrombin-activated<br />
platelet-rich plasma are suitable alternatives to fetal calf serum for the expansion of<br />
mesenchymal stem cells from adipose tissue. Stem Cells. 25(5):1270-8 (2007).<br />
König D, Mattler S, Eichler H, Klüter H, Bugert P: Prevalence of the H63D and C282Y<br />
Mutations in the HFE Gene in 3015 Healthy Blood Donors. Transfus Med Hemother. 30:66-<br />
70 (2003)<br />
76
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Lauber, S; Latta, M; Klüter, H; Müller-Steinhardt, M. The Mannheim Cord Blood Bank:<br />
Experiences and Perspectives for the Future. TRANSFUSION MEDICINE AND<br />
HEMOTHERAPY. 37 (2): 90-97 (20<strong>10</strong>).<br />
Leo E, Scheuer L, Schmidt-Wolf IG, Kerowgan M, Schmitt C, Leo A, Baumbach T, Kraemer<br />
A, Mey U, Benner A, Parwaresch R, Ho AD: Significant thrombocytopenia associated with<br />
the addition of rituximab to a combination of fludarabine and cyclophosphamide in the<br />
treatment of relapsed follicular lymphoma. Eur J Haematol. 73: 251-257 (2004).<br />
Maercker C, Rogge T, Mathis H, Ridinger H, Bieback K: Development of live cell chips to<br />
monitor cell differentiation processes. Eng Life Sci. 8: 33-39 (2008).<br />
Muller MC, Erben P, Saglio G, Gottardi E, Nyvold CG, Schenk T, Ernst T, Lauber S, Kruth J,<br />
Hehlmann R, Hochhaus A: Harmonization of BCR-ABL mRNA quantification using a uniform<br />
multifunctional control plasmid in 37 international laboratories. Leukemia. 22: 96-<strong>10</strong>2 (2008).<br />
Muller MC, Erben P, Saglio G, Gottardi E, Nyvold CG, Schenk T, Ernst T, Lauber S, Kruth J,<br />
Hehlmann R, Hochhaus A: Harmonization of BCR-ABL mRNA quantification using a uniform<br />
multifunctional control plasmid in 37 international laboratories. Leukemia. 22: 96-<strong>10</strong>2 (2008).<br />
Muller-Berghaus J, Kern K, Paschen A, Nguyen XD, Klüter H, Morahan G, Schadendorf D:<br />
Deficient IL-12p70 secretion by dendritic cells based on IL12B promoter genotype. Genes<br />
Immun. 5:431-434 (2004).<br />
Müller-Steinhardt M, Ebel B, Härtel C: The impact of interleukin-6 promoter -597/-572/-<br />
174genotype on interleukin-6 production after lipopolysaccharide stimulation. Clin Exp<br />
Immunol. 147: 339-345 (2007).<br />
Müller-Steinhardt M, Schulte F, Klüter H, Bugert P: Optimized PCR with sequence<br />
specific primers (PCR-SSP) for fast and efficient determination of interleukin-6 promoter –<br />
597/–572/–174 haplotypes. BMC Research Notes. 2: 245 (2009).<br />
Müller-Steinhardt M, Wortmeier K, Fricke L, Ebel B, Härtel C: The pharmacodynamic effect<br />
of sirolimus: individual variation of cytokine mRNA expression profiles in human whole blood<br />
samples. Immunobiol. 214: 17-26 (2009).<br />
Nguyen XD, Dengler T, Schulz-Linkholt M, Klüter H. A novel tool for high-throughput<br />
screening of granulocyte-specific antibodies using the automated flow cytometric granulocyte<br />
immunofluorescence test (Flow-GIFT). ScientificWorldJournal.;11:302-9 (<strong>2011</strong>).<br />
Nguyen XD, Dugrillon A, Beck C, Kerowgan M, Klüter H: A Novel Method for<br />
Simultaneous Analysis of Specific Platelet Antibodies: SASPA. Br J Hematol. 127:552-560<br />
(2004).<br />
Nguyen XD, Eichler H, Dugrillon A, Piechaczek C, Braun M, Klüter H: Flow cytometric<br />
analysis of T cell proliferation in a mixed lymphocyte reaction with dendritic cells. J Immunol<br />
Methods. 275:57-68 (2003)<br />
Nguyen XD, Eichler H, Sucher A, Hofmann U, Schadendorf D, Klüter H: Collection of<br />
autologous monocytes for dentritic cell vaccination therapy in metastatic melanoma patients.<br />
Transfusion. 42:428-432 (<strong>2002</strong>).<br />
Nguyen XD, Flesch B, Sachs UJ, Kroll H, Klüter H, Müller-Steinhardt M: Rapid screening<br />
of granulocyte antibodies with a novel assay: flow cytometric granulocyte<br />
immunofluorescence test. Transfusion., 49: 2700-2708 (2009)<br />
Nguyen XD, La Rosée P, Nebe T, Klüter H, Dieter B, Benz E. Rapid Treatment of<br />
Leukostasis in Leukemic Mantle Cell Lymphoma using Therapeutic Leukapheresis: A Case<br />
Report. ScientificWorldJournal.;11:1554-9 (<strong>2011</strong>).<br />
Nguyen XD, Müller-Berghaus J, Kälsch T, Schadendorf D, Borggrefe M, Klüter H:<br />
Differentiation of monocyte-derived dendritic cells under the influence of platelets.<br />
Cytotherapy.;<strong>10</strong>:720-9 (2008).<br />
77
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Nguyen XD, Scherpf R, Sassenhof F, Flesch B, Klüter H. Detection of granulocyte<br />
antibodies using simultaneous analysis of specific granulocyte antibodies assay (SASGA).<br />
Vox Sang. <strong>10</strong>1(2):147-53 (<strong>2011</strong>).<br />
Nguyen XP, Kronemayer R, Herrmann P, Mejía A, Daw Z, Nguyen XD, Kränzlin B, Gretz N.<br />
Validation of a new non-invasive blood pressure measurement method on mice via pulse<br />
wave propagation time measurement on a cuff. Biomed Tech (Berl). 56(3):153-8 (<strong>2011</strong>).<br />
Nguyen, XD; Goebel, M; Schober, M; Klüter, H; Panzer, S. The detection of platelet<br />
antibodies by simultaneous analysis of specific platelet antibodies and the monoclonal<br />
antibody-specific immobilization of platelet antigens: an interlaboratory comparison.<br />
TRANSFUSION. 50 (7): 1429-1434(20<strong>10</strong>).<br />
Osen, W ; Soltek, S; Song, MX; Leuchs, B; Steitz, J; Tuting, T ; Eichmuller, SB; Nguyen, XD;<br />
Schadendorf, D; Paschen, A. Screening of Human Tumor Antigens for CD4(+) T Cell<br />
Epitopes by Combination of HLA-Transgenic Mice, Recombinant Adenovirus and Antigen<br />
Peptide Libraries. PLOS ONE. 5 (11): Art. No. e14137 ( 20<strong>10</strong>)<br />
Paschen A, Jing W, Drexler I, Klemm M, Song M, Mueller-Berghaus J, Nguyen XD, Osen W,<br />
Stevanovic S, Sutter G, Schadendorf D: Melanoma patients respond to a new HLA-A*01-<br />
presented antigenic ligand derived from a multi-epitope region of melanoma antigen TRP-2.<br />
Int J Cancer. 116: 944-948 (2005).<br />
Paschen A, Song M, Osen W, Nguyen XD, Mueller-Berghaus J, Fink D, Daniel N, Donzeau<br />
M, Nagel W, Kropshofer H, Schadendorf D: Detection of spontaneous CD4+ T-cell<br />
responses in melanoma patients against a tyrosinase-related protein-2-derived epitope<br />
identified in HLA-DRB1*0301 transgenic mice. Clin Cancer Res. 11: 5241-5247 (2005).<br />
Paschen A, Sucker A, Hill B, Moll I, Zapatka M, Nguyen XD, Sim GC, Gutmann I, Hassel J,<br />
Becker JC, Steinle A, Schadendorf D, Ugurel S: Differential clinical significance of individual<br />
NKG2D ligands in melanoma: soluble ULBP2 as an indicator of poor prognosis superior to<br />
S<strong>10</strong>0B. Clin Cancer Res.;15: 5208-5215 (2009).<br />
Puzik A, Schultz C, Iblher P, Müller-Steinhardt M, Härtel C: Effects of ciclosporin A,<br />
tacrolimus and sirolimus on cytokine production in neonatal immune cells. Acta Paediatr. 96 :<br />
1483-1489 (2007).<br />
Reuter B, Bugert P, Stroick M, Bukow S, Griebe M, Hennerici MG, Fatar M: TIMP-2 gene<br />
polymorphism is associated with intracerebral hemorrhage. Cerebrovasc Dis. 28: 558-563<br />
(2009).<br />
Rohn TA, Reitz A, Paschen A, Nguyen XD, Schadendorf D, Vogt, AB, Kropshofer H: A novel<br />
strategy for the discovery of MHC class II-restricted tumor antigens: identification of a<br />
melanotransferrin helper T-cell epitope. Cancer Res. 65: <strong>10</strong>068-<strong>10</strong>078 (2005).<br />
Rohn TA, Schadendorf D, Sun Y, Nguyen XD, Roeder D, Langen H, Vogt AB, Kropshofer:<br />
Melanoma cell necrosis facilitates transfer of specific sets of antigens onto MHC class II<br />
molecules of dendritic cells. Eur J Immunol. 35: 2826-2839 (2005).<br />
Rolf N, Bugert P, Gehrisch S, Siegert G, Suttorp M, Knöfler R: Klinische und<br />
labordiagnostische Aspekte <strong>des</strong> Aspirin-like Defekts als hereditäre Thrombozytopathie.<br />
Hämostaseologie. 29: 177-183 (2009).<br />
Rolf N, Knoefler R, Bugert P, Gehrisch S, Siegert G, Kuhlisch E, Suttorp M: Clinical and<br />
laboratory phenotypes associated with the Aspirin-like defect: a study in 17 unrelated<br />
families. Br J Haematol. 144: 416-424 (2009).<br />
Rolf N, Knoefler R, Suttorp M, Klüter H, Bugert P: Optimized procedure for platelet RNA<br />
profiling from blood samples with limited platelet numbers. Clin Chem. 51; <strong>10</strong>78-<strong>10</strong>80 (2005).<br />
Rox JM, Bugert P, Müller J, Schorr A, Hanfland P, Madlener P, Klüter H, Pötzsch B: Gene<br />
expression analysis in single donor platelets: Evaluation of a PCR-based amplification<br />
technique. Clin Chem. 50:2271-2278 (2004).<br />
78
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Sadick H, Hage J, Goessler U, Bran G, Riedel F, Bugert P, Hörmann K: Does the genotype<br />
of HHT patients with mutations of the ENG and ACVRL1 gene correlate to different<br />
expression levels of the angiogenic factor VEGF Int J Mol Med. 22: 575-580 (2008).<br />
Sadick H, Hage J, Goessler U, Stern-Straeter J, Riedel F, Hormann K, Bugert P: Novel<br />
mutations in the “Endoglin“ and “Activin receptor-like kinase” genes in German patients with<br />
hereditary hemorrhagic telangiectasia and the value of rapid genotyping using an allelespecific<br />
PCR-technique. BMC Med Genet. <strong>10</strong>: 53 (2009).<br />
Schaaf B, Rupp J, Müller-Steinhardt M, Kruse J, Boehmke F, Maass M, Zabel P, Dalhoff K:<br />
The interleukin-6 -174 promoter polymorphism is associated with extrapulmonary bacterial<br />
dissemination in Streptococcus pneumoniae infection. Cytokine. 31: 324-328 (2005).<br />
Scharberg EA, Green C, Daniels G, Richter E, Klüter H, Bugert P: Molecular Basis of the<br />
JAHK (RH53) Antigen. Transfusion. 45; 1314-1318 (2005).<br />
Schedel A, Schloss P, Klüter H, Bugert P: The dopamine agonism on ADP-stimulated<br />
platelets is mediated through D2-like but not D1-like dopamine receptors. Naunyn<br />
Schmiedebergs Arch Pharmacol. 378: 431-439 (2008).<br />
Schedel A, Thornton S, Schloss P, Klüter H, Bugert P. Human platelets express functional<br />
alpha7-nicotinic acetylcholine receptors. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 31(4):928-34 (<strong>2011</strong>).<br />
Schedel, A; Thornton, S; Klüter, H; Bugert, P. The Effect of Psychoactive Drugs on in vitro<br />
Platelet Function. TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY. 37 (5): 293-298<br />
(20<strong>10</strong>).<br />
Schulte F, Schnülle P, Bugert P, Klüter H, Müller-Steinhardt M. The interleukin-6 promoter<br />
(-597/-572/-174)genotype does not affect interleukin-6 production in hemodialysis patients. J<br />
Interferon Cytokine Res. 31(8):639-42 (<strong>2011</strong>).<br />
Schulze TJ, Weiss C, Luhm J, Brockmann C, Görg S, Hennig H. Preanalytical stability of<br />
HIV-1 and HCV RNA: impact of storage and plasma separation from cells on blood donation<br />
testing by NAT. Transfus Med. 21(2):99-<strong>10</strong>6 (<strong>2011</strong>)<br />
Seifried E, Klüter H, Weidmann C, Staudenmaier T, Schrezenmeier H, Henschler R,<br />
Greinacher A, Mueller MM. How much blood is needed Vox Sang <strong>10</strong>0:<strong>10</strong>-21 (<strong>2011</strong>)<br />
Sireis W, Rüster B, Daiss C, Hourfar MK, Capalbo G, Pfeiffer HU, Janetzko K, Goebel M,<br />
Kempf VA, Seifried E, Schmidt M. Extension of platelet shelf life from 4 to 5 days by<br />
implementation of a new screening strategy in Germany. Vox Sang <strong>10</strong>1:191-9 (<strong>2011</strong>)<br />
Stach K, Kälsch AI, Nguyen XD, Elmas E, Kralev S, Lang S, Weiss C, Borggrefe M, Kälsch<br />
T. 1α,25-dihydroxyvitamin D3 attenuates platelet activation and the expression of VCAM-1<br />
and MT1-MMP in human endothelial cells. Cardiology. 118(2):<strong>10</strong>7-15 (<strong>2011</strong>).<br />
Sun Y, Song M, Jäger E, Schwer C, Stevanovic S, Flindt S, Karbach J, Nguyen XD,<br />
Schadendorf D, Cichutek K: Human CD4+ T Lymphocytes Recognize a Vascular Endothelial<br />
Growth Factor Receptor-2-Derived Epitope in Association with HLA-DR. Clin Cancer<br />
Res.;14:4306-15 (2008).<br />
Tchatchou S, Jung A, Hemminki K, Sutter C, Wappenschmidt B, Bugert P, Weber BH,<br />
Niederacher D, Arnold N, Varon-Mateeva R, Ditsch N, Meindl A, Schmutzler RK, Bartram<br />
CR, Burwinkel B: A variant affecting a putative miRNA target site in estrogen receptor (ESR)<br />
1 is associated with breast cancer risk in premenopausal women. Carcinogenesis. 30: 59-64<br />
(2009).<br />
Tchatchou S, Wirtenberger M, Hemminki K, Sutter C, Meindl A, Wappenschmidt B, Kiechle<br />
M, Bugert P, Schmutzler RK, Bartram CR, Burwinkel B: Aurora kinases A and B and familial<br />
breast cancer risk. Cancer Lett. 247: 266-272 (2007).<br />
Tchatchou, S, Riedel, A, Lyer, S, Schmutzhard, J, Strobel-Freidekind, O, Gronert-Sum, S,<br />
Mietag, C, D'Amato, M, Schlehe, B, Hemminki, K, Sutter, C, Ditsch, N, Blackburn, A, Hill, LZ,<br />
Jerry, DJ, Bugert, P, Weber, BHF, Niederacher, D, Arnold, N, Varon-Mateeva, R,<br />
79
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Wappenschmidt, B, Schmutzler, RK, Engel, C, Meindl, A, Bartram, CR, Mollenhauer, J,<br />
Burwinkel, B,. Identification of a DMBT1 Polymorphism Associated with Increased Breast<br />
Cancer Risk and Decreased Promoter Activity. HUMAN MUTATION. 31 (1): 60-66 20<strong>10</strong>.<br />
Thornton S, Schedel A, Besenfelder S, Klüter H, Bugert P. Cholinergic drugs inhibit in<br />
vitro megakaryopoiesis via the alpha7-nicotinic acetylcholine receptor. Platelets.;22:390-5.<br />
(<strong>2011</strong>)<br />
Tregouet D-A, König IR, Erdmann J, Munteanu A, Braund PS, Hall AS, Götz A, Linsel-<br />
Nitschke P, Perret C, DeSuremain M, Meitinger T, Wright BJ, Preuss M, Balmforth AJ, Ball<br />
SG, Meisinger C, Germain C, Evans A, Arveiler D, Luc G, Ruidavets J-B, Morrison C, van<br />
der Harst P, Schreiber S, Neureuther K, Schäfer A, Bugert P, El Mokhtari NE,<br />
Schrezenmeier J, Stark K, Rubin D, Wichmann E, Hengstenberg C, Ouwehand W, Ziegler A,<br />
Tiret L, Wellcome Trust Case Control Consortium*, Cardiogenics Consortium*, Thompson<br />
JR, Cambien F, Schunkert H, Samani NJ: A genome-wide haplotype association study<br />
identifies the SLC22A3/LPAL2/LPA gene cluster as a strong susceptibility locus for coronary<br />
artery disease. Nat Genet: Genet. 41: 283-285 (2009).<br />
Vaclavicek A, Bermejo JL, Wappenschmidt B, Meindl A, Sutter C, Schmutzler RK, Kiechle M,<br />
Bugert P, Burwinkel B, Bartram CR, Hemminki K, Forsti A: Genetic variation in the major<br />
mitotic checkpoint genes does not affect familial breast cancer risk. Breast Cancer Res<br />
Treat. <strong>10</strong>6: 205-213 (2007).<br />
Van Rhenen D, Gulliksson H, Cazenave JP, Pamphilon D, Ljungman P, Klüter H, Vermeij H,<br />
Kapper-Klunne MC, de Greef GE, Laforet M, Lioure B, Davis K, Marblie S, Mayaudon V,<br />
Flament J, Conlan M, Lin L, Metzel P, Buchholz D, Corash L: Transfusion of pooled buffy<br />
coat platelet components prepared with photochemical pathogen inactivation treatment: the<br />
euroSPRITE trial. Blood. <strong>10</strong>1:2426-2433 (2003)<br />
Verderio, P, Pizzamiglio, S, Southey, MC, Spurdle, AB, Hopper, JL, Chen, XQ, Beesley, J,<br />
Schmutzler, RK, Engel, C, Burwinkel, B, Bugert, P, Ficarazzi, F, Manoukian, S, Barile, M,<br />
Wappenschmidt, B, Chenevix-Trench, G, Radice, P, Peterlongo, P,, Australian Ovarian Canc<br />
Study Grp; kConFab. A BRCA1 promoter variant (rs11655505) and breast cancer risk.<br />
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS. 47 (4): 268-270 (20<strong>10</strong>)<br />
Vossmerbaeumer U, Kuehl S, Bieback K, Klüter H, Jonas JB: Cultivation and differentiation<br />
characteristics of human limbal progenitor cells. Tissue Cell 40:83-8 (2008).<br />
Vossmerbaeumer U, Kühl S, Kern S, Klüter H, Jonas JB, Bieback K: Induction of retinal<br />
pigment epithelium properties in ciliary margin progenitor cells. Clin Experiment Ophthalmol.<br />
36: 358-366 (2008).<br />
Vossmerbaeumer U, Ohnesorge S, Kuehl S, Haapalahti M, Klüter H, Jonas JB, Thierse HJ,<br />
Bieback K: Retinal pigment epithelial phenotype induced in human adipose tissue-derived<br />
mesenchymal stromal cells. Cytotherapy. 11:177-188 (2009).<br />
Wirtenberger M, Hemminki K, Försti A, Klaes R, Schmutzler RK, Grzybowska E, Bermejo JL,<br />
Wappenschmidt B, Bugert P, Butkiewicz D, Pamula J, Pekala W, Zientek H, Bartram CR,<br />
Burwinkel B: c-MYC Asn11Ser is associated with increased risk for familial breast cancer. Int<br />
J Cancer. 117: 638-642 (2005).<br />
Yang R, Dick M, Marme F, Schneeweiss A, Langheinz A, Hemminki K, Sutter C, Bugert P,<br />
Wappenschmidt B, Varon R, Schott S, Weber BH, Niederacher D, Arnold N, Meindl A,<br />
Bartram CR, Schmutzler RK, Müller H, Arndt V, Brenner H, Sohn C, Burwinkel B. Genetic<br />
variants within miR-126 and miR-335 are not associated with breast cancer risk. Breast<br />
Cancer Res Treat. 127(2):549-54 (<strong>2011</strong>).<br />
Yang R, Frank B, Hemminki K, Bartram CR, Wappenschmidt B, Sutter C, Kiechle M, Bugert<br />
P, Schmutzler RK, Arnold N, Weber BH, Niederacher D, Meindl A, Burwinkel B: SNPs in<br />
Ultraconserved Elements and Familial Breast Cancer Risk. Carcinogenesis. 29: 351-355<br />
(2008).<br />
80
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Yang, RX, Schlehe, B, Hemminki, K, Sutter, C, Bugert, P, Wappenschmidt, B, Volkmann, J,<br />
Varon, R, Weber, BHF, Niederacher, D, Arnold, N, Meindl, A, Bartram, CR, Schmutzler, RK,<br />
Burwinkel, B,. A genetic variant in the pre-miR-27a oncogene is associated with a reduced<br />
familial breast cancer risk. BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 121: 693-702<br />
(20<strong>10</strong>)<br />
Übersichtsarbeiten, Editorials und Buchkapitel<br />
Bieback K, Kern S, Kocaömer A, Ferlik K, Bugert P: Comparing mesenchymal stromal<br />
cells from different human tissues: bone marrow, adipose tissue and umbilical cord blood.<br />
Biomed Mater Eng. 18 (Suppl): S71-6 (2008).<br />
Bieback K, Klüter H. Mesenchymal Stromal Cells from Umbilical Cord Blood. Current Stem<br />
Cell Research & Therapy. 2(4):3<strong>10</strong>-323 (2007).<br />
Bieback K, Brinkmann I: Mesenchymal stromal cells from human perinatal tissues: From<br />
biology to cell therapy. World J Stem Cells. 2(4):81-92 (20<strong>10</strong>)<br />
Bieback K, Kinzebach S, Karagianni M. Translating research into clinical scale<br />
manufacturing of mesenchymal stromal cells. Stem Cells Int. 193519 (<strong>2011</strong>).<br />
Bieback K, Schallmoser K, Klüter H, Strunk D: Clinical Protocols for the Isolation and<br />
Expansion of Mesenchymal Stromal Cells. Transf Med Hemother. 35(4): 286-295 (2008).<br />
Bieback K: Fatty Tissue: Not all Bad Optimally cultured Adipose Tissue-derived Stromal<br />
Cells improve experimentally-induced ischemia. Stem Cells Dev. 18: 531-532 (2009).<br />
Bieback K: Highlights of the 12th Annual Meeting of the International Society for Cellular<br />
Therapies (ISCT). Blood Therapies in Medicine. 5(3):126-128. (2007).<br />
Bieback. K: Basic Biology of Mesenchymal Stem Cells. Transf Med Hemother. 35(3): 151-<br />
152 (2008).<br />
Bugert P (ed.): DNA and RNA profiling in human blood. Methods in Molecular Biology 496,<br />
Humana Press, Totowa, NJ (2009).<br />
Bugert, P. Clinical and Laboratory Diagnosis of Inherited Platelet Function Disorders.<br />
TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY. 37 (5): 229-230 20<strong>10</strong>.<br />
Bugert P, Lösel R, Dugrillon A, Günaydin A, Eichler H, Wehling M, Klüter H: Gene<br />
transcripts in platelets: Just ‘junk’ RNA or prerequisites for de novo protein biosynthesis<br />
Proceed XVII Meeting Int Soc Hematol. 9-14 (2003)<br />
Bugert P: 5th international platelet forum. Blood Therapies in Medicine. 2: 112-113 (<strong>2002</strong>).<br />
Bugert P: Detection of Mycoplasma contamination. In: Cellular Therapy: Principles, Methods,<br />
and Regulations. Areman EM, Loper K (eds), AABB Press, Bethesda MD. 612-619 (2009).<br />
Bugert P: The ‘Whole Genome Age’. Transfus Med Hemother. 36: 244-245 (2009).<br />
Cassens U, Eichler H, Klüter H, Kroll H, Schlenke P, Wiesneth M: Stellungnahme der<br />
Sektion ‚Transplantation und Zelltherapie‘ der DGTI zur Transplantation hämatopoetischer<br />
Stammzellen mit Blutgruppendifferenz. Transfus Med Hemother. 31:56-60 (2004)<br />
Dugrillon A, Klüter H: Topical application of platelets for improved wound healing. Blood<br />
Therapies in Medicine. 2: 21-26 (<strong>2002</strong>).<br />
Eichler H, Burkhart J, Sputtek A, Wiesneth M: Stellungnahme der Sektion ‚Transplantation<br />
und Zelltherapie‘ der DGTI: Gewinnung und Langzeitlagerung von autologen und allogenen<br />
Stammzellpräparaten aus Nabelschnurblut: Indikationen und Grenzen. Transfus Med<br />
Hemother. 32:274-282 (2005).<br />
81
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Eichler H, Klüter H: Lehrbuchbeitrag ‚Präparate zur Therapie mit Leukozyten’. In ‚Rationelle<br />
Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten (Hämotherapie)’. Eds. Hellstern P,<br />
Seyfert UT, 2. Auflage, Uni-Med, Bremen (2005).<br />
Frank B, Bermejo JL, Hemminki K, Klaes R, Bugert P, Wappenschmidt B, Schmutzler RK,<br />
Burwinkel B: Association of a common variant of the CASP8 gene with reduced risk of breast<br />
cancer. Reply to letter to the editor. J Natl Cancer Inst. 97:<strong>10</strong>12 (2005).<br />
Hartwig D, Klüter H: Febrile and allergic reactions after transfusion of platelet<br />
concentrates.Transfus Med Hemother. 30:277-282 (2003)<br />
Humpert PM, Eichler H, Lammert A, Hammes HP, Nawroth PP, Bierhaus A: Adult vascular<br />
progenitor cells and tissue regeneration in metabolic syndrome. VASA. 34:73-80 (2005).<br />
Review<br />
Hütter G, Ganepola S, Hofmann WK: The Hematology of Anorexia Nervosa. Int J Eating<br />
Disorders. 42:293-300 (2009).<br />
Hütter G, Ganepola S. Eradication of HIV by transplantation of CCR5-deficient<br />
hematopoietic stem cells. ScientificWorldJournal. 11:<strong>10</strong>68-76 (<strong>2011</strong>).<br />
Hütter G, Ganepola S. The CCR5-delta32 polymorphism as a model to study host<br />
adaptation against infectious diseases and to develop new treatment strategies. Exp Biol<br />
Med (Maywood). 236(8):938-43 (<strong>2011</strong>).<br />
Hütter G, Zaia JA. Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with<br />
human immunodeficiency virus: the experiences of more than 25 years. Clin Exp Immunol.<br />
163:284-95 (<strong>2011</strong>)<br />
Janetzko K, Klüter H, Eichler H, Van Waeg G: Fully automated processing of buffy-coat<br />
derived pooled concentrates. Reply to letter to the editor. Transfusion. 45:642-643 (2005).<br />
Janetzko K, Klüter H: Lehrbuchbeitrag ‚Pathogeninaktivierung’. In ‚Rationelle Therapie mit<br />
Blutkomponenten und Plasmaderivaten (Hämotherapie)’. Eds. Hellstern P, Seyfert UT, 2.<br />
Auflage, Uni-Med, Bremen (2005).<br />
Klüter H, Salama A: Thrombozytenkonzentrate. In: Wissenschaftl. Beirat der<br />
Bun<strong>des</strong>ärztekammer (Hrsg.). Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und<br />
Plasmaderivaten, 3. Auflage; Deutscher Ärzte-Verlag, Köln (2003)<br />
Klüter H: Sicherheit der Therapie mit zellulären Blutpräparaten. In: ’Fortschritt und<br />
Fortbildung in der Medizin’; Hrsg. Bun<strong>des</strong>ärztekammer: Band 27 (2003)<br />
Krishnan U, Goodall AH, Bugert P: Letter by Krishnan et al regarding article, "Platelet<br />
expression profiling and clinical validation of myeloid-related protein-14 as a novel<br />
determinant of cardiovascular events". Circulation. 115: e186 (2007).<br />
Müller N, Eckstein R, Klüter H, Northoff H: Forschung und Lehre in der Transfusionsmedizin.<br />
Transfus Med Hemother. 31(suppl2):118-121 (2004).<br />
Müller N, Klüter H, Bauer AW: 50 Jahre Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und<br />
Immunhämatologie (DGTI). Transfus Med Hemother. 31(suppl2):1-2 (2004)<br />
Nesselmann C, Ma N, Bieback K, Wagner W, Ho A, Konttinen YT, Zhang H, Hinescu ME,<br />
Steinhoff G: Mesenchymal stem cells and cardiac repair. J Cell Mol Med. 12: 1795-8<strong>10</strong><br />
(2008).<br />
Nguyen XD: Rapid screening of granulocyte antibodies with a novel assay: flow cytometric<br />
granulocyte immunofluorescence test (Flow-GIFT). Transfusion. 49: 2547 (2009).<br />
Reesink HW, Panzer S, Dettke M, Gabriel C, Lambermont M, Deneys V, Sondag D,<br />
Dickmeiss E, Fischer-Nielsen A, Kohonen M, Krusius T, Ali A, Tiberghien P, Schrezenmeier<br />
H, Tonn T, Seifried E, Klüter H, Politis C, Stavropoulou-Gioka A, Papara W, Flesland O,<br />
Nascimento F, Balint B, Marin P, Bart T, Chen FE, Pamphilon DH: New cellular therapies: Is<br />
there a role for Transfusion medicine Vox Sang. 97:77-90 (2009).<br />
82
Veröffentlichungen______________________________________________________<br />
Hütter G, Schneider T, Thiel E: Transplantation of selected or transgenic blood stem cells –<br />
a future treatment for HIV/AIDS J Int AIDS Soc. 12:<strong>10</strong> (2009).<br />
Schäfer R, Dominici M, Müller I, Dazzi F, Bieback K, Godthardt K, Le Blanc K, Meisel R,<br />
Pochampally R, Richter R, Skutella T, Steinhoff G, Mitterberger M, Wendel H, Wiskirchen J,<br />
Handgretinger R, Northoff H: Progress in characterization, preparation and clinical<br />
applications of non-hematopoietic stem cells, 29-30 September 2006, Tubingen, Germany.<br />
Cytotherapy. 9(4):397-405 (2007).<br />
Schäfer R, Dominici M, Müller I, Horwitz E, Asahara T, Bulte JW, Bieback K, Le Blanc K,<br />
Bühring HJ, Capogrossi MC, Dazzi F, Gorodetsky R, Henschler R, Handgretinger R, Kajstura<br />
J, Kluger PJ, Lange C, Luettichau I, Mertsching H, Schrezenmeier H, Sievert KD, Strunk D,<br />
Verfaillie C, Northoff H: Basic research and clinical applications of non-hematopoietic stem<br />
cells, 4-5 April 2008, Tubingen, Germany. Cytotherapy. 11: 245-255 (2009).<br />
Schedel A, Rolf N: Genome-wide platelet RNA profiling in clinical samples: DNA and RNA<br />
Profiling in Human Blood, Bugert P (ed.). Methods in Molecular Biology. 496: 273-283<br />
(2009).<br />
Stichling F, Arnold JC, Grenz S, Schneider ARJ, Riemann JF: Die klinische Leberambulanz<br />
als Schnittstelle zwischen Klinik, Praxis und Patient: Aufgabenspektrum und Leistungsbreite.<br />
Ärzteblatt Rheinland-Pfalz. 12:24-27 (<strong>2002</strong>).<br />
Stichling F: Transfusionsmedizin und Immunhämatologie in Roter Faden Innere Medizin.<br />
Lehrbuch Innere Medizin, Haghi D / Haase K (Hrsg.). Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft<br />
mbH Stuttgart. 249-270 (2009).<br />
83
Lehre_____________________________________________________________________<br />
4 Lehre<br />
4.1 Lehre in der Klinischen Medizin (<strong>2002</strong> – 20<strong>10</strong>)<br />
Querschnittsbereich Immunologie/Infektiologie<br />
Themen<br />
Einführung in die Immunologie<br />
Immunhämatologie<br />
Immungenetik<br />
Transplantationsimmunologie I<br />
Blockkurs im Wahlfach „Transfusionsmedizin“<br />
Das Wahlfach Transfusionsmedizin wurde erstmals im Wintersemester 05/06 im Rahmen<br />
eines einwöchigen, ganztägigen Blockkurses angeboten. Dieser Blockkurs bis zum<br />
Wintersemester 09/<strong>10</strong> in jedem Semester jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit (Ende<br />
September bzw. Ende März) durchgeführt. Der Kurs war bei den Studenten im 4. oder 5.<br />
Studienjahr sehr beliebt und wurde regelmäßig hervorragend von den Teilnehmern evaluiert.<br />
Mit der Einführung <strong>des</strong> Reformstudiengangs MaReCuM wurde das Wahlfach<br />
„Transfusionsmedizin“ zum Pflichtfach, das seit dem Wintersemester 09/<strong>10</strong> Bestandteil <strong>des</strong><br />
Curriculums im klinischen Studienabschnitt ist.<br />
Repetitorium im Praktischen Jahr<br />
Durch einen regelmäßig angebotenen Kurs zur ‚Praxis der Bluttransfusion’ werden die<br />
Studenten im praktischen Jahr der Ausbildung hinsichtlich der notwenigen Untersuchungen<br />
und Techniken bei der Transfusion von Blutpräparaten geschult.<br />
84
Lehre_________________________________________________________________<br />
4.2 Lehre im Reformstudiengang MaReCuM<br />
http://www.ma.uni-heidelberg.de/studium/studma/marecum/<br />
MaReCuM: Modularer Aufbau mit fächerübergreifender Lehre<br />
85
Lehre_________________________________________________________________<br />
1. Studienjahr<br />
Modul I<br />
Themenschwerpunkt: Naturwissenschaftliche Propädeutik<br />
Thema<br />
Molekulare Bausteine<br />
Nukleinsäuren<br />
Aminosäuren / Proteine<br />
Signaltransduktion<br />
Grundlagen <strong>des</strong> Experimentierens<br />
Nukleinsäuren<br />
Aminosäuren<br />
Enzyme<br />
Kohlenhydrate<br />
Lipide<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Praktikum<br />
Praktikum<br />
Praktikum<br />
Praktikum<br />
Praktikum<br />
Praktikum<br />
Themenschwerpunkt: Zelle<br />
Thema<br />
Zellzyklus/Zellteilung/Zelltod<br />
Regulation der Zellfunktion<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Modul II<br />
Themenschwerpunkt: Blut<br />
Thema<br />
Zelluläre Blutbestandteile<br />
Blutbestandteile und Funktionen<br />
Knochenmark und Blutbildung<br />
Gerinnung und Blutstillung<br />
Physiologie <strong>des</strong> Blutes<br />
Gerinnung<br />
Punktion<br />
i.V.-Applikation<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Praktikum<br />
Praktikum<br />
Praxiseinheit<br />
Praxiseinheit<br />
86
Lehre_________________________________________________________________<br />
2. Studienjahr:<br />
Modul VI<br />
Themenschwerpunkt: Molekularbiologie<br />
Thema<br />
Gendiagnostik<br />
Gentechnik<br />
Signaltransduktion<br />
Genregulation<br />
Mutation und Kanzerogenese<br />
Einführung in die Stammzellforschung<br />
Gentechnik<br />
Veranstaltung<br />
Vorlesung und Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Vorlesung und Seminar<br />
Praktikum<br />
Modul VIII<br />
Themenschwerpunkt: Pathobiochemie<br />
Thema<br />
Mediatoren<br />
Molekularbiologie (Repetitorium)<br />
Gerinnung (Repetitorium)<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Im klinischen Studienabschnitt der medizinischen Ausbildung wird der in MaReCuM<br />
bun<strong>des</strong>weit einmalig angebotene Leistungsnachweis `Immunologie und<br />
Transfusionsmedizin’ in zwei Teilscheinen im 3. und im 4. Studienjahr gelehrt.<br />
3. Studienjahr<br />
Modul 3.3 Entzündung und Neoplasie<br />
Teilschein: Klinische Immunologie/<br />
Thema<br />
Immunhämatologie I<br />
Immunhämatologie II<br />
Immungenetik<br />
Transplantationsimmunologie 2<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Innerhalb <strong>des</strong> Moduls 3.3. Entzündung und Neoplasie (Modulverantwortlicher Herr Prof. Dr.<br />
Marx, Institut für Pathologie) wird der Teilschein Immunologie (Verantwortlicher Teilschein:<br />
PD Dr. med. Michael Müller-Steinhardt) in Kooperation mit der Klinik für Dermatologie, der V.<br />
87
Lehre_________________________________________________________________<br />
<strong>Medizinische</strong>n Klinik, der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin sowie<br />
dem Institut für Klinische Chemie gelehrt.<br />
Die Verantaltungsreihe besteht aus 4 Vorlesungen à 2 Unterrichtseinheiten, <strong>10</strong><br />
Seminarveranstaltungen à 2 Unterrichtseinheiten und 1 Unterricht am Krankenbett mit 2<br />
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.<br />
Vom Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie werden die im Folgenden<br />
aufgeführten Vorlesungs- bzw. Seminarveranstaltungen mit folgenden Lehrzielen gelehrt:<br />
Vorlesung „Einführung in die Klinische Immunologie„<br />
Unterscheidung <strong>des</strong> spezifischen und unspezifischen Immunsystems, zeitliche Abfolge<br />
humorale bzw. zelluläre Komponenten <strong>des</strong> Immunsytems sowie die dazugehörigen<br />
Effektormechanismen. Zusammenspiel der verschiedenen Immunzellen bzw. humoralen<br />
Komponenten anhand der lokalen Entzündungsreaktion. Relevanz <strong>des</strong> spezifischen<br />
Immunsystems mit seine humoralen und zellulären Komponenten für die Integrität <strong>des</strong><br />
Organismus. Veranschaulichung von Fehlsteuerung am Beispiel der Autoimmunität bzw.<br />
allergische Reaktionen. Definition von Immundefekten und deren Systematik anhand von<br />
klinischen Fallbeispielen.<br />
Seminar „Immunhämatologie I“<br />
Ursache und Pathophysiologie <strong>des</strong> Morbus hämolyticus neonatorum und der AB0-<br />
Erythroblastose, Blutgruppenkompatibilitäten und Transfusionsregeln für die relevanten<br />
zellulären Blutprodukte, erythrozytäre Allo- und Autoanitkörper, Verständnis für relevante<br />
Untersuchungstechniken: Coombs-Test, Blutgruppen-bestimmung, Antikörperuntersuchung,<br />
Elution, Kreuzprobe und Rhesus-Prophylaxe.<br />
Seminar „Immunhämatologie II“<br />
<strong>Medizinische</strong> Relevanz von antithrombozytären und antigranulozytären Antikörpern im<br />
Zusammenhang mit Unverträglichkeitsreaktionen auf Blutprodukte, Nachweisverfahren für<br />
antithrombozytäre und antigranulozytäre Allo- und Autoantikörper, klinisches Bild der<br />
transfusionsassoziierten Lungeninsuffizienz (TRALI) und diagnostisches Vorgehen.<br />
Seminar „Immungenetik“<br />
Wiederholung der Grundbegriffe der strukturellen und funktionellen Unterschiede zwischen<br />
HLA Klasse I und Klasse II-Molekülen. Genetische Variabilität und Polymorphismus <strong>des</strong><br />
HLA-Systems sowie der entsprechenden Nomenklatur, relevante Labormethoden zur HLA-<br />
Genotypisierung bzw. –Phänotypisierung, diagnostisches Vorgehen.<br />
88
Lehre_________________________________________________________________<br />
Seminar „Transplantationsimmunologie II“<br />
Fähigkeit von hämatopoietischen Stammzellen zur asymmetrischen Zellteilung, Funktion der<br />
Stammzellnische, klinische Relevanz der Stammzellmigration und Homing zur<br />
Transplantation von hämotopietischen Stammzellen. Prinzipien der syngenen, autologen und<br />
allogenen Stammzelltransplantationen. Notwendigkeit der Konditionierungsbehandlung<br />
sowie möglicher In-Vitro-Manipulation. Zeitliche Abfolge <strong>des</strong> Engraftments sowie mögliche<br />
Komplikationen (Graft-versus-Host-Erkrankung und Transplantatversagen).<br />
Opportunistischer Infektionserreger und ihre klinische Relevanz, Alternativen zu den<br />
gängigen Transplantationsverfahren wie Nabelschnurbluttransplantation und Donor-<br />
Lymphozyten-Infusion bzw. Mini-Transplantation<br />
4. Studienjahr<br />
Modul Verletzungen, Unfälle, degenerative Erkrankungen und Rehabilitation (VdER)<br />
Teilschein: Klinische Transfusionsmedizin<br />
Thema<br />
Transfusionsmedizin allgemein<br />
Anämie und Behandlungsstrategien<br />
Thrombozytopenie /-pathie und<br />
Behandlungsstrategien<br />
Hämorrhagische Diathesen und<br />
Behandlungsstrategien<br />
Blutspende, Arzneimittelherstellung und –<br />
freigabe, praktische Aspekte der<br />
Transfusionsmedizin<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Unterricht am Krankenbett<br />
Der Themenkoordinator dieses Moduls ist Herr Prof. Obertacke; die Lehrverantwortliche für<br />
den Teil Klinische Transfusionsmedizin ist Frau PD Dr. Janetzko.<br />
Das Modul und somit der Teil der Klinischen Transfusionsmedizin wird 6 Mal im Jahr mit<br />
einer durchschnittlichen Studentenzahl von ca. 30 – 40 pro Durchgang abge-halten. Die<br />
Dauer je<strong>des</strong> Durchgangs beläuft sich auf 7 Wochen und gliedert sich wie folgt: Woche 1, 2, 4<br />
und 5 jeweils ein Seminar á 2 Stunden, an dem alle Studenten gemeinsam teilnehmen<br />
(Freitag 13:15 - 14:45). Zudem werden die Studenten in Kleingruppen á ca. 6 Personen in<br />
den Wochen 1 bis 5 in der 5-stündigen Unterrichts-einheit am Krankenbett (Montag 13:15 –<br />
17:45) ausgebildet. Die 6. Woche ist frei; in der 7. Woche wird der Durchgang mit einer<br />
Multiple-Choise-Klausur abgeschlossen.<br />
89
Lehre_________________________________________________________________<br />
In diesem Modul soll den Studenten die Transfusionsmedizin als ein interdisziplinärer,<br />
medizinischer Bereich vorgestellt werden (Seminar 1 – Transfusionsmedizin allgemein).<br />
Neben Aspekten die Blutspende betreffend (Demographie der Blut-spender, Möglichkeiten<br />
der Gewinnung von allogenen und autologen Blutprodukten, Herstellung von Blutproduktion,<br />
freigaberelevante infektionsserologische, molekularbiologische und immunhämatologische<br />
Untersuchungen, Sicherheit der Blutüber-tragung) erlernen die Studenten Inhalte zur<br />
Indikation und Durchführung der Trans-fusion unterschiedlicher Blutkomponenten. Hierzu<br />
werden theoretisch Inhalte in den Seminaren vermittelt: Seminar 2 „Anämie und<br />
Behandlungsmöglichkeiten“ - Indikation zur Gabe von Erythrozytenkonzentraten; Seminar 3<br />
„Hämorrhagische und thrombophile Diathesen“ – Indikation zur Gabe von Plasma und<br />
Plasmaderivaten und Seminar 4 Thrombozytenfunktionsstörung / Thrombozytopenien sowie<br />
Behandlungsstrategien – Indikation zur Gabe von Thrombozytenkonzentraten.<br />
In der UaK erlernen die Studenten an einem praktischen Beispiel, was bei der Bestellung<br />
von Blutprodukten und im Vorfeld einer Transfusion zu beachten ist. Sie führen den Bett-<br />
Side-Test durch und erhalten Kenntnis darüber, was im Zusammenhang mit einer<br />
Transfusion zu dokumentieren ist.<br />
Darüber hinaus werden mögliche transfusionsassoziierte Nebenwirkungen, deren Ursache<br />
und Behandlung sowie das daraus resultierende Meldewesen besprochen.<br />
Praktisches Jahr<br />
Thema<br />
Blutgruppenserologisches Praktikum<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
4.3 Lehre im Master-Studiengang „Translational Medical Research“<br />
Modul 3.2<br />
Themenschwerpunkt: Extended key Competences<br />
Thema<br />
Scientific Writing<br />
Veranstaltung<br />
Seminar + Übungen<br />
Modul 3.3<br />
Themenschwerpunkt: Disease Processes<br />
90
Lehre_________________________________________________________________<br />
Thema<br />
Stem Cells 1<br />
Stem Cells 2<br />
Veranstaltung<br />
Seminar<br />
Seminar<br />
Modul 5.4<br />
Themenschwerpunkt: Vascular Medicine; Animal models in translational research and<br />
experimental therapy in vascular medicine<br />
Thema<br />
Cord Blood Stem Cells<br />
Veranstaltung<br />
Seminar + Praktikum<br />
Darüberhinaus können die Studierenden in den Laboren Project-Practicals und<br />
Masterarbeiten experimentell durchführen.<br />
4.4 Lehre in der MTA-Ausbildung<br />
Die MTA-Schule ist dem Universitätsklinikum Mannheim angegliedert. Die Ausbildung<br />
beginnt im Oktober und verläuft über drei Jahre. Im 3. Semester findet die Vorlesungsreihe<br />
Transfusionsmedizin statt. Diese wird themenabhängig mit ein bis zwei Wochenstunden von<br />
Mitarbeitern unseres Institutes gehalten.<br />
Der ärztliche Ansprechpartner <strong>des</strong> Fachbereiches Transfusionsmedizin war Herr Dr.<br />
Kerowgan. Im oblag auch die Abnahme der mündlichen Prüfung am Ende der Ausbildung.<br />
Seit dem Jahr 2008 hat Frau PD D. Janetzko diese Aufgabe übernommen, nachdem sie<br />
bereits seit Oktober 2005 für die allgemeinen organisatorischen Belange der MTA-Schule<br />
wie z.B. die Stundenplangestaltung oder auch die Abnahme der schriftlichen Prüfungen. Für<br />
diese Aufgabe ist ein ärztlicher Kollege zuständig, der sich entweder in der fortgeschrittenen<br />
Facharztweiterbildung befindet oder diese bereits beendet hat. Nachdem diese Aufgabe von<br />
Frau Dr. Karagianni im Jahr 2008 bis 2009 und von Frau Dr. Lauber in den Jahren 20<strong>10</strong> bis<br />
<strong>2011</strong> erfüllt wurde, wird im Jahr 2012 diese Funktion Frau Dr. Goebel übernehmen.<br />
Der Vorlesungsplan, der in enger Abstimmung mit der MTA-Schule erstellt wird, enthält alle<br />
wesentlichen Themenbereiche <strong>des</strong> Fachbereiches Transfusionsmedizin. Die Inhalte haben<br />
sich in den letzten Jahren nur unwesentlich geändert und bestehen aus folgenden<br />
Unterrichtseinheiten:<br />
91
Lehre_________________________________________________________________<br />
Gewinnung von Blut und –bestandteilen, Herstellung von Blutpräparaten<br />
Bereitstellung und Anwendung von Blutpräparaten, Qualitätskontrollen<br />
Antigene/ Antikörper allgemein<br />
AB0-System<br />
Rhesus-System<br />
Weitere Blutgruppensysteme<br />
Irreguläre Antikörper<br />
Prätransfusionelle Untersuchungen und Transfusion<br />
Immunologie (angeborenes/ erworbenes Immunsystem, lösliche Faktoren <strong>des</strong><br />
Immunsystems)<br />
Morbus hämolyticus neonatorum<br />
Transfusionszwischenfälle<br />
Autoimmunhämolysen<br />
Immunhämatologische Labormethoden<br />
Fallbeispiele<br />
Qualitätssicherung<br />
Thrombozyten- und Granulozytendiagnostik (Theorie und praktische Aspekte)<br />
HLA-System<br />
Nukleinsäuren und PCR<br />
Moderne molekularbiologische Diagnostik<br />
Zellbiologie<br />
Knochenmarkspende und Logistik<br />
Die Vorlesungen werden von verschiedenen ärztlichen Kollegen <strong>des</strong> Institutes, die<br />
min<strong>des</strong>tens das erste Weiterbildungsjahr absolviert haben, gehalten. Die eher praktisch<br />
orientierten Themen werden von medizinisch-technischen Assistentinnen übernommen, die<br />
im Bereich der Immunhämatologie langjährige Erfahrung haben.<br />
In den letzten Jahren waren insbesondere Frau Jeschke, Frau Thompson, Frau Preißler und<br />
Frau Rink involviert.<br />
Parallel zu dieser immunhämatologischen Vorlesung gibt es ein vierwöchiges<br />
Schulpraktikum, in dem die Schüler die immunhämatologischen Untersuchungstechniken<br />
und Methoden erlernen.<br />
Neben diesem Schulpraktikum haben die Schüler die Möglichkeit, für mehrere Wochen in<br />
den verschiedenen Routinelaboren <strong>des</strong> Universitätsklinikums sowie der angegliederten<br />
Lehrkrankenhäuser Erfahrungen zu sammeln. Unser Institut für Transfusionsmedizin und<br />
Immunologie ist hier mit eingeschlossen. Im Rahmen eines einwöchigen Praktikums, das die<br />
92
Lehre_________________________________________________________________<br />
Schüler in der Regel zwischen dem 4. und 6. Semester absolvieren, lernen sie einige<br />
Routinearbeitsplätze in unserem Institut kennen. Jeweils tageweise sind die Schüler den<br />
einzelnen Laboren zugeteilt. Nach der Blutbank ( Blutgruppen-, Antikörperbestimmungen,<br />
Kreuzprobenbearbeitung und weiterführende immunhämatologische Techniken), folgen das<br />
Thrombozytenlabor (thrombozytäre Antikörperbestimmungen am FACS), das<br />
Qualitätskontrolllabor, das infektionsserologische Labor, das Stammzelllabor und das HLAund<br />
Granulozyten- Labor.<br />
4.5 TopLab - Kompetenz im Labor<br />
TopLab - Kompetenz im Labor ist ein internes Bildungsprogramm als gemeinsamer Service<br />
<strong>des</strong> Universitätsklinikums Heidelberg, der medizinischen Fakultät Mannheim und der<br />
Universität Heidelberg (http://www.toplab.uni-hd.de/).<br />
Aus dem Institut werden seit 20<strong>10</strong> folgende Kurse im Rahmen von TopLab angeboten:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
PCR-Methoden zur SNP-Genotypisierung - Seminar mit praktischem Teil<br />
Referenten: Gabi Rink und Peter Bugert<br />
RNA-Isolierung / -Quantifizierung / -Qualifizierung - Seminar mit praktischem Teil<br />
Referenten: Gabi Rink, Katharina Kemp und Peter Bugert<br />
Relative Quantifizierung der Genexpression - Seminar mit Übungen<br />
Referenten: Andrea Hecker und Peter Bugert<br />
Zellkultur – Theorie<br />
Referenten: Karen Bieback<br />
Zellkultur – Praxis<br />
Referenten: Andrea Hecker, Susanne Elvers-Hornung und Karen Bieback<br />
Einführung in die Durchflusszytometrie<br />
Referenten: Melanie Grassl, Stefanie Uhlig und Karen Bieback<br />
93
Lehre_____________________________________________________________________<br />
4.6 Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten, Promotionen<br />
Bachelorarbeiten<br />
<strong>2011</strong> Katja Kraushaar, Technische Universität Kaiserslautern, Abteilung Allgemeine<br />
Zoologie<br />
Differentielle Regulation von Pref-1während adipogener Induktion in<br />
mesenchymal stromalen Zellen<br />
<strong>2011</strong> Ina Rink, Fachbereich Biochemie, Technische Universität Darmstadt<br />
Bestimmung von Kinaseaktivität während der Megakaryopoese<br />
Masterarbeiten<br />
20<strong>10</strong> Mina Zeinali, Master of Biotechnology Biotechnology Faculty, Hochschule<br />
Mannheim<br />
Differentiation of Mesenchymal Stromal Cells to Endothelial Cells under Shear<br />
Stress<br />
Diplomarbeiten<br />
<strong>2002</strong> Dipl. Ing. (FH) Ayse Günaydin<br />
Das Genexpressionsprofil von hämatopoetischen Stammzellen aus<br />
Nabelschnurblut vor und nach der ex vivo Expansion mit Hilfe der Microarray-<br />
Technologie.<br />
2005 Dipl. Ing. (FH) Melanie Ficht<br />
Identifizierung neuer Rezeptoren bei Thrombozyten<br />
2007 Dipl. Ing. (FH) Kathrin Ferlik<br />
Vergleichende Genexpressionsanalysen mesenchymaler Stammzellen aus<br />
Knochenmark, Nabelschnurblut und Fettgewebe<br />
Dissertationen<br />
2003 Dr. med. Christian Beck<br />
Untersuchungen zur Selektion hämatopoetischer Progenitorzellen aus<br />
kryokonserviertem Plazentarestblut<br />
2004 Dr. med. Andrea B. Lese<br />
Noninvasive Prenatal Genotyping for Human Platelet Alloantigens (HPA) from<br />
Maternal Plasma or Serum<br />
94
Lehre_________________________________________________________________<br />
2005 Dr. med. Linda Rütten, Dr. med. der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim, Ruprecht-<br />
Karls-Universität Heidelberg<br />
Molekulargenetische Charakerisierung <strong>des</strong> ABO-Genlokus bei Individuen mit<br />
schwache Blutgruppe A Phänotypen<br />
2005 Dr. sc. hum. Diplom-Biologin Susanne Kern<br />
Vergleichende Analyse mesenchymaler Stammzellen aus Knochemark,<br />
Nabelschnurblut und Fettgewebe<br />
2006 Dr. med. Marion Vosberg<br />
Die Bedeutung von DNA-Polymorphismen in P-Selektin für die Entstehung der<br />
koronaren Gefäßerkrankung<br />
2007 Dr. med. Stephanie Lauber<br />
Einfluß von Thrombozyten und thrombozytärer Faktoren auf Proliferation und<br />
Differenzierung osteoblastärer Zellen<br />
2007 Dr. med. Christian Kessler<br />
Untersuchung zur Co-Transplantation von hämatopoetischen und<br />
mesenchymalen Stammzellen aus Nabelschnurblut im NOD/SCID-Mausmodell<br />
2008 Dr. med. vet. Christiane Dobrowolski, Justus-Liebig-Universität Gießen<br />
Nachweis nachhaltiger Wirkungen humaner Thrombozyten in der Wundheilung<br />
am Beispiel der Biosynthese relevanter Wachstumsfaktoren<br />
2008 Dr. med. Asli Serife Kocaömer<br />
Standardized isolation and expansion of mesenchymal stem cells for clinical<br />
application<br />
2008 Dr. med. Kathrin Stamer<br />
Molekulare und funktionelle Charakterisierung genetischer Varianten von CD154<br />
und CD62P<br />
20<strong>10</strong> Dr. med. Iris Klaus<br />
Molekularbiologische Untersuchungen zu den Pathomechanismen <strong>des</strong> Aspirinlike<br />
Defekts<br />
20<strong>10</strong> Dr. med. Viet Anh-Thu Ha<br />
Analyse differenteller Gen- und Proteinexpression in mesenchymalen<br />
Stammzellen expandiert für die klinische Anwendung<br />
20<strong>10</strong> Dr. med. Stephan Gerodez<br />
Untersuchungen von GMP-konformen Präparationstechniken von<br />
Nabelschnurblut : Quantifizierung von SCID repopulating cells<br />
95
Lehre_________________________________________________________________<br />
<strong>2011</strong> Dr. med. Sophia Thornton<br />
Einfluss cholinerger Substanzen auf die Megakaryopoese<br />
<strong>2011</strong> Dr. med. Marianna Karagianni<br />
Adipogenic differentiation potential of mesenchymal stromal cells from cord blood,<br />
adipose tissue and bone marrow<br />
<strong>2011</strong> Dr. sc. hum. Angelika Schedel<br />
Charakterisierung <strong>des</strong> nikotinischen Acetylcholinrezeptors 7 an Thrombozyten<br />
4.7 Habilitationen<br />
<strong>2002</strong> Dr. med. Hermann Eichler: Habilitation für das Fach Transfusionsmedizin und<br />
Immunologie<br />
Plazentarestblut als Quelle hämatopoetischer Stammzellen und autologer<br />
Erythrozyten.<br />
2004 Dr. rer. nat. Peter Bugert: Habilitation für das Fach Klinische<br />
Molekularbiologie, Fachbereich Humanmedizin<br />
Die Rolle von Thrombozyten bei inflammatorischen Prozessen.<br />
2009 Dr. med. Karin Janetzko: Habilitation für das Fach Transfusionsmedizin<br />
Pathogeninaktivierung von Thrombozytenkonzentraten - ein innovativer Beitrag<br />
zur Sicherheit in der Hämotherapie<br />
20<strong>10</strong> Dr. rer. nat. Karen Bieback: Habilitation für das Fach Experimentelle<br />
Zelltherapie<br />
Charakterisierung humaner adulter mesenchymaler Stammzellen und ihre<br />
Eignung für die zellbasierte regenerative Medizin<br />
4.8 Berufungen<br />
<strong>10</strong>/2006 PD Dr. Hermann Eichler<br />
Universitätsprofessor für Transfusionsmedizin und Klinische<br />
Hämostaseologie, <strong>Medizinische</strong> Fakultät <strong>des</strong> Saarlan<strong>des</strong>; Direktor am Institut<br />
für Klinische Hämostaseologie und Transfusionsmedizin, Universitätsklinikum<br />
<strong>des</strong> Saarlan<strong>des</strong>, Homburg<br />
96
Lehre_________________________________________________________________<br />
4.9 Preise/Auszeichnungen<br />
Jahr Person Auszeichnung<br />
<strong>2002</strong> A. Lese, J. Meckies, W. Zieger,<br />
H. Klüter, P. Bugert<br />
2006 A. Kocaömer, S. Kern, H. Klüter,<br />
K. Bieback<br />
Posterpreis anlässlich <strong>des</strong> 35. DGTI<br />
Jahreskongresses<br />
Posterpreis anlässlich <strong>des</strong> 39. DGTI<br />
Jahreskongresses<br />
2009 Dr. Gero Hütter Chugai Science Award<br />
20<strong>10</strong> Dr. Gero Hütter Certificate of Honor, Board of<br />
Supervisors of the City and County of San<br />
Francisco<br />
<strong>2011</strong> PD Dr. Karen Bieback Scott Murphy Guest Lecture<br />
The Biomedical Excellence for Better<br />
Transfusion Collaborative<br />
97
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
5 Patientenversorgung<br />
5.1 Blutspende<br />
5.1.1 Spendeabteilung im Institut<br />
In den Jahren <strong>2002</strong> bis <strong>2011</strong> fand ein Wandel in der Aktivität der stationären Blutspende im<br />
Institut Mannheim statt. Nach wie vor werden hauptsächlich Vollblutspenden abgenommen;<br />
allerdings machen hochspezialisierte Aphereseverfahren einen immer höheren Anteil aus.<br />
Bedarfsorientiert unterstützt die stationäre Blutspende mit Thrombozytapheresen,<br />
Erythrozytapheresen und Plasmapheresen die Blutversorgung, besonders bei Engpässen.<br />
Gezielte Einbestellungen von Blutspendern - gerade der seltenen Blutgruppen A Rh negativ<br />
und 0 Rh negativ bei Thrombapheresen und Erythrozytapheresen - sind besonders wichtig.<br />
Die enge Verzahnung von hausinterner Diagnostik (HLA- Thrombozytenlabor) mit der<br />
stationären Blutspende und der Blutbank ermöglicht die Versorgung von Patienten mit<br />
speziell ausgewählten und gematchten Blutpräparaten, vor allem Thrombozytenkonzentraten,<br />
nach vorangegangener Immunisierung. Durch den hohen Anteil der für HLAund<br />
HPA-Merkmale typisierten Apheresespender können speziell Spender einbestellt<br />
werden, und eine Verträglichkeitsprobe durchgeführt werden. Dies hat eine zunehmende<br />
regionale Bedeutung gewonnen.<br />
98
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Übersicht der Entwicklung der spezialisierten Aphereseverfahren in den letzten 4 Jahren<br />
Innerhalb der letzten zwei Jahre hat eine verstärkte Versorgung von Patienten mit Sepsis in<br />
der Neutropenie mit Granulozytekonzentraten stattgefunden. Das Institut in Mannheim ist<br />
dafür ein Schwerpunkt geworden. Allein in Mannheim wurden in diesen Jahren ca. 140<br />
Präparate hergestellt. Auch hier ist das Vorhandensein eines hausinternen HLA- und<br />
Granulozytenlabor von unschätzbarem Wert. Die Indikation zur Granulozytengabe wird in der<br />
Regel dringlich gestellt. Nacht der Diagnostik auf antileukozytäre Antikörper werden Spender<br />
einbestellt, die vom Antigenmuster passend sind. Diese dürfen dann erst nach negativer<br />
Verträglichkeitsprobe im Flow-GIFT Granulozyten spenden. In der Regel kann am dritten<br />
Tag nach Anforderung ein Präparat ausgeliefert werden. So wundert es nicht, dass der<br />
Einzugsbereich für die Versorgung mit Granulozytenkonzentraten von Mannheim bis<br />
Heidelberg, Tübingen, Würzburg, Frankfurt und Mainz reicht. Bislang wurden keine<br />
schweren unerwarteten Wirkungen nach der Gabe der so vorselektierten Granulozyten<br />
berichtet. Um die Wirkung prospektiv zu dokumentieren, wird eine Studie zur Verträglichkeit<br />
der Granulozytenspenden 2012 stattfinden.<br />
In der stationären Blutspende finden Stammzellspenden von Spendern der<br />
Stammzellspenderdatei Rhein-Neckar statt, die nach Deutschland und weltweit Patienten<br />
zugute kommen. Der enge Austausch zwischen der Stammzellspenderdatei Rhein-Neckar<br />
und der stationären Blutspende ermöglicht eine reibungslose Vorbereitung der Spender und<br />
der Spenden. Die gespendeten Präparate werden am Tag nach der Spende an einen Kurier<br />
übergeben, der diese dann zum Patienten transportiert. Das Team der stationären<br />
99
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Blutspende betreut die Spender und optimiert die Stammzellsammlung, damit die Spender,<br />
die mehrere Stunden bei einer Apherese liegen müssen nur so lange wie nötig spenden. In<br />
der stationären Blutspende werden darüber hinaus auch Apheresen von Spendern <strong>des</strong><br />
Heidelberger Stammzellregisters (HSR) durchgeführt.<br />
Stammzellapherese eines Spenders der Stammzellspenderdatei Rhein-Neckar<br />
Über die III. Medizinsche Klinik der Universitätsmedizin Mannheim von Prof. Hofmann<br />
werden Patienten zur autologen Stammzellapherese zugewiesen. Nachdem eine eigene<br />
Stammzelltransplantationseinheit auf der Station 17-4 eingerichtet worden ist und diese im<br />
Jahr 2014 durch eine neuerbaute Transplantationsstation ersetzt wird, wird auch dieses<br />
Segment der Stammzellherstellung durch die Hausspende weiter expandieren.<br />
Patienten, für die eine autologe Apherese geplant ist, werden der stationären Blutspende<br />
vorgestellt, bzw. vom ärztlichen Personal <strong>des</strong> Institutes auf der Station gesehen, um die<br />
Apheresetauglichkeit zu beurteilen und gegebenenfalls die Anlage eines zentralen<br />
Venenzuganges zu veranlassen. In den vergangenen <strong>10</strong> Jahren ist es immer besser<br />
gelungen, nach vorangegangener Messung der hämatopoetischen Stammzellen, den<br />
geeignetsten Zeitpunkt für eine Apherese zu bestimmen, so dass die Patienten in der Regel<br />
nur einer oder zwei, sehr selten drei Apheresen ausgesetzt sind.<br />
Die Einrichtung einer Schwerpunktseinheit für Stammzelltransplantation hat zur Folge, dass<br />
seit 20<strong>10</strong> zum ersten Mal auch allogene Familienspender uns zugewiesen wurden.<br />
Familienmitglieder von Patienten, die zu einer allogenen Transplantation anstehen, werden<br />
<strong>10</strong>0
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
über das hausinterne HLA-Labor typisiert. Bei Ungleichheit kann dann rasch eine<br />
Fremdspendersuche eingeleitet werden. Sollten Familienmitglieder von den HLA-Merkmalen<br />
passen, werden diese analog zu Stammzellspendern der Stammzellspenderdatei Rhein-<br />
Neckar untersucht und eine Empfehlung ausgesprochen, welcher Spender am geeignetsten<br />
für eine Apherese ist. Die Entscheidung wird dann von der Transplantationskonferenz der III.<br />
Med. Klinik beschlossen. Gemeinsam mit der stationären Blutspende werden dann Termine<br />
vereinbart. <strong>2011</strong> konnte sogar erstmalig ein Patient der III. Med. Klinik Mannheim von einem<br />
Stammzellspender der Stammzellspenderdatei Rhein Neckar versorgt werden.<br />
Das in der stationären Blutspende wirkende medizinische Team (<strong>2011</strong>)<br />
5.1.2 Entnahmeteams und externe Spendetermine<br />
Mittlerweile 6 Entnahmeteams sorgen für den täglichen Einsatz von Blutspendeaktionen in<br />
der gesamten Region Nordbaden und Nordwürttemberg. Die Blutspendeaktionen finden in<br />
öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Hallen oder Rathäusern statt und werden in<br />
Zusammenarbeit mir den DRK-Ortsvereinen durchgeführt.<br />
Zu den Aufgaben der Mitarbeiter in den Entnahmeteams gehören:<br />
1. die Planung und Organisation <strong>des</strong> Personal- und Materialeinsatzes<br />
2. die organisatorische und personelle Führung der Entnahmeteams und der<br />
Vorbereitung.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahlen:<br />
Entnahmeteams Leitende Oberschwester Frau Martine Weber (anteilig)<br />
<strong>10</strong>1
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
50 Teamschwestern (davon 14 VZK, 36 TZK)<br />
Auf den Blutspendeaktionen werden die Entnahmeschwestern durch die Mitarbeiter <strong>des</strong><br />
Fuhrparks unterstützt. Die Fahrer der Teamfahrzeuge sind während der Blutspendeaktion<br />
am Laborarbeitsplatz eingesetzt und führen die Hämoglobinbestimmung bei den<br />
Blutspendern durch und bereiten die Entnahme durch Etikettierung der Probenröhrchen und<br />
Blutbeutelsysteme vor.<br />
Wichtige Entwicklungen in der Abteilung von <strong>2002</strong> bis 2006:<br />
Einführung der mobilen Datenverarbeitung der Blutspendeaktionen im Jahr 2004<br />
bzw. 2005 (Mob DV, Inlog)<br />
Anschaffung von modernen Vollblutmischwagen der neuesten Generation im Jahre<br />
2007.<br />
Einführung von modernen Scannern zum Erfassen der Blutprobenröhrchen bei der<br />
Blutspende im Jahre 2012<br />
Ab dem Jahre 2008 sind auch sogenannte externe Teamschwestern, die von Ihrem<br />
Wohnort aus direkt zu den Blutspendeaktionen kommen, mit der Leitung von<br />
Blutspendeaktionen (Teamleitung) betraut.<br />
Blutspendeaktionen von Mannheimer Teams 2007 - <strong>2011</strong><br />
<strong>10</strong>00<br />
900<br />
840<br />
872<br />
800<br />
700<br />
704<br />
725<br />
760<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
<strong>10</strong>0<br />
0<br />
2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Abbildung 1: Anzahl Blutspendeaktionen 2007-<strong>2011</strong><br />
<strong>10</strong>2
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Entnommene Vollblutspenden von Mannheimer Teams 2007 - <strong>2011</strong><br />
140000<br />
135000<br />
134732<br />
133568<br />
130000<br />
126098<br />
125000<br />
120000<br />
120917<br />
121830<br />
115000<br />
1<strong>10</strong>000<br />
2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Abbildung 2: Anzahl entnommener Vollblutspenden<br />
Die Mitarbeiterinnen der Teamvorbereitung<br />
Mannheim mit Gruppenleitung (Leitende<br />
Oberschwester Institut Mannheim Frau<br />
Martine Weber)<br />
Täglich werden sämtliche Ausgangsmaterialien für die<br />
Blutspendeaktionen in der Teamvorbereitung Mannheim<br />
zusammen gestellt.<br />
Ein Mannheimer Entnahmeteam vor einem<br />
der neuen Teamfahrzeuge<br />
<strong>10</strong>3
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Ablauf der Blutspende<br />
Annahmebereich zur Blutspende mit neuen Laptops und<br />
Etikettendruckern der neuesten Generation<br />
Vor jeder Blutspende wird die<br />
Spendetauglichkeit durch einen<br />
voruntersuchenden Arzt festgestellt.<br />
Vorbereitende Tätigkeiten zur<br />
Blutspende am Laborarbeitsplatz<br />
Seit dem Jahre 2007 sind elektronische Blutbeutelmischwaagen der<br />
neuesten Generation im Einsatz.<br />
Durchführung einer Vollblutspende durch<br />
unsere erfahrenen Entnahmeschwestern<br />
Nach der Blutspende darf eine zünftige Vesper<br />
nicht fehlen.<br />
Ein Dankeschön an alle Blutspenderinnen<br />
und Blutspender <strong>2002</strong> - 2012<br />
<strong>10</strong>4
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
5.1.3 Blutpräparate und ihre Herstellung<br />
Die Abteilung Produktion am Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie verarbeitet<br />
sämtliche Blutspenden, die in der stationären Spendeabteilung am Institut in Mannheim und<br />
vor allem durch die mobilen Entnahmeteams entgegen genommen werden. Sie deckt damit<br />
fast das gesamte Spektrum einer modernen Transfusions-medizin ab. Zu den Aufgaben<br />
gehört v. a. die Komponentenauftrennung und Weiterverarbeitung von Vollblutspenden bis<br />
hin zum fertigen Blutprodukt wie leukozytenfiltriertes Erythrozytenkonzentrat (EK),<br />
leukozytenfiltriertes Thrombozyten-konzentrat (TK) und gefrorenes Frischplasma (GFP)<br />
einschließlich der Etikettierung und Freigabe nach den jeweils aktuellen Vorgaben <strong>des</strong><br />
Arzneimittelrechtes.<br />
Neben den Standardpräparaten EK, TK und GFP stellt die Abteilung auch wichtige<br />
Spezialpräparate für die klinische Versorgung am Mannheimer Universitätsklinikum, an<br />
weiteren großen Kliniken in Mannheim, sowie der gesamten Region her. Dazu zählen z. B.<br />
EK-Babyportionierungen und volumenreduzierte TK für die Versorgung von Kleinkindern,<br />
gewaschene EK und TK bei IgA-Unverträglichkeit, bestrahlte Blutkomponenten für die<br />
Versorgung von immunkompromitierten Patienten. Ferner werden Eigenblutspenden für die<br />
Autotransfusion verarbeitet und in Blutkomponenten aufgetrennt. Etabliert wurde auch die<br />
Herstellung pathogeninaktivierter Thrombozytenkonzentrate.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung ist die GMP-konforme Präparation von<br />
Stammzellpräparaten in einem eigenen Reinraum. Dazu zählt insbesondere die Herstellung<br />
von Plazentarestblutpräparaten für die allogene und autologe Stammzelltransplantation.<br />
Neben der Routineproduktion von modernen Blutkomponenten ist die Abteilung in den<br />
letzten Jahren auch maßgeblich an der Entwicklung und Etablierung neuartiger<br />
Produktionsmethoden beteiligt gewesen.<br />
Neu ist auch die Direktversorgung von Forschungsgruppen mit Buffy-coats und Seren zu<br />
wissenschaftlichen Zwecken und die stärkere Beteiligung von Produktionsmitarbeitern an<br />
internen Forschungsinitiativen wie dem Projekt „Mesenchymale Stammzellen“.<br />
In der Abteilung sind zurzeit folgende Mitarbeiter beschäftigt:<br />
1 Abteilungsleiter (Herstellungsleitung): Dr. med. Gero Hütter<br />
1 Gruppenleiter: Matthias Lindner<br />
2 stellv. Gruppenleiter: Rainer Ullrich, Thomas Sackewitz<br />
14 Vollzeitkräfte, 2 Teilzeitkräfte, 5 Aushilfen<br />
<strong>10</strong>5
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Team Produktion (<strong>2011</strong>)<br />
5.1.4 Lagerung und Vertrieb von Blutpräparaten<br />
Die Abteilung Ausgabe/Vertrieb am Institut Mannheim lagert alle freien und etikettierten<br />
Präparate wie leukozytenfiltriertes Erythrozytenkonzentrat (EK), leukozytenfiltriertes<br />
Thrombozytenkonzentrat (TK) und gefrorenes Frischplasma (GFP).<br />
Hierzu stehen in der Ausgabe Lagerungsmöglichkeiten wie folgt zur Verfügung:<br />
Präparate Lagerungsmöglichkeit Lagerungskapazität<br />
EK´s Kühlhaus 4°C 4.000 Stück<br />
GFP´s<br />
4 Tiefkühlschränke -35°C<br />
1 Tiefkühlhaus -35°C<br />
500 Stück<br />
mehrere tausend Stück<br />
TK´s<br />
2 Thrombozytenschränke<br />
22°C mit 6 Agitatoren<br />
156 Stück<br />
<strong>10</strong>6
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
EK`s Kühlhaus 4°C Tiefkühlschränke – 35°C<br />
Thrombozytenschränke 22°C mit Agitatoren<br />
Schwerpunkt <strong>des</strong> Vertriebes in Mannheim ist es, das Depot im Klinikum Mannheim, das IKTZ<br />
in Heidelberg, sowie 15 Depotkrankenhäuser mit Blutpräparaten zu versorgen. Die<br />
Depotkrankenhäuser, das Depot im Klinikum Mannheim und das IKTZ Heidelberg werden<br />
mit Blutpräparatelieferungen bei Bedarf täglich angefahren.<br />
Zusätzlich werden mehr als 40 weitere Krankenhäuser per Abholung bzw. durch externe<br />
Transportdienste versorgt.<br />
Die Transporte erfolgen durch geeignete Verpackung (incl. Kühlmittel) bei Abholung bzw.<br />
durch gekühlte Fahrzeuge immer innerhalb der Temperaturgrenzen für die vorgenannten<br />
Präparate.<br />
<strong>10</strong>7
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Täglich werden die Krankenhäuser mit durchschnittlich 470 Blutpräparaten versorgt.<br />
Die Ausgabe Mannheim besteht seit 1989.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahl:<br />
- Abteilungsleiter (Herr Ole-Björn Baasch; anteilig)<br />
- Gruppenleiter (Herr Bernd Lutz)<br />
- Stellv. Gruppenleiterin (Frau Brigitte Schulz)<br />
- Weitere 2 Vollzeitkräfte<br />
- Ab Mitte Jahr 20<strong>10</strong> 7 studentische Aushilfen<br />
Ab Mitte 20<strong>10</strong> ist die Ausgabe in Mannheim 24 Stunden am Tag besetzt und zur Versorgung<br />
der Krankenhäuser gerüstet. Die Nacht- bzw. Wochenend- und Feiertagsdienste werden von<br />
unseren studentischen Aushilfen übernommen.<br />
5.2 Stammzellspende- und transplantation<br />
5.2.1 Knochenmarkspendedatei Rhein-Neckar/Deutsche<br />
Stammzellspenderdatei<br />
Die Arbeit der Deutschen Stammzellspenderdatei Rhein Neckar<br />
Die Deutsche Stammzellspenderdatei<br />
Rhein Neckar ist eine von 29<br />
Knochenmarkspender-Dateien in<br />
Deutschland. Sie ist am Institut für<br />
Transfusionsmedizin<br />
und<br />
Immunologie in Mannheim<br />
angesiedelt. Von hier aus werden<br />
Typisierungsaktionen in der<br />
Metropolregion Rhein-Neckar und in<br />
den Regionen Nord-Württembergs<br />
und Badens organisiert und die<br />
Stammzellspender betreut. Das<br />
Institut für Transfusionsmedizin und<br />
Immunologie ist zudem ein<br />
akkreditiertes Entnahmezentrum für<br />
Stammzellspenden.<br />
<strong>10</strong>8
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Seit der Registrierung <strong>des</strong> ersten Spenders im Jahre 1993 setzt sich die Deutsche<br />
Stammzellspenderdatei Rhein Neckar für die Werbung, Registrierung und Typisierung von<br />
gesunden Knochenmark- und Blutstammzellspendern zur Versorgung von Patienten mit<br />
Blutkrebs und anderen Erkrankungen <strong>des</strong> Knochenmarks bzw. <strong>des</strong> blutbildenden Systems<br />
ein und leitet die für die Suche relevanten Daten der Spender an das Zentrale<br />
Knochenmarkspender Register Deutschland (ZKRD) weiter.<br />
Jährlich erkranken allein in Deutschland rund 11.000 Menschen<br />
an bösartigen Blutkrankheiten. Nur einem Teil dieser Patienten<br />
kann alleine durch Medikamente geholfen werden. Für viele ist<br />
die Transplantation von Knochenmark oder Blutstammzellen<br />
gesunder Spender die Chance, die Krankheit zu überwinden.<br />
Im Jahre 2004 initiiert die<br />
Deutsche<br />
Stammzellspenderdatei Rhein<br />
Neckar unter dem Motto<br />
„Blutspender sein …<br />
Stammzellspender werden“ ein<br />
Projekt, das dem Wunsch<br />
vieler Blutspender entgegen<br />
kommt, sich in das weltweite<br />
Netz der freiwilligen<br />
Knochenmarkspender<br />
aufnehmen zu lassen. Umgekehrt wird mit der Blutspende gerade jungen<br />
Stammzellspendern die Möglichkeit gegeben, die Versorgung von Patienten zu erleben.<br />
Etwa 70% der Stammzellspender sind auch Blutspender. Der 25.000 Spender wurde 2008 in<br />
die Datei aufgenommen. 2009 schließen sich die Dateien <strong>des</strong> DRK- Blutspendedienstes<br />
Baden-Württemberg – Hessen zu der gemeinsamen Deutschen Stammzellspenderdatei<br />
zusammen, zu der auch die Deutsche Stammzellspenderdatei Rhein Neckar gehört.<br />
Aktuell betreut die Deutsche Stammzellspenderdatei Rhein Neckar 33.936 Spendewillige<br />
aus der Region. Wir freuen uns, dass darunter auch viele Mitbürger ethnischer Minderheiten<br />
sind, Ausdruck der weltweiten Verbundenheit unserer Datei.<br />
Unsere Spender:<br />
Von <strong>2002</strong> bis <strong>2011</strong> konnten 174 Patienten durch Spender der Deutschen<br />
Stammzellspenderdatei Rhein Neckar versorgt werden.<br />
<strong>10</strong>9
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
50<br />
40.000<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
Deutsche Stammzellspenderdatei Rhein-Neckar<br />
registrierte Spender<br />
Stammzellspenden<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
20<br />
15<br />
<strong>10</strong><br />
5<br />
2001 <strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong><br />
15.000<br />
<strong>10</strong>.000<br />
5.000<br />
0<br />
2001 <strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
0<br />
5.2.2 Nabelschnurblutbank Mannheim<br />
Die Nabelschnurblutbank Mannheim (Deutsche Stammzellspenderdatei Nabelschnurblut)<br />
wurde im Jahre 1996 am Institut mit der Einlagerung der ersten allogenen<br />
Stammzelltransplantate aus Nabelschnurblut gegründet.<br />
Zunächst wurde in enger Kooperation mit dem Universitätsklinikum Mannheim (Klinik für<br />
Gynäkologie und Geburtshilfe) später auch mit der Hedwigs-Klinik in Mannheim sowie dem<br />
Marienhospital in Darmstadt und dem St. Rochus-Krankenhaus in Dieburg die allogene<br />
Nabelschnurblutspende etabliert. In der Zwischenzeit sind über 2.000 Stammzellpräparate<br />
aus Nabelschnurblut oder synonym Plazentarestblut in der Gasphase von Flüssigstickstoff<br />
am Institut eingelagert. Diese Präparate stehen für die Transplantation vor allem von Kindern<br />
aber zunehmend auch von Erwachsenen umgehend zur Verfügung. Seit dem Jahre <strong>2002</strong> ist<br />
das Institut im Besitz einer Zulassung für Nabelschnurvollblutpräparate. Seit dem Jahre 2007<br />
auch für volumenreduzierte Stammzellpräparate aus Plazentarestblut (Zulassung bei der<br />
Bun<strong>des</strong>oberbehörde, dem Paul-Erlich-Institut). Neben der Transplantation von allogenen<br />
(von Fremdspendern gewonnenen) Stammzellen aus Knochenmark bzw. aus peripherem<br />
Blut im Rahmen der Therapie von malignen Erkrankungen <strong>des</strong> blutbildenden Systems bzw.<br />
genetisch bedingten Erkrankungen stehen seit Anfang der 90er Jahre auch<br />
Stammzellpräparate aus Nabelschnurblut zur Verfügung. Mittlerweile werden weltweit über<br />
20 % aller Stammzellpräparate aus Nabelschnurblut gewonnen. Damit wird die steigende<br />
1<strong>10</strong>
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Bedeutung dieser Präparate im Rahmen der allogenen Transplantationen deutlich.<br />
Stammzellpräparate aus Nabelschnurblut können ohne je<strong>des</strong> Risiko für Mutter und Kind<br />
unmittelbar nach der Abnabelung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> gewonnen werden. Sie werden nach der<br />
Volumenreduktion am Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin in der Gasphase<br />
von Flüssigstickstoff bei – 155° bis – 196° Grad Celsius gelagert. Nach eigenen Daten ist die<br />
Lagerung dieser Präparate für mind. 12 Jahre ohne erkennbare Einschränkung möglich. Im<br />
Laufe der nächsten Jahre ist zu erwarten, dass sich weitere Erkenntnisse zur<br />
Langzeitlagerung dieser Präparate gewinnen lassen werden. Waren in der Vergangenheit<br />
Nabelschnurpräparate vor allem für die Transplantation von Kindern bzw. Jugendlichen bis<br />
zu einem Körpergewicht von 30 kg geeignet, sind in der Zwischenzeit auch ältere<br />
Jugendliche oder gar Erwachsene mit diesem Präparat behandelbar. Weltweit hat sich die<br />
Transplantation von mehreren Stammzellpräparaten (z. B. Doppeltransplantation zweier<br />
Präparate) in der klinischen Anwendung durchgesetzt. Somit ist die Behandlung auch von<br />
erwachsenen Patienten auf dem Vormarsch.<br />
Die Mannheimer Nabelschnurblutbank ist seit dem Jahre 2003 an die Netcord Foundation<br />
angebunden und über das Zentralregister für Knochenmarkspende in Deutschland (ZKRD) in<br />
Ulm international vernetzt. Die Mannheimer Präparate sind damit sämtlichen<br />
Transplantationszentren weltweit zugängig. Seit ihrem Bestehen hat die Mannheimer<br />
Nabelschnurblutbank 39 Stammzellpräparate an Transplantationszentren abgegeben. Nach<br />
uns vorliegenden klinischen Daten konnte eine Vielzahl von Patienten damit erfolgreich<br />
transplantiert werden. Seit dem Jahre 20<strong>10</strong> ist die Mannheimer Nabelschnurblutbank bei der<br />
Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) akkreditiert und erfüllt damit den<br />
höchsten weltweiten Standard für die Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung von allogenen<br />
Stammzellpräparaten aus Nabelschnurblut.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahl:<br />
<br />
<br />
<br />
Abteilungsleiter PD Dr. Michael Müller-Steinhardt (anteilig)<br />
Gruppenleitung Frau Monika Latta<br />
2,5 Vollzeitkräfte MTA<br />
111
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Ablauf einer Plazentarestblutspende<br />
Punktion der Vene umbilicalis unter sterilen Bedingungen nach Abnabelung <strong>des</strong> Kin<strong>des</strong><br />
und Entnahme von mind. 68 ml Plazentarestblut in ein spezielles Entnahmebeutelset im<br />
Kreißsaal.<br />
Auftrennung <strong>des</strong> Vollblutes in die einzelnen Komponenten mittels konventionieller<br />
Komponentenauftrennung (Optipress)<br />
112
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Buffy-<br />
Coat<br />
Erythrozyten<br />
Plasma<br />
Auftrennung in die Komponenten Erythrozyten, Plasma und Buffycoat.<br />
Für die Weiterverarbeitung wird der leukozyten- bzw. stammzellreiche Buffycoat<br />
verwendet.<br />
Alternative Komponentenauftrennung mittels automatisierter Zentrifugation<br />
(Sepax-Gerät)<br />
113
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Kryokonservierung <strong>des</strong> Buffycoatpräparates unter Zugabe <strong>des</strong> Kryoprotektivums<br />
Dimethylsulfoxid (DMSO) unter GMP-gerechten Bedingungen im Reinraumlabor<br />
Langzeitlagerung der volumenreduzierten Nabelschnurpräparate in der Gasphase von<br />
flüssigen Stickstoff bei – 155 °° bis -196°Grad Celsius<br />
5.2.3 Knochenbank<br />
Seit dem Dezember 20<strong>10</strong> nimmt das Institut für Transfusionsmedizin Knochen vom<br />
Orthopädisch Unfallchirurgischen Zentrum (OUZ) der Universitätsmedizin Mannheim<br />
114
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
entgegen. Es handelt sich dabei um Femurköpfe von freiwilligen Spendern, die sich einer<br />
Hüftarthroplastik mit Einbau einer Totalendoprothese unterziehen. Dieser Knochen wird über<br />
die Gewebebank <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes zu allogenem sterilisierten Knochen<br />
aufgearbeitet. Da das OUZ auch noch eine hauseigene Knochenbank unterhält ist die<br />
Abgabe an die Gewebebank Baden Baden einer natürlichen Schwankung unterworfen,<br />
jeweils abhängig von der aktuellen Beständen der Knochenbank werden die Entnahmen<br />
entweder der einen oder anderen Bank zur Verfügung gestellt. Die infektionsserologischen<br />
Testungen und die Aufklärung der Spender sind identisch zu normalen Blutspendern.<br />
Wichtig ist dabei die Einhaltung von Fristen bis zum Abseren <strong>des</strong> Probenblutes und die bis<br />
zum Einfrieren <strong>des</strong> Femurkopfes. Um dies zu gewährleisten, wurden das Vorgehen <strong>des</strong> OUZ<br />
an die Kriterien <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes angeglichen. In der Regel wird am OP-Tag<br />
vom Gewebebankbeauftragten <strong>des</strong> OUZ entschieden, für wen der Femurkopf bestimmt ist.<br />
Entwicklung der Femurkopfentnahmen von Dezember 2009 bis Dezember 2012.<br />
115
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
5.3 Labordiagnostik<br />
5.3.1 Leistungskatalog Labordiagnostik<br />
116
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Institut Mannheim: Ansprechpartner und Telefonnummern 4<br />
Präanalytik<br />
Gewinnung von Untersuchungsmaterial 6<br />
Probenmaterial 7<br />
Verpackung von Proben 7<br />
Anforderungsscheine 7<br />
Ergebnisse, Befundmitteilung 8<br />
Infektionsserologie<br />
CMV-IgG-Antikörper 9<br />
CMV-IgM-Antikörper 9<br />
Hepatitis-A-Virus-IgG-Antikörper 9<br />
Hepatitis-A Virus-IgM-Antikörper 9<br />
Hepatitis-B-Virus Core-IgG-Antikörper 9<br />
Hepatitis B-Surface-Antigen <strong>10</strong><br />
Hepatitis-B-Surface-Antikörper <strong>10</strong><br />
Hepatitis-C-Virus (HCV)-Antikörper <strong>10</strong><br />
Human-immunodeficiency-Virus Typ 1/2 (HIV 1/2)-Antikörper <strong>10</strong><br />
Lues-Antikörper <strong>10</strong><br />
HTLV-1/2 Antikörper <strong>10</strong><br />
Thrombozytendiagnostik<br />
Antikörperbeladung auf Thrombozyten 11<br />
Freie Thrombozytenantikörper 11<br />
Heparin induzierte Thrombozytopenie (HIT Typ II) 12<br />
Thrombozyten-Crossmatch 12<br />
Medikamentenabhängige Thrombozytenantikörper 12<br />
Thrombozytenantigene HPA-1, -2, -3, -5, -15 12<br />
Thrombobasthenie Glanzmann 12<br />
Bernhard-Soulier-Syndrom 13<br />
Granulozytendiagnostik<br />
Freie Granulozytenantikörper 14<br />
Granulozyten-Crossmatch 14<br />
Medikamentenabhängige Granulozytenantikörper 14<br />
Granulozytenantigene (HNA, -SH) 14<br />
HLA-Labor – Transplantationsimmunologie<br />
HLA-Klasse I/II-Antikörperscreening 15<br />
HLA-Klasse I/II-Antikörperdifferenzierung 15<br />
Lymphozyten-Crossmatch (LCT) 15<br />
Molekularbiologische Bestimmung der HLA-Klasse I (A/B/C)-Merkmale 16<br />
Molekularbiologische Bestimmung der HLA-Klasse II (DR/DQ)-Merkmale 16<br />
Immunstatus 16<br />
Chimärismus-Analyse 17<br />
Referenz- und Kreuzprobenlabor – Immunhämatologie<br />
Blutgruppe 18<br />
Molekularbiologische Bestimmung von Blutgruppenmerkmalen 18<br />
Antikörpersuchtest 18<br />
Antikörperdifferenzierung 19<br />
117
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Spezielle immunhämatologische Folgeuntersuchungen 19<br />
Direkter Coombstest 19<br />
Serologische Verträglichkeitsprobe 20<br />
Antigenaustestung 20<br />
Antikörper-Titration 20<br />
Hämolysin-Titer, Isoagglutinin-Titer 21<br />
Kälteagglutinine 21<br />
Kältehämolysine, Donath-Landsteiner-Hämolysine 21<br />
Kryoglobuline 21<br />
Polyagglutinabilität und Nachweis von bakteriellen Antigenen auf Erythrozyten 22<br />
Medikamentenabhängige Antikörper gegen Erythrozyten 22<br />
Abklärung einer Transfusionsreaktion 22<br />
Abstammungsgutachten<br />
Blutgruppensysteme AB0 und Rhesus 23<br />
Molekularbiologische Bestimmung der Blutgruppe 23<br />
STR-Analyse 23<br />
Stammzelldiagnostik<br />
Koloniebildende Zellen (CFU-Assay) 24<br />
Immunologisches Differentialblutbild (quantitativ) 24<br />
CD34+ -Zellen (quantitativ) 24<br />
5.3.2 Blutbank und Immunhämatologie<br />
Die Blutbank der Universitätsmedizin Mannheim gehört zum Institut für Transfusionsmedizin<br />
und Immunologie. Durch ihre Lage direkt auf dem Gelände <strong>des</strong> Klinikums ist eine schnelle<br />
Versorgung der Patienten mit Blutprodukten insbesondere in Notfallsituationen jederzeit<br />
gewährleistet. Die Mitarbeiterinnen der Blutbank arbeiten in verschiedenen Schichten und<br />
Bereitschaftsdiensten, so dass eine Bereitstellung von Blutpräparaten 24h am Tag möglich<br />
ist.<br />
Die ärztliche Leitung der Blutbank oblag bis zum Jahr 2008 Herrn Dr. Kerowgan und wurde<br />
im Anschluss von Frau PD Dr. Janetzko übernommen. Der jeweiligen Leitung zur Seite steht<br />
ein ärztlicher Kollege oder eine Kollegin, die sich überwiegend vor Ort um die Belange der<br />
Abteilung kümmert. Hierbei handelt es sich in der Regel um einen Facharzt für<br />
Transfusionsmedizin. Seit Oktober 2005 war Frau PD Dr. Janetzko für diese Aufgabe<br />
verantwortlich. Im Frühjahr 2009 übernahm Frau Dr. Goebel ihre Funktion. Zusätzlich wird<br />
die tägliche ärztliche Routinearbeit in diesem Bereich von einem ärztlichen Kollegen oder<br />
einer Kollegin abgebildet, die sich in der Weiterbildung befindet. Dieser Assistenzarzt/-ärztin<br />
ist im Rahmen der Rotation in ca. 4-6 wöchigen Blöcken in der Blutbank eingesetzt.<br />
Im Jahr <strong>2002</strong> waren in der Blutbank 13 medizinisch technische Assistenten/-innen angestellt.<br />
Nachdem zwischenzeitlich die Mitarbeiterzahl abfiel, liegt sie aktuell bei 16 Personen,<br />
darunter 5 Mitarbeiterinnen in Teilzeitbeschäftigung. Seit dem Jahr <strong>2002</strong> ist der Blutbank<br />
118
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
auch der Laborbereich „Thrombozytendiagnostik“ angegliedert. Aus dem Pool der MTAs sind<br />
aktuell 7 Mitarbeiterinnen in dieses zusätzliche Aufgabenfeld eingearbeitet und rotieren nach<br />
Dienstplan zwischen diesen beiden Laborbereichen. Für beide Laborbereiche ist zurzeit Frau<br />
Jeschke als Gruppenleitung verantwortlich.<br />
Zusätzlich zur Routinearbeit hat jede MTA noch weitere Sonderaufgaben. Dazu zählen z.B.<br />
die Betreuung von Projekten im Zusammenhang mit einer Automatisierung oder der<br />
Einführung neuer Methoden, Verantwortlichkeiten im Bereich <strong>des</strong> laborinternen<br />
Qualitätsmanagement-Systems oder eine Assistenz bei Studien in Kooperation mit der<br />
molekularbiologischen Abteilung. Des Weiteren sind einige Mitarbeiterinnen an<br />
Lehrveranstaltungen im Bereich der MTA-Ausbildung beteiligt oder betreuen zusammen mit<br />
ärztlichen Kollegen transfusionsmedizinische Praktikumseinheiten für Medizinstudenten.<br />
Zusätzlich zu den medizinisch-technischen Assistentinnen sind seit November 2006 für den<br />
Arbeitsplatz der Probenannahme drei Arzthelferinnen (jeweils 50%) eingestellt, die die<br />
Blutbank in administrativen Aufgaben unterstützen.<br />
119
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Allein für die Universitätsmedizin Mannheim mit einer Bettenzahl von 1.352 Betten und einer<br />
Fallzahl von ca. 76.000 stationären Patienten und ca. 218.000 ambulanten Patienten im Jahr<br />
20<strong>10</strong> wurden in diesem Jahr insgesamt 18.062 Erythrozytenkonzentrate, 3.414<br />
Thrombozytenkonzentrate und 4.302 Plasmapräparate ausgegeben. Vergleichbare Zahlen<br />
finden sich auch für das Jahr <strong>2011</strong>.<br />
Neben der Versorgung der Patienten der Universitätsmedizin Mannheim mit Blutprodukten,<br />
übernimmt die Blutbank auch die immunhämatologische Diagnostik und Versorgung von<br />
Patienten externer Krankenhäuser in Mannheim und der Region sowie von verschiedenen<br />
Arztpraxen.<br />
Die Blutbank ist zudem Referenzlabor für viele Krankenhäuser der Region, die nur eine<br />
immunhämatologische Basisdiagnostik durchführen. Bei auffälligen Befunden werden die<br />
Blutproben zur weiterführenden Abklärung in die Blutbank geschickt. Hier werden dann<br />
weitere Untersuchungen wie eine Antikörperdifferenzierung, Elution oder Autoabsorption<br />
durchgeführt. Die Blutbank übernimmt auch die Versorgung und Bereitstellung von<br />
speziellen Antigen-ausgetesteten Erythrozytenkonzentraten für diese Krankenhäuser.<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
Kreuzprobe<br />
Blutgruppe<br />
AKS<br />
20.000<br />
<strong>10</strong>.000<br />
0<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
In der <strong>10</strong>-Jahres-Statistik (siehe Abbildung oben) zeigte sich bis zum Jahr 2006 eine in etwa<br />
konstante Zahl der Blutgruppenbestimmungen von ca. 6.000 pro Jahr, in den folgenden<br />
Jahren gab es einen leichten Anstieg mit zuletzt ca. 7.500 Bestimmungen im Jahr <strong>2011</strong>.<br />
Ein ähnlicher Trend findet sich bei der Zahl der Verträglichkeitstestungen. Während in den<br />
Jahren <strong>2002</strong> – 2008 zwischen 40.000 und 45.000 Testungen durchgeführt wurden, ließ sich<br />
in den Jahren 2009 bis <strong>2011</strong> ein deutlicher Anstieg der Verträglichkeitstestungen<br />
120
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
verzeichnen. Im Jahr <strong>2011</strong> führte die Blutbank etwas mehr als 56.000<br />
Verträglichkeitstestungen durch.<br />
Die Zahl der Antikörpersuchteste (AKS) blieb ebenfalls in den Jahren <strong>2002</strong> – 2009 konstant<br />
bei annähernd 8000 Untersuchungen pro Jahr. In den beiden folgenden Jahren kam es<br />
jedoch nahezu zu einer Verdopplung der Antikörpersuchteste. Die Zahl der Untersuchungen<br />
lag im Jahr <strong>2011</strong> bei fast 16.000.<br />
Aufgrund dieser deutlichen Zunahme der Untersuchungszahlen und zur weiteren Erhöhung<br />
der Sicherheit bei der Bereitstellung von Blutpräparaten wurde im März 20<strong>10</strong> der erste<br />
Vollautomat zur Durchführung von Verträglichkeitstestungen und Antikörpersuchtesten in die<br />
Routinearbeit integriert. In den Jahren zuvor wurden verschiedene Automaten im<br />
Probebetrieb getestet um ein für die Belange der Blutbank passen<strong>des</strong> Gerät zu finden. Die<br />
Entscheidung fiel schlussendlich auf das Gerät AutoVue Innova der Firma Ortho Clinical<br />
Diagnostics. Seit Herbst <strong>2011</strong> wurde aufgrund <strong>des</strong> weiterhin steigenden Probenaufkommens<br />
und der Auslastung <strong>des</strong> ersten Gerätes ein weiteres Gerät beschafft.<br />
Der ansteigende Trend in der Zahl der Probeneinsendungen bestätigt die zentrale Rolle der<br />
Blutbank als Referenzlabor und versorgende Einrichtung der Region mit Blutprodukten.<br />
5.3.3 Thrombozytenimmunologie<br />
Im unserem Laborbereich, der Thrombozytenimmunologie, wird die Diagnostik im<br />
Zusammenhang mit Thrombozytopenien, Thrombozytopathien und<br />
121
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Thrombozytensubstitutionsbedarf durchgeführt. Wir bieten zudem unseren klinisch tätigen<br />
Kollegen bei diesen Fragestellungen einen 24-Stunden Konsiliardienst an.<br />
Ein besonderer Aspekt der Thrombozytenimmunologie stellt die Diagnostik der neonatalen<br />
Allo-Immunthrombozytopenie (NAIT) einschließlich der weitergehenden Versorgung dieser<br />
Patienten mit HPA-ausgewählten Thrombozytenpräparaten dar.<br />
Der Nachweis und die Spezifizierung von thrombozytären Allo- und Autoantikörpern erfolgt<br />
durchflußzytometrisch mittels Plättchen-Immunfluoreszenztest (PIFT) und Simultaneous<br />
Analysis of Specific Platelet Antibody (SASPA). Diese Methode wurde in unserm Institut<br />
entwickelt und etabliert und kommt mittlerweile über das Institut hinaus zunehmend zur<br />
Anwendung.<br />
Die Bestimmung der thrombozytenspezifischen HPA-Merkmale erfolgt mittels PCR. Auch<br />
diese PCR-Methode ist eine Eigenentwicklung, die inzwischen breite Anwendung findet.<br />
Beim Vorliegen von thrombozytären und/ oder HLA-Antikörper erfolgt bei Substitutionsbedarf<br />
die gezielte Auswahl von HPA- und HLA-kompatiblen Thrombozytenkonzentraten. Hierfür<br />
steht eine große Zahl getesteter Spender zur Verfügung.<br />
Darüber hinaus klären wir unter Verwendung der Durchflusszytometrie Thrombozytopathien<br />
bei Verdacht auf Thrombasthenia Glanzmann und dem Bernhard Soulier Syndrom sowie<br />
medikamenteninduzierte Thrombozytopenien ab.<br />
Auch die Diagnostik der heparininduzierten Thrombozytopenie Typ II (HIT) unter<br />
Verwendung <strong>des</strong> Thrombozytenagglutinationstest (HIPA) und eines ELISA (HIA) fällt in<br />
unseren Aufgabenbereich.<br />
122
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Zur Verbesserung der Patientenversorgung wurde der Laborbereich<br />
Thrombozytenimmunologie 2004 ins Universitätsklinikum Mannheim verlegt. Unser Labor<br />
befindet sich somit in der direkten Nähe zu allen Bettenstationen, den Ambulanzbereichen<br />
sowie der Notaufnahme und bildet zusammen mit unserem immunhämatologischen Labor,<br />
der Blutbank, eine Einheit. Die MTAs aus dem Bereich Thrombozytenimmunologie werden<br />
nach dem Rotationsprinzip auch in dem immunhämatologischen Labor eingeteilt. Aus einem<br />
Pool von 16 MTAs, davon 5 Mitarbeiterinnen in Teilzeitbeschäftigung, sind 7 Kolleginnen,<br />
darunter eine Kollegin in Teilzeit, in die Thrombozytenimmunologie eingearbeitet. Davon<br />
sind 2,5 MTAs kostenstellenmäßig der Thrombozytenimmunologie zugeordnet.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahl:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1 Oberarzt, Abteilungsleiter (anteilig)<br />
1 Facharzt für Transfusionsmedizin, Stationsarzt (anteilig)<br />
In Rotation alle Assistenzarzt/Assistenzärztin in Weiterbildung sowie Fachärzte<br />
für die Routinedienste (anteilig)<br />
2,5 MTAs<br />
Die Thrombozytendiagnostik wurde insbesondere durch die Einführung der hoch sensitiven<br />
und spezifischen Methode SASPA zur Spezifizierung von thrombozytären Antikörpern<br />
erweitert und in der Sensitivität wie auch Spezifität bei der Detektion von Antikörpern im<br />
Vergleich zu der bisherigen Methode MAIPA verbessert.<br />
Die Anzahl der Probeneingänge konnten wir über die letzten <strong>10</strong> Jahre kontinuierlich steigern.<br />
Im DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen ist Mannheim das einzige Institut,<br />
dass eine Thrombozytendiagnostik anbietet, so dass wir in dem Einzugsbereich Baden-<br />
Württemberg und Hessen unsere Kompetenz einbringen können.<br />
123
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Anzahl der eingeschickten Proben in den letzten <strong>10</strong> Jahren<br />
1200<br />
<strong>10</strong>00<br />
Anzahl der Proben<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Jahre<br />
Ein großes, für 2012 anstehen<strong>des</strong> Projekt, ist die Anbindung <strong>des</strong> Thrombozytenlabors an<br />
das Host-EDV-System INLOG. Zukünftig werden die Analysenerfassung, -bearbeitung und -<br />
befundung sowie die Erstellung von Befundbriefen über die EDV erfolgen.<br />
5.3.4 HLA-Labor<br />
Im HLA-Labor <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> erfolgen verschiedene transplantationsimmunologische<br />
Untersuchungen sowie Beratung bei der Blutstammzell- und Knochenmarkstransplantation<br />
für Familienspender oder unverwandte Fremdspender. Es werden derzeit alle modernen<br />
Typisierungsverfahren für die Merkmale der HLA-Klasse I sowie HLA-Klasse II mittels<br />
molekulargenetischer Methoden inklusive der Sequenzierung durchgeführt.<br />
Zum Nachweis von transfusionmedizinisch- oder transplantationsimmunologisch relevanten<br />
HLA-Antikörpern einschließlich deren Differenzierungen werden der Lymphozytotoxizitätstest<br />
(LCT) sowie ELISA-basiertem Verfahren eingesetzt.<br />
In der Granulozytenimmunologie werden Patienten mit Erkrankungen wie<br />
Autoimmungranulozytopenie, Neonatale Alloimmungranulozytopenie, medikamenteninduzierte<br />
Granulozytenpenie oder TRALI (Transfusionsassoziierte akute Lungeninsuffizienz)<br />
untersucht. Hierfür stehen hoch sensitive durchflusszytometrische Methoden zum Nachweis<br />
und zur Spezifizierung dieser Allo- und Autoantikörper zur Verfügung (Flow-Gift, Sasga).<br />
Zum weiteren Aufgabenbereich <strong>des</strong> Labors gehört auch die Immunphenotypisierung der<br />
Lymphozyten (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD56+, CD19+ Zellpopulation) einschließlich<br />
124
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
der Bestimmung der Aktivierungsprofile der T-Lymphozyten (HLA DR, CD38, CD57, CD45<br />
RO). Diese Untersuchungen werden im Zusammenhang mit der Diagnostik von habituellen<br />
Aborten oder aber auch bei Transplantationen eingesetzt.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahl im Labor:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Facharzt für Transfusionsmedizin (anteilig)<br />
Biologe (anteilig)<br />
Assistenzarzt / Assistenzärztin in Weiterbildung<br />
4,5 MTAs<br />
Gestern und heute: Die Besetzung <strong>des</strong> HLA-Labores in den letzten <strong>10</strong> Jahren<br />
HLA-Labor / Granulozytendiagnostik<br />
125
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Der typische Handgriff im HLA-Labor: Griff an die eingefrorenen<br />
Proben zur hochauflösenden Typisierung<br />
Derzeit ist der Arbeitsaufwand<br />
für die HLA-Typisierungen und<br />
Tests der Granulozytendiagnostik<br />
immens: Die<br />
optimale MTA sieht etwa so<br />
aus …<br />
Die PCR-Cycler<br />
Auswertung der<br />
OLERUP-SSP<br />
Der Biomek-<br />
Pipettierroboter<br />
Der Quickstep: HLA-Typisierung mittels SSO<br />
Wichtige Entwicklungen in der Abteilung von 2007 bis 2012<br />
Im HLA-Labor wurden in den letzten Jahren insbesondere die technischen Voraussetzungen<br />
für eine Automatisierung der molekulargenetischen HLA-Typisierung geschaffen. Mit Hilfe<br />
von modernen Laborautomaten ist eine effektive Typisierung von potenziellen<br />
Knochenmarkspendern für die Deutsche Stammzellspenderdatei Rhein-Neckar mittels<br />
Polymerase Kettenreaktion mit sequenzspezifischen Oligonukleotiden (PCR-SSO) möglich.<br />
126
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Projektes zur Förderung der hochauflösenden Spendertypisierung <strong>des</strong> DRK<br />
Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen wurden im Laufe der letzten 2 Jahre<br />
nahezu 4000 Spender typisiert (siehe Abbildung 1). In diesem Zusammenhang wurde auch<br />
die hochauflösende HLA-Typisierung mittels Sequenzierung im Labor etabliert.<br />
Im Rahmen der Akkreditierung bei der European Ferderation for Immunogenetics (EFI)<br />
finden jährliche Audits im Labor statt. Alle 3 Jahre erfolgt eine Auditierung durch externe<br />
Gutachter im jährlichen Rhythmus durch interne Gutachter.<br />
Im Rahmen der Granulozytendiagnostik wurde insbesondere im Laufe der letzten Jahre eine<br />
Automatisierung der Granulozytenantikörperdiagnostik im Labor etabliert. Damit ist es<br />
möglich, täglich bis zu mehrere hundert Proben auf das Vorhandensein auf HLA-Antikörpern<br />
zu untersuchen (Flow-Gift). Dies ist im Zusammenhang mit der Diagnostik und Prävention<br />
der Transfusionsassoziierten akuten Lungeninsuffizienz (TRALI) von zentraler Bedeutung.<br />
Am Standort Mannheim ist die zentrale Testung von Blutspendern beim DRK<br />
Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen angesiedelt (siehe Abbildung 2).<br />
HLA-Typisierungen von Spendern und Patienten<br />
8000<br />
7000<br />
7250<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
4277<br />
3000<br />
2000<br />
<strong>10</strong>00<br />
0<br />
2278<br />
1800<br />
1849<br />
1434<br />
1150<br />
<strong>10</strong>50 <strong>10</strong>20 <strong>10</strong>30 <strong>10</strong>00<br />
1<strong>10</strong>0<br />
850<br />
700<br />
797<br />
205 278<br />
331 380<br />
116<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Patienten<br />
Spender<br />
Abbildung 1<br />
127
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Granulozytenantikörperdiagnostik<br />
3000<br />
2757<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1235<br />
<strong>10</strong>00<br />
500<br />
0<br />
632 625<br />
282<br />
179<br />
122 131 183 168<br />
192 187<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Abbildung 2<br />
Patienten<br />
Spender<br />
Auswertung <strong>des</strong> Flow-GIFTs in der Granulolzytendiagnostik<br />
128
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
5.3.5 Infektionsserologie<br />
Die infektionsserologische Testung von Blutspenden, welche nach Vorgaben der Richtlinien<br />
der Bun<strong>des</strong>ärztekammer zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung<br />
von Blutprodukten (Hämotherapie) zur Freigabe einer Blutspende erforderlich sind, wurde<br />
von <strong>2002</strong> bis <strong>2011</strong> zentral in Baden-Baden durchgeführt. Seit <strong>2011</strong> erfolgen diese<br />
Untersuchungen in Frankfurt einschließlich der PCR Testung, die bis 20<strong>10</strong> in Ulm zentral für<br />
die Institute Baden-Baden, Mannheim und Ulm durchgeführt wurde.<br />
Im Institut in Mannheim erfolgt die infektionsserologische Testung für speziell ausgewählte<br />
Blutspenden. Hierunter fallen Granulozyt-, Thrombozyt-, Monozyt- und periphere<br />
Stammzellapheresen, die zeitnah zur Spende freigegeben werden müssen und für die unter<br />
Umständen die Untersuchungsergebnisse auch am Wochenende zur Verfügung stehen<br />
müssen.<br />
Das Untersuchungspanel umfasst die folgenden Parameter:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Anti HIV-1/2-Antikörper<br />
HBs-Ag<br />
Anti-HCV-Antikörper<br />
Anti-CMV (IgG und IgM)<br />
Antikörper gegen Treponema pallidum<br />
HTLV 1+2 Antikörper<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
HIV (Axsym)<br />
HBsAg (Axsym)<br />
HCV (Axsym)<br />
CMV-IgG (Axsym)<br />
CMV-IgM (Axsym)<br />
TPHA<br />
HTLV<br />
<strong>10</strong>00<br />
0<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Die Graphik zeigt die Anzahl der Untersuchungsansätze (Verbrauchsstatistik).<br />
129
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Alle Parameter mit Ausnahme der TPHA- und HTLV-Testung werden maschinell<br />
über den Axsym der Firma Abbott untersucht. Die Testung auf das Vorliegen von<br />
Antikörpern gegen Treponema pallidum bzw. das HTL-Virus erfolg manuell unter<br />
Verwendung eines ELISA. Die Spenden- und damit die Befundverwaltung erfolgt<br />
über das Host-EDV-System Inlog. Da die Anbindung <strong>des</strong> Axsym nicht umgesetzt<br />
werden konnte, erfolgt die Befundeingabe manuell durch die MTAs im 4-<br />
Augenprinzip.<br />
Zusätzlich fallen in den Aufgabenbereich unserer Abteilung die infektionsserologische<br />
Testung von Spendern im Zuge der Voruntersuchung zu unterschiedlichen Apheresen, von<br />
Spendern, die für eine Stammzellspende in Frage kommen (confirmatory typing), die<br />
Testung von allogenen und autologen Plazentarestblutspenden sowie Testungen im<br />
Rahmen betriebsärztlicher Untersuchungen. Bei diesen Fragestellungen werden über die<br />
oben genannten Untersuchungsparameter hinaus auch die Testung auf Anti-HAV, Anti-HBc<br />
und Anti-HBs durchgeführt.<br />
Neben diesen praktischen Aufgaben entfällt ein großer Arbeitsanteil auf die Koordinierung<br />
und Verschickung der Rückstellproben im Zusammenhang mit Rückverfolgungsverfahren<br />
sowie der Verwaltung der Befunde und Befundunterlagen der in Frankfurt untersuchten<br />
infektionsserologischen Parameter der Bestätigungsdiagnostik. Die Befunde müssen alle<br />
händisch in das EDV System durch die MTAs eingepflegt werden.<br />
130
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Die MTAs aus unserem Bereich werden nach dem Rotationsprinzip auch im<br />
Stammzelllaborbereich eingeteilt. Aus einem Pool von 5 MTAs, davon 2 Mitarbeiterinnen in<br />
Teilzeitbeschäftigung, sind Alle in die infektionsserologische Diagnostik eingearbeitet.<br />
Davon ist 0,5 MTA kostenstellenmäßig der Infektionsserologie zugeordnet.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahl:<br />
<br />
1 Oberarzt, Leiter der Kontrolle (anteilig)<br />
In Rotation alle Assistenzarzt/Assistenzärztin in Weiterbildung sowie Fachärzte<br />
für die Routinedienste (anteilig)<br />
<br />
0,5 MTAs<br />
Aufgrund wirtschaftlicher Aspekte werden 2012 alle Untersuchen mit Ausnahme der HTLV<br />
Testung nach Frankfurt verlagert.<br />
5.3.6 Qualitätskontrolle<br />
Unsere Abteilung die Qualitätskontrolle (QKO) hat die Aufgabe, die Qualität der hergestellten<br />
Blutkomponenten regelmäßig zu überprüfen. Die Prüffrequenz sowie die Prüfparameter zu<br />
den jeweiligen Blutprodukten sind in den Richtlinien der Bun<strong>des</strong>ärztekammer zur Gewinnung<br />
von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) sowie<br />
den Endproduktspezifikationen der jeweiligen Blutprodukte festgelegt. Die Ergebnisse der<br />
QKO-Untersuchungen dienen als Steuerungselemente zur Überwachung und Optimierung<br />
der Herstellungsprozesse.<br />
Die Abteilung ist in zwei Bereiche, die mikrobiologische und die hämatologische<br />
Qualitätskontrolle, eingeteilt und führt die folgenden Untersuchungen durch:<br />
131
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Baden-Baden Frankfurt Kassel Mannheim Ulm<br />
Qualitätskontrolle<br />
Hämatologische<br />
Mikrobiologische QKO<br />
• Hämatokrit<br />
• Hämoglobin<br />
• % Hämolyserate<br />
• Restleukozytenzahl<br />
• Resterythrozytenzahl<br />
• Restthrombozytenzahl<br />
• ph-Messung<br />
• Kaliumbestimmung<br />
• Faktor VIII Bestimmung<br />
• ATP-Messung<br />
• Citrat-Messung<br />
• CD 62-Messung<br />
•<br />
• Sterilitätstestung<br />
(aerob / anaerobe Ansätze)<br />
• Luftkeimzahl<br />
• Oberflächenkeimzahl<br />
• Autoklavenüberprüfung<br />
• Reinraummonitoring<br />
Die Häufigkeit der hämatologischen Kontrollen beträgt 1 % der hergestellten Produkteart<br />
bzw. min<strong>des</strong>tens 4 Einheiten pro Monat. Eine Ausnahme hiervon stellt die<br />
Probennahmefrequenz zur Kontrolle <strong>des</strong> Gerinnungsfaktors VIII in Plasma dar, die sich auf<br />
0,5 % bzw. min<strong>des</strong>tens 4 Einheiten pro Monat beläuft.<br />
132
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Folgende Laborparameter werden aus den jeweiligen Blutkomponenten am Laufzeitanfang<br />
bzw. – ende bestimmt:<br />
Erythrozytenkonzentrat<br />
Thrombozytenkonzentrat<br />
Gefrorenes<br />
Frischplasma<br />
Laufzeitanfang<br />
Hämatokrit<br />
Hämoglobin<br />
Restleukozyten<br />
Volumen<br />
Thrombozytenzahl<br />
Resterythrozyten<br />
Restleukozyten<br />
Volumen<br />
Restthrombozyten<br />
Restleukozyten<br />
Resterythrozyten<br />
Faktor VIII<br />
Volumen – wird bei der<br />
Herstellung erfasst<br />
Laufzeitende<br />
Hämolyserate<br />
Freies Hämoglobin<br />
Bakteriologische Testung<br />
Thrombozytenzahl<br />
pH-Wert<br />
Bakteriologische Testung<br />
Faktor VIII<br />
Bakteriologische Testung<br />
Die QKO-Testung muss immer aus dem Originalprodukt durchgeführt werden Lediglich für<br />
aus Vollblut hergestellte Plasmen werden Pools, hergestellt aus 6 Einzelplasmen, auf Faktor<br />
VIII untersucht.<br />
133
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Seit 2000 wird die Sterilkontrolltestung für die Institute Baden-Baden, Mannheim und Ulm<br />
zentral in unserem Labor durchgeführt. 2004 kamen die Institute Frankfurt und Kassel hinzu.<br />
Im gleichen Jahr wurde auch die hämatologische Qualitätskontrolle für alle 5 Institute in<br />
unsere Abteilung zentralisiert. Somit werden die zu untersuchenden Blutkomponenten täglich<br />
von den Instituten Frankfurt, Kassel, Ulm und Baden-Baden nach Mannheim transportiert<br />
und hier untersucht.<br />
Hämatologische Qualitätskontrolle<br />
Alle Institute<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
Anzahl<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
Erythrozytenkonzentrat<br />
Thrombozytenkonzentrat<br />
Gefrorenes Frischplasma<br />
2000<br />
<strong>10</strong>00<br />
0<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
Bakteriologische Qualitätskontrolle<br />
Alle Institute<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
Anzahl<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
Erythrozytenkonzentrat<br />
Thrombozytenkonzentrat 4er Pool<br />
Gefrorenes Frischplasma<br />
<strong>10</strong>00<br />
500<br />
0<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
134
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Die Anzahl der monatlich durchzuführenden Sterilitätskontrolltestung (bakteriologische<br />
Qualitätskontrolle) errechnet sich nach der Formel 0,4 x √n (n = Anzahl der hergestellten<br />
Komponenten pro Monat) bzw. muss min<strong>des</strong>tens 4 Einheiten pro Monat für alle<br />
Blutproduktarten umfassen.<br />
Bis 2005 erfolgte bei positiven Sterilitätstestungen in aeroben und anaeroben<br />
Flüssigkulturmedien die Keimisolierung und Keimdifferenzierung in unserer Abteilung. 2005<br />
wurden diese Untersuchungen in das Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene <strong>des</strong><br />
Universitätsklinikums Mannheim ausgelagert.<br />
Darüber hinaus werden Sterilkontrolltestungen generell aus allen autolog hergestellten<br />
Blutprodukten sowie aus Produkten, die in einen Transfusionszwischenfall involviert sind,<br />
durchgeführt.<br />
135
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung der Laborleistungen von <strong>2002</strong> – <strong>2011</strong>:<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
<strong>10</strong>000<br />
Faktor VIII<br />
Freies Hb<br />
Restzell-gehalt<br />
Sterilitäts-prüfung<br />
Kleines BB<br />
5000<br />
0<br />
<strong>2002</strong> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20<strong>10</strong> <strong>2011</strong><br />
In unserer Abteilung werden ebenfalls zentral für alle Institute Untersuchungen im<br />
Zusammenhang mit der Zulassung von neuen Blutprodukten bzw. der Etablierung neuer<br />
Herstellungsmodalitäten durchgeführt. Zusätzlich zu den oben genannten<br />
Untersuchungsparametern werden hierfür abhängig von der Produkteart Citrat- und ATP-<br />
Messungen sowie Thrombozytenaktivierungsmarker (CD 62) bestimmt. Für die Zukunft ist<br />
die Etablierung weiterer Testverfahren zur Beurteilung der Thrombozytenfunktion geplant.<br />
Wie bereits eingangs dargestellt, fallen in den Aufgabenbereich dieser Abteilung auch die<br />
Hygienekontrollen für das Institut Mannheim. Diese umfassen die Überprüfung der<br />
Autoklaven und der Heißluftsterilisatioren, die Oberflächenkeimzahlbestimmung und<br />
Luftkeimkontrollen in den Räumen der Produktion sowie im Reinraumbereich, in dem auch<br />
der Hygienezustand der Lamiarflowbänke und der dort arbeitenden Mitarbeiter durch<br />
Abklatschkulturen überwacht wird.<br />
Zentral für alle Institute werden auch Reklamationen von Blutprodukten bei Verdacht auf eine<br />
erhöhte Hämolyserate oder bakterielle Kontamination in unserer Abteilung untersucht.<br />
Neben diesen praktischen Aufgaben entfällt ein großer Arbeitsanteil auf die Erstellung von<br />
Probenziehplänen und die statistische Auswertung der erhobenen Daten, da bei<strong>des</strong> bisher<br />
noch händisch erfolgen muss.<br />
2008 wurde in der Qualitätskontrolle für die Institute der Muttergesellschaft ein neues EDV<br />
Programm, QUAKO, etabliert, das seit 2001 im DRK-Blutspendedienst Nord läuft. Das<br />
Programm wurde für die Erstellung der Probenziehpläne und Analysenpanels für die<br />
136
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
jeweilige Produktart, Ergebnisdokumentation und die statistische Datenauswertung<br />
konzipiert. Das Programm ermöglicht zum einen die Anbindung der Analysengeräte an die<br />
EDV zur on-line Übertragung der QKO-Daten. Zum anderen können durch eine Vernetzung<br />
mit der Host-EDV Inlog herstellungsrelevante Daten übernommen werden. Die Verbindung<br />
beider Datensätze ermöglicht eine deutliche Verbesserung für die statistische Auswertung<br />
von Ergebnissen abhängig von der Herstellung. Zugriff zu diesem Programm ist von allen<br />
Instituten aus möglich, so dass eine zeitnahe Überwachung der Ergebnisse durch den Leiter<br />
der Kontrolle vor Ort möglich ist.<br />
Da <strong>2011</strong> der Support für dieses EDV Programm eingestellt wurde, hat sich Herr Gerlich,<br />
MTA der QKO Abteilung, in das Programm so intensiv eingearbeitet, dass er diese Aufgabe<br />
für die Institute der Muttergesellschaft übernehmen konnte.<br />
Die MTAs der Qualitätskontrollabteilung werden nach dem Rotationsprinzip eingeteilt, so<br />
dass alle Kolleginnen und Kollegen in allen Arbeitsbereichen einsetzbar sind.<br />
Aktuelle Mitarbeiterzahl:<br />
<br />
<br />
1 Oberarzt, Leiter der Kontrolle (anteilig)<br />
9 MTAs davon 5 Vollzeitbeschäftigte und 4 Teilzeitbeschäftigte<br />
5.4 Weitere Leistungen <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong><br />
5.4.1 Reisemedizinische Impfambulanz<br />
Das Institut Mannheim unterhält eine<br />
reisemedizinische Impfambulanz mit<br />
Gelbfieberimpfstelle. Diese arbeitet mit dem CRM,<br />
Centrum für Reisemedizin in Düsseldorf, zusammen<br />
und berücksichtigt somit die aktuellsten weltweit<br />
gültigen Reiseinformationen. Seit Dezember 2012 ist<br />
die Reisemedizinische Impfambulanz auf der CRM-<br />
Hompage (CRM-Zertifikat) gelistet.<br />
Neben reisemedizinischen Beratungen und Impfungen<br />
werden natürlich auch die Standardimpfungen nach<br />
den aktuellen Empfehlungen der STIKO in der<br />
Impfambulanz durchgeführt. Hierzu zählt insbesondere<br />
die jährliche Grippeimpfung, die den Mitarbeitern <strong>des</strong><br />
Hauses und den Blutspendern im Rahmen einer<br />
137
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Blutspendenaktion kostenlos angeboten wird.<br />
Die Sprechstunden der Impfambulanz sind montags von 7.30 – 12.00 und 13.00 – 15.30<br />
Uhr, dienstags von 7.30 – 11.00 und 13.00 – 15.30 Uhr, donnerstags von 7.30 – 12.00 Uhr.<br />
Die reisemedizinischen Beratungen und Impfungen erfolgen nach telefonischer Anmeldung.<br />
Die Schwestern der stationären Spende vergeben die Termine und pflegen den<br />
Terminkalender.<br />
In Abhängigkeit von der Destination und den vorhandenen Impfungen sind häufig mehrere<br />
Impfkontakte notwendig.<br />
Auch der Betriebsarzt impft in den Räumlichkeiten der Impfambulanz.<br />
Impfkontakte in den 2000er Jahren<br />
5.4.2 Externe Transfusionsverantwortliche<br />
Mit dem Inkrafttreten <strong>des</strong> Transfusionsgesetzes zur Regelung <strong>des</strong> Transfusions-wesens<br />
(TFG am 7. Juli 1998) wurde sowohl dem Blutspende- als auch dem Transfusionswesen,<br />
also den Einrichtungen der Krankenversorgung, die Blutprodukte am Patienten anwenden,<br />
ein rechtlicher Rahmen gegeben.<br />
Das TFG (§ 15 Abs. 1 TFG) und die regelmäßig aktualisierten Richtlinien Hämotherapie,<br />
aufgestellt von der Bun<strong>des</strong>ärztekammer im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut,<br />
verpflichten alle stationären und ambulanten Einrichtungen in denen Blutpräparate und/oder<br />
apothekenpflichtige Blutprodukte angewendet werden, zur Implementierung eines<br />
funktionierenden Qualitäts-sicherungssystem „Hämotherapie“.<br />
138
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
Ziel dieses umfassenden Systems ist es, Patienten eine qualitätsgesicherte Versorgung mit<br />
Blutprodukten, unter Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit und einem optimalen<br />
Nutzen, zu ermöglichen.<br />
Zu diesem Qualitätssicherungssystem gehört u. a. die Bestellung einer<br />
transfusionsverantwortlichen Person, welche ein approbierter transfusions-medizinisch<br />
qualifizierter Arzt/Ärztin mit hämostaseologischen Grundkenntnissen sein muss. Es ist<br />
gestattet, für diese Tätigkeit externen Sachverstand hinzu zu ziehen, optimalerweise<br />
einen/eine Facharzt/in für Transfusionsmedizin.<br />
Seit 2001 werden zeitweilig oder dauerhaft verschiedenste Einrichtungen der<br />
Krankenversorgung im Versorgungsgebiet <strong>des</strong> DRK Blutspendedienstes Baden-<br />
Württemberg-Hessen gGmbH durch Frau Dr. med. F. Stichling, Fachärztin für<br />
Transfusionsmedizin, als externe Transfusionsverantwortliche betreut:<br />
Einrichtung<br />
Betreuungszeitraum<br />
Universitätsklinikum Mannheim Seit 01.01.2009<br />
Diakonissen-Stiftungskrankenhaus, Speyer seit 01.04.2001<br />
Diakoniekrankenhaus, Mannheim seit 01.01.<strong>2002</strong><br />
St. Marien Krankenhaus, Lampertheim seit 01.07.<strong>2002</strong><br />
St. Josef Krankenhaus, Viernheim seit 01.06.2005<br />
Kreiskrankenhaus Eberbach, Eberbach seit 01.06.2005<br />
Ze:ro, Nieren- und Dialysezentren & Gemeinschaftspraxen,<br />
Schwetzingen, Hockenheim, Mannheim, Wiesloch<br />
MVZ am Schlossgarten GmbH, Gemeinschaftspraxis für<br />
Hämatologie und Onkologie, Schwetzingen<br />
Klinitel Private Kliniken GmbH, Gensingen<br />
Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim<br />
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach gGmbH, Karlsbad<br />
seit 01.08.2006<br />
seit 01.01.2012<br />
01.09.2003 bis<br />
31.12.2004<br />
01.01.2003 bis<br />
31.12.2004<br />
01.01.2004 bis<br />
31.12.2005<br />
Frau Dr. Stichling ist als Transfusionsverantwortliche - bis auf das Universitätsklinikum<br />
(Prof. Dr. H. Klüter) - an allen Häusern mit der Aufgabe betraut, für die Einhaltung<br />
einschlägiger Gesetze, Richtlinien und sonstiger Vorschriften Sorge zu tragen und eine<br />
139
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
einheitliche Organisation bei der Vorbereitung und Durchführung hämotherapeutischer<br />
Maßnahmen einzurichten und fest zu schreiben. Hierzu gehören neben der Erarbeitung einer<br />
internen Verfahrens-anweisung Hämotherapie, auch die Entwicklung eines funktionierenden<br />
Dokumentationssystems, die regelmäßige Erfassung von meldepflichtigen Daten<br />
(Verbrauch, Verfall der Blutprodukte), eine konsiliarische Funktion und die Mithilfe im<br />
Rahmen von Rückverfolgungsverfahren.<br />
Ihr zur Seite gestellt sind vor allem der, von der Einrichtung bestellte, Qualitätsbeauftragte<br />
und die Transfusionsbeauftragten der jeweiligen Krankenhausabteilungen, um die<br />
gemeinsamen festgelegten hämothera-peutischen Verfahrensweisen und<br />
Dokumentationswege in den Klinikalltag zu übertragen. In regelmäßigen<br />
transfusionsmedizinischen Fortbildungen für Ärzte und Pflegedienstmitarbeiter wird das<br />
erarbeitete Qualitätssicherungssystem geschult und mittels gemeinsamer Auditierungen<br />
überwacht. In meist halbjährlichen stattfindenden Transfusionskommissionssitzungen<br />
werden neue Informationen und Ergebnisse besprochen und das Hämotherapiesystem <strong>des</strong><br />
Hauses mit den Verantwortungsträgern gemeinsam fortentwickelt. Der<br />
Transfusionskommission gehören auch Vertreter der Labor-, der Apotheken- und der<br />
Pflegedienstleitung und der Geschäftsführung an.<br />
5.4.3 Fortbildungsveranstaltung zur Qualifikation als<br />
Transfusionsverantwortliche/r und Transfusionsbeauftragte/r<br />
Min<strong>des</strong>tens einmal jährlich findet im Institut Mannheim eine von der Lan<strong>des</strong>ärztekammer<br />
anerkannte Fortbildungsveranstaltung zur Qualifikation als Transfusionsverantwortliche/r und<br />
Transfusionsbeauftragte/r statt. In einem zweitägigen 16-Stunden Kurs wird den, von den<br />
Einrichtungen für diese Funktionen bestellten Ärzte, eine interdisziplinäre theoretische<br />
Fortbildung in klinischer Transfusionsmedizin angeboten.<br />
Nach aktuellem Stand der Wissenschaft und Technik werden die Teilnehmer von<br />
qualifizierten Referenten sowohl über die gesetzlichen Grundlagen der Hämotherapie als<br />
auch über die verschiedensten klinischen Anwendungs-bereiche umfassend informiert.<br />
Darüber hinaus ist vom Institut für alle interessierten Transfusions-verantwortlichen und –<br />
beauftragten der regionalen Einrichtungen ein Arbeitkreis für Hämotherapie eingerichtet<br />
worden, welcher der regionalen Zusammenarbeit und dem regelmäßigen<br />
Informationsaustausch auf dem Gebiet der Transfusionsmedizin dient.<br />
Unter der Leitung von Frau Dr. Stichling werden jährlich zwei Sitzungen mit aktuellen<br />
transfusionsmedizinischen Themenschwerpunkten durchgeführt die, von der<br />
Lan<strong>des</strong>ärztekammer geforderte.<br />
140
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
5.4.4 Externe immunhämatologische Laborleitung<br />
Das vom Gesetzgeber mittels Transfusionsgesetz geforderte und durch die Richtlinien<br />
Hämotherapie dezidiert festgelegte Qualitätssicherungssystem Hämotherapie, umfasst auch<br />
die Verantwortlichkeiten bei der Führung eines immunhämatologischen Laborbereiches bzw.<br />
eines Blutdepots in einer Einrichtung der Krankenversorgung.<br />
Die jeweilige Einrichtung muss gemäß Richtlinien zur Leitung <strong>des</strong> immunhämatologischem<br />
Laboratoriums und/oder Blutdepots eine entsprechend qualifizierte Person bestellen. In einer<br />
Übergangsregelung wurde die Laborverantwortlichkeit in vielen Fällen von erfahrenen,<br />
klinisch tätigen Kollegen übernommen. Seit geraumer Zeit kann, wie bei der<br />
Transfusionsverantwortlichkeit, externer Sachverstand mit umfangreicher Qualifikation für die<br />
immunhämatologische Laborbetreuung und das Depot herangezogen werden. Eine solche<br />
Qualifikation besitzt auf jeden Fall, wer Facharzt für Transfusionsmedizin ist.<br />
Seit 01.12.2006 wird das immunhämatologische Laboratorium und Blutdepot <strong>des</strong><br />
Diakoniekrankenhauses Mannheim von Frau Dr. Stichling als externe Laborleitung<br />
verantwortlich betreut.<br />
Die Kernleistungen der ärztlichen Laborleitung umfassen neben der Wahl und Festlegung<br />
der blutgruppenserologischen Untersuchungsmethodik und –durchführung, die tägliche<br />
Auswertung der Untersuchungsergebnisse, inklusive der Beurteilung patientenspezifischer<br />
Transfusionsrisiken bei pathologischen Untersuchungsergebnissen und die schriftlichen<br />
Befundmitteilung an die Kollegen. Die Organisation einer ständigen qualitätsgesicherten<br />
Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten gehört ebenso zum Aufgabenbereich der<br />
Laborleitung wie die Beschreibung und Festlegung der Untersuchungs-dokumentationen, der<br />
internen und externen Qualitätskontrollen, die Implementierung und Auswertung eines<br />
Fehleranalysesystems und die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter.<br />
5.4.5 Abstammungsbegutachtung<br />
Abstammungsgutachten werden erstellt, um Vaterschaften bei Unterhaltsfragen oder<br />
ungeklärte Verwandschaftsverhältnisse abzuklären. Die Gutachten werden seit <strong>2002</strong> gemäß<br />
den aktuellen Richtlinien durchgeführt und sind gerichtlich anerkannt. Prof. Dr. med. Harald<br />
Klüter ist Sachverständiger für Abstammungsgutachten und das Abstammungslabor unter<br />
der Leitung von Prof. (apl) Dr. rer. nat. Peter Bugert ist seit 2005 nach DIN ISO 15189<br />
akkreditiert und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Die Laboruntersuchungen werden von Frau<br />
Gabi Rink (MTA) und Frau Katharina Kemp (BTA) durchgeführt. Die Zuverlässigkeit und<br />
Qualität der erstellten Gutachten sind durch regelmäßige interne und externe Audits sowie<br />
durch die Teilnahme an Ringversuchen gewährleistet. Auftraggeber sind in erster Linie die<br />
141
Patientenversorgung_________________________________________________________<br />
zuständigen Familiengrichte und Behörden in der näheren Umgebung. Gelegentlich sind<br />
auch Privatpersonen die Auftraggeber<br />
Die Abstammungsgutachten werden gemäß der Richtlinien vom 8. März <strong>2002</strong> angefertigt.<br />
Die Laboruntersuchungen bestehen standardmäßig aus folgenden Untersuchungen:<br />
1. Serologische ABO-Blutgruppenanalyse:<br />
Bei den Blutgruppen handelt es sich um bestimmte Merkmale der roten<br />
Blutkörperchen (Erythrozyten). Unter Verwendung einer serologischer Methode<br />
werden die Blutgruppenmerkmale ABO und Rhesus-Faktor bestimmt.<br />
2. Molekulargenetische Bestimmung der ABO Blutgruppenmerkmale:<br />
Die ABO-Blutgruppenmerkmale sind auf bestimmte DNA-Sequenzeigenschaften <strong>des</strong><br />
ABO-Gens zurückzuführen. Diese genetischen Eigenschaften eignen sich zur<br />
Vererbungsanalyse. Die ABO-Genmerkmale werden mit Hilfe der PCR-Technik<br />
('polymerase chain reaction' = Polymerasekettenreaktion) und der Verwendung<br />
allelspezifischer Primer bestimmt.<br />
3. STR-Analyse:<br />
Die STR ('short tandem repeat' = kurze direkte Sequenzwiederholung) Analyse ist<br />
ebenfalls eine molekulargenetische Untersuchungsmethode. Hierbei werden<br />
sogenannte anonyme genetische Merkmale bestimmt, also Merkmale, die sich nicht<br />
innerhalb funktioneller Gene befinden, die aber dennoch sowohl mütterlich als auch<br />
väterlich vererbt werden. Grundlegende Analysemethode ist auch hier die PCR mit<br />
Hilfe derer die zu untersuchenden DNA-Abschnitte gezielt angereichert werden. Die<br />
Produkte aus den PCR-Reaktionen werden unter Verwendung eines automatischen<br />
Analysegeräts sichtbar gemacht. An jedem der bis zu 19 untersuchten DNA-<br />
Abschnitte ist ein Muster zu erkennen, das im direkten Vergleich von Kind, Mutter<br />
und fraglichem Vater Übereinstimmungen oder Unterschiede erkennen lässt.<br />
Die im Labor erhobenen Daten werden in ein speziell zu diesem Zweck entwickeltes<br />
Computerprogramm eingegeben. Das Programm errechnet dann anhand der bekannten<br />
Verteilungshäufigkeiten der einzelnen Merkmale die Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft. Mit<br />
einer AVACH (Allgemeine Vaterschafts-Ausschluss-Chance) von min<strong>des</strong>tens 99,9 % ist eine<br />
Vaterschaft praktisch erwiesen.<br />
142
Öffentlichkeitsarbeit_________________________________________________________<br />
6 Öffentlichkeitsarbeit<br />
„Blut ist ein ganz besonderer Saft“ – Die Besuchergruppen <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong><br />
Die Blutspende in den Mittelpunkt zu stellen, ist auch die Leitlinie zur Betreuung der<br />
zahlreichen Besuchergruppen, die das Institut für Transfusionsmedizin im Laufe eines<br />
Jahres empfängt.<br />
Eine Gruppe angehender Pharmazeutisch-Technischer Assistenten, parallelklassenweise<br />
Gäste aus der Krankenpflegeschule <strong>des</strong> Mannheimer Klinikums, Realschüler oder der Bio-<br />
LK eines Gymnasiums mit dem Lehrthema Blut sowie, befördert je nach Lehrkörper, die<br />
Blutspende, oder eine DRK-Ortsbereitschaft, die sich ein Bild von „ihrer Blutspendezentrale“<br />
machen möchte.<br />
Es empfiehlt sich die Verschiedenartigkeit der Besucher zu beachten, möchte man eine<br />
glückliche Gruppe wieder auf den Heimweg entlassen. Die Interessen und das Vorwissen,<br />
der berufliche und vielleicht auch der persönliche Hintergrund sowie der Anlass für den<br />
Besuch können denen, die sich auf die Besucher vorbereiten, entscheidend weiter helfen.<br />
Der auf den Hörerkreis zugeschnittene medizinische Vortrag, die eingeräumte Gelegenheit<br />
zur Frage und ihre Antwort, mit Glück auch eine aufgekommene Diskussion stellen den<br />
einen Schwerpunkt der Begegnung mit unserer Arbeit dar. Hinzu kommt die praktische Seite.<br />
Nach einem Imbiss im Spendefoyer ist der Entschluss, sich jetzt als Stammzellspender<br />
registrieren zu lassen, eine Blutgruppenuntersuchung z.B. mittels Bedside-Test mit dem<br />
eigenen gerade abgenommen Blut durch zu führen oder sogar regulär Blut zu spenden, der<br />
andere Ausgangspunkt einer inhaltsreichen Exkursion verbunden mit ersten Erfahrungen in<br />
unsere Sache der Blut- und Blutstammzellspende.<br />
143
Öffentlichkeitsarbeit_________________________________________________________<br />
Besonders herausgefordert fühlten sich die zuständigen Gästebetreuer beim Empfang der<br />
„Jungforscher“ aus Schulen und einer Kindertagesstätte Mannheims, welche mit ihrem<br />
Auftrag im Rahmen der „Forschungsexpedition Stadt“ auf der Spur <strong>des</strong> Lebenselexiers Blut<br />
in das Institut für Transfusionsmedizin kamen. Wie erklärt man 5jährigen das mit dem Weg<br />
vom Blut … woher kommt das Blut Kein Problem, fürs Beispiel muss bei guter Miene die<br />
Arztvene bluten. Das tut gar nicht weh Nein, dem Blut tut gar nichts weh …<br />
Am Ende war dieses Besuchercluster ein sehr eindrückliches Beispiel wie das Thema<br />
Blutspende letztlich durch die Konfrontation mit sich selbst unseren Spendern von morgen<br />
nahe gebracht werden kann.<br />
144
Öffentlichkeitsarbeit_________________________________________________________<br />
Jungforscher: Dem Lebenselixier Blut auf der<br />
Spur”Forschungsexpedition Stadt“ führt jugendliche<br />
Forschernaturen in das Institut für Transfusionsmedizin der<br />
Universitätsmedizin MannheimDie Kinder-Uni<br />
2006 wurde von der Universitätsmedizin Mannheim die<br />
„Kinder-Uni“ ins Leben gerufen. Diese findet seitdem jährlich in<br />
den Sommerschulferien statt und richtet sich an Kinder im<br />
Alter von 8 bis 12 Jahren. Die Kinder werden zu „Studenten“<br />
und erleben ihre ersten Vorlesungen. Dozenten tragen den ca. <strong>10</strong>00 Teilnehmern je<strong>des</strong> Jahr<br />
8 Sachverhalte aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen kindgerecht vor und<br />
ergänzen die theoretischen Inhalte anschaulich durch praktische Beispiele.<br />
Im August 2009 wurde erstmals ein Beitrag aus unserem Institut eingereicht und auch<br />
angenommen. Mit dem Titel „Blut – Der Saft <strong>des</strong> Lebens“„ beschrieb die Dozentin, Frau PD<br />
Dr. Janetzko, warum Menschen manchmal frem<strong>des</strong> Blut bekommen müssen und auf<br />
welchem Weg es zu ihnen gelangt.<br />
Die Kinder lernten Daniela kennen, die mit Ihrem Roller einen Verkehrsunfall hatte. Dabei hat<br />
sie sich ein Bein gebrochen und viel Blut verloren. Sie musste operiert werden und brauchte<br />
möglicherweise frem<strong>des</strong> Blut.<br />
Die Kinder haben an diesem Beispiel erfahren, dass Blut aus vielen verschiedenen Zellen<br />
zusammengesetzt ist, die ganz unterschiedliche Aufgaben im Organismus zu erfüllen haben.<br />
Sie haben Herrn Adler, unseren Blutspender, kennengelernt und ihn zu einer virtuellen<br />
Blutspende begleiten können. Den Kindern wurde die Aufarbeitung <strong>des</strong> Vollblutes in die<br />
145
Öffentlichkeitsarbeit_________________________________________________________<br />
unterschiedlichen Blutprodukte gezeigt und sie haben erfahren, welche Untersuchungen<br />
warum notwendig sind, bevor ein Patient Blut transfundiert bekommen darf.<br />
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Blutgruppe gelegt. Die Kinder haben erfahren,<br />
was eine Blutgruppe ist, welche Blutgruppen es gibt und warum Blutgruppen wichtig sind.<br />
Den Kindern wurde die serologische Blutgruppenbestimmung live vorgeführt und einige der<br />
Teilnehmer ließen sich nach der Vorlesung auch gleich Ihre Blutgruppe bestimmen.<br />
146